Internationale Revue - 2000s
- 4140 Aufrufe
Internationale Revue - 2000
- 3978 Aufrufe
Internationale Revue 25
- 2738 Aufrufe
100 Ausgaben der International Review
- 2330 Aufrufe
Der folgende Artikel erschien in der hundertsten Ausgabe derInternational Review (engl./frz./
span. Ausgabe). Obwohl die Internationale Revue in deutscherSprache bis jetzt noch nicht so häufig erscheint, wie die vierteljährlicheenglische, französische und spanische Ausgabe, sind die Aussagen über dieBedeutung der Revue auch im deutschen Sprachraum gültig. Darüber hinaus gibtder Artikel gerade für diejenigen, die nicht regelmäßig die vierteljährlicheRevue lesen oder dies erst seit kurzem tun, einen guten Überblick über dieArtikel und Serien, die schon vor längerer Zeit publiziert wurden und teilweisebis jetzt auf Deutsch nicht zu lesen waren.
Die eher beiläufige Tatsache, dass die hundertste Ausgabeder International Review (eng./
franz./span. Ausgabe[i] [1])mit dem Beginn des Jahres 2000 zusammenfällt, ist nicht rein zufällig. Die IKSwar früh im Jahr 1975 offiziell gegründet worden, und die erste Ausgabe derReview erschien kurz darauf als ein Ausdruck der internationalen Einheit derStrömung. Von Beginn an war sie als theoretisches Organ gedacht, dasvierteljährlich in den drei Hauptsprachen der IKS – Englisch, Französisch undSpanisch – und weniger häufig in einer Anzahl weiterer Sprachen – Italienisch,Deutsch, Holländisch, Schwedisch – erschien. Vier Ausgaben im Jahr mal 25 Jahreergeben 100 Ausgaben. Dies ist an sich schon von einiger politischer Tragweite.In dem Artikel, den wir anlässlich des 20. Geburtstages der IKS veröffentlichthaben (International Review Nr. 80), bemerkten wir, dass nur wenigeinternationale proletarische Organisationen über so lange Zeit existiert haben.Und diese „Dauer“ muss angesichts einer Periode, in der so viele Gruppen, dieaus der Wiederbelebung des Klassenkampfes Ende der 60er Jahre entstanden waren,sich seitdem im Nichts aufgelöst haben, als eine besondere Leistung gewürdigtwerden. Wir haben keinen Hehl aus unserer Zustimmung zu Lenins Sichtweisegemacht, dass die Verpflichtung zu einer regelmäßigen Presse das sine qua noneiner ernsthaften revolutionären Organisation ist; dass die Presse für jedeGruppe, die vom Parteigeist und nicht vom Zirkelgeist beseelt ist, derHaupt„organisator“ ist. Die International Review ist nicht die einzigeregelmäßige Publikation der IKS; letztere veröffentlicht 12 territorialeZeitungen oder Revuen in sieben verschiedenen Sprachen, desgleichen Bücher,Broschüren und viele Beilagen. Auch die territorialen Zeitungen erscheinenbeständig und regelmäßig. Die Review ist jedoch unsere zentrale Publikation,das Organ, durch das die IKS klar und deutlich und mit einer Stimme spricht unddas die eher lokalen Publikationen mit den grundsätzlichen Orientierungenversorgt.
Letztlich ist jedoch das Wichtigste an der InternationalReview nicht so sehr ihre Regelmäßigkeit noch ihr internationaler,zentralisierter Charakter, sondern ihre Fähigkeit, als ein Instrument dertheoretischen Klärung zu agieren. „Die Review wird vor allem der Ausdruck dertheoretischen Bemühungen unserer Strömung sein, da nur diese theoretischenBemühungen, basierend auf einer Kohärenz der politischen Positionen undOrientierungen, die Grundlage für die Umgruppierung und die reale Interventionder Revolutionäre schaffen kann.“ (Vorwort zur ersten Ausgabe der International
Review, April 1975)
Der Marxismus ist als der theoretische Standpunkt derrevolutionären Klasse im Nachdenken des Menschen über die gesellschaftlicheRealität am weitesten vorangeschritten. Doch Marx bestand in den Thesen überFeuerbach darauf, dass die Richtigkeit einer Denkweise nur in der Praxisgetestet werden kann. Der Marxismus hat seine Überlegenheit über alle anderengesellschaftlichen Theorien demonstriert, weil er fähig ist, ein globalesVerständnis der Wendungen der menschlichen Geschichte anzubieten und die Linienihrer weiteren Entwicklung vorauszusagen. Aber es reicht nicht zu behaupten,Marxist zu sein, um sich diese Methoden wirklich anzueignen, sie zum Leben zuerwecken und richtig anzuwenden. Wenn wir meinen, dass uns dies während derletzten drei Jahrzehnte einer sich beschleunigenden Geschichte gelungen ist,dann nicht deshalb, weil wir denken, dass uns dies vom Himmel gefallen war,sondern weil wir meinen, dass wir unsere Anregungen während dieser Periode ausden besten Traditionen der internationalen Linkskommunisten gewonnen haben.Zumindest war dies eines unserer ständigen Ziele gewesen. Und um dieseBehauptung zu untermauern, können wir keinen besseren Beweis dafür anführen alsunseren Fundus von etwas mehr als 600 Artikeln aus 100 Ausgaben der InternationalReview.
Kontinuität, Bereicherung und Debatte
Der Marxismus ist eine lebendige historische Tradition.Einerseits bedeutet dies, dass er sich vollkommen über die Notwendigkeit imKlaren ist, sich allen Problemen, mit denen er konfrontiert ist, von einemhistorischen Ausgangspunkt anzunähern, sie nicht als völlig „neu“ hinzustellen,sondern als Produkt eines langen historischen Prozesses. Vor allem erkennt erdie wesentliche Kontinuität des revolutionären Denkens an, die Notwendigkeit,auf den soliden Fundamenten der früheren revolutionären Minderheitenaufzubauen. Zum Beispiel sah sich in den 20er und 30er Jahren des 20.Jahrhunderts die italienische Linksfraktion, die während der 30er Jahre dieZeitschrift Bilan herausgab, der absoluten Notwendigkeit gegenüber, denCharakter des konterrevolutionären Regimes zu begreifen, das in Russlandentstanden war. Doch sie lehnte jede voreilige Schlussfolgerung ab undkritisierte besonders jene, die zwar früher als die Italienische Linke einekorrekte Charakterisierung der stalinistischen Macht (eine Form desStaatskapitalismus) entwickelt hatten, dies aber um den Preis der Deklassierungder gesamten Erfahrung des Bolschewismus und der Oktobererhebung als vonvornherein „bürgerlich“ taten. Bilan dachte gar nicht daran, die Kontinuität,in der sie mit der revolutionären Energie stand, die die bolschewistischePartei, die Rätemacht und die Kommunistische Internationale einst verkörperthatte, in Frage zu stellen.
Die Fähigkeit, die Verbindungen mit der vergangenenrevolutionären Bewegung aufrechtzuerhalten bzw. zu erneuern, war besonders indem proletarischen Milieu wichtig, das aus dem Wiedererwachen desKlassenkampfes Ende der 60 Jahre entstanden war, ein Milieu, das sichgrößtenteils aus neuen Gruppen zusammensetzte, die ohne organisatorische odergar politische Bindungen zu früheren Generationen von Revolutionären waren.Viele dieser Gruppen fielen der Illusion zum Opfer, dass sie aus dem Nirgendskommen, und blieben in völliger Unkenntnis der Beiträge der vergangenenGeneration, welche fast vollständig durch die Konterrevolution ausgelöschtworden war. Im Falle derjenigen, die von rätekommunistischen odermodernistischen Ideen beeinflusst waren, war die „alte Arbeiterbewegung“ in derTat etwas, was mit allen Mitteln zurückgelassen werden musste. Tatsächlich wardies eine theoretische Rechtfertigung für einen Bruch, der vom Klassenfeinddurchgesetzt worden war. In Ermangelung eines Ankers in der Vergangenheit hattedie große Mehrheit dieser Gruppen bald auch keine Zukunft mehr und verschwand.Es ist daher nicht überraschend, dass das heutige revolutionäre Milieu sichfast vollständig aus Gruppen zusammensetzt, die auf der einen oder anderenWeise von der linken Strömung abstammen, die am klarsten diese Frage der historischenKontinuität begriffen hat – die italienische Fraktion. Wir sollten hinzufügen,dass dieser historische Anker heute wichtiger denn je ist, angesichts derKultur des kapitalistischen Zerfalls, eine Kultur, die mehr denn je danachtrachtet, das historische Gedächtnis der Arbeiterklasse auszuradieren, und dieohne jegliche eigene Zukunftsperspektive nur versuchen kann, das Bewusstseinauf das Nächstliegende zu verengen, in der das Neue die einzige Tugend ist.
Andererseits ist der Marxismus nicht die bloße Verewigungeiner Tradition; er ist auf die Zukunft gerichtet, auf das endgültige Ziel desKommunismus, und muss daher ständig seine Fähigkeit erneuern, die Richtung derrealen Bewegung, der ewig schwankenden Gegenwart zu erfassen. In den 50erJahren versuchte der bordigistische Sprössling der Italienischen Linken, in derErfindung der Idee einer „Invarianz“ Zuflucht vor der Konterrevolution zufinden, und widersetzte sich jedem Versuch, das kommunistische Programm zubereichern. Aber diese Herangehensweise unterschied sich vollkommen vom GeistBilans, die, auch wenn sie nie die Verbindung zur revolutionären Vergangenheitabgebrochen hatte, auf der Notwendigkeit bestanden hatte, neue Situationen„ohne Tabus und Verfemung“, ohne Furcht davor, programmatisches Neuland zubetreten, zu prüfen. Vor allem hatte sich die Fraktion nicht davor gefürchtet,selbst die Thesen des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale inFrage zu stellen, etwas, wozu der „Bordigismus“ der späteren Jahre nicht fähigwar. In den 30er Jahren hatte Bilan einer neuen Situation gegenüber gestanden,die aus der Niederlage der Weltrevolution hervorgegangen war; auch die IKS wardazu gezwungen, ihre Analysen den neuen Bedingungen anzupassen, die durch dasEnde der Konterrevolution in den späten 60ern und erst jüngst durch die Periodegeschaffen wurden, die dem Zusammenbruch des Ostblocks folgte. Angesichts solchwechselnder Umstände können sich Marxisten nicht auf die Wiederholung erprobterund vertrauter Formeln beschränken, sondern müssen ihre Hypothesen einerständigen praktischen Verifizierung unterziehen. Dies bedeutet, dass sich derMarxismus wie jeder andere wissenschaftliche Zweig tatsächlich ständig neubereichert.
Gleichzeitig ist der Marxismus keine Form des akademischenWissens, des Lernens um des Lernens willen; er kämpft unerbittlich gegen dievorherrschende Ideologie an. Die kommunistische Theorie ist per Definition einepolemische und kämpferische Form des Wissens; ihr Ziel ist es, dasproletarische Klassenbewusstsein durch die Entlarvung und Verbannung derEinflüsse bürgerlicher Mystifikationen voran zu bringen, ob dieseMystifikationen nun in ihrer gröbsten Form innerhalb der Massen der Arbeiteroder in ihrer subtileren Verkleidung in den Reihen der proletarischen Avantgardeselbst auftreten. Es ist daher eine zentrale Aufgabe für jede gewissenhafterevolutionäre Organisation, eine ständige Kritik an den Konfusionen zu üben,die sich in anderen revolutionären Gruppen oder in den eigenen Reihen breitmachen. Es kann keine Klarheit erreicht werden, wenn man der Debatte und derKonfrontation ausweicht, wie dies leider zu oft der Fall ist innerhalb desheutigen politischen Milieus des Proletariats, das den Kontakt zu denTraditionen der Vergangenheit verloren hat – den Traditionen, die von Leninverteidigt worden waren, der nie vor einer Polemik, ob mit der Bourgeoisie, mitkonfusen Gruppen innerhalb der Arbeiterbewegung oder mit seinen eigenenGenossen, zurückgescheut war; Traditionen, die auch Bilan vertreten hatte,welche in ihrem Streben, das kommunistische Programm im Gefolge der vergangenenNiederlagen zu vervollkommnen, sich in Debatten mit all den verschiedenenStrömungen innerhalb der damaligen internationalen Arbeiterbewegung (die ausder internationalen Linksopposition, aus der Holländischen und Deutschen Linkenstammenden Gruppen, etc.) engagiert hatte.
In diesem Artikel können wir nicht einen komplettenÜberblick über all die Texte geben, die in der International Review erschienensind, obwohl wir beabsichtigen, eine vollständige Liste der Inhaltsangaben aufunserer Web Site zu veröffentlichen. Was wir versuchen werden, ist, zu zeigen,wie die International Review im Mittelpunkt unserer Bemühungen stand und steht,diese drei Schlüsselaspekte der theoretischen Auseinandersetzung des Marxismuszu erfüllen.
Die Wiederherstellungder revolutionären Vergangenheit des Proletariats
In Anbetracht der endlosen Diffamierungskampagnen gegen dieErinnerung an die Russische Revolution und der Bemühungen bürgerlicherHistoriker, das internationale Ausmaß der von der Oktobererhebung ausgelöstenrevolutionären Welle zu verschleiern, hat sich ein großer Teil der Reviewnotwendigerweise der Rekonstruktion der wahren Geschichte dieser Ereignissegewidmet, um die proletarische Erfahrung gegen die offenen Lügen undAuslassungen der Bourgeoisie zu bekräftigen und zu verteidigen und sowohl gegendie Verzerrungen durch den linken Flügel des Kapitals als auch gegen dieirrigen Schlussfolgerungen innerhalb der heutigen revolutionären Bewegung ihreauthentischen Lehren zu ziehen.
Um die wichtigsten Beispiele zu zitieren: Die InternationalReview Nr. 3 enthält einen Artikel, der einen Rahmen zum Verständnis derDegeneration der Russischen Revolution ausgearbeitet hat; eine Antwort auf dieKonfusionen innerhalb des damaligen revolutionären Milieus (in diesem Fall dieRevolutionary Workers Group aus den USA); sie enthält außerdem eine langeStudie der Lehren aus dem Kronstädter Aufstand, jenem Schlüsselmoment imZerfall der Revolution. Die International Review Nr. 12 und 13 enthaltenArtikel, die den proletarischen Charakter der bolschewistischen Partei und derOktobererhebung gegen die semi-menschewistischen Auffassungen desRätekommunismus neu bekräftigten; diese Artikel hatten ihren Ursprung in einerDebatte innerhalb jener Gruppe, die der direkteste Vorläufer der IKS war – derGruppe Internacionalismo aus Venezuela in den 60er Jahren - und wurden in derForm einer Broschüre mit dem Titel 1917, start of the world revolution (1917 –der Beginn der Weltrevolution) wiederveröffentlicht. Infolge des Zusammenbruchsder stalinistischen Regimes veröffentlichten wir in der International ReviewNr. 71, 72 und 75 eine Reihe von Artikeln als Antwort auf das propagandistischeSperrfeuer über den Tod des Kommunismus, in denen vor allem die Fabelzurückgewiesen wurde, dass der Oktober 1917 nichts anderes als einStaatsstreich durch die Bolschewiki gewesen war, und detailliert aufgezeigtwurde, dass es vor allen Dingen die Isolation der russischen Bastion gewesen war,die zu ihrem Ableben geführt hatte. Wir setzten 1997 dieses Thema mit einerweiteren Reihe von Artikeln fort, die einen näheren Blick auf denentscheidenden Zeitraum zwischen Februar und Oktober 1917 warf (s.International Review
Nr. 89, 90, 91). Von Anfang an bestand die Position der IKSin einer militanten Verteidigung der Russischen Revolution, doch gibt es keinenZweifel darüber, dass mit der Reifung der IKS schrittweise dierätekommunistischen Einflüsse über Bord geworfen wurden, die zum Zeitpunkt ihrerGründung noch sehr stark waren, und die Schüchternheit in der Frage der Parteioder solch bedeutender historischer Persönlichkeiten wie Lenin oder Trotzkiabgelegt wurde.
Die International Review enthält in einer ihrer erstenAusgaben (Nr. 2) auch eine Untersuchung der Lehren aus der DeutschenRevolution, und zwei weitere Artikel erschienen anlässlich des 70. Jahrestagesdieses äußerst wichtigen Ereignisses, das von der bürgerlichen
Geschichtsschreibung so sorgsam verdeckt worden war(International Review Nr. 55 und 56). Aber wir kehrten noch ausgiebiger zurDeutschen Revolution in einer Reihe von Artikeln zurück, die in derInternational Review Nr. 81-83, 85, 88–90, 93, 95, 97–99 veröffentlicht wurde.Einmal mehr sehen wir hier eine deutliche Reifung in der Herangehensweise derIKS an ihr Thema, auch hier kritisch gegenüber den politischen undorganisatorischen Mängeln der deutschen kommunistischen Bewegung und auf eintieferes Verständnis in der Frage des Aufbaus einer revolutionären Parteifußend. Eine Reihe von Artikeln befasste sich etwas allgemeiner auch mit derrevolutionären Welle von 1917–23, besonders die Artikel über Zimmerwald in derInternational Review Nr. 44, über die Gründung der KommunistischenInternationale in Nummer 57, über das Ausmaß und die Bedeutung derrevolutionären Welle in Nummer 80, über die Beendigung des Krieges durch dasProletariat in Nummer 96.
Auch anderen Schlüsselereignissen in der Geschichte derArbeiterbewegung wurde Platz in eigenen Artikeln in der International Revieweingeräumt: die Revolution in Italien (Nr. 2); Spanien 1936, insbesondere dieRolle des Anarchismus und der „Kollektive“ (Nr. 15, 22, 47, etc.); die Kämpfein Italien 1943 (Nr. 75) und, allgemeiner; Artikel, die die Verbrechen der„Demokratien“ während des Zweiten Weltkrieges an den Tag gelegt hatten (Nr. 66,79, 83); eine Reihe von Artikeln über den Klassenkampf im Ostblock, die sichmit den massiven Klassenbewegungen 1953, 1956 und 1970 befassten (Nr. 27 - 29);eine Reihe über China, die den Mythos des Maoismus entlarvte (Nr. 81, 84, 94,96); Reflexionen über die Bedeutung der Ereignisse in Frankreich im Mai 1968(Nr. 14, 53, 74, 93, etc.).
Eng verknüpft mit diesen Studien, hat es ständige Bemühungendarum gegeben, die fast verloren geglaubte Geschichte des Linkskommunismus indiesen gewaltigen Ereignissen wiederzuentdecken, was unser Verständniswiderspiegelt, dass es uns ohne diese Geschichte nicht geben würde. DiesesBemühen hat sowohl in Form von Veröffentlichungen seltener Texte, oft zumersten Mal in andere Sprachen übersetzt, als auch in Form eigenerNachforschungen der Positionen und der Entwicklung linker Strömungenstattgefunden. Wir wollen folgende Studien erwähnen, obwohl auch hier die Listenicht vollständig ist: über die russischen Linkskommunisten, deren Geschichtenatürlich direkt mit dem Problem der Degeneration der Russischen Revolutionverknüpft ist (International Review Nr. 8 und 9); über die Deutsche Linke(Artikelreihen über die Deutsche Revolution, s.o.; Wiederveröffentlichung vonKAPD-Texten – „Thesen über die Partei“ in der International Review Nr. 41 – undihres Programms in der International Review
Nr. 94); über die Holländische Linke, mit einer langenArtikelserie (Nr. 45–50, 52), die die Grundlage für das Buch bildete, das aufFranzösisch, Spanisch und Italienisch veröffentlicht wurde und demnächst aufEnglisch erscheint; über die italienische Linksfraktion, insbesondere durch dieVeröffentlichung von Texten über den spanischen Bürgerkrieg (InternationalReview Nr. 4, 6, 7), über den Faschismus (Nr. 71) und über die Volksfront (Nr.47); über die französischen Linkskommunisten in den 40er Jahren durch dieWiederveröffentlichung ihrer Artikel und Manifeste gegen den Zweiten Weltkrieg(Nr. 79 und 88), ihrer zahllosen Polemiken mit der Partito ComunistaInternazionalista (Nr. 33, 34, 36), ihrer Texte über den Staatskapitalismus unddie Organisation des Kapitalismus in seiner dekadenten Phase (Nr. 21, 61) undihrer Kritik an Pannekoeks Buch „Lenin als Philosoph“ (Nr. 27, 28, 30); über diemexikanische Linke (Texte aus den 30er Jahren über Spanien, China,Nationalisierungen in der International Review Nr. 19 und 20); über diegriechische Linke um Stinas (Nr. 72).
Ebenfalls untrennbar verbunden mit diesem historischenRekonstruktionswerk war die Energie gewesen, die wir in die Texte gesteckthatten, mit denen wir versuchten, unsere Positionen zu fundamentalenKlassenpositionen zu erarbeiten, die sowohl aus der praktischen Erfahrung desKlassenkampfes selbst als auch aus der theoretischen Interpretation dieserErfahrungen durch kommunistische Organisationen herstammen. In diesemZusammenhang sei auf solche Fragen hingewiesen wie:
– dieÜbergangsperiode, insbesondere die Lehren, die aus der russischen Erfahrungüber das Verhältnis zwischen dem Proletariat und dem Übergangsstaat gezogenwerden müssen. Dies war eine wichtige Debatte im proletarischen Milieu, als dieIKS gegründet wurde, eine Tatsache, die durch die Veröffentlichung zahlreicherDiskussionstexte verschiedener Gruppen in der allerersten Ausgabe derInternational Review zum Ausdruck kam. Diese Debatte wurde in der IKSfortgesetzt und eine Reihe von Texten für oder gegen die Mehrheitspositioninnerhalb der IKS veröffentlicht (Nr. 6, 11, 15, 18);
– dienationale Frage: Eine Artikelfolge, welche die Art und Weise untersucht, wiesich diese Frage in der Arbeiterbewegung der ersten beiden Jahrzehnte des 20.Jahrhunderts gestellt hatte, wurde in der International Review Nr. 37 und 42veröffentlicht. Eine zweite Artikelserie erschien in den Nummern 66, 68 und 69,die den weiten Bereich von der revolutionären Welle bis zum Los der „nationalenBefreiungskämpfe“ in der Phase des kapitalistischen Zerfalls abdeckte;
– dieökonomischen Fundamente des Imperialismus und der kapitalistischen Dekadenz: Ineiner Anzahl von Texten haben wir in unserer Entgegnung auf die Kritik andererproletarischer Gruppen für die Kontinuität gestritten, die im wesentlichenzwischen der Krisentheorie von Marx und der von Rosa Luxemburg in „DieAkkumulation des Kapitals“ und anderen Texten entwickelten Analyse besteht(siehe z.B. Nr. 13, 16, 19, 22, 29, 30). Parallel dazu haben wir eine ganzeArtikelreihe der Verteidigung des fundamentalen Konzeptes der kapitalistischenDekadenz gegen seine „radikalen“ Verunglimpfer aus dem parasitären Lager odersonstwoher gewidmet (Nr. 48, 49, 54, 55, 56, 58, 60)..
– auch mitanderen allgemeinen Fragen haben wir uns beschäftigt, einschließlich derGewerkschaftsfrage in der Kommunistischen Internationale (Nr. 24 und 25), derBauernfrage (Nr. 24), der Theorie der Arbeiteraristokratie (Nr. 25), derkapitalistischen Umweltbedrohung, d.h. die „Ökologie“ (Nr. 63), des Terrors,Terrorismus und der Klassengewalt, letzteres ebenfalls das Produkt einerwichtigen Debatte in der IKS, insbesondere darüber, ob das Kleinbürgertumirgendwelche politischen Ausdrücke in der Periode der Dekadenz hat. DieUnterscheidung zwischen dem Staatsterror und dem kleinbürgerlichen Terrorismusund zwischen beiden und der proletarischen Klassengewalt durch die IKS beantwortetediese Frage voll und ganz (Nr. 14 und 15).
Dies ist vielleicht der geeignetste Moment, um auf dieArtikelserie über den Kommunismus hinzuweisen, die seit 1992 regelmäßig in derInternational Review erscheint und uns noch eine Weile erhalten bleibt.Ursprünglich war dieses Projekt als eine Reihe von vier oder fünf Artikelnvorgesehen, in denen die wahre Bedeutung des Kommunismus entgegen derbürgerlichen Lügen von der Gleichsetzung des Kommunismus mit dem Stalinismusgeklärt werden sollte. Aber bei dem Versuch, die historische Methode so rigoroswie möglich anzuwenden, wuchs sich diese Serie aus zu einer tieferenUntersuchung der Biografie des sich ständig weiter entwickelndenkommunistischen Programms, das durch die Schlüsselerfahrungen der Klasse im allgemeinenund durch die Beiträge und Debatten der revolutionären Minderheiten imbesonderen immer weiter bereichert wurde. Obgleich die Mehrheit der Artikeldieser Reihe sich notwendigerweise mit den fundamentalen politischen Fragenbefasst, da der erste Schritt zur Schaffung des Kommunismus die Errichtung derDiktatur des Proletariats ist, ist es ebenfalls Prämisse dieser Reihe,darzustellen, dass der Kommunismus die Menschheit aus dem Reich der Politikführen und ihre wahre soziale Natur befreien wird. Diese Reihe stellt somit dasProblem der marxistischen Anthropologie aufs Trapez. Die Verflechtung der„politischen“ und „anthropologischen“ Dimensionen in dieser Reihe wartatsächlich eines ihrer Leitmotive. Der erste Teil dieser Reihe begann (abInternational Review Nr. 68) mit den Vorläufern des Marxismus und mit dergrandiosen Vision des jungen Marx von den endgültigen Zielen des Kommunismus;er endete auf dem Höhepunkt der Massenstreiks von 1905, die signalisierthatten, dass der Kapitalismus sich auf eine neue Epoche zu bewegte, wo sich diekommunistische Revolution von einer globalen Perspektive der Arbeiterbewegungzu einer dringenden Notwendigkeit auf der historischen Tagesordnung entwickelte(International Review Nr. 88). Der zweite Teil hat sich größtenteils auf dieDebatten und programmatischen Dokumente konzentriert, die aus der großenrevolutionären Welle von 1917- 23 entstanden waren; noch muss er sich durch dieJahre der Konterrevolution und der darauffolgenden Wiederbelebung der Debattenüber den Kommunismus in der Periode nach 1968 durcharbeiten und denDiskussionsrahmen über die Bedingungen der Revolution von morgen klären. AmEnde jedoch wird diese Reihe zur Frage zurückkehren, wie es mit unserer Speziesim künftigen Reich der Freiheit aussehen wird.
Eine weitere wichtige Komponente in den Bemühungen derReview, den von den Revolutionären vertretenen Klassenpositionen eine größereshistorisches Gewicht zu verleihen, war ihre konstante Verpflichtung zur Klärungder Organisationsfrage gewesen. Dies war sicherlich die schwierigste allerFragen für jene Generation von Revolutionären, die den späten 60ernentstammten, vor allem aufgrund des Traumas der stalinistischenKonterrevolution und des mächtigen Einflusses des individualistischen,anarchistischen und rätekommunistischen Verhaltens auf diese Generation. Weiterunten werden wir einige der zahlreichen Polemiken erwähnen, die die IKS mitanderen Gruppen des proletarischen Milieus über diese Frage geführt hatte. Doches trifft ebenso zu, dass einige der wichtigsten Texte in der Review überFragen der Organisation das direkte Produkt von Debatten innerhalb der IKSselbst und oft schmerzvoller Auseinandersetzungen waren, die die IKS in ihreneigenen Reihen führen musste, um sich die marxistische Auffassung von einerrevolutionären Organisation wieder anzueignen. Seit dem Beginn der 80er Jahrehat die IKS drei ernste innere Krisen durchlaufen, von denen jede in Spaltungenund Austritten endete, aus denen aber die IKS politisch wie organisatorisch gestärkthervorging. Um diese Schlussfolgerung zu stützen, verweisen wir auf dieQualität der Artikel, die aus diesen Kämpfen entstanden und das verbesserteVerständnis der IKS für die Organisationsfrage zusammenfassten. Soveröffentlichten wir in Antwort auf die Spaltung mit der Chenier-Tendenz in denfrühen 80ern zwei wichtige Texte – einen über die Rolle der revolutionärenOrganisation innerhalb der Klasse (Nr. 29), den anderen über ihre interneFunktionsweise (Nr. 33). Insbesondere der letztere war und bleibt einSchlüsseltext, denn die Chenier-Tendenz drohte, alle fundamentalen Auffassungenin unseren Statuten, unsere Funktions“regeln“, über Bord zu werfen. Der Text inder International Review Nr. 33 war eine klare Darstellung und Ausarbeitungjener Auffassungen (hier sollten wir auch auf einen weit früheren Text in derInternational Review Nr. 5 über die Statuten verweisen). Mitte der 80er Jahremachte die IKS einen weiteren Schritt in der Abrechnung mit den verbliebenenanti-organisatorischen und rätekommunistischen Einflüssen in ihrer Mitte, undzwar durch die Debatte mit der Tendenz, die dazu übergegangen war, eine„Externe Fraktion der IKS“ zu bilden, jetzt „Internationalist Perspective“genannt, ein typisches Element des parasitären Milieus. Die Haupttexte, die inder International Review im Rahmen dieser Debatte veröffentlicht wurden,veranschaulichen diese eminent wichtigen Streitpunkte: die Einschätzung derGefahr, die von den rätekommunistischen Ideen für das revolutionäre Lager vonheute ausgeht (Nr. 40 – 43); die Frage des Opportunismus und Zentrismus in derArbeiterbewegung (Nr. 43 und 44). Durch diese Debatte – und durch dieAusarbeitung ihrer indirekten Folgen für unsere Intervention im Klassenkampf –nahm die IKS endgültig das Verständnis einer revolutionären Kampforganisationan, einer militanten politischen Führung innerhalb der Klasse. Die dritteDebatte Mitte der 90er Jahre kehrte, auf einer höheren Ebene, zur Frage derFunktionsweise zurück und spiegelte die Bestimmtheit wider, mit der die IKSalle Überbleibsel des Zirkelgeistes anging, der während ihrer Anfangsphasegeherrscht hatte, um die offene und zentralisierte Funktionsweise zu stärken,die auf den von allen akzeptierten Statuten basieren, gegen anarchistischePraktiken, die auf freundschaftlichen Netzwerken und sippenhaften Intrigengegründet sind. Auch hier drückt eine Anzahl von Texten von echter Qualitätunsere Bemühungen aus, die marxistische Position zur innerorganisatorischenFunktionsweise wieder zu etablieren und zu vertiefen: insbesondere die Reihevon Texten, die sich mit dem Kampf zwischen dem Marxismus und dem Bakuninismusin der Ersten Internationale befassten (Nr. 84, 85, 87, 88) und die beidenArtikel „Sind wir Leninisten geworden?“ in den Nummern 96 und 97.
Die Analyse derrealen Bewegung
Die zweite Schlüsselaufgabe, die zu Beginn dieses Artikelshervorgehoben wurde – die ständige Einschätzung einer sich konstant änderndenWeltlage–, war immer auch ein zentrales Element in der International Review.
Fast ausnahmslos jede Ausgabe beginnt mit einem Editorialüber die wichtigsten Ereignisse des internationalen Geschehens. Diese Artikelstellen die allgemeine Orientierung der IKS hinsichtlich dieser Ereignisse dar,indem sie die Positionen lenken und zentralisieren, die von unserenterritorialen Publikationen angenommen wurden. Wenn man durch diese Editorialsblättert, kann man sich ein prägnantes Bild von der Antwort der IKS auf allewichtigen Ereignisse der 70er, 80er und 90er Jahre machen: die zweite unddritte Welle des internationalen Klassenkampfes; die Offensive desUS-Imperialismus in den 80er Jahren; die Kriege im Nahen Osten, im Golf vonPersien, in Afrika, auf dem Balkan; der Zusammenbruch des Ostblocks und dieEröffnung der Periode des kapitalistischen Zerfalls; die Schwierigkeiten desKlassenkampfes angesichts dieser neuen Periode und so weiter. Parallel dazumachte auch der regelmäßige Bericht zur Frage: „Welchen Punkt hat die Kriseerreicht?“ es möglich, die wichtigsten Trends und Momente im langen Abstieg desKapitalismus in den Morast seiner eigenen Widersprüche zu erkennen. Zusätzlichzu diesen vierteljährlichen Einschätzungen veröffentlichten wir auch Texte, diedie Entwicklung der Krise aus längerfristigem Blickwinkel betrachten, seitdemsie Ende der 60er Jahre ans Tageslicht trat; hierzu besonders erwähnenswertunsere aktuelle Artikelserie „30 Jahre offene Krise“ (International Review Nr.96 – 98). Längerfristige Analysen aller Aspekte der internationalen Lage sindauch in den Berichten und Resolutionen unserer alle zwei Jahre stattfindendeninternationalen Kongresse enthalten, die immer so vollständig wie möglich inder International Review veröffentlicht werden (s. Nr. 8, 11, 18, 26, 35, 44,51, 59, 67, 74, 82, 90, 92, 97, 98).
Im Grunde ist es nicht möglich, einen striktenTrennungsstrich zwischen Texten, die die gegenwärtige Situation analysieren,und historisch-theoretischen Artikeln zu ziehen. Die analytischen Bemühungenstimulieren unvermeidlich die Reflexion und Debatte, welche ihrerseits denAnlass zu wichtigen Orientierungstexten liefern, die die allgegenwärtigeDynamik der Periode feststellen und bestimmte grundsätzliche Konzepte klären.Diese Texte sind häufig das Produkt der internationalen Kongresse oder derTreffen des Zentralorgans der IKS.
Zum Beispiel nahm der III. Kongress der IKS 1979 solcheOrientierungstexte über den historischen Kurs und den Wechsel der linkenParteien des Kapitals in die Opposition an, womit der grundsätzliche Rahmen zumVerständnis des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen in der Periode, diedurch das Wiedererwachen des Klassenkampfes 1968 eröffnet wurde, und zumVerständnis der überwiegend politischen Antwort der Bourgeoisie auf denKlassenkampf der 70er und 80er Jahre abgesteckt wurde (s. International ReviewNr. 18). Weitere Aufklärung darüber, wie die herrschende Klasse den Wahlprozessmanipuliert, bis er ihren eigenen Bedürfnissen entspricht, verschaffte derArtikel über den „Machiavellismus“ der Bourgeoisie in der International ReviewNr. 31 und die internationalen Korrespondenz über dieselbe Frage in Nr 39.Ebenso ist die erst kürzlich erfolgte Rückkehr der Bourgeoisie zu ihrerStrategie, die linken Parteien in der Regierung zu installieren, in einem Textdes XIII. Kongresses der IKS analysiert und in der International Review Nr. 98veröffentlicht worden.
Der IV. Kongress – 1981, im Gefolge des Massenstreiks inPolen, abgehalten – nahm einen Text über die Bedingungen für dieGeneralisierung des Klassenkampfes an, in dem besonders betont wurde, dass dieAusbreitung der Massenstreiks auf die Zentren des Weltkapitals eine Antwort aufdie Wirtschaftskrise des Kapitalismus sein wird, und nicht auf einenkapitalistischen Weltkrieg; einen weiteren Beitrag, der den Versuch eineshistorischen Überblicks über die Entwicklung des Klassenkampfes seit 1968unternahm (International Review Nr. 26). Debatten über die gesamte zweiteinternationale Welle von Kämpfen, in der die Kämpfe der polnischenArbeiterklasse den Höhepunkt darstellten, haben zu einer Reihe von anderenwichtigen Texten über die Charakteristiken des Massenstreiks (Nr. 27), über dieTheorie des schwächsten Glieds (Nr. 31, 37), über die Bedeutung der Kämpfe derfranzösischen Stahlarbeiter 1979 und die Intervention der IKS (Nr. 17, 20),über Arbeiterkampfgruppen (Nr. 21), die Arbeitslosenkämpfe (Nr. 14) u.s.w.geführt. Besonders wichtig war der Text „Der proletarische Kampf im dekadentenKapitalismus“(International Review Nr. 23), der aufzuzeigen beabsichtigte,warum die Kampfmethoden, die in der aufsteigenden Periode des Kapitalismus(gewerkschaftliche Streiks in einzelnen Bereichen, finanzielle Solidarität,etc.) angewendet worden waren, in der dekadenten Epoche durch die Methoden desMassenstreiks ersetzt werden mussten. Die stetigen Bemühungen um einePerspektive der internationalen Klassenbewegung setzte sich in zahlreichenArtikeln fort, die während der dritten Welle von Kämpfen zwischen 1983 und 1988geschrieben wurden.
1989 fand eine weitere wichtige historische Änderung in derinternationalen Lage statt: der Zusammenbruch des Ostblocks und der endgültigeBeginn der Zerfallsphase des Kapitalismus, eine Verschlimmerung all derAusgeburten eines dekadenten Systems, das vor allem durch den wachsenden Kriegjeder gegen jeden auf imperialistischer Ebene gekennzeichnet war. Obwohl dieIKS diesen „friedlichen“ Zusammenbruch des russischen Blocks im Vorfeld nichterwartet hatte, stellte sie schnell fest, aus welcher Richtung der Wind blies,denn sie war bereits mit dem theoretischen Rahmen ausgerüstet, um zu erklären,warum der Stalinismus sich nicht selbst reformieren konnte (s. die Artikel überdie Wirtschaftskrise im russischen Block in der International Review Nr. 22,23, 43 und insbesondere die Thesen über „Die internationale Dimension desArbeiterkampfes in Polen“ in der International Review Nr. 24). Dieser Rahmenbildete die Grundlage für den Orientierungstext „Über die ökonomische undpolitische Krise in den osteuropäischen Ländern“ in der International ReviewNr. 60, der lange, bevor dies mit dem Fall der Berliner Mauer und demAuseinanderbrechen der UdSSR eintrat, das Ableben des russischen Blocksvorausgesagt hatte. Gleichermaßen wichtig als Hilfe zum Verständnis derCharakteristiken der neuen Periode waren die Thesen mit dem Titel „Der Zerfall– die letzte Phase in der Dekadenz des Kapitalismus“ in der InternationalReview Nr. 62 und der Artikel „Militarismus und Zerfall“ in der InternationalReview Nr. 64. Letzterer ging noch weiter und präzisierte unsere Artikel„Krieg, Militarismus und imperialistische Blöcke“, die wir in der InternationalReview Nr. 52 und 53 veröffentlicht hatten, also vor dem Zusammenbruch desrussischen Blocks, und die den Begriff der Irrationalität des Krieges in derkapitalistischen Dekadenz erläuterten. Durch diese Beiträge wurde es möglich,den Rahmen zum Verständnis der Verschärfung der imperialistischen Spannungen ineiner Welt ohne Blockdisziplin zu erweitern. Die ganz offensichtlicheVerschärfung der interimperialistischen Konflikte, des chaotischen Kampfesjeder gegen jeden während dieses Jahrzehnts hat den in diesen Textenentwickelten Rahmen vollauf bestätigt.
Die Verteidigung desPrinzips der offenen Debatte zwischen den Revolutionären
Auf einem erst kürzlich stattgefundenen öffentlichen Forum,das von der Communist Workers‘ Organisation in London organisiert wurde undsich auf den Appell der IKS für gemeinsame Aktionen revolutionärer Gruppenangesichts des Balkankrieges bezog, stellte ein Genosse der CWO die Frage: „Wasführt die IKS im Schilde?“. Er äußerte die Ansicht, dass „die IKS mehrWendungen vollzogen hat als die stalinistische Komintern“ und dass ihre„freundschaftliche“ Haltung gegenüber dem Milieu nur die letzte dieserWendungen sei. Die bordigistische Gruppe Le Prolétaire beschrieb den Appell derIKS mit ähnlichen Worten und denunzierte ihn als ein „Manöver“ (s. RévolutionInternationale Nr. 294).
Solche Anschuldigungen lassen einen ernsthaft daranzweifeln, ob diese Genossen die IKS-Presse über die letzten 25 Jahre verfolgthaben. Ein kurzes Durchblättern der 100 Ausgaben der International Reviewreicht aus, um den Gedanken zurückzuweisen, dass der Aufruf zur Einheitzwischen den Revolutionären eine „neue Wendung“ der IKS ist. Wie wir bereitsgesagt haben, war für uns der Geist der Linkskommunisten, insbesondere der deritalienischen Fraktion, ein Geist der ernsthaften Debatte und Konfrontationzwischen allen verschiedenen Kräften innerhalb des kommunistischen Lagers undnatürlich auch zwischen den Kommunisten und denjenigen, die sich darum bemühen,das proletarisch-politische Terrain zu betreten. Von ihrer Gründung an – und imGegensatz zum weitverbreiteten Sektierertum, das als ein direktes Resultat deskonterrevolutionären Drucks in dem Milieu vorherrschte – hat die IKS auf:
– die Existenzeines proletarisch-politischen Lagers, das sich aus verschiedenen Tendenzenzusammensetzt, die auf der einen oder anderen Weise Ausdrücke desKlassenbewusstseins des Proletariats sind;
– auf diezentrale Bedeutung jener Gruppen innerhalb dieses Lagers, die aus denhistorischen Strömungen des Linkskommunismus stammen;
– dieNotwendigkeit einer Einheit und Solidarität zwischen den revolutionären Gruppenangesichts des Klassenfeindes – seiner antikommunistischen Kampagnen, seinerRepression, seiner Kriege;
– dieNotwendigkeit einer ernsthaften und verantwortungsbewussten Debatte über dierealen Divergenzen zwischen diesen revolutionären Gruppierungen;
– dieultimative Notwendigkeit der Umgruppierung der revolutionären Kräfte als Teildes Prozesses, der zur Bildung der Weltpartei führt,
bestanden.
Bei der Verteidigung dieser Prinzipien hat es Zeitengegeben, in denen es notwendiger war, die Differenzen herauszustellen, undandere Zeiten, in denen die Aktionseinheit übergeordnet war, doch dies hat nieauch nur eines der fundamentalen Prinzipien in Frage gestellt. Wir erkennenauch an, dass das Gewicht des Sektierertums das ganze Milieu betrifft und auchwir nicht behaupten, völlig immun dagegen zu sein – selbst wenn wir aufgrundder bloßen Tatsache, dass wir im Gegensatz zu anderen Gruppen seine Existenzerkennen, bessere Ausgangsbedingungen haben. Auf jeden Fall passierte es da unddort, dass unsere Argumente von sektiererischen Übertreibungen geschwächtwurden: zum Beispiel trug ein sowohl in der World Revolution als auch in derRévolution Internationale veröffentlichter Artikel den Titel „Die CWO fällt dempolitischen Parasitismus zum Opfer“, aus dem sich ergeben konnte, dass die CWOtatsächlich ins parasitäre Lager übergewechselt sei und somit sich außerhalbdes proletarischen Milieus befände, wohingegen der Artikel in Wahrheit imWesentlichen durch die Notwendigkeit, eine nahestehende kommunistische Gruppevor den Gefahren des Parasitismus zu warnen, motiviert war. Auf ähnliche Weisekonnte der Titel des Artikels über die Gründung des IBRP 1985 – „Die Gründungdes IBRP – ein opportunistischer Bluff“ -, den wir in der International ReviewNr. 40 und 41 veröffentlicht hatten, den Eindruck erwecken, dass dieseOrganisation vollständig vom Virus des Opportunismus angesteckt sei, wohingegenwir tatsächlich die einzelnen Gruppen des IBRP stets als integralen Bestandteildes kommunistischen Lagers anerkannten, auch wenn wir immer offen und heftigihre opportunistischen Irrtümer kritisierten.
Schon aus den frühesten Ausgaben der International Reviewist leicht ersichtlich, wie unser tatsächliches Verhalten ausgesehen hat.
Die erste Ausgabe enthält Diskussionsartikel über dieÜbergangsperiode, welche die Diskussion zwischen den Gruppen, die die IKSbildeten, und anderen, die draußen blieben, widerspiegelten; dieselbeInternational Review hob gleichfalls hervor, dass einige dieser Gruppeneingeladen worden waren, an der Gründungskonferenz der IKS teilzunehmen. Fernerwurde die Praxis, Beiträge anderer Gruppen und Elemente in der InternationalReview zu veröffentlichen, seither ständig fortgeführt (u.a. Texte von der CWO,von der mexikanischen GPI, der argentinischen Gruppe Emancipacion Obrera, vonindividuellen Elementen aus Hongkong, Russland, etc.)
In der International Review Nr. 11 veröffentlichten wireinen Text, den unser zweiter Kongress 1977 verabschiedet hatte. Er definiertedie wesentlichen Konturen des proletarisch-politischen Milieus einerseits sowiedes „Sumpfes“ andererseits und unterstrich unsere allgemeine Politik gegenüberanderen proletarischen Organisationen und Individuen.
In den späten 70ern unterstützten wir mit ganzem Herzen denVorschlag von Battaglia Comunista, eine internationale Konferenz derlinkskommunistischen Gruppen abzuhalten, nahmen aktiv an allen folgendenKonferenzen teil, veröffentlichten ihre Sitzungsberichte und Artikel über siein der International Review und vertraten im Zusammenhang mit diesenKonferenzen die Notwendigkeit der beteiligten Gruppen, gemeinsameStellungnahmen zu zentralen Tagesthemen abzugeben (wie im Fall der russischenInvasion in Afghanistan). Aus dem gleichen Grund kritisierten wir heftig dieEntscheidung von Battaglia, diese Konferenzen abzubrechen (s. dazu dieInternational Review Nr. 10, 16, 17, 22 und auch die beiden Pamphlete „Texteund Sitzungsberichte der Internationalen Konferenzen der Linkskommunisten“).
In den frühen 80ern veröffentlichten wir eine Artikelserie,welche die Krise analysierte, von der eine Reihe von Gruppen aus demproletarischen Milieu betroffen war (International Review Nr. 29, 31).
Die International Review Nr. 35 enthält einen Appell anproletarische Gruppen, der von unserem V. Internationalen Kongress 1983verabschiedet worden war. In diesem Appell schlugen wir nicht die sofortigeWiedereinberufung der internationalen Konferenzen vor, sondern strebten danach,„bescheidenere“ Praktiken zu etablieren, wie unsere Anwesenheit auf denöffentlichen Veranstaltungen anderer Gruppen, umfassendere Polemiken in unsererPresse, etc.
In der International Review Nr. 46 Ende 1986 drückten wirunsere Zustimmung zum „internationalen Vorschlag“ aus, der von derargentinischen Gruppe Emancipacion Obrera zugunsten einer größeren Kooperationund der Organisation von Diskussionen zwischen den Revolutionären angeregtworden war.
In der International Review Nr. 67 veröffentlichten wireinen weiteren Appell an das proletarische Milieu, diesmal von unserem IX.Kongress 1991 verabschiedet.
Somit stellt die Politik der IKS seit 1996, zu einergemeinsamen Antwort auf solche Ereignisse wie die Kampagnen der Bourgeoisiegegen die Linkskommunisten oder den Balkankrieg aufzurufen, keineswegs eineneue Wendung oder irgendein verstecktes Manöver dar, sondern stimmt völlig mitunserer gesamten Haltung seit jeher gegenüber dem proletarische Milieu überein.
Die zahlreichen Polemiken, die wir in der InternationalReview veröffentlicht haben, sind gleichfalls Teil dieser Orientierung. Wirkönnen sie hier nicht alle auflisten, aber wir können sagen, dass wir durch dieInternational Review praktisch über jeden Aspekt des revolutionären Programmseine ständige Debatte mit all den Strömungen des proletarischen Milieus undeinigen an seinen Rändern geführt haben.
Die Debatten mit dem IBRP (Battaglia und CWO) warensicherlich die zahlreichsten und zeigten, wie ernst wir diese Strömung stetsgenommen haben. Einige Beispiele:
– über diePartei: das Problem des Substitutionismus (International Review Nr. 17), dieunterirdische Reifung des Klassenbewusstseins (International Review Nr. 43),das Verhältnis zwischen Fraktion und Partei (Nr. 60, 61, 64, 65);
– über dieGeschichte der Italienischen Linken und die Ursprünge der Partito ComunistaInternazionalista (Nr. 8, 34, 39, 90, 91);
– über dieAufgaben der Revolutionäre in den Peripherien des Kapitalismus (Nr. 46 und100);
– über dieGewerkschaftsfrage (Nr. 51);
– über denhistorischen Kurs (Nr. 36, 50, 89);
über dieKrisentheorie und den Imperialismus (Nr. 13, 19, 86, etc.);
– über dieNatur der Kriege in der Dekadenz (Nr. 79, 82);
– über dieÜbergangsperiode (Nr. 47);
– über denIdealismus und die marxistische Methode (Nr. 99).
Nicht zu erwähnen die zahllosen Artikel, die sich mit derPosition des IBRP zu den unmittelbareren Ereignissen oder Interventionenbefassten (z.B. über unsere Intervention im Klassenkampf in Frankreich 1979oder 1995, über die Streiks in Polen oder den Zusammenbruch des Ostblocks, dieUrsachen des Golfkrieges, etc., etc.)
Mit den Bordigisten haben wir über alle Fragen der Parteidebattiert (z.B. Nr. 14, 23), aber auch über die nationale Frage (Nr. 32), dieDekadenz (Nr. 77 und 78), den Mystizismus (Nr. 94), etc.
Wir sollten auch die Polemiken mit den Spätabkömmlingen desRätekommunismus (z.B. die holländische Gruppe Spartakusbond und Daad enGedachte in der International Review Nr. 2, die dänische Gruppe Rätekommunismusin der International Review Nr. 25) und mit der von Munis initiierten Strömung(Nr. 25, 29, 52) erwähnen. Parallel zu diesen Debatten innerhalb desproletarischen Milieus haben wir eine Anzahl von Kritiken über die Gruppen desSumpfes verfasst (Autonomia in Nr. 16, Modernismus in Nr. 34, Situationismus inNr. 80), so wie wir die Auseinandersetzung mit dem politischen Parasitismusgeführt haben, der in unseren Augen eine ernste Gefahr für das proletarischeLager darstellt, weil er von Elementen verkörpert wird, die behaupten, ein Teilvon ihm zu sein, die jedoch eine völlig destruktive Rolle spielen (s. z.B. dieThesen über den Parasitismus in der International Review Nr. 94, Artikel überdie EFICC (Nr. 46, 60, 70, 92), über die CGB (Nr. 83, etc.).
Selbst wenn wir sehr scharf gegen andere proletarischeGruppen polemisiert haben, so haben wir stets versucht, fair zu bleiben, indemwir unsere Argumentation nicht auf den Boden von Spekulationen und Verzerrungenstellten, sondern von den wahren Positionen anderer Gruppen ausgehen ließen.Heute versuchen wir angesichts der riesigen Verantwortung, die schwer auf denSchultern einer schmalen revolutionären Minderheit lastet, noch größereAnstrengungen zu unternehmen, um noch akkurater und grundsätzlich brüderlich zuargumentieren. Unsere Leser können durch unsere polemischen Artikel in derInternational Review schweifen und sich ihr eigenes Urteil darüber bilden, wieerfolgreich wir in dieser Hinsicht sind. Unglücklicherweise müssen wir jedochfeststellen, dass es nur wenige ernsthafte Antworten auf die meisten dieserPolemiken oder auf die vielen Orientierungstexte gab, die wir demproletarischen Milieu ausdrücklich als Diskussionsbeiträge angeboten haben.Viel zu häufig wurden unsere Artikel ignoriert oder als das jüngsteSteckenpferd der IKS abgetan, ohne jeden ernsthaften Versuch, sich mit denvorgebrachten Argumenten auseinanderzusetzen. Im Geiste unserer früherenAppelle an das proletarische Milieu können wir die anderen Gruppen nur dazuaufrufen, die sektiererischen Barrieren, die eine wirkliche Debatte zwischenden Revolutionären verhindern – eine Schwäche, von der letztendlich nur dieBourgeoisie profitiert -, zu erkennen und damit zu überwinden.
Genossen!
Helft uns dieInternational Review zu verbreiten!
Wir können eigentlich ganz stolz auf die InternationalReview sein und sind davon überzeugt, dass sie eine Publikation ist, die auchdie Zukunft meistern wird. Obwohl sich die Lage seit dem Beginn derInternational Review gründlich geändert hat, obwohl die Analysen der IKS reifergeworfen sind, denken wir nicht, dass die 100 Ausgaben der InternationalReview, die wir bis jetzt veröffentlicht haben, obsolet geworden sind,genausowenig wie das für die künftigen Ausgaben gilt. Es ist zum Beispiel keinZufall, dass viele unserer neuen Kontakte, sobald sie einmal richtigesInteresse an unseren Positionen gefunden haben, anfangen, eine Sammlung derfrüheren Ausgaben der International Review zusammenzustellen. Doch wir sind unsnur zu bewusst, dass unsere Presse im allgemeinen und die International Reviewim Besonderen immer noch nur eine verschwindende Minderheit erreicht. Wirwissen, dass es objektive historische Gründe für die numerische Schwäche derkommunistischen Kräfte von heute, für ihre Isolation in der Klasse als Ganzesgibt. Die Kenntnisnahme dieser Gründe erfordert zwar einen gewissenRealitätssinn unsererseits, ist aber keine Entschuldigung für eine Passivitätunsererseits. Die Verkaufszahlen der revolutionären Presse und somit derInternational Review können, wenn auch in bescheidenem Maße, durch eineAnstrengung des revolutionären Willens auf Seiten der IKS und ihrer Leser undSympathisanten durchaus erhöht werden. Daher wollen wir diesen Artikel miteinem Appell an unsere Leser schließen, aktiv an den Bemühungen zur Steigerungder Verteilung und des Verkaufs der International Review teilzunehmen – indemsie ältere Exemplare oder komplette Sammlungen (die wir zu einem Preis von £ 50oder entsprechend in anderer Währung, alles inklusive, verkaufen) bestellen,indem sie Exemplare für den Weiterverkauf ordern, indem sie mithelfen,Buchläden und Vertriebssagenturen ausfindig zu machen und zu beliefern und soweiter. Die theoretische Übereinstimmung mit der Auffassung von der Wichtigkeitder revolutionären Presse beinhaltet auch eine praktische Verpflichtung, sie zuverkaufen, da wir keine Anarchisten sind, die die Einbeziehung in dasschmutzige Geschäft von Verkauf und Abrechnung verachten, sondern Kommunisten,die ihre Klasse so weit wie möglich erreichen wollen, aber verstehen, dass diesnur auf organisierte und kollektive Art gelingen kann.
Zu Beginn dieses Artikels unterstrichen wir die Fähigkeitunserer Organisation, seit 25 Jahren vierteljährlich eine Zeitschrift zuveröffentlichen, ohne Unterbrechung, während viele andere Gruppen nurunregelmäßig oder wechselhaft veröffentlicht haben oder einfach verschwanden.Man könnte natürlich einwenden, dass die IKS nach einem Vierteljahrhundertihrer Existenz immer noch nicht die Häufigkeit ihrer theoretischen Organegesteigert hat. Dies ist offensichtlich ein Zeichen einer gewissen Schwäche,unserer Meinung nach jedoch nicht eine Schwäche in unseren politischenPositionen und Analysen. Es ist eine Schwäche, die dem gesamtenLinkskommunismus eigen ist, in dem die IKS trotz ihrer geringen numerischenStärke die bei weitem größte und am weitesten verbreitete Organisation ist. Esist eine Schwäche der gesamten Arbeiterklasse, die, obwohl sie sich Ende der60er Jahre als fähig erwiesen hatte, aus dem Schatten der Konterrevolutionhervorzutreten, auf einige gewaltige Hindernisse auf ihrem Weg gestoßen ist,last not least in Gestalt des Zusammenbruchs der stalinistischen Regimes unddes allgemeinen Zerfalls der bürgerlichen Gesellschaft. Ein besonderesKennzeichen des Zerfalls, das wir in unserer Presse hervorgehoben haben, istdie Entwicklung von allerlei Arten seichter, irrationaler oder mystischerSichtweisen in der ganzen Gesellschaft einschließlich der Arbeiterklasse, zumNachteil einer tiefen, zusammenhängenden und materialistischenHerangehensweise, deren bester Ausdruck allein der Marxismus ist. Heute findenBücher über die Esoterik ein weitaus größeres Interesse als die Werke desMarxismus. Selbst wenn wir die Kapazität besäßen, die International Reviewhäufiger zu veröffentlichen, ihr gegenwärtiger Verbreitungsgrad würde solcheMühen nicht rechtfertigen. Deshalb rufen wir unsere Leser dazu auf, uns in denBemühungen, unsere Presse weiter zu verbreiten, zu helfen. Indem sie sichdiesen Bemühungen anschließen, werden sie am Kampf gegen die Ansteckung durchbürgerliche Ideologie und Zerfall teilnehmen, die das Proletariat überwindenmuss, um den Weg zur kommunistischen Revolution freizumachen.
Amos, Dezember 1999
[i] [1] Immer wennin diesem Artikel von International Review die Rede ist, sprechen wir von derenglischen, französischen (Revue Internationale) und spanischen (RevistaInternacional) Ausgabe. Die Revue ist in diesen drei Sprachen identisch. MitInternationale Revue umgekehrt ist die Ausgabe in deutscher Sprache gemeint,die einen anderen Erscheinungsrhythmus und somit auch eine andere Numerierunghat.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
13.Kongress der IKS
- 2433 Aufrufe
Bericht über den Klassenkampf
Ziel dieses Berichts ist es vor allem, die verbreiteten bürgerlichen Kampagnen über das „Ende des Klassenkampfes“ und das Verschwinden der Arbeiterklasse zu bekämpfen und den Standpunkt zu verteidigen, dass das Proletariat trotz aller aktuellen Schwierigkeiten sein revolutionäres Potenzial nicht verloren hat. Wie wir in den einleitenden Abschnitten, die wir hier aus Platzmangel weglassen müssen, betont hatten, gründet sich die bürgerliche Geringschätzung seines Potenzials auf eine rein immediatistische Konzeption, die den Stand des Klassenkampfes zu irgendeinem Zeitpunkt mit der wahren Dynamik des Proletariats in einem längeren Zeitraum verwechselt. Dieser seichten und empirischen Herangehensweise setzen wir die marxistische Methode entgegen, die feststellt, dass „das Proletariat... nur weltgeschichtlich existieren (kann), wie der Kommunismus, seine Aktion, nur als ‚weltgeschichtliche' Existenz überhaupt vorhanden sein kann“ (Marx, Die deutsche Ideologie). Der Bericht über den Klassenkampf war also eingebettet in den Gesamtzusammenhang der historischen Klassenbewegung seit ihren ersten heroischen Versuchen zwischen 1917 und 1923, den Kapitalismus zu überwinden, und den darauffolgenden Jahrzehnten der Konterrevolution. Wir geben hier den Bericht ab der Stelle wieder, wo er sich insbesondere auf die Entwicklung der Klassenbewegung seit dem Wiederaufflammen der Klassenauseinandersetzungen Ende der 60er Jahre konzentriert. Einige Passagen, die sich mit aktuelleren und kurzzeitigen Entwicklungen befassen, haben wir hier ebenfalls weggelassen bzw. komprimiert.
1968–69: das Wiedererwachen des Proletariats
Und hier liegt die ganze Bedeutung der Ereignisse vom Mai bis Juni 1968 in Frankreich verborgen: das Auftreten einer neuen Generation von Arbeitern, die durch das Elend und die Niederlagen der vergangenen Jahrzehnte nicht gebrochen und demoralisiert waren, die sich an einen verhältnismäßig höheren Lebensstandard in den „Boomjahren“ nach dem Krieg gewöhnt hatten und die nicht bereit waren, sich den Forderungen einer erneut in die Krise schlitternden nationalen Wirtschaft zu beugen. Der zehn Millionen Arbeiter umfassende Generalstreik in Frankreich, der von einer riesigen politischen Gärung begleitet wurde, in der Begriffe wie Revolution oder die Veränderung der Welt wieder Gegenstand ernsthafter Diskussionen wurden, markierte den Wiederauftritt der Arbeiterklasse auf der historischen Bühne und das Ende des konterrevolutionären Albtraums, der so lange auf ihrer Brust gelastet hatte. Die Bedeutung des „wilden Mai“ in Italien und des „heißen Herbstes“ im darauffolgenden Jahr besteht darin, dass sie der Beweis für die Richtigkeit dieser Interpretation waren, entgegen jener Stimmen, die versuchten, den Mai 1968 als nicht mehr als eine kleine Studentenrevolte darzustellen. Der Ausbruch von Kämpfen unter den italienischen Arbeitern, damals mit ihrer mächtigen antigewerkschaftlichen Dynamik politisch die fortgeschrittenste Arbeiterklasse auf der Welt, zeigte ganz deutlich, dass der Mai 68 kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern die Ouvertüre einer ganzen Periode weltweit wachsender Klassenkämpfe war. Die folgenden Massenbewegungen (Argentinien 69, Polen 70, Spanien und Großbritannien 72) sind nur weitere Bestätigungen dieser Interpretation.
Nicht alle existierenden revolutionären Organisationen waren imstande, dies zu erkennen: Die älteren, besonders die bordigistische Strömung, wurden mit den Jahren immer kurzsichtiger und waren unfähig, den tiefgehenden Wandel im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen zu sehen. Doch diejenigen, die fähig waren, sowohl die Dynamik dieser neuen Bewegung zu erfassen als auch sich die „alten“ Methoden der Italienischen Linken wiederanzueignen, welche in den finstersten Zeiten der Konterrevolution ein bewundernswertes Maß an Klarheit besaß, hatten sich in die Lage versetzt, die Eröffnung einer neuen historischen Periode zu erklären, die sich markant unterscheidet von jener, die unter dem Gewicht der Konterrevolution vorgeherrscht und in der der Kurs zum Krieg dominiert hatte. Der erneute Ausbruch der Weltwirtschaftskrise hätte sicherlich zu einer Verschärfung der imperialistischen Antagonismen geführt, die wiederum, wenn sie ihrer eigenen Dynamik überlassen worden wären, die Menschheit in einen dritten und höchstwahrscheinlich endgültigen Weltkrieg gestoßen hätte. Doch indem das Proletariat begonnen hatte, der Krise auf eigenem Klassenterrain entgegenzutreten, wirkte es als fundamentales Hindernis gegenüber dieser Dynamik. Und nicht nur das; es entwickelte zudem durch die Aufnahme seiner Abwehrkämpfe eine eigene Dynamik hin zu einem zweiten weltrevolutionären Ansturm gegen das kapitalistische System.
Der massive und offene Charakter dieser ersten Welle von Kämpfen und die Tatsache, dass sie es endlich wieder ermöglicht hatten, über die Revolution zu sprechen, führte viele der ungeduldigen Abkömmlinge der Bewegung dazu, „ihre Träume für bare Münze zu nehmen“ und zu denken, dass die Welt sich Anfang der 70er Jahre bereits am Rande einer revolutionären Krise befände. Dieser Art von Immediatismus fehlte das Verständnis dafür, dass:
– die Wirtschaftskrise, welche die Triebkraft für den Kampf geschaffen hatte, sich noch ziemlich in der Anfangsphase befand, und im Gegensatz zu den 30er Jahren dieser Krise eine Bourgeoisie gegenüberstand, die ausgerüstet war mit den Lehren ihrer eigenen Erfahrungen und mit Instrumenten, die sie in die Lage versetzten, den Abstieg in den Abgrund zu ‚managen‘, wie der Gebrauch blockweiter Organe, die Fähigkeit, die schlimmsten Auswirkungen der Krise durch die Flucht in die Verschuldung und durch ihre Abwälzung in die Peripherien des Systems hinauszuzögern;
– die politischen Folgen der Konterrevolution immer noch ein beträchtliches Gewicht innerhalb der Arbeiterklasse besaßen: der beinahe völlige Bruch in der organischen Kontinuität mit den politischen Organisationen der Vergangenheit, der niedrige Grad an politischer Kultur im Proletariat als Ganzes, sein abgrundtiefes Misstrauen gegenüber der „Politik“, Resultat seiner traumatischen Erfahrung mit dem Stalinismus und der Sozialdemokratie.
Diese Faktoren sind ausschlaggebend dafür, dass die Periode des proletarischen Kampfes, die im Mai 68 eröffnet wurde, sich sehr lange hinziehen wird. Im Gegensatz zur ersten revolutionären Welle, die als Antwort auf den Krieg auftrat und so sehr schnell auf die politische Ebene katapultiert wurde – in vielerlei Hinsicht zu schnell, wie Rosa Luxemburg bezüglich der Novemberrevolution in Deutschland bemerkte –, können die revolutionären Schlachten der Zukunft nur durch eine Reihe von defensiven ökonomischen Auseinandersetzungen vorbereitet werden, welche – und dies ist in jedem Fall ein wesentlicher Zug in den allgemeinen Klassenkämpfen – dazu gezwungen sind, nach dem schwierigen und unregelmäßigen Muster von Fortschritt und Rückzug zu verlaufen.
Die Antwort der französischen Bourgeoisie auf den Mai 68 gab den Ton an für die Gegenattacke der Weltbourgeoisie: der Wahltrick wurde benutzt, um den Klassenkampf zu zerstreuen (sobald die Gewerkschaften letzteren erst einmal eingepfercht hatten); die Versprechungen einer linken Regierung, die den Arbeitern in Aussicht gestellt wurde, indem die blendende Illusion vermittelt wurde, dass sie all die Probleme erledigen werde, die den Ausbruch bewirkt hatten, und eine neue Herrschaft von Wohlstand und Gerechtigkeit, ja sogar ein bisschen „Arbeiterkontrolle“, installieren werde. Die 70er Jahre können also insofern als „Jahre der Illusion“ bezeichnet werden, als dass sich die Bourgeoisie angesichts eines relativ eingeschränkten Ausmaßes der Wirtschaftskrise noch in der angenehmen Lage befand, diese Illusion der Arbeiterklasse auch verkaufen zu können. Diese Gegenoffensive nahm der ersten internationalen Welle von Kämpfen die Spitze.
Die Unfähigkeit der Bourgeoisie, auch nur eine ihrer falschen Versprechungen zu verwirklichen, bedeutete, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis die Kämpfe wieder zurückkehrten. Die Jahre 1978 bis 1980 waren eine Zeit sehr konzentrierter Ausbrüche wichtiger Klassenkämpfe: Longwy-Denain in Frankreich mit den Bemühungen, den Kampf über den Stahlsektor hinaus auszudehnen und die Autorität der Gewerkschaft herauszufordern; der Rotterdamer Hafenarbeiterstreik, der das Auftauchen eines unabhängigen Streikkomitees erblickte; die Massenbewegung im Iran, die zum Sturz des Schah-Regimes führte; in England der „Winter des Unfriedens“, in dem es in einer Reihe von Bereichen gleichzeitig zum Ausbruch von Kämpfen kam, und der Stahlarbeiterstreik von 1980; und schließlich Polen 1980, der Höhepunkt dieser Welle und, in vielerlei Hinsicht, der gesamten Periode der wiederauflebenden Klassenkämpfe bis dahin.
Am Ende dieser turbulenten Dekade hatte die IKS bereits angekündigt, dass die 80er Jahre die „Jahre der Wahrheit“ werden, womit wir nicht meinten, wie häufig missgedeutet, dass dies das Jahrzehnt der Revolution sei, sondern ein Jahrzehnt, in dem die Illusionen der 70er Jahre durch die brutale Beschleunigung der Krise und dem daraus resultierenden Anschlag auf die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ausgetrieben werden. Ein Jahrzehnt, in dem die Bourgeoisie selbst die Sprache der Wahrheit spricht, „des Blutes, des Schweißes und der Tränen“, des „Es-gibt-keine-Alternative“ à la Thatcher – ein Wechsel in der Sprache, der auch dem Wechsel in der politischen Aufstellung der herrschenden Klasse entsprach, mit einer kaltschnäuzigen Rechten an der Macht, die offen die notwendigen Angriffe ausführte, und einer scheinbar radikalisierten Linken in der Opposition, damit beauftragt, die Antwort der Arbeiter von innen zunichte zu machen. Und schließlich waren die 80er Jahre „Jahre der Wahrheit“, weil die historische Alternative, der die Menschheit gegenübersteht – Weltkrieg oder Weltrevolution –, nicht nur deutlicher zutage trat, sondern in einem gewissen Sinn auch von den Ereignissen der folgenden Dekade entschieden wurde. Und in der Tat verdeutlichten dies die Ereignisse zu Anfang dieser Dekade: Auf der einen Seite warf die sowjetische Invasion in Afghanistan ein deutliches Schlaglicht auf die „Antwort“ der Bourgeoisie auf die Krise und eröffnete eine Periode der weiteren Verschärfung von Spannungen zwischen den Blöcken, was versinnbildlicht wurde durch Reagans Warnungen vor dem Reich des Bösen und den gigantischen Militärbudgets, die für Waffensysteme wie das „Star-Wars“-Projekt aufgewendet wurden. Auf der anderen Seite veranschaulichten die Massenstreiks in Polen die Antwort des Proletariats klar und deutlich.
Die IKS hat stets die enorme Bedeutung dieser Bewegung anerkannt, die die „Antwort“ auf all die in den vorherigen Schlachten gestellten Fragen lieferte: „Der Kampf in Polen hat Antworten auf eine ganze Reihe von Fragen geliefert, die in den früheren Kämpfen gestellt worden waren, ohne je klar beantwortet zu werden:
– die Notwendigkeit einer Ausweitung des Kampfes (Rotterdam);
– die Notwendigkeit der Selbstorganisation (Stahlarbeiterstreik in England);
– das Verhalten gegenüber der Repression (Longwy-Denain).
In all diesen Punkten stellten die Kämpfe in Polen einen großen Schritt vorwärts dar im weltweiten Kampf des Proletariats, weswegen diese Kämpfe die wichtigsten seit über einem halben Jahrhundert sind.“ („Resolution über den Klassenkampf“, 4. Kongress der IKS, 1980, veröffentlicht in International Review, Nr. 26)
Zusammengefasst zeigte die polnische Bewegung, wie das Proletariat selbst als eine einheitliche soziale Kraft auftreten kann, die nicht nur imstande ist, sich dem Angriff des Kapitals zu widersetzen, sondern auch in der Lage ist, die Perspektive der Arbeitermacht aufzustellen (eine Gefahr, die von der Bourgeoisie sehr wohl gewürdigt wurde, als sie zeitweise die imperialistischen Rivalitäten zurückstellte, um die Bewegung, insbesondere durch die Konstruktion der Solidarnosc, zu ersticken).
Indem der polnische Massenstreik die Frage beantwortete, wie der Kampf ausgeweitet und organisiert werden soll – nämlich durch seine Vereinigung –, stellte er eine neue Frage: Wie kann der Massenstreik über die nationalen Grenzen hinaus generalisiert werden – eine Vorbedingung für die Entwicklung einer revolutionären Situation? Doch wie unsere Resolution es damals ausdrückte, stand dies nicht in unmittelbarer Aussicht. Die Frage der Generalisierung konnte in Polen nur gestellt werden, doch es lag am Weltproletariat und insbesondere am Proletariat Westeuropas, darauf zu antworten. Bei dem Versuch, einen klaren Kopf über die Bedeutung der Ereignisse in Polen zu behalten, mussten wir zwei verschiedene Verirrungen bekämpfen: einerseits eine ernsthafte Unterschätzung der Wichtigkeit des Kampfes (z.B. in unserer Sektion in Großbritannien, unter den Kampfgenossen der gewerkschaftlichen Streikkomitees im britischen Stahlarbeiterstreik, welche die Bewegung in Polen als weniger wichtig einschätzten als das, was in Großbritannien geschah), und andererseits ein gefährlicher Immediatismus, der das kurzfristige revolutionäre Potenzial dieser Bewegung überschätzte. Um diese sich diametral gegenüberstehenden Irrtümer zu kritisieren, waren wir dazu gezwungen, die Kritik der Theorie des „schwächsten Gliedes“ weiterzuentwickeln.
Das zentrale Element dieser Kritik besteht in der Erkenntnis, dass der revolutionäre Durchbruch ein konzentriertes und vor allem ein politisch erfahrenes bzw. „kultiviertes“ Proletariat erfordert. Das Proletariat der osteuropäischen Länder besitzt eine ruhmreiche revolutionäre Vergangenheit, doch dies alles ist vom Schrecken des Stalinismus ausradiert worden, was die riesige Lücke zwischen dem Grad der Selbstorganisation und der Ausweitung der Bewegung in Polen einerseits und ihrem politischen Bewusstsein (die Vorherrschaft der Religion, aber vor allem der demokratischen und gewerkschaftlichen Ideologie) andererseits erklärt. Der politische Bewusstseinsgrad des Proletariats in Westeuropa, das jahrzehntelange Erfahrungen mit den demokratischen Ergötzlichkeiten hat, ist beträchtlich höher (eine Tatsache, die unter anderem durch das Phänomen ausgedrückt wird, dass die Mehrheit der revolutionären Organisationen der Welt in Westeuropa konzentriert ist). Es ist also zuallererst Westeuropa, auf das wir Acht geben müssen, wenn wir die Reifung der Bedingungen für die nächste revolutionäre Bewegung der Arbeiterklasse beurteilen wollen.
Einerlei, die tiefe Konterrevolution, die in den 20er Jahren über die Arbeiterklasse hergefallen war, hat ihren Tribut vom gesamten Proletariat erfordert. Man könnte sagen, dass das Proletariat von heute einen Vorteil gegenüber der revolutionären Generation von 1917 hat: Heute gibt es keine große Arbeiterorganisation, die, gerade erst zur herrschenden Klasse übergelaufen, noch fähig wäre, die grenzenlose Loyalität einer Klasse einzufordern, die noch nicht in der Lage war, die historischen Konsequenzen ihres Betruges wahrzunehmen. Dies war der Hauptgrund für die Niederlage der deutschen Revolution durch die Hände der Sozialdemokratie 1918/19. Doch die Sache hat auch eine Kehrseite. Die systematische Zerstörung der revolutionären Traditionen des Proletariats, das vom Proletariat entwickelte Misstrauen gegenüber allen politischen Organisationen, sein wachsender Gedächtnisverlust gegenüber seiner eigenen Geschichte (ein Faktor, der sich seit ungefähr einem Jahrzehnt beschleunigt) bilden eine große Schwäche der Arbeiterklasse auf dem gesamten Globus.
In keinem der nachfolgenden Ereignisse war das westeuropäische Proletariat bereit, die Herausforderung, die vom polnischen Massenstreik aufgestellt worden war, anzunehmen. Die zweite Welle von Kämpfen brach die Bourgeoisie durch die neue Strategie der Platzierung der Linken in der Opposition, und die polnischen Arbeiter fanden sich selbst genau zu jener Zeit in der Isolation wieder, in der sie den Ausbruch des Kampfes an anderer Stelle am dringendsten benötigten. Diese Isolation (bewusst von der Weltbourgeoisie erzwungen) öffnete die Tore für Jaruzelskis Panzer. Die Repression in Polen 1981 markierte das Ende der zweiten Welle von Kämpfen.
Historische Ereignisse von dieser Tragweite haben langfristige Konsequenzen. Der Massenstreik in Polen lieferte den endgültigen Beweis, dass der Klassenkampf die einzige Kraft ist, die die Bourgeoisie dazu nötigen kann, ihre imperialistischen Rivalitäten hintanzustellen. Er zeigte insbesondere, dass der russische Block – historisch durch seine schwache Position dazu verdammt, der „Aggressor“ in jedwedem Krieg zu sein – unfähig war, auf seine wachsende wirtschaftliche Krise mit einer Politik der militärischen Expansion zu antworten. Es war klar, dass die Arbeiter des Ostblocks (und selbst Russlands) als Kanonenfutter in irgendeinem künftigen Krieg für den Ruhm des „Sozialismus“ total ungeeignet waren. So war der Massenstreik in Polen ein wichtiger Faktor bei der kommenden Implosion des imperialistischen russischen Blocks.
Auch wenn sie nicht in der Lage war, die Frage der Generalisierung zu beantworten, blieb die Arbeiterklasse des Westens nicht lange auf dem Rückzug. Mit der ersten Serie von Streiks im öffentlichen Sektor Belgiens 1983 startete sie eine sehr lange „dritte Welle“, die, auch wenn sie nicht von der Ebene des Massenstreiks ausging, eine allgegenwärtige Dynamik in diese Richtung entwickelte.
In unserer oben zitierten Resolution von 1980 verglichen wir die Situation der Klasse von heute mit jener von 1917. Die Bedingungen des Weltkrieges garantierten, dass jeder Klassenwiderstand sofort mit der ganzen Macht des Staates konfrontiert war und somit die Frage der Revolution stellen musste. Gleichzeitig brachten die Kriegsbedingungen zahllose Nachteile mit sich – u.a. die Fähigkeit der Bourgeoisie, einen Keil zwischen die Arbeiter der „Sieger“ und der „besiegten“ Nationen zu treiben und durch die Beendigung des Krieges der Revolution den Wind aus den Segeln zu nehmen. Eine lang hingezogene und weltweite Wirtschaftskrise jedoch tendiert nicht nur dazu, einheitliche Bedingungen für die gesamte Klasse zu schaffen, sondern verschafft dem Proletariat auch mehr Zeit, seine Kräfte, sein Klassenbewusstsein durch eine ganze Reihe von Teilkämpfen gegen die kapitalistischen Angriffe zu entwickeln. Die internationale Welle der 80er Jahre besaß definitiv diese Charakteristik. Auch wenn keiner der Kämpfe eine ähnlich spektakuläre Gestalt annahm wie in Frankreich 1968 oder in Polen 1980, so vereinigten sie in sich wichtige Klärungen über Ziel und Zweck des Kampfes. Zum Beispiel zeigten die weitverbreiteten Solidaritätsappelle über sektorale Grenzen hinaus in Belgien 1983 und 1986 oder in Dänemark 1985 konkret, wie das Problem der Ausdehnung gelöst werden konnte; die Bemühungen, die Kontrolle über den Kampf zu erlangen (Eisenbahnarbeiterversammlungen in Frankreich 1986, Versammlungen von Schulbediensteten in Italien 1987) zeigten, wie man sich außerhalb der Gewerkschaften organisiert. Es gab auch erste, noch zaghafte Versuche, Lehren aus den Niederlagen zu ziehen: In Großbritannien z.B. deuteten Kämpfe gegen Ende des Jahrzehnts darauf hin, dass die Arbeiter nach der Niederlage der militanten, aber lange hingezogenen und isolierten Kämpfe der Bergarbeiter und Drucker Mitte der 80er Jahre nicht gewillt waren, in dieselben Fußstapfen zu treten (so die britischen Telecom-Arbeiter, die schnell zuschlugen und dann zur Arbeit zurückkehrten, bevor sie ins Leere liefen, oder die gleichzeitigen Streiks in etlichen Branchen im Sommer 1988). Zur gleichen Zeit lieferte das Auftreten von aus dem Arbeiterkampf entstandenen Gruppen in etlichen Ländern die Antwort auf die Frage, wie sich die militantesten Arbeiter gegenüber den Kämpfen in ihrer Gesamtheit verhalten sollen. All diese scheinbar voneinander getrennten Strömungen mündeten in einen gemeinsamen Lauf, welcher eine qualitative Vertiefung des weltweiten Klassenkampfes darstellte.
Nichtsdestotrotz begann ab einem gewissen Punkt der Zeitfaktor immer weniger eine für das Proletariat günstige Rolle zu spielen. Angesichts der Vertiefung der Krise der gesamten Produktionsweise, einer geschichtlichen Gesellschaftsformation, hielt der Arbeiterkampf trotz seines allmählichen Fortschritts nicht mehr Schritt mit den sich allerorten überschlagenden Ereignissen, erreichte er nicht mehr die Qualität, die erforderlich war, um das Proletariat in seiner Rolle als positive revolutionäre Kraft zu bestätigen, auch wenn er immer noch den Weg zum Weltkrieg blockierte. So blieb die Existenz der dritten Welle von Arbeiterkämpfen der weiten Mehrheit der Menschheit und auch des Proletariats mehr oder weniger verborgen – sicherlich auch durch die Unterdrückung dieser Wahrheit durch die Bourgeoisie, aber vor allem durch die langsame, unspektakuläre Natur dieser Kämpfe. Die dritte Welle war selbst proletarischen politischen Organisationen „verborgen“ geblieben, die dazu neigten, nur die oberflächlichen Ausdrücke zu sehen und dies auch nur als getrennte und nicht miteinander verbundene Phänomene.
Diese Situation, in der es trotz der sich immer weiter vertiefenden Krise keiner der Hauptklassen gelang, ihre Lösung durchzusetzen, rief das Phänomen des Zerfalls hervor, das den 80er Jahren auf mannigfaltigen, miteinander verbundenen Ebenen seinen Stempel aufdrückte: auf der sozialen Ebene (wachsende Atomisierung der Individuen, Banditentum, Drogenmissbrauch etc.), auf ideologischer Ebene (Verbreitung irrationaler und fundamentalistischer Heilslehren), auf ökologischer Ebene usw. usf. Entstanden aus der Sackgasse im Klassenkampf, sorgte der Zerfall seinerseits dafür, dass die Fähigkeit des Proletariats geschwächt wurde, eine einheitliche Kraft zu schmieden. Zum Ende dieses Jahrzehnts hin rückte der Zerfall mehr und mehr in den Mittelpunkt und kulminierte in den gigantischen Ereignissen von 1989, die die endgültige Eröffnung einer neuen Phase im langen Abstieg des überflüssig gewordenen Kapitalismus markierte, eine Phase, in der das gesamte gesellschaftliche Gefüge zu krachen, zu wanken und zusammenzufallen beginnt.
1989–99: der Klassenkampf im Angesicht der Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft
Der Zusammenbruch des Ostblocks fand also in einem Augenblick statt, in dem das Proletariat zwar immer noch kämpferisch war und langsam sein Bewusstsein entwickelte, aber noch nicht den Punkt erreicht hatte, an dem es imstande gewesen wäre, eine Antwort auf solch ein enormes historisches Ereignis auf seinem eigenen Klassenterrain parat zu haben. Der Kollaps des „Kommunismus“ stoppte die dritte Welle abrupt und hatte (bis auf eine sehr begrenzte politisierte Minderheit) einen äußerst negativen Einfluss auf das Schlüsselelement des Klassenbewusstseins – die Fähigkeit, eine Perspektive, ein allgemeingültiges Ziel für den Kampf zu entwickeln, was in einer Epoche, in der die defensiven Kämpfe je länger je weniger von den offensiven, revolutionären Kämpfen der Klasse getrennt werden können, notwendiger denn je ist. Der Kollaps des Ostblocks griff die Klasse auf zweierlei Weise an:
– Er ermöglichte der Bourgeoisie, eine ganze Reihe von Kampagnen rund um das Thema „Das Ende des Kommunismus“, „Das Ende des Klassenkampfes“ zu entwickeln, was tiefe Spuren in der Fähigkeit der Klasse hinterließ, ihrem Kampf die Perspektive des Aufbaus einer neuen Gesellschaft zu verleihen, sich selbst als eine unabhängige, dem Kapital feindlich gesonnene Kraft zu positionieren und ihre eigenen Interessen zu verteidigen.
– Gleichzeitig löste der Zusammenbruch des Ostblocks all die Kräfte des Zerfalls aus, die bereits im Verborgenen gelauert hatten, was die Klasse der korrupten Atmosphäre des Jeder-für-sich, der schlimmsten Einflüsse des Banditentums, Fundamentalismus etc. aussetzte. Darüber hinaus war die Bourgeoisie imstande, die Manifestationen des Zerfalls gegen die Arbeiterklasse zu nutzen, obwohl dies ihr System noch weiter in Mitleidenschaft zog. Ein klassisches Beispiel war die Dutroux-Affäre in Belgien, wo die schmutzigen Praktiken bürgerlicher Cliquen als Vorwand benutzt wurden, um die Arbeiterklasse in einer breiten demokratischen Kampagne für eine „saubere Regierung“ zu ertränken. Tatsächlich wurde die demokratische Mystifikation immer systematischer genutzt, war sie doch sowohl die logische „Schlussfolgerung“ aus dem „Scheitern des Kommunismus“ als auch das ideale Instrument, um die Klasse noch mehr zu atomisieren und sie mit Händen und Füßen an den kapitalistischen Staat zu fesseln. Auch die vom Zerfall verursachten Kriege – der Golfkrieg 1991, Ex-Jugoslawien etc. – hatten, auch wenn sie einer Minderheit erlaubten, die militaristische Natur des Kapitalismus noch deutlicher zu erkennen, den allgemeinen Effekt, dass das Gefühl der Machtlosigkeit, des Lebens in einer grausamen und irrationalen Welt, in der es keine andere Lösung gibt, als den Kopf in den Sand zu stecken, im Proletariat noch verstärkt wurde.
Die Lage der Arbeitslosen wirft ein deutliches Licht auf die Probleme, denen sich die Klasse hier gegenübersieht. In den späten 70er und den frühen 80er Jahren identifizierte die IKS die arbeitslosen Arbeiter als potenzielle Quelle der Radikalisierung der Klassenbewegung insgesamt, vergleichbar mit der Rolle, die die Soldaten in der ersten weltrevolutionären Welle gespielt hatten. Doch unter dem Gewicht des Zerfalls hat es sich für die Arbeitslosen als immer schwieriger erwiesen, ihre eigenen kollektiven Kampf- und Organisationsformen zu entwickeln, da sie für die zerstörerischsten sozialen Auswirkungen (Atomisierung, Kriminalität, etc.) besonders verwundbar sind. Dies trifft vor allem auf die Generation junger arbeitsloser Proletarier zu, die nie die kollektive Disziplin und Arbeitersolidarität erfahren haben. Gleichzeitig jedoch ist dieses negative Gewicht nicht von der Tendenz des Kapitals erleichtert worden, jene „traditionellen“ Bereiche zu „de-industrialisieren“, in denen die Arbeiter eine alte Erfahrung mit der Klassensolidarität besitzen – Bergbau, Schiffbau, Stahl etc. Statt ihre kollektiven Traditionen unter die Arbeitslosen zu bringen, neigten diese Proletarier dazu, in der anonymen Masse unterzugehen. Die Dezimierung dieser Bereiche hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Kämpfe der Beschäftigten selbst, da sie mit dazu beitrug, wichtige Quellen der Klassenidentität und –erfahrung zuzuschütten.
Die Gefahren der neuen Periode für die Arbeiterklasse und für die Zukunft ihrer Kämpfe darf nicht unterschätzt werden. Während der Klassenkampf in den 70er und 80er Jahren definitiv eine Barriere gegen den Krieg darstellte, wird der Prozess des Zerfalls von den Tageskämpfen weder gestoppt noch verlangsamt. Um einen Weltkrieg auszulösen, müsste die Bourgeoisie eine Reihe wichtiger Siege über die zentralen Bataillone der Arbeiterklasse erringen. Heute sieht sich das Proletariat einer längerfristigen, aber nicht minder gefährlichen Bedrohung des „Todes auf Raten“ gegenüber, wo die Arbeiterklasse in wachsendem Maße durch den ganzen Prozess bis zu dem Punkt niedergerungen werden kann, an dem sie die Fähigkeit verliert, sich selbst als Klasse zu behaupten, während der Kapitalismus von einer Katastrophe in die nächste stürzt (lokale Kriege, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen, etc.), bis jener Punkt erreicht ist, an dem die Aussicht auf eine kommunistische Gesellschaft auf Generationen hinaus zerstört würde – ganz zu schweigen von der eigentlichen Vernichtung der Menschheit selbst.
Für uns jedoch ist die Fähigkeit des Proletariats, auf die Auflösung des kapitalistischen Systems zu antworten, trotz der vom gesellschaftlichen Zerfall aufgekommenen Probleme, trotz des Rückflusses des Klassenkampfes, den wir in den letzten paar Jahren erlebt hatten, nicht verschwunden, und die Tür zu massiven Klassenkonfrontationen bleibt geöffnet. Um dies zu belegen, ist es notwendig, sich aufs Neue der breiten Dynamik des Klassenkampfes seit dem Beginn der Zerfallsphase zu vergewissern.
Die Entwicklung der Kämpfe seit 1989
Wie die IKS zu jener Zeit vorhergesagt hat, war der Rückgang sowohl auf der Ebene des Bewusstseins als auch auf der des Kampfgeistes sehr markant. Die Arbeiterklasse stand voll und ganz im Bann der Kampagnen über den Tod des „Kommunismus“.
Ab 1992 begannen die Auswirkungen dieser Kampagnen, wenn nicht zu verschleißen, so doch zumindest sich abzuschwächen, und die ersten Anzeichen einer Rückkehr der Klassenmilitanz machten sich bemerkbar, insbesondere mit der Mobilisierung der italienischen Arbeiter gegen das Austeritätsprogramm der Regierung D'Amato im September 1992. Dem folgten die Bergarbeiterdemonstrationen gegen Zechenschließungen in Großbritannien im Oktober desselben Jahres. Das Ende des Jahres 1993 sah weitere Bewegungen in Italien, Belgien, Spanien und besonders in Deutschland, wo in einer Reihe von Branchen, besonders aber im Maschinenbau und in der Automobilindustrie, Streiks und Demonstrationen stattfanden. Die IKS erklärte im Editorial der International Review Nr.76 („The difficult resurgence of the class struggle“), dass „die Ruhe, die fast vier Jahre lang geherrscht hat, endgültig durchbrochen worden ist“. Zwar begrüßte die IKS die Wiederbelebung des Kampfgeistes in der Klasse, doch betonte sie auch die Schwierigkeiten, die ihr gegenüberstanden: die wiedergenesene Stärke der Gewerkschaften, die Manövrierfähigkeit der Bourgeoisie gegenüber der Arbeiterklasse, die es ihr vor allem erlaubte, Zeitpunkt und Umfang einer jeder größeren Bewegung, die auszubrechen droht, zu bestimmen, und die ähnlich geartete Fähigkeit der herrschenden Klasse, vollen Gebrauch von den Phänomenen des Zerfalls zu machen, um die Atomisierung der Arbeiterklasse weiter voranzutreiben (die Aufdeckung von Skandalen wie z.B. die „Saubere-Hände“-Kampagne in Italien wurde in den letzten Jahren besonders stark ins Rampenlicht gerückt).
Im Dezember 1995 sahen sich die IKS im besonderen und das revolutionäre Milieu im allgemeinen einer harten Prüfung ausgesetzt. Im Zusammenhang mit den Kontroversen über die Eisenbahn und einer höchst provokanten Attacke auf den Mindestlohn aller Arbeiter schien es, als ob Frankreich sich an der Spitze der wichtigsten Klassenbewegungen befand, nachdem Streiks und Massenversammlungen viele Branchen ergriffen und Arbeiter skandiert hatten, dass der einzige Weg, Forderungen durchzusetzen, im gemeinsamen Kampf aller bestünde. Eine Reihe von revolutionären Gruppen, die dem Klassenkampf im allgemeinen skeptisch gegenüberstanden, brach angesichts dieser Bewegung in große Begeisterung aus. Die IKS jedoch warnte die Arbeiter, dass diese „Bewegung“ vor allem das Produkt eines gigantischen Manövers der herrschenden Klasse war, die sich der sich zuspitzenden Unzufriedenheit innerhalb der Klasse bewusst war und danach trachtete, mit einem Präventivschlag zu verhindern, dass die gärende Wut in wirkliche Militanz, in einen tatsächlichen Willen zur Aktion umschlägt. Indem die Bourgeoisie besonders die Gewerkschaften als Helden des Arbeiterkampfes, als Spezialisten der proletarischen Kampfmethoden (Versammlungen, das Entsenden von Massendelegationen in andere Sektoren etc.) darstellte, versuchte die Bourgeoisie in Vorbereitung auf weitaus wichtigere Konfrontationen in der Zukunft, die Glaubwürdigkeit ihres Gewerkschaftsapparates aufzupolieren. Obgleich die IKS wegen ihrer „konspirativen“ Ansicht über den Kampf heftig kritisiert worden war, wurde diese Analyse in der folgenden Periode bestätigt. Die deutsche und belgische Bourgeoisie kopierten die französischen Streiks bis aufs i-Tüpfelchen, und auch in Großbritannien (die Liverpooler Hafenarbeiter-Kampagne) sowie den USA (der Streik bei UPS) wurden weitere Versuche unternommen, um das Image der Gewerkschaften zu stärken.
Die wichtigste Bestätigung unserer Analyse wurde vom riesigen Streik in Dänemark im Sommer 1998 geliefert. Auf den ersten Blick wies diese Bewegung viele Ähnlichkeiten mit den Dezember-Ereignissen 1995 in Frankreich auf, doch wie wir im Editorial der International Review Nr.94 sagten, entsprach dies nicht der Realität: „Trotz des Scheiterns des Streiks und der Manöver der Bourgeoisie hat diese Bewegung eine andere Bedeutung als jene vom Dezember 1995 in Frankreich. Während besonders in Frankreich die Rückkehr zur Arbeit mit einer gewissen Euphorie einherging, die keinen Platz für die Infragestellung der Gewerkschaften ließ, brachte das Ende des dänischen Streiks ein Gefühl der Niederlage und weniger gewerkschaftliche Illusionen mit sich. Diesmal war das Ziel der Bourgeoisie nicht, eine riesige Operation durchzuführen, um die Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften international wiederherzustellen wie 1995, sondern ‚Dampf abzulassen', um der Unzufriedenheit und der wachsenden Kampfbereitschaft zuvorzukommen, die sich Stück für Stück in Dänemark wie auch in anderen europäischen Ländern und anderswo angehäuft hatte.“
Das Editorial hebt auch andere wichtige Aspekte des Streiks hervor: sein bedeutender Umfang (ein Viertel der Arbeitskräfte zwei Wochen lang im Streik), was ein wahres Zeugnis vom wachsenden Ausmaß der Wut und der Kampfbereitschaft ablegt, die sich in der Klasse angesammelt haben, und der intensive Gebrauch der Basisgewerkschaften, um diese Militanz und Unzufriedenheit der Arbeiter mit dem offiziellen Gewerkschaftsapparat wegzuwischen.
Vor allem hatte sich der internationale Kontext geändert: eine wachsende Kampfbereitschaft, die in zahlreichen Ländern zum Ausdruck kam und sich seitdem fortgesetzt hat:
– im Sommer 1998 in den USA mit dem Streik von nahezu 10.000 Arbeitern bei General Motors, von 70.000 Arbeitern bei Bell Atlantic, der Krankenhausangestellten in New York und mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und 40.000 Maschinenbauern in New York;
– in Großbritannien mit den inoffiziellen Streiks von Sozialarbeitern in Schottland, von Postangestellten in London und mit den beiden Streiks der Elektriker in London, welche einen entschlossenen Willen offenbarten, gegen die Opposition der Gewerkschaftsführung zu kämpfen;
– im Sommer in Griechenland, wo Kämpfe rund um den Erziehungssektor in Auseinandersetzungen mit der Polizei mündeten;
– in Norwegen, wo im Herbst ein Streik stattfand, der in seinem Umfang mit jenem in Dänemark vergleichbar war;
– in Frankreich, wo es eine ganze Reihe von Kämpfen in verschiedenen Bereichen gab, einschließlich Erziehung, Gesundheit, Post und Transport, wobei am bemerkenswertesten der Streik von Busfahrern im herbstlichen Paris war, als die Arbeiter gegen eine der Konsequenzen des Zerfalls – die steigende Zahl von Angriffen auf Transportarbeiter – auf eigenem Terrain reagierten, indem sie mehr Jobs statt mehr Polizei forderten;
– in Belgien, wo die langsame, aber unaufhaltsame Steigerung der Kampfbereitschaft, ausgedrückt durch Streiks in der Automobilindustrie, im Transportwesen und in der Kommunikationsindustrie, von einer riesigen Kampagne der Bourgeoisie rund um das Thema „kämpferische Gewerkschaften“ eingehüllt wurde. Diese Kampagne hat mit der Förderung einer „Bewegung für die gewerkschaftliche Erneuerung“, die eine sehr radikale, „einheitliche“ Sprache benutzte und deren Führer, D'Orazio, den Nimbus der Radikalität erhalten hat, weil er wegen „Gewalttätigkeit“ vor Gericht gestellt worden war, eine ausgesprochen deutliche Gestalt angenommen;
– in der Dritten Welt mit Streiks in Südkorea, mit dem Rumoren massiver gesellschaftlicher Unzufriedenheit in China und erst kürzlich in Simbabwe, wo ein Generalstreik ausgerufen wurde, um die Wut der Arbeiter nicht nur über die Regierung, sondern auch über die Opfer, die der Krieg in der Demokratischen Republik Kongo erfordert hatte, zu kanalisieren; dieser Streik fiel mit Desertionen und Protesten in den Truppen zusammen.
Es könnten noch weitere Beispiele gegeben werden, obgleich es schwierig ist, Informationen zu erhalten, da – im Gegensatz zu den großen, in der Öffentlichkeit breit getretenen Manövern von 1995/96 – die Bourgeoisie auf die meisten dieser Bewegungen mit der Taktik des Verschweigens geantwortet hat, was ein zusätzlicher Beweis dafür ist, dass diese Bewegungen eine reelle und wachsende Kampfbereitschaft ausdrückten, die die Bourgeoisie natürlich nicht ermutigen wollte.
Die Antwort der Bourgeoisie und die Perspektiven für den Klassenkampf
Angesichts der wachsenden Kampfbereitschaft wird die Bourgeoisie nicht untätig bleiben. Sie hat bereits eine ganze Reihe von Kampagnen lanciert oder intensiviert, sowohl auf dem direkten Kampfterrain als auch im allgemeineren politischen Spektrum, um die Militanz der Klasse zu untergraben und die Entwicklung ihres Bewusstseins zu behindern: eine Wiederbelebung der „kämpferischen“ Gewerkschaften (z.B. in Belgien, in Griechenland, im britischen Elektrikerstreik); das propagandistische Sperrfeuer der „Demokratie“ (Sieg der linken Regierungen, Pinochet-Affäre, etc.); Mystifikationen der Krise („Globalisierungskritik“, der Ruf nach einem „dritten Weg“, welcher den Staat benutzen möchte, um die zügellose „Marktwirtschaft“ zu kontrollieren); Fortsetzung der Verleumdungen gegen den Oktober 1917, gegen den Bolschewismus und die Linkskommunisten und so weiter.
Zusätzlich zu diesen Kampagnen wird das Kapital einen maximalen Nutzen aus all den Manifestationen des gesellschaftlichen Zerfalls ziehen, um all die Probleme, denen die Arbeiterklasse gegenübersteht, weiter zu erschweren. Es ist noch ein weiter Weg zurückzulegen von der Art von Bewegung, wie wir sie in Dänemark gesehen haben, bis zur Entwicklung massiver Klassenkonfrontationen in den Hauptländern des Kapitals, Konfrontationen, die die Perspektive der Revolution aller Ausgebeuteten und Unterdrückten dieser Welt wieder eröffnen werden.
Nichtsdestotrotz hat die Entwicklung der Kämpfe in der gegenwärtigen Periode gezeigt, dass trotz aller Schwierigkeiten, denen sie sich gegenübersah, die Arbeiterklasse immer noch ungeschlagen ist und ein riesiges Kampfpotenzial gegen das hinfällige System bewahrt hat. In der Tat gibt es etliche wichtige Faktoren, die dazu dienen können, die aktuelle Klassenbewegung zu radikalisieren und sie auf eine höhere Ebene zu heben:
– die immer offenere Entwicklung der Weltwirtschaftskrise. Trotz aller bürgerlicher Versuche, ihr Ausmaß zu minimalisieren und ihre Ursachen zu verzerren, bleibt die Krise insofern der „Verbündete des Proletariats“, als dass sie dahin tendiert, die wahren Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise bloßzulegen. Während des letzten Jahres haben wir bereits eine große Vertiefung der Wirtschaftskrise gesehen, und wir wissen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt. Vor allem die großen kapitalistischen Zentren beginnen jetzt, die Auswirkungen des letzten Sturzes am eigenen Leib zu verspüren.
– Die Beschleunigung der Krise bedeutet auch die Beschleunigung der bürgerlichen Angriffe auf die Arbeiterklasse. Und sie bedeutet ebenfalls, dass die Bourgeoisie sich immer weniger in der Position befindet, wo sie diese Angriffe staffeln, strecken, auf einzelne Bereiche richten kann. Die gesamte Arbeiterklasse wird immer mehr unter die Knute geraten, und alle Aspekte ihres Lebensstandards werden bedroht werden. So wird die Notwendigkeit massiver Angriffe durch die Bourgeoisie in wachsendem Maße die Notwendigkeit einer massiven Antwort durch die Arbeiterklasse unumgänglich machen.
– Gleichzeitig werden die wichtigsten kapitalistischen Zentren auch dazu gezwungen sein, sich immer mehr in militärischen Abenteuern zu engagieren. Die Gesellschaft wird in wachsendem Maße von einer Atmosphäre des Krieges durchdrungen werden. Wir haben bemerkt, dass unter gewissen Umständen (wie unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Ostblocks) die Entwicklung des Militarismus das Gefühl der Machtlosigkeit im Proletariat steigern kann. Gleichzeitig bemerkten wir selbst während des Golfkrieges, dass solche Ereignisse durchaus auch einen positiven Effekt auf das Klassenbewusstsein ausüben können, besonders in einer politisierteren und militanteren Minderheit. Und es trifft weiterhin zu, dass die Bourgeoisie nicht in der Lage ist, das Proletariat en masse für seine militärischen Abenteuer zu mobilisieren. Einer der Faktoren, die die breite „Opposition“ in der herrschenden Klasse gegen die jüngsten Überfälle auf den Irak erklären, bestand in dem Problem, der Bevölkerung im allgemeinen und der Arbeiterklasse im besonderen diese Kriegspolitik zu verkaufen. Diese Schwierigkeiten der herrschenden Klasse werden noch weiter wachsen, so wie sie gezwungen sein wird, immer offener ihre (militärischen) Zähne zu zeigen.
Das Kommunistische Manifest beschreibt den Klassenkampf als einen „mehr oder minder versteckten Bürgerkrieg“. Bei allen Versuchen, die Illusion einer gesellschaftlichen Ordnung zu schaffen, in der Klassenkonflikte der Vergangenheit angehören, ist die Bourgeoisie nichtsdestotrotz dazu gezwungen, die eigentlichen Bedingungen, die die Gesellschaft in zwei Lager polarisieren und durch unversöhnliche Antagonismen spalten, noch weiter zu verschärfen. Je mehr die bürgerliche Gesellschaft in Agonie versinkt, desto mehr werden die Schleier, die diesen „Bürgerkrieg“ verhüllen, weggerissen. Angesichts immer weiter wachsender ökonomischer, sozialer und militärischer Widersprüche ist die Bourgeoisie dazu gezwungen, ihren totalitären politischen Griff auf die Gesellschaft zu verstärken, jede Herausforderung ihrer Ordnung für außergesetzlich zu erklären, immer mehr Opfer für immer weniger Belohnung zu fordern. Mit der Geburt des Kapitalismus, als das Manifest verfasst worden war, neigte der Arbeiterkampf mehr als einmal zu einem Kampf einer „außergesetzlichen Klasse“, einer Klasse, die nichts in dem herrschenden System zu verlieren hatte und deren Rebellionen und Proteste samt und sonders per Gesetz verboten waren. Hier liegt die Bedeutung dreier fundamentaler Aspekte im heutigen Klassenkampf:
– der Kampf zur Schaffung eines Kräfteverhältnisses zugunsten der Arbeiter: dies ist der Schlüssel, der die Arbeiterklasse in die Lage versetzt, sich gegen alle korporatistischen Spaltungen, die von der bürgerlichen Ideologie im allgemeinen und von den Gewerkschaften im besonderen erzwungen wurden, und gegen die Atomisierung, die sich durch den kapitalistischen Zerfall verschlimmert, wieder ihrer Klassenidentität zu besinnen. Es ist insbesondere ein praktischer Schlüssel, weil er sich in jedem Kampf als zwingende Notwendigkeit aufdrängt: Die Arbeiter können sich nur selbst verteidigen, wenn sie die Front ihres Kampfes so weit wie möglich verbreitern.
– der Kampf, um aus dem gewerkschaftlichen Gefängnis auszubrechen: es sind die Gewerkschaften, die überall die kapitalistische „Legalität“ und die korporatistischen Spaltungen im Kampf verstärken, die danach trachten, die Arbeiter an der Schaffung eines Kräfteverhältnisses zu ihren Gunsten zu hindern. Die Fähigkeit der Arbeiter, den Gewerkschaften entgegenzutreten und ihre eigenen Organisationsformen zu entwickeln, werden somit ein Meilenstein bei der wirklichen Reifung des Kampfes in der vor uns liegenden Periode sein, gleichgültig, wie ungleichmäßig und schwierig dieser Prozess sein mag.
– die Konfrontation mit den Gewerkschaften bedeutet gleichzeitig die Konfrontation mit dem kapitalistischen Staat, und die Konfrontation mit dem kapitalistischen Staat ist
– unter der Teilnahme der fortgeschritteneren Minderheit – der Katalysator bei der Politisierung des Klassenkampfes. In vielerlei Hinsicht ist es die Bourgeoisie, welche die Initiative ergreift, um aus „jedem Klassenkampf einen politischen Kampf“ (Kommunistisches Manifest) zu machen, weil sie letztendlich den Klassenkampf nicht in ihr System integrieren kann. Die herrschende Klasse hat die „konfrontative“ Herangehensweise gewählt und wird auch in Zukunft nicht davon abweichen. Doch die Arbeiterklasse darf nicht nur auf dem Gebiet der unmittelbaren Selbstverteidigung reagieren, sondern muss vor allem mit der Entwicklung einer allgemeingültigen Perspektive ihres Kampfes antworten, indem sie jeden Teilkampf in den breiteren Zusammenhang des Kampfes gegen das gesamte System stellt. Für lange Zeit wird dieses Bewusstsein notwendigerweise auf eine Minderheit beschränkt bleiben. Aber diese Minderheit wird wachsen, und dieses Wachstum wird durch den steigenden Einfluss der revolutionären politischen Organisationen auf eine breitere Schicht von radikalisierten Arbeitern seinen Ausdruck finden. Fortan wird es für diese Organisationen überlebenswichtig, sehr aufmerksam der wirklichen Klassenbewegung zu folgen und in der Lage zu sein, so effektiv, wie es ihre Mittel erlauben, in ihr zu intervenieren.
Die Bourgeoisie mag uns die Lüge verkaufen, dass der Klassenkampf tot ist. Dabei ist sie schon längst dabei, den „unverhüllten Bürgerkrieg“ vorzubereiten, auf den die Zukunft dieser Ordnung unvermeidlich hinausläuft, sobald sie mit dem Rücken zur Wand steht. Die Arbeiterklasse und ihre revolutionären Minderheiten müssen ebenfalls vorbereitet sein.
28.12.1998
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Deutsche Revolution, Teil IX
- 2818 Aufrufe
Die März-Aktion 1921: Die Gefahr kleinbürgerlicher Ungeduld
Im vorigen Artikel zum Kapp-Putsch 1920 haben wir herausgestellt, dass die Arbeiterklasse nach den Niederlagen von 1919 wieder auf dem Vormarsch war. Aber weltweit war die revolutionäre Welle, auch wenn die Kampfkraft der Arbeiterklasse noch nicht erloschen war, doch absteigend.
Die Beendigung des Krieges hatte in vielen Ländern den revolutionären Elan gebrochen und es vor allem der Bourgeoisie ermöglicht, die Spaltung der Arbeiterklasse in Arbeiter der „Siegermächte“ und der besiegten Staaten auszunutzen. Zudem schaffte es das Kapital, die revolutionäre Bewegung in Russland immer weiter zu isolieren. Die Siege der Roten Armee über die Weißen Truppen, die von den westlichen bürgerlichen Demokratien mächtig unterstützt wurden, hinderte die herrschende Klasse nicht daran, ihre Konteroffensive international fortzusetzen.
In Russland selber forderten die Isolierung der Revolution und die wachsende Integration der Bolschewistischen Partei in den russischen Staat ihren Preis. Im März 1921 erhoben sich in Kronstadt revoltierende Arbeiter und Matrosen.
Auf diesem Hintergrund sollte in Deutschland die Arbeiterklasse noch immer eine stärkere Kampfbereitschaft zeigen als in den anderen Staaten. Überall standen die Revolutionäre vor der Frage: nachdem der Höhepunkt der internationalen Welle revolutionärer Kämpfe überschritten war und die Bourgeoisie weiter in der Offensive blieb, wie auf diese Situation reagieren?
Innerhalb der Komintern setzte sich eine politische Kehrtwende durch. Die auf dem 2. Kongress im Sommer 1920 verabschiedeten 21 Aufnahmebedingungen verdeutlichten dies klar. Hierin wurde die Arbeit in den Gewerkschaften wie die Beteiligung an den Parlamentswahlen bindend vorgeschrieben. Damit hatte die Komintern einen Rückschritt zu den alten Methoden aus der Zeit des aufsteigenden Kapitalismus gemacht, in der Hoffnung, dass man damit größere Kreise von Arbeitern erreichen würde.
Diese opportunistische Kehrtwende äußerte sich in Deutschland darin, dass die Kommunistische Partei im Januar 1921 einen „Offenen Brief“ an die Gewerkschaften und SPD wie auch an die Freie Arbeiterunion (Syndikalisten), USPD und KAPD richtete, in dem „sämtlichen sozialistischen Parteien und
Gewerkschaftsorganisationen vorgeschlagen (wurde), gemeinsame Aktionen zur Durchsetzung der dringendsten wirtschaftlichen und politischen Forderungen der Arbeiter zu führen“. Durch diesen Aufruf insbesondere an die Gewerkschaften und SPD sollte die „Einheitsfront der Arbeiter in den Betrieben“ hergestellt werden. Die VKPD betonte, „sie wollte zurückstellen die Erinnerung an die Blutschuld der mehrheitssozialdemokratischen Führer. Sie wollte für den Augenblick zurückstellen die Erinnerungen an die Dienste, die die Gewerkschaftsbürokratie den Kapitalisten im Krieg und in der Revolution geleistet hat.“ (aus „Offener Brief“, Rote Fahne, 8.1.1921). Während man mit opportunistischen Schmeicheleien Teile der Sozialdemokratie auf die Seite der Kommunisten ziehen wollte, wurde gleichzeitig in den Reihen der Partei zum ersten Mal die Notwendigkeit einer proletarischen Offensive theoretisiert. Und „sollten die Parteien und Gewerkschaften, an die wir uns wenden, nicht gewillt sein, den Kampf aufzunehmen, so würde die VKPD sich verpflichtet erachten, diesen Kampf allein zu führen, und sie ist überzeugt, dass ihr die Arbeitermassen folgen werden“. (ebenda).
Gleichzeitig hatte der im Dezember 1920 vollzogene Zusammenschluss zwischen KPD und USPD, der zur Gründung der VKPD führte, in der Partei die Auffassungen einer Massenpartei erstarken lassen. Dies wurde dadurch verstärkt, dass die Partei jetzt über 500000 Mitglieder verfügte. So ließ sich die VKPD selbst blenden durch den Stimmenanteil bei den Wahlen zum Preußischen Landtag, wo sie im Februar nahezu 30% aller Stimmen erzielte.[i] [3]
Die Idee machte sich breit, man könne die Lage in Deutschland „aufheizen“. Vielen schwebte die Idee eines Rechtsputsches vor, der wie ein Jahr zuvor im Kapp-Putsch eine mächtige Reaktion der gesamten Arbeiterklasse mit Aussichten auf die Machtergreifung auslösen würde. Diese irrigen Auffassungen sind im wesentlichen auf den verstärkten Einfluss des Kleinbürgertums in der Partei seit dem Zusammenschluss zwischen KPD und USPD zurückzuführen. Die USPD war wie jede zentristische Richtung in der Arbeiterbewegung stark von den Auffassungen und Verhaltensweisen des Kleinbürgertums beeinflusst. Das zahlenmäßige Wachstum der Partei neigte zugleich dazu, das Gewicht des Opportunismus, Immediatismus und der kleinbürgerlichen Ungeduld zu vergrößern.
Auf diesem Hintergrund – Rückgang der revolutionären Welle international, tiefgreifende Verwirrung innerhalb der revolutionären Bewegung in Deutschland – leitete die Bourgeoisie im März 1921 eine neue Offensive gegen das Proletariat ein. Hauptzielscheibe ihres Angriffs sollten die Arbeiter in Mitteldeutschland sein. Im Krieg war dort im Industriegebiet um Leuna, Bitterfeld und das Mansfelder Becken eine große Konzentration von Proletariern entstanden, die überwiegend relativ jung und kämpferisch waren, aber über keine große Organisationserfahrung verfügten. So zählte die VKPD dort allein über 66000 Mitglieder, die KAPD brachte es auf 3200 Mitglieder. In den Leuna-Werken gehörten von 20000 Beschäftigten ca. 2000 den Arbeiterunionen an.
Da nach den Auseinandersetzungen von 1919 und nach dem Kapp-Putsch viele Arbeiter bewaffnet geblieben waren, wollte die Bourgeoisie den Arbeitern weiter an den Kragen.
Die Bourgeoisie versucht die Arbeiter zu provozieren
Am 19. März 1921 zogen starke Polizeitruppen in Mansfeld ein, um die Arbeiter zu entwaffnen.
Der Befehl ging nicht vom „rechten“ Flügel der Herrschenden (innerhalb der Militärs oder der rechten Parteien) aus, sondern von der demokratisch gewählten Regierung. Es war die bürgerliche Demokratie, die die Henkersrolle der Arbeiterklasse spielte und darauf abzielte, diese mit allen Mitteln zu Boden zu werfen.
Es ging der Bourgeoisie darum, durch die Entwaffnung und Niederlage eines sehr kämpferischen, relativ jungen Teils des deutschen Proletariats die Arbeiterklasse insgesamt zu schwächen und zu demoralisieren. Vor allem aber verfolgte die Bourgeoisie das Ziel, der Vorhut der Arbeiterklasse, den revolutionären Organisationen einen fürchterlichen Schlag zu versetzen. Das Aufzwingen eines vorzeitigen Entscheidungskampfes in Mitteldeutschland sollte dem Staat vor allem die Gelegenheit geben, die Kommunisten gegenüber der gesamten Klasse zu isolieren, um diese Parteien dann in Verruf zu bringen und der Repression auszusetzen. Es ging darum, der frisch gegründeten VKPD die Möglichkeit zu rauben, sich zu konsolidieren, sowie die sich anbahnende Annäherung zwischen KAPD und VKPD zunichte zu machen. Schließlich wollte das deutsche Kapital stellvertretend für die Weltbourgeoisie die Russische Revolution und die Kommunistische Internationale weltweit weiter isolieren.
Die Komintern hatte gleichzeitig jedoch verzweifelt nach Möglichkeiten einer Hilfe von Außen für die Revolution in Russland gesucht. Man hatte gewissermaßen auf die Offensive der Bourgeoisie gewartet, damit die Arbeiter weiter in Zugzwang gerieten und endlich losschlagen würden. Anschläge wie der gegen die Siegessäule in Berlin am 13. März, der von der KAPD initiiert wurde, hatten dazu dienen sollen, die Kampfbereitschaft weiter anzustacheln.
Levi berichtete von einer Sitzung der Zentrale, wo der Moskauer Gesandte Rakosi meinte: „Russland befinde sich in einer außerordentlich schwierigen Situation. Es sei unbedingt erforderlich, dass Russland durch Bewegungen im Westen entlastet würde, und aus diesem Grunde müsse die deutsche Partei sofort in Aktion treten. Die VKPD zähle jetzt 500000 Mitglieder, mit diesen könne man 1500000 Proletarier auf die Beine bringen, was genügt, um die Regierung zu stürzen. Er sei also für sofortigen Beginn des Kampfes mit der Parole: Sturz der Regierung“. (P. Levi, „Brief an Lenin“, 27.03.1921)
„Am 17. März fand die Zentralausschusssitzung der KPD statt, in der die Anregungen oder Weisungen des aus Moskau gesandten Genossen zur Richtlinie gemacht wurden.
Am 18. März stellte sich die Rote Fahne auf diesen neuen Beschluss um und forderte zum bewaffneten Kampf auf, ohne zunächst zu sagen, für welche Ziele, und hielt diesen Ton einige Tage fest.“ (Levi, ebenda)
Die erwartete Offensive der Regierung im März 1921 war mit dem Vorrücken der Polizeitruppen nach Mitteldeutschland eingetreten.
Die Revolution forcieren?
Die vom sozialdemokratischen Polizeiminister Hörsing am 19. März nach Mitteldeutschland beorderten Polizeikräfte sollten Hausdurchsuchungen vornehmen und die Arbeiter um jeden Preis entwaffnen. Die Erfahrung aus dem Kapp-Putsch vor Augen, hatte die Regierung davor zurückgeschreckt, Soldaten der Reichswehr einzusetzen.
In derselben Nacht wurde vor Ort der Entschluss zum Generalstreik ab dem 21. März gefasst. Am 23. März kam es zu ersten Kämpfen zwischen Truppen der Sicherheits-Polizei und Arbeitern. Am gleichen Tag erklärten die Arbeiter der Leuna-Werke bei Merseburg den Generalstreik. Am 24. März riefen die VKPD und KAPD gemeinsam zum Generalstreik in ganz Deutschland auf. Nach diesem Aufruf kam es sporadisch in mehren Städten des Reichs zu Demonstrationen und Schießereien zwischen Streikenden und Polizei. Etwa 300000 Arbeiter beteiligten sich landesweit an den Streiks.
Der Hauptkampfplatz blieb jedoch das mitteldeutsche Industriegebiet, wo sich ca. 40000 Arbeiter und 17000 Mann Polizei- und Reichswehrtruppen gegenüberstanden. In den Leuna-Werken waren insgesamt 17 bewaffnete proletarische Hundertschaften aufgestellt worden. Die Polizeitruppen setzten alles daran, die Leuna-Werke zu stürmen. Erst nach mehreren Tagen gelang es ihnen, die Fabrik zu erobern. Dazu schickte die Regierung kurzerhand Flugzeuge und bombardierte die Leuna-Werke. Gegen die Arbeiterklasse waren ihr alle Mittel recht.
Auf Initiative der KAPD und VKPD wurden Dynamit-Attentate in Dresden, Freiberg, Leipzig, Plauen und anderswo verübt. Die besonders hetzerisch gegen die Arbeiter vorgehende Hallische – und Saale-Zeitung sollten am 26. März mit Sprengstoff zum Schweigen gebracht werden.
Während die Repression in Mitteldeutschland spontan die Arbeiter zu bewaffnetem Widerstand trieb, gelang es diesen jedoch wiederum nicht, den Häschern der Regierung einen koordinierten Widerstand entgegenzusetzen. Die von der VKPD aufgestellten Kampforganisationen, die von Hugo Eberlein geleitet wurden, waren militärisch und organisatorisch völlig unzureichend vorbereitet. Max Hoelz, der eine ca. 2500 starke Arbeiter-Kampftruppe aufgestellt und es geschafft hatte, bis einige Kilometer vor die von Regierungstruppen belagerten Leuna-Werke zu gelangen, versuchte vor Ort eine Zentralisierung aufzubauen. Aber seine Truppen wurden ebenso am 1. April aufgerieben, nachdem die Leuna-Werke zwei Tage zuvor schon erstürmt worden waren.
Obwohl in anderen Städten die Kampfbereitschaft nicht im Ansteigen begriffen war, hatten VKPD und KAPD zu einem sofortigen militärischen Zurückschlagen gegen die eingerückten Polizeikräfte aufgerufen.
„Die Arbeiterschaft wird aufgefordert, den aktiven Kampf aufzunehmen mit folgenden Zielen:
1. Sturz der Regierung...
2. Entwaffnung der Konterrevolution und Bewaffnung der Arbeiter“
(Aufruf vom 17. März).
In einem weiteren Aufruf der Zentrale der VKPD schrieb sie am 24. März:
„Denkt daran, dass ihr im Vorjahr in fünf Tagen mit Generalstreik und bewaffnetem Aufstand die Weißgardisten und Baltikumstrolche besiegt habt. Kämpft mit uns wie im Vorjahr Schulter an Schulter die Gegenrevolution nieder!
Tretet überall in den Generalstreik! Brecht mit Gewalt die Gewalt der Konterrevolution, Entwaffnung der Konterrevolution, Bewaffnung, Bildung von Ortswehren aus den Kreisen der organisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten!
Bildet sofort proletarische Ortswehren! Sichert Euch die Macht in den Betrieben! Organisiert die Produktion durch Betriebsräte und Gewerkschaften! Schafft Arbeit für die Arbeitslosen!“
Vor Ort jedoch waren die Kampforganisationen der VKPD und die spontan bewaffneten Arbeiter nicht nur schlecht organisatorisch und militärisch gerüstet; die örtlichen Parteileitungen selber hatten keinen Kontakt zu ihren Parteizentralen. Verschiedene Truppenverbände (die von Max Hoelz und Karl Plättner waren die bekanntesten) kämpften an mehreren Orten im Aufstandsgebiet unabhängig voneinander. Nirgendwo gab es Arbeiterräte, die ihre Aktionen hätten koordinieren können. Dagegen standen die Repressionstruppen der Bürgerlichen natürlich im engsten Kontakt mit ihrem Generalstab und koordinierten ihre Taktik!
Nachdem die Leuna-Werke gefallen waren, zog die VKPD am 31. März 1921 den Aufruf zum Generalstreik zurück. Am 1. April lösten sich die letzten bewaffneten Arbeitertruppen in Mitteldeutschland auf.
Wieder herrschten Ruhe und Ordnung! Wieder schlug die Repression zu. Wieder wurden viele Arbeiter ermordet und misshandelt. Hunderte waren erschossen worden, über 6000 wurden verhaftet.
Die Hoffnung großer Teile der VKPD und KAPD, ein provokatives Vorgehen des staatlichen Repressionsapparates würde eine Spirale des Widerstandes in den Reihen der Arbeiter auslösen, war enttäuscht worden. Die Arbeiter in Mitteldeutschland waren relativ isoliert geblieben.
In dieser Situation hatten die VKPD und die KAPD derart auf ein Losschlagen gebrannt, ohne die Gesamtlage im Auge zu behalten, dass sie sich durch die Devise „Wer nicht für uns ist, der ist wider uns“ (Editorial der Roten Fahne, 20. März), von den unentschlossenen und nicht-kampfbereiten Arbeitern völlig isolierten und einen Graben der Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse aushoben.
Anstatt zu erkennen, dass die Lage nicht günstig war, schrieb die Rote Fahne am 30. März: „Nicht nur auf das Haupt eurer Führer, auf das Haupt jedes einzelnen von euch kommt die Blutschuld, wenn ihr stillschweigend oder auch nur unter lahmen Protesten duldet, dass die Ebert, Severing, Hörsing den weißen Schrecken und die weiße Justiz gegen die Arbeiter loslassen (...)
Schmach und Schande über den Arbeiter, der jetzt noch beiseite steht, Schmach und Schaden über den Arbeiter, der jetzt noch nicht weiß, wo sein Platz ist.“
Um die Kampfbereitschaft weiter anzustacheln, hatte man die Arbeitslosen als Speerspitze einsetzen wollen.
„Die Arbeitslosen wurden als Sturmkolonnen vorangeschickt. Sie besetzten die Tore der Fabriken. Sie drangen in die Betriebe ein, löschten hier und da die Feuer und versuchten, die Arbeiter aus den Betrieben herauszuprügeln... Es war ein entsetzlicher Anblick, wie die Arbeitslosen, laut weinend über die Prügel, die sie empfangen, aus den Betrieben hinausgeworfen wurden, und wie sie denen fluchten, die sie dahin gesandt.“
Dass die VKPD-Zentrale vor dem Beginn der Kämpfe das Kräfteverhältnis falsch eingeschätzt hatte und nach Auslösung der Kämpfe ihre Einschätzung nicht revidierte, war schon tragisch genug. Es kam noch schlimmer, denn statt dessen verbreitete sie die Parole: „Leben oder Tod“. Nach dem falschen Motto: „Kommunisten weichen nie zurück“!
„Unter keinen Umständen darf ein Kommunist, auch wenn er in Minderheit ist, zur Arbeit schreiten. Die Kommunisten gingen hinaus aus den Betrieben. In Trupps von 200, 300 Mann, oft mehr, oft weniger, gingen sie aus den Betrieben: der Betrieb ging weiter. Sie sind heute arbeitslos, die Unternehmer haben die Gelegenheit benutzt, die Betriebe ‘kommunistenrein’ zu machen in einem Falle, in dem sie selbst ein groß Teil der Arbeiter auf ihrer Seite hatten.“ (Die Rote Fahne)
Welche Bilanz aus den März-Kämpfen?
Während dieser Kampf der Arbeiterklasse von der Bourgeoisie aufgezwungen wurde und sie ihm nicht ausweichen konnte, hatte die VKPD den Fehler begangen, dass sie „den defensiven Charakter des Kampfes nicht klar genug hervorhob, sondern durch den Ruf von der Offensive den gewissenlosen Feinden des Proletariats, der Bourgeoisie, der SPD und der USPD Anlass gab, die VKPD als Anzettlerin von Putschen dem Proletariat zu denunzieren. Dieser Fehler wurde von einer Anzahl von Parteigenossen gesteigert, indem sie die Offensive als die hauptsächlichste Methode des Kampfes der VKPD in der jetzigen Situation darstellten“ („Thesen und Resolutionen des 3. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale“, S. 52/53, Juni 1921).
Dass die Kommunisten weiter für eine Verstärkung der Kampfbereitschaft eintraten, war ihre erste Pflicht. Aber Kommunisten sind nicht einfach Aufpeitscher der Kampfbereitschaft. Die „Kommunisten sind (...) praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegungen voraus.“ (Kommunistisches Manifest) Deshalb müssen sie sich gegenüber der Klasse insgesamt durch ihre Fähigkeit auszeichnen, das Kräfteverhältnis richtig einzuschätzen, die Strategie des Klassengegners zu durchschauen, denn eine für entscheidende Kämpfe noch zu schwache Arbeiterklasse in eine sichere Niederlage zu führen, oder sie in die von der Bourgeoisie gestellten Fallen zu treiben, ist das Unverantwortlichste, was Revolutionäre tun können. Insbesondere erfordert dies vor allem auch die Fähigkeit zu entwickeln, den jeweiligen Bewusstseinsstand und die Kampfbereitschaft innerhalb der Arbeiterklasse einschätzen zu können, und die Vorgehensweise der Herrschenden zu durchschauen. Nur so können revolutionäre Organisationen ihre wirkliche Führungsrolle in der Klasse übernehmen.
Sofort nach dem Ende der März-Aktion kam es zu heftigen Debatten innerhalb der VKPD und der KAPD.
Falsche Organisationsauffassungen — eine Fessel für die Fähigkeit der Partei zur Selbstkritik
In einem Leitartikel vom 4.–6. April verkündete die Rote Fahne, dass die „VKPD eine revolutionäre Offensive eingeleitet“ habe und die März-Aktion „der Beginn, der erste Abschnitt der entscheidenden Kämpfe um die Macht“ sei.
Am 7./8. April tagte der Zentralausschuss der VKPD. Anstatt eine kritische Einschätzung der Intervention zu liefern, versuchte Heinrich Brandler vor allem die Politik der VKPD-Zentrale zu rechtfertigen. Er begründete die Hauptschwäche in einer mangelnden Disziplin der VKPD-Mitglieder vor Ort und im Versagen der sogenannten Militärorganisation. Brandler meinte gar, „Wir haben keine Niederlage erlitten, wir hatten eine Offensive“.
Gegenüber dieser Einschätzung sollte Paul Levi innerhalb der VKPD zum heftigsten Kritiker der Vorgehensweise der Partei in der März-Aktion werden.
Nachdem er neben Clara Zetkin im Februar 1921 schon aus dem Zentralausschuss ausgeschieden war, weil es unter anderem zu Divergenzen um die Gründung der KP in Italien gekommen war, sollte er sich erneut als unfähig erweisen, die Organisation durch Kritik nach vorne zu treiben. Das Tragische war, dass er „mit seiner Kritik an der März-Aktion 1921 in Deutschland in vielem dem Wesen der Sache nach recht“ hatte (Lenin, „Brief an die deutschen Kommunisten“, Werke Bd. 32, S. 541). Aber anstatt seine Kritik innerhalb des Rahmens der Organisation den Regeln und Prinzipien derselben folgend vorzubringen, verfasste er am 3./4. April eine Broschüre, die am 12. April veröffentlicht wurde, ohne dass die Partei ihren Inhalt kannte.[ii] [3]
In dieser Broschüre brach er nicht nur die Organisationsdisziplin, sondern er veröffentliche Details aus dem internen Leben der Partei. Somit brach er ein proletarisches Prinzip, gefährdete gar die Organisation, indem er in aller Öffentlichkeit die Funktionsweise der Organisation preisgab. Dafür wurde er am 15. April aus der Partei wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen.[iii] [3]
Levi, der wie wir in einem früheren Artikel zum Oktoberparteitag der KPD 1919 festgestellt haben, dazu neigte, jede Kritik als Angriff auf die Organisation, als Infragestellung einer ganzen Linie und somit als Bedrohung der Organisation, aber auch seiner Person aufzufassen, sabotierte jeden Versuch einer kollektiven Funktionsweise. Seine Einstellung offenbart dies: „Ist die März-Aktion richtig, dann gehöre ich hinausgeworfen (aus der Partei). Oder ist die März-Aktion ein Fehler, dann ist meine Broschüre gerechtfertigt“ (Levi, „Brief an die Zentrale der VKPD“). Diese organisationsschädigende Haltung war von Lenin wiederholt kritisiert worden. Nach Bekanntwerden seines Austritts aus der Zentrale der VKPD im Februar schrieb Lenin dazu: „Aber Austritt aus der Zentrale!!?? Das jedenfalls der größte Fehler! Wenn wir solche Gepflogenheiten dulden werden, dass verantwortliche Mitglieder der Zentrale austreten, wenn sie in der Minderheit geblieben sind, dann wird die Entwicklung und Gesundung der kommunistischen Parteien niemals glatt gehen. Statt auszutreten – die strittige Frage mehrere Male besser mit der Exekutive ventilieren (...). Alles mögliche und etwas unmögliches dazu zu tun – aber, es koste was es wolle, Austritt vermeiden und Gegensätze nicht verschärfen.“ (Lenin an Clara Zetkin und Paul Levi, 16.4.1921).
Levis zum Teil maßlose und überspitzte Beschuldigungen (dass er die Verantwortung der Bourgeoisie für die Kämpfe im März in den Hintergrund geraten ließ und der VKPD praktisch die Alleinschuld aufbürdete) verzerrten die Wirklichkeit.
Nachdem er aus der Partei ausgeschlossen war, gab er eine kurze Zeit die Zeitschrift Sowjet heraus, die zum Sprachrohr der Gegner dieses Kurses der VKPD wurden. Levi wollte seine Kritik an der Taktik der VKPD dem Zentralausschuss vortragen, wurde aber zur Tagung nicht mehr zugelassen. Statt dessen trug Clara Zetkin eine Reihe seiner Kritiken vor. „Die Kommunisten haben nicht die Möglichkeit (...) die Aktion an Stelle des Proletariats, ohne das Proletariat, am Ende gar gegen das Proletariat zu machen“ (Levi). Zetkin schlug eine Gegenresolution zur Stellungnahme der Partei vor. Mehrheitlich verwarf die Sitzung des Zentralausschusses jedoch die Kritik und hob hervor, dass ein „Ausweichen vor der Aktion (...) unmöglich für eine revolutionäre Partei, (...) ein glatter Verzicht auf ihren Beruf, die Revolution zu führen“ gewesen wäre. Die VKPD „muss, wenn sie ihre geschichtliche Aufgabe erfüllen will, festhalten an der Linie der revolutionären Offensive, die der März-Aktion zugrunde liegt, und sie muss entschlossen und sicher auf diesem Wege fortschreiten“ („Leitsätze über die März-Aktion“, Die Internationale Nr. 4, April 1921).
Die Zentrale bestand auf der Fortsetzung der eingeschlagenen Offensivtaktik und verwarf alle Kritiken. In einem vom 6. April 1921 gezeichneten Aufruf hatte das EKKI (Erweitertes Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationalen) noch die Haltung der VKPD gebilligt und aufgerufen, „Ihr habt richtig gehandelt (...) Rüstet zu weiteren Kämpfen“ (Rote Fahne, 14.4.1921).
So war auf dem 3. Weltkongress der Komintern weder das EKKI noch der Kongress selber einig über die Einschätzung der deutschen Ereignisse. Vor allem die Gruppe um Clara Zetkin in der KPD wurde in dem ersten Teil der Diskussion erbittert angegriffen. Erst das Eingreifen und die Autorität Lenins und Trotzkis in der Debatte brachte die Wende in der Auseinandersetzung, indem die Hitzköpfe zur Abkühlung gebracht wurden.
Lenin, der sowohl durch die Ereignisse in Kronstadt wie auch durch die Staatsführung so beschäftigt war, dass er die Ereignisse und die Debatten um die Bilanz nicht hatte näher verfolgen können, fing an, sich eingehend mit der Bilanz der März-Aktion zu befassen. Während er den Disziplinbruch Levis auf das schärfste verwarf, trat er dafür ein, dass die März-Aktion wegen ihrer „großen internationalen Bedeutung dem 3. Weltkongress der Komintern unterbreitet werden solle“. Breitestmögliche, ungehinderte Diskussion innerhalb der Partei, hieß seine Devise.
W. Koenen, der Vertreter der VKPD beim EKKI, wurde im April vom EKKI mit dem Auftrag nach Deutschland geschickt, dass der Zentralausschuss keine endgültigen Beschlüsse gegen die Opposition fassen sollte. In der Parteipresse kamen dann auch wieder die Kritiker der März-Aktion zu Wort. Die Diskussion über die Taktik wurde fortgesetzt.
Dennoch vertrat die Mehrheit der Zentrale weiterhin ihre im März eingenommene Haltung. Arkady Maslow verlangte die neuerliche Billigung der März-Aktion. Guralski, ein Gesandter des EKKI forderte gar: „keine Beschäftigung mit der Vergangenheit. Die beste Antwort auf Angriffe der Richtung Levi sind die weiteren politischen Kämpfe der Partei“. Auf der Sitzung des Zentralausschusses vom 3.-5. Mai trat Thalheimer dafür ein, die Aktionseinheit der Arbeiter wieder aufzunehmen. Fritz Heckert plädierte für verstärkte Arbeit in den Gewerkschaften.
Am 13. Mai veröffentlichte die Rote Fahne Leitsätze, die auf eine künstliche Beschleunigung der revolutionären Entwicklung abzielten. Als Beispiel wurde dafür die März-Aktion hingestellt. Die Kommunisten „müssen in zugespitzten Situationen, wo wichtige Interessen des Proletariats bedroht sind, den Massen einen Schritt vorausgehen und versuchen, sie durch ihre Initiative in den Kampf zu führen, auch auf die Gefahr hin, nur Teile der Arbeiterschaft mit sich zu reißen“. Wilhelm Pieck, der sich in der Januar-Woche 1919 schon mit Karl Liebknecht entgegen den Parteibeschluss am Aufstand beteiligt hatte, meinte: Auseinandersetzungen unter den Arbeitern „werden wir noch häufiger erleben. Die Kommunisten müssen sich gegen die Arbeiter wenden, wenn diese nicht unseren Aufrufen folgen“.
Die Reaktion der KAPD
Während VKPD und KAPD einen Schritt vorwärts gemacht hatten und zum ersten Mal gemeinsam losschlagen wollten, lag das Drama darin, dass diese Aktionen selbst unter ungünstigen Bedingungen stattgefunden hatten. Auch war der gemeinsame Nenner der VKPD und KAPD bei der März-Aktion gewesen, der Arbeiterklasse in Russland zu Hilfe zu eilen. Im Gegensatz zu den späteren Rätekommunisten verteidigte die KAPD damals noch die Revolution in Russland.
Gegenüber der Bilanz der März-Aktion waren die Haltung und Intervention der KAPD jedoch widersprüchlich. Einerseits rief sie gemeinsam mit der VKPD zum Generalstreik auf, schickte F. Jung und F. Rasch als Vertreter der Zentrale nach Mitteldeutschland zur Unterstützung der Koordinierung der Kampfhandlungen. Andererseits hielten die örtlichen Führer der KAPD, Utzelman und Prenzlow, aufgrund ihrer Kenntnis der Lage im mitteldeutschen Industriegebiet einen Aufstandsversuch für unsinnig und wollten nicht über den Generalstreik hinausgehen. Deshalb waren sie gegenüber den Leuna-Arbeitern dafür eingetreten, im Werksbereich zu verbleiben und sich auf einen Defensivkampf einzustellen. Die KAPD-Leitung reagierte ohne Abstimmung mit der Partei vor Ort.
Im Anschluss an die Bewegung lieferte die KAPD Ansätze zu einer kritischen Einschätzung ihrer eigenen Intervention. Sie reagierte sehr widersprüchlich. In einer Antwort auf die Broschüre Levis griff sie jedoch die grundsätzliche Problematik auf, die hinter der Vorgehensweise der VKPD-Zentrale stand. So schrieb Herman Gorter: „Die VKPD hatte durch die parlamentarische Aktion – die unter dem bankerotten Kapitalismus keine andere Bedeutung mehr hat, als die Irreführung der Massen – das Proletariat vom revolutionären Handeln abgelenkt. Sie hatte Hunderttausende von nichtkommunistischen Mitgliedern gesammelt, war also zu einer ‘Massenpartei’ geworden. Die VKPD hatte durch die Zellentaktik die Gewerkschaften unterstützt (...) als die deutsche Revolution immer machtloser zurückwich, als ihre besten Elemente dadurch unzufrieden, stets mehr auf die Aktion drängten – da beschloss sie auf einmal eine große Aktion zur Eroberung der politischen Gewalt. D.h. vor der Herausforderung Hörsings und der Sipo hat sie zu einer künstlichen Aktion von oben, ohne spontanen Drang großer Massen, d.h. zur Putschtaktik, den Beschluss gefasst.
Das Exekutiv-Komitee und seine Repräsentanten in Deutschland hatten schon lange darauf gedrängt, die VKPD solle losschlagen. Sie sollte sich als eine richtige revolutionäre Partei erweisen. Als ob in dem Losschlagen allein schon das Wesen einer revolutionären Taktik besteht! Wenn eine Partei, die statt die revolutionäre Kraft des Proletariats aufzubauen, Parlament und Gewerkschaften unterstützt und dadurch das Proletariat schwächt und seine revolutionäre Kraft unterminiert, dann (nach diesen Vorbereitungen!!) auf einmal losschlägt und eine große, angreifende Aktion beschließt, für dies selbe, von ihr selbst geschwächte Proletariat, so ist das im Grunde ein Putsch. Das heißt eine von oben beschlossene, nicht aus den Massen selbst hervorkommende, von vornherein zum Scheitern verdammte Tat. Und diese Putschtaktik ist nicht revolutionär, sondern genau so opportunistisch, wie der Parlamentarismus und die Zellentaktik selbst. Ja, diese Putschtaktik ist die notwendige Gegenseite des Parlamentarismus und der Zellentaktik, der Sammlung nichtkommunistischer Elemente, der Führer – statt Massen- oder besser Klassenpolitik. Diese schwache, innerlich faule Taktik muss notwendig zu Putschen führen.“ („Lehren der März-Aktion“, Nachschrift zum „Offenen Brief an den Genossen Lenin“ von Herman Gorter, in Der Proletarier, 5/1921)
Damit legte dieser KAPD-Text richtigerweise den Finger auf den Widerspruch zwischen der Taktik der Einheitsfront, die die Illusionen der Arbeiter über Gewerkschaften und Sozialdemokratie verstärkt hatte, und dem plötzlichen gleichzeitigen Aufruf zum Sturmangriff gegen den Staat. Gleichzeitig finden sich in diesem Text jedoch Widersprüche, denn während die KAPD einerseits von einer Verteidigungshandlung der Arbeiter sprach, schätzte sie die März-Aktion gleichzeitig als „ersten bewussten Angriff der revolutionären Arbeiter Deutschlands gegen die bürgerliche Staatsmacht“ ein (S. 21). Dabei hatte die KAPD selbst festgestellt, dass „selbst die großen Arbeitermassen neutral, wenn nicht feindlich gegenüber der kämpferischen Avantgarde eingestellt blieb“ (S. 24). Auch auf dem außerordentlichen Parteitag der KAPD im September 1921 wurden die Lehren aus der März-Aktion nicht weiter aufgegriffen.
Auf diesem Hintergrund heftiger Debatten innerhalb der VKPD und widersprüchlicher Reaktionen der KAPD begann Ende Juni der 3. Weltkongress der Komintern.
Die Haltung der Komintern zur März-Aktion
Innerhalb der Komintern war der Prozess der Bildung verschiedener Flügel in Gang gekommen. Das EKKI selber hatte gegenüber den Ereignissen in Deutschland weder eine einheitliche Meinung, noch sprach es mit einer Stimme. Bei der Einschätzung der Lage in Deutschland war das EKKI lange Zeit gespalten.
Radek hatte zahlreiche Kritiken an den Positionen und dem Verhalten des Vorsitzenden der KPD, Levi, entwickelt, die von anderen Mitgliedern der Zentrale aufgegriffen wurden.
Innerhalb der KPD wurden diese Kritiken jedoch nicht offen und auf einem Parteitag oder in anderen Parteiinstanzen in entsprechender Form formuliert.
Anstatt offen über die Einschätzung der Lage zu debattieren, war von Radek eine Funktionsweise gefördert worden, die der Partei zutiefst schädlich sein sollte. Kritiken wurden häufig nicht brüderlich in aller Deutlichkeit vorgetragen, sondern in verdeckter Form. Im Mittelpunkt stand oft nicht die jeweilige Fehleinschätzung durch ein Zentralorgan, sondern die Suche nach Schuldigen. Der Trend setzte sich durch, Positionen jeweils mit Personen zu verbinden. Anstatt die Einheit als Organisation um eine Position und Vorgehensweise herzustellen, anstatt für und als ein kollektiv funktionierender Körper zu kämpfen, untergrub man das Organisationsgewebe auf eine völlig unverantwortliche Weise.
Darüber hinaus waren die Kommunisten in Deutschland selber ebenfalls zutiefst gespalten. Zum einen gehörten zum damaligen Zeitpunkt der Komintern die VKPD und die KAPD an, die allerdings aufs heftigste wegen der Orientierung der Organisation aufeinander prallten.
Gegenüber der Komintern waren vor der März-Aktion von Teilen der VKPD sowohl Informationen über die Einschätzung der Lage verschwiegen wie auch die unterschiedlichen Positionen und Einschätzungen der Komintern nicht umfassend mitgeteilt worden.
In der Komintern selber gab es keine wirklich gemeinsame Reaktion und kein einheitliches Vorgehen gegenüber der Entwicklung. Der Kronstädter Aufstand hatte die ganze Aufmerksamkeit der Führung der Bolschewistischen Partei auf sich gezogen und sie daran gehindert, die Lage in Deutschland näher zu verfolgen. Zudem war es oft nicht klar, wie Entscheidungen innerhalb des Exekutivkomitees zustande gekommen waren und wie Mandate erteilt wurden. Gerade gegenüber Deutschland scheinen die Mandate von Radek und anderen Delegierten des EKKI nicht immer klar genug festgelegt worden zu sein.[iv] [3]
So hatten in dieser Situation der zunehmenden Spaltung innerhalb der VKPD Mitglieder des EKKI, unter Radeks Federführung, inoffiziellen Kontakt mit Flügeln in beiden Parteien – VKPD und KAPD – aufgenommen, um unter Umgehung der Zentralorgane der beiden Organisationen Vorbereitungen für putschistische Maßnahmen zu treffen. Anstatt also auf eine Klärung und Mobilisierung der Organisationen zu drängen, begünstigte man eine Spaltung der Parteien und förderte Schritte, die Entscheidungen außerhalb der verantwortlichen Organe zu treffen. Diese Haltung, die im Namen des EKKI eingenommen wurde, leistete somit dem organisationsschädlichen Verhalten innerhalb VKPD und KAPD Vorschub.
Paul Levi kritisierte: „Der Fall war schon häufiger, dass Abgesandte des EKKI über ihre Vollmacht hinausgingen, d.h. dass sich nachträglich ergab, die Abgesandten hätten zu dem oder jenem keine Vollmachten gehabt.“ („Unser Weg, Wider den Putschismus“, S. 63, 3. April 1921).
Von den Statuten festgelegte Entscheidungsstrukturen in der Komintern wie auch innerhalb der VKPD und KAPD wurden umgangen. Tatsache war, dass in der März-Aktion dann von beiden Organisationen zum Generalstreik aufgerufen wurde, ohne dass die ganze Organisation an der Einschätzung der Lage und den Entscheidungen beteiligt war. In Wirklichkeit hatten Genossen des EKKI mit den Elementen und den Flügeln innerhalb der beiden Organisationen Kontakt aufgenommen, die nach Aktionen drängten. Die Partei als solche wurde „umgangen“!
So konnte es nie zu einer einheitlichen Vorgehensweise der einzelnen Parteien und noch weniger zu einem gemeinsamen Vorgehen der beiden Parteien kommen.
Aktivismus und Putschismus hatten in diesen Organisationen teilweise die Oberhand gewonnen – mit einem sehr zerstörerischen Verhalten für die Partei und die Klasse insgesamt. Jeder Flügel fing an, seine eigene Politik zu betreiben und seine eigenen informellen, parallelen Kanäle aufzubauen. Die Sorge um die Einheit der Partei, eine statutengemäße Funktionsweise war einem Großteil der Partei abhanden gekommen.
Obwohl die Komintern durch die Identifikation der Bolschewistischen Partei mit den Interessen des russischen Staates und durch die opportunistische Kehrtwendung hin zur Einheitsfront geschwächt war, sollte der 3. Weltkongress dennoch ein Moment der kollektiven, proletarischen Kritik an der März-Aktion werden.
Für den Kongress hatte das EKKI aus richtiger politischer Sorge auf Anregung Lenins auch die Entsendung von Vertretern der Opposition innerhalb der VKPD durchgesetzt. Während die Delegation der VKPD-Zentrale weiter jegliche Kritik an der Haltung der VKPD zur März-Aktion unterbinden wollte, beschloss das Politbüro der KPR(B) auf Vorschlag Lenins: „Als Grundlage der Resolution ist der Gedanke zu nehmen, dass man vielmals detaillierter die konkreten Fehler der VKPD in der März-Aktion aufzeigen und vielmals energischer vor der Wiederholung dieser Fehler warnen muss.“
Wie Haltung einnehmen?
In der Eingangsdiskussion über „Die wirtschaftliche Krise und die neuen Aufgaben der Kommunistischen Internationale“ hatte Trotzki hervorgehoben: „Erst jetzt sehen und fühlen wir, dass wir nicht so unmittelbar nahe dem Endziel, der Eroberung der Macht, der Weltrevolution stehen. Wir haben damals im Jahre 1919 uns gesagt: es ist die Frage von Monaten, und jetzt sagen wir, es ist die Frage vielleicht von Jahren (...) Der Kampf wird vielleicht langwierig sein, wird nicht so fieberhaft, wie es wünschenswert wäre, voranschreiten, der Kampf wird höchst schwierig und opferreich sein (...)“ („Protokoll des 3. Kongresses“, S. 90).
Lenin: „Deshalb musste der Kongress gründlich mit den linken Illusionen aufräumen, dass die Weltrevolution ununterbrochen in ihrem stürmischen Anfangstempo weiterrase, dass wir von einer zweiten revolutionären Welle getragen würden, und dass es einzig und allein vom Willen der Partei und ihrer Aktion abhänge, den Sieg an unsere Fahne zu fesseln (...)“ (Zetkin, „Erinnerungen an Lenin“)
Für den Kongress hatte die VKPD-Zentrale unter der Federführung A. Thalheimers und Bela Kuns einen Thesenentwurf zur Taktik geschickt, der forderte, dass die Komintern jetzt zu einer neuen Periode der Aktionen übergehen müsse. In einem Brief vom 10. Juni an Sinowjew hatte Lenin den Thesenentwurf als „politisch grundfalsch, als linksradikale Spielerei“ eingeschätzt und gefordert, ihn gänzlich abzulehnen. „Die Mehrheit der Arbeiterklasse haben die kommunistischen Parteien noch nirgends erobert. Nicht für die organisatorische Führung, aber auch nicht für die Prinzipien des Kommunismus (...) Deshalb muss die Taktik darauf gerichtet werden, unentwegt und systematisch um die Mehrheit der Arbeiterklasse, in erster Linie innerhalb der alten Gewerkschaften zu ringen.“ (10. Juni, 1921, Lenin, Briefe, Bd. 7, S. 269). Gegenüber dem Delegierten Heckert meinte Lenin: „Die Provokation lag doch glatt auf der Hand. Statt von der Verteidigung aus die Arbeitermassen gegen die Angriffe der Bourgeoisie zu mobilisieren und so den Massen zu zeigen, dass das Recht auf eurer Seite ist, habt ihr die sinnlose ‘Offensivtheorie’ erfunden, die allen Polizeikerls und den reaktionären Regierungen die Möglichkeit gibt, euch als die Angreifer darzustellen, vor denen man das Volk schützen muss.“ (Erinnerungen, F. Heckert, „Meine Begegnungen mit Lenin“)
Während Radek selbst vorher die März-Aktion unterstützt hatte, sprach er in seinem Referat im Namen des EKKI vom widersprüchlichen Charakter der März-Aktion, lobte den Heldenmut der kämpfenden Arbeiter und kritisierte andererseits die falsche Politik der Zentrale der VKPD. Trotzki charakterisierte die März-Aktion als ganz unglücklichen Versuch, der, „wenn er wiederholt werden sollte, diese gute Partei wirklich zugrunde richten könnte“. Er unterstrich, „wir sind verpflichtet, der deutschen Arbeiterschaft klipp und klar zu sagen, dass wir diese Offensivphilosophie als die größte Gefahr und in der praktischen Anwendung als das größte Verbrechen auffassen“. („Protokoll des 3. Kongresses“, S. 644-646).
Die Delegation der VKPD und die gesondert eingeladenen Delegierten der VKPD-Opposition prallten auf dem Kongress aufeinander.
Der Kongress war sich der Gefahren für die Einheit der Partei bewusst. Deshalb drängte man auf eine Einigung zwischen VKPD-Führung und Opposition. Eine Übereinkunft mit folgendem Inhalt wurde erzielt: „Der Kongress erachtet jede weitere Zerbröckelung der Kräfte innerhalb der VKPD, jede Sonderbündelei – von Spaltung gar nicht zu sprechen – als die größte Gefahr für die ganze Bewegung“. Gleichzeitig wurde vor einer revanchistischen Haltung gewarnt: „Der Kongress erwartet von der Zentrale und der Mehrheit der VKPD die tolerante Behandlung der früheren Opposition, falls diese die vom 3. Kongress gefassten Beschlüsse loyal durchführt“ („Resolution zur März-Aktion und über die Lage in der VKPD“, 21. Sitzung des 3. Weltkongresses, 9.7.1921).
In den Debatten auf dem 3. Kongress äußerte sich die KAPD-Delegation kaum selbstkritisch zur März-Aktion. Sie schien sich mehr auf die Prinzipienfrage der Arbeit in den Gewerkschaften und den Parlamentarismus zu konzentrieren.
Während der 3. Kongress so selbstkritisch vor den putschistischen Gefahren, die in der März-Aktion sichtbar geworden war, gewarnt hatte und diesem „blinden Aktionismus“ eine Abfuhr erteilt hatte, schlug der Kongress selber tragischerweise den unheilvollen Kurs der „Einheitsfront von Unten“ ein. Zwar hatte er die putschistische Gefahr abgewandt, aber die opportunistische Kehrtwende, die durch die Verabschiedung der 21 Thesen eingeleitet worden war, wurde bestätigt und beschleunigt. Die wirklichen Fehler, die in der Grundsatzkritik der KAPD von Gorter aufgeworfen worden waren, nämlich die Rückkehr zur gewerkschaftlichen und parlamentarischen Ausrichtung, wurden nicht korrigiert.
Ermuntert durch die Ergebnisse des 3. Kongresses schlug die VKPD dann ab Herbst 1921 den Kurs der Einheitsfront ein.
Gleichzeitig hatte der 3. Kongress der KAPD ein Ultimatum gestellt: entweder Beitritt zur VKPD oder Ausschluss aus der Komintern.
Im September 1921 trat die KAPD dann aus der Komintern aus – Teile von ihr stürzten sich anschließend in das Abenteuer der Bildung einer Kommunistischen Arbeiterinternationale. Nur wenige Monate vergingen bis zur Spaltung der KAPD.
Für die KPD (die im August 1921 wieder ihren Namen von VKPD zu KPD geändert hatte) war die Tür zu einer opportunistischen Entwicklung weiter aufgestoßen.
Die Bourgeoisie ihrerseits hatte ihr Ziel erreicht: Erneut hatte sie mit der März-Aktion ihre Offensive fortsetzen können. Sie hatte die Arbeiterklasse weiter geschwächt.
Aber noch verheerender als die Konsequenzen dieser putschistischen Haltung für die Arbeiterklasse insgesamt waren die Folgen für die Kommunisten selber: erneut wurden sie Opfer der Repression. Die Jagd auf Kommunisten wurde wieder verschärft. Bei der KPD kam es zu einer großen Austrittswelle aus der Partei. Viele Mitglieder zeigten sich zutiefst enttäuscht über die gescheiterte Erhebung. Anfang des Jahres zählte die VKPD ca. 35000-400000 Mitglieder. Ende August 1921 gehörten ihr nur noch ca. 160000 an, im November sogar nur noch 135000-150000 zahlende Mitglieder.
Zum wiederholten Male hatte die Arbeiterklasse in Deutschland gekämpft, ohne eine starke, schlagkräftige Partei an ihrer Seite zu haben.
Dv.
[i] [3] Bei den Wahlen zum Preußischen Landtag im Februar 1921 entfielen auf die VKPD 1.1 Mio., die USPD 1.1 Mio. und die SPD 4.2 Mio. Stimmen. In Berlin übertrafen VKPD und USPD die SPD-Stimmenanteile.
[ii] [3] Clara Zetkin, die mit der inhaltlichen Kritik Paul Levis übereinstimmte, hatte in mehreren Briefen aufgefordert, sich nicht organisationsschädlich zu verhalten. So schrieb sie am 11. April an Levi: „(...) dem Vorwort sollten Sie die persönliche Note nehmen. Ebenso scheint mir politisch wirksam, dass Sie über die Zentrale und ihre Mitglieder kein ‘persönliches Urteil’ fällen, sie reif für die Kaltwasserheilanstalt erklärten und ihre Entfernung fordern etc. (...) Es ist klüger, dass Sie sich bloß an die Politik der Zentrale halten, die Leute außer Spiel lassen, die ihre Träger sind (...) Nur die persönlichen Wallungen sollten gestrichen werden.“ Levi ließ sich nicht belehren. Stolz und Rechthaberei, sowie sein monolithisches Organisationsverständnis sollten fatale Folgen haben.
[iii] [3] „Paul Levi hat der Parteileitung von seiner Absicht, eine solche Broschüre zu veröffentlichen, weder Kenntnis gegeben noch ihr Mitteilung von den in der Broschüre aufgestellten Behauptungen gemacht (...)
Paul Levi hat seine Broschüre in Druck gegeben am 3. April, zu einer Zeit, wo der Kampf noch in vielen Teilen des Reiches im Gange war und in der Tausende von Kämpfern vor den Sondergerichten stehen, die Paul Levi durch die Veröffentlichung seiner Broschüre zu den Bluturteilen gerade anreizt (...)
Die Zentrale anerkennt in vollem Umfange das Recht der Parteikritik vor und nach Aktionen, die von der Partei geführt werden. Kritik auf dem Boden des Kampfes und dem der vollen Kampfsolidarität ist eine Lebensnotwendigkeit für die Partei und revolutionäre Pflicht. Paul Levis Haltung (...) läuft nicht auf die Stärkung, sondern auf die Zerrüttung und Zerstörung der Partei hinaus“. (Zentrale der VKPD, 16.4.1921)
[iv] [3] Der Delegation des EKKI gehörten Bela Kun, Pogany und Guralski an. Karl Radek wirkte insbesondere seit der Gründung der KPD als „Verbindungsmann“ zwischen der KPD und der Komintern. Ohne immer über ein klares Mandat zu verfügen, praktizierte vor allem er die Politik der „informellen“ und parallelen Kanäle.
Theorie und Praxis:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Internationale Revue 25 - Editorial
- 2440 Aufrufe
Wohin der Kapitalismus die Welt treibt
Kriege in allen Kontinenten, immer mehr Armut, Not, Hunger und Katastrophen aller Art. Eine Übersicht über die Lage auf der Welt zeigt, wie katastrophal alles ist.
„Ein Jahr nach Beginn des Kosovokrieges hinterlassen die tödlichen Racheakte, die Zunahme der Kriminalität, die inneren politischen Konflikte, Einschüchterungen und Korruption in diesem Gebiet einen unangenehmen Eindruck [....]. Der Kosovo ist ein Schlamassel.“ (The Guardian, 17.3.00).[i] [6] Seit dem Kosovokrieg und der Besetzung des Landes durch die NATO haben Hass und Gewalt nur noch weiter zugenommen. Der Tschetschenienkrieg wird fortgesetzt – seine Opfer sind Tausende Verletzte und Tote – von denen die meisten Zivilisten sind – sowie Hunderttausende Flüchtlinge, die in den Lagern hungern. Wie im Kosovo und zuvor in Bosnien sind die Gewalttaten unglaublich schrecklich. Die Hauptstadt Grosny wurde von der Karte ausradiert, zerstört. Die amerikanischen Generäle brüsten sich, mittels der NATO-Bombardierungen Serbien um 50 Jahre zurückgebombt zu haben. Die russischen Generäle haben sich in Tschetschenien als noch „leistungsfähiger“ erwiesen: „Diese kleine kaukasische Republik läuft somit Gefahr, in ihrer Entwicklung um ein Jahrhundert zurückgeworfen zu werden“ (Le Monde Diplomatique, Februar 2000). Die Kämpfe, die bislang das Land zerstört haben, gehen weiter, und ein Ende ist noch lange nicht abzusehen.
Die Zahl der kriegerischen Spannungsgebiete wird immer größer. Insbesondere in Südostasien sind sie sehr zahlreich und ausgesprochen gefährlich. „In keiner anderen Region auf der Erde stehen wir vor solch dramatischen Fragen.“ (Bill Clinton, International Herald Tribune, 20.3.00).
Armut und Not dehnen sich überall auf der Welt aus
„Die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Armut“ (International Herald Tribune, 17.3.00). Das ganze Gerede von Wohlstand wird durch die dramatische Lage von Milliarden Menschen widerlegt. „Während die weltweite Grundnahrungsmittelproduktion 110% der Bedürfnisse deckt, sterben weiterhin jedes Jahr 30 Millionen Menschen an Hunger, und mehr als 800 Millionen Menschen sind unterernährt“ (Le Monde Diplomatique, Dezember 2000).
Die Lage in den Ländern der Peripherie, die vor kurzem noch als „Dritte-Welt-Staaten“ und heute als „Schwellen-“ oder „Entwicklungsländer“ bezeichnet werden, entblößt die Lügen der gegenwärtigen Propaganda, denn überall nehmen Verarmung und absolute Armut zu. „Es gibt immer noch eine große Anzahl von Unterernährten, obwohl es einen Nahrungsmittelüberschuss gibt. In den Entwicklungsländern leiden 150 Millionen Kinder an Untergewicht, d.h. ca. ein Drittel aller Kinder“ (International Herald Tribune, 9.3.00).
Selbst wenn man uns heute eintrichtern will, dass die asiatische Krise vom Sommer 1997 überwunden und die „asiatischen Tiger“ wieder genesen seien, die Rezession in Asien und Lateinamerika viel weniger verheerend als befürchtet gewesen sei und es wieder positive Wachstumszahlen gebe, „leben in Asien und Lateinamerika 2,2 Milliarden Menschen mit weniger als 2 Dollar pro Tag“ (International Herald Tribune, 14.7.00, James D. Wolfensohn, Präsident der Weltbank). Die Inflation sei unter Kontrolle, die Produktion ziehe wieder an, somit sei „Russland ein kleines Wunder, wenn man den makro-ökonomischen Indikatoren glauben soll“ (Le Monde, 24.3.00). Aber wie in den Ländern Asiens und Lateinamerikas vollzieht sich diese Besserung der „wirtschaftlichen Grundlagen“ auf Kosten der Bevölkerung und dank einer wachsenden Verarmung. „Russland ist weiterhin nahezu pleite, angeschlagen durch eine Auslandsschuld von annähernd 170 Mrd. Dollar [....]. Die allgemeine Entwicklung des Lebensstandards ist seit 1990 rückläufig und heute beträgt das Durchschnittseinkommen ca. 60 $ im Monat, ein Durchschnittslohn 63 $ und eine Durchschnittsrente 18 $. 1998 lebten zur Zeit des Börsenkrachs 48% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze (die auf 50 $ festgelegt worden war), Ende 1998 lebten schon 54% unter dieser Grenze und mittlerweile sind es ca. 60%“ (Le Monde, Wirtschaftsbeilage, 14.3.00).
Armut und Not in den Industriestaaten
Die Idee, dass die Industriestaaten eine Oase des Wohlstands seien, hält auch keiner Überprüfung stand – auch nicht einer oberflächlichen. Allein der Anblick von Hunderten von Millionen von Männern und Frauen, hauptsächlich Arbeitern mit oder ohne Stelle, genügt. Wie wir in der Nummer 100 unserer International Review (engl./frz./span. Ausgabe) schrieben, leben 18% der amerikanischen Bevölkerung, d.h. mindestens 36 Millionen Menschen, unter der Armutsgrenze, in Großbritannien sind es 8 Mio. und in Frankreich 6 Mio. Wenn die Arbeitslosenzahl gesunken ist, dann steckt dahinter eine täglich größer werdende Flexibilität, immer prekärere Bedingungen und ein drastischer Lohnverfall. Neben den USA und Großbritannien werden die Niederlande oft als Beispiel eines wirtschaftlichen Erfolgs erwähnt. Wie kann man den Rückgang der Arbeitslosenzahlen in den Niederlanden von 10% 1983 auf weniger als 3% 1999 erklären, fragt sich Le Monde. „Mehrere Erklärungen sind schon angeführt worden: [....] Die Ausbreitung der Teilzeitarbeit, die 1997 38,4% der Gesamtbeschäftigten ausmachte, zahlreiche Pensionierungen von Beschäftigten, die als behindert eingestuft wurden (besonders weit verbreitet in Holland, da sie nahezu 11% der aktiven Bevölkerung umfassen), schließlich die Zurückhaltung bei den Löhnen während der 80er Jahre, all das sind Gründe, die eine Erklärung für den starken Rückgang der Arbeitslosigkeit liefern“ (Le Monde, Wirtschaftsbeilage, 14.3.00). Das Rätsel des Erfolgs ist gelöst. Einer von zehn Erwachsenen ist in einem der höchst entwickelten Industriestaaten der Erde behindert. Aber das ist kein Grund zum Lachen. Der Erfolg Hollands? Größtmögliche Ausdehnung prekärer Arbeitsbedingungen und von Teilzeitarbeit, Zahlenspielereien mit den Wirtschaftsstatistiken und den Gesundheitszahlen, schließlich drastische Lohnsenkungen. Da haben wir das „Erfolgsrezept“. Und es wird in allen Ländern angewandt.[ii] [7]
Zu diesen Zahlen, die nur einen Teileinblick in die wirtschaftliche und soziale Wirklichkeit der Industriestaaten darstellen, müsste man die gewaltige öffentliche und private Verschuldung der USA, die Ausdehnung ihres Handelsdefizits hinzufügen[iii] [8] und die gewaltige Börsenspekulationsblase der Wall Street sowie aller anderen Börsen der Welt. Der viel gepriesene ununterbrochene US-amerikanische Wachstumszyklus der 90er Jahre wurde von den anderen Staaten der Welt durch eine gewaltige Ausbreitung der Verschuldung und eine gesteigerte Ausbeutung der Arbeiterklasse finanziert. Der andere große Industriestaat, die zweitgrößte Wirtschaftsmacht, Japan, hat die offizielle Rezession, d.h. die offiziell als solche anerkannt wird, noch nicht überwunden. Und das obwohl man eine astronomische Staatsverschuldung eingegangen ist, die „sich Ende 1999 auf 3300 Milliarden Dollar belief, womit Japan weltweiter Spitzenreiter war [....]. Japan hat somit die USA überholt, die zuvor die höchst verschuldete Nation der Erde war“ (Le Monde 4.3.00).
Die wirkliche Lage der Weltwirtschaft ist genau das Gegenteil der Idylle, die uns immer wieder geschildert wird.
Mörderische Katastrophen und Zerstörung des Planeten
Umwelt- und Naturkatastrophen häufen sich. Die todbringenden Überschwemmungen in Venezuela und Mosambik, die denen in China und anderswo folgten, haben Tausende von Toten und Verschwundenen, Hunderttausende Obdachlose und Hungernde hinterlassen. Gleichzeitig haben Dürreperioden, die weniger „spektakulär“ sind, in Afrika und in den von Überflutungen heimgesuchten Ländern zu einem anderen Zeitpunkt eine Unzahl von Opfern gefordert und Zerstörungen bewirkt. Aber die Tausenden von Toten, die in den Trümmern ihrer Elendshütten um Caracas verschüttet und begraben wurden, sind keine Opfer von Naturphänomenen geworden, sondern sie sind Opfer der Lebensbedingungen und der Anarchie des Kapitalismus. Die reichen Länder sind von den Katastrophen auch nicht ausgespart geblieben, auch wenn sie dort unmittelbar weniger dramatische Auswirkungen hinterlassen haben. Die Zahl der ‚Zwischenfälle“ in den Atomkraftwerken häuft sich. Genauso wie die Fälle von ‚Ölpest“, die nach dem Schiffbruch von Billigflaggschiffen entstehen, und die Zahl von Eisenbahn- und Flugzeugunfällen. Oder die Vergiftung von Flüssen wie die Einleitung von großen Quecksilbermassen in die Donau. Das Wasser ist mehr und mehr vergiftet und wird zu einer Mangelware. „Eine Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem und trinkbarem Wasser, hauptsächlich deshalb, weil sie arm sind“ (International Herald Tribune, 17.3.00). Die Luft in den Städten und auf dem Lande wird immer verschmutzter. Krankheiten wie Cholera und Tuberkulose, die als überwunden galten, tauchen wieder auf und verbreiten sich. „Dieses Jahr werden 3 Millionen Menschen an Tuberkulose sterben, und 8 Millionen werden dadurch infiziert, fast alle leben in den armen Ländern [....]. Die Tuberkulose ist keineswegs nur ein medizinisches Problem. Sie ist ein politisches und soziales Problem, das unberechenbare Folgen für zukünftige Generationen haben könnte“, so die Aussage von Ärzten ohne Grenzen (zit. nach International Herald Tribune, 24.3.00).
Die Zerstörung des sozialen Gewebes und dessen dramatische Folgen
Diese Verschlechterung der Lebensbedingungen sowohl auf ökonomischer als auch auf allgemeiner Ebene geht einher mit einer Explosion der Korruption, dem Aufblühen von Mafia-Organisationen und schlimmster Kriminalität. Ganze Länder werden von Drogen, Kriminalität und Prostitution überschwemmt. Die Veruntreuung von Geldern des IWF in Russland in Milliardenhöhe durch Mitglieder der Jelzin-Familie sind nur ein karikaturaler Ausdruck der weit verbreiteten Korruption, die auf der ganzen Welt um sich greift.
Die Hölle, in der sich Millionen von Kinder auf der Welt befinden, ist unglaublich. „Die Liste der Tätigkeitsfelder, wo Kinder zu Waren werden, ist lang [....]. Aber die Kinder werden keineswegs nur für den internationalen ‚Markt“ der Adoption verkauft. Man verkauft sie auch wegen ihrer Arbeitskraft [....]. Das Sex-Gewerbe – Kinderprostitution, Erwachsenenprostitution – ist heute so lukrativ geworden, dass es fast 15% des Bruttoinlandprodukts einiger asiatischer Länder ausmacht (Thailand, Philippinen, Malaysia). Die immer jüngeren Opfer leben überall in einer immer größeren Armut, vor allem wenn sie krank auf der Straße landen oder in ihre Dörfer zurückgeschickt werden, wo sie dann von ihren Familien verworfen und somit von allen im Stich gelassen werden“ (Le Monde, 21.3.00, Claire Bisset, Direktorin des Französischen UNICEF-Komitees).[iv] [9]
Genauso schrecklich ist die Ausbreitung der Prostitution junger Mädchen. Infolge der Intervention der NATO im Kosovo landeten Tausende junger Frauen in den Flüchtlingslagern. Während ihre Brüder von der Mafia der UCK zwangsrekrutiert wurden, sich am Drogenhandel beteiligten und der Kriminalität verfielen, sind die Frauen ebenfalls zu Opfern der Mafia geworden. „Oft werden sie in den Flüchtlingslagern gekauft oder entführt, um dann ins Ausland oder in den Kneipen an die Soldaten von Pristina verkauft zu werden [....]. Die meisten von ihnen erleiden Misshandlungen, insbesondere Vergewaltigungen, bevor sie gezwungen werden sich zu prostituieren. ‚Anfangs glaubte ich nicht, dass es wirkliche Konzentrationslager gab, in denen sie vergewaltigt und auf die Prostitution vorbereitet werden“, erklärte eine französischer Polizist“ (Le Monde, 15.3.00).
Auf allen Ebenen: Kriege, Wirtschaftskrise, Armut, in ökologischer und sozialer Hinsicht ein düsteres und katastrophales Bild.
Wohin treibt der Kapitalismus die Welt?
Aber handelt es sich um eine zugegebenermaßen schreckliche und dramatische Übergangsperiode hin zu einer besseren Welt mit Frieden und Wohlstand? Oder handelt es sich um einen unaufhaltsamen Abstieg in die Hölle? Handelt es sich um eine Gesellschaft, die schlimmste Zeiten durchmacht, bis dann wieder eine neue außergewöhnliche Entwicklung dank neuer Technologien möglich wird? Oder befinden wir uns in einem unumkehrbaren Zerfall des Kapitalismus? Welche tiefgreifenden Tendenzen gibt es, die ausschlaggebend sind für alle Aspekte im Kapitalismus?
Hin zu einer Zerstörung der Umwelt
Trotz der Reden der Grünen und ihrer Regierungsbeteiligung werden Katastrophen aller Art und die Zerstörung des Planeten durch den Kapitalismus nur noch zunehmen und sich weiter zuspitzen. Wenn die Wissenschaftler es schaffen, eine „objektive“ und ernsthafte Untersuchung zu erstellen, und wenn sie zu Wort kommen, sind ihre Vorhersagen verheerend. So äußerte sich ein Wasserspezialist: „Es ist, als ob wir auf eine Mauer zurasen [....]. Das schlimmste Zukunftsszenario besteht darin, dass, wenn wir so weitermachen wie heute, dann steht die Krise fest [....]. 2025 wird die Mehrheit der Menschen mit einer schwachen oder katastrophal schwachen Wasserversorgung konfrontiert sein“ (Le Monde, 14.3.00). Die Schlussfolgerung des Wissenschaftlers: „Eine Änderung der globalen Politik ist dringend geboten“.
Wir brauchen gar nicht mehr auf das Loch in der Ozonschicht zurückzukommen, auch nicht auf die Erwärmung der Erde, die zu einem Eisschmelzen an den beiden Polen führt und den Meerwasserspiegel ansteigen lässt. Die Luft in den meisten Megastädten der Erde ist kaum noch zu atmen und die damit verbundenen Krankheiten, Asthma, chronische Bronchitis und andere, wie Krebs, steigen schnell an. Aber nicht nur die Großstädte und die Industriegebiete sind davon betroffen, sondern der ganze Erdball. Die Wolke von Industrieabgasen, für die die Industrie in Indien und China verantwortlich ist, hing wochenlang über dem Indischen Ozean und war so groß wie die Fläche der USA. Welche Antwort bietet der Kapitalismus? Kann er die Verschmutzung einstellen oder zumindest reduzieren? Keinesfalls. Seine Antwort? Sich Luft ‚anzueignen“ und sie als Ware verkaufen: „Zum ersten Mal wird die Luft, universeller Lebensbestandteil, zu einer Ware [....]. Das Prinzip eines Marktes für zugelassene Emissionen (d.h. Rechte zu verschmutzen) ist einfach [....]. Ein Land, das mehr CO2 ausstößt als erlaubt, kann von einem anderen Land, das weniger ausstößt, dessen Emissionsanteile abkaufen“ (Le Monde, Wirtschaftsbeilage, 21.3.00). Mit dem Wasser wird schon so verfahren, genauso wie mit Kindern und mit den Arbeitern. Statt die Zerstörung der Umwelt zu stoppen, oder sie zumindest zu reduzieren, beschleunigt der Kapitalismus den ganzen Zerstörungsprozess, indem er alles zu einer Ware werden lässt.
Hin zu noch mehr Armut und Not
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts haben sich die Lebensbedingungen der Weltbevölkerung – die Arbeiterklasse der Industriestaaten eingeschlossen – trotz des technischen Fortschritts und einer Entwicklung der quantitativ gewaltigen Produktivkräfte wesentlich verschlechtert, ohne all die Opfer und die Armut zu erwähnen, die durch die beiden Weltkriege verursacht wurden. Wie die Kommunistische Internationale 1919 feststellte, war der Zeitraum der Dekadenz des Kapitalismus eröffnet worden.
In den 70er Jahren gingen die Staaten Afrikas bankrott und der Schuldenberg Lateinamerikas erreichte astronomische Ausmaße. In den 80er Jahren gingen diese beiden Kontinente pleite und die Verschuldung Osteuropas explodierte. In den 90er Jahren ging Osteuropa pleite, dann kam die Explosion der Verschuldung und Pleite Asiens. Ob Afrika, Lateinamerika, oder jetzt Asien und Osteuropa – die Lage hat sich Ende des vorigen Jahrhunderts dramatisch verschlechtert. Anfang der 70er Jahre betrug die Zahl der Armen (die der Weltbank zufolge weniger als einen Dollar pro Tag verdienten) ca. 200 Millionen. Anfang der 90er Jahre war diese Zahl auf ca. 2 Milliarden angestiegen.
Nach dem Zusammenbruch des stalinistischen Staatskapitalismus in Osteuropa wurde allen der große Wohlstand des Westens versprochen. „Doch statt eines Anstiegs der Löhne und des Lebensstandards auf das Niveau Westeuropas vergrößerte sich das Gefälle zwischen Ost- und Westeuropa nach 1989 noch mehr. Das Bruttoinlandprodukt fiel gar in den höchst entwickelten Ländern um 20%. Zehn Jahre nach dem Beginn des Übergangs hat einzig Polen sein Bruttoinlandprodukt von 1989 übertroffen, während Ungarn sich erst Ende der 90er Jahre diesem Niveau nähert“ (Le Monde Diplomatique, Febr. 2000).
Über Asien, wo die Krise vom Sommer 1997 angeblich überwunden sei, hört man: „Viele Banken sitzen noch auf gewaltigen Schulden, bei denen es auch bei einer Besserung des Wirtschaftsklimas keine Aussichten auf eine Rückzahlung gibt“ (The Economist, in „Die Welt im Jahr 2000“). Sicher ist die Bourgeoisie entzückt über die Genesungskraft der asiatischen Wirtschaften. „Die Wiederbelebung der Wirtschaft der Region ist ‚bemerkenswert“, meinte der Vizepräsident der Weltbank, zuständig für Ostasien und den Pazifik. Aus seiner Sicht ‚nimmt die Armut nicht weiter zu, die Währungskurse sind stabil, die Reserven beträchtlich, die Exporte steigen, Auslandsinvestitionen nehmen zu und die Inflation bleibt gering“ (Le Monde, 24.3.00). Hinter der Aussage, „die Armut nimmt nicht weiter zu“, steckt in Wirklichkeit die Zerstörung ganzer Bereiche der Wirtschaft Asiens und eine gewaltige Verarmung der Bevölkerung, eine gestiegene öffentliche und private Verschuldung, die die Erklärung dafür liefert, dass „die Reserven beträchtlich“ sind; dahinter steckt auch eine abgewertete Landeswährung, was die Exporte und Auslandsinvestitionen begünstigt. Aber selbst im Falle Südkoreas, das vor der Krise vom Sommer 1997 als zehntgrößte Industriemacht eingestuft wurde, sind die Experten geteilter Meinung, und nicht alle lassen sich von den Erfordernissen der Propaganda beeindrucken.
„Hilton Root, ein ehemaliger Wirtschaftsprofessor an der Wharton School, beschrieb ein beunruhigendes Bild des koreanischen Wiederaufschwungs, der sehr zerbrechlich sei und nicht auf fest Füßen stehe. Auf den mächtigen südkoreanischen Chaebols (Konglomerate) lasten immer noch gigantische Schulden, und im Land bündelt sich der Reichtum noch immer in den Händen einiger weniger Familien, die Korruption treibt weiter Blüten und schadet dem politischen und Rechtssystem der Nation. Mr. Root bezweifelt, dass der koreanische Wiederaufschwung andauert, auch wenn Mr. Kim stärker als je zuvor erscheint. Viele Menschen befürchten, dass Südkorea schnell wieder einen Rückschlag erleidet“ (International Herald Tribune, 18.3.00). Man kann sehen, auch wenn die Erklärung der Schwierigkeiten durch diesen Ökonomen keineswegs ausreichen, dass die Wirklichkeit überhaupt nicht so rosig aussieht, wie sie uns die Spezialisten der internationalen Bourgeoisie darstellen wollen.
Für die meisten Länder der Peripherie, d.h. für die meisten Kontinente, Länder und den Großteil der Weltbevölkerung lauten die Perspektiven: noch mehr Zerstörung, noch mehr Armut und Hunger.
Hin zu noch mehr Arbeitslosigkeit und noch prekäreren Arbeitsbedingungen in den reichen Ländern
Wie können wir behaupten, dass der Kapitalismus bankrott ist, obwohl man doch Wachstum verzeichnet? Sind wir denn blind? Wird die „neue Wirtschaft“ die Wirtschaft nicht noch mehr ans Laufen bringen und einen ununterbrochenen Wohlstand garantieren? Wird es nicht „Vollbeschäftigung“ geben, wie die Regierungen behaupten? Wirklichkeit oder Traum? Ist all dies möglich oder handelt es sich um Lügen?
Die Wirtschaftsvorhersagen, die uns von den Medien vorgetragen werden, sind nichts als Propaganda. Sie dienen nur dazu, den allgemeinen Bankrott zu übertünchen. Die Politiker, Spezialisten und Journalisten legen uns manipulierte Zahlen vor, die deren Lügen decken sollen. Im Mittelpunkt der Kampagne, wonach es bald wieder Vollbeschäftigung geben werde, steht die „neue Wirtschaft“.[v] [10] Wie soll das geschafft werden? Durch immer mehr prekäre Bedingungen, aufgezwungene Teilzeitarbeit und Tricks: „Während sich die Zeiten ändern, ändern sich auch die Orientierungspunkte. In besseren Zeiten sprach man von Vollbeschäftigung, als die Arbeitslosigkeit nur 3% betrug. Seit neustem meinen die Experten, könne man davon sprechen, wenn es nur 6% Arbeitslosigkeit gebe. Einige wollen die Zahl gar auf 8,5% anheben“ (Le Monde, Wirtschaftsbeilage, 21.3.00). Die Tatsache, dass ihre Kriterien ständig geändert werden, untergräbt jetzt schon die versprochene Rückkehr zur „Vollbeschäftigung“ und zeigt das geringe Vertrauen, das man in ihre Prognosen haben kann. Die Arbeitslosigkeit und die prekären Arbeitsbedingungen werden sich noch weiter verschlimmern und die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse weltweit verschlechtern.
Das Gleiche trifft für die Wachstumszahlen zu. In Zahlentricks geübt, haben es sich die japanischen Politiker angewöhnt, die Rezession in ihrem Land zu leugnen. „Auch wenn das Bruttoinlandprodukt jetzt schon zwei Halbjahre in Folge[vi] [11] rückläufig ist, glauben wir nicht, dass wir in einer Rezession stecken“ (Le Monde, 14.3.00). Warum sollten sie davor zurückschrecken? Weil die Zahlen so verfälscht sind, damit sie in bestem Licht erscheinen. „Früher hätte man eine Wachstumsrate von 1–1,5% der Weltwirtschaft als Rezession betrachtet. Bei den drei vergangenen weltweiten ‚Rezessionen“ – 1975, 1982, 1991 – ist die Weltproduktion nie wirklich zurückgegangen“ (The Economist, „Die Welt 1999“, veröffentlicht in Courrier International). Unter diesen Bedingungen sind die triumphierenden Erklärungen über das wieder anziehende Wachstum in den Industriestaaten keineswegs glaubwürdig.
Es geht den Herrschenden heute darum, in den Augen der Weltbevölkerung, insbesondere gegenüber der Arbeiterklasse der Industriestaaten, den wirtschaftlichen Bankrott des Kapitalismus zu verschleiern. Eine der himmelschreiendsten Ausdrücke dieses Bankrotts ist der Rückgang der Produktion, die Rezession, mit ihren dramatischen und gewalttätigen Folgen. Die lyrischsten Schwärmereien über das US-Wachstum, dessen künstlicher Charakter und dessen Preis, den die US-Bevölkerung dafür zu zahlen hat, wir erwähnt haben, sollen die weltweite Rezession übertünchen. Wie viele Artikel und Lobpreisungen über das US-Wachstum im Vergleich zu den seltenen, verstreuten Erwähnungen der „tiefgreifenden Rezession in den meisten Ländern der Dritten Welt“ (The Economist) und in Osteuropa?
Hin zu einer Zuspitzung der Widersprüche der US-Wirtschaft
Trotz der Tricks ist die Bourgeoisie dennoch gezwungen, für sich mehr Klarheit zu schaffen, auch wenn es nur darum geht zu sehen, wie sie ihren Bankrott besser kontrollieren kann. Auf diesem Hintergrund also die gegenwärtige Diskussion über die „sanfte Landung“. Die asiatische „Krise“ vom Sommer 1997, die vor allem Asien, Lateinamerika und Osteuropa erfasste, konnte in Nordamerika und in Westeuropa eingedämmt werden, auch wenn Westeuropa und insbesondere die USA eine wachsende öffentliche und private Verschuldung hinnehmen mussten, mit der Folge, dass die Inflation ansteigt, die Wirtschaft überhitzt und eine noch größere und „irrationalere“ Börsenspekulation einsetzt als vorher.
Allen Lobliedern über die angebliche blendende Gesundheit der Wirtschaft, die revolutionäre Energie und den Boom der mit dem Internet verbundenen „neuen Wirtschaft“ zum Trotz, haben die ernsthaftesten Wirtschaftsspezialisten und Verantwortlichen nur eine einzige wahre Sorge: „die sanfte Landung“ der Weltwirtschaft. In Wirklichkeit handelt es sich um ein stillschweigendes Eingeständnis, dass die Wirtschaft schon dabei ist abzusinken. „Eine Sache ist klar: die Expansion der US-Wirtschaft wird sich abschwächen [....]. Könnte die Bremsung so heftig werden, dass sie zu einer weltweiten Rezession führt? Dies ist wenig wahrscheinlich, aber das Risiko kann man nicht ausschließen. (Dennoch) befürchten wir zwei beunruhigende Folgen. Erst wird die notwendige Verlangsamung, um eine Rückkehr der Inflation in den USA im Jahr 2000 zu vermeiden, ziemlich stark sein [....]. Wenn die neue Wirtschaft ein Mythos ist, oder wenn sie jedenfalls weniger reell ist, als man behauptet, sind die gegenwärtigen Börsennotierungen der US-Firmen völlig überzogen. Wenn man sich die Notwendigkeit einer Abschwächung der globalen Nachfrage und die überbewerteten Aktienkurse (die Anleger haben sich auf den Verlust von Illusionen wenig eingestellt) vor Augen führt, lassen sich keine Bedingungen für eine erfolgreiche Landung erkennen“ (The Economist, „Die Welt im Jahre 2000“).
Zweifel machen sich breit. Wird es die Bourgeoisie schaffen, den Absturz zu kontrollieren um solch einen brutalen und unkontrollierten Schock wie 1929 vermeiden können? Es geht nicht darum, ob sich die Pleite vermeiden lässt oder nicht. Die Pleite ist längst schon eingetreten. Wachstum oder Rezession? Die Rezession hat sich längst schon niedergelassen, wie oben aufgezeigt. Wohlstand oder Armut? Die Armut ist längst eingezogen. Arbeitslosigkeit – prekäre Arbeitsbedingungen oder Vollbeschäftigung? Arbeitslosigkeit und prekäre Arbeitsbedingungen gehören längst zum Alltag. Nein, es geht darum: Wird die Bourgeoisie weiterhin den Absturz so kontrollieren können, wie sie es heute tut? Kontrollierter oder unkontrollierter Absturz? Zweifel und Fragestellungen sind in einem anderen Artikel der gleichen Zeitung zu erkennen. „Wenn eine sanfte Landung gelingt, werden die USA ein genauso erstaunliches Wunder vollbracht haben wie das fortgesetzte Wachstum während der letzten Jahre“ (ebenda). Zum Teufel! Zwei „Wunder“ hintereinander! Welch blinder Glaube. Und welches Vertrauen in die Tugenden der kapitalistischen Wirtschaft. Wie beim ersten wird dieses neue „Wunder“, falls es jemals eintreten sollte, nicht durch den Markt bewirkt werden, sondern durch das autoritäre Eingreifen der Staaten – an führender Stelle der USA – in die Wirtschaft, durch politische Entscheidungen der Regierungen und der „Techniker“ der Zentralbanken, die erneut versuchen werden, das Wertgesetz außer Kraft zu setzen, nicht um die Wirtschaft zu retten, sondern um so „sanft“ wie möglich zu landen.
Hin zu mehr Kriegen und Chaos
Wir haben in unserer Presse aufgezeigt[vii] [12], dass in Tschetschenien kein Frieden einkehren wird – genau so wenig wie auf dem Balkan. Und es gibt eine Vielzahl von Spannungsherden. Aus dieser Vielfalt von lokalen Antagonismen ragen besonders die Spannungen zwischen China und Taiwan, Indien und Pakistan und damit Indien und China heraus, d.h. den drei Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Darüber hinaus spitzen sich die Gegensätze zwischen den industriellen Großmächten zu, auch wenn diese Zuspitzung bislang teilweise noch verdeckt ist. Diese Rivalitäten schüren die lokalen Konflikte und spitzen sie zu, wenn sie nicht gar deren direkte Ursache sind wie in Jugoslawien. Die Divergenzen hinsichtlich des Kosovos und des Einsatzes der NATO-Truppen verdeutlichen dies.
Wiederaufflammen der lokalen Konflikte, Zuspitzung der Gegensätze zwischen den imperialistischen Großmächten, dahin treibt uns der Kapitalismus immer mehr.
Auf der Ebene der lokalen imperialistischen Gegensätze hat der gegenwärtige Zeitraum des Zerfalls in den meisten Kontinenten ein Chaos hervorgerufen. „In den südlichen Staaten ist der Staat dabei zusammenzubrechen. Gebiete, in denen es kein Rechtssystem mehr gibt, wo immer mehr unregierbare chaotische Zustände herrschen, versinken in einen Zustand der Barbarei, wo nur die Banden von Plünderern dazu in der Lage sind, ihr Gesetz durchzusetzen, indem sie die Bevölkerung erpressen“ (Le Monde Diplomatique, Dez. 1999). Afrika, das aufgegeben zu sein scheint, zeigt es am deutlichsten. Die gewaltigen Regionen Zentralasiens haben den gleichen Weg eingeschlagen, und obwohl es noch nicht die gleiche Stufe erreicht hat, ist Lateinamerika auch von dieser Entwicklung erfasst, wie uns das Beispiel Kolumbien zeigt.[viii] [13]
Genauso wie in ökologischer und ökonomischer Hinsicht stürzt diese unumkehrbare Tendenz des zerfallenden Kapitalismus die Menschheit ins Chaos und in die Katastrophe. „Dieses [russische] Reich, das in selbständige Regionen zerfällt, diese Einheit ohne Gesetze, ohne Zusammenhalt, dieses aufleuchtende Universum, wo die größten Reichtümer und die furchtbarsten Gewalttätigkeiten gleichzeitig anzutreffen sind, liefert uns ein klares Bild von diesem neuen Mittelalter, in das der ganze Planet zurückfallen könnte, falls wir die Globalisierung nicht in den Griff kriegen“ (J. Attali, ehemaliger Berater des französischen Präsidenten F. Mitterand, L’Express, 23.3.00).
Hat die Menschheit eine Zukunft?
Ein Überblick über die Welt von heute zeigt, wie schrecklich und katastrophal die Lage ist. Die Perspektiven, die der Kapitalismus der Menschheit anzubieten hat, sind schauderhaft und apokalyptisch, aber auch unausweichlich. Es sei denn, wir schaffen es, die Ursache dieses Übels zu überwinden: den Kapitalismus.
„Der Mythos besteht weiterhin, dass der Hunger die Folge eines Mangels an Nahrungsmitteln sei [....]. Aber die eigentliche Ursache des Hungers in den reichen und armen Staaten ist die Armut“ (International Herald Tribune, 9.3.00). Die kapitalistische Welt hat ausreichend Produktivkräfte entwickelt, um die ganze Menschheit zu ernähren. Dies geschah sogar, obwohl während des 20. Jahrhunderts ungeheure Reichtümer und die Produktivkräfte massiv zerstört wurden. Der Überfluss an Gütern und das Ende der Armut – all das bleibt weiter im Bereich des Möglichen für die Menschheit und damit auch die Beherrschung der Produktivkräfte und der gesellschaftlichen Verteilung der Güter, das Ende der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, das Ende der Kriege und der Massaker, das Ende der Umweltzerstörung. In ökonomischer und technischer Hinsicht ist diese Frage seit Anfang des 20. Jahrhunderts längst geklärt. Aber die Aufgabe der Zerstörung des Kapitalismus muss noch erfüllt werden.
Dem gegenüber will die herrschende Klasse uns immer eintrichtern, dass jegliches revolutionäre Projekt unvermeidbar zu einem blutigen Scheitern verurteilt sei; sie verbreitet die Lüge, dass der Kommunismus seiner Negation, dem Stalinismus, gleichzusetzen sei. Mit Hilfe ihrer „Oppositionskräfte“ leiert sie demokratische Kampagnen gegen Pinochet an, gegen die extreme Rechte in Österreich, gegen die Vorherrschaft der Finanzgiganten über die Gesellschaft, gegen die Auswüchse des Liberalismus, gegen die Welthandelsorganisation während der großen Medienshow um die Gipfelgegner in Seattle, für die Tobin-Steuer in Frankreich. In jedem Land werden diese Kampagnen jeweils an die nationalen Verhältnisse angepasst – so wie bei der Dutroux-Affäre in Belgien, dem Kampf gegen den ETA-Terrorismus in Spanien, den Mafia-Skandalen in Italien und der Anti-Rassismus Kampagne in Frankreich. Ein Leitgedanke dieser demokratischen Kampagnen besteht darin, dass die Bevölkerung und an erster Stelle die Arbeiterklasse sich als „Bürger“ um ihren Staat zusammenschließen, um diesem zu helfen, und bei den radikalsten unter ihnen, um ihn zu zwingen, die Demokratie zu verteidigen.
Das Ziel dieser Kampagnen und dieser demokratischen Verschleierungen ist klar. Der Kampf der Arbeiterklasse wird ersetzt durch die Bürgerbewegung aller Klassen und aller Interessensgruppierungen. Dem Kampf gegen den Kapitalismus und seinen Repräsentanten und höchsten Verteidiger, den Staat, stellt man die Unterstützung des Staates entgegen. Die Arbeiterklasse würde alles verlieren, wenn sie sich in dieser Vermischung aller Klassen der Bürger und des Volkes auflösen würde. Sie würde alles verlieren, wenn sie sich hinter den kapitalistischen Staat stellte. Die Bourgeoisie verbreitet auch die Idee, dass der Klassenkampf und die Arbeiterklasse als solche verschwunden seien. Aber die Tatsache, dass diese Kampagnen überhaupt angeleiert werden, ihre oft internationale Orchestrierung und ihr Ausmaß belegen, dass die Arbeiterklasse aus der Sicht der Bourgeoisie weiterhin eine Gefahr darstellt und als Klasse bekämpft werden muss.
Und dies gilt umso mehr, als sich heute wieder mehr Klassenkämpfe entfalten, die sicherlich noch zerstreut und von den Gewerkschaften und den politischen Kräften der Linken kontrolliert und in Niederlagen geführt werden. Aber diese Kämpfe verdeutlichen nichtsdestotrotz eine wachsende Unzufriedenheit mit den Angriffen des Kapitals. In Deutschland, in Großbritannien, in Frankreich gab es zwar schüchterne und von den Gewerkschaften noch voll kontrollierte, aber dennoch bedeutsame Klassenbewegungen.[ix] [14] Die Proteste der New Yorker U-Bahn-Beschäftigten im Nov.-Dez. 99 (siehe Internationalism Nr. 111, Zeitung der IKS in den USA) waren sicherlich ein Ausdruck der Stärken und Schwächen sowie der Grenzen der Arbeiterklasse heute. Denn es gab auf der einen Seite eine Kampfbereitschaft, die Weigerung, die Opfer ohne Widerstand hinzunehmen, eine Bereitschaft, sich zu versammeln und über die Bedürfnisse und Mittel des Kampfes zu diskutieren, sowie auch ein gewisses Misstrauen gegenüber den gewerkschaftlichen Manövern; auf der anderen Seite ein mangelndes Selbstvertrauen, eine mangelnde Entschlossenheit der Arbeiter zur Überwindung der gewerkschaftlichen Hindernisse, damit sie offen in den Kampf eintreten und versuchen können, die Ausdehnung auf andere Bereiche in die Hand zu nehmen.
Die Lügen über die gute Gesundheit der Wirtschaft zielen darauf ab, die Bewusstwerdung der Arbeiterklasse zu verhindern und vor allem so lange wie möglich zu verzögern. Es geht nicht so sehr darum, die Bewusstwerdung über die Angriffe und die Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verhindern – denn die Arbeiter erleben das alltäglich und sind sich darüber im klaren –, sondern vor allem die Bewusstwerdung über den Bankrott des Kapitalismus soll verhindert werden. Und auf ideologischer und politischer Ebene steht die ständige und systematische Kampagne über die Notwendigkeit der Verteidigung der Demokratie und ihrer Verstärkung im Mittelpunkt der politischen Offensive der Bourgeoisie gegen das Proletariat in der heutigen Zeit.
Auf geschichtlicher Ebene steht viel auf dem Spiel. Für den Kapitalismus geht es darum, die Entwicklung von massiven und vereinten Kämpfen so lange wie möglich hinauszuschieben und sie in Sackgassen zu lenken, um damit auch eine Verstärkung des Selbstbewussteins der Arbeiter zu vereiteln. Damit sollen die Abwehrkämpfe der Arbeiter erschöpft, zerstreut und schließlich in Niederlagen geführt werden. Es wäre eine Katastrophe für die ganze Menschheit, wenn das internationale Proletariat in den zukünftigen entscheidenden Klassenzusammenstößen geschlagen und zu Boden geworfen werden würde.
R.L. 26.3.00
[i] [15] Die Übersetzung der Zitate aus der englischen bzw. französischen Presse ist von uns.
[ii] [16] Teilzeitarbeit und Flexibilität sowie Zahlentricks auch in Großbritannien: „Obwohl es ein wichtiges Faktum ist, wird der große Rückgang der aktiven Bevölkerung meist verschwiegen [....] . Ein anderer Faktor ist zu berücksichtigen: der starke Anstieg der Teilzeitarbeit, denn seit 1992 sind zwei von drei neu geschaffenen Arbeitsplätzen Teilzeitjobs. Das ist ein Rekord in Europa! Schließlich verfährt man nach einem alten Rezept, die Arbeitslosenzahlen werden in Großbritannien frisiert. Jeder Arbeitswillige, der aber nicht aktiv eine Beschäftigung sucht (d.h. eine Million Menschen) wird aus der Statistik gestrichen, genauso wie diejenigen, die nicht sofort zur Arbeitsaufnahme zur Verfügung stehen (ca. 200000)“ (Le Monde Diplomatique, Febr. 1998). Siehe auch Le Monde Diplomatique April 1998 mit Zahlen zu den prekären Arbeitsbedingungen und Zwangsteilzeitarbeit in den Hauptindustriestaaten USA, Großbritannien, Frankreich usw.
[iii] [17] „Das Defizit beträgt 338,9 Milliarden Dollar 1999, ein Anstieg um 53.6% im Vergleich zu den 220,6 Mrd. Dollar 1998. Seit Einführung der Statistiken, d.h. nach dem 2. Weltkrieg, gab es noch nie ein solch großes Defizit“ (Le Monde, 17.3.00).
[iv] [18] Kinder als Waren sind keine auf die armen Länder beschränkte Erscheinung, wo ein totales Chaos
herrscht. „Großbritannien ist ebenfalls europäischer Spitzenreiter der Kinderarbeit, wie ein Bericht einer unabhängigen Kommission, die Low Pay Unit, aufdeckt, der am 11. Februar veröffentlicht wurde: Zwei Millionen Jugendliche zwischen 6 und 15–16 Jahren, darunter 500000 unter 13 Jahren, gehen einer fast regelmäßigen Beschäftigung nach. Dabei handelt es sich nicht nur um geringfügige Beschäftigungen, sondern um Tätigkeiten, die normalerweise von Erwachsenen in der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe ausgeübt werden sollte, und die lächerlich gering bezahlt werden. Das Generationsdumping, das ist das neueste britische Modell“ (Le Monde Diplomatique, April 1998).
[v] [19] Wir können im Rahmen dieses Artikels die neue Entdeckung, den neusten Trick, das Internet und die „neue Ökonomie“, welche die Menschheit und den Kapitalismus aus der Sackgasse führen soll, nicht ausführlich analysieren, kritisieren und denunzieren. Wir können jedoch ganz einfach feststellen, dass der Enthusiasmus der letzten Monate am zusammenbrechen und die Raserei und spekulative Hitze auf dem Internet bereits am abkühlen ist. Die mit dem Internet verknüpften astronomischen Ziffern der Kapitalisierung der Gesellschaften an der Börse stehen in keinem Verhältnis zu den Zahlen der Bruttoumsätze und noch weniger zu den Profiten, wenn diese überhaupt existieren, was selten der Fall ist. Dass immense Kapitalmassen die „alte Ökonomie“ verlassen, also diejenige, welche Produktions- und Konsumgüter herstellt, und sich auf Unternehmen stürzen, welche nichts produzieren und nur die Spekulation zum Ziel haben, ist eine deutliche Bestätigung der Sackgasse des Kapitalismus. „Im Januar gab es einen Zustrom von 32 Milliarden Dollar in Technologiefonds, die stark wachsen (die „neue Ökonomie“ im Zusammenhang mit dem Internet). In dieser Zeit zogen die Investoren ihr Geld aus anderen Geschäften zurück, welche einen Rückgang von 13 Milliarden verzeichneten. Die Zahlen im Dezember waren genauso eindrücklich: 26 Milliarden für die Spitzentechnologie, und 13 Milliarden flohen aus anderen Sektoren.“ (International Herald Tribune, 14.3.2000)
[vi] [20] Laut den Spielregeln der Ökonomen braucht es drei aufeinanderfolgende Quartale mit zurückgehendem Wachstums, damit man „offiziell“ von Rezession sprechen kann. Doch wie The Economist hervorhebt, sind die negativen Zahlen nur Anzeichen einer „offenen“ Rezession, welche keinesfalls die Existenz einer Rezession auch im Falle positiver Zahlen in Frage stellt.
[vii] [21] Siehe die letzten Nummern der International Review mit ausführlicheren Analysen und Stellungnahmen zu den imperialistischen Konflikten, vor allem im Kosovo, Timor und Tschetschenien (Nr. 97, 98, 99, 100 engl./ franz./ span. Ausgabe)
[viii] [22] Es gilt zu erwähnen, dass „Kolumbien nach Israel und Ägypten der drittgrößte Empfänger amerikanischer Militärhilfe ist“ („Die Welt im Jahre 2000“, Courrier International).
[ix] [23] In Deutschland „haben sich die sozialen Spannungen zugespitzt (...) als die Regierung einschneidende Veränderungen in der Beschäftigungspolitik einleitete“ (International Herald Tribune, 24.3.00). Siehe auch Weltrevolution, unsere deutschsprachige zweimonatliche Presse. Zu England siehe unsere monatlich erscheinende World Revolution Nr. 228 und 229, sowie die Stellungnahme der Communist Workers Organisation in Revolutionary Perspectives Nr. 15 und 16 zu den verschiedenen Einschätzungen über die gegenwärtigen Arbeiterkämpfe. Zu Frankreich siehe unsere Monatspresse Revolution International.
Die bedeutendsten Bewegungen sind nicht die, über welche in den Medien am meisten geschrieben wird. So haben in Frankreich die zahlenmäßig unbedeutenden und korporatistischen Streiks der Steuerbeamten und im Schulwesen die Schlagzeilen mit Siegesmeldungen beherrscht, die auf das Konto der Gewerkschaften geschrieben wurden, während umgekehrt eine Vielzahl von Konflikten im privaten und öffentlichen Sektor, wie z.B. bei der Post, gegen die Einführung der 35-Stunden-Woche und deren Konsequenzen heruntergespielt, wenn überhaupt vermittelt, werden.
Polemik mit dem IBRP: Die marxistische Methode und der Aufruf der IKS gegenüber dem Krieg in Ex-Jugoslawien
- 2596 Aufrufe
Im vorliegenden Artikel wollen wir auf die Idee des IBRP, laut der unser Aufruf auf einer „idealistischen“ Methode beruhe, antworten.
„Wenn ihr in eurem Flugblatt schreibt, dass `die Weltarbeiterklasse seit den massiven Streiks vom Mai 68 in Frankreich ihre Kämpfe entfaltet und sich damit geweigert hat, sich der Logik des krisengeschüttelten Kapitalismus zu unterwerfen, (weshalb) sie die Auslösung eines 3. Weltkrieges hat verhindern können`, dann bleibt ihr Gefangene eures Schemas, welches wir schon zuvor als idealistisch charakterisiert haben und das heute für die Bedürfnisse der theoretisch-politischen Klarheit und Solidarität, um in der Arbeiterklasse zu intervenieren, besonders unbrauchbar ist.“ (Brief des IBRP vom 8.4.1999, von uns aus dem Englischen übersetzt)
Tatsächlich wäre der Idealismus für eine revolutionäre Organisation eine grosse Schwäche. Der Idealismus ist ein gewichtiges Bollwerk der bürgerlichen Philosophie. Er sieht die vorwärtstreibenden Kräfte der Geschichte in den Ideen, der Moral und den Wahrheiten, welche durch das menschliche Bewusstsein hervorgebracht wurden. Damit bildet er ein wichtiges Fundament für die verschiedenen bürgerlichen Ideologien, welche die Ausbeutung der Arbeiterklasse verschleiern und ihr jegliche Fähigkeit zur Selbstbefreiung absprechen. Die Teilung der Gesellschaft in Klassen, sowie die Möglichkeit und Notwendigkeit der kommunistischen Revolution mit dem Ziel, diese Gesellschaft zu überwinden, können nur mit einer materialistischen Sichtweise der Geschichte begriffen werden. Die Geschichte des Denkens erklärt sich aus der Geschichte des Seins, und nicht umgekehrt.
Der Idealismus und der historische Kurs
Weshalb soll denn die Auffassung des „historischen Kurses“, der zum Kräfteverhältnis zwischen den Klassen in einer gegebenen Periode Stellung bezieht und zur Schlussfolgerung kommt, dass heute nicht der Kurs hin zu einem generalisierten imperialistischen Krieg offen ist, sondern nach wie vor in Richtung einer verstärkten Klassenkonfrontation schreitet, wohl „idealistisch“ sein? Der Brief der Communist Workers Organisation (das IBRP in Grossbritannien) an die IKS, in dem der Vorschlag zu einer gemeinsamen öffentlichen Diskussionsveranstaltung zurückgewiesen wird, versucht uns dies zu erklären:
„Für euch scheint dies eine Nebensächlichkeit zu sein, doch für uns unterstreicht es, wie stark ihr von der Realität entfernt seid. Wir sind absolut bestürzt über die geringe proletarische Antwort gegenüber den momentanen Ereignissen. Das Motto „Sozialismus oder Barbarei“ hat in dieser Krise seine wahre Gültigkeit. Doch wie könnt ihr weiterhin behaupten, die Arbeiterklasse verhindere den Krieg, wenn die Ereignisse in Jugoslawien zeigen, wie die Imperialisten (ob klein oder gross) freie Hand haben?(...) Dieser Krieg ist nur 800 Meilen (ein Krähenflug) von London entfernt. Muss er sich nach Brighton ausdehnen, bis ihr eure Perspektiven korrigiert? Der Krieg ist ein direkter Schritt hin zur Barbarei. Wir können nicht zusammenspannen im Kampf für eine kommunistische Alternative, wenn ihr behauptet, dass man in der gegenwärtigen Periode auf die Arbeiterklasse zählen könne.“ (Brief der CWO vom 26.4.1999, von uns aus dem Englischen übersetzt)
Der Idealismus, unser Idealismus, scheint also nichts mit der „Realität“, den „Ereignissen“, zu tun zu haben, welche das IBRP als Tatsachen beschreibt. Der vom IBRP erhobene schwerwiegende Vorwurf des Idealismus ist kaum brauchbar, da er eine historische Frage auf ein Problem des „gesunden Menschenverstandes“ reduziert.
Dieser kurze Abschnitt, in welchem das IBRP seine Version der Realität darstellt, entbehrt jedoch einer seriösen materiellen Grundlage und gründet allzufest auf Überlegungen des „gesunden Menschenverstandes“, die durch kurzzeitige und lokale Fakten bestimmt sind. Sicherlich passt der Ausdruck „Sozialismus oder Barbarei“ zur gegenwärtigen Situation: die historischen Alternativen der zwei hauptsächlichen Klassenfeinde in der Gesellschaft stehen auf dem Balkan auf dem Spiel. Das IBRP widerspricht sich einige Zeilen später, wenn es behauptet, das Proletariat und seine historische Perspektive, der Sozialismus, habe in der gegenwärtigen Situation kein Gewicht.
Das IBRP hält die Fahne der kommunistischen Alternative offenbar alleine auf der ganzen Welt aufrecht. Seine widersprüchlichen Analysen über die Realität, die „unmittelbare“ Realität, die „wirklichen Ereignisse“ sind nicht „dialektisch“ wie es das IBRP gerne möchte, da es nicht fähig ist, zu begreifen, wie sich die grundlegenden historischen Tendenzen in einer gegebenen Situation ausdrücken.
Während die IKS versucht hat, zumindest das historische Gewicht der Arbeiterklasse in bezug auf den Krieg auf dem Balkan zu verstehen, ohne den Ernst der Situation herunterzuspielen, begibt sich das IBRP auf die Ebene des Empirismus à la Bacon und Lockei [24], und misst die Ereignisse an ihrer geografischen Nähe zu Brighton und London. Das Proletariat ist offenbar keine Kraft, „auf die man in der gegenwärtigen Periode zählen kann“, da es keine greifbaren Fakten gibt, welche dies beweisen und die sich empirisch belegen lassen. Das IBRP sieht in der heutigen historischen Periode das Proletariat nicht, riecht, fühlt oder hört es nicht, und deshalb existiert es nicht. Und jeder, der behauptet, die Arbeiterklasse sei eine Kraft, auch wenn eine bescheidene, ist offenbar ein Idealist.
So werden die Gegentendenzen zur anscheinenden Abwesenheit des Proletariats – vor allem die mangelnde Kriegsbegeisterung der Arbeiterklasse in Westeuropa und den USA – übersehen. Doch wer mit der historischen Wirklichkeit in Einklang stehen will, muss auch die unter der Oberfläche verborgenen Tendenzen in den Ereignissen wahrnehmen, die manchmal nur ein negativer Abdruck der Situation sind, wie eine Spur im Sand.
Eine Methode, welche die Ereignisse nur als simple Fakten betrachtet, ohne die historischen Zusammenhänge mit einzubeziehen, ist nur in einem metaphysischen Sinne materialistisch:
„Und indem, wie dies durch Bacon und Locke geschah, diese Anschauungsweise aus der Naturwissenschaft sich in die Philosophie übertrug, schuf sie die spezifische Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die metaphysische Denkweise. Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre Gedankenabbilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem andern und ohne das andre zu betrachtende, feste, starre, ein für allemal gegebne Gegenstände der Untersuchung. Er denkt in lauter unvermittelten Gegensätzen; seine Rede ist ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel. Für ihn existiert ein Ding entweder, oder es existiert nicht: Ein Ding kann ebenso wenig es selbst und ein andres sein. Positiv und negativ schliessen einander absolut aus; Ursache und Wirkung stehn ebenso in starrem Gegensatz zueinander. Diese Denkweise erscheint uns auf den ersten Blick deswegen äusserst einleuchtend, weil sie diejenige des sogenannten gesunden Menschenverstands ist. Allein der gesunde Menschenverstand, ein so respektabler Geselle er auch in dem hausbackenen Gebiet seiner vier Wände ist, erlebt ganz wunderbare Abenteuer, sobald er sich in die weite Welt der Forschung wagt; und die metaphysische Anschauungsweise, auf so weiten, je nach der Natur des Gegenstands ausgedehnten Gebieten sie auch berechtigt und sogar notwendig ist, stösst doch jedes Mal früher oder später auf eine Schranke, jenseits welcher sie einseitig, borniert, abstrakt wird und sich in unlösliche Widersprüche verirrt, weil sie über den einzelnen Dingen deren Zusammenhang, über ihrem Sein ihr Werden und Vergehen, über ihrer Ruhe ihre Bewegung vergisst, weil sie vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. (Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW, Bd. 19, S. 203-204)
Der Empirismus - der gesunde Menschenverstand - setzt den historischen Materialismus und seine dialektische Methode dem Idealismus gleich und versteht nicht, dass der Marxismus sich weigert, die Dinge nur als einzelne Erscheinungen zu betrachten.
Das IBRP widerspricht der Geschichte der revolutionären Bewegung, wenn es das „Schema“ des historischen Kurses als idealistisch bezeichnet. War die linke Fraktion der italienischen Kommunistischen Partei, welche in den 30er Jahren die Zeitschrift BILAN herausgab, vom Idealismus beseelt, als sie dieses Konzept entwickelte, um herauszufinden, ob die Geschichte in Richtung Krieg oder Revolution führe? ii [24] Dies ist eine Frage, auf die das IBRP eine Antwort geben muss, da BILAN ein Bestandteil der Geschichte der Italienischen Kommunistischen Linken ist, auf welche es sich beruft.
Auf der einen Seite meint das IBRP, den historischen Materialismus einseitig anwenden zu können, um eine angebliche und offensichtliche Wahrheit der Tatsachen zu proklamieren; auf der anderen Seite aber greift es auf mechanische Schemata zurück, um nicht existierende Tatsachen zu erfinden. In seinem internationalistischen Flugblatt gegen den Krieg in Ex-Jugoslawien behauptet es, dass der Hauptgrund der NATO-Intervention „die Kontrolle über das Öl im Kaukasus“ sei. Wie ist das IBRP zu dieser Fantasie gelangt? Durch die Anwendung des Schemas, nach dem die Haupttriebkraft des Imperialismus heute die Suche nach ökonomischen Profiten sei, „um sich die Kontrolle und Verwaltung des Erdöls anzueignen, der Ölprofite und der Finanz- und Handelsmärkte“.
Dies ist zwar ein materialistisches Schema, jedoch eines mechanischen Materialismus. Der Hauptfaktor des modernen Imperialismus sind zwar die wirtschaftlichen Widersprüche des Kapitalismus, doch übergeht dieses Schema die politischen und strategischen Faktoren, welche im Konflikt zwischen den Ländern Überhand genommen haben.
Die marxistische Methode und die Intervention der Revolutionäre gegen den Krieg
Auch wenn das IBRP in der Frage der Rolle der Arbeiterklasse in der Geschichte eine empiristische Herangehensweise übernimmt, zeigt es in den generellen und entscheidenden Fragen die Fähigkeit, eine marxistische Sichtweise anzuwenden, zu welcher der gesunde Menschenverstand nicht fähig ist. Sein Flugblatt über den Krieg – genauso wie die Flugblätter der anderen Gruppen der Kommunistischen Linken – deckte auf, dass hinter den angeblich humanitären Zielen der Grossmächte im Kosovo eine breite und unvermeidbare Konfrontation steckte. Es zeigte auf, wie die Pazifisten und Linken trotz ihrer grossen Erklärungen gegen die Gewalt in Wirklichkeit das Feuer des Krieges schürten. Und schliesslich, auch wenn es das Proletariat nicht als eine Kraft in der heutigen Situation sehen kann, hob es dennoch hervor, dass der revolutionäre Kampf der Arbeiterklasse das alleinige Mittel ist, um der um sich greifenden kapitalistischen Barbarei ein Ende zu setzen.
Die gemeinsame internationalistische, proletarische Position gegen den imperialistischen Krieg der verschiedenen Gruppen der Kommunistischen Linken, die auch von der IKS und dem IBRP geteilt wird, ist marxistisch und der Methode des historischen Materialismus treu.
Spätestens hier bricht der Vorwurf des Idealismus gegenüber der IKS zusammen.
Das Problem der Einheit in der Geschichte der revolutionären Bewegung
In seinem Brief an Wilhelm Bracke von 1875, der die Einleitung zur Kritik des Gothaer Programms der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands bildete, schrieb Marx: „Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme“(MEW Bd. 19, S. 13) Dieser berühmte Satz ist ein Referenzpunkt für die gemeinsame Aktion der Revolutionäre. Er ist eine perfekte Anwendung der ebenfalls berühmten Thesen über Feuerbach von 1845, die zeigten, dass der historische Materialismus keine neue beschauliche Philosophie ist, sondern eine Waffe des proletarischen Handelns:
„Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst werden und rationell verstanden werden.“ und „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt darauf an sie zu verändern.“ (Thesen über Feuerbach, MEW, Bd. 3, S. 6-7)
In seinem Einleitungsbrief und dem folgenden Text kritisierte Marx scharf das Einheitsprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands wegen der gegenüber den Lassalleanern gemachten Kompromisse.iii [24] Er ging davon aus, dass „...eine Übereinkunft für Aktionen gegen den gemeinsamen Feind...“ von grosser Wichtigkeit war und schlug vor, die Abfassung des Programms „...bis zur Zeit aufzuschieben, wo dergleichen durch längere gemeinsame Tätigkeit vorbereitet war...“. (Brief an Bracke, a.a.O.) Die grossen Differenzen waren kein Hindernis zu einer gemeinsamen Aktion, sondern wurden gerade in diesem Zusammenhang ausgetragen.
Wie wir schon in unserem Aufruf hervorgehoben haben, wandten Lenin und die anderen Vertreter der marxistischen Linken dieselbe Methode auf der Konferenz von Zimmerwald im September 1915 an, wo sie das aufsehenerregende Manifest gegen den Ersten Weltkrieg unterschrieben. Dennoch hatten sie Kritiken und Uneinigkeiten an den schwerwiegenden Schwächen des Manifests angebracht und legten ihren eigenen Standpunkt iv [24] zur Abstimmung vor, der von der Mehrheit der Konferenz verworfen wurde.
Das IBRP hat bereits versucht aufzuzeigen, dass dieses Beispiel der Einigkeit unter den Revolutionären unter anderen Umständen stattfand und sich deshalb nicht auf die heutige Zeit übertragen lasse. In anderen Worten: Das IBRP will den Faden, der aus der Vergangenheit von Zimmerwald hin zur Aktualität führt, nicht sehen. Es sieht darin nur eine abgeschlossene Episode aus der Vergangenheit, welche nur noch für die Geschichtsschreiber von Wert ist.
Die unterschiedlichen Umstände, unter denen sich die Einheit der Revolutionäre in der Vergangenheit bewährte, beweisen nicht ihre Ungültigkeit für die heutige revolutionäre Bewegung, sondern vielmehr, dass die Grundsätze immer noch anwendbar sind.
Das Bemerkenswerteste an der Verteidigung der Zusammenarbeit der Revolutionäre durch Marx und Lenin in den zwei angeführten Beispielen ist, dass die Differenzen zwischen den Eisenachern und den Lassalleanern im einen, und zwischen der marxistischen Linken (vor allem den Bolschewiki) und den Sozialisten von Zimmerwald im anderen Beispiel, erheblich grösser waren als die Meinungsverschiedenheiten unter den Gruppen der Kommunistischen Linken von heute.
Marx befürwortete die Zusammenarbeit in einer Partei mit einer Tendenz, welche den „freien Staat“, die „Gleichheit“ und „die gerechte Verteilung des Arbeitsertrags“ verteidigte und vom „ehernen Lohngesetz“ und anderen bürgerlichen Vorurteilen sprach. Das Zimmerwalder Manifest war eine gemeinsame Stellungnahme gegen den ersten imperialistischen Weltkrieg, einerseits durch die unbeugsamen Internationalisten, welche zum Klassenkrieg gegen den imperialistischen Krieg und zur Bildung einer neuen Internationalen aufriefen, und andererseits den Pazifisten, Zentristen und anderen Zweiflern, die mit der Versöhnung mit den Sozialpatrioten liebäugelten und die Parolen der revolutionären Linken in Frage stellten. Im Gegensatz dazu existieren im heutigen kommunistischen Milieu keine Konzessionen gegenüber demokratischen und humanistischen Illusionen. Es gibt eine gemeinsame Anprangerung des Krieges als imperialistischen Krieg, eine gemeinsame Denunzierung des Pazifismus und Chauvinismus der Linken und ein gemeinsames Engagement für den „Klassenkrieg“, um dem imperialistischen Krieg die Perspektive und Notwendigkeit einer proletarischen Revolution entgegenzusetzen.
Lenin unterzeichnete das Zimmerwalder Manifest mit all seinen Schwächen und Haltlosigkeiten, um die tatsächliche Bewegung voranzutreiben. In einem direkt nach der ersten Zimmerwalder Konferenz veröffentlichten Artikel schreibt er:
„Dass dieses Manifest einen Schritt vorwärts macht zum wirklichen Kampf gegen den Opportunismus, ist eine Tatsache. Es wäre Sektierertum, wollte man darauf verzichten, gemeinsam mit der Minderheit der Deutschen, Franzosen, Schweden und Schweizer diesen Schritt vorwärts zu machen, solange wir uns die volle Freiheit und die volle Möglichkeit wahren, die Inkonsequenz zu kritisieren und mehr anzustreben. Es wäre schlechte militärische Taktik, wollte man es ablehnen, gemeinsam mit der wachsenden internationalen Protestbewegung gegen den Sozialchauvinismus zu marschieren, weil sich diese Bewegung langsam entwickelt, weil sie „nur“ einen Schritt vorwärts macht, weil sie bereit und gewillt ist, morgen wieder einen Schritt zurück zu machen und mit dem alten Internationalistischen Büro Frieden zu schliessen.“ (Lenin, Ein erster Schritt, 11. Oktober 1915, Ges. Werke, Bd. 21, S. 393-394)
Radek gelangte in einem anderen Artikel über diese Konferenz zur selben Schlussfolgerung:
„... die Linke hat aus folgenden Gründen beschlossen, für die Resolution zu stimmen. Es wäre doktrinär und sektiererisch, uns von den Kräften abzuwenden, welche in einem gewissen Grade begonnen haben, in ihrem eigenen Land gegen den Sozialpatriotismus zu kämpfen, während sie mit heftigsten Attacken der Sozialpatrioten konfrontiert sind.“ (Die Zimmerwalder Linke, von uns aus dem Englischen übersetzt)
Zweifellos müssen die heutigen Revolutionäre der Entfaltung des imperialistischen Krieges mit derselben Methode entgegentreten wie Lenin und die Zimmerwalder Linke gegen den Ersten Weltkrieg. Das Vorankommen der revolutionären Bewegung als Ganzes ist die wichtigste Priorität. Der hauptsächliche Unterschied zwischen den Bedingungen von damals und denen von heute ist der, dass es heute eine viel grössere Übereinstimmung unter den internationalistischen Gruppen gibt als zwischen der Linken und dem Zentrum in Zimmerwaldv [24], und deshalb auch eine viel grössere Notwendigkeit und Berechtigung zu einer gemeinsamen Aktion.
Eine gemeinsame internationalistische Erklärung und andere Ausdrücke von gemeinsamen Aktionen gegen den Krieg der NATO hätte die politische Präsenz der Kommunistischen Linken im Vergleich mit dem Widerhall, den jede Gruppe alleine hat, enorm verstärkt. Dies wäre ein handfester Gegenpol gegen die nationalistischen Spaltungen der herrschenden Klasse gewesen. Das gemeinsame Bestreben, die reale Bewegung voranzubringen, hätte ein verstärkter Anziehungspol für nach kommunistischen Positionen suchende Elemente dargestellt, welche heute von der verwirrenden Verstreutheit der einzelnen Gruppen enttäuscht sind. Und die Vereinigung der Kräfte hätte auf die Arbeiterklasse als ganzes eine grössere Wirkung gehabt. Zudem hätte dies ein historischer Referenzpunkt für die Revolutionäre der Zukunft dargestellt, wie dies beim Zimmerwalder Manifest der Fall war, welches über die Schützengräben hinweg ein Hoffnungsschimmer für die angehenden Revolutionäre war. Wie soll man eine politische Methode beschreiben, welche eine solche gemeinsame Aktion zurückweist? Die Antwort wurde von Lenin und Radek gegeben: sie ist doktrinär und sektiererisch. vi [24]
Wenn wir hier nur zwei historische Beispiele aufführen, dann aus Platzgründen und nicht weil es an gemeinsamen Aktionen unter Revolutionären in der Vergangenheit gemangelt hätte. Die Erste, Zweite und Dritte Internationale wurden alle mit der Teilnahme von Elementen gegründet, die nicht einmal die wichtigsten marxistischen Voraussetzungen erfüllten, wie den Anarchisten in der Ersten Internationale oder den französischen und spanischen Anarchosyndikalisten, welche den Internationalismus und die Russische Revolution verteidigten und in die Kommunistische Internationale aufgenommen wurden.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass der Spartakist Karl Liebknecht, der von der gesamten marxistischen Linken als einer der heroischsten Verteidiger der Arbeiterklasse im Ersten Weltkrieg anerkannt wurde, ein Idealist im wahren Sinne des Wortes war, da er den historischen Materialismus zugunsten des Kantismus zurückwies.
Die Methode der Konfrontation der Positionen in der revolutionären Bewegung
Die Mehrheit der heute existierenden revolutionären Gruppierungen gehen davon aus, dass eine Einheit zu einer wenn auch nur kleinen gemeinsamen Aktion die wichtigen Differenzen mit den anderen überdecken oder verwischen würden. Nichts ist falscher als dies! Nach der Gründung der deutschen Sozialdemokratischen Partei und nach Zimmerwald gab es keineswegs eine opportunistische Verwässerung der Meinungsverschiedenheiten, die unter den einzelnen Teilnehmern existierten, sondern im Gegenteil eine Zuspitzung und schlussendlich eine Bestätigung der klarsten Positionen in der Praxis. Die Marxisten errangen in der deutschen Sozialdemokratie und nach 1875 in der Zweiten Internationale über die Lassalleaner klar die Oberhand. Nach Zimmerwald setzten sich die unbeugsamen Positionen der Linken, welche in der Minderheit gewesen waren, gänzlich durch. Vor allem als die revolutionäre Welle 1917 in Russland begann, wurde ihre Politik durch den Gang der Ereignisse und das Zurückfallen der Zentristen in die Arme der Sozialpatrioten bestätigt.
Hätten sie ihre Positionen nicht in einer wenn auch beschränkten gemeinsamen Aktion auf den Prüfstein gelegt, wäre deren Erfolg nicht möglich gewesen. Die Kommunistische Internationale hat ihre Wurzeln in der Zimmerwalder Linken. vii [24]
Diese Beispiele aus der Geschichte der revolutionären Bewegung bestätigen ebenfalls eine bekannte These über Feuerbach:
„Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, i.e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit des Denkens – das von der Praxis isoliert ist – ist eine rein scholastische Frage.“ (MEW, Bd. 3, S. 5, Hervorhebungen durch Marx selbst)
Diejenigen Gruppen der Kommunistischen Linken, welche einen praktischen Rahmen für ihre gemeinsame Bewegung zurückweisen, in dem ihre Differenzen ausgetragen werden könnten, reduzieren ihre Meinungsverschiedenheiten über die marxistische Theorie auf ein scholastisches Niveau. Auch wenn diese Gruppen den Willen zeigen, die Gültigkeit ihrer Positionen der Praxis des breiten Klassenkampfes zu stellen, so bleibt dies ein frommer Wunsch, solange sie ihr eigenes Haus nicht in Ordnung bringen und ihre Positionen in der praktischen Zusammenarbeit mit den anderen internationalistischen Tendenzen nicht überprüfen.
Die Anerkennung eines Minimums an gemeinsamer Aktivität ist für Elemente, die aus den Reihen der Arbeiterklasse kommen, besonders in den Ländern, in welchen die Kommunistische Linke noch über keine organisierte Präsenz verfügt, die Basis, auf der die Meinungsverschiedenheiten klar dargelegt, konfrontiert, getestet und überprüft werden können. Die heutigen kommunistischen Gruppierungen weigern sich leider, dies zu verstehen. Die Gruppierungen der bordigistischen Strömung verteidigen das Sektierertum als ein Prinzip. Ohne selbst soweit zu gehen versucht das IBRP jegliche seriöse Konfrontation der politischen Positionen zu umgehen: „Wir kritisieren die IKS (...), auf ein, wie sie es nennt ‚politisches proletarisches Milieu‘ zu warten, welches ihre immer seltsameren politischen Anliegen aufnehmen und debattieren soll.“ viii [24] (von uns aus dem Englischen übersetzt) Dies steht in Internationalist Communist Nr. 17, der Zeitschrift des IBRP, eine Nummer, die vor allem der Darstellung der Differenzen mit der IKS gewidmet ist und eine Antwort an suchende Elemente in Russland geben soll, Elemente die sich gerade über die Frage der Verantwortung der Internationalisten und ihrer gemeinsamen Aktion gegen den imperialistischen Krieg in Unklarheit befinden. Es ist wirklich bedauernswert, dass das internationalistische Milieu jede seriöse Debatte aus Angst vor der Konfrontation der unterschiedlichen Positionen zurückweist. Die heutige revolutionäre Bewegung braucht wieder Vertrauen, wie sie die Revolutionäre der Vergangenheit in ihre Ideen und Positionen hatten.
Die Anschuldigung, nach der die IKS idealistisch sei, ist absolut haltlos. Wir erwarten zumindest Kritiken, die solide und gründlich ausgeführt sind.
Angesichts der internationalen Situation und der Herausforderung, vor der die Arbeiterklasse steht, sollte klar sein, dass die materialistische Methode der revolutionären marxistischen Bewegung eine gemeinsame Antwort erfordert. Die Kommunistische Linke war angesichts des Krieges im Kosovo nicht fähig, ihre Verantwortung voll wahrzunehmen. Doch die Herausforderungen der Zukunft werden uns dazu zwingen, dies verstärkt zu tun. 11.9.1999 Como
i [24] Francis Bacon (1561-1626) und John Locke (1632-1704) waren zwei materialistische englische Philosophen.
ii [24] In einem Artikel mit dem Titel „Der Kurs hin zum Krieg“ stellte BILAN in Nr. 29 im März 1936 die Frage des historischen Kurses ausdrücklich: „Die heutigen Regierenden (...) haben ein Recht auf die ewige Anerkennung der kapitalistischen Herrschaft, da sie das Weltproletariat wie nie zuvor plattgewalzt haben. Doch durch die Erwürgung der einzigen Kraft, welche fähig ist, eine neue Gesellschaft zu gründen, haben sie auch die Türe zum unabwendbaren Krieg geöffnet, dem extremsten Ausdruck der Widersprüche der kapitalistischen Herrschaft. (...) Wann wird der Krieg ausbrechen? Niemand kann dies voraussagen. Nur eines ist sicher: alles ist bereit dazu.“ Ein anderer Artikel in derselben Nummer kommt auf die Frage der Vorbedingungen des Krieges zurück: „Wir sind überzeugt, dass mit der Politik des sozial-zentristischen Verrats der das Proletariat als Klasse in den `demokratischen` Ländern zur Ohnmacht geführt hat; dass mit dem Faschismus, der mit dem Terror zum selben Ziel gelangte, die Weichen für eine neue weltweite Schlächterei gestellt worden sind. Die Degenerierung der UdSSR und der Komintern ist eines der alarmierendsten Signale für den Kurs hin zum Abgrund des Krieges.“
Nebenbei ist es interessant, das IBRP und die bordigistischen Gruppen an den Vorschlag zu erinnern, welchen BILAN den übriggebliebenen kommunistischen Kräften machte: „Die alleinige Antwort, die diese Kommunisten den Ereignissen, in denen wir uns befinden, entgegensetzen können, die einzige politische Handlung, die auf dem Weg zum Sieg von morgen ein Wegweiser sein kann, ist eine internationale Konferenz, welche die traurigen Überbleibsel des Gehirns der Weltarbeiterklasse sammelt.“ Unsere Sorge, den historischen Kurs zu erkennen, und unser Appell zu einer gemeinsamen Verteidigung des Internationalismus befinden sich in der Tradition der Italienischen Linken, ob man dies nun wahrhaben will oder nicht.
iii [24] Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands entstand durch die Vereinigung der zwei grossen Strömungen, die kleinbürgerliche, nach ihrem Führer Lassalle benannt, und die marxistische, die Eisenacher, benannt nach der Stadt, in der sich diese Strömung als Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands 1869 gegründet hatte.
iv [24] Wir haben die Gültigkeit einer einheitlichen Politik wie der Zimmerwalder Linken auch für das internationalistische Lager von heute in der Internationalen Revue Nr. 44 (engl./franz./span.) beschrieben.
v [24] Man kann sogar sagen, dass die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Zimmerwalder Linken selbst grösser waren als diejenigen innerhalb des heutigen internationalistischen Lagers. Es gab bedeutende Differenzen, ob die Möglichkeit der nationalen Befreiung noch vorhanden war und ob deshalb die Losung „Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ in der marxistischen Politik noch eine Gültigkeit hatte. Die verschiedenen und sich widersprechenden Auffassungen Lenins auf der einen und Trotzkis und Radeks auf der anderen Seite über den Aufstand von Ostern 1916 in Dublin zeigte klar die Differenzen innerhalb der Zimmerwalder Linken auf. Selbst innerhalb der bolschewistischen Partei existierten zu dieser Zeit bedeutende Differenzen zur Forderung der nationalen Selbstbestimmung mit Bucharin und Piatakov, welche diese als überlebt bezeichneten, und über die Gültigkeit der Losung des „revolutionären Defätismus“ und der „Vereinigten Staaten von Europa“.
vi [24] Lenins Politik der internationalen Einheit beschränkte sich nicht auf die Zimmerwalder Bewegung. Er wandte sie auch innerhalb der russischen Sozialdemokratie an, indem er die Zusammenarbeit mit Trotzkis nicht-bolschewistischer Gruppe Nasche Slovo befürwortete. Wenn diese Bemühungen bis hin zur Russischen Revolution nicht von Erfolg gekrönt waren, dann nur wegen der Zweifel und des Sektierertums Trotzkis.
vii [24] „Die Zimmerwalder und Kienthaler Konferenzen hatten zu der Zeit Bedeutung, wo es wichtig war, all diejenigen Elemente des Proletariats zu vereinigen, welche bereit waren, in dieser oder jener Form gegen das imperialistische Morden zu protestieren.(...) Die Zimmerwalder Vereinigung hat sich überlebt. Alles was wirklich revolutionär in der Zimmerwalder Vereinigung war, geht in die Kommunistische Internationale über.“ Dieser Text ist von Rakowski, Lenin, Sinowjew, Trotzki und Platten unterzeichnet. (Erklärung der Teilnehmer von Zimmerwald auf dem Kongress der Kommunistischen Internationale, Die Kommunistische Internationale Bd. 1, S. 97, Intarlit Verlag 1984)
viii [24] „We critisice the ICC (…) for expecting what they call the “proletarian political milieu” to take up and debate their increasingly outlandish political concerns.”
Geographisch:
- Balkan [25]
Historische Ereignisse:
Theoretische Fragen:
- Krieg [27]
Wirtschaftskrise: II. Die 80er Jahre
- 8259 Aufrufe
30 Jahre offene Krise des Kapitalismus
II. Die 80er Jahre
In der letzten Ausgabe der Internationalen Revue sahen wir, wie der Kapitalismus seit 1967 dem offenen Wiederauftreten seiner historischen Krise durch die Entwicklung der staatlichen Wirtschaftsintervention begegnet war. Damit versuchte die Bourgeoisie, die Krise zu verlangsamen und ihre schlimmsten Auswirkungen auf die Peripherie, auf die schwächsten Sektoren ihres eigenen nationalen Kapitals und natürlich auf die Gesamtheit der Arbeiterklasse zu schieben. Wir analysierten die Entwicklung der Krise und die Antwort des Kapitalismus in den 70er Jahren. Nun wollen wir auf die Entwicklung ihres Verlaufs während der 80er Jahre blicken. Diese Analyse wird es uns gestatten zu begreifen, dass die staatliche Politik der „Krisenbegleitung, um den Absturz zu verzögern und abzufedern“, nichts gelöst hat, noch dass sie irgendetwas anderes gebracht hat als die Vertiefung der fundamentalen Widersprüche des Kapitalismus.
Die Krise von 1980-82
Auf dem 2. Internationalen Kongress der IKS, der 1977 abgehalten worden war1, warfen wir ein Schlaglicht auf die Art und Weise, wie die vom Kapitalismus geförderte expansionistische Politik immer weniger Wirkung zeigte und in die Sackgasse geraten war. Die Schwankungen zwischen „Erholung“, die die Inflation provozierte, und plötzlichen Drosselungen, die in der Rezession endeten, führten zu dem, was „Stagflation“ genannt wird (Rezession und Inflation zur gleichen Zeit) und demonstrierten die ernste Lage des Kapitalismus sowie den unlösbaren Charakter dieser Widersprüche. Die unheilbare Krankheit der Überproduktion verschärfte ihrerseits global die imperialistischen Spannungen dergestalt, dass es in den letzten Jahren dieses Jahrzehnts eine bemerkenswerte Verschärfung militärischer Konfrontationen und die Entwicklung des Rüstungswettlaufes sowohl auf der nuklearen als auch auf der konventionellen Ebene gegeben hat2.
Die 80er Jahre begannen mit einer offenen Rezession, die bis 1982 dauerte und die in vielerlei Hinsicht schlimmer war als die vorherige Rezession 1974/75: Die Produktion stagnierte (die Wachstumsraten waren in Großbritannien und den europäischen Ländern negativ), die Arbeitslosigkeit wuchs spektakulär (1982 registrierte man in den USA allein in einem Monat den Verlust von einer halben Million Arbeitsplätzen); die Industrieproduktion fiel in Großbritannien 1982 auf den Stand von 1967 zurück, und das erste Mal seit 1945 ging der Welthandel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zurück3. Dies führte zur Schließung von Fabriken und zur Massenarbeitslosigkeit in einem Maße, wie es seit 1929 nicht mehr gesehen worden war. Was industrielle und landwirtschaftliche Verwüstung genannt wurde, begann sich nun zu entwickeln und setzte sich seither ständig fort. Einerseits sahen ganze Regionen alter traditioneller Industrien die systematische Schließung von Fabriken und Zechen, und die Arbeitslosigkeit schoss auf 30%. Dies passierte in solchen Gebieten wie Manchester, Liverpool oder Newcastle in Großbritannien, Charleroi in Belgien, Lorraine in Frankreich oder Detroit in den Vereinigten Staaten. Andererseits war die landwirtschaftliche Überproduktion in vielen Ländern dermaßen groß, dass die Regierungen für die Beseitigung weiter landwirtschaftlicher Flächen zahlten und die Hilfen für Landwirtschaft und Fischerei brutal beschnitten wurden, was den wachsenden Ruin kleiner und mittlerer Bauern sowie Arbeitslosigkeit unter den Landarbeitern verursachte.
Nach 1983 gab es jedoch eine wirtschaftliche Erholung, die anfangs auf die Vereinigten Staaten beschränkt blieb, aber ab 1984/85 auch auf Europa und Japan übergriff. Diese Erholung wurde grundsätzlich durch die kolossalen Schuldenstände der Vereinigten Staaten bewirkt, die die Produktion steigerten und der Wirtschaft Japans und Westeuropas stufenweise erlaubten, auf den Zug des Wachstums aufzuspringen.
Es handelte sich hier um die berühmten „Reaganomics“, welche damals als die große Lösung der Krise des Kapitalismus vorgestellt wurden. Diese „Lösung“ wurde auch als Rückkehr zu den „Ursprüngen des Kapitalismus“ bezeichnet. Angesichts der „Exzesse“ des Staatsinterventionismus, die die staatliche Wirtschaftspolitik in den 70er Jahren kennzeichneten (Keynesianismus) und denen „Sozialismus“ oder der „Hang“ zum Sozialismus nachgesagt wurde, präsentierten sich die neuen Wirtschaftstheoretiker selbst als „Neoliberale“, und ihre Rezepte für „weniger Staat“, den „freien Markt“, etc. wurden in nah und fern gerühmt.
In Wahrheit waren die Reaganomics weder die große Lösung (ab 1985 war es, wie wir sehen werden, notwendig, den Preis für die Schuldenstände der USA zu zahlen), noch handelte es sich um einen angeblichen „Rückzug des Staates“. Was die Reagan-Regierung tat, war, ein gigantisches Rüstungsprogramm (unter dem Namen „Star Wars“ leistete es einen mächtigen Beitrag dafür, ihren rivalisierenden Block in die Knie zu zwingen) unter massiver Zuhilfenahme staatlicher Schulden aufzulegen. Die berühmte Lokomotive wurde nicht mit dem gesunden Brennstoff einer wirklichen Marktexpansion betrieben, sondern mit dem verdünnten Brennstoff allgemeiner Schulden.
Die „neue“ Schuldenpolitik
Das einzig Neue an Reagans Politik war die Art und Weise, wie diese Schuldenstände erreicht wurden. Während der 70er Jahre war der Staat direkt verantwortlich für die Finanzierung der wachsenden Defizite der öffentlichen Ausgaben, indem er die Geldmenge erhöhte. Dies bedeutete, dass der Staat das Geld bereitstellte, das die Banken benötigten, um Geld an Geschäfte, an private Kreditnehmer oder an andere Staaten auszuleihen. Dies verursachte einen kontinuierlichen Wertverlust des Geldes und führte so zu einer explosionsartigen Inflation.
Wir haben bereits den wachsenden Engpass gesehen, in dem sich die Weltwirtschaft befand, insbesondere die Wirtschaft Amerikas Ende der 70er Jahre. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, änderte der Präsident der Federal Reserve, Volcker, in den letzten beiden Jahren der Carter-Administration radikal die Kreditpolitik. Er schloss die Geldhähne, was die Rezession von 1980-82 provozierte, aber gleichzeitig den Weg öffnete für eine massive Finanzierung durch die Ausgabe von Obligationen und Anleihen, die konstant auf dem Markt erneuert wurden. Diese Orientierung wurde übernommen und verallgemeinert von der Reagan-Administration und über die ganze Welt verbreitet.
Der Mechanismus des „Finanz-Engineering“ war wie folgt. Auf der einen Seite gab der Staat Obligationen und Anleihen aus, um seine beträchtlichen und ständig wachsenden Defizite zu finanzieren, zu denen auch die Finanzmärkte (Banken, Geschäfte, Individuen) beisteuerten. Auf der anderen Seite drängte er die Banken dazu, nach Anleihen auf den Finanzmärkten zu suchen und gleichzeitig Obligationen und Anleihen zu emittieren sowie die sukzessive Expansion von Kapital (Ausgabe von Aktien) durchzuführen. Es handelte sich hierbei um einen höchst spekulativen Mechanismus, der versuchte, die Entwicklung einer wachsenden Menge von fiktivem Kapital (toter Mehrwert, der nicht in neues Kapital investiert werden kann) auszubeuten.
Auf diese Weise wurde das Gewicht privater Fonds größer als das der öffentlichen Fonds bei der Finanzierung der Schulden (öffentlicher und privater).
Die Finanzierung der öffentlichen Schulden in den USA (in Milliarden Dollar):
Fonds 1980 1985 1990 1995 1997
öffentlich 24 45 70 47 40
privat 46 38 49 175 260
(Quelle: Global Development Finance)
Das heißt nicht, dass es eine Verringerung des staatlichen Gewichts (wie die „Liberalen“ behaupten) gegeben hat, vielmehr war dies eine Antwort auf die wachsenden Bedürfnisse der Finanzierung (und besonders der sofortigen Liquidität), die eine massive Mobilisierung allen verfügbaren Kapitals erforderte.
Diese angeblich „liberale“ und „monetaristische“ Politik bedeutete, dass der Rest der Weltwirtschaft die famose US-Wirtschaft finanzierte. Besonders der japanische Kapitalismus mit seinen enormen Handelsüberschüssen kaufte massive Beträge von Obligationen und Anleihen des amerikanischen Staats genauso wie die verschiedenen Emissionen durch Gesellschaften in diesem Land auf. Das Resultat war, dass die Vereinigten Staaten, die seit 1914 der Hauptkreditgeber auf der Welt gewesen waren, sich ab 1985 in einen Netto-Schuldner verwandelten und ab 1988 zum Hauptschuldner dieser Welt wurden. Eine andere Konsequenz war, dass ab dem Ende der 80er Jahre die japanischen Banken fast 50% der amerikanischen Vermögensanteile hielten. Schließlich bedeutete diese Form von Verschuldung, dass, „während in der Periode von 1980 bis 1982 die Industrieländer 49 000 Millionen Dollar mehr in den sog. Entwicklungsländern verteilten, als sie erhielten, letztere in der Periode von 1983 bis 1989 an erstere 242 000 Millionen Dollar mehr abführten“ (Prometeo, Nr. 16, Organ von Battaglia Comunista, aus dem Artikel „Eine neue Phase in der kapitalistischen Krise“, Dezember 1998).
Die Methode, die benutzt wurde, um den Zins und die Schuld selbst der ausgegebenen Obligationen zurückzuzahlen, bestand in der Ausgabe neuer Anleihen und Obligationen. Dies bedeutete wachsende Schuldenstände und das Risiko, dass die Gläubiger die neuen Ausgaben nicht zeichneten. Um weiterhin Investoren anzuziehen, gab es regelmäßige Wiederaneignungen von Dollars durch mannigfaltige künstliche Neubewertungen des Devisenaustausches. Das Resultat war einerseits eine enorme Dollarflut, die sich über den Weltmarkt ergoss, und andererseits ein gigantisches Handelsdefizit der USA, das von Jahr zu Jahr neue Rekorde brach. Die Mehrheit der Industrieländer folgte mehr oder weniger derselben Politik: Sie benutzten das Geld als ein Instrument zur Kapitalgewinnung.
All dies ermutigte eine Tendenz, die während der 90er Jahre noch vertieft wurde: die völlige Verfälschung und Manipulation des Geldes. Die klassische Funktion des Geldes im Kapitalismus war es, Wertmaßstab und Preisstandard zu sein. Um dieser Funktion nachzukommen, musste das Geld der verschiedenen Staaten durch einen minimalen Anteil wertvoller Metalle gestützt werden4. Diese Edelmetallreserven drückten tendenziell das Wachstum und die Entwicklung des Reichtums eines Landes aus, der auch durch den Wechselkurs seines Geldes dargestellt wurde.
Wir haben im vorhergehenden Artikel (Internationale Revue Nr. 24) bereits gesehen, wie der Kapitalismus das 20. Jahrhundert hindurch diese Reserven abschaffte, was bedeutete, dass das Geld ohne jegliches Äquivalent zirkulierte, mit all den Risiken, die dies zur Folge hatte. Nichtsdestotrotz stellten die 80er Jahre einen wirklich qualitativen Schritt hin zum Abgrund dar: Das schon an sich ernste Phänomen, dass das Geld vollkommen getrennt von einem Äquivalent in Gold oder Silber war, verschärfte sich im Laufe des Jahrzehnts noch. Dazu kamen: erstens das Spiel mit der Auf- und Abwertung, um Kapital anzuziehen, was ungeheure Spekulationen in ihnen hervorrief; zweitens eine immer systematischere Zuflucht zur „wettbewerbsbedingten Abwertung“, d.h. die Senkung des Geldpreises per Dekret, mit dem Ziel, die Exporte anzukurbeln.
Die Säulen dieser „neuen“ Wirtschaftspolitik waren einerseits der konstante Schneeballeffekt der massiven Emissionen von Anleihen und Obligationen und andererseits die zusammenhangslose Geldmanipulation durch die Mittel eines komplizierten und raffinierten „Finanzsystems“, das in Wahrheit das Werk des gesamten Staates und der großen Finanzinstitutionen (Banken, Sparkassen und Investmentgesellschaften, die in enger Verbindung zum Staat stehen) war. Dem äußeren Anschein nach war es ein „liberaler“ und „nicht-interventionistischer“ Mechanismus, in der Praxis war es eine typische Konstruktion des Kapitalismus der westlichen Staaten, nämlich ein Management auf der Basis einer Kombination der vom privaten und vom staatlichen Kapital dominierten Sektoren.
Diese Politik wurde als der magische Zaubertrank präsentiert, der in der Lage sei, Wirtschaftswachstum ohne Inflation zu bewerkstelligen. In den 70er Jahren sah sich der Kapitalismus vor dem unlösbaren Dilemma von Inflation oder Rezession gestellt, jetzt konvertierten die Regierungen, ungeachtet ihrer politischen Couleur („Sozialisten“, „Linke“ oder die „Mitte“), zum Glaubensbekenntnis der „Neoliberalen“ und „Monetaristen“ und behaupteten, dass der Kapitalismus dieses Dilemma überwunden hätte und dass die Inflation auf ein Niveau zwischen 2 und 5% reduziert worden sei, ohne das Wirtschaftswachstum zu beeinträchtigen.
Diese Politik des „Kampfes gegen die Inflation“ und des angeblichen „Wachstums ohne Inflation“ beruhte auf folgenden Instrumenten:
1. Die Eliminierung der „überflüssigen“ industriellen und landwirtschaftlichen Kapazitäten, die zur Schließung zahlloser industrieller Einrichtungen und zu massiven Entlassungen führte.
2. Die drastischen Streichungen von Subventionen für Industrie und Landwirtschaft, was ebenfalls Entlassungen und Schließungen mit sich brachte.
3. Der Druck der Kostenreduzierungen und Produktionssteigerungen bedeutete in Wirklichkeit eine verdeckte und allmähliche Deflation, die auf brutalen Angriffen gegen die Arbeiterklasse der zentralen Länder und einer permanenten Senkung der Rohstoffpreise beruhte.
4. Das Abwälzen der inflationären Effekte auf die Länder der unmittelbaren Peripherie durch Mechanismen des Währungsdrucks und insbesondere durch die Abwertung des Dollars. So gab es in Brasilien, Argentinien, Bolivien etc. Explosionen von Hyperinflationen, die zu Preissteigerungen von 30% am Tag (!) führten.
5. Vor allem die Bezahlung alter Schulden durch neue Schulden. Die Schuldenfinanzierung ging von der Ausgabe neuen Papiergeldes über auf die Ausgabe von Schuldverschreibungen (staatliche Schuldpapiere und Obligationen, Geschäftsanteile etc.), was zur Verlangsamung der langfristigen Auswirkungen der Inflation führte. Die Schulden, die durch die Ausgabe von Schuldpapieren gemacht worden waren, wurden durch neue Ausgaben zurückgezahlt. Diese Schuldverschreibungen waren Objekt einer nicht aufzuhaltenden Spekulation. Die Überbewertung ihres Preises (diese Überbewertung wurde durch die Manipulation des Geldpreises ergänzt) bedeutete, dass der zugrundeliegende enorme inflationäre Druck bis irgendwann in der Zukunft hinausgezögert wurde.
Maßnahme 4 löst nicht die Inflation, sondern nimmt einfach einen Ortswechsel vor (indem sie sie auf die schwächsten Länder abwälzt). Maßnahme 5 mag die Inflation bis in die Zukunft hinauszögern, aber dies um dem Preis, ihre Schattenseite gefördert zu haben: die Bombe der währungspolitischen und finanziellen Instabilität und Unordnung.
Was die Maßnahmen 1 und 3 anbetrifft, so mögen diese kurzfristig die Inflation reduziert haben, aber mittel- bis langfristig werden ihre Konsequenzen weitaus ernsthafter sein. Tatsächlich bilden diese Maßnahmen eine versteckte Deflation, das heißt, eine methodische und organisierte Reduzierung der realen Produktionskapazitäten durch den Staat. Wie wir in der International Review (engl./franz./span. Ausgabe) Nr. 59 betonten: „Diese Produktion mag den Gütern entsprechen, die tatsächlich hergestellt werden, aber es ist keine Produktion von Werten (...), der Kapitalismus ist in seinem Wachstum nicht reicher, sondern ärmer geworden.“ 5
Der Prozess der industriellen und landwirtschaftlichen Verwüstung, die enormen Kostenreduzierungen, die Entlassungen und die allgemeine Verarmung der Arbeiterklasse - all dies wurde systematisch und methodisch von allen Regierungen in den 80er Jahren ausgeführt und erlebte in den 90ern eine weitere Eskalation, die in Gestalt einer versteckten und permanenten Deflation antrat. Während 1929 eine brutale und offene Deflation stattfand, wurde in den 80er Jahren eine bis dahin unbekannte Tendenz ausgelöst: kontrollierte und geplante Deflation, eine Form allmählicher und methodischer Zerstörung der Basis der kapitalistischen Akkumulation, ein Zustand langsamer aber unumkehrbarer De-Akkumulation.
Die Streichung von Kosten, die Eliminierung der entbehrlichen und nicht wettbewerbsfähigen Bereiche, das gigantische Wachstum an Produktivität waren keine Symptome für Wachstum und Entwicklung des Kapitalismus an sich. Sicherlich begleiteten diese Phänomene die Phasen des Kapitalismus im 19.Jahrhundert. Jedoch hatten sie damals noch eine reelle Bedeutung, weil sie der Ausweitung und Erweiterung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse und der Bildung sowie dem Wachstum des Weltmarktes gedient hatten. Ihre Funktion in den 80er Jahren dieses Jahrhunderts entsprach einem diametral entgegengesetzten Ziel: dem Schutz vor der Überproduktion, und ihre Ergebnisse sind kontraproduktiv, indem sie alles noch schlimmer machen.
Wenn also diese Politik der „konkurrenzbedingten Deflation“, wie die Ökonomen sie schamhaft nennen, kurzfristig die Inflationsbasis reduziert, so wird sie mittel- bis langfristig sie verstärken und stimulieren, da die Reduzierung des globalen Kapitals einerseits nur durch eine ständig steigende Schuldenmenge und andererseits durch unproduktive Ausgaben (Rüstung, Staat, Finanz- und Handelsbürokratie) kompensiert werden kann. Wie wir im Bericht über die Wirtschaftskrise auf unserem 12. Internationalen Kongress sagten: „Die wirkliche Gefahr des in die Inflation führenden Wachstums liegt woanders: in der Tatsache, dass jedes solche Wachstum heute, jede sogenannte Erholung auf einer riesigen Schuldensteigerung, auf der künstlichen Stimulierung der Nachfrage basiert - in anderen Worten, auf fiktives Kapital. Dies ist die Matrix, die die Inflation in die Welt setzt, da diese eine profunde Tendenz im dekadenten Kapitalismus ausdrückt: die wachsende Spaltung zwischen Geld und Wert, zwischen dem, was in der ‘realen’ Welt der Produktion von Dingen abläuft, und einem Austauschprozess, der zu solch einem ‘äußerst extremen und künstlichen Mechanismus’ geworden ist, dass selbst Rosa Luxemburg, wenn sie heute noch leben würde, verblüfft sein würde.“ (International Review
Nr. 92 engl./franz./span. Ausgabe)
Daher war das Einzige, das dem Fallen der Inflationsrate während der 80er und 90er Jahre standgehalten hatte, die Aufschiebung der Schuldentilgung durch das Karussell des neuen Schuldenmachens, mit dem die alten beglichen werden, und die Explosion der globalen Inflation in immer zahlreicheren schwachen Ländern.
All dies wurde deutlich durch die Schuldenkrise illustriert, die ab 1982 in den „Drittwelt“-Ländern (Brasilien, Argentinien, Mexiko, Nigeria, etc.) ausbrach. Diese Staaten, die ihre Expansion in den 70er Jahren durch enorme Schulden gefüttert haben (s. den ersten Teil dieses Artikels), drohten damit, sich selbst für bankrott zu erklären. Die wichtigsten Länder reagierten sehr schnell und kamen ihnen mit Plänen für eine „Umschuldung“ (der Brady-Plan) und durch direkte Intervention des Internationalen Währungsfonds „zu Hilfe“. In Wirklichkeit war das, wonach sie trachteten, die Verhinderung eines brutalen Zusammenbruchs dieser Staaten, was das gesamte Weltwirtschaftssystem destabilisiert hätte.
Die Gegenmittel, die angewendet wurden, waren eine Kopie der „neuen Schuldenpolitik“:
– Die Anwendung brutaler Deflationspläne unter der direkten Kontrolle des IWF und der Weltbank, was fürchterliche Angriffe auf die Arbeiterklasse und die gesamte Bevölkerung bedeutete. Jene Länder, die in den 70ern noch von einer „Entwicklung“ träumten, wachten in einem Alptraum allgemeiner Armut auf, aus der es für sie kein Entrinnen gab.
– Die Umwandlung der Anleihen der nationalen Verschuldung in Schuldverschreibungen, die eine hohe Zinsrate (10 bis 20% mehr als der Weltdurchschnitt) und eine wunderbare Spekulationsgelegenheit boten. Die Schulden verschwanden nicht: Sie waren nur umgewandelt in ausgesetzte Schulden. Weit entfernt davon zu fallen, sind die Schulden der „Drittwelt“-Länder in den 80er und 90er Jahren in schwindelerregende Höhe gewachsen.
Der Krach von 1987
Ab 1985 begann der amerikanischen Lokomotive der Dampf auszugehen. Die Wachstumsraten fielen langsam, aber unerbittlich, und dies übertrug sich allmählich auf die europäischen Länder. Politiker und Ökonomen sprachen von einer „sanften Landung“, das heißt, sie versuchten, dem Verschuldungsmechanismus die Zügel anzulegen, der hinter einer wachsend unkontrollierbaren Spekulation stand. Der Dollar wurde nach Jahren der Aufwertung einer brutalen Abwertung unterzogen: er fiel zwischen 1985 und 1987 um mehr als 50%. Dies erleichterte zeitweilig das amerikanische Defizit und bewirkte eine Reduzierung der Zinszahlungen für diese Schulden, aber die Schattenseite davon war der brutale 27%-Fall der New Yorker Börse im Oktober 1987.
Diese Zahl war quantitativ geringer als die 1929 erreichte Quote (mehr als 30%), doch ein Vergleich der Situation von 1929 und 1987 erlaubt es uns zu begreifen, dass die Probleme 1987 weitaus schlimmer waren (siehe unten).
Die Börsenkrise von 1987 bedeutete eine brutale Entleerung der spekulativen Blase, die die Reaktivierung der Wirtschaft durch die Reagonomics gefüttert hatte. Seither ist diese Reaktivierung dahingeschwunden. In der letzten Hälfte der 80er Jahre sahen wir Wachstumsraten zwischen 1 und 3%: im Endeffekt Stagnation. Aber gleichzeitig endete das Jahrzehnt mit dem Kollaps Russlands und seiner Satelliten im Ostblock, ein Phänomen, das, auch wenn es seine Wurzeln in den Besonderheiten dieser Regimes hatte, grundsätzlich eine Konsequenz der brutalen Verschlimmerung der Weltwirtschaftskrise war.
Zusammen mit dem Kollaps des imperialistischen russischen Blocks trat eine sehr gefährliche Tendenz ab 1987 auf: die Instabilität des gesamten Weltfinanzsystems, die zu immer häufigeren Beben führen sollte und seine wachsende Fragilität und Verwundbarkeit demonstrierte.
Allgemeine Bilanz der 80er Jahre
Wir werden jetzt einige Schlussfolgerungen aus der Gesamtheit des Jahrzehnts ziehen; so wie im vorherigen Artikel werden diese die Entwicklung der Ökonomie genauso wie die Lage der Arbeiterklasse betreffen. Ein Vergleich mit den 70er Jahren enthüllt einen ernsten Verfall.
Die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation
1. Das Produktionswachstum erreichte 1984 seinen Höchststand: 4,9%. Der Durchschnitt für diese Periode lag bei 3,4%, wohingegen er im vorherigen Jahrzehnt noch bei 4,1% lag.
2. Es gab eine strikte Straffung des industriellen und landwirtschaftlichen Apparates. Dies war ein neues Phänomen nach 1945, das die Hauptindustrieländer betraf. Die folgende Tabelle, die sich auf drei zentrale Länder (Deutschland, Großbritannien und die USA) bezieht, demonstriert die fallenden Produktionszahlen in Industrie und Bergbau und eine wachsende Verlagerung zu unproduktiven und spekulativen Sektoren.
Produktionsentwicklung nach Sektoren zwischen 1974 und 1987 (%)
Deutschland GB USA
Bergbau -8,1 -42,1 -24,9
Industrie -8,2 -23,8 -6,5
Bau -17,2 -5,5 12,4
Handel & Dienstleistungen -3,1 5,0 15,2
Finanzen & Versicherungen 11,5 41,9 34,4
(Quelle: OECD)
3. Die Mehrheit der produktiven Bereiche erlitt einen Einbruch in ihrer Produktion. Dies konnte bei den Kürzungen bei den industriellen Spitzenreitern (Autos, Elektronik, Haushaltgeräte) wie auch in den „traditionellen“ Bereichen (Schiff-, Maschinenbau, Textil, Bergbau) beobachtet werden. So waren die Produktionsstände in der Autoindustrie 1978 dieselben wie 1987.
4. Die Lage in der Landwirtschaft war katastrophal:
– Die Länder des Ostens und der Dritten Welt waren zum ersten Mal seit 1945 gezwungen, Grundnahrungsmittel zu importieren.
– Die Europäische Union entschied, 20 Millionen Hektar Land brachzulegen.
5. Die Produktion in der Informationstechnologie, Telekommunikation und Elektronikindustrie wuchs, dennoch konnte sie die Einbußen in der Schwerindustrie und Landwirtschaft nicht ausgleichen.
6. Die Erholungsphasen erfassten nicht die gesamte Weltwirtschaft; außerdem waren sie kurz und begleitet von Stagnationsphasen (z.B. zwischen 1987 und 1989).
– Die Erholung in den USA während der Periode von 1983 und 1985 war groß, aber zwischen 1986 und 1989 war sie weit unter dem Durchschnitt von 1970.
– Die Erholung war in allen westeuropäischen Ländern schwächer (eine globale Situation der Semi-Stagnation) außer in Westdeutschland.
– Eine gute Zahl von „Drittwelt“-Ländern war vom Wachstumszug abgekoppelt und fiel der Stagnation anheim.
– Die Länder des Ostens litten an einer fast generellen Stagnation während des gesamten Jahrzehnts (ausgenommen Ungarn und die Tschechoslowakei).
7. Japan und Deutschland schafften es, ab 1983 akzeptable Wachstumsraten aufrechtzuerhalten. Dieses Wachstum war höher als der Durchschnitt und erlaubte beträchtliche Handelsüberschüsse, was sie zu wichtigen finanziellen Gläubigern werden ließ. Jedoch waren diese Wachstumsraten nicht so hoch wie in den beiden vorhergegangenen Jahrzehnten.
Jährliches Durchschnittswachstum des BIP in Japan:
1960 bis 1970 8,7%
1970 bis 1980 5,9%
1980 bis 1990 3,7%
(Quelle: OECD)
8. Die Rohstoffpreise fielen während des gesamten Jahrzehnts (ausgenommen die Jahre 1987-88). Dies erlaubte den Industrieländern, das grundlegende Gewicht der Inflation auf Kosten der „Drittwelt“-Länder (den Produzenten der Rohstoffe) abzumildern, die fortschreitend in eine totale Stagnation fielen.
9. Die Rüstungsproduktion erlebte ihr bedeutendstes historisches Wachstum: Zwischen 1980 und 1988 wuchs sie in den USA gemäß den offiziellen Zahlen um 41%. Dieses Wachstum bedeutet, wie die Linkskommunisten stets gezeigt haben, letztlich die Schwächung der Wirtschaft. Beweis dafür ist das amerikanische Kapital: Zur gleichen Zeit, als es unaufhörlich seinen Anteil an der globalen Rüstungsproduktion steigerte, fiel der Anteil seiner Exporte in wichtigen Bereichen des Welthandels, wie man aus folgender Tabelle ersehen kann:
Exporte im Welthandel in %
1980 1987
Maschinenbau 12,7% 9,0%
Kraftfahrzeuge 11,5% 9,4%
Informatik 31,0% 22,0%
10. Die Verschuldung erlebte eine starke Explosion auf quantitativer wie auf qualitativer Ebene
Auf quantitativer Ebene
– In der „Dritten Welt“ wuchsen die Schulden auf unkontrollierbare Weise:
Die Gesamtschulden der unterentwickelten Länder in Millionen Dollar
1980: 580000
1985: 950000
1988: 1320000
(Quelle: Weltbank)
– In den USA schossen sie spektakulär in die Höhe:
Die Gesamtschulden der USA
in Millionen Dollar
1970: 450000
1980: 1069000
1988: 5000000
(Quelle: OECD)
– In Deutschland und Japan waren sie jedoch moderat.
Auf qualitativer Ebene
Nachdem sie 71 Jahre lang Gläubiger gewesen waren, wurden die USA 1985 zu einem Schuldnerland;
– 1988 waren die Vereinigten Staaten zum höchstverschuldeten Land auf dem Planeten nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ mutiert. Dies wird klar ersichtlich aus der Tatsache, dass, während Mexikos Auslandsschulden neun Monate seines BSP und Brasiliens Verpflichtungen sechs Monate des BSP ausmachten, sie in den USA zwei Jahre ihres BSP betrugen!
– In den Industrieländern machte das Gewicht der Zinszahlungen auf Anleihen durchschnittlich 19% des Staatshaushaltes aus.
11. Ab 1987 wurde der Finanzapparat, der bis dahin verhältnismäßig stabil und gesund war, zunehmend Opfer von durch den Schuldendienst verursachten immer ernsthafteren Turbulenzen.
– Bedeutende Banken brachen zusammen, am ernstesten war der Kollaps der Sparkassen in Amerika mit Schulden in Höhe von 500000 Millionen Dollar..
– 1987 begann eine Serie von Börsenkrächen: 1989 gab es einen weiteren Börsenkrach, auch wenn er infolge staatlicher Maßnahmen, die den Börsenhandel sofort aussetzten, als die Kurse um 10% fielen, weniger ernst war.
– Die Spekulation nahm spektakuläre Züge an. In Japan z.B. verursachte die Immobilienspekulation 1989 einen Crash, dessen Konsequenzen immer noch spürbar sind.
Die Lage der Arbeiterklasse
1. Wir erleben die schlimmste Welle der Arbeitslosigkeit seit 1945. Die Arbeitslosigkeit stieg in den Industrieländern brutal an:
Die Arbeitslosenzahlen in den 24 Ländern der OECD
1979: 18000000
1989: 30000000
2. Während in der „Dritten Welt“ die Unterbeschäftigung zur Allgemeinheit wurde, trat sie in den Industrieländern tendenziell auf (Zeitarbeit, Teilzeitarbeit und prekäre Arbeitsverhältnisse).
3. Ab 1985 ergriffen die Regierungen der Industriestaaten Maßnahmen, die unter dem Vorwand des „Kampfes gegen die Arbeitslosigkeit“ zu Zeitarbeitsverträgen ermutigten. So waren 1990 8% der Arbeitskräfte von Zeitverträgen betroffen, während die Zahl der Dauerarbeitsplätze abnahm.
4. Die Nominallöhne wuchsen sehr bescheiden (im Durchschnitt stiegen sie in den OECD-Ländern zwischen 1980 und 1988 um 3%) und konnten die Inflation trotz ihrer sehr geringen Rate nicht ausgleichen.
5. Die Sozialausgaben (soziale Sicherheitssysteme, Wohngeld, Gesundheit, Erziehung, etc.) erlitten ihre ersten bedeutenden Kürzungen.
Der Verfall der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse war dramatisch in den „unterentwickelten“ Ländern und ernst in den Industrieländern. In letzteren war er nicht mehr so sanft und langsam wie im vorhergegangenen Jahrzehnt, trotz der Tatsache, dass die Regierungen, um die Vereinigung der Kämpfe zu vermeiden, die Angriffe langsam und wohldurchdacht organisierten und sich vor plötzlichen und generalisierten Attacken hüteten.
Dennoch war der Kapitalismus das erste Mal seit 1945 nicht mehr in der Lage, die Gesamtzahl der Arbeitskräfte zu steigern: Die Zahl der Lohn- und Gehaltsempfänger wuchs langsamer als die Weltbevölkerung. 1990 legte die Internationale Arbeitsorganisation die Zahl von 800 Millionen Arbeitslosen vor. Dies zeigt deutlich die Verschlimmerung der Krise des Kapitalismus und enthüllte gründlich die verlogenen Reden der Bourgeoisie über die Gesundung der Wirtschaft.
Adalen
Internationale Revue 26
- 3317 Aufrufe
Debatte mit dem IBRP
- 3763 Aufrufe
Die marxistische und die opportunistische Sichtweise in der Politik des Parteiaufbaus
In den letzten Monaten veröffentlichte das IBRP[1] [28] in seiner Presse Artikel über die Notwendigkeit der Umgruppierung unter den revolutionären Kräften im Hinblick auf den Aufbau der zukünftigen internationalen kommunistischen Partei. Einer dieser Artikel, ”Revolutionäre, Internationalisten gegenüber der Kriegsperspektive und die Lage des Proletariats”[2] [28], ist ein Dokument, das in der Zeit unmittelbar nach dem letztjährigen Krieg im Kosovo geschrieben wurde:
”Die jüngsten kriegerischen Ereignisse auf dem Balkan stellen, gerade weil sie in Europa stattfanden, (....) einen bedeutsamen Schritt vorwärts zum generalisierten imperialistischen Krieg dar. (...)
Der Krieg selber und die Art, wie ihm entgegengewirkt wurde, bilden die Grundlage für eine Formierung und Auswahl der revolutionären Kräfte, die fähig sind, am Parteiaufbau teilzunehmen.
Sie werden durch die folgenden grundlegenden Punkte eingegrenzt, die unabdingbare Voraussetzung für jede politische Initiative bilden, welche die revolutionäre Front gegen das Kapital und seine Kriege zu stärken versucht.”
Anschließend folgen ”21 grundlegende Punkte”[3] [28], die das IBRP als fundamental bezeichnet.
Es sind gerade die ”kriegerischen Ereignisse auf dem Balkan” gewesen, die unsere Organisation dazu bewegt haben, zu Beginn des Krieges einen Aufruf an die verschiedenen revolutionären Organisationen, die es auf internationaler Ebene gibt, zu richten, damit sich der proletarische Internationalismus mit einer einheitlichen und starken Stimme vernehmen lasse. Und parallel zu diesem Aufruf haben wir präzisiert:
”Natürlich gibt es auch Divergenzen, die in einer unterschiedlichen Herangehensweise in der Analyse des Imperialismus in der gegenwärtigen Phase und des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen liegen. Aber ohne diese Divergenzen zu unterschätzen betrachten wir die gemeinsamen Aspekte als viel wichtiger und bedeutsamer als diejenigen, welche bezüglich der momentanen Begebenheiten unterschiedlich sind. Auf dieser Grundlage haben wir am 29. März 1999 an alle diese Gruppen einen Appell für eine gemeinsame Initiative gegen den Krieg gerichtet.”[4] [28]
Da dieser Aufruf, den wir vor mehr als einem Jahr lanciert haben, auf vollkommen taube Ohren gestoßen ist[5] [28], muss man sich fragen, warum nun das IBRP plötzlich und erst jetzt mit seinen ”21 Bedingungen” kommt - mit denen wir, abgesehen von gewissen Vorbehalten bei gerade zwei Punkten[6] [28], völlig einverstanden sind -, statt seinerzeit auf unseren Appell zu antworten. Die Antwort darauf findet man fast am Schluss des Textes des IBRP, wo es in einem Abschnitt ganz offensichtlich um die IKS geht (doch selbstverständlich ohne diese beim Namen zu nennen): ”23 Jahre nach der 1. Internationalen Konferenz, die durch Battaglia Comunista[7] [28] einberufen wurde, um eine erste Konfrontation unter den politischen Gruppen herbeizuführen, die sich auf die allgemeinen durch die Kommunistische Linke seit Mitte der 20er Jahre vertretenen Klassen- und internationalistischen Prinzipien beriefen, ist es möglich - und deshalb auch notwendig - eine Bilanz über diese Konfrontation zu ziehen.”
Eine Bilanz? Nach 23 Jahren? Und weshalb erst jetzt? Gemäss IBRP fand in den letzten beiden Jahrzehnten ”eine Beschleunigung im Prozess der Klärung innerhalb des ‚proletarischen politischen Lagers‘ (statt), der all jene Organisationen ausschloss, die aus irgendeinem Grund über die Kriegsfrage stolperten, indem sie das unverzichtbare Prinzip des revolutionären Defätismus verrieten.”
Doch der Abschnitt, den sie uns (und den bordigistischen Gruppierungen) widmen, schließt gleich daran an:
”Andere Gruppen in diesem Lager, die zwar nicht in den tragischen Fehler der Unterstützung einer Kriegsfront verfielen (...), stehen der Methode und den Arbeitsperspektiven, die zur Bildung der zukünftigen revolutionären Partei beitragen, ebenfalls fern. Sie sind endgültig verlorene Opfer idealistischer oder mechanistischer Positionen (...)” (Hervorhebung durch uns).
Da wir denken, dass die durch das IBRP gegen uns erhobenen Vorwürfe nicht begründet sind - und wir darüber hinaus befürchten, dass sie lediglich der Bemäntelung einer opportunistischen politischen Praxis dienen -, werden wir versuchen, darauf im Folgenden zu antworten, indem wir aufzeigen, was die Haltung der marxistischen Strömung der Arbeiterbewegung hinsichtlich ”der Methode und der Perspektiven der Arbeit, die zum Beitritt zur künftigen revolutionären Partei führen wird”, gewesen ist. Dabei werden wir konkret untersuchen, ob und inwieweit das IBRP und die Gruppen, die es geschaffen haben, mit dieser Orientierung übereinstimmen. Wir werden zu diesem Zweck zwei Fragen genauer betrachten, die in ihrem gegenseitigen Verhältnis Ausdruck der beiden Ebenen sind, auf denen sich das Problem der revolutionären Organisation heute stellt:
1. Wie soll die zukünftige Internationale aufgefasst werden?
2. Welche Politik soll für den Organisationsaufbau und die Umgruppierung der Revolutionäre verfolgt werden?
1. Wie soll die zukünftige Internationale aufgefasst werden? Als internationale kommunistische Partei oder als Internationale der kommunistischen Parteien?
Was wird die zukünftige Internationale sein? Eine Organisation, die von allem Anfang an einheitlich begriffen wird, d.h. eine internationale kommunistische Partei ist, oder eine Internationale der kommunistischen Parteien in den verschiedenen Ländern? Diesbezüglich sind die Auffassungen und der Kampf von Amadeo Bordiga und der Kommunistischen Linken ein unverzichtbarer Bezugspunkt. Für Bordiga hätte die Kommunistische Internationale schon das sein sollen, was er die Weltpartei nannte. Folgerichtig ging Bordiga so weit, dass er gewisse von ihm vertretene ”taktische” Punkte (Abstentionismus bei den Wahlen; eine Umgruppierung, die die Zentristen ausschloss) aufgab, um dem Vorrang der Internationale gegenüber den einzelnen nationalen Parteien Nachachtung zu verschaffen, um zu gewährleisten, dass die Kommunistische Internationale eine einheitliche Organisation ist, und nicht eine Föderation von Parteien, eine Organisation mit einer einheitlichen Politik überall, und nicht verschieden von Land zu Land.
”So behaupten wir, dass die höchste internationale Versammlung nicht nur das Recht hat, diese Regeln aufzustellen, die ausnahmslos in allen Ländern gültig sind und gültig sein müssen, sondern dass sie auch das Recht hat, sich in die Situation eines einzelnen Landes einzumischen und somit zu sagen, dass die Internationale meint, dass man - zum Beispiel - in England in dieser bestimmten Art vorgehen soll.” (Amadeo Bordiga, Rede auf dem Kongress von Livorno 1921, in ”La Sinistra Comunista nel cammino della rivoluzione” Edizioni Sociali, 1976)
Diese Auffassung vertrat Bordiga im Namen der Italienischen Linken, und er tat dies insbesondere im Kampf gegen die Degenerierung der Internationale selber mit vollem Recht, als die Politik derselben immer mehr mit der Politik und den Interessen des russischen Staates vermischt wurde.
”Die Schwesterparteien müssen der russischen Partei bei der Lösung ihrer Probleme helfen, auch wenn sie nicht die unmittelbare Erfahrung der Probleme der Regierungsführung haben; trotzdem können sie zu ihrer Lösung beitragen, indem sie eine revolutionäre Klassenorientierung einbringen, die direkt aus der Realität des Klassenkampfes in ihren jeweiligen Ländern abgeleitet ist.”[8] [28]
Schließlich kommt noch deutlicher in Bordigas Antwort an Karl Korsch zum Ausdruck, was die Internationale sein sollte und was ihr nicht gelungen ist zu sein:
”Ich glaube, dass einer der Mängel der gegenwärtigen Internationale derjenige gewesen ist, ein ”Block lokaler und nationaler Oppositionen” zu bilden. Wir müssen darüber nachdenken, ohne uns zu Übertreibungen hinreißen zu lassen, mit dem Ziel, alle Lehren zu ziehen. Lenin machte einen großen Teil der Arbeit von der ‚spontanen‘ Ausarbeitung abhängig, als er damit rechnete, die verschiedenen Gruppen materiell zusammenzubringen und sie dann in der Hitze der Russischen Revolution einheitlich zu schmieden. Insgesamt ist ihm dies aber nicht gelungen.” (Auszüge aus dem Brief von Bordiga an Korsch, veröffentlicht in Programme Communiste Nr. 68)
Mit anderen Worten bedauerte also Bordiga, dass die Internationale auf der Grundlage der ”Oppositionen” der alten sozialdemokratischen Parteien gebildet worden war - diese ”Oppositionen” waren untereinander politisch alles andere als kohärent - und dass Lenins Vorhaben, diese unterschiedlichen Bestandteile zu vereinen, im Grunde genommen gescheitert war.
Von dieser Sichtweise ausgehend haben sich die revolutionären Organisationen in den Jahren der Konterrevolution trotz den widrigen politischen Umständen immer nicht nur als internationalistische, sondern auch als internationale Organisationen aufgefasst. Und es ist kein Zufall, dass eine der Machenschaften der Internationalen Linksopposition um Trotzki gegen die Italienische Fraktion gerade darin bestand, ihr die Verfolgung einer ”nationalen” Politik vorzuwerfen.[9] [28]
Stellen wir dem umgekehrt die Auffassung des IBRP zu dieser Frage gegenüber:
”Das IBRP hat sich als einzig mögliche Form der Organisation und der Koordination konstituiert, auf dem Mittelweg zwischen der isolierten Arbeit der Avantgarde in den verschiedenen Ländern und der Präsenz einer wirklichen Internationalen Partei (...). Neue Avantgarden - die sich von den alten, für das Verständnis der Gegenwart und somit für die Voraussage der Zukunft nutzlosen Schemata befreit haben - haben den Parteiaufbau in Angriff genommen (...). Diese Avantgarden haben die Aufgabe - die sie auch erfüllen - sich zu konsolidieren und auf der Grundlage einer Sammlung von Thesen, einer Plattform und eines organisatorischen Rahmens zu wachsen. Diese Grundlagen sind untereinander und mit dem Bureau kohärent, das so die Rolle eines Bezugspunkts für die notwendige Homogenisierung der Kräfte der zukünftigen Partei übernimmt (...).”
Bis hierher scheint der Diskurs des IBRP, abgesehen von einigen überflüssigen Floskeln, in seinen groben Zügen mit der oben zitierten Position in Einklang zu stehen. Doch der folgende Abschnitt stellt ein Problem dar:
”Bezugspunkt heißt nicht aufgezwungene Struktur. Das IBRP hat nicht im Sinn, die Frist, die es für die internationale Umgruppierung der revolutionären Kräfte braucht, unter die ”natürliche” Zeitspanne für das politische Wachstum der kommunistischen Avantgarde in den verschiedenen Ländern zu verkürzen.”[10] [28]
Das heißt, dass das IBRP, oder besser gesagt: die beiden Organisationen, aus denen es besteht, nicht von der Möglichkeit ausgehen, vor der Gründung der internationalen Partei eine einheitliche internationale Organisation aufzubauen. Darüber hinaus nimmt es bezug auf eine seltsame ”natürliche Zeitspanne für das politische Wachstum der kommunistischen Avantgarde in den verschiedenen Ländern”, welche Formulierung klarer wird, wenn man sieht, von welcher Auffassung sich das IBRP abzugrenzen versucht, d.h. von derjenigen der IKS und der Italienischen Kommunistischen Linken:
”Wir weisen grundsätzlich und auf der Grundlage verschiedener Resolutionen unserer Kongresse die Idee zurück, wonach nationale Sektionen durch das Aufpfropfen auf eine vor-existierende Organisation gegründet werden sollen, selbst wenn diese Organisation unsere wäre. Man baut eine nationale Sektion einer internationalen Partei des Proletariats nicht dadurch auf, dass man in einem Land mehr oder weniger künstlich ein Redaktionszentrum für Publikationen schafft, die anderswo und in jedem Fall ohne Bezug zu den wirklichen politischen und sozialen Kämpfen im Land selber redigiert worden sind.” (Hervorhebungen durch uns)[11] [28]
Dieser Abschnitt verdient in jedem Fall eine genaue Antwort, denn in ihm ist der strategische Unterschied zwischen der internationalen Umgruppierungspolitik des IBRP einerseits und der IKS andererseits enthalten. Das IBRP versucht hier natürlich, unsere Strategie lächerlich zu machen, indem es sie darstellt als das ”Aufpfropfen auf eine vor-existierende Organisation”, als eine ”mehr oder weniger künstliche” Gründung ”eines Redaktionszentrums für Publikationen, die anderswo redigiert worden sind” mit der Absicht, beim Leser automatisch eine Abneigung gegen die Strategie der IKS hervorzurufen.
Aber sehen wir konkreter hin und überprüfen den Wahrheitsgehalt solcher Behauptungen. Das IBRP meint, wenn eine neue Gruppe von Genossen entsteht (wie z.B. in Kanada), die sich internationalistischen Positionen nähert, können brüderlich-kritische, ja, polemische Beiträge dieser Gruppe nur nutzen, doch Letztere muss innerhalb des politischen Umfeldes des Landes, wo sie wohnt, wachsen und sich entfalten, “indem sie in Verbindung mit den wirklichen politischen und sozialen Kämpfen im Land selber steht”. Aus der Sicht des IBRP soll dies heißen, dass das gegenwärtige und lokale Umfeld in einem gegebenen Land wichtiger ist als der internationale und historische Rahmen, der durch die Erfahrung der Arbeiterbewegung gestellt wird. Worin besteht dagegen die Strategie der IKS beim Aufbau der Organisation auf internationaler Ebene, welche das IBRP absichtlich in ein schlechtes Licht stellen will, wenn es von der “Schaffung von nationalen Sektionen durch die Fortentwicklung einer vorher bestehenden Organisation” spricht? Egal, ob es einen oder hundert Kandidaten in einem neuen Land gibt, die der IKS beitreten wollen, unsere Strategie besteht nicht darin, eine lokale Gruppe zu schaffen, die sich in “Verbindung mit den wirklichen politischen und sozialen Kämpfen im Land selber” unter den dortigen Verhältnissen entwickelt. Stattdessen zielen wir darauf ab, diese neuen Militanten schnell in die internationale Arbeit unserer Organisation zu integrieren, damit diese auf zentralisierte Art und Weise in dem Land intervenieren kann, wo die Genossen wohnen. Deshalb versuchen wir auch bei zahlenmäßig geringen Kräften, mit einer Publikation in diesem Land präsent zu sein, die unter der Verantwortung der neuen Gruppe von Genossen herausgebracht wird, weil wir meinen, dass dies die direktere und wirksamere Methode ist, um unseren Einfluss zu vergrößern und direkt zum Aufbau der revolutionären Organisation beizutragen. Was ist dabei künstlich, und warum soll man von der Fortentwicklung von schon bestehenden Organisationen sprechen? Das sollte vom IBRP geklärt werden.
In Wirklichkeit sind die Verwirrungen von BC und der CWO hinsichtlich der Organisationsfrage dem mangelnden Verständnis des Unterschiedes zwischen der 2. und 3. Internationale aufgrund des grundlegenden Wechsels der historischen Periode geschuldet:
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts stellte einen günstigen Zeitraum für die Kämpfe um Reformen dar; der Kapitalismus befand sich in voller Expansion, und die Internationale war in dieser Zeit eine Internationale von nationalen Parteien, die in den jeweiligen Ländern mit unterschiedlichen Programmen kämpften (in einigen Fällen um demokratische Errungenschaften, in anderen Fällen um die nationale Frage, hier gegen den Zarismus in Russland, dort für die “Sozialgesetzgebung” usw.).
Der Ausbruch des 1. Weltkriegs zeigte, dass das Potenzial der kapitalistischen Produktionsform, der Menschheit noch eine Zukunft zu bieten, erschöpft war. Eine Epoche von Kriegen und Revolutionen wurde eröffnet, in der die Menschheit objektiv vor der Alternative “Kommunismus oder Barbarei” steht. Auf diesem Hintergrund ist es nicht mehr möglich, nationale Parteien mit spezifisch nationalen Aufgaben zu gründen, sondern es geht darum, eine einzige Weltpartei mit einem einzigen Programm und einheitlichen Aktionen zur gemeinsamen und synchronen Führung des Weltproletariats zur Revolution zu schaffen[12] [28].
Die föderalistischen Reste, die in der Komintern weiterhin bestanden, waren Überreste der vorhergehenden Perioden (wie z.B. im Fall des Parlamentarismus), die auf den Schultern der Komintern lasteten (“die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden”, wie Marx im 18. Brumaire schrieb).
Man kann hinzufügen, dass die marxistische Linke während ihrer Geschichte immer gegen den Föderalismus gekämpft hat. Erinnern wir uns an die wichtigsten Episoden:
Marx und der Generalrat der I. Internationale (AIT) kämpften gegen den Föderalismus der Anarchisten und gegen ihren Versuch, eine Geheimorganisation innerhalb der AIT aufzubauen.
In der 2. Internationale kämpfte Rosa Luxemburg darum, dass die Beschlüsse ihrer Kongresse in den Mitgliedsländern auch tatsächlich umgesetzt wurden.
In der 3. Internationale (Komintern) kämpfte nicht nur die Linke für die Zentralisierung, sondern trat in Gestalt Lenins und Trotzkis auch von Anfang an gegen die “Besonderheiten” einiger Parteien an, die so ihre opportunistische Politik vertuschen wollten (z.B. bekämpfte sie die Freimaurer in der Kommunistischen Partei Frankreichs).
Man kann ferner hinzufügen, dass der Entstehungsprozess der Weltpartei nicht wartet, bis sie ihre Präsenz in jedem einzelnen Land konsolidiert bzw. geschaffen hat.[13] [28] Es ist bekannt, dass zwischen Lenin und Luxemburg in dieser Frage Meinungsverschiedenheiten bestanden. Rosa Luxemburg war gegen die unmittelbare Gründung der Komintern – und deshalb trat sie dafür ein, dass der deutsche Delegierte Eberlein gegen ihre Gründung stimmen sollte –, weil sie meinte, dass die Zeit noch nicht reif sei, da die meisten Parteien noch nicht einmal gebildet worden waren und die russische Partei innerhalb der Komintern folglich ein zu großes Gewicht haben würde. Zwar haben sich leider ihre Befürchtungen hinsichtlich des Übergewichtes der russischen Partei nach dem Rückfluss der revolutionären Phase und dem Niedergang der Komintern als richtig herausgestellt. Dennoch erfolgte die Gründung der Komintern angesichts der Bedürfnisse der Klasse zu spät, auch wenn die Kommunisten aufgrund des Krieges, der erst einige Monate zuvor zu Ende gegangen war, nicht anders handeln konnten.
Es wäre interessant zu wissen, was das IBRP von dieser historischen Kontroverse denkt. Meint es etwa, dass Rosa Luxemburg gegenüber Lenin Recht hatte, als sie sagte, die Zeit sei noch nicht reif für die Gründung der Komintern?
Diese föderalistische Orientierung auf theoretischer Ebene spiegelt sich natürlich in der Alltagspraxis wider. Die beiden Bestandteile des IBRP hatten 13 Jahre lang, von der Gründung des IBRP bis 1997, zwei unterschiedliche Plattformen. Es gibt keine Vollversammlungen der gesamten Organisation (sondern nur der jeweiligen Einzelorganisationen, an der sich eine Delegation der anderen Organisation beteiligt, was etwas ganz anderes ist). Es gibt keine erkennbaren Debatten untereinander, und sie scheinen auch nicht das Bedürfnis danach zu verspüren, auch wenn es während der letzten 16 Jahre seit der Gründung des IBRP oft himmelschreiende Differenzen in der Aktualitätsanalyse, in der Haltung zur internationalen Arbeit usw. gegeben hat. In Wirklichkeit ist dieses Organisationsmodell, das das IBRP als die jetzt “einzig mögliche Organisations- und Koordinierungsform” darstellt, die klassisch opportunistische Organisationsform. Mit dieser Organisationsform können neue Organisationen in den Kreis des IBRP gezogen werden, indem man ihnen das Etikett “linkskommunistisch” verleiht, ohne ihre Vergangenheit auch nur zu hinterfragen. Wenn das IBRP davon spricht, dass man “die ‚natürliche‘ Zeitspanne für das politische Wachstum der kommunistischen Avantgarde in den verschiedenen Ländern” abwarten müsse, bringt es damit in Wirklichkeit nur seine opportunistische Auffassung zum Ausdruck, weil es die Kritik an den Gruppen, mit denen es in Kontakt steht, nicht zu stark vorantreiben will, um deren Vertrauen nicht zu verlieren.[14] [28]
Wir haben all das nicht erfunden; es handelt sich schlicht und einfach um die Bilanz der letzten 16 Jahre IBRP, das trotz der Jubelarien, die in seiner Presse verbreitet werden, bislang keine bedeutsamen Erfolge erzielen konnte: Als das IBRP 1984 gebildet wurde, gehörten ihm zwei Gruppen an, und das ist auch heute noch so. Es wäre für BC und die CWO angebracht, einen Blick auf die verschiedenen Gruppen zu werfen, die sich einst dem IBRP angenähert oder ihm gar – wenn nur vorübergehend – angehört hatten, und zu überprüfen, wo diese gelandet sind, oder warum sie nicht im IBRP geblieben sind. Was ist z.B. aus den Iranern der SUCM-Komala geworden? Und die indischen Genossen von Lal Pataka? Oder die französischen Genossen, die eine Zeitlang sogar den dritten Teil des IBRP gebildet hatten?
Eine opportunistische Umgruppierungspolitik ist nicht nur politisch falsch, sondern sie ist als Politik auch zum Scheitern verurteilt.[15] [28]
2. Die Umgruppierungspolitik und der Aufbau der Organisation
In dieser Frage kann man natürlich nur bei Lenin beginnen, der einen großen Beitrag zum Aufbau der Partei und Pionierarbeit bei der Gründung der Komintern geleistet hat. Sein erfolgreicher Kampf auf dem 2. Kongress der SDAPR 1903 um den Artikel 1 der Statuten, in dem strenge Zugehörigkeitskriterien zur Partei festgelegt wurden, war wahrscheinlich einer der wichtigsten Beiträge Lenins überhaupt. “Es würde bedeuten, nur sich selbst zu betrügen, die Augen vor der gewaltigen Größe unserer Aufgaben zu verschließen, diese Aufgaben einzuengen, wollte man den Unterschied zwischen dem Vortrupp und all den Massen, die sich zu ihm hingezogen fühlen, vergessen, wollte man die ständige Pflicht des Vortrupps vergessen, immer breitere Schichten auf das Niveau dieses Vortrupps zu heben. Ja, es bedeutet, die Augen zu verschließen und all dies zu vergessen, wenn man den Unterschied verwischt zwischen denen, die der Partei angehören, und denen, die sich ihr anschließen, zwischen den bewussten und aktiven Mitgliedern und den Helfern.” (Lenin, Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, LW Bd. 7, S. 258)
Dieser Kampf Lenins, der zur Spaltung innerhalb der SDAPR zwischen der Bolschewiki (der Mehrheit) und den Menschewiki (der Minderheit) geführt hat, ist von besonderer historischer Bedeutung, da er das vorwegnahm, was einige Jahre später die neue Partei werden sollte; eine Kaderpartei, die zahlenmäßig eng begrenzt war, aber an die Bedürfnisse der neuen historischen Periode der “Kriege und Revolutionen” besser als das alte Modell der Massenpartei angepasst war, da Letztere zahlenmäßig größer war und bei den Zugehörigkeitskriterien weniger streng vorging, was in der historischen Phase des aufsteigenden Kapitalismus noch vertretbar gewesen war.
Dann stellt sich die Frage, wie sich die Partei (bzw. die Fraktion oder irgendeine politische Gruppe) in den Auseinandersetzungen mit anderen proletarischen Organisationen verhalten soll. Anders ausgedrückt: wie kann man am wirksamsten auf das richtige Bedürfnis der Umgruppierung der revolutionären Kräfte eingehen? Hier können wir uns nur auf die Erfahrung der Arbeiterbewegung stützen, besonders auf die von der Italienischen Linken in der Komintern initiierte Debatte hinsichtlich der Eingliederung von Zentristen bei der Bildung der kommunistischen Parteien. Die Position Bordigas ist sehr eindeutig, und sein Beitrag zur Verabschiedung einer 21. Aufnahmebedingung durch die Komintern war grundlegend. Darin heißt es: “Diejenigen Parteiangehörigen, welche die von der Kommunistischen Internationale aufgestellten Bedingungen und Leitsätze grundsätzlich ablehnen, sind aus der Partei auszuschließen. Dasselbe gilt namentlich von Delegierten zum außerordentlichen Parteitage.”[16] [28] 1920 äußerte sich Bordiga besorgt darüber, dass einige zentristische Elemente, die sich 1914 nicht besonders schmutzig gemacht hatten, in den neuen kommunistischen Parteien statt in den diskreditierten sozialdemokratischen Parteien mitwirken könnten.
“Heute ist es einfach zu behaupten, dass man in einem neuen Krieg nicht mehr die gleiche Fehler – den Burgfrieden und die Verteidigung des Vaterlandes - begehen würde. Die Revolution ist noch weit weg, werden die Zentristen behaupten, das ist kein unmittelbares Problem. Und sie werden die Thesen der Kommunistischen Internationale akzeptieren: die Macht der Arbeiterräte, die Diktatur des Proletariats, roter Terror (...). Der rechte Flügel akzeptiert unsere Thesen, sie tun dies jedoch unzureichend und unter Vorbehalt. Als Kommunisten müssen wir fordern, dass diese Thesen voll und ohne Einschränkung akzeptiert werden – sowohl auf der Ebene der Theorie als auch auf praktischer Ebene (...). Gegenüber den Reformisten müssen wir eine unüberwindbare Schranke aufbauen (...) Beim Programm gibt es keine Alternative: Entweder akzeptiert man es, oder man tut es nicht, und in diesem Fall muss man aus der Partei austreten.”[17] [28]
Bordiga und die Italienische Linke leisteten zu dieser Frage einen Schlüsselbeitrag. Ausgehend von dieser Position, geriet Bordiga später mit einer in der Regression befindlichen Komintern in Konflikt, als er gegen die Politik der Aufnahme von Zentristen in die kommunistischen Parteien kämpfte, genauso wie er sich dagegen wehrte, dass die Verteidigung des russischen Staates gegenüber allen anderen Problemen in den Vordergrund gestellt wurde[18] [28]. Es ist auch bekannt, dass die Komintern die KP Italiens dazu zwang, den maximalistischen (linken) Flügel der PSI, die sogenannten “Terzinternationalisti” oder “Terzini Serratis”, wiederaufzunehmen, von dem sich die KPI 1921, im Jahre ihrer Gründung, getrennt hatte.
Diese Strenge im Umgang mit den gemäßigten und zentristischen Strömungen hat jedoch nie sektiererische Verschlossenheit, Dialogverweigerung, Diskussionsverbot bedeutet – ganz im Gegenteil! So hat die Italienische Linke schon seit ihren Anfängen als abstentionistische Fraktion der PSI immer darauf hingewirkt, die sich in zentristischen Positionen vergeudenden revolutionären Energien zu erobern, um sowohl ihre eigenen Kräfte zu verstärken als auch dem Feindeslager Kräfte zu entreißen.
“Obgleich als eigenständige Fraktion mit ihrer eigenen Zeitung innerhalb der PSI organisiert, versuchte die abstentionistische Fraktion vor allem die Mehrheit der Partei für ihr Programm zu gewinnen. Sie meinte noch, dass dies möglich sei, trotz des überwältigenden Sieges der parlamentarischen Tendenz, die das Bündnis zwischen Lazzari und Serrati darstellte. Die Fraktion konnte nur zu einer Partei werden, wenn sie sich mit allen Kräften für die Eroberung mindestens einer bedeutenden Minderheit einsetzte. Sich nicht zurückzuziehen, ohne den Kampf zu Ende geführt zu haben, war immer das Anliegen der ‚bordigistischen‘ Bewegung, und in dieser Hinsicht war sie nie eine Sekte, wie es ihr ihre Gegner vorwarfen.”[19] [28]
Wir können zusammenfassend sagen, dass es zwei grundlegende Aspekte in der Politik der Italienischen Linken gibt, die der Tradition der Bolschewiki folgten:
Strenge bei den Zugehörigkeitskriterien zur Partei, die sich stützen auf:
+ das militante Engagement (Artikel 1 der Statuten der SDAPR),
+ die Klarheit in den programmatischen Grundlagen und der Auswahl der Militanten;
Offenheit in den Diskussionen mit anderen politischen Strömungen der Arbeiterbewegung (siehe z.B. die Beteiligung der Italienischen Linken an den Konferenzen in Frankreich zwischen 1928 und 1933 oder die fortgesetzten Diskussionen mit der Ligue des Communistes Internationalistes Belgiens [LCIB] mit der Veröffentlichung von Artikeln, die von Mitgliedern der LCIB verfasst wurden, in der Zeitschrift Bilan).
Es ist an dieser Stelle notwendig zu unterstreichen, dass es eine Verbindung zwischen der programmatischen und organisatorischen Strenge der Italienischen Linken und ihrer Bereitschaft zur Diskussion gibt: In Tradition mit den linken Strömungen verfolgte die Italienische Linke eine langfristige Arbeit, die sich auf politische Klarheit und Solidität stützte und dubiose “unmittelbare Erfolge” ablehnte, da diese den Weg zum Opportunismus erleichterten und Vorbedingung für zukünftige Niederlagen waren (“Die Ungeduld ist die Mutter des Opportunismus” so Trotzki). Die Italienische Linke hatte keine Angst, mit anderen politischen Strömungen zu diskutieren, da sie Vertrauen in die Solidität ihrer Positionen hatte.
Auch zwischen der Verwirrung und den Unklarheiten der Opportunisten sowie ihrem ‚Sektierertum‘, das im allgemeinen eher gegen die Linke als gegen die Rechte gerichtet ist, gibt es eine Verbindung.
Wenn man weiß, dass die eigenen Positionen wenig solide sind, hat man natürlich Angst, sich mit den Positionen der Linken auseinanderzusetzen, wie im Falle der Komintern nach dem 2. Weltkongress, die sich dem Zentrum gegenüber öffnete, sich aber in den Debatten mit den Linken ‚sektiererisch‘ verhielt, als sie z.B. die KAPD ausschloss. Dasselbe galt auch für Trotzkis Politik gegenüber der Italienischen Linken, die er unter bürokratischen Vorwänden aus der Internationalen Opposition ausschloss, um innerhalb der Sozialdemokratie Entrismus zu betreiben. Und für die Politik der PCInt nach 1945, als diese die Kommunistische Linke Frankreichs (GCF) ausschloss, um dann ungestört alle möglichen Leute zusammenzuführen, die noch schlimmer als opportunistisch waren und sich weigerten, ihre Fehler in der Vergangenheit zu kritisieren.
Unter den Linksoppositionen bietet uns die Italienische Fraktion eine ausgezeichnete Lektion in revolutionärer Verantwortung und Methode, indem sie sich für die Umgruppierung der Revolutionäre einsetzte, aber auch und vor allem für die Klarheit der politischen Positionen kämpfte. Die Italienische Linke hat immer auf der Notwendigkeit eines programmatischen Dokumentes gegen die Manöver bestanden, die die Linksopposition untergraben haben. Wenn es nämlich zu einem Bruch kommen sollte, sollte dieser auf der Grundlage von Texten geschehen.
Seit ihrer Gründung im 1. Weltkrieg in den Reihen der II. Internationale hat die Italienische Linke diese Methode angewandt. Auch gegenüber der niedergehenden Komintern von 1924 bis 1928 hat sie diese Methode benutzt, bis sie sich 1928 in Pantin (Frankreich) als Fraktion bildete. Trotzki selbst hat diese politische Ehrlichkeit gewürdigt, als er in seinem letzten Brief an die Fraktion im Dezember 1932 schrieb: “Die Spaltung von einer ehrlichen revolutionären Gruppe (von der IKS unterstrichen) wie der eurigen muss nicht notwendigerweise durch Feindseligkeiten, persönliche Angriffe oder boshafte Kritiken geprägt sein”.
Dagegen hatte die Methode Trotzkis innerhalb der Opposition nichts mit denen der Arbeiterbewegung zu tun. Der Ausschluss der Italienischen Linken verlief nach dem gleichen Schema wie in der stalinisierten Komintern, d.h. ohne offene Debatte, die diesen Ausschluss hätte rechtfertigen können. Solch ein Verhalten wurde von Trotzki nicht nur einmal an den Tag gelegt, denn er hat oft Abenteurer unterstützt, die sein Vertrauen erschlichen hatten. Aber all die revolutionären Gruppen wie die belgische, deutsche und spanische Linke und all die ehrenhaften revolutionären Militanten wie Rosmer, Nin, Landau und Hennaut wurden einer nach dem anderen ausgeschlossen oder beiseite gedrängt, bis die Internationale Opposition eine rein “trotzkistische “ Strömung geworden war.[20] [28]
Auf diesem Dornen reichen Weg der Verteidigung des Erbes des Marxismus und ihrer politischen Identität ist die Italienische Linke international zu jener politischen Strömung geworden, die die Notwendigkeit einer kohärenten Partei am besten ausgedrückt hat, einer Partei, aus der die Unentschiedenen und Zentristen ausgeschlossen bleiben, die aber gleichzeitig die große Fertigkeiten darin entwickelt, eine Umgruppierungspolitik der revolutionären Kräfte voranzutreiben, weil sie sich stets auf die Klarheit der Positionen und der Arbeitsmethoden gestützt hat.
Wird das IBRP (und vor ihm die PCInt seit 1943) – das sich als der einzig wirkliche politische Erbe der Italienischen Linken darstellt – wirklich den Ansprüchen seiner politischen Vorfahren gerecht? Sind seine Eintrittsbedingungen wirklich so streng, wie sie von Lenin seinerzeit verlangt wurden? Ehrlich gesagt, scheint uns das nicht der Fall zu sein. Die ganze Geschichte dieser Gruppe wird von verschiedenen Episoden des “Opportunismus in Organisationsfragen” geprägt, und statt vielmehr die Orientierungen umzusetzen, die man zu unterstützen vorgibt, betreibt das IBRP in Wirklichkeit eine Politik, die der niedergehenden Komintern und der Trotzkisten viel näher steht. Wir wollen hier nur einige symptomatische historische Beispiele zur Verdeutlichung desselben aufgreifen.
1943-1946
1943 wurde in Norditalien die Internationalistische Kommunistische Partei (PCInt) gegründet. Diese Nachricht weckte große Hoffnungen, und die Führung der neuen Partei wurde auf breiter Front vom Opportunismus übermannt. Dies fing damit an, dass Elemente in Massen dem PCInt beitraten, die aus dem Partisanenmilieu[21] [28] oder aus verschiedenen Gruppen aus dem Süden stammten, unter ihnen etliche aus der SP oder der KP, andere gar aus den Reihen der Trotzkisten, ganz zu schweigen von einer Reihe von Militanten, die zuvor offen mit dem programmatischen und organisatorischen Rahmen der Italienischen Linken gebrochen hatten, um sich in konterrevolutionäre Abenteuer zu stürzen, wie im Falle der Minderheit der Auslandsfraktion des PCI, die sich 1936 am Spanienkrieg beteiligte, oder wie Vercesi, der 1943 in der ‚Antifaschistischen Koalition” in Brüssel mitgewirkt hatte.[22] [28]
Natürlich wurde keiner dieser Genossen, die der neuen Partei beigetreten waren, um Rechenschaft über seine frühere politische Aktivität gebeten. Und was soll man davon halten, dass Bordiga selbst, entgegen dem Geist und den Worten Lenins, sich an den Aktivitäten der Partei bis 1952[23] [28] beteiligte, ihre politische Linie mit inspirierte, sogar eine politische Plattform verfasste und die Partei anerkannte - ohne Mitglied der Partei zu sein?
Es war die französische Fraktion der kommunistischen Linken (Fraction française de la Gauche Communiste – FFGC, Internationalisme), die in dieser Phase das Erbe der kommunistischen Linken fortsetzte, als sie die politischen Lehren der italienischen Fraktion (Bilan) aufgriff und weiter verfeinerte. Es war die FFGC, die gegenüber dem PCInt das Problem des Beitritts von Vercesi und der Minderheit von Bilan aufwarf, weil von ihnen niemals Rechenschaft über ihre früheren politischen Fehler verlangt worden war; sie brachte auch das Problem der Parteigründung in Italien zur Sprache, die stattfand, ohne die während der zehn vorausgegangenen Jahre erarbeitete Bilanz der Fraktion zu berücksichtigen.
1945 wurde ein internationales Büro unter Beteiligung des PCInt, der belgischen Fraktion und einer “parallelen” französischen Fraktion der FFCG, die “FFCGbis”, gegründet. In Wirklichkeit hatte sich diese “FFGCbis” aus einer Abspaltung zweier Individuen gebildet, die, der Exekutivkommission der FFGC angehörend, Kontakt zu Vercesi in Brüssel aufgenommen hatten und sich wahrscheinlich von seinen Argumenten hatten überzeugen lassen, nachdem sie selbst zuvor, Anfang 1945, dessen sofortigen Ausschluss ohne Diskussion unterstützt hatten.[24] [28]
Das eine Mitglied, Suzanne, war sehr jung und unerfahren, während das andere aus der spanischen POUM stammte (später trat er Socialisme ou Barbarie bei). Die “FFGCbis” “verstärkte” sich später durch den Eintritt von Mitgliedern der Minderheit von Bilan und der alten Union Communiste (Chazé, etc), die von der Fraktion wegen ihrer Konzessionen an den Antifaschismus während des Spanienkrieges kritisiert worden waren.
In Wirklichkeit diente die Gründung dieser “parallelen” Fraktion dazu, die Glaubwürdigkeit von Internationalisme zu untergraben. Wir sehen, die Geschichte wiederholt sich, da die PCInt das gleiche Manöver vollzog wie 1930, als sie innerhalb der Opposition gegen die italienische Fraktion die “Neue Italienische Opposition” (NOI) bildete, eine aus ehemaligen Stalinisten bestehende Gruppe, die nur zwei Monate vorher die Finger mit im Spiel hatte, als Bordiga aus der KPI ausgeschlossen wurde, und deren politische Funktion nur in ihrer provozierenden Konkurrenz zur Fraktion bestand.
Am 28. November 1946 richtete die GCF einen Brief an die PCInt, der mit einem Anhang versehen war, in dem sie eine Liste aller zu diskutierenden Fragen aufführte und eine Reihe von Verfehlungen aufzählt, für die verschiedene Teile der italienischen Linkskommunisten während des Krieges verantwortlich waren (Internationalisme Nr. 16).
Diesem zehn Seiten langen Brief antwortet die PCInt sehr lapidar mit folgenden Worten: “Sitzung des Internationalen Büro in Paris: Euer Brief, der erneut die ständige Verdrehung der Tatsachen und politischen Positionen sowohl des PC Italiens als auch der belgischen und französischen Fraktionen zum Inhalt hat, zeigt, dass ihr keine revolutionäre politische Organisation seid und dass eure Aktivitäten sich darauf beschränken, Verwirrung zu stiften und unsere Genossen zu besudeln. Daher haben wir einstimmig eure Bitte um Beteiligung am internationalen Treffen der Organisationen der GCI abgelehnt.”
Es stimmt, die Geschichte wiederholt sich als Farce. Auf dieselbe bürokratische Weise, mit der sie 1926 aus der Komintern ausgeschlossen worden war, wurde die GCI 1933 auch aus der Linksoppposition ausgeschlossen (siehe unsere Broschüre zur Italienischen Linken); schließlich schloss die GCI ihrerseits unter bürokratischen Vorwänden die französische Fraktion aus ihren Reihen aus, um der politischen Konfrontation auszuweichen.
Die 50er Jahre
Der Eklektizismus in den Positionen bedeutet, dass auf internationaler Ebene die Methode des ‚Herr im eigenen Haus‘ herrschte. Mit der Spaltung von 1952 nahmen die Bordigisten eine Position der “Unnachgiebigkeit” ein – allerdings nur in der Form einer Karikatur. Einerseits verweigerte man jede Diskussion ; andererseits öffnete man sich nach allen Seiten, wie im Herbst 1956, als die PCInt (Battaglia Comunista) mit den GAAP[25] [28], den Trotzkisten der Groupes Communistes Révolutionnaires und Action Communiste[26] [28] eine “Bewegung für die Kommunistische Linke” gründeten, deren markanteste Merkmale Heterogenität und Verwirrung waren. Diese vier Gruppen wurden von Bordiga ironisch das “Vierblättrige Kleeblatt” genannt.
Die 70er Jahre
Anfang 1976 haben die Genossen von Battaglia Comunista den “internationalen Gruppen der kommunistischen Linken” einen “Initiativvorschlag” unterbreitet, in dem sie dazu einluden:
- eine internationale Konkurrenz abzuhalten, um zu sehen, wo die Gruppen stehen, die sich auf den internationalen Linkskommunismus berufen;
- ein internationales Kontakt- und Diskussionszentrum zu schaffen.
Die IKS hat sich voller Überzeugung an der Konferenz beteiligt. Dabei haben wir jedoch die Festlegung von politischen Minimalkriterien für die Beteiligung verlangt. Die Genossen von Battaglia Comunista, die offensichtlich eine andere Art von Konferenzen gewohnt sind (siehe oben), zögerten bei der Festlegung von aus ihrer Sicht zu strengen Abgrenzungen: Sie befürchteten offenbar, einige Gruppen dadurch die Tür zu verschließen.
Die erste Konferenz fand im Mai 1977 in Mailand statt, wobei sich nur zwei Gruppen beteiligten – BC und die IKS. Aber BC verweigerte jede öffentliche Erklärung und wollte auch jene Gruppen nicht kritisieren, die sich trotz Einladung nicht an der Konferenz beteiligen wollten.
Ende 1978 fand die zweite Konferenz, diesmal in Paris, statt, an der sich mehrere Gruppen beteiligten. Am Ende der Konferenz kam die Frage der Teilnahmekriterien zur Sprache, aber diesmal schlug BC strengere Kriterien vor: “Die Kriterien müssen ermöglichen, die Rätekommunisten von diesen Konferenzen auszuschließen, und wir müssen deshalb auf der Anerkennung der historischen Notwendigkeit der Partei als wesentliches Kriterium bestehen.” Darauf antworteten wir, indem wir an “unsere Betonung der Notwendigkeit von Kriterien auf der ersten Konferenz (erinnerten). Wir meinen heute, dass die Hinzufügung von zusätzlichen Kriterien nicht angebracht ist. Wir sagen das nicht, weil es an Klarheit mangelte, und auch nicht hinsichtlich der Frage der Kriterien bezüglich der nationalen oder der Gewerkschaftsfrage, sondern weil dies verfrüht ist. In der gesamten revolutionären Bewegung gibt es in diesen Fragen noch sehr viel Verwirrung; und die NCI besteht zu Recht auf die dynamische Entwicklung der politischen Gruppen, die wir verfrüht ausschließen würden.”[27] [28]
In der ersten Hälfte des Jahres 1980 tagte die dritte und letzte internationale Konferenz[28] [28], deren Atmosphäre von Anfang an ihren späteren Ausgang vorweg nahm. Abgesehen vom Interesse am Diskussionsthema war auf dieser Konferenz die deutliche Absicht seitens BC zu spüren, die IKS von weiteren Konferenzen auszuschließen. BC war jedes Mittel recht, einen Vorwand zu finden, um die Konferenz zur Annahme eines noch strengeren und noch selektiveren Kriteriums zu bewegen, mit dem Ziel, die IKS definitiv auszuschließen. Der Hintergrund war, dass BC die IKS immer weniger als eine Gruppe des gleichen Lagers betrachtete, mit der sie zu einer Klärung gelangen könnte, die für alle Genossen und die neuen, in der Entstehung befindlichen Gruppen vorteilhaft wäre, sondern als einen gefährlichen Konkurrenten, der Letztere für sich vereinnahmen könnte.
So gelangte man also von der Gleichgültigkeit gegenüber den politischen Teilnahmekriterien auf der ersten Konferenz zur Erzwingung von Kriterien auf der dritten Konferenz, die absichtlich für den Ausschluss der IKS, d.h. des linken Flügels innerhalb der Konferenz, geschaffen wurden. Die dritte Konferenz war eine Wiederauflage des Ausschlusses der GCF von 1945 und damit die Fortsetzung früherer Episoden des Ausschlusses der Italienischen Linkskommunisten aus der Komintern (1926) und der Opposition (1933).
Die politische Verantwortung, die BC (und die CWO) dabei übernahm, ist gewaltig: Nur einige Monate später, im August 1980, brach der Massenstreik in Polen aus, doch diese einmalige Gelegenheit verstrich, ohne dass die Gesamtheit der linkskommunistischen Gruppen sich zu einer abgestimmten Intervention aufraffen konnte, von der das Weltproletariat hätte profitieren können.
Aber die Geschichte geht noch weiter. Einige Zeit später haben BC und die CWO, die zeigen wollten, dass sie die Konferenzserie und vier Jahre internationaler Arbeit nicht grundlos abgebrochen hatten, eine vierte Konferenz organisiert, an der neben ihnen eine sogenannte Revolutionäre Gruppe aus dem Iran teilnahm, vor der wir im übrigen BC gewarnt hatten. Nur einige Jahre später gestand das IBRP ein, dass diese iranische Gruppe alles andere als revolutionär war.
Die 90er Jahre
So kommen wir nun zu den letzten Jahren, wo wir von einer gewissen, sicher noch schwachen, aber ermutigenden Öffnung hin zum Dialog und zur Auseinandersetzung innerhalb des proletarischen politischen Lagers sprechen konnten[29] [28]. Der in gewisser Hinsicht sicherlich interessanteste Aspekt war der Anfang gemeinsamer Interventionen von IKS und IBRP (insbesondere unter Beteiligung ihres Bestandteils in England – der CWO). Es wurden gemeinsam abgesprochene Interventionen in Debatten durchgeführt (wenn sie nicht gar gemeinsam stattfanden), wie z.B. auf den Konferenzen über Trotzki, die in Russland stattfanden, auf einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung zur Russischen Revolution von 1917 in London oder bei der gemeinsamen Verteidigung gegen die Angriffe bestimmter parasitärer Gruppierungen usw. Wir haben diese Interventionen immer ohne Hintergedanken durchgeführt, ohne die Absicht, irgend jemanden zu vereinnahmen oder innerhalb des IBRP, zwischen die CWO und BC, einen Keil zu treiben. Dabei waren wir immer besorgt wegen der Diskrepanz zwischen der größeren Offenheit der CWO und der “schweigenden Abwesenheit” von BC. Schließlich beschloss BC, dass das Maß voll sei, zog die Zügel an und rief seine Partner zur Einhaltung der Partei- pardon, Bürodisziplin auf. Nun vollzog die CWO eine Kehrtwendung, denn alles, was sie zuvor für vernünftig und normal hielt, wurde nunmehr als inakzeptabel angesehen. Vorbei die Abstimmung bei der Arbeit gegenüber Russland, vorbei die gemeinsamen öffentlichen Veranstaltungen usw. Das IBRP übernimmt damit erneut eine schwere Verantwortung, denn aufgrund seines kleinkrämerischen Opportunismus musste das Weltproletariat in einem der schwierigsten Momente der gegenwärtigen Zeit, dem Kosovokrieg, reagieren, ohne dass seine Avantgarde es geschafft hätte, eine gemeinsame Stellungnahme abzugeben.
Um das ganze Ausmaß des Opportunismus des IBRP bei seiner Verweigerung gegenüber dem Vorschlag der IKS, einen gemeinsamer Aufruf gegen den Krieg zu verfassen, zu erkennen, ist es aufschlussreich, einen Artikel von BC, der im November 1995 unter der Überschrift “Irrtümer gegenüber dem Balkankrieg” geschrieben wurde, zu zitieren. BC berichtete darin, dass es von der OCI (Organizzazione Comunista Internazionale /Che Fare) eine(n) Brief/Einladung zu einer nationalen Versammlung in Mailand gegen den Krieg erhalten habe. BC meinte, dass “der Inhalt des Briefes interessant und wesentlich verbessert worden ist im Vergleich zu den Positionen der OCI gegenüber dem Golfkrieg, ihrer ‚Unterstützung für das vom Imperialismus angegriffene irakische Volk‘ und ihrer sehr polemischen Haltung in der Diskussion unserer angeblichen Indifferenz.” Der Artikel führt dann weiter aus. “Es fehlt der Bezug auf die Krise des Akkumulationszyklus (...) und die wesentliche Analyse ihrer Auswirkungen in der jugoslawischen Föderation. (...) Aber dies scheint kein Hindernis zu sein für eine mögliche gemeinsame Initiative derjenigen, die sich auf dem Klassenterrain gegen den Krieg stellen.” (Hervorhebung von uns) Vor gerade einmal vier Jahren wollte BC in einer Lage, die weniger ernst war als zur Zeit des Kosovokrieges, eine gemeinsame Initiative mit einer mittlerweile völlig konterrevolutionär gewordenen Gruppe[30] [28] ergreifen, um ihre aktivistischen Bestrebungen auszutoben, schreckte aber nicht davor zurück, Nein zur IKS zu sagen - unter dem Vorwand, dass unsere Positionen zu weit von ihren entfernt seien. Das nennt man Opportunismus.
Schlussfolgerungen
In diesem Artikel wollten wir auf die These des IBRP antworten, wonach Organisationen wie unsere “der Methode und den Arbeitsperspektiven, die zur Bildung der zukünftigen revolutionären Partei beitragen”, fern stehen. Zu diesem Zweck haben wir zwei Ebenen aufgegriffen, auf denen sich die Organisationsfrage stellt. Auf diesen beiden Ebenen haben wir gezeigt, dass das IBRP (und nicht die IKS) von der Tradition der italienischen und internationalen Linkskommunisten abweicht. Der Eklektizismus des IBRP bei seiner Umgruppierungspolitik ähnelt eher jener Trotzkis, der sich besessen um den Aufbau seiner IV. Internationale bemüht hatte. Die Methode der IKS stützt sich dagegen auf die der Italienischen Fraktion, die immer für einen Umgruppierungsprozess auf klarer Grundlage eingetreten ist, da diese Klarheit die Bedingung ist, um die zögernden und zaudernden Elemente aus dem Zentrum zu gewinnen.
Auch wenn es den verschiedenen selbsternannten Erben nicht gefällt, die wirkliche Kontinuität der Italienischen Fraktion wird heute von der IKS verkörpert, weil unsere Organisation sich auf all die Schlachten der 20er, 30er und 40er Jahre beruft, die Lehren daraus übernommen und fortgesetzt hat.
31.8.2000
Ezechiele
[1] [28] IBRP: Internationales Büro für die Revolutionäre Partei, eine internationale Organisation, welche die beiden Organisationen Communist Workers Organisation (CWO) und den Partito internazionalista in Italien vereinigt.
[2] [28] Veröffentlicht in Battaglia Comunista Nr. 1, Januar 2000, und in Internationalist Communist Nr. 18, Winter 2000.
[3] [28] Die Kommunistische Internationale hatte seinerzeit auch 21 Aufnahmebedingungen.
[4] [28] Vgl. unseren Artikel ”Über den Aufruf der IKS zu einer Stellungnahme gegen den Krieg in Serbien. Die kriegerische Offensive der Bourgeoisie erfordert eine gemeinsame Antwort der Revolutionäre”, Internationale Revue Nr. 24
[5] [28] Vgl. auch ”Polemik mit dem IBRP. Die marxistische Methode und der Aufruf der IKS gegenüber dem Krieg in Ex-Jugoslawien”, Internationale Revue Nr. 25
[6] [28] Es geht dabei um die Punkte 13 und 16, wo es Divergenzen gibt, die aber nicht grundlegend sind, sondern nur die Analyse der gegenwärtigen Lage betreffen.
[7] [28] Die Berichte und kritische Einschätzungen über diese Konferenzen können in verschiedenen Artikeln der Internationalen Revue und in Broschüren nachgelesen werden, die auf Bestellung erhältlich sind.
[8] [28] Thesen der Linken für den 3. Kongress der Kommunistischen Partei Italiens, Lyon, Januar 1926
[9] [28] ”Während dieser ganzen Zeit (1930), wurde Trotzki durch die Briefe von Rosmer informiert. Dieser ist gegen die Italienische Linke und ‚blockiert alle Diskussionen‘. Er kritisierte Prometeo, der zunächst vor der Gründung der Internationale nationale Sektionen bilden wollte, und er nannte das Beispiel von Marx und Engels, die” 1847 die kommunistische Bewegung mit einem internationalen Dokument zum Leben erweckt und die erste Internationale gegründet haben. “Diese Argumentation ist zu unterstreichen, da sie in der Folge immer wieder zu Unrecht gegen die Italienische Fraktion ins Feld geführt wird.” (IKS, Rapports entre la fraction de gauche du PC d’Italie et l’Opposition de la Gauche Internationale, 1929-1933, im Buch La Gauche Communiste d’Italie, in frz., engl., span. oder ital. Sprache erhältlich)
[10] [28] IBRP, ”Hin zur neuen Internationalen”, Prometeo Nr. 1, Serie VI, Juni 2000
[11] [28] IBRP, a.a.O.
[12] [28] Vgl. auch unsere allgemeine Stellungnahme zu dieser Frage im Artikel Über die Partei und ihre Beziehung zur Klasse, ein Text des 5. Kongresses der IKS, Internationale Revue Nr. 9
[13] [28] “Viele (Delegierte am Gründungskongress der KI) waren tatsächlich bolschewistische Militante: Die Kommunistische Partei Polens in vielerlei Hinsicht, diejenige Lettlands, der Ukraine, Litauens, Weißrusslands, Armeniens, die vereinigte Gruppe der Völker Ostrusslands, die Sektionen des Zentralbüros der Völker des Ostens waren unter verschiedenen Titeln letztlich Schöpfungen der Bolschewistischen Partei selber. (...) Aus dem Ausland kamen eigentlich nur die beiden Schweizer Delegierten, Fritz Platten und Kascher, der Deutsche Eberlein (...), der Norweger Stange und der Schwede Grimlund, der Franzose Guilbeaux. Doch auch bei ihnen konnte über die Repräsentanz diskutiert werden. (...) Es blieben letztlich nur die beiden Delegierten, die ein unbestreitbares Mandat hatten, der Schwede Grimlund und Eberlein.” (Der Erste Kongress der Kommunistischen Internationale, Pierre Broué: Einführung, die Ursprünge der Kommunistischen Internationale. EDI, Paris, S. 35-36)
[14] [28] Diese Kritik haben wir schon kürzlich gegenüber BC im Zusammenhang mit deren opportunistischen Methode geübt, mit der sie Beziehungen zu Elementen der GLP pflegt. Die GLP sind eine politische Gruppierung, deren Teile daran sind, mit der autonomen Bewegung zu brechen, und auf halbem Weg der Klärung angelangt sind, wobei sie immer noch eine gute Dosis ihrer ursprünglichen Verwirrung beibehalten haben: “Diese Intervention ist aber weit davon entfernt, die Klärung dieser Gruppe und die Aneignung einer revolutionären Kohärenz voranzubringen, im Gegenteil ihre mögliche Entwicklung wurde blockiert.” (aus “Die ‚Gruppen proletarischer Kampf‘: ein unvollständiger Versuch des Erreichens einer revolutionären Kohärenz”, Weltrevolution Nr. 89)
[15] [28] Das IBRP wird uns wahrscheinlich widersprechen, indem es auf das Beispiel von Gruppen verweist, die sich in den letzten Jahren dazu entschlossen haben, mit ihm zu “arbeiten”, bzw. auf eine neue Präsenz in Frankreich mit einer Publikation (Bilan et perspectives). Wir hoffen, dass sich diese neuen Kräfte anders als ihre Vorläufer halten können, doch das IBRP wird besonders wachsam sein müssen, wenn es nicht dieselben Enttäuschungen erleben will wie zuvor.
[16] [28] Der zweite Kongress der Kommunistischen Internationale, Protokoll der Verhandlungen vom 19. Juli in Petrograd und vom 23. Juli bis 7. August 1920 in Moskau, Hamburg 1921, S. 395
[17] [28] Rede von Amadeo Bordiga über die Die Aufnahmebedingungen der KI, 1920, veröffentlicht in La Sinistra Comunista nel cammino della rivoluzione, Edizioni sociali, 1976
[18] [28] Diese Politik der degenerierenden Komintern führte zur Isolierung der revolutionären Kräfte in den Parteien und hat sie der Repression und dem Massaker ausgeliefert, wie dies insbesondere in China der Fall war.
[19] [28] IKS: Die Italienische Kommunistische Linke 1927-52 (frz./engl./span./ital.)
[20] [28] aus dem Buch der IKS: Die Beziehungen zwischen der Linksfraktion der KP Italiens und der Internationalen Linksopposition, 1923-1952, das demnächst auf Französisch erscheint
[21] [28] “Die Unklarheiten über die ‚Partisanen” bei der Gründung der Internationalistischen Kommunistischen Partei in Italien”, Antwort der IKS in Revue Internationale (frz./engl./span. Ausgabe) Nr. 8 auf einen Brief von Battaglia Comunista
[22] [28] s. die Artikel “Die Wurzeln der IKS und des IBRP” in Internationale Revue Nr. 22/23 und den Artikel “Die Schatten des Bordigismus und seiner Epigonen” in Revue Internationale (frz./engl./span. Ausgabe) Nr. 95
[23] [28] das Jahr der Spaltung zwischen der heutigen Gruppe Battaglia Comunista und den ‚bordigistischen” Bestandteilen der IKP
[24] [28] IKS: Die Italienische Kommunistische Linke 1927-52
[25] [28] Einige ehemalige Partisanen, unter ihnen Crevetto, Massimi und Parodi, traten der anarchistischen Bewegung bei und versuchten in ihren Reihen als Klassentendenz tätig zu sein, als sie im Februar 1951 mit der Herausgabe der Zeitung L‘impulso die “Gruppi Anarchici di Azione Proletaria” (GAAP) gründeten.
[26] [28] AC entstand 1954 als eine Tendenz der IKP, die von Seniga, Raimondi, einem ehemaligen Partisanen, und Fortichiari, einem der Gründer der KP Italiens 1921, der der IKP nach seinem Ausschluss aus der KP beigetreten war, gebildet wurde. Seniga war ein Mitarbeiter Pietro Secchias, welcher die Gruppen links von der KP Italiens während der Resistance als “Marionetten der Gestapo” bezeichnet und dazu aufgefordert hatte, diese physisch zu eliminieren. Es handelte sich um den Zusammenschluss eines Teils von AC und den GAAP, die 1965 die Gruppe Lotta Comunista gründeten.
[27] [28] Das Protokoll der Konferenz wurde in “Vorbereitungstexte (Fortsetzung), Berichte, Korrespondenz der 2. Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken”, Paris, November 1978, veröffentlicht.
[28] [28] Revue Internationale (frz./engl./span. Ausgabe) Nr. 22, 3. Quartal 1980, “3. Internationale Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken” Paris, Mai 1980, “Das Sektierertum, ein Erbe der Konterrevolution, das überwunden werden muss”; s. auch das Protokoll der 3. Konferenz, das von der IKS auf Französisch als Broschüre und von BC als Sonderausgabe von Prometeo auf Italienisch herausgebracht wurde.
[29] [28] Internationale Revue Nr. 21, “6. Kongress des Partito Comunista Internazionalista - Ein Schritt vorwärts für die Kommunistische Linke”, Revue Internationale (frz./engl./span. Ausgabe) Nr. 93, “Debatten unter bordigistischen Gruppen: eine bedeutsame Entwicklung des proletarischen politischen Milieus”, Internationale Revue Nr. 95: Die Kommunistische Linke Italiens, “Zur Broschüre ‘Die Schatten des Bordigismus und seiner Epigonen‘ (Battaglia Comunista)”.
[30] [28] Es ist typisch für den Opportunismus der Genossen von BC, dass sie im Herbst 1995 erneut Verbindung zu einer Organisation aufgenommen haben, die seit mindestens fünf Jahren, seit dem Golfkrieg, nichts anderes tut, als eine imperialistische Front gegen die andere zu unterstützen, und sich direkt an der Mobilisierung des Proletariats für die imperialistischen Massaker beteiligt. Siehe dazu unsere Artikel in Rivoluzione Internazionale: “L’OCI – la calunnia è un venticello” Nr. 76, Juni 92, “Le farnetticazioni dell’OCI”, Nr. 69, April 91, außerdem: “Les poissons-chats du Golfe” in Revue Internationale (frz./engl./span. Ausgabe) Nr. 67, Dez. 90.
Politische Strömungen und Verweise:
Deutsche Revolution, Teil X
- 3060 Aufrufe
Der Rückfluss der revolutionären Welle und die Entartung der Kommunistischen Internationalen
Mit der erfolgreichen Machtübernahme im Oktober 1917 hatte die russische Arbeiterklasse ein Zeichen gesetzt, das weltweite Ausstrahlungskraft haben sollte. Sofort griffen die Arbeiter der benachbarten Länder das Beispiel der russischen Arbeiterklasse auf. Schon im November 1917 traten die finnischen Arbeiter in den Kampf. Die tschechischen Provinzen, Polen Österreich, Rumänien und Bulgarien wurden im Laufe des Jahres 1918 von einer Streikwelle nach der anderen erschüttert. Als dann im November die deutschen Arbeiter auf die Bühne traten, hatte die revolutionäre Welle ein Land erfasst, das für den weiteren Verlauf der Kämpfe, für Sieg oder Niederlage der Weltrevolution von ausschlaggebender Bedeutung war.Durch die unverzügliche Beendigung des Krieges im November 1918, durch die Sabotage von Sozialdemokratie und Gewerkschaften in engster Abstimmung mit dem Militär und schließlich durch die Provokation eines verfrühten Aufstandes gelang es der deutschen Bourgeoisie und ihren “demokratischen” Kräften, eine erfolgreiche Machtübernahme durch die deutsche Arbeiterklasse und somit die weitere Ausdehnung der russischen Revolution zu verhindern.
Die Vereinigung der internationalen Bourgeoisie gegen die revolutionäre Welle
Die Gründung einer Räterepublik in Ungarn im März, die Streikwelle in Frankreich im Frühjahr, die Erhebungen in der slowakischen Republik im Juni und die schweren Kämpfe in den USA und in Argentinien – alle diese Erhebungen in Europa und auf anderen Kontinenten im Jahre 1919 fanden erst statt, nachdem die Revolution in Deutschland bereits einen herben Rückschlag erlitten hatte. Da es dem Dreh- und Angelpunkt bei der weltweiten Ausdehnung der Revolution, der Arbeiterklasse in Deutschland, nicht gelang, die Kapitalistenklasse in einem schnellen Sturmlauf wegzufegen, verlor diese Welle ab 1919 langsam ihre Dynamik. Zwar leisteten die Arbeiter in einer Reihe von Konfrontationen – so in Deutschland selbst (Kapp-Putsch im März 1920), so in Italien im Herbst 1920 – noch heldenhaften Widerstand gegen die Offensive der Bourgeoisie, doch konnten diese Kämpfe die Bewegung nicht mehr vorwärts tragen.
Zuvorderst hatten es diese Kämpfe nicht vermocht, die Offensive des Kapitals gegen die isolierte russische Bastion der Weltrevolution zu durchbrechen. Im Frühjahr 1918 hatte dieselbe russische Bourgeoisie, die noch im Oktober 1917 so schnell und nahezu gewaltlos davongejagt worden war, mit der Unterstützung von 14 Armeen der “demokratischen” Staaten begonnen, einen Bürgerkrieg gegen die russische Revolution zu entfachen. In einem mehr als dreijährigen Krieg, bei gleichzeitiger Wirtschaftsblockade mit dem Ziel des Aushungerns, wurde die russische Arbeiterklasse von den “weißen” Armeen der kapitalistischen Staaten ausgeblutet. Zwar blieb die militärische Offensive der “Roten Armee” im Laufe dieses Krieges siegreich, doch wurden die russischen Arbeiter zu einem Krieg gezwungen, in dessen Verlauf sie isoliert sengenden und mordenden imperialistischen Armeen gegenüberstanden. Am Ende der jahrelangen Blockade und des Bürgerkrieges, Ende 1920, war die russische Arbeiterklasse ausgeblutet (eine Million Tote in ihren Reihen), erschöpft und vor allem politisch enorm geschwächt.
Ende 1920, als die deutschen Arbeiter bereits ihre erste Niederlage eingesteckt hatten, als die italienischen Arbeiter in die Falle der Fabrikbesetzungen gelaufen waren, als die Rote Armee auf ihrem Vormarsch in Polen zurückgeschlagen worden war, wurde den Kommunisten klar, dass die Hoffnung auf eine schnelle Ausdehnung der Revolution sich nicht erfüllen sollte. Auch die Kapitalistenklasse spürte, dass die unmittelbare Todesgefahr, die die Erhebung der deutschen Arbeiterklasse für sie bedeutete, einstweilen gebannt war.
Die Ausdehnung der revolutionären Welle war vor allem vereitelt worden, weil die Kapitalistenklasse rasch die Lehren aus der Machtergreifung durch die russischen Arbeiter gezogen hatte.
Die historische Erklärung sowohl der explosiven Entwicklung der Revolution als auch ihrer schnellen Niederlage liegt in der Tatsache begründet, dass diese revolutionäre Welle, entgegen der Erwartung von Marx, nicht aus einer allgemeinen Wirtschaftskrise, sondern aus einem imperialistischen Krieg hervorgegangen war. Anders als 1939 war die Arbeiterklasse vor dem I. Weltkrieg nicht entscheidend geschlagen worden. So war sie, trotz des gegenseitigen Abschlachtens an der Front, in der Lage, eine revolutionäre Antwort auf die vom Imperialismus verursachte Barbarei zu liefern. Doch dem Krieg und der Fortsetzung der Massaker konnte nur ein Ende gemacht werden, indem die Arbeiterklasse schnell und entschlossen die Macht ergriff. Daher hatte sich die Revolution, sobald sie einmal ausgelöst war, mit großer Schnelligkeit entwickelt und ausgeweitet. Infolgedessen erwartete das revolutionäre Lager zumindest in Europa einen schnellen Erfolg der Revolution.
Nun ist die Bourgeoisie zwar unfähig, die Wirtschaftskrise ihres Systems zu beenden, doch ist sie allemal in der Lage, einen imperialistischen Krieg zu beenden, sofern die Revolution droht. Und genau dies tat sie, als die revolutionäre Welle im November 1918 das Herz des Weltproletariats, die deutsche Arbeiterklasse, erreicht hatte. Auf diese Weise vermochten die Ausbeuter die Dynamik der revolutionären Ausdehnung zu bremsen.
Die Bilanz der revolutionären Welle von 1917 bis 1923 zeigt sehr deutlich, dass der Weltkrieg schon lange vor der Entwicklung der Atomwaffen mit ihrem zerstörerischen Potenzial relativ ungünstige Rahmenbedingungen für den Erfolg der proletarischen Revolution schuf. Wie Rosa Luxemburg in der Junius-Broschüre aufzeigte, bedeutete das Abschlachten von Millionen von Arbeitern, auch und gerade der Erfahrensten und Bewusstesten unter ihnen, in einem modernen Krieg eine unmittelbare Bedrohung der Grundlagen für den Sieg des Sozialismus. Darüber hinaus schafft der Krieg unterschiedliche Kampfbedingungen für die Arbeiter – je nachdem, ob sie in einem Siegerland, einem neutralen oder einem besiegten Land leben. Es war kein Zufall, dass die revolutionäre Welle am stärksten in den besiegten Ländern, in Russland, Deutschland, Österreich-Ungarn, aber auch in Italien (das nur formell dem Lager der Sieger angehörte), zum Ausdruck kam und weit weniger stark war in Ländern wie Frankreich, England und den USA. Den Siegermächten gelang es nicht nur, ihre Wirtschaft durch Beutegut aus den besiegten Ländern zu stabilisieren, sondern sie vermochten auch viele Arbeiter mit dem Bazillus der ‚Siegeseuphorie‘ zu infizieren. In gewisser Weise gelang es ihnen sogar, das Feuer des Chauvinismus neu zu entfachen. So richtete das nationalistische Gift, das während des Krieges von der herrschenden Klasse gegen die weltweite Solidarität mit der Oktoberrevolution und gegen den wachsenden Einfluss der internationalistischen Revolutionäre verbreitet wurde, noch nach Beginn der Revolution große Schäden an. Die revolutionäre Bewegung in Deutschland liefert hierfür klare Beweise: der Einfluss des extremistischen Nationalismus, für den die “Nationalbolschewisten” unter dem Etikett des “Linkskommunismus” während des Krieges in Hamburg eintraten und antisemitische Flugblätter gegen die Spartakisten verteilten, weil diese eine internationalistische Position verteidigten; die patriotischen Gefühlsaufwallungen, die nach der Unterzeichnung des Versailler Vertrages aufgekommen waren; der nach der Ruhrgebietsbesetzung von 1923 gegen Frankreich gerichtete Chauvinismus usw. Wie wir in weiteren Folgen dieser Artikelserie zeigen werden, schickte sich die Kommunistische Internationale in ihrer opportunistischen Niedergangsphase an, diese Welle des Nationalismus noch zu übertreffen, statt ihr entgegenzutreten.
Aber die Intelligenz und Hinterlist der deutschen Bourgeoisie wurde nicht nur darin deutlich, dass sie sofort den Krieg beendete, nachdem die Arbeiter zum Sturm gegen den bürgerlichen Staat antraten. Im Gegensatz zur russischen Arbeiterklasse, die es mit einer unerfahrenen und schwachen Bourgeoisie zu tun hatte, stand die deutsche Arbeiterklasse einer vereinten Front des Kapitals, mit der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften als Speerspitze, gegenüber.
Unter Ausnutzung der noch vorhandenen demokratischen Illusionen unter den Arbeitern und der durch das Kriegsende eingetretenen Spaltung zwischen “Siegermächten” und “Besiegten” vermochte die Kapitalistenklasse mit einer Reihe von politischen Schachzügen und Provokationen die Arbeiterklasse in die Sackgasse zu führen und zu besiegen.
Die Ausdehnung der Revolution war gestoppt worden. Die Bourgeoisie konnte, nachdem sie die erste Welle von Erschütterungen überlebt hatte, zur Offensive übergehen. Sie setzte alles daran, das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten zu wenden. Untersuchen wir, wie die Revolutionäre auf den Rückzug des Klassenkampfes reagierten und welche Konsequenzen dies für die Arbeiterklasse in Russland hatte.
Die Entwicklung der Komintern vom II. zum III. Kongress
Nachdem die deutsche Arbeiterklasse im November 1918 in Bewegung geraten war, ergriffen die Bolschewiki bereits einen Monat später die Initiative, um eine internationale Konferenz einzuberufen. Damals gingen die meisten Revolutionäre davon aus, dass die Machtergreifung in Deutschland ähnlich schnell und erfolgreich durchgeführt werden könne wie in Russland. So wurde im Einladungsschreiben der Tagungsort Deutschland (legal) bzw. Holland (illegal) für den 1. Februar 1919 ins Auge gefasst. Niemand dachte zur damaligen Zeit daran, die Konferenz in Moskau abzuhalten. Erst die Niederschlagung der Berliner Arbeiter im Januar, die Ermordung der revolutionären Führer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und die damit verbundene Repression der sozialdemokratisch angeführten Freikorps gegen die Revolutionäre machten ein Treffen in Berlin unmöglich. Erst daraufhin wurde Moskau als Tagungsort ins Spiel gebracht. Als im März 1919 die Komintern gegründet wurde, schrieb Trotzki in der Iswestija: “Wenn sich heute das Zentrum der Internationalen in Moskau befindet, so wird es morgen – wir sind davon zutiefst überzeugt – sich gegen Westen, in Richtung Berlin, Paris, London verlagern.” (29. April 1919)
Gemäß aller revolutionären Organisationen sollte die Politik der Kommunistischen Internationale von den Interessen der Weltrevolution bestimmt werden. Die ersten Debatten auf dem Kongress waren durch die Situation in Deutschland geprägt. Im Vordergrund stand die Rolle der Sozialdemokratie bei der Niederschlagung der Arbeiterkämpfe im Januar und die Notwendigkeit, diese Partei als eine kapitalistische Partei zu bekämpfen.
Trotzki schrieb im oben zitierten Artikel ferner: “Das revolutionäre ‚Erstgeburtsrecht‘ des russischen Proletariats ist nur vorübergehend (...) Die Diktatur des russischen Proletariats wird erst endgültig abgeschafft und sich in einen tatsächlichen allgemeinen sozialistischen Aufbau verwandeln können, wenn die europäische Arbeiterklasse uns vom wirtschaftlichen und vor allem militärischen Joch der europäischen Bourgeoisie befreien wird (...)” (Trotzki, Iswestija, 29. April / 1. Mai 1919) Und: “Wenn sich die Völker Europas nicht erheben und den Imperialismus zerschmettern, werden wir zerschmettert werden – das steht außer Zweifel. Entweder die russische Revolution entfesselt den Wirbelsturm des Kampfes im Westen – oder die Kapitalisten aller Länder ersticken unseren Kampf.” (II. Weltkongress)
Nachdem binnen kürzester Zeit etliche Parteien der Komintern beigetreten waren, stellte man auf dem II. Weltkongress fest: “(...) unter gewissen Umständen kann für die Komintern die Gefahr entstehen, dass sie durch wankelmütige Gruppen verwässert wird, die eine Politik der Halbheiten treiben und sich von der Ideologie der 2. Internationalen noch nicht frei gemacht haben (...) Deshalb erachtet es der II. Weltkongress der Komintern für notwendig, ganz genaue Bedingungen für die Aufnahme von neuen Parteien festzusetzen.”
Auch wenn die Komintern in der Hitze des Feuers gegründet wurde, machte sie in den zentralen Themen wie der Ausdehnung der Revolution, der Machtübernahme, der schärfsten Abgrenzung von der Sozialdemokratie oder der Entlarvung der bürgerlichen Demokratie klare Aussagen. Dagegen ließ sie Fragen wie die Gewerkschafts- oder Parlamentarismusfrage offen.
Die Mehrheit in der Komintern trat für die Teilnahme an den Parlamentswahlen ein. Gleichwohl gab es keine ausdrückliche Verpflichtung dazu, da eine starke Minderheit (insbesondere die Gruppe um Bordiga, die damals unter dem Namen ‚Abstentionistische Fraktion‘ bekannt wurde) sich vehement gegen diese Orientierung ausgesprochen hatte.
Dagegen verpflichtete die Komintern ihre Mitglieder zur Arbeit innerhalb der Gewerkschaften. Die KAPD-Delegierten, die in völlig verantwortungsloser Manier bereits vor der Eröffnung des Kongresses wieder abgereist waren, versäumten es, es den italienischen Genossen gleich zu tun und ihren Standpunkt zu diesen Fragen auf dem Kongress vorzubringen.
Dreh- und Angelpunkt der Debatte, die schon vor dem Kongress mit der Veröffentlichung von Lenins Werk Der Linksradikalismus – Kinderkrankheit des Kommunismus eingeleitet worden war, war die Frage der Kampfmethoden in der neuen Ära der kapitalistischen Dekadenz. In dieser politischen Auseinandersetzung entstand der Linkskommunismus.
Hinsichtlich des weiteren Verlaufs der Kämpfe verbreitete der II. Kongress noch Optimismus. Alle erwarteten im Sommer 1920 ein weiteres Anwachsen der revolutionären Kämpfe. Doch nach der Niederlage im Herbst 1920 sollte sich das Blatt wenden.
Der rückläufige Klassenkampf verlieh dem Opportunismus Auftrieb
In den “Thesen zur Weltlage und die Aufgaben der Kommunistischen Internationale” auf dem III. Weltkongress analysierte die Komintern die Lage folgendermaßen: “Während des Jahres zwischen dem II. und III. Kongress der Komintern endete eine Reihe von Aufständen und Kämpfen der Arbeiterklasse z.T. mit Niederlagen (die Offensive der Roten Armee gegen Warschau im August 1920, die Bewegung des italienischen Proletariats im September 1920, der Aufstand der deutschen Arbeiter im März 1921). Die erste Periode der revolutionären Bewegung nach dem Kriege (...) erscheint als im Wesentlichen abgeschlossen. Die Führer der Bourgeoisie (...) sind in allen Ländern zur Offensive gegen die Arbeitermassen übergegangen. Infolgedessen stellt die Kommunistische Internationale sich und der ganzen Arbeiterklasse folgende Fragen: In welchem Ausmaß entspricht das neue politische Verhältnis der Bourgeoisie zum Proletariat dem tatsächlichen Kräfteverhältnis? Ist die Bourgeoisie wirklich nahe daran, das soziale Gleichgewicht wiederherzustellen, das durch den Krieg zerstört worden ist? Ist es begründet anzunehmen, dass anstelle politischer Erschütterungen und Klassenkämpfe eine neue, lang andauernde Epoche der Wiederherstellung und des Wachstums des Kapitalismus eintreten werde? Folgt daraus nicht die Notwendigkeit der Revision des Programms oder der Taktik der Kommunistischen Internationalen?” (S. 9)
Und in den Thesen über die Taktik wurde folgende Vorgehensweise vorgeschlagen: “Die Weltrevolution (...) wird eine längere Periode von revolutionären Kämpfen in Anspruch nehmen (...) Die Weltrevolution ist kein gradlinig fortschreitender Prozess.”
Die Komintern versuchte auf verschiedene Weise, sich auf diese neue Situation einzustellen.
Der Schlachtruf ‚Zu den Massen!‘ – ein Schritt zur opportunistischen Verwirrung
In einem früheren Artikel sind wir bereits auf die sogenannte Offensivtheorie eingegangen.
Ein Teil der Komintern und große Kreise der Revolutionäre in Deutschland drängte auf eine “Offensive”, auf einen “Befreiungsschlag” zugunsten Russlands. Diese Kräfte ummantelten ihre abenteuerlichen Handlungen mit einer “Offensivtheorie”, derzufolge die Partei, wenn sie nur entschlossen und mutig genug sei, sich ungeachtet des Kräfteverhältnisses und der Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit in einen Ansturm auf das Kapital stürzen könne.
Doch die Geschichte hat gezeigt, dass man die proletarische Revolution nicht künstlich entfachen und die mangelnde Initiative und fehlende Kampfbereitschaft der Klasse nicht durch die Partei ersetzen kann. Auch wenn die Komintern auf ihrem III. Weltkongress im Juli 1921 das Abenteurertum der KPD schließlich verwarf, so benutzte sie dennoch selbst opportunistische Mittel, um größeren Einfluss unter den rückständigen Arbeitern zu erlangen. “‘Zu den Massen‘ – das ist die erste Kampflosung, die der III. Kongress den Kommunisten aller Länder zuruft.” Wenn die Massen weiter auf der Stelle träten, müsse man sich eben selbst zu den Massen hin bewegen.
Um einen größeren “Masseneinfluss” zu erlangen, hatte die Komintern im Herbst 1920 auf die Gründung von Massenparteien in etlichen Ländern gedrängt. In Deutschland wurde im Dezember 1920 der linke Flügel der zentristischen USPD mit der KPD zur VKPD zusammengeschlossen (die somit etwa 400.000 Mitglieder umfasste); im Herbst 1920 wurde die tschechische KP mit 350.000 Mitgliedern und die französische KP mit ca. 120.000 Mitgliedern in die Komintern aufgenommen.
“Die Komintern hat vom ersten Tage ihrer Bildung an klar und unzweideutig sich zum Zwecke gesetzt nicht die Bildung kleiner, kommunistischer Sekten, (...) sondern die Teilnahme an dem Kampfe der Arbeitermassen, die Leitung dieses Kampfes in kommunistischem Sinne und die Bildung im Kampfe erprobter, großer revolutionärer, kommunistischer Massenparteien. Die Komintern hat schon im ersten Jahre ihrer Existenz die sektiererischen Tendenzen abgelehnt, indem sie die ihr angeschlossenen Parteien – mochten sie noch so klein sein – aufforderte, sich an den Gewerkschaften zu beteiligen, um deren reaktionäre Bürokratie von innen heraus zu überwinden und die Gewerkschaften zu revolutionären Massenorganisationen des Proletariats, zu Organen seines Kampfes zu machen. (...) Auf ihrem II. Weltkongress hat die Komintern die sektiererischen Tendenzen in ihren Resolutionen über die Gewerkschaftsfrage und über die Ausnützung des Parlamentarismus offen abgelehnt (...) Der deutsche Kommunismus wurde dank der Taktik der Komintern (revolutionäre Arbeit in den Gewerkschaften, Offener Brief usw.) (...) zu einer großen, revolutionären Massenpartei (...) In der Tschechoslowakei ist es den Kommunisten gelungen, die Mehrheit der politisch organisierten Arbeiter auf ihre Seite zu bringen (...) Die sektiererischen kommunistischen Gruppen (wie die KAPD usw.) konnten dagegen auf ihrem Wege nicht die geringsten Erfolge erreichen.” (“Thesen zur Taktik”, S. 37)
Die Auseinandersetzung über die Mittel des Kampfes und über die Möglichkeit der Existenz einer Massenpartei im neuen Zeitalter der kapitalistischen Dekadenz hatte schon auf dem Gründungsparteitag der KPD im Dezember 1918/Januar 1919 begonnen. Schon damals ging es um die Frage, ob die Kommunisten auch weiterhin in den Gewerkschaften arbeiten und das Parlament als Tribüne verwenden können.
Auch wenn Rosa Luxemburg in der Debatte des Gründungsparteitages über die Gewerkschafts- und Parlamentarismusfrage noch für eine Mitarbeit in diesen Institutionen gestimmt hatte, so bewies sie dennoch einen außerordentlichen Weitblick, als sie erkannte, dass neue Kampfbedingungen entstanden waren, unter denen die Revolutionäre nur mit großer Ausdauer und ohne jegliche naive Hoffnung auf eine “schnelle” Lösung ihrer Arbeit nachgehen können. Den Kongress vor Ungeduld und überstürztem Handeln warnend, betonte sie mit Nachdruck: “Wenn ich es so schildere, nimmt sich der Prozess vielleicht etwas langwieriger aus, als man geneigt wäre, ihn sich im ersten Moment vorzustellen.” Noch in ihrem letzten Artikel für die Rote Fahne vor ihrer Ermordung warnte sie: “Aus alledem ergibt sich, dass auf einen endgültigen, dauernden Sieg in diesem Augenblick noch nicht gerechnet werden konnte.” (Die Ordnung herrscht in Berlin)
Die Analyse der aktuellen Lage und die Einschätzung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Kommunisten. Wenn sie dieser Verantwortung nicht gerecht werden und einen Sturm erwarten, wo doch alles bereits wieder abflaut, besteht die Gefahr, voller Ungeduld abenteuerlichen Aktionen anheim zu fallen und danach zu trachten, die reale Klassenbewegung durch künstlich stimulierte Versuche zu ersetzen.
Auf dem Heidelberger Parteitag der KPD im Oktober 1919 hatte die Führung um Levi angesichts des ersten Abebbens der Kämpfe in Deutschland gegen das Mehrheitsvotum vorgeschlagen, die KPD solle, um ihren Einfluss auf die Arbeitermassen zu vergrößern, ihre Arbeit darauf ausrichten, in die Gewerkschaften und Parlamente einzudringen. Keine zwei Jahre später sollte auf dem III. Weltkongress der Komintern erneut diese Debatte stattfinden.
Die italienische Linke um Bordiga hatte schon auf dem II. Weltkongress heftig die Teilnahme am Parlamentarismus attackiert (s. Thesen zum Abstentionismus) und vor dieser Ausrichtung gewarnt, da sie ein fruchtbarer Nährboden für den Opportunismus sei. Und die KAPD, die es auf dem II. Weltkongress noch versäumt hatte, ihre Stimme zu erheben, sollte dafür auf dem III. Weltkongress unter schwierigsten Bedingungen intervenieren und Kritik an dieser opportunistischen Entwicklung üben.
Während die KAPD-Delegation hervorhob, “das Proletariat braucht dann eine durchgebildete Kernpartei” (Jan Appel auf dem III. Weltkongress, S. 497), suchte die Komintern Zuflucht im Aufbau von Massenparteien. Die Position der KAPD wurde mehrheitlich abgelehnt.
Die opportunistische Ausrichtung nach dem Motto: “Zu den Massen” erleichterte wiederum die Durchsetzung der “Einheitsfronttaktik”, die einige Monate später auf dem III. Kongress offiziell angenommen wurde.
Entscheidend hierbei ist, dass die Komintern diesen Kurs erst einschlagen konnte, als sich die Welle der revolutionären Kämpfe in Europa nicht mehr ausdehnte, sondern zurückzog. So wie die russische Revolution 1917 nur der Auftakt einer internationalen Welle von Kämpfen gewesen war, so war der Rückgang in den revolutionären Kämpfen und der politische Rückzug der Komintern Ergebnis und Ausdruck eines veränderten Kräfteverhältnisses. Es waren die historisch ungünstigen Bedingungen einer Revolution, die aus einem Weltkrieg hervorging, sowie die Intelligenz der Bourgeoisie, die den Krieg rechtzeitig beendete und die “demokratische Karte” ausspielte, welche die Bedingungen für den wachsenden Opportunismus innerhalb der Komintern förderten, als die Ausdehnung der revolutionären Welle gestoppt wurde.
Die Debatte über die Entwicklung in Russland
Um die Reaktionen der Revolutionäre gegenüber der Isolierung der russischen Arbeiterklasse und dem veränderten Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat zu verstehen, müssen wir einen Blick auf die Entwicklung in Russland selbst werfen.
Als im Oktober 1917 die Arbeiter unter der Führung der bolschewistischen Partei die Macht ergriffen, gab es keine Illusionen über die Möglichkeit eines Aufbaus des Sozialismus in einem Land. Alle Blicke richteten sich auf die Hilfe aus dem Ausland. Angesichts der spontanen Maßnahmen vieler Arbeiter, die Produktion mittels Enteignungen sofort in die eigenen Hände zu nehmen, warnten die Bolschewiki vor falschen Erwartungen. Sie verstanden am klarsten, wie lebenswichtig die politischen Maßnahmen waren, d.h. die Konzentration auf die Ausweitung der Revolution. Gerade den Bolschewiki war klar, dass mit der Machtergreifung in einem Land der Kapitalismus natürlich noch längst nicht aus der Welt geschafft war. Solange die herrschende Klasse noch nicht weltweit bzw. in den wichtigsten Regionen dieser Erde gestürzt worden war, standen die politischen Maßnahmen an erster und entscheidender Stelle. Dort, wo das Proletariat die Macht ergriffen hatte, musste es sich darauf beschränken, den durch den Kapitalismus geschaffenen Mangel in seinem Interesse zu verwalten.
Schlimmer noch: nachdem die kapitalistischen Mächte ab Frühjahr 1918 ihre Wirtschaftsblockade und, zusammen mit der russischen Bourgeoisie, den Bürgerkrieg begonnen hatten, sahen sich die russischen Arbeiter und Bauern einer katastrophalen wirtschaftlichen Lage gegenüber. Wie sollte man die Versorgung der Bevölkerung trotz der Sabotage durch die Kapitalistenklasse sicherstellen? Auf welche Weise mussten die militärischen Anstrengungen koordiniert werden, um die Armeen der bürgerlichen Konterrevolution abzuwehren? Nur ein Staat konnte diese Aufgaben erfüllen. Es war der damals aus dem Aufstand neu entstandene, aber auf vielen Ebenen aus der alten Beamtenschicht zusammengesetzte Staat, der sich der Aufgabe stellte. Und auch zur Bewältigung von Aufgaben wie dem Bürgerkrieg oder dem Kampf gegen die innere Sabotage reichten die Arbeitermilizen der ersten Stunde nicht mehr aus. Es war notwendig, eine “Rote Armee” und spezielle Repressionsorgane aufzubauen.
Während die Arbeiterklasse in den Aufstandswochen im Oktober und danach noch die Zügel fest in ihren Händen gehalten hatte und die Hauptentscheidungen in den Sowjets gefällt wurden, setzte bald darauf ein Prozess ein, in dessen Verlauf die Arbeiter zunehmend ihre Macht und ihre Druckmittel an den neu entstandenen Staatsapparat verloren. Statt von den Arbeiterräten kontrolliert und als Instrument zu ihren Gunsten eingesetzt zu werden, schickte sich dieses neue Organ, das von den Bolschewiki irrtümlicherweise als “Arbeiterstaat” bezeichnet wurde, an, die Macht der Arbeiterräte zu untergraben und ihnen seine Direktiven aufzuzwingen. Diese Entwicklung, deren eigentliche, materielle Wurzel in den noch vorhandenen kapitalistischen Verhältnissen lag, war auch möglich, weil der nach der Machtergreifung entstandene Staat keine Anstalten machte, abzusterben und Macht abzugeben, sondern sich im Gegenteil immer mehr aufblähte.
Diese Tendenz konnte sich in dem Maße verstärken, wie die revolutionäre Welle sich nicht mehr ausdehnte, gar zurückwich und die russische Arbeiterklasse isoliert blieb.
Doch je weniger die Arbeiterklasse international imstande war, das Kapital unter Druck zu setzen, desto unentschlossener konnte sie seinen Plänen entgegentreten. Vor allem konnte sie es nicht an seinen militärischen Feldzügen gegen die russische Revolution hindern. So besaß die Bourgeoisie weiteren Spielraum, um die russische Revolution in den Würgegriff zu nehmen, und der infolge dieses Kräfteverhältnisses entstandene Staat in Russland erhielt weiteren Auftrieb. Dadurch, dass es der Bourgeoisie gelang, die Ausdehnung der Revolution zu stoppen, wurde dieser Staat in die Lage versetzt, immer mehr zum alles beherrschenden Faktor in Russland zu werden und sich zu verselbständigen.
Aufgrund der vom internationalen Kapital erzwungenen, wachsenden Unterversorgung, der schlechten Ernteergebnisse, der Sabotage durch die Bauern, der großen Zerstörungen durch den Bürgerkrieg und den daraus resultierenden Hungersnöten und Epidemien war der von den Bolschewiki angeführte Staat gezwungen, immer mehr Zwangsmaßnahmen aller Art zu ergreifen, wie z.B. die Beschlagnahmung der Ernten oder die Rationierung nahezu aller Güter. Er war auch dazu gezwungen, an die alten Handelsbeziehungen zu den kapitalistischen Staaten wieder anzuknüpfen, wobei es sich hier nicht um eine Frage der Moral, sondern um eine Überlebensfrage handelte. Der Mangel und der Handel – beides konnte nur von einem Staat verwaltet und gesteuert werden. Doch wer sollte diesen Staat kontrollieren?
Partei oder Räte – Wer übt die Kontrolle über den Staat aus?
Zum damaligen Zeitpunkt war es in der revolutionären Bewegung gängige Auffassung, dass die Partei im Namen der Arbeiterklasse die Macht übernimmt und somit an die Schalthebel dieses neuen, postrevolutionären Staates rückt. So hatten ab Oktober 1917 die führenden Mitglieder der bolschewistischen Partei die zentralen Positionen dieses Staates übernommen und angefangen, sich mit selbigem zu identifizieren.
Diese von der gesamten revolutionären Bewegung vertretene Auffassung wäre im Falle erfolgreicher Aufstände in anderen Ländern und vor allem in Deutschland sicherlich in Frage gestellt und über Bord geworfen worden. In einem solchen Fall hätten die Arbeiterklasse und ihre Revolutionäre die Differenzen und Interessenskonflikt zwischen Staat und Revolution ans Tageslicht geholt und somit die Fehler der Bolschewiki korrigieren können. Doch die Isolierung der Revolution führte dazu, dass die bolschewistische Partei immer öfter Stellung zugunsten des Staates bezog, statt die Interessen des internationalen Proletariats zu verteidigen. Zug um Zug entriss der Staat den Arbeitern die Initiative und verselbständigte sich. Und die bolschewistische Partei war gleichermaßen Getriebene wie treibende Kraft beim Wiedererstarken des Staates.
Nach dem Ende des Bürgerkrieges kam es im Winter 1920/21 zu einer weiteren Verschärfung der Hungersnot, was dazu führte, dass infolge des Exodus der vor dem Hunger fliehenden Menschen die Bevölkerung Moskaus um die Hälfte, die Petrograds um zwei Drittel dezimiert wurde. Vielerorts brachen Bauernrevolten und Arbeiterproteste aus.
Vor allem in der Gegend von Petrograd brach eine Streikwelle aus. Die Arbeiter und Matrosen von Kronstadt erwiesen sich dabei schnell als die Speerspitze des Widerstandes gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen und gegen den Staat. Neben ökonomischen stellten sie auch politische Forderungen auf. Abgesehen von der Ablehnung der Parteidiktatur wurde vor allem die Notwendigkeit der Erneuerung der Sowjets in den Vordergrund gestellt.
Der von den Bolschewiki angeführte Staat entschloss sich, den Widerstand der Arbeiter mit Gewalt zu brechen. Er bezeichnete letztere als vom Ausland manipulierte konterrevolutionäre Kräfte.
Damit stellte sich die bolschewistische Partei zum ersten Mal an die Spitze einer gewaltsamen Niederschlagung eines Teils der Arbeiterklasse. Dies geschah ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als die bolschewistische Partei selbst den 50. Jahrestag der Pariser Kommune feierte, und zwei Jahre nach dem Gründungskongress der Komintern, als Lenin noch die Parole “Alle Macht den Räten” auf das Banner der Kommunisten geschrieben hatte. Nicht nur, dass die bolschewistische Partei tatkräftig die Zerschlagung des Kronstädter Aufstandes übernahm, die gesamte revolutionäre Bewegung befand sich damals über den Charakter dieses Aufstandes in Irrtum. Sowohl die russische Arbeiteropposition als auch die Mitgliedsparteien der Komintern verurteilten ihn unmissverständlich.
Als Reaktion auf die wachsende Unzufriedenheit und mit dem Ziel, die weiterhin hortenden Bauern zur Produktion und Ablieferung ihrer Ernten zu bewegen, wurde im März 1921 die Einführung der “Neuen Ökonomischen Politik” beschlossen, die keine “Rückkehr” zum Kapitalismus bedeutete (schließlich war dieser nie abgeschafft worden), sondern nur eine Anpassung an die Mangelerscheinungen und Marktverhältnisse. Noch im gleichen Monat wurde ein Handelsabkommen zwischen Großbritannien und Russland abgeschlossen.
Hinsichtlich der Frage des Staates und der Identifizierung der Partei mit ihm gab es innerhalb der bolschewistischen Partei Divergenzen. Wie wir in der Internationalen Revue Nr. 8 und 9 geschrieben haben, schlugen linkskommunistische Stimmen in Russland schon früh Alarm und warnten vor dem Aufbau eines staatskapitalistischen Regimes. So sprach sich die Zeitung Kommunist im Jahre 1918 gegen die Versuche der Disziplinierung der Arbeiterklasse aus. Obwohl sich nach dem Beginn des Bürgerkrieges die Reihen der Partei unter dem Druck der konterrevolutionären Aggression schlossen und der größte Teil der Kritik zurückgehalten wurde, wuchs die Opposition gegen das wachsende Gewicht bürokratischer Strukturen in der Partei. Die 1919 gegründete Gruppe Demokratische Zentralisten um Ossinski sprach sich gegen den Verlust der Initiative der Arbeiter aus und rief zur Wiederherstellung der innerparteilichen Demokratie auf, insbesondere während der 9. Parteikonferenz im Herbst 1920, als sie die wachsende Bürokratisierung der Partei an den Pranger stellte.
Obgleich Lenin selbst die höchste staatliche Verantwortung mit repräsentierte, erkannte er in gewisser Weise am deutlichsten die Gefahr für die Revolution, die von diesem Staat ausging. Oft war er es, der die Arbeiter am entschiedensten zur Verteidigung gegen diesen Staat aufrief und ermunterte.
In der Debatte über die Gewerkschaftsfrage hob Lenin hervor, dass die Gewerkschaften auch weiterhin als Verteidigungsorgane der Klasse zu handeln hätten, auch gegen einen Arbeiterstaat, der an “bürokratischen Deformationen” leide, womit Lenin prinzipiell die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen Staat und Arbeiterklasse anerkannte. Dagegen plädierte Trotzki für die totale Integration der Gewerkschaften in den “Arbeiterstaat”. Er wollte die Militarisierung der Produktion auch nach der Beendigung des Bürgerkrieges fortsetzen. Die auf dem 10. Kongress im März 1921 erstmals in Erscheinung tretende Arbeiteropposition befürwortete hingegen staatsabhängige Industriegewerkschaften, welche die Leitung der Produktion übernehmen sollten.
Die Entscheidungen innerhalb der Partei verlagerten sich immer mehr vom Parteitag auf das Zentralkomitee und das neu geschaffene Politbüro. Die Militarisierung der Gesellschaft, die vom Bürgerkrieg ausgelöst worden war, erfasste über den Staat auch die Partei. Statt die Initiative der örtlichen Parteikomitees zu fördern, wurden sämtliche Aktivitäten der Partei einer strengen Kontrolle mittels sog. politischer Abteilungen unterzogen und auf dem 10. Parteitag ein allgemeines Fraktionsverbot erlassen.
Im zweiten Teil dieses Artikels werden wir den Widerstand der Linkskommunisten gegen die opportunistische Tendenz untersuchen und aufzeigen, wie die Kommunistische Internationale mehr und mehr zu einem Instrument des russischen Staates wurde.
Dv
Geographisch:
- Europa [30]
Theorie und Praxis:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Freunde Durrutis: Lehren aus einem unvollständigen Bruch mit dem Anarchismus
- 3566 Aufrufe
Die anarchistische Gruppe Freunde Durrutis ist immer wieder als ein Beispiel für die Lebendigkeit des Anarchismus während der Ereignisse in Spanien nach 1936 ins Feld geführt worden. Ihre Mitglieder spielten während den Kämpfen im Mai 1937 eine herausragende Rolle, indem sie die Kollaboration der CNT mit der republikanischen Regierung Kataloniens und der Generalität anprangerten und sich dagegen stellten. Die CNT bezieht sich heute auf die Errungenschaften dieser Gruppe, verkauft deren bekannteste Publikationen[1] [34] und nimmt deren Positionen in Beschlag.
Unserer Ansicht nach besteht die wichtigste Lehre aus den Erfahrungen dieser Gruppe nicht im Beweis für die ”Lebendigkeit” des Anarchismus, sondern im Gegenteil in der Unmöglichkeit in seinem Rahmen eine revolutionäre Alternative zu verteidigen[2] [34]. Auch wenn die Freunde Durrutis sich der ”Kollaboration” der CNT entgegenstellten, verstanden sie deren Rolle als aktiver Faktor bei der Niederschlagung der Arbeiterklasse; ihre Teilnahme im bürgerlichen Lager nicht. Aus diesem Grund denunzierten sie die CNT nicht als Instrument des Klassenfeindes, sondern sie betonten immer wieder ihre Mitgliedschaft in der CNT und die Möglichkeit, diese Organisation zur Verteidigung der Interessen der Arbeiterklasse zu gewinnen.
Der wirkliche Grund für diese Schwierigkeiten lag in der Unfähigkeit der Freunde Durrutis mit dem Anarchismus zu brechen. Es erklärt auch, weshalb alle Anstrengungen und der revolutionäre Wille der Mitglieder dieser Gruppe zu keiner Klärung über die Ereignisse in Spanien von 1936 führte.
1936: Proletarische Revolution oder imperialistischer Krieg?
In den Geschichtsbüchern werden die Ereignisse in Spanien von 1936 als ein ”Bürgerkrieg” beschrieben. In den Augen der Trotzkisten und Anarchisten handelte es sich gar um eine ”Spanische Revolution”. Für die IKS ist es weder ein ”Bürgerkrieg” noch eine ”Revolution”, sondern ein imperialistischer Krieg. Ein Krieg zwischen zwei Fraktionen der spanischen Bourgeoisie: auf der einen Seite Franco mit dem deutschen und italienischen Imperialismus im Rücken und auf der anderen Seite, vor allem in Katalonien, die Volksfront-Republik inklusive Stalinisten, POUM und die CNT, mit der Unterstützung der UdSSR und der demokratischen Imperialisten. Die Arbeiterklasse wehrte sich im Juli 1936 gegen den Putschversuch Francos und im Mai 1937 in Barcelona gegen den Versuch der herrschenden Klasse, den Widerstand der Arbeiterklasse zu brechen.[3] [34] In beiden Ereignissen jedoch war die Volksfront das Mittel, die Arbeiterklasse zu schlagen, aufzuspalten und unter dem Banner des ”Antifaschismus” in die militärischen Auseinandersetzungen zu führen.
Dies war auch die Analyse von BILAN, der Zeitschrift der Italienischen Kommunistischen Linken im Exil. Für BILAN war der internationale Rahmen, in dem sich die Ereignisse in Spanien abspielten, entscheidend. Die internationale revolutionäre Welle, die dem Erstem Weltkrieg ein Ende gesetzt und sich über fünf Kontinente ausgebreitet hatte, war niedergeschlagen, auch wenn es in China 1926, mit dem Generalstreik in England und in Spanien im selben Jahr nochmals ein Aufflackern gab. Die 30er Jahre waren geprägt von der Vorbereitung aller grossen imperialistischen Mächte auf einen neuen weltweiten Konflikt. Dies war der internationale Rahmen für die Ereignisse in Spanien: eine geschlagene Arbeiterklasse und freie Bahn zu einem zweiten Weltkrieg. Andere proletarische Gruppen wie die GIK[4] [34] verteidigten ähnliche Positionen, auch wenn gerade in der Zeitschrift der GIK Positionen Platz fanden, die dem Trotzkismus nahe standen und davon ausgingen, dass das Proletariat durch die Beteiligung an einer Bewegung für die ”bürgerliche Revolution” in eine revolutionäre Richtung voranschreiten könne. BILAN führte mit diesen Gruppen beharrlich eine Diskussion, selbst mit der eigenen Minderheit, welche daran glaubte, die Revolution werde aus dem Krieg herauswachsen, und für die Beteiligung in der ”Lenin-Brigade” in Spanien mobilisierte.[5] [34]
Trotz aller Konfusionen liess sich keine dieser Gruppen dazu herab, die republikanische Regierung zu unterstützen. Im Gegensatz zur POUM und CNT beteiligten sie sich nicht an der Unterwerfung der Arbeiter unter die Republik, sie stellten sich nicht auf die Seite der herrschenden Klasse![6] [34]
Heute benutzt die Bourgeoisie diese Irrtümer der Arbeiterklasse, um den politischen Verrat und die konterrevolutionäre Rolle der POUM und der CNT in Spanien im Jahre 1936 zu vertuschen, indem sie diese Ereignisse als eine ”proletarische Revolution” darstellen, die von diesen Organisationen angeführt worden sei.[7] [34] In Wirklichkeit jedoch waren CNT und POUM die letzte Verteidigungslinie der herrschenden Klasse gegen den Kampf der Arbeiterklasse: ”Doch es waren vor allem die POUM und die CNT, welche eine entscheidende Rolle zur Anheuerung der Arbeiter an die Front spielten. Diese zwei Organisationen erwirkten den Abbruch des Generalstreiks, ohne dass sie in dessen Entfaltung eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Die Kraft der Bourgeoisie drückte sich nicht so sehr in Franco aus, sondern im Bestehen einer extremen Linken, welche fähig war das Proletariat zu demobilisieren.” (aus unserem Buch: Die Italienische Kommunistische Linke 1926-1945)
Die anarchistische Grundlage für den Verrat der CNT 1936
Für viele Arbeiter ist es schwierig zu verstehen, dass die CNT, welche die kämpferischsten und entschlossensten Arbeiter anzog und die radikalsten Positionen vertrat, Verrat an der Arbeiterklasse begehen konnte, indem sie die Arbeiter in die Arme des republikanischen Staates und in den antifaschistischen Kampf trieb.
Verwirrt vom Durcheinander und der Heterogenität, die das anarchistische Milieu auszeichnet, ziehen viele den Schluss, das Problem habe nicht bei der CNT gelegen, sondern beim ”Verrat” von vier Ministern (die Montseny, Garcia Oliver, etc.) oder dem Einfluss vom Strömungen wie der Trentisten.[8] [34]
Es ist wahr, dass während der internationalen revolutionären Welle, die auf die Russische Revolution folgte, sich die Mehrheit des spanischen Proletariates der CNT anschloss (die Sozialistische Partei war den Sozialpatrioten gefolgt, die das Weltproletariat in einen imperialistischen Weltkrieg geführt hatten, und die Kommunistische Partei stellte nur eine sehr kleine Minderheit dar). Grundsätzlich war dies Ausdruck einer Schwäche der Arbeiterklasse in Spanien aufgrund der dortigen Wesenszüge des Kapitalismus (ein schwacher nationaler Zusammenhalt und ein Übergewicht der Grossgrundbesitzer und der Aristokratie innerhalb der herrschenden Klasse).
Diese Voraussetzungen bildeten einen idealen Nährboden für die anarchistische Ideologie, welche das Denken des radikalen Kleinbürgertums und dessen Einfluss in die Arbeiterklasse verkörpert. Dieses Gewicht wurde zusätzlich verstärkt durch den Einfluss, den die Kreise um Bakunin in der Ersten Internationale in Spanien ausgeübt hatten. Wie Engels in seinem Buch Die Bakunisten an der Arbeit aufgezeigt hatte, führte er durch die Mobilisierung des Proletariats hinter die abenteurerische, radikale Bourgeoisie in der kantonistischen Bewegung von 1873 in Spanien zu fatalen Konsequenzen. Als der Anarchismus damals zwischen der Machtübernahme durch die Arbeiterklasse und der bürgerlichen Regierung zu wählen hatte, entschied er sich für Letztere:”...dieselben Leute, die sich autonome, anarchistische Revolutionäre usw. nennen, haben sich bei dieser Gelegenheit mit Eifer darauf geworfen, in Politik zu machen, aber in der allerschlimmsten, in der Bourgeoispolitik. Sie haben nicht dafür gearbeitet, der Arbeiterklasse die politische Macht zu verschaffen – diese Idee verabscheuen sie im Gegenteil -, sondern einem Bruchteil der Bourgeoisie ans Ruder zu verhelfen, der aus Abenteurern, Ehrgeizigen und Stellenjägern besteht, und sich intransingente (unversöhnliche) Republikaner nennt.” (”Bericht der neuen Madrider Föderation der Ersten Internationale” in Die Bakunisten an der Arbeit, Denkschrift über den Aufstand in Spanien im Sommer 1873, MEW, Bd.18, S. 477)
Während der revolutionären Welle, die auf den Ersten Weltkrieg folgte, wurde die CNT von der Russischen Revolution und der Dritten Internationale beeinflusst. 1919 bejahte der Kongress der CNT klar den proletarischen Charakter der Russischen Revolution und den revolutionären Charakter der Kommunistischen Internationale, in welcher sie zu arbeiten gedachte. Doch mit der Niederlage der weltrevolutionären Welle und dem offenen Kurs hin zur Konterrevolution fand die CNT in ihren anarchistischen und syndikalistischen Grundlagen nicht die theoretische und politische Kraft, um die Lehren aus der Niederlage in Deutschland, Russland usw. zu ziehen und der enormen Kampfbereitschaft des spanischen Proletariates eine revolutionäre Führung zu geben.
Nach ihrem Kongress von 1931 zog sie ihren ”Hass auf die Diktatur des Proletariates” ihren vorangegangenen Auffassungen über die Russische Revolution vor und sah trotz ihrer formalen Ablehnung des bürgerlichen Parlamentes in der Konstituierenden Versammlung eine ”Frucht der revolutionäre Aktion” (Kongressbericht: ”Position der CNT über die Konstituierende Versammlung”) Damit begann sie die herrschende Klasse zu unterstützen, am deutlichsten durch Fraktionen wie diejenige der Trentisten; und dies trotz der Tatsache, dass sie Militante in ihren Reihen hatte, die dem revolutionären Kampf des Proletariates treu blieben.
Im Februar 1936 warf sie ihre abstentionistischen Prinzipien durch einen indirekten Aufruf zur Wahl der Volksfront über den Haufen: ”Natürlich hat die spanische Arbeiterklasse, der die CNT während Jahren geraten hat nicht wählen zu gehen, unsere Propaganda in dem Sinne verstanden, wie wir es uns wünschten, das heisst, dass sie wählen gehen soll, weil damit erreicht wird, dass den rechten Faschisten leichter die Stirn geboten werden kann, wenn diese revoltieren, nachdem sie eine Niederlage erlitten haben und nicht mehr in der Regierung sind.” [9] [34]
Damit zeigte die CNT deutlich ihre Entwicklung hin zur Unterstützung des bürgerlichen Staates, ihre Anteilnahme an der Politik zur Niederschlagung und Isolierung des Proletariates und zur Vorbereitung des imperialistischen Krieges.
Was sich danach im Juli 1936 abspielte, überrascht nicht mehr. Als die Generalität in den Händen der bewaffneten Arbeiter war, gab die CNT die Macht der Regierung Luis Companys zurück, rief die Arbeiter zur Wiederaufnahme der Arbeit auf und schickte sie ins Massaker an der Aragon-Front. Noch weniger überraschend war, was sich im Mai 1937 ereignete, als die Arbeiter auf die Provokation der Bourgeoisie in Barcelona spontan Barrikaden errichteten und in den Strassen die Kontrolle übernahmen: Die CNT rief erneut zum Abbruch des Kampfes auf und hinderte Arbeiter, die ihre Kameraden in Barcelona unterstützen wollten, an der Rückkehr von der Front.[10] [34]
Die Ereignisse in Spanien zeigen, dass in Zeiten des Krieges oder der Revolution Teile der Anarchisten für den revolutionären Kampf des Proletariates gewonnen werden können, der Anarchismus als ideologische Strömung jedoch unfähig ist, der Konterrevolution zu widerstehen und ihr eine revolutionäre Alternative entgegenzustellen; er lässt sich sogar zur Verteidigung des bürgerlichen Staates einspannen. BILAN hatte dies verstanden und formulierte es auf treffende Art und Weise: ”Es muss offen gesagt werden: In Spanien existierten die Bedingungen nicht, um die Aktionen des iberischen Proletariates in ein Signal für das weltweite Wiedererwachen des Proletariates umzuwandeln, auch wenn dort tiefere und schlimmere ökonomische, soziale und politische Gegensätze herrschten als in anderen Ländern. (...) Die Gewalttätigkeit dieser Ereignisse sollte uns nicht zu einem Irrtum über ihre Natur verleiten. Sie verkörpern den Kampf auf Leben und Tod, in den das Proletariat gegen die Bourgeoisie eingetreten ist, doch sie zeigen ebenfalls die Unmöglichkeit auf, einzig durch Gewalt – die nur ein Kampfmittel, und nicht Programm des Kampfes ist – eine historische Vision zu ersetzen, welche durch die Mechanismen des Klassenkampfes nicht mehr befruchtet werden kann. Da die sozialen Bewegungen nicht die Kraft haben, eine klare Vision der Ziele des Proletariats zu befruchten, und da sie sich nicht mit einer kommunistischen Intervention treffen, die in diese Richtung zeigt, kehren sie schlussendlich auf das Geleise der kapitalistischen Entwicklung zurück und reissen in ihrer Niederlage diejenigen sozialen und politischen Kräfte mit sich, welche bis anhin in einer klassischen Form die Trittbrettfahrer der Arbeiterklasse darstellten: die Anarchisten.” [11] [34]
Die Freunde Durrutis, ein Versuch, sich dem Verrat der CNT entgegenzustellen
Die Freunde Durrutis waren anarchistische Elemente, welche sich trotz der bürgerlichen Ausrichtung der CNT, in der sie während der ganzen Zeit mitwirkten, mit der Revolution verbunden fühlten, und in diesem Sinne sind sie Zeugnis des Widerstandes proletarischer Teile, die nicht in dieselbe Richtung gehen wollten, wie die anarchistischen Hauptquartiere.
Aus diesem Grund versucht die CNT und die gesamte herrschende Klasse diese Gruppe als Beispiel der revolutionären Flamme darzustellen, die auch während der schlimmsten Zeiten von 1936-37 in der CNT noch existiert habe.
Eine solche Darstellung ist komplett falsch. Was das revolutionäre Wesen der Freunde Durrutis ausmachte, war eben genau ihr Kampf gegen die Positionen der CNT. Sie schöpften ihre Kraft aus dem Proletariat, von dem sie ein Teil waren und für das sie sich in den vordersten Reihen befanden.
Die Freunde Durrutis bewegten sich auf dem Terrain der Arbeiterklasse, und dies nicht als Militante der CNT sondern als militante Arbeiter, welche die Kraft ihrer Klasse vom 19. Juli spürten und sich seither gegen die Positionen der CNT auflehnten.
Ihr Versuch, den eigenen proletarischen Impuls mit ihrer Verbindung zur CNT und deren anarchistischen Orientierungen unter einen Hut bringen zu wollen, verunmöglichte es ihnen, eine revolutionäre Alternative aufzugreifen oder klare Lehren aus diesen Ereignissen zu ziehen.
Die Freunde Durrutis waren eine dem Anarchismus zugeneigte Gruppe, welche sich im März 1937 formell konstituierte. Sie formierte sich aus einer Strömung, die in der CNT-Presse gegen deren Kollaboration mit der Regierung auftrat, und aus einer anderen Strömung, welche nach Barcelona zurückkehrte, um gegen die Militarisierung der Milizen zu kämpfen.
Die Freunde Durrutis standen in direktem Zusammenhang mit der Entfaltung von Arbeiterkämpfen, in die sie ihre Überlegungen und Aktivitäten stellten. Es war keine Gruppe von Theoretikern, sondern von kampfbereiten Arbeitern. Deshalb bezogen sie sich grundsätzlich auf die Kämpfe vom Juli 1936 und deren ”Errungenschaften”, Kämpfe, die sich vor allem durch die Kontrolle von Arbeitergarden in den Quartieren und die Bewaffnung der Arbeiterklasse ausgezeichnet hatten. In ihren Augen lagen die Fundamente der Bewegung im Geist der Julitage und der spontanen Kraft des Arbeiterkampfes, als dieser den Angriff Francos bewaffnet zurückschlug und in Barcelona die Kontrolle in den Strassen ausübte.
Vor den Maitagen schrieben einige wichtige Mitglieder dieser Gruppe auch in der Zeitschrift der CNT LA NOCHE, und ihre grundlegende Aktivität bestand in Treffen, auf denen der Gang dieser Ereignisse diskutiert wurde.
Während der Maitage 1937 kämpften die Freunde Durrutis auf den Barrikaden und veröffentlichten das Flugblatt, das sie berühmt machte, da sie die Bildung einer ”revolutionären Junta”, die Vergesellschaftung der Wirtschaft und die Hinrichtung der Schuldigen forderten. Ihre Positionen glichen denen der trotzkistischen Gruppe der Bolschewiki-Leninisten (in der Munis mitwirkte), mit denen sie Diskussionen führten, die ihr Nachdenken befruchtete. Doch es war nicht möglich, die Freunde Durrutis zum Bruch mit dem Anarchismus zu bewegen.
Nach den Maitagen brachten sie die Zeitschrift EL AMIGO DEL PUEBLO heraus (insgesamt 15 Nummern), die ihren Willen ausdrückte, im Kampf aufgetauchte Fragen zu klären. Der bekannteste Theoretiker der Gruppe war Jaime Balius, der 1938 eine Broschüre mit dem Titel Hin zu einer neuen Revolution schrieb, die eine ausgereiftere Verteidigung der Positionen von EL AMIGO DEL PUEBLO darstellte.
Doch die Gruppe war direkt vom Leben des Arbeiterkampfes abhängig und als dieser vom republikanischen Staat besiegt war, kehrte sie in den Schoss der CNT zurück.
Auch wenn die Freunde Durrutis eine proletarische Antwort auf den Verrat der CNT darstellten, so war ihre Entwicklung dennoch von der Unfähigkeit gezeichnet, mit dem Anarchismus und Syndikalismus zu brechen. Und auch wenn der Kampf und die Stärke der Klasse sie am Leben erhielt, die Freunde Durrutis waren nicht fähig, weiter zu gehen.
Ein unvollständiger Bruch mit dem Anarchismus
In den zwei zentralen Fragen, die sich im Klassenkampf zwischen Juli und Mai stellten: derjenigen des Verhältnisses zwischen dem Krieg an der antifaschistischen Front und dem Klassenkampf und der Frage der Kollaboration mit der republikanischen Regierung oder deren Überwindung, widersetzten sich die Freunde Durrutis der Politik der CNT und nahmen den Kampf auf.
Die Natur des Krieges in Spanien
Im Gegensatz zur CNT, welche den Aktionen der Arbeiter vom 18. Juli offen gegenübertrat, verteidigten die Freunde Durrutis die revolutionäre Natur dieser Ereignisse: ”Man hat behauptet, die Julitage seien eine Antwort auf die faschistische Provokation gewesen, doch wir, die Freunde Durrutis haben offen die Meinung vertreten, dass die Essenz dieser erinnerungswürdigen Tage im Juli ihre Wurzeln im Durst des Proletariates nach Befreiung hatten.” [12] [34]
Sie kämpften auch gegen die Politik der Unterordnung der Revolution unter die Bedürfnisse des antifaschistischen Krieges, eine Frage, die eine wichtige Rolle bei der Gründung dieser Gruppe gespielt hatte[13] [34]:
”Die konterrevolutionäre Arbeit wird erleichtert durch die fehlende Solidarität unter vielen Revolutionären. Wir sind uns der zahlreichen Individuen bewusst die glauben, um den Krieg gewinnen zu können, müsse man auf die Revolution verzichten. Damit lässt sich auch der seit dem 19. Juli eingetretene Rückschritt erklären (...) Um die Massen an die Front zu führen, müssen ihre revolutionären Wünsche zum Schweigen gebracht werden. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Die Revolution noch mehr sichern, damit die Arbeiter sich mit einer aussergewöhnlichen Energie in den Kampf um die Eroberung der neuen Welt stürzen, die in diesen Momenten der Unentschlossenheit nichts als ein Versprechen ist.”[14] [34]
Im Mai 1937 widersetzten sich die Freunde Durrutis der Weisung der CNT an ihre Mitglieder an der Front, den Marsch auf Barcelona (zur Unterstützung der in den Strassen kämpfenden Arbeiter) zu stoppen, und stattdessen den Krieg an der Front fortzuführen.
Diese im Kampf eingeschlagene Richtung stimmte jedoch nicht mit den theoretischen Errungenschaften der Freunde Durrutis über die Frage von Krieg und Revolution überein. Sie hatten nie wirklich mit der Auffassung gebrochen, dass der Krieg mit der proletarischen Revolution verbunden sei und es sich deshalb um einen ”revolutionären” Krieg handle, der den imperialistischen Kriegen entgegengesetzt sei. Dies machte sie von Beginn weg zu einem Opfer der Politik der Niederschlagung und Isolierung des Proletariats.
”Seit den ersten Zusammenstössen mit dem Militär war es nicht mehr möglich, Krieg und Revolution voneinander zu trennen (...) Je mehr Wochen und Monate vergingen, desto klarer wurde, dass der Krieg gegen die Faschisten, den wir unterstützten, nichts gemein hatte mit Kriegen, die von Staaten geführt werden (...) Wir Anarchisten können nicht das Spiel derer führen, die vorgeben, unser Krieg sei nur ein Unabhängigkeitskrieg mit demokratischen Zielen. Gegenüber diesen Ideen antworten wir, die Freunde Durrutis, dass unser Krieg ein Bürgerkrieg ist.” [15] [34]
Damit begaben sie sich in den Rahmen der CNT, deren ”radikale” Version bürgerlicher Positionen über den Kampf zwischen Diktatur und Demokratie die kämpferischsten Arbeiter ins Schlachthaus des antifaschistischen Krieges führte.
Die Überlegungen der Freunde Durrutis über den Krieg basierten in Wirklichkeit auf den Irrtümern des Anarchismus und seinem ahistorischen und nationalistischen Gedankengut. Dies führte sie zur Auffassung, die Ereignisse in Spanien seien eine Fortführung der lächerlichen bürgerlichen Revolutionsbemühungen gegen die Invasion Napoleons von 1808.[16] [34] Während sich die internationale Arbeiterbewegung mit der Niederlage des Weltproletariates und der Perspektive eines zweiten Weltkrieges auseinander setzte, dachten die Anarchisten in Spanien an Fernando VII. und Napoleon:
”Was sich heute abspielt, ist eine Wiederholung der Zeit Fernandos VII. Erneut fand in Wien eine Konferenz faschistischer Diktatoren statt, um ihren Einfall in Spanien zu organisieren. Und heute nehmen die bewaffneten Arbeiter die Rolle von El Empacinado ein. Deutschland und Italien brauchen Rohstoffe. Diese beiden Länder benötigen Eisen, Kupfer, Blei und Quecksilber. Doch diese spanischen Bodenschätze sind in den Händen von Frankreich und England. Heute, wo sie Spanien zu erobern versuchen, wehrt sich England nicht dagegen. Im Gegenteil versucht es, hinter den Kulissen mit Franco gemeinsame Sache zu machen (...) Die Arbeiterklasse hat die Pflicht, Spaniens Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten. Das nationale Kapital erledigt dies nicht mehr, seit das internationale Kapital alle Grenzen überwunden hat. Dies ist das Drama des heutigen Spaniens. Den Arbeitern fällt die Aufgabe zu, die fremden Kapitalisten zu verjagen. Dies ist keine Frage des Patriotismus. Es ist eine Frage der Klasseninteressen.”[17] [34]
Wie wir sehen sind alle Mittel recht, um einen imperialistischen Krieg zwischen patriotischen Staaten in einen ”Klassenkrieg” zu verwandeln. Dies ist ein Ausdruck der politischen Entwaffnung, die der Anarchismus gegen solch ehrliche militante Arbeiter wie die Freunde Durrutis betrieb. Diese Genossen, die versuchten, gegen den Krieg und für die Revolution zu kämpfen, waren unfähig, für ihren Kampf einen wirklichen Ausgangspunkt zu finden: den Aufruf an die Arbeiter und Bauern (entweder im republikanischen oder franqistischen Lager eingebunden) zu desertieren, die Waffen gegen ihre eigenen Offiziere zu richten, von denen sie unterdrückt wurden, von der Front zurückzukehren und mit Streiks und Demonstrationen auf ihrem eigenen Klassenterrain gegen den Kapitalismus als ganzes zu kämpfen.
Für die internationale Arbeiterbewegung war die Frage des Charakters des Krieges in Spanien entscheidend und polarisierte die Debatten zwischen der Kommunistischen Linken und den Trotzkisten, sowie auch innerhalb der Kommunistischen Linken:
”Der Krieg in Spanien war für alle entscheidend: Für den Kapitalismus stellte er ein Mittel dar, um die Front seiner Kräfte, die auf den Krieg hinarbeiteten, auszudehnen, mit dem Antifaschismus die Trotzkisten und die sogenannten linken Kommunisten einzuverleiben und das Erwachen der Arbeiter von 1936 zu ersticken. Für die linken Fraktionen war es die entscheidende Prüfung, die Selektion der Köpfe und Ideen, die Notwendigkeit, sich der Frage des Krieges zu stellen. Wir haben standgehalten gegen den Strom und werden es weiterhin tun.” (BILAN, Nr. 44, zitiert aus Die Italienische Kommunistische Linke)
Die Kollaboration der CNT mit der Regierung
Viel klarer als bei der Frage des Krieges setzten sich die Freunde Durrutis der Kollaborationspolitik der CNT gegenüber der republikanischen Regierung entgegen.
Sie denunzierten den Verrat der CNT vom Juli: ”Im Juli bot sich eine gute Gelegenheit. Wer widersetzte sich der CNT und der FAI in Katalonien? Statt ein Bündnisdenken zu entwickeln, das sich auf die Sympathien zu den rot-schwarzen Flaggen und die Kraft der Massen stützt, machten unsere Komitees einen Rundgang durch die verschiedenen offiziellen Stellen, doch ohne eine Haltung, die derjenigen entsprach, die wir auf der Strasse hatten. Im Laufe einiger Wochen des Zweifels beteiligten sie sich an der Macht. Wir erinnern uns gut, wie auf regionaler Ebene die Bildung eines revolutionären Organs vertreten wurde, welches auf nationaler Ebene Nationale Verteidigungsjunta und auf regionaler Ebene Regionale Junta genannt wurde. Wie auch immer, sie führten die gefällten Entschlüsse nicht aus. Sie übergingen oder verstiessen sogar gegen die von den Vollversammlungen gefällten Beschlüsse. Erst beteiligte man sich an der Regierung der Generalität und später an der Madrider Regierung.” [18] [34]
... Und noch offener im Flugblatt, das sie auf den Barrikaden im Mai verteilten: ”Die Generalität repräsentiert nichts. Ihre Aufrechterhaltung der Macht fördert die Konterrevolution. Wir Arbeiter haben den Kampf gewonnen. Es ist unbegreiflich, wie die CNT-Komitees mit solcher Ängstlichkeit vorgingen, eine Waffenruhe anordneten und zur Rückkehr zur Arbeit aufriefen, als wir den Sieg beinahe in der Hand hatten. Man hat nicht gesehen, woher die Provokation und Aggression kam, man hat die tatsächliche Bedeutung dieser Tage nicht erkannt. Diese Politik muss als Verrat an der Revolution bezeichnet werden, eine Politik, die einem nicht zu überzeugen vermag. Und wir wissen auch, wie man die unselige Arbeit der Solidaridad Obrera und der führenden CNT-Mitglieder zu bezeichnen hat.”
Diese Erklärung trug ihnen die Missgunst der CNT und einen drohenden Ausschluss ein, der jedoch nicht zustande kam. Die Freunde Durrutis widerriefen ihre Anschuldigung über einen Verrat, den sie in der Nr. 3 von EL AMIGO DEL PUEBLO veröffentlicht hatten, in der Nr. 4: ”Im Namen der anarchistischen und revolutionären Einheit nehmen wir, die Freunde Durrutis, die Analyse über einen Verrat zurück.” (EL AMIGO DEL PUEBLO Nr. 4) Dies taten sie nicht aus mangelnder Courage, die sie zur Genüge bewiesen hatten, sondern weil ihr Horizont nicht über die CNT hinausreichte, die sie als einen Ausdruck der Arbeiterklasse und nicht als Agenten der Bourgeoisie betrachteten.
In diesem Sinne waren ihre theoretischen Schranken dieselben wie die der CNT und des Anarchismus. Und deshalb beschränkte sich auch ihre Kritik an der CNT, als sie weitab der Barrikaden in ruhigerem Nachdenken zustande kam, darauf, dass diese über keine revolutionäre Plattform verfüge: ”Die grosse Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung stand zur CNT. Die CNT war die grösste Organisation in Katalonien. Weshalb hat die CNT ihre Revolution, die Revolution des Volkes, die Revolution der Mehrheit der Bevölkerung nicht gemacht?
Es geschah, was geschehen musste. Die CNT war ein Waisenkind bezüglich revolutionärer Theorie. Wir hatten kein richtiges Programm. Wir wussten nicht, wohin wir gehen sollten. Ein Haufen Lyrik, doch als alles gesagt war, wussten wir nicht, was mit diesen enormen Arbeitermassen zu tun war, oder wie wir den enormen Elan, der aus ihnen in unsere Organisationen strömte, auf den Punkt bringen konnten. Als wir nicht wussten, was zu tun war, begannen wir die Revolution unter die Fahnen der Bourgeoisie und der Marxisten (d.h. der Sozialdemokratie und der Stalinisten) zu stellen, welche die Ordnung von Gestern unterstützten. Noch schlimmer, wir gaben der Bourgeoisie einen immer breiteren Spielraum, um zurückzukehren, sich zu formieren und als Sieger aufzutreten.
Die CNT war nicht fähig, ihre Rolle wirklich zu spielen. Wir
waren nicht fähig, die Revolution mit all ihren Konsequenzen voranzutreiben.”
(aus Balius‘
Broschüre: Hin zu einer neuen Revolution)
Doch die CNT hatte zur damaligen Zeit eine klar formulierte Theorie: die Verteidigung des bürgerlichen Staates. Die Behauptung von Balius trifft für das Proletariat als ganzes zu (im selben Sinne wie auch BILAN die Abwesenheit einer Orientierung und einer revolutionären Vorhut feststellte), nicht jedoch für die CNT. Spätestens ab Februar 1936 arbeitete die CNT unzweifelhaft mit der bürgerlichen Volksfront-Regierung zusammen: ”Im Februar 1936 stellten sich alle Kräfte aus der Arbeiterklasse hinter dieselbe Front: die Notwendigkeit, einen Sieg der Volksfront herbeizuführen, um sich von der Herrschaft der Rechten zu befreien und Amnestie zu erhalten. Von der Sozialdemokratie über den Zentrismus bis zu den Trotzkisten, der CNT und dem POUM, inklusive die Parteien der republikanischen Linken, waren sich alle einig, die Explosion der Klassenwidersprüche in die parlamentarische Arena zu lenken. Und schon hier ist in flammenden Lettern die Niederlage der Anarchisten und des POUM geschrieben, so wie die wirkliche Funktion all der demokratischen Kräfte des Kapitalismus.” (BILAN ”Die Lehren aus den Ereignissen in Spanien”)
Entgegen der Auffassung der Freunde Durrutis, die CNT wisse nicht, wie die Revolution zu vollbringen sei, wusste diese nach dem Juli genau, was sie wollte:
”Wir, und dies war die Sicht der CNT-FAI, hatten verstanden, dass es richtig war, Companys an die Front der Generalität zu folgen, vor allem, dass wir nicht auf die Strassen gingen, um für die soziale Revolution zu kämpfen, sondern um uns gegen die faschistischen Schergen zu verteidigen.” (Garcia Oliver in einer Antwort auf Bolloten, zitiert aus Agustin Guillamon, Die Freunde Durrutis)
Wenn die Freunde Durrutis während der Maitage 1937 im Gegensatz zur CNT zu einer ”revolutionäre Junta” gegen die Regierung der Generalität und zur ”Hinrichtung der Schuldigen” aufriefen, war dies nicht das Produkt eines Bruchs mit dem Anarchismus oder einer Entwicklung weg vom Anarchismus hin zu einer revolutionären Perspektive (wie Guillamon meint), sondern Resultat des Widerstandes der Arbeiterklasse. Es war mehr eine Feststellung, und kein ein Wegweiser für die Machtübernahme, eine Frage, die sich in dieser Situation gar nicht stellte, in der die Initiative in den Händen der Bourgeoisie lag, die eine Provokation gestartet hatte, um den Widerstand der Arbeiter zu brechen. Doch wie Munis bemerkte, waren sie nicht fähig, einen Schritt weiter zu tun: ”Munis machte in Nr. 2 von LA VOZ LENINISTA (23. August 1937) eine Kritik am Konzept der ”revolutionären Junta”, wie es in Nr. 6 von EL AMIGO DEL PUEBLO (12. August 1937) formuliert worden war. In den Augen von Munis litten die Freunde Durrutis an einem zunehmenden theoretischen Niedergang und einer Unfähigkeit, in der Praxis die CNT zu beeinflussen, was sie dazu führe, einige aus den Maitagen gelernte theoretische Positionen wieder zu verlieren. Munis schrieb, dass die Freunde Durrutis im Mai 1937 die Losung der ”revolutionären Junta” gleichzeitig mit ”Alle Macht dem Proletariat” aufgestellt hatten; während EL AMIGO DEL PUEBLO in seiner Nr. 6 vom 12. August die Losung der ”revolutionären Junta” als eine Alternative zum ”Scheitern jeglicher Form von staatlicher Macht” vertrat. Laut Munis war dies ein theoretischer Rückschritt der Freunde Durrutis gegenüber ihren aus der Erfahrung des Mai gewonnenen Erkenntnissen, ein Rückschritt, der sie weiter von der marxistischen Auffassung der Diktatur des Proletariates entfernte und sie in die Unklarheiten der anarchistischen Theorie über den Staat zurückwarf.” [19] [34]
Als der Nährboden des Arbeiterkampfes verschwunden und dessen Niederlage besiegelt war, kehrten die Überlegungen und Vorschläge der Freunde Durrutis ohne Aufhebens in den Schoss der CNT zurück, und die ”revolutionäre Junta” wurde in ein Komitee der antifaschistischen Milizen ungewandelt, das sie zuvor noch als ein Organ der herrschenden Klasse blossgestellt hatten: ”Die Gruppe hat die Auflösung der Verteidigungskomitees, der Kontrollpatrouillen und des Milizkomitees scharf kritisiert, sowie auch das Dekret der Militarisierung. Sie verstanden, dass diese aus den Julitagen hervorgegangen Organe die Basis – zusammen mit den Gewerkschaften und den Gemeindenverwaltungen – für eine neue Strukturierung sein müssen, also Modell einer neuen Ordnung der Dinge. Dies schloss auch durch den Gang der Ereignisse und die revolutionäre Erfahrung gemachte Änderungen ein.” [20] [34]
Es lohnt sich, folgende Aussage desselben Autors aus seiner Broschüre Hin zu einer neuen Revolution von 1938 mit dem Vorangegangenen zu vergleichen: ”Im Juli wurde ein Komitee der antifaschistischen Milizen gegründet. Dies war kein Klassenorgan. Es befanden sich darin Vertreter der Bourgeoisie und der Konterrevolutionäre.”
Schlussfolgerungen
Die Freunde Durrutis waren kein Ausdruck revolutionärer Lebenskraft der CNT oder des Anarchismus, sondern einer Anstrengung militanter Arbeiter; und dies trotz des Gewichts des Anarchismus, der nie das revolutionäre Programm der Arbeiterklasse war und es auch nie sein wird.
Der Anarchismus kann Teile der Arbeiterklasse anziehen, welche, wie heute zahlreiche junge Arbeiter, einen Mangel an Erfahrung und Orientierung haben, aber aus seinen Positionen kann keine revolutionäre Alternative wachsen. In den meisten Fällen, so wie bei den Freunden Durrutis, sind dies Zeichen von Mut und proletarischem Kampfwillen. Doch wie die Geschichte in Spanien zweimal gezeigt hat, stellen seine ideologischen Irrfahrten den Anarchismus in den Dienst des bürgerlichen Staates.
Einzelne Arbeiter mögen davon ausgehen, dass sie sich an der Revolution auf der Grundlage des Anarchismus beteiligen können, doch um sich ein revolutionäres Programm anzueignen, muss man mit dem Anarchismus brechen.
Ronsesvalles 31.3.2000
[1] [34] Ein Beispiel dazu ist die Broschüre von Balius Hin zu einer neuen Revolution.
[2] [34] Bezüglich dieser zentralen Frage sind wir nicht derselben Meinung wie Agustin Guillamon, der über diese Gruppe die Broschüre Die Freunde Durrutis, 1937-1939 veröffentlicht hat. Seine Arbeit ist die bisher wichtigste und gewissenhafteste Anstrengung zur Dokumentation der Erfahrungen und Publikationen dieser Gruppe, die uns bisher begegnet ist. Deshalb beziehen wir uns in diesem Artikel mehrmals auf diese Quelle. Doch auch wenn der Autor hervorhebt, dass die Ereignisse in Spanien von 1936 den Tod des Anarchismus bedeuteten, so behauptet er gleichzeitig, dass eine revolutionäre Alternative aus dem Anarchismus herauswachsen kann.
[3] [34] Zur genaueren Analyse über den Juli 1936 und Mai 1937 siehe die Broschüre Spanien 1936 unserer IKS-Sektion in Spanien.
[4] [34] Gruppe Internationaler Kommunisten, die Hauptvertreter des Rätekommunismus in Holland. Ein Text dieser Gruppe ”Revolution und Konterrevolution in Spanien” ist in unserer Broschüre Spanien 1936 veröffentlicht.
[5] [34] Zu den Positionen dieser Strömung siehe unsere Broschüre Spanien 1936.
[6] [34] Anders also als die Trotzkisten, welche später im Zweiten Weltkrieg die UdSSR unterstützten.
[7] [34] Die Kino-Version dieser Behauptungen ist in Filmen wie ”Erde und Freiheit” des englischen Regisseurs Ken Loach zu sehen, welche einen großen kommerziellen Erfolg hatten.
[8] [34] Eine Strömung innerhalb der CNT, angeführt von Angel Pestaña, der eine ”syndikalistische Partei” gründen wollte.
[9] [34] Auszug aus einer Antwort von Garcia Oliver, eines Führers der CNT 1936, an den amerikanischen Forscher Bolloten 1950. Zitiert aus dem Buch von Guillamon.
[10] [34] Als Ausgeburt des Zynismus rief eine der Führerinnen der CNT, Federica Montseny, die Arbeiter dazu auf, ”die Gendarmen zu küssen”, von denen sie massakriert wurden.
[11] [34] BILAN Nr.36, ”Die Lehren aus den Ereignissen in Spanien”, Oktober-November 1936
[12] [34] ”Die gegenwärtige Bewegung” in EL AMIGO DEL PUEBLO Nr. 5, Seite 3, zitiert aus dem Buch von Frank Mintz und M. Peciña: Die Freunde Durrutis, die Trotzkisten und die Mai-Ereignisse
[13] [34] Guillamon beschreibt in seinem Buch die Verwandtschaft dieser Gruppe mit den Ideen von Buenaventura Durruti, die er vor allem in einer seiner letzten Reden am 5. November 1936 vertrat.
[14] [34] Jaime Balius in LA NOCHE, ”Achtung Arbeiter! Kein Schritt zurück!”, 2. März 1937, zitiert nach Mintz/Peciña, S. 14-15.
[15] [34] EL AMIGO DEL PUEBLO, Nr. 1, zitiert nach Mintz/Peciña, S. 68-69.
[16] [34] Aus diesem Grund geht Guillamon über diese Überlegungen (wie überhaupt über die Frage von Krieg und Revolution) hinweg, wenn er versucht aufzuzeigen, dass die Freunde Durrutis eine revolutionäre Alternative zum Anarchismus dargestellt hätten.
[17] [34] Jaime Balius, Hin zu einer neuen Revolution, Historisches Dokumentationszentrum, S. 32-33
[18] [34] EL AMIGO DEL PUEBLO, Nr. 1, zitiert nach Mintz/Peciña, S. 63
[19] [34] Agustin Guillamon, Die Freunde Durrutis 1937-1939, Seite 70
[20] [34] Brief von Balius an Bolloten, 1946, zitiert aus
Guillamon, Seite 89, Hervorhebung im Original.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Die New Economy: Eine erneute Rechtfertigung des Kapitalismus
- 3400 Aufrufe
In den 1970er Jahren gab es eine Kampagne, gemäss der die Wirtschaftskrise ein Auswuchs der Erdölknappheit gewesen sei. Anschließend wurde uns zu Beginn der 80er Jahre von den Reaganomics versprochen, dass die Krise nun durchgestanden sei. Dennoch muss man klar und deutlich erkennen: Seit 30 Jahren, d.h. seit Beginn des erneuten Ausbruchs der historischen Krise, konnten wir niemals einer derart tiefgreifenden ideologischen Kampagne beiwohnen, die darauf abzielt, uns einzubläuen, dass die Krise nun überwunden sei und wir in ein neues Zeitalter der Prosperität eingetreten seien. Gemäss dieser in den letzten Jahren entfesselten Propaganda wären wir jetzt also in der dritten industriellen Revolution. Ein Hauptvertreter dieser Argumentation hat sich folgendermaßen geäußert: ”Es handelt sich hier um ein historisches Ereignis von mindestens ebenso großer Tragweite wie die industrielle Revolution des 18. Jahrhunderts ... Das Zeitalter der Industrialisierung basierte auf der Einführung und dem Gebrauch von neuen Energiequellen; das Zeitalter der Informatik gründet auf der Technologie zur Herstellung von Wissen, dem Umgang mit Informationen und der Sprachsymbole.”[1] [36] Die Medien trichtern uns ständig ein, dass die Arbeitslosigkeit nun verschwinden wird. Sie beziehen sich dabei auf die Wachstumszahlen des BIP in den USA während der letzten Jahre. Sie schließen daraus, dass der ökonomische Zyklus, der seit Beginn der siebziger Jahre von schwachem Wachstum und periodischen, ständig tieferen Rezessionen gekennzeichnet war, nun überwunden sei. Wir seien jetzt also in eine ununterbrochene Wachstumsperiode geraten, die man nur mit Superlativen beschreiben könne. Und was ist der Grund dafür? Wir leben im Zeitalter der New Economy, die von einer großartigen neuen technologischen Innovation getragen werde: dem Internet.
Was ist nun also der Inhalt dieser Revolution, die die Bourgeoisie dermaßen entzückt? Es geht hier hauptsächlich darum, dass es das Internet oder viel allgemeiner der Aufbau von neuen Telekommunikationsnetzen erlaube, Informationen viel schneller auszutauschen und effizienter zu verwalten und zwar völlig unabhängig von der Distanz. Dies wiederum erlaube zuallererst Käufer und Verkäufer auf globaler Ebene zusammenzuführen. Kauf und Verkauf seien deshalb unabhängig von Verkaufsstellen und Verkaufsdienstleistungen durch die Unternehmen, was wiederum eine Verringerung der Kosten nach sich ziehe. Jeder Produzent habe jetzt durch das Internet sofortigen Zugriff auf den Weltmarkt, was eine enorme Ausdehnung des Marktes bedeute. Der Verkauf von Waren im Internet erfordere wichtige technologische Kenntnisse, was wiederum die Gründung von neuen Unternehmen begünstige. Die bekannten Start-ups versprächen denn auch eine blendende Zukunft für Profit und Wachstum. Dies ziehe wiederum eine höhere Produktivität in den industriellen Unternehmen nach sich, da eine solch hohe Verkehrsdichte an Informationen eine bessere Koordination und somit tiefere Kosten für Kleinbetriebe, Dienstleistungen und Ateliers bedeuten würden. So könne man auch die Lager reduzieren, da Produktion und Verkauf nun ja unmittelbar miteinander verknüpft werden könnten. Auch die Werbekosten sänken, da eine einzige Werbewebseite ja alle Online-Kunden erreiche. Die Medien weisen auch auf einen anderen wichtigen Punkt mit weitreichenden politischen Folgen hin: Die Internetinnovationen beruhten einzig und allein auf Wissen und nicht auf teuren Maschinen. Man stehe also vor einer Demokratisierung von Innovationen, alle könnten Start-ups in die Wege leiten und somit könnten alle vom Reichtum profitieren.
Trotz der triumphierenden medialen Schreie kann man bereits eine ganze Reihe von davon abweichenden Nachrichten lesen, die doch den Zweifel an der Realität eines neuen großartigen Zeitalters wecken: Einerseits sind alle mit der Feststellung einverstanden, dass sich das Elend auf der Welt ständig vergrößert, dass auch die Ungleichheit in den entwickelten Ländern im Zunehmen begriffen sind und dass die berühmten Start-ups, statt sich in Richtung der prunkvollen Zukunft zu bewegen, die ihnen von den Propagandisten der New Economy gezeigt worden ist, immer zahlreicher einfach zusammenbrechen. Man kann sich also fragen, ob nicht eine Anzahl dieser bis zum Hals verschuldeten Unternehmer nicht einfach das Heer der neuen Armen vergrößern werden. Andererseits treiben einer ganzen Reihe von Ökonomen die Kursbewegungen an der Börse im allgemeinen und diejenigen der Aktien im Bereich der neuen Technologien den kalten Schweiß auf die Stirn. Sie sehen, dass hier das Risiko einer Finanzkrise sehr hoch ist. Würde sie ausbrechen, könnte sie durch die Weltwirtschaft nur schwer aufgefangen werden.
Der Mythos des Produktivitätswachstums
Um die Bedeutung der New Economy wirklich seriös zu beurteilen, muss man zuallererst einmal von der Behauptung vieler Experten ausgehen, dass das Wachstum der Arbeitsproduktivität in der amerikanischen Wirtschaft nach einer Abnahme seit Ende der sechziger Jahre, in denen es bei 2,9% stand, seit einigen Jahren ständig gestiegen sei. In den neunziger Jahren habe es 3,9% betragen[2] [36]. Dieser Umschwung belege den Eintritt der Wirtschaft in ein neues Zeitalter.
Diese Zahlen sind alles andere als über alle Zweifel erhaben: R. Gordon von der Northwestern Universität in den USA schätzt, dass die stündliche Arbeitsproduktivität von 1,1% im Jahr 1995 auf 2,2% zwischen 1995 und 1999 angestiegen sei (Financial Times 4.8.1999). Weiter sind sie für viele Statistiker ganz einfach nicht beweiskräftig und zwar aus folgenden Gründen:
- Die Rentabilität aller produktiven Investitionen hat nur wenig zugenommen, was bedeutet, dass die Zunahme der Arbeitsproduktivität nur durch eine Erhöhung des Tempos und somit der Ausbeutung der Arbeiterklasse zustande gekommen sein kann.
- Die Produktivität weist ständig die Tendenz zum Anstieg auf, wenn man sich auf dem Höhepunkt eines Aufschwungs befindet, was in den USA 1998-1999 der Fall war. Die Produktionskapazitäten sind in einer solchen Zeit besser ausgelastet.
- Schließlich ist vor allem im Bereich der Computerproduktion die Produktivität angestiegen. Die Financial Times hat dieser Umstand zu folgender Aussage veranlasst: ”Der Computer steht am Ursprung des Wunders der Produktivität in der Computerproduktion.” (Ebd.)
Der Kapitalismus realisiert also angetrieben von der Konkurrenz - wie er das immer getan hat - technische Fortschritte. Die Zahlen zeigen keinesfalls, dass wir uns in einer außergewöhnlichen Phase befinden würden, die einen wirklichen Bruch mit den vergangenen Jahrzehnten darstellen würde.
Die historischen Vergleiche zwischen der industriellen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts und den heutigen Ereignissen sind vollkommen irreführend. Die Einführung der Dampfmaschine und die großen Innovationen des 19. Jahrhunderts haben dazu geführt, dass der Arbeiter eine viel größere Menge von Gebrauchswerten in der gleichen Arbeitszeit herstellen konnte. So konnte die Bourgeoisie einen größeren Mehrwert herauspressen. Gewiss erzielte man im 20. Jahrhundert und insbesondere in den letzten 30 Jahren mit der Automatisierung der Produktion ein Wachstum der Arbeitsproduktivität. Dieser Umstand lieferte der Bourgeoisie und ihren Experten das Argument, dass der Arbeiter im weißen Kittel kein Arbeiter mehr (die Roboter arbeiten ja ganz alleine!) und die Arbeiterklasse logischerweise im Verschwinden begriffen sei.
Beim Internet geht es überhaupt nicht um diese Fragen. Mit diesem Vorgehen produziert der Arbeiter in einer gegebenen Zeitspanne ständig dieselbe Menge. Vom Standpunkt der Produktion aus ändert das Internet rein gar nichts. Mit der Kampagne über die New Economy will uns die Bourgeoisie glauben machen, dass der Kapitalismus eine Welt aus Waren sei, ohne dass diese erst produziert werden müssten. Somit will sie auch den Umstand verwischen, dass die Arbeiterklasse das wirkliche Herz dieser Gesellschaft ist, d.h. diese Gesellschaft existieren lässt.
Die Verminderung der Handelskosten kann die Krise nicht verhindern
Aber selbst wenn das Internet oder auch eine andere Innovation eine Senkung der Verkaufskosten eines Produktes nach sich zieht, wie das auch die Eisenbahnen im 19. Jahrhundert mit der Verminderung der Transportkosten um den Divisor 20 und somit auch der Verkaufspreise erreicht haben, wird dies kein neues Wirtschaftswachstum auslösen können. Die Eisenbahnen erlaubten ein starkes Wirtschaftswachstum, weil sie Güter für einen expandierenden Markt transportierten. Damals eroberte der Kapitalismus gerade den gesamten Planeten, und er konnte sich so neue Absatzmärkte öffnen. Heute existiert aber kein solcher Markt mehr[3] [36], der Verkauf durch das Internet kann also nur das Verschwinden oder die Verminderung einer ganzen Reihe wirtschaftlicher Aktivitäten nach sich ziehen. In der Folge verschwinden also Stellen, die nicht durch neue im Internetbereich ersetzt werden. Gerade diese Technologie erlaubt es zu sparen, sei es nun im Verkauf an Kunden oder im Verkauf zwischen Unternehmen. Das gleiche Lied kann man von der mit dem Internet angeblich möglichen Restrukturierung von Unternehmen singen. Selbst John Chambers von Cisco, einem der wichtigsten Unternehmen im Bereich der neuen Technologien, sagt: ”Wir haben durch den Gebrauch des Internets für den Informationsaustausch zwischen den Angestellten, den Lieferanten und den Kunden bereits Tausende von Stellen gestrichen ... Dasselbe gilt für die Kostenabrechnungen. Heute sind nur noch zwei Personen für die Spesenabrechnungen unserer 26000 Angestellten zuständig ... So konnten wir bereits 3000 Stellen im Servicebereich streichen” (Le Monde, 28.3.2000). Und damit auch wirklich alles klar ist, fügt er noch hinzu: ”In zehn Jahren wird jedes Unternehmen, das nicht vollständig auf das Internet umgestiegen ist (d.h. nicht all diese Stellen gestrichen hat), schließen.” Die Einkommen, die diese Unternehmen ausschütten, nehmen also ab, was die globale zahlungsfähige Nachfrage offensichtlich nicht erhöhen, der Weltwirtschaft also keinen Anstoß geben kann. Wenn die nötigen außerkapitalistischen Gebiete fehlen - und dies ist in der dekadenten Periode der Fall -, kann keine Innovation die Krise lösen, selbst wenn sie neue Stellen schaffen würde. J. Chambers fügt hinzu, dass er ”die 3000 Personen im Bereich der Forschung und Entwicklung angestellt” habe, aber dies ist nur möglich, weil die Installationswelle im Internetbereich Cisco gegenwärtig hohe Verkaufsabschlüsse bringt. Sobald diese Welle im Abflauen begriffen ist, wird sich diese Firma keine dermaßen große Forschungs- und Entwicklungsabteilung mehr leisten können.
Der Internetblase geht die Luft aus
Es gibt also nichts wirklich Neues über die Wirtschaftsentwicklung zu berichten. Und auch die Bourgeoisie, die verzweifelt die Zeichen eines neuen Aufschwungs in einem hypothetischen Kondratieff-Zyklus sucht, d.h. einem alle 50 Jahre alternierenden Zyklus von Krise und Aufschwung[4] [36], wird nichts Neues finden. Den Beweis dafür hat ein Börsenkrach bei den Technologieaktien in diesem Frühling erbracht. Zwischen dem 10. März und dem 14. April ist der Index für diese Werte in den USA, der NASDAQ, um 34% eingebrochen. Internetunternehmen wie Boo.com - finanziert von so mächtigen Banken wie J.P. Morgan und dem französischen Geschäftsmann B. Arnault - sind bankrott gegangen. Das sind Konkurse, die weitere nach sich ziehen werden, in Finanzkreisen zirkulieren Listen mit Internetunternehmen, die ernsthafte Schwierigkeiten haben.[5] [36] Man muss hier insbesondere auch Amazon nennen, der ein großes Internetportal eröffnete und der in Seattle ebenso bekannt ist wie Boeing. Seine finanziellen Schwierigkeiten ziehen neue Erschütterungen an der Wall Street nach sich. Das Forschungsinstitut Gartner Group behauptete, dass 95% bis 98% aller Unternehmen in diesem Sektor bedroht seien (Le Monde, 13.6.2000) und dass dies die Bestätigung der Tatsache sei, dass deren kürzlicher unglaublicher Aufschwung auf nichts anderes als eine spekulative Blase, die nur Luft enthalte, zurückzuführen sei.
Und wenn keine New Economy existiert, dann ist das Internet auch nicht das Mittel, um die ganze Wirtschaft in Schwung zu bringen. Einer der Gründe für den absehbaren Zusammenbruch von Amazon.com liegt darin, dass die konkurrenzierten Verteilunternehmen nun reagieren. Die Nummer 1 dieses Sektors, Wal Mart, verkauft nun nämlich auch über das Internet. Angesichts der Konkurrenz durch diese neuen Unternehmen, die die ”alten” großen Unternehmen zu verschlingen gedroht hatten, reagierten diese mit den gleichen Mitteln. Ein Kader eines französischen Verteilunternehmens erklärt dies so: ”Bei Promedès sagten wir uns, wenn wir nicht aktiv bleiben, so wird auf jeden Fall ein anderer unsere Aktivitäten übernehmen” (Le Monde, 25.4.2000). Dieser Kadermitarbeiter gibt implizit zu, dass die Unternehmen, die ebenfalls den Verkauf über das Internet einführen, keine neuen Arbeitsplätze schaffen (wir haben dies bereits im Falle Ciscos gesehen), sondern sogar Entlassungen vornehmen. In der gleichen Ausgabe von Le Monde steht auch, dass die Internetaktivitäten zumindest teilweise für die Streichung von 3000 Stellen bei der britischen Bank Lloyd’s TSB, von 1500 bei dem Versicherer Prudential verantwortlich seien und dass die amerikanische Computer-Verkaufskette Egghead Software 77 von 156 Filialen geschlossen habe.
Dies sind die realen Auswirkungen der sogenannten New Economy auf die kapitalistische Wirtschaft. Die Maßnahmen der Unternehmen in bezug auf das Internet sind nichts anderes als ein Moment des tödlichen Konkurrenzkampfes, den sich die Kapitalisten angesichts des bereits seit längerer Zeit gesättigten Marktes liefern. Dieser Wirtschaftskrieg kann auch anhand der Welle von Fusionen und Akquisitionen wahrgenommen werden, die bereits vor einem Dezennium angerollt ist und sich nun noch verstärkt. Diese Unternehmen müssen jetzt danach trachten, sich des Produktivapparats und des Markts der Konkurrenten zu bemächtigen, um sich auf dem Weltmarkt zu etablieren. ”1999 hat sich dieser Markt um 123% ausgedehnt und ein Volumen von 1870 Mrd. frz. Francs erreicht (...) Ein Wettlauf auf Weltebene ist im Gang.” (Le Monde, 11.4.2000) Im Rahmen der Dekadenz des Kapitalismus ist es zumindest ein Mittel jedes Sektors der Bourgeoisie, um der Konkurrenz die Stirn zu bieten: Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse. Man weiß, dass solche Riesenfusionen in den meisten Fällen mit Entlassungen zu Ende gehen.
Die Börsenhausse bei den New-Economy-Unternehmen hat übrigens auch alle anderen Börsenwerte in die Höhe gezogen. Dies darf aber keinesfalls als Zeichen einer neuen Phase hohen Wirtschaftswachstums verstanden werden, sondern ist lediglich das Ergebnis des seit Jahrzehnten unternommenen Versuchs der bürgerlichen Staaten, der Krise, in die die Wirtschaft immer tiefer hineinschlittert, Einhalt zu gebieten. Als Beispiel sei hier die Verschuldung angeführt: Gemäss dem Generaldirektor von Altavista Frankreich würde es ausreichen, ”200000 Francs unter einigen Freunden zusammenzulegen, um von Risikoinvestoren weitere vier Millionen zu erhalten, von denen dann die Hälfte in Werbung fließt, bevor weitere 20 Millionen an der Börse beschafft werden könnten” (L’Expansion, 27.4.-11.5.2000). Von Standpunkt der Kapitalakkumulation ist dies natürlich eine reine Absurdität. Da es keine Möglichkeit gibt, wirklich produktiv zu investieren, fließt das Geld halt in unproduktive Aktivitäten wie beispielsweise in die Werbung und endet schließlich in der Spekulation, sei es nun im Bereich der Börse, des Geldes oder des Erdöls.[6] [36] Nur auf diese Weise kann man erklären, weshalb die Aktienkurse der neuen Technologien, bevor sie schließlich einbrachen, innerhalb eines Jahres um 100% angestiegen waren, während die entsprechenden Unternehmen nur Verluste geschrieben hatten.
Es handelt sich hier um keine neue Erscheinung, denn die Bourgeoisie entwickelt seit der Krise von 1929, die nicht zu einem spontanen Wiederaufschwung geführt hat, wie dies noch nach den Krisen des 19. Jahrhunderts der Fall gewesen war, die unproduktiven Bereiche, um der Krise die Stirn zu bieten. Eine gewisse Anzahl der bürgerlichen Zeitungen können diesen Umstand nicht verhehlen: ”Die Internetwirtschaft kann vielleicht die Produktivität langfristig beeinflussen, aber die Schuldenwirtschaft ist der Ursprung dieser Entwicklung ... Die aufsteigende Phase ist mit dem Kredit viel eher unterstützt worden als durch die neuen Technologien, die nichts als ein Alibi für die Spekulation sind.” (L’Expansion, 13.27.4.2000) Und tatsächlich kann diese Spekulation zu nichts anderem führen, das haben die letzten 20 Jahre gezeigt, als zu Erschütterungen in der Finanzsphäre, wie wir dies gerade jetzt erleben.
Die New Economy versteckt die Angriffe gegen die Arbeiterklasse
Die Realität der New Economy zeigt, dass die ganze Medienpropaganda über die Verwandlung der Gesellschaft durch das Internet, die uns alle als im Netz arbeitend und von den Innovationen profitierend und im selben Atemzug auch als Aktionäre darstellen, nichts als ein Bluff ist. Die Gründeraktionäre der Start-ups, die nun zusammenbrechen, können sich durchaus in der größten Not wieder finden. Und alle, die durch die Werbung mit der Möglichkeit von erheblichen Gewinnen mit nur 20% des Aktienwertes als Einsatz zum Kauf von Internetaktien verleitet worden sind, sind nun nach dem Krach gezwungen, während einer längeren Zeit einen Teil ihres Einkommens für die Rückzahlung der Schulden bei der Bank zu benutzen.
Wenn man die Lohnabhängigen mit Aktienoptionen entlohnt, wenn man sie zum Kauf von Fonds verleitet, verwandelt man sie noch lange nicht in Aktionäre, sondern beschneidet sie nur auf zweifache Weise. Einerseits stellt der Teil des Einkommens, den der Arbeiter dem Unternehmen überlässt, nichts anderes als eine Erhöhung des Mehrwertes und eine unmittelbare Verminderung des Einkommens dar. Anderseits bedeutet dies, trotz aller verlockender Angebote, die den Lohnabhängigen zu einem Aktionär der Firma machen sollen, nichts anderes als dass das Kapital den Lohn des Arbeiters von den zukünftigen Ergebnissen des Unternehmens abhängig macht: Wenn die Kurse fallen, fällt auch des Einkommen des Arbeiters. Der Volkskapitalismus, der heute unter der Parole der ”Republik der Aktionäre” so stark in Mode ist, ist doch nur ein Mythos, denn die Bourgeoisie, ob sie sich nun im Staatsapparat oder in der Direktion von Unternehmen befindet, ist Inhaberin der als Kapital wirkenden Produktionsmittel. Sie kann das Kapital nur durch die Ausbeutung der Arbeiterklasse gewinnbringend anwenden. Der Arbeiter kann weder den ganzen noch Teile des Gewinns erhalten, denn gerade um einen Gewinn zu erhalten, muss der Arbeiter nach dem Wert seiner Arbeitskraft bezahlt werden.[7] [36] Die Bourgeoisie hat die Pensionsfonds und den Arbeiteraktionär nur hervorgebracht, weil die Krise des Kapitalismus derart schwer ist, dass sie mit allen Mitteln danach trachtet, den Wert der Arbeitskraft zu senken, indem sie ihn von den Aktienkursen abhängig macht. Der Zusammenbruch der Technologiewerte zeigt das Risiko, dem die Arbeiter ausgesetzt sind, deren Lohn von der Aktienentwicklung abhängt.
Alles in allem kommt die Anstrengung der Bourgeoisie zur Förderung des Arbeiteraktionärs einer zusätzlichen Attacke auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse gleich, und nicht der Teilhabe der Arbeiter an einem Teil des Profits. Genau so wie die Bourgeoisie durch die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen die Mittel hat, Arbeiter von einem auf den nächsten Tag zu entlassen, wenn es das Interesse des Kapitals erheischt, hat sie mit dem Arbeiteraktionär die Mittel in der Hand, das Einkommen oder die Rente des Arbeiters zu senken, wenn sich die Situation des Unternehmens oder des Kapitals verschlechtert.
Dieser wirtschaftliche Angriff steckt hinter der ohrenbetäubenden Kampagne über die New Economy. Der Anschluss des Unternehmens ans Netz bedeutet, dass die Informationen sofort verfügbar sind. Somit entfällt jegliche Pause zwischen zwei Arbeiten. Sobald die eine Arbeit erledigt ist, muss man zur nächsten übergehen, für die man ja auch bereits über das Netz den Auftrag bekommen hat. Jede Arbeit kann jederzeit angepasst werden usw. Teuflisch wird es, wenn die Aufträge immer schneller hereinkommen. Nur so kann man verstehen, dass ”mindestens ein Drittel der mit dem Netz verbundenen Arbeiter mindestens 6,5 Stunden in der Woche zu Hause arbeiten, um Ruhe zu haben” (Le Monde, 13.4.2000). Das auf den ersten Blick sehr großzügige Geschenk eines Computers, den gewisse Unternehmen (Ford mit 300000 Arbeitern, Vivendi mit 250000, Intel mit 70000) ihren Arbeitern zukommen lassen, zeigt sehr gut, wie man die Arbeiter zur ständigen Arbeit zwingen möchte. Der wiederholten Leugnung dieses Umstandes mangelt es nicht an Dreistigkeit, wenn Ford mit diesem Geschenk darauf abzielt, dass ihre Arbeiter ”den Kunden schneller antworten können” und sie ”die Gewohnheit eines schnelleren Informationsaustausches” annehmen. Ständig mehr Experten der Arbeitsorganisation sagen, dass man in der Informationsgesellschaft überhaupt nicht mehr wisse, ”wo die Arbeit beginnt, und wo sie endet”, und dass der Begriff Arbeitszeit zunehmend an Konturen verliere, was wiederum durch Arbeiter bestätigt wird, die nach Belieben zu Hause kontaktiert werden können und ”nie zu arbeiten aufhören” (Libération, 26.5.2000). Tatsächlich wäre das Ideal der Bourgeoisie, wenn alle Arbeiter sich wie die Gründer eines Start-ups im Silicon Valley verhalten würden, die ”13 bis 14 Stunden am Tag, sechs Tage in der Woche arbeiten, in Räumen von 2 mal 2 Metern wohnen ..., ohne Pause, ohne Frühstück, ohne kollegiale Treffen in der Cafeteria” (L’Expansion, 16.-30.3.2000). Diese Arbeitsbedingungen sind die Regel in allen Start-ups weltweit.
Der Angriff gegen das Bewusstsein der Arbeiterklasse
Die große Medienkampagne verfolgt noch ein weiteres Ziel. Hinter der New Economy, in der jeder mit dem Netz arbeitet, sich in einen Innovator und Aktionär verwandelt, steckt ein gewaltiger Bluff, allerdings einer von großer Tragweite.
Er unterstellt, dass die Gesellschaft, zumindest diejenige der Industrieländer, eine reale Verbesserung erfahren werde und dass deshalb die Unternehmen, die Verwaltung, in denen die Existenzbedingungen der Arbeiter angegriffen würden, nur eine Randerscheinung, eine Ausnahme, darstellten. Wenn diese Arbeiter Widerstand leisteten, so wäre dies ein rückwärtsgewandter, anachronistischer Kampf, der in der Isolation enden würde. Die Propaganda über die New Economy ist ein Mittel, die Arbeiter zu demoralisieren, damit sich ihre Unzufriedenheit nicht in Kampfkraft umwandelt.
Weiter unterstellt er nichts Geringeres, als dass die Gesellschaft sich derart tiefgreifend am verändern sei, dass der Kapitalismus überwunden werde und somit auch alle Projekte zum Umsturz des Kapitalismus überholt seien. Man sagt uns, dass derjenige, der in der New Economy arbeite, reich werden würde, was logischerweise bedeuten würde, dass die materiellen Bedingungen des Arbeiterdaseins überwunden würden. Wer sich allerdings nicht dieser Trilogie von Netz-Innovator-Aktionär anpasse, werde Opfer einer größeren Einkommensungleichheit. Die Gesellschaft sei also nicht mehr in Bourgeoisie und Arbeiterklasse aufgeteilt, sondern in Involvierte und Ausgeschlossene der New Economy. Und um den Nagel noch ganz reinzuschlagen, behauptet man, dass die Teilhabe an der New Economy von der Intelligenz und vom Willen abhänge: ”Entweder bist du reich oder ein Trottel”, behauptet die Zeitschrift Business 2.0.
All dies wird durch die Propaganda vervollständigt, wonach sich die Unternehmen, der Ort, an dem Wert geschaffen und die Arbeitskraft ausgebeutet wird und sich die Klassen zeigen, sich umwandeln würden. Alle, die an der New Economy partizipierten und Zugriff zum Reichtum hätten, könnten nicht mehr als Arbeiter bezeichnet werden. Die Arbeit im Betrieb, da wo der Reichtum hergestellt werde, sei nicht mehr geteilt zwischen Kapitalist, d.h. Inhaber des Kapitals, und Arbeiter, d.h. Besitzer der Arbeitskraft: ”Die New Economy bedeutet mehr Mannschaft: Die Angestellten bilden ein wirkliches Team, sie haben durch die Aktien teil am Reichtum der Unternehmen”, sagt der Präsident der BVRP Software (Le Monde Diplomatique, Mai 2000).
Diejenigen allerdings, die sich nicht in die New Economy einfügen, schlecht bezahlte und präkarisierte Arbeiter und Arbeitslose, bilden noch immer die große Mehrheit der Gesellschaft. Die Klasse, die den gesellschaftlichen Reichtum herstellt, wird nicht durch den Studenten aus Silicon Valley oder anderswo repräsentiert, der sich durch das Trugbild vom Reichtum in Griffweite blenden lässt. Die den gesellschaftlichen Reichtum produzierende Arbeiterklasse ist diejenige, die von der Bourgeoisie ständig mehr ausgebeutet wird; und wenn die Ausbeutung nicht mehr funktioniert, wird der Arbeiter aufs Pflaster geworfen und aus dem produktiven Prozess ausgeschieden. Angesichts dieser Angriffe hat die Arbeiterklasse keine andere Wahl als zu kämpfen. Das Bewusstsein, das die Arbeiter über die Notwendigkeit dieses Kampfes und seinen Perspektiven haben, sind für ihn lebenswichtig.
Die ideologischen Kampagnen zur New Economy haben die gleichen Themen zum Inhalt und verfolgen dieselben Ziele wie diejenigen, die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 entfesselt worden sind.
Einerseits zielt man darauf ab, der Arbeiterklasse ihre Identität zu rauben, indem man die Gesellschaft als eine Gemeinschaft von Bürgern präsentiert, in der die sozialen Klassen, die Trennung von Ausbeuter und Ausgebeuteten sowie ihre Konflikte verschwunden seien. Gestern war es der Zusammenbruch der Regime, die sich als ”sozialistisch” und arbeiterfreundlich darstellten, die für diese Behauptungen herhalten mussten; heute ist es der Mythos, dass die Herren und die Arbeiter dieselben Interessen hätten, da sie ja jetzt alle Aktionäre desselben Betriebes seien.
Anderseits will man der Arbeiterklasse jegliche Perspektive außerhalb des Kapitalismus rauben. Gestern musste dafür der ”Zusammenbruch des Sozialismus” herhalten. Heute ist es die Idee, dass der Kapitalismus, selbst wenn er seine Fehler habe, nicht in der Lage sei, das Elend zu beseitigen, noch die Kriege, noch die Katastrophen aller Art, er doch eben das ”am wenigsten schlechte aller Systeme” sei, da er trotz allem in der Lage sei zu funktionieren, den Fortschritt zu garantieren, die Krisen zu überwinden.
Aber selbst die Tatsache, dass die Bourgeoisie solche ideologischen Kampagnen für notwendig erachtet, die Tatsache, dass sie sich auf neue wirtschaftliche Angriffe vorbereitet, bedeutet, dass sie kaum an die verzauberte Welt der New Economy glaubt. Die Verfälschungen der politischen Ökonomie durch den amerikanischen Notenbankpräsidenten A. Greenspan, um eine weiche Landung der amerikanischen Wirtschaft herbeizuführen nach Jahren der Verschuldung, der wachsenden Handelsdefizite, der jetzt wieder signifikant ansteigenden Inflation in den USA, bedeuten nicht, dass wir jetzt die Perspektive eines unvorstellbaren Wirtschaftswachstums hätten. Weiche Landung oder noch schlimmere Rezession sind nichts anderes als die Bestätigung der marxistischen Analyse: Der Kapitalismus ist nach der Wiederaufbauphase nach dem zweiten Weltkrieg in die offene Wirtschaftskrise zurückgekippt, die er nicht überwinden kann. Diese Krise wirft einen immer größeren Teil der Menschheit in die absolute Verarmung und ist der Grund für die ständig härteren Lebensbedingungen für die Gesamtheit der Arbeiterklasse. Die Zukunft des Kapitalismus bietet uns nichts anderes als eine ständige und schreckliche Zunahme all dieser Übel. Einzig die Arbeiterklasse hat die Fähigkeit, eine Gesellschaft zu errichten, in der der Überfluss herrschen wird, weil sie allein in der Lage ist, die Grundlage für eine Gesellschaft zu bilden, die zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse und nicht des Profits einer Minderheit produziert. Diese Gesellschaft nennt sich Kommunismus.
JS, Juni 2000
[1] [36] Interview mit Manuel Castells (Professor an der Universität von Berkeley), in: Problèmes économiques Nr. 2642, 1.12.1999
[2] [36] Business Review, Juli/August 1999. Diese Zeitschrift publiziert die Zahlen der Handelsabteilung der amerikanischen Regierung.
[3] [36] Siehe den Artikel von Mitchell: ”Krisen und Zyklen in der niedergehenden kapitalistischen Wirtschaft” in International Review Nr. 102 und 103 (engl./frz./span. Ausgabe) und die Broschüre der IKS ”Die Dekadenz des Kapitalismus”.
[4] [36] In den 1920er Jahren hat N. Kondratieff diese Theorie entwickelt, nach der die Weltwirtschaft einen Zyklus von Krise und Aufschwung von ca. 50 Jahren durchläuft. Diese Theorie hat für die Bourgeoisie den großen Vorteil, dass auf eine Krise der Aufschwung ebenso sicher folgt wie die Sonne auf den Regen.
[5] [36] ”Peapod.com, CDNow, salon.com, Yahoo!...” in: Le Monde, 13.6.2000
[6] [36] Wir schrieben bereits in der am 14. Kongress von unserer Sektion in Frankreich verabschiedeten Resolution (siehe Weltrevolution Nr. 102): ”Die Besessenheit, welche Investoren ergriffen hat, in die ‚Neue Ökonomie‘ zu investieren, ist nichts anderes als ein Ausdruck der Sackgasse der kapitalistischen Wirtschaft. Marx hatte schon zu seiner Zeit aufgezeigt, dass die Börsenspekulation nicht ein Zeichen für die Gesundheit der Wirtschaft, sondern für den sich anbahnenden Bankrott ist.” (Punkt 4)
[7] [36] Für eine detailliertere marxistische Analyse des kapitalistischen Ausbeutungsprozesses siehe den bereits zitierten Artikel von Mitchell.
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [37]
Die “serbische Revolution"
- 3203 Aufrufe
Ein Sieg der Bourgeoisie, nicht der Arbeiterklasse
Im Augenblick der Fertigstellung der International Review Nr. 103 (engl./frz./span. Ausgabe), aus welcher dieser Artikel übernommen wird, erfährt die Situation in Ex-Jugoslawien eine neue Wende. Wir sehen uns deshalb zu einer unmittelbaren Stellungnahme veranlasst. Als revolutionäre Organisation der Arbeiterklasse ist dies unsere Aufgabe, auch wenn der Positionsbezug nur kurz sein kann. Unsere Leser können gewiss sein, dass wir unsere Analyse und unsere Intervention zu dieser Frage in unseren verschiedenen territorialen Publikationen sehr schnell vorantreiben werden.
Wenn wir also den Medien der Bourgeoisie und insbesondere den auf allen Fernsehkanälen der vorgeblich großen Demokratien verbreiteten Bildern glauben, so wohnen wir in Belgrad seit zwei Tagen einem großen historischen Augenblick bei: nämlich einer friedlichen demokratischen Revolution, vollendet durch das serbische Volk und den Fall von Milosevic. Dies bedeute das Ende der “letzten national-kommunistischen Diktatur Europas”. Alles entwickelt sich also bestens in der besten aller kapitalistischen Welten! Dieses “historische Ereignis” wird von allen Staatschefs und anderen Anführern der großen “demokratischen” Mächte begrüßt und beweihräuchert, denselben, die erst im letzten Jahr den Krieg entfesselt und mit ihrem Bombardement auf den Kosovo und auf Serbien massive Zerstörungen und Massaker verursacht hatten. All dies geschah, wir erinnern uns wohl, im Namen der notwendigen “humanitären Intervention”, die Milosevic und seine Bluthunde an der Vollendung ihrer schrecklichen Taten im Kosovo hätten hindern sollen.
Damals hatte unsere Organisation sofort auf diese Lügner reagiert und sie als “feuerlegende Feuerwehrmänner” denunziert. Wir hatten ihre Verantwortung für die Entfesselung der Barbarei insbesondere in dieser Weltgegend in Erinnerung gerufen: “Die Politiker und die Medien der NATO-Länder präsentieren uns diesen Krieg als eine Aktion zur ‘Verteidigung der Menschenrechte’ gegen ein besonders widerliches Regime, verantwortlich für verschiedenste Missetaten wie die seit 1991 Ex-Jugsolawien besudelnden ‘ethnischen Säuberungen’. In Wirklichkeit kümmern sich die ‘demokratischen’ Staaten keineswegs um das Schicksal der Bevölkerung im Kosovo, ebenso wenig wie sie das Schicksal der kurdischen und schiitischen Bevölkerung im Irak, die nach dem Golfkrieg von den Truppen Saddam Husseins massakriert wurden, rührte. Die Leiden der durch diesen oder jenen Diktator verfolgten Zivilbevölkerung dienten immer nur als Vorwand, der es den großen ‘Demokratien’ erlaubte, im Namen einer ‘gerechten Sache’ den Krieg zu entfesseln.” (Internationale Revue, Nr. 23)
Nur kurz darauf doppelten wir nach: “Wer, wenn nicht die großen imperialistischen Mächte, hat während der letzten zehn Jahre den schlimmsten Cliquen und nationalistischen kroatischen, serbischen, bosnischen und jetzt kosovarischen Mafias erlaubt, ihre blutige nationalistische Hysterie und die generalisierte ethnische Säuberung in einem teuflischen Prozess zu entfesseln? Wer, wenn nicht Deutschland, hat Slowenien und Kroatien zur Ausrufung der einseitigen Unabhängigkeit getrieben und hat so die nationalistischen Brandungen auf dem Balkan, die Massaker und die Vertreibung der serbischen und bosnischen Bevölkerung autorisiert und vorangetrieben? Wer, wenn nicht Großbritannien und Frankreich, hat die Repression, die Massaker an der kroatischen und bosnischen Bevölkerung und schließlich die ethnische Säuberung von Milosevic und seinen nationalistischen Großserben gutgeheißen? Wer, wenn nicht die Vereinigten Staaten, hat die verschiedenen bewaffneten Banden unterstützt und ausgerüstet, je nachdem wie sich ihre Rivalen gerade positioniert hatten? Die Heuchelei und Hinterhältigkeit der ‘alliierten’ westlichen Demokratien sind grenzenlos, wenn sie ihre Bombardements als ‘humanitäre Intervention’ rechtfertigen.” (International Review (engl. frz. span. Ausgabe) Nr. 98)
Wenn heute all diese großen imperialistischen Gangster keine Worte finden, um den Traum des serbischen Volkes zu begrüßen, das nach ihrer eigenen Ansicht ‘den Mut und den Stolz’ fand, sich des blutigen Diktators zu entledigen, so wollen sie mittels dieses trügerischen Diskurses hauptsächlich glauben machen, dass die gegenwärtigen Ereignisse nichts anderes als die Rechtfertigung der tödlichen Bombardierungen des letzten Jahres seien. Le Monde, dieses wichtige Sprachrohr der herrschenden Klasse in Frankreich, steht ohne Umschweife dazu: “...Mit dem späten Entscheid für einen militärischen Angriff auf Serbien haben Europa und die Vereinigten Staaten den Herrscher in Belgrad geschwächt und ein bisschen von seinem Volk isoliert.” Haben und werden die scheinbar großen Demokratien auch in Zukunft Grund haben, militärisch im Namen der unerlässlichen “humanitären Intervention” einzuschreiten? Unter dem Vorwand der “Verteidigung der Menschenrechte in der Welt” wollen sie auf diese Weise freie Hand haben, um die Massaker und Zerstörungen ungehindert zu vervielfachen. Von diesem Blickwinkel aus sind die aktuellen Ereignisse in Belgrad (ohne ihren ideologischen Nutzen zu vergessen) schon ein Erfolg für die Bourgeoisie.
Die herrschende Klasse betont aber auch einen anderen Aspekt: den angeblich “glorreichen Marsch der Demokratie” gegen alle Formen der Diktatur. Sind die “historischen Stunden”, denen wir heute beiwohnen dürfen, dafür nicht ein schreiender Beweis? Diese ideologische Schlacht ist desto wirksamer, je stärker die bürgerlichen Medien unterstreichen, dass unter den Hauptverantwortlichen für den Fall von Milosevic und den Sieg der Demokratie die Arbeiterklasse zu finden sei. Sie ist dem Ruf zum “zivilen Ungehorsam” gefolgt, den der Wahlsieger Kostunica ausgestoßen hatte. Dieser große nationalistische Bourgeois, in Bosnien lange ein Komplize des blutigen Karadzic, steht heute als Gegner der Diktatur da. Einige Sektoren der Arbeiterklasse wie beispielsweise die Minenarbeiter von Kolubra haben nun ihren Platz in den Zeilen der bürgerlichen Presse bekommen, da sie für die Verteidigung der Demokratie streikten. Wenn die internationale herrschende Klasse einen Wunsch hat, so dass dieses Beispiel überall in der Welt nachgeahmt werde und zwar insbesondere in den großen Arbeiterzentren im Herzen des Kapitalismus.
In diesem Augenblick trägt alle Welt das Wort “Revolution” zur Beschreibung der Situation in Belgrad im Mund. Jedoch handelt es sich um ein Täuschungsmanöver. Der Sieg der “Demokratie”, d.h. der bürgerlichen Kräfte, ist nichts anderes als der Sieg der kapitalistischen Klasse und niemals derjenige des Proletariats.
Elfe, 7.10.2000
Erbe der kommunistischen Linke:
- Die nationale Frage [38]
Einführung zu: Anarchismus und Kommunismus
- 3969 Aufrufe
Der Anarchismus ist heute wieder im Aufwind. Sei es durch das Erscheinen und Wiedererstarken des Anarchosyndikalismus, sei es durch das Auftauchen verschiedenster kleiner Gruppen, die sich auf libertäre Ideen beziehen und in mehreren Ländern aus dem Boden spriessen. Sie geniessen auch die vermehrte Aufmerksamkeit der kapitalistischen Medien. Dies lässt sich durch die Besonderheiten der heutigen Zeit erklären.
Der Zusammenbruch der stalinistischen Regime Ende der 80er Jahre hat es der herrschenden Klasse erlaubt, eine bisher nie gesehene Kampagne über den “Tod des Kommunismus” zu entfesseln. Diese Kampagne hatte auch auf die Arbeiterklasse Auswirkungen, selbst auf Elemente, die das kapitalistische System ablehnen und auf dessen revolutionäre Überwindung hoffen. Laut den bürgerlichen Kampagnen bedeutet das Scheitern dessen, was als “Sozialismus” oder “Kommunismus” dargestellt wird, auch ein Scheitern der kommunistischen Ideen von Marx, welche die stalinistischen Regime zur offiziellen Ideologie erhoben (und dabei natürlich systematisch verfälscht) hatten.
Marx, Lenin und Stalin sind dasselbe Feindbild: ein während Jahren von allen Teilen der herrschenden Klasse abgedroschenes Thema. Und es ist auch exakt die Aussage, welche der Anarchismus während des ganzen 20. Jahrhunderts vertreten hat, seit in der UdSSR eines der barbarischsten Regime, die der dekadente Kapitalismus hervorgebracht hat, installiert wurde. Für die Anarchisten, die immer behauptet haben, der Marxismus sei von Natur aus autoritär, war die stalinistische Diktatur die logische Konsequenz der Ideen von Marx. In diesem Licht gesehen ist das heutige Wiederaufleben der anarchistischen und libertären Strömung eine Folge der bürgerlichen Kampagnen, ein Zeichen ihres Einflusses auf Elemente, die den Kapitalismus zwar ablehnen, den Lügen, die während der letzten zehn Jahre verbreitet wurden, aber auf den Leim kriechen. Diese Strömung, die sich als radikalster Gegner der bürgerlichen Ordnung gibt, verdankt einen grossen Teil ihres Erfolgs den Konzessionen, die sie gegenüber den klassischen Themen der bürgerlichen Ideologien heute und schon früher immer gemacht hat.
Es gibt aber heute auch viele Anarchisten und Libertäre, welche sich dabei nicht sehr wohl fühlen.
Einerseits haben sie Mühe, das Verhalten der grössten Organisation in der Geschichte des Anarchismus, der spanischen CNT, die den entscheidendsten Einfluss auf die Arbeiterklasse eines ganzen Landes hatte, zu akzeptieren. Es ist tatsächlich nicht einfach, sich auf die Erfahrung einer Organisation zu berufen, die nach jahrzehntelangem Aufruf zur “direkten Aktion”, der Denunzierung jeglicher Beteiligung am bürgerlichen parlamentarischen Spiel und aufrührerischen Reden gegen jede Form des Staates 1936 nichts besseres zu tun wusste, als vier Minister für die bürgerliche Regierung der Republik zu stellen und verschiedene Vertreter in die Regierung der “Generalitat” in Katalonien zu entsenden. Minister, die im Mai 1937, als sich die Arbeiter von Barcelona im Aufstand gegen die Politik dieser Regierung befanden (eine von den Stalinisten kontrollierte Politik), die Arbeiter dazu aufriefen, die Waffen niederzulegen und sich mit ihren Henkern zu “verbrüdern”. Mit andern Worten: Sie fielen den Arbeitern in den Rücken. Aus diesem Grund versuchen sich heute einige Libertäre auf Strömungen zu berufen, die aus dem Anarchismus oder der CNT selbst hervorgegangen sind, sich aber der verbrecherischen Politik der Zentrale widersetzt haben. Eine dieser Strömungen sind die “Freunde Durrutis”, die 1937 die offizielle Linie der spanischen CNT bekämpft haben, bis die CNT sie als Verräter bezeichnete und ihnen mit dem Ausschluss drohte. Um den Charakter dieser Strömung zu untersuchen veröffentlichen wir im Folgenden einen Artikel aus der Broschüre Spanien 1936 unserer IKS Sektion in Spanien.
Andererseits spüren Leute, die sich von libertären Ideen angezogen fühlen, die Inhaltslosigkeit der anarchistischen Ideologie (was nicht schwer fällt) und suchen nach anderen Bezugspunkten, mit denen sie diejenigen der klassischen Köpfe dieser Ideologie (Proudhon, Bakunin, Kropotkin, usw.) ergänzen können. Und auf welch bessere Referenz kann man dabei stossen als auf Marx, als dessen “Schüler” sich Bakunin einst selbst bezeichnet hatte. Angespornt vom Willen, die bürgerlichen Lügen, die den Marxismus für alles Schlechte behaften wollen was in Russland nach 1917 passierte, neigen sie dazu, Marx radikal Lenin gegenüberzustellen und fallen der Kampagne zum Opfer, die Stalin als den aufrechten Erben Lenins darstellt. Aus diesem Grund neigen sie auf der Suche nach einem “libertären Marxismus” zur Bezugnahme auf die Strömung der Deutsch-Hollänischen Linken. Deren bekannteste Theoretiker, Otto Rühle als Erster und danach Anton Pannekoek, hatten die Russischen Revolution von 1917 als eine bürgerliche Revolution bezeichnet, von einer bürgerlichen bolschewistischen Partei angeführt und durch einen bürgerlich-jakobinistischen Denker, Lenin, geleitet. Die Genossen der Deutsch-Holländischen Linken jedoch beriefen sich immer explizit auf den Marxismus, und keineswegs auf den Anarchismus, und haben alle Versuche abgelehnt, diese zwei Strömungen miteinander zu versöhnen. Dies hindert heute gewisse Anarchisten nicht daran, die Deutsch-Holländische Linke für sich in Anspruch zu nehmen, oder – oft auch ehrlich gemeint – einzelne Teile herauszunehmen und einen “libertären Marxismus” zu konstruieren, die unmögliche Synthese von Anarchismus und Marxismus.
IKS
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Geschichte der Arbeiterbewegung: Der Antifaschismus – eine Anleitung zur Konfusion
- 3150 Aufrufe
Was auch immer die spezifischen Gründe waren, die die österreichische Bourgeoisie dazu veranlassten, die “Faschisten” in die Regierung zu bringen[1] [40], dieses Ereignis hat sich als vorzügliche Gelegenheit für all ihre europäischen und amerikanischen Kompagnons angeboten, einer Mystifikation neues Leben einzuhauchen, die sich bereits als sehr wirksam gegen die Arbeiterklasse erwiesen hatte. In den vergangenen Jahren hatte sich die Kampagne gegen die “faschistische Gefahr” von nichts anderem nähren können als vom Wahlerfolg der Nationalen Front in Frankreich und von den Angriffen von Skinheadbanden gegen Immigranten. Selbst die Pinochet-Show konnte die Massen nicht mehr in ihrem Bann ziehen, seitdem der alte Diktator in den Ruhestand gegangen ist. Natürlich bot da der Eintritt einer “faschistischen” Partei in eine europäischen Regierung eine viel reichhaltigere Kost für solcherlei Kampagnen.
Als die Genossen von Bilan (die französischsprachige Publikation der linken Fraktion der Italienischen Kommunistischen Partei) den Text veröffentlichten, den wir nachfolgend neu auflegen, befanden sich in etlichen europäischen Ländern faschistische Regierungen an der Macht; Hitler war seit 1933 in Deutschland an der Macht. Doch sie verloren nicht den Kopf und ließen sich nicht von der Raserei des “Antifaschismus” anstecken, von der nicht nur die sozialistischen und stalinistischen Parteien ergriffen waren, sondern auch Strömungen, die der Degeneration der Kommunistischen Internationalen in den 20er Jahren Paroli geboten hatten, insbesondere die Trotzkisten. Bilan war in der Lage, klar und deutlich vor den Gefahren des Antifaschismus zu warnen – was sich auf dem Höhepunkt des spanischen Bürgerkrieges als prophetisch erweisen sollte. In Spanien war die faschistische Fraktion der Bourgeoisie nur deshalb in der Lage, das Proletariat, das sich angesichts des Franco-Putsches am 18. Juli 1936 bewaffnet hatte, zu unterdrücken, weil sich letzteres im Namen der Priorität des antifaschistischen Kampfes und der Notwendigkeit, eine Einheitsfront aller antifaschistischer Kräfte zu bilden, von seinem Klassenterrain, dem Terrain des unversöhnlichen Kampfes gegen die bürgerliche Republik, hat wegzerren lassen.
Die heutige Situation gleicht nicht jener in den 30er Jahren, als die Arbeiterklasse gerade die fürchterlichste Niederlage in ihrer Geschichte erlitten hatte, und zwar nicht durch den Faschismus, sondern durch die “demokratische” Bourgeoisie. Genau diese Niederlage ermöglichte es dem Faschismus, in bestimmten Ländern Europas an die Macht zu gelangen. Demzufolge können wir sagen, dass der Faschismus heute keine Notwendigkeit für den Kapitalismus besitzt. Nur indem sie die Unterschiede zwischen der heutigen Situation und jener in den 30er Jahren völlig ignorieren, können Strömungen, die behaupten, zur Arbeiterklasse zu gehören oder gar die Revolution zu favorisieren, wie die Trotzkisten, ihre Beteiligung an den Kampagnen gegen die “faschistische Bedrohung” rechtfertigen. In diesem Sinn bestand Bilan absolut zu Recht darauf, dass die Revolutionäre die Ereignisse innerhalb ihres historischen Zusammenhanges analysieren und dabei besonders das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen berücksichtigen müssen. Während der 30er Jahre entwickelte Bilan insbesondere gegen die Trotzkisten (die im Text als “Bolschewiki-Leninisten” bezeichnet werden, wie sich die Trotzkisten in den 30er Jahren selbst bezeichnet hatten) ihre Argumente. Damals waren die Trotzkisten noch Bestandteil der Arbeiterklasse, aber ihr Opportunismus sollte sie während des II. Weltkrieges in das bürgerliche Lager führen. Im Namen eben jenes Antifaschismus unterstützten die Trotzkisten den alliierten Imperialismus während des Krieges und traten dabei eines der fundamentalsten Prinzipien der Arbeiterbewegung mit Füßen: den Internationalismus. Dies vor Augen, bleiben die Argumente Bilans gegen die antifaschistischen Kampagnen, ihre Entlarvung der Gefahr, die der Antifaschismus für die Arbeiterklasse darstellt, auch heute vollkommen gültig. Die historische Lage hat sich verändert, aber die Lügen, die in der Arbeiterklasse verbreitet werden, um sie von ihrem Klassenterrain unter das Banner der demokratischen Bourgeoisie zu ziehen, bleiben grundsätzlich dieselben. Der Leser wird es nicht schwer haben, die “Argumente” wiederzuerkennen, die von Bilan angegriffen werden: Es sind exakt dieselben, die wir auch aus dem Munde heutiger Antifaschisten und besonders von denjenigen hören, die sich so revolutionär gebärden. Wir wollen hier zwei Passagen aus dem Text von Bilan als Beispiel zitieren.
“(...) ist die Position unserer Gegner, die das Proletariat dazu bewegen wollen, die am wenigsten schlechte Organisationsform des kapitalistischen Staates zu wählen, nicht mit jener von Bernstein identisch, der das Proletariat dazu aufrief, die beste Form des kapitalistischen Staates anzustreben?”
“(...) wenn das Proletariat wirklich stark genug ist, der Bourgeoisie seine Regierungsform aufzuzwingen, warum sollte es dann bei diesem Ziel haltmachen und nicht seine eigenen zentralen Forderungen nach Zerstörung des kapitalistischen Staates durchsetzen? Wenn aber im Gegenteil das Proletariat noch nicht stark genug ist, um sich zum Aufstand zu erheben, bedeutet dann nicht sein Vorwärtsdrängen zu einer demokratischen Regierung tatsächlich, es auf die falsche Fährte zu locken, was erst den Sieg des Feindes möglich macht?”
Schließlich antwortete Bilan auf all diejenigen, die behaupteten, der Antifaschismus sei ein Mittel, um “die Arbeiter zu sammeln”, dass das einzige Terrain, auf dem sich das Proletariat sammeln kann, jenes der Verteidigung seiner Klasseninteressen ist, das auch heute dasselbe ist, ganz gleich, wie das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen aussieht. “(...) da es nicht die Machtfrage stellen kann, muss sich das Proletariat in seinen Tageskämpfen um begrenztere, aber immer noch klassenmäßige Ziele scharen (...) Statt sich der langfristigen Änderung der Arbeiterforderungen zu widmen, ist es die vordringliche Pflicht der Kommunisten, die Regruppierung der Arbeiterklasse um ihre Klassenforderungen und innerhalb ihrer Klassenorganisationen, den Gewerkschaften, zu betreiben.”
Im Gegensatz zur deutsch-holländischen Linken hatten die italienischen Linkskommunisten damals noch nicht die Frage der Gewerkschaften geklärt. Denn seit der Zeit des I. Weltkrieges waren die Gewerkschaften unwiderruflich zu Organen des kapitalistischen Staates geworden. Doch dies stellt in keiner Weise die Positionen in Frage, die von Bilan vertreten wurden, als sie die Arbeiter dazu aufrief, sich um ihre eigenen Klassenforderungen zu sammeln. Diese Position bleibt auch heute vollkommen gültig, wo jede Fraktion der Bourgeoisie die Arbeiter dazu auffordert, jenes kostbare Gut, die Demokratie, zu verteidigen – ob gegen den Faschismus oder gegen jeden Versuch, eine neue Revolution zu unternehmen, die nur zu einer Rückkehr desselben Totalitarismus führe, der zehn Jahre zuvor in den sog. “sozialistischen” Ländern zusammengebrochen sei.
In diesem Sinn wendet der nachfolgend abgedruckte Artikel von Bilan dieselbe Vorgehensweise bei der Entlarvung der demokratischen Lügen an, wie dies auch in unserer Veröffentlichung von Lenins Thesen Über die bürgerliche Demokratie und die proletarische Diktatur in der vorherigen Ausgabe der International Review geschah (siehe International Review Nr. 100, engl./franz./span. Ausgabe).
BILAN Nr. 7, Mai 1934
Der Antifaschismus - eine Anleitung zur Konfusion
Auf dem Tiefstand der Revolution ist die gegenwärtige Lage ganz offensichtlich verwirrender als sonst. Dies ist das Resultat einerseits der konterrevolutionären Entwicklung all der Stützpunkte, die das Proletariat in einem bitteren Kampf nach dem Krieg erobert hatte (der russische Staat, die III. Internationale), und andererseits der Unfähigkeit der Arbeiter, in einer ideologischen und revolutionären Widerstandsfront dieser Entwicklung entgegenzutreten. Die Arbeiter haben mit Kämpfen und manchmal mit großartigen Schlachten (Österreich) auf die Kombination dieses Phänomens mit der brutalen Offensive des Kapitalismus reagiert, die auf die Bildung von Bündnissen angesichts des drohenden Krieges ausgerichtet ist. Aber diese Schlachten sind daran gescheitert, die Macht des Zentrismus, der einzigen politischen Massenorganisation, zu erschüttern, der sodann zu den Kräften der weltweiten Konterrevolution überlief.
In solch einem Moment der Niederlage ist die Konfusion nur ein Resultat, das der Kapitalismus erzielt, indem er sich zu seinem eigenen Schutz den Arbeiterstaat und den Zentrismus einverleibt, die er auf dasselbe Terrain führt, das seit 1914 von den hinterhältigen Kräften der Sozialdemokratie besetzt ist, dem wichtigsten Agenten der Auflösung des Massenbewusstseins und Sprecher der Parolen der proletarischen Niederlage und des kapitalistischen Sieges.
In diesem Artikel werden wir eine typische Formel der Konfusion untersuchen: etwas, was – auch unter Arbeitern, die sich selbst als links betrachten – “Antifaschismus” genannt wird (...) Zugunsten der Klarheit wollen wir hier uns auf ein Problem beschränken: den Antifaschismus und die Einheitsfront, die sich unter dieser Parole angeblich errichten lässt.
Es ist elementar – besser: es ist üblich – festzustellen, dass, bevor man sich in einer Klassenauseinandersetzung engagiert, es nötig ist, die Ziele, die man im Auge hat, die Methoden, die man benutzen will, und die Klassenkräfte zu nennen, die zu unserem Gunsten intervenieren können. Es ist nichts “Theoretisches” an diesen Betrachtungen, und trotzdem meinen wir, dass sie für die oberflächliche Kritik all jener Elemente unzugänglich sind, die in der Regel die theoretische Klärung ignorieren und mit jedem ins Bett steigen, an jeder Bewegung teilhaben, solange es “eine Aktion” gibt. Natürlich gehören wir zu denjenigen, die denken, dass die Aktion nicht einem Wutanfall oder dem guten Willen von Individuen entspringt, sondern aus der Situation selbst entsteht. Darüber hinaus ist für die Aktion die theoretische Arbeit unerlässlich, um die Arbeiterklasse vor neuen Niederlagen zu bewahren. Und wir müssen die Bedeutung der Geringschätzung begreifen, die so viele Militante gegenüber der theoretischen Arbeit an den Tag legen, denn in Wahrheit geht dies in jenen revolutionären Milieus stets – ohne es auszusprechen – mit der Ersetzung proletarischer Positionen durch die Prinzipien des Feindes Sozialdemokratie einher, wobei gleichzeitig zu Aktionen um jeden Preis im “Rennen” gegen den Faschismus aufgerufen wird.
So weit es das Problem des Antifaschismus angeht, so werden seine zahllosen Anhänger nicht nur von einer Geringschätzung der theoretischen Arbeit begleitet, sondern auch von einer dummen Manie der Schaffung und Verbreitung von Verwirrung, die notwendig ist, um eine breite Widerstandsfront zu errichten. Es darf keine Grenze geben, die auch nur einen einzigen Verbündeten abschrecken oder die geringste Möglichkeit zum Kampf auslassen könnte: Dies ist die Parole des Antifaschismus. Hier sehen wir, dass von letzterem die Konfusion idealisiert und als Element des Sieges betrachtet wird. Hier sollten wir uns vergegenwärtigen, dass mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor Marx zu Weitling gesagt hatte, dass die Ignoranz niemals der Arbeiterbewegung in irgendeiner Weise gedient hat.
Statt heute das Ziel des Kampfes, die Methoden, die benutzt werden sollen, und das notwendige Programm abzustecken, wird die Quintessenz der marxistischen Strategie (die Marx als Ignoranz bezeichnet hätte) so dargestellt: Man nehme ein Adjektiv – heute ist “leninistisch” das gebräuchlichste – und rede endlos und völlig zusammenhanglos über die Lage in Russland 1917 und Kornilows Septemberoffensive. O weh! Es soll eine Zeit gegeben haben, in der die Revolutionäre ihre Köpfe noch auf den Schultern trugen und die historische Erfahrung analysierten. Daraufhin bestimmten sie zunächst, ob es möglich ist, eine politische Parallele zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart zu ziehen, bevor sie versuchten, eine Analogie zwischen der Lage in ihrer eigenen Epoche und jenen Erfahrungen herzustellen. Doch solche Zeiten sind vergangen, besonders wenn wir die übliche Phraseologie proletarischer Gruppen betrachten.
Uns wird gesagt, dass es keinen Anlass gebe, einen Vergleich zwischen der Situation des Klassenkampfes in Russland 1917 und heute in anderen Ländern zu ziehen. Ähnlich gebe es keinen Anlass zu entscheiden, ob das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen damals Ähnlichkeiten mit dem von heute aufweist. Der Sieg des Oktobers 1917 sei eine historische Tatsache, so dass alles, was wir zu tun hätten, darin bestehe, die Taktiken der russischen Bolschewiki zu kopieren und vor allem eine ganz schlichte Kopie anzufertigen, die entsprechend der verschiedenen Milieus variiert, die die Ereignisse auf der Basis radikal gegensätzlicher Auffassungen interpretieren.
Diejenigen, die sich heute selbst “Leninisten” nennen, lassen sich nicht im Geringsten von der Tatsache stören, dass der Kapitalismus in Russland 1917 seine erste Erfahrung mit der Staatsmacht gemacht hatte, während der Faschismus im Gegensatz dazu aus einem Kapitalismus herauskroch, der seit Jahrzehnten an der Macht ist, und dass die explosive revolutionäre Lage in Russland 1917 überhaupt nicht mit der reaktionären Situation von heute vergleichbar ist. Im Gegenteil: Ihre erstaunliche Gelassenheit kann nicht einmal durch einen Vergleich der Ereignisse von 1917 mit denen von heute erschüttert werden, der auf einer ernsthaften Auseinandersetzung mit den deutschen und italienischen Erfahrungen basiert. Kornilow ist die Antwort auf alles. Die Siege von Mussolini und Hitler werden allein den Abweichungen der kommunistischen Parteien von den klassischen Taktiken der Bolschewiki 1917 zugeschrieben, dies mittels einer politischen Akrobatik, die zwei entgegengesetzte Situation zusammenwirft: die revolutionäre und die reaktionäre.
* * *
So weit es den Antifaschismus angeht, so gehen politische Überlegungen an ihm vorbei. Seine Absicht ist es, alle diejenigen, die von faschistischen Angriffen bedroht sind, in einer Art “Gewerkschaft der Bedrohten” zu sammeln.
Die Sozialdemokraten raten den Radikal-Sozialisten, sich um ihre eigene Sicherheit zu kümmern und sofort Abwehrmaßnahmen gegen die faschistische Bedrohung zu ergreifen, nachdem Herriot und Daladier ebenfalls Opfer eines faschistischen Sieges wurden. Leon Blum geht sogar noch weiter, indem er Doumergue eindringlich davor warnt, dass ihm dasselbe Schicksal blüht wie Brüning, wenn er nicht achtgibt auf den Faschismus. Der Zentrismus wandte sich an die “sozialistische Basis” bzw. der SFIO an den Zentrismus, um eine Einheitsfront zu bilden, da beide, Sozialisten wie Kommunisten, vom Faschismus bedroht seien. Schließlich gibt es noch die Bolschewiki-Leninisten, die in ihrer Wut großmäulig allen und jedem verkünden, dass sie bereit sind, eine Kampffront zu schaffen, frei von politischen Rücksichten, auf der Grundlage einer dauerhaften Solidarität unter allen Arbeiter(?)gruppierungen gegen die Aktivitäten der Faschisten.
Der Gedanke, der hinter diesen Spekulationen steckt, ist sicherlich ganz simpel – zu einfach, um wahr zu sein: Man bringe alle diejenigen, die bedroht und von demselben Wunsch, nämlich den eigenen Tod zu vermeiden, getrieben sind, in einer allgemeinen antifaschistischen Front zusammen. Doch selbst die oberflächlichste Analyse wird aufzeigen, dass die idyllische Einfachheit dieses Vorschlags in Wahrheit die völlige Abschaffung der fundamentalen Positionen des Marxismus verbirgt, die Leugnung der vergangenen Ereignisse und der Bedeutung der heutigen Ereignisse. (...)
Aber all die Predigten darüber, was die Radikalen, Sozialisten und Zentristen unternehmen wollen, um ihre eigene Haut und ihre Institutionen zu retten, werden nichts am Verlauf der Ereignisse ändern, da das wahre Problem darauf hinausläuft: Wie ist es möglich, Radikale, Sozialisten und Zentristen in Kommunisten umzuwandeln, wenn der Kampf gegen den Faschismus nur auf der Kampffront für die proletarische Revolution beruhen kann? Ganz gleich, wieviel Predigten noch verkündet werden, die belgische Sozialdemokratie wird weiterhin ihre Pläne auf die Bewahrung des Kapitalismus ausrichten, wird weiterhin nicht zögern, jeden Klassenkonflikt zu torpedieren, in einem Wort: Sie wird nicht zögern, die Gewerkschaften dem Kapitalismus auszuliefern. Doumergue wird Brüning nacheifern, Blum wird in die Fußstapfen Bauers treten, Cachin in jene von Thälmann.
Wir wiederholen, unsere Absicht in diesem Artikel ist es nicht festzustellen, ob die Lage in Frankreich oder Belgien mit den Umständen verglichen werden kann, die die Machtergreifung des Faschismus in Italien und Deutschland ermöglichten. Uns geht es hier vor allem um die Tatsache, dass, unter Berücksichtigung ihrer Funktion in zwei ziemlich verschiedenen kapitalistischen Ländern, Doumergue eine Kopie von Brüning ist und dass diese Funktion (wie dies auch für Blum und Cachin gilt) darin besteht, das Proletariat zur Unbeweglichkeit zu verdammen, sein Klassenbewusstsein aufzulösen und so zu ermöglichen, den Staatsapparat den neuen Umständen des interimperialistischen Kampfes anzupassen. Es gibt genug Anlass anzunehmen, dass besonders in Frankreich die Erfahrungen mit Thiers, Clémenceau und Poincaré unter Doumergue wiederholt werden und dass wir eine Konzentration des Kapitalismus um seinen rechten Flügel sehen werden, ohne damit zu sagen, dass die sozialistischen und radikal-sozialistischen Kräfte der Bourgeoisie dabei stranguliert werden. Zudem ist es völlig falsch, proletarische Taktiken auf politischen Positionen aufzubauen, die von einer bloßen Perspektive ausgehen.
Es geht daher nicht darum, eine vereinigte “antifaschistische Front” aufzustellen, sobald der Faschismus droht. Im Gegenteil, es ist notwendig, die Positionen so zu gestalten, dass sie das Proletariat für seinen Kampf gegen den Kapitalismus zusammenfassen. So gesehen, bedeutet dies den Ausschluss der antifaschistischen Kräfte aus der Kampffront gegen den Kapitalismus. Es bedeutet – auch wenn dies paradox erscheinen mag –, dass dann, wenn sich der Kapitalismus endgültig dem Faschismus zuwenden sollte, die Bedingung für den Erfolg in der Unveränderlichkeit des Programms und der Forderungen der Arbeiterklasse besteht, wohingegen die Voraussetzung für die sichere Niederlage die Auflösung des Proletariats im antifaschistischen Sumpf ist.
* * *
Die Tat des Einzelnen und gesellschaftlicher Kräfte wird nicht durch Gesetze zum Schutz des Einzelnen oder gesellschaftlicher Kräfte außerhalb jeder klassenmäßigen Berücksichtigung bestimmt: Brüning und Matteoti konnten nicht handeln, wie es ihren persönlichen Interessen oder den von ihnen vertretenen Ideen entsprach, und einfach den Weg zur proletarischen Revolution einschlagen, der allein in der Lage gewesen wäre, sie vor dem Faschismus zu bewahren. Die Handlung des Einzelnen oder gesellschaftlicher Kräfte geschieht als eine Funktion jener Klasse, der sie angehören. Dies erklärt, warum die gegenwärtigen Akteure der französischen Politik bloß in die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten und auch damit fortfahren würden, wenn der französische Kapitalismus sich dem Faschismus zuwenden würde.
Die grundlegende Formel des Antifaschismus (die “Gewerkschaft der Bedrohten”) entlarvt sich somit als völlig unzureichend. Mehr noch, wenn wir die Ideen des Antifaschismus (wenigstens was sein Programm angeht) näher untersuchen, finden wir schnell heraus, dass sie auf der Trennung von Kapitalismus und Faschismus basieren. Sicher, wenn wir einen Sozialisten, einen Zentristen oder einen Bolschewiki-Leninisten zum Thema befragen, werden sie uns erklären, dass Faschismus in der Tat Kapitalismus sei. Aber die Sozialisten werden sagen: “Wir müssen die Verfassung und die Republik verteidigen, um uns auf den Sozialismus vorzubereiten”; die Zentristen werden erklären, dass es viel einfacher sei, den Klassenkampf der Arbeiter um den Antifaschismus als um den Kampf gegen den Kapitalismus zu organisieren, während gemäß den Bolschewiki-Leninisten es keine bessere Grundlage für die Einheit und den Kampf gibt als die Verteidigung der demokratischen Institutionen, welche der Kapitalismus der Arbeiterklasse nicht mehr zugestehen kann. Es läuft also darauf hinaus, dass die allgemeine Erklärung, wonach “Faschismus gleich Kapitalismus” ist, zu politischen Schlussfolgerungen führen kann, die nur aus der Trennung zwischen Kapitalismus und Faschismus herrühren können.
Die Erfahrung hat gelehrt – und dies macht jede Möglichkeit einer Unterscheidung zwischen Faschismus und Kapitalismus zunichte –, dass die Hinwendung des Kapitalismus zum Faschismus nicht von dem Willen bestimmter Gruppen innerhalb der bürgerlichen Klasse abhängt, sondern von den Notwendigkeiten einer ganzen historischen Periode und den Besonderheiten gewisser Staaten, die noch weniger als andere in der Lage sind, der Krise und dem Todeskampf des bürgerlichen Regimes zu trotzen. Sofern es überhaupt möglich ist, eine völlige Trennung vorzunehmen, zeigt uns die Erfahrung von Italien und Deutschland, dass, wenn der Kapitalismus gezwungen ist, sich in Richtung einer faschistischen Organisation der Gesellschaft zu bewegen, die faschistischen Bataillone die Terrortruppen bilden, die sich gegen die Klassenorganisationen des Proletariats richten. Die demokratischen Gruppierungen der Bourgeoisie erklären daraufhin ihre Opposition zum Faschismus, mit der Absicht, das Proletariat dazu zu überreden, die Verteidigung dieser Institutionen den demokratischen Gesetzen und der Verfassung anzuvertrauen. Die Sozialdemokratie, die auf derselben Linie wie die liberalen und demokratischen Kräfte agiert, ruft das Proletariat auch dazu auf, es zu seiner zentralen Forderung zu machen, dass der Staat die faschistischen Kräfte dazu zwingen möge, das Gesetz zu respektieren, dass er sie entwaffnet oder gar für illegal erklärt. Die Handlungslinie dieser drei politischen Kräfte befindet sich in völliger Harmonie: Ihr Ursprung liegt in der Notwendigkeit des Kapitalismus, den Triumph des Faschismus durchzusetzen, wo immer der kapitalistische Staat beabsichtigt, den Faschismus zur neuen Form der kapitalistischen Organisation der Gesellschaft zu erheben.
Da der Faschismus den fundamentalen Bedürfnissen des Kapitalismus entspricht, müssen wir eine Möglichkeit finden, an einer radikal anderen Front dagegen zu kämpfen. Es trifft zu, dass wir heute oft unsere Positionen von unseren Gegnern verfälscht sehen, weil letztere sie nicht politisch bekämpfen wollen. Zum Beispiel hatten wir uns kaum der antifaschistischen Parole (die keine politische Basis besitzt) widersetzt, weil die Erfahrung lehrt, dass die antifaschistischen Kräfte genauso notwendig für den Sieg des Faschismus sind wie die faschistischen Kräfte selbst, da wurde uns erzählt: “Wir kümmern uns nicht darum, die politische und programmatische Substanz des Antifaschismus zu analysieren; worauf es ankommt, ist, dass Daladier gegenüber Doumergue vorzuziehen ist, dass der letztere Maurras vorzuziehen ist und dass es in unserem konsequenten Interesse ist, Daladier gegen Doumergue oder Doumergue gegen Maurras zu verteidigen. Oder entsprechend den Umständen entweder Daladier oder Doumergue zu verteidigen, weil sie ein Hindernis für den Sieg von Maurras sind, und unsere Pflicht ist es, ‚die kleinste Unstimmigkeit zu nutzen, um eine stärkere Position für das Proletariat zu erlangen‘”. Natürlich sind die Ereignisse in Deutschland – wo die “Unstimmigkeiten” zunächst der preußischen, dann der Hindenburg-von Schleicher-Regierung nicht anderes waren als Meilensteine beim Aufstieg des Faschismus – bloße Bagatellen, die ignoriert werden können. Unsere Interventionen werden natürlich als anti-leninistisch und anti-marxistisch gebrandmarkt: Uns wird gesagt, dass wir zu undifferenziert in der Frage sind, ob eine Regierung rechts, links oder faschistisch ist. Was dies anbetrifft, möchten wir gern ein für alle Mal folgende Frage stellen: Wenn wir die Veränderungen in der Nachkriegslage berücksichtigen, ist die Position unserer Gegner, die das Proletariat dazu bewegen wollen, die am wenigsten schlechte Organisationsform des kapitalistischen Staates zu wählen, nicht identisch mit jener von Bernstein, der das Proletariat dazu aufrief, die beste Form des kapitalistischen Staates anzustreben? Uns wird womöglich gesagt, dass die Idee nicht laute, das Proletariat aufzufordern, Partei für die Regierung zu ergreifen, die als die beste Herrschaftsform ... vom proletarischen Standpunkt aus anerkannt ist, sondern dass es einfach das Ziel sei, die Position des Proletariats so weit zu stärken, bis es eine demokratische Regierungsform des Kapitalismus durchsetzen kann. In diesem Fall brauchen wir nur die Wörter austauschen, die Bedeutung bleibt immer dieselbe. Doch wenn das Proletariat stark genug ist, um der Bourgeoisie seine Regierungswahl aufzuzwingen, warum soll es dann bei diesem Ziel haltmachen und nicht seine eigenen zentralen Forderungen nach Zerstörung des kapitalistischen Staates durchsetzen? Und wenn das Proletariat im Gegenteil noch nicht stark genug ist, um sich zum Aufstand zu erheben, bedeutet dann nicht das Vorwärtsdrängen zu einer demokratischen Regierung tatsächlich, das Proletariat auf die falsche Fährte zu locken, was erst den Sieg des Feindes möglich macht?
Bei dem Problem handelt es sich sicherlich nicht um dasjenige, das uns die Anhänger der “besten Wahl” schmackhaft machen wollen: Das Proletariat hat seine eigene Lösung für das Problem des Staates und besitzt keinerlei Einfluss auf die Lösungen, zu denen der Kapitalismus bei seiner Machtfrage greift. Es ist logischerweise offensichtlich, dass es zu seinem Vorteil wäre, sehr schwache bürgerliche Regierungen zu haben, die die Entfaltung des revolutionären Kampfes des Proletariats ermöglichen würde. Aber es ist gleichermaßen offensichtlich, dass der Kapitalismus linke oder annähernd linke Regierungen nur bildet, wenn diese in einer gegebenen Situation am besten in seine Verteidigungslinie passen. 1917-21 kam die Sozialdemokratie an die Macht, um das bürgerliche Regime zu verteidigen, und war die einzige Regierungsform, die es möglich machte, die proletarische Revolution zu zerschlagen. Angenommen, eine rechte Regierung hätte die Arbeitermassen zu einem Aufstand getrieben, sollten die Marxisten dann eine reaktionäre Regierung empfehlen? Wir greifen zu dieser Hypothese, um zu zeigen, dass es keine Regierungsform gibt, die im allgemeinen besser oder schlechter für das Proletariat ist. Diese Attribute existieren nur für den Kapitalismus und sind abhängig von der jeweiligen Situation. Im Gegenteil, die Arbeiterklasse hat die absolute Pflicht, den Kapitalismus zu bekämpfen, welche konkrete Form er auch annehmen mag: eine faschistische, demokratische oder sozialdemokratische.
Die erste wesentliche Überlegung in der heutigen Situation besteht darin zu sagen, dass sich die Machtfrage nicht unmittelbar für die Arbeiterklasse stellt und dass einer der schrecklichsten Ausdrücke dieser Situation die Entfesselung der faschistischen Gewalt und die Bewegung der Demokratie hin zu Notstandsregierungen ist. Daraus folgt, dass wir die Grundlage bestimmen müssen, auf der sich die Arbeiterklasse umgruppieren kann. Und hier trennt eine wirklich strenge Auffassung die Marxisten von all den Verwirrten und feindlichen Agenten und ihrem Treiben innerhalb der Arbeiterklasse. Für uns ist die Umgruppierung der Arbeiter ein Problem der Quantität: Da es nicht die Machtfrage stellen kann, muss sich das Proletariat in seinen Tageskämpfen um begrenztere, aber immer noch klassenmäßige Ziele scharen. Die anderen, deren Extremismus reiner Bluff ist, verfälschen die Klassensubstanz des Proletariats, indem sie sagen, dass es in jeder Periode um die Macht kämpfen könne. Unfähig, die Frage einer Klassen– d.h. proletarischen Basis zu stellen, verwässern sie sie, indem sie die Frage nach einer antifaschistischen Regierung stellen. Wir möchten noch hinzufügen, dass die Partisanen der Auflösung des Proletariats im antifaschistischen Sumpf natürlich dieselben sind, die die Bildung einer proletarischen Klassenfront zur Erkämpfung eigener ökonomischer Forderungen behindern.
Frankreich hat in den vergangenen Monaten ein Aufblühen von antifaschistischen Programmen, Plänen und Organismen gesehen. Dies hat Doumergue absolut nicht daran gehindert, mit einer massiven Kürzung der Gehälter und Pensionen ein Signal für die Lohnkürzungen zu geben, welche der französische Kapitalismus durchaus auf breiter Ebene einzuführen gedenkt. Wenn nur ein Hundertstel der Energie, die für den Antifaschismus aufgewendet wird, für die Bildung einer soliden Arbeiterfront für einen Generalstreik bei der Verteidigung der unmittelbaren ökonomischen Forderungen aufgeboten worden wäre, dann stünde absolut sicher, dass einerseits die Repressionsdrohung nicht in die Tat umgesetzt worden wäre und andererseits das Proletariat, wenn es erst einmal neu gruppiert ist, sein Selbstvertrauen wiederentdeckt haben würde. Dies würde umgekehrt eine veränderte Situation schaffen, in der die Machtfrage erneut in der einzigen Form, die sie für die Arbeiterklasse annehmen kann – die Diktatur des Proletariats –, gestellt werden kann.
Aus all diesen elementaren Überlegungen folgt, dass die einzige Rechtfertigung für den Antifaschismus die Existenz einer antifaschistischen Klasse wäre: Nur aus dem solch einer Klasse innewohnenden Programm könnte ein antifaschistisches Programm folgen. Wenn wir uns außerstande sehen, solch eine Schlussfolgerung zu ziehen, so nicht nur dank der einfachsten Sätze des Marxismus, sondern auch wegen der Situation in Frankreich im einzelnen. Sofort werden wir mit dem Frage konfrontiert, wo der Antifaschismus rechts aufhört. Bei Doumergue, der angeblich die Republik verteidigt? Bei Herriot, der am “Waffenstillstand” teilhatte, welcher Frankreich vor dem Faschismus bewahrte, bei Marquet, der das “Auge des Sozialismus” in der Nationalen Einheit zu repräsentieren behauptet, bei den Jungtürken der Radikalen Partei oder schon bei den Sozialisten? Oder beim Teufel selbst, der dafür sorgt, dass die Hölle mit Antifaschisten gepflastert ist? Wenn man die Frage konkret stellt, zeigt sich, dass die Parole des Antifaschismus lediglich den Interessen der Konfusion dient und die sichere Niederlage der Arbeiterklasse bedeutet.
Statt sich der langfristigen Änderung der Arbeiterforderungen zu widmen, ist es die vordringliche Pflicht der Kommunisten, die Umgruppierung der Arbeiterklasse um ihre Klassenforderungen und innerhalb ihrer Klassenorganisationen, den Gewerkschaften, zu betreiben (...) Wir berufen uns selbst dabei nicht auf die formelle Idee der Gewerkschaft, sondern auf die grundsätzliche Überlegung, dass – wie wir bereits gesagt haben – es, da sich heute die Machtfrage nicht stellt, notwendig ist, beschränktere Ziele anzustreben, die dennoch Klassenziele für den Kampf gegen den Kapitalismus sind. Und der Antifaschismus schafft die Bedingungen, unter denen nicht nur die politischen und ökonomischen Mindestforderungen der Arbeiterklasse erstickt, sondern die Chancen eines revolutionären Kampfes aufs Spiel gesetzt werden. Und ehe ihre Fähigkeit, eine revolutionäre Schlacht für den Aufbau der Gesellschaft von Morgen zu führen, sich wieder erholt hat, findet sich die Arbeiterklasse bereits selbst als Opfer des imperialistischen Krieges wieder.
[1] [40] Es ist nicht die Absicht dieses Artikels, die Gründe für den Eintritt der FPÖ in die österreichische Regierung im Detail zu analysieren – wir verweisen unsere Leser auf unsere territoriale Presse. Kurz gesagt, hat die gegenwärtige Aufmachung der Regierung den enormen Vorteil, dass die SPÖ (Sozialdemokratische Partei Österreichs) die Gelegenheit erhält, sich nach etlichen Jahrzehnten an der Regierung einer Frischzellenkur in der Opposition zu unterziehen, während gleichzeitig der Einfluss der FPÖ, deren Erfolg größtenteils auf ihrem Image als eine von jedem Kompromiss unbefleckte Partei beruhte, unterminiert wird. Die italienische Bourgeoisie hat bereits gezeigt, wie durch die Wiederverwertung der alten neofaschistischen MSI durch die Berlusconi-Regierung diese Art von Manöver läuft.
Geographisch:
- Europa [30]
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Die "Einheitsfront" [43]
Wirtschaftskrise: 30 Jahre offene Krise des Kapitalismus
- 6379 Aufrufe
Die 90er Jahre
Der dritte Teil dieser Geschichte der kapitalistischen Krise ist der Dekade der 90er Jahre gewidmet. Dieses Jahrzehnt hat sich noch nicht dem Ende genähert, und allein die letzten 30 Monate gestalteten sich auf ökonomischer Ebene schon als besonders ernst[1] [44].
Das letzte Jahrzehnt erlebte den Kollaps aller Modelle des ökonomischen Managements, die der Kapitalismus als Allheilmittel und Lösung seiner Krise präsentiert hat: 1989 fand die Auflösung des stalinistischen Modells statt, das die Bourgeoisie als ”Kommunismus” darstellte, um so die Lüge vom ”Triumph des Kapitalismus” besser verkaufen zu können. Seitdem kippten, auch wenn etwas diskreter, nacheinander das deutsche, japanische, schwedische und schweizerische Modell, und schließlich brachen die ”Tiger” und ”Drachen” einer nach dem anderen zusammen. Diese Kette von Fehlschlägen demonstriert, dass der Kapitalismus keine Lösung für seine historische Krise besitzt und dass all die Jahre des Schwindels und der Manipulationen der ökonomischen Gesetze die Lage nur noch schlimmer gemacht haben.
Der Zusammenbruch des Ostblocks und die Weltrezession von 1991-93
Der Untergang der Länder des alten russischen Blocks[2] [44] war eine echte Katastrophe: Zwischen 1989 und 1993 fiel die Produktion regelmäßig um 10 bis 30 Prozent. Zwischen 1989 und 1993 verlor Russland 70% seiner produzierenden Industrie! Während sich das Tempo dieses Sturzes mittlerweile etwas verlangsamt hat, bleibt die Leistungsbilanz dennoch verheerend: In Ländern wie Bulgarien, Rumänien und Russland sind die Zahlen negativ, nur in Polen, Ungarn und Tschechien sind sie positiv.
Der Kollaps der Wirtschaft dieser Länder, die mehr als ein Sechstel der Erdoberfläche bedecken, ist – zumindest in ”Friedenszeiten” - der schlimmste im 20. Jahrhundert gewesen. Hinzugefügt werden sollte die Liste der Opfer der 80er Jahre: die Mehrheit der afrikanischen Länder und eine reichliche Anzahl von asiatischen, karibischen, mittel- und südamerikanischen Ländern. Die Fundamente der kapitalistischen Reproduktion erlitten eine neue und schwer wiegende Zerrüttung. Jedoch war der Zusammenbruch des ehemaligen Ostblocks kein isoliertes Ereignis; er war nur der Vorbote neuer Verwerfungen der Weltwirtschaft: Nach fünf Jahren der Stagnation und Finanzkrisen (s. unseren vorherigen Artikel) wurden Ende 1990 die Hauptindustrieländer von der Rezession erfasst:
- Den Vereinigten Staaten ereilte zwischen 1989 und 1990 eine Verlangsamung des Wachstums (von 2 auf 0,5%), dessen Rate 1991 negativ wurde (-0,8%).
- Großbritannien wurde von der seit 1945 schlimmsten Rezession heimgesucht, die bis 1993 anhielt.
- In Schweden erwies sich die Rezession als heftigste in der Nachkriegszeit und führte zu einer Situation der Semi-Stagnation (das famose ”Schwedische Modell” verschwand aus den Textbüchern).
- Zwar verzögerte sich die Rezession in Deutschland und in anderen Ländern Westeuropas, doch Mitte 1992 explodierte sie auch dort und dauerte bis 1993/94. 1993 sank die Industrieproduktion Deutschlands um 8,3%; in den Ländern der EU schrumpfte sie um insgesamt ein Prozent.
- Japan stürzte ab 1990 in den Zustand einer sich allmählich entfaltenden Rezession: Das durchschnittliche Wachstum betrug während der Periode von 1990-97 erbärmliche 1,2%, und dies trotz der Tatsache, dass die Regierung elf Förderungsprogramme aufgelegt hatte!
- Die Arbeitslosigkeit erreichte neue Rekorde. Dies wird anhand einiger Zahlen deutlich genug:
- 1991 wurden in den 24 Ländern der OECD sechs Millionen Arbeitsplätze vernichtet.
- Zwischen 1991 und 1993 wurden in den zwölf Ländern der Europäischen Union 8 Millionen Arbeitsplätze abgebaut.
- 1992 erreichte die Arbeitslosigkeit in Deutschland Ausmaße, wie sie seit den 30er Jahre nicht mehr erblickt worden waren, und stieg, weit entfernt davon zu fallen, seitdem weiter an, um 1994 die 4-Millionen- und 1995 die 5-Millionen-Grenze zu überschreiten.
Betrachtet man nur den Fall der Produktionszahlen, so scheint die Rezession von 1991-93 etwas milder ausgefallen zu sein wie jene von 1974-75 oder 1980-82, doch es gibt eine Reihe von Elementen, die das Gegenteil beweisen:
- Anders als die früheren Rezessionen wurde kein Bereich von der Krise ausgespart.
- Die Rezession traf die Rüstungs- und Computersektoren, die bis dahin nicht betroffen waren, besonders hart. 1991 entließ IBM 20.000 Arbeiter (1993 waren es bereits 80.000), NCR entließ 18.000, Digital Equipment 10.000, Wang 8.000 etc. 1993 plante die modernisierte und mächtige deutsche Autoindustrie 100.000 Entlassungen
- Dies verlieh Phänomenen Vorschub, die in früheren Rezessionen nicht beobachtet wurden. Letztere waren entstanden, weil die mit der Gefahr der Inflation konfrontierten Regierungen die Kreditquellen schlossen. Ganz im Gegensatz dazu versuchten sie in der Rezession von 1991-93, die Wirtschaft mit beträchtlichen Kreditspritzen zu stimulieren- und scheiterten. ”Anders als in den Rezessionen von 1967, 1970, 1974-75, 1980-82 bewirkt der Anstieg im Geldvolumen, das direkt vom Staat geschaffen wird (Banknoten und Geldmünzen, die von den Zentralbanken herausgegeben werden) keinen Anstieg mehr im Volumen der Bankkredite. Die amerikanische Regierung hat das Gaspedal durchgedrückt, doch die Banken haben nicht reagiert.” (International Review, Nr. 70, ”Eine Rezession anders als ihre Vorgänger”) So senkte die Federal Reserve der Vereinigten Staaten zwischen 1989 und 1992 die Zinsraten 22 Mal, von 10 auf 3% (ein Niveau, das niedriger ist als die Inflationsrate, was bedeutet, dass das Geld, das den Banken geliehen wurde, praktisch zinslos war), doch die Wirtschaft zu stimulieren bewirkte dies nicht. Es handelt sich hierbei um, wie die Experten es nennen, die ”Schuldenfalle”.
-Dies verursachte einen größeren Ausbruch der Inflation. Die Zahlen für 1989-90 betragen:
USA 06,0%
Großbritannien 10,4%
EG 06,1%
Brasilien 1800%
Bulgarien 70%
Polen 50%
Ungarn 40%
UdSSR 34%
In der Rezession von 1991-93 drohte die Rückkehr jener gefürchteten Kombination, die den bürgerlichen Regierungen in 70er Jahren so viel Sorgen bereitet hatten: Rezession und Inflation bzw. ”Stagflation”. Es zeigt ganz allgemein, dass das ”Krisenmanagement”, das wir im ersten Artikel dieser Reihe analysiert hatten, die kapitalistischen Gebrechen weder überwinden noch lindern kann, sondern nichts anderes tun kann, als sie aufzuschieben, mit der Folge, dass jede neue Rezession um so schlimmer wird. So offenbarte die Rezession von 1991-93 drei qualitativ äußerst wichtige Fakten:
- die steigende Unfähigkeit, die Produktion mit Krediten anzukurbeln;
- die immer größere Gefahr einer Kombination zwischen der Stagnation der Produktion auf der einen und der Explosion der Inflation auf der anderen Seite;
- die Tatsache, dass die shooting stars der Wirtschaft (Computer, Telekommunikation, Rüstung), die bis dahin von der Krise verschont geblieben waren, nun ebenfalls betroffen waren.
Eine Wirtschaftsaufschwung ohne Arbeitsplätze
Nach einigen schüchternen Ansätzen 1993 erlebte im darauffolgenden Jahr die Wirtschaft der Vereinigten Staaten, begleitet von Großbritannien und Kanada, ein steigendes Wachstum, das allerdings nie mehr als 5% betrug. Angesichts dessen vermeinte der Bourgeoisie, bereits Hurra zu schreien und mit Sprüchen über ”Jahre des ununterbrochenen Wachstums” die Wirtschaftsaufschwung in alle vier Himmelsrichtungen hinauszuposaunen.
- Diese ”Aufschwung” gründete sich auf ein massives Wachstum der Verschuldung der USA und der Weltwirtschaft als Ganzes:
...- Zwischen 1987 und 1997 wuchs die Gesamtverschuldung der USA um 628 Millionen Dollar pro Tag. Grundlage dieser Verschuldung war einerseits die Ableitung enormer Dollarmassen in die ganze Welt[3] [44] und andererseits die unkontrollierte Stimulation des Konsums der Privathaushalte, die das private Sparvermögen derart schrumpfen ließ, dass 1996 der Wert der Sparguthaben das erste Mal seit 53 Jahren wieder negativ war.
...- China und die sogenannten asiatischen ”Tiger” und ”Drachen” bezogen beträchtliches Kapital aus der Parität zwischen ihren Währungen und dem Dollar (eine große Gelegenheit für ausländische Investoren), mit dem sie ihr schnelles, aber illusorisches Wachstum ölten.
...- Eine Reihe wichtiger lateinamerikanischer Länder (Brasilien, Chile, Argentinien, Venezuela und Mexiko) bildete das Zentrum enormer spekulativer Anleihen, für die mit hohen, kurzfristigen Zinsraten bezahlt wurden.
- Die spektakuläre Steigerung der Arbeitsproduktivität erlaubte eine Senkung der Arbeitskosten und machte amerikanische Waren konkurrenzfähiger.
- Die aggressive Handelspolitik von Seiten des amerikanischen Kapitals stand auf folgenden Säulen:
...- auf dem Zwang gegenüber seinen Rivalen, ihre Zölle und andere protektionistische Maßnahmen abzubauen;
...- auf der Dollarmanipulation, die es erlaubte, seinen Kurs zu senken, wenn die Stimulation des Exports vorrangig war, und ihn anzuheben, wenn es darum ging, Kapital anzulocken;
...- auf der Ausnutzung sämtlicher Instrumente, die die USA als imperialistische Hauptmacht besitzen (militärisch, diplomatisch, ökonomisch), um ihre Position auf dem Weltmarkt zu verbessern.
Die europäischen Länder folgten dem Weg der USA und kamen ab 1995 ebenfalls in den Genuss eines ”Wachstums”, wenn auch auf viel niedrigerem Niveau (die Zahlen schwankten zwischen 1% und 3%).
Das auffälligste Kennzeichen dieser neuen ”Aufschwung” besteht darin, dass es eine Aufschwung ohne Arbeitsplätze war, was eine neue Entwicklung, verglichen mit den früheren, einleitete. So:
- hörte die Arbeitslosigkeit in den OECD-Ländern zwischen 1993 und 1996 nicht auf zu wachsen;
- vernichteten Großunternehmen Arbeitsplätze, statt neue zu schaffen: Laut Berechnungen kürzten die ”Fortune 500”-Unternehmen zwischen 1993 und 1996 500.000 Stellen;
- sank zum ersten Mal seit 1945 die Zahl der öffentlichen Angestellten. Die amerikanische Bundesadministration strich zwischen 1994 und 1996 118.000 Arbeitsplätze;
- wurde das Wachstum der Unternehmensprofite, anders als in früheren Aufschwungphasen, nicht von einer Steigerung der Beschäftigungsquote begleitet – ganz im Gegenteil.
Die neuen Jobs, die geschaffen wurden, waren schlecht bezahlt und Teilzeitarbeit.
Diese Aufschwung, die die Arbeitslosigkeit noch steigerte, ist ein beredtes Zeugnis für das große Ausmaß, das die historische Krise des Kapitalismus erreicht hat, wie wir in der International Review, Nr. 80 betont hatten: ”Wenn die kapitalistische Wirtschaft gesund ist, ist die Steigerung oder Aufrechterhaltung der Profite das Ergebnis einer Steigerung der Zahl ausgebeuteter Arbeiter und der Fähigkeit, größere Mengen an Mehrwert aus ihnen herauszupressen. Leidet sie aber an einer chronischen Krankheit, verhindert trotz der Intensivierung der Ausbeutung und Produktivität der Mangel an Märkten eine Aufrechterhaltung ihrer Profite, ohne die Zahl der ausgebeuteten Arbeiter zu reduzieren, ohne den Kapitalismus zu zerstören.”
Wie bei der offenen Rezession von 1991-93 ist die Aufschwung von 1994-97, entsprechend ihrer Zerbrechlichkeit und gewaltigen Widersprüche, ein neuer Ausdruck der Vertiefung der kapitalistischen Krise; aber sie unterscheidet sich von den früheren darin, dass:
- viel weniger Länder einbezogen sind;
- die USA nicht mehr die Rolle der Weltwirtschaftslokomotive spielen, indem sie ihren ”Partnern" den nötigen Schub verleihen; vielmehr wurde diese Aufschwung auf Kosten anderer, besonders Deutschlands und Japans, erreicht;
- die Arbeitslosigkeit weiterhin wächst; im günstigsten Fall kann man sagen, dass sie etwas langsamer wächst;
- die Aufschwung begleitet wurde von Erschütterungen an den Finanzmärkten und Börsen, unter anderem:
...- der Zusammenbruch der mexikanischen Wirtschaft (1994);
...- die Verwerfungen des europäischen Währungssystems (1995);
...- der Bankrott der Barings-Bank (1996).
Wir können die Schlussfolgerung ziehen, dass im Werdegang der kapitalistischen Krise in den letzten 30 Jahren jede neue Aufschwungphase schwächer als die vorherige und trotzdem stärker als die folgende ist, während jede neue Rezession schlimmer als die letzte, aber nicht so schlimm wie die kommende ist.
Die sogenannte ”Globalisierung”
In den 90er Jahren waren wir Zeuge der überschäumenden Ideologie der ”Globalisierung”. Demzufolge würde eine Ausdehnung der Marktgesetze, der strikten staatlichen Ausgabendisziplin, der Flexibilität der Arbeit und der unbegrenzten Zirkulation von Kapital auf den gesamten Globus die ”endgültige” Überwindung der Krise möglich machen (natürlich in Kombination mit einer ganzen Ladung niederdrückender Opfer auf dem Rücken des Proletariats). Wie alle ihr vorausgehenden ”Modelle” ist auch diese neue Alchimie ein Versuch der wichtigsten kapitalistischen Staaten, mit der Krise Schritt zu halten, um ihr Tempo zu drosseln. Er wird getragen wird von drei Hauptelementen:
- von einer gewaltigen Steigerung der Produktivität,
- von einer Verminderung der Handelsbarrieren und anderer Restriktionen des Weltmarktes;
- von einer spektakulären Entwicklung der finanziellen Transaktionen.
Der Anstieg in der Produktivität
Während der 90er Jahre erlebten die meisten Hauptindustrieländer einen beträchtlichen Anstieg in der Produktivität. Bei diesem Wachstum müssen wir unterscheiden zwischen der Kostenreduzierung einerseits und dem Wachstum der organischen Zusammensetzung des Kapitals (Verhältnis zwischen konstantem und variablem Kapital) andererseits.
Viele Faktoren trugen zur Kostenreduzierung bei:
- ein immenser Druck auf die Lohnkosten: Verminderung des Nominallohns und wachsende Kürzungen jenes Lohnanteils, der in den Sozialausgaben materialisiert wird;
- ein Schwindel erregender Fall der Rohstoffpreise;
- die organisierte und systematische Eliminierung unproduktiver Bereiche des Produktionsapparates – im privaten wie im öffentlichen Sektor – durch mannigfaltige Mechanismen: auf die ganz simple Tour, durch Betriebsschließungen nämlich, durch Privatisierung von Staatseigentum, Fusionen, Kauf und Übereignung von Aktien.
- die sogenannte ”Ausgliederung”, mit anderen Worten: der Transfer wenig rentabler Wertproduktion in die Dritte Welt mit ihren niedrigen Arbeitskosten und lächerlich geringen Preisen (die häufig auf Dumping zurückzuführen sind), was den zentralen Länder erlaubt, ihre Kosten zu vermindern.
Das allgegenwärtige Resultat war eine universelle Reduzierung der Arbeitskosten (und ein krasses Wachstum sowohl des absoluten als auch des relativen Mehrwerts).
Stand der jährlichen Schwankungen in den Kosten pro Arbeitseinheit (Quelle: OECD)
1985-96 1996 1997 1998
Australien 3,8 2,8 1,7 2,8
Deutschland 0,0 -0,4 -1,5 -1,0
Frankreich 1,5 0,9 0,8 0,4
Großbritannien 4,6 2,5 3,4 2,8
Italien 4,1 3,8 2,5 0,8
Japan 0,5 -2,9 1,9 0,5
Kanada 3,1 3,8 2,5 0,8
Schweden 4,4 4,0 0,5 1,7
Schweiz 3,5 1,3 -0,4 -0,7
Spanien 4,2 2,6 2,7 2,0
Südkorea 7,0 4,3 3,8 -4,3
Vereinigte Staaten 3,1 2,0 2,3 2,0
Was den Anstieg in der Zusammensetzung des Kapitals angeht, so ist dies nichts Neues in der Periode der kapitalistischen Dekadenz, da dies unerlässlich ist, um den Fall der Profitrate auszugleichen. Die systematische Einführung von Robotern, der Informationstechnologie und der Telekommunikation verlieh diesem Prozess weiteren Auftrieb.
Dieser Anstieg in der organischen Zusammensetzung verleiht diesem oder jenem Einzelkapital, dieser oder jener Nation einen gewissen Vorteil gegenüber den Konkurrenten, doch was bedeutet dies vom Standpunkt des gesamten Weltkapitals aus? In der aufsteigenden Periode, als das System fähig war, immer größere Arbeitermassen in seine Ausbeutungsverhältnisse einzuverleiben, bildete das Wachstum der organischen Zusammensetzung einen beschleunigenden Faktor in der kapitalistischen Expansion. Unter den gegenwärtigen Umständen der Dekadenz und einer 30-jährigen, chronischen Krise ist die Wirkung dieses Anstiegs in der organischen Zusammensetzung eine völlig andere. Auch wenn er lebenswichtig ist für jedes Einzelkapital, um die Tendenz zum Fall der Profitrate auszugleichen, hat er für das Gesamtkapital insofern eine andere Wirkung, als er die Überproduktion verschärft und durch die Verminderung des variablen Kapitals, d.h. durch die Entlassung immer größerer Arbeitermassen auf die Straße, der eigentlichen Ausbeutungsgrundlage den Boden entzieht.
Die Reduzierung der Handelsbarrieren
Die bürgerliche Propaganda hat das Verschwinden von Handelsbarrieren im letzten Jahrzehnt als ”Triumph des Marktes” bezeichnet. Wir wollen dies hier nicht detaillierter analysieren[4] [44], doch ist es notwendig, die Wahrheit zu enthüllen, die sich hinter diesen ideologischen Nebelkerzen verbirgt:
- Die Abschaffung von Handelszöllen und anderer protektionistischer Maßnahmen fand im Wesentlichen nur einseitig statt: Sie wurde von den schwächsten Ländern zum Nutzen der stärksten ausgeführt und betraf vor allem Brasilien, Russland, Indien etc. Weit davon entfernt, ihre eigenen Handelsbarrieren zu reduzieren, haben die Hauptindustrieländer neue geschaffen, indem sie das Alibi des Umweltschutzes, der ”Menschenrechte” u.ä. benutzen. Im Gegensatz zu ihrer Darstellung in der bürgerlichen Ideologie hat diese Politik die imperialistischen Spannungen noch verschärft.
- Angesichts der Verschlimmerung der Krise haben die Hauptindustrieländer die Politik der ”Kooperation” durchgesetzt, deren Inhalt sich darauf konzentriert:
...- die Auswirkungen der Krise und der verschärften Konkurrenz auf die schwächsten Länder abzuwälzen;
...- mit allen Mitteln einen Zusammenbruch des Welthandels zu verhindern, was nichts anderes bewirkt als eine weitere Verschärfung der Krise mit besonders schwerwiegenden Konsequenzen für die zentralen Länder.
Die Globalisierung der Finanztransaktionen
Während der 90er Jahre fand eine neue Schuldeneskalation statt. Quantität verwandelte sich in Qualität, die Verschuldung mutierte zur Überverschuldung:
- In den 70er Jahren konnten die Schulden reduziert werden, indem man das Risiko einging, eine Rezession zu provozieren; seit Mitte der 80er Jahre ist die Verschuldung zur dauernden und wachsenden Notwendigkeit für jeden Staat während des Aufschwungs wie auch in der Rezession geworden: ”Die Verschuldung ist keine Option, keine Wirtschaftspolitik, für die sich die Weltführer entscheiden oder nicht. Sie ist ein Zwang, eine Notwendigkeit, die ihnen durch die Funktionsweise und die Widersprüche des kapitalistischen Systems aufgezwungen wird.” (International Review, Nr. 87, ”The casino economy”)
- Einerseits benötigen Staaten, Banken und das Business einen Zustrom von frischem Kapital, was nur durch die Finanzmärkte ermöglicht werden kann. Dies führt zu einem rasenden Wettbewerb um Geldanleihen. Allein für diesen Zweck wurden in wachsendem Maße sorgfältig ausgeheckte Tricks genutzt: die Etablierung einer erzwungenen Parität zwischen den lokalen Währungen und dem Dollar (dieser Trick wurde von China und den berühmten ”Tigern” und ”Drachen” benutzt), die Neubewertung von Währungen, um Kapital an sich zu binden, wachsende Zinsraten etc.
- Andererseits ”findet der Profit aus der Produktion nicht mehr genügend Anlagemöglichkeiten in rentablen Investitionen, um die Produktionskapazitäten zu steigern. ‚Krisenmanagements bedeutet also, andere Anlagemöglichkeiten für dieses Übermaß an flüssigem Kapital zu finden, um seine abrupte Entwertung zu vermeiden” (ebenda). Es sind die Staaten und die angesehensten Finanzinstitutionen selbst, die die frenetische Spekulation stimulierten, nicht nur, um das Platzen dieser gigantischen Blase von fiktivem Kapital zu vermeiden, sondern auch, um die Kosten der stetig wachsenden Verschuldung zu vermindern.
Die Überverschuldung sowie die überbordende und irrationale Spekulation, die von Ersterer verursacht wurde, führten zur berühmten ”grenzenlosen Bewegungsfreiheit” des Kapitals, zum Gebrauch der Elektronik und des Internet bei Finanztransaktionen, zur Koppelung der Währungen an den Dollar, zur ungehinderten Rückführung der Profite in die Heimat. Das komplizierte Finanzmanagement der 80er Jahre (s. die vorhergehenden Artikel) nimmt sich gegen die raffinierten und verschlungenen Tricks der finanziellen ”Globalisierung” in den 90er Jahren wie ein Kinderspiel aus. Bis in die Mitte der 80er Jahre hinein war die Spekulation, die schon immer im Kapitalismus existiert hatte, ein mehr oder weniger temporäres Phänomen. Seither hat sie sich in ein tödliches, aber unerlässliches Gift verwandelt, das untrennbar mit dem Prozess der Überverschuldung verbunden und notgedrungen Bestandteil der Funktionsweise des Systems geworden ist. Das Gewicht der Spekulation ist beträchtlich: Gemäß den Zahlen der Weltbank ist das sogenannte ”Risikokapital” auf 30 Milliarden Dollar angewachsen, von denen 24 Milliarden aus den Industrieländern kommen.
Eine vorläufige Bilanz der 90er Jahre
Wir möchten hier einige vorläufige Schlussfolgerungen aus der Periode 1990-96 (vor der Explosion, die als ”asiatische Krise” bezeichnet wurde) anbieten, die uns wichtig erscheinen.
Die Entwicklung der Wirtschaftslage
1. Die durchschnittlichen Wachstumsraten sind weiter gefallen: Steigerungsraten in BSP (Durchschnitt der 24 OECD-Länder)
1960-70 5,6%
1970-80 4,1%
1980-90 3,4%
1990-95 2,4%
2. Die Amputation der produzierenden Industrie- und Landwirtschaftssektoren setzt sich fort und betrifft alle Bereiche, die ”veralteten” wie auch die ”Vorreiter”.
Entwicklung des BSP-Anteils des direkt produzierenden Gewerbes (in %) (Industrie und Landwirtschaft)
1975 1985 1996
Vereinigte Staaten 36,2 32,7 27,8
China 74,8 73,5 68,5
Indien 64,2 61,1 59,2
Japan 47,9 44,2 40,3
Deutschland 52,2 47,6 40,8
Brasilien 52,3 56,8 51,2
Kanada 40,7 38,1 34,3
Frankreich 40,2 34,4 28,1
Großbritannien 43,7 43,2 33,6
Italien 48,6 40,7 33,9
Belgien 39,9 33,6 32,0
Israel 40,1 33,1 31,3
Südkorea 57,5 53,5 49,8
3. Im Kampf gegen den unvermeidlichen Fall der Profitrate sucht das Business Zuflucht bei einer ganzen Reihe von Maßnahmen, welche den Fall kurzfristig verzögern sollen, aber mittelfristig das Problem nur noch weiter verschärfen werden:
- die Reduzierung der Arbeitskosten und die Steigerung der organischen Zusammensetzung des Kapitals;
- Dekapitalisierung: der massive Transfer von Vermögenswerten (Fabriken, Eigentum, finanzielle Investitionen), um die Profite aufzublähen;
- Konzentration: Betriebsfusionen haben ein spektakuläres Wachstum erlebt.
Der Wert von Fusionen in Milliarden Dollar (Quelle: ”JP Morgan”)
Europäische Union Vereinigte Staaten
1990 260 240
1992 214 220
1994 234 325
1996 330 628
1997 558 910
1998 670 1500
Während der gigantische Prozess der Kapitalkonzentration zwischen 1850 und 1910 die Entwicklung der Produktion widerspiegelte und positiv für die Entfaltung der Wirtschaft war, drückt der gegenwärtige Prozess das Gegenteil aus. Es handelt sich hier um eine defensive Antwort, die darauf ausgerichtet ist, den starken Widerspruch zwischen Angebot und Nachfrage dadurch auszugleichen, indem sie die Verringerung der Produktionskapazitäten organisiert (1998 kürzten die Industrieländer ihre Produktionskapazitäten um 10%) und die Arbeitskräfte reduziert: Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass infolge der getätigten Fusionen 1998 die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt um 11% reduziert wurde.
4. Die Fundamente des Weltmarktes wurden ein weiteres Mal reduziert: Große Teile Afrikas, eine gewisse Anzahl asiatischer und lateinamerikanischer Länder beteiligten sich nur noch schwach am Weltmarkt, da sie sich in einer Lage des Zerfalls befinden. Sie sind bekannt geworden als ”schwarze Löcher”: ein Zustand des Chaos‘, die Wiederauferstehung von Formen der Sklaverei, eine Wirtschaft, die auf Tauschhandel und Ausplünderung basiert.
5. Die bisher als ”Modelle” gepriesenen Länder sind in eine ausgedehnte Stagnation gestürzt. Dies ist der Fall in Deutschland, der Schweiz, in Japan und Schweden, wo:
- die durchschnittliche Wachstumsrate der Produktion in der Periode von 1990 bis 1997 zwei Prozent nicht überschritt;
- die Arbeitslosigkeit beträchtlich wuchs: zwischen 1990 und 1997 verdoppelte sie sich praktisch (zum Beispiel betrug in der Schweiz die Arbeitslosigkeitsrate zwischen 1970 und 1990 noch 1%; 1997 war sie auf 5,2% gestiegen);
- alle vier Länder von Gläubigern zu Schuldnern wurden (die Schweizer Haushalte sind die nach den USA und Japan am höchsten verschuldeten in der Welt);
- Besonders prekär ist die Situation der Schweizer Wirtschaft, die bis vor kurzem noch als die gesündeste in der Welt galt:
Wachstum des Schweizer BSP
1992 0,3%
1993 0,8%
1994 0,5%
1995 0,8%
1996 0,2%
1997 0,7%
6. Die Verschuldung setzt ihr unaufhaltsames Wachstum fort und verwandelt sich in eine Überverschuldung:
- Die globale Verschuldung stieg auf die astronomische Zahl von 30 Billarden Dollar (anderthalb Jahre der Weltproduktion).
- Japan, Deutschland und die anderen westeuropäischen Länder nahmen die oberen Ränge der Höchstverschuldeten ein (ein Jahrzehnt zuvor waren ihre Schulden noch weitaus moderater):
Der prozentuale Anteil der Schulden am Bruttosozialprodukt (Quelle: Weltbank)
1975 1985 1996
Vereinigte Staaten 48,9 64,2
Japan 45,6 67,0 87,4
Deutschland 24,8 42,5 60,7
Kanada 43,7 64,1 100,5
Frankreich 20,5 31,0 56,2
Großbritannien 62,7 53,8 54,5
Italien 57,5 82,3 123,7
Spanien 12,7 43,7 130,0
- Die Länder der Dritten Welt litten an einer neuen Überdosis Schulden:
Die Gesamtschulden der ”unterentwickelten Länder” (Quelle: Weltbank)
1990 1.480.000 Millionen $
1994 1.927.000 Millionen $
1996 2.177.000 Millionen $
7. Die Finanzplätze erlebten die schlimmsten Erschütterungen seit 1929 und hörten auf, ein sicherer Ort zu sein, wie das bis Mitte der 80er Jahre noch der Fall war. Ihre Aushöhlung wird von einer gigantischen Entwicklung der Spekulation begleitet, die alle Aktivitäten betrifft: Aktien in den Börsen, Eigentum, Kunst, Landwirtschaft, etc.
8. Zwei Phänomene, die stets im Kapitalismus existiert hatten, haben in diesem Jahrzehnt alarmierende Ausmaße angenommen:
- die Korruption von Politikern und Wirtschaftsmanagern, die ein Produkt zweier miteinander verbundener Faktoren ist:
...- des immer überwältigenderen Gewichts des Staates in der Wirtschaft (Geschäfte sind in wachsendem Maße abhängig von staatlichen Investitionsplänen, von Subventionen, öffentlichen Aufträgen);
...- der wachsenden Schwierigkeit, mit ”legalen” Mitteln ausreichenden Profit zu erzielen.
- die Kriminalisierung der Wirtschaft, die immer stärkere wechselseitige Durchdringung von Staaten, Banken, Business und Drogen-, Waffen-, Kinder- und Menschenhändlern. Die dubiosesten Geschäfte sind zumeist die profitabelsten, und die ”seriösesten” Institutionen öffentlicher und privater Natur können nicht anders, um ihren Appetit zu stillen. Nichts veranschaulicht deutlicher die Tendenz zum wirtschaftlichen Zerfall.
9. Im Gefolge der o. g. Erscheinungen hat sich auch ein Phänomen in den Industrieländern breit gemacht, das bis dahin für die Bananenrepubliken und stalinistischen Regimes reserviert war – das Phänomen immer unverfrorener Verfälschungen von Wirtschaftsindikatoren und der ”kreativen Buchführung” in allen Variationen. Dies ist ein weiterer Ausdruck der Verschlimmerung der Krise, da es für die Bourgeoisie stets notwendig war, über zuverlässige Statistiken zu verfügen (besonders in den Ländern des ”westlichen” Staatskapitalismus, wo der Markt benötigt wird, um zu einem unbestechlichen Urteil über die Funktionsweise der Wirtschaft zu gelangen).
Die Weltbank, Quelle vieler Statistiken, führt als einen Teil des BSP den Begriff der ”nicht handelsfähigen Dienstleistungen” auf, der die Zahlungen für das Militär, die Staatsbediensteten und Lehrer umfasst. Eine andere Methode, die Zahlen aufzublähen, besteht darin, nicht nur die landwirtschaftlichen Tätigkeiten, sondern auch eine ganze Reihe von Dienstleistungen als ”Eigenkonsum” zu berücksichtigen. Der viel gerühmte ”Haushaltsüberschuss” des amerikanischen Staates ist eine Fiktion, die aufrechterhalten wird, indem man mit den Überschüssen der Sozialversicherungen spielt[5] [44]. Doch werden, gemessen an ihrer großen sozialen und politischen Bedeutung, die skandalösesten Tricks mit den Arbeitslosenstatistiken angestellt, die beträchtlich nach unten ”korrigiert” werden:
- In den USA hat unsere Publikation Internationalism die von der Clinton-Administration benutzten Tricks deutlich gemacht, um ihre ”hervorragenden” Arbeitslosenzahlen zu erzielen: indem sie diejenigen, die einer Teilzeitarbeit nachgehen, in ihren Beschäftigtenzahlen voll mit einschließt, indem sie jene Arbeitslose aus ihren Statistiken eliminiert, die sich weigern, irgendeinen McBurger-Job anzunehmen, indem sie die verschiedenen Teilzeitjobs, die von einem Arbeiter ausgeübt werden, so zählt, als würden sie von mehreren Individuen ausgeführt u.s.w.
- In Deutschland werden nur diejenigen als arbeitslos anerkannt, die einen Job von mindestens 18 Arbeitsstunden in der Woche suchen, in den Niederlanden beträgt die Zahl der zu leistenden Wochenarbeitsstunden 12 Stunden und in Luxemburg 20 Wochenstunden[6] [44].
- Österreich und Griechenland haben sich der monatlichen Statistiken entledigt, um auf vierteljährliche überzugehen, mit denen sie die wirklichen Zahlen verschleiern wollen.
- In Italien werden diejenigen, die zwischen 20 und 40 Stunden in der Woche oder nur zwischen vier und sechs Monaten im Jahr arbeiten, nicht als arbeitslos anerkannt. In Großbritannien werden jene Arbeitslosen, die keine staatliche Unterstützung erhalten, aus den Statistiken ausradiert.
Die Lage der Arbeiterklasse
1. Die Arbeitslosigkeit hat sich während dieses Jahrzehnts brutal ausgeweitet:
Arbeitslosigkeit in den 24 Ländern der OECD
1989 30 Millionen
1993 35 Millionen
1996 38 Millionen
Arbeitslosigkeit in den Industrieländern in % (Quelle: IAO)
1976 1980 1990 1996
USA 7,4 7,1 6,4 5,4
Japan 1,8 2,0 2,1 3,4
Deutschland 3,8 2,9 5,0 12,4
Frankreich 4,4 6,3 9,1 12,4
Italien 6,6 7,5 10,6 12,1
Großbritannien 5,6 6,4 7,9 8,2
Die IAO hat erklärt, dass 1996 die weltweite Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung die Schwelle von einer Milliarde erreicht hat.
2. Die chronische Unterbeschäftigung in der Dritten Welt hat sich auf die Industrieländer ausgebreitet:
- 1995 machten die Zeitarbeitsverträge 20% der Arbeitskräfte in den 24 OECD-Ländern aus.
- Der IAO-Bericht von 1996 bemerkte, dass ”zwischen 25% und 30% der Arbeiter der Welt auf einen Arbeitsplatz, dessen Arbeitstag kürzer ist, als sie es wünschten, oder auf einen Lohn angewiesen sind, der niedriger ist als das notwendige Minimum, um anständig zu leben”.
3. In der Dritten Welt hat eine massive Wiederkehr vergangen geglaubter Ausbeutungsformen stattgefunden, wie Kinderarbeit (nahezu 200 Millionen gemäß den Statistiken der Weltbank von 1996), Sklaverei oder Arbeitszwang – selbst in entwickelten Ländern wie Frankreich wurden Diplomaten verurteilt, weil sie ihr von Madagaskar oder Indonesien mitgebrachtes Hauspersonal wie Sklaven behandelt hatten.
4. Zusammen mit allgemeinen Massenentlassungen (besonders in den Großbetrieben) haben sich die Regierungen der Politik der ”Reduzierung überflüssiger Kosten” verschrieben:
- Einschränkungen der Abfindungen im Falle von Entlassungen;
- Kürzungen der Arbeitslosengelder und einer Reihe anderer Wohlfahrtsgelder.
5. Die Löhne haben zum ersten Mal seit den 30er Jahren eine nominale Senkung erlebt:
- Das Lohnniveau in Spanien war 1997 niedriger als in den 80er Jahren.
- In den USA fiel der Durchschnittslohn zwischen 1974 und 1997 um 20%.
- In Japan fielen die Löhne zum ersten Mal seit 1955 (1998 um 0,9%).
6. Es werden permanent wesentliche Bereiche der Sozialausgaben gekürzt. Dagegen steigen die Steuern, Preise und Sozialversicherungsabgaben ohne Unterlass.
7. Seit Mitte des Jahrzehnts hat das Kapital eine neue Angriffsfront eröffnet: die Eliminierung eines legalen Minimums in den Arbeitsbedingungen. Dies hatte eine Reihe von Konsequenzen zur Folge:
- die Verlängerung des Arbeitstages (insbesondere durch die Demagogie der ”35-Stunden-Woche”, welche eine flexible Berechnung der Arbeitsstunden auf jährlicher Grundlage und daher auch einen Abbau der Überstundenzuschläge voraussetzte);
- die Eliminierung der Grenzen für das Rentenalter;
- die Aufhebung der Grenzen für das Alter des Berufseintritts (zwei Millionen Kinder arbeiten bereits in den Ländern der EU);
- der Abbau des Arbeitsschutzes und des Schutzes vor Berufskrankheiten etc.
8. Ein anderer, unübersehbarer Aspekt besteht darin, dass Banken, Versicherungsgesellschaften u.a. die Arbeiter dazu drängen, ihre kleinen Einkommen (oder ihre Erbschaften von Eltern oder Großeltern) auf das russische Roulett der Börsen zu setzen, um sie so zu den ersten Opfern der ständigen Purzelbäume an den Börsen zu machen. Doch ein noch größeres Problem ist, dass mit den Kürzungen der lächerlichen Sozialversicherungsrenten die Arbeiter in die Abhängigkeit von Rentenfonds gezwungen werden, die die Masse ihrer Beiträge in Börsengeschäfte investieren, welche große Unsicherheiten in sich bergen: Beispielsweise verlor 1997 der wichtigste Rentenfonds der Angestellten im Erziehungswesen der USA 11% seines Wertes (s. ”Internationalism”, Nr. 105)
Die bürgerliche Propaganda hat bis zum Überdruss die Verringerung der Ungleichheiten, die ”Demokratisierung” des Wohlstands und des Konsums propagiert. Dreißig Jahre der sich ausweitenden historischen Krise des Kapitalismus haben diese Proklamationen systematisch der Lüge überführt und die marxistische Analyse bestätigt, wonach die Verschlimmerung der Krise eine eindeutige Tendenz zur wachsenden Verarmung der Arbeiterklasse und der gesamten ausgebeuteten Bevölkerung mit sich bringt. Im Kapitalismus ist die Menschheit in einer immer kleineren Minderheit mit unverschämt großem Reichtum auf der einen Seite und einer wachsenden Mehrheit von Menschen auf der anderen Seite geteilt, die unter fürchterlicher und niederschmetternder Armut leiden. Einige im Jahresbericht der UNO von 1998 zusammengefassten Zahlen sind sehr aufschlussreich: Während es noch 1996 weltweit 358 Superreiche waren, die in ihren Händen dasselbe Geldvermögen wie das der 2,5 Milliarden Ärmsten konzentrierten hatten, besaßen 1997 allein die 225 reichsten Menschen das Äquivalent des Milliardenheeres der Verarmten.
Adalen
[1] [44] Es ist nicht der Zweck dieser Artikelreihe, die neue Stufe der historischen Krise des Kapitalismus zu analysieren, die im August 1997 mit der sog. ”asiatischen Krise” erklommen wurde. Siehe dazu International Review Nr. 92 und andere spezifischere Studien darüber.
[2] [44] Es ist nicht das Ziel dieses Artikels, die Konsequenzen daraus für den Klassenkampf, die imperialistischen Spannungen und für das Überleben der dem stalinistischen Regime unterworfenen Länder zu analysieren. Wir wollen hier auf die Artikel verweisen, die wir in der International Review, besonders in den Nr. 60, 61, 62, 63 und 64, veröffentlicht haben.
[3] [44] Während die amerikanische Produktion 26,7% der Weltproduktion ausmacht, betragen die Dollarmengen 47,5% der Bankdepositen, 64,1% der Weltwährungsreserven und 47,6% der Finanztransaktionen (Zahlen von der Weltbank).
[4] [44] s. International Review, Nr. 86, ”Behind the ‚gobalisation‘ of the economy: the aggravation of the capitalist crisis”;
[5] [44] gemäß einer Analyse, die am 9. November 1998 in der New York Times veröffentlicht wurde;
[6] [44] Diese und die folgenden Zahlen wurden dem Offiziellen Jahrbuch der Europäischen Union (1997) entnommen.
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Internationale Revue - 2001
- 4450 Aufrufe
Internationale Revue 27
- 2806 Aufrufe
Bilan Nr. 10 vom August/September 1934: Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus
- 3353 Aufrufe
Einleitung
Dies ist der erste Teil einer Studie, die 1934 in der Zeitschrift Bilan, Organ der Linken Fraktion der Kommunistischen Partei Italiens, veröffentlicht worden ist. Diese Studie setzte sich damals das Ziel, ”den Sinn der periodisch wiederkehrenden Krisen besser zu verstehen, die immer wieder den ganzen Kapitalismus erschüttert haben, und zu versuchen, mit größtmöglicher Präzision das Zeitalter der definitiven Dekadenz zu charakterisieren und die von ihm ausgehenden tödlichen Zuckungen zu verstehen”.
Es handelte sich also darum, die klassische marxistische Analyse zu aktualisieren und zu vertiefen, um zu verstehen, weshalb der Kapitalismus zyklischen Produktionskrisen ausgesetzt war und weshalb er im 20. Jahrhundert mit der zunehmenden Sättigung des Weltmarktes in eine neue Phase, die seiner unwiderruflichen Dekadenz, getreten ist. Die zyklischen Krisen sind längst einem viel tieferen und schwerwiegenderen Phänomen gewichen - der historischen Krise des kapitalistischen Systems. Sie ist gekennzeichnet durch einen sich ständig verschärfenden Widerspruch zwischen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und der Entwicklung der Produktivkräfte. Die kapitalistische Produktionsweise hat sich nicht nur in eine Fessel des Fortschritts verwandelt, sondern bedroht nun gar das Überleben der Menschheit selbst. Die Studie von Mitchell[1] [46] beginnt mit den Grundlagen der marxistischen Analyse: dem Profit und der kapitalistischen Akkumulation. Sie zeigt die Kontinuität zwischen den Analysen von Marx und Rosa Luxemburg auf, die in der Akkumulation des Kapitals eine Erklärung für die Tendenz des Kapitalismus zu immer tödlicheren Erschütterungen geliefert und die historischen Grenzen des Systems aufgezeigt hat, das nun in ein Zeitalter der ”Krisen, Kriege und Revolutionen” eingetreten war.
Mitchells Arbeit der Aktualisierung und Vertiefung ist auch heute noch vollständig gültig. Natürlich konnte Bilan sich das heutige Ausmaß der Verschuldung, der Spekulation, der monetären Manipulationen, der Unternehmensfusionen und -konzentrationen nicht vorstellen. Dennoch liefert diese Analyse alle Grundlagen zum Verständnis ihrer Mechanismen. Dieses Dokument erlaubt es uns also, die Grundlagen der Analysen zu formulieren, die wir in einem Artikel in der letzten Nummer über ”Die New Economy, eine erneute Rechtfertigung des Kapitalismus” entwickelten. Dies wird noch deutlicher im zweiten Teil der Studie über ”Die Analyse der allgemeinen Krise des dekadenten Imperialismus”, den wir in der nächsten Nummer veröffentlichen werden.
IKS
Die marxistische Analyse der kapitalistischen Produktionsweise bezieht sich hauptsächlich auf folgende Punkte:
a) auf die Kritik an den feudalen und vorkapitalistischen Produktions- und Austauschformen;
b) auf die Notwendigkeit, diese rückständigen Formen durch die fortschrittlichere kapitalistische Form zu ersetzen;
c) auf die Demonstration des fortschrittlichen Charakters der kapitalistischen Produktionsweise, indem der positive Aspekt und die gesellschaftliche Notwendigkeit der Gesetze aufgezeigt werden, die ihre Entwicklung bestimmen;
d) auf die vom Standpunkt einer sozialistischen Kritik aus zu erfolgende Untersuchung der negativen Aspekte derselben Gesetze, ihrer widersprüchlichen und zerstörerischen Auswirkungen, die die kapitalistische Evolution in eine Sackgasse führen;
e) auf den Beweis dafür, dass die kapitalistischen Aneignungsformen schließlich ein Hemmnis der vollständigen Entwicklung der Produktion sind und dass infolgedessen diese Produktionsweise ein immer unhaltbarer werdendes Klassenverhältnis schafft, was sich durch eine immer größere Kluft zwischen den immer wenigeren, aber reicheren KAPITALISTEN auf der einen und den immer zahlreicheren und unglücklicheren LOHNABHÄNGIGEN ohne Eigentum auf der anderen Seite ausdrückt;
f) und schließlich auf die Anerkennung, dass die immensen, vom Kapitalismus entwickelten Produktivkräfte sich nur in einer Gesellschaft harmonisch entfalten können, die wiederum nur von einer Klasse organisiert werden kann, die kein besonderes Eigeninteresse als Kaste besitzt: vom PROLETARIAT.
In dieser Studie werden wir keine vertiefte Analyse der organischen Evolution des Kapitalismus in seiner aufsteigenden Phase anfertigen. Wir werden uns darauf beschränken, dem dialektischen Prozess seiner inneren Kräfte zu folgen, um so besser den Sinn der Krisen zu verstehen, die den Kapitalismus periodisch erschüttert haben. Schließlich werden wir versuchen, mit größter Genauigkeit das Zeitalter der definitiven Dekadenz des Kapitalismus zu bestimmen, in dem er von den blutigen Zuckungen seines Todeskampfes geschüttelt wird.
Wir werden ebenfalls untersuchen, wie der Zerfall der vorkapitalistischen Wirtschaftsformen – Feudalismus, Handwerksproduktion, ländliche Gemeinwirtschaft - die Bedingungen für die Ausweitung des Marktes für die kapitalistischen Waren schafft.
Die kapitalistische Produktion orientiert sich am Profit, nicht an den Bedürfnissen
Fassen wir die wichtigsten Vorbedingungen der kapitalistischen Produktionsweise zusammen.
1. Die Existenz von Waren, mit anderen Worten: von Produkten, die, ehe sie als GEBRAUCHSWERT entsprechend ihrem gesellschaftlichen Nutzen betrachtet werden können, als Austauschverhältnis mit anderen Gebrauchswerten verschiedener Art, d.h. als TAUSCHWERT, auftreten. Das einzige gemeinsame Maß der Waren ist die Arbeit; der Tauschwert einer Ware wird von der zu ihrer Herstellung gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bestimmt.
2. Waren werden nicht DIREKT untereinander ausgetauscht, sondern durch die Zwischenschaltung einer universellen Ware, die den Wert aller Waren ausdrückt: die Ware GELD.
3. Die Existenz einer Ware mit einem besonderen Charakter, die ARBEITSKRAFT, die das einzige Eigentum des Arbeiters ist und von den Kapitalisten, den alleinigen Eigentümern der Produktions- und Subsistenzmittel, auf dem Arbeitsmarkt wie jede andere Ware zu ihrem WERT oder, in anderen Worten, zu ihren Produktionskosten bzw. dem Preis zur „Erhaltung“ der Lebenskraft des Proletariers gekauft wird. Doch während der Konsum aller anderer Waren nicht zu einer Wertsteigerung führt, verschafft die Arbeitskraft dagegen dem Kapitalisten, der sie gekauft hat, daher auch ihr Eigentümer ist und nach seinem Willen über sie verfügen kann, einen Wert, der größer ist als ihre Kosten, vorausgesetzt, er lässt den Proletarier länger arbeiten, als notwendig ist, um sein striktes Existenzminimum zu produzieren.
Dieser MEHRWERT entspricht der MEHRARBEIT, die der Proletarier kraft der Tatsache, dass er seine Arbeitskraft „frei“ und auf vertraglicher Basis verkauft, gratis an den Kapitalisten abtritt. Dies schafft den PROFIT des Kapitalisten. Es handelt sich hier also nicht um etwas Abstraktes, sondern um LEBENDIGE ARBEIT.
Wir möchten uns an dieser Stelle für unser Beharren auf dem, was allgemein zum kleinen Einmaleins der marxistischen Wirtschaftstheorie gehört, entschuldigen. Wenn wir insistieren, so, weil wir nicht aus dem Blick verlieren dürfen, dass alle wirtschaftlichen und politischen Probleme, die sich dem Kapitalismus stellen (und in Krisenzeiten sind sie zahlreich und komplex), auf das zentrale Ziel hinauslaufen, ein MAXIMUM an MEHRWERT zu produzieren. Der Kapitalismus kümmert sich nicht im mindesten um die Bedürfnisse der Menschheit, um ihren Konsum und oder um ihr Existenzminimum. NUR EIN EINZIGER KONSUM regt seine Interessen und Leidenschaft an, stimuliert seine Energien und seinen Willen, bildet seinen Daseinsgrund: DER KONSUM VON ARBEITSKRAFT!
Der Kapitalismus gebraucht die Arbeitskraft, um den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen, was der größtmöglichen Menge an Arbeitskraft entspricht. Aber dies ist nicht alles: Notwendig ist auch die maximale Steigerung der Gratisarbeit im Verhältnis zur bezahlten Arbeit, des Profites im Verhältnis zu den Löhnen und zum verausgabten Kapital – die MEHRWERTRATE. Der Kapitalist gelangt zu seinem Ziel einerseits durch die Vergrößerung der Arbeitsmenge, sei es durch eine Verlängerung des Arbeitstages oder durch eine Erhöhung der Arbeitsintensität, und andererseits durch eine möglichst geringe Bezahlung der Arbeitskraft (sogar unter ihrem Wert), was vor allem dank der Entwicklung der Arbeitsproduktivität möglich ist, die die Kosten für die vordringlichsten Bedürfnisse und das Existenzminimum senkt. Aus eigenen Stücken wird der Kapitalismus dem Arbeiter natürlich nicht erlauben, aufgrund des Preisverfalls mehr Waren zu kaufen. Die Löhne bewegen sich stets um den Durchschnitt des Wertes der Arbeitskraft herum, welcher jenen Dingen entspricht, die für ihre Reproduktion unbedingt erforderlich sind: Die Bewegungen im Lohnwert über oder unter diesem Wert entfalten sich parallel zu den Fluktuationen im Kräfteverhältnis zwischen Kapitalisten und Proletariern.
Aus obigen Zeilen geht klar hervor, dass die Mehrwertmenge nicht eine Funktion des GESAMTEN verausgabten Kapitals ist, sondern nur des Teils, der für den Kauf der Arbeitskraft, des VARIABLEN KAPITALS, ausgegeben wird. Deshalb tendiert der Kapitalist dazu, aus einem MINIMUM von GESAMTKAPITAL ein MAXIMUM an MEHRWERT herauszuschlagen. Doch wie wir bei der Analyse des Akkumulationsprozesses feststellen, wirkt dieser Tendenz ein Gesetz entgegen, das zu einem Fall der Profitrate führt.
Wenn wir also das Gesamtkapital oder das in der kapitalistischen Produktion investierte Kapital betrachten - sagen wir: innerhalb eines Jahres -, so dürfen wir es nicht als Ausdruck einer konkreten, materiellen Form der Waren, sprich: Gebrauchswerte, betrachten, sondern als Verkörperung von Waren, als Tauschwerte. Ist dies der Fall, so setzt sich der Wert der Jahresproduktion folgendermaßen zusammen:
a) aus dem verausgabten konstanten Kapital, d.h. aus den verschlissenen Produktionsmitteln und den absorbierten Rohstoffen: diese beiden Elemente sind der Ausdruck vergangener Arbeit, die bereits in vorhergehenden Produktionsperioden verausgabt, materialisiert worden war;
b) aus dem variablen Kapital und dem Mehrwert, die die neue, lebendige, während des Jahres verausgabte Arbeit darstellt.
Dieser abstrakte Wert erscheint im Gesamtprodukt ebenso wie in jedem Einzelstück. Der Wert eines Tisches beispielsweise ist die Summe des Wertes der Maschinen, die ihn produzieren, plus des Wertes der Rohstoffe und der Arbeit, die dabei verbraucht wurden. Man darf das Produkt also nicht als ausschließlichen Ausdruck entweder des konstanten Kapitals, des variablen Kapitals oder des Mehrwerts verstehen.
Das variable Kapital und der Mehrwert sind der Ertrag aus der Produktionssphäre (da wir hier nicht die außerkapitalistische Produktion der Bauern, Handwerker usw. berücksichtigen, beziehen wir auch ihr Einkommen nicht mit ein).
Das Einkommen der Proletarier entspricht dem Lohnfonds. Das Einkommen der Bourgeoisie entspricht der Mehrwertmasse bzw. dem Profit (wir wollen hier nicht die Verteilung des Mehrwerts in Industrie, Handel und Banken sowie in Form der Grundrente innerhalb der Bourgeoisie analysieren). Auf diese Weise definiert, begrenzt das Einkommen aus der kapitalistischen Sphäre den individuellen Konsum sowohl des Proletariats als auch der Bourgeoisie. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Konsum der Bourgeoisie nur durch die Möglichkeiten der Mehrwertproduktion begrenzt wird, wohingegen der Konsum der Arbeiter eine ausgesprochene Notwendigkeit derselben Mehrwertproduktion ist. Folglich ist die Verteilung der Einkünfte der Hauptwiderspruch, der alle anderen Widersprüche auslöst. Denjenigen, die behaupten, dass die Arbeiter produzieren, um zu konsumieren oder dass die Bedürfnisse, die ja unbegrenzt seien, immer größer seien als die Produktionskapazitäten, antworten wir mit den Worten von Marx: ”Die Arbeiter produzieren tatsächlich den Mehrwert: solange sie ihn produzieren, können sie auch konsumieren, sobald jedoch die Produktion unterbricht, können sie auch nicht mehr konsumieren. Es ist falsch zu sagen, dass sie konsumieren können, da sie das Äquivalent ihrer Produktion herstellen.” Er sagt ferner: ”Die Arbeiter müssen immer Mehrwertproduzenten sein und über ihre Bedürfnisse hinaus produzieren, um Konsument oder Käufer in den Grenzen der Bedürfnisse zu sein.”
Doch für den Kapitalisten reicht es nicht aus, sich Mehrwert anzueignen, er kann sich nicht damit zufrieden geben, dem Arbeiter einen Teil der Früchte seiner Arbeit zu rauben, er muss in der Lage sein, den Mehrwert auch zu realisieren, ihn durch den Verkauf des Produkts zu seinem Wert in Geld umzuwandeln.
Erst mit dem Verkauf kann ein neuer Produktionszyklus beginnen. Er erlaubt dem Kapitalisten, die im gerade beendeten Produktionsprozess verbrauchten Teile des Kapitals zu ersetzen. Er muss verbrauchte Produktionsmittel ersetzen, neue Rohstoffe kaufen, die Arbeitskraft bezahlen. Doch vom kapitalistischen Standpunkt aus gelten diese Elemente nicht in ihrer materiellen Form als entsprechende Menge von Gebrauchswerten, als dieselbe Produktionsmenge, die in den Produktionsprozess wieder einverleibt wird, sondern als Tauschwert, als Kapital, das in die Produktion auf ihrem alten Stand (dabei den neuen akkumulierten Wert ignorierend) reinvestiert wird, um mindestens denselben Profit wie zuvor zu erzielen. Das erstrangige Ziel des Kapitalisten ist ein neuer Produktionszyklus, der ihm neuen Mehrwert einbringt.
Falls die Produktion nicht vollständig realisiert werden kann oder sie unter ihrem Wert realisiert wird, hat die Ausbeutung des Arbeiters dem Kapitalisten nichts oder nur wenig eingebracht, da sich die Gratisarbeit ja nicht in Geld und anschließend in Kapital zur erneuten Mehrwertproduktion hat umwandeln lassen. Dass dabei nichtsdestotrotz konsumierbare Produkte produziert worden sind, ist dem Kapitalisten völlig gleichgültig, selbst wenn es der Arbeiterklasse am Notwendigsten mangelt. Wenn wir hier die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass dieser Verkauf misslingt, so geschieht das vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich der kapitalistische Produktionsprozess in zwei Phasen gliedert, nämlich in die der Produktion und des Verkaufs. Obwohl beide eine Einheit bilden und eng voneinander abhängig sind, verlaufen sie dennoch vollständig getrennt voneinander. Der Kapitalist beherrscht den Markt nicht, sondern ist ihm vielmehr völlig ausgeliefert. Nicht nur der Verkauf ist von der Produktion abgetrennt, sondern auch der anschließende Erwerb von Waren ist vom Verkauf derselben getrennt. Mit anderen Worten: Der Verkäufer einer Ware ist nicht notwendigerweise und gleichzeitig Käufer einer anderen Ware. In der kapitalistischen Ökonomie bedeutet Warenhandel nicht direkten Tauschhandel: Alle Waren müssen sich vor ihrer endgültigen Bestimmung in Geld umwandeln. Diese Metamorphose ist der wichtigste Moment in ihrer Zirkulation.
Die erste Möglichkeit einer Krise resultiert also aus der Differenzierung zwischen Produktion und Verkauf einerseits und zwischen Kauf und Verkauf andererseits, was es notwendig macht, dass die Ware sich zunächst in Geld und dann vom Geld zur Ware umwandeln muss, und dies auf der Grundlage einer Produktion, die als Kapital-Geld beginnt und als Geld-Kapital endet.
Hier taucht für den Kapitalismus das Problem der Realisierung auf. Welche Lösungen bieten sich an? Zunächst kann der das konstante Kapital verkörpernde Teil des Produktwertes unter normalen Umständen in der kapitalistischen Sphäre selbst, durch den inneren Austausch zur Erneuerung der Produktion, verkauft werden. Der das variable Kapital darstellende Teil wird von den Arbeitern gekauft, dank der Löhne, die ihnen vom Kapitalisten bezahlt werden, und strikt innerhalb der Grenzen, die wir hervorgehoben haben, da der Preis der Arbeitskraft um seinen Wert herum pendelt: Dies ist der einzige Teil des Gesamtprodukts, dessen Realisierung und dessen Markt durch die Finanzierung des Kapitalismus selbst gesichert ist. Es bleibt also der Mehrwert. Man könnte natürlich in Betracht ziehen, dass die Bourgeoisie ihn allein für ihren Konsum ausgibt, obwohl dazu das Produkt erst in Geld umgewandelt werden müsste (wir vernachlässigen hier die Möglichkeit, dass individuelle Ausgaben auch mit gespartem Geld bestritten werden können), denn die Kapitalisten können nicht einfach ihr eigenes Produkt konsumieren. Doch wenn die Bourgeoisie sich derart verhalten würde, wenn sie nicht mehr täte, als die Früchte des Mehrwerts zu genießen, die sie sich vom Proletariat nimmt, wenn sie sich auf eine einfache Reproduktion beschränken würde, statt eine erweiterte Reproduktion anzustreben, um sich so eine friedliche und sorgenfreie Existenz zu sichern, dann würde sie sich nicht von den früheren herrschenden Klassen unterscheiden, abgesehen von ihren Herrschaftsformen. Die Struktur der Sklavenhaltergesellschaft unterdrückte jegliche technische Entwicklung und hielt die Produktion auf einem Niveau, auf dem der Sklavenhalter gut leben konnte, dessen Bedürfnissen die Sklaven vollauf gerecht wurden. Auch der Feudalherr erhielt im Austausch für den Schutz, den er seinen Leibeigenen gewährte, von Letzteren das Produkt ihrer Mehrarbeit und entledigte sich somit der Sorge um die Produktion, den Markt, der sich auf einen engen, nicht anpassungsfähigen lokalen Austausch beschränkte.
Angetrieben von der Entwicklung einer merkantilen Gesellschaft, war es die historische Aufgabe des Kapitalismus, diese dumpfen und stagnierenden Gesellschaften wegzufegen. Die Enteignung der Produzenten schuf den Arbeitsmarkt und öffnete den Quell des Mehrwerts des merkantilen Kapitals, um es in industrielles Kapital umzuwandeln. Ein Produktionsfieber erfasste die gesamte Gesellschaft. Angespornt von der Konkurrenz, zog Kapital Kapital an. Die Produktivkräfte und die Produktion wuchsen exponentiell, und die kapitalistische Akkumulation erreichte im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts mit dem Aufblühen des ”Freihandels” ihren Höhepunkt.
Die Geschichte zeigt also, dass die Bourgeoisie in ihrer Gesamtheit keinesfalls den gesamten Mehrwert konsumieren kann. Im Gegenteil: Ihre Profitgier veranlasst sie, den größeren Teil des Mehrwerts beiseite zu legen und – da Profit Profit anzieht, so wie der Magnet das Eisen – in KAPITAL umzuwandeln. Die Produktion wird unaufhörlich erweitert, wobei die Konkurrenz sie stimuliert und technologische Verbesserungen voraussetzt.
Die Erfordernisse der Akkumulation verwandeln die Realisierung des Mehrwerts zu einem Stolperstein für die Realisierung des Gesamtprodukts. Während die Realisierung des für den Konsum bestimmten Teils kein Problem darstellt (zumindest theoretisch), so verbleibt nichtsdestotrotz der Teil des Mehrwerts, der für die Akkumulation reserviert ist. Dieser kann unmöglich von den Proletariern absorbiert werden, da ihre Kaufkraft auf ihren Lohn beschränkt ist. Soll man nun davon ausgehen, dass er vom Austausch unter den Kapitalisten und innerhalb des kapitalistischen Bereichs absorbiert wird und dass dieser Austausch für eine Produktionsausdehnung ausreicht?
Marx unterstreicht die offensichtliche Absurdität einer solchen Lösung: ”Die kapitalistische Produktion will nicht andere Güter besitzen, sondern sich Wert, Geld, abstrakten Reichtum aneignen.” Die Ausdehnung der Produktion ist eine Funktion der Akkumulation dieses abstrakten Reichtums. Der Kapitalist produziert nicht aus Gefallen am Produzieren, am Akkumulieren von Produktionsmitteln oder Konsumgütern oder etwa aus Gefallen daran, sich mit immer mehr Arbeitern „vollzustopfen“, sondern weil die Produktion Gratisarbeit erzeugt, also Mehrwert, der akkumuliert und um so mehr wächst, je mehr er in Kapital umgewandelt wird. Marx fügt hinzu: ”Wenn man sagt, dass die Kapitalisten ihre Waren ja nur unter sich auszutauschen und zu konsumieren hätten, so vergisst man den ganzen Charakter der kapitalistischen Produktionsweise, bei der es sich um die Umwandlung des Kapitals in Wert und nicht um seinen Verzehr handelt.”
Wir befinden uns also beim Kern des Problems, das sich dem Gesamtkapital unausweichlich und ständig stellt: dem Verkauf außerhalb des kapitalistischen Marktes, dessen Aufnahmefähigkeit durch die Gesetze des Kapitalismus streng begrenzt ist, da die Mehrproduktion zumindest den Teil des Mehrwerts darstellt, der nicht von der Bourgeoisie konsumiert wird, sondern dafür vorgesehen ist, in Kapital umgewandelt zu werden. Da gibt es kein Entrinnen: Das Warenkapital kann nur Mehrwert erzeugendes Kapital werden, wenn es zuvor in außerkapitalistischen Gebieten in Geld umgewandelt worden ist. ”Der Kapitalismus benötigt nichtkapitalistische, nicht lohnabhängige und sich im Besitz autonomer Kaufkraft befindlicher Käufer, um einen Teil seiner Waren loszuwerden.” (Rosa Luxemburg)
Bevor wir betrachten, wo und wie das Kapital diese ”autonome” Kaufkraft findet, müssen wir zunächst den Akkumulationsprozess weiterverfolgen.
Die kapitalistische Akkumulation: Faktor des Fortschritts und des Rückschritts
Wir haben bereits betont, dass das Wachstum des arbeitenden Kapitals unter dem Zwang der technischen Verbesserungen gleichzeitig die Produktivkräfte entwickelt. Doch neben diesem positiven und fortschrittlichen Aspekt der kapitalistischen Produktionsweise taucht ein rückschrittlicher, widersprüchlicher Faktor auf, der aus den Veränderungen der inneren Zusammensetzung des Kapitals entsteht.
Das akkumulierte Kapital ist in zwei ungleiche Teile aufgeteilt: Der größte Teil dient der Erweiterung des konstanten Kapitals, der kleinere wird für den Kauf zusätzlicher Arbeitskraft aufgewendet. Der Rhythmus in der Entwicklung des konstanten Kapitals beschleunigt sich also auf Kosten desjenigen des variablen Kapitals, und das konstante Kapital wächst im Verhältnis zum Gesamtkapital. Anders ausgedrückt erhöht sich die organische Zusammensetzung des Kapitals. Gewiss erhöht die Nachfrage nach mehr Arbeitern den absoluten Anteil des Proletariats am Sozialprodukt, doch sein relativer Anteil verringert sich, da das variable Kapital im Verhältnis zum konstanten und zum Gesamtkapital abnimmt. Aber auch das absolute Wachstum des variablen Kapitals, also des Lohnfonds, kann sich nicht unbegrenzt fortsetzen: An einem bestimmten Punkt erreicht es seine Sättigung. Tatsächlich treibt die ständige Erhöhung der organischen Zusammensetzung (in anderen Worten: die technische Entwicklung des Kapitals) die Entwicklung der Produktivkräfte und Arbeitsproduktivität derart voran, dass das fortgesetzte Wachstum des Kapitals, weit davon entfernt, neue Arbeitskräfte zu absorbieren, im Gegenteil darin endet, einen Teil jener Arbeitskraft, die bereits in die Produktion integriert war, auf den Markt zu werfen und so ein „Phänomen“ zu produzieren, das eine Eigentümlichkeit des dekadenten Kapitalismus ist: die permanente Arbeitslosigkeit, Ausdruck eines relativen und konstanten „Überschusses“ von Arbeitern.
Andererseits gewinnen die gigantischen Proportionen, die die Produktion nun erreicht hat, ihre volle Bedeutung erst durch den Umstand, dass die Masse der Produkte oder Gebrauchswerte schneller wächst als die ihr entsprechenden Tauschwerte, sprich: als der Wert des konsumierten konstanten Kapitals, des variablen Kapitals und des Mehrwerts. Zum Beispiel: Eine Maschine zum Preis von 1000 Franken, mit der zwei Arbeiter in der Lage sind, 1000 Einheiten eines bestimmten Produkts herzustellen, wird durch eine ausgereiftere Maschine zum Preis von 2000 Franken ersetzt, mit der aber ein Arbeiter das Drei- bis Vierfache produzieren kann. Man kann nun einwenden, dass der Arbeiter mit seinem Lohn mehr Produkte kaufen kann, da ja mit weniger Arbeit ein Mehr an Waren hergestellt werden kann. Man vergisst dabei aber völlig, dass diese Produkte vor allem Waren sind und dass auch die Arbeitskraft eine Ware ist. Folglich kann diese Ware Arbeitskraft, wie wir dies bereits zu Beginn sagten, nur zu ihrem Tauschwert, der ihren Reproduktionskosten entspricht, verkauft werden. Diese Reproduktionskosten stellen umgekehrt das strikte Existenzminimum für die Arbeiter dar. Wenn nun wegen des technischen Fortschritts die Lebenshaltungskosten reduziert werden, dann wird auch der Lohn entsprechend reduziert. Und selbst wenn sich diese Kürzung wegen eines für das Proletariat günstigen Kräfteverhältnisses nicht proportional zur Verminderung der Produktionskosten verhält, so muss sie sich auf jeden Fall innerhalb der Grenzen bewegen, die mit den Erfordernissen der kapitalistischen Produktionsweise vereinbar sind.
Der Akkumulationsprozess vertieft also einen ersten Widerspruch: das Wachstum der Produktivkräfte auf der einen Seite, die Reduzierung der in der Produktion tätigen Arbeitskräfte und die Entwicklung eines relativen und konstanten Überschusses an Arbeitern auf der anderen Seite. Dieser Widerspruch ruft einen weiteren hervor. Wir haben bereits angesprochen, welche Faktoren die Mehrwertrate bestimmen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass sich bei einer unveränderlichen Mehrwertrate die Masse des Mehrwerts und somit auch die Masse des Profits immer proportional zur Masse des in der Produktion verausgabten variablen Kapitals verhält. Wenn nun das variable Kapital im Verhältnis zum Gesamtkapital abnimmt, dann vermindert sich auch die Profitmasse im Verhältnis zum Gesamtkapital und sinkt infolgedessen die Profitrate. Der Fall der Profitrate verschärft sich in dem Maß, in dem die Akkumulation voranschreitet und das konstante Kapital im Verhältnis zum variablen Kapital wächst, während die Profitmasse weiter wächst (in Folge einer Steigerung der Mehrwertrate). Es findet nun also keineswegs eine Verminderung der Ausbeutungsintensität statt, sondern es wird nur weniger Arbeit im Verhältnis zum Gesamtkapital aufgewendet, die aber auch weniger Gratisarbeit liefert. Mehr noch, der Akkumulationsrhythmus wird beschleunigt, weil er den Kapitalisten ständig quält, ihn nie zur Ruhe kommen lässt und zwingt, aus einer gegebenen Anzahl von Arbeitern den maximalen Mehrwert herauszupressen, um so immer mehr Mehrwert zu akkumulieren.
Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate erzeugt die zyklischen Krisen und ist ein mächtiger Beschleunigungsfaktor im Zerfall des dekadenten Kapitalismus. Ferner liefert es uns eine Erklärung für den Kapitalexport, der ein spezifischer Zug des imperialistischen und monopolistischen Kapitalismus ist. „Der Kapitalexport“, sagt Marx, „ ist nicht auf die absolute Unmöglichkeit der inneren Anlage zurückzuführen, sondern auf die Möglichkeit der ausländischen Anlage zu einer höheren Profitrate.” Lenin bestätigt diesen Gedanken: ”Die Notwendigkeit des Kapitalexports ergibt sich aus der Überreife des Kapitalismus in einigen Ländern, in denen die vorteilhaften Anlagen (was wir hervorheben:) - rückständige Landwirtschaft, elende Massen - nur noch mangelhaft vorhanden sind.”
Ein weiterer Faktor, der die Akkumulation zu beschleunigen hilft, ist der Kredit, der heute auf die bürgerlichen Ökonomen und Sozialdemokraten auf ihrer Suche nach Heilmitteln und Lösungen eine magische Wirkung ausübt. Im Lande Roosevelts und in allen Planwirtschaften, für DeMan, die Bürokraten des CGT und andere Retter des Kapitalismus übte er einen großen Zauber aus. Denn es schien, als habe der Kredit die Eigenschaft, Kaufkraft zu schaffen.
Doch wenn wir all den pseudowissenschaftlichen und verlogenen Kram einmal beiseite lassen, können wir den Kredit einfach folgendermaßen definieren: Mittels seines Finanzapparates wird dem Kapital zur Verfügung gestellt:
a) zurzeit im Produktionsprozess nicht benötigte und zur Erneuerung des konstanten Kapitals bestimmte Summen;
b) jener Teil des Mehrwerts, den die Bourgeoisie nicht unverzüglich konsumiert oder den sie nicht akkumulieren kann;
c) Summen, die nichtkapitalistischen Schichten (Bauern, Handwerker) oder privilegierten Schichten der Arbeiterklasse zur Verfügung stehen,
Mit einem Wort: Es handelt sich hierbei um ERSPARNISSE oder potenzielle Kaufkraft.
Daher kann eine Kreditoperation bestenfalls zu nicht viel mehr führen, als zu einer Umwandlung von latenter Kaufkraft in neue Kaufkraft. Darüber hinaus ist dies ein Problem, das nur diejenigen interessiert, die müßige Zuschauer amüsieren wollen. Uns interessiert jedoch die Tatsache, dass Ersparnisse zur Kapitalisierung mobilisiert werden können und somit die akkumulierte Kapitalmasse anwachsen lassen. Ohne Kredit wären die Ersparnisse nur gehortetes Geld und kein Kapital. ”Der Kredit lässt die Ausdehnungsmöglichkeit der Produktion auf unermessliche Weise anwachsen und bildet die treibende interne Kraft zur ständigen Überwindung der Grenzen des Marktes.” (R. Luxemburg)
Ein dritter Beschleunigungsfaktor muss erwähnt werden. Es ist der Bourgeoisie nicht möglich, ihren eigenen Konsum dem Schwindel erregenden Wachstum der Mehrwertmenge anzupassen. Ihr Magen, so unersättlich er auch sein mag, kann das Mehr an produziertem Mehrwert nicht absorbieren. Selbst wenn ihre Völlerei sie zu einem erhöhten Konsum treiben würde, wäre sie nicht dazu in der Lage, denn sie ist dem unverrückbaren Gesetz der Konkurrenz unterworfen: die Produktion zu steigern, um die Preise zu senken. Da der Teil des Mehrwerts, der konsumiert wird, sich im Verhältnis zum Gesamtmehrwert verringert, steigt die Akkumulationsrate. Somit haben wir einen weiteren Grund für die Schrumpfung des kapitalistischen Marktes.
Wir wollen hier noch einen vierten Beschleunigungsfaktor erwähnen, der parallel zur Entwicklung des Banken- und Kreditkapitals auftritt und ein Produkt des selektiven Konkurrenzprozesses ist: die Konzentration von Kapital und Produktionsmitteln in gigantischen Unternehmungen, die, indem sie den Mehrwert für die Akkumulation en gros steigern, ungleich schneller die Kapitalmasse vergrößern. Da sich diese Unternehmen organisch zu parasitären Monopolen entwickeln, werden sie auch zu einem bösartigen Desintegrationsherd in der Periode des Imperialismus.
Fassen wir also die Grundwidersprüche zusammen, die die kapitalistische Produktionsweise untergraben:
a) Auf der einen Seite hat die Produktion ein Niveau erreicht, das in den Massenkonsum gemündet ist; auf der anderen Seite bringen die Erfordernisse dieser Produktion die Fundamente des Konsums innerhalb des kapitalistischen Marktes zum Schwinden. Der relative und absolute Anteil des Proletariats am Gesamtprodukt nimmt ab, der individuelle Konsum der Kapitalisten wird relativ eingeschränkt.
b) Es ist notwendig, jenen Teil des Gesamtprodukts außerhalb des kapitalistischen Marktes zu realisieren, der innerhalb nicht konsumiert werden kann. Dieser Teil entspricht dem akkumulierten Mehrwert, der unter dem Druck diverser, beschleunigender Faktoren immer schneller und permanent wächst.
Es ist daher notwendig, auf der einen Seite das Produkt zu realisieren, ehe die Produktion wieder beginnen kann, und auf der anderen Seite die Absatzmärkte zu vergrößern, damit das Produkt realisiert werden kann.
Wie Marx unterstrich: ”Die kapitalistische Produktion muss auf ständig größerer Stufenleiter produzieren, die aber gerade gar nichts mit der gegenwärtigen Nachfrage zu tun hat, sondern von der ständigen Ausdehnung des Weltmarktes abhängt. Die Nachfrage der Arbeiter genügt keineswegs, da der Profit ja gerade aus dem Umstand entsteht, dass die Nachfrage der Arbeiter kleiner ist als der Wert der von ihnen hergestellten Produkte und er ist um so größer, je kleiner diese Nachfrage ist. Die wechselseitige Nachfrage der Kapitalisten ist ebenso ungenügend.”
Wie also gelingt diese kontinuierliche Ausdehnung des Weltmarktes, die Erschließung und ständige Schaffung und Vergrößerung von außerkapitalistischen Märkten, deren lebenswichtige Bedeutung für den Kapitalismus Rosa Luxemburg hervorhob? Aufgrund seiner historischen Stellung in der Evolution der Gesellschaft muss der Kapitalismus, um weiter zu überleben, den Kampf weiterführen, den er zunächst begonnen hatte, um das Fundament für die Entwicklung seiner Produktion zu schaffen. Mit anderen Worten: Um den Mehrwert, den er aus jeder Pore ausschwitzt, in Geld umzuwandeln und zu akkumulieren, muss der Kapitalismus die alten Wirtschaftsweisen, die bis dahin alle historischen Erschütterungen überlebt hatten, auflösen. Um die Produkte, die er in der kapitalistischen Sphäre nicht verkaufen kann, loszuwerden, muss er Käufer finden, die ihrerseits nur in einer Warenwirtschaft existieren können. Ferner benötigt der Kapitalismus, um das Produktionsniveau zu halten, große Vorräte an Rohstoffen, die er sich nur in den Ländern aneignen kann, wo die Eigentumsformen keine Barriere gegen seine Ziele darstellen und die notwendige Arbeitskraft zur Ausbeutung dieser begehrten Reichtümer verfügbar ist. Wo immer noch solche Sklavenhalter- oder Feudalgesellschaften oder bäuerliche Subsistenzwirtschaft vorkamen, in denen der Produzent an die Produktionsmittel gebunden war und für die Befriedigung seiner unmittelbaren Bedürfnisse arbeitete, musste der Kapitalismus daher die Bedingungen schaffen und den Weg öffnen, um seine Ziele zu erreichen. Mit Gewalt, Enteignung, der Steuerschraube und der Unterstützung der herrschenden Schichten dieser Gegenden zerstörte er zuallererst das Gemeineigentum, wandelte die Produktion zur Bedürfnisbefriedigung in eine Produktion für den Markt um, etablierte neue Produktionen, die seinen eigenen Bedürfnissen entsprachen, schnitt die bäuerliche Wirtschaft von jenen Handwerkern ab, die sie ergänzt hatten. So schuf er einen Markt, auf dem der Bauer gezwungen war, seine landwirtschaftlichen Produkte – die alles waren, was er noch produzieren konnte – im Austausch für den in den kapitalistischen Fabriken hergestellten Ramsch zu verkaufen. In Europa hatte bereits die landwirtschaftliche Umwälzung des 15. und 16. Jahrhunderts die Enteignung und Vertreibung eines Teils der ländlichen Bevölkerung bewirkt und den Markt für die entstehende kapitalistische Produktionsweise geschaffen. Marx bemerkte diesbezüglich, dass erst die Vernichtung der häuslichen Baumwollindustrie dem heimischen Markt eines Landes zur notwendigen Ausdehnung und zum Zusammenwachsen verhelfen konnte.
In seiner Unersättlichkeit macht der Kapitalismus hier jedoch nicht Halt. Die Realisierung des Mehrwerts genügt nicht. Nun muss der Kapitalismus die unabhängigen Produzenten ausrotten, die aus den primitiven Gesellschaften hervorgegangen waren und noch immer im Besitz eigener Produktionsmittel waren. Er muss ihre Produktion ersetzen, und zwar durch kapitalistische Produktion, um Anlagefelder für die Massen akkumulierten Kapitals zu finden, welche ihn zu ersticken drohen. Die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem in den Vereinigten Staaten eingeleitete Industrialisierung der Landwirtschaft ist ein schlagendes Beispiel für den Auflösungsprozess der bäuerlichen Wirtschaften, der die Kluft zwischen dem kapitalistischen Farmer einerseits und dem Landarbeiter andererseits weiter öffnete.
In den Kolonien füllte trotz der Tatsache, dass der Prozess der kapitalistischen Industrialisierung sehr begrenzt blieb, die Enteignung und Proletarisierung der eingeborenen Massen das Reservoir, aus dem der Kapitalismus die Arbeitskräfte schöpft, die ihm die billigen Rohstoffe liefern.
Infolgedessen bedeutet die Realisierung des Mehrwerts für den Kapitalismus die fortschreitende und ständige Annexion vorkapitalistischer Wirtschaftsformen, deren Existenz lebenswichtig für ihn ist, die er aber dennoch vernichten muss, wenn er seinen Daseinsgrund fortsetzen will: die Akkumulation. Daraus entsteht ein weiterer, mit dem oben Genannten verbundener Grundwiderspruch: Die Entwicklung der Akkumulation und der kapitalistischen Produktion nährt sich von der ”menschlichen” Substanz der außerkapitalistischen Gebiete, löscht diese aber auch zunehmend aus. Was einst als eine ”autonome” Kaufkraft erschien, die in der Lage war, Mehrwert zu absorbieren - wie der Konsum der Bauern -, wird zu einer spezifisch kapitalistischen Kaufkraft (mit anderen Worten: zu einer Kaufkraft, die in die engen Grenzen gezwängt ist, die durch das variable Kapital und den konsumierbaren Mehrwert bestimmt werden), sobald die Bauernschaft in Proletarier und Kapitalisten getrennt ist. Der Kapitalismus sägt also in gewisser Weise den Ast ab, auf dem er sitzt.
Man könnte sich natürlich eine Epoche vorstellen, in der der weltweit verbreitete Kapitalismus ein Gleichgewicht zwischen den Produktivkräften und der gesellschaftlichen Harmonie hergestellt hat. Doch es scheint uns, dass, wenn Marx in seinen Schemata über die erweiterte Produktion diese Hypothese einer vollständig kapitalistischen Gesellschaft aufgestellt hat, in der es nur den Gegensatz zwischen Kapitalisten und Proletariern gibt, dies genau deshalb geschah, um die Absurdität einer kapitalistischen Gesellschaft zu demonstrieren, die eines Tages ein Gleichgewicht und einen Einklang mit den Bedürfnissen der Menschheit erlangt. Denn dies würde bedeuten, dass der zu akkumulierende Mehrwert dank der Ausweitung der Produktion einerseits durch den Kauf neuer Produktionsmittel, andererseits durch die zusätzliche Nachfrage der Arbeiter (wo sie sonst finden?) direkt realisiert werden kann und dass die Kapitalisten sich von Wölfen in friedliche Schafe verwandeln würden.
Wäre Marx in der Lage gewesen, seine Schemata weiterzuentwickeln, wäre er zum gegenteiligen Schluss gelangt: dass ein kapitalistischer Markt, der sich nicht mehr durch die Einverleibung nicht-kapitalistischer Gebiete ausdehnen kann, dass eine allumfassende kapitalistische Produktion – die historisch unmöglich ist – das Ende des Akkumulationsprozesses und das Ende des Kapitalismus selbst bedeuten würde. Folglich dient die Darstellung dieser Schemata als Abbild einer kapitalistischen Produktion, die in der Lage ist, ohne Ungleichgewicht, ohne Überproduktion, ohne Krisen zu überdauern, nur dazu, die marxistische Theorie bewusst zu verfälschen, wie manche „Marxisten“ es tun.
Dem Kapital gelingt es nicht, seine gewaltigen Produktionssteigerungen an die Kapazitäten der Märkte, derer er sich bemächtigt hat, anzupassen. Einerseits dehnen sich die Märkte nicht fortlaufend aus, während andererseits die mannigfaltigen Beschleunigungsfaktoren, die wir erwähnt haben, der Akkumulation einen Schwung verleihen, der die Produktion schneller wachsen lässt, als sich die außerkapitalistische Absatzmärkte ausweiten. Der Akkumulationsprozess erzeugt nicht nur eine enorme Menge an Tauschwerten, sondern die wachsende Kapazität der Produktionsmittel lässt, wie wir bereits gesagt haben, die Masse an Produkten oder Gebrauchswerten in noch beträchtlicherem Ausmaß wachsen. Die Folge ist, dass der Produktionsprozess zwar in der Lage ist, den Massenkonsum zu befriedigen, aber der Verkauf seiner Produkte einer ständigen Anpassung an der Aufnahmefähigkeit, die nur außerhalb der kapitalistischen Sphäre existiert, untergeordnet ist.
Wenn diese Anpassung nicht stattfindet, entsteht eine relative Überproduktion von Waren, und zwar nicht in Bezug auf die Konsumkapazitäten, sondern in Bezug auf die Kaufkraft sowohl innerhalb als auch außerhalb der kapitalistischen Sphäre.
Träte die Überproduktion erst dann ein, wenn alle Mitglieder einer Nation ihre dringendsten Bedürfnisse befriedigt hätten, so wäre es in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft nie zu einer generellen oder partiellen Überproduktion gekommen. Wenn der Markt an Schuhen, Stoffen, Wein und Kolonialwaren gesättigt ist, heißt dies, dass ein Teil der Nation, sagen wir zwei Drittel, auch tatsächlich ihren Bedarf an diesen Schuhen usw. mehr als befriedigt hat? Die Überproduktion ist keine Frage von absoluten Bedürfnissen; sie richtet sich nur nach jenen Bedürfnissen, die ”bezahlbar” (Marx) sind.
Diese Art von Überproduktion ist in keiner älteren Gesellschaftsform vorzufinden. Der niedrige Stand der Produktionsmittel erforderte die Ausbeutung von Sklaven, um gewaltsam jeden Hang einzuschränken, die Bedürfnisse der Massen zu erweitern. Falls zufällig eine Überproduktion auftrat, so wurde sie entweder durch Lagerung oder durch die Ausweitung des Luxuskonsums absorbiert. Mit anderen Worten: Es handelte sich also um keine eigentliche Überproduktion, sondern um einen Überkonsum der Reichen. Desgleichen ist unter dem Feudalregime die geringe Produktion schnell verbraucht worden: Der Leibeigene musste den größten Teil seines Produkts zur Befriedigung der Bedürfnisse des Feudalherrn abgeben und bemühte sich mit dem Rest, nicht zu verhungern. Hungersnöte und Kriege ließen keine Gefahr der Überproduktion befürchten.
Unter kapitalistischem Regime überfluten die Produktivkräfte ein Fundament, das zu klein geworden ist, um sie zu umfassen: Die kapitalistischen Produkte sind im Überfluss vorhanden, doch sie hegen puren Widerwillen gegen die einfachen Bedürfnisse der Menschen, sie geben sich nur dem Austausch gegen Geld hin, und wenn kein Geld vorhanden ist, ziehen sie es vor, sich in Fabriken, Geschäften oder Lagerhallen anzuhäufen oder gar zu verrotten.
Die chronischen Krisen des aufsteigenden Kapitalismus
Die einzigen Grenzen der kapitalistischen Produktion sind diejenigen, die ihr durch die Möglichkeit der Kapitalverwertung aufgezwungen werden: Solange Mehrwert produziert und kapitalisiert werden kann, schreitet die Produktion voran. Ihre Unausgewogenheit zu den allgemeinen Konsumkapazitäten erscheint erst, wenn die Warenflut an die Grenzen des Marktes stößt und die Kanäle der Zirkulation blockiert, mit anderen Worten: wenn die Krise ausbricht.
Es ist offensichtlich, dass die Krise nicht jener Definition entspricht, die sie auf eine Gleichgewichtsstörung zwischen den verschiedenen Produktionssektoren reduziert, wie dies gewisse bürgerliche und selbst marxistische Ökonomen tun. Marx hebt hervor, dass ”in Perioden genereller Überproduktion die Überproduktion in gewissen Sphären nur das Ergebnis, die Konsequenz der Überproduktion in den Hauptzweigen ist. Es handelt sich nur um eine relative Überproduktion, weil es Überproduktion in anderen Sphären gibt.” Gewiss kann eine zu starke Diskrepanz z.B. zwischen dem Produktionsmittel herstellenden Sektor und dem Konsumartikel herstellenden Sektor eine partielle Krise auslösen, kann sogar der ursprüngliche Grund einer allgemeinen Krise sein. Die Krise ist das Produkt einer allgemeinen und relativen Überproduktion, einer Überproduktion von Waren aller Art (seien es nun Produktionsmittel oder Konsumgüter) im Verhältnis zur Nachfrage auf dem Markt.
Kurz, die Krise ist Ausdruck der Unfähigkeit des Kapitalismus, aus der Ausbeutung der Arbeiter Profit zu schlagen. Wir haben bereits aufgezeigt, dass es nicht ausreicht, unbezahlte Arbeit herauszupressen und diese in Form eines neuen Wertes, des Mehrwerts, in das Produkt zu integrieren. Sie muss durch den Verkauf des Gesamtprodukts zu seinem Wert oder besser zu seinem Produktionspreis, der sich aus dem Kostpreis (dem Wert des verwendeten Kapitals, sowohl des konstanten als auch des variablen) und dem gesellschaftlichen Durchschnittsprofit zusammensetzt, in der Geldform materialisiert werden. Andererseits ist der Marktpreis, wenngleich theoretisch, der monetäre Ausdruck des Produktionspreises, unterscheidet sich in der Realität jedoch von Letzterem insofern, als er den Kurven folgt, die vom kaufmännischen Gesetz von Angebot und Nachfrage bewirkt werden, während er nichtsdestotrotz unter dem Einfluss des Wertes steht. Man muss daher betonen, dass Krisen durch abnormale Preisbewegungen gekennzeichnet sind und in beträchtlichen Entwertungen bis hin zur totalen Vernichtung von Werten münden, was einem Verlust von Kapital entspricht. Die Krise offenbart jäh, dass eine zu große Masse an Produktionsmitteln, Arbeitsmitteln und Konsumgütern hergestellt worden ist, so dass es unmöglich geworden ist, diese zu einer bestimmten Profitrate als Ausbeutungsinstrumente der Arbeiter anzuwenden. Das Sinken der Profitrate unter ein für die Bourgeoisie akzeptables Niveau bis zur Gefahr, dass jeglicher Profit verschwindet, bewirkt eine Störung des Produktionsprozesses und kann ihn sogar lähmen. Die Maschinen geraten nicht etwa ins Stocken, weil sie mehr produzieren, als konsumiert werden kann, sondern weil das existierende Kapital nicht mehr den Mehrwert erhält, der es am Leben erhält. Die Krise löst den Nebel über der kapitalistischen Produktionsweise auf: Auf einen Schlag offenbart sich der grundlegende Widerspruch zwischen Gebrauchswert und Tauschwert, zwischen den Bedürfnissen der Menschen und den Bedürfnissen des Kapitals. ”Es werden”, wie Marx sagte, ”zu viele Waren produziert, als dass sie mit ihrem Wert und Mehrwert unter den Verteilungs- und Konsumptionsbedingungen der kapitalistischen Produktion realisiert und wieder in neues Kapital verwandelt werden könnten. Es werden nicht zu viele Reichtümer produziert. Aber periodisch wird zuviel Reichtum in seinen widersprüchlichen kapitalistischen Formen produziert.”
Die mit beinahe mathematischer Regelmäßigkeit wiederkehrenden Krisen bilden einen der spezifischen Züge der kapitalistischen Produktionsweise. Weder diese Regelmäßigkeit noch die Eigentümlichkeiten der kapitalistischen Krisen finden sich in irgendeiner der vorangehenden Gesellschaftsformen. Krisen, die aus einem Übermaß an Reichtum entstehen, waren unbekannt in den antiken patriarchalischen oder feudalen Wirtschaftsweisen, die hauptsächlich auf der Bedürfnisbefriedigung der herrschenden Klasse basierten und weder vom technischen Fortschritt noch von einem Markt, der einen breiten Austausch ermöglichte, abhängig waren. Wie wir bereits aufgezeigt haben, war Überproduktion in ihnen unmöglich, und Wirtschaftskatastrophen waren entweder das Resultat natürlicher Ursachen (Dürre, Überschwemmungen, Epidemien) oder die Folge gesellschaftlicher Faktoren (wie Kriege).
Wirtschaftskrisen treten erst mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts auf, als der Kapitalismus, gefestigt durch harte und erfolgreiche Kämpfe gegen die feudale Gesellschaft, in die Blütephase seiner Expansion tritt und auf einer soliden industriellen Grundlage mit der Eroberung der Welt beginnt. Seither entwickelte sich die kapitalistische Produktion ungleich. Auf eine Phase der fieberhaften Produktion zur Befriedigung der wachsenden Forderungen des Weltmarktes folgte eine Verstopfung des Marktes. Das Abebben der Zirkulation erschütterte den ganzen Produktionsmechanismus. Das Wirtschaftsleben bildet so eine lange Kette, deren einzelne Glieder einen Zyklus darstellen, der sich in eine Abfolge von Perioden durchschnittlicher Aktivität, von Prosperität, Überproduktion, Krise und Depression unterteilt. Die Bruchstelle dieses Zyklus‘ ist die Krise, die ”momentane und gewaltsame Lösung der Widersprüche, gewaltsamer Ausbruch, der für einen Augenblick das gestörte Gleichgewicht wiederherstellt” (Marx). Krise und Prosperität sind also unzertrennlich miteinander verbunden und bedingen sich wechselseitig.
Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts lag das Gravitationszentrum der zyklischen Krisen in Großbritannien, der Wiege der industriellen Revolution. Die erste Überproduktionskrise ereignete sich 1825 (ein Jahr zuvor hatte die Gewerkschaftsbewegung begonnen, sich auf der Grundlage des Koalitionsgesetzes, das die Arbeiter der Bourgeoisie abgerungen hatten, auszubreiten). Die Ursprünge diese Krise waren für damalige Begriffe seltsam: Die stattlichen Anleihen, die in den vorangegangenen Jahren in London von den jungen südamerikanischen Republiken aufgenommen worden waren, waren allesamt ausgegeben, was zu einer plötzlichen Schrumpfung des Marktes führte. Die Krise betraf vor allem die Baumwollindustrie und führte zu dem Verlust ihres Monopols und zu Aufständen der Baumwollarbeiter. Die Krise wurde durch die Ausdehnung der Absatzgebiete überwunden, die im Wesentlichen auf England begrenzt gewesen waren: Erstens fand das Kapital in England selbst noch weite Regionen auf dem Land vor, wo es sich realisieren und kapitalisieren konnte, und zweitens eröffneten die Anfänge des Exports nach Indien einen Markt für die Baumwollindustrie. Die Errichtung des Eisenbahnnetzes und die Entwicklung einer Werkzeugbauindustrie öffneten der Maschinenbauindustrie einen Markt und sorgten dafür, dass Letztere in den Himmel schoss. 1836 brach die Baumwollindustrie nach einer langen Depression, die einer Periode der Prosperität gefolgt war, zusammen; dies führte zu einer Generalisierung der Krise, und die verhungernden Weber wurden einmal mehr als Sühneopfer dargeboten. Die Krise wurde 1839 mit der Ausdehnung des Eisenbahnnetzes überwunden, aber inzwischen war die Chartistenbewegung geboren worden, Ausdruck der ersten politischen Bestrebungen des englischen Proletariats. 1840 führte eine erneute Depression in der englischen Textilindustrie zu Arbeiterrevolten; die Krise selbst hielt bis 1843 an. 1840 setzte eine erneute Expansion ein, die 1845 zu einer Periode großer Prosperität führte. 1847 brach eine allgemeine Krise aus, die sich auf den Kontinent ausdehnte. Auf sie folgte der Pariser Aufstand von 1848 sowie die deutsche Revolution, die bis 1849 andauerte, als sich die amerikanischen und australischen Märkte den Europäern und vor allem der britischen Industrie öffneten. Gleichzeitig erlebte der Eisenbahnbau in Kontinentaleuropa einen enormen Aufschwung.
Bereits zu dieser Zeit hatte Marx im Kommunistischen Manifest die allgemeinen Merkmale der Krisen festgehalten und die Antagonismen zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und ihrer bürgerlichen Aneignung betont. Mit brillantem Scharfsinn hatte er die Perspektiven der kapitalistischen Produktionsweise skizziert. ”Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; andererseits durch die Eroberung neuer Märkte und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, dass sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert.”
Mit dem Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errang der Industriekapitalismus die Vorherrschaft auf dem Kontinent. 1860 begann der industrielle Aufschwung in Deutschland und Österreich. Als Folge breiten sich auch die Krisen immer mehr aus. Die Krise von 1857 ist dank der Ausdehnung des Kapitals vor allem nach Zentraleuropa nur von kurzer Dauer. Die britische Baumwollindustrie erreicht 1860, mit der Sättigung der Märkte in Indien und Australien, ihren Gipfel. Der Sezessionskrieg in den Vereinigten Staaten unterbricht die Zufuhr von Baumwolle, was in ihren totalen Zusammenbruch mündet und eine allgemeine Krise nach sich zieht. Doch das englische und das französische Kapital verloren keine Zeit und sicherten sich zwischen 1860 und 1870 starke Positionen in Ägypten und in China.
Der Zeitraum von 1850 bis 1873 verlief für die Entwicklung des Kapitals äußerst günstig. Er war gekennzeichnet durch lange Prosperitätsphasen (ca. sechs Jahre) und kurze Depressionen von ungefähr zwei Jahren. Während der folgenden Periode, von der Krise 1873 bis 1896, wurde der Prozess in sein Gegenteil verkehrt: chronische Depressionen, unterbrochen von kurzen Aufschwungphasen. Deutschland (nach dem Frieden von Frankfurt 1871) und die Vereinigten Staaten entpuppten sich als gefährliche Konkurrenten für England und Frankreich. Die erstaunliche Entwicklung der kapitalistischen Produktion übertraf den Rhythmus der Marktdurchdringung: Es folgten die Krisen von 1882 und 1890. Die großen Kolonialkriege um die Aufteilung der Welt waren bereits im Gange, und unter dem Druck einer gewaltigen Mehrwertakkumulation katapultierte sich der Kapitalismus selbst in die Phase des Imperialismus, der in die allgemeine Krise und den Bankrott führen sollte. Unterdessen gab es die Krisen von 1900 (der Burenkrieg und der Boxeraufstand) und 1907. Die Krise von 1913/14 sollte schließlich im Ersten Weltkrieg explodieren.
Ehe wir uns der Analyse der allgemeinen Krise des dekadenten Imperialismus zuwenden, die Inhalt des zweiten Teils unserer Studie ist, müssen wir die Kurven aller Krisen des aufstrebenden Kapitalismus untersuchen.
Es gibt zwei Extreme im Wirtschaftszyklus:
a) die letzte Phase der Prosperität, die zum Scheitelpunkt der Akkumulation führt, ausgedrückt in der höchsten organischen Zusammensetzung des Kapitals; die Macht der Produktivkräfte erreicht einen Punkt, an dem sie die Marktkapazitäten sprengt; wie wir bereits betonten, bedeutet dies auch, dass die niedrige Profitrate, die der hohen organischen Zusammensetzung entspricht, mit den Erfordernissen der Kapitalverwertung zusammenprallt;
b) den Tiefpunkt der Krise, der einer vollständigen Lähmung der Kapitalakkumulation gleichkommt und der Depression vorangeht.
Zwischen diesen beiden Polen verläuft einerseits die Krise selbst, d.h. eine Periode der Umwälzungen und der Zerstörung von Tauschwerten, und andererseits die Depression, auf die der Wiederaufschwung und die Prosperität folgen, in der neue Werte geschaffen werden.
Das instabile Produktionsgleichgewicht wird, unterminiert durch die fortschreitende Vertiefung der Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise, beim Ausbruch der Krise abrupt umgestoßen und kann sich nur stabilisieren, wenn sich die Kapitalwerte wieder gesund geschrumpft haben. Dieser Reinigungsprozess wird durch die Preissenkungen bei den Endprodukten eingeleitet, während die Rohstoffpreise noch einige Zeit ansteigen. Die Reduzierung der Warenpreise bewirkt natürlich eine Entwertung des Kapitals, das in diesen Waren materialisiert ist, und ihr Fall endet erst mit der Zerstörung eines kleineren oder größeren Teils des Kapitals, je nach Schwere und Intensität der Krise. Es gibt zwei Aspekte im Zerstörungsprozess: auf der einen Seite einen Verlust an Gebrauchswerten in Folge eines völligen oder teilweise Stopps des Produktionsapparates, was zur Entwertung ungenutzter Maschinerien und Rohstoffe führt, und auf der anderen Seite einen Verlust an Tauschwerten, was bedeutsamer ist, da es den Prozess der Produktionserneuerung angreift, indem es ihn aufhält und desorganisiert. Der erste Schock trifft das konstante Kapital. Die Verminderung des variablen Kapitals erfolgt nicht gleichzeitig, denn die Senkung der Löhne hinkt im Allgemeinen dem Preisverfall hinterher. Das Schrumpfen der Werte verhindert ihre Reproduktion im alten Ausmaß. Mehr noch, die Lähmung der Produktivkräfte hindert das Kapital, das sie darstellen, daran, als solches zu existieren: Als Kapital ist es tot und nicht vorhanden, auch wenn es in seiner materiellen Form weiter existiert. Der Prozess der Kapitalakkumulation ist ebenfalls unterbrochen, denn der akkumulierbare Mehrwert hat sich mit dem Preisverfall verflüchtigt, obwohl die Akkumulation von Gebrauchswerten dank bereits geplanter Produktionsausweitungen sehr wohl fortdauern kann.
Die schrumpfenden Werte ziehen schrumpfende Unternehmen nach sich: Die Schwächsten gehen unter oder werden von den Stärksten, die weniger von der Preissenkung betroffen sind, geschluckt. Dieser Konzentrationsprozess findet nicht ohne Auseinandersetzungen statt: Solange die Prosperität anhält, es also eine Beute zu teilen gibt, wird diese zwischen den verschiedenen Fraktionen der kapitalistischen Klasse gemäß dem investierten Kapital aufgeteilt. Doch sobald die Krise ausbricht und der Verlust für die Klasse in ihrer Gesamtheit unvermeidlich wird, versucht jeder Einzelkapitalist oder jede Kapitalistengruppe alles Erdenkliche, um den Verlust zu begrenzen oder gar auf den Nächsten abzuwälzen. Das Klasseninteresse löst sich unter dem Druck der Partikularinteressen auf, während es in normalen Zeiten durchaus respektiert wird. Wir werden umgekehrt aber sehen, dass in der allgemeinen Krise das Klasseninteresse vorherrscht.
Doch der Preisverfall, der es ermöglicht hatte, alte Warenlager zu liquidieren, kommt zu einem Ende. Das Gleichgewicht stellt sich langsam wieder ein. Die Kapitalwerte kehren auf einem niedrigeren Niveau zurück, die organische Zusammensetzung des Kapitals fällt ebenfalls. Gleichzeitig sinken Kostpreise, was hauptsächlich durch einen massiven Lohndruck bedingt ist. Der Mehrwert - der Sauerstoff des Kapitals - erscheint wieder und belebt langsam wieder den ganzen kapitalistischen Körper. Die liberalen Ökonomen feiern die Verdienste ihrer Gegengifte und die ”spontanen Reaktionen” des Systems. Die Profitrate steigt wieder an und wird ”interessant”. Kurz: Die Rentabilität der Unternehmen ist wieder hergestellt. Die Akkumulation kommt wieder in Gang. Sie schürt den Appetit der Kapitalisten und bereitet den Ausbruch einer neuen Überproduktion vor. Die Masse des akkumulierten Mehrwerts nimmt zu und verlangt nach neuen Absatzgebieten, bis jener Moment erreicht ist, in dem der Markt einmal mehr als eine Bremse der Produktionsentwicklung fungiert. Die Krise ist reif. Der Zyklus beginnt von neuem.
”Die Krisen erscheinen als ein Mittel, um das Feuer der kapitalistischen Entwicklung ständig von neuem zu entfachen und zu entfesseln.” (R. Luxemburg)
(Fortsetzung folgt)
Mitchell
[1] [46] Mitchell war Mitglied der Minderheit der Ligue des communistes internationalistes in Belgien und nahm mit der Konstituierung der Belgischen Fraktion 1937 an der Gründung der Kommunistischen Linken um die Zeitschrift Bilan teil.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutsche Revolution, Teil XI
- 2793 Aufrufe
Die Linkskommunisten und der Konflikt zwischen russischem Staat und Weltrevolution
In unserem Artikel “Der Rückfluss der revolutionären Welle und die Entartung der Kommunistischen Internationale” haben wir gezeigt, wie die Verhinderung der internationalen Ausweitung der Revolution durch die Bourgeoisie und der Rückfluss des Klassenkampfes eine opportunistische Reaktion der Komintern hervorgerufen haben. Diese opportunistische Tendenz innerhalb der Komintern stieß auf den Widerstand jener Kräfte, die sich später Linkskommunisten nannten. Nachdem auf dem II. Kongress der Komintern 1920 die Parole “Zu den Massen!” gegen den Widerstand der Gruppen des späteren Linkskommunismus in den Vordergrund gerückt worden war, sollte der III. Kongress, der im Sommer 1921 veranstaltet wurde, zum entscheidenden Moment im Kampf eben jener Linkskommunisten gegen den Beginn der Unterordnung der Weltrevolution unter die Interessen des russischen Staates werden.
Der Beitrag der KAPD
Auf dem III. Weltkongress griff die KAPD zum ersten Mal direkt in die Debatten ein und entwickelte erste Ansätze einer umfassenden Kritik an dem Vorgehen der Komintern. In ihren Beiträgen ‚Zur wirtschaftlichen Krise und die neuen Aufgaben der Komintern‘, über Fragen der Taktik, über die Rolle der Gewerkschaften und insbesondere über die Entwicklung in Russland betonte die KAPD gegen die Mehrheitsposition innerhalb der Komintern unaufhörlich die führende Rolle der Revolutionäre und die Unmöglichkeit der Bildung einer kommunistischen Massenpartei. Während die italienischen Delegierten, die noch 1920 so tapfer ihre abweichende Auffassung in der Parlamentarismusfrage gegenüber der Mehrheit in der Komintern vertreten hatten, sich kaum zur Entwicklung in Russland und zum Verhältnis zwischen der Sowjetregierung und der Komintern äußerten, war es vor allem das Verdienst der KAPD, diese Fragen auf dem Kongress aufgeworfen zu haben.
Bevor wir uns näher mit den Auffassungen und der Haltung der KAPD befassen, möchten wir noch einschränkend bemerken, dass die KAPD weit davon entfernt war, eine homogene und geschlossene Haltung gegenüber der neuen Periode und den sich überstürzenden Ereignissen einzunehmen. Zwar besaß sie den Mut, einen Anfang zu machen bei der Aufarbeitung der Lehren aus der neuen Periode (Parlamentarismus- und Gewerkschaftsfrage); zwar verstand sie die Unmöglichkeit der Aufrechterhaltung einer Massenpartei, doch offenbarte die KAPD trotz ihrer programmatischen Kühnheit einen Mangel an Vorsicht, Sorgfalt und politischer Stringenz bei der Einschätzung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen und in der Frage der politischen Organisation. Ohne alle Mittel bei der Verteidigung der bestehenden Organisation ausgeschöpft zu haben, neigte sie dazu, voreilige Schlüsse zu ziehen.
Es war nicht überraschend, dass die KAPD eine Reihe von Verirrungen mit dem Rest der revolutionären Bewegung damals teilte. Ähnlich wie die Bolschewiki meinte auch sie, dass die Partei die Macht ergreifen müsse und dass der nach der Machtergreifung installierte Staat ein “Arbeiterstaat” sein müsse.
Auf dem III.Kongress thematisierte die KAPD-Delegation das Verhältnis zwischen Staat und Partei folgendermaßen: “Wir verkennen keinen Augenblick, in welche Schwierigkeiten die russische Sowjetmacht durch die Verzögerung der Weltrevolution geraten ist. Aber wir sehen zugleich die Gefahr, dass aus diesen Schwierigkeiten ein Widerspruch zwischen den Interessen des revolutionären Weltproletariats und den Augenblicksinteressen Sowjetrusslands – scheinbar oder tatsächlich – sich ergibt (...) Aber die politische und organisatorische Loslösung der III. Internationalen aus dem System der russischen Staatspolitik ist das Ziel, auf das hingearbeitet werden muss, wenn wir den Bedingungen der westeuropäischen Revolution gerecht werden wollen.” (Hempel/J.Appel, “Protokolle des III. Weltkongresses der Komintern”, S.224)
Während des III. Kongresses neigte die KAPD dazu, die Folgen der von der Bourgeoisie vereitelten Ausdehnung der Revolution zu unterschätzen. Statt alle Lehren aus dieser verhinderten Ausweitung zu ziehen, statt sich der Argumentation Rosa Luxemburgs anzuschließen, die schon 1917 begriffen hatte, dass “in Russland (...) das Problem nur gestellt werden (konnte). Es konnte nicht in Russland gelöst werden, es kann nur international gelöst werden”, statt dem Aufruf des Spartakusbundes vom November 1918 zu folgen, in dem letzterer warnte: “Gelingt es Euren herrschenden Klassen, die proletarische Revolution in Deutschland wie in Russland abzuwürgen, dann werden sie sich mit doppelter Wucht gegen Euch wenden (...) Deutschland ist schwanger mit der sozialen Revolution, aber den Sozialismus kann nur das Weltproletariat verwirklichen”, neigte die KAPD dazu, die Ursache der allgemeinen Schwierigkeiten in Russland selbst zu suchen.
“Die in ihrem Glanz entstandene Idee einer kommunistischen Internationale ist und bleibt lebendig, aber sie ist nicht mehr verknüpft mit der Existenz Sowjetrusslands. Der Stern Sowjetrusslands ist heute für die Augen der revolutionären Arbeiter blasser geworden, in dem Maße, in dem sich Sowjetrussland immer deutlicher zu einem antiproletarischen, kleinkapitalistischen Bauernstaat entwickelt. Es macht wenig Freude, etwas derartiges auszusprechen, aber wir wissen, dass die klare Erkenntnis auch der härtesten Tatsache, dass das rücksichtslose Aussprechen solcher Erkenntnisse allein die Atmosphäre geben kann, die die Revolution zu ihrem Leben braucht. (...) Man muss verstehen, dass die russischen Kommunisten auch den ganzen Umständen ihres Landes entsprechend [48] , nach der Zusammensetzung der Bevölkerung und der außenpolitischen Lage, nichts anderes tun konnten, als eine Diktatur der Partei aufzurichten, die der einzige festgefügte, disziplinierte, funktionsfähige Organismus im ganzen Lande war, man muss verstehen, dass die Ergreifung der Macht durch die Bolschewiki trotz aller Schwierigkeiten unbedingt richtig war, und dass die Arbeiter von Mittel- und Westeuropa die weitaus meiste Schuld daran tragen, wenn Sowjetrussland heute, da es sich nicht auf die revolutionären Kräfte anderer Länder stützen kann, gezwungen ist, sich auf kapitalistische Mächte zu stützen.
Es ist eine Tatsache, dass Sowjetrussland sich heute auf die kapitalistischen Kräfte Europas und Amerikas stützen muss (...) Da Sowjetrussland heute gezwungen ist, sich in seiner inneren und äußeren Wirtschaftspolitik auf kapitalistische Kräfte zu stützen – wie lange wird angesichts dieser Tatsache Sowjetrussland bleiben? Wie lange und mit welchen Mitteln wird die RKP es noch durchsetzen können, dieselbe RKP zu bleiben, die sie war? Wird sie das durchsetzen können, indem sie Regierungspartei bleibt? Und wenn sie, um eine kommunistische Partei bleiben zu können, nicht mehr Regierungspartei bleiben könnte, wie soll man sich dann die weitere Entwicklung vorstellen?” (“Die Sowjetregierung und die III. Internationale”, in der Kommunistischen Arbeiterzeitung, Herbst 1921)
Die KAPD hat zwar die Gefahren erahnt, vor denen die Arbeiterklasse stand, aber eine falsche Erklärung geliefert. Statt zu betonen, dass der Lebensnerv der Revolution – die Macht und Initiative der Sowjets – in Russland abgetötet wurde, weil die Revolution weltweit scheiterte, statt zu zeigen, dass der Staat sich auf Kosten der Arbeiterklasse verstärkte, die Arbeiterräte entwaffnete und ihre Initiative erstickte, wählte die KAPD eine deterministische und – in der Praxis – fatalistische Argumentationsweise. Der Hinweis, dass “dass die russischen Kommunisten auch den ganzen Umständen ihres Landes entsprechend, nach der Zusammensetzung der Bevölkerung und der außenpolitischen Lage, nichts anderes tun konnten, als eine Diktatur der Partei aufzurichten”, zeigt, dass sie im Grunde nicht begriffen hatte, wie im Oktober 1917 die russische Arbeiterklasse und ihre Sowjets die Macht überhaupt ergreifen konnten. Die Idee von der Entstehung eines “kleinkapitalistischen Bauernstaates” stellt ebenfalls die Wirklichkeit auf den Kopf. Diese im zitierten Text erst im Keim vorhandenen Ideen sollten später von den Rätekommunisten zu einer ganzen Theorie ausformuliert werden.
Die IKS hat ausführlich die falschen und unmarxistischen Auffassungen der Rätekommunisten über die Entwicklung in Russland bloßgelegt (s. unsere Artikel in der Internationalen Revue Nr. 12 und 13 sowie unser auf Englisch erschienenes Buch The Dutch Left).
Insbesondere haben wir angegriffen:
die Theorie der doppelten Revolution, derzufolge es in den Industrieregionen Russlands eine proletarische, auf dem Lande aber eine bäuerlich-demokratische Revolution gegeben habe; eine Theorie, die in Teilen der KAPD mit dem Beginn des Rückflusses der revolutionären Welle und dem erstarkenden Staatskapitalismus 1921 aufkam;
den Fatalismus, der sich hinter der Auffassung verbarg, dass die russische Revolution notwendigerweise dem Übergewicht des Bauerntums erliegen musste und die Bolschewiki von vornherein zu ihrer Entartung verdammt gewesen seien;
die Trennung in unterschiedliche Teile der Welt (Meridian-Theorie), wonach es in Russland andere Mittel und Wege der Revolution gebe als in Westeuropa;
die falsche Kritik an den Handelsbeziehungen Russlands zum kapitalistischen Westen, weil sie den falschen Eindruck erweckt, dass man in Russland tatsächlich das Geld hätte abschaffen können und der “Aufbau des Sozialismus in einem Land” doch möglich sei.
Doch je länger man sich mit den Positionen der KAPD befasst, um so deutlicher wird die Konsequenz, mit der diese Organisation (wie auch die anderen linkskommunistischen Gruppen) ihr Hauptziel, die Klärung der politischen Fragen voranzutreiben, verfolgte.
Der wachsende Konflikt zwischen dem russischen Staat und den Interessen der Weltrevolution
Während die Komintern sich vorbehaltlos hinter die “Außenpolitik” des russischen Staates stellte, übte die KAPD-Delegation auf dem III. Weltkongress schonungslose Kritik und legte den Finger in die Wunde.
“Wir alle erinnern uns an die ungeheure propagandistische Wirkung der diplomatischen Noten Sowjetrusslands aus jener Zeit, wo die Arbeiter- und Bauernregierung in ihren Drohungen noch keine Rücksicht zu nehmen brauchte auf das Bedürfnis, Handelsverträge abzuschließen oder gar auf die Klauseln schon abgeschlossener Verträge. Die revolutionäre Bewegung Asiens, die für uns alle eine große Hoffnung und für die Weltrevolution eine objektive Notwendigkeit ist, kann von Sowjetrussland weder offiziell noch inoffiziell unterstützt werden. Die englischen Agenten in Afghanistan, Persien und der Türkei arbeiten gut, und jeder revolutionäre Schritt Russlands stellt die Ausführung der Handelsverträge in Frage. Wer muss bei dieser Sachlage die auswärtige Politik Sowjetrusslands entscheidend dirigieren? Die russischen Handelsvertreter in England, Deutschland, Amerika, Schweden usw.? Ob sie Kommunisten sind oder nicht, sie müssen in jedem Fall eine Verständigungspolitik treiben.
Innenpolitisch zeigen sich ähnliche, vielleicht noch gefährlichere Rückwirkungen. Die politische Macht liegt heute faktisch in den Händen der Kommunistischen Partei (nicht etwa der Sowjets). (...) während die spärlichen revolutionären Massen in der Partei sich in ihrer Initiative gehemmt fühlen und die manövrierende Taktik mit wachsendem Misstrauen beobachten, gewinnen mehr und mehr, insbesondere im großen Funktionärsapparat, diejenigen an Einfluss, die zur Kommunistischen Partei gehören, nicht, weil sie eine kommunistische ist, sondern weil sie eine Regierungspartei ist (...) Es liegt auf der Hand, dass die legalisierten Möglichkeiten des Freihandels und der kapitalistischen Wirtschaft überhaupt unter Staatsaufsicht, d.h. unter Aufsicht einer solchen, in die Defensive gedrängten und innerlich sich zersetzenden Partei in wachsendem Maße der durchaus noch nicht abgestorbenen Korruption neue Lebenskraft geben müssen (...)”
Während die meisten Delegierten des Kongresses immer bedingungsloser die bolschewistische Partei unterstützten, die im Begriff war, in den Staatsapparat integriert zu werden, besaß die KAPD-Delegation den Mut, auf den wachsenden Widerspruch zwischen den Interessen der Arbeiterklasse einerseits und den Partei- und Staatsinteressen andererseits hinzuweisen.
“Da (die RKP) die Initiative der revolutionären Arbeiter ausgeschaltet hat und immer weiter ausschaltet, da sie dem Kapital weiteren Spielraum als bisher geben muss, verwandelt sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ihren eigenen Charakter, solange sie Regierungspartei bleibt, und kann dabei doch nicht verhindern, dass die ökonomische Basis, auf der sie – als Regierungspartei! – steht, erschüttert und damit die Grundlage ihrer politischen Macht geschmälert wird.
Was nun aus Russland und was aus der revolutionären Entwicklung in der ganzen Welt werden müsste, wenn die russische Partei eines Tages nicht mehr Regierungspartei wäre, lässt sich kaum übersehen. Und dennoch treiben die Dinge einem Zustande zu, in dem eines Tages – wenn nicht revolutionäre Erhebungen in Europa ein Gegengewicht schaffen – notwendig werden wird, diese Frage im Ernst zu stellen, wo also im Ernst nachgeprüft werden muss, ob im Interesse der proletarischen Revolution das Aufgeben der russischen Staatsgewalt nicht vielleicht richtiger erscheint, als das Festhalten an ihr (...)
Dieselbe Russische Kommunistische Partei, die in ihrem Innern und in ihrer Rolle als Regierungspartei jetzt in einer solchen kritischen Situation steht, ist auch die absolut führende Partei der III. Internationale (...) An diesem Punkte ergibt sich nun der tragische Knoten, in dessen Verschlingung die III. Internationale sich gefangen hat, und zwar so, dass ihr die revolutionäre Lebensluft abgeschnitten ist. Die russischen Genossen, unter bestimmender Führung von Lenin, unterlassen es nicht nur, in der Politik der III. Internationale ein Gegengewicht gegen die rückläufige Kurve ihrer Staatspolitik zu schaffen, sondern sie tun alles, um die Politik dieser Internationale mit dieser rückläufigen Kurve in Einklang zu bringen. (...) Die III. Internationale ist heute ein Werkzeug der reformistischen Verständigungspolitik der Sowjetregierung.
Gewiss sind Lenin, Bucharin usw. in ihrem innersten Wesenskern echte Revolutionäre, aber sie sind eben jetzt wie das ganze Zentralkomitee der Partei Träger der Staatsgewalt, und damit unvermeidlich dem Gesetz einer notwendig zum Konservativen hingleitenden Entwicklung unterworfen.” (KAZ, “Moskauer Politik”, Herbst 1921)
Auf dem anschließenden Außerordentlichen Kongress der KAPD im September 1921 äußerte sich Goldstein folgendermaßen dazu: “Wird es in der KP in Russland möglich sein, auf die Dauer diese beiden Gegensätze in irgendeiner Form auszugleichen? Die KPR zeigt auch heute schon einen Doppelcharakter, Sie zeigt ihn einmal dadurch, dass sie, weil sie noch die Regierungspartei in Russland ist, die die Interessen Russlands als Staat verkörpern muss, dass sie aber gleichzeitig auch die Interessen des internationalen Klassenkampfes vertreten soll und will.” (September-Kongress, 1921, Protokoll, S. 59)
Die deutschen Linkskommunisten wiesen zu Recht auf die Rolle des russischen Staates bei der opportunistischen Entartung der Kommunistischen Internationale hin, und sie hoben richtigerweise auch hervor, dass man die Interessen der Weltrevolution gegen die Interessen des russischen Staates verteidigen muss.
Dennoch lag, wie wir bereits gesagt hatten, der Hauptgrund der opportunistischen Wendung der Komintern tatsächlich nicht in der Rolle des russischen Staates, sondern in dem Scheitern der revolutionären Ausdehnung auf Westeuropa und dem darauffolgenden Rückzug des internationalen Klassenkampfes. Obgleich die KAPD hauptsächlich die russische KP für diesen Opportunismus verantwortlich machte, war die Politik der prinzipienlosen “Bündnisse”, die von den sozialdemokratischen Illusionen ausging, damals in sämtlichen Arbeiterparteien verbreitet. Lange vor den russischen Kommunisten hatte die Führung der KPD bereits diese opportunistische Wende vollzogen, als sie nach der Niederlage des Berliner Januaraufstandes 1919 den linken Flügel, die künftige KAPD, aus der Partei ausgeschlossen hatte.
Tatsächlich waren die KAPD-eigenen Schwächen zunächst und vor allem das Ergebnis der Desorientierung, die aus der Niederlage und dem Rückfluss der revolutionären Welle besonders in Deutschland entstanden war. Der Autorität ihrer revolutionären Führer beraubt, die 1919 im Auftrag der Sozialdemokratie ermordet worden waren, waren die deutschen Linkskommunisten, die sich noch entschlossen an die Spitze der anschwellenden revolutionären Welle gestellt hatten, im Gegensatz zur italienischen Linken unfähig, mit der Niederlage der Revolution fertigzuwerden. Es kamen noch weitere Faktoren hinzu, die diese Schwächen der KAPD noch vertieften.
Die Schwächen der KAPD in der Organisationsfrage
Die Gründe für die Schwächen der KAPD im Verständnis der Organisationsfrage liegen tiefer.
Erinnern wir uns: Aufgrund eines falschen Organisationsverständnisses innerhalb der KPD gelang es der von Levi angeführten Zentrale, die Mehrheit wegen ihrer Auffassungen über den Parlamentarismus und die Gewerkschaften aus der Partei auszuschließen[B3] [48] . Letztere gründete im Anschluss an die gewaltigen Kämpfe nach dem Kapp-Putsch im April 1920 die KAPD. Diese frühe Spaltung der Kommunisten in Deutschland bewirkte eine fatale Schwächung der Arbeiterklasse. Das Drama bestand darin, dass diese linkskommunistische Strömung, nachdem sie selbst aus der KPD ausgeschlossen wurde, ebenfalls diese fehlerhafte Auffassung vertrat.
Diese Schwäche wurde wenige Monate später erneut deutlich, als sich die KAPD-Delegation (mit O. Rühle und P. Merges) kampflos aus dem II. Weltkongress zurückzog. Ein Jahr später, 1921, lehnte die KAPD das Ultimatum des III. Weltkongresses, entweder dem Zusammenschluss zur VKPD zuzustimmen oder aus der Komintern ausgeschlossen zu werden, ab. Ihr daraus resultierender Ausschluss aus der Komintern rief eine gewisse Feindseligkeit in den Reihen der KAPD gegenüber der Komintern hervor.
Dadurch wurde eine durchaus mögliche Zusammenarbeit zwischen den in der Komintern jüngst entstandenen linkskommunistischen Strömungen unmöglich gemacht. Die deutsche und holländische Linke unternahm nichts, um dem enormen Druck der KPR entgegenzutreten und gemeinsam mit der italienischen Linken um Bordiga einen gemeinsame Front gegen die opportunistische Politik der Komintern zu bilden. Ferner neigte die KAPD zu vorschnellen und überstürzten Urteilen über die Komintern, wie die folgenden Stellungnahmen der KAPD zum III. Kongress belegen.
Flucht oder Kampf: die Reaktion gegenüber der Entartung der Komintern
“Sowjetrussland als Staat scheidet in Zukunft als Faktor der Weltrevolution aus; es wird zu einem Stützpunkt der internationalen Konterrevolution (...) Das russische Proletariat hat damit bereits seinen Staat aus den Händen verloren.
Das bedeutet nichts Anderes, als dass die Sowjetregierung nunmehr zum Sachwalter der Interessen der internationalen Bourgeoisie werden muss (...)
Die Sowjetregierung muss zu einer Regierung über und gegen die Arbeiterklasse werden, nachdem sie offen auf die Seite des Bürgertums getreten ist. Die Sowjetregierung ist die Kommunistische Partei Russlands. Also ist die Kommunistische Partei Russlands ein Gegner der Arbeiterklasse geworden, weil sie als Sowjetregierung die Interessen des Bürgertums auf Kosten des Proletariats vertritt. Dieser Zustand wird nicht lange dauern, die Kommunistische Partei Russlands wird sich spalten müssen (...)
Die Sowjetregierung wird binnen ganz kurzer Zeit ihr wahres Gesicht eines national-bürgerlichen Staates nicht mehr verbergen können. Sowjetrussland ist kein proletarisch-revolutionärer Staat mehr, oder richtiger gesagt, Sowjetrussland kann noch nicht ein proletarisch-revolutionärer Staat sein.
Denn allein ein Sieg des deutschen Proletariats in Gestalt der Eroberung der politischen Macht hätte Sowjetrussland vor seinem jetzigen Schicksal behüten, hätte das russische Proletariat vor dem Elend und der Unterdrückung durch ihre eigene Sowjetregierung retten können. Nur die deutsche bzw. westeuropäische Revolution hätte den Klassenkampf zwischen den russischen Arbeitern und den russischen Bauern zugunsten der russischen Arbeiter entscheiden können (...)
Der III. Weltkongress hat die Interessen der proletarischen Weltrevolution untergeordnet den Interessen der bürgerlichen Revolution eines einzigen Landes. Er, das oberste Organ der proletarischen Internationale, hat diese proletarische Internationale in den Dienst eines bürgerlichen Staates gestellt. Er hat damit der 3. Internationale jede Selbständigkeit genommen und sie in die direkte Abhängigkeit des Bürgertums gebracht.
Die 3. Internationale ist für die proletarische Weltrevolution verloren. Sie befindet sich ebenso wie die 2. Internationale in den Händen des Bürgertums.
Daher wird die 3. Internationale in Zukunft sich im Rahmen ihrer Stärke und Kraft immer dort bewähren, wo es sich um den Schutz des bürgerlichen Staates Russland handelt; sie wird aber immer und überall dort versagen, wo es sich um die Förderung der proletarischen Weltrevolution handelt. Ihre Handlungen werden eine lange Reihe fortgesetzten Verrates der proletarischen Weltrevolution sein (...)
Die 3. Internationale ist für die proletarische Weltrevolution verloren.
Die 3. Internationale hat sich aus dem Vorkämpfer der proletarischen Weltrevolution zu ihrem bitterste[B4] [48] n Feind verwandelt.
(...) An der unheilvollen Verknüpfung der Leitung eines Staates, dessen anfangs proletarischer Charakter sich im Laufe der letzten Jahre einen ausgesprochen bürgerlichen Charakter hat verwandeln müssen, und der Führung der proletarischen Internationale in ein- und derselben Hand ist die Lösung der ursprünglichen Aufgabe der 3. Internationale gescheitert. Vor die Alternative zwischen bürgerlicher Staatspolitik und proletarischer Weltrevolution gestellt, haben sich die russischen Kommunisten für die Interessen der ersteren entschieden und die ganze 3. Internationale in deren Dienst gestellt.” (Die Sowjetregierung und die 3. Internationale im Schlepptau der internationalen Bourgeoisie, August 1921)
Während die KAPD zu Recht den wachsenden Opportunismus innerhalb der Komintern anprangerte, während sie völlig zutreffend die wachsende Gefahr erkannte, dass die Komintern von den Interessen des russischen Staates stranguliert und zu dessen Instrument wurde, beging sie andererseits jedoch den schwerwiegenden Fehler, die tatsächlich existierenden Gefahren als einen bereits abgeschlossenen Prozess zu betrachten.
Auch wenn 1921 das Kräfteverhältnis schon bedrohlich gekippt und die internationale Welle von Kämpfen rückläufig war, so legte die KAPD doch eine gefährliche Voreiligkeit an den Tag und unterschätzte die Notwendigkeit eines zähen, ausdauernden Kampfes um die Organisation. Daher war zum damaligen Zeitpunkt die Kernaussage der KAPD, dass die Komintern “heute ein Werkzeug der reformistischen Verständigungspolitik” sei, die “offen auf die Seite des Bürgertums getreten” und in die “Abhängigkeit des Bürgertums” geraten sei, eine falsche Einschätzung. So verbreitete sich innerhalb der KAPD das Gefühl, die Schlacht um die Komintern sei verloren. Man hatte zwar eine Ahnung von dem, was später tatsächlich eintreten sollte, aber die Fehleinschätzung der damaligen Gesamtlage führte dazu, den Kampf gegen den Opportunismus innerhalb der Komintern vorschnell aufzugeben.
Das Ultimatum des III. Weltkongresses mag die Wut und Empörung in der KAPD erklären, doch kann es nicht Tatsache rechtfertigen, dass sich die Genossen voreilig aus dem Ring zurückzogen und bei ihrer Aufgabe der Verteidigung der Internationale versagten.
Wieder einmal wurde auf tragische Weise deutlich, wie verheerend falsche und unzureichende Organisationsauffassungen wirken und welche Auswirkungen sie auf richtige politische Positionen haben können.
Diese große Schwäche der KAPD wird noch durch ein anderes Beispiel veranschaulicht, nämlich durch die Haltung der KAPD-Delegation auf dem III. Kongress der Komintern.
Während die KAPD-Delegation sich vom II. Kongress kampflos zurückzog, erhob die Delegation zum III. Kongress ihre Stimme als Minderheit und rief kurz danach zu einem außerordentlichen Kongress der Partei auf.
Diese Delegation warf dem III. Weltkongress vor, durch die verfälschende Wiedergabe ihrer Positionen und durch Redezeitbeschränkungen, durch Umstellungen der Tagesordnung, durch selektive Ausgrenzungen bei Diskussionen die Debatte zu beschränken. So behauptete die KAPD-Delegation, sie sei von der Sitzung des während des Kongresses tagenden EKKIs ausgeschlossen worden, obwohl man über die Frage der KAPD debattierte (Kongressbericht S. 18). Doch als die Diskussion über den Status der KAPD geführt werden sollte, verzichtete die KAPD-Delegation darauf, das Wort zu ergreifen, weil man ‘nicht unfreiwillige Helfer einer Komödie werden wollte’. Unter Protest zog die Delegation aus dem Saal.
Statt es als ihre Aufgabe anzusehen, einen langen, zähen Kampf gegen die drohende Entartung dieser Organisation zu führen, zog die KAPD übereilte Schlussfolgerungen und verurteilte die Komintern in Bausch und Bogen. Sie erklärte die Komintern wie auch die KPR als “für die Arbeiterklasse verloren”.
Darüber hinaus wurde, obgleich es sporadische Kontakte gab, von den Delegierten der italienischen Linken und der KAPD keine gemeinsame Politik verfolgt, obwohl auch die Italienische Linke den Kampf gegen den zunehmenden Opportunismus, der in der Haltung der Komintern zur Parlamentarismusfrage deutlich wurde, aufgenommen hatte.
Der Ausschluss der KAPD aus der Komintern sollte letztendlich auch die Position der Italienischen Linken auf dem IV. Kongress schwächen, als die italienische KP unter Führung von Bordiga von der Komintern zum Zusammenschluss mit der PSI gezwungen werden sollte. So fanden sich sowohl die “deutsche” als auch die “italienische” Linke isoliert voneinander im Kampf gegen den Opportunismus wieder, unfähig, gemeinsam gegen diese Entartung zu kämpfen. Doch der Flügel um Bordiga hatte wenigstens seine Verantwortung für die langwierige, zähe Verteidigung und Wiederherrichtung der politischen Organisation erkannt. Kurz, bevor Bordiga 1923 ein Manifest des Bruchs mit der Komintern verfassen wollte, nahm er schließlich doch Abstand davon, weil er von der Notwendigkeit überzeugt war, seinen Kampf innerhalb der Komintern und innerhalb der italienischen Partei fortsetzen zu müssen.
Auf dem für September 1921 einberufenen Sonderkongress der KAPD wurde kaum auf die Entwicklung des weltweiten Kräfteverhältnisses eingegangen und somit versäumt, Schlussfolgerungen hinsichtlich der nächsten Aufgaben der Partei zu ziehen.
Für die große Mehrheit in der Partei stand die Revolution weiterhin unmittelbar auf der Tagesordnung. Der reine Wille schien wichtiger als die Analyse des Kräfteverhältnisses. Ferner stürzte sich ein Teil der Organisation im Frühjahr 1922 in das Abenteuer der Gründung der “Kommunistischen Arbeiterinternationale” (KAI).
Die Unfähigkeit, das Zurückweichen des Klassenkampfes zu erkennen, sollte sich schließlich negativ auf die Fähigkeit der KAPD auswirken, unter den Bedingungen des zurückgehenden Klassenkampfes und der anbrechenden Konterrevolution zu überleben.
Die falschen Antworten der russischen Kommunisten
Trotz all ihrer Fehler und Konfusionen ist es das Verdienst der KAPD, das wachsende Konfliktpotenzial zwischen dem russischen Staat und der Arbeiterklasse sowie zwischen dem russischen Staat und der Komintern zur Sprache gebracht zu haben, ohne jedoch gleichzeitig die richtigen Antworten darauf zu liefern. Was die russischen Kommunisten angeht, so hatten sie die größten Schwierigkeiten, überhaupt das Wesen dieses Konfliktes zu durchschauen.
Aufgrund der wachsenden Integration der Partei in den Staatsapparat konnte sie nur eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge entwickeln. Die Haltung Lenins, der 1917 die Lehren des Marxismus hinsichtlich Staat und Revolution in seiner bekannten Schrift am klarsten herausgearbeitet hat, aber gleichzeitig seit 1917 an der Spitze des Staatsapparates gestanden hatte, bringt die wachsenden Widersprüche und Schwierigkeiten in dieser Frage deutlich zum Ausdruck.
Heute unternimmt die bürgerliche Propaganda alles, um Lenin als Vater des totalitären russischen Staatskapitalismus darzustellen. Tatsächlich aber erkannte Lenin mit seiner brillanten revolutionären Intuition unter allen russischen Kommunisten seiner Zeit noch am klarsten, dass der Übergangsstaat, der nach der Oktoberrevolution entstanden war, nicht wirklich die Interessen und die Politik des Proletariats vertrat. Lenin zog im übrigen daraus den Schluss, dass die Arbeiterklasse darum kämpfen muss, dem Staat ihre Politik aufzuzwingen, und das Recht haben müsse, sich gegen ihn zu verteidigen.
Auf dem XI. Parteitag im März 1922 stellte er besorgt fest: “Wir haben nun ein Jahr hinter uns, der Staat ist in unseren Händen – aber hat er nach unserem Willen funktioniert? Nein (...) Das Steuer entgleitet den Händen: Scheint, als [B5] [48] sitzt ein Mensch da, der den Wagen lenkt, aber der Wagen fährt nicht dorthin, wohin er ihn lenkt, sondern dorthin, wohin ihn ein anderer lenkt.” (März/April 1922, XI. Parteitag, Ges. Werke, Bd. 33, S. 266)
Er äußerte diese Sorge besonders angesichts der Haltung Trotzkis in der Gewerkschaftsdebatte 1921. Während vordergründig die Rolle der Gewerkschaften in der Diktatur des Proletariats behandelt wurde, bestand der Kern der Frage darin, ob die Arbeiterklasse das Recht hat, ihre Interessen auch gegen den Übergangsstaat zu verteidigen. Trotzki zufolge, demzufolge der Übergangsstaat per Definition ein Arbeiterstaat ist, war die Auffassung, das Proletariat müsse sich gegen ihn verteidigen können, eine Absurdität. Trotzki gebührt zumindest das Verdienst, seine Logik bis zur letzten Konsequenz durchgeführt zu haben, als er offen die Militarisierung der Arbeit vertrat. Im Gegensatz zu ihm bestand Lenin, auch wenn er noch nicht in der Lage war zu erkennen, dass dieser Staat kein Arbeiterstaat war (diese Position wurde erst in den 30er Jahren von der Zeitschrift Bilan entwickelt und vertreten), auf der Notwendigkeit, dass die Arbeiter sich selbst gegen den Staat wehren können.
Diese völlig berechtigte Sorge Lenins ermöglichte es den russischen Kommunisten jedoch nicht, zu einer wirklichen Klärung dieser Frage zu gelangen. Lenin selber wie andere Kommunisten der damaligen Zeit meinten weiterhin, dass in Russland das ungeheure Gewicht des Kleinbürgertums die Haupttriebkraft der Konterrevolution sei und nicht der bürokratisierte Staat.
“Der Feind ist im gegebenen Augenblick und für den gegebenen Zeitabschnitt nicht derselbe, der er gestern war. Der Feind – das sind nicht die Heerhaufen der Weißgardisten (...) Der Feind, das ist der graue Alltag der Wirtschaft in einem kleinbäuerlichen Land mit zerstörter Großindustrie. Der Feind – das ist das kleinbürgerliche Element. (...) das Proletariat ist geschwächt, zersplittert, entkräftet. Die ‚Kräfte der Arbeiterklasse‘ sind nicht grenzenlos (...)Der Zustrom frischer Kräfte aus der Arbeiterklasse ist jetzt schwach, manchmal sehr schwach (...) (Wir müssen) mit der Unvermeidlichkeit eines verlangsamten Zuwachses neuer Kräfte der Arbeiterklasse rechnen.” (20.8.1921, Ges. Werke, Bd. 33, S. 3, 6)
Der Rückzug des Klassenkampfes und die Entfaltung des Staatskapitalismus
Nach den Niederlagen der internationalen Arbeiterklasse 1920 verschlechterten sich die Bedingungen für die russische Arbeiterklasse zusehends. Einer immer größeren Isolation ausgesetzt, stand sie nun auch einem Staat gegenüber, an dessen Spitze die bolschewistische Partei, wie Kronstadt zeigte, mit harter Hand gegen streikende Arbeiter vorging. Die Niederschlagung der Arbeiter in Kronstadt hatte vor allem jenen Kräften in der Partei Auftrieb gegeben, die an einer Stärkung des Staats - falls notwendig, auch auf Kosten der Arbeiterklasse – und an einer Bindung der Komintern an den russischen Staat interessiert waren.
Der russische “Übergangsstaat” war mehr und mehr zu einem ganz “normalen” Staat wie die anderen geworden.
Schon im Frühjahr 1921 hatte die deutsche Bourgeoisie ihre Fühler nach Moskau ausgestreckt, um in Geheimverhandlungen die Möglichkeit einer Zusammenarbeit beider Staaten bei der Wiederaufrüstung zu sondieren. Es war beispielsweise geplant, Flugzeuge für Russland von den Albatross-Werken, U-Boote von Blöhm & Voss und Gewehre sowie Munition von Krupp herstellen zu lassen. [B6] [48]
Als Ende 1921 Russland das Projekt einer allgemeinen Konferenz zur Regelung der Beziehungen zwischen Russland und der kapitalistischen Welt vorschlug, waren bereits seit langem Geheimverhandlungen zwischen Deutschland und Russland im Gange. Auf der Konferenz von Genua pries Tschitscherin, der Leiter der russischen Delegation, die Möglichkeiten an, die das Potenzial der noch nicht ausgeschöpften Rohstoffquellen Russlands biete, wenn sie in Zusammenarbeit mit westlichen Kapitalisten realisiert würden. Als diese Konferenz abgebrochen wurde, hatten Deutschland und Russland im nahegelegenen Rapallo bereits ein Geheimabkommen abgeschlossen. Wie E.H. Carr schrieb: “Es war die erste große diplomatische Angelegenheit, wo Sowjetrussland und die Weimarer Republik auf gleichem Fuß stehend miteinander verhandelt hatten.” (Die bolschewistische Revolution, Band 3) Aber Rapallo war mehr als das.
Das im Winter 1917/18 unter dem Druck der deutschen Offensive zustande gekommene Abkommen von Brest-Litowsk wurde von russischer Seite nur aus dem Grunde unterschrieben, um die isolierte Bastion des russischen Proletariats durch einen Waffenstillstand vor dem deutschen Imperialismus zu schützen. Nicht nur, dass dieses Abkommen Russland also aufgezwungen worden war, es bedurfte auch einer heftigen und offenen Debatte in der bolschewistischen Partei, bevor es abgeschlossen wurde.
Das Geheimabkommen von Rapallo dagegen stellte dieses Prinzip auf den Kopf. Nicht genug damit, dass die russischen staatlichen Vertreter in diesem Abkommen geheimen Waffenlieferungen zustimmten – diese Tatsache wurde darüber hinaus auf dem IV. Weltkongress der Komintern mit keinem einzigen Wort erwähnt!
Die Aufforderung der Komintern an die KPs der Türkei und Persiens, “die Bewegung zugunsten der nationalen Freiheit in der Türkei (und Persien) zu unterstützen”, führte in Wirklichkeit nur dazu, dass die dortige Arbeiterklasse um so leichter von der türkischen bzw. persischen Bourgeoisie niedergeschlagen werden konnte. Das Interesse des russischen Staates an festen Beziehungen zu diesen Staaten hatte obsiegt.
Schritt für Schritt wurde die Komintern den Bedürfnissen der russischen Außenpolitik unterworfen. Während zum Zeitpunkt der Gründung der Komintern 1919 die Betonung noch auf der Zerstörung der kapitalistischen Staaten gelegen hatte, bestand ab 1921 das Bestreben des russischen Staates (und seiner Vertreter in der Komintern) in einer Stabilisierung der zwischenstaatlichen Verhältnisse. Die ausbleibende Weltrevolution hatte dem russischen Staat genug Auftrieb verliehen, um für sich seinen Platz zu beanspruchen.
Auf der Anfang 1922 in Berlin tagenden gemeinsamen Konferenz der “Arbeiterparteien”, zu der die Komintern die Parteien der II. Internationale und der 2½. Internationale[i] [48] 1 [48][B7] [48] eingeladen hatte, bemühte sich die Komintern-Delegation vor allem um die diplomatische Anerkennung Sowjetrusslands, um den Aufbau von Handelsbeziehungen zum Westen und um Hilfe für den wirtschaftlichen Aufbau Sowjetrusslands. Hatte man 1919 noch die Henkersrolle der II. Internationale bloßgestellt, hatte der II. Weltkongress der Komintern noch 21 Bedingungen aufgestellt, die die Abgrenzung zur und die Bekämpfung der II. Internationale bezweckten, so saß nun, 1922, die Komintern im Namen des russischen Staates mit den Parteien eben jener II. Internationale an einem Tisch! Es war offensichtlich geworden, dass der russische Staat nicht an der Ausdehnung der Weltrevolution, sondern an seiner eigenen Stärkung interessiert war. Je stärker die Komintern in sein Schlepptau geriet, desto deutlicher wurde ihre Abkehr vom Internationalismus.
Das Auswuchern des russischen Staatsapparates
Die politische Orientierung des russischen Staates auf Anerkennung durch die anderen Staaten ging einher mit der Stärkung des russischen Staatsapparates im Innern.
Die immer stärkere Integration der Partei in den Staat, die wachsende Bündelung der Macht in den Händen eines immer kleineren und begrenzteren Kreises von “Regierenden” und die zunehmende Diktatur des Staates über die Arbeiterklasse waren das Resultat eines zielstrebigen Vorgehens jener Kräfte, die an der Verstärkung des Staatsapparates auf Kosten der Arbeiterklasse interessiert waren.
Auf dem XI. Parteitag im April 1922 wurde Stalin zum Generalsekretär der Partei ernannt. Damit bekleidete Stalin drei Ämter gleichzeitig: Er stand außerdem an der Spitze des Volkskommissariats der Arbeiter- und Bauerninspektion, und er war Mitglied des Politbüros. Mit seiner Ernennung zum Generalsekretär riss Stalin bald das Tagesgeschäft der Partei an sich und schaffte es, das Politbüro vom Generalsekretär abhängig zu machen.
Zuvor schon, auf dem X. Parteitag im März 1921, war Stalin zum Leiter der Säuberungsaktionen geworden[ii] [48]. Im März 1922 hatte sich eine Gruppe von Mitgliedern der Arbeiteropposition an das EKKI gewandt, um die “Unterdrückung der Selbständigkeit, der Arbeiterinitiative, den Kampf mit allen Mitteln gegen Andersdenkende zu verurteilen (...) Die vereinten Kräfte der Partei- und Gewerkschaftsbürokratie ignorieren unter Ausnützung ihrer Macht und Stellung (...) das Prinzip der Arbeiterdemokratie” (Rosmer, S. 110) Unter dem Druck der KPR-Führung lehnte das EKKI die Beschwerde der Gruppe Arbeiteropposition ab.
Anstatt den örtlichen Parteizellen die Initiative zur Ernennung von Delegierten zu überlassen, wurden mit zunehmender Integration der Partei in den Staat die Personalfragen in die Hände der Parteileitung und damit des Staates gelegt. Nicht mehr Wahlen und Abstimmungen auf lokaler Parteiebene gaben den Ausschlag, sondern die Ernennung durch den verstaatlichten Parteiapparat, an dessen Spitze der Generalsekretär und das von Stalin geleitete Organisationsbüro stand. Schon 1923 waren sämtliche Delegierte des XII. Parteitages von der Parteileitung berufen worden.
Wenn wir an dieser Stelle die Rolle der Partei und ihrer führenden Persönlichkeiten hervorheben, dann nicht, weil wir das Problem des Staates auf eine Person – Stalin – fixieren wollten und es somit unterschätzen würden. Nein, es war dieser Staat, der, nachdem er im Oktober 1917 entstanden, die bolschewistische Partei in sich aufgesogen und seine Tentakeln nach der Komintern ausgestreckt hat, zum Zentrum der Konterrevolution geworden war. Die Konterrevolution war jedoch kein quasi passives, anonymes Treiben unbekannter, gesichtsloser oder unsichtbarer Kräfte, sondern nahm in Gestalt des Staats- und Parteiapparates ganz konkrete Formen an. Stalin war einer der bedeutendsten Repräsentanten dieser Kräfte, die auf den diversen Parteiebenen die Drähte zogen und all das angriffen, was an revolutionärem Potenzial in der Partei noch übrig geblieben war.
Dieser Entartungsprozess verursachte in der bolschewistischen Partei selbst Widerstände und Erschütterungen, über die wir in der Internationalen Revue Nr. 12 und 13 ausführlicher berichtet haben.
Trotz all der o.g. Konfusionen schickte sich Lenin an, sich zum entschlossensten Gegner dieses Staatsapparates zu entwickeln. Nachdem er zum ersten Mal einen Schlaganfall im Mai 1922 erlitten hatte, verfasste Lenin kurz nach seinem zweiten Schlaganfall am 9. März 1923 einen später als sein Testament bekannt gewordenen Text, in dem er die Ablösung Stalins als Generalsekretär verlangte. So brach Lenin, ans Bett gefesselt, schon mit dem Tode ringend, im März 1923 mit Stalin, mit dem er jahrelang Seite an Seite gestanden hatte, und erklärte ihm den Krieg. Doch wurde diese Kriegserklärung in der Parteipresse, die schon damals stark vom Generalsekretär, also Stalin, kontrolliert wurde, nie bekanntgegeben.
Es war auch kein Zufall, dass Kamenew, Sinowjew und Stalin, die die neue Führung – die Troika – bildeten, die typisch bürgerliche Überzeugung von der Notwendigkeit eines “Thronfolgers” Lenins teilten. Vor dem Hintergrund eines innerparteilichen Machtkampfes veröffentlichte im Sommer 1923 eine Gruppe von Gegnern der “Troika” die Plattform der 46, die heftige Kritik an der Erdrosselung des proletarischen Lebens in der Partei übte, und welche sich am 1. Mai 1922 zum ersten Mal seit dem Oktober 1917 geweigert hatte, einen Aufruf zur Weltrevolution mit zu verfassen.[B8] [48]
Im Sommer 1923 brach eine Reihe von Streiks in Russland aus, insbesondere in Moskau.
Während der russische Staat sich nach Innen immer mehr verstärkte und nach Außen alles unternahm, um von den großen kapitalistischen Staaten anerkannt zu werden, sollte sich der Entartungsprozess innerhalb der Komintern nach der opportunistischen Kehrtwende auf dem III. Weltkongress unter dem Druck des russischen Staates beschleunigen.
Der IV. Kongress der Komintern: die Unterwerfung unter den russischen Staat
Mit der Einführung der Einheitsfronttaktik auf dem IV.Weltkongress im November 1922 warf die Komintern ihre eigenen Prinzipien über Bord, die sie auf ihrem I. und II. Kongress verfasst hatte, als sie noch auf schärfste Abgrenzung gegen die Sozialdemokratie und auf ihre kompromisslose Bekämpfung bestanden hatte.
Zur Rechtfertigung führte sie jetzt an, die Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen Bourgeoisie und Proletariat zeige, dass “die breitesten Massen des Proletariats den Glauben daran verloren (haben), dass sie in absehbarer Zeit die Macht erobern können. Die Arbeiterbewegung wird in die Verteidigung gedrängt (...) die Eroberung der Macht steht als aktuelle Aufgabe nicht auf der Tagesordnung” (Radek). Daher müsse man sich mit den Arbeitern, die noch unter dem Einfluss der Sozialdemokratie stehen, zusammenschließen: “Die Losung des III. Kongresses ‚Zu den Massen!‘ hat jetzt mehr denn je Gültigkeit (...) Die Taktik der Einheitsfront ist das Angebot des gemeinsamen Kampfes der Kommunisten mit allen Arbeitern, die anderen Parteien oder Gruppen angehören (...), die Kommunisten müssen sich unter Umständen bereit erklären, zusammen mit nichtkommunistischen Arbeiterparteien und Arbeiterorganisationen eine Arbeiterregierung zu bilden.” (Thesen zur Taktik der Komintern, IV. Kongress)
Die KPD rief als erste zu dieser Taktik auf, wie wir im nächsten Artikel dieser Reihe zeigen werden.
Innerhalb der Komintern stieß diese neue opportunistische Steigerung, die die Arbeiter geradezu in die Hände der Sozialdemokratie trieb, auf den erbitterten Widerstand der Italienischen Linken. Schon im März, kurz nach der Verabschiedung der Thesen zur Einheitsfront, schrieb Bordiga in Il Comunista:
“Was die Arbeiterregierung angeht, fragen wir: warum sich mit den Sozialdemokraten verbünden? Um nur das zu machen, was diese verstehen, machen können und wollen; oder um von ihnen zu verlangen, was sie nicht verstehen, nicht machen können und wollen? Erwartet man von uns, dass wir den Sozialdemokraten sagen, wir seien zur Zusammenarbeit mit ihnen bereit, selbst im Parlament und selbst in dieser Regierung, die als ‚Arbeiterregierung‘ getauft wurde? In diesem Fall, d.h. wenn man von uns verlangt, im Namen der Kommunistischen Partei ein Projekt einer Arbeiterregierung zu entwerfen, an dem sich Kommunisten und Sozialisten beteiligen, und um diese Regierung den Massen als ‚anti-bürgerliche Regierung‘ zu verkaufen, in diesem Fall übernehmen wir die volle Verantwortung für unsere Antwort, dass solch eine Haltung im Gegensatz zu allen Grundsatzprinzipien des Kommunismus steht. Diese politische Formel zu akzeptieren, hieße in der Tat, einfach unsere Fahne einzuziehen, auf der geschrieben steht: Es gibt keine Arbeiterregierung, die sich nicht auf den revolutionären Sieg des Proletariats stützt.” (Il Comunista, 26.3.1922)
Auf dem IV. Kongress sagte die KP Italiens, dass sie “nicht akzeptieren wird, sich an gemeinsamen Organismen in verschiedenen politischen Organisationen zu beteiligen (...) Sie wird ebenso vermeiden, sich an gemeinsamen Erklärungen mit politischen Parteien zu betätigen, wenn diese Erklärungen im Widerspruch stehen zu ihrem Programm und der Arbeiterklasse als das Ergebnis von Verhandlungen dargestellt werden, mit der eine gemeinsame Handlungslinie angestrebt werden soll (...) Von Arbeiterregierung zu sprechen (...) heißt in der Praxis, das politische Programm des Kommunismus zu verleugnen, d.h. die Notwendigkeit, die Massen auf den Kampf für die Diktatur des Proletariats vorzubereiten.” (Bericht der Italienischen Kommunistischen Partei an den IV. Kongress der Kommunistischen Internationale, November 1922)
Doch nachdem die KAPD durch das Ultimatum auf dem III. Kongress 1921 aus der Komintern ausgeschlossen und damit die kritischste Stimme gegen die Degeneration der Komintern mundtot gemacht worden war, hing es allein an der Italienischen Linken, den Standpunkt des Linkskommunismus in der Komintern zu vertreten.
Gleichzeitig muss jenes Ereignis vom Oktober 1922 mit berücksichtigt werden, in dessen Verlauf Mussolini in Italien die Macht ergriff, was eine Verschlechterung der Bedingungen für die Kommunisten in Italien zur Folge hatte. Vor dieses Problem gestellt, hatte die Italienische Linke Schwierigkeiten, ihre Kräfte gegen die Degeneration der Komintern und der Bolschewiki zu mobilisieren.
Zu dieser Zeit schuf der IV. Weltkongress weitere Grundlagen dafür, dass die Komintern sich den Interessen des russischen Staates unterwarf.
Den russischen Staat und die Interessen der Komintern in einen Topf schmeißend, interpretierte der Vorsitzende der Komintern, Sinowjew, die Stabilisierung des Kapitalismus und das Ausbleiben von Angriffen gegen Russland folgendermaßen: “Wir können jetzt ohne Übertreibung behaupten, dass die Zeit der größten Schwierigkeiten für die Kommunistische Internationale überwunden ist und sie sich mittlerweile so gestärkt hat, dass sie keine Angriffe mehr von der weltweiten Reaktion zu befürchten hat.” (Carr, S. 439)
Da die Perspektive der Machtergreifung nicht mehr unmittelbar auf der Tagesordnung stand, schlug der IV. Kongress vor, die internationale Arbeiterklasse solle sich neben der Einheitsfronttaktik auch die Unterstützung und Verteidigung Russlands zu eigen machen. Aus einer Resolution zur Frage der Russischen Revolution wird ersichtlich, wie stark die Sichtweise der Komintern von der Lage des russischen Staates geprägt war und wie stark sie den Standpunkt der internationalen Arbeiterklasse gegenüber der Aufbauarbeit in Russland hinten anstellte:
“Der IV. Weltkongress der Kommunistischen Internationale spricht dem schaffenden Volk Sowjet-Russlands tiefsten Dank und höchste Bewunderung dafür aus, dass es (...) die Errungenschaften der Revolution bis heute siegreich gegen alle Feinde im Innern und von Außen verteidigte.
Der IV. Weltkongress stellt mit größter Genugtuung fest, dass der erste Arbeiterstaat der Welt (...) seine Lebens- und Entwicklungskraft vollauf bewiesen hat. Der Sowjetstaat ist aus den Schrecken des Bürgerkriegs gefestigt hervorgegangen.
Der IV. Weltkongress stellt mit Befriedigung fest, dass Sowjet-Russlands Politik die wichtigste Vorbedingung für den Aufbau und die Entwicklung zur kommunistischen Gesellschaft gesichert und befestigt hat: nämlich die Sowjetmacht, die Sowjetordnung, d.h. die Diktatur des Proletariats. Denn diese Diktatur allein (...) verbürgt die vollständige Überwindung des Kapitalismus und freie Bahn für die Verwirklichung des Kommunismus.
Hände weg von Sowjet-Russland! Rechtliche Anerkennung Sowjet-Russlands! Jede Stärkung Sowjet-Russlands bedeutet eine Schwächung der Weltbourgeoisie.”
In welchem Maße ein halbes Jahr nach Rapallo der russische Staat die Komintern an der Leine führte, wurde auch aus der Tatsache ersichtlich, dass vor dem Hintergrund wachsender imperialistischer Spannungen die Möglichkeit in der Komintern diskutiert wurde, Russland einen militärischen Block mit einem der kapitalistischen Staaten schmieden zu lassen. Die Komintern behauptete, dass mit einem solchen Bündnis das bürgerliche Regime aus dem Sattel gehoben werde. Doch die Komintern sollte damit immer mehr in den Dienst des russischen Staates treten. “Ich behaupte, wir sind schon stark genug, um ein Bündnis mit einer ausländischen Bourgeoisie einzugehen, um – mit Hilfe dieses bürgerlichen Staates – eine andere Bourgeoisie zu stürzen (...) Nehmen wir an, ein militärisches Bündnis ist mit einem bürgerlichen Staat geschlossen worden, besteht die Pflicht der Genossen in allen Ländern darin, zum Sieg der beiden Bündnisse beizutragen.” (Zitat von Bucharin bei Carr, a.a.O., S. 442)
Einige Monate später propagierten Komintern und KPD die Perspektive eines Bündnisses zwischen der “unterdrückten deutschen Nation” und Russland. Hinsichtlich den gegensätzlichen Interessen Deutschlands auf der einen und der alliierten Siegerländer auf der anderen Seite nach dem I. Weltkrieg bezogen sowohl die Komintern als auch der russische Staat Stellung zugunsten Deutschlands, das sie als Opfer der französischen imperialistischen Interessen ansahen.
Bereits auf dem “Ersten Kongress der Werktätigen des Ferner Ostens” im Januar 1922 setzte die Komintern die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit “nichtkommunistischen Revolutionären” als eine zentrale Doktrin durch. Der IV. Weltkongress beschloss, “mit allen Kräften die nationalrevolutionäre Bewegung zu unterstützen, die sich gegen den Imperialismus richtet” (Thesen über die Taktik), und kritisierte gleichzeitig scharf “die Weigerung der Kommunisten der Kolonien, am Kampf gegen die imperialistische Vergewaltigung teilzunehmen, unter Vorgabe angeblicher ‚Verteidigung‘ selbständiger Klasseninteressen, [dies] ist Opportunismus schlimmster Sorte, der die proletarische Revolution im Osten nur diskreditieren kann.” (Leitsätze zur Orientfrage).
Damit trug die Komintern zu einer enormen Schwächung und Desorientierung der Arbeiter bei.
Nachdem die revolutionäre Welle von Kämpfen 1919 ihren Höhepunkt überschritten hatte und sich nach dem Scheitern der revolutionären Ausdehnung im Rückfluss befand, nachdem sich der russische Staat gefestigt und die Komintern seinen Interessen unterworfen hatte, fühlte sich die Weltbourgeoisie stark genug, um jenen Teil der internationalen Arbeiterklasse entscheidend niederzuringen, der noch am kämpferischsten geblieben war: die Arbeiterklasse in Deutschland.
Diesen Ereignissen von 1923 werden wir uns im nächsten Artikel widmen.
Dv.
[i] [48] Die 2½. Internationale wurde von den Kommunisten so bezeichnet, weil es sich hier um einen gescheiterten Umgruppierungsversuch zentristischer Elemente handelte, die sich wegen des Krieges von der Sozialdemokratie getrennt hatten, sich aber weigerten, der Komintern beizutreten.
[ii] [48] Nachdem die Mitgliederzahl der Bolschewistischen Partei 1920 auf 600.000 Mitglieder angewachsen war, wurden 1920-21 im Zuge der “Säuberungsaktionen” ca. 150.000 Mitglieder aus der Partei entfernt. Es lag auf der Hand, dass nicht nur Karrieristen, sondern auch viele Arbeiter ausgestoßen wurden. Die Säuberungskommission unter Stalin war eines der mächtigsten Organe in Russland
Theorie und Praxis:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Die Ermordung Trotzkis im Jahre 1940
- 5928 Aufrufe
Trotzki wurde ermordet weil er ein Symbol für die Arbeiterklasse war
Am 20. August 1940, vor 60 Jahren, starb Trotzki. Er wurde zu Beginn des Zweiten Weltkrieges von den Meuchelmördern Stalins umgebracht. Mit diesem Artikel wollen wir nicht nur eine der wichtigsten Figuren des proletarischen Kampfes ehren, sondern auch auf seine Fehler und politischen Einschätzungen zu Beginn des Krieges eingehen. Trotzki starb nach einem leidenschaftlichen, kämpferischen Leben, das der proletarischen Klasse gewidmet war. Es gibt in der Geschichte zahlreiche Beispiele von Revolutionären, welche sich zurückzogen oder gar die Arbeiterklasse verraten haben. Trotzki war einer der wenigen, die ihr Leben lang der Arbeiterklasse treu blieben, und er kämpfte wie Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht bis zum Tod für die Revolution.
In seinen letzten Lebensjahren verteidigte Trotzki viele opportunistische Positionen, wie beispielsweise die Politik des Entrismus innerhalb der Sozialdemokratie, die Einheitsfront usw. Die Linkskommunisten kritisierten diese Positionen in den 30er Jahren mit guten Gründen. Trotzdem hat Trotzki nie die Seite gewechselt. Er ist nie in das Lager der Bourgeoisie übergelaufen, so wie es die Trotzkisten nach seinem Tod gemacht haben. Er verteidigte bis zum Schluss die traditionelle revolutionäre Haltung: die Umwandlung des imperialistischen Krieges in einen revolutionären Bürgerkrieg.
Die Bourgeoisie der ganzen Welt vereint gegen Trotzki
Je näher der imperialistische Weltkrieg rückte, um so entscheidender wurde es für die internationale Bourgeoisie Trotzki zu beseitigen.
Um seine politische Macht zu stärken und die politische Entwicklung zu fördern, die ihn zum wichtigsten Diener der Konterrevolution gemacht hatte, tötete Stalin zahlreiche Revolutionäre oder schickte sie in die Verbannung. Dies betraf vor allem bolschewistische Führer der Russischen Revolution und nahestehende Genossen Lenins. Doch dies genügte nicht. Wegen der zunehmenden kriegerischen Spannungen Ende der 30er Jahre brauchte Stalin totale Handlungsfreiheit im Innern, um seine imperialistische Politik voran zu treiben. 1936, also zu Beginn des Krieges in Spanien, fanden die ersten grosse Prozesse und Exekutionen von Sinowjew, Kamenjew und Smirnow (siehe 16 Hinrichtungen in Moskau von Victor Serge, Edition Spartacus), später von Pjatakow und Radek und zuletzt die Prozesse gegen die Gruppe Rikow-Bucharin-Krestinski statt. Aber der gefährlichste Bolschewik, obwohl im Ausland lebend, blieb Trotzki. Als Stalin dessen Sohn Leo Sedow 1938 in Paris ermorden ließ, hatte er Trotzki schwer getroffen. Jetzt blieb Stalin nur noch Trotzki selbst, den es zu töten galt.
General Walter G. Krivitsky, der militärische Befehlshaber der sowjetischen Abwehrspionage in Westeuropa fragte sich in seinem Buch, „ob es notwendig war, dass die bolschewistische Revolution alle Bolschewiki töten liess?“ Auch wenn er selbst seine Frage nicht beantwortet, gibt es in seinem Buch Ich war ein Agent Stalins eine klare Antwort (Editions Champ libre, Paris, 1979, S. 35 und 36).
Die Prozesse von Moskau und die Liquidierung der letzten Bolschewiki waren der Preis, um den Krieg vorbereiten zu können: ”Das geheime Ziel von Stalin blieb immer das gleiche, nämlich sich mit Deutschland zu verstehen. Im März 1938 eröffnete Stalin den großen 10 Tage dauernden Prozess gegen die Gruppe Rikow-Bucharin-Krestinski, die Väter der russischen Revolution und engste Verbündete Lenins. Diese bolschewistischen Führer, von Hitler gehasst, wurden am 3. März auf Befehl Stalins exekutiert. Am 12. März annektierte Hitler Österreich. (...) Am 12. Januar 1939 traf sich der sowjetische Botschafter mit den gesamten diplomatischen Kreisen in Berlin zu einem freundschaftlichen und demokratischen Gespräch.“ Und somit wurde der deutsch-sowjetische Pakt zwischen Hitler und Stalin vom 23. August 1939 geschlossen.
Obwohl die Ermordung der letzten Bolschewiki zur Durchsetzung der Politik Stalins geschah, war dies auch eine Antwort der gesamten Weltbourgeoisie. Das Schicksal von Leo Trotzki war deshalb ebenfalls schon lange besiegelt. Für die herrschende Klasse der ganzen Welt musste Trotzki als Zeichen der Revolution verschwinden!
Robert Coulondre,1 [49] ehemaliger Botschafter Frankreichs, gab in der Beschreibung über sein letztes Treffen mit Hitler vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ein eindrucksvolles Zeugnis. Hitler prahlte mit dem Pakt, den er gerade mit Stalin abgeschlossen hatte und begann ein grossartiges Bild seiner triumphalen militärischen Zukunft zu zeichnen. Der französische Botschafter appellierte an seine „Vernunft“ und sprach vom sozialen Chaos und den Revolutionen, die auf einen langen und schrecklichen Krieg folgen und sämtliche kriegführenden Regierungen mit sich in den Abgrund reissen könnten: ”Sie sehen sich als Sieger“... sagte der Botschafter, „aber haben Sie eine andere Möglichkeit erwogen – dass der Sieger Trotzki sein kann?”2 [49] Bei diesen Worten sprang Hitler auf, als ob er einen Hieb in den Magen erhalten hätte und brüllte, dass diese Möglichkeit, die Gefahr eines siegreichen Trotzki, ein Grund mehr wäre, warum Frankreich und England nicht gegen das Dritte Reich Krieg führen sollten. Isaac Deutscher hatte seine Gründe den Kommentar Trotzkis3 [49] hervorzustreichen, als dieser von dem Dialog erfahren hatte: Die Vertreter der internationalen Bourgeoisie “sind über das Gespenst der Revolution erschrocken und haben ihm jetzt den Namen eines Menschen gegeben”.4 [49]
Trotzki musste verschwinden5 [49] und er wusste genau, dass seine Tage gezählt waren. Seine Eliminierung hatte eine viel grössere Bedeutung als die der anderen Bolschewiki und Mitglieder der russischen Linkskommunisten. Die Ermordung der alten Bolschewiki hatten Stalin in seiner Macht gestärkt. Die Ermordung Trotzkis verdeutlichte, dass die internationale Bourgeoisie, die russische eingeschlossen, den Kurs in Richtung Weltkrieg ohne Störungen einschlagen wollte. Nach der Entfernung der letzten grossen Figur der Oktoberrevolution, des standhaften Internationalisten war dieser Weg frei. Stalin setzte alle Mittel des GPU-Apparates zur Ermordung Trotzkis ein. Mehrere Attentate wurden hintereinander gegen ihn verübt und man konnte nur auf das nächste warten. Nichts konnte die stalinistische Maschine stoppen. Kurze Zeit vor seiner Ermordung wurde Trotzki am 24. Mai 1939 nachts von einem Kommando angegriffen. Die Agenten Stalins feuerten aus dem gegenüberliegenden Haus etwa 200-300 Kugeln ab und warfen einige Bomben auf die Fenster von Trotzkis Haus. Glücklicherweise waren dessen Fenster sehr hoch angelegt und Trotzki, seine Frau Natalia und sein Enkel Sieva konnten sich unter den Betten verstecken und sich wie durch ein Wunder retten. Doch der darauf folgende Anschlag wurde von Ramon Mercader und seiner Gruppe mit ”Erfolg” durchgeführt.
>Die Position Trotzkis vor dem Krieg >
Ohne Zweifel genügte der Bourgeoisie die Ermordung Trotzkis nicht. Lenin schrieb zu Recht in seinem Buch Staat und Revolution: ”Die grossen Revolutionäre werden zu Lebzeiten von den unterdrückenden Klassen ständig verfolgt, die ihrer Lehre mit wildestem Ingrimm und wütendstem Hass begegneten, mit zügellosen Lügen und Verleumdungen gegen sie zu Felde zogen. Nach ihrem Tode versucht man, sie in harmlose Götzen zu verwandeln, sie sozusagen heiligzusprechen, man gesteht ihrem Namen einen gewissen Ruhm zu zur „Tröstung“ und Betörung der unterdrückten Klassen, wobei man ihre revolutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr die revolutionäre Spitze abbricht, sie vulgarisiert. (...) Man vergisst, verdrängt und entstellt die revolutionäre Seite der Lehre, ihren revolutionären Geist. Man schiebt in den Vordergrund, man rühmt das, was für die Bourgeoisie annehmbar ist oder annehmbar erscheint.“ (Lenin, Staat und Revolution, Ges. Werke Bd. 25, S. 397)
In Bezug auf Trotzki sind jene gemeint, die sich als Trotzkisten bezeichnen, das Erbe Trotzkis für sich beanspruchen und sich in Kontinuität mit Trotzki sehen. Es sind die, welche nach dem Tod Trotzkis eine schmutzige Arbeit übernommen haben. Sie beziehen sich auf die „opportunistischen“ Positionen Trotzkis, mit denen sie alle nationalen Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg gerechtfertigt haben und sich zu Verteidigern eines imperialistischen Lagers gemacht haben, dem der Sowjetunion.
Als die IV. Internationale 1938 gegründet wurde, basierten Trotzkis Ideen auf der Annahme, dass der Kapitalismus in der Phase des Todeskampfes sei. Ebenso verteidigte die italienische Fraktion der Kommunistischen Linken (Bilan) diese Idee. Wir sind mit dieser Einschätzung der Epoche einverstanden; auch wenn wir Trotzki in seiner Analyse über „die Produktivkräfte, die aufgehört haben zu wachsen“ nicht folgen.6 [49] Es ist absolut richtig ihn darin zu bestätigen, dass der Kapitalismus in der Phase des „Todeskampfes“ aufgehört hat eine fortschrittliche Gesellschaftsform zu sein und der Übergang zum Sozialismus auf der historischen Tagesordnung steht. Jedoch hat sich Trotzki getäuscht, davon auszugehen, dass in den 30er Jahren die Bedingungen für eine Revolution vorhanden waren. Er kündigte sie an, indem er sich auf die Bildung der Volksfront in Frankreich und später in Spanien berief, also auf das Gegenteil dessen, was die italienische Fraktion der Kommunistischen Linken verteidigte.7 [49] Dieser Fehler im Verständnis des historischen Kurses, der Trotzki glauben ließ, die Revolution stehe auf der Tagesordnung, während umgekehrt der Zweite Weltkrieg vorbereitet wurde, ist ein Schlüssel zum Verständnis seiner in dieser Zeit entwickelten opportunistischen Positionen.
Konkret drückte sich dies bei Trotzki im Konzept des ”Übergangsprogramms” aus, das im Hinblick auf die Gründung der IV. Internationale 1938 ausgearbeitet wurde. Es bestand in Wirklichkeit aus einer Menge von Forderungen, die nicht realisierbar waren. Sie sollten das Bewusstsein der Arbeiterklasse heben und den Klassenkampf anspornen. Dies war die Grundlage seiner politischen Strategie. Aus seiner Sicht war das Übergangsprogramm nicht eine Gesamtheit reformistischer Maßnahmen, da diese nicht verwirklicht werden konnten und es schließlich auch nicht sein Ziel war diese anzuwenden. Tatsächlich sollten sie aufzeigen, dass der Kapitalismus unfähig sei, langfristige Reformen zu bewilligen, und folglich den Bankrott des Systems entblössen, um den Kampf zu dessen Zerstörung voranzutreiben.
Auf dieser Basis entwickelte Trotzki auch seine berühmtes ”proletarisches militärisches Programm”.8 [49] Es bestand hauptsächlich darin, das Übergangsprogramm in einer Periode von Krieg und weltweitem Militarismus anzuwenden. Diese Politik hoffte, all die Millionen unter Waffen stehenden Arbeiter für die revolutionären Ideen zu gewinnen. Sie konzentrierte sich auf die Forderung nach einer obligatorischen militärischen Ausbildung der Arbeiterklasse in speziellen vom Staat getragenen Schulen, unter der Obhut von offiziell gewählten Offizieren, jedoch unter der Kontrolle der Arbeiterinstitutionen, womit insbesondere die Gewerkschaften gemeint waren. Es liegt auf der Hand, dass kein kapitalistischer Staat solche Forderungen der Arbeiterklasse bewilligen konnte, wenn dies die Existenz des Staates in Frage gestellt hätte. Die Perspektive Trotzkis war, dass das bewaffnete Proletariat den Kapitalismus zerstören muss, weil der Krieg in seinen Augen günstige Bedingungen für einen proletarischen Aufstand schafft, so wie es im Ersten Weltkrieg der Fall war.
”Der aktuelle Krieg ist, wie wir es schon oft gesagt haben, nur die Fortsetzung des letzten Krieges. Aber Fortsetzung ist nicht gleichzusetzen mit Wiederholung. (...) Unsere Politik, die proletarische revolutionäre Politik ist, was den zweiten imperialistischen Krieg betrifft eine Fortsetzung der, während des ersten imperialistischen Krieges unter der Führung von Lenin ausgearbeiteten Politik.” (Trotzki, Faschismus, Demokratismus und Krieg)
Für Trotzki waren die Bedingungen zudem günstiger als 1917, da der Kapitalismus kurz vor dem neuen Krieg den Beweis dafür geliefert habe, dass er sich in einer historischen Sackgasse befinde, während gleichzeitig auf der subjektiven Seite, die Arbeiterklasse weltweit viel an Erfahrung gewonnen habe.
”Es ist die Perspektive (die Revolution), die die Grundlage sein muss für unsere Agitation. Es reicht nicht, nur eine Position über den Militarismus des Kapitalismus zu haben und sich zu weigern, den bürgerlichen Staat zu verteidigen, sondern es geht um die Vorbereitungen zur Eroberung der Macht und Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes (...).” (ebenda)
Durch seinen Glauben, der historische Kurs führe hin zur proletarischen Revolution, hatte Trotzki offensichtlich jegliche Orientierung verloren. Er hatte keine korrekte Einschätzung über die Situation der Arbeiterklasse und auch nicht über das Kräfteverhältnis, welches zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie bestand. Einzig die Italienische Kommunistische Linke war fähig aufzuzeigen, dass sich in den 30er Jahren die Menschheit in einer tiefen konterrevolutionären Phase befand, das Proletariat geschlagen war und infolgedessen einzig die „Lösung“ der Bourgeoisie, der imperialistische Krieg, möglich war.
Trotz seines „militaristischen“ Kauderwelsch, das ihn ins Lager des Opportunismus abgleiten ließ, hielt Trotzki standhaft an einer internationalistischen Haltung fest. Mit dem Wunsch, „konkret“ zu sein (bezüglich des Klassenkampfes mit seinem Übergangsprogramm und in der Armee mit seiner militärischen Politik), um die Arbeitermassen für die Revolution zu gewinnen, begann er sich vom klassischen Marxismus zu entfernen und verteidigte eine den Interessen des Proletariats entgegengesetzte Politik. Dies Politik, die beanspruchte taktisch zu sein, war in Wirklichkeit sehr gefährlich. Sie fesselte das Proletariat an den bürgerlichen Staat und ließ es im Glauben, dass es gute bürgerliche Lösungen gäbe. Im Krieg wurde diese „subtile“ Taktik durch die Trotzkisten in die Praxis umgesetzt, um zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist, so insbesondere ihren Anschluss an die Bourgeoisie mittels der Verteidigung der Nation und der Beteiligung an der ”Résistance”.
Doch weshalb ließ Trotzki seiner „militärischen Politik“ ein dermaßen großes Gewicht zukommen? In seinen Augen zeichnete sich für die Menschheit die Perspektive einer total militarisierten Gesellschaft ab, die jeden Tag mehr gekennzeichnet sei vom bewaffneten Kampf zwischen den Klassen. Das Schicksal der Menschheit würde demnach vor allem auf militärischem Terrain entschieden. Für ihn bestand die dringendste Verantwortung des Proletariats darin, sich auf den Kampf um die Macht gegen die kapitalistische Klasse vorzubereiten. Das war vor allem seine Idee zu Beginn des Krieges:
”In den besiegten Ländern wird sich die Lage der Massen sofort verschlechtern. Zur sozialen Unterdrückung kommt die nationale Unterdrückung hinzu, deren Hauptgewicht die Arbeiterklasse erleiden muss. Von allen Formen der Diktatur ist die totalitäre Diktatur eines fremden Eroberers die unerträglichste.“ (Wir wechseln unser Lager nicht, 30. Juni 1940)
„Es ist nicht möglich hinter jeden Arbeiter oder Bauern, seien dies polnische, norwegische, dänische, holländische oder französische, einen bewaffneten Soldaten zu stellen.“ 9 [49]
„Wir können mit grosser Sicherheit davon ausgehen, dass alle besiegten Länder sich in Kürze in ein Pulverfass verwandeln. Die Gefahr ist, dass sich die Explosionen sehr schnell entladen, ohne genügend vorbereitet zu sein, und in isolierten Niederlagen enden. Es unmöglich von der europäischen Revolution und der Weltrevolution zu reden, ohne die einzelnen Niederlagen in Betracht zu ziehen.“ (ebenda)
All das mindert überhaupt nicht die Tatsache, dass Trotzki bis zum Schluss ein Revolutionär des Proletariats geblieben ist. Der Beweis dazu steht im Manifest, genannt Alarm, der IV. Internationale, das er verfasste, um eine Position ohne Zweideutigkeiten und einzig aus dem Blickwinkel des revolutionären Proletariats zu beziehen, dies im Angesicht des generalisierten imperialistischen Krieges:
”Gleichzeitig sollten wir nicht für einen Moment vergessen, dass dieser Krieg nicht unser Krieg ist (...) Die IV. Internationale setzt mit ihrer Politik nicht auf das militärische Glück der kapitalistischen Staaten, sondern auf die Transformation des imperialistischen Krieges in einen Krieg der Arbeiter gegen die Kapitalisten, für die Beseitigung der herrschenden Klassen aller Länder, für die sozialistische Weltrevolution (...) Wir erklären den Arbeitern, dass ihre Interessen und die des blutdürstigen Kapitalismus unvereinbar sind. Wir mobilisieren die Arbeiter gegen den Imperialismus. Wir propagieren die Einheit der Arbeiter in allen kriegsführenden und neutralen Länder." (Manifest der IV. Internationale, 29. Mai 1940)
Und genau dies haben die Trotzkisten "vergessen" und verraten!
Im Gegensatz dazu enthielten das "Übergangsprogramm" und die „militärische proletarische Politik“ eine politische Orientierung von Trotzki, die aus der Sicht der Arbeiterklasse in einem Fiasko endete. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges brach nicht nur keine proletarische Revolution aus, sondern die „militärische proletarische Politik“ diente der IV. Internationale als Rechtfertigung für ihre Teilnahme an der generalisierten imperialistischen Schlächterei und dazu, ihre Militanten in gute Soldaten der "Demokratie" und des Stalinismus zu verwandeln. Das war der Moment, als der Trotzkismus unwiederbringlich ins feindliche Lager überging.
Die Frage der Natur der UdSSR: Die Achillesferse Trotzkis
Die grösste Schwäche Trotzkis bestand darin, dass er nicht verstanden hatte, dass der historische Kurs in Richtung Konterrevolution und deshalb zum Weltkrieg führte, so wie es die Italienische Kommunistische Linke klar erkannt hatte. Immer die Vision eines Kurses in Richtung einer Revolution vor den Augen, rief er 1936 aus: "Die französische Revolution hat begonnen" (La lutte ouvrière, 9. Juni 1936); und was Spanien betrifft: "Die Arbeiter der ganzen Welt erwarten brennend den neuen Sieg des spanischen Proletariats." (La lutte ouvrière, 9. August 1936). Er beging hier einen enormen politischen Fehler, indem er die Arbeiterklasse glauben machte, dass das, was eben geschah, insbesondere in Frankreich und Spanien, in Richtung einer proletarischen Revolution gehe, obwohl in Wirklichkeit die weltweite Situation sich in die Gegenrichtung bewegte: "Seit seiner Ausweisung aus der UdSSR 1929 bis zu seiner Ermordung, hörte Trotzki nicht auf, die Welt verkehrt zu interpretieren. Während die momentane Aufgabe darin bestand, die von der Niederlage übriggebliebenen revolutionären Kräfte zu sammeln, um allem voran eine komplete politische Bilanz der revolutionären Welle in Angriff zu nehmen, fand ein verblendeter Trotzki immer wieder Wege, das Proletariat stets in Bewegung zu sehen, auch wenn es in der Realität geschlagen war. Deshalb war die IV. Internationale, die vor mehr als 50 Jahren gegründet wurde, nichts als eine leere Hülle, in der sich niemals eine wirkliche Bewegung der Arbeiterklasse hätte realisieren können. Und dies aus dem schlichten und tragischen Grund, dass sie sich im vollen Rückfluss der Konterrevolution befand. Alle Taten Trotzkis, basierend auf diesem Irrtum, trugen dazu bei, die damals schon auf der Welt schwachen revolutionären Kräfte der 30er Jahre noch mehr zu zerstreuen, und schlimmer noch, den grössten Teil davon in den kapitalistischen Morast der "kritischen" Unterstützung der Regierungen des Typs "Volksfront" und in die Teilnahme am imperialistischen Krieg zu zerren." (siehe unsere Broschüre Der Trotzkismus gegen die Arbeiterklasse)
Einer der schlimmsten Irrtümer Trotzkis bestand insbesondere in seiner Position über die Natur der UdSSR. Er kritisierte und griff den Stalinismus an, hielt die UdSSR jedoch weiterhin für ein "Vaterland des Sozialismus" oder mindestens noch einen "degenerierten Arbeiterstaat". Jedoch alle diese politischen Fehler, so viele dramatische Konsequenzen sie auch immer hatten, konnten ihn nicht zum Feind der Arbeiterklasse machen, während aber gerade seine "Erben" nach seinem Tod dazu wurden. Trotzki war sogar fähig, angesichts der Ereignisse zu Beginn des Krieges zu gestehen, dass er seine politischen Analysen überprüfen und modifizieren müsse, insbesondere in Bezug auf die UdSSR.
Er bestätigte zum Beispiel, in einer seiner letzten Schriften vom 25. September 1939, mit dem Titel Die UdSSR im Krieg: "Wir ändern unseren Kurs nicht (...) Nehmen wir aber an, Hitler wendet seine Waffen nach Osten und greift die von der Roten Armee besetzten Gebiete an. (...) Während die Bolschewiki-Leninisten mit der Waffe in der Hand Hitler bekämpfen, werden sie gleichzeitig revolutionäre Propaganda gegen Stalin führen, um seinen Sturz im nächsten – und vielleicht sehr nahen – Stadium vorzubereiten.“ (Die UdSSR im Krieg, in Verteidigung des Marxismus, Verlag Neuer Kurs Berlin, S. 28-29)
Er hielt zwar an seiner Analyse über die Natur der UdSSR fest. Seine Schlussfolgerungen hingen aber davon ab, welches Urteil die Prüfung des Zweiten Weltkriegs über die Sowjetunion fällen würde. Im gleichen Artikel schrieb Trotzki, dass er, wenn der Stalinismus als Sieger und gestärkt aus dem Krieg hervorgehen sollte (eine Perspektive, die er sich nicht vorstellen konnte), nochmals sein Urteil über die UdSSR überprüfen müsse, eingeschlossen jenes über die allgemeine politische Situation: „Wenn man jedoch annimmt, dass der gegenwärtige Krieg keine Revolution hervorrufen wird, sondern den Niedergang des Proletariates, bleibt eine andere Möglichkeit: der weitere Verfall des Monopolkapitalismus, seine weitere Verschmelzung mit dem Staat und das Ersetzen der Demokratie überall da, wo sie noch verblieben war, durch ein totalitäres Regime. Die Unfähigkeit des Proletariats, die Führung der Gesellschaft in seine Hände zu nehmen, könnte tatsächlich unter diesen Bedingungen dazu führen, dass sich eine neue Ausbeuterklasse aus der bonapartistischen faschistischen Bürokratie entwickelt. Dies wäre, allen Anzeichen zufolge, ein Regime des Verfalls, das den Untergang der Zivilisation bedeuten würde.
Ein entsprechendes Ergebnis könnte sich ergeben, wenn sich das Proletariat der hochentwickelten kapitalistischen Länder, nach der Eroberung der Macht, als unfähig erweisen sollte, sie zu halten, und sie, wie in der UdSSR, an eine privilegierte Bürokratie abtreten sollte. Dann wären wir gezwungen zuzugeben, dass der Grund für den bürokratischen Rückfall nicht in der Rückständigkeit des Landes und nicht in der imperialistischen Umklammerung liegt, sondern in der angeborenen Unfähigkeit des Proletariates, eine herrschende Klasse zu werden. Dann müsste man im Rückblick feststellen, dass die grundlegenden Züge der jetzigen UdSSR der Vorläufer eines neuen Ausbeutungsregimes im internationalen Maßstab waren.
Wir sind weit vom terminologischen Streit über die Bezeichnung des Sowjetstaates abgekommen. Aber unsere Kritiker sollen nicht protestieren. Nur indem man die notwendige historische Perspektive betrachtet, kann man sich ein richtiges Urteil über die Frage wie die Ersetzung einer sozialen Regierungsform durch eine andere bilden. Die historische Alternative, zu Ende geführt, ist folgende: Entweder ist das Stalin-Regime ein widerlicher Rückfall im Prozess der Umwandlung der bürgerlichen Gesellschaft in eine sozialistische, oder das Stalin-Regime ist die erste Stufe einer neuen Ausbeutungsgesellschaft. Wenn sich die zweite Prognose als richtig erweist, dann wird die Bürokratie selbstverständlich eine neue Ausbeuterklasse werden. (durch uns unterstrichen) Wie beschwerlich der zweite Ausblick auch immer sein mag, wenn das Weltproletariat sich tatsächlich als unfähig erweisen sollte, den Auftrag zu erfüllen, der ihm vom Verlauf der Entwicklung gestellt wurde, müsste man notgedrungen anerkennen, dass das sozialistische Programm, das auf die inneren Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft gegründet ist, in einer Utopie endet. Es ist selbstverständlich, dass ein neues „Minimal“programm erforderlich wäre – zur Verteidigung der Interessen der Sklaven der totalitären bürokratischen Gesellschaft.“ (ebenda, S. 12-13)
Abstrahiert man von der Zukunftsvision, die Trotzki in diesem Moment entwickelte, eine Vision, die eine grosse Entmutigung offenbart, wenn nicht gar eine tiefe Demoralisierung, und die offenbar sein ganzes Vertrauen in die Arbeiterklasse und ihre Fähigkeit, die historische revolutionäre Perspektive zu übernehmen, erschütterte, ist es klar, dass Trotzki hier Zweifel an seiner eigenen Position zu der "sozialistischen" Natur der UdSSR und dem "Arbeiter-Charakter“ der Bürokratie überkommen.
Trotzki wurde lange vor dem Ende des Krieges ermordet; Russland stand wieder auf der Seite der Gewinner, zusammen mit den "demokratischen" Ländern. Wie Trotzki vorgesehen hatte, verlangten diese historischen Bedingungen denjenigen etwas ab, die meinten, Trotzkis treue Nachkommen zu sein. Und zwar eine Neubeurteilung seiner Positionen oder wie er es ausdrückte: "(...) im Rückblick feststellen, dass die grundlegenden Züge der jetzigen UdSSR der Vorläufer eines neuen Ausbeutungsregimes im internationalen Maßstab waren". Die IV. Internationale hatte diese Einsicht nicht nur ignoriert, sondern sich darüber hinaus mit Sack und Pack den Reihen der Bourgeoisie angeschlossen. Nur wenige Elemente, die aus dem Trotzkismus kamen, konnten auf revolutionärem Terrain bleiben, so wie jene, die in China eine Gruppe ins Leben riefen und 1941 Der Internationalist publizierten (siehe unsere Internationale Revue Nr. 94); die Mitglieder der spanischen Sektion der IV. Internationale um G. Munis1 [49]0; die Revolutionären Kommunisten Deutschlands (RKD); die Gruppe Socialisme ou Barbarie in Frankreich; Agis Stinas in Griechenland oder Natalia Trotzki.
Treu dem Geiste ihres Gefährten im Leben und im Kampf für die Revolution kam Natalia Trotzki in einem Brief vom 9. Mai 1951, gerichtet ans Exekutivkomitee der IV. Internationale, darauf zurück und beharrte insbesondere auf dem konterrevolutionären Charakter der UdSSR: "Besessen von alten und überholten Formeln, haltet Ihr den stalinistischen Staat noch immer für einen Arbeiterstaat. Ich kann und will Euch in diesem Punkt nicht folgen. (...) Es dürfte für jeden einzelnen klar sein, dass die Revolution vom Stalinismus völlig zerstört wurde. Und trotzdem, sagt Ihr weiterhin, dass unter diesem monströsen Regime Russland noch immer ein Arbeiterstaat sei."
Sie zog sämtliche Konsequenzen aus dieser mehr als deutlichen Position und folgerte richtigerweise: "Das weitaus Untragbarste an allem ist die Position über den Krieg, die Ihr eingenommen habt. Der dritte Weltkrieg, der die Menschheit bedroht, stellt die revolutionäre Bewegung vor die schwierigsten Probleme, die komplexesten Situationen, die schwerwiegendsten Entscheidungen. (...) Aber angesichts der Ereignisse der letzten Jahre propagiert Ihr noch immer die Verteidigung des stalinistischen Staates und ein Engagement der ganzen Arbeiterbewegung dafür. Ihr unterstützt jetzt sogar die Armee des Stalinismus im Krieg, der das koreanische Volk peinigt".
Und sie kam zu einem mutigen Schluss: "Ich kann und will Euch in diesem Punkt nicht folgen. Es gibt kein anderes Mittel mehr, als Euch bekannt zu geben, dass mir keine andere Lösung bleibt, als offen zu sagen, dass unsere Meinungsverschiedenheiten mir nicht mehr erlauben, noch länger in Euren Reihen zu verbleiben." (Die Kinder des Propheten, Cahiers Spartacus, Paris 1972)
Die Trotzkisten heute
Wie Natalia Trotzki bestätigt, folgten die Trotzkisten weder Trotzki, noch revidierten sie ihre politischen Positionen nach dem Sieg der UdSSR im Zweiten Weltkrieg. Die einzigen Diskussionen oder Fragezeichen zur Klärung und Vertiefung – wenn es sie überhaupt gibt - beziehen sich auf das Thema der "proletarischen militärischen Politik" (siehe Chaiers Léon Trotzky, Nr. 23, 39 und 43 oder Revolutionary History, Nr. 3, 1988). Diese Diskussionen jedoch halten das große Schweigen über die grundsätzlichen Fragen wie die Natur der UdSSR, den proletarischen Internationalismus und den revolutionären Defätismus gegenüber dem Krieg aufrecht. Geschmückt mit einem pseudo-wissenschaftlichen Gerede stellt Pierre Broué fest: "Es ist tatsächlich indiskutabel, dass das Ausbleiben einer Diskussion und Bilanz über diese Frage (die PMP) ein Alptraum in der Geschichte der IV. Internationale war. Eine gründliche Analyse würde die Ursache dieser Krise aufzeigen, die sich in den 50er Jahren in der Internationale abzuzeichnen begann" (Cahiers Léon Trotzky, Nr. 39).
Welch schöne Worte!
Die trotzkistischen Organisationen begingen Verrat und wechselten das Lager, so stehen die Dinge. Auch wenn die trotzkistischen Geschichtsschreiber wie Pierre Broué oder Sam Levy die Dinge bis zur Abwürgung drehen und wenden mögen, indem sie von einer blossen Krise ihrer Bewegung reden: "Die fundamentale Krise des Trotzkismus entstand aus der Verwirrung und der Unfähigkeit, den Krieg und die Welt der darauffolgenden Nachkriegszeit zu verstehen" (Sam Levy, ein Veteran der britischen trotzkistischen Bewegung in Cahiers Léon Trotzky, Nr. 23).
Es ist wahr, dass der Trotzkismus weder den Krieg noch die Welt der darauffolgenden Nachkriegszeit verstand. Aber genau deshalb haben sie die Arbeiterklasse und den proletarischen Internationalismus verraten, indem sie ein imperialistisches Lager gegen ein anderes im Zweiten Weltkrieg unterstützt haben. Seit damals gaben sie es nie auf, die kleinen Imperialisten gegen die Grossen zu unterstützen, in den zahllosen Kämpfen der sogenannten nationalen Befreiung und anderen Kämpfen der "unterdrückten Völker". Pierre Broué, Sam Levy und Konsorten sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber der Trotzkismus ist tot für die Arbeiterklasse; und es gibt für ihn kein Wiederaufleben mehr als mögliches Instrument der Emanzipation der Arbeiterklasse. Es bringt den Trotzkisten nichts zu versuchen, die wirklichen Internationalisten und insbesondere die Arbeit der Italienischen Kommunistischen Linken während des Krieges für sich zu beanspruchen, so wie es Cahiers Léon Trotzky in ihrer Nummer 39 (Seiten 36 und folgende) versucht. Ein bisschen Anstand ihr Herrschaften! Vermischt die Internationalisten der Italienischen Kommunistischen Linken nicht mit der patriotischen und gegenüber der Arbeiterklasse verräterischen IV. Internationale. Wir, die Kommunistische Linke, haben mit der IV. Internationale und allen ihren heutigen Wiedergeburten überhaupt nichts gemeinsam. Im Gegenteil, wir sagen: Lasst eure Hände von Trotzki! Er gehört weiterhin der Arbeiterklasse.
Rol
1 [49] Robert Coulondre (1885–1959), Botschafter in Moskau, später in Berlin.
2 [49] Zitiert nach Isaac Deutscher, Trotzki, der verstossene Prophet 1929-1940, Kohlhammer-Urban Verlag, 1972, S. 474-475
3 [49] Manifest der IV. Internationale über den imperialistischen Krieg und die proletarische Weltrevolution, von Trotzki selbst verfasst am 23. Mai 1939
4 [49] Pierre Broué zitiert in Cahiers Léon Trotzky die Arbeit des amerikanischen Historikers Gabriel Kolko Politik des Krieges, welche Beispiele aufführt, die in dieselbe Richtung gehen.
5 [49] Ähnlich wie Jean Jaurès kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges von 1914-18. Mit dem Unterschied jedoch dass dieser ein Pazifist war, während Trotzki immer ein Revolutionär und Internationalist blieb.
6 [49] Auch wenn das System in seine niedergehende Phase eingetreten ist, heisst das für uns nicht, dass es sich nicht mehr entwickeln kann. Für uns, wie auch für Trotzki, zeichnet sich die Dekadenz durch den Verlust der Dynamik eines System aus und dadurch, dass die Produktionsverhältnisse zu einer Fessel für die Entwicklung der Gesellschaft geworden sind. Zusammengefasst hat ein System somit seine fortschrittliche Rolle in der Geschichte verloren und ist reif, um einer anderen Gesellschaft Platz zu machen.
7 [49] Siehe dazu unser Buch Die Italienische Kommunistische Linke (zweiter Teil auf deutsch als Broschüre erhältlich) und die Broschüre Der Trotzkismus gegen die Arbeiterklasse (nur auf französisch erhältlich)
8 [49] Diese Position Trotzkis war nicht neu, er hatte damit schon während des Krieges in Spanien begonnen. „...wir müssen uns klar vom Verrat und den Verrätern abgrenzen und die besten Kämpfer an der Front behalten“. Er ging davon aus, dass der beste Arbeiter in der Fabrik auch der beste Soldat an der Front sein müsse. Diese Losung wurde auch im Krieg Chinas gegen Japan aufgestellt, als China als „angegriffenes“ und „kolonisiertes“ Land bezeichnet wurde.
9 [49] ebenda; diese Länder sind erwähnt, weil sie zum Zeitpunkt, als Trotzki den Artikel schrieb, besiegt wurden.
10 [49] Vgl. in unserer Broschüre Der Trotzkismus gegen die Arbeiterklasse den Artikel „Trotzki gehört der Arbeiterklasse, die Trotzkisten haben ihn entführt“, sowie in der Internationalen Revue Nr. 58 (engl./frz./span. Ausgabe) den Artikel „In Erinnerung an Munis“ zu seinem Tod im Jahre 1989.
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [50]
Internationale Situation
- 3156 Aufrufe
„Frieden und Wohlstand“ oder Krieg und Elend?
Acht Jahre nach seinem Vater tritt George W. Bush sein Amt als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. George Bush senior hatte nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Auseinanderbrechen der UdSSR „eine Ära des Friedens und des Wohlstands“ versprochen. Sein Sohn tritt sein Amt in einer Zeit der Kriege und des allgemeinen Elends an, deren Ausmaß und Intensität während der 90er Jahre noch zugenommen haben. Die Weltlage ist wirklich katastrophal. Und diese Situation ist nicht vorübergehend, denn man darf nicht erwarten, dass die Prophezeiungen von Bush senior eintreten. Alles weist darauf hin, dass der Kapitalismus die Welt in eine tödliche Spirale von mörderischen Konflikten zerren wird, die weltweit, auf allen Kontinenten aufbrechen. Die imperialistischen Gegensätze, insbesondere zwischen den Großmächten, werden sich weiter verschärfen. Eine neue, brutale Runde der Wirtschaftskrise und des Elends steht bevor, begleitet von einer Reihe von Katastrophen aller Art. Diese drei Elemente, die Kriege, die wirtschaftliche Sackgasse und die Zerstörung des Planeten, führen dazu, dass das Leben der heutigen Generationen immer unerträglicher wird und das Leben der zukünftigen Generationen in Gefahr ist. Es wird immer offensichtlicher, dass der Kapitalismus die Gattung Mensch auszulöschen im Begriff ist.
Während die Friedensillusionen mit dem Golfkrieg und den Bombardierungen Iraks 1991 und schließlich mit den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien schnell verflogen waren, erhielten die Illusionen über einen zu erwartenden Wohlstand mehrmals neuen Auftrieb; so, als es in den USA in den 90er Jahren durchweg positive Wachstumsraten gab, so durch die Börsenhaussen und durch die fabelhafte „Neue Ökonomie“ im Internet. Jedoch haben die Wachstumsraten in den USA und die Börsenhausse die dramatische Zunahme von Hunger und Verarmung auf der Welt nicht verhindern können. Im Gegenteil, der Traum von der „Neuen Ökonomie“ ist längst geplatzt, und die Illusionen über den Wohlstand für alle haben sich in Luft aufgelöst.
Eine Wirtschaft im virtuellen Bankrott
Wir haben in der Internationalen Revue die Lügen über die angebliche “Erholung” der Weltwirtschaft, die sich auf steigende Wachstumsraten stützte, bereits entlarvt. So hat die Weltbourgeoisie „Regeln“ aufgestellt, denen zufolge man von Rezession erst nach zwei Halbjahren rückläufigen Wachstums sprechen kann. An dieser Stelle sei hier nur nebenbei festgestellt, dass sich Japan seit Jahren auch „offiziell“, d.h. nach den Kriterien der bürgerlichen Propaganda, in einer Rezession befindet. Aber abgesehen von den Zahlentricks und den Täuschungsmanövern in der Art der Berechnung bedeutet ein „positives“ Wachstum keineswegs, dass die Wirtschaft sich einer guten Gesundheit erfreut. Die Zunahme der Verarmung gerade in den USA (1) unter Präsident Clinton trotz „außergewöhnlicher“ Wachstumsraten belegt dies.
Schlimmer als 1929
Die Medien, die bürgerlichen Politiker und die Ökonomen führen stets die Weltwirtschaftskrise von 1929 als Nonplusultra einer katastrophalen Wirtschaftskrise an und behaupten, dass heute die Wirtschaft dagegen floriere. Die Erfahrung von 1929 widerlegt diese Behauptung: „Im Leben der meisten Menschen waren die zentralen Erfahrungen mit der Wirtschaft sicherlich von großen Krisen geprägt, wie der von 1929-33, aber das Wirtschaftswachstum kam während all dieser Jahrzehnte nicht zum Erliegen. Es verlangsamte sich nur. Im größten und reichsten Land, den USA, überstieg das durchschnittliche Wachstum des BSP pro Kopf nicht einen bescheidenen Satz von 0,8%. Gleichzeitig stieg die weltweite Industrieproduktion um mehr als 80%, d.h. ungefähr die Hälfte des Wachstums des letzten [19.] Vierteljahrhunderts“. (W. W. Rostow, 1978, S. 662) [...] „Wenn ein Marsmensch die Wachstumskurven aus der Ferne beobachtet hätte, wären ihm die Auf- und Abschwünge auf der Erde nicht aufgefallen, unter deren Folgen die Menschen zu leiden hatten, und er hätte daraus zweifellos die Schlussfolgerung gezogen, dass es eine fortgesetzte Expansion der Weltwirtschaft gegeben hat.“ (E.J. Hobsbawn, Das Zeitalter der Extreme)
Unsere Ökonomen und Regierungen sind keine Marsmenschen, sondern Repräsentanten und Verteidiger der kapitalistischen Ordnung. Kraft ihrer Funktion mühen sie sich ab, die Wirklichkeit der Wirtschaftskrise zu vertuschen. Nur selten und zumeist in vertraulichen Insiderschriften räumt man die Tatsachen ein, die unsere Aussage bekräftigen: „Jedoch reichen die Wachstumsraten weiterhin nicht aus, um die Verarmung zurückzudrängen und der Bevölkerung Wohlstand zu bringen“, schätzt The Economist die Lage in Lateinamerika ein (Courrier International, „Le Monde en 2001“). Dies trifft auch auf die restliche Weltbevölkerung zu. Und welch dramatische Zuspitzung der Verarmung wird man erst erwarten können, wenn die Prognosen Fred Hickeys, die vom Wall Street Journal zitiert werden, zutreffen: „Es ist sicher, dass wir in eine Rezession schlittern.“ (Le Monde, 17.3.2001)!
Nach dem Absturz der Börsen seit Jahresbeginn kann man kaum noch behaupten können, dass in der Welt der Börsen und der mit dem Internet verbundenen „Neuen Ökonomie“ alles in Ordnung ist. „Seit dem historischen Höchststand von 5132 Punkten am 10. März 2000 sind die Technologiewerte um nahezu 65% gefallen. Ein trauriger Jahrestag, da sich in der gleichen Zeit nahezu 4.500 Mrd. Dollar an der amerikanischen Börse in Luft aufgelöst haben.“ (Le Monde, ebenda)
Neben den mit der Internet-Wirtschaft verbundenen Technologiebörsen sind auch alle anderen Börsen vom Kursverfall der Aktien erfasst worden. Dennoch scheint im Gegensatz zu den Börsenkrisen der 80er und 90er Jahre in Amerika, Asien und Russland der aktuelle Kursverfall noch unter Kontrolle zu sein, obwohl es sich hier faktisch um einen großen Krach handelt. Eine große Unbekannte steht weiterhin im Raum: die Lage in Japan, dessen Finanz- und Bankensystem vor allem durch faule Kredite am Rande der Zahlungsunfähigkeit steht: „Der Absturz des japanischen Bankensystems bedroht die ganze Welt.“ (Le Monde, 27.03.2001) Falls Japan seine Anlagen in den USA zurückziehen sollte, wäre die gesamte Kreditpolitik der USA durch den daraus entstehenden Dominoeffekt bedroht. „Wenn die ausländischen Investoren das notwendige Kapital nicht zur Verfügung stellen wollen, könnte es zu schwerwiegenden Auswirkungen auf das Wachstum, die Aktien und den Dollarkurs kommen.“ (The Economist, Courrier International, „Die Welt im Jahr 2001“) Zudem ist die Sparquote in den US-Haushalten nahezu gleich Null, und die Verschuldung der Haushalte und Firmen zu Spekulationszwecken hat alle bisherigen Rekorde gebrochen. Wir haben bereits mehrfach aufgezeigt, dass die Weltwirtschaft auf einem Schuldenberg fußt, der nie getilgt werden wird. Zwar ist es kurzfristig gelungen, die Rückzahlung der Schulden eine Zeitlang aufzuschieben und durch Umschuldungen besonders in den „Schwellenländern“ Zeit herauszuschlagen, doch auf Dauer wird dies die Wirtschaftskrise noch verstärken. Die US-Wirtschaft, die größte in der Welt, ist gleichzeitig auch am stärksten verschuldet; ihr Wachstum basierte einzig und allein auf Pump, d.h. auf einem „gewaltigen Handelsdefizit und einer massiven Auslandsverschuldung (...) Zusammenfassend kann gesagt werden, braucht die US-Wirtschaft im Jahre 2001 eine intelligente Führung und vor allem eine gute Portion Glück.“ (ebenda) Zweifel sind angebracht: Wer würde gern in ein Flugzeug steigen, wenn vor dem Start ankündigt wird, dass man einen intelligenten Piloten braucht und vor allem „eine gute Portion Glück“?
Nach den vielen Finanzkrisen, die Russland, Asien und Lateinamerika mehrfach erschüttert hatten und in deren Gefolge jedes Mal die Zahlungsunfähigkeit bei der Schuldentilgung festgestellt worden war, musste nun die Türkei quasi ihre Zahlungsunfähigkeit eingestehen und zum Bittgang beim IWF antreten. Da die Türkei nicht in der Lage war, fristgemäß zum 23. März drei Milliarden Dollar zurückzuzahlen, wurde ihr vom IWF ein Kredit von sechs Milliarden Dollar gewährt, der an die Bedingung geknüpft war, drastische Sparmaßnahmen gegen die Bevölkerung zu ergreifen. Und auch der freie Fall der argentinischen Wirtschaft beschleunigt sich. Im vergangenen Winter musste „eine außergewöhnlichen Finanzhilfe von 39,7 Mrd. Dollar gewährt werden, um damit vor allem eine Zahlungsunfähigkeit gegenüber der großen Auslandsverschuldung (122 Mrd. Dollar, d.h. 42% ihres BSP) zu vermeiden.” (Le Monde, 20. 3.2001) Isoliert betrachtet, mögen diese lokalen Krisen nur die Fragilität dieser Länder zum Ausdruck bringen. Doch in Wirklichkeit spiegeln sie die Zerbrechlichkeit der Weltwirtschaft wider, denn jede dieser seit der Lateinamerika-Krise 1982 zunehmenden Turbulenzen, in denen die „Schwellenländer“ ihre Schulden nicht mehr zurückzahlen können, bedroht unmittelbar das gesamte internationale Finanzsystem. Daher die überstürzten Interventionen der Regierungen der Großmächte und des IWF durch neue, noch umfangreichere „Hilfspakete“.
Unter diesen Bedingungen geht es für die Bourgeoisie seit Jahren nur noch darum, den unvermeidbaren Absturz der US-Wirtschaft zu kontrollieren. „Der Nachfrageüberhang im Verhältnis zum Angebot symbolisiert in den USA die Kehrseite der Medaille dieses Wunders (des amerikanischen Wachstums). Dies ist auch eine Gefahr, denn es ist verbunden mit einem gewaltigen Handelsdefizit und einer enormen Auslandsverschuldung. Wenn das Handelsdefizit und die Verschuldung weiter zunehmen, wäre ein Zusammenbruch unvermeidbar. Aber das wird nicht der Fall sein. Wenn das US-Wachstum 2001 wieder bescheidenere Ausmaße annimmt, d.h. nicht mehr außergewöhnliche, sondern nur noch beeindruckende, wird das Außenhandels- und Zahlungsbilanzdefizit zurückgehen.“ (The Economist, Courrier International, „Die Welt im Jahre 2001“) Der oben zitierte Journalist setzte auf das Glück. Der hier zitierte setzt in seinem Artikel „Das goldene Zeitalter der Weltwirtschaft“ auf Wunder. An vorderster Stelle steht für die verschiedenen Teile der Weltbourgeoisie, ungeachtet ihrer entgegengesetzten imperialistischen, politischen und Handelsinteressen, die Sorge um eine „weiche Landung“ der US-Wirtschaft. D.h. eine Landung ohne allzu große Erschütterungen, die der ganzen Welt und insbesondere der internationalen Arbeiterklasse die dramatische Wirklichkeit, den irreversiblen Bankrott der kapitalistischen Produktionsweise, offenbaren würde. Die Bevölkerung auf der ganzen Welt, einschließlich der Industriestaaten Europas und Nordamerikas, kann von diesem System nur eine Zunahme der Verarmung und des Elends erwarten, die ohnehin schon ungeheure Ausmaße erreicht haben.
Die „Agrarkrise“ - Krise des Kapitalismus
Infolge der landwirtschaftlichen Überproduktionskrise werden in den Industrieländern Tausende von kleineren und mittleren Bauernhöfen in Konkurs gehen; der Konzentrationsprozess in diesem Wirtschaftszweig wird sich weiter zuspitzen. BSE und Maul- und Klauenseuche sind keine Naturkatastrophen, sondern gesellschaftliche Katastrophen, d.h. verbunden mit der kapitalistischen Produktionsweise und durch sie verursacht. Sie sind das Ergebnis einer Verschärfung der wirtschaftlichen Konkurrenz und eines Strebens nach Produktivitätserhöhung. Kurzum, sie sind ein Ausdruck der weltweiten landwirtschaftlichen Überproduktionskrise. Und auch die „Lösungen“ der bürgerlichen Krisenmanager zeigen, wie im Fall der Maul- und Klauenseuche, die ganze Perversität dieses System. Während ein Großteil der Weltbevölkerung hungert, werden die Tiere massenhaft geschlachtet und verscharrt, und das, obwohl eine Impfung völlig ausreichend wäre. „Die Agrarkrise unterstreicht erneut, in welchem Maße der Hunger im Süden verbunden ist mit der Überproduktion im Norden.“ (Sylvie Brunel, „Gegen den Hunger kämpfen“, Le Monde, 10.03.2001) Diese Krise wird auch die Bauern in der Peripherie des Kapitalismus, d.h. einen großen Teil der Weltbevölkerung, erfassen. „Für die Dritte Welt zeichnet sich eine andere verheerende Folge des Zusammenbruchs des Fleischmarktes ab: die Weizenüberproduktion.“ (ebenda) Deutlicher ließe sich der Wahnsinn des kapitalistischen Systems und der absurden Folgen, die sich aus seinem Weiterbestehen ergeben, nicht zeigen. „Denn das Problem der weltweiten Ernährung liegt nicht bei der Nahrungsmittelproduktion, die weltweit völlig ausreicht, sondern in der Verteilung: diejenigen, die an Unterernährung leiden, sind zu arm, um die Lebensmittel zu kaufen, um sich zu ernähren.“ (ebenda) (2) Der Kapitalismus kann sich einfach nicht den „Luxus“ erlauben, diese Tiere, statt sie zu schlachten, den Hungernden der Welt kostenlos zu überlassen - die Preise würden ins Bodenlose abstürzen.
Solange der Kapitalismus nicht überwunden ist und seine ökonomischen Gesetzmäßigkeiten, insbesondere das Wertgesetz, fortbestehen, ist es eine philanthropische Utopie zu fordern, gesunde Tiere zu verschenken, die aufgrund der Überproduktion abgeschlachtet werden sollen. Dies trifft auf die gesamte Überschussproduktion in der Landwirtschaft wie in allen anderen kapitalistischen Wirtschaftsbereichen zu. Daher liegen unzählige Felder in den Industriestaaten brach und stapeln sich Tonnen unverkäuflicher Butter und Milch. Nur eine Gesellschaft, in der das Wertgesetz, die Lohnarbeit und die Existenz gesellschaftlicher Klassen aus der Welt geschafft sind, kann dieses Dilemma lösen, weil sie dazu in der Lage sein wird, den Bedürfnissen der Menschen und nicht denen des Profits gerecht zu werden.
Doch nicht nur die in der Landwirtschaft tätige Bevölkerung – ob sie über einen kleinen Landbesitz verfügt, Land pachtet oder ihre Arbeitskraft als Tagelöhner oder Landarbeiter verkauft - ist von der Zuspitzung der Wirtschaftskrise betroffen.
Die Angriffe gegen die Arbeiterklasse
Eine Welle von Entlassungen findet derzeit in allen Wirtschaftsbranchen statt. In den USA haben Firmen aus der „Neuen Ökonomie“ wie Intel, Dell, Delphi, Nortel, Cisco, Lucent, Xerox und Compaq, aber auch Firmen aus der traditionellen Wirtschaft wie General Motors und Coca-Cola Zehntausende von Entlassungen angekündigt. Desgleichen in Europa, wo die Zahl von Werksschließungen horrend zugenommen hat, wie beispielsweise bei Marks & Spencer, Danone und in der Rüstungsindustrie bei EADS sowie bei den französischen Giat Industries (die den Leclerq-Panzer herstellen), während gleichzeitig der Personalabbau in den großen Firmen und im Öffentlichen Dienst vorangetrieben wird.
In den Industriestaaten, wo die nationalen Bourgeoisien sich des Potenzials und der Gefahren bewusst sind, die aus dem Widerstand einer zahlenmäßig stark konzentrierten und historisch erfahrenen Arbeiterklasse entstehen können, geht die herrschende Klasse bei diesen Angriffen politisch äußerst vorsichtig vor. Dort jedoch, wo die Arbeiterklasse jünger, unerfahrener und zerstreuter ist, sind die Angriffe weitaus brutaler. So liegt es auf der Hand, dass die Angriffe gegen die Arbeiter in Argentinien und besondere in der Türkei – um nur zwei Beispiele zu erwähnen – noch zunehmen werden.
Diese massiven Angriffe in allen Ländern und in allen Wirtschaftsbereichen entlarven die Behauptung, dass die „Wirtschaft floriert“, als eine Lüge. Vor allem die stets wiederholte Behauptung, dass Entlassung nur Ausnahmen, Einzelfälle seien, ginge es doch dem Rest der Wirtschaft gut, läuft zunehmend ins Leere. Die ganze Arbeiterklasse ist betroffen; in allen Branchen rollt die Entlassungswelle, werden die Löhne gekürzt, nimmt die Unsicherheit zu, werden die Arbeitszeiten und -rhythmen erhöht, kurz: verschlechtern sich die Arbeits- und Lebensbedingungen.
Der alte Bush und mit ihm die Funktionsträger der verschiedenen Staaten und Regierungen, Politiker, Ideologen, Journalisten, Intellektuellen – sie alle sprachen vom Wohlstand. Dabei herausgekommen ist einzig und allein noch allgemeinere Armut, und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht.
Die Menschheit ist mit einer historischen Blockade konfrontiert. Einerseits hat der Kapitalismus nichts anderes mehr anzubieten als eine allgemeine Krise, lokale Kriege, Massenverelendung und eine wachsende Barbarei, ist jedoch nicht in der Lage, seine einzig reelle „Lösung“, einen dritten Weltkrieg, durchzusetzen. Andererseits gelingt es der einzigen gesellschaftlichen Kraft, die eine Perspektive für die Überwindung des Kapitalismus und Errichtung einer neuen Gesellschaft anbieten könnte, die internationale Arbeiterklasse, noch nicht, offen als Klasse in Erscheinung zu treten und ihre Kraft zu demonstrieren. In dieser Situation tritt die kapitalistische Gesellschaft in ein Stadium der Fäulnis. Zu den schlimmsten Gefahren für Zukunft und Überleben der Menschheit gehören neben den Kriegen, der Gewalt in den Städten auch die Zunahme der Umweltzerstörung und sonstiger Katastrophen.
Fäulnis und Wahnsinn der kapitalistischen Gesellschaft
In Folge des Rückgangs der Ozonschicht, der Verschmutzung der Meere, des Bodens, der Flüsse, der Städte und des Landes, der Manipulationen an Lebensmitteln, der Epidemien unter Menschen und Tieren (die Liste ließe sich beliebig fortsetzen) wird der Planet Erde immer unbewohnbarer; sein Gleichgewicht gerät zunehmend aus den Fugen.
Bislang erschienen die Katastrophen und die Umweltzerstörung nur als „natürliche“ Folgen der Zuspitzung der Wirtschaftskrise, der kapitalistischen Konkurrenz und der fieberhaften Jagd nach maximaler Produktivität. Heute jedoch sind die Fragen des Umweltschutzes zu einer imperialistischen Streitfrage, zu einem Schlachtfeld zwischen den Großmächten geworden. Die Aufkündigung des Kyoto-Abkommens über die Emissionen von Treibhausgasen durch die USA bot den anderen Großmächten, insbesondere den europäischen, Gelegenheit, den USA ein unverantwortliches Verhalten vorzuwerfen. „Die Europäische Union sieht keine andere Lösung für das Klimaproblem außerhalb des Protokolls von Kyoto, und sie ist weiterhin entschlossen, dieses anzuwenden, ob mit oder ohne die USA.“ (Romano Prodi, Präsident der Europäischen Kommission, Le Monde, 6. April 2001) So wie die „humanitären Angelegenheiten“ und die „Verteidigung der Menschenrechte“ sind auch Umweltverschmutzung und andere Katastrophen zum Streitpunkt und Teil des Wettbewerbs zwischen den Staaten geworden. So wie bei der Intervention in Somalia konnte auch die „humanitäre“ Intervention in Bosnien nur schwerlich die Interessenskollisionen zwischen den Großmächten verbergen. „Humanitäre Hilfe“ erfüllt den gleichen Zweck: Bei jedem Erdbeben entflammt ein Wettbewerb zwischen den amerikanischen und europäischen Suchmannschaften auf der Suche nach Überlebenden unter den Trümmern.
Der Kapitalismus stürzt die Menschheit und den ganzen Planeten in eine tödliche Spirale von wirtschaftlichen Katastrophen, sich verschärfenden imperialistischen Interessensgegensätzen und all den daraus entstehenden Folgen für das gesamte gesellschaftliche Leben, welche ihrerseits die imperialistischen Rivalitäten und Konflikte zuspitzen und die Wirtschaftskrisen weiter beschleunigen.
Eine Zunahme der Kriege
„Dass die Menschheit gelernt hat, in einer Welt zu leben, wo Massaker, Folter, Massenflucht zu einem alltäglichen Schicksal geworden sind, das wir kaum noch wahrnehmen, ist nicht der geringste tragische Aspekt dieser Katastrophe.“ (E.J. Hobsbawn, Das Zeitalter der Extreme)
Ein Blick auf die gegenwärtige Welt jagt einem Angst und Schrecken ein. Eine Reihe von endlosen blutigen, kriegerischen Konflikten prägt das Bild. Sie haben sich auf allen Kontinenten breitgemacht: in der ehemaligen UdSSR, insbesondere in ihren ehemaligen asiatischen Republiken und im Kaukasus; im Mittleren Osten vom Irak bis Pakistan und Afghanistan; in Südostasien, natürlich im Nahen Osten, in Afrika, zum Teil in Südamerika, insbesondere in Kolumbien; auf dem Balkan. Heute stellen jene Territorien auf dem Globus, die nicht direkt von offenen oder verdeckten Kriegen in der einen oder anderen Form betroffen sind, gleichsam Inseln des „Friedens“ in einem Meer von militärischen Zusammenstößen dar.
Ende der 70er Jahre und in den 80er Jahren war der Bürgerkrieg im Libanon der klarste Ausdruck des Eintritts der kapitalistischen Welt in die Phase ihres Zerfalls. Damals wurde der Begriff „Libanisierung“ zum Synonym für jene Länder, die in Folge endloser Kriege auseinanderbrachen. Heute sind ganze Kontinente diesem Prozess der „Libanisierung“ anheim gefallen. Eine ganze Reihe afrikanischer Staaten gehört dazu (3); müßig, sie alle aufzuzählen. Die meisten von ihnen sind Opfer Libanon-ähnlicher Verhältnisse geworden. Afghanistan mit seinen mehr als 20 Jahren Krieg und Massaker ist sicherlich einer der extremsten und dramatischsten Ausdrücke (4).
Wir dürfen uns nichts vormachen: Verantwortlich dafür sind historisch wie auch aktuell an erster Stelle der Imperialismus im Allgemeinen und die Großmächte im Besonderen. Die imperialistischen Rivalitäten unter diesen Staaten haben diese Konflikte erst ausgelöst und sie immer wieder angefacht: Dies trifft auf Afghanistan zu, das 1980, zur Zeit des Kalten Krieges, von russischen Truppen besetzt worden war, und dessen islamische Guerilla erst von den USA aus der Taufe gehoben und unterstützt wurde. Das trifft ebenso auf den Balkan zu, wo auf der einen Seite Deutschland 1991 die Unabhängigkeit Sloweniens und Kroatiens unterstützte und auf der anderen Seite Großbritannien, Frankreich, Russland, Italien, Spanien und die USA zu (womit wir nur die Hauptmächte genannt haben) intervenierten, um sich dem deutschen Bestreben entgegenzustellen. Das Gleiche gilt für Afrika. Eine Analyse der Wurzeln und des Ablaufs dieser Konflikte heute belegt die Handschrift der Großmächte und zeigt, wie diese Öl aufs Feuer dieser Konflikte gießen, selbst wenn Letztere aus ihrer Sicht keinen großen Stellenwert mehr haben, wie dies in Afrika oder Afghanistan der Fall ist.
Die direkten imperialistischen Rivalitäten zwischen den Großmächten, die in der Regel mit größerer Diskretion ausgetragen werden, haben seit der Auflösung der Blöcke 1989 und besonders in der letzten Zeit an Schärfe zugenommen. Die USA haben eine besonders aggressive Haltung gegenüber China eingenommen, wie der Vorfall um den chinesischen Abfangjäger und das US-amerikanische Spionageflugzeug am 1.April 2001 verdeutlicht, aber auch gegenüber Russland, mit der Ausweisung von 50 russischen Diplomaten Ende März 2001, und gegenüber Europa, mit der Ablehnung des Kyotoer Protokolls zu den Begrenzungen der Treibhauseffekte und dem Projekt des National Missile Defence (NMD), eine rüdere Haltung eingenommen.
George Bush senior und mit ihm die gesamte Welt sprachen vom Frieden. Aber in Wirklichkeit gab, gibt und wird es ständig Kriege geben.
Die Kriege in der Zeit des Niedergangs des Kapitalismus
Der Kapitalismus erscheint aus historischer Sicht gesehen als irrational. Er führt zur Auslöschung der Gattung Mensch, denn er respektiert keine ökonomische oder historische Rationalität mehr.
„Im kurzen 20. Jahrhundert hat man schon mehr Menschen getötet oder bewusst sterben lassen als je zuvor in der Geschichte (...). Dieses Jahrhundert hat sicherlich die mörderischsten Spuren in der Geschichte hinterlassen – sowohl hinsichtlich des Ausmaßes, der Häufigkeit und der Länge der Kriege (und die nur während der 20er Jahre kurz unterbrochen wurden), aber auch hinsichtlich des unvergleichlichen Ausmaßes der menschlichen Katastrophen, die stattfanden, von den größten Hungersnöten der Geschichte bis zu den systematischen Völkermorden. Im Unterschied zum ‚langen 19. Jahrhundert‘, das als eine Zeit nahezu ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritts erschien und war, d.h. des Ausbaus der Zivilisationswerte, hat seit 1914 ein ungeheuerlicher Zerfall der Werte eingesetzt, die bislang in den entwickelten Staaten und im Bürgertum als normal angesehen wurden, und von denen man meinte, dass sie sich auf die rückständigeren Gebiete und auf die weniger gebildeten Teile der Bevölkerung ausdehnen würden.“ (E. J.Hobsbawn)
Gewiss ermöglicht uns die Geschichte des Kapitalismus, seine gegenwärtige Dynamik zu begreifen. Es gibt historische „Gründe“ für seine Irrationalität. Der Hauptgrund liegt in seinem Eintritt in die Epoche seines historischen Niedergangs, seiner Dekadenz, der mit Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte und zum 1. Weltkrieg 1914-1918 führte, welcher das Ergebnis und ein aktiver Faktor dieser Dekadenz war. Im Niedergangsstadium haben die Kriege aufgehört, Kolonial- oder nationale Kriege zu sein, d.h. sie verfolgen nicht mehr „vernünftige“ Ziele und Zwecke wie die Eroberung neuer Märkte oder die Schaffung und Etablierung neuer Nationen, die an der historischen Entwicklung teilhaben konnten. Sie sind stattdessen zu imperialistischen Kriegen geworden. Ursache derselben ist der Mangel an Märkten und die Notwendigkeit einer imperialistischen Neuaufteilung, also eines Ziels, das zum historischen Fortschritt nicht beitragen kann. Daher sind die Merkmale der imperialistischen Kriege immer barbarischer, mörderischer und zerstörerischer geworden. Seit dem Beginn der Dekadenz stehen die Kriege nicht mehr im Dienst der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft wird den Interessen des Krieges unterworfen. Dies trifft sowohl auf Friedens- als auch auf Kriegszeiten zu. Der Zeitraum seit 1945 bestätigt dieses Phänomen.
„Im Laufe des 20. Jahrhunderts sind die Kriege immer mehr gegen die Wirtschaft, die Infrastruktur der Staaten und ihre Zivilbevölkerungen gerichtet gewesen. Seit dem 1. Weltkrieg übersteigt die Zahl der Kriegsopfer unter den Zivilisten die der Opfer unter den Soldaten in allen kriegsbeteiligten Staaten – mit Ausnahme der USA. Warum sollten unter diesen Bedingungen die führenden Mächte beider Lager den Ersten Weltkrieg als ein Nullsummenspiel betreiben, d.h. als einen Krieg, der entweder nur vollkommen verloren oder total gewonnen werden konnte? (...) In Wirklichkeit zählte als einziges Kriegsziel der totale Sieg, und der Feind hieß – wie man ihn im Zweiten Weltkrieg nannte, eine ‚bedingungslose Kapitulation‘. Das war ein absurdes und selbstzerstörerisches Ziel, das sowohl Sieger als auch Verlierer ruinierte. Die Letztgenannten wurden dadurch in die Revolution getrieben, und die Sieger in den Bankrott und die physische Erschöpfung.“ (E.J. Hobsbawn)
Diese für den imperialistischen Krieg des 20. Jahrhunderts typischen Eigenschaften sind während des 2. Weltkriegs und in allen darauffolgenden Kriegen drastisch bestätigt worden. Seit dem Zerfall der imperialistischen Blöcke um die USA und die UdSSR im Jahre 1989 ist die Gefahr eines Weltkrieges geschwunden. Doch die Auflösung der Blöcke und der Blockdisziplin hat einer Reihe von kriegerischen Konflikten Tür und Tor geöffnet, welche durch die Großmächte provoziert und genährt werden, wobei Letztere Schwierigkeiten haben, diese Konflikte unter Kontrolle zu halten, sobald sie einmal ausgelöst sind. Nach der Auflösung der imperialistischen Blöcke sind die Kriege als ein Hauptmerkmal des dekadenten Kapitalismus keinesfalls von der Bildfläche verschwunden. Ganz im Gegenteil, an Stelle der Blockdisziplin ist nun die Dynamik des „Jeder für sich“ getreten, wo jede imperialistische Macht, jeder Staat, ob groß oder klein, sein eigenes Spiel auf Kosten der anderen spielt. Der Kapitalismus ist in eine besondere Phase seines historischen Niedergangs getreten. Wir haben sie als die Epoche seines Zerfalls bezeichnet (5). Doch gleichgültig, wie man sie bezeichnet: „Man darf nicht daran zweifeln, dass Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre ein Abschnitt der Geschichte zu Ende gegangen ist und ein neues Kapitel der Geschichte begonnen hat (...) Der letzte Teil des Jahrhunderts öffnete eine neue Periode des Zerfalls, der Unsicherheiten und der Krise – und zu einem großen Teil auf der Welt wie in Afrika, der ehemaligen UdSSR, und im ehemaligen sozialistischen Teil Europas, von Katastrophen.“ (Hobsbawn).
Die Kriege in der Zerfallsphase des Kapitalismus
Die gegenwärtigen imperialistischen Spannungen können nur auf dem Hintergrund dieser historisch einzigartigen Situation verstanden werden.
„Im Zeitalter der Dekadenz des Kapitalismus sind alle Staaten imperialistisch und richten sich nach diesen Verhältnissen aus: Kriegswirtschaft, Rüstung usw. in allen Staaten. Deshalb wird die Zuspitzung der Erschütterungen der Weltwirtschaft nur die Konflikte zwischen den verschiedenen Staaten auch mehr und mehr auf militärischer Ebene verschärfen. Der Unterschied zu der jetzt zu Ende gegangenen Epoche besteht darin, dass diese Konflikte und Interessengegensätze, die zuvor von den beiden großen imperialistischen Blöcken im Griff gehalten und ausgenutzt wurden, jetzt in den Vordergrund rücken werden. Das Verschwinden des russischen imperialistischen Gendarmen und damit auch die Auflösung der Gendarmenrolle des amerikanischen Imperialismus gegenüber seinen ‚Hauptpartnern‘ von früher öffnet die Tür für das Aufbrechen einer ganzen Reihe von lokalen Rivalitäten. Diese Rivalitäten und Zusammenstöße können gegenwärtig nicht in einen Weltkrieg ausarten (selbst wenn das Proletariat nicht mehr dazu in der Lage wäre, sich dagegen zur Wehr zu setzen). Weil die vom Block aufgezwungene Disziplin nicht mehr gegeben ist, werden diese Konflikte dagegen viel häufiger und gewalttätiger werden, insbesondere in den Gebieten, wo die Arbeiterklasse am schwächsten ist.“ (Internationale Revue, Nr. 12, 10.2.1990).
Während der Balkan und der Nahe Osten seit jeher Kriegsschauplätze und ständige Konfliktherde waren und sind, hat es in den letzten Wochen eine Zunahme der interimperialistischen Spannungen zwischen den Großmächten gegeben. Die USA haben eine aggressive Haltung eingenommen. „Der Grund für das, was als eine willkürliche Brutalität in der Haltung der Bush-Administration nicht nur gegenüber Russland und China, sondern auch gegenüber Südkorea und den Europäern scheint, bleibt rätselhaft.“ (W.Pfaff, International Herald Tribune, 28.03.2001) Es wäre eine zu grobe Vereinfachung, diese neue Aggressivität nur der Person des neuen Präsidenten Bush zuzuschreiben. Sicher stellt ein Präsidentenwechsel und der Einzug einer neuen Regierungsmannschaft eine Gelegenheit für einen Politikwechsel dar. Doch die grundsätzlichen Orientierungen der US-Politik bleiben im Wesentlichen gleich. Die Politik des „starken Manns“ und des „Haltet-mich-zurück-oder-ich-richte-ein-Unheil-an“ ist nicht auf die intellektuelle Unbedarftheit der Bush-Familie zurückzuführen, wie uns die europäischen Medien und manchmal auch die amerikanischen glauben machen wollen. Es handelt sich um eine tiefer greifende Tendenz, die durch die geschichtliche Lage selbst aufgezwungen wird.
„Mit dem Verschwinden der russischen Bedrohung ist der ‚Gehorsam‘ der anderen fortgeschrittenen Länder keineswegs sichergestellt (gerade aus diesem Grunde ist der westliche Block auseinandergefallen). Um solch einen Gehorsam sicherzustellen, müssen sich die USA nunmehr systematisch auf eine militärische Offensive stützen.“ (Internationale Revue, Nr. 67, engl., franz., span., Bericht zur internationalen Situation, 9. Kongress der IKS, 1991) Seitdem ist dieses grundlegende Merkmal der US-imperialistischen Politik nicht hinfällig geworden, denn „gegenüber dem unaufhaltsamen Aufstieg des ‚Jeder für sich‘ haben die USA keine andere Wahl, als ständig eine Politik der militärischen Offensive zu betreiben.“ (Internationale Revue, Nr. 98, engl., franz., span., Bericht über die imperialistischen Konflikte, 13. Kongress der IKS, 1999)
Wachsende imperialistische Gegensätze
Diese Notwendigkeit, Stärke zu zeigen, ist um so wichtiger, da die USA auf diplomatischer Ebene auf Widerstände stoßen. Die Ausdehnung des Balkankrieges auf Mazedonien ist ein Zeichen der wachsenden US-Schwierigkeiten, die Lage in diesem Teil der Welt im Griff zu behalten. Ohne wirklichen Stützpunkt in der Region sind die USA - im Gegensatz zu England, Frankreich und Russland, die traditionell auf serbischer Seite stehen, und Deutschland, das sich auf die Kroaten und Albaner stützt - gezwungen, ihre Politik den jeweiligen Verhältnissen anzupassen. Es ist deshalb kein Zufall, wenn „die NATO die teilweise Rückkehr der jugoslawischen Armee in der ‚Sicherheitszone‘ um den Kosovo zulässt (...). Das Bemühen, Belgrad bei der Verhinderung eines neuen Konfliktes einzubinden, ist offensichtlich.“ (Le Monde, 10.3.2001) Wie die Verbündeten Serbiens sind die USA an der Aufrechterhaltung der Stabilität Mazedoniens interessiert, das „seit jeher als ein schwaches Glied betrachtet wurde, welches unter allen Umständen aufrechterhalten werden muss, weil sonst eine Destabilisierung in ganz Südosteuropas eintreten würde.“ (ebenda) Die einzige Macht, die aus der Ausdehnung des Krieges auf Mazedonien Nutzen zieht und die an der Aufrechterhaltung dieses Zustands interessiert ist, ist Deutschland. Mit einem unabhängigen Kroatien mitsamt der kroatischen Provinz Bosnien-Herzegowinas und einem Großalbanien, das Mazedonien und Montenegro in Stücke zerreißen würde, wären die historischen, geo-strategischen Ziele Deutschlands – ein direkter Zugang zum Mittelmeer – erfüllt. Natürlich würde solch eine Perspektive auch den imperialistischen Appetit Griechenlands und Bulgariens, die im Augenblick im Zaum gehalten werden, auf Mazedonien wieder vergrößern. Der mazedonische Präsident irrte sich nicht, als er die wirklich Verantwortlichen für die Offensive der albanischen Guerilla nannte. Vor der US-Kehrtwende sagte er. „Sie werden heute in Mazedonien niemanden davon überzeugen, dass die Regierungen der USA und Deutschlands die Terroristenführer nicht kennen und sie nicht an ihren Aktivitäten hindern könnten, wenn sie wollten.“ (Le Monde, 20.03.2001)
Wie in Afghanistan, Afrika und anderen Regionen der Welt, die von Kriegen erschüttert werden, wird der Frieden solange nicht auf dem Balkan einkehren, wie der Kapitalismus besteht.
Das Gleiche trifft auf den Nahen Osten zu. Wie wir schon in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift schrieben: „Der Plan, den Clinton unter allen Umständen vor dem Ende seines Mandats durchsetzen wollte, wird, wie vorauszusehen war, nur ein Stück Papier sein.“ Die neue Bush-Administration scheint sich mit dieser Unfähigkeit der USA, eine „pax americana“ durchzusetzen, zu arrangieren. Sie scheint sich damit abzufinden, dass diese Region immer ein Kriegsherd bleiben wird, jedenfalls solange, wie der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern nicht beendet worden ist. Colin Powell, der neue US-Außenminister und ehemalige Stabschef der US-Armee während des Golfkriegs, gesteht ein, dass es keine ‚magische Formel‘ gibt, zumal Israel nicht mehr zögert, eine eigenständige Politik zu betreiben - auch dies ein Zeichen für die Dominanz des „Jeder für sich“. Die Bourgeoisie Palästinas wiederum, eines Landes, dessen unterdrückte und wirtschaftlich ausgemergelte Bevölkerung im Elend lebt, kann ihre Verzweiflung nur in einem selbstmörderischen, gegen Israel gerichteten Nationalismus kundtun. Sie wird dabei von europäischen Mächten unterstützt. Insbesondere Frankreich zögert nicht, alles zu unterstützen, was gegen die US-Politik in der Region gerichtet ist.
Die Reaktion der USA auf ihre eigene Hilflosigkeit waren die mörderischen Bombenangriffe auf Bagdad kurz nach Bushs Amtseinführung. Die Botschaft war an alle gerichtet, sowohl an die arabischen Staaten als auch an die anderen imperialistischen Großmächte: Die USA werden keinen Frieden mehr erzwingen, sondern dann, wenn es notwendig ist, wenn sie meinen, dass das Fass voll ist, militärische Schläge führen.
Nicht nur wird es zwischen Israelis und Palästinensern keinen Frieden geben, sondern der mehr oder minder verdeckte Krieg droht sich auf die ganze Region auszudehnen.
Die Gesetze des Kapitalismus führen unvermeidlich zur Zuspitzung der imperialistischen Rivalitäten, zur Zunahme der kriegerischen Konflikte auf allen Kontinenten, auf dem ganzen Erdball, wie auch zur Verschärfung der Wirtschaftskrise. Der dahinsiechende Kapitalismus kann keinen „Frieden und Wohlstand“ bringen. Er wird nur noch mehr Kriege und Armut bringen.
Welche Alternative gibt es zur kapitalistischen Barbarei?
Nur mit Hilfe der marxistischen Theorie konnte man bereits 1989, noch vor dem Ende des Ostblocks und vor dem Auseinanderbrechen der UdSSR, die Bedeutung der Ereignisse und ihre Folgen für den Kapitalismus und die internationale Arbeiterklasse begreifen und vorhersehen (7). Hierbei handelt es nicht um die Überlegenheit irgendwelcher Geistesgrößen, auch nicht um einen blinden und mechanischen Glauben an irgendeine Bibel. Der Marxismus ist hellsichtig, weil er die Theorie des internationalen Proletariats, den lebendigen Ausdruck seines revolutionären Wesens darstellt. Der Marxismus existiert, weil das Proletariat die revolutionäre Klasse ist, und deshalb kann er die historische Zukunft in groben Zügen erkennen, insbesondere die Unfähigkeit des Kapitalismus, die dramatischen Probleme zu lösen, die sein Fortbestehen der Menschheit beschert.
Die offenkundige Verschlechterung der weltwirtschaftlichen Lage, trotz der Bemühungen der Bourgeoisie, ihre Folgen abzumildern, und die heute gegen die Arbeiterklasse insbesondere in Westeuropa gerichteten brutalen Angriffe werden dazu beitragen, den Mythos von Wohlstand und verheißungsvoller Zukunft in der Arbeiterklasse zu zerstören. Schon jetzt entfaltet sich eine gewisse Kampfbereitschaft der Arbeiter, die die Gewerkschaften zu kanalisieren, einzudämmen und in Sackgassen zu lenken versuchen. Auch wenn sich diese Kampfbereitschaft noch sehr langsam entwickelt und die Reaktionen der Arbeiter auf diese Lage noch sehr schüchtern sind, tragen diese Kämpfe in sich den Keim für die Überwindung dieser alltäglichen Barbarei und des Kapitalismus. Die Überwindung des Kapitalismus ist nur möglich durch die ökonomischen Abwehrkämpfe, zu denen die Arbeiterklasse genötigt wird, und durch die Ablehnung jeglicher Beteiligung an den imperialistischen Kriegen, d.h. durch die Verteidigung des proletarischen Internationalismus. Dies erfordert ebenso die größtmögliche Entfaltung und Ausdehnung der Arbeiterkämpfe. Es ist der einzige Weg zu einer revolutionären Perspektive für die Menschheit, eine Gesellschaft ohne Kriege, ohne Armut, ohne Barbarei aufzubauen. Es gibt keine andere Lösung und keine andere Alternative.
R.L. 7. 4. 2001
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Konferenz von Den Haag
- 2913 Aufrufe
Nur die proletarische Revolution kann die Menschheit retten
Alle internationalen Organisationen der herrschenden Klasse wie die Welthandelsorganisation (WTO), die Weltbank, die OECD oder der Internationale Währungsfonds (IWF) beteuern, dass sie alles Erdenkliche für eine „nachhaltige Entwicklung“ zugunsten der kommenden Generationen tun würden. Kaum ein Staat, der nicht seine große Sorge um die Umwelt verkündet. Kaum eine ökologisch ausgerichtete Nichtregierungsorganisation, die nicht die ganze Palette von Demonstrationen, Petitionen und Memoranden eingesetzt hat. In keiner bürgerlichen Zeitung fehlen pseudo-wissenschaftliche Artikel über die globale Erwärmung. All diese feinen Herrschaften mit ihren lauteren Beweggründen schickten ihre Vertreter vom 13. bis 25. November 2000 zur Konferenz von Den Haag, welche sich zum Ziel setzte, die Abmachungen des Protokolls von Kyoto[1] [52] umzusetzen. Nicht weniger als 2000 Delegierte aus 180 Ländern, umschwärmt von 4000 Beobachtern und Journalisten, hatten den Auftrag, ein Patentrezept auszubrüten, das der Klimaveränderung ein Ende setzen soll. Und das Resultat: nichts, nicht das Geringste! Vielmehr ist es ein erneuter Beweis, dass die herrschende Klasse all ihre Beteuerungen um das Überleben der Menschheit den Interessen des nationalen Kapitals unterordnet.
Vor zehn Jahren hat die IKS im Artikel „Ökologie: Der Kapitalismus vergiftet die Erde“ (Internationale Revue Nr. 13, deutsche Ausgabe) geschrieben, „dass das ökologische Desaster jetzt fühlbar das eigentliche Biosystem des Planeten bedroht“. Heute müssen wir feststellen, dass der Kapitalismus diese Drohung wahr gemacht hat. Während der 90er Jahre hat die Ausplünderung des Planeten an Tempo zugelegt: Waldrodungen, Bodenerosion, die Vergiftung der Luft, des Grundwassers und der Meere, die Ausplünderung der Bodenschätze und die Verbreitung chemischer und nuklearer Substanzen, die Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten, die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten und schlussendlich die Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf dem ganzen Planeten (sieben der heißesten Jahre des Jahrhunderts fielen in die 90er Jahre). Die ökologischen Katastrophen werden immer komplexer, globaler und nehmen meist einen irreversiblen Charakter mit langfristigen Konsequenzen an, die kaum absehbar sind.
Nicht nur hat die Bourgeoisie ihre Unfähigkeit bewiesen, auch nur das Geringste zu tun, um diesen Irrsinn etwas zu bremsen, sie hat auch alles daran gesetzt, ihre Verantwortung dafür hinter einer Reihe von ideologischen Kulissen zu verbergen. Die Bourgeoisie muss das ökologische Elend, wenn sie es nicht mehr schlicht und einfach ignorieren kann, als etwas darstellen, das sich außerhalb der Sphäre der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse und des Klassenkampfes befindet. All die falschen Alternativen, von den staatlichen Maßnahmen bis hin zu den Antiglobalisierungspredigten der Nichtregierungsorganisationen, verschleiern nur die einzig mögliche Perspektive der Menschheit, diesem Alptraum zu entkommen: die revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch die Arbeiterklasse.
Aus der Sicht der Revolutionäre ist klar, dass es sich dabei um die dem Kapitalismus innewohnende produktivistische Logik handelt, wie sie Marx schon im Kapital analysiert hatte: „Akkumulation um der Akkumulation, Produktion um der Produktion willen, in dieser Formel sprach die klassische Ökonomie den historischen Beruf der Bourgeoisperiode aus. Sie täuschte sich keinen Augenblick über die Geburtswehn des Reichtums, aber was nützt der Jammer über historische Notwendigkeit?“ (Marx, Das Kapital, Erster Band, Kapitel 22) Hier liegt die Logik und der grenzenlose Zynismus des Kapitalismus verborgen: Die Anhäufung von Kapital und nicht die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse ist das wirkliche Ziel der kapitalistischen Produktion. Das Schicksal des Planeten, der Menschheit und im Besonderen der Arbeiterklasse ist dabei von geringer Bedeutung. Mit der weltweiten Sättigung der Märkte, die 1914 endgültig erreicht war, trat der Kapitalismus in seine niedergehende Phase. Dies bedeutete, dass die Akkumulation von Kapital zunehmend zur Quelle von Konflikten und Erschütterungen wurde. Es geschah vor allem in dieser Periode des Kapitalismus, „dass die unbarmherzige Umweltzerstörung durch das Kapital eine andere Stufe und Qualität erreichen konnte (...) Dies ist die Epoche, die alle kapitalistischen Nationen dazu zwingt, miteinander um einen gesättigten Weltmarkt zu konkurrieren; eine Epoche der ständigen Kriegswirtschaft also, mit einem unverhältnismäßigen Wachstum der Schwerindustrie; eine Epoche, die charakterisiert ist durch eine irrationale, verschwenderische Vervielfältigung von Industriekomplexen in jeder nationalen Einheit, (...) Der Aufstieg der ‚Megastädte‘ ist sehr stark ein Phänomen der dem 2. Weltkrieg folgenden Zeit, sowie auch die Entwicklung von Landwirtschaftsformen, die ökologisch nicht weniger schädlich sind als die meisten Formen der Industrie.“ (Internationale Revue Nr. 13, deutsche Ausgabe) Diese Tendenz ist mit dem Einritt des Kapitalismus in seine letzte Phase, den Zerfall, der seit 20 Jahren dieses System auf der Stelle treten lässt, noch beschleunigt worden, da weder die Arbeiterklasse noch die Bourgeoisie ihre Antwort auf die Krise durchsetzen konnten: proletarische Revolution oder allgemeiner Krieg.
Der Kapitalismus hat Chaos und Zerstörung zur Tagesordnung gemacht. Die Auswirkungen auf die Umwelt sind katastrophal. Dies wollen wir hier veranschaulichen (anhand weniger Beispiele unter unendlich vielen) und auch die Art und Weise aufzeigen, wie die Bourgeoisie ein ideologisches Sperrfeuer gegen diejenigen richtet, die sich berechtigterweise die Frage stellen, wie dieses barbarische und sich in einer Sackgasse befindliche System gestoppt werden kann.
Der Kapitalismus zerrüttet das ökologische System...
Wegen ihres globalen Charakters und ihrer weltweiten Auswirkungen ist die Klimaveränderung von besonderer Bedeutung. Es ist kein Zufall, dass die herrschende Klasse sie zu einem Hauptthema ihrer Medienkampagne gemacht hat. Die Besserwisser mögen wohl behaupten, „bezüglich der Meteorologie und Klimawissenschaft hat der Mensch ein entschieden zu kurzes Gedächtnis“ (Le Monde, 10.9.2000), oder auf die gängigen Milleniumsängste verweisen. Doch eine solche Haltung, welche die Bourgeoisie selbst nicht in Frage stellt, klammert an sich den Status quo - eine vorherrschende Haltung, hinter der man sich gut verstecken kann. Die Arbeiterklasse kann sich diesen Luxus nicht erlauben. Es sind immer die Arbeiter und die ärmsten Schichten der Weltbevölkerung, die am stärksten von den schrecklichen Auswirkungen dieser globalen Störungen in der Biosphäre der Erde betroffen sind, die durch den kapitalistischen Zauberlehrling hervorgerufen werden.
Die IPPC (Intergovernemental Panel on Climate Change), welche für die Erstellung einer Synthese der wissenschaftlichen Arbeiten über die Klimaveränderung verantwortlich ist, fasste in ihrem „Bericht an die Entscheidungsträger“ vom 22. Oktober 2000 die grundlegendsten Tatsachen zusammen, welche eine neue Qualität in der Klimaveränderung aufzeigen: „Die Durchschnittstemperatur auf der Erdoberfläche ist seit 1860 um 0,6 Grad gestiegen (...). Neue Analysen gehen davon aus, dass das 20. Jahrhundert vermutlich die bedeutendste Erwärmung aller Jahrhunderte in den letzten tausend Jahren auf der nördlichen Hemisphäre erlebt hat (...) Die mit Schnee bedeckte Oberfläche hat seit 1960 um ca. 10% abgenommen und die Periode, in der Seen und Flüsse in der nördlichen Hemisphäre vereist sind, ist während des 20. Jahrhunderts um etwa zwei Wochen kürzer geworden. (...) die Dicke des arktischen Eises hat um 40% abgenommen (...) der Meeresspiegel ist während des 20. Jahrhunderts um 10 bis 20 cm angestiegen (...) das Tempo der Anhebung des Meeresspiegels während des 20. Jahrhunderts war ungefähr zehnmal höher als während der letzten 3000 Jahre. (...) Die Niederschläge haben im 20. Jahrhundert auf der Mehrheit der Kontinente in mittleren und hohen Breitengraden der nördlichen Hemisphäre pro Jahrzehnt um 0,5 bis 1% zugenommen. Der Regen ist in den meisten Regionen zwischen den Wendekreisen zurückgegangen.“
Dieser Qualitätssprung zeigt sich noch klarer bei der Betrachtung der sogenannten Treibhausgaskonzentrationen[2] [52], denn „seit Beginn der industriellen Ära hat die chemische Zusammensetzung des Planeten eine noch nie da gewesene Veränderung durchgemacht“ [3] [52], die der Bericht der IPCC nicht verschweigt: „Seit 1750 hat sich die atmosphärische Konzentration von Kohlendioxid verdreifacht. Die gegenwärtige Konzentration ist so hoch wie nie zuvor in den letzten 420‘000 Jahren, wenn nicht sogar in den letzten 20 Millionen Jahren. (...) Die Methankonzentration in der Atmosphäre ist seit 1750 um das 2,5-fache gestiegen und steigt weiter an.“ Tatsächlich wurden diese Veränderungen vor allem in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhundert und nicht schon seit 1750 bewirkt.
Die einfache Tatsache, dass man die Periode der Dekadenz des Kapitalismus hierbei in einem Atemzug mit Perioden von Hunderttausenden, ja, sogar Millionen von Jahren nennen muss, ist an sich schon die eindeutige Verurteilung der irrsinnigen Verantwortungslosigkeit der kapitalistischen Produktionsweise. Es ist eine unleugbare Tatsache, dass diese Veränderungen ein direktes Resultat der ungezügelten und anarchischen Funktionsweise einer Industrie und eines Transportwesens sind, die auf der Verbrennung fossiler Energie beruhen. Es ist fast überflüssig zu sagen, dass, obwohl der Kapitalismus in dieser Periode seine Produktionskapazitäten erheblich gesteigert hat, nicht die Arbeiterklasse und die Mehrheit der Weltbevölkerung ihre Früchte geerntet haben. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist die menschliche und soziale Bilanz der Dekadenz des Kapitalismus mit den Kriegen und der Armut als ihre Begleiterscheinungen noch finsterer als die “Klima“bilanz selbst und kann deshalb keineswegs als mildernder Umstand anerkannt werden.[4] [52]
Wenn der IPCC-Bericht unterstreicht, dass „die Beweise für den menschlichen Einfluss auf das globale Klima heute deutlicher sind als zur Zeit des zweiten Berichtes“ von 1995, so widerlegt dies die Behauptungen der Bourgeoisie, welche während der 90er Jahre stets versucht hat, die wissenschaftliche Diskussion zu manipulieren, indem sie falsche Fragen auf den Tisch gebracht hat. Als die Erderwärmung zum Thema wurde (im Vergleich zu den wissenschaftlichen Studien ohnehin sehr spät), stellte die herrschende Klasse folgende Frage: Wo ist der formale Beweis dafür, dass diese Erwärmung mit der Industrie zusammenhängt und nicht mit einem natürlichen Zyklus? Es ist tatsächlich schwer, auf diese direkte Frage eine wissenschaftlich fundierte Antwort zu geben. Doch andererseits ist der o.g. qualitative Sprung in der Klimaentwicklung insofern besonders offenkundig, als er in einer Zeit stattfindet, in welcher der Klimazyklus seit etwa 1000 Jahren und in den nächsten 5000 Jahren in Richtung relativer Vergletscherung weist (was gut erforscht ist und sehr genau belegt werden kann, da er durch astronomische Parameter wie die Veränderungen im Weltraum und die Neigung der Erdachse bestimmt wird). Doch nicht nur das, zwei andere Parameter sollten eigentlich auch in Richtung Abkühlung wirken: der Zyklus der Sonnenaktivität und die Zunahme von Partikeln in der Atmosphäre – eine Zunahme, verursacht durch die industrielle Verschmutzung (wie auch durch Vulkanausbrüche). Dies sagt wohl genug über die Scheinheiligkeit der herrschenden Klasse, die noch auf „Beweise“ wartet! Da es heute schwer ist, die kapitalistische Ursache der Erderwärmung zu verleugnen, lautet die große Frage, die sich die Medien stellen, folgendermaßen: Kann formal belegt werden, dass es einen Zusammenhang zwischen der globalen Erderwärmung und den extremen klimatischen Phänomenen der letzten Zeit gibt, wie die Wirbelstürme „Mitch“ und „Eline“, die Stürme in Frankreich, die Überschwemmungen in Venezuela, England usw.? Auch hier fällt es der Wissenschaft schwer, auf diese nicht sehr wissenschaftliche Frage zu antworten, deren einziges Ziel darin besteht, die Idee zu verbreiten, die globale Erderwärmung habe eventuell doch nicht derart schwerwiegende Konsequenzen. Offizielle Stellen wie das französische meteorologische Institut versteigen sich dabei zu köstlichen, jesuitischen Formulierungen wie: „Es ist nicht bewiesen, dass die kürzlich stattgefundenen extremen Ereignisse Zeichen einer klimatischen Veränderung sind, doch wenn dieser Klimawechsel voll wahrnehmbar wird, dann wird er zweifellos von einer Zunahme extremer Ereignisse begleitet!“
Und die bis ins Jahr 2100 zu erwartenden klimatischen Veränderungen sind, um nochmals die IPCC zu zitieren, enorm: „Der mittlere Temperaturanstieg auf der Erdoberfläche wird schätzungsweise zwischen 1,5 und 6 Grad betragen (...) einen solchen Anstieg hat es in den vergangenen zehntausend Jahren nie gegeben“; während der Anstieg der Meeresspiegel im Durchschnitt 0,47 Meter betragen wird, „was zwei bis vier Mal mehr ist als während des 20. Jahrhunderts“. Aber all diese Voraussagen berücksichtigen dabei das tatsächliche Tempo bei der Abholzung nicht (bleibt es bei dem derzeitigen Tempo, sind in 600 Jahren alle Wälder verschwunden). Die Konsequenzen dieser klimatischen Veränderungen werden schrecklich und zerstörerisch sein: Überschwemmungen und Stürme in den einen, Dürre in den anderen Regionen; Mangel an Trinkwasser, das Verschwinden von Tierarten und so weiter. Doch für Dominique Frommel, den Forschungsdirektor des INSERM, liegt „die größte Gefahr nicht dort. Sie liegt in der Abhängigkeit des Menschen von seiner Umwelt. Die Flüchtlingsströme, die menschliche Überkonzentration in den Städten, die Verringerung von Wasserreserven, die Umweltverschmutzung und die Armut haben immer (wobei jedoch der Kapitalismus mehr als jede ihm vorausgehende Gesellschaft Megastädte, Armut und Umweltverschmutzung verursacht hat!) die günstigsten Bedingungen geschaffen für die Verbreitung infektiöser Mikroorganismen. Die Reproduktions- und Infektionskapazität vieler Insekten und Nagetiere, Träger von Parasiten und Viren, ist verbunden mit der Temperatur und Feuchtigkeit des Milieus. Anders gesagt, ein Anstieg der Temperatur, wenn auch nur geringfügig, gibt der Ausbreitung von zahlreichen, Mensch und Tier krank machenden Erregern grünes Licht. Deshalb haben sich verschiedene Parasitenkrankheiten wie Malaria, Schistosomiasis und die Schlafkrankheit, sowie Vireninfektionen wie das Dengue-Fieber, verschiedene Formen von Gehirnhautentzündungen und das hämorrhagische Fieber in den letzten Jahren ausgebreitet. Entweder sind sie in Regionen wieder aufgetaucht, in denen sie zuvor verschwunden waren, oder sie betreffen nun Regionen, die bisher davon verschont geblieben sind. (...) Die Prognosen für das Jahr 2050 gehen von drei Milliarden Malariakranken aus. (...) Gleichzeitig werden sich durch das Wasser übertragene Krankheiten ausbreiten. Die Erwärmung des Süßwassers fördert die Entstehung von Bakterien. Die Erwärmung des Salzwassers – vor allem, wenn es mit menschlichen Abwässern durchsetzt ist – erlaubt dem Plankton, das den Boden für den Cholerabazillus bildet, sich in gesteigertem Masse zu vermehren. Seit 1960 in Lateinamerika praktisch verschwunden, forderte die Cholera dort zwischen 1991 und 1996 1‘368‘053 Todesopfer. Parallel dazu tauchen neue Infektionen auf oder sie beginnen ihre ökologischen Nischen zu verlassen, auf die sie bis anhin beschränkt waren. (...) Die Medizin steht der Explosion so vieler unerwarteter Krankheiten trotz ihrer Fortschritte hilflos gegenüber. Die Ansteckungsgefahr durch infektiöse Krankheiten (...) kann im 21. Jahrhundert ein neues Gesicht annehmen, vor allem durch die Ausbreitung durch von Tieren auf Menschen und umgekehrt übertragene Infektionen.“ (Manière de Voir, Nr. 50, S. 77)
…und unternimmt alles, um seine Schuld daran zu verschleiern
Angesichts dieser historischen Verantwortung besteht die Antwort der Bourgeoisie darin, einen gigantischen Medienzirkus um die Weltkonferenzen von Rio 1992, Den Haag, Kyoto und Berlin zu veranstalten, um uns weiszumachen, dass die herrschende Klasse sich endlich der Gefahren bewusst ist, die dem Planeten drohen. Dieses Täuschungsmanöver findet auf verschiedenen Ebenen statt.
Erstens beabsichtigt es, den Eindruck zu erwecken, dass die Erfüllung der Abmachungen von Kyoto einen ersten wichtigen Schritt darstellen. Doch diese Abmachungen sind nicht nur nicht erfüllt worden; selbst wenn sie es wären, hätten ihre selbst gesteckten Ziele nur lächerlich geringfügige Auswirkungen auf die globale Erwärmung. All die Nichtregierungsorganisationen und ökologischen Parteien, die an der Diskussion über die Verwirklichung des Kyoto-Protokolls teilnahmen, sind also Teil dieses Täuschungsmanövers. Nicht einmal ein Ausweichschritt ist erreicht worden, geschweige denn ein Schritt vorwärts.
Zweitens wird uns erzählt, dass die Unfähigkeit der Staaten, sich untereinander zu verständigen, an ihren verschiedenen Vorstellungen über den Weg zum gemeinsamen Ziel lägen, die den Treibhauseffekt bewirkenden Emissionen zu reduzieren. Tatsächlich jedoch weiß jeder Staat sehr wohl, was er tut, wenn er seine nationalen Interessen verteidigt und daher die Verhandlungen dazu benutzt, um Produktionsnormen durchzusetzen, die am besten zu seinem Produktionsniveau, seinen technologischen Kapazitäten, Energiequellen etc. passen. So respektieren zum Beispiel Frankreich und die USA die Abmachungen von Kyoto nicht (seit 1990 ist der Ausstoß von Kohlendioxid in den USA um 11% und in Frankreich um 6,5% gestiegen), doch wenn Präsident Chirac behauptet, dass „es vor allem an Amerika liegt, unseren Hoffnungen auf eine Reduktion der Treibhausgase Auftrieb zu geben“ (Le Monde, 20.11.2000), so heißt dies im Klartext, dem anderen im Handelskrieg einen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. So verhält es sich auch, wenn die Europäische Union die Einrichtung eines „Überwachungssystems“ fordert, das Steuern für diejenigen einführt, die die Verschmutzungsquoten überschreiten. Ebenso gut könnte man die USA dazu auffordern, den Airbus zu finanzieren und die Produktion von Boeing einzuschränken! Für die Staaten der Dritten Welt ist es noch durchsichtiger: Die Bürde der Krise, der Schulden und des Elends führt zu einer systematischen Ausplünderung der natürlichen Bodenschätze und zu einem Laissez-faire-Verhalten gegenüber den großen westlichen Unternehmen, welche die lokale Korruption fördern. All dies ist die unvermeidliche Realität des Kapitalismus. Unter diesen Umständen läuft die Unterstützung irgendeiner Maßnahme auf Kosten anderer darauf hinaus, das Spiel eines oder mehrerer Staaten zu spielen.
Und schließlich noch ein Wort zu einer Mystifikation, die sich größter Beliebtheit unter Reformisten aller Couleur erfreut: die Idee, für einen sauberen Kapitalismus zu kämpfen, der die Umwelt respektiert, ein Kapitalismus ohne Konkurrenz - ein unvorstellbarer Kapitalismus. Dieser heilige Kreuzzug findet im Namen der Antiglobalisierung statt und ruft flehentlich die Staaten dazu auf, Gesetze gegen die bösen Multis zu erlassen, Steuern zu erheben oder anderweitig gegen sie vorzugehen. Aber genauso wie Arbeitsgesetze die kapitalistische Ausbeutung, Arbeitslosigkeit und Armut nicht aufhalten und, falls notwendig, außer Kraft gesetzt werden können, werden auch die Gesetzgebung, die Steuerschraube oder andere Maßnahmen, die das Prädikat „ökologisch“ für sich beanspruchen, nur das tun, was völlig in Einklang mit dem Kapitalismus steht und was tatsächlich die Modernisierung des Produktionsapparates fördert. Oder aber es handelt sich schlicht und einfach um eine versteckte Form von Protektionismus oder um eine Rechtfertigung arbeiterfeindlicher Maßnahmen (Begründungen zur Schließung von Betrieben, welche die Umwelt belasten, Lohnkürzungen zur Deckung der Kosten einer den Umweltnormen gerechten Produktion usw.) So gesehen, veranschaulichen die Ökosteuern („ich verschmutze, aber bezahle dafür ... ein wenig“) und der Handel mit Zertifikaten für Treibhausgas-Emissionen, der prinzipiell akzeptiert worden ist, lediglich die kapitalistische Wirklichkeit im Kampf gegen die Umweltverschmutzung und die globale Erwärmung!
Aus diesem Grund versuchen die wichtigsten Repräsentanten einer ökologischen Politik und der Nichtregierungsorganisationen, die von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen vom Standpunkt der Rentabilität des Kapitals aus zu legitimieren, und es kommt nicht selten vor, dass sie von den Machtzentralen der Bourgeoisie als Berater herangezogen werden. Dies ist unleugbar bei den grünen Parteien, die sich an verschiedenen Regierungen beteiligen (Frankreich, Deutschland), aber auch bei Nichtregierungsorganisationen der Fall, wie dem „World Conservation Monitoring Center“, welches zum verlängerten Arm der Vereinten Nationen geworden ist und behauptet, dass „die Politik und die Maßnahmen bezüglich der Klimaveränderung im Verhältnis zur Effizienz und den Kosten stehen müssen, damit sie globale Profite zu geringst möglichen Kosten sichern können“. Ins selbe Horn bläst Le Monde Diplomatique, der Hausierer der Antiglobalisierungs-Ideologie in Frankreich (vor allem anti-amerikanisch ausgerichtet), wenn er sich daran stößt, dass „die gesellschaftlichen Gesamtkosten des Automobiltransports – Lärm, Luftverschmutzung, Verkehrschaos, Platzverbrauch und Sicherheitsrisiko – bis zu 5% des Bruttosozialproduktes ausmachen“ (Manière de Voir, Nr. 50, Seite 70). Dieser Wandel zum ökologischen Realismus kann auch die Form einer direkten Hilfe für den Staat annehmen, wie dies Greenpeace nach der Strandung des Chemietankers Ievoli-Sun an der Küste Frankreichs im November 2000 tat.
Es ist charakteristisch für all die ökologischen Bewegungen, Parteien oder Nichtregierungsorganisationen, den kapitalistischen Staat zum Garanten der Allgemeininteressen zu machen. Ihre Handlungsweise ist grundsätzlich Klassen übergreifend (da „wir ja alle betroffen sind“) und demokratisch (sie sind meisterhaft in lokaler Demokratie und beharren darauf, dass der Staat, den sie für fähig halten, sich durch solche Demonstrationen zu bewegen, durch den Druck der Bevölkerung, durch die Tat des Bürgers gezwungen werden könne, umweltfreundliche Maßnahmen zu ergreifen). Es erübrigt sich zu sagen, dass diese Art von Protest, die weder die Fundamente der kapitalistischen Produktionsweise noch die Macht der herrschenden Klasse in Frage stellt, von der Bourgeoisie vollkommen assimiliert werden kann. Und auch die Demoralisierung derer, die diesen Märchen keinen Glauben schenken, ist ein Sieg für die herrschende Klasse.
Wir haben aufgezeigt, dass es illusorisch ist zu glauben, es gäbe Mechanismen innerhalb des Kapitalismus, welche die ökologischen Katastrophen verhindern könnten[5] [52], da Letztere ein Produkt der grundlegenden Funktionsweise des Kapitalismus sind. Es sind vielmehr die gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus, die ausgemerzt werden müssen, wenn wir eine Gesellschaft errichten wollen, in der die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, die zum Antrieb der Produktion werden muss, nicht auf Kosten der Natur geht, da beide aufs engste miteinander verknüpft sind. Eine solche Gesellschaft, der Kommunismus, kann nur vom Proletariat errichtet werden, der einzigen gesellschaftlichen Kraft, die ein Bewusstsein und eine Praxis entwickeln kann, welche „die bestehende Welt revolutionieren, die vorgefundenen Dinge praktisch angreifen und verändern“ kann (Marx, Die deutsche Ideologie, MEW Bd. 3, S. 42).
Seit seinem Erscheinen als revolutionäre Theorie der Arbeiterklasse hat sich der Marxismus gegen die bürgerliche Ideologie gewandt, einschließlich ihrer fortgeschrittensten materialistischen Auffassungen, welche die Natur nur als ein Objekt außerhalb des Menschen betrachten und nicht als historische Natur. Die Beherrschung der Natur hat für das Proletariat nie die Ausplünderung der Natur bedeutet: „Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht – sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und dass unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Grenzen erkennen und richtig anwenden zu können.“ (Engels, Die Dialektik der Natur, MEW Bd. 20 S. 453)
Es gilt jedoch weiterhin, dass das Bewusstsein über den Ernst der ökologischen Lage für sich selbst nicht ein Mobilisierungsfaktor der Kämpfe ist, welche das Proletariat bis zur kommunistischen Revolution führen muss. Wie schon in der Internationalen Revue Nr. 13 erwähnt und in den letzten 10 Jahren bestätigt wurde, „erlaubt die Frage als solche dem Proletariat nicht, sich als gesonderte soziale Kraft zu bestätigen. In der Tat schafft sie einen idealen Vorwand für die Kampagnen der Bourgeoisie, bei denen die Klassenunterschiede verwischt werden (...) Die Arbeiterklasse wird nur dann fähig sein, sich mit der ökologischen Frage als Ganzes zu beschäftigen, wenn sie die politische Macht auf Weltebene erobert hat.“ Doch der Irrsinn des kapitalistischen Systems in seiner Zerfallsphase berührt die Arbeiter ganz direkt (Gesundheit, Ernährung, Wohnen usw.) und kann auf dieser Ebene künftige ökonomische Kämpfe radikalisieren.
Für alle Elemente außerhalb des Proletariats, die aufrichtig gegen das schreckliche Massaker an diesem Planeten rebellieren, besteht der einzige konstruktive Weg vorwärts für ihren Unwillen darin, Kritik an der ökologischen Ideologie zu üben, zu einem allgemeinen Verständnis der Geschichte des Klassenkampfes zu gelangen und sich dem Kampf des Proletariats in Gestalt seiner revolutionären Organisationen anzuschließen.
Die Zerstörung der Umwelt ist kein technisches Problem, sondern ein politisches: Mehr als je zuvor stellt der Kapitalismus eine tödliche Gefahr für das Überleben der Menschheit dar; mehr als je zuvor liegt die Zukunft der Menschheit in den Händen der Arbeiterklasse. Dies ist keinesfalls eine mechanistische oder abstrakte Vision. Es ist eine Notwendigkeit, deren Wurzeln in der Realität der kapitalistischen Produktionsweise liegen. Um den Knoten zwischen der kommunistischen Revolution und dem Sturz in die Barbarei zu lösen, muss sich die Arbeiterklasse beeilen. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr hinterlässt der beschleunigte Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft einer künftigen kommunistischen Gesellschaft ein apokalyptisches Erbe.
BT
[1] [52] Das Protokoll von Kyoto vom Dezember 1997 ist eine Liste von Prinzipien, die von den Staaten angenommen wurde, welche die Konvention der Klimakonferenz von Rio 1992 unterschrieben hatten, und die sie dazu verpflichtete, Emissionen, die zum Treibhauseffekt führen, bis zum Jahr 2010 um 5,2% zu reduzieren.
[2] [52] Der Treibhauseffekt „ist ein Prozess, welcher Gasen, die in der Atmosphäre nicht vorherrschend sind (Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, Ozon), eine erhebliche Wirkung zukommen lässt: Indem sie die infrarote Strahlung daran hindern, den Planeten frei zu verlassen, halten sie genügend Sonnenwärme zurück, damit der Planet bewohnbar wird (sonst würde eine mittlere Temperatur von minus 18 Grad herrschen)“ (Hervé Le Treut, Forschungsdirektor des meteorologischen Institutes Paris, Le Monde, 7. 8. 2000)
[3] [52] Hervé Le Treut, ebenda.
[4] [52] Vgl. den Artikel „Das barbarischste Jahrhundert der Geschichte“ in International Review Nr. 101, franz./engl./span. Ausgabe
[5] [52] Aus Platzgründen können wir hier all die anderen
Aspekte des ökologischen Desasters nicht weiter ausführen: die unkontrollierte
Verödung und Abholzung der Wälder, das Verschwinden von Lebensraum für Tiere
und ihr damit einhergehendes Aussterben (von heute bis zum Jahr 2010 werden 20%
der bekannten Tierarten verschwunden sein, davon ein Drittel Haustiere), die
permanente Vergiftung mit Dioxin, der massive Gebrauch toxischer Pestizide, der
Mangel an Trinkwasser (alle acht Sekunden stirbt ein Kind wegen mangelndem oder
schlechtem Wasser), die nukleare Vergiftung durch Militär- und Zivilwirtschaft,
die Ausplünderung ganzer Regionen durch die Ölwirtschaft, die Auszehrung der
Meeresschätze, die Folgen lokaler Kriege usw. Wie bei der globalen Erwärmung
besteht auch hier die „Lösung“ der Bourgeoisie darin, die Realität zu
verschleiern, während sich die Verhältnisse immer mehr zuspitzen.
Theoretische Fragen:
- Umwelt [53]
Korrespondenz mit Russland
- 2830 Aufrufe
Die entscheidende Rolle der linken Fraktionen in der marxistischen Tradition
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit haben wir das Entstehen von revolutionären Gruppen und Elementen in Osteuropa, besonders in Russland, begrüßt. Sie stehen unübersehbar in einem internationalen Zusammenhang. Auf jedem Kontinent haben proletarische politische Gruppen, welche die Tradition des Linkskommunismus vertreten, mit dieser Art von Elementen zu tun bekommen. Wir sollten dies daher als eine charakteristische, mittelfristige Tendenz der gegenwärtigen Periode betrachten. Gerade nach dem Zusammenbruch der UdSSR und ihres imperialistischen Blocks hat die Bourgeoisie triumphierend den Bankrott des Kommunismus und das Ende des Klassenkampfes verkündet. Durch diese Ereignisse verwirrt, konnte die Arbeiterklasse nicht anders, als unter den Hammerschlägen der ideologischen Kampagnen der Bourgeoisie den Rückzug antreten. Doch außerhalb konterrevolutionärer Perioden kann es eine historische Klasse nicht dabei belassen, auf Angriffe welche ihre eigene Existenz und Perspektive so tief in Frage stellen, lediglich zu reagieren. Wenn es ihr nicht gelingt, ihren wirtschaftlichen Kampf durch Ausdehnung voranzutreiben, dann muss sie zumindest ihre politische Avantgarde stärken um sich zu verteidigen. Die isolierten Elemente, Diskussionsgruppen, Kerne und Grüppchen sollten den Grund ihrer Existenz nicht bei sich selbst oder im Zufall suchen. Sie sind ein Produkt der internationalen Arbeiterklasse. Auf ihren Schultern liegt eine schwere Verantwortung. Zunächst müssen sie den historischen Prozess anerkennen, dessen Produkt sie sind, und bis ans Äußerste für ihr Bewusstsein und ihre politische Klarheit kämpfen, ohne von der Schwere der Aufgabe erdrückt zu werden.
In den Ländern der Peripherie der kapitalistischen Großmächte werden diese kleinen Minderheiten mit einer Unzahl von Schwierigkeiten konfrontiert: geographische Zersplitterung, Sprachprobleme, wirtschaftliche Rückständigkeit. Zu diesen materiellen Schwierigkeiten gesellen sich darüber hinaus noch die politischen, die aus der Schwäche der Arbeiterbewegung und der Abwesenheit einer robusten Tradition des revolutionären Marxismus herrühren. In Russland, dem „Land der großen Lüge“, wie Anton Ciliga es in seinem Buch Au pays du grand mensonge (1938 veröffentlicht) nannte, wo die stalinistische Konterrevolution am schlimmsten gewütet hatte, war die Zerstörung und Entstellung des kommunistischen Programms grenzenlos. Das Potenzial, das in diesen neuen revolutionären Energien steckt, kann an der Art und Weise ermessen werden, wie sie bestrebt sind, diese Schwierigkeiten zu überwinden:
- durch die Beipflichtung zum proletarischen Internationalismus, wie sie aus ihrer Denunziation des Krieges und aller imperialistischen Lager in den Kriegen in Tschetschenien und Ex-Jugoslawien ersichtlich wird;
- durch ihre Suche nach internationalen Kontakten;
- durch ihre Wiederentdeckung der politischen Strömungen, die während der 1920er Jahre als Erste im Namen des Kommunismus den Kampf gegen die Degeneration der kommunistischen Bewegung und den Aufstieg Stalins und des Opportunismus aufnahmen.
Dies war stets der Boden für die Entwicklung des revolutionären Marxismus: international, internationalistisch und einen historischen Standpunkt vertretend.
Die Abgrenzung vom Linksextremismus
Diese Herangehensweise offenbart die wahrhaft proletarische Natur dieser Gruppen, die sehr schnell mit der Notwendigkeit konfrontiert wurden, sich selbst abseits zu stellen vom heutigen Trotzkismus – der immer gute Gründe hat, die Arbeiter zur Teilnahme am imperialistischen Krieg einzuladen – und vom Maoismus, jenem waschechten Abkömmling des stalinistischen „Nationalkommunismus“. Dies ist eine Klassengrenze, die die internationalistischen Linkskommunisten vom „Linksextremismus“ trennt [1] [54].
Offensichtlich sind all diese aus derselben Situation hervorgegangenen proletarischen Elemente sehr heterogen. Sich der Identifizierung des Stalinismus mit dem Kommunismus zu verweigern, die empörendsten Erklärungen der feindlichen Propaganda zu denunzieren ist nicht die schwierigste aller Übungen, denn ihre bürgerliche Natur wird schnell offenbar. „Es war Lenin, der das Fundament für das Regime legte, das später ‚stalinistisch‘ genannt wurde.“ Für die wenig scharfsinnigen Journalisten ist dies dadurch bewiesen, „dass Lenin der Gründer der Kommunistischen Internationale war, deren Ziel die ‚kommunistische Weltrevolution‘ war. Aufgrund seiner eigenen Überzeugung unternahm Lenin die Oktoberrevolution nur, weil er von der Unvermeidbarkeit einer europäischen Revolution überzeugt war, die in Deutschland beginnen sollte.“ (aus: L’Histoire, Nr. 250, S. 19) Man muss sich der Lügen bewusst sein, die verbreitet werden von der nationalen Beengtheit unserer ausgekochten Universitäten. Doch die Offensive der Bourgeoisie beschränkt sich nicht auf diese Karikatur. Wir müssen uns auch weiterhin mit der grundsätzlichen Bedeutung der Russischen Revolution und des Werkes Lenins identifizieren und sie verteidigen. Denn hier stoßen wir nicht nur auf eine subtile Degradierung der marxistischen Theorie durch den Linksextremismus, sondern auch auf eine Reihe von gefährlichen Konfusionen oder programmatischen Streitpunkten, die das Objekt einer harten Diskussion innerhalb der politischen Bewegung des Proletariats bleiben.
Es gilt also einen ganzen Klärungsprozess durchzuführen, den all diese Elemente nicht notwendigerweise in ihren Schlussfolgerungen berücksichtigt haben. Um den Stalinismus zu begreifen, ist es notwendig, der trotzkistischen Theorie eines „degenerierten Arbeiterstaates“, der anarchistischen Auffassung, dass er nichts anderes sei als das unvermeidliche Produkt eines „autoritären Sozialismus“, und dem vollkommen mechanistischen Marxismus der Rätisten, die den Bolschewismus als ein auf die Bedürfnisse des Kapitalismus in Russland zugeschnittenes Instrument betrachten, entgegentreten. Hinter diesen Fragen verbirgt sich das Problem des historischen Niedergangs des kommunistischen Programms und seiner Kohärenz. Die Ablehnung aktivistischer Ungeduld und die Konfrontation mit diesem Problem ist eine Bedingung für den Eintritt in die Reihen jener anonymen Militanten, die heute den Kampf für denselben Kommunismus fortsetzen, der von Marx‘ und Engels im Kommunistischen Manifest vor 150 Jahren dem Proletariat vorgestellt wurde.
Doch wo ist der Faden, der den proletarischen Kampf von Gestern, Heute und Morgen miteinander verknüpft? Um ihn aufzunehmen, müssen wir stets von der letzten revolutionären Erfahrung des Proletariats ausgehen. Heute heißt dies, mit der Revolution vom Oktober 1917 zu beginnen. Es geht dabei nicht um eine religiöse Huldigung der Vergangenheit, sondern um eine kritische Bewertung der Revolution, ihrer großartigen Schritte nach vorn, aber auch ihrer Irrtümer und Niederlagen. Die Russische Revolution selbst wäre unmöglich gewesen ohne die Lehren aus der Pariser Kommune. Ohne die kritische Bilanz der Kommune, die in den Adressen an den Generalrat der Internationalen Arbeiter Assoziation IAA gezogen worden war, und Lenins vorzüglicher Synthese in Staat und Revolution wäre dem russischen Proletariat kein Erfolg beschieden gewesen. Hier liegt die tiefe Einheit zwischen Theorie und Praxis, zwischen dem kommunistischen Programm und der Tat. Und es waren die linkskommunistischen Fraktionen, welche die schwere Arbeit einer Bilanz der Russischen Revolution auf sich nahmen. Eine Bilanz, die bis in ihr kleinstes Teil lebenswichtig für die nächste Revolution ist, so wie dies auch in der Vergangenheit der Fall war.
Daher begrüßen wir aufs Wärmste die Bemühungen, die auf die Wiederaneignung dieser Bilanz ausgerichtet sind, und unterstützen sie mit all unserer Kraft. Was uns angeht, so haben wir nicht nur versucht, diesen Genossen all die Dokumente zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, sondern auch ihre wichtigsten Positionen bekannt zu machen, sofern es die Übersetzungsprobleme zuließen, und in militantem Geist an den Kontroversen über die wichtigsten politischen Fragen teilzunehmen, mit jener Offenheit und Solidarität, welche die Diskussion unter Kommunisten auszeichnen.
In der Internationalen Revue Nr. 92 und 101 (engl., franz., span.) sowie in unserer territorialen Presse haben wir bereits die Entwicklung des proletarisch-politischen Milieus in Russland berücksichtigt. In diesem Artikel beabsichtigen wir, unsere Korrespondenz mit dem Südlichen Büro (SB) der Marxistischen Arbeitspartei (MLP) zu veröffentlichen. Die MLP sieht sich selbst in der Kontinuität der Arbeiterbewegung, und in diesem Sinn bezieht sich der Begriff „Arbeit“ direkt auf die Russische Sozialdemokratische Arbeitspartei (RSDLP) während des Übergangs vom 19. ins 20. Jahrhundert. Die Genossen führen diese Korrespondenz mit uns im Namen des Südlichen Büros, da sie die MLP insgesamt aufgrund der Tatsache, dass die Diskussion innerhalb der MLP noch im Gange ist, nicht in sämtliche Details ihrer Positionen einweihen können. Doch wir wollen die Genossen zunächst vorstellen, sie selbst und ihre politischen Kämpfe seit ihrem ersten Kongress im März 1990, der den Anstoß zur Bildung der „MLP – der Partei der Diktatur des Proletariats“ gab[2] [54].
„Allseits gute Stimmung herrschte bei der Gründung einer neuen kommunistischen Partei, die sich deutlich von Gorbatschows KPdSU unterschied, welche zu der Zeit in der UdSSR noch existierte. Doch das ideologische Make-up der Teilnehmer auf diesem ersten Kongress war so mannigfaltig wie instabil, und eine erste Spaltung fand statt, mit einer kleinen Gruppe von zwölf Leuten (die meinten, dass Russland ein ‚Feudalstaat‘ mit einer großräumig entwickelten Industrie sei und dass die UdSSR daher eine bürgerliche Revolution zu durchlaufen habe, ehe sie zur sozialistischen Revolution gelangt); unmittelbar nach der Spaltung trafen sie sich in einem Nebenraum und stellten ein Komitee für die Bildung einer ‚demokratischen (marxistischen) Arbeitspartei‘ auf. Doch zu mehr reichte es nicht, und so lösten sie sich wieder auf.“ (Brief vom 10.Juli 1999)
„Es gab keinen Trotzkisten auf diesem ersten Kongress, aber es verblieben dafür ein paar Stalinisten und Anhänger der Idee des ‚Industriefeudalismus‘, die, anders als die Spalter, nicht meinten, dass eine bürgerliche Revolution nötig sei. Nichtsdestotrotz vereinten sich alle Teilnehmer um die Parole: ‚Die Arbeiterklasse muss sich selbst organisieren‘ und ‚Die Macht der Sowjets ist die Arbeitermacht‘. Auch der zweite Kongress fand im September 1990 in Moskau statt. Er nahm mehrere Texte über die Partei einschließlich des Programms an. Die Idee der staatskapitalistischen Natur der UdSSR wurde übernommen. Fast überflüssig zu sagen, dass die verbliebenen Vertreter des ‚industriellen Feudalismus in der UdSSR‘ die Partei während dieses Kongresses verließen und ihre eigene ‚Partei der Diktatur des Proletariats (Bolschewiki)‘ gründeten. Die Stalinisten, von denen es nur wenige gab, verließen ebenfalls die Partei.“ (ebenda)
„Die erste Konferenz der MLP im Februar 1991 entfernte den Begriff ‚Die Partei der proletarischen Diktatur' aus dem Namen der Gruppe. 1994/95 bildete sich innerhalb der Partei eine kleine Fraktion, die meinte, dass die Produktionsweise in der UdSSR neo-asiatisch sei. Früh im Januar 1996 spaltete sich diese Fraktion ab und trat den (argentinischen) morenistischen Trotzkisten der Internationalen Arbeiterpartei bei, die ziemlich aktiv in Russland und in der Ukraine sind.“ (ebenda)
„Das auf dem Zweiten Kongress angenommene Programm enthielt im Besonderen die folgenden Grundprinzipien:
- Die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats für den Übergang zum Kommunismus (Sozialismus) und die Notwendigkeit dieses Übergangs selbst;
- genauer, die Diktatur der städtischen Arbeiterklasse ist notwendig, nicht die der Partei der proletarischen Diktatur oder jene ‚aller Arbeiter‘, noch weniger ‚aller Menschen‘;
- der Ruin der russischen Partei des Proletariats in den 1920er Jahren und die Notwendigkeit ihrer Wiedererschaffung heute;
- die Erkenntnis, dass die ‚Diktatur der Klasse‘ und die ‚Diktatur der Partei‘ als Vorhut der Klasse nicht ein und dieselbe Sache sind.“ (ebenda)
Und die Genossen sagten schlussendlich, „obwohl das Programm von 1990 keine Kritik der Theorie vom ‚Sozialismus in einem Land‘ oder der Notwendigkeit einer Weltrevolution enthielt, waren diese Ideen ein Allgemeinplatz und galten als selbstverständlich.“ (ebenda)
Wir sehen, wie bitter der Kampf in Russland war, wie lebenswichtig es ist, mit den ehemaligen Stalinisten zu brechen, die sich selbst immer noch für Revolutionäre halten. Wir sehen auch den Druck, der von einem ganzen Arsenal trotzkistischer Sekten ausgeübt wird, wobei jede versucht, ihr eigenes, selbst patentiertes revolutionäres Rezept zu verkaufen. 1980 beeilten sich die westlichen Gewerkschaften (CFDT in Frankreich, AFL-CIO in den USA), logistische Unterstützung für Solidarnosc gegen den Kampf der polnischen Arbeiter zu leisten. Heute sind es die Trotzkisten, die mit ihren guten Ratschlägen und ihrem Beistand gen Osten eilen, um die Wiedergeburt eines politischen Milieus des Proletariats zu verhindern. Im Moment betrifft diese Wiedergeburt lediglich eine kleine Minderheit, die sich vielfachen Ausdrücken der herrschenden Ideologie ausgesetzt sieht, welche, im wahrsten Sinn des Wortes, allgegenwärtig ist.
Die Frage des historischen Erbes
In ihren Briefen vom 15. März und 20. März 2000 bezogen die Genossen Stellung zu unserer Polemik mit dem IBRP über den Klassenkampf in den Ländern der kapitalistischen Peripherie, veröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 100 (engl., franz., span.); doch vor allem entwickelten sie eine Reihe von offiziellen Positionen des Südlichen Büros der MLP.
Der Autor der beiden Briefe schrieb ausdrücklich: „Die anderen Mitglieder des SB der MLP stimmen den Hauptpositionen dieses Kommentars zu. Ihr könnt daher die obigen Positionen als die unseren ansehen.“ (20. März)
Wir müssen zunächst erwähnen, dass die Genossen durch die Polemik zwischen der IKS und dem IBRP etwas verwirrt waren, einfach, weil sie noch nicht die Möglichkeit hatten, die grundsätzlichen Positionen beider Organisationen gründlich zu prüfen. Daher hatten sie einige Schwierigkeiten, die wirklichen Unstimmigkeiten zu identifizieren, und sahen in ihnen einen bloßen Zank, in dem mehr Wert auf den einen Aspekt der Realität als auf dem anderen gelegt würde, „auch wenn beide oft zwei Seiten derselben dialektischen Einheit sind“, wie sie sagen. Im Endeffekt „habt ihr beide Recht“, ganz wie man die Sache betrachtet. Wir denken, dass Erfahrung und Diskussion ihnen erlauben werden, einen klareren Blick dafür zu bekommen, was das proletarische Lager an Gemeinsamkeiten hat und wo die Unstimmigkeiten liegen. Die Genossen schreiben: „Wir denken, dass die Schwäche der Linkskommunisten in Westeuropa diese ist: Statt erfolgreich als Gleiche unter Gleichen miteinander zu kooperieren, ignoriert ihr euch entweder oder ‚entblößt‘ die anderen, indem ihr ‚die Bettdecke auf eure Seite des Bettes zieht‘, wie man in Russland sagt (...) Für uns, dem SB der MLP, sollten alle Linkskommunisten, die ‚Staatskapis‘ (d.h. jene, die die staatskapitalistische Natur der UdSSR anerkennen), wie wissenschaftliche Mitarbeiter im gleichen Forschungsinstitut zusammenarbeiten!“ (15. März)
Wir fürchten uns nicht vor Ironie, die alle großen Revolutionäre gepflegt hatten. Dennoch ist es unser Anliegen bei der Vorstellung der wahren Positionen unserer Widersacher, aufzuzeigen, wohin sie führen, und unerschütterlich zu verteidigen, was wir als unantastbare Prinzipien des Marxismus betrachten. Unser Angriff richtet sich nicht gegen eine besondere Person oder Gruppe, sondern gegen opportunistische Herangehensweisen bzw. theoretische Irrtümer, für die wir morgen teuer bezahlen werden. Deshalb widerspricht revolutionäre Unnachgiebigkeit niemals dem Bedürfnis nach Solidarität unter Kommunisten.
Auf der Grundlage dieses ersten Eindrucks schlossen die Genossen, dass die gesamte Kommunistische Linke als historische Strömung schwach sei. Und es ist vor allem dieser Gedanke, den wir kritisieren wollen. Die Divergenzen zwischen IBRP und IKS über die Fragen des Imperialismus und der Dekadenz des Kapitalismus vor Augen, behaupten die Genossen, dass dies ein Irrtum in der Methode sei, dass es nicht eine Angelegenheit von „entweder - oder“, sondern von „sowohl - als auch“ sei. In der Tat machten sich Linkskommunisten oft diese Herangehensweise zu Eigen. Es ist offensichtlich, dass wir nicht alle Positionen der Linkskommunisten, seitdem sie aus der Kommunistischen Internationale hervorzutreten begonnen hatten, übernommen haben. Im Gegenteil, wir sind fälschlicherweise beschuldigt worden, gegen die Partei zu sein, sind als ungeduldige Aktivisten bezeichnet worden, als leichtfertige Radikale, unfähig zu Konzessionen und zum Anarchismus neigend, was letztendlich zu einem sterilen Purismus führe, der unfähig sei, die Probleme anders zu sehen als in Schwarz-Weiß-Begriffen: entweder das Eine oder das Andere. Alle führenden Mitglieder der Kommunistischen Linken waren Marxisten aus tiefstem Herzen und der Idee der Partei äußerst zugetan. Ihr Ziel war es, eben jene Partei gegen den Opportunismus zu verteidigen. Dies war die Arbeit, die anstand.
„Genosse“, schrieb Gorter in seiner Antwort an den Genossen Lenin, „mit der Errichtung der Dritten Internationale ist auch bei uns der Opportunismus nicht gestorben. Wir sehen ihn schon in allen kommunistischen Parteien, in allen Ländern. Es würde ein Wunder sein und allen Gesetzen der Entwicklung widersprechen, wenn dasjenige, wodurch die zweite Internationale starb, nicht in der dritten fortlebte!“ Bordiga nahm denselben Gedanken auf: „Es wäre absurd, steril und extrem gefährlich, zu behaupten, dass die Partei und die Internationale auf mysteriöse Weise vor einem Rückfall in den Opportunismus oder vor jeder Tendenz gefeit ist, dahin wieder zurückzukehren!“ (Thesenentwurf der Linken, Kongress von Lyon, 1926) Dies war ein Zeichen dafür, dass es notwendig war, als eine Fraktion zu arbeiten, nicht als simple Opposition, die Trotzkis Strömung in eine Sackgasse und anschließend in den völligen Bankrott führte. Die Linke ihrerseits bewährte sich als Erbe der marxistischen Strömung in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Sie kehrte zu der Aufgabe zurück, die Lenin 1903 gegen den Opportunismus in der Zweiten Internationale begonnen hatte und die es den Bolschewiki erlaubte, 1914 beide imperialistische Lager zu bekämpfen, den Prinzipien des Kommunismus treu zu bleiben und der Partei somit zu ermöglichen, ihre Rolle im Oktoberaufstand voll wahrzunehmen. Es war eine Arbeit für die Partei, nicht gegen sie. Die Kommunistische Linke kämpfte bis zum bitteren Ende, trotz der Ausschlüsse und all der Hindernisse, die sich ihnen durch die formale Führungsdisziplin in den Weg stellten. Es war der Geist Lenins, von dem sich die Linke inspirieren ließ. 1911 systematisierte Lenin den Begriff der Fraktion, wobei er die Erfahrung nutzte, die die Bolschewiki seit der Bildung ihrer Fraktion auf der Genfer Konferenz 1904 erlangt hatten: „Eine Fraktion ist eine Organisation innerhalb der Partei, die nicht durch den Ort der Arbeit, nicht durch die Sprache oder durch andere objektive Bedingungen, sondern durch eine besondere Plattform der Auffassungen in Parteifragen zusammengehalten wird.“ (Über die neue Fraktion der Versöhnler oder der Tugendhaften, Werke Bd. 17, S. 253, Dietz Verlag Berlin) Revolutionäre Unnachgiebigkeit steht in keiner Weise im Gegensatz zum Realismus, sie allein kann wirklich die konkrete Situation erfassen. Was hätte realistischer sein können als die Ablehnung der Position Trotzkis, der 1936 die Eröffnung einer neuen revolutionären Periode erblickte, durch die Italienische Linke?
Die Fraktion steht im Mittelpunkt der Frage eines historischen Erbes. Es ist die Fraktion, welche die Verbindung zwischen der alten und der neuen Partei sicherstellt, vorausgesetzt, sie ist in der Lage, die Lehren aus den Erfahrungen der Arbeiterklasse zu ziehen und sie in eine neue Bereicherung des Programms umzusetzen. Zum Beispiel haben etliche Revolutionäre seit dem Ersten Weltkrieg bemerkt, dass sich die Rolle des bürgerlichen Parlaments völlig gewandelt hatte. Doch es waren die Linkskommunisten, die die prinzipiellen Konsequenzen daraus zogen: die Ablehnung des revolutionären Parlamentarismus und jeder Beteiligung an den Wahlen der bürgerlichen Demokratie. Es waren die italienischen Linkskommunisten, die die Rolle der Fraktion in aller Gründlichkeit ausarbeiteten.
„Die Umwandlung der Fraktion in eine Partei wird von zwei Elementen bedingt, die eng miteinander verknüpft sind:
1. Die Erarbeitung neuer politischer Positionen durch die Fraktion, um in der Lage zu sein, dem Kampf des Proletariats für die Revolution in seiner neuen, fortgeschritteneren Phase einen soliden Rahmen zu verschaffen (...)
2. Die Überwindung der Klassenverhältnisse des gegenwärtigen Systems (...) durch den Ausbruch revolutionärer Bewegungen, die es der Fraktion ermöglichen werden, mit Blick auf den Aufstand die Führung des Kampfes in die Hand zu nehmen.“ (Bilan Nr. 1)
Die Genossen der MLP erinnern uns daran, dass gemäß dem dialektischen Materialismus die Bewegung in der Realität ein komplexes Phänomen sei, bei dem sich eine Vielzahl von Faktoren in Bewegung setzt. Doch sie vergessen dabei, dass das System von Widersprüchen, das die Realität produziert, in bestimmten Momenten eine klar umrissene Alternative eröffnet. Dann gibt es nur das eine oder das andere, entweder Sozialismus oder Barbarei, entweder proletarische Politik oder bürgerliche Politik. Das zentristische Abdriften der Führung der Internationale, angefangen mit der Parole „Zu den Massen“, liegt allein in der Suche nach Abkürzungen begründet, die ihre Klassenpolitik tiefgreifend veränderte: sowohl Räte als auch Gewerkschaften, sowohl außerparlamentarischer Kampf als auch revolutionärer Parlamentarismus, sowohl Internationalismus als auch Nationalismus... Und es war eine Katastrophe. Jede politische Erneuerung war ein Schritt tiefer in die Niederlage. Weit entfernt davon, die Parteien und kommunistischen Kerne zu stärken, bewirkten die Allianzen mit der Sozialdemokratie nichts anderes, als die Kräfte zu erdrosseln, die sich nur auf der Basis eines klaren kommunistischen Programms entwickeln konnten. Lenins Buch Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus symbolisiert diese opportunistische Wende. Er beabsichtigte zu kritisieren, was er als unvermeidliche und vergangene Fehler einer authentischen revolutionären Strömung ansah: „Natürlich ist der Fehler des linken Doktrinarismus im Kommunismus gegenwärtig tausendmal weniger gefährlich und weniger folgenschwer als der Fehler des rechten Doktrinarismus...“ Aber er endete damit, die Positionen der Linken mit jenen des Anarchismus zu vermischen, während er gleichzeitig das Prestige der Rechten aus dem Grund hebt, weil sie noch immer große Bereiche des Proletariats dominieren. Das ist Zentrismus. Und die Rechten machten ausgiebig von der Autorität, die ihnen so verliehen wurde, Gebrauch, um die Linken zu isolieren.
Lohnarbeit und Weltmarkt, zwei grundsätzliche Kennzeichen des Kapitalismus
Die Genossen schreiben: „Wir meinen, dass das 21. Jahrhundert Zeuge neuer Schlachten für nationale Unabhängigkeit sein wird. Trotz der Macht (und der Dekadenz, gemäß Euch) des Kapitalismus in den hochentwickelten Ländern kann der Kapitalismus in den rückständigen Ländern seine Entwicklung,, sein Wachstum sozusagen im eigenen Schrittmaß fortsetzen. Und dies ist keine Frage von Prinzipien, es ist die objektive Realität!“ (15. März)
Dies ist in der Tat ein wichtiger Punkt der Nichtübereinstimmung innerhalb des politischen Milieus des Proletariats. Wie die Genossen wissen, denken wir, dass Lenin falsch lag, als er Rosa Luxemburg entgegnete: „Nationale Kriege der Kolonien und Halbkolonien sind in der Epoche des Imperialismus nicht nur wahrscheinlich, sondern unvermeidlich.“ (Lenin, Ges. Werke, Bd. 22, S. 315) Doch es ist wichtig zu betonen, dass dies die Genossen nicht dazu veranlasst hat, dem proletarischen Internationalismus abzuschwören, auch wenn er unserer Auffassung nach dadurch geschwächt wird. Ihnen geht es darum zu definieren, unter welchen Bedingungen die Einheit des internationalen Proletariats stattfindet, nicht darum, sich hinter Lenin zu verstecken, um die eine oder andere imperialistische Macht zu unterstützen, wie es die Linksextremisten tun.
„Ihr habt zweifellos bemerkt, wie wenig leninistisch wir sind. Nichtsdestotrotz denken wir, dass Lenins Position in dieser Frage die beste ist. Jede Nation (merke: Nation, nicht Nationalität oder nationale bzw. ethnische Gruppe, etc.) hat das vollständige Recht der Selbstbestimmung innerhalb des Rahmens ihres ethno-historischen Territoriums, bis hin zur Abtrennung und Schaffung eines neuen Staates (...) Was die Marxisten interessiert, ist die Frage der freien Verfügbarkeit der Selbstbestimmung des Proletariats innerhalb dieser oder jener Nation, mit anderen Worten: die Möglichkeit, über sich selbst zu bestimmen, ob die Klasse für sich bereits existiert oder nur die Möglichkeit für vor-proletarische Elemente, sich selbst innerhalb des Rahmens eines neuen bürgerlichen Nationalstaates als Klasse zu bilden. Dies ist der Fall in Tschetschenien. Tschetschenien/Ingutschetien wurde unter Sowjetmacht industrialisiert, aber mehr als 90% aller Arbeiter waren russischer Herkunft; die Tschetschenen waren Kleinbauern, Intellektuelle, Staatsfunktionäre, etc. Lasst die neue tschetschenische Bourgeoisie erst einmal das nationale tschetschenische Proletariat schaffen, lasst sie erst einmal mit der Ausbeutung ihres nationalen Proletariats, ihrer Bauernschaft, ihrer einheimischen Bevölkerung (die russischen Arbeiter werden bestimmt nicht zurückkommen, um sich von den Nationalisten enthaupten zu lassen) beginnen, und dann werden wir sehen, was aus der ‚stabilen Einheit der tschetschenischen Nation‘ werden wird! Erst dann wird die Einheit des russischen und tschetschenischen Proletariats eine objektive Möglichkeit sein, und nicht vorher." (15. März)
Doch diese Position führt zu einer Reihe von Widersprüchen, die auch nicht dadurch aufgelöst werden können, indem die Genossen einfach erklären, dass „... die Anerkennung der Objektivität des nationalen Kampfes nicht bedeutet, ihn zu rechtfertigen (übrigens: was bedeutet der Begriff ‚rechtfertigen‘?) oder gar zu einem Bündnis mit Fraktionen der nationalen Bourgeoisie aufzurufen!“ (20. März)
Das ganze Problem besteht darin zu erkennen, worin diese objektive Realität besteht, von der die Genossen sprechen. Tatsächlich entspricht sie einer vergangenen Epoche, der Epoche der Bildung von bürgerlichen Nationen gegen den Feudalismus. Haben die Genossen wirklich die nationalistische Motivation der tschetschenischen Bourgeoisie analysiert? Wenn ja, dann hätten sie sich vergegenwärtigt, dass diese nationalen Forderungen nicht mehr denselben Inhalt haben wie auf früheren Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung. Rosa Luxemburg fasst dies so zusammen: „Die französische Bourgeoisie hatte (...) das Recht, während der Großen Revolution im Namen des französischen ‚Volkes‘ als dritter Stand aufzutreten, und sogar die deutsche Bourgeoisie konnte sich bis zu einem gewissen Grade im Jahre 1848 als Repräsentant des deutschen ‚Volkes‘ verstehen (...) In beiden Fällen bedeutete dies nichts anderes, als dass die revolutionäre Sache der bürgerlichen Klasse im damaligen Stadium der gesellschaftlichen Entwicklung mit derjenigen des gesamten Volkes zusammenfiel, da dieses mit der Bourgeoisie noch eine politisch einheitliche Masse gegen den herrschenden Feudalismus bildete.“ (Nationalitätenfrage und Autonomie (1908), publiziert in Internationalismus und Klassenkampf, Sammlung Luchterhand, S. 259 f.) Die Genossen sehen nicht, dass der Grad gesellschaftlicher Entwicklung nicht von der lokalen, tschetschenischen Situation bestimmt wird, sondern vom gesellschaftlichen Umfeld, von der allgemeinen Situation. Als blutiger Spielball des Imperialismus und in völliger Abhängigkeit vom Weltmarkt hat Tschetschenien schon längst alle Hauptkennzeichen einer feudalen Gesellschaft abgelegt.
Den Genossen zufolge existiert in einer gewissen Zahl von Ländern eine fortschrittliche Bourgeoisie, „da der nationale Kapitalismus weiterhin spontan aus den traditionellen Sektoren entsteht, in Einklang mit den allgemeinen Entwicklungsgesetzen der Völker in der Epoche des zweiten gesellschaftlichen Überbaus, jener des Privateigentums. Es gibt drei dieser Überbauten: den Überbau des primitiven Kommunismus (Nr. 1), dann den Überbau des Privateigentums einschließlich der Sklaverei in der Antike, des Feudalismus und Kapitalismus (Nr. 2) und schließlich den Überbau eines authentischen Kommunismus (Nr. 3). Dies ist, Marx zufolge, die Trinität (s. die Entwürfe seiner Antwort an Vera Sassulitsch, 1881). Doch es gibt ein paar Länder – und es werden derer immer weniger -, wo ein sich selbst entwickelnder nationaler Kapitalismus dominiert. Wo dies der Fall ist, kann die fortschrittliche Bourgeoisie mit der Unterstützung des Volkes (einschließlich der Arbeiter, besonders wenn sie sich in einem vor-proletarischen Zustand befinden!) an die Macht gelangen. Aber all dies ist sehr temporär, da sie immer abhängiger von der imperialistischen Weltbourgeoisie werden, wie der Fall Afghanistan uns zeigt (...) Der Kapitalismus kann mit einer Welle im ‚Meer‘ des zweiten Überbaus (s.o.) verglichen werden, ja, nicht mit einer Welle, sondern mit einem ganzen Prozess von Wellen! Der zweite Überbau (Marx nannte ihn ‚ökonomisch‘) erzeugt diese Wellen von innen! Doch die Grenzen, die Gestade dieses ‚Meeres‘ des ‚ökonomischen Überbaus‘ sind gleichzeitig die Grenzen des Kapitalismus, sie sind die Küste, an denen die Wogen des Kapitalismus ‚brechen‘.
Das wesentliche Kennzeichen dieses ‚Meeres‘ des ökonomischen gesellschaftlichen Überbaus (der zweite in der Trinität) ist das Wertgesetz. Doch der ‚Wellenprozess‘ beginnt, wird angeregt und erhält seinen Anstoß von... dem kleinen Eigentümer-Produzenten! Er war, ist und wird der aktive Mittler des Wertgesetzes über dem gesamten Umfang des ökonomischen Überbaus der Gesellschaft (des ‚zweiten‘, jenes des Privatkapitals) sein. Aus diesem Grund kann der Kapitalismus den kleinen Produzenten nicht zerstören! Und deshalb kann der Staatsmonopolismus weder vollständig noch lang andauernd sein. Die Welle wird abebben! Wenn die Linkskommunisten die Dinge von diesem Standpunkt aus analysiert hätten, so hätten sie viele Probleme vermieden, einschließlich ihrer eigenen Beziehungen! Und der Platz und die Rolle der sozialen Weltrevolution des Proletariats wären verständlicher gewesen.“ (20. März)
Wie sollen wir uns diese Perspektive einer Rückentwicklung des Staatskapitalismus, die die Genossen vertreten, erklären? Jeder Tag stärkt die Tendenz zum Wirtschaftsmanagement durch einen einzigen, kollektiven Kapitalisten, wie Engels in seinem Anti-Dühring voraussah. Überall ist es der Staat, der die Fusionen der großen multinationalen Unternehmen regelt und ihnen seine Orientierung aufzwingt. Jeder Staat, der auf eine solche Kontrolle verzichtet, würde sich sofort in einer Position der Schwäche im Handelskrieg wiederfinden. Die Position der Genossen kann zweifellos nur vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs der UdSSR verstanden werden. In diesem Fall verallgemeinern die Genossen eine spezifische Situation. Die UdSSR war durch ihre ökonomische Schwäche gezeichnet, und was da zusammenbrach, war nicht der Staatskapitalismus, sondern seine krasseste Karikatur, in der die überwiegende Mehrheit der Industrie verstaatlicht war. Direktes Staatseigentum der Unternehmen ist stets ein Zeichen der Schwäche. In den entwickeltsten Ländern ist der Staatskapitalismus genauso real, aber weitaus flexibler, da der Staat nur teilweise Eigentum in einigen Gesellschaften besitzt, ansonsten sich damit zufrieden gibt, die ökonomischen Regeln festzulegen, die jedes Unternehmen befolgen muss.
Wir können durchaus nachvollziehen, warum die Genossen den Staatskapitalismus als ein vorübergehendes Phänomen darstellen, da für sie der kleine, unabhängige Produzent am besten Privateigentum und Wertgesetz symbolisiert. Es trifft zu, dass der Kapitalismus einst als eine Gesellschaft ihren Anfang nahm, die vom Privateigentum und dem Warenaustausch charakterisiert war. In der Tat ist der Kapitalismus ihre logische Folge und ihr höchster Ausdruck, solange Waren in Kapital verwandelt werden. Es ist ebenfalls wahr, dass der Kapitalismus nie imstande sein wird, den kleinen Produzenten vollständig aus der Welt zu schaffen. Doch es trifft gleichfalls zu, dass sich der kleine Produzent unter einem ständigen Wettbewerbsdruck befindet. Heute, wo die Überproduktion allgegenwärtig und permanent geworden ist, wird ein Teil der Bourgeoisie ins Kleinbürgertum gespült, und gleichzeitig werden zahllose Kleinproduzenten in den Ruin und in die Arbeitslosigkeit gestoßen, es sei denn, sie überleben mit kleinen Geschäften, die sich oft hart am Rande der Legalität befinden. Der Kleinproduzent ist nicht für den Kapitalismus charakteristisch, sondern vielmehr Überlebender aus vorkapitalistischen Gesellschaften bzw. aus der ersten Entwicklungsstufe des Kapitalismus. In der bürgerlichen Mythologie wird der Kapitalist stets als kleiner Produzent präsentiert, der dank seiner eigenen Bemühungen irgendwann zum großen Produzenten wird. Aus dem kleinen Handwerker des Mittelalters sei der Großindustrielle geworden. Die historische Realität sieht völlig anders aus. Nicht die städtischen Handwerker, sondern vielmehr die Kaufleute traten aus dem zerfallenden Feudalismus als künftige kapitalistische Klasse hervor. Mehr noch, oft befanden sich unter den ersten Proletariern, die der formellen Herrschaft des Kapitals unterworfen wurden, eben jene Handwerker. Die Genossen vergessen, dass der Kapitalist nicht in erster Linie ein Produzent ist, sondern ein Kaufmann, ein Händler. Er ist ein Kaufmann, der hauptsächlich mit der Arbeitskraft handelt.
Es hat den Anschein, als ob die Genossen dabei von einer Passage in Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus inspiriert worden sind. Lenin erklärt nämlich, dass die Macht der Bourgeoisie „nicht nur in der Stärke des internationalen Kapitals, in der Stärke und Festigkeit der internationalen Verbindungen der Bourgeoisie besteht, sondern auch in der Macht der Gewohnheit, in der Stärke der Kleinproduktion. Denn Kleinproduktion gibt es auf der Welt leider noch sehr, sehr viel; die Kleinproduktion aber erzeugt unausgesetzt, täglich, stündlich, elementar und im Massenumfang Kapitalismus und Bourgeoisie“. Erinnern wir uns an die Begleitumstände dieser Äußerung. Wir befinden uns hier im Jahr 1920, und seit 1918 hatte sich innerhalb der bolschewistischen Partei zwischen Lenin und den Linkskommunisten, die das Blatt Kommunist veröffentlichten, eine Kontroverse entwickelt. Die führende Figur der Linken, Bucharin, gesellte sich früh zur Mehrheit der Partei, nachdem er sich in der Frage des Brest-Litowsker Vertrages noch in der Minderheit befunden hatte. Doch die Gruppe selbst setzte die Kontroverse über die Frage des Staatskapitalismus fort, den Lenin als eine Etappe auf dem Weg zum Sozialismus und somit als einen Schritt vorwärts verstand. Es trifft zu, dass das siegreiche Proletariat zwar nicht mit der Wut der alten herrschenden Klasse, so doch mit der tödlichen Last riesiger bäuerlicher Massen konfrontiert war, die ihre eigenen Gründe hatten, sich jedem weiteren Fortschreiten des revolutionären Prozesses zu widersetzen. Aber diese gesellschaftlichen Schichten lasteten auf dem Proletariat vor allem in Gestalt des Staates, der in seinem natürlichen Drang zur Verteidigung des gesellschaftlichen Status quo dahin tendierte, zu einer autonomen Macht mit eigenen Gesetzen zu werden. Alle Revolutionäre wussten, dass eine Isolation fatal für die Russische Revolution wäre. Die Frage war, ob die bürgerliche Macht durch einen militärischen Sieg der weißen Armeen oder unter dem enormen Druck des Kleinbürgertums wiederhergestellt werden würde. Von diesem Standpunkt ausgehend, war die Partei nicht in der Lage, den Prozess zu erfassen, der durch die Erschaffung einer Staatsbürokratie zur Wiedergeburt der russischen Bourgeoisie führen sollte. Die Kritik der Linken enthielt etliche Schwächen (wie sollte es auch anders sein in der Hitze des Gefechts?), und Lenin hielt oftmals zu Recht den Finger drauf. Doch die Linkskommunisten demonstrierten ihre ganze Stärke, als sie die Gefahr des Staatskapitalismus enthüllten. Dieselbe Herangehensweise finden wir später bei der deutschen Linken wieder, die die Erste war, die das stalinistische Russland als staatskapitalistisch analysierte. In der oben zitierten Passage offenbart Lenin große Verwirrung über die Natur des Kapitalismus, die sich bereits in seinem Pamphlet Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus 1916 gezeigt hatte. In diesem wie auch in anderen Punkten ist es heute möglich, eine Synthese all der Beiträge der Linkskommunisten trotz ihrer Verschiedenartigkeit und mancher gegensätzlicher Positionen zu schaffen, weil sie der marxistischen Methode und den kommunistischen Prinzipien grundsätzlich treu geblieben waren. „Der Staatskapitalismus ist kein organischer Schritt zum Sozialismus. Tatsächlich stellt er die letzte Verteidigungsform des Kapitalismus gegen den Zusammenbruch des Systems und das Auftreten des Kommunismus dar. Die kommunistische Revolution ist die dialektische Negation des Staatskapitalismus.“ (Internationale Revue Nr. 99, engl., franz., span.)
Nach unserer Auffassung ist es ein Fehler, den kleinen, unabhängigen Produzenten als den Agenten des Mehrwerts darzustellen. Ganz allgemein gesprochen, wird der Kapitalismus nicht vom Kapitalisten geschaffen, sondern umgekehrt: Der Kapitalismus erzeugt die Kapitalisten. Indem wir diese Herangehensweise auf Russland anwenden, verstehen wir, warum „der Staat nicht so funktionierte wie wir angenommen hatten“, um Lenins Worte zu benutzen. Die Macht, die dem russischen Staat ihre Richtung aufzwang, war weitaus größer als die „NEP-Leute“, als Privatkapitalismus oder kleines Eigentum. Es war die ungeheure, unpersönliche Macht des Weltkapitals, die kompromisslos den Lauf der russischen Wirtschaft und des Sowjetstaates bestimmte. Wenn die Genossen Schwierigkeiten dabei haben, die grundsätzliche Natur des Kapitalismus oder des Staatskapitalismus als Ausdruck eines dekadenten Systems zu begreifen, liegt dies zweifellos auch daran, dass sie die Dinge aus einer sehr langfristigen Perspektive betrachten, so wie Marx in seinem Brief an Vera Sassulitsch, in dem er die Menschheitsgeschichte in drei Perioden unterteilte: die archaische Gesellschaftsstruktur (primitiver Kommunismus), die zweite Gesellschaftsstruktur der Klassenherrschaft und den modernen Kommunismus, der die kollektive Produktion und Aneignung auf einer höheren Ebene wiederherstellt. Für Marx waren die Beispiele primitiver Gesellschaften ein weiterer Beweis dafür, dass die Familie, das Privateigentum und der Staat der menschlichen Natur nicht immanent sind. Diese Texte sind auch eine Denunziation der fatalistischen Interpretation der ökonomischen Entwicklung und der bürgerlichen Vision eines linearen, widerspruchsfreien Prozesses. Doch wenn wir auf diesem Terrain bleiben, wird es unmöglich, präzise zu untersuchen, was am Kapitalismus so besonders ist, und vor allem zu erkennen, dass der Kapitalismus selbst eine Geschichte hat, dass er sich von einem fortschrittlichen System in eine ernsthafte Barriere in der Entwicklung der Produktivkräfte verwandelt hat. Die Fundamente solch einer Analyse wurden bereits im Kommunistischen Manifest so wie anderen Texten von Marx gelegt. Nach der Pariser Kommune und dem Ende der großen nationalen Kämpfe im 19. Jahrhundert zeigte Marx sich fähig zu erkennen, dass die Bourgeoisie in den kapitalistischen Hauptländern keine revolutionäre Rolle auf der historischen Bühne mehr spielte, auch wenn dem Kapitalismus noch ein unermessliches Expansionsfeld offen stand. Eine neue Periode, die der kolonialen Eroberungen und des Imperialismus, brach an. Diese Herangehensweise ermöglichte es dem Marxismus, die historische Entwicklung vorwegzunehmen und den Eintritt des Kapitalismus in seine Periode der Dekadenz vorherzusehen. Dies wird sehr deutlich in dieser Passage aus dem zweiten Entwurf: „Das kapitalistische System hat im Westen seinen Höhepunkt überschritten und den Punkt erreicht, wo es nichts anders mehr als ein rückläufiges soziales System wird“.
Marx‘ Überlegungen über die bäuerlichen Gemeinden Russlands sollten von gewissen Linken verunstaltet werden. Der Amerikaner Shanin zum Beispiel betrachtet sie als Beweis dafür, dass der Sozialismus durch bäuerliche Revolutionen in der Peripherie des Kapitalismus erreicht werden kann. Ohne seine Begeisterung für Ho Tschi Minh und Mao zu teilen, haben Raja Dunajewskaja und die Gruppe News and Letters dennoch dieselbe Herangehensweise praktiziert. Sie behaupten, dass der Marx der 1880er Jahre nach einem neuen revolutionären Subjekt außerhalb der Arbeiterklasse Ausschau gehalten habe. Ein Teil der Linksextremen stellt daher die Arbeiterklasse nur als ein revolutionäres Subjekt unter vielen anderen dar, als da sind: primitive Stämme, Frauen, Schwule, Schwarze, Jugendliche, die Völker der „Dritten Welt“.
Oktober 1917: Ein Produkt der Weltlage
Solche Absurditäten haben nichts gemein mit den Ideen der russischen Genossen. Doch wie wir sehen werden, führt sie ihre Behauptung, nationale Kriege seien noch möglich, zu einer originellen Analyse der Oktoberrevolution von 1917.
„Wir unsererseits (das SB der MLP) denken, dass die Geschichte diesen Eckstein Lenins, seine Auffassung über das ‚schwächste Glied‘, bereits widerlegt hat! Doch Achtung: sie hat auf einer sehr originellen Weise gezeigt, dass es möglich war, ‚die Kette des Imperialismus‘ zu sprengen, ja, sogar den ‚Sozialismus zu errichten‘ in jenen rückständigen Ländern (oder, wie Ihr sie nennt, den ‚zurückgebliebenen‘ Ländern, obwohl ich hier einen Unterschied machen würde: Der Aufbau des Sozialismus begann nicht nur in kapitalistisch zurückgebliebenen Ländern wie Russland z.B., sondern auch in der Mongolei, in Vietnam, etc., in Ländern also, die wirklich rückständig sind). Und wir sehen: Ja, es ist möglich, den Sozialismus in einzelnen Ländern aufzubauen und zu etablieren (mit anderen Worten: ‚den Aufbau zu beenden‘)... Aber! Dies bedeutet keineswegs, dass dies in irgendeiner Weise zum Kommunismus führt! Niemals und in keiner Weise! Warum waren, theoretisch betrachtet, die Bolschewiki in der Lage, diesen Weg einzuschlagen, warum waren sie in der Lage, sich selbst und viele andere, einschließlich der Linkskommunisten, zu täuschen? Die Ursache von all dem liegt in.... nur einem Wort (und in dieser Frage geht es nicht um meinen Subjektivismus: hinter diesem Wort verbirgt sich eine völlig unrichtige, fundamental anti-marxistische Auffassung!) – dieses Wort (diese ‚Losung‘ des Tages) ist die ‚sozialistische Revolution‘! Wo doch Marx und vor allem Engels solch ein Zerrbild des Konzeptes der ‚sozialen Revolution des Proletariats‘, der kommunistischen Weltrevolution akzeptiert hatten! Wie die ‚sozialistische Revolution‘ endet sie früher oder später im ‚Aufbau des Sozialismus‘, wobei sich dann herausstellt, dass dieser ‚Sozialismus‘, ob ‚staatlich‘, ‚marktwirtschaftlich‘ oder ‚national‘, in Wahrheit nicht mit dem Kapitalismus gebrochen hat!“ (15. März)
„Wo dieser von Außen kommende kapitalistische Sektor existiert, spielt die progressive Bourgeoisie eine Rolle und hat einen Einfluss, der umgekehrt proportional zum Reifegrad des Sektors ist: Die Bourgeoisie des importierten kapitalistischen Sektors lastet schwer auf der progressiven nationalen Bourgeoisie und korrumpiert sie, ganz zu schweigen von der (transnationalen) imperialistischen Weltbourgeoisie. Diese beiden Sektoren waren in Russland Anfang des 20. Jahrhunderts präsent, und der russische Marxismus war Ausdruck der Beziehungen innerhalb des von Außen kommenden kapitalistischen Sektors. Doch dann entschieden sich die Bolschewiki, für alle Ausgebeuteten zu sprechen: für jene im Sektor des importierten, entwickelten Kapitalismus, für jene im Bereich des nationalen Kapitalismus (und selbst für jene im landwirtschaftlichen Sektor mit seinen überlebenden ländlichen Gemeinden). Und so wurden sie zu ‚Sozial-Jakobinern‘ und verkündeten die ‚sozialistische Revolution‘.“ (20. März)
„Ihr befasst Euch mit dem Problem des Objektiven und Subjektiven in der proletarischen Weltrevolution, und das ist richtig. Aber warum habt Ihr nicht den leisesten Zweifel daran, dass ‚objektiv die Revolution seit dem imperialistischen Weltkrieg von 1914 möglich gewesen ist‘, etc.? Dachten nicht auch Marx und Engels zu ihrer Zeit, dass ‚die Revolution objektiv möglich war‘? Erinnert Euch an die Kategorien der Dialektik: Möglichkeit und Wirklichkeit, Notwendigkeit und Eventualität! Wie wir wissen, ist es notwendig, zwischen der abstrakten (formellen) und der praktischen (konkreten) Möglichkeit zu unterscheiden. Eine abstrakte Möglichkeit ist durch die Abwesenheit der Haupthindernisse für die im Werden begriffenen Ziele gekennzeichnet, wobei hingegen alle notwendigen Bedingungen für ihre Verwirklichung vorhanden sind. Eine praktische Möglichkeit besitzt alle Bedingungen, die für ihre Verwirklichung notwendig sind: Latent vorhanden, wird sie unter bestimmten Umständen zur neuen Wirklichkeit. Der Wandel dieser Bedingungen in ihrer Gesamtheit bestimmt den Übergang von der abstrakten zur praktischen Möglichkeit, und Letztere verwandelt sich in die Wirklichkeit. Das numerische Maß der Möglichkeit wird ausgedrückt durch den Begriff der Wahrscheinlichkeit. Die Notwendigkeit ist, wie wir wissen, die Art und Weise der Umwandlung der Möglichkeit in Wirklichkeit, wobei es nur eine einzige Möglichkeit für ein bestimmtes Ziel gibt, die Wirklichkeit werden kann. Und die Eventualität ist im Gegensatz dazu die Art und Weise der Umwandlung der Möglichkeit in Realität, bei der es mehrere, verschiedene Möglichkeiten für ein bestimmtes Ziel (unter bestimmten Umständen natürlich) gibt, die Wirklichkeit werden können, aber nur eine, die tatsächlich verwirklicht wird.“ (15. März)
Wir begreifen nicht, wie man sagen kann, dass die Errichtung des Sozialismus in einem Land sowohl möglich als auch, da er in keiner Weise mit dem Kapitalismus bricht, unmöglich ist. Wir ziehen es vor, der Behauptung beizupflichten, dass der Sozialismus in einem Land eine Mystifikation war, die in keiner Beziehung zur Realität stand, eine Waffe der Konterrevolution. Was die Genossen anscheinend sagen, ist, dass die Bolschewiki an einem bestimmten Punkt aufhörten, die Interessen des Proletariats zu vertreten. Dies war in der Tat die stalinistische Konterrevolution. Die ganze Schwierigkeit bei diesem Problem, mit dem viele Revolutionäre seit den 30er Jahren zu kämpfen hatten, besteht darin, dass die Konterrevolution erst ganz am Ende eines Prozesses der Degeneration und des opportunistischen Abgleitens kam. Am Ende dieses langen und manchmal unmerklichen Prozesses fand dann gewissermaßen ein Umschlagen von Quantität in Qualität statt. Was zunächst nicht mehr als ein Problem innerhalb der Arbeiterbewegung dargestellt hatte, wuchs sich zur bürgerlichen Konterrevolution aus. Doch der Bruch in der Natur des Sowjetregimes war dafür um so deutlicher: Er fand statt in Gestalt der Eliminierung der alten bolschewistischen Garde durch Stalin, der Ersetzung der Perspektive der Weltrevolution durch die Verteidigung des nationalen Kapitals Russlands. Die Schwächung der Macht der Arbeiterräte und die Untergrabung der Führung der bolschewistischen Partei durch den Opportunismus folgten zwei parallelen Wegen zur Etablierung der Macht der russischen Staatsbourgeoisie. Die Erinnerung an die wahre Bewegung der Klassenkonfrontationen in den 1920er Jahren rüstet uns nicht nur gegen die bürgerliche Propaganda, sondern auch gegen jede Schwächung der revolutionären Theorie, wie jene, die, objektiv oder subjektiv, eine Kontinuität zwischen Lenin und Stalin sieht.
Die Genossen werden letztendlich eine solche Schwächung erleiden, wenn sie die stalinistische Konterrevolution aus dem Blick verlieren und die Idee einführen, dass „die Bolschewiki entschieden, für alle Ausgebeuteten zu sprechen“. Wann und warum wurde eine solche Entscheidung getroffen? Bedeuten die Worte „alle Ausgebeuteten“ alle Arbeitenden, mit anderen Worten: neben dem Proletariat verschiedene andere Klassen, einschließlich der nicht-ausbeutenden Klassen wie die Bauernschaft und den Rest des Kleinbürgertums, die im Kapitalismus ausgebeutet werden? Wenn dies der Fall ist, dann akzeptieren sie das Gerede von Stalin und besonders von Mao über den „Block der vier Klassen“ als Realität. Jedenfalls können wir ihrer Behauptung nicht folgen, dass Marx und Engels das Konzept einer sozialistischen Revolution akzeptiert (?) hatten, die „in Wirklichkeit nicht mit dem Kapitalismus bricht“. Es trifft zu, dass einige Formulierungen von Marx und Engels zu Verwechslungen zwischen der Verstaatlichung des Kapitalismus und dem Sozialismus führen können. Damals sind sie ohne weiteres verstanden worden, in einer Epoche, als das Proletariat unter bestimmten Umständen die progressive Bourgeoisie noch gegen die Überbleibsel des Feudalismus unterstützte. Bewusstsein und Programm sind das Resultat einer ständigen Auseinandersetzung mit der Ideologie der herrschenden Klasse. Wenn Revolutionäre die Buchstaben des Programms schärfen, präziser machen wollen, müssen sie getreu dem Geist der früheren Generationen von Marxisten vorgehen. Die endgültige Korrektur der überlebenden „staatskapitalistischen“ Irrtümer in der marxistischen Doktrin wurde durch die Erfahrung der Russischen Revolution von 1917 ermöglicht. Doch die Voraussetzungen dafür waren schon bei Marx vorhanden, in seiner Definition des Kapitals als ein gesellschaftliches Verhältnis und des Kapitalismus als ein auf Lohnarbeit, Auspressung und Realisierung von Mehrwert gegründetes System. So gesehen, verändert der Übergang von individuellem Kapitaleigentum zu kollektivem Staatseigentum keineswegs den Charakter der Gesellschaft. Mehr noch, der Keim ihrer Kritik am angeblich progressiven Charakter des kollektiven Staatseigentums ist bereits im Kampf von Marx und Engels gegen den Lassalleschen Staatssozialismus enthalten, der die Arbeiter dazu bringen wollte, den Staat gegen die Kapitalisten und gegen die Liebknecht/Bebel-Strömung innerhalb der deutschen Sozialdemokratie zu nutzen, die es ihrerseits zugelassen hatte, dass die Formulierungen der Lassalleaner in das Gothaer Programm rutschten.
Wir möchten die Gedanken der Genossen folgendermaßen zusammenfassen. Der Bolschewismus sei zunächst eine marxistische Strömung gewesen, die die Interessen des Proletariats im Rahmen der entwickelten kapitalistischen Verhältnisse ausgedrückt habe. Aber diese seien ursprünglich ausländischer Herkunft gewesen, während innerhalb Russlands ein weniger entwickelter Kapitalismus existiert habe, der einer antifeudalen Revolution bedurfte. Somit seien die Bolschewiki nicht der stalinistischen Konterrevolution, sondern bereits zuvor dem Charme des nationalen Kapitals erlegen gewesen und hätten beschlossen, „Sozial-Jakobiner“ zu werden. Hier wird der Unterschied zwischen ihrer Vision und jener des Rätekommunismus ersichtlich. Für Letztere konnte die Russische Revolution nur im Staatskapitalismus enden, und die Bolschewiki waren eine Widerspiegelung dieses von Anbeginn vorbestimmten Schicksals. Diese Entdeckung kam spät, denn sie datiert in den 1930er Jahren, als es Pannekoek, der damals zum Rätekommunisten wurde, in einem Gewaltakt gelang, die Erbsünde des Bolschewismus in Lenins Buch von 1908 Materialismus und Empiriokritizismus zu enthüllen. „Es ist eine so deutliche und ausschliessliche Widerspiegelung des oben angegebenen Charakters der erstrebten russischen Revolution, seine Grundgedanken stimmen so völlig mit denen des bürgerlichen Materialismus überein, dass, hätte man es damals gekannt (...) (im Westen) und wäre man damals imstande gewesen, es richtig zu interpretieren, man hätte voraussagen können, dass die kommende russische Revolution den Charakter einer bürgerlichen Revolution tragen und in irgendeinen sich auf die Arbeiter stützenden Kapitalismus ausmünden müsse.“ (Pannekoek, Lenin als Philosoph, Ca ira – Verlag 1991, S. 142/143)
Die marxistische Methode basiert auf dem Konzept als Ganzes, woraus sie ihr Verständnis auch für die konkreteren Situationen schöpft. Indem sie vom kleinen, unabhängigen Produzenten bzw. von einer lokalen Situation ausgehen, entfernen sich die Genossen von der marxistischen Methode und enden darin, ein paar Überbleibsel des Feudalismus fälschlicherweise als allgemeine Merkmale darzustellen. Es ist angebracht, sich daran zu erinnern, dass Russland 1917 die fünftgrößte Industrienation der Welt war. Dadurch, dass die Entwicklung des russischen Kapitalismus die Stufe der Handwerksproduktion und der Manufakturen größtenteils übersprungen hatte, nahm der russische Kapitalismus die modernste und konzentrierteste Form an: Die Putilow-Fabrik z.B. mit mehr als 40.000 Arbeitern war die weltweit größte. Es ist diese Entwicklung, die den Schlüssel zum Verständnis der Lage in Russland vermittelt, nicht der Gegensatz zwischen dem von Außen und dem von Innen kommenden Kapitalismus. Die Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse hatten einen Punkt erreicht, der nichts gemeinsam hatte mit der Epoche der bürgerlichen Revolutionen des 17. und 18. Jahrhunderts. „Russlands staatlicher Apparat wird seit dem famosen Zusammenbruch im Krimkriege und seit seiner Modernisierung durch die Reformen Alexanders II. in hohem Maße durch geliehenes Kapital aus Europa, in der Hauptsache aus Frankreich, bestritten (...) Das geliehene französische Kapital dient seit Jahrzehnten in der Hauptsache zu zwei Zwecken: Eisenbahnbau mit Staatsgarantien und Militärrüstungen. Zur Bedienung beider ist in Russland seit den siebziger Jahren – unter dem Schutze des Hochschutzzollsystems – eine starke Großindustrie entstanden. Das Leihkapital aus dem alten kapitalistischen Lande Frankreich hat in Russland einen jungen Kapitalismus großgezogen, der aber seinerseits nachhaltig der Unterstützung und Ergänzung durch eine bedeutende Einfuhr an Maschinen und anderen Produktionsmitteln aus technischen führenden Ländern, England und Frankreich, bedarf.“ (Rosa Luxemburg, Einführung in die Nationalökonomie, Ges. Werke, Bd. 5, S. 553) Das Beispiel Polens ist gleichermaßen bedeutend. Die Bildung des Weltmarktes ist ein Hauptmerkmal der kapitalistischen Produktionsweise, er zerstört die vorkapitalistischen Verhältnisse. Es ist dieser dynamische Prozess, der die Bedingungen für die Einheit des internationalen Proletariats schafft, nicht die autonome Entwicklung eines nationalen Kapitals. Die Revolution von 1905 war die erste praktische Demonstration dieses Prozesses. Im Gegensatz dazu hat die Losung des „Rechts der Völker auf Selbstbestimmung“, die die Bolschewiki tragischerweise unterstützten, die Spaltung des Proletariats nur verstärkt. Wurde dies nicht in der Praxis der 1920er Jahre bestätigt?
Die Dekadenz eines gesellschaftlichen Gebildes
Weder die Bolschewiki noch irgendeine moderne Bourgeoisie können mit den Jakobinern verglichen werden. Das Ende der Weltmarktbildung und die Überproduktionskrise haben die Möglichkeit jeder wirklichen Weiterentwicklung eliminiert. Die tschetschenische Bourgeoisie wird niemals ein nationales Proletariat schaffen. Wo würde sie einen Absatz für ihre Waren finden? Nur die proletarische Revolution kann die Fundamente für eine Industrialisierung der rückständigen Länder legen. Das Kommunistische Manifest beschreibt sehr gut, wie die Bourgeoisie eine Welt nach ihrem eigenen Bild schafft, indem sie billige Waren exportiert und ihre Warenbeziehungen immer weiter ausdehnt. Doch lange, bevor der gesamte Planet industrialisiert ist, erreicht sie ihre Grenzen. Schon Marx und Engels hatten aufgezeigt, wie die unlösbaren Widersprüche, die den Verhältnissen der Lohnarbeit entspringen, den Kapitalismus nur in seine Dekadenz führen können. Charles Fouriers eindringliche Kritik hat bereits die Grundzüge dieses Gedankens angedeutet: „Fourier, wie man sieht, handhabt die Dialektik mit derselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse Hegel. Mit gleicher Dialektik hebt er hervor, gegenüber dem Gerede von der unbegrenzten menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit, dass jede geschichtliche Phase ihren aufsteigenden, aber auch ihren absteigenden Ast hat, und wendet diese Anschauungsweise auch auf die Zukunft der gesamten Menschheit an.“ (Engels, Anti-Dühring, MEW, Bd. 20, S. 243) Marx erklärt dieses Phänomen. In einem bestimmten Moment in der Entwicklung des Kapitalismus kann die Tendenz der fallenden Profitrate aufgrund des gesättigten Weltmarktes nicht mehr durch ein entsprechendes Wachstum des Mehrwerts kompensiert werden. „Aber in demselben Maße, worin seine (des Kapitalisten Produktion sich ausgedehnt hat, hat sich das Bedürfnis des Absatzes für ihn ausgedehnt. Die mächtigeren und kostspieligeren Produktionsmittel, die er ins Leben gerufen, befähigen ihn zwar, seine Ware wohlfeiler zu verkaufen, sie zwingen ihn aber zugleich, mehr Waren zu verkaufen, einen ungleich größeren Markt für seine Waren zu erobern (S. 418). (...) In dem Maße endlich, wie die Kapitalisten durch die oben geschilderte Bewegung gezwungen werden, schon vorhandne riesenhafte Produktionsmittel auf größerer Stufenleiter auszubeuten und zu diesem Zweck alle Springfedern des Kredits in Bewegung zu setzen, in demselben Maße vermehren sich die industriellen Erdbeben, worin die Handelswelt sich nur dadurch erhält, dass sie einen Teil des Reichtums, der Produkte und selbst der Produktionskräfte den Göttern der Unterwelt opfert - nehmen mit einem Wort die Krisen zu. Sie werden häufiger und heftiger schon deswegen, weil in demselben Maße, worin die Produktenmasse, also das Bedürfnis nach ausgedehnten Märkten wächst, der Weltmarkt immer mehr sich zusammenzieht, immer weniger neue Märkte zur Exploitation übrigbleiben, da jede vorhergehende Krise einen bisher uneroberten oder vom Handel nur oberflächlich ausgebeuteten Markt dem Welthandel unterworfen hat.“ (Lohnarbeit und Kapital, MEW Bd. 6, S. 423) Es blieb den linken Fraktionen, mit Lenin und Luxemburg an der Spitze, vorbehalten, aufzuzeigen, dass der Ausbruch des ersten imperialistischen Weltkrieges das Zeichen dafür war, dass der Kapitalismus in die Phase seines Zerfalls eingetreten war. Die kommunistische Revolution war nicht mehr nur notwendig, sie war auch möglich geworden.
Zum Schluss dieser ersten Antwort auf die Genossen der MLP rufen wir zur Weiterentwicklung der Debatte und Reflexion auf, wobei es uns Leid tut, dass wir nicht in der Lage gewesen waren, ihre Texte aus dem Russischen zu übersetzen.
Wir hoffen, dass die Diskussion und gegenseitige Kritik fortgesetzt werden. Doch wir möchten auch darauf drängen, dass diese Debatte nicht auf uns selbst begrenzt sein darf: Sie sollte sich öffnen und andere Genossen in Russland sowie Gruppen des politischen Milieus des Proletariats auf der ganzen Welt einschließen.
Pal
[1] [54] Seit Mai ‚68 ist der Begriff „Linksextremismus“ allgemein gebräuchlich geworden, nicht um die Opposition innerhalb der Kommunistischen Internationale zu beschreiben, die Lenin brüderlich kritisierte und die der Ausdruck des Linkskommunismus war, sondern um all jene außerparlamentarischen Strömungen zu benennen, die, wie die Trotzkisten und die Maoisten (hierbei sollten wir zwischen den „Maoisten“ der westlichen Länder, die wir als „Linksextremisten“ bezeichnen, und Mao selbst unterscheiden, der, indem er die Theorie einer Art von „bäuerlichen Nationalkommunismus“ schuf, nichts mit der Arbeiterbewegung zu tun gehabt hatte. Er war eher eine „orientale“ Version des Stalinismus), Verrat am Internationalismus begingen und die Parteien der bürgerlichen Linken (Sozialisten und Stalinisten) sowie die Gewerkschaften kritisch unterstützen. Er ist daher ein Begriff, um eine politische Tendenz zu beschreiben, die eindeutig dem politischen Apparat der Bourgeoisie angehört.
[2] [54] Diese Korrespondenz war ursprünglich auf Französisch verfasst. Die Übersetzungen sind von uns, und wir haben natürlich unser Bestes gegeben, um die Meinungen der Genossen nicht zu verfälschen.
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Internationale Revue 28
- 2788 Aufrufe
14. Kongress der IKS
- 3185 Aufrufe
Bericht über die Wirtschaftskrise (Auszüge)
Vor über 80 Jahren ist der Kapitalismus in seine dekadente Phase getreten. Er überlebt einzig noch dadurch, dass er die Menschheit in eine Spirale der offenen Krise wirft. Diese Spirale setzt sich aus dem generalisierten Krieg, dem Wiederaufbau, und der erneuten Krise zusammen.1 Die wirtschaftliche Stagnation und die Erschütterungen des Systems im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts mündeten schnell in die schreckliche Schlächterei des Ersten Weltkriegs, die grosse Depression von 1929 mündete nach 10 Jahren in das noch wildere Gemetzel des Zweiten Weltkriegs. Die am Ende der 60er Jahre beginnende Krise jedoch mündete nicht in die organische Lösung eines neuen generalisierten Kriegs, weil das Proletariat nicht geschlagen war.
Angesichts dieser neuartigen Situation der ausweglosen Krise führt der Kapitalismus ein ständiges Krisenmanagement. Für dessen Umsetzung nahm er Rückgriff auf sein erstrangiges Organ zur Verteidigung seines Systems: den Staat. Auch wenn die Tendenz zum Staatskapitalismus sich bereits vor mehreren Jahrzehnten herausgebildet hatte, so haben wir in den letzten 30 Jahren der Perfektionierung und einer bisher unbekannten Verfeinerung der Interventionsmechanismen und der Kontrolle der Wirtschaft und Gesellschaft beiwohnen können. Zur Begleitung der Krise mit dem Ziel, ihren Rhythmus im Vergleich zu 1929 zu verlangsamen und weniger spektakulär zu gestalten, haben die Staaten sich in eine astronomische Verschuldung gestürzt, wie sie die Geschichte bisher noch nie gesehen hat. Die wichtigsten Mächte haben mit einer Zusammenarbeit zur Unterstützung und Organisierung des Welthandels begonnen, um die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf die schwächsten Länder abzuwälzen.2 Dieser Überlebensmechanismus erlaubte es den zentralen Ländern, die auch eine Schlüsselstellung bezüglich des Klassenkampfes einerseits, bezüglich der Aufrechterhaltung der globalen Stabilität des Kapitalismus anderseits einnehmen, einen verlangsamten und stufenweisen Fall in die Krise zu bewerkstelligen. So entstand der Eindruck der Beherrschung und der Normalität oder sogar des "Fortschritts" oder der "Erneuerung".
Diese Begleitmaßnahmen führten jedoch keineswegs zu einer Stabilisierung der Situation. Der Kapitalismus ist seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts ein globales System, das allen bedeutenden Gebieten dieses Planeten seine Produktionsbeziehungen aufgezwungen hat. Unter diesen Bedingungen kann das Überleben eines nationalen Kapitals oder von Zusammenschlüssen derselben nur auf Kosten der Rivalen gehen. Im Laufe der letzten 30 Jahre konnten wir einer fortschreitenden Degeneration des Kapitalismus beiwohnen. Seine Reproduktion vollzog sich auf einer sich ständig verengenden Grundlage, das Weltkapital verarmt.3
Dieser fortschreitende Zusammenbruch des Gesamtkapitals hat sich durch periodische Erschütterungen manifestiert, die in keiner Art und Weise etwas mit den zyklischen Krisen des 19. Jahrhunderts gemeinsam haben. Diese Erschütterungen zeigten sich in den mehr oder weniger starken Rezessionen von 1974/75, 1980-1982 und 1991-1993. Jedoch drückte sich die Rezession nicht in erster Linie durch den offiziellen Fall des Produktionsindex aus, und zwar gerade weil der Staatskapitalismus alles in seiner Möglichkeit Liegende unternimmt, um dieses zu klassische und offensichtliche Zeichen des Systemzusammenbruchs zu unterbinden. Die Rezession hat sich also tendenziell in anderen, nicht weniger schwerwiegenden und gefährlichen Formen dargestellt. Hier sind zu nennen: die monetären Erschütterungen des britischen Pfund Sterling 1967 und des Dollar 1971, die brüske inflationäre Explosion in den 70er Jahren, die Schuldenkrise und die Erschütterungen des Finanzsektors ab der zweiten Hälfte der 80er Jahre: Börsenkrach 1987, Mini-Börsenkrach 1989, die Erschütterung des europäischen Währungssystems 1992/93, der Tequila-Effekt (Abwertung des mexikanischen Peso und Fall der lateinamerikanischen Börsen) 1994 und die sog. Asienkrise 1997/98.
Der 13. Kongress der IKS hatte die schwerwiegenden Schäden dieser letzten Episode der Krise analysiert. Damals hatten wir die äußerst pessimistischen Warnungen der bürgerlichen Experten einbezogen, die offen von Rezession und sogar Depression gesprochen hatten.
Diese Rezession ist dann allerdings nicht eingetroffen und der Kapitalismus konnte abermals das Jubellied über die eiserne Gesundheit seiner Produktionsweise anstimmen. Die Dreistigkeit ging bis zur Behauptung, eine neue Gesellschaft sei mit der „New Economy“ entstanden. Der Anstieg der Inflation im Sommer 2000, dessen Tragweite und Auswirkungen nicht unterschätzt werden dürfen, hat die generelle Euphorie dann allerdings ein wenig verstummen lassen. In etwas mehr als zwei Jahren konnten wir dem brutalen Einbruch von 1997/98, dem euphorischen Aufschwung zwischen der zweiten Jahreshälfte 1999 und dem Sommer 2000 und dem erneuten Rückgang des Index beiwohnen.
Das neue Jahrtausend wird der Krise keine Lösung mehr anbieten können ausser der Stabilisierung der Situation, wenn nicht gar im Gegenteil eine neue Phase des Zusammenbruchs, der uns all die Leiden des 20. Jahrhunderts als Zuckerschleck erscheinen lässt.
10 Jahre ununterbrochenes Wachstum in den USA
Die Bewunderer des Kapitalismus geifern schon nur bei der Erwähnung dieser "10 Jahre Wachstum ohne Inflation".4 In ihrem Delirium sind sie sogar soweit gegangen, das Ende aller zyklischen Krisen und ein ununterbrochenes Wachstum vorauszusagen.
Diese Herren geben sich erst gar nicht Mühe, die Wachstumsraten anderer Epochen des Kapitalismus zu vergleichen, und noch weniger, seine Natur und Zusammensetzung zu verstehen. Sie sind vollständig mit dem "Wachstum" zufrieden. Aber angesichts dieser unmittelbaren und oberflächlichen Betrachtungsweise, die ja typisch ist für die Ideologen einer dem Untergang geweihten Gesellschaftsordnung, wenden wir eine globale und historische Betrachtungsweise an und sind somit in der Lage, die Falschheit all dieser Argumente, die sich auf die "10 Jahre ununterbrochenen Wachstums in den USA" stützen, zu entlarven.
Wenn wir die Wachstumsraten der USA seit 1950 unter die Lupe nehmen, stellen wir fest, dass das Wachstums der vergangenen 10 Jahre das geringste der letzten 50 Jahre ist:
Mittlere BIP-Wachstumsraten der USA5
1950-1964 3,68%
1965-1972 4,23%
1973-1990 3,40%
1991-1999 1,98%
Diese Zahlen sehen auch in anderen hochindustrialisierten Ländern nicht anders aus:
Mittlere BIP-Wachstumsraten in den wichtigen Industrieländern6
1960-73 1973-89 1989-99
Japan 9,2% 3,6% 1,8%
Deutschland 4,2% 2,0% 2,2%
Frankreich 5,3% 2,4% 1,8%
Italien 5,2% 2,8% 1,5%
Großbritannien 3,1% 2,0% 1,7%
Kanada 5,3% 3,4% 1,9%
Diese beiden Tabellen zeigen den graduellen, aber anhaltenden Niedergang der Weltwirtschaft, der den Triumphalismus der Führer des Kapitalismus in nichts auflöst und ihre Täuschungsmanöver entblößt: sie wollen uns mit Zahlen täuschen, die vollständig aus ihrem historischen Kontext herausgelöst worden sind.
Das "amerikanische Wachstum" hat tatsächlich eine Geschichte, die uns aber vorenthalten wird: Man spricht nicht darüber, wie die Wiederankurbelung der Wirtschaft 1991/92 zustande kam. Es mussten nämlich 33 Mal die Zinsen gesenkt werden, so dass die Zinsraten für das an Banken geliehene Geld unter der Inflationsrate lag! Der Staat hat also eigentlich "Gratisgeld" zur Verfügung gestellt. Man spricht noch weniger über das ab 1995 abflauende Wachstum, das mehrere Finanzkrisen mit der "asiatischen Grippe" 1997/98 als Tiefpunkt nach sich zog und in die Stagnation 1996-1998 mündete.
Was steckt jedoch hinter der letzten Wachstumsphase von 1996-1998? Ihre Grundlage ist noch verletzlicher und zerstörerischer, denn ihr Motor verwandelt sich in eine historisch gesehen beispiellose spekulative Blase. Die Investition an der Börse wird die "einzig rentable Investition".
Die amerikanischen Familien und Unternehmen wurden in einem perversen Mechanismus zur Verschuldung ermutigt, um an der Börse zu spekulieren und die gekauften Titel als Sicherheiten für den frenetischen Kauf von Waren und Dienstleistungen zu gebrauchen, was dann den Motor des Wachstums darstellte. Die Grundlagen der eigentlichen Investitionen sind so ernsthaft zerstört worden: Unternehmen und Individuen haben ihre Verschuldung von 1997 bis 1999 um 300% gesteigert. Die Sparquote ist seit 1996 negativ (nach 53 Jahren von ununterbrochen positiven Sparquoten), während sie 1991 noch +8,3% betrug, sank sie 1999 auf -2,5%.
Der Konsum auf Pump erhält zwar die Wachstumsflamme in Gang, aber die Auswirkungen auf der produktiven Ebene der USA sind tödllich.7 Paul Samuelson, ein bekannter Ökonom, räumt ein, dass "die Auslastung der industriellen Produktionskapazitäten Nordamerikas seit ihrem Gipfel in der Mitte der 80er Jahre nur noch gefallen ist". Die Industrie verliert immer mehr an Bedeutung, seit April 1998 sind 418‘000 Stellen gestrichen worden. Die amerikanische Zahlungsbilanz erlitt mit der Vergrösserung des Defizits von -2,5% des BIP 1998 auf aktuell -4% eine spektakuläre Verschlechterung.
Diese Art des Wachstums steht in krassem Gegensatz zu demjenigen, das der Kapitalismus, historisch betrachtet, erlebt hat. Zwischen 1865 und 1914 erzielten die USA mit der ständigen Erhöhung der Handels- und Finanzüberschüsse ein spektakuläres Wachstum. Die amerikanische Expansion nach dem Zweiten Weltkrieg beruhte auf der Überlegenheit im Export von Gütern und Kapital. 1948 beispielsweise deckten die amerikanischen Exporte 180% der Importe. Seit 1971 erzielten die USA erstmals eine negative Handelsbilanz, die seither ständig gewachsen ist.
Während sich das Wachstum der zentralen kapitalistischen Länder im 19. Jahrhundert auf die Exportzunahme an Gütern und Kapital abstützte, was zu einer ständigen Eingliederung von neuen Gebieten in die kapitalistischen Produktionsverhältnisse führte, wohnen wir heute einer aberwitzigen und gefährlichen Entwicklung bei: Heute fliessen, unterstützt durch den überbewerteten Dollar, die Reichtümer in die USA, um die wichtigste Nationalökonomie der Welt zu unterstützen. Seit 1985 ist der Investitionsfluss in die 10 wichtigsten Nationalökonomien der Welt größer als umgekehrt. Das bedeutet konkret, dass der Kapitalismus unfähig ist, die globale Produktion auszudehnen und nun all seine Mittel auf die Erhaltung der Metropolen konzentriert. Der Rest der Welt wird zu einer riesigen Brachlandschaft degradiert, und somit werden die Grundlagen der kapitalistischen Reproduktion zerstört.
Die nicht eingetretene Rezession nach der Asienkrise
Man möchte uns glauben machen, dass die schwerwiegende Erschütterung von 1997/98 nichts als eine zyklische Krise gleich jenen des 19. Jahrhunderts gewesen sei. Zu jener Zeit ist aber jede Krise mit einer neuen Produktionsausdehnung zu Ende gegangen, so dass immer ein höheres Produktionsniveau als in der vorhergegangenen Periode erreicht wurde. Neue Märkte öffneten sich durch die Eingliederung neuer Territorien in die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. So entstanden einerseits neue Proletariermassen, die Mehrwert hervorbrachten, anderseits neue zahlungskräftige Käufer für die hergestellten Waren.
Eine solche Lösung ist für den heutigen Kapitalismus nicht mehr angesagt: Die Märkte sind bereits seit längerer Zeit gesättigt. Der Ausweg kann also nicht in neuen Märkten und in neuen Lohnarbeit verrichtenden Proletariermassen liegen, sondern gerade im Gegenteil: Heute greift man zur Verschuldung und versucht so, den realen Fall der Produktion und die neuen Entlassungswellen (die uns dann als Restrukturierungen, Privatisierungen und Fusionen untergejubelt werden) zu kaschieren. Auf diese Weise werden die Quellen des Mehrwerts ausgetrocknet: „Das Fehlen kaufkräftiger Märkte, auf denen die Realisierung des produzierten Mehrwerts möglich ist, führte zur Bildung fiktiver Märkte (...) Mit einem komplett gesättigten Weltmarkt konfrontiert kann ein Wachstum der Produktionszahlen nur durch ein Wachstum der Schulden stattfinden. Eine noch beträchtlichere Zuspitzung als zuvor.“ (Internationale Revue Nr. 59, engl./frz./span. Ausgabe)
Das Resultat ist eine ständig gewaltsamere Erschütterung und ein tieferer Fall während die Aufschwünge lediglich den Fall leicht abfedern: Der ganze Prozess spielt sich in einer Dynamik des progressiven Zerfalls ab.
Im 19. Jahrhundert befand sich der Kapitalismus in einer dynamischen Expansionsphase, in der jede Krise eine neue Prosperitätsphase vorbereitete. Heute beobachten wir den genau umgekehrten Prozess: Jede Aufschwungsphase ist nichts anderes als die Vorbereitung neuer und schwerwiegenderer Erschütterungen.
Japan (die zweite Weltwirtschaftsmacht) ist ein schlagender Beweis. Dieses Land bewegt sich nicht mehr vom Fleck und erreichte 1999 eine rachitische Wachstumsrate von 0,3%. Die Perspektiven für das Jahr 2000 sind sehr pessimistisch. Und dies trotz einer spektakulären Entwicklung der Staatsausgaben: Das Staatsdefizit erreichte 1999 9,2% des BIP.
Die “New Economy”
Die Argumente über das „enorme Wachstum“ in Amerika und die „spielende Überwindung der Asienkrise“ entbehren jeglicher seriösen Analyse. Doch ein drittes Argument scheint mehr Bestand zu haben: „die Revolution der New Economy“, welche die Fundamente der Gesellschaft komplett umwälzen und durch das Internet die traditionelle Aufteilung der Gesellschaft in Klassen (Arbeiter und Unternehmer) auflösen werde, sie zu einer Masse von „Partnern“ mache. Mit anderen Worten, der Motor der Wirtschaft sei nicht mehr die Anhäufung von Profit, sondern der Konsum und die Information. Schlussendlich werde die Krise zu einem alten Hut aus vergangenen Zeiten, da sich die Weltwirtschaft harmonisch durch die Transaktionen via Internet reguliere. Das einzige Problem seien die „Unangepassten“ die noch in der „alten Ökonomie“ verharren würden.
Es ist hier nicht der Ort, um erneut all diese stupiden Behauptungen aufzulisten. Der erste Artikel in der Internationalen Revue Nr. 26 entlarvte schon auf überzeugende Art und Weise diesen neuen Mythos mit dem uns der Kapitalismus einlullen will.8
Zuerst sollten wir uns an die Geschichte erinnern: Wie oft schon in den letzten siebzig Jahren hat uns der Kapitalismus ein ökonomisches „Modell“ als endgültige Lösung verkaufen wollen? In den 30er Jahren präsentierten sich die sowjetische Industrialisierung, der amerikanische New Deal und der belgische DeMan-Plan als Lösung gegen die Krise von 1929 - sie führten aber in Wirklichkeit zum Zweiten Weltkrieg! Es waren der „Wohlfahrtsstaat“ der 50er, der „Aufschwung“ der 60er Jahre, die verschiedenen „Wege zum Sozialismus“ und die „Rückkehr zu Keynes“ in den 70er Jahren, die „Reagonomics“ und das „japanische Modell“ der 80er Jahre, die „asiatischen Tiger“ und die „Globalisierung“ der 90er Jahre - heute ist es die „New Economy“. Der Sturm der Krise hat sie alle nacheinander hinweggefegt. Schon ein Jahr nach ihrer Geburt ist die „New Economy“ veraltet und unbrauchbar.
Zweitens wurde die Lüge portiert, dass die „New Economy“, basierend auf dem Internet, sehr viele Arbeitsplätze schaffen würde. Dies ist ein kompletter Irrtum. Der oben zitierte Artikel von Battaglia comunista (Fussnote 5) zeigt auf, dass von den 20 Millionen geschaffenen Arbeitsplätzen in den USA lediglich eine Million mit dem Internet zusammenhängen. Der Rest besteht aus „High-Tech-Jobs“ wie Hundeausführen, Parkplatzbewachung, Pizza- und Hamburgerkurieren, Babysittern usw.
In Wirklichkeit eliminiert die Einführung des Internet in Handel, Information, Finanz und öffentlicher Verwaltung Arbeitsplätze statt neue zu schaffen. Eine Studie über Bankinstitute der „New Economy“ zeigt, dass:
- ein Netz von Büros, die Computer ohne permanente Verbindung einsetzen9, 100 Angestellte;
- ein Netz von Büros mit permanent verbundenen Computern nur noch 40 Angestellte;
- ein Telebanking-Netz 25 Angestellte;
- ein Internet-Banking-Netz schließlich gerade noch 3 Angestellte beschäftigt.
Eine andere Studie der EU kommt zum Schluss, dass das Ausfüllen von Formularen via Internet einen Drittel der Arbeitsplätze in der öffentlichen Verwaltung überflüssig machen kann.
Ist es möglich, dass das Internet die Basis für eine Ausweitung der kapitalistischen Produktion bildet?
Der Zyklus des Kapitals kennt zwei untrennbare Stufen: die Mehrwertproduktion und ihre Realisierung. In der dekadenten Phase des Kapitalismus, mit einem gesättigten Markt, wird die Realisierung des Mehrwerts zum Hauptproblem. In diesem Rahmen nehmen die Kosten für Absatz, Verteilung und Finanzierung, welche zur Realisierung des Mehrwerts gehören, enorme Proportionen an. Die Unternehmen und Staaten entwickeln einen gigantischen Apparat für Absatz, Werbung, Finanzierung usw., um aus dem noch existierenden Markt die letzten Tropfen auszupressen (Tricks zur künstlichen Vergrößerung des Konsums) und den Konkurrenten Marktsegmente abspenstig zu machen.
Zu diesen notwendigen Kosten für die Realisierung des Mehrwerts kommen jedoch weitere hinzu, die eine noch größere Dimension annehmen: die Aufrüstung, der Aufbau einer gigantischen staatlichen Bürokratie usw. Die Einführung des Internet versucht, das enorme Gewicht dieser Kosten so weit als möglich zu senken, doch für die Wirtschaft als Ganze, vom Gesichtpunkt des Gesamtkapitals aus betrachtet, kann sich der Markt nicht erweitern. Er erfährt nur eine erneute Reduktion, die Menge der zahlungskräftigen Käufer nimmt ab.
Weit entfernt davon, Gesundheit und Fortschritt des Kapitalismus darzustellen, ist die ganze Geschichte mit dem Internet Ausdruck der tödlichen Spirale, in der er sich befindet: Der Rückgang eines kaufkräftigen Marktes steigert die unproduktiven Kosten und bedeutet Schulden, was wiederum den kaufkräftigen Markt reduziert, worauf erneut die Schraube der Schulden und unproduktiven Kosten angezogen wird - und so weiter!
Das erneute Auftauchen der Inflation
Die Inflation ist eine typische Erscheinung des dekadenten Kapitalismus und fand ihren wohl spektakulärsten Ausdruck im Deutschland der 20er Jahre mit einer Entwertung der Mark von über 2000%. Nach dem gewaltigen Ausbruch der Inflation in den 70er Jahren hat der Kapitalismus 20 Jahre lang die Inflationsraten in den industrialisierten Ländern beträchtlich gesenkt. Doch wie wir bereits im Bericht für den 13. Kongress der IKS schrieben, wurde die Inflation in Wirklichkeit nur versteckt durch eine kräftige Reduktion der Kosten und ein sehr aufmerksames Vorgehen der Zentralbanken bezüglich der zirkulierenden Geldmenge. Dennoch, die Gründe für die Inflation – die gigantische Verschuldung und die unproduktiven Kosten, die notwendig sind, um das System über Wasser zu halten - sind keineswegs verschwunden, sondern nehmen immer mehr an Gewicht zu. Der neue inflationäre Druck, welcher sich seit Beginn des Jahres 2000 entwickelt, kommt also keineswegs überraschend. Die Zuspitzung der Krise, die sich seit 1995 in einer Erschütterung der Börsen ausdrückt, kann eine weitere schwerwiegende Episode durch einen Ausbruch der Inflation auslösen.
In ihrem Bericht vom Juni 2000 läutete die OECD die Alarmglocken wegen des zunehmenden inflationären Risikos, welches von der amerikanischen Wirtschaft ausgeht: „Die gerade stattgefundene Steigerung der Inlandsnachfrage ist untolerierbar, und ein inflationärer Druck wurde in letzter Zeit viel spürbarer, während das gegenwärtige Handelsdefizit scharf, nämlich auf 4% des Bruttoinlandproduktes, anstieg. Die Herausforderung für die Regierenden ist eine geordnete Reduktion der steigenden Nachfrage.“ Nachdem die Inflation in den USA 1998 einen Tiefststand erreicht hat (1,6%), wird sie laut der US-Notenbank im Jahr 2000 auf 4,5% ansteigen. Diese Tendenz wurde auch in Europa festgestellt, wo der Durchschnitt für die Euro-Zone von 1,3% 1998 auf eine Voraussage von 2,4% für das Jahr 2000 anstieg, mit Spitzen wie in Holland (erwartete 3,5%), Spanien (im September 3,6%) und Irland (wo 4,5% erreicht wurden).
Die astronomische Verschuldung, die Spekulationsblase, der sich vertiefende Graben zwischen Produktion und Konsumption und das zunehmende Gewicht der unproduktiven Kosten drängen an die Oberfläche und stellen die angebliche Gesundheit der Wirtschaft in Frage.
Die katastrophalen Auswirkungen des Krisenmanagements
Nach knapp 2 Jahren Ruhe gerät die Weltwirtschaft erneut in einen Sturm.
Der Lärm der Kampagnen über die „Gesundheit“ des Kapitalismus und die „New Economy“ ist umgekehrt proportional zur tatsächlichen Wirkung der Politik des Krisenmanagements. Die triumphalistischen Höhenflüge verdecken den immer beschränkter werdenden Handlungsspielraum der Staaten. Der wirtschaftliche, menschliche und gesellschaftliche Preis, den das Proletariat und die gesamte zukünftige Menschheit zu bezahlen haben, wird immer höher. Der Kapitalismus droht die ganze Welt durch Kriege (heute sind sie noch lokal begrenzt) und die Politik des „Krisenmanagements“ in eine Trümmerlandschaft zu verwandeln. Es drohen vor allem 3 Gefahren:
- der Zusammenbruch der Wirtschaft in immer mehr Ländern;
- ein zunehmender Prozess der Schwächung
- und Zersetzung der Ökonomie der zentralen Länder;
- Angriffe auf die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse.
Die „Organisierung“ des weltweiten Handels und der Finanzen durch die am meisten industrialisierten Länder hat die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf die peripheren Länder abgewälzt und diese in eine gigantische Brachlandschaft verwandelt. Unsere Genossen in Mexiko haben in Revolución Mundial hervorgehoben, dass „bis Ende der 60er Jahre die Länder der Peripherie vornehmlich Exporteure von Rohmaterialien waren. Doch die Tendenz ist, dass die peripheren Länder Importeure werden, selbst von Rohstoffen. Mexiko zum Beispiel, das Land des Mais, ist heute Importeur dieses Getreides. Es sind heute die zentralen Länder, welche zu Exporteuren von Rohstoffen geworden sind.“ Der Kapitalismus konzentriert sich heute dermaßen darauf, die zentralen Länder über Wasser zu halten, dass diese nun auf dem Rohstoffmarkt konkurrenzfähig sind, während es historisch eine internationale Arbeitsteilung gab, die von diesen Ländern selbst eingeführt wurde und die die Rohstoffproduktion den peripheren Ländern überließ.
Ein kürzlich verfasster Bericht der Weltbank über Afrika präsentiert ein schreckliches Bild: Afrika liefert nicht mehr als 1% des weltweiten Bruttosozialproduktes und sein Anteil am Welthandel beträgt weniger als 2%. „Während der letzten 30 Jahre hat Afrika die Hälfte seines Anteils am Weltmarkt verloren, die traditionellen Rohstoffmärkte eingeschlossen. Nur um den Anteil zu halten den es 1970 hatte, müsste es zusätzlich 70 Billionen Dollar pro Jahr mehr einnehmen.“ In Kilometern gemessen hat Afrika weniger Strassen als Polen und nur 16% davon sind asphaltiert. Weniger als 20% der Bevölkerung hat Zugriff auf elektrischen Strom, und weniger als 50% verfügen über trinkbares Wasser. Es gibt nur 10 Millionen Telefone für eine Bevölkerung von 300 Millionen Menschen. Mehr als 20% der Erwachsenen sind mit AIDS infiziert und die Arbeitslosigkeit in den großen Städten wird auf rund 25% geschätzt. Jede fünfte Person in Afrika lebt in einem Kriegsgebiet. Diese Zahlen schliessen Südafrika und die nordafrikanischen Länder mit ein, ansonsten würden die Zahlen noch schlimmer aussehen.
Diese Entfaltung der Barbarei kann nur durch die unkontrollierte Vertiefung der kapitalistischen Krise erklärt werden. So wie die Entwicklung des Kapitalismus im England des 19. Jahrhunderts die Zukunft der Welt aufzeigte, kündigt heute die Misere in Afrika die Zukunft an, die der Kapitalismus der Menschheit bereitet, wenn er nicht überwunden werden kann.10 Die Auswirkungen des „Krisenmanagements“ greifen mehr und mehr auch die Infrastruktur und Grundlage des Produktionsapartes der großen kapitalistischen Staaten an, deren Grundstrukturen immer zerbrechlicher werden.
Bürgerliche Experten geben offen zu, dass der westliche Kapitalismus eine „Risikogesellschaft“ geworden sei. Mit dieser Beschönigung verschleiern sie den beschleunigten Zerfall, dem die Transportsysteme (Luftfahrt, Eisenbahn und Straßen) unterliegen. Dies zeigt sich klar in der Zunahme von Unfällen bei Untergrundbahnen und der Eisenbahn, wie letzthin bei einer Seilbahn in Österreich, wo 150 Menschen starben.
Dasselbe spielt sich bei der öffentlichen Infrastruktur ab. Kanalisationssysteme, Dämme und Schutzvorrichtungen gegen Überschwemmungen sind immer mehr veraltet; eine Konsequenz der systematischen und zunehmenden Budgetstreichungen für deren Unterhalt. Das Ergebnis waren Überschwemmungen und andere Katastrophen in Ländern wie England, Deutschland und Holland, wo sich doch solche Ereignisse bisher vor allem auf südliche und unterentwickelte Ländern beschränkten.
Was das Gesundheitssystem angeht, so ist die Kindersterblichkeitsrate in New Yorker Quartieren wie Harlem und Brooklyn höher als in Shanghai oder Moskau. Die Lebenserwartung in diesen Gebieten beträgt 66 Jahre. In Großbritannien stellt die nationale Ärztegesellschaft in einem Bericht, der am 25. November 1996 veröffentlicht wurde, fest, dass „die Krankheiten aus der Zeit Dickens von neuem England befallen. Dies sind die typischen Armutskrankheiten wie Rachitis und Tuberkulose.“
Der Angriff auf die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse
Die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ist das wichtigste Indiz für das Voranschreiten der Krise. Wie Marx es im Kapital ausdrückte: „Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.“ (3. Band, MEW 25 S. 501) Der Angriff auf die Lebensbedingungen war in den 70er Jahren noch relativ sanft, er hat sich aber in den letzten 20 Jahren zugespitzt.11
Um die Verschuldung aufrecht zu erhalten, Ballast abzuwerfen und jedes unrentable Geschäft abzustoßen und mit diesen Mitteln den erbarmungslosen Konkurrenzkampf auszufechten, hat jedes nationale Kapital die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf die Arbeiterklasse abgewälzt: Seit den 80er Jahren ist das Leben der “privilegierten” Arbeiter der zentralen Ländern - ganz zu schweigen von der furchtbaren Lage ihrer Klassenbrüder und -schwestern in den Ländern der Dritten Welt - mit dem glühenden Eisen der Massenentlassungen gebrandmarkt worden, mit der Umwandlung der festen Anstellung in prekäre Arbeit, der Ausbreitung von schlechtest entlöhnten Stellen verbunden mit Unterbeschäftigung, der Verlängerung des Arbeitstages mithilfe von zahlreichen Schlichen wie der “35-Stunden-Woche”, der Kürzung der Renten und der Sozialhilfe, dem schwindelerregenden Anstieg der Arbeitsunfälle ...
Die Arbeitslosigkeit ist der wichtigste und zuverlässigste Maßstab der historischen Krise des Kapitalismus. Die herrschende Klasse der industrialisierten Länder ist sich der Ernsthaftigkeit des Problems bewusst und hat eine Verschleierungspolitik gegenüber der Arbeitslosigkeit entwickelt, mit der sie diese vor den Augen der Arbeiter und der ganzen Bevölkerung zu verstecken versucht. Diese Politik, die zahlreiche Arbeiter auf ein tragisches Karussell verbannt (eine prekäre Stelle, einige Monate Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung, ein Umschulungskurs, wieder einige Monate Arbeitslosigkeit etc.) und zu der sich die skandalöse Manipulation der Statistiken gesellt, erlaubt es der Bourgeoisie, in alle Windrichtungen zu verkünden, dass die “dauerhaften” Erfolge die Arbeitslosigkeit ausgerottet hätten.
Eine Studie über den Prozentsatz der Arbeitslosen unter den 25- bis 55-jährigen offenbart viel genauere Zahlen als die allgemeinen Statistiken über die Arbeitslosigkeit, die die Prozentzahlen verwässern, indem sie die Jungen, die häufig ihre Studien fortsetzen (18-25-jährige), und die frühpensionierten Arbeiter (56-65-jährige) darunter mischen:
Durchschnittliche Arbeitslosenrate bei den 25- bis 55-jährigen (1988-95)
Frankreich 11.2%
Großbritannien 13.1%
USA 14.1%
Deutschland 15.0%
In Großbritannien entwickelte sich die Zahl der Familien, bei denen alle Mitglieder arbeitslos waren, wie folgt12:
1975 6.5%
1985 15.1%
1995 19.1%
Die unmittelbare Konjunktur der letzten Monate war gekennzeichnet von einer Entlassungswelle ohnegleichen in allen produktiven Sektoren, von der Industrie über die sehr alten Handelsunternehmen wie Marks & Spencer bis zu den Dot.com-Unternehmen.
Die UNO erarbeitet einen Index mit der Bezeichnung IMA (Index der menschlichen Armut). 1998 betrug der Prozentsatz der Bevölkerung, der unter diesem IMA-Minimum lebt, in:
den USA 16,5%
Großbritannien 15,1%
Frankreich 11,9%
Italien 11,6%
Deutschland 10,4%
Die Löhne sind in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gesunken. Betrachten wir die USA allein, so ist „das durchschnittliche Wocheneinkommen – die Inflationsrate mit einberechnet – von 80% der amerikanischen Arbeiter zwischen 1973 und 1995 um 18% von 315 Dollar auf 285 Dollar pro Woche gefallen“13. Diese Zahlen wurden in den letzten fünf Jahren nochmals bestätigt: Zwischen Juli 1999 und Juni 2000 fielen die Lohnkosten in den USA um 0,8%. Der durchschnittliche Stundenlohn betrug 1973 11,5 Dollar, 1999 10 Dollar14. Die Ausbeutung nahm in den USA unerbittlich zu: Um dasselbe Einkommen zu erhalten (die Inflationsrate einberechnet), mussten die Arbeiter 1999 mehr Stunden arbeiten als 1980.
Die Grenzen des Kapitalismus
Die Überlebensstrategie des Kapitalismus hat bis heute in den zentralen Ländern eine Stabilität aufrecht erhalten können, allerdings zum Preis, dass die Situation an sich nur noch verschlimmert wurde: „Im Gegensatz zu 1929 ist die Bourgeoisie in den letzten 30 Jahren gegenüber der Krise nicht überrascht oder tatenlos gewesen, sondern hat ständig auf sie reagiert, um ihren Verlauf zu kontrollieren. Dies erklärt die lange Dauer und die erbarmungslose Vertiefung der Krise, die sich trotz aller Bemühungen der herrschenden Klasse weiter zuspitzt. (...) 1929 gab es noch keine ständige staatliche Überwachung der Wirtschaft, der Finanzmärkte und der internationalen Handelsabkommen, keine Garantieerklärungen, keine internationale Feuerwehr, um diejenigen zu retten, die in Schwierigkeiten steckten. Zwischen 1997-99 dagegen sind ganze Wirtschaften mit beträchtlicher ökonomischer und politischer Bedeutung in der kapitalistischen Welt den Bach runter gegangen trotz der Existenz all dieser staatskapitalistischen Instrumente.“ (Resolution zur internationalen Lage, 13. Kongress der IKS)
Angesichts dieser Situation ist es eine falsche, auf Hoffnungslosigkeit und kurzfristigem Denken beruhende Methode, wie besessen auf die große Rezession zu warten, in der die herrschende Klasse derart die Kontrolle verlieren würde, dass die Krise durch ihre Brutalität und die ausgelöste sichtbare Katastrophe die kapitalistische Produktionsweise in Frage stellen würde.
Wir schließen die Möglichkeit einer Rezession nicht aus. 1999-2000 brauchte der Kapitalismus, um noch atmen zu können, noch riskantere Dosen desselben Gifts, das zur Explosion von 1997-98 führte, was in nächster Zukunft noch größere Erschütterungen erwarten lässt. Doch die Tiefe der Krise lässt sich nicht am Fall der Produktionszahlen messen, sondern vielmehr - aus einem globalen und historischen Sichtwinkel - an der Zuspitzung der Widersprüche, dem sich verringernden Spielraum für Manöver und vor allem an der Verschlechterung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse.
Unsere Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus beschreibt zur Kritik der Auffassungen Trotzkis, demzufolge in der dekadenten Phase des Kapitalismus „die Produktivkräfte der Menschheit zu wachsen aufgehört haben“, folgendes: „Jede gesellschaftliche Änderung ist das Ergebnis einer langen und wirklichen Zuspitzung des Zusammenstoßes zwischen den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften. Falls wir die Hypothese eines endgültigen und ständigen Stillstandes dieser Entwicklung verteidigen, könnte nur eine „absolute“ Verschärfung der Beschränkungen, den die Produktionsverhältnisse darstellen, die Tendenz zur eindeutigen Zuspitzung dieses Widerspruchs erklären. Man kann jedoch feststellen, dass die Bewegung, die sich im allgemeinen während den verschiedenen Dekadenzzeiträumen der Geschichte (den Kapitalismus eingeschlossen) entwickelt, eher zu einer Ausdehnung der Grenzen bis zu deren „Äußersten“ neigt, als zu einem Schrumpfen derselben.“ (Die Dekadenz des Kapitalismus, Seite 18)
Ein wichtiger Teil der marxistischen Analyse zur Dekadenz von Produktionsformen ist das Verständnis über die Art und Weise, wie der Kapitalismus sein „Krisenmanagement“ betreibt, um in den zentralen Ländern die Auswirkungen möglichst begrenzt zu halten. War nicht das römische Reich gezwungen, sich aus Byzanz zurückzuziehen und weite Gebiete der Invasion der Barbaren zu überlassen? Reagierten nicht auch die feudalen Könige mit derselben despotischen Manier Angesichts des Erfolgs der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise?
„Die Befreiung der Sklaven unter dem späten römischen Reich, die Befreiung der Leibeigenen am Ende des Mittelalters, die beschränkten Freiheiten, die die im Verfall begriffene Monarchie den neuen Städten der Bourgeoisie zugestehen musste, die Verstärkung der Zentralmacht der Krone, die Ausschaltung der „Schwertadligen“ zugunsten eines „Kleideradels“, der zentralisiert, geschwächt und dem König direkt unterworfen war, ebenso die kapitalistischen Erscheinungen wie Planungsversuche, die Bemühungen der Lockerung der nationalen, wirtschaftlichen Grenzen, die Tendenz der Ersetzung der schmarotzerhaften Bourgeoisie durch „wirkungsvolle Manager“, die Angestellte der Kapitals sind, die Politik des „New-Deal“-Types und die ständigen Manipulationen bestimmter Mechanismen des Wertgesetztes, all dies beweist die Tendenz zur Ausweitung des juristischen Rahmens durch die Offenlegung der Produktionsverhältnisse. Die dialektische Bewegung kann nicht aufgehalten werden, nachdem die Gesellschaft ihren Höhepunkt erreicht hat. Diese Bewegung unterläuft einen qualitativen Wandel, aber sie endet nicht. Die Verschärfung der der Gesellschaft innewohnenden Widersprüche setzt sich notwendigerweise fort, und daher muss diese Entwicklung der gefesselten Kräfte weitergehen, selbst wenn sie sich auch noch so langsam vollzieht.“ (ebenda)
Die Entwicklung der letzten 30 Jahre stimmt vollkommen mit dieser Analyse überein. Nach mehr als 50 Jahren Überleben inmitten großer Erschütterungen hat sich der Kapitalismus auf eine Politik des Krisenmanagements zu konzentrieren, um einen brutalen Kollaps in den zentralen Ländern zu verhindern. Ein solcher Kollaps würde für den Kapitalismus wegen der sich über diese 50 Jahre angehäuften Widersprüche und vor allem angesichts eines ungeschlagenen Proletariates eine Katastrophe bedeuten.
In seinem Kampf gegen den ökonomischen Determinismus. der im Milieu der Linksopposition herrschte, verurteilte Bilan die plumpe Deformierung des Marxismus, welche behauptete: “Der produktive Mechanismus ist nicht nur die Quelle zur Bildung von Klassen, sondern bestimmt automatisch die Aktion und die Politik der Klassen und der Menschen, die sie repräsentieren; das Problem wird so vollkommen simplifiziert; die Menschen und selbst die Klassen würden so lediglich zu Marionetten der Produktivkräfte.“ (Bilan Nr. 5, „Die Prinzipien, Waffen der Revolution“) Doch, „wenn es zwar absolut richtig ist, dass die ökonomischen Mechanismen die Bildung von Klassen bestimmen, so ist es total falsch zu glauben, dass die ökonomischen Mechanismen diese direkt dazu stoßen, den Weg einzuschlagen, der zu ihrer Abschaffung führt“ (ebenda). Aus diesem Grunde „ist die Aktion der Klassen nicht möglich ohne ein Verständnis ihrer historischen Rolle und der Mittel. die zu ihrem Sieg führen. Die Klassen sind abhängig von den ökonomischen Mechanismen, um geboren zu werden und zu sterben, doch um zu siegen, müssen sie fähig sein, sich eine politische und organische Gestalt zu geben, ohne die sie, selbst wenn es durch die Entwicklung der Produktivkräfte bestimmt ist, Gefahr laufen, für lange Zeit Gefangene der alten Klasse zu bleiben, welche ihrerseits selbst den Kurs der ökonomischen Entwicklung gefangen hält.“ (ebenda)
Es ist kaum möglich, die gegenwärtigen Probleme, die durch den heutigen Kurs der historischen Krise des Kapitalismus gestellt werden, treffender zu beschreiben. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf die apokalyptische Depression zu warten, sondern eine methodische Analyse der konstanten Zuspitzung der Krise zu entwickeln und damit das Scheitern aller kapitalistischer Maßnahmen, die der Kapitalismus als „Mittel zur Überwindung der Krise und als Weg zu besseren Zeiten“ präsentiert, aufzuzeigen. All dies mit der Sorge um das Wesentliche: die Entwicklung des Klassenkampfes und vor allem des Bewusstseins des Proletariates, des Totengräbers der kapitalistischen Gesellschaft und Handwerkers der Aktion der Menschheit zur Bildung einer neuen Gesellschaft.
Aus diesem Grunde hat die Resolution des letzten Kongresses klargestellt, dass es in der Entwicklung des Kapitalismus keinen „wirtschaftlichen Punkt gibt, wo es „keine Rückkehr“ mehr geben kann, ab dem das System unwiderruflich dazu verdammt wäre zu verschwinden. Genauso wenig gibt es irgendeine theoretisch festgelegte Grenze des Schuldenbergs (die Hauptdroge des todkranken Kapitalismus), die das System sich selbst setzen kann, ohne seine eigene Existenz zu verunmöglichen. In der Realität hat der Kapitalismus seine ökonomischen Grenzen mit dem Eintritt in die Phase seiner Dekadenz erreicht. Seitdem konnte der Kapitalismus nur noch durch zunehmende Manipulationen an den Gesetzen des Kapitalismus überleben: eine Aufgabe, die nur der Staat erfüllen kann.
In Wirklichkeit sind die Grenzen des Kapitalismus politisch und nicht ökonomisch. Der Ausgang der historischen Krise des Kapitalismus hängt von der Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen ab:
entweder kann das Proletariat seinen Kampf entfalten, bis es seine weltweite revolutionäre Diktatur durchsetzen kann,
oder der Kapitalismus stürzt die Menschheit durch seine ihm innewohnende Tendenz zum Krieg in Barbarei und endgültige Zerstörung.“
1 Siehe dazu: Internationale Revue Nr. 25: „Wohin der Kapitalismus die Welt treibt“ und International Review Nr. 101 (engl./franz./span. Ausgabe): „Das barbarischste Jahrhundert der Geschichte“.
2 Im Rahmen dieser Zusammenarbeit gegen die kleinen Gangster haben sich die Großen jedoch eine wütende Schlacht zur Steigerung des jeweils eigenen Anteils an der Weltwirtschaft geliefert.
3 „Die kapitalistische Gesellschaft in der imperialistischen Epoche ist wie ein Gebäude bei dem das Material für den Bau der oberen Stockwerke den unteren und dem Fundament entnommen wurde. Je wilder die oberen Stöcke in die Höhe schießen, desto schwächer werden die Fundamente, die das Gebäude stützen. Je größer der Schein der Macht an der Spitze, desto zerbrechlicher ist das Gebäude in Wirklichkeit.“ (Internationalisme Nr. 2, „Bericht über die internationale Situation“, Juli 1945)
4 Diese runde Ziffer ist eh falsch. In Realität handelt es sich um 33 Wachstumsmonate (8 Jahre und ein Quartal). All die Kommentare über das „Aussergewöhnliche“ dieses Wachstumszyklus unterschlagen bewusst, dass es in den 60er Jahren einen längeren Zyklus (35 Trimester) gab.
5 Die Zahlen stammen aus einem Artikel von Battaglia comunista über die „New Economy“: Prometeo Nr. 1, 2000.
6 UNO-Bericht der Wirtschaftskommission für Europa.
7 Das Gewicht der Rüstungsausgaben in den USA drückt ebenfalls auf das kranke Wachstum. Diese Ausgaben erreichten 1985 in der Epoche des sog. Kriegs der Sterne unter Reagan den Höhepunkt mit 352‘000 Millionen Dollar und sind seit 1990 auf den Tiefstand von 1997 mit 255‘000 Millionen Dollar gefallen. Seither ist ein neuer Anstieg zu verzeichnen, 2000 erreichten die Ausgaben wieder 274‘000 Millionen Dollar (Zahlen aus Révolution Internationale Nr. 305).
8 Die Juniausgabe 2000 von Prometeo enthielt auch einen Artikel gegen den Mythos der „Neuen Ökonomie“ und enthält wertvolle Argumente.
9Als Vergleichsgrundlage dient ein solches Netz von Büros mit 100 Arbeitsplätzen und Computern ohne permanente Verbindung.
10 Die herrschende Klasse bietet demgegenüber andere Visionen an, diejenigen der Bewegung von Prag und Seattle: Die Schuld wird einer bestimmten Form der kapitalistischen Politik in die Schuhe geschoben (dem Liberalismus und der Globalisierung), fordert einen „faireren Handel“, „Schuldenerlasse“ und „radikale Proteste“. Sie fördert somit die Idee, dass der Kapitalismus gesund sei, eine fortschrittliche Entwicklung stattfinden könnte und „Reformen“ möglich seien, wenn nur die „Irrtümer“ des IWF und der WTO und anderer „Bösewichte“ korrigiert würden.
11 Vgl. unsere Serie ”30 Jahre offene Krise des Kapitalismus” in Internationale Revue Nr. 24-26
12 Quelle: London School of Economics, eine im Januar 1997 veröffentlichte Studie.
13 Diese Zahlen sind einem Buch von J. Gray mit dem Titel Falso amanecer entnommen, welches eine Kritik an der Globalisierung sein will.
14 Zahlen aus dem zitierten Artikel von Battaglia comunista in Prometeo.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
1921 Kronstadt verstehen
- 3534 Aufrufe
Vor 80 Jahren im März 1921, vier Jahre nach der erfolgreichen Machtübernahme durch die Arbeiterklasse in der russischen Oktoberrevolution 1917, unterdrückte die bolschewistische Partei gewaltsam eine Erhebung in der Garnison der baltischen Flotte in Kronstadt auf der kleinen Insel Kotlin im finnischen Meerbusen, 30 Kilometer von Petrograd entfernt.
Die bolschewistische Partei hatte im Kampf gegen die konterrevolutionären Armeen der russischen und ausländischen Bourgeoisien eine mehrjährige Erfahrung im Führen eines blutigen Bürgerkrieges gesammelt. Doch der Aufstand der Kronstädter Garnison war neu und anders: Es war ein Aufstand von Innen, von der Arbeiterklasse, die das Sowjetregime unterstützt hatte, die die Avantgarde der Oktoberrevolution gewesen war und nun Klassenforderungen aufstellte, um etliche inakzeptable Deformationen und Verirrungen der neuen Machthaber zu korrigieren.
Die gewaltsame Niederschlagung dieses Kampfes bildete seitdem einen Bezugspunkt für das Verständnis der Bedeutung des revolutionären Projektes. Und heute, wo die Bourgeoisie alles daran setzt, der Arbeiterklasse zu beweisen, dass es einen unerschütterlichen Zusammenhang zwischen Marx und Lenin sowie Stalin und dem Gulag gibt, um so mehr.
Wir haben nicht die Absicht, in alle historischen Details zu gehen. Frühere Artikel in der Internationalen Revue haben sich mit dem Ereignis bereits detailliert befasst. (Internationale Revue, engl./franz./span. Ausgabe, Nr. 3: „Die Lehren von Kronstadt“, und Nr. 100: „Das Proletariat und der Staat in der Übergangsperiode“)
Im Gegenteil, wir wollen die Gelegenheit dieses Jubiläums wahrnehmen, um uns polemisch mit zwei Arten von Argumenten über den Aufstand von Kronstadt auseinanderzusetzen: erstens die anarchistische Verwendung der Ereignisse, um die autoritäre, konterrevolutionäre Natur des Marxismus und der Parteien, die in seinem Namen agieren, zu beweisen; zweitens der Gedanke, der noch immer im proletarischen Lager heute existiert, wonach die Niederschlagung der Rebellion eine „tragische Notwendigkeit“ gewesen sei, um die Errungenschaften des Oktobers zu verteidigen.
Die anarchistische Sichtweise
Der anarchistischen Historiker Voline schreibt: „Lenin hat von der Kronstädter Bewegung nichts begriffen – oder wollte vielmehr nichts begreifen. Für ihn und seine Partei ging es einzig und allein darum, die Macht zu behaupten, koste es was es wolle. (...) Als autoritäre und staatsgläubige Marxisten konnten die Bolschewiki keine Freiheit der Massen zulassen, keine Unabhängigkeit ihrer Aktion. Sie hatten überhaupt kein Vertrauen in die freien Massen. Sie waren überzeugt, dass der Sturz ihrer Diktatur das Ende des ganzen begonnenen Werkes, die Gefährdung der Revolution überhaupt bedeuten würde, der Revolution, mit der sie ihre Diktatur verwechselten. (...) Kronstadt war der erste vollkommen unabhängige Versuch des Volkes, sich von jedem Joch zu befreien und die Soziale Revolution zu verwirklichen: Es war ein direkter, entschlossener und kühn durchgeführter Versuch der werktätigen Massen selbst, ohne „politische Hüter“, ohne „Führer“ oder Vormund. Kronstadt war der erste Schritt zur Dritten, zur Sozialen Revolution. Kronstadt fiel. Aber es tat, was es tun musste, und das ist das Entscheidende. In dem verwirrenden und finsteren Labyrinth der Wege, die sich den revolutionären Massen anbieten, ist Kronstadt ein strahlender Leuchtturm, der den richtigen Weg erhellt. Dabei ist es unwichtig, dass die Aufständischen – unter den spezifischen Bedingungen – noch von einer Macht (der Sowjets) sprachen, anstatt den Begriff und die Vorstellung einer Macht für immer zu verbannen, anstatt von Koordination, Organisation und Administration zu sprechen. Dies war der letzte Tribut an die Vergangenheit. Wenn die uneingeschränkte Diskussions-, Organisations- und Handlungsfreiheit von den werktätigen Massen selbst endgültig errungen sein wird, wenn der wahre Weg der unabhängigen Aktivität des Volkes beschritten sein wird, dann folgt alles übrige zwangsläufig, automatisch.“ (Voline, Der Aufstand von Kronstadt, Unrast-Verlag, Seiten 128 und 133. Originaltitel: Die unbekannte Revolution)
Für die Anarchisten, deren Sichtweisen Voline prägnant ausdrückt, war die Unterdrückung des Kronstädter Aufstandes also die natürliche, logische Konsequenz aus den marxistischen Auffassungen der Bolschewiki. Der Substitutionismus der Partei, die Identität zwischen der Diktatur des Proletariats und der Parteidiktatur und die Schaffung eines Übergangsstaates seien Ausdruck ihrer überbordenden Gier nach Macht, Autorität über die Massen gewesen, in die sie kein Vertrauen besessen hätten. Bolschewismus bedeutete Voline zufolge die Ersetzung der einen Form der Unterdrückung durch eine andere.
Doch war Kronstadt für ihn nicht nur eine Revolte, sondern ein Modell für die Zukunft. Indem der Kronstädter Sowjet sich selbst auf wirtschaftliche und soziale Aufgaben (Koordination, Organisation, Administration) beschränkt, und sich nicht um politische Aufgaben (dem Gerede über die Sowjetmacht) geschert habe, habe er bildhaft gemacht, wie eine wahre soziale Revolution aussehen müsste: eine Gesellschaft ohne Führer, ohne Parteien, ohne Staat, ohne Macht jeglicher Art, eine Gesellschaft der sofortigen und völligen Freiheit.
Dumm nur für die Anarchisten, dass die erste Lektion sich auffällig mit der vorherrschenden Ideologie der Weltbourgeoisie deckt, wonach eine kommunistische Revolution nur zu einer neuen Form der Tyrannei führt.
Diese Übereinstimmung in der Sichtweise zwischen den Anarchisten und der Bourgeoisie ist nicht zufällig. Beide behandeln die Geschichte mit den Abstraktionen der Gleichheit, Solidarität und Brüderlichkeit gegen Hierarchie, Tyrannei und Diktatur. Die Bourgeoisie benutzte diese moralischen Prinzipien zynisch und heuchlerisch gegen die Oktoberrevolution, um die Brutalität der konterrevolutionären Kräfte zwischen 1918 und 1920 zu rechtfertigen, als sie bewaffnete Interventionen gegen Russland anführte und es wirtschaftlich strangulierte. Die praktische Alternative der Anarchisten zum Bolschewismus ist auf der anderen Seite eine naive Utopie, wo die historischen Probleme, denen die proletarische Revolution gegenüber steht, auf mysteriöse Weise wegschmelzen.
Doch wie die Ereignisse von Spanien 1936 bestätigen, bleibt der anarchistischen Naivität, nachdem sie die marxistische historische Konzeption der Revolution verworfen hat, nur noch, vor der praktischen Konterrevolution der Bourgeoisie zu kapitulieren.
Wenn die Bolschewiki grundsätzlich von einer Manie für die völlige Machtausübung motiviert waren, wie Voline behauptet, dann ist der Anarchismus im Gegensatz dazu unfähig, auf eine ganze Reihe von Fragen zu antworten, die von der historischen Realität aufgeworfen werden. Wenn das ultimative Ziel der Bolschewiki die Macht war, warum verdammten sie sich dann, anders als die Mehrheit der Sozialdemokraten, selbst zu einer Periode der Ächtung zwischen 1914 und 1917, als sie den imperialistischen Krieg denunzierten und dazu aufriefen, ihn in einen Bürgerkrieg zu verwandeln? Warum weigerten sie sich dann, anders als die Menschewiki und Sozialrevolutionäre, zusammen mit der liberalen Bourgeoisie Russlands nach der Februarrevolution von 1917 der Provisorischen Regierung beizutreten, und forderten stattdessen: „Alle Macht den Räten“?
Warum vertrauten sie den Fähigkeiten der russischen Arbeiterklasse, im Oktober die proletarische Weltrevolution zu beginnen, anders als der überwiegende Rest der internationalen Sozialdemokratie, die das dortige Proletariat für zu rückständig und zahlenmäßig für zu klein hielten, um die Bourgeoisie zu stürzen?
Warum vertrauten sie der Unterstützung durch die Arbeiterklasse, errangen und behielten sie, als es darum ging, die notwendigen Opfer zu erbringen, um die alliierte Blockade zu überleben und mit Waffen in den Händen den konterrevolutionären Armeen zu widerstehen?
Wie ist es zu erklären, dass sie das Weltproletariat dazu inspirierten, dem russischen Vorbild mit eigenen revolutionären Versuchen in ganz Europa und in der restlichen Welt zu folgen? Wie konnte die bolschewistische Partei die Initiative bei der Schaffung einer neuen Kommunistischen Internationalen auf Weltebene übernehmen?
Und schließlich: Weshalb trat der Integrationsprozess der Partei in die Staatsmaschinerie, ihre Aneignung der Massenorgane der Arbeitermacht – die Arbeiterräte und Fabrikkomitees – und letztendlich der Gebrauch von Gewalt gegen den Klassenkampf nicht über Nacht auf, sondern erst nach einer längeren Periode?
Die Theorie von der den Bolschewiki innewohnenden „Boshaftigkeit“ erklärt weder die Degeneration der Russischen Revolution im Allgemeinen noch die Kronstädter Episode im Besonderen.
Ab 1921 war die Revolution in Russland und die sie anführende bolschewistische Partei mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Die Ausbreitung der Revolution auf Deutschland und andere Länder schien weitaus weniger wahrscheinlich als 1919. Die Lage der Weltwirtschaft hatte sich verhältnismäßig stabilisiert, und der Spartakusaufstand, Angelpunkt der Weltrevolution, war gescheitert. Innerhalb Russlands war die Lage, trotz des Sieges im Bürgerkrieg, infolge der wiederholten Anschläge durch konterrevolutionäre Armeen und der wirtschaftlichen Strangulierung, die von der internationalen Bourgeoisie bewusst organisiert worden war, dramatisch. Die industrielle Infrastruktur lag in Trümmern, und die Arbeiterklasse war durch ihre Opfer auf den Schlachtfeldern zunächst im Ersten Weltkrieg und dann im Bürgerkrieg und schließlich dadurch dezimiert, dass sie in Scharen die Städte verlassen und aufs Land gehen mussten, um zu überleben. Auch sahen sich die Bolschewiki einer wachsenden Unzufriedenheit mit dem Regime nicht nur unter den Bauern gegenüber, die eine Reihe von Erhebungen in den Provinzen in Gang setzten, sondern vor allem unter den Arbeitern, die Mitte Februar 1921 eine Streikwelle in Petrograd auslösten. Und dann kam Kronstadt.
Wie konnte Russland eine Bastion der Weltrevolution bleiben, die Verdrossenheit der Arbeiterklasse und die wirtschaftliche Auflösung überstehen und gleichzeitig auf die späte Hilfe durch die Arbeiterrevolutionen in anderen Ländern und besonders in Europa warten? Die Anarchisten haben keine Erklärung für die Degeneration der Revolution, außer, ihre Augen vor dem Problem der politischen Souveränität des Proletariats, der Zentralisierung ihrer Macht, der internationalen Ausdehnung der Revolution und der Übergangsperiode zur kommunistischen Gesellschaft zu schließen. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass die Bolschewiki einem katastrophalen Irrtum aufgesessen waren, als sie auf den Aufstand von Kronstadt militärisch antworteten und den Widerstand der Arbeiterklasse als einen Akt des Verrates und der Konterrevolution behandelten. Doch die bolschewistische Partei konnte nicht von der nachträglichen Einsicht profitieren wie die heutigen Revolutionäre. Sie konnte lediglich die Errungenschaften der Arbeiterbewegung zu jener Zeit nutzen, die niemals zuvor mit der immens schwierigen Aufgabe konfrontiert war, sich innerhalb einer feindlichen, kapitalistischen Umwelt an der Macht zu halten. Weder das Verhältnis der Sowjets zur Partei der Arbeiterklasse nach der erfolgreichen Machtergreifung noch das Verhältnis von beiden zum Übergangsstaat, der unvermeidbar war, um den bürgerlichen Staat erfolgreich zu zerschlagen, war verstanden worden.
Als sie das Staatsruder übernahm und allmählich die Arbeiterräte und Fabrikkomitees dem Staat einverleibte, stocherte die bolschewistische Partei im Dunkeln. Gemäß der vorherrschenden Meinung innerhalb der damaligen Arbeiterbewegung kam die Hauptgefahr für die Revolution von außerhalb des neuen Staatsapparates: von der internationalen Bourgeoisie und von der Bauernschaft sowie der russischen Bourgeoisie im Exil. Keine Tendenz in der kommunistischen Bewegung zu jener Zeit, nicht einmal der linke Flügel, hatte eine alternative Perspektive, auch wenn es Manche, auch innerhalb der bolschewistischen Partei, gab, die vor der Bürokratisierung des Regimes warnten. Aber ihre Rezepte waren nur bedingt wirksam und enthielten zudem andere Gefahren. Die Arbeiteropposition von Kollontai und Schljapnikow forderte die Gewerkschaften auf, die Arbeiter gegen die staatlichen Exzesse zu verteidigen, und übersah dabei, dass die Arbeiterräte sie als Massenorgane des revolutionären Proletariats abgelöst hatten.
Es gab so manchen in der bolschewistischen Partei, der gegen die Zerschlagung der Revolte opponierte: die Parteimitglieder in Kronstadt, die sich der Bewegung anschlossen, und Elemente wie Gawrjil Miasnikow, der später die Arbeitergruppe gründen sollte und sich der militärischen Lösung widersetzte. Doch die existierenden linken Tendenzen in der Partei und in der Kommunistischen Internationalen unterstützten, trotz ihrer Kritik am bolschewistischen Regime, unbeirrt die Anwendung von Gewalt. Die Arbeiteropposition meldete sich gar freiwillig bei den Stoßtruppen. Die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, die KAPD, die gegen die Parteidiktatur opponierte, stimmte dennoch der militärischen Handlungen gegen die Kronstädter Rebellion zu (dies hindert einige Anarchisten wie die Anarchistische Föderation in Großbritannien heute nicht daran, die KAPD als ihre Ahnen zu beanspruchen!).
Schließlich bildeten die Forderungen des Kronstädter Sowjets entgegen der Auffassung Volines keine kohärente, alternative Perspektive, da sie hauptsächlich in einem unmittelbaren und lokalen Kontext eingebunden waren und sich nicht mit den weiteren Auswirkungen für die proletarische Bastion und mit der Weltlage befassten. Insbesondere gaben sie keine Antwort darauf, wie die Rolle der Avantgardepartei aussehen sollte.921#_edn1">1
Erst später, viel später, versuchten Revolutionäre, all die Lehren aus der Niederlage der Russischen Revolution und der revolutionären Welle, die dadurch ausgelöst wurde, zu ziehen, und konnten so auf die wirklichen Lektionen dieser tragischen Episode hinweisen:
„Es mag sein, dass unter bestimmten Umständen das Proletariat – und wir wollen ihm sogar zugestehen, dass es unbewusstes Opfer der feindlichen Manöver ist – in den Kampf gegen den proletarischen Staat tritt. Was ist in einer solchen Situation zu tun? Wir müssen von dem Prinzip ausgehen, dass der Sozialismus dem Proletariat nicht mit Zwang und Gewalt aufoktroyiert werden kann. Es wäre besser gewesen, Kronstadt zu verlieren, als es vom geographischen Standpunkt aus festzuhalten, da dieser Sieg substantiell nur ein Resultat haben konnte: die Änderung der eigentlichen Basis, der Substanz der vom Proletariat ausgeübten Tat.“ (Octobre Nr. 2, März 1938, Organ des Internationalen Büros der Fraktionen der Kommunistischen Linken)
Die Linkskommunisten haben den Finger auf das wesentliche Problem gelegt: Die bolschewistische Partei hat, indem sie staatliche Gewalt gegen die Arbeiterklasse anwendete, sich selbst an die Spitze der Konterrevolution gesetzt. Der Sieg über Kronstadt beschleunigte die Tendenz der bolschewistischen Partei, zu einem Instrument des russischen Staates gegen die Arbeiterklasse zu werden. Aus dieser Einsicht heraus waren die Linkskommunisten in der Lage, andere, kühne Schlussfolgerungen zu ziehen. Die kommunistische Partei muss, um die Vorhut des Proletariats zu bleiben, ihre Autonomie gegenüber dem postrevolutionären Staat sicherstellen, der die unvermeidliche Tendenz hat, den Status quo zu erhalten und das Fortschreiten des revolutionären Prozesses zu verhindern.
Die bordigistische Sichtweise
Jedoch ist diese Schlussfolgerung weit davon entfernt, von den heutigen Linkskommunisten allgemein anerkannt zu werden. In der Tat sind einige von ihnen, besonders die bordigistische Strömung, in völligem Gegensatz zu der Position der italienischen Fraktion von 1938, zu den Rechtfertigungen Lenins und Trotzkis für die Unterdrückung Kronstadts zurückgekehrt: „Es wäre sinnlos, über die schrecklichen Umstände, welche die Bolschewiki zwangen, Kronstadt niederzuschlagen, mit jemandem zu diskutieren, der aus Prinzip dagegen ist, dass eine proletarische Macht in ihrer Geburtsstunde oder auf dem Weg zur ihrer Konsolidierung auf Arbeiter schießen darf. Die Prüfung des schrecklichen Problems, mit welchem der proletarische Staat konfrontiert ist, beinhaltet eine Kritik an der Vision der Revolution durch eine rosarote Brille und lässt uns verstehen, weshalb die Niederschlagung dieser Rebellion mit den Worten Trotzkis ausgedrückt „eine tragische Notwendigkeit“ war, eine Notwendigkeit und eine Pflicht zugleich.“ („Kronstadt: eine tragische Notwendigkeit“, Programme Communiste Nr. 88, Organ der Internationalistischen Kommunistischen Partei, auf Französisch, übersetzt durch uns)
Die bordigistische Strömung mag unnachgiebig den Internationalismus der bolschewistischen Partei vertreten, doch indem sie diesen Teil der Tradition, zu der sie, wie sie selbst behauptet, gehört, übergeht, vertritt sie genauso vehement die Fehler der Bolschewiki und zeigt sich unfähig, aus all den Gründen für die Degeneration von Partei und Revolution zu lernen.921#_edn2">2
Ihr zufolge ist das Verhältnis der Partei zur Klasse und zum postrevolutionären Staat im revolutionären Prozess keine Frage des Prinzips, sondern der Zweckdienlichkeit: Wie übt die revolutionäre Avantgarde in jeder Lage am besten ihre Funktion aus.
„Dieser gigantische Kampf kann auch innerhalb des Proletariates selbst schreckliche Spannungen hervorrufen. Es ist zwar klar, dass die Partei die Revolution und die Diktatur nicht gegen oder ohne die Massen machen kann, der revolutionäre Wille der Klasse drückt sich aber nicht durch konsultative Abstimmungen oder „Meinungsumfragen“ aus, in denen eine „numerische Mehrheit“, oder noch absurder, eine Einstimmigkeit zu suchen wäre. Er drückt sich durch ein Anwachsen und eine immer klarere Ausrichtung der Kämpfe aus, in denen die entschlossensten Teile die unentschlossenen und zweifelnden mitreißen und falls nötig den Widerstand beiseite fegen. Während der Umtriebe des Bürgerkrieges und der Diktatur können sich die Verhältnisse und Beziehungen unter den verschiedenen Schichten ändern. Und weit entfernt von irgendeinem Recht auf „Rätedemokratie“ mit gleichem Gewicht und gleicher Wichtigkeit für alle Arbeiterschichten, Halbproletarier oder Kleinbürger, erklärt Trotzki in Terrorismus und Kommunismus, dass selbst ihr Recht an den Arbeiterräten teilzunehmen, das heisst an den Organen des proletarischen Staates, von ihrer Haltung in den Kämpfen abhängt.
Keine „verfassungsmäßige Regel“, kein „demokratisches Prinzip“ kann die Beziehungen innerhalb des Proletariates harmonisieren. Kein Rezept kann die Widersprüche zwischen den lokalen Bedürfnissen und den Erfordernissen der internationalen Revolution lösen, zwischen den unmittelbaren Bedürfnissen und den Erfordernissen des historischen Kampfes der Klasse, Widersprüche, die ihren Ausdruck im Widerstand verschiedener Teile des Proletariates finden. Kein Formalismus erlaubt es, Regeln aufzustellen über das Verhältnis zwischen der Partei, der fortgeschrittensten Fraktion der Arbeiterklasse und Organ ihres revolutionären Kampfes, und den Massen, die in unterschiedlichem Masse unter dem Druck der lokalen und unmittelbaren Bedingungen stehen. Selbst die beste Partei, die fähig ist ‚den Geist der Massen zu überwachen und zu beeinflussen‘ wie Lenin sagte, muss manchmal das Unmögliche von den Massen verlangen. Genauer gesagt, sie findet die ‚Grenze‘ des Möglichen nur im Versuch noch weiter zu gehen.“ (ebenda, übersetzt von uns)
1921 wählte die bolschewistische Partei den falschen Weg ohne jegliche vorherige Erfahrung oder Parameter, an denen sie sich hätte orientieren können. Heute machen die Bordigisten absurderweise aus den Fehlern der Bolschewiki Tugenden und erklären: „Es gibt keine Prinzipien.“ Die Bordigisten zaubern das Problem der Ausübung proletarischer Macht dadurch weg, dass sie formale und abstrakte Methoden zur Erlangung einer gemeinsamen Position der gesamten Klasse verspotten. Auch wenn es sicherlich zutrifft, dass es nie ein perfektes Mittel geben kann, um in einer äußerst schwankenden Situation einen Konsens zu erreichen, auch wenn die Erfahrungen aus Deutschland 1918 und anderswo zeigen, dass die Arbeiterräte gegenüber den Vereinnahmungsversuchen der Bourgeoisie verwundbar sind, haben sie (oder die Sowjets) sich dennoch als das geeignetste Mittel zur Widerspiegelung und Ausführung des sich entfaltenden revolutionären Willens des Proletariats in seiner Gesamtheit erwiesen. Obwohl die Bordigisten so generös sind zuzugeben, dass die Partei ohne die Massen keine Revolution machen könne, haben die Massen anschließend keine Möglichkeit, ihren revolutionären Willen als gesamte Klasse auszudrücken, außer durch die Partei und mit der Genehmigung der Partei. Und die Partei kann das Proletariat notfalls mit dem Maschinengewehr korrigieren, wie in Kronstadt. Entsprechend dieser Logik hat die proletarische Revolution zwei sich widersprechende Parolen: vor der Revolution „Alle Macht den Sowjets“, nach der Revolution „Alle Macht der Partei“.
Anders als Octobre haben die Bordigisten vergessen, dass im Gegensatz zur bürgerlichen Revolution die Aufgaben einer proletarischen Revolution nicht an eine Minderheit delegiert werden können, sondern von der selbstbewussten Mehrheit ausgeübt werden müssen. Die Emanzipation der Arbeiter ist die Aufgabe der Arbeiterklasse selbst.
Die Bordigisten lehnen sowohl die bürgerliche Demokratie wie auch die Arbeiterdemokratie ab, als sei beides derselbe Schwindel. Doch die Sowjets bzw. Arbeiterräte – das Mittel, durch das sich das Proletariat für den Sturz des Kapitalismus selbst mobilisiert – müssen die Organe der proletarischen Diktatur sein, die die Spannungen und Differenzen innerhalb des Proletariats reflektieren und regulieren sowie seine bewaffnete Macht über den Übergangsstaat beherbergen. Die Partei, die unersetzliche Avantgarde, kann, so klar und so weit gegenüber dem Rest des Proletariats vorangeschritten sie in einer bestimmten Zeit auch sein mag, dennoch nicht dieses an der Macht ersetzen.
Doch nachdem sie das Recht der Partei – praktisch, nicht „prinzipiell“ – demonstriert haben, Arbeiter niederzuschießen, fahren die Bordigisten fort und streiten, als schreckten sie selbst vor dem Schrecken dieser Schlussfolgerung zurück, ab, dass der Aufstand von Kronstadt überhaupt einen proletarischen Charakter gehabt habe. Einer von Lenins Definitionen jener Zeit folgend, sei Kronstadt eine „kleinbürgerliche Konterrevolution“ gewesen, die den reaktionären Weißgardisten Tür und Tor geöffnet habe.
Es ist sicherlich richtig, dass alle Arten konfuser und gar reaktionärer Ideen von den Rebellen Kronstadts zum Ausdruck gebracht wurden, und einige von ihnen spiegelten sich in ihrer Plattform wider. Es trifft ebenfalls zu, dass die organisierten Kräfte der Konterrevolution versucht hatten, die Rebellion für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Doch die Arbeiter von Kronstadt betrachteten sich selbst weiterhin in Kontinuität mit der Revolution von 1917 und als integraler Bestandteil der proletarischen Bewegung auf Weltebene:
„Lasst die Arbeiter der gesamten Welt wissen, dass wir, die Verteidiger der Sowjetmacht, die Errungenschaften der sozialen Revolution schützen. Wir werden gewinnen oder auf den Ruinen von Kronstadt zugrunde gehen, indem wir für die eigentliche Sache der proletarischen Massen kämpfen.“ (aus der Kronstädter Prawda)
Welche Konfusionen von den Kronstädter Rebellen auch immer ausgedrückt wurden, es ist absolut unstrittig, dass ihre Forderungen auch die Interessen des Proletariats widerspiegelten, das sich fürchterlichen Lebensbedingungen, einer wachsenden Unterdrückung durch die Staatsbürokratie und dem Verlust seiner politischen Macht in den verkümmerten Sowjets gegenübersah. Der Versuch der Bolschewiki, sie als kleinbürgerlich und potenzielle Agenten der Konterrevolution zu brandmarken, war natürlich ein Vorwand, um eine Situation äußerster Gefahr und Komplexität innerhalb der Arbeiterklasse mit Gewalt zu lösen.
Mit dem Vorteil der historischen, nachträglichen Einsicht und des theoretischen Werkes der Kommunistischen Linken gewappnet, sind wir in der Lage, den fundamentalen Irrtum in der Argumentation der Bolschewiki zu erkennen: Sie schlugen den Aufstand von Kronstadt nieder, und trotzdem wurden die Kommunisten von einer antiproletarischen Diktatur massakriert – vom Stalinismus, der absoluten Macht der kapitalistischen Bürokratie. Tatsächlich haben die Bolschewiki mit der Niederschlagung der Bemühungen der Arbeiter von Kronstadt, die Sowjets zu regenerieren, mit ihrer Identifizierung mit dem Staat den Weg geebnet für den Stalinismus, ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie halfen mit bei der Beschleunigung des konterrevolutionären Prozesses, der weitaus fürchterlichere und tragischere Konsequenzen für die Arbeiterklasse haben sollte als die Restauration durch die Weißen. In Russland gewann die Konterrevolution, indem sie sich selbst als kommunistisch darstellte. Der Gedanke, dass das stalinistische Russland die lebende Verkörperung des Sozialismus sei und in direkter Kontinuität mit der Oktoberrevolution stünde, erzeugte schlimme Verwirrungen und uferlose Demoralisierung in den Reihen der Arbeiterklasse überall auf der Welt. Wir leben heute, wo die Bourgeoisie seit 1989 mit der Gleichsetzung des Todes des Stalinismus mit dem Tod des Kommunismus fortfährt, noch immer mit den Konsequenzen dieser Verzerrung der Realität.
Aber die Bordigisten identifizieren sich trotz dieser Erfahrung immer noch mit dem tragischen Fehler von 1921. Für sie war dies weniger eine „tragische“ Notwendigkeit, sondern eine kommunistische Pflicht, die jederzeit wiederholt werden muss!
Wie die Anarchisten sehen die Bordigisten keinen Widerspruch zwischen der bolschewistischen Partei von 1917, die den bewaffneten Willen des in den Sowjets organisierten, revolutionären Proletariats nicht nur lenkte, sondern sich ihm auch beugte und von ihm abhängig war, und der bolschewistischen Partei von 1921, die die Sowjets zu einem Schatten ihrer früheren Macht degradierte und die staatliche Gewalt gegen die Arbeiterklasse richtete. Doch während die Anarchisten der Bourgeoisie bei ihrer gegenwärtigen Kampagne helfen, indem sie die Bolschewiki als machiavellistische Tyrannen porträtieren, feiern die Bordigisten diesen arglistigen Ruf als den eigentlichen Gipfel revolutionärer Kompromisslosigkeit.
Doch eine Kommunistische Linke, die den Namen auch verdient, muss, auch wenn sie sich mit dem bolschewistischen Erbe identifiziert, in der Lage sein, seine Fehler zu kritisieren. Die Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes war einer der schädlichsten und schlimmsten von ihnen.
Como, 8. Januar 2001
1 siehe Internationale Revue, Nr. 3, engl./franz./span. Ausgabe, S. 51, zur Plattform der Kronstädter Revolte
2 Das Internationale Büro für die Revolutionäre Partei (IBRP), ein anderer Zweig der Linkskommunisten, hat eine zweideutige Position zu Kronstadt. In einem Artikel, der in Revolutionary Perspectives Nr. 23 (1986) veröffentlicht wurde, wird der proletarische Charakter der Oktoberrevolution und der bolschewistischen Partei bekräftigt und die anarchistische Idealisierung des Kronstädter Aufstandes abgelehnt, indem unterstrichen wird, dass der Aufstand eindeutig die ungünstigen Bedingungen für die proletarische Revolution widergespiegelt habe und dass er viele konfuse und reaktionäre Elemente enthalten habe. Gleichzeitig kritisiert der Artikel den bordigistischen Gedanken, dass der Angriff auf Kronstadt eine Notwendigkeit gewesen sei, um die Diktatur der Partei zu wahren. Er bestätigt, dass eine der fundamentalen Lehren von Kronstadt darin besteht, dass die Diktatur des Proletariats von der Klasse selbst ausgeübt werden muss, durch ihre Arbeiterräte, und nicht durch die Partei. Er zeigt ebenfalls auf, dass die Irrtümer der Bolschewiki bezüglich des Verhältnisses zwischen Partei und Klasse im allgemeinen Rahmen der Isolation der proletarischen Bastion die innere Degeneration sowohl der Partei als auch des Sowjetstaates beschleunigten. Nichtsdestotrotz charakterisiert der Artikel die Revolte nicht als proletarisch und antwortet nicht auf die fundamentale Frage: Ist es möglich, dass eine proletarische Diktatur gegen die Unzufriedenen unter den Arbeitern Gewalt anwendet? Die Genossen des IBRP sagen gar, dass als Folge der Manipulationen der Konterrevolution – selbst wenn sie damit ein Kapitel der langsamen Agonie in der Arbeiterbewegung ansprechen – die Unterdrückung der Revolte mehr als gerechtfertigt gewesen sei.
Erbe der kommunistischen Linke:
Bilan Nr. 11 vom Oktober/November 1934
- 3547 Aufrufe
Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus II
Vorstellung
Im Folgenden veröffentlichen wir den zweiten Teil einer Studie, die in der Zeitschrift "Bilan" 1934 erschienen ist. Wir haben in der letzten Nummer der Internationalen Revue den ersten Teil publiziert, in dem Mitchell die Grundlagen der marxistischen Analyse des Profits und der Kapitalakkumulation in der Kontinuität von Marx und Rosa Luxemburg untersucht. In diesem zweiten Teil wendet er sich der "Analyse der allgemeinen Krise des dekadenten Imperialismus" zu und erklärt mit einer bemerkenswerten Klarheit die Merkmale dieser allgemeinen Krise des Imperialismus. Diese Studie errichtete damals die theoretische Grundlage für das Verständnis der unausweichlichen Tendenz zum Krieg in der historischen Krise des Kapitalismus. Sie bleibt von brennendem Interesse, da sie einen theoretischen Rahmen gibt für das heutige Verständnis der Wirtschaftskrise. IKS
Wir haben im ersten Teil dieser Studie festgestellt, dass die Periode von 1852 bis 1873 den Stempel einer beträchtlichen Entwicklung des Kapitalismus in freier Konkurrenz (gemildert einzig durch den Protektionismus zur Verteidigung von im Wachstum befindlichen Industrien) trug. In dieser historischen Phase vollendeten die diversen nationalen Bourgeoisien ihre ökonomische und politische Vorherrschaft auf den Ruinen der feudalistischen Überbleibsel. Sie befreiten die kapitalistischen Produktivkräfte von allen Fesseln: in Russland mit der Aufhebung der Leibeigenschaft, in den Vereinigten Staaten mit dem Sezessionskrieg und der Überwindung der anachronistischen Sklaverei und in Italien und Deutschland mit der Vollendung der nationalen Einigung. Der Vertrag von Frankfurt beendete den Zyklus der großen nationalen Kriege, aus denen die modernen Staaten hervorgegangen waren.
Der organische Prozess in der kapitalistischen Ära
Im schnellen Entwicklungsrhythmus integrierte die kapitalistische Produktionsweise bereits gegen 1873 die angrenzenden außerkapitalistischen Gebiete in ihre Sphäre, in ihren Markt. Europa war eine große, von der kapitalistischen Produktionsweise beherrschte Warenwirtschaft geworden (mit Ausnahme von einigen rückständigen Gebieten im Zentrum und im Osten). Auf dem nordamerikanischen Kontinent errichtete der bereits stark entwickelte angelsächsische Kapitalismus seine Hegemonie.
Der kapitalistische Akkumulationsprozess wurde zeitweise von zyklischen Krisen unterbrochen, nahm dann aber mit um so ungestümerer Kraft aufs Neue seinen Lauf und brachte eine ungeheure Zentralisierung der Produktionsmittel hervor, die den tendenziellen Fall der Profitrate noch mehr beschleunigte. Es gab ein Aufblühen riesiger Unternehmen mit hoher organischer Zusammensetzung des Kapitals, das durch die Entwicklung von Aktiengesellschaften weiter angeregt wurde. Diese Gesellschaften ersetzten den individuellen Kapitalisten, der allein nicht in der Lage war, den extensiven Forderungen der Produktion zu genügen. Die Industriellen verwandelten sich in den Verwaltungsräten untergeordnete Agenten.
Ein anderer Prozess kam in Gang: Aus der Notwendigkeit, einerseits dem tendenziellen Fall der Profitrate entgegenzuwirken, d.h. den Profit auf einer Höhe zu halten, die dem Charakter der kapitalistischen Produktionsweise entspricht, andererseits eine anarchische und zerstörerische Konkurrenz zu bremsen, tauchten nach 1873 monopolistische Organisationsformen auf. Erste Kartelle entstanden, bald darauf die konzentriertere Form der Syndikate. Schließlich entstanden Trusts und Konzerne mit horizontaler Integration ähnlicher Industrien oder vertikaler Integration von verschiedenen Produktionszweigen.
Mit dem Zustrom von beträchtlichen Mengen an verfügbaren Ersparnissen, die durch die intensive Akkumulation erwirtschaftet wurden, erlangte das Humankapital einen überragenden Einfluss. Das Beteiligungssystem, das sich über die Monopolgebilde spannte, gab ihm den Schlüssel zur Kontrolle der Produktion. Das industrielle sowie das Handels- und Bankkapital verloren so schrittweise ihre selbständige Stellung im wirtschaftlichen Mechanismus und auch einen beträchtlichen Anteil am Mehrwert. Sie wurden zu einer höheren kapitalistischen Organisationsweise gedrängt, die nach eigenem Gutdünken agiert: Es entstand das Finanzkapital. Dieses war alles in allem gesehen das Ergebnis der kapitalistischen Akkumulation und ihrer widersprüchlichen Erscheinungsformen. Diese Definition hat natürlich nichts mit jener gemeinsam, die das Finanzkapital als einen Willensausdruck einzelner Individuen darstellt, die vom Spekulationsfieber getrieben werden, um andere kapitalistische Formationen auszuplündern und ihre „freie“ Entwicklung zu behindern. Eine solche Auffassung vertreten die kleinbürgerlichen Sozialdemokraten und Neomarxisten, die sich im Sumpf des "Antihyperkapitalismus" bewegen, und bringt das Unverständnis für die Gesetze der kapitalistischen Entwicklung zum Ausdruck. Sie ist dem Marxismus fremd und verstärkt lediglich die ideologische Herrschaft der Bourgeoisie.
Der Prozess der organischen Zentralisierung lässt die Konkurrenz keineswegs verschwinden, sondern vergrößert sie im Gegenteil in anderen Formen. Sie bringt also nur eine höhere Stufe der grundlegenden kapitalistischen Widersprüchlichkeit zum Ausdruck. Auf die Konkurrenz zwischen Individualkapitalisten, die sich zur Zeit des "progressiven" Kapitalismus auf allen nationalen und internationalen Märkten tummelten, folgt der internationale Wettstreit zwischen höher entwickelten Organismen: nämlich den Monopolen, den Herren der nationalen Märkte und der Grundindustrien.
In dieser Zeit hat die Produktion einen Umfang erreicht, der die Kapazitäten des nationalen Marktes überfordert und sie deshalb geographisch, durch koloniale Eroberungen zu Beginn der imperialistischen Ära, ausweitet. Die höchste Form der kapitalistischen Konkurrenz manifestiert sich schließlich in den imperialistischen Kriegen. Sie taucht auf, sobald alle Gebiete des Globus unter den imperialistischen Nationen aufgeteilt sind. Unter der Leitung des Finanzkapitals findet ein Transformationsprozess der nationalen Gebilde statt. Diese Umbildung der globalen Wirtschaftseinheiten ist eine Folge der historischen Umwälzungen und brachte schließlich eine globale Arbeitsteilung mit sich. "Die Monopole verstärken den Widerspruch zwischen dem internationalen Charakter der kapitalistischen Weltwirtschaft und dem Charakter des kapitalistischen Nationalstaates." (Rosa Luxemburg)
Die Entwicklung des ökonomischen Nationalismus ist sowohl intensiv als auch extensiv.
Das Hauptgerüst der intensiven Entwicklung bildet der Protektionismus. Er beschützt nun aber nicht mehr die in Entstehung begriffenen Industrien, sondern die Monopole des nationalen Marktes und beinhaltet zwei Möglichkeiten: Im Innern bringt er einen Superprofit ein, nach Außen erlaubt er das Dumping durch den Verkauf unter dem Wert.
Die extensive Entwicklung orientiert sich an der Eroberung von vorkapitalistischen Gebieten und Kolonien, um der ständigen Notwendigkeit zur Ausdehnung des Kapitals, sprich: der Realisierung und Kapitalisierung des Mehrwerts, gerecht zu werden.
Die fundamentale Notwendigkeit der kapitalistischen Produktionsweise besteht in der ständigen Ausdehnung seines Marktes, um der ständigen Drohung einer Überproduktion an Waren, die sich in den zyklischen Krisen bemerkbar macht, zu entgehen. Einerseits steigt die organische Zusammensetzung des Kapitals und führt so zu Monopolen, zum Finanzkapital und zu einem wirtschaftlichen Nationalismus, anderseits mündet die historische Entwicklung in den Imperialismus. Bucharin definiert den Imperialismus als "ein Produkt des Finanzkapitals", was aber nichts anderes als eine falsche Herleitung ist und vor allem auch eine Außerachtlassung des gemeinsamen Ursprungs beider o.g. Aspekte des kapitalistischen Prozesses bedeutet: nämlich der Mehrwertproduktion.
Die Kolonialkriege in der ersten Phase des Kapitalismus
Der Zyklus der nationalen Kriege ist hauptsächlich durch den Kampf von sich im Aufbau befindlichen Nationen charakterisiert. Die Bedürfnisse der kapitalistischen Produktion machen eine ihnen entsprechende politische und soziale Struktur erforderlich.
Die zu erobernden Gebiete kann man folgendermaßen unterteilen:
a) Die Siedlungskolonien dienen hauptsächlich als Kapitalanlagefelder und werden als solche eine Art Verlängerung der metropolitanen Wirtschaft. Sie durchlaufen eine ähnliche kapitalistische Entwicklung und werden in einigen Bereichen gar Konkurrenten. Beispiele dafür sind die britischen Dominions, die eine vollständige kapitalistische Struktur aufweisen.
b) In den Ausbeutungskolonien mit dichter Bevölkerung verfolgt das Kapital zwei Hauptzielsetzungen: Es realisiert hier seinen Mehrwert und eignet sich günstig Rohstoffe an, was eine Wachstumsbremse für das konstante Kapital und somit eine Verbesserung des Verhältnisses der Mehrwertmasse zum Gesamtkapital bedeutet. Den Prozess der Realisierung der Waren haben wir bereits beschrieben: Der Kapitalismus zwingt die Bauern und die Kleinproduzenten zur Arbeit nicht nach ihren Bedürfnissen, sondern für den Markt, wo die kapitalistisch hergestellten Produkte gegen die landwirtschaftlichen Produkte ausgetauscht werden. Die Agrarvölker in den Kolonien müssen sich unter dem Druck des Handelskapitals in die Warenwirtschaft integrieren und auf die Großkultur von Rohstoffen wie Baumwolle, Kautschuk, Reis usw. konzentrieren. Die Kolonialanleihen sind ein Vorstoß des Finanzkapitals zur Bereitstellung von Kaufkraft, die zum Aufbau eines Verkehrsnetzes für die Waren dient: Es werden Eisenbahnen und Häfen zur Erleichterung des Rohstofftransports oder aber strategische Anlagen zur Konsolidierung der imperialistischen Herrschaft gebaut. Das Finanzkapital wacht sehr streng darüber, dass diese Kapitalien nicht etwa zur wirtschaftlichen Emanzipation der Kolonien dienen, dass sich die Produktivkräfte also nur in einer Art und Weise entwickeln, in der sie für die metropolitanen Industrien keine Gefahr darstellen können. So werden beispielsweise ihre Aktivitäten auf eine erste Verarbeitung der Rohstoffe gelenkt, die mit der einheimischen Arbeitskraft quasi gratis ausgeführt wird. Die Bauern, die unter dem Gewicht der Wucherzinsen und der Steuern ächzen, müssen die Produkte ihrer Arbeit weit unter dem Wert, wenn nicht gar unter den Kosten verkaufen.
Zu den zwei erwähnten Kolonisierungsmethoden gesellt sich eine dritte: Man belegt Einflusszonen in rückständigen Staaten, macht sie durch Anleihen und Kapitalanlagen abhängig. Der breite Strom von Kapitalexporten ging einher mit der Ausweitung des monopolistischen Protektionismus und begünstigte die Ausweitung der kapitalistischen Produktionsweise auf Zentral- und Osteuropa, nach Amerika und selbst nach Asien, wo Japan zu einer imperialistischen Macht wurde.
Die Ungleichheit der kapitalistischen Entwicklung setzte sich im Prozess der kolonialen Ausdehnung fort. Zu Beginn des Zyklus der Kolonialkriege standen die ältesten kapitalistischen Nationen bereits auf einer soliden imperialistischen Basis. Die beiden größten damaligen Mächte, Großbritannien und Frankreich, hatten bereits erkleckliche Teile Amerikas, Asiens und Afrikas unter sich aufgeteilt. Dieser Umstand trug dazu bei, dass diese Länder zuungunsten ihrer jüngeren Konkurrenten Deutschland und Japan ihre Ausdehnung vollenden konnten, während Letztere sich mit einigen mageren Flecken in Afrika und Asien zufrieden geben mussten. Jedoch waren sie in der Lage, ihre metropolitane Stellung in ungleich höherem Rhythmus zu verstärken als die alten Nationen: Deutschland konnte als Industriemacht bald den europäischen Kontinent dominieren, sich gegenüber dem englischen Imperialismus erheben und schließlich die Frage der Weltherrschaft stellen, deren Lösung im ersten imperialistischen Krieg gesucht wurde.
Während sich im Laufe des Zyklus der Kolonialkriege die wirtschaftlichen Unterschiede und die imperialistischen Widersprüche zuspitzten, konnten die daraus resultierenden Klassenkonflikte durch die Bourgeoisie in den fortgeschrittenen Ländern noch friedlich „gelöst“ werden. Dies war dank der während der kolonialen Raubzüge angehäuften Reserven an Mehrwert möglich. Die Bourgeoisie konnte nun daraus schöpfen und die privilegierten Schichten der Arbeiterklasse korrumpieren.1 Die beiden letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts schufen innerhalb der internationalen Sozialdemokratie den Boden für den Triumph des Opportunismus und Reformismus, monströse parasitäre Gewächse, die sich von den Kolonialvölkern nähren.
Der koloniale Expansionismus ist in seiner Entwicklungsfähigkeit jedoch begrenzt, da er in seinem unersättlichen Eroberungsdrang bald alle außerkapitalistischen Absatzgebiete in sich aufgesogen hat. So orientiert sich die Konkurrenz zwischen den imperialistischen Mächten, nun bar jeglicher Ausweichmöglichkeiten, hin zum imperialistischen Krieg.
„Diejenigen, die sich nun mit der Waffe in der Hand gegenüberstehen“, sagt R. Luxemburg, „sind nicht einerseits die kapitalistischen Länder und andererseits Länder mit Naturalwirtschaft, sondern Staaten, die gerade durch die Identität ihrer fortgeschrittenen kapitalistischen Entwicklung zur Auseinandersetzung gedrängt werden.“
Zyklen von interimperialistischen Kriegen und Revolutionen in der allgemeinen Krise des Kapitalismus
Während die alten Naturgesellschaften Tausende von Jahren bestehen blieben und die antiken und feudalen Gesellschaftsordnung ebenfalls eine lange historische Zeitspanne durchliefen, ist „die moderne kapitalistische Produktion dagegen“, wie Engels hervorhob, „kaum 300 Jahre alt und wurde zur herrschenden erst mit der Errichtung der Großindustrie, d.h. seit 100 Jahren, hat in dieser kurzen Zeitspanne Ungleichheiten in der Verteilung hervorgebracht - Konzentration des Kapitals in einer kleinen Anzahl Hände auf der einen Seite, Konzentration der eigentumslosen Massen in den großen Städten auf der anderen Seite -, die ihren Sturz unausweichlich vorbereiten“.
Die kapitalistische Gesellschaftsordnung ist aufgrund der zugespitzten Widersprüche ihrer Produktionsweise nicht in der Lage, ihre historische Mission zu vollenden, d.h. kontinuierlich die Produktivkräfte und die Produktivität der menschlichen Arbeitskraft weiter zu entwickeln. Die Revolte der Produktivkräfte gegen die private Aneignung wird nun permanent. Der Kapitalismus tritt in seine allgemeine Zerfallskrise ein, und die Geschichte wird Zeuge seiner blutigen Agonie.
Fassen wir die Hauptcharakteristiken dieser allgemeinen Krise zusammen: eine allgemeine und konstante industrielle Überproduktion; eine chronische und technische Arbeitslosigkeit, die die Produktion von Kapital erschwert; eine beträchtliche permanente Massenarbeitslosigkeit, die die Klassenwidersprüche verschärft; eine chronische landwirtschaftliche Überproduktion (wir analysieren diese weiter unten), die die industrielle Krise in eine allgemeine Krise verwandelt; eine beträchtliche Verlangsamung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses, hervorgerufen durch eine Verengung des Ausbeutungsfeldes der Arbeitskräfte (organische Zusammensetzung), und der kontinuierliche Fall der Profitrate, den Marx bereits voraussah, als er schrieb, dass „die Produktion jeden belebenden Anreiz verliert und in Schlaftrunkenheit verfällt, sobald sich die Bildung von Kapital ausschließlich in den Händen von einigen großen Kapitalisten befindet, für die die Masse des Profits die Rate kompensiert. Die Profitrate ist die Triebkraft der kapitalistischen Produktion. Ohne Profit keine Produktion.“ Schließlich die Notwendigkeit für das Finanzkapital, nach einem Extraprofit zu trachten, nicht durch die Produktion von Mehrwert, sondern durch die Ausplünderung sowohl der Konsumenten (durch die Verteuerung der Warenpreise über ihren Wert hinaus) als auch der Kleinproduzenten (durch die Aneignung eines Teils ihrer Arbeit). Der Extraprofit stellt also eine auf der Warenzirkulation erhobene indirekte Steuer dar. Der Kapitalismus weist die Tendenz auf, im wahrsten Sinn des Wortes parasitär zu werden.
Schon während der beiden letzten Jahrzehnte vor dem Weltkrieg hatten sich diese Faktoren der allgemeinen Krise entwickelt und in gewisser Weise gewirkt, obwohl sich die Konjunktur noch in einem Aufwärtstrend befand – sozusagen der „Schwanengesang“ des Kapitalismus. 1912 wurde der Kulminationspunkt erreicht, die kapitalistische Welt wurde von Waren überschwemmt. 1923 brach die Krise in den USA aus und griff nach Europa über. Der Funke von Sarajewo führte zur Explosion und zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Dieser stellte die Neuaufteilung der Kolonien auf die Tagesordnung. Das folgende Massaker bildete ein beträchtliches Ventil für die kapitalistische Produktion und eröffnete „großartige“ Perspektiven.
Die Schwerindustrie fabrizierte nun nicht mehr Produktions-, sondern Destruktionsmittel und auch die Konsumgüterindustrie arbeitete nun nicht mehr in erster Linie für die Existenzsicherung der Menschen, sondern an der Beschleunigung ihrer Zerstörung. Auf der einen Seite führte der Krieg die „heilsame“ Operation der Wiederherstellung der überzogenen Kapitalwerte aus, indem er sie ersatzlos zerstörte. Auf der anderen Seite ermöglichte er durch einen beträchtlichen Preisanstieg unter dem Regime von Preiskontrollen die Realisierung von Waren weit über ihren Wert. Die Masse des Extraprofits, den das Kapital aus der Ausplünderung der Konsumenten so bezog, kompensierte bei weitem die Verminderung der Mehrwertmasse, die das Resultat einer Reduzierung von Gelegenheiten zur Ausbeutung von Arbeitskraft, eine Folge ihrer Mobilisierung für die Front, war.
Der Krieg zerstört vor allem viele Arbeitskräfte, die im Frieden nicht im Produktionsprozess verwendet werden können und somit eine zunehmende Gefahr für die Herrschaft der Bourgeoisie darstellen.2 Man schätzt die Zerstörung von reellen Werten auf einen Drittel des gesamten weltweiten, durch die Arbeit von Generationen von Arbeitern und Bauern akkumulierten Reichtums. Dieses soziale Desaster nimmt aus der Sicht der weltkapitalistischen Interessen das Aussehen einer gesunden Bilanz einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an, die mit Wertpapieren und deren Gewinn- und Verlustrechnung handelt, von Gewinnen aufgebläht den Ruin zahlloser kleiner Unternehmen und das Elend der Arbeiter überdeckt. Denn obwohl die Zerstörungen apokalyptische Ausmaße annehmen, gehen sie nicht auf Kosten des Kapitalismus. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, eine Kriegswirtschaft zu etablieren, versammeln sich während des Konfliktes alle Mächte unter dem Schirm des kapitalistischen Staates. Der Staat wird zum großen und unersättlichen Konsumenten, der seine Kaufkraft mittels gigantischer Anleihen unter bezahlter Mithilfe des Finanzkapitals aus dem nationalen Sparfonds beschafft. Er bezahlt mit Verträgen, die nichts anderes als eine Hypothek auf zukünftige Einkommen der Arbeiter und Bauern sind. Marx‘ vor über 75 Jahren getroffene Feststellung erhält hier die volle Bestätigung: "Der einzige Teil des so genannten nationalen Reichtums, der wirklich in das kollektive Eigentum der modernen Völker übergeht, ist ihre öffentliche Schuld."
Der Krieg beschleunigt natürlich die Zuspitzung der sozialen Widersprüche. Der Donnerschlag des Oktober 1917 eröffnet die letzte Phase des Massakers. Der schwächste Teil des globalen Kapitalismus fiel in sich zusammen. Revolutionäre Erschütterungen ließen Mittel- und Osteuropa erbeben. Die bürgerliche Macht wankte. Dem Konflikt musste ein Ende gesetzt werden. In Russland gelang es der Arbeiterklasse unter der Führung einer in 15 Jahren der Arbeiterkämpfe und ideologischen Arbeit gestählten Partei, eine noch schwache Bourgeoisie zu überwältigen und eine eigene Diktatur zu errichten; in den Ländern Zentraleuropas jedoch ist der Kapitalismus schon fester verwurzelt und der Bourgeoisie gelang es, obschon unter dem Druck der revolutionären Welle ins Wanken geraten, mit Hilfe einer noch mächtigen Sozialdemokratie und dem Umstand der völlig Unreife der kommunistischen Parteien das Proletariat in eine Richtung zu lenken, die es immer weiter von seinen eigenen Zielsetzungen entfernte. Das Anliegen des Kapitalismus wurde durch den Waffenstillstand erleichtert, der die Möglichkeit schuf, die "Kriegsprosperität" in eine Periode des wirtschaftlichen Wachstums zu verlängern, die durch die Notwendigkeit gerechtfertigt wurde, die Kriegsproduktion der Erneuerung und Instandsetzung des Produktionsapparates in Friedenszeiten anzupassen, um dem riesigen Deckungsbedarf bei den Grundbedürfnissen nachzukommen. Dieser Aufschwung integrierte fast die Gesamtheit aller demobilisierten Arbeiter. Zudem machte die Bourgeoisie der Arbeiterklasse wirtschaftliche Zugeständnisse, wenn sie nicht gerade den Profit schmälerten (die gestiegenen Löhne folgten der Entwertung der Kaufkraft auf den Fuß). Diese Konzessionen weckten in der Arbeiterklasse die Illusion einer Verbesserung ihres Loses innerhalb des Kapitalismus. Sie isolierten die Arbeiterklasse von der revolutionären Avantgarde und erlaubten schließlich deren Liquidierung.
Die Erschütterungen auf der Ebene der Währungen verschlimmerten die bereits durch den Krieg verursachte Unordnung der Wertehierarchie und der Austauschbeziehungen. Der Aufschwung mündete (zumindest in Europa) in spekulative Aktivitäten und in eine Zunahme von fiktiven Werten statt in eine neue zyklische Phase. Er erreichte im übrigen schon bald seinen Höhepunkt. Und obwohl die Produktionskapazitäten stark vermindert worden und auch spürbar unter dem Vorkriegsniveau geblieben waren, überstieg das Produktionsvolumen schnell wieder die Kapazität der Massenkaufkraft. Deshalb erlebten wir bereits 1920 eine neue Krise, die der 3. Kongress der Kommunistischen Internationale als "Reaktion der Armut gegen die Anstrengungen, so zu produzieren, zu handeln und zu leben wie in der vorangehenden kapitalistischen Epoche", d.h. als fiktive Prosperität im Krieg und in der Nachkriegsära, definierte.
Ganz im Gegensatz zu Europa erschien die Krise in den Vereinigten Staaten noch als Schlusspunkt eines industriellen Zyklus. Der Krieg erlaubte es der US-Wirtschaft, sich vom Griff der wirtschaftlichen Depression von 1913 zu lösen und bot ihr beträchtliche Akkumulationsmöglichkeiten durch die Eliminierung ihrer europäischen Konkurrenten und der Eröffnung eines nahezu unerschöpflichen militärischen Marktes. Amerika lieferte nun Rohstoffe, landwirtschaftliche und industrielle Produkte nach Europa. Gestützt auf ihre kolossale Produktivkraft, auf eine mächtige industrialisierte Landwirtschaft, ihren enormen Kapitalressourcen und auf ihre Position als Hauptgläubiger der Welt, wurden die USA zum ökonomischen Mittelpunkt des Weltkapitalismus und verschoben so die Achse der imperialistischen Widersprüche. Der englisch-amerikanische Antagonismus trat nun an Stelle der englisch-deutschen Rivalität, die der Motor des Ersten Weltkriegs war.3 Das Ende des Krieges ließ in den USA einen starken Kontrast zwischen dem überentwickelten Produktionsapparat und dem beträchtlich zusammengeschrumpften Markt entstehen. Dieser Widerspruch entlud sich in der Krise vom April 1920, die der Wendepunkt des jungen amerikanischen Imperialismus zum Sturz seiner Ökonomie in den allgemeinen Zerfall war.
In der dekadenten Phase des Imperialismus gibt es nur noch einen Ausweg für die Gegensätze des Kapitalismus: den Krieg. Die Menschheit kann diesem Umstand allein durch die Revolution entgehen. Doch die Oktoberrevolution zeigte sich in den fortgeschrittenen westlichen Ländern nicht imstande, das Bewusstsein des Proletariats zur Reife zu bringen. Die Revolution war nicht in der Lage, die Produktivkräfte in Richtung Sozialismus zu lenken, der allein die Widersprüche des Kapitalismus überwinden konnte. So war, nachdem die letzten revolutionären Energien nach der Niederlage des deutschen Proletariats 1923 erst einmal ausgebrannt waren, die Bourgeoisie in der Lage, ihrem System wieder eine relative Stabilität zu verleihen. Obwohl sie ihre Vorherrschaft stärkte, drängte sie es nichtsdestotrotz wieder auf eine Fährte, die zu einer neuen und noch verheerenderen Feuersbrunst führt.
In der Zwischenzeit begann eine neue Periode wirtschaftlichen Aufschwungs, der alle Erscheinungsmerkmale einer Prosperität analog zu den Zyklen im aufsteigenden Kapitalismus hatte, zumindest was einen der Hauptaspekte anbelangt: nämlich die Produktionsentwicklung. Wir haben jedoch gesehen, dass das frühere Wachstum mit einer Ausdehnung des kapitalistischen Marktes einherging, der sich außerkapitalistische Gebiete einverleibte. Das Wachstum der Jahre 1924-1929 fand jedoch im Rahmen der allgemeinen Krise des Kapitalismus statt und konnte nicht auf solcherlei Möglichkeiten zurückgreifen. Im Gegenteil, wir wohnten einer Verschärfung der allgemeinen Krise bei, die von gewissen Faktoren, die wir nun kurz unter die Lupe nehmen, angetrieben wurde:
a) Dem kapitalistischen Markt ist das große Absatzgebiet des imperialen Russland amputiert worden, einem Importeur von Industriegütern und Kapital und Exporteur von Rohstoffen und landwirtschaftlichen Produkten, die dank einer heftigen Ausbeutung der Bauern billig verkauft wurden. Schlimmer noch: Dieses letzte große vorkapitalistische Gebiet mit seinen enormen Ressourcen und den unermesslichen Arbeitskräften war in fürchterliche soziale Konvulsionen gestoßen worden, was es dem Kapitalismus unmöglich machte, hier sichere Investitionen zu tätigen.
b) Der Zusammenbruch der weltwirtschaftlichen Mechanismen eliminierte das Gold als Universalwährung und als allgemeines Äquivalent für Waren. Das Fehlen eines gemeinsamen Maßstabs und die Koexistenz von Währungssystemen, die entweder auf dem Gold, dem fixen Wechselkurs oder der Nichtkonvertibilität fußten, verursachten derartige Preisunterschiede, dass der Wertbegriff zunehmend vage wurde, der internationale Handel aus den Fugen geriet und seine Unordnung durch die immer häufigere Zuflucht zum Dumping verschlimmert wurde.
c) Die chronische und allgemeine Krise der Landwirtschaft in den Agrarstaaten und in den landwirtschaftlichen Sektoren der Industriestaaten erreichte ihr volles Ausmaß in der Weltwirtschaftskrise. In der Vorkriegszeit erhielt die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion den Hauptimpuls von der Industrialisierung und der landwirtschaftlichen Kapitalisierung in den großen Gebieten der USA, Kanadas und Australiens und weitete sich auf die rückständigen Gebiete Zentraleuropas und Südamerikas aus, deren hauptsächliche Agrarwirtschaften ihren halbautonomen Charakter verloren und nun vollständig vom Weltmarkt abhängig wurden.
Darüber hinaus übten die Industrieländer, welche normalerweise Importeure landwirtschaftlicher Güter waren, eine Politik des wirtschaftlichen Nationalismus aus und versuchten, ihre eigenen agrarwirtschaftlichen Defizite durch die Erweiterung der Anbauflächen für Getreide und durch eine Steigerung der Erträge unter dem Schutz von Zollschranken und Subventionen auszugleichen.
Diese Praxis wurde zunehmend auch in den Ländern mit industrialisierter Landwirtschaft (USA, Kanada und Argentinien) angewendet. Aus dem monopolistischen Druck resultierte ein Regime von unrealistischen Agrarpreisen, die auf das Niveau der höchsten Produktionskosten anstiegen und schwer auf der Massenkaufkraft lasteten (dies macht sich vor allem beim Getreide, einem Massenkonsumartikel, bemerkbar).
Die völlige Integration der bäuerlichen Wirtschaften in den Markt führte zu einer für den Kapitalismus wichtigen Konsequenz: Die nationalen Märkte konnten nun nicht mehr ausgedehnt werden und hatten den Punkt der absoluten Sättigung erreicht. Der Bauer blieb zwar scheinbar ein unabhängiger Produzent, jedoch wurde er genauso wie ein Lohnabhängiger in die Sphäre der kapitalistischen Produktion integriert: Gleich wie der Arbeiter durch den Zwang zum Verkauf seiner Arbeitskraft seiner Mehrarbeit beraubt wird, ist auch der Bauer nicht in der Lage, sich die in seinem Produkt enthaltene Mehrarbeit anzueignen, da er dieses unter seinem Wert verkaufen muss.
Im nationalen Markt zeigt sich die Vertiefung der kapitalistischen Widersprüche deutlich: Einerseits nimmt der Anteil des Proletariats am Gesamtprodukt zunächst relativ, schließlich absolut ab; die Erhöhung der permanenten Arbeitslosigkeit sowie der industriellen Reservearmee vermindert den Absatz für landwirtschaftliche Güter. Die daraus resultierende Verringerung der kleinbäuerlichen Kaufkraft schränkt den Markt für kapitalistische Güter ein. Die konstante Senkung der allgemeinen Massenkaufkraft der Arbeiter und Bauern gerät nun in einen immer krasseren Gegensatz zur überbordenden landwirtschaftlichen Produktion, die vor allem Massenkonsumgüter herstellt.
Die Existenz einer endemischen landwirtschaftlichen Überproduktion (sie wird anhand des Falls der Getreidepreise zwischen 1926 und 1933 um zwei Drittel klar ersichtlich) verstärkt die Zerfallsfaktoren, die innerhalb der allgemeinen Krise des Kapitalismus wirken. Denn die landwirtschaftliche Überproduktion unterscheidet sich streng genommen von der kapitalistischen Überproduktion insofern, als ihr nicht entgegengehandelt werden kann (es sei denn durch den „glücklichen“ Umstand einer Naturkatastrophe), betrachtet man die spezifische Natur der landwirtschaftlichen Produktion, die noch immer unzureichend zentralisiert und kapitalisiert ist und Millionen von Familien beschäftigt.
Wir haben nun die Bedingungen bestimmt, in deren Rahmen sich die interimperialistischen Widersprüche entwickeln. Es ist nun leicht, den wahren Charakter der ungewöhnlichen Prosperität in der Periode der Stabilisierung des Kapitalismus zu erraten. Die Hauptzüge der Konjunkturphase von 1924 bis 1928 - die beträchtliche Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktion, des globalen Handelsvolumens und der internationalen Kapitalbewegungen – erklären sich aus der Notwendigkeit, die Spuren des Krieges zu entfernen und die früheren Produktionskapazitäten wiederaufzubauen, so dass sie für ihr fundamentales Ziel genutzt werden konnten: die Vollendung der ökonomischen und politischen Struktur der imperialistischen Staaten, die die Sicherstellung ihrer Konkurrenzfähigkeit bestimmt, und die Herrichtung der Ökonomien für den Krieg. Es wird nun klar, dass all diese konjunkturellen Schwankungen, obwohl sie sich auf einer aufsteigenden Kurve bewegen, nichts anderes als die Veränderungen der imperialistischen Kräfteverhältnisse widerspiegeln, die in der Neuaufteilung der Welt durch den Versailler Vertrag fixiert worden waren.
Der technische Fortschritt und das Wachstum der Produktionskapazitäten nahmen hauptsächlich in Deutschland gigantische Ausmaße an. Nach den inflationären Erschütterungen der Jahre 1922/23 nahmen die englischen, französischen und vor allem amerikanischen Kapitalinvestitionen derart zu, dass sie keine heimische Anlagemöglichkeit mehr vorfanden und durch die Banken insbesondere an die UdSSR zur Finanzierung des Fünfjahresplans geleitet wurden.
Im Laufe des Expansionsprozesses der Produktivkräfte wurde auch das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate wieder virulent. Die organische Zusammensetzung nahm nun noch schneller als die Entwicklung des Produktionsapparates zu, was sich vor allem in den Hauptbranchen zeigte. Das Resultat war eine Änderung im konstanten Kapital: Der fixe Teil (Maschinen) stieg stark im Verhältnis zum zirkulierenden Teil (Rohstoffe und Verbrauchsgüter) und wurde zu einem einengenden Faktor, der die Produktionskosten in dem Masse erhöhte, wie das Produktionsvolumen schrumpfte und das fixe Kapital den Gegenwert zum geliehenem Kapital darstellte. Die mächtigsten Unternehmen reagierten daher beim geringsten Konjunktureinbruch am sensibelsten. 1929, auf dem Höhepunkt der wirtschaftlichen Prosperität, wurden in den USA für die gesamte Stahlproduktion lediglich 85% der Produktionskapazitäten benötigt; im März 1933 war die Auslastungsrate der Produktionskapazitäten auf 15% gefallen. 1932 wurden in den großen Industrieländern wertmäßig nicht einmal mehr so viele Produktionsgüter produziert, wie eigentlich zum Ersatz des verbrauchten fixen Kapitals notwendig gewesen wären.
Solche Fakten spiegeln einen anderen widersprüchlichen Aspekt des dekadenten Imperialismus wider: die Aufrechterhaltung eines teilweise ungenutzten Produktionsapparates als wichtiges militärisches Potenzial.
In der Zwischenzeit griff das Finanzkapital, um die Produktionskosten zu vermindern, auf die uns bereits vertrauten Mittel zurück: auf die Senkung der Rohstoffpreise, um den Wert des zirkulierenden Teils des konstanten Kapitals zu reduzieren; auf die Festsetzung der Verkaufspreise über ihren Wert, um einen Extraprofit zu erzielen; auf die Reduzierung des variablen Kapitals entweder mittels direkter bzw. indirekter Lohnsenkungen oder mittels der Intensivierung der Arbeit, die durch eine Verlängerung des Arbeitstages erreicht und durch Rationalisierung und Fließbandarbeit realisiert wird. Man versteht, weshalb diese letztgenannten Methoden gerade in den technisch am meisten entwickelten Ländern, nämlich den USA und Deutschland, am rigorosesten eingeführt worden sind, d.h. in Ländern, die in Zeiten der Rezession benachteiligt sind gegenüber weniger entwickelten Staaten, in denen die Produktionspreise viel stärker auf eine Lohnsenkung reagieren.
Die Rationalisierung findet indessen ihre Grenze in der menschlichen Kapazität. Außerdem erlauben die Lohnsenkungen nur so lange eine Steigerung der Mehrwertmasse, wie es keine Senkung der Zahl der beschäftigten Arbeiter gibt. Konsequenterweise müssen zur Lösung des Grundproblems - Erhaltung des Werts und der Rentabilität des investierten Kapitals durch die Produktion und Realisierung eines Maximums an Mehrwert und Extraprofit (bei parasitärer Ausweitung des Erstgenannten) - andere Richtungen eingeschlagen werden. Um lebensunfähiges Kapital am Leben zu halten und ihm einen Profit zu sichern, muss man ihm "frisches" Geld zur Verfügung stellen, was das Finanzkapital natürlich nicht seinen eigenen Fonds zu entnehmen bereit ist. Es schöpft dieses Geld also entweder aus den Ersparnissen, die ihm der Staat zur Verfügung stellt, oder aus der Kaufkraft der Verbraucher. Daher die Entwicklung der Monopole, der staatlichen Teilhaberschaft an Mischbetrieben, daher die Schaffung von kostspieligen „öffentlichen Bedürfnissen“, Anleihen, der staatlichen Beihilfen für unprofitable Betriebe bzw. der staatlichen Garantien ihrer Einnahmen. Deshalb auch die Kontrolle der Haushaltsausgaben, die "Demokratisierung" der Steuern durch die Erweiterung der steuerpflichtigen Basis, die Steuererlasse zu Gunsten des Kapitals, um die "Lebenskraft" der Nation wiederzubeleben, die Verminderung der "nichtproduktiven" sozialen Ausgaben etc.
Doch all dies genügt nicht. Die produzierte Mehrwertmasse bleibt ungenügend und die Produktionssphäre muss ausgedehnt werden. Während der Krieg das große Ventil für die kapitalistische Produktion ist, ist es in „Friedenszeiten“ der Militarismus (d.h. alle Aktivitäten, die mit der Vorbereitung auf den Krieg zu tun haben), der den Mehrwert fundamentaler Bereiche der vom Finanzkapital kontrollierten Produktion realisiert. Letzteres bestimmt die Aufnahmekapazitäten des Militarismus, indem es einen Teil der Kaufkraft der Arbeiter- und Bauernmassen konfisziert und durch die Besteuerung an den Staat überweist, welcher der Besitzer der Zerstörungsmittel und der strategischen Öffentlichkeitsarbeit ist. Doch der so gewonnene Aufschub kann die Widersprüche des Kapitalismus natürlich nicht lösen. Marx hat dies bereits vorausgesehen: "Der Widerspruch zwischen der durch das Kapital konstituierten allgemeinen gesellschaftlichen Macht und der Macht jedes einzelnen Kapitalisten, über die gesellschaftlichen Bedingungen der kapitalistischen Produktion zu bestimmen, entwickelt sich immer weiter." All diese der Bourgeoisie innewohnenden Antagonismen müssen schließlich von ihrem Herrschaftsapparat, den kapitalistischen Staat, in die Hände genommen werden, der dazu aufgerufen ist, die fundamentalen Interessen der gesamten bürgerlichen Klasse vor der sie bedrohenden Gefahr zu beschützen und die Vereinigung der Partikularinteressen der verschiedenen kapitalistischen Formationen – die teilweise bereits vom Finanzkapital ausgeführt worden war – zu vervollständigen. Je weniger Mehrwert es zu teilen gibt, desto schärfer sind die internen Konflikte und desto mehr gebietet sich diese Konzentration. Die italienische Bourgeoisie war die erste, die Zuflucht im Faschismus suchte, weil ihre zerbrechliche ökonomische Struktur unter dem Druck nicht nur der Krise von 1921, sondern auch der gewalttätigen sozialen Konflikte auseinander zu brechen drohte.
Deutschland, eine Macht ohne Kolonien und mit einem schwachen imperialistischen Fundament, war im vierten Jahr der Weltwirtschaftskrise dazu gezwungen, die Gesamtheit der wirtschaftlichen Ressourcen im Schosse des totalitären Staates zu konzentrieren, indem es die einzige Kraft zerschlug, die sich selbständig gegen die kapitalistische Diktatur hätte wehren können. Darüber hinaus war in Deutschland der Umwandlungsprozess der Wirtschaft in ein Instrument des Krieges am fortgeschrittensten. Hingegen verfügten die weit mächtigeren imperialistischen Mächte Frankreich und England noch über beträchtliche Reserven an Mehrwert; sie hatten noch nicht definitiv den Weg der staatlichen Zentralisierung betreten.
Wir haben gerade gesehen, dass das Wachstum der Jahre 1924 bis 1928 eine Folge der Wiederherstellung und strukturellen Verstärkung der imperialistischen Mächte war, mit einer Anzahl von zweitrangigen Staaten, die entsprechend ihren eigenen Interessen und Neigungen sich in den Dunstkreis Ersterer begeben hatten. Aber gerade weil diese Expansion zwei entgegengesetzte – obwohl eng miteinander verknüpfte – Bewegungen beinhaltet, eine in Richtung einer Ausweitung der Produktion und der Zirkulation von Waren, die andere in Richtung Zersplitterung des Weltmarktes in unabhängige Volkswirtschaften, konnte dieser Sättigungspunkt nicht lange hinausgezögert werden.
Die Weltkrise, die die Traumtänzer des Wirtschaftsliberalismus als eine zyklische Krise betrachtet wissen wollen, die dank der Effekte „spontaner“ Faktoren gelöst werden könne und der der Kapitalismus daher durch die Anwendung von Arbeitsprogrammen nach Art von De Man entweichen könne, eröffnet die Periode der interimperialistischen Kämpfe, zunächst ökonomisch und politisch, dann gewaltsam und blutig, sobald die Krise alle friedlichen Möglichkeiten des Kapitalismus erschöpft hat.
Wir können hier den Prozess des in seinem Ausmaß noch nie da gewesenen wirtschaftlichen Zusammenbruchs nicht analysieren. Während der Krise werden alle von uns bereits beschriebenen Versuche, einen Ausweg aus seinen Widersprüchen zu finden, zigfach und mit verzweifelter Energie vom Kapitalismus angewendet: Ausweitung der Monopole vom nationalen Markt auf die Kolonien und Versuche, unter dem Schutz einer einzigen Zollmauer (Ottawa) einheitliche Imperien zu bilden; die Diktatur des Finanzkapitals und die Verstärkung seiner parasitären Aktivitäten; der Rückzug der internationalen Monopole, die im Angesicht des aufsteigenden Nationalismus zur Aufgabe gezwungen wurden (Kreuger Krach); die Zuspitzung der Gegensätze durch die Errichtung von Zollschranken, zu denen sich Auseinandersetzungen über Währungen gesellen, was die Goldbestände der Zentralbanken in Mitleidenschaft zog; im Handel die Einsetzung von Institutionen zur Regulierung von Ausgleichszahlungen oder gar Tauschhandel, die die Regelfunktion des Goldes als allgemeingültiges Äquivalent für sämtliche Waren übernahmen; die Annullierung nicht wiedergutzumachender „Reparationen“ und die Nichtanerkennung der amerikanischen Schulden durch die „Sieger“staaten, die Suspendierung des Schuldendienstes für private Anleihen und Schulden in den „besiegten“ Staaten, was zu einem Zusammenbruch der internationalen Kreditpolitik und der „moralischen“ Werte des Kapitalismus führte.
Wenn wir die bestimmenden Faktoren der allgemeinen Krise des Kapitalismus erkennen, begreifen wir, warum die Weltkrise von der „natürlichen“ Wirkung der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus nicht aufgefangen werden kann und warum im Gegenteil diese Gesetzmäßigkeiten durch die kombinierte Macht von Finanzkapital und kapitalistischem Staat ausgehöhlt werden, die sämtliche Manifestationen von kapitalistischen Partikularinteressen verdichtet haben. Unter diesem Gesichtswinkel müssen all die vielfältigen "Experimente" und Versuche zur Verbesserung der Lage, zur Wiedergenesung gesehen werden, die während der Krise auftauchten. All diese Aktivitäten werden nicht auf internationaler Ebene im Sinne einer Verbesserung der Weltkonjunktur, sondern auf der nationalen Ebene der imperialistischen Wirtschaften und in einer Form ausgeübt, die ihren Strukturen angepasst ist. Wir können hier nicht spezifische Ausdrücke wie die der Deflation, Inflation oder Währungsabwertung analysieren. Sie sind lediglich von zweitrangigem Interesse, da sie untergeordnet und kurzlebig sind. All diese künstlichen Wiederbelebungsversuche der sich im Zerfall befindlichen Wirtschaft bringen dennoch gemeinsame Früchte hervor. Diejenigen, die demagogisch versprachen, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Kaufkraft der Massen zu steigern, endeten mit dem gleichen Resultat: nicht mit der Senkung der Arbeitslosenzahlen, mit denen sich die offiziellen Statistiken brüsten, sondern mit der Verteilung der verfügbaren Arbeit unter immer mehr Arbeitern, was natürlich nur eine Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen verursacht.
Die Steigerung der Produktion im Bereich der Investitionsgüter (und nicht der Konsumgüterindustrie), die sich in jedem Imperialismus bemerkbar macht, wird einzig durch die Politik der öffentlichen (strategischen) Arbeiten und des Militarismus alimentiert, deren Bedeutung wir sehr gut kennen.
Wohin er sich auch immer wendet, was auch immer er versucht, um dem Griff der Krise zu entkommen, der Kapitalismus wird unaufhaltsam zu seinem Schicksal, der Auslösung eines neuen Krieges, getrieben. Heute ist es noch nicht möglich zu bestimmen, wann und wo er ausbrechen wird. Es ist jedoch wichtig zu unterstreichen, dass er im Zusammenhang mit der Aufteilung Asiens ausbrechen und weltweit sein wird.
Alle Imperialismen steuern zum Krieg, ob sie nun im demokratischen Gewand oder in der faschistischen Uniform daher kommen. Das Proletariat darf sich nicht in eine abstrakte Unterscheidung zwischen „Demokratie“ und Faschismus ziehen lassen, denn dies lenkt es nur von seinem täglichen Kampf gegen die eigene Bourgeoisie ab. Seine Aufgaben und Taktiken von den illusorischen Perspektiven einer wirtschaftlichen Wiedergenesung oder von der Scheinexistenz von gegen den Krieg eingestellten, kapitalistischen Kräften abhängig zu machen würde das Proletariat geradewegs in den Krieg führen oder es jeder Möglichkeit berauben, den Weg zur Revolution zu finden.
MITCHELL
1 Wir lehnen diese falsche Auffassung über die "privilegierten Schichten der Arbeiterklasse" ab, die unter dem Konzept der "Arbeiteraristokratie" bekannt ist. Dieses Konzept ist hauptsächlich von Lenin entwickelt worden (der es wiederum von Engels aufgegriffen hatte) und wird heute noch von den bordigistischen Gruppen vertreten. Wir haben unsere Auffassung zu dieser Frage im Artikel "Die Arbeiteraristokratie: eine soziologische Theorie zur Spaltung der Arbeiterklasse" (Internationale Revue, Nr. 25, franz., engl. und span. Ausgabe, 2. Halbjahr 1981) dargelegt.
2 Auch wenn es unbestreitbar ist, dass der „Krieg enorme Mengen an Arbeit zerstört“, mit anderen Worten: dass er zu Massakern an einer großen Anzahl von Proletariern führt, so kann dieser Satz doch zum Schluss führen, dass die Bourgeoisie das Mittel des Krieges ergreift, um der Gefahr durch das Proletariat zu begegnen. Diese Auffassung teilen wir nicht. Diese unmarxistische Sichtweise, gemäß der der Krieg im Kapitalismus tatsächlich „ein Bürgerkrieg der Bourgeoisie gegen das Proletariat“ sei, wurde innerhalb der Italienischen Linken vor allem von Vercesi vertreten.
3 Diese Behauptung sollte bald durch die Realität widerlegt werden. Sie stützte sich auf eine politische Position, gemäß der die Hauptkonkurrenten im Handel zwingend auch die Hauptfeinde auf imperialistischer Ebene sein mussten. Diese Auffassung ist bereits in einer Debatte der Komintern vertreten worden. Es war Trotzki, der ihr zu Recht aus dem Grunde widersprach, dass militärische Antagonismen nicht notwendig ökonomische Rivalitäten widerspiegeln.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Erbe der kommunistischen Linke:
Deutsche Revolution XII (Teil 1)
- 3440 Aufrufe
1923: Die Bourgeoisie will der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beifügen
Wir haben in den vorherigen Artikeln gesehen, wie nach dem Erreichen des Höhepunktes der revolutionären Welle 1919 das Proletariat in Russland isoliert blieb. Während die Komintern gegenüber dem Rückflussß der Welle durch eine opportunistische Kehrtwende zu reagieren versuchte, dadurch ihre Degenerierung einleitete, verselbständigte sich der russische Staat zunehmend gegenüber der Klassenbewegung und versuchte, die Komintern verstärkt in seinen Dienst zu stellen.
Gleichzeitig spürte die Bourgeoisie, nachdem sie den Bürgerkrieg gegen Russland beendet hatte, dass nicht mehr die gleiche Gefahr von der Arbeiterklasse in Russland ausging und dass international die Welle von Kämpfen rückläufig war. Sie hatte bemerkt, dass die Komintern nicht mehr mit aller Kraft die Sozialdemokratie bekämpfte, ja, statt dessen sich gar mit ihr durch Einheitsfronten zu verbünden suchte. Instinktiv erkannte die bürgerliche Klasse, dass der russische Staat nicht mehr nach Ausdehnung der Revolution strebte, sondern zu einer Kraft geworden war, die nach einem eigenständigen Platz als Staat suchte, wie es die Konferenz von Rapallo hatte deutlich werden lassen. Die Bourgeoisie spürte, dass sie gegen die Arbeiterklasse eine internationale Offensive einleiten konnte, deren Schwerpunkt in Deutschland liegen sollte.
Neben Russland 1917 war die Arbeiterklasse in Deutschland und Italien am weitesten gegangen. Trotz der Niederlagen im Frühjahr 1920 nach der Abwehr des Kapp-Putsches und selbst nach den Märzkämpfen 1921 zeigte sich die Arbeiterklasse in Deutschland immer noch kämpferisch, aber international war sie relativ isoliert. Während die Arbeiter in Österreich, Ungarn und Italien bereits besiegt waren und sich massiven Angriffen ausgesetzt sahen, und das Proletariat Deutschlands, Polens und Bulgariens zu verzweifelten Reaktionen getrieben wurde, blieb die Lage in Frankreich und Großbritannien vergleichsweise stabil.
Bei ihrem Vorhaben, der Arbeiterklasse in Deutschland eine entscheidende Niederlage beizufügen und somit die ganze internationale Arbeiterklasse zu schwächen, konnte die Bourgeoisie mit der internationalen Unterstützung der gesamten Kapitalistenklasse rechnen. Zudem hatte sie sich gleichzeitig durch die Integration der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften in den Staatsapparat beträchtlich verstärken können.
1923 versuchte die Bourgeoisie, die Arbeiterklasse in eine nationalistische Falle zu locken, in der Hoffnung, sie so von ihrem Kampf gegen den Kapitalismus abzulenken.
Die verheerende Politik der KPD: Schutz der Demokratie und Einheitsfront
Wir haben in früheren Artikeln aufgezeigt, wie die KPD sich durch den Ausschluss der ‘Linksradikalen’, die später die KAPD gründeten, selbst schwächte und dadurch die Tür zum Opportunismus weit öffnete.
Während die KAPD vor den Gefahren des Opportunismus und der Degenerierung der Komintern sowie vor dem Staatskapitalismus in Russland warnte, reagierte die KPD opportunistisch. Sie war es, die 1921 in einem „Offenen Brief an die Arbeiterparteien“ als erste Partei zu einer Einheitsfront aufrief.
„Der Kampf um die Einheitsfront führt zur Eroberung der alten proletarischen Klassenorganisationen (Gewerkschaften, Genossenschaften usw.). Er verwandelt die durch die Taktik der Reformisten zu Werkzeugen der Bourgeoisie gewordenen Organe der Arbeiterschaft wieder in Organe des proletarischen Klassenkampfes.“
Und das, obwohl die Gewerkschaften selbst mit Stolz bekannt hatten: „Aber die Tatsache, dass die Gewerkschaften der einzige, feste Damm sind, der Deutschland bisher vor der bolschewistischen Flut geschützt hat, bleibt bestehen!“ (Korrespondenzblatt der Gewerkschaften, Juni 1921) Der KPD-Gründungsparteitag hatte sich nicht getäuscht, als er mit der Stimme Rosa Luxemburgs erklärte: „Die offiziellen Gewerkschaften haben sich im Verlaufe des Krieges und in der Revolution bis zum heutigen Tage als eine Organisation des bürgerlichen Staates und der kapitalistischen Klassenherrschaft gezeigt.“ Nun jedoch trat man für die Rückverwandlung der zum Klassenfeind übergelaufenen Organe in Arbeiterorgane ein.
Gleichzeitig plädierte die KPD-Führung unter Brandler für eine Einheitsfront von Oben, also mit der SPD-Führung. Dieser Ausrichtung stellte sich der Flügel um Fischer und Maslow mit der Losung der ‚Arbeiterregierung‘ innerhalb der KPD entgegen. Er meinte, die Losung der ‘Arbeiterregierung’ ebenso wie „die Unterstützung der sozialdemokratischen Minderheitsregierung (bedeutet) (...) nicht ein Weitertreiben der Zersetzung der SPD“, sie fördere „die Illusionen der Massen, als ob das sozialdemokratische Kabinett eine Machtposition der Arbeiterklasse wäre“; „es heiße die KPD zu liquidieren, wolle man der SPD als Partei zugestehen, dass sie revolutionär kämpfen könne“.
Aber vor allem die gerade entstandenen Strömungen der Kommunistischen Linken in Deutschland und in Italien wandten sich gegen diese Politik der Einheitsfront.
„Was die Arbeiterregierung angeht, fragen wir: Warum will man sich mit den Sozialdemokraten verbünden? Um nur das zu machen, was sie zu machen verstehen, was sie können und wollen, oder um sie zu aufzufordern, das zu machen, was sie nicht vermögen, nicht können und nicht wollen? Erwartet man von uns, dass wir den Sozialdemokraten sagen, wir seien bereit, mit ihnen zusammenzuarbeiten, gar im Parlament und gar in dieser Regierung, die man als ‘Arbeiterregierung’ bezeichnet? In diesem Fall, d.h. wenn man von uns verlangt, dass wir im Namen der Kommunistischen Partei ein Projekt der Arbeiterregierung erarbeiten, an dem sich die Kommunisten und Sozialdemokraten beteiligen sollten, und diese Regierung den Massen als eine ’anti-bürgerliche Regierung’ präsentieren, entgegnen wir: Wir übernehmen die volle Verantwortung für unser Handeln, denn solch eine Haltung steht im völligen Gegensatz zu den Grundprinzipien des Kommunismus.“ (Il Comunista, 26.3.1922)
Auf dem 4. Kongress „akzeptierte die KP Italiens somit nicht, sich an gemeinsamen Organen mit verschiedenen politischen Organisationen zu beteiligen (...) Sie vermied es auch, gemeinsame Erklärungen mit politischen Parteien zu verabschieden, wenn diese Erklärungen im Widerspruch zu ihrem Programm standen und der Arbeiterklasse als das Ergebnis von Verhandlungen dargestellt wurden, die darauf abzielten, eine gemeinsame Linie zu finden (...) Von Arbeiterregierung zu sprechen (....) heißt, in der Praxis das politische Programm des Kommunismus zu verwerfen, d.h. die Notwendigkeit, die Massen auf den Kampf für die Diktatur des Proletariats vorzubereiten.“ (Bericht der KPI auf dem 4. Kongress der Kommunistischen Internationale, Nov. 1922)
Ungeachtet dieser Kritik der Linkskommunisten bot schon im November 1922 die KPD entgegen dem Votum der Komintern der SPD in Sachsen eine Koalition an.
Die gleiche KPD, die es auf ihrer Gründungskonferenz Anfang 1919 noch abgelehnt hatte, „mit den Handlangern der Bourgeoisie, mit den Scheidemann-Ebert die Regierungsgewalt zu teilen, weil er (der Spartakusbund) in einer solchen Zusammenwirkung einen Verrat an den Grundsätzen des Sozialismus, eine Stärkung der Gegenrevolution und eine Lähmung der Revolution erblickt“, trat nun für das exakte Gegenteil ein.
Zudem ließ die KPD sich von den in den Parlamentswahlen errungenen Stimmenanteil blenden, als sie glaubte, diese Stimmen würden das tatsächliche Kräfteverhältnis oder gar einen entsprechenden Einfluss der Partei zum Ausdruck bringen.
Die ersten faschistischen Gruppierungen rekrutierten sich bereits aus Mittelstand und der Kleinbourgeoisie, etliche rechtsradikale Wehrgruppen fingen, meist mit Kenntnis des Staates, an, Militärübungen abzuhalten. Der Großteil dieser Gruppen war direkt aus den Freikorps hervorgegangen, die die SPD-geführte Regierung 1918-1919 als Antwort auf die revolutionären Kämpfe der Arbeiter aufgestellt hatte. Schon am 31. August 1921 hatte die Rote Fahne erklärt, dass „die Arbeiterschaft das Recht und die Pflicht hat, den Schutz der Republik vor der Reaktion zu übernehmen...“. Ein Jahr später, im November 1922, unterzeichnete die KPD ein Abkommen mit den Gewerkschaften und der SPD (‘Berliner Abkommen’), das die „Demokratisierung der Republik“ (Republikschutzgesetz, Entfernung der Reaktionäre aus Verwaltung, Justiz und Armee) anstrebte. Damit verstärkte die KPD die Illusionen der Arbeiter über die bürgerliche Demokratie und stellte sich in direkten Gegensatz zu den Positionen der Italienischen Linken um Bordiga, die auf dem 4. Weltkongress im November 1922 in ihrer Analyse des Faschismus betonte, dass die bürgerliche Demokratie nur die Maske der Diktatur der Bourgeoisie sei.
In einem früheren Artikel haben wir bereits hervorgehoben, dass die Komintern insbesondere in der Person Radeks ihre Kritik an der Politik der KPD nicht den Statuten entsprechend vortrug und der KPD-Führung oft dadurch in den Rücken fiel, indem sie parallel zu ihr fungierte. Zudem drangen immer mehr kleinbürgerliche Umgangsformen in die Partei ein. Eine Stimmung des Misstrauens und der Verdächtigungen machte sich breit, anstatt durch brüderliche Kritik, wo notwendig, eine Stärkung der Organisation herbeizuführen[1].
Die herrschende Klasse spürte, dass die KPD dabei war, Verwirrung in der Arbeiterklasse zu stiften, statt durch Klarheit und Entschlossenheit eine echte Führungsrolle zu übernehmen. Die herrschende Klasse ahnte, dass sie die opportunistische Haltung der KPD noch gegen die Arbeiterklasse einsetzen konnte.
Mit dem Abebben der revolutionären Welle eine Zuspitzung der imperialistischen Konflikte
Die Veränderung im Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie und Proletariat nach dem Abebben der revolutionären Welle nach 1920 wurde auch anhand der interimperialistischen Beziehungen sichtbar. Kaum war die unmittelbare Bedrohung durch die Arbeiterklasse zurückgegangen und die revolutionäre Flamme der russischen Arbeiterklasse erloschen, begannen die imperialistische Spannungen wieder an Schärfe zuzunehmen.
Deutschland selbst strebte mit allen Tricks danach, seine durch den Ausgang des Weltkriegs und die Unterzeichnung des Versailler Vertrages eingetretene Schwächung rückgängig zu machen. Gegenüber den ‘Siegerländern’ im Westen bestand seine Taktik darin zu versuchen, Großbritannien und Frankreich gegeneinander auszuspielen, da an eine offene militärische Konfrontation mit ihnen nicht zu denken war. Gleichzeitig versuchte Deutschland, die traditionell engen Beziehungen zu seinen Nachbarn im Osten wieder zu erneuern. Wir haben in einem früheren Artikel beschrieben, wie zielstrebig die deutsche Bourgeoisie in Anbetracht der imperialistischen Spannungen im Westen geheime Waffenlieferungen und militärische Zusammenarbeit mit dem neuen russischen Staat beschlossen hatte.
So erkannte einer der großen Militärchefs in Deutschland: „Seit dem Friedensabschluss sind die Beziehungen zu Russland die erste und bislang nahezu einzige Verstärkung, die wir durchsetzen konnten. Dass sich die Grundlagen dieser Beziehung in der Wirtschaft befinden, liegt in der Natur der Sache; aber die Stärke liegt darin begründet, dass diese wirtschaftliche Annäherung die Möglichkeit einer politischen und damit auch militärischen Verbindung eröffnet.“ (Seeckt, zitiert von Carr, S. 434)
Gleichzeitig hatte der russische Staat in Gestalt Bucharins verlauten lassen: „Ich behaupte, dass wir schon mächtig genug sind, ein Bündnis mit einer ausländischen Bourgeoisie einzugehen, damit wir mittels dieses bürgerlichen Staates eine andere Bourgeoisie besiegen (...) Falls ein Militärbündnis mit einem bürgerlichen Staat geschlossen wird, besteht die Aufgabe der Genossen in jedem Land darin, zum Sieg der beiden Verbündeten beizutragen.“ (Bucharin, zitiert von Carr, ebenda)
„Wir sagen diesen Herren der deutschen Bourgeoisie (...) wenn Sie wirklich gegen die Besatzung, wirklich gegen die Beleidigungen durch die Entente ankämpfen wollen, haben Sie keine andere Wahl als eine Annäherung mit dem ersten proletarischen Land zu suchen, das unbedingt diese Länder unterstützen muss, die jetzt in einer erbärmlichen Abhängigkeit gegenüber dem internationalen Imperialismus stecken.“ (Sinowjew, 12. Parteikongress, April 1923)
In nationalistischer Manier sprach das deutsche Kapital von der ‘Schmach und der Unterjochung’ durch das Auslandskapital, insbesondere durch Frankreich. So gaben deutsche Militärführer sowie prominente Vertreter der deutschen Bourgeoisie wiederholt öffentliche Erklärungen von sich, denen zufolge die einzige Rettung für die deutsche Nation gegen die Knechtschaft von Versailles in einem Militärbündnis mit der Sowjetunion und einem „revolutionären Volkskrieg“ gegen den französischen Imperialismus lag.
Innerhalb des russischen Staates, wo sich mittlerweile eine neue Schicht von staatskapitalistischen Verwaltern herausgebildet hatte, stieß diese Politik auf ein großes Echo.
Auch die proletarischen Internationalisten innerhalb der Komintern und der russischen Partei, die noch am Ziel der Ausdehnung der Weltrevolution festhielten, ließen sich durch diese Lockrufe des deutschen Kapitals blenden. Während es für das deutsche Kapital nie in Frage gekommen wäre, ein wirkliches Bündnis mit Russland gegen den Westen einzugehen, erschien den damaligen russischen Staatsführern und der Komintern-Spitze dieses Angebot als echt, sie ließen sich täuschen und liefen in die Falle. So trugen sie aktiv dazu bei, dass die Arbeiterklasse in die gleiche Falle getrieben wurde.
Mit Rückendeckung der gesamten Kapitalistenklasse heckte die deutsche Bourgeoisie folgenden Plan gegen die Arbeiterklasse aus. Einerseits wollte das deutsche Kapital dem Druck des Versailler Vertrages ausweichen, indem man insbesondere gegenüber Frankreich die Reparationsleistungen verschleppte und einzustellen drohte, andererseits sollte die Arbeiterklasse in Deutschland in eine nationalistische Falle gelockt werden. Dazu war jedoch die `Mithilfe‘ des russischen Staates und der Komintern erforderlich.
So fasste die deutsche Bourgeoisie den bewussten Entschluss, das französische Kapital durch Zahlungsverweigerung der Reparationsschulden zu provozieren. Frankreich reagierte darauf am 11. Januar 1923 mit der Besetzung des Ruhrgebietes.
Gleichzeitig ergänzte das deutsche Kapital seine Taktik durch den Entschluss, an der durch die Krise hervorgerufenen Inflationsspirale bewusst zu drehen. Das deutsche Kapital setzte die Inflation als eine Waffe ein, um die Reparationskosten abzuschwächen und um die Last der Kriegsanleihen zu erleichtern. Außerdem sollte somit die Modernisierung seiner Produktionsanlagen finanziert werden.
Die Bourgeoisie war sich dessen bewusst, dass die Inflation der Stachel im Fleisch der Arbeiterklasse sein würde, der sie in den Kampf treiben würde. Und der herrschenden Klasse kam es darauf an, diesen einkalkulierten Abwehrkampf der Arbeiterklasse auf ein nationalistisches Terrain zu locken. Der ausgelegte Köder war die in Kauf genommene Ruhrgebietsbesetzung durch französisches Militär. Es war daher kreuzwichtig für die Arbeiterklasse und ihre Revolutionäre, diese Falle der sich im Überlebenskampf befindlichen deutschen Bourgeoisie zu erkennen und zu entblößen. Andernfalls drohte die Gefahr, dass die deutsche Bourgeoisie der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beifügte. So war die deutsche Bourgeoisie also bereit, erneut die Arbeiterklasse herauszufordern, da sie spürte, dass das internationale Kräfteverhältnis gekippt war und Teile des russischen Staates zu dieser Politik verführt werden konnten, ja, gar die Komintern in diese Falle gelockt werden konnte.
Die Provokation der Ruhrgebietsbesetzung: Welche Aufgabe der Arbeiterklasse?
Frankreich hoffte, durch die Einverleibung des Ruhrgebiets zum größten Stahl- und Kohleproduzenten in Europa aufzusteigen, denn das Ruhrgebiet lieferte für Deutschland 72% der Kohleproduktion, 50% der Eisen-Stahl-Produktion, 25% der gesamten deutschen Industrieproduktion. Es lag auf der Hand, dass, sobald diese Produktion für Deutschland ausfiel, der starke Produktionsrückgang zu Güterknappheit und schwerwiegenden wirtschaftlichen Zerrüttungen führen musste. Die deutsche Bourgeoisie war also zu einem großen Opfer bereit, weil für sie viel auf dem Spiel stand. Das Kapital setzte alles daran, die Arbeiter zu Streiks und Arbeitsniederlegungen mit nationalistischem Hintergrund anzustacheln. Unternehmer und die Regierung in Berlin beschlossen die Aussperrung, und wer unter den französischen Besatzungstruppen arbeitete, wurde mit Entlassung bedroht. Am 4. März kündigte SPD-Reichspräsident Ebert schwere Strafen für die Arbeiter an, die in den Gruben oder bei der Eisenbahn für Frankreich arbeiteten. Am 24. Januar 1923 appellierten Unternehmer und der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam, „sofort Geldmittel“ im Kampf gegen Frankreich zur Verfügung zu stellen. Die Folge: Immer mehr Firmen im Ruhrgebiet schmissen ihre Beschäftigten auf die Straße. Und das vor dem Hintergrund einer galoppierenden Inflation: Während der Dollar noch im April 1922 1.000 Mark kostete, betrug sein Preis im November 1922 schon 6.000, nach der Ruhrgebietsbesetzung im Februar 1923 20.000 Mark. Im Laufe des Jahres stieg er dann auf 100.000 Mark (Juni), auf 1 Mio. Mark Ende Juli auf 10 Mio. Mark Ende August, 100 Mio. Mark Mitte September und schließlich im November auf 4.200.000.000.000 Mark.
Diese Entwicklung traf die Kohlebarone im Ruhrgebiet nicht so hart, da sie in der Zwischenzeit eine Bezahlung in Gold bzw. in Sachwerten eingeführt hatten. Für die Arbeiterklasse dagegen bedeutete dies, am Hungertuch zu nagen. Häufig marschierten Arbeitslose und Beschäftigte zu den Rathäusern, um ihre Forderungen vorzulegen. Immer wieder kam es zu Zusammenstößen mit den französischen Truppen.
Die Komintern treibt die Arbeiter in die Falle des Nationalismus
Den Sirenengesängen des deutschen Kapitals über einen gemeinsamen Kampf zwischen den ‘unterdrückten Nationen’ Deutschland und Russland erlegen, verbreitete die Komintern selbst die Idee, in Deutschland sei eine starke Regierung erforderlich, die der französischen Besatzerregierung entschlossen und ungestört von jeglichem Klassenkampf die Stirn biete. Damit opferte die Komintern den proletarischen Internationalismus zugunsten der Interessen des russischen Staates.[2]
Diese Politik wurde im Namen des ‘Nationalbolschewismus’ vollzogen. Während die Komintern sich im Herbst 1920 noch energisch und entschlossen ‘national-bolschewistischen Tendenzen’ entgegengestellt und in den Verhandlungen mit der KAPD den Ausschluss der Nationalbolschewisten Laufenberg und Wolffheim aus ihren Reihen gefordert hatte, plädierte sie nun selbst für diese Linie.
Diese Kehrtwende der Komintern läßt sich nicht nur mit den Konfusionen und dem Opportunismus innerhalb des EKKI erklären. Jene ‘unsichtbare Hand’ der Kräfte, die nicht an der Revolution, sondern an der Stärkung des Staates interessiert waren, spielte dabei auch eine Rolle. Der Köder des Nationalbolschewismus konnte erst ausgelegt werden, als die Komintern schon in der Entartung begriffen, in die Fangarme des russischen Staates geraten und von diesem einverleibt worden war. Radek argumentierte: „Die Sowjetunion ist in Gefahr, alle Aufgaben müssen der Verteidigung der Sowjetunion untergeordnet werden, auf Grund dieser Analyse würde eine revolutionäre Bewegung in Deutschland gefährlich sein und den Interessen der Sowjetunion zuwiderlaufen (.....) Die deutsche kommunistische Bewegung ist nicht fähig, den deutschen Kapitalismus zu stürzen, sie hat als Stütze der russischen Außenpolitik zu dienen. Ein unter Führung der bolschewistischen Partei organisiertes Europa, das die militärische Leistungsfähigkeit der deutschen Armee gegen den Westen einsetzt, das ist die Perspektive, der einzige Ausweg.“
Die Rote Fahne schrieb im Januar 1923: „Die deutsche Nation wird in den Abgrund gestoßen, wenn das Proletariat sie nicht rettet. Die Nation wird von den deutschen Kapitalisten verkauft und vernichtet, wenn sich die Arbeiterklasse nicht dazwischen wirft. Entweder verhungert und zerfällt die deutsche Nation unter der Diktatur der französischen Bajonette oder sie wird durch die Diktatur des Proletariats gerettet.“
„Heute bedeutet jedoch der Nationalbolschewismus, dass alles von dem Gefühl durchdrungen ist, dass die Rettung nur bei den Kommunisten vorhanden ist. Wir sind heute der einzige Ausweg. Die starke Betonung der Nation in Deutschland ist ein revolutionärer Akt, wie die Betonung der Nation in den Kolonien“ (Rote Fahne, 21.06.1923). „Die Nation zerfällt. Das Erbe des deutschen Proletariats (...) ist bedroht. Nur die Arbeiterschaft kann die Nation retten.“ (1.4.1923, Rote Fahne)
Rakosi, Delegierter der Komintern, lobte die KPD für diese Linie: „... eine kommunistische Partei muss an die nationale Frage ihres Landes herantreten. Die deutsche Partei hat diese Frage mit glücklicher Hand angeschnitten. Sie ist dabei, den deutschen Faschisten die nationalistische Waffe aus den Händen zu schlagen.“ (Schüddelkopf, S. 177)
In einem Manifest an Sowjetrussland meinte die KPD: „Der Parteitag dankt Sowjetrussland für die mit Strömen von Blut und unermesslichen Opfern unverwischbar in die Geschichte geschriebene große Lehre, dass die Sache der Nation heute die Sache der Arbeiterklasse ist.“
Thalheimer sprach am 18. April sogar davon, „der proletarischen Revolution sei es vorbehalten, nicht allein Deutschland zu befreien, sondern das Werk Bismarcks mit dem Anschluss Österreichs zu vollenden. Diese Aufgabe muss das Proletariat an der Seite des Kleinbürgertums erfüllen.“ (Die Internationale, V 8, 18.4.23, S. 242-247)
Welche Perversion der Grundsatzpositionen der Kommunisten in der nationalen Frage! Welche Abkehr von der internationalistischen Position der Revolutionäre im 1. Weltkrieg, an deren Spitze Lenin und Rosa Luxemburg gestanden hatten, die für die Abschaffung aller Nationen eingetreten waren!
Im Rheinland und in Bayern war die separatistische Bewegung nach dem Krieg im Aufschwung begriffen. Die Gunst der Stunde witternd und mit französischer Unterstützung wollten diese Kräfte eine Loslösung des Rheinlands vom Reich durchsetzen. Mit Stolz berichtete die KPD-Presse, wie man der Cuno-Regierung unter die Arme griff, um gegen die Separatisten zu kämpfen. „Aus dem Ruhrgebiet wurden kleine bewaffnete Stoßtrupps nach Düsseldorf gezogen, die den Auftrag erhielten, die Ausrufung der ‘Rheinischen Republik’ unmöglich zu machen. Als mittags gegen 14.00 Uhr die Separatisten auf den Rheinwiesen versammelt waren und die Kundgebung beginnen sollte, griffen einige Stoßtrupps mit Handgranaten die Separatisten an. Einige wenige Handgranaten genügten, und die ganze Separatistenbande versuchte in völliger Auflösung und Panik, die Rheinwiesen zu räumen (...) Von einer Kundgebung oder Ausrufung der ‘Rheinischen Republik’ konnte keine Rede mehr sein.“ (W. Ulbricht, S. 132, Bd. I)
„Wir verraten kein Geheimnis, wenn wir aussprechen, dass die kommunistischen Stoßtrupps, die in der Pfalz, in der Eifel und am Düsseldorfer Totensonntag mit Revolvern und Handgranaten die Separatisten auseinandergetrieben haben, unter der Führung von nationalgesinnten preußischen Offizieren standen.“ (Vorwärts, 4.9.1930/Flugblatt der Gruppe)
Diese nationalistische Orientierung war aber nicht allein das Werk der KPD, sondern die Ausgeburt der Politik des russischen Staates und bestimmter Teile der Komintern.
Nach Absprache mit dem EKKI sollte der Zentrale zufolge der Kampf in erster Linie gegen Frankreich und erst in zweiter Linie gegen die deutsche Bourgeoisie geführt werden. Deshalb behauptete die Zentrale: „Die Niederlage des französischen Imperialismus im Weltkrieg war kein kommunistisches Ziel, seine Niederlage im Ruhrgebiet ist ein kommunistisches Ziel.“
Die KPD und die Hoffnung auf ein ‘nationales Bündnis’
Folglich wandte sich die KPD-Zentrale gegen die Auslösung von Streiks.
Schon auf dem Leipziger Parteitag Ende Januar, kurze Zeit nach Beginn der Ruhrgebietsbesetzung, hatte die Zentrale mit Unterstützung der Komintern eine Diskussion über ihre Orientierung blockiert, da sie befürchtete, es würde zu einer Ablehnung ihrer Orientierung kommen, weil der Großteil der Partei sich ihr widersetzte.
Als die Ruhrgebiets-Verbände der KPD am 23. März einen Bezirksparteitag abhielten, um über Kampfmaßnahmen zu entscheiden, wandte sich die Zentrale gegen die Ausrichtung der Ortsgruppen der KPD im Ruhrgebiet. Die Zentrale der KPD behauptete, „eine starke Regierung allein kann Deutschland retten, eine Regierung, die getragen ist von der lebendigen Kräften der Nation“ (Rote Fahne, 1. April 23).
Dennoch traten die meisten Delegierten der KPD-Konferenz im Ruhrgebiet ein für:
- die Niederlegung der Arbeit in allen militärisch besetzten Gebieten,
- die Übernahme der Betriebe unter Ausnutzung des deutsch-französischen Konfliktes und, wenn möglich, die lokale Machtergreifung.
Innerhalb der KPD prallten somit zwei inhaltlich unterschiedliche Orientierungen aufeinander: eine proletarisch- internationalistische Ausrichtung, die für die Konfrontation mit der Cuno-Regierung und eine Radikalisierung der Bewegung im Ruhrgebiet eintrat[3]; dagegen stand die Position der KPD-Zentrale, die sich energisch und mit Unterstützung der Komintern gegen Streiks aussprach und die Arbeiterklasse auf ein nationalistisches Terrain drängte.
Das Kapital war sich der Sabotage der Arbeiterkämpfe so sicher, dass der Staatssekretär von Malzahn nach einem Gespräch mit Radek am 26. Mai in einer streng geheimen Denkschrift an Ebert und die wichtigsten Minister berichtete: „Er (Radek) könne mir versichern, dass russische Sympathien schon aus eigenen Interesse im Ruhrkampf auf Seiten der deutschen Regierung ständen(...) Er habe in den letzten acht Tagen mit allen Kräften auf die kommunistischen Parteiführer eingewirkt, um ihnen die Dummheit ihres jetzigen Vorgehens gegen die deutsche Regierung vorzuhalten. Wir würden ja sehen, dass in einigen Tagen die Kommunistenputsche in der Ruhr abnehmen würden.“ (Archive des Auswärtigen Amtes, Bonn, Deutschland 637.442ff; in Dupeux, S. 181).
Nach dem Angebot der Einheitsfront an die konterrevolutionäre SPD und die Parteien der 2. Internationalen nun die Stillhaltepolitik gegenüber der kapitalistischen deutschen Regierung.
Wie weit die KPD-Führung sich darüber im Klaren war, dass sie der Regierung „nicht in den Rücken fallen durfte“, beweist eine Stellungnahme der Roten Fahne: „Die Regierung weiß, dass die KPD aus Rücksicht auf die Gefahr seitens des französischen Kapitalismus über vieles geschwiegen hat, was diese Regierung (...) unmöglich machen würde für jede internationale Verhandlung. Solange die sozialdemokratischen Arbeiter nicht zusammen mit uns für die Arbeiterregierung kämpfen, hat die Kommunistische Partei kein Interesse daran, dass an die Stelle dieser kopflosen Regierung eine andere bürgerliche tritt (...) Entweder lässt die Regierung die Mordhetze gegen die KP verstummen, oder wir werden das Schweigen brechen.“ (27.5.1923, Rote Fahne, Dupeux, S. 181)
Nationalistische Lockrufe an die patriotische Kleinbourgeoisie
Da die Inflation auch die Kleinbourgeoisie und den Mittelstand praktisch enteignet hatte, erblickte die KPD die Möglichkeit, diesen Schichten ein Bündnis vorzuschlagen. Statt auf den eigenständigen Kampf der Arbeiterklasse zu pochen, der in dem Maße, wie er an Stärke und Ausstrahlung zunimmt, andere nicht-ausbeutende Schichten mit einbeziehen kann, wurden diese Schichten mit der Aussicht geködert, ein Bündnis mit der Arbeiterklasse einzugehen. „Wir müssen vor die leidenden, verwirrten, aufgebrachten Massen des proletarischen Kleinbürgertums treten und ihnen sagen, dass sie sich selbst und die Zukunft Deutschlands nur dann verteidigen können, wenn sie sich mit dem Proletariat zum Kampf gegen die wahre Bourgeoisie verbunden haben.“ (Carr, Interregnum, S. 176)
„Aufgabe der KPD ist es, den breiten kleinbürgerlichen und intellektuellen nationalistischen Massen die Augen darüber zu öffnen, dass nur die Arbeiterklasse, nachdem sie gesiegt hat, imstande sein wird, den deutschen Boden, die Schätze der deutschen Kultur und die Zukunft der deutschen Nation zu verteidigen.“ (Rote Fahne vom 13. Mai 1923)
Auch diese Politik - Sammlung auf nationaler Grundlage - war nicht das Produkt der KPD allein, sondern wurde von der Komintern selbst mitgetragen. Die Rede, die Radek am 20. Juni 1923 vor dem EKKI hielt, legt Zeugnis davon ab. In dieser Rede lobte er Schlageter, Mitglied rechtsradikaler separatistischer Kreise, der am 26. Mai bei Sabotageaktionenen gegen Eisenbahnbrücken bei Düsseldorf von den französischen Militärs gefasst und erschossen worden war. Es war der gleiche Radek, der in den Reihen der Komintern 1919 und 1920 mit darauf gedrängt hatte, die Hamburger Nationalbolschewisten aus den Reihen der KPD und KAPD zu werfen. „Aber wir glauben, dass die große Mehrheit der national empfindenden Massen nicht in das Lager des Kapitals, sondern in das Lager der Arbeit gehört. Wir wollen und wir werden zu diesen Massen den Weg suchen und den Weg finden. Wir werden alles tun, dass Männer, wie Schlageter, die bereit waren, für eine allgemeine Sache in den Tod zu gehen, nicht Wanderer ins Nichts, sondern Wanderer in eine bessere Zukunft der gesamten Menschheit werden.“ (Radek, 20.06.23)
„Es ist klar, die deutsche Arbeiterklasse wird nie zur Macht kommen, wenn sie nicht imstande ist, den breiten Massen des deutschen Volkes das Vertrauen zu geben, dass sie für die Abschaffung des Joches des fremden Kapitals mit allen Kräften kämpfen wird.“ (Dupeux, S. 190)
Diese Idee, dass das „Proletariat als Vorhut, das nationalistische Kleinbürgertum als Nachhut“, kurzum: das Volk für die Revolution eintreten könnte, dass man die Nationalisten auf die Seite der Arbeiter ziehen müsse, wurde später vom 5. Kongress der Komintern 1924 vorbehaltlos bestätigt.
Während die KPD-Opposition sich gegen diese Orientierung auf die ‘Stillhaltepolitik’ wandte, die von der KPD-Zentrale bis September 1923 praktizierte wurde, schützte es sie nicht davor, die Arbeiterklasse selbst in Sackgassen zu lenken und nationalistischen Verlockungen anheim zu fallen. So betrieb Ruth Fischer eifrig anti-semitische Propaganda. „Wer gegen das Juden-Kapital aufruft, (...) ist schon Klassenkämpfer, auch wenn er es nicht weiß (...) Tretet die Juden-Kapitalisten nieder, hängt sie an die Laterne, zertrampelt sie (...) Der französische Imperialismus ist jetzt die größte Gefahr der Welt, Frankreich ist das Land der Reaktion (...) Nur im Bunde mit Russland (...) kann das deutsche Volk den französischen Kapitalismus aus dem Ruhrgebiet herausjagen...“ (Flechtheim S. 178)
Die Arbeiterklasse wehrt sich auf ihrem Klassenterrain
Während es der Bourgeoisie also darum ging, die Arbeiterklasse in Deutschland auf nationalistisches Terrain zu locken, sie damit von der Verteidigung ihrer eigenständigen Klasseninteressen abzubringen, während das EKKI und die KPD-Führung dabei tatkräftig mithalfen, ließ sich der Großteil der Arbeiterklasse im Ruhrgebiet und in den anderen Städten nicht auf dieses Terrain ziehen. Es gab fast keinen Betrieb, wo die Arbeiter nicht in den Streik traten.
Immer wieder und zunehmend landesweit kam es zu kleineren Streik- und Protestwellen. So am 9. März in Oberschlesien, wo 40‘000 Bergarbeiter streikten, am 17. März in Dortmund, wo ebenfalls Bergarbeiter in den Ausstand traten. Immer häufiger kam es zu Zusammenschlüssen zwischen demonstrierenden Arbeitslosen, Beschäftigten und Notstandsarbeitern, wie am 2. April in Mühlheim /Ruhr.
Obwohl sich Teile der KPD-Führung durch die nationalistischen Umwerbungsversuche verführen und täuschen ließen, war für die deutsche Bourgeoisie, sobald die Streiks im Ruhrgebiet ausgebrochen waren, klar, dass sie die Hilfe der anderen kapitalistischen Staaten einfordern musste. In Mühlheim/Ruhr hatten am 12. April Arbeiter mehrere Betriebe besetzt. Nahezu die ganze Stadt wurde bestreikt, das Rathaus besetzt. Da aufgrund der Besetzung durch französische Truppen die Reichswehr im Ruhrgebiet zur Niederschlagung der Streiks nicht intervenieren durfte, wurde die Polizei gerufen, deren Kräfte jedoch nicht ausreichten, um die Arbeiter vernichtend zu schlagen. Deshalb appellierte der Bürgermeister von Düsseldorf in einem Brief an den Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen um Unterstützung: „Ich muss sie daran erinnern, dass während des Kommune-Aufstandes das deutsche Oberkommando den französischen Truppen in jeder Beziehung entgegenkam, um den Aufstand gemeinsam zu unterdrücken. Ich bitte Sie, uns die gleiche Unterstützung zu erweisen, wenn Sie nicht wollen, dass künftig eine gefährliche Situation entsteht.“ (Dr. Lutherbeck, Brief an General de Goutte)
So wurde wiederholt die Reichswehr zu Niederschlagungsaktionen in verschiedene Städte geschickt - unter anderem nach Gelsenkirchen und Bochum. Während die deutsche Regierung ihre angebliche Feindschaft gegenüber Frankreich zur Schau trug, zögerte sie nie, ihr Militär gegen die Arbeiter zu schicken, die dem Nationalismus widerstanden hatten.
Die rasante Beschleunigung der Wirtschaftskrise, vor allem die Inflation, heizten die Kampfbereitschaft der Arbeiter wieder an. Löhne und Gehälter der Arbeiter verloren stündlich an Wert. Im Vergleich zur Vorkriegszeit war die Kaufkraft um drei Viertel gesunken. Immer mehr Arbeiter wurden arbeitslos. Im Sommer zählte man ca. 60% Arbeitslose. Selbst Beamte erhielten vom Staat nur Spottlöhne. Unternehmen wollten ihre eigene Währungen drucken, Gemeindeverwaltungen führten ‘Notwährungen’ zur Bezahlung ihrer Beamten ein. Da der Verkauf von Lebensmitteln für die Bauern nicht mehr Gewinn bringend war, hielten sie ihre Produkte zurück und horteten sie. Die Nahrungsmittelversorgung kam teilweise zum Erliegen. Arbeiter und Arbeitslose demonstrierten immer öfter gemeinsam. Überall kam es zu Hungerrevolten und Plünderungen. Oft konnte die Polizei den Hungerrevolten nur noch ohnmächtig zusehen.
Ende Mai traten im Ruhrgebiet ca. 400‘000 Arbeiter in den Streik, im Juni wiederum ca. 100‘000 Berg- und Hüttenarbeiter in Schlesien sowie 150‘000 Metaller in Berlin. Im Juli brach eine weitere Streikwelle aus, die auch von gewalttätigen Zusammenstößen gekennzeichnet war.
In diesen Kämpfen trat erneut ein Merkmal auf, das die Radikalisierung aller Arbeiterkämpfe in der Dekadenz auszeichnet: eine große Welle von Gewerkschaftsaustritten. Die Arbeiter kamen in den Betrieben zu Vollversammlungen zusammen und versammelten sich immer häufiger auch auf den Straßen. Man verbrachte mehr Zeit auf der Straße, in Diskussionen und Demonstrationen, als auf der Arbeit. Die Gewerkschaften stemmten sich mit aller Kraft gegen diese Entwicklung. Die Arbeiter strebten spontan danach, sich in Vollversammlungen, Fabrikkomitees und Fabrikausschüssen vor Ort zusammenzuschließen. Die Bewegung gewann weiter an Auftrieb. Sie scharte sich dabei nicht um nationalistische Forderungen, sondern suchte nach einer Klassenorientierung.
Was machten die revolutionären Kräfte an ihrer Seite?
Die KAPD, die mittlerweile durch das Fiasko der Spaltung in die Essener und Berliner Richtung und durch die Gründung der Kommunistischen Arbeiter-Internationale (KAI) zahlenmäßig stark geschrumpft und organisatorisch erheblich geschwächt war, konnte als solche in dieser Situation keine Präsenz zeigen, obwohl sie laut ihre Ablehnung der nationalbolschewistichen Falle äußerte.
Auch die KPD, die immer mehr Zulauf erhielt, hatte sich einen Strick um den Hals gelegt. Sie konnte keine klare Orientierung bieten - im Gegenteil. Was schlug sie vor?[4] Sie weigerte sich, auf den Sturz der Regierung hin zu arbeiten. Sie KPD und die Komintern stifteten mit ihrer Politik große Verwirrung und trugen zur Schwächung der Arbeiterklasse bei.
Einerseits wetteiferte die KPD mit den Faschisten auf nationalistischem Terrain. So hielt am 10. August z.B. (am gleichen Tag, als in Berlin eine Streikwelle ausbrach) in Stuttgart Thalheimer im Namen der KPD noch gemeinsame Versammlungen mit Nationalsozialisten ab. Andererseits rief sie gleichzeitig zum Kampf gegen die faschistische Gefahr auf. Während die Berliner Regierung jegliche Demonstrationen verboten hatte und die KPD-Zentrale sich dem Verbot beugen wollte, pochte die Parteilinke auf der unbedingten Durchführung einer Demonstration am 29. Juni, die zu einer großen Einheitsfrontdemonstration gegen die Faschisten werden sollte.
In ihrer Unfähigkeit, eine klare Entscheidung zu treffen, ließ die KPD am Tag der Demo 250‘000 Teilnehmer auf den Straßen und vor den Parteibüros vergeblich auf ihre Anweisungen warten.
Die KPD gegen die Intensivierung der August-Kämpfe
Im August setzte eine erneute Streikwelle ein. Nahezu täglich demonstrierten Arbeiter - beschäftigte wie arbeitslose. In den Betrieben brodelte es, an vielen Orten entstanden Fabrikkomitees. Der Einfluß der KPD erreichte seinen Höhepunkt.
Am 10. August traten die Drucker der Notenbankpresse in den Ausstand. In einer Wirtschaft, in der der Staat stündlich immer mehr Geld drucken musste, sollte der Streik der Notenscheindrucker eine besonders lähmende Wirkung auf die Wirtschaft haben. Die Papiergeldreserve war innerhalb weniger Stunden verbraucht. Die Löhne konnten nicht mehr ausgezahlt werden. Der Drucker-Streik, der in Berlin einsetzte, griff wie ein Lauffeuer auf andere Teile der Klasse über. Von Berlin aus pflanzte er sich fort über die Wasserkante, das Rheinland, Württemberg, Oberschlesien, Thüringen bis nach Ostpreussen. Immer mehr Teile der Arbeiterklasse schlossen sich der Bewegung an. Am 11. und 12. August kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen in mehreren Städten; über 35 Arbeiter wurden dabei erschossen. Wie schon in allen vorangegangenen Bewegungen der Arbeiterklasse seit 1914 zeichneten sich auch diese Kämpfe dadurch aus, dass sie sich außerhalb und gegen den Willen der Gewerkschaften entwickelten.
Die Gewerkschaften erkannten den Ernst der Lage. Einige von ihnen wollten vortäuschen, den Streik zu unterstützen, um ihn besser von Innen her sabotieren zu können. Andere stellten sich ihm offen entgegen. Die KPD selbst bezog nach der Ausdehnung der Berliner Streiks Stellung: „Für eine Verschärfung der ökonomischen Streiks, nicht aber für das Aufstellen von politischen Forderungen“.
Und sobald die Gewerkschaftsführung verkündet hatte, dass sie den Streik nicht unterstützte, rief die KPD-Zentrale zum Abbruch des Streiks auf. Man wolle nicht außerhalb der Gewerkschaften streiken.
Während Brandler darauf bestand, den Streik abzubrechen, da der ADGB offiziell nicht mitmachte, wollten örtliche Parteiorganisationen dagegen die zahlreichen lokalen Streiks ausdehnen und zu einer einzigen Bewegung gegen die Cuno-Regierung zusammenfassen. So wurde die „übrige Arbeiterschaft (aufgerufen), ihre Bewegung mit der mächtigen Bewegung des Berliner Proletariats zu vereinen und den Generalstreik über ganz Deutschland auszudehnen“.
Die Partei hatte sich selbst in eine Sackgasse manövriert. Denn die Parteileitung wandte sich gegen die Fortsetzung und Ausdehnung der Streiks, da andernfalls die Ablehnung des nationalistischen Sumpfes, in den das Kapital die Arbeiter zerren wollte, notwendig geworden wäre. Gleichzeitig wäre damit auch die Einheitsfront mit SPD und Gewerkschaften gefährdet gewesen. Noch am 18.August schrieb die Rote Fahne: „Sogar mit Leuten, die Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet haben, werden wir zusammengehen, wenn sie in unsere Reihen treten wollen“ (18.08.1923).
Die Ausrichtung auf die Einheitsfront, die Verpflichtung, in den Gewerkschaften zu arbeiten, unter dem Vorwand, dort die Arbeiter zu ‘erobern’, bedeutete in Wirklichkeit, sich der gewerkschaftlichen Ausrichtung und Struktur zu unterwerfen, dazu beizutragen, dass die Arbeiter ihren Kampf nicht in die eigenen Hände nehmen können. All das brachte die KPD in einen schrecklichen Konflikt: entweder die Dynamik des Arbeiterkampfes anerkennen, die nationalistische Orientierung und die gewerkschaftliche Sabotage zu verwerfen, oder sich gegen die Streiks wenden, in den gewerkschaftlichen Apparat aufgesogen, letztendlich zu einer Schutzmauer des Staates zu werden und als Hindernis der Interessen der Arbeiter zu wirken. Zum ersten Mal war damit die KPD wegen ihrer gewerkschaftlichen Ausrichtung in eine offene Konfrontation mit der kämpfenden Arbeiterklasse geraten, denn die Dynamik des Kampfes selbst zwang die Arbeiter dazu, den gewerkschaftlichen Rahmen zu sprengen. Die Konfrontation mit den Gewerkschaften war unausweichlich. Statt dessen diskutierte die KPD-Zentrale, wie sie die Unterstützung der Gewerkschaftsführer für den Streik gewinnen kann!
Unter dem Druck dieser Streikwelle trat am 12. August die Cuno-Regierung zurück. Am 13. August gab die Zentrale der KPD einen Aufruf zur Beendigung des Streiks heraus. Dieser Aufruf der Zentrale stieß auf den Widerstand der Betriebsräte in Berlin, die sich mittlerweile radikalisiert hatten, wie auch der örtlichen Parteileitungen, die für eine Fortführung der Bewegung eintraten. Die örtlichen Parteileitungen warteten auf Anordnungen der Zentrale. Sie wollten isolierte Zusammenstöße mit der Reichswehr vermeiden, bis die Waffen, die das Zentralkomitee angeblich zur Verfügung hatte, verteilt sein würden.
Während die KPD Opfer ihrer eigenen nationalbolschewistischen Politik und der Einheitsfronttaktik geworden war, die Arbeiterklasse damit wie benommen dastand und nicht wusste, was zu tun war, war die Bourgeoisie bereit, die Initiative zu ergreifen.
Wie auch in früheren Situationen aufsteigender Kampfkraft der Arbeiterklasse sollte die SPD die besondere Rolle übernehmen, der Bewegung die Spitze zu brechen. An die Stelle des der Zentrumspartei nahestehenden Cuno trat eine ‘große’ Koalition, an deren Spitze der Zentrumspolitiker Gustav Stresemann stand, der aber von vier SPD-Ministern unterstützt wurde (mit Hilferding als Finanzminister). Dieser Eintritt der SPD in die Regierung war nicht Ausdruck einer lähmenden Hilflosigkeit und Handlungsunfähigkeit des Kapitals, wie die KPD fälschlicherweise vermutete, sondern ein bewusster Schachzug der Bourgeoisie zur Eindämmung der Bewegung. Die SPD war keineswegs dabei auseinander zu brechen, wie die KPD-Führung später behauptete, noch war die Bourgeoisie gespalten oder unfähig, eine neue Regierungsclique aufzustellen.
Am 14. August kündigte Stresemann die Einführung einer neuen Währung und wertbeständiger Löhne an. Die Bourgeoisie hatte die Zügel in der Hand behalten und beschloss bewusst die Beendigung der Inflationsspirale - genauso wie sie sich ein Jahr zuvor dazu entschlossen hatte, diese bewusst auszulösen.
Gleichzeitig rief die Regierung zum Abbuch des ‘passiven Widerstandes’ gegen Frankreich im Ruhrgebiet auf und erklärte nach dem Kokettieren mit Russland nun den ‘Kampf gegen den Bolschewismus’ zu einem der obersten Ziele der deutschen Politik.
Durch das Versprechen, die Inflation zu beenden, konnte die Bourgeoisie eine Wende im Kräfteverhältnis herbeiführen - denn auch wenn nach dem Abbruch der Bewegung in Berlin am 20. August im Rheinland und Ruhrgebiet erneut eine Streikwelle aufloderte, flachte die Bewegung insgesamt schnell ab.
Auch wenn die Arbeiterklasse sich nicht auf das nationalistische Terrain hatte ziehen lassen, konnte sie ihre Bewegung nicht weiter vorantreiben. Einer der Gründe: Die KPD selbst war zum Gefangenen ihrer nationalbolschewistischen Politik geworden. So war die Bourgeoisie ihrem Ziel, der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beizufügen, einen Schritt näher gekommen.
Die Arbeiterklasse ging desorientiert aus diesen Kämpfen hervor, mit dem Gefühl, gegenüber der Krise hilflos zu sein.
Die linken Fraktionen in der Komintern, die sich nach der Aufkündigung des erhofften Bündnisses zwischen dem ‘unterdrückten Deutschland’ und Russland noch isolierter fühlten, versuchten nach dem Fiasko des Nationalbolschewismus nun, das Blatt durch einen verzweifelten Aufstandsversuch zu wenden. Dies werden wir im nächsten Artikel behandeln.
Dv
[1] Der Parteivorsitzende des Jahres 1922, Ernst Meyer, beschimpfte in seiner Privatkorrespondenz die Zentrale und einzelne Parteiführer. So schickte Meyer Charakterisierungen anderer Parteiführer an seine Frau. Er bat seine Frau, sie solle ihm über die Stimmung in der Partei unterrichten, während er in Moskau weilte. So gab es Privatkorrespondenzen von Mitgliedern der KPD-Zentrale mit der Komintern, und jeder der verschiedenen Flügel innerhalb der Komintern pflegte seine besondere Beziehungen zum entsprechenden ‘Flügel’ innerhalb der KPD. Das Netz ‘informeller Kanäle’ war weit verzweigt. Darüber hinaus war die Atmosphäre in weiten Teilen der Partei vergiftet. Auf dem 5. Kongress der Komintern berichtete Ruth Fischer, die selbst entscheidend zu dieser Entwicklung beigetragen hatte: „Auf dem Leipziger Parteitag (im Jan. 1923) kam es vor, dass Arbeiter verschiedener Bezirke an einem Tische saßen. Dann fragten sie zum Schluss: Woher kommst du? Und dann sagte der brave Arbeiter: Ich komme aus Berlin. Dann standen die anderen vom Tisch auf und ließen ihn sitzen. So war die Lage in unserer Partei.“ (R. Fischer auf dem 5. Kongreß der Komintern, S. 201)
[2] Innerhalb der tschechischen KP erhob sich dagegen Widerstand. So griff Neurath Thalheimers Position als einen Ausdruck der Zersetzung durch patriotische Gefühle an. Auch ein anderer tschechischer Kommunist, Sommer, verlangte in der Roten Fahne die Ablehnung dieser Orientierung. „Es kann keine Verständigung mit dem inneren Feind geben“ (Carr, Interregnum, S. 168).
[3] Gleichzeitig wollte man selbständige Wirtschaftseinheiten aufzubauen, was zum Teil auf starke syndikalistische Strömungen zurückzuführen ist. Die Vorstellung der KPD-Opposition war, eine im Rhein-Ruhr-Gebiet errichtete Arbeiterrepublik sollte eine Armee nach Mitteldeutschland schicken, um dort zur Machtergreifung beizutragen. Diese von R. Fischer eingebrachte Resolution wurde mehrheitlich mit 68 zu 55 Stimmen abgelehnt.
[4] Viele Arbeiter, die ohne Erfahrung, ohne größere theoretische und politische Bildung waren, fühlten sich zur Partei hingezogen. Die Partei öffnete sich für Masseneintritte. Jeder war willkommen. Bereits im April 1922 hatte die KPD verkündet: „In der gegenwärtigen politischen Situation [hat die KPD] die Pflicht, jeden Werktätigen, der zu ihr will, in ihre Reihen aufzunehmen.“ Im Sommer 1923 gingen viele lokale Parteibezirke in die Hände junger, radikaler Elemente über. Damit strömten noch mehr ungeduldige und unerfahrene Elemente in die Partei. Innerhalb von sechs Monaten verzeichnete sie einen Mitgliederzuwachs von 225.000 auf 295.000, von September 1922 bis September 1923 stieg die Zahl der Ortsgruppen von 2481 auf 3321. Damals verfügte die KPD über einen eigenen Pressedienst und 34 Tageszeitungen sowie zahlreiche Zeitschriften. Gleichzeitig hatten viele dubiose Kräfte die Partei infiltriert, um sie zu unterwandern.
Theorie und Praxis:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue 28 - Editorial
- 3197 Aufrufe
In New York wie überall auf der Welt sät der Kapitalismus Tod.
Wir wissen nun, dass die Attentate von New York mehr als 6‘000 Tote verursacht haben. Abgesehen von dieser unglaublichen Zahl stellt die Zerstörung des World Trade Centres einen Wendepunkt in der Geschichte dar, dessen Ausmaß wir noch nicht voll erfassen können. Es handelt sich um den ersten Angriff auf US-Territorium seit Pearl Harbour 1941, die erste Bombardierung auf dem US-amerikanischen Kontinent in seiner Geschichte, die erste Bombardierung einer Metropole der entwickelten Industriestaaten seit dem 2. Weltkrieg. Wie die Medien sagen, handelt es sich um eine wirkliche Kriegshandlung. Und wie alle Kriegshandlungen ist es ein schreckliches Verbrechen, das gegen eine wehrlose Zivilbevölkerung verübt wurde. Wie immer ist die Arbeiterklasse Hauptopfer dieser Kriegshandlungen. Die Sekretärinnen, das Reinigungs- und Unterhaltungspersonal, die Büroangestellten, die den Hauptteil der Getöteten ausmachten, gehören zu uns.
Und wir verwehren der heuchlerischen Bourgeoisie und den ihr ergebenen Medien den Anspruch darauf, wegen der ermordeten Arbeiter Trauer zu zeigen. Die herrschende Kapitalistenklasse ist schon verantwortlich für so viele Massaker und so viele Gemetzel: das schreckliche Abschlachten des 1. Weltkriegs, das noch größere Abschlachten des 2. Weltkriegs, als zum ersten Mal die Zivilbevölkerung zur Hauptzielscheibe wurde. Erinnern wir uns, zu was die herrschende Klasse fähig war: Sie hat London, Dresden, Hamburg, Hiroshima, Nagasaki bombardiert und Millionen Tote in den KZs der Nazis und im Gulag des Stalinismus hinterlassen.
Erinnern wir uns an die Hölle der Bombardierungen der Zivilbevölkerung und der flüchtenden irakischen Armee während des Golfkrieges 1991 und der Hunderttausenden von Toten. Erinnern wir uns an die alltäglichen und noch fortdauernden Massaker in Tschetschenien, die in Komplizenschaft mit den Demokratien des Westens verübt werden. Erinnern wir uns an die Komplizenschaft des belgischen, französischen und amerikanischen Staates während des Bürgerkriegs in Algerien, an die schrecklichen Pogrome in Ruanda.
Erinnern wir uns auch an die afghanische Bevölkerung, die heute durch amerikanische Bomben terrorisiert wird und die schon mehr als 20 Jahre an ununterbrochenem Krieg leidet, der zur Flucht von 2 Millionen Menschen in den Iran, von 2 Millionen nach Pakistan, mehr als einer Million Toten geführt hat. Die Hälfte der Bevölkerung ist von Nahrungsmittellieferungen der UNO und anderer NGOs abhängig.
Dies sind nur einige Beispiele von vielen für das Wüten eines Kapitalismus, der immer mehr in einer unüberwindbaren Wirtschaftskrise versinkt und unwiderruflich im Niedergang steckt. Der Kapitalismus steckt in einer verzweifelten Lage.
Die Bombenangriffe von New York sind kein Angriff „gegen die Zivilisation“, sondern sie sind im Gegenteil der Ausdruck dieser bürgerlichen „Zivilisation“.
Heute tritt diese unendlich heuchlerische herrschende Klasse mit blutbeschmierten Händen vor uns - ein Blut, das von den Arbeitern und den anderen Ausgebeuteten stammt, die durch ihre Bomben umgekommen sind - und wagt vorzugeben, sie trauere über die Toten, obwohl sie selbst für den Tod dieser Menschen verantwortlich ist.
Die gegenwärtigen Kampagnen der westlichen Demokratien gegen den Terrorismus sind besonders heuchlerisch. Nicht nur, weil das zerstörerische Wüten unter der Zivilbevölkerung durch den staatlichen Terror dieser Demokratien viel tödlicher ist als die schlimmsten Attentate (Millionen von Toten in den Kriegen in Korea und Vietnam – um nur einige zu nennen). Nicht nur weil diese Demokratien sich unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus unter anderem mit Russland zusammenschließen, obwohl sie häufig dessen Kriegsverbrechen gegen die Bevölkerung in Tschetschenien angeprangert haben. Nicht nur weil sie nie gezögert haben, mittels Staatsstreichen und blutiger Diktaturen ihre eigenen Interessen durchzusetzen (wie die USA im Falle Chiles z.B.). Sie sind auch Heuchler, weil sie nie davor zurückgeschreckt haben, terroristische Mittel einzusetzen oder das Leben von Zivilisten zu opfern, solange diese Methoden auch nur vorübergehend ihren Interessen dienten. Erinnern wir uns einiger Beispiele aus der jüngsten Geschichte:
In den 80er Jahren schossen russische Flugzeuge eine Boeing der Korean Airlines über dem Luftraum der UdSSR ab. Im Nachhinein fand man heraus, dass das Abweichen von der Flugroute durch den US-Geheimdienst eingefädelt worden war, um so die Reaktion der Russen gegenüber dem Eindringen eines Flugzeuges in ihren Luftraum zu testen.
Während des Iran-Irak-Krieges schossen die USA ein iranisches Linienflugzeug über dem Persischen Golf ab. Der iranische Staat sollte gewarnt werden, sich ruhig zu verhalten, und davon abgeschreckt werden, einen Krieg am Golf auszulösen.
Während französischen Atomwaffenversuchen in Mururoa im Pazifik hat Frankreich Agenten seines Geheimdienstes nach Neuseeland geschickt, um das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrier in die Luft zu jagen und zu versenken.
Das Attentat im Bahnhof von Bologna, bei dem in den 70er Jahren ca. 100 Menschen ihr Leben verloren, wurde lange Zeit den Roten Brigaden in die Schuhe geschoben, bis man schließlich herausfand, dass der italienische Geheimdienst am Werk gewesen war. Dieser Geheimdienst war zutiefst verbunden mit Mafia-Aktivitäten um das Netz Gladio, das von den USA in ganz Europa aufgebaut worden war und das im Verdacht steht, an einer Reihe von mörderischen Attentaten in Belgien beteiligt gewesen zu sein.
Während des Bürgerkrieges in Nicaragua lieferte die Reagan-Regierung Waffen und Geld an die „Contras“. Es handelte sich um eine Geheimaktion, die gegenüber dem US-Kongress verschwiegen und durch den Waffenverkauf an den Iran (auch illegal) sowie den Drogenhandel finanziert wurde.
Der sehr demokratische Staat Israel setzt auch heute noch seine Politik der Attentate und des Mordens in den Gebieten Palästinas gegen die Führer der Fatah, Hamas usw. fort1 [57].
Wir können nicht mit Sicherheit behaupten, dass heute Osama Bin Laden wirklich verantwortlich ist für die Angriffe auf das World Trade Centre, wie dies der US-Staat behauptet. Aber wenn diese Hypothese sich als richtig herausstellt, dann ist nur ein Kriegsherr der Kontrolle seiner alten Herren entwichen. Bin Laden ist nicht einfach ein fanatischer, islamisierter Terrorist. Im Gegenteil – seine Karriere fing an, als er ein Teil der US-imperialistischen Kette im Krieg gegen die UdSSR in Afghanistan war. Aus einer stinkreichen saudischen Familie stammend, die von der Königsfamilie um Bin Saoud unterstützt wurde, wurde Bin Laden 1979 in Istanbul von der CIA rekrutiert. „Der Afghanistankrieg war soeben ausgebrochen und Istanbul war eine Durchgangsstelle, die die Amerikaner ausgewählt hatten, um von dort Freiwillige an die afghanische Guerrillafront zu schicken. Zunächst für die Logistik verantwortlich, wurde Bin Laden zum Finanzvermittler des Waffenhandels, der jeweils von den USA und Saudi-Arabien mit einem gleichen Anteil von ca. 1,2 Mrd. $ pro Jahr finanziert wurde. 1980 traf Bin Laden in Afghanistan ein, wo er praktisch bis zum Abzug der Russen 1989 verblieb. Er hatte die Aufgabe, die Mittel unter den verschiedenen Fraktionen des Widerstands zu verteilen, d.h. er nahm eine höchst politische Schlüsselrolle ein. Damals unterstützten ihn die USA und Saudi-Arabien vollständig, wobei sein Freund, der Prinz Turki Bin Faycal, der Bruder des saudischen Königs und Chef der saudischen Geheimdienste sowie dessen Familie eine entscheidende Rolle spielten. Er beteiligte sich an Geldwäsche zur Umwandlung von schmutzigem in sauberes Geld und umgekehrt.“ (Le Monde 15.9.2001). Dieser gleichen Zeitung zufolge habe Bin Laden ebenso ein Netz für den Opiumhandel aufgebaut - zusammen mit seinem Freund Gulbuddin Hekmatyar, einem Taliban-Führer, der auch von den USA unterstützt wurde. Diese und jener beschuldigen sich heute gegenseitig „der große Teufel“ und „der Welt führender Terrorist“ zu sein, als ob sie unversöhnliche Feinde wären; tatsächlich aber sind sie die treuen Verbündete von gestern.2 [58]
Der allgemeine Rahmen
Aber abgesehen von dem Ekel, den die Anschläge von New York und die Heuchelei der Bourgeoisie hervorrufen, müssen die Revolutionäre und die Arbeiterklasse die Gründe dieses Massakers begreifen, wenn wir keine einfache Zuschauer sein wollen, die die Ereignisse mit Schrecken verfolgen. Gegenüber den bürgerlichen Medien, die behaupten, verantwortlich seien die islamischen „Fundamentalisten“, die „Schurkenstaaten“, die „Fanatiker“, entgegnen wir: Der wahre Verantwortliche ist das ganze kapitalistische System.
Aus unserer Sicht trat der Kapitalismus zu Beginn des letzten Jahrhunderts auf der ganzen Welt in sein Niedergangsstadium ein3 [59]. In den Jahren um 1900 schloss der Kapitalismus seine historische Aufgabe ab: Die Einverleibung des gesamten Erdballs in einen einzigen Weltmarkt, die Auslöschung des Einflusses früherer Machtstrukturen (feudaler, Stammesgesellschaften usw.) lieferten die materiellen Grundlagen dafür, dass zum ersten Mal in der Geschichte eine wirkliche Menschengemeinschaft errichtet wird. Wenn die Produktivkräfte diesen Entwicklungsstand erreicht hatten, bedeutete dies, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu einer Fessel für ihre weitere Entwicklung geworden sind. Seitdem kann der Kapitalismus kein fortschrittliches System mehr sein; statt dessen ist er zu einer Fessel für die Gesellschaft geworden.
Die Dekadenz einer Gesellschaft eröffnet nie einfach einen Zeitraum des Zerfalls oder der Stagnation. Im Gegenteil – der Konflikt zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen kann nur ein gewalttätiger sein. Dies belegt die Geschichte zur Zeit des Niedergangs der römischen Sklavengesellschaft, die geprägt war von gesellschaftlichen Erschütterungen, Kriegen im Innern und nach Außen, die Invasion von Barbaren, bis die Reifung neuer Produktionsverhältnisse, der Feudalismus, den Durchbruch einer neuen Gesellschaftsform ermöglichte. Der Niedergang des Feudalismus war ebenso von zwei Jahrhunderten zerstörerischer Kriege bis zum Beginn der bürgerlichen Revolutionen geprägt (insbesondere in England im 17. Jahrhundert, Frankreich im 18. Jahrhundert), wodurch die Macht der Feudalherren und der absoluten Monarchen gebrochen und ein Zeitraum kapitalistischer Herrschaft eröffnet wurde.
Die kapitalistische Produktionsform ist die dynamischste der ganzen Menschengeschichte, da sie nur durch eine ständige Umwälzung der vorhandenen Produktionsformen und - wichtiger noch – eine ständige Erweiterung ihres Handlungsraumes überleben kann. Weniger noch als bei den früheren Gesellschaften konnte ihr Niedergang ein Zeitraum des Friedens sein. Materiell wurde der Beginn des Niedergangs des Kapitalismus durch zwei gewaltige und entgegengesetzte Ereignisse geprägt: den Ersten Weltkrieg und die proletarische Revolution in Russland 1917.
Seit dem Ersten Weltkrieg konnten die Zusammenstöße zwischen den imperialistischen Großmächten keine begrenzten Kriege mehr sein oder beschränkt bleiben auf entfernt gelegene Länder wie während der Eroberung der Kolonien. Von 1914 an wurden die imperialistischen Konflikte zu unglaublich mörderischen, zerstörerischen Konflikten mit weltweiter Ausstrahlung.
In der Oktoberrevolution 1917 gelang es dem russischen Proletariat zum ersten Mal in der Geschichte, die Kapitalistenherrschaft zu zerschlagen; die Arbeiterklasse stellte ihr revolutionäres Wesen unter Beweis und zeigte, dass sie dazu in der Lage ist, die Barbarei des Krieges zu beenden und das Tor zur Bildung einer neuen Gesellschaft aufzustoßen.
In ihrem Manifest, das die 3. Internationale verfasst hatte, um dem Proletariat auf dem Weg zur Weltrevolution die Richtung zu weisen, erklärte sie, dass der durch den Krieg eröffnete Zeitraum der des kapitalistischen Niedergangs ist, die „Periode der Kriege und der Revolutionen“, oder wie Marx im Kommunistischen Manifest gesagt hatte, bestand die Alternative im Sieg der Revolution einerseits und dem gemeinsamen Ruin der sich bekämpfenden Klassen andererseits. Die Revolutionäre der Kommunistischen Internationale fassten entweder diesen Sieg ins Auge oder den Abstieg der gesamten menschlichen Zivilisation in die Hölle.
Sie konnten sich sicher nicht den Horror des 2. Weltkriegs ausmalen, die KZs, die Atombombenabwürfe usw. Und noch weniger konnten sie sich die noch nie da gewesene historische Lage von heute vorstellen.
So wie der Erste Weltkrieg den Eintritt des Kapitalismus in seinen Niedergang eröffnete, stellte der Zusammenbruch des russischen Blocks 1989 dessen Eintritt in eine neue Phase dieses Niedergangs dar: den seines Zerfalls. Der Dritte Weltkrieg, der seit dem Zweiten Weltkrieg seit 1945 vorbereitet wurde, fand nicht statt. Seit dem Mai 1968 in Frankreich, d.h. dem massivsten Streik in der Geschichte, und einer Reihe von Arbeiterkämpfen, die die großen kapitalistischen Staaten bis Ende der 80er Jahre erschüttert haben, wurde deutlich, dass die Arbeiterklasse, insbesondere die Arbeiterklasse im Zentrum des kapitalistischen Systems, nicht bereit war, wie 1914 oder wie 1939 in einem neuen Krieg verheizt zu werden. Aber während die Arbeiterklasse sich implizit dem Krieg verweigerte, hat sie es dennoch nicht geschafft, eine Bewusstseinsstufe zu erreichen, die ihrer eigentlichen Stellung in der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer historischen Rolle als Totengräber des Kapitalismus entspricht. Eine der auffallenden Ausdrücke dieser Schwierigkeit zeigt sich in der Unfähigkeit der heutigen kommunistischen Gruppen, etwas anderes als kleine, zerstreute Gruppen zu sein, ohne ein bedeutendes Echo in der Arbeiterklasse.
Die Gefahr eines Weltkrieges zwischen den beiden imperialistischen Blöcken ist verschwunden, aber die Menschheit ist weiterhin bedroht. Die Fäulnis des Kapitalismus ist nicht einfache eine Phase, der andere folgen werden. Sie ist die Endphase des Niedergangs, die nur zu einem der beiden „Wege“ führen kann: entweder proletarische Revolution und Übergang zu einer neuen Form menschlicher Gesellschaft, oder der immer schnellere Abstieg in eine grenzenlose Barbarei, mit der viele unterentwickelte Staaten jetzt schon konfrontiert sind und die jetzt zum ersten Mal auch im Herzen der bürgerlichen Gesellschaft zugeschlagen hat. Vor dieser Wahl steht die Gesellschaft jetzt.
Das Auseinanderbrechen des russischen Blocks hat die imperialistischen Rivalitäten nicht aus der Welt geschafft; im Gegenteil: Die imperialistischen Ambitionen nicht nur der alten europäischen Großmächte können jetzt ungehindert walten, sondern auch die der zweitrangigen Regionalmächte, bis hin zu den kleinsten Ländern und den jämmerlichsten Kriegsherren.
1989 kündigte uns Präsident Bush das Ende des Konfliktes mit dem „Reich des Bösen“ an und versprach uns einen neuen Zeitraum des Friedens und des Wohlstands. 2001 wurden die USA zum ersten Mal in der Geschichte in ihrem Herzen getroffen, und der Sohn Bushs, der mittlerweile Präsident geworden ist, kündigte danach einen „Kreuzzug des Guten gegen das Böse“ an, ein Kreuzzug, der bis „zur weltweiten Auslöschung all der terroristischen Gruppen“ dauern werde. Am 16. September wiederholte Donald Rumsfeld, US-Verteidigungsminister, dass es sich um „lange, breitgefächerte Anstrengungen“ handelte, die „nicht nur Tage oder Wochen dauern werden, sondern Jahre“ (Le Monde, 18. 9.01). So stehen wir vor einem Krieg, dessen Ende selbst die herrschende Klasse nicht absehen kann. Keiner redet mehr euphorisch über die hinter uns liegenden zehn Jahre amerikanischen „Wohlstands“, sondern man wird sich bewusst über das, was Winston Churchill 1940 dem englischen Volk angekündigt hatte: „Blut, Schweiß und Tränen“.
Die Lage, vor der wir heute stehen, bestätigt in jedem Punkt das, was wir in unserer Resolution zur internationalen Situation auf dem 14. Kongress der IKS im Frühjahr dieses Jahres schrieben:
„Das Auseinanderbrechen der alten Blockstrukturen und der Blockdisziplin ließ der Entfaltung der nationalen Rivalitäten auf einem bislang nie gekannten Niveau freien Lauf und brachte einen wachsenden chaotischen Kampf des Jeder-gegen-jeden mit sich - von den Großmächten der Welt bis hin zu den finstersten örtlichen Warlords. Das äußerte sich in einer Zunahme lokaler und regionaler Kriege, in denen die Großmächte ständig Vorteile für sich herausschlagen wollen (...)
Die für die gegenwärtige Phase des kapitalistischen Zerfalls charakteristischen Kriege sind nicht weniger imperialistisch als die Kriege in den früheren Phasen der Dekadenz, aber sie haben an Ausmaß zugenommen, sind weniger kontrollierbar und schwieriger auch nur vorübergehend zu beenden. (...) Die kapitalistischen Staaten sind alle Gefangene einer Logik, die sich ihrer Kontrolle entzieht und die selbst im kapitalistischen Sinne immer weniger Sinn macht, und deshalb ist die Lage, vor der die Menschheit steht, so gefährlich und instabil.“ (vgl. Weltrevolution Nr. 106)
Wem nützt das Verbrechen?
Zum Zeitpunkt, als wir diesen Artikel verfassen, hat niemand – kein Staat, keine Terroristengruppe – die Verantwortung für die Attentate übernommen. Dabei liegt es auf der Hand, dass dazu eine lange Vorbereitung und großer Materialeinsatz erforderlich war; die Debatte unter den „Experten“ hat begonnen, ob dies nur die Tat einer Terroristengruppe sein konnte oder allein das Ausmaß der Angriffe die Beteiligung von Geheimdiensten irgendeines Staates erforderlich machte. All die öffentlichen Erklärungen der US-Behörden weisen mit dem Finger auf die Organisation al-Kaida Osama Bin Ladens, aber sollen wir diese Erklärungen notwendigerweise für bare Münze nehmen?4 [60]
In Ermangelung wirklich konkreter Beweise und aufgrund des geringen Vertrauens, das wir den bürgerlichen Medien schenken können, müssen wir der alten Detektivmethode treu bleiben und den Beweggrund für das Verbrechen finden. Wem nützt das Verbrechen?
Hätte eine andere Großmacht geneigt sein können, diesen Schlag zu wagen? Hätte ein europäischer Staat oder Russland oder China, - d.h. ein Staat, der durch die US-Supermacht verletzt worden ist, aber seine eigenen Ambitionen verdunkelt - geneigt sein können, den USA einen Schlag ins Herzen zu versetzen und damit das Ansehen dieser Supermacht auf der Welt zu untergraben? Diese These scheint uns a priori als unmöglich, da das Resultat der Attentate auf internationaler Ebene vorhersehbar war: Die USA mussten ihre Vorherrschaft erneut behaupten und ihre Entschlossenheit zeigen, militärisch überall gegen jeden loszuschlagen und ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, alle Staaten der Erde – ob sie wollen oder nicht - hinter sich zu scharen.
Dann gibt es die sogenannten „Schurkenstaaten“ wie Irak, Iran, Libyen usw. Die Vermutung, dass sie beteiligt waren, erscheint uns zumindest unwahrscheinlich. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Staaten in der Regel weniger „Schurken“ sind als von ihnen behauptet wird (die iranische Regierung z.B. unterstützt eher die Allianz mit den USA), liegt es auf der Hand, dass sie ein großes Risiko eingehen würden, wenn ihre Mittäterschaft aufgedeckt würde. Sie würden das Risiko der vollständigen militärischen Zerstörung auf sich nehmen, und der Vorteil solch einer Aktion erscheint für sie sehr ungewiss.
Im Nahen Osten beschuldigen die Palästinenser und der israelische Staat sich gegenseitig der terroristischen Umtriebe. Wir schließen sofort eine palästinensische Beteiligung aus: Arafat und seine Konsorten wissen genau, dass nur die USA Israel daran hindern können, die Missgeburt ihres Staates zu zerstören; und aus ihrer Sicht sind die Anschläge in New York ein totales Desaster, das „alles Arabische“ sofort in Misskredit geraten lässt. Die gleiche Herangehensweise – aber mit umgekehrten Vorzeichen, um der Welt und vor allem den USA aufzuzeigen, dass man den „Terroristen“ Arafat auslöschen muss – könnte jetzt angewendet werden mit der Frage nach einer israelischer Beteiligung: Der israelische Geheimdienst Mossad wäre sicherlich von seinen organisatorischen Fähigkeiten her dazu in der Lage, solche Angriffe durchzuführen, aber es ist kaum vorstellbar, dass der Mossad solch einen Schritt ohne die Zustimmung des US-Staates wagen würde.
Die US-Beschuldigungen sind vielleicht gerechtfertigt: Diese Attentate seien das Werk einer Gruppe, d.h. eines Teils dieser nebulösen Menge von Terroristengruppen, die es zuhauf im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt gibt. Dann wäre es viel schwerer, das Motiv zu erhellen, denn diese Gruppen haben keine leicht erkennbaren staatlichen Interessen. Aber man kann hinzufügen: Selbst wenn die Gruppe al-Kaida beteiligt wäre, würde das nicht viel zur Klärung beitragen: Der Zerfall der kapitalistischen Weltwirtschaft wird seit Jahren geprägt von dem Aufblühen einer gewaltigen Schattenwirtschaft, die sich auf den Drogenhandel, die Prostitution, Waffen- und Flüchtlingshandel stützt. So hat das finstere islamische Regime der Taliban Afghanistan nicht daran gehindert, zum Hauptlieferanten für Opium und Heroin zu werden – im Gegenteil. In Russland hat der Geschäftsmann Berezowski, ein enger Freund Jelzins, nie ein Hehl aus seinen Geschäftsverbindungen zur tschetschenischen Mafia gemacht. In Lateinamerika finanzieren sich linksextreme Guerrillagruppen wie die kolumbianische FARC durch den Verkauf von Kokain. Überall manipulieren die Staaten diese Gruppen gemäß ihrer eigenen Interessen. Und das zumindest seit dem 2. Weltkrieg, als die US-Armee den Mafia-Boss Lucky Luciano aus dem Gefängnis ließ, um den USA bei der Landung ihrer Truppen in Sizilien behilflich zu sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass gewisse Geheimdienste auf eigene Faust gehandelt haben, unabhängig vom Willen ihrer Regierungen.
Die letzte Hypothese mag als „wahnsinnigste“ erscheinen: Die US-Regierung oder ein Teil von ihr - innerhalb der CIA zum Beispiel - hätte vielleicht die Attentate mit vorbereitet, sie hervorgerufen und sie stattfinden lassen ohne einzugreifen. Es stimmt, dass der Schaden, der für die weltweite Glaubwürdigkeit der USA und auch auf wirtschaftlicher Ebene entstanden ist, zu groß erscheint, um sich eine solche Vermutung überhaupt vorzustellen.
Bevor man sie jedoch verwirft, sollte man den weiter reichenden Vergleich mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbour (dieser Vergleich wird übrigens in der Presse oft gezogen) ziehen und einen Blick auf die Geschichte werfen.
Am 8. Dezember 1941 griffen japanische Marine- und Flugzeugverbände den US-Stützpunkt in Pearl Harbour auf Hawaii an, wo nahezu die gesamte US-Flotte des Pazifiks vor Anker lag. Die für die Sicherheit auf dem Stützpunkt verantwortlichen Militärs waren durch diesen Angriff völlig überrascht, und der Angriff richtete großen Schaden an: Die meisten vor Anker liegenden Schiffe sowie mehr als die Hälfte der Flugzeuge wurden zerstört; man beklagte 4‘500 Tote und Verletzte auf amerikanischer Seite im Vergleich zu 30 verlorenen Flugzeugen auf japanischer Seite. Während bis zum damaligen Zeitpunkt die Mehrheit der US-Bevölkerung gegen einen Kriegseintritt der USA gegen die Achsenmächte war und die isolationistischen Bereiche der US-Bourgeoisie, die im Komitee „Amerika zuerst“ zusammengeschlossen waren, eine große Rolle spielten, brachte der „heuchlerische und feige“ Angriff der Japaner jeglichen Widerstand gegen einen Kriegseintritt zum Schweigen. Präsident Roosevelt, der von Anfang an für den Kriegseintritt war und seit geraumer Zeit für eine militärische Unterstützung Englands eintrat, erklärte: „Wir müssen feststellen, dass der moderne Krieg, so wie er von den Nazis geführt wird, eine widerwärtige Angelegenheit ist. Wir wollten nicht in den Krieg eintreten. Jetzt sind wir am Krieg beteiligt und wir werden mit all unseren Kräften kämpfen.“ Er vermochte es, eine lückenlose nationale Einheit um seine Politik herzustellen.
Nach dem Krieg wurde auf Betreiben der Republikaner eine umfassende Untersuchung angestellt, die aufklären sollte, warum das US-Militär so stark von den japanischen Angriff überrascht worden war. Diese Untersuchung brachte deutlich ans Tageslicht, dass höchste politische Stellen die Verantwortung für den japanischen Angriff und dessen Erfolg trugen. Einerseits hatten sie während der japanisch-amerikanischen Verhandlungen, die zu diesem Zeitpunkt stattfanden, für Japan unannehmbare Bedingungen aufgestellt, insbesondere ein Embargo für Öllieferungen an Japan. Andererseits hatten sie, obwohl sie über die japanischen Vorbereitungen (insbesondere durch Entschlüsselung des Nachrichtenkodes des japanischen Generalstabs) voll im Bild waren, die Leitung des Militärstützpunktes in Pearl Harbour nicht unterrichtet. Roosevelt hatte gar den Admiral Richardson getadelt, der sich der Bündelung der gesamten Pazifikflotte in dieser Basis widersetzt hatte. Man muss allerdings bemerken, dass die drei Flugzeugträger (d.h. bei weitem die wichtigsten Kriegsschiffe), die dort normalerweise stationiert waren, den Hafen einige Tage zuvor verlassen hatten. Tatsächlich stimmen heute die meisten ernsthaften Historiker darin überein, dass die US-Regierung Japan provoziert hatte, um den Kriegseintritt der USA in den 2. Weltkrieg zu rechtfertigen und die Unterstützung der US-Bevölkerung und aller Teile der Bourgeoisie zu erlangen.
Es ist heute schwierig zu sagen, wer der Verantwortliche für die Attentate in New York ist; insbesondere ist es schwierig zu behaupten, dass es sich um eine Neuauflage des Angriffs auf Pearl Harbour handelt. Was wir dagegen mit Sicherheit sagen können, ist, dass die USA als allererste davon profitieren, womit sie eindrucksvoll unter Beweis stellen, wie sie aus dem Schlag gegen sie Kapital schlagen können.
Wie die USA Nutzen aus der Lage ziehen
The Economist fasste es sehr knapp zusammen: „Die von den USA zusammengestellte Koalition ist sehr außergewöhnlich. Diese Allianz umfasst Russland, die NATO-Länder, Usbekistan, Tadschikistan, Pakistan, Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten, schweigende Zustimmung Irans und Chinas – das wäre vor dem 11. September nicht denkbar gewesen.“
Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die NATO den Bündnisfall gemäß Artikel 5 erklärt, wonach alle Mitgliedsstaaten gezwungen sind, einem von Außen angegriffenen Mitgliedsstaat Hilfe zu leisten. Noch außergewöhnlicher ist, dass der russische Präsident Putin seine Zustimmung zur Benutzung russischer Stützpunkte für „humanitäre Operationen“ (die sicherlich ebenso „humanitär“ sind wie die Bombardierung des Kosovos) gegeben und gar logistische Hilfe angeboten hat. Russland stellt sich nicht dagegen, dass Tadschikistan und Usbekistan es den USA erlaubt haben, ihre Flughäfen für militärische Operationen der USA gegen Afghanistan zu benutzen. Amerikanische und britische Truppen befinden sich wohl schon vor Ort und leisten der Nordallianz Hilfe, die als einzige afghanische Gruppe noch gegen die Taliban-Regierung aufmarschieren kann.
Offensichtlich geschieht all dies nicht ohne Hintergedanken. Russland, um damit zu beginnen, beabsichtigt aus der gegenwärtigen Situation einen Vorteil zu erringen, indem es jede Kritik an seinem blutigen Krieg in Tschetschenien zum Verstummen bringt und die Versorgung der Rebellen aus Afghanistan (die bestimmt nicht ohne Mitwirkung des ISI, des pakistanischen Geheimdienstes, zustande kam) unterbindet. Usbekistan begrüßt die Ankunft US-amerikanischer Truppen als Druckmittel gegen Russland, den lästigen Grossen Bruder.
Was die europäischen Staaten betrifft, so schliessen sich diese nicht aus freien Stücken den USA an, und jeder versucht, möglichst seine Handlungsfreiheit zu erhalten. Im Moment erklärt einzig die britische Bourgeoisie eine totale, auch militärische Solidarität mit den USA mit der Präsenz von 20‘000 Soldaten im Persischen Golf (dem größten Kontingent seit dem Falklandkrieg) und der Entsendung der Eliteeinheit SAS nach Usbekistan. Auch wenn die englische Bourgeoisie in den letzten Jahren gegenüber den USA mit ihrer Unterstützung für eine europäische schnelle Eingreiftruppe, die unabhängig von den USA agieren kann, und der Zusammenarbeit mit den französischen Seestreitkräften eine gewisse Distanz aufgebaut hat, so ist sie durch ihre eigene Geschichte im Nahen Osten und ihren historischen und vitalen Interessen in dieser Region gezwungen, sich heute hinter die USA zu stellen. England spielt wie alle anderen sein eigenes Spiel, und in der jetzigen Situation beinhaltet dies eine treue Zusammenarbeit mit Amerika. So drückte es Lord Palmerston schon im 19. Jahrhundert aus: „Wir haben keine ewigen Verbündeten und keine dauernden Feinde. Unsere Interessen sind permanent, und es ist unsere Pflicht, diese aufrecht zu erhalten.“ (zitiert aus Kissinger, Die Diplomatie) Lord Robertson, der aktuelle NATO-Generalsekretär konnte es sich nicht verkneifen, die Selbständigkeit jedes Mitgliedslandes zu betonen: „Es ist klar, dass für jeden Staat eine würdevolle moralische Verpflichtung besteht, Hilfe zu leisten. Diese wird einmal davon abhängen, was das angegriffene Land entscheidet, und auch von der Art, wie die Mitgliedsländer an dieser Operation teilnehmen können.“ (Le Monde, 15.9.2001) Frankreich ist da noch nuancierter: Für Alain Richard, den Verteidigungsminister, können die Prinzipien „der gegenseitigen Unterstützung (der NATO) gut angewandt werden“, doch „jede Nation macht dies mit den für sie passenden Mitteln“, und wenn „die militärische Aktion notwendig ist, um die terroristische Bedrohung einzudämmen, dann gibt es nichts anderes“. „Solidarität bedeutet nicht Blindheit“, fügte Henri Emmanuelli, ein Führer der Sozialdemokratischen Partei an.5 [61] Präsident Chirac setzte bei seinem Besuch in Washington das Tüpfchen aufs I: „Die militärische Zusammenarbeit kann selbstverständlich in Erwägung gezogen werden, doch nur in dem Maße, wie wir uns zuvor über die Ziele und Modalitäten einer Aktion, deren Ziel die Ausschaltung des Terrorismus ist, absprechen.“ (zitiert aus Le Monde, 15. und 20.9.2001).
Es gibt einen Unterschied zwischen der heutigen Situation und derjenigen des Golfkrieges von 1990/91. Vor 11 Jahren schloss die von den USA einberufene Allianz die militärischen Kräfte verschiedener europäischer und arabischer Staaten (vor allem Saudi-Arabien und Syrien) zusammen. Heute sind die USA gewillt, auf der militärischen Ebene alleine vorzugehen. Dies zeigt auf, wie sehr ihre diplomatische Isolation wie auch das Misstrauen gegenüber ihren „Alliierten“ seit jenem Krieg zugenommen haben. Die USA werden diese sicher dazu verpflichten, sie zu unterstützen, insbesondere indem sie versuchen werden, sich deren nachrichtendienstliche Netze dienstbar zu machen, doch werden die USA keine Fessel bei der militärischen Aktion dulden.
Es gilt noch einen anderen Vorteil hervorzuheben, den die herrschende Fraktion der US-amerikanischen Bourgeoisie auf der innenpolitischen Ebene aus der heutigen Lage zieht. Es gab schon immer eine „isolationistische“ Tendenz innerhalb der amerikanischen Bourgeoisie, die davon ausgeht, dass ihr Land durch die Weltmeere genügend abgeschirmt und genug reich sei, um sich nicht in die Angelegenheiten der Welt einmischen zu müssen. Es war diese Fraktion, die sich gegen den Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg stemmte und die von Roosevelt nach dem Angriff auf Pearl Harbour zum Schweigen gebracht wurde. Es ist klar, dass diese Fraktion heute nichts zu sagen hat, und der Kongress bewilligte 40 Milliarden Dollar mehr für den „Kampf gegen den Terrorismus“, von denen 20 Milliarden ausschließlich dem Präsidenten zu Verwendung bereit stehen. Dies bedeutet eine enorme Verstärkung der zentralen Staatsmacht
Weshalb Afghanistan?
Mit einer außerordentlichen Schnelligkeit hat die Polizei und der amerikanische Geheimdienst einen Urheber des Attentats präsentiert: Osama Bin Laden und seine Taliban-Freunde.6 [62] Und bevor auch nur ein einziger konkreter Beweis vorlag, hat der amerikanische Staat sein Ziel und seine Absicht bekannt gegeben: dem Taliban-Regime den Garaus zu machen. Zum Zeitpunkt, als wir diesen Artikel schreiben (und es ist sicher, dass sich die Situation dramatisch weiterentwickelt, bis diese Zeitschrift die Druckerei verlässt) kündigt die Presse die Präsenz von fünf amerikanischen und britischen Transportflugzeugen in der Region, die Landung von US-Flugzeugen in Usbekistan und einen vorgesehenen Angriff in den nächsten 48 Stunden an. Wenn man einen Vergleich anstellt mit den sechs Monaten Vorbereitungszeit vor der Attacke gegen den Irak 1991, so kann man sich wahrlich fragen, ob das alles nicht schon vorher geplant war. In jeden Fall ist es für die amerikanische Bourgeoisie entscheidend, ihre eigene Ordnung in Afghanistan durchzusetzen. Und das offensichtlich nicht um die reiche Wirtschaft oder die Märkte diese ausgebluteten Landes zu erobern. Weshalb also Afghanistan?
Dieses Land ist auf der ökonomischen Ebene nie von Interesse gewesen, doch genügt ein Blick auf die Landkarte, um seine strategische Wichtigkeit zu verstehen, die es seit mehr als zwei Jahrhunderten hat. Seit der Bildung des Raj (dem britischen Reich in Indien) und während des gesamten 19. Jahrhunderts war Afghanistan ein Ort der Konfrontation zwischen dem britischen und dem russischen Imperialismus in dem, was damals „das Große Spiel“ hieß. Großbritannien beobachtete mit Besorgnis das Vorrücken des russischen Imperialismus in Richtung der Emirate von Taschkent, Samarkand und Bukhara und noch mehr gegenüber seinen Jagdgründen in Persien (dem heutigen Iran). Großbritannien nahm nicht ohne Grund an, dass das Ziel der zaristischen Armeen die Eroberung Indiens sei, aus dem es enorme Profite und ein großes Prestige herausschlug. Deshalb unternahm es zwei militärische Feldzüge in Afghanistan (der erste endete in einer bitteren Niederlage mit dem Verlust von 16‘000 Mann und einem einzigen Überlebenden).
Das 20. Jahrhundert machte den Nahen Osten mit der Entdeckung von riesigen Ölreserven in dieser Region, mit der Abhängigkeit der Wirtschaft der entwickelten Länder und vor allem deren Armeen vom Öl, zu einem strategisch noch wichtigeren Gebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Afghanistan für die militärischen Pläne der beiden großen imperialistischen Blöcke zur Drehscheibe in der Region. Die USA vereinigten die Türkei, Iran und Pakistan in der CENTO (Central Treaty Organisation), der Iran war gespickt mit amerikanischen Abhörstationen, und die Türkei wurde eine der stärksten militärischen Mächte des Nahen Ostens. Pakistan wurde von den USA unterstützt als Bollwerk gegen Indien, welches gegenüber den russischen Ansprüchen sehr offen war.
Die islamische „Revolution“ im Iran entriss dieses Land dem Einfluss der USA. Russlands Invasion in Afghanistan 1979, das die Schwäche der USA zu seinen Gunsten nutzen wollte, bedeutete für die ganze Strategie des amerikanischen Blocks ein große Gefahr, und zwar nicht nur im Nahen und Mittleren Osten, sondern in ganz Asien. Da sie die russischen Stellungen nicht direkt angreifen konnten (vor allem wegen dem spektakulären Wiederaufflammen von Arbeiterkämpfen, ausgelöst durch den Massenstreik in Polen) reagierten die USA mittels einer auf die Beine gestellten Guerilla. Seit diesem Zeitpunkt haben die USA zusammen mit dem pakistanischen Staat und seinem ISI als Handlangern mit den modernsten Waffen die zweifellos rückständigste „Befreiungsbewegung“ auf der ganzen Welt unterstützt. Und um auch ihre Finger mit im Spiel zu haben beeilten sich die Geheimdienste Großbritanniens und Frankreichs, der Nordallianz von General Massud ihre Hilfe anzubieten.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts haben zwei neue Ereignisse die strategische Bedeutung Afghanistans verstärkt. Einerseits förderten das Auseinanderfallen Russlands und das Auftauchen neuer unbeständiger Staaten (Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisien, Turkmenistan, Armenien, Aserbaidschan und Georgien) den Appetit zweitrangiger imperialistischer Mächte: Die Türkei versuchte mittels Allianzen in den neuen Türkei-freundlichen Staaten Fuß zu fassen; Pakistan setzte auf das Taliban-Regime, um seinen Einfluss zu vergrößern und um Rückendeckung im Kaschmir-Krieg gegen Indien zu erhalten; und letzten Endes darf auch der Versuch Russlands, von neuem seine militärische Präsenz in der Region aufzubauen, nicht vergessen werden. Andererseits zieht die Entdeckung neuer wichtiger Ölreserven rund ums Kaspische Meer und vor allem in Kasachstan die großen westlichen Erdölkonzerne an.
Wir können an dieser Stelle nicht alle imperialistischen Rivalitäten und Konflikte genau beleuchten, welche diese Region seit 19897 [63] erschüttern. Doch um ein Bild des Pulverfasses zu bekommen, welches Afghanistan umgibt, genügt es, einige dieser Konflikte und Gegnerschaften aufzulisten:
Die absurden Grenzen, die durch das Auseinanderfallen der UdSSR entstanden sind, bringen es mit sich, dass die reichste und bevölkertste Region - das Fergana-Tal – aufgeteilt ist zwischen Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisien, und zwar so, dass keiner dieser Staaten über eine direkte Route zwischen der Hauptstadt und seinem bevölkerungsreichsten Teil besitzt.
Nach einem fünfjährigen Bürgerkrieg sind die Islamisten der „Tadschikischen Vereinigten Union“ in die Regierung eingetreten; dennoch muss man sich bewusst sein, dass sie ihre Verbindungen zur islamischen Bewegung in Usbekistan (der stärksten Guerillabewegung) nicht abgebrochen haben, vor allem weil letztere tadschikisches Gebiet passieren muss, um Usbekistan von ihren Basen in Afghanistan aus anzugreifen:
Usbekistan ist das einzige Land, welches die Präsenz russischer Truppen auf seinem Territorium zurückgewiesen hat, und steht deshalb unter dem Druck Russlands.
Pakistan unterstützt seit jeher die Taliban, dies auch mit einer Beteiligung von 2000 Soldaten an den letzten Offensiven gegen die Nordallianz. Es erhofft sich damit, eine „strategische Vertiefung“ in der Region gegenüber Indien und Russland zu schaffen, nicht zu sprechen vom lukrativen Heroinhandel, der zum größten Teil via Pakistan läuft und von den Generälen des ISI kontrolliert wird.
China, welches seine eigenen Probleme mit den Uigur-Separatisten in Xinjiang hat, versucht, seinen Einfluss in der Region auch durch die Shanghai-Coorporation-Organisation, welche die oben aufgeführten, nach dem Auseinanderbrechen der UdSSR entstandenen Staaten (mit Ausnahme von Turkmenistan, das von der UNO als neutral anerkannt wurde) und Russland umfasst, zu verstärken. Gleichzeitig will China mit den Taliban gut Freund bleiben und schickte sich an, einen Industrie- und Handelsvertrag mit ihrer Regierung abzuschließen.
Natürlich stehen die USA nicht abseits. Sie haben der wenig anerkannten usbekischen Regierung bereits Hilfe zukommen lassen: „Das US-Militär kennt das usbekische Militär und die Luftwaffenstützpunkte von Taschkent gut. Amerikanische Verbände haben an Manövern mit Truppen aus Usbekistan, Kasachstan und Kirgisien teilgenommen, als Teil der Centrazbat-Übungen im Rahmen des NATO-Programms „Partnerschaft für den Frieden“. Mehrere dieser Übungen fanden auf der Militärbasis von Chirchik, in der Nähe von Taschkent statt. Usbekistan hat sich seit seiner Unabhängigkeit 1991 auch aktiv um US-Unterstützung bemüht, oft auf Kosten seiner Verbindungen zu Russland (...) Anlässlich einer Reise der damaligen Staatssekretärin Albright in dieser Region im Jahre 2000 haben die USA Usbekistan militärisches Material für mehrere Millionen Dollar versprochen, und amerikanische Spezialeinheiten haben usbekische Truppen im Anti-Terror- und Gebirgskampf geschult.“.
Die USA intervenieren also in einem wahren Pulverfass, angeblich um dort den „dauerhaften Frieden“ einzuführen. Heute können wir nicht genau voraussagen, was das Resultat der ganzen Sache sein wird. Doch die Geschichte des Golfkrieges zeigt uns, dass heute, zehn Jahre nach Ende des Krieges:
die Region keinen Frieden kennt, solange Zusammenstöße zwischen Israelis und Palästinensern, zwischen Kurden und Türken, zwischen Regierungen und fundamentalistischen Guerillas sich zuspitzen, sowie auch die wöchentlichen Bombardierungen des Iraks durch amerikanische und britische Flugzeuge anhalten;
die US-Truppen sich in der Region fest auf ihren neuen Basen in Saudi-Arabien installiert haben und diese Präsenz selbst zu einer Quelle der Instabilität wird (antiamerikanisches Attentat in Dahran).
Wir können aber mit Sicherheit voraussagen, dass die in Afghanistan geführte Intervention keinen Frieden, keine Freiheit, keine Gerechtigkeit und keine Stabilität bringen wird, sondern einzig und allein mehr Krieg und Elend, so dass das Feuer des Hasses und die Hoffnungslosigkeit der Bevölkerung noch stärker geschürt werden, dieselbe Hoffnungslosigkeit, von welcher die Kamikazepiloten am 11. September beseelt waren.
Die Krise und die Arbeiterklasse
Nur einige Tage vor dem Attentat auf New York kündigte Hewlett-Packard die Übernahme von Compaq an. Diese Fusion wird 14'500 Stellen kosten. Das ist nur ein Beispiel unter vielen für die Vertiefung der Krise, die immer mehr zu- und immer stärker auf die Arbeiter einschlägt.
Nur einige Tage nach dem Anschlag kündigten United Airlines, US Air und Boeing Zehntausende von Entlassungen an. Seither sind ihrem Beispiel diverse Fluggesellschaften und Flugzeugproduzenten in der ganzen Welt gefolgt (Bombardier Aircraft, Air Canada, Scandinavian Airlines, British Airways und Swissair, um nur die letzten paar zu erwähnen).
Darüber hinaus behauptet die Bourgeoisie, ohne dabei rot zu werden, dass der Anschlag auf das World Trade Centre verantwortlich sei für die neue Krise, die nun über die Arbeiterklasse hereinbricht8 [64]. Die Erklärung scheint einen Anstrich von Wahrheit zu haben, da sich doch an der Börse aufgrund des Krachs nach dem 11. September 6,6 Billionen Dollar in Luft auflösten. Doch die Krise war schon vorher eine Tatsache, die Bosse nützten nur die Situation aus. Nach den Aussagen von Leo Mullin, dem CEO von Delta Airlines, wurde „die Sonderliquidität aufgrund des Geschäftsverlusts, der nur durch die Ereignisse vom 11. September verursacht wurde, berechnet, auch wenn der Kongress eine allgemeine Finanzspritze für die Industrie beschlossen hat (...) Die Nachfrage sinkt, während die laufenden Kosten steigen. Delta erleidet deshalb einen Abfluss von Mitteln.“ (Le Monde).
Die kapitalistische Welt ist schon voll von der Rezession erfasst, die sich natürlich zuerst in Angriffen auf die Arbeiterklasse ausdrückt. In den Vereinigten Staaten hat die Zahl der Arbeitslosen zwischen Januar und August 2001 um mehr als eine Million zugenommen. Riesenunternehmen wie Motorola und Lucent, die kanadische Nortel, die französische Alcatel, die schwedische Ericsson haben Zehntausende von Arbeitern entlassen. In Japan ist die Arbeitslosenrate in diesem Jahr von 2% auf 5% angestiegen9 [65]. Die haarsträubende Beschleunigung, mit der neue Entlassungswellen angekündigt werden (57‘000 zwischen 17. und 21. September in den USA) zeigt, wie die Bosse den Vorwand der Anschläge benutzten, um die Entlassungspläne, die sie schon seit Monaten vorbereitet hatten, in die Tat umzusetzen.
Die Arbeiterklasse bezahlt nicht nur für die Krise, sondern auch für den Krieg, und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten, wo sich die Rechnung bereits auf mindestens 40 Milliarden Dollar beläuft. In Europa sind sich alle Regierungen darin einig, dass sie ihre Anstrengungen im Hinblick auf die Bildung einer schnellen Eingreiftruppe, die den europäischen Mächten die unabhängige Intervention erlauben würde, erhöhen wollen. In Deutschland hat man 20 Milliarden DM für die militärische Aufrüstung noch nicht im Bundesbudget unterbringen können. Zweifellos wird man aber bald einen Platz dafür finden, und auch diese Rechnung werden die Arbeiter bezahlen müssen.
Die Solidarität des Burgfriedens ist entschieden eine Einbahnstraße, nämlich von den Arbeitern zur herrschenden Klasse! Und der Zynismus dieser herrschenden Klasse, die den Tod von Arbeitern als Vorwand für Stellenabbau benützt, kennt keine Grenzen.
Heute wie seit eh und je ist die Arbeiterklasse das erste Opfer des Krieges.
Ein Opfer mit dem eigenen Leib, aber vor allem auch in seinem Bewusstsein. Die Arbeiterklasse ist die einzige gesellschaftliche Kraft, die diesem System, das verantwortlich ist für den Krieg, ein Ende bereiten kann; die herrschende Klasse dagegen bedient sich des Kriegs, um zum Burgfrieden und der nationalen Einheit aufzurufen. Zur Einheit der Ausgebeuteten mit ihren Ausbeutern. Zur Einheit derer, die zuallererst unter dem Kapitalismus leiden, mit denen, die daraus ihre Genüsse befriedigen und ihre Privilegien ziehen.
Die erste Reaktion der Proletarier von New York, einer der größten Arbeiterstädte der Welt, war nicht diejenige eines rachedurstigen Chauvinismus. Zunächst gab es eine spontane Reaktion der Solidarität gegenüber den Opfern, wie dies mit den Schlangen von Blutspendern oder den Tausenden von individuellen Hilfeleistungen und Trostspenden bewiesen wurde. In den Arbeiterquartieren, wo man dann über die Toten trauerte, die nicht beerdigt werden konnten, stand auf Transparenten: „Hassfreie Zone“, „Zusammen zu leben ist die einzige Art, die Toten zu ehren“, „Krieg ist nicht die Antwort“. Es ist klar, dass diese Parolen von demokratischem und pazifistischem Geist durchdrungen sind. Ohne eine Kampfbewegung, die fähig ist, den kapitalistischen Angriffen einen starken Widerstand entgegen zu setzen, und vor allem ohne revolutionäre Bewegung, die fähig ist, sich in der Arbeiterklasse Gehör zu verschaffen, wird diese spontane Solidarität erbarmungslos weggefegt durch die gewaltige Patriotismuswelle, die die Medien seit den Attentaten in Bewegung gesetzt haben. Für diejenigen, die versuchen, sich der Kriegslogik zu entziehen, breitet der Pazifismus seine Arme aus, der immer der erste Kriegstreiber ist, wenn sich das „Vaterland in Gefahr“ befindet. So kann man beispielsweise auf einer pazifistischen Website folgende Erklärung (eines Einzelnen) lesen. „Wenn eine Nation angegriffen wird, muss der erste Entscheid sein, ob man kapituliert oder kämpft. Ich denke, dass es da keinen Mittelweg gibt: Entweder kämpft ihr, oder ihr kämpft nicht, und nichts zu tun heißt zu kapitulieren.“ (Willamette Week Online) Für die Grünen ist „die Nation heute geeint: Wir wollen nicht als uneinig mit der Regierung erscheinen.“ (Alan Metrick, Sprecher von Natural Resources Defence Council, 530‘000 Mitglieder, zitiert in Le Monde, 28. September 2001):
„Der Weltfriede kann weder durch internationale Schiedsgerichte kapitalistischer Diplomaten noch durch diplomatische Abmachungen über ‚Abrüstung‘, (...) und dergleichen utopische oder in ihrem Grunde reaktionäre Projekte gesichert werden. Imperialismus, Militarismus und Kriege sind nicht zu beseitigen und nicht einzudämmen, solange die kapitalistischen Klassen unbestritten ihre Klassenherrschaft ausüben. Die einzige Sicherung und die einzige Stütze des Weltfriedens ist der revolutionäre Wille und die politische Aktionsfähigkeit des internationalen Proletariats.“
Das schrieb Rosa Luxemburg 1915 (Leitsätze über die Aufgaben der internationalen Sozialdemokratie) mitten in einer der dunkelsten Zeiten, die die Menschheit bis dahin gekannt hatte, während sich die Proletarier der am meisten entwickelten Länder auf den Schlachtfeldern des imperialistischen Krieges massakrierten. Auch heute ist die Zeit eine schwierige, sowohl für die Arbeiter im allgemeinen als auch für die Revolutionäre im besonderen, die das Banner der kommunistischen Revolution, koste es, was es wolle, hoch halten. Aber wir sind mit Rosa Luxemburg davon überzeugt, dass die Alternative Sozialismus oder Barbarei heißt und dass die Arbeiterklasse die einzige gesellschaftliche Kraft bleibt, die fähig ist, der Barbarei zu widerstehen und den Sozialismus zu errichten. Mit Rosa Luxemburg behaupten wir, dass die Beteiligung der Arbeiter am Krieg nicht bloß „ein Attentat (...) auf die bürgerliche Kultur der Vergangenheit (ist), sondern auf die sozialistische Kultur der Zukunft, ein tödlicher Streich gegen diejenige Kraft, die die Zukunft der Menschheit in ihrem Schoß trägt und die allein die kostbaren Schätze der Vergangenheit in eine bessere Gesellschaft hinüberretten kann. Hier enthüllt der Kapitalismus seinen Totenschädel, hier verrät er, dass sein historisches Daseinsrecht verwirkt, seine weitere Herrschaft mit dem Fortschritt der Menschheit nicht mehr vereinbar ist. (...) Der Wahnwitz wird erst aufhören und der blutige Spuk der Hölle wird verschwinden, wenn die Arbeiter (...) endlich aus ihrem Rausch erwachen, einander brüderlich die Hand reichen und den bestialischen Chorus der imperialistischen Kriegshetzer wie den heiseren Schrei der kapitalistischen Hyänen durch den alten mächtigen Schlachtruf der Arbeit überdonnern: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“
Jens, 3. Oktober 2001
1 [66] Es sei hinzugefügt, dass alle Staaten Geheimdienste unterhalten, die jeweils Abteilungen für „schmutzige Angelegenheiten“ haben, und wenn sie nicht ihre eigenen Killer beschäftigen, immer bereit sind, auf die Dienste von anderen, unabhängig Handelnden zurückzugreifen.
2 [67] Den Enthüllungen von Robert Gates (ehemaliger CIA-Chef) zufolge haben die USA nicht nur auf die russische Invasion Afghanistans reagiert, sondern sie haben sie absichtlich hervorgerufen, indem sie der damaligen pro-sowjetischen Opposition in Kabul unter die Arme griffen. Zbigniew Brzezinski (ehemaliger Berater Präsident Carters) sagte 1998 in einem Interview mit dem Nouvel Observateur: „Diese geheime Operation war eine exzellente Idee. Sie machte es möglich, die Russen in die afghanische Falle zu locken; erwarten Sie, dass ich das bedauere? An dem Tag, als die Sowjets offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich Präsident Carter im wesentlichen: ‚Jetzt haben wir die Gelegenheit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg aufzuzwingen (...) Wer ist wichtiger für die Geschichte der Welt? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetreiches?‘“ (zitiert in Le Monde Diplomatique, Sept. 2001).
3 [68] Siehe unsere Broschüre „Die Dekadenz des Kapitalismus“.
4 [69] Erinnern wir uns an den Lockerbie-Prozess gegen die Agenten des libyschen Geheimdienstes. Die USA und Großbritannien haben steif und fest behauptet, dass die Libyer verurteilt werden müssten, auch nachdem klar geworden war, dass die Verantwortlichen eher auf syrischer Seite zu suchen waren. Aber damals streckten die USA gegenüber Syrien die Hand aus, um zu versuchen, es am Friedensprozess zwischen Israel und Palästina zu beteiligen.
5 [70] Nebenbei sei bemerkt, dass die sogenannte Kommunistische Partei Frankreichs keine derartigen Gefühlsregungen zeigte: Am 13. September hielt der nationale Rat des PCF eine zweiminütige Schweigeminute ein, „um dem ganzen amerikanischen Volk, der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger dieses großen Landes und der Regierung, die sie sich gegeben haben, die Solidarität auszudrücken“. Oder was soll man sagen zum Titel von Lutte Ouvrière: „Man kann den Krieg nicht an allen vier Ecken der Welt aufrechterhalten, ohne dass es einem eines Tages selbst trifft“. Mit anderen Worten: „Getötete amerikanische Arbeiter, das stopft euch die Fresse“.
6 [71] Bezüglich dieser Schnelligkeit tun sich einige Fragen auf: ein Mietwagen mit arabischen Flughandbüchern wurde nur wenige Stunden nach dem Attentat entdeckt, auch wenn die Kamikaze-Piloten seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren in den USA gewohnt hatten; der Bericht über ein in den Trümmern des World Trade Centers gefundenen Passes, der einem der Terroristen gehörte und offenbar nicht einmal durch die Explosion von einigen hundert Tonnen Kerosin zerstört wurde...
7 [72] Wir gehen hier nicht im Besonderen auf die dauernden Konflikte um den Bau von neuen Pipelines zum Transport des Erdöls vom Kaspischen Meer zu den hochentwickelten Ländern ein, bei denen Russland versucht, eine Linie durch Tschetschenien und Russland bis nach Novorossiysk an der russischen Schwarzmeerküste zu errichten und die US-Regierung dagegen die Route Baku-Tiflis-Ceyhan (also Aserbaidschan-Georgien-Türkei) bevorzugt, welche Russland komplett umgeht. Es sei hier lediglich bemerkt, dass die US-Regierung ihre bevorzugte Route zum Nachteil der großen Erdölkonzerne erzwingen musste, welche diese als wirtschaftlich uninteressant bezeichneten.
8 [73] Wie sie es schon 1974 tat, als die Krise angeblich durch den Anstieg der Ölpreises verursacht wurde, welche Erklärung dann auch wieder 1980 herhalten musste. Und was die Krise von 1990-93 betrifft, so sei sie die Folge des Golfkriegs gewesen ...
9 [74] Anzufügen bleibt, dass zwar diese Rate im Vergleich zu beispielsweise Frankreich als niedrig erscheint, dies aber nur den Erfolg des japanischen Staates nicht im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, sondern in der Zahlenschieberei unter Beweis stellt.
Aktuelles und Laufendes:
- 11. September [75]
Theoretische Fragen:
- Terrorismus [76]
Zehn Jahre nach dem Golfkrieg
- 3352 Aufrufe
Halbwahrheiten, Lügen und Intrigen oder Wie die „demokratischen Goebbels“ arbeiten
Beim deutsch-französischen Fernsehsender Arte lief kürzlich eine lange Dokumentation mit dem vielsagenden Titel: „Les dessous de la guerre du Golf“ (was man in etwa mit „Die Wahrheit hinter dem Golfkrieg“ übersetzen kann). Zur selben Zeit wie die Dokumentation erschien in etlichen Wochenmagazinen eine Reihe von Artikeln, die voller „Enthüllungen“ über die Vorbereitung und Durchführung des Golfkrieges waren. Der Titel des französischen Wochenmagazins Marianne (22.-28. Januar 2001) wurde sogar noch ausdrücklicher: „Die Lügen über den Golfkrieg“. Warum kommen diese „Enthüllungen“ jetzt, zehn Jahre nach dem Ereignis, ans Tageslicht? Warum bringen jetzt, nach dem Haufen von Lügen während des Krieges, einige Fraktionen der Bourgeoisie Licht ins Dunkle der kriminellen Manöver der US-Administration unter Bush sen. bei ihrer Vorbereitung, Eröffnung und Führung des Krieges von seinem Beginn im Sommer 1990 bis Februar 1991, ja, bis heute?
Die offizielle Version
„Der Golfkrieg war eine militärische Operation, durchgeführt im Januar und Februar 1991 von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten, welche mit dem Mandat der Vereinten Nationen gegen den Irak handelten, mit dem Ziel, die Besetzung Kuwaits durch die Truppen der Armee Saddam Husseins zu beenden, die am 2. August 1990 in das Land eingedrungen waren. Der UN-Sicherheitsrat forderte noch am 2. August den Rückzug der irakischen Truppen und rief dann ein ökonomisches, finanzielles und militärisches Embargo (‚Operation Desert Shield‘) aus, das anschließend in eine Blockade mündete. Am 29. November autorisierte eine weitere Resolution des Sicherheitsrates die Mitgliederstaaten dazu, Gewalt anzuwenden, falls sich die irakischen Truppen nicht bis zum 15. Januar 1991 aus Kuwait zurückgezogen haben. Am 17. Januar begann die anti-irakische Front, die unter amerikanischem Kommando in Saudi-Arabien stationiert und aus Truppen der USA, Großbritanniens, Frankreichs und rund zwanzig weiterer verbündeter Länder zusammengesetzt war, die Operation Wüstensturm, indem sie militärische Ziele im Irak und in Kuwait bombardierte. Eine vom 24. bis zum 28. Februar erfolgte, erfolgreiche Bodenoffensive in Richtung Kuwait City machte dem Krieg an der Front ein Ende. Der Irak verlor mehrere zehntausend Soldaten und Zivilisten, die Koalition verzeichnete dagegen weniger als 200 Opfer. Zwei Drittel der militärischen Kapazität des Iraks wurden zerstört. Der Krieg endete offiziell am 11. April 1991 mit der Annahme der vom Sicherheitsrat auferlegten Bedingungen, insbesondere der Zerstörung der chemischen und biologischen Waffen sowie der Lang- und Mittelstreckenraketen des Iraks, durch Saddam Hussein.“1
Dies ist die Art von Darstellung, wie wir sie aus den Schulbüchern kennen. Alles soll uns glauben machen, dass die so genannte historische „Objektivität“ gewahrt bleibt. Dies war im Wesentlichen der Kern dessen, was uns (abgesehen von den Opferzahlen) vor zehn Jahren erzählt worden war.
Der Krieg wurde mit der Verteidigung des unantastbaren Völkerrechts gerechtfertigt, das von der „hinterhältigen“ Invasion Kuwaits durch die Truppen Saddam Husseins mit Füßen getreten worden sei. Dies geschah just zu dem Zeitpunkt, als der Zusammenbruch des Ostblocks angeblich den Weg der Menschheit zu einer strahlenden Zukunft des „Friedens und Wohlstands“ eröffnet hatte. Letzteres wurde uns bei jeder Gelegenheit versprochen und stellte dar, was vom US-Präsidenten mit der Phrase von der „neuen Weltordnung“ bezeichnet wurde. Der Kriegstreiber, der sich weigerte, Völkerrecht zu respektieren, musste mit allen erdenklichen Mitteln gestoppt werden. Die UNO, internationales „Friedens“forum, wurde zur Bühne, auf der, vom Embargo bis zur Blockade, der Weltbevölkerung (mit anderen Worten: dem Proletariat) eine hinterhältige, diplomatische Farce vorgespielt wurde, damit Letztere den kommenden Krieg akzeptierte. Schließlich war der Krieg selbst angeblich ein „sauberer“, chirurgischer Krieg, in dem die einzigen Leute, die getötet wurden, die „bösen Jungs“ waren. Offiziell wurde der Krieg im April 1991 beendet, doch in Wahrheit ist sein Schlusswort noch nicht geschrieben, da die amerikanische Bourgeoisie seit zehn Jahren den einsamen Rächer mimt (manchmal von ihrem britischen Messdiener begleitet), indem sie Saddam (oder vielmehr die irakische Bevölkerung) regelmäßig als Punchingball benutzt, um in einer Welt, die immer tiefer vom Krieg in die Barbarei gedrängt wird, ihre Muskeln spielen zu lassen.2
Die „enthüllte Wahrheit“
Heute erkennen einige Teile der bürgerlichen Presse die Wahrheit dessen an, was die IKS bereits vor zehn Jahren gesagt hatte. Wir sind auf diese Tatsache nicht „stolz“ – dies ist für uns nicht von Belang. Was uns jedoch interessiert, ist mehr denn je die Betonung der Notwendigkeit für die Revolutionäre, angesichts der Ereignisse wachsam zu bleiben, ihre Analysen in der marxistischen Methode einzubetten und der Überprüfung durch die Wirklichkeit zu unterwerfen, kritisch zu sein und ihre Orientierungen nicht wie ein Wetterhahn bei jeder Änderung der Windrichtung zu drehen. Dies ist Vorbedingung für das Fortschreiten des Klassenkampfes und eine der Hauptfunktionen der revolutionären Organisation. Wir sind ebenfalls daran interessiert zu verstehen, warum sich heute die Bourgeoisie entschlossen hat zu enthüllen, was sie einst verborgen hatte: d.h. die Arbeit derjenigen zu verstehen, die man die „demokratischen Goebbels‘“ nennen kann.3
Washingtons Falle
Die Arte-Dokumentation und die Zeitschrift Marianne sagen Folgendes: „Washingtons Falle: (...) Washington nahm kaum Notiz, als Saddam davon sprach, in seine einstige Provinz einzufallen“; die USA beteuerten, dass sie „kein Verteidigungsabkommen mit den Kuwaitis hatten“. „Es war ein Manöver, um ihn zu täuschen“, und: „‘Wir können feststellen, dass die USA nach der Invasion keine diplomatische Lösung wollten‘, schlussfolgerte Dr. Halliday von der UN.“
Und genau dies sagten wir im frühen September 1990, einen Monat nach der Invasion Kuwaits durch Saddams Truppen und noch vor dem Kriegsausbruch: „Doch dies ist nicht das Ende ihrer Heuchelei und ihres Zynismus. Es scheint, als haben die USA diskret, aber absichtlich dem Irak gestattet, ein militärisches Abenteuer zu wagen. Ob richtig oder falsch – und es ist zweifellos richtig -, wirft es ein bezeichnendes Licht auf das Verhalten und die Praktiken der Bourgeoisie, ihrer Lügen und Manipulationen, auf den Nutzen, den sie aus den Ereignissen schlägt. (...) Der Irak hatte keine Wahl. Das Land wurde dahin gelenkt, diese Politik auszuführen. Und die USA ließen es gewähren, ermutigten es, um Saddam Husseins militärisches Abenteuer auszunutzen, wohl bewusst des wachsenden Chaos‘, wohl bewusst in der Absicht, ein Exempel zu statuieren.“ Im Sommer 1990 hatte die bürgerliche Presse diese Information sehr diskret enthüllt. Und hier können wir sehr gut sehen, wie die Propagandamaschinerie unter der demokratischen Diktatur arbeitet: Selbst nachdem einige Zeitungen eine verschleierte Darstellung der Falle gebracht hatten, die die USA für Saddam ausgelegt hatten, gaben sie die militärische Propaganda der anti-irakischen Koalition fast einstimmig wieder. Diese Heuchler geben dies heute freimütig zu: „Diesmal stellte die US-Armee sicher, dass die Journalisten ‚loyal‘ blieben.“ Es gelang der Regierung, die Presse auf Abstand zu halten. Tatsächlich wusste man nie, was los war, „sagte Paul Sullivan, Präsident des Hilfszentrums für Kriegsveteranen (...) Vier Monate lang spielten sie mit der Angst vor der fixen Idee, dass die irakische Armee, ‚die viertgrößte der Welt‘, ein gefährlicher Gegner sei...“ (Marianne). „Diese maßlose Blindheit (sic!) hinderte westliche Journalisten nicht daran, Märchen über (Saddams) diabolische Manövrierkünste zu verfassen (...) Die westliche Presse erging sich endlos über die tatsächlichen oder angeblichen Gräueltaten der Besatzerarmee. Zum Beispiel veröffentlichte sie die Geschichte einer ‚jungen Frau aus dem Volk‘, die Zeuge unbeschreiblichen Horrors gewesen sei. Diese ‚Überlebende‘ war in Wahrheit die Tochter des Botschafters Kuwaits in Washington ...“ So war nach der irakischen Invasion in Kuwait am 2. August alles getan, um die öffentliche Meinung zu „konditionieren“ und dazu zu bringen, das, was folgte, zu akzeptieren. Und die Journalisten, ob mit ihrer Übereinstimmung oder mehr oder weniger ohne ihr Wissen, erfüllten ihre Rolle voll und ganz.
Doch was die Journalisten trotz ihres heutigen Anspruchs, „ehrlich“ zu sein, nicht sagen, ist, dass die US-Falle vor allem ihren einstigen „Verbündeten“, mit anderen Worten: den anderen Großmächten, galt.
In einem Artikel unserer International Review4, datiert vom November 1990, nahmen wir ausführlicher zur von der Golfkrise geschaffenen Lage kurz vor Ausbruch des Krieges Stellung. Unsere Analyse basierte auf Positionen, die wir zuvor gefasst und in denen wir die Tatsache zum Ausdruck gebracht hatten, dass der Zusammenbruch des Ostblocks das Verschwinden des westlichen Blocks und die Entwicklung zentrifugaler Tendenzen in Letzterem, die Neigung aller Hauptmächte herbeigeführt habe, danach zu trachten, zur „Nummer 1“ zu werden. Die so genannte „neue Weltordnung“ war also nichts anderes als eine üble Täuschung. Obwohl sie dem Irak eine Falle stellte, galt die hauptsächliche Absicht der US-Politik nicht dem Irak, auch nicht der Region des Nahen Ostens oder gar dem Erdöl, sondern den anderen Hauptmächten, vor allem Frankreich, das gezwungen wurde, seinen langjährigen irakischen Verbündeten anzugreifen, während Deutschland und Japan genötigt wurden, finanzielle Unterstützung für die Kriegsausgaben herauszurücken. Die UdSSR befand sich bereits im Zustand der Auflösung, so dass ein paar diplomatische Floskeln ausreichten, um sie gefügig zu machen. So „gelang es den USA, eine Fassade der Einheit in der ‚internationalen Gemeinschaft‘ zu schaffen, indem sie im August 1990 die ‚Golfkrise‘ gegen den ‚verrückten Saddam‘ provozierten. Doch kaum zwei Monate später waren alle Mitglieder dieser ‚internationalen Gemeinschaft‘ offen darauf aus, ihre eigenen Interessen zu verteidigen.“ (International Review, Nr. 64) Ende Oktober begann Saddam wahrscheinlich die Falle zu dämmern, in die die US-Administration ihn gelockt hatte; jedenfalls spekulierte er, vielleicht „weil er sich der Klüfte zwischen den verschiedenen Ländern bewusst war“ (ebenda), auf die offensichtlichen Unstimmigkeiten innerhalb der westlichen Koalition: Ende Oktober 1990 ließ er alle französischen Geiseln frei und empfing etwa zur gleichen Zeit den deutschen Ex-Bundeskanzler Willy Brandt (dem prompt die Freilassung der deutschen Geiseln folgte).
In der Tat benutzten die USA den Irak zu einem Zeitpunkt, als ihr Status als einzige Weltsupermacht dabei war, in Frage gestellt zu werden, um „den anderen entwickelten Ländern ihre Macht und Entschlossenheit zu demonstrieren“ (ebenda), indem sie eine brutale und blutige Vergeltungsaktion gegen den Irak auslösten. Im gleichen Artikel schrieben wir unter der Überschrift „Der Gegensatz zwischen den USA, sekundiert von Großbritannien, und den anderen“: „Mit dem Zusammenbruch des russischen imperialistischen Blocks wurde das gesamte politisch-militärische und geostrategische Gleichgewicht auf dem Planeten zu Fall gebracht. Und diese Situation hat nicht nur in den Ländern und Gebieten des alten Ostblocks eine Periode des völligen Chaos‘ eröffnet, sie hat überall die Tendenzen zum Chaos beschleunigt, womit die kapitalistische ‚Weltordnung‘ bedroht ist, deren Hauptnutznießer die Vereinigten Staaten sind. Letztere mussten als Erste reagieren. Sie (...) provozierten im August 1990 die ‚Golfkrise‘, nicht nur, um eine entscheidende Ausgangsposition in dieser Region zu erlangen, sondern auch und vor allem (....), um ein Exempel zu statuieren, das als eine Warnung gegen jeden dienen sollte, der sich ihrer Position als vorherrschende Supermacht in der weltkapitalistischen Arena widersetzt.“ (ebenda).
Der Krieg bricht aus: Die Medien stehen Gewehr bei Fuß
Spätestens im Januar 1991 gelang es den USA, die Oberhand über die UN-Koalition zu erlangen. Eine Unmenge von Bomben regnete auf den Irak nieder. Der Zynismus der Gangster, die diese Koalition am Laufen hielten, ging so weit, dies einen „sauberen Krieg“ zu nennen. „Dem Pentagon zufolge waren diese Angriffe äußerst präzise. Das ist völlig unwahr. In einem Zeitraum von 41 Tagen wurden 85.000 Tonnen Bomben auf den Irak abgeworfen, was dem Siebeneinhalbfachen Hiroshimas entspricht! Zwischen 150’000 und 200’000 Menschen wurden getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.“ (Ramsey Clark, ehemaliger Bevollmächtigter US-General in Marianne und in der Arte-Dokumentation) „Tatsächlich tat die Koalition weitaus mehr, als die irakische Militärmaschinerie auszulöschen: Sie zerstörte systematisch seine ökonomische Infrastruktur.“
Die Presse kollaborierte meist ohne Zögern mit den Regierungen der verschiedenen Krieg führenden Länder. Sie begnügte sich nicht damit, das irakische Regime und seinen Blut triefenden Diktator anzuklagen5: Sie stellte sich selbst auch unter das Kommando der Militärs der Koalition. Wir wollen hier an die Fernsehdokumentationen mit ihren zivilen und militärischen Experten erinnern, die in ihren gelehrten Reden von der „hochgefährlichen“ irakischen Armee sprachen, der angeblich viertgrößten auf der Welt. Dieselben Journalisten überschwemmten uns mit Details über die schrecklichen Waffen Bagdads, die fähig seien, die gesamte zivilisierte Welt zu bedrohen. Uns wurde erzählt, dass Saddams blutrünstige Armee Säuglinge in den Kinderkrippen Kuwaits getötet hätte. Auf westlicher Seite hätten unsere netten Piloten dagegen darauf geachtet, nur die strategischen Ziele der verhassten Macht zu zerstören. Heute bestätigt die Wochenzeitschrift Marianne die feige Unterwerfung und Komplizenschaft der Medien: „Vier Monate lang spielten sie mit der Angst davor, dass die irakische Armee (...) ein gefährlicher Gegner sei. Sie sprachen von verborgenen Pestizidfabriken, von Vorkommen angereicherten Urans (...), von der Reichweite der 'Superkanone‘. Niemand, so schien es, wagte es, die offensichtlichste Hypothese aufzugreifen: dass dieser großspurige Aufschneider (Saddam) lediglich so dumm wie widerspenstig war. Die wirklichen Spezialisten, die Militärhistoriker, ließen sich durch diese Konditionierung nicht täuschen: ‚Ohne jeglichen Schutz in der offenen Wüste werde die irakische Armee nicht eine Stunde der Feuerkraft der Koalition standhalten.‘ (...) Völlig konditioniert, nahm die öffentliche Meinung des Westens die Fiktion von den ‚intelligenten Waffensystemen‘ und den auf das strikte Minimum reduzierten Bombardierungen für bare Münze.“ (Marianne) Doch die Manipulationen endeten nicht etwa hier: Die USA ermutigten die Kurden im Norden Iraks und die Schiiten im Süden zum Aufstand gegen Saddam. „Am 3. März nahm General Schwarzkopf die irakische Kapitulation an und gestattete es dem Irak, seine Hubschrauber zu behalten (um die Aufstände niederzuschlagen)6. Wochenlang rief der CIA-Radiosender zum Aufstand auf, und dennoch rührten sich die Alliierten nicht, als Saddam die Aufständischen mit den Eliteeinheiten der Republikanischen Garden angriff und auf wundersame Weise dabei von den Bombern verschont wurde.“ (ebenda)
Warum „enthüllen“ die Medien heute all dies?
In diesen Zitaten spricht Marianne von „Konditionierung“. Diese Aufgabe fällt den Medien im Allgemeinen und dem Fernsehen im Besonderen zu. Wir wissen sehr wohl zu beurteilen, was die „demokratische“ Bourgeoisie unter der „Pressefreiheit“ versteht, vor allem zu derart wichtigen Zeitpunkten wie dem des Golfkriegs. All die Verteidiger der „Pressefreiheit“ stellten sich selbst ohne Zögern und auf Dauer unter die militärische Zensur. Und war einer von ihnen versucht, auf der Suche nach der Wahrheit oder einem sensationellen Aufmacher hinter den Vorhang zu schauen, so war unverzüglich die Armee zur Stelle, um ihn zur Ordnung zu rufen. Wie Marianne auf ihre Weise sagt: „Niemand, so schien es, wagte es, die offensichtlichste Hypothese aufzugreifen.“
Wir sehen deutlich die Funktionsweise der Propagandadienste in den demokratischen Staaten. Wenn Ereignisse Ruhe erfordern, wird nichts Wichtiges raus gelassen. Stattdessen werden wir mit allen Arten von Lügen, Halbwahrheiten, Manipulationen gefüttert, die durch die Auffassungen „unabhängiger“ Experten, Universitätsprofessoren u.ä. aufgedonnert und durch die „freie“ Stimme der Presse in den demokratischen Ländern noch glaubwürdiger gemacht werden. Nach den Ereignissen wird alles (oder beinahe alles) nach und nach „ans Tageslicht“ gebracht. Doch auch zehn Jahre später kann die „Wahrheit“ nur in Zeitschriften mit geringer Auflage oder in Fernsehsendern mit kleiner Zuschauerquote gefunden werden. Die populäreren Massenmedien werden nach wie vor von einer Lawine der Desinformationen überschwemmt. Wir haben dieselben Mechanismen 1995 während des Genozids in Ruanda und vor allem während des letzten Krieges in Ex-Jugoslawien (Kosovo) arbeiten sehen, wo sich das Modell der Medienkontrolle aus dem Golfkrieg erneut bewährte.
Im Anschluss an den Golfkrieg und die Auslieferung der kurdischen und schiitischen Bevölkerung an die von Saddam Hussein angeheuerten Killer besaßen die „großen Demokratien“ den unglaublichen Zynismus, zu ihren berühmten „humanitären Interventionen“ und „Flugeinsätzen zur Rettung bedrohter Völker“ zu greifen. Bis zum Überdruss ist uns die „Pflicht zur humanitären Einmischung“ aufgetischt worden. Der Golfkrieg ist eine Art Schablone für all die imperialistischen Kampagnen gewesen, die ihm überall auf der Welt folgten.
Wenn heute ein Teil der Wahrheit veröffentlicht wird, so im Wesentlichen, weil die herrschende Klasse ihr System rechtfertigen muss. Uns soll glauben gemacht werden, dass solch eine Offenheit nur im „demokratischen“ Kapitalismus möglich ist. Die Möglichkeit, „in der Demokratie alles sagen zu dürfen“, wird dazu benutzt, um umgekehrt die Momente zu rechtfertigen, wo alles manipuliert, verzerrt oder versteckt werden muss.
Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum gewisse Medien solche Fakten heute veröffentlichen. All diese Artikel und Dokumentationen haben eins gemeinsam: In ihnen erscheint der US-Staat als der allein Schuldige. Obwohl es zutrifft, dass die USA den „Kreuzzug“ anführte, die Falle vorbereitete und sie zuschnappen ließ sowie das meiste der bewaffneten Macht der Koalition bereitstellte, tragen alle Großmächte die Verantwortung für die im Krieg verursachten Massaker. Doch gewisse europäische Mächte – insbesondere Frankreich und Deutschland, für die die USA der Hauptrivale auf der imperialistischen Weltbühne sind – haben ein großes Interesse daran, ihre eigene Verantwortung zu minimieren sowie die Barbarei und den Zynismus des amerikanischen Imperialismus (der natürlich real genug ist) zu enthüllen.
Die revolutionäre Intervention
Natürlich erhalten auch wir unsere Informationen aus der bürgerlichen Presse. Schon 1990 gab es in einigen Zeitungen begrenzte Berichterstattungen über die Manipulationen. Seither war die Flut an Lügen so groß, dass das, was wir in unserer Presse sagten, bei einigen Leuten (einschließlich jener Gutgläubigen und selbst einiger linkskommunistischer Militanter) den Eindruck erweckte, wir seien nun völlig außer Rand und Band geraten und besessen von machiavellistischen Komplotten.
Doch diese Informationen sind an sich nicht das Wichtigste. Was bedeutsam ist, ist die Methode, die zur Analyse der Ereignisse benutzt wird. Wenn wir fähig waren zu begreifen, was zwischen 1990 und 1991 im Nahen Osten vor sich ging, so deshalb, weil wir uns analytisch die Konsequenzen des Zusammenbruchs des Ostblocks und des Zerfalls des Kapitalismus erarbeitet haben. Revolutionäre haben keine „geheimen Informanten“ und können auch keine haben. Unsere Stärke liegt in unserer Zugehörigkeit zu unserer Klasse, dem Proletariat, zu ihrer Geschichte und zur marxistischen Methode, die sie geschaffen hat.
Auch sollten wir nicht naiver Illusion anheimfallen: Auch Revolutionäre veröffentlichen heute nur unter Überwachung. Unser einziger Schutz ist nicht die „Pressefreiheit“, sondern die Stärke und der Kampf unserer Klasse.
Während der Ereignisse selbst waren allein Revolutionäre imstande, aufzuzeigen, was auf dem Spiel stand, und somit die Barbarei des Krieges und die Manipulation der Wahrheit durch die herrschende Klasse zu denunzieren. Zwar denunzierten einige Fraktionen der Bourgeoisie die Barbarei, die den Irak heimsuchte, doch geschah dies nur aus nationalistischen (anti-amerikanischen) oder offen pro-irakischen Gründen (wie dies bei gewissen linksextremen Gruppierungen der Fall war). Allein die Gruppen der Kommunistischen Linken verteidigten die internationalistische, proletarische Stellung während des Golfkrieges. Und unter diesen Gruppen war allein die IKS in der Lage, ein Licht darauf zu werfen, was in dieser Situation wirklich auf dem Spiel stand. Die für den Irak aufgestellte Falle wäre gegenstandslos gewesen, wenn es allein um Erdöl gegangen wäre. Ihr Zweck wird erst klar, wenn wir berücksichtigen, dass das, was wirklich auf dem Spiel stand, die US-Führerschaft in der Zeit nach dem Kollaps des Blocksystems war7. Erst in diesem Zusammenhang erhält die Ölfrage als ein Element in der allgemeinen imperialistischen Politik ihre volle Bedeutung.
Im Rahmen ihrer Propaganda und „News“ tut die Bourgeoisie alles, was sie kann, die Arbeiterklasse – die allein der Bourgeoisie und ihrem System ein Ende machen kann – daran zu hindern, sich darüber bewusst zu werden, was auf dem Spiel steht. Sie verdoppelt ihre Bemühungen, wann immer die tödliche Wirtschaftskrise, die das System seit den letzten 30 Jahren erfasst hat, oder Ereignisse wie der Golfkrieg zur Debatte stehen. Was ihre ideologischen Kapazitäten angeht, ihre Fähigkeit zu lügen, zu verstecken und die Realität zu verzerren, so bieten die Propagandaspezialisten totalitärer Regimes nichts, was die demokratische Bourgeoisie noch lernen könnte. Die Revolutionäre haben die Pflicht, nicht nur die imperialistische Barbarei, sondern auch die Propagandamechanismen zu denunzieren, womit die Bourgeoisie versucht, das Proletariat zu narkotisieren und für dumm zu verkaufen.
PA, 30. März 2001
1 Dieses Zitat ist der Enzyklopädia Universalis entnommen. Ihre Artikel wurden von bedeutenden Historikern verfasst, und wir können davon ausgehen, dass die Kapitel in den Schulbüchern zur Indoktrination der jungen Generationen auf dieselbe Art und Weise geschrieben werden.
2 Dieser Bericht erwähnt nicht die Statisten, die der Vervollständigung des Szenarios dienen: die so genannten „Anti-Imperialisten“ und die Pazifisten. Einige Fraktionen der europäischen Bourgeoisie (von den Rechtsextremen bis hin zu den Linksextremen, in Frankreich einschließlich der „Nationalrepublikaner“ und anderer „Verteidiger der nationalen Souveränität“) heizen anti-amerikanische Ressentiments auf, um ihre Nichtübereinstimmung mit den gegenwärtigen rechten oder linken Regierungen in Europa auszudrücken. Im Allgemeinen betonen all diese bürgerlichen Fraktionen, die die anti-irakische Koalition kritisieren, die Bedeutung des Erdöls als Hauptursache des Krieges.
Frankreich befand sich damals unter der sozialistischen Regierung François Mitterands. Das einzige Regierungsmitglied, das seine Ablehnung gegenüber der anti-irakischen Koalition offen zum Ausdruck brachte, war der linke, nationalrepublikanische Chevènement. Spaniens sozialistische Regierung unter Felipe Gonzales nahm ebenfalls an der anti-irakischen Koalition teil, trotz des Gezeters gewisser Sozialisten. Es ist bemerkenswert, dass die Grünen in Deutschland durch und durch Pazifisten waren. Während des letzten Krieges in Ex-Jugoslawien – sie befanden sich bereits in der Regierung – waren sie, ohne zu zaudern, für die Bombardierung Serbiens. Wenn man etwas Gutes über die deutschen Grünen sagen kann, dann, dass sie uns langatmige Analysen über die wahre Natur des Pazifismus erspart haben. Es reicht aus, ihre Taten zu betrachten.
3 Dr. Goebbels war der Minister für Propaganda und Information im deutschen Naziregime. Wenn wir diesen Ausdruck benutzen, dann aus dem Grunde, weil Goebbels seither als archetypisches Muster für die Propaganda, Indoktrination und Manipulation des bürgerlichen Staates gilt. Doch wie dieser Artikel aufzuzeigen beabsichtigt, gibt es an ähnlichen Exemplaren auch in stalinistischen oder demokratischen Regimes keinen Mangel.
4 „Against the spiral of military barbarism, there is only one solution: the development of the class struggle“, International Review, Nr. 64, erstes Vierteljahr 1991;
5 In der Tat hat bis zum Zeitpunkt der Golfkrise die westliche Presse ein Loblied auf Saddam gesungen, indem sie ihn als „modernen“ Herrscher und vor allem als jemanden schilderte, der gegen die Ambitionen der iranischen Ajatollahs während des iranisch-irakischen Krieges unterstützt werden sollte. 1988 unterstützten westliche Regierungen Saddams Unterdrückung der Kurden, der dabei von chemischen Waffen Gebrauch machte, da er zu jener Zeit das Schlüsselelement gegen den Iran darstellte.
6 Marianne fährt fort, dass es „ein bisschen so war, als ob die Alliierten im Winter 1945 am Rhein gestoppt und Hitler genügend Waffen gelassen hätten, um mit eventuellen Aufständischen fertig zu werden“. Doch es ist nicht „ein bisschen so“, genau dies taten die Alliierten in Italien 1944, als sie ihre Nordoffensive gestoppt hatten, um dem faschistischen Regime freie Hand bei der Zerschlagung von Arbeiterstreiks und Aufständen zu gewähren, die dort ausgebrochen waren.
7 s. „The proletarian political milieu confronted with the Gulf War“ (1. November 90), International Review, Nr. 64 und unseren „Appeal to the proletarian political milieu“ in Nr. 67 (Juli 1991);
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [78]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Internationale Revue - 2002
- 3843 Aufrufe
Internationale Revue 29
- 2905 Aufrufe
14. Kongress der IKS: Bericht über den Klassenkampf: Die revolutionäre Bewegung und das Konzept des Historischen Kurses,Teil 1
- 2812 Aufrufe
Seit dem Bericht über den Klassenkampf auf dem letzten Kongress hat es keine unmittelbaren Verschiebungen in der allgemeinen Lage der Klasse gegeben. Das Proletariat hat in etlichen Kämpfen demonstriert, dass seine Kampfbereitschaft intakt ist und dass seine Unzufriedenheit wächst (s. Transportarbeiterstreik in New York, ‚Generalstreik‘ in Norwegen, Kämpfe in zahllosen Bereichen in Frankreich, der Postangestellten in Großbritannien, Bewegungen in peripheren Ländern wie Brasilien, China, etc.). Doch die Situation ist auch weiterhin vornehmlich von den Schwierigkeiten geprägt, denen sich die Klasse gegenübersieht – Schwierigkeiten, die ihr infolge der Bedingungen des zerfallenden Kapitalismus aufgezwungen wurden und die kontinuierlich von den Kampagnen der Bourgeoisie über das ‚Ende der Arbeiterklasse‘, die ‚Neue Ökonomie‘, die ‚Globalisierung‘ und selbst über den ‚Antikapitalismus‘ verschärft wurden. Innerhalb des politischen Milieus des Proletariats verbleiben fundamentale Meinungsverschiedenheiten über das Kräfteverhältnis mit gewissen Gruppen, die die ‚idealistische‘ Sichtweise der IKS über den Historischen Kurs als Grund anführen, um sich nicht an einer gemeinsamen Initiative gegen den Kosovo-Krieg zu beteiligen. Dies ist sicherlich ein Grund dafür, diesen Bericht nicht so sehr auf die Kämpfe zu konzentrieren, sondern darauf, unser Verständnis für das Konzept des Historischen Kurses, so wie es in der Arbeiterbewegung entwickelt worden war, zu vertiefen: Wenn wir dieser Kritik wirkungsvoll entgegentreten wollen, müssen wir uns an die historischen Wurzeln der Missverständnisse begeben, die das proletarische Milieu infiziert haben. Ein weiterer Grund besteht darin, dass eine unserer Schwächen in unseren eigenen Analysen der jüngsten Kämpfe eine gewisse Neigung zum Immediatismus war, eine Tendenz, sich auf bestimmte Kämpfe zu konzentrieren, um sie als ‚Beweis‘ für die Richtigkeit unserer Position über den Kurs zu verwenden, oder sich auf die Schwierigkeiten des Kampfes zu stürzen, um sie als mögliche Basis für die Infragestellung unserer Auffassungen zu nutzen. Was folgt, ist weit entfernt davon, ein erschöpfender Überblick zu sein; Absicht des Artikels ist es, der Organisation dabei zu assistieren, sich selbst etwas näher mit der allgemeinen Methode bekannt zu machen, mit der sich der Marxismus dieser Frage angenähert hat.
Teil 1: 1848-1952
Vom Kommunistischen Manifest bis zum Ersten Weltkrieg
Das Konzept des ‚Historischen Kurses‘, wie es vor allem von der italienischen Fraktion der Linkskommunisten entwickelt worden war, entspringt der historischen Alternative, die von der marxistischen Bewegung im 19. Jahrhundert entwickelt worden war: die Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei. Mit anderen Worten, die kapitalistische Produktionsweise enthält selbst die beiden sich widersprechenden Tendenzen und Möglichkeiten – die Tendenz zur Selbstvernichtung und die Tendenz zur weltweiten Assoziation der Arbeit und zur Entstehung einer neuen und höheren Gesellschaftsordnung. Dabei muss betont werden, dass aus marxistischer Sicht keine der beiden Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft von Außen aufgedrängt werden, wie beispielsweise die bürgerlichen Theorien, die solche Manifestationen der Barbarei wie den Nazismus oder Stalinismus für eine der kapitalistischen Normalität fremdartigen Störung erklären, oder die mannigfaltigen mystischen und utopistischen Visionen über die Ankunft der kommunistischen Gesellschaft meinen. Beide möglichen Resultate des historischen Niedergangs des Kapitals sind der logische Höhepunkt seines innersten Lebensprozesses. Die Barbarei, der gesellschaftliche Kollaps und der imperialistische Krieg rühren aus der unbarmherzigen Konkurrenz her, die das System vorwärtstreibt, aus den der Warenproduktion innewohnenden Spaltungen und dem unaufhörlichen Krieg eines Jeden gegen Jeden. Der Kapitalismus schafft infolge der Notwendigkeit des Kapitals, die Arbeit zu vereinheitlichen und zu assoziieren, so mit dem Proletariat seinen eigenen Totengräber. Entgegen aller idealistischen Irrtümer, die das Proletariat vom Kommunismus zu trennen versuchen, definierte Marx Letzteren als Verkörperung seiner ‚wahren Bewegung‘ und hielt daran fest, dass die Arbeiterklasse „keine Ideale zu verwirklichen (hat); sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoß der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben“ („Der Bürgerkrieg in Frankreich“).
Im Kommunistischen Manifest gibt es eine gewisse Neigung zur Annahme, dass diese Schwangerschaft automatisch mit einer glücklichen Geburt endet – dass der Sieg des Proletariats unvermeidlich sei. Gleichzeitig zeigt das Manifest, wenn es von den früheren Gesellschaftsformen spricht, auf, dass, wenn die Revolution sich nicht durchgesetzt hätte, das Ergebnis ”der gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen“ gewesen wäre – kurz: die Barbarei. Obgleich diese Alternative nicht ausdrücklich auf den Kapitalismus gemünzt wird, ist sie die logische Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass die proletarische Revolution alles andere als ein automatischer Prozess ist und die bewusste Selbstorganisation des Proletariats erfordert, jener Klasse, deren Mission darin besteht, eine Gesellschaft zu schaffen, die es der Menschheit erstmalig erlaubt, Herr über ihr eigenes Schicksal zu werden. Ab da konzentriert sich das Manifest auf die Notwendigkeit der „Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen Partei“. Ungeachtet späterer Klärungen über die Unterscheidung zwischen der Partei und der Klasse, bleibt der Kern dieser Stellungnahme völlig zutreffend: Das Proletariat kann nur als eine revolutionäre und selbstbewusste Kraft handeln, wenn es den Kapitalismus auf politischer Ebene konfrontiert; und wenn es so handelt, kann es nicht auf die Notwendigkeit verzichten, eine politische Partei zu gründen.
Ebenso klar wurde verstanden, dass die „Organisation der Proletarier zur Klasse“, ausgerüstet mit einem expliziten Programm gegen die kapitalistische Gesellschaft, nicht zu jeder Zeit möglich war. Schon im Manifest wurde die Notwendigkeit für die Klasse betont, durch eine lange Periode der Schulung zu gehen, wo sie ihren Kampf von seinen ursprünglichen, „primitiven“ Formen (wie dem Ludismus) zu organisierteren und bewussten Formen (Bildung von Gewerkschaften und politischen Parteien) weiterentwickeln konnte. Und entgegen dem „jugendlichen“ Optimismus des Manifestes über das Potenzial einer sofortigen Revolution zeigte die Erfahrung von 1848-52, dass Perioden der Konterrevolution und des Rückzugs ebenfalls Teil der Schulung des Proletariats waren und dass in solchen Perioden die Taktiken und die Organisation der proletarischen Bewegung sich entsprechend anzupassen haben. Dies war die ganze Bedeutung der Polemik zwischen der marxistischen Strömung und der Willich-Schapper-Tendenz, die in Marx‘ Worten „statt der materialistischen Auffassung eine idealistische vertritt. Statt die wirkliche Lage als die Triebkraft der Revolution zu betrachten, sieht sie einzig den Willen“ (Adresse an den Zentralrat des Bundes der Kommunisten, September 1850). Diese Herangehensweise war die Grundlage für die Entscheidung, den Kommunistischen Bund aufzulösen und sich auf die Aufgaben der Klärung und der Verteidigung der Prinzipien zu konzentrieren – die Aufgaben einer Fraktion –, statt Energien in grandiosen revolutionären Abenteuern zu verschwenden. Mit ihrer tatsächlichen Praxis in der aufsteigenden Epoche des Kapitalismus zeigte die marxistische Vorhut, dass es vergebens war zu versuchen, eine wirklich wirkungsvolle Klassenpartei in Perioden des Rückzugs und der Reaktion zu gründen: Auch die Erste Internationale und die Zweite Internationale zur Zeit ihrer Gründung folgte dem Modell der Gründung von Parteien während Phasen wachsenden Klassenkampfes und der Erkenntnis der Unvermeidbarkeit ihres Dahinscheidens in Phasen der Niederlage.
Es ist wahr, dass die Schriften der Marxisten aus dieser Periode trotz vieler wichtiger Einsichten nicht in eine zusammenhängende Theorie über die Rolle der Fraktion in Perioden des Rückzugs mündeten; wie Bilan (die Publikation der Italienischen Linken während der 30er Jahre) hervorhob, war dies nicht möglich, solange der Begriff der Partei selbst nicht theoretisch erschlossen war, eine Aufgabe, die erst in der von der Dekadenz des kapitalistischen Systems eingeläuteten Periode des direkten Kampfes um die Macht vollkommen erfüllt werden konnte (s. unseren Artikel über das Verhältnis zwischen Fraktion und Partei in der International Review, Nr. 61). Darüber hinaus schärften die Bedingungen der Dekadenz die Konturen dieser Frage noch mehr, da im Gegensatz zur Aufstiegsperiode mit ihren langfristigen Kämpfen um Reformen, wo die politischen Parteien einen proletarischen Charakter bewahren konnten, ohne vollkommen aus Revolutionären zusammengesetzt zu sein, in der Dekadenz die Klassenpartei nur aus revolutionären Militanten zusammengesetzt sein darf und als solche sich nicht lange als eine kommunistische Partei – d.h. als ein Organ, das die Fähigkeit besitzt, die revolutionäre Offensive anzuführen – außerhalb der Phasen des offenen Klassenkampfes halten kann.
Aus dem gleichen Grund machten es die Bedingungen des aufsteigenden Kapitalismus nicht möglich, ein vollständiges Konzept darüber zu verfassen, dass die kapitalistische Gesellschaft, abhängig vom globalen Kräfteverhältnis der Klassen, auf einen Weltkrieg oder auf revolutionäre Aufstände zusteuert. Ein Weltkrieg war nicht „erforderlich“, für einen Kapitalismus, der seine periodischen Wirtschaftskrisen noch durch die Expansion des Weltmarkts überwinden konnte, und da sich der Kampf um Reformen noch nicht erschöpft hatte, blieb die Weltrevolution für die Arbeiterklasse eher eine langfristige Perspektive denn eine brennende Notwendigkeit. Die historische Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei konnte noch nicht in einer viel unmittelbareren Wahl zwischen Krieg und Revolution herausgefiltert werden.
Nichtsdestotrotz hatte das Auftauchen des Imperialismus Engels 1887 in die Lage versetzt, eine erste klare Vorhersage über die genaue Form zu machen, die die Tendenz des Kapitalismus zur Barbarei anzunehmen gezwungen war – verheerende Kriege im eigentlichen Herzen des Systems: „Und endlich ist kein andrer Krieg für Preußen-Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg, und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Europa kahlfressen, wie noch nie ein Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, allgemeine, durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der Heere wie der Volksmassen; rettungslose Verwirrung unsres künstlichen Getriebs in Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankerott; Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer traditionellen Staatsweisheit, derart, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sich findet, der sie aufhebt, absolute Unmöglichkeit, vorherzusehen, wie das alles enden und wer als Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird, nur ein Resultat absolut sicher: die allgemeine Erschöpfung und die Herstellung der Bedingungen des schließlichen Siegs der Arbeiterklasse.“ (15. Dezember 1887, MEW Bd. 21, S. 350f.) Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass Engels – indem er sich zweifellos auf die Erfahrung der Pariser Kommune anderthalb Jahrzehnte zuvor berief – voraussah, dass dieser europäische Krieg die proletarische Revolution in die Welt setzen wird.
Während des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts wurde die wachsende Gefahr dieses Krieges zu einer wichtigen Beschäftigung für den revolutionären Flügel der Sozialdemokratie, für diejenigen also, die sich nicht von den Sirenengesängen des „endlosen Fortschritts“, des „Superimperialismus“ und anderer Ideologien täuschen ließen, welche große Teile der Bewegung in den Bann zogen. Auf den Kongressen der Zweiten Internationalen war es der linke Flügel – besonders Lenin und Luxemburg –, der am stärksten auf der Notwendigkeit für die Internationale bestand, angesichts der Kriegsdrohung klare Stellung zu beziehen. Die Stuttgarter Resolution von 1907 und die Baseler Resolution, die 1912 ihre Vorhersagen bekräftigte, waren Früchte ihrer Bemühungen. Die erste stellte folgende Bedingung auf: „Droht der Ausbruch eines Krieges, so sind die arbeitenden Klassen und deren parlamentarische Vertretungen in den beteiligten Ländern verpflichtet, unterstützt durch die zusammenfassende Tätigkeit des Internationalen Büros, alles aufzubieten, um durch die Anwendung der ihnen am wirksamsten erscheinenden Mittel den Ausbruch des Krieges zu verhindern, die sich je nach der Verschärfung des Klassenkampfes und der Verschärfung der allgemeinen politischen Situation naturgemäß ändern.
Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es die Pflicht, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur Aufrüttelung des Volkes auszunutzen und dadurch die Beseitigung der kapitalistischen Klassenherrschaft zu beschleunigen.“
Mit einem Wort: Angesichts des Abgleitens des Imperialismus in einen katastrophalen Krieg musste die Arbeiterklasse sich nicht nur diesem Abgleiten widersetzen, sondern auch, als der Krieg ausbrach, mit revolutionären Taten darauf antworten. Diese Resolutionen sollten als Grundlage für Lenins Parole während des Ersten Weltkrieges dienen: ‚Verwandelt den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg‘.
Um diese Periode widerzuspiegeln, ist es wichtig, nicht zurück zu projizieren, was das Bewusstsein beider Seiten der Klassengrenze anbelangt. Auf dieser Stufe konnte weder das Proletariat noch die Bourgeoisie vollkommen erfassen, was ein Weltkrieg wirklich bedeutete. Vor allem war noch nicht deutlich geworden, dass der moderne imperialistische Krieg nicht ohne die totale Mobilisierung des Proletariats – sowohl der Arbeiter in Uniform als auch der Arbeiter an der Heimatfront – geführt werden kann, da er ein totaler Krieg und keine auf abgelegenen Schlachtfeldern ausgefochtene Auseinandersetzung zwischen Söldnerarmeen ist. Sicherlich hatte die Bourgeoisie begriffen, dass sie keinen Krieg vom Zaun brechen kann, ohne sicher zu sein, dass die Sozialdemokratie verfault genug war, sich ihm nicht zu widersetzen. Doch die revolutionären Ereignisse von 1917–23, die direkt vom Krieg ausgelöst worden waren, erteilten ihr viele Lehren, die sie nie vergessen sollte, vor allem bezüglich der Notwendigkeit, sorgfältig den gesellschaftlichen und politischen Boden zu bereiten, ehe sie einen größeren Krieg auslöst, mit anderen Worten: die ideologische und physische Zerstörung der proletarischen Opposition zu vervollständigen.
Wenn man das Problem vom Standpunkt des Proletariats aus betrachtet, fällt auf, dass es in der Stuttgarter Resolution an einer Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen mangelt – einer Analyse der wirklichen Stärke des Proletariats, seiner Fähigkeit, sich dem Abgleiten in den Krieg zu widersetzen. Aus der Sicht der Resolution konnte der Krieg durch die Klassenaktion verhindert oder, nach seinem Ausbruch, gestoppt werden. In der Tat argumentierte die Resolution, dass die vielfältigen Antikriegs-Stellungnahmen und die Interventionen der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie in diesen Tagen „Zeugnis ablegen von der wachsenden Macht des Proletariats und von seiner wachsenden Kraft, die Aufrechterhaltung des Friedens durch entschlossenes Eingreifen zu sichern“. Diese optimistische Stellungnahme stellte eine tatsächliche Unterschätzung des Ausmaßes dar, in dem die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften bereits in das System integriert worden waren und sich als nutzlose Instrumente (und nicht nur das) für die internationalistische Antwort erwiesen hatten. Dies sollte die Linke in einige Verwirrung stürzen, als der Krieg ausbrach – wie beispielsweise Lenins Ansicht bezeugt, dass das deutsche Oberkommando die Ausgabe des Vorwärts gefälscht habe, die die Arbeiter zur Unterstützung des Krieges aufrief; die Isolation der Gruppe Internationale in Deutschland und so weiter. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass es der schleichende Verrat durch die alten Arbeiterorganisationen, ihre allmähliche Einverleibung in den Kapitalismus waren, die das Kräfteverhältnis zuungunsten der Arbeiterklasse verschoben sowie den Kurs zum Krieg öffneten, und dies trotz der hochgradigen Kampfbereitschaft, die die Arbeiter in vielen Ländern in dem Jahrzehnt vor dem Krieg und noch kurz zuvor offenbart hatten.
Letztere Tatsache hat häufig Anlass zur Theorie gegeben, dass die Bourgeoisie den Krieg als Präventivmaßnahme gegen die drohende Revolution ausgelöst habe – eine Theorie, die, wie wir meinen, auf dem Unvermögen basiert, zwischen Kampfbereitschaft und Bewusstsein zu unterscheiden, und die die enorme historische Bedeutung und Auswirkung des Verrats der Organisationen herunterspielt, die die Arbeiterklasse mit so viel Mühe aufgebaut hatte. Was dagegen zutrifft, ist, dass die Art und Weise des ersten großen Sieges der Bourgeoisie über die Arbeiter – der von der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften proklamierte ‚Burgfrieden‘ – sich als ungenügend erwies, um die Dynamik des Massenstreiks total zu brechen, die in der europäischen, russischen und amerikanischen Arbeiterklasse im Jahrzehnt zuvor herangereift war. Die Arbeiterklasse erwies sich als fähig, sich von der hauptsächlich ideologischen Niederlage von 1914 zu erholen und drei Jahre später ihre revolutionäre Antwort zu formulieren. So wendete das Proletariat durch seine eigene Tat den Historischen Kurs: Die Flutwelle floss nun weg vom imperialistischen Weltkonflikt hin zur kommunistischen Weltrevolution.
Von der revolutionären Welle zur Konterrevolution
Während der folgenden revolutionären Jahre schuf die Praxis der Bourgeoisie ihren eigenen ‚Beitrag‘ zur Vertiefung des Problems des historischen Kurses. Sie bewies, dass angesichts einer offenen revolutionären Herausforderung durch die Arbeiterklasse der Marsch in den Krieg nur den zweiten Platz gegenüber der Notwendigkeit einnahm, die Kontrolle über die ausgebeuteten Massen wiederzuerlangen. Dies war nicht nur der Fall in der Hitze der Revolution selbst, als die Aufstände in Deutschland die herrschende Klasse dazu zwangen, einen Waffenstillstand auszurufen und sich gegen ihren Todfeind zu vereinigen, sondern auch in den folgenden Jahren, da die interimperialistische Antagonismen zwar nicht verschwanden (der Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland zum Beispiel), aber weitestgehend hintangestellt wurden, während die Bourgeoisie um die Lösung der sozialen Frage rang. Dies ist zum Beispiel die Erklärung für die Unterstützung von Hitlers Programm des Terrors gegen die Arbeiterklasse durch viele Fraktionen der Weltbourgeoisie, obwohl deren imperialistische Interessen einzig von einem wiedererwachten deutschen Militarismus bedroht werden konnten. Die Wiederaufbauperiode, die dem Krieg folgte – auch wenn sie im Vergleich mit der Wiederaufbauperiode nach 1945 in Umfang und Tiefe sehr begrenzt war – diente ebenfalls dazu, das Problem der Neuaufteilung der imperialistischen Beute zeitweilig zu verschieben, soweit die herrschende Klasse betroffen war.
Der Kommunistischen Internationalen ihrerseits wurde nur sehr wenig Zeit gewährt, um solche Fragen zu klären, obwohl sie von Beginn an klar gemacht hatte, dass, sollte die Arbeiterklasse daran scheitern, auf die revolutionäre Herausforderung durch die russischen Arbeiter zu antworten, der Weg zu einem weiteren Weltkrieg offen sei. Das Manifest des ersten Kongresses der KI (März 1919) warnte davor, dass, sollte sich die Arbeiterklasse von den Predigten der Opportunisten vereinnahmen lassen, „so würde die kapitalistische Entwicklung auf den Knochen mehrerer Generationen in neuer, noch konzentrierterer und ungeheuerlicherer Form ihre Wiederaufrichtung feiern mit der Aussicht eines neuen, unausbleiblichen Weltkrieges. Zum Glück für die Menschheit ist dies nicht mehr möglich“. Während dieser Periode war die Frage der Kräftebalance zwischen den Klassen in der Tat entscheidend, jedoch weniger in Bezug auf die Kriegsgefahr als vielmehr auf die unmittelbaren Chancen der Revolution. Der letzte Satz in der eben zitierten Passage verschafft uns Stoff zum Nachdenken: In den ersten, unbesonnenen Momenten der revolutionären Welle gab es eine eindeutige Tendenz, die den Sieg der Weltrevolution als unumstößlich ansah und die sich nicht vorstellen konnte, dass ein neuer Weltkrieg wirklich möglich war. Dies stellte eine eindeutige Unterschätzung der gigantischen Aufgabe dar, der sich die Arbeiterklasse bei der Schaffung einer auf Solidarität basierenden Gesellschaft und bei der bewussten Beherrschung der Produktivkräfte gegenübersieht. Und zusätzlich zu diesem allgemeinen Problem, das für alle revolutionären Bewegungen der Klasse gilt, kommt noch hinzu, dass das Proletariat sich in den Jahren 1914–21 mit dem plötzlichen und brutalen ‚Ausbruch‘ einer neuen historischen Epoche konfrontiert sah, die es dazu zwang, seine althergebrachten Verhaltensweisen und Kampfmethoden abzulegen und sich ‚über Nacht‘ neue Methoden zu verschaffen, die für diese neue Periode geeignet waren.
Nachdem der erste Schwung der revolutionären Welle nachgelassen hatte, erwies sich der auf eine Art vereinfachende Optimismus der frühen Jahre als unangemessen, und es wurde immer dringlicher, eine nüchterne und realistische Einschätzung des wahren Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen zu machen. In den frühen 20er Jahren gab es eine besonders scharfe Polemik zwischen der KI und der deutschen Linken über diesen Punkt, eine Debatte, in der keine der beiden Seiten die Wahrheit für sich allein gepachtet hatte. Die KI erblickte schneller die Realität des Rückzugs der Revolution nach 1921 und somit die Notwendigkeit, die Organisation zu konsolidieren und durch die Teilnahme an ihren Verteidigungskämpfen das Vertrauen der Arbeiterklasse zu erwerben. Doch unter dem Druck der Forderungen des auf Grund gelaufenen russischen Staates und seiner Wirtschaft, neue Stützpunkte außerhalb Russlands zu finden, übersetzte die KI diese Perspektive in wachsendem Maße in die Sprache des Opportunismus (Einheitsfront, Vereinigung mit zentristischen Parteien, etc.). Die deutsche Linke lehnte diese opportunistischen Schlussfolgerungen rundweg ab, doch ihre revolutionäre Ungeduld sowie ihre Theorie von der Todeskrise des Kapitalismus hinderte sie daran, den Unterschied zwischen der allgemeinen historischen Epoche des kapitalistischen Niedergangs, die die Notwendigkeit einer Revolution im allgemeinen historischen Sinn beinhaltete, und den verschiedenen unmittelbaren Phasen innerhalb dieser Epoche zu erblicken, Phasen, die nicht automatisch alle Bedingungen für einen revolutionären Umsturz in sich tragen. Das Versäumnis der deutschen Linken, das objektive Kräfteverhältnis zwischen den Klassen zu analysieren, war mit der Schlüsselschwäche an der organisatorischen Front verknüpft – ihre Unfähigkeit, die Aufgaben einer Fraktion zu begreifen, die gegen die Degeneration der alten Partei kämpft. Diese Schwächen sollten fatale Konsequenzen für die eigentliche Existenz der deutschen Linken als organisierte Strömung haben.
Der Beitrag der Italienischen Linken
Genau an diesem Punkt kam die Italienische Linke als ein internationaler Pol der Klärung zum Tragen. Sie, die selbst ihre Erfahrungen mit dem Faschismus gemacht hatte, war in der Lage, Kenntnis davon zu nehmen, dass das Proletariat von der entschlossenen Offensive der Bourgeoisie zurückgedrängt worden war. Diese Erkenntnis führte jedoch weder zum Sektierertum, da sie fortfuhr, an den Verteidigungskämpfen der Klasse teilzunehmen, noch zum Opportunismus, da sie deutliche Kritik an der Gefahr des Opportunismus in der Internationalen übte, besonders an den Zugeständnissen Letzterer gegenüber der Sozialdemokratie. Nachdem sie sich bereits in den Auseinandersetzungen innerhalb der italienischen Sozialistischen Partei in den Aufgaben einer Fraktion geübt hatte, würdigte die Italienische Linke ebenfalls voll und ganz die Notwendigkeit, innerhalb der existierenden Klassenorgane zu kämpfen, solange diese irgendeinen proletarischen Charakter enthielten. Um 1927/28 musste die Linke jedoch erkennen, dass der Ausschluss der linken Opposition aus der bolschewistischen Partei und anderer linker Strömungen auf internationaler Ebene eine qualitative Vertiefung der Konterrevolution bedeutete und die formelle Gründung einer unabhängigen linken Fraktion verlangte, auch wenn die Möglichkeit einer Wiedereroberung der Kommunistischen Parteien offen gelassen wurde.
Das Jahr 1933 war das nächste bedeutsame Datum für die Italienische Linke, nicht nur, weil in jenem Jahr die erste Ausgabe von Bilan herauskam, sondern auch, weil der Triumph des Nazismus in Deutschland die Fraktion davon überzeugte, dass der Kurs zu einem zweiten Weltkrieg nun eröffnet war. Bilans Verständnis der Dynamik im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen seit 1917 wurde im Logo, das ihre Zeitung einige Zeit schmückte, zusammengefasst: „Lenin 1917, Noske 1919, Hitler 1933“: Lenin als Personifizierung der proletarischen Revolution, Noske als solche der Unterdrückung der revolutionären Welle durch die Sozialdemokratie, Hitler als Inbegriff der Komplettierung der bürgerlichen Konterrevolution und der Vorbereitungen für einen neuen Krieg. Von Anbeginn war Bilans Position in der Debatte über den Historischen Kurs eines ihrer markantesten Kennzeichen.
Es trifft zu, dass der Leitartikel von Bilan Nr.[i], der durchaus die schwere Niederlage der Arbeiterklasse anerkennt, irgendwie unentschlossen erscheint, räumt er doch die Möglichkeit ein, dass das Proletariat immer noch imstande sei, seinen Kampf wiederzubeleben und durch einen neuen revolutionären Anlauf den Kriegsausbruch zu verhindern (s. The Italian Communist Left, S. 71). Dies war möglicherweise das Resultat des Unwillens, die Möglichkeit der Umkehrung der konterrevolutionären Flutwelle völlig auszuschließen. Doch in den nächsten paar Jahren gründeten sich sämtliche Analysen der internationalen Lage von Bilan – ob es dabei um die nationalen Befreiungskämpfe in der Peripherie ging, um die Expansion der deutschen Macht in Europa, die Volksfront in Frankreich, die Integration der UdSSR in das imperialistische Schachspiel oder um die so genannte spanische Revolution – auf die nüchterne Erkenntnis, dass sich die Waage im Kräfteverhältnis entscheidend zuungunsten des Proletariats geneigt und die Bourgeoisie den Weg zu einem weiteren imperialistischen Massaker freigemacht hat. Diese Entwicklung wurde mit großer Klarheit in einem Text in Bilan Nr. 17 ausgedrückt: ”Die Bildung von Fraktionen in einer Epoche zu befürworten, in der die Zerschlagung des Weltproletariats von einer Konkretisierung des Kriegsausbruchs begleitet wird, ist die Stellungnahme eines ‚Fatalismus‘, der die Unvermeidbarkeit des kommenden Krieges und die Unmöglichkeit der Mobilisierung des Proletariats dagegen akzeptiert” (‚Resolutionsentwurf über die Probleme der linken Fraktion‘).
In Bilan Nr.16 wurde der unüberbrückbare Gegensatz zwischen einem Kriegskurs und dem Kurs zur Revolution resümiert: „Wir haben es bereits gesagt: Krieg und Revolution sind zwei gegensätzliche Ausdrücke derselben Situation, in der beide aus der Explosion der Widersprüche heranreifen (...), doch sie sind ‚gegensätzliche Ausdrücke‘, was bedeutet, dass die Entfesselung des Krieges aus politischen Bedingungen resultiert, die die Revolution ausschließen. Es ist eine anarchistische Vereinfachung, wenn man meint, dass in dem Moment, wenn der Kapitalismus die Arbeiter bewaffnen muss, die Bedingungen bereits reif sind für das Proletariat, diese Waffen für den Triumph seiner revolutionären Sache zu benutzen (...) Das ganze Ausmaß des Gegensatzes zwischen Krieg und Revolution wird deutlich, wenn man anerkennt, dass die politischen Bedingungen, die den Ausbruch des Krieges erst möglich machen, das Verschwinden aller Bedingungen mit einschließen, die den Sieg des Proletariats erlauben könnten, und zwar aller Art von revolutionärer Bewegung bis hin zur letzten Äußerung des proletarischem Bewusstseins“ (‚Resolutionsentwurf über die internationale Lage‘).
Diese methodische Herangehensweise stand in krassem Gegensatz zur Position Trotzkis, der zu jener Zeit (und auch später) der weitaus bekannteste ‚Repräsentant‘ der linken Opposition gegen den Stalinismus war. Es sollte jedoch gesagt werden, dass auch Trotzki das Jahr 1933 und den Sieg des Nazismus als einen Wendepunkt betrachtete. Wie für Bilan markierte dieses Ereignis für ihn auch den endgültigen Verrat der Kommunistischen Internationalen zugunsten des Regimes in der UdSSR. Wie Bilan fuhr Trotzki zwar damit fort, sich auf Letzterem als Arbeiterstaat zu beziehen, meinte aber ab dieser Periode nicht mehr, dass das stalinistische Regime reformiert werden könnte, sondern dass es in einer ”politischen Revolution” mit Gewalt gestürzt werden muss. Doch neben diesen sichtbaren Ähnlichkeiten blieben fundamentale Gegensätze offen und sollten in einen endgültigen Bruch zwischen der italienischen Fraktion und der internationalen Linksopposition münden. Diese Gegensätze waren eng mit dem von der Italienischen Linken geprägten Begriff des Historischen Kurses und den Aufgaben einer Fraktion verbunden. Für Trotzki bedeutete der Bankrott der alten Partei die sofortige Proklamation einer neuen Partei. Bilan lehnte dies als voluntaristisch und idealistisch ab und bestand darauf, dass die Partei als effektive politische Führung der Klasse in Momenten des Tiefstands der Klassenbewegung nicht existieren könne. Trotzkis Bemühungen, in solch einer Periode eine Massenorganisation zusammenzuschustern, konnten nur zum Opportunismus führen, was durch die Hinwendung der Linksopposition zum linken Flügel der Sozialdemokratie ab 1934 beispielhaft veranschaulicht wurde. Für Bilan konnte eine wahre Partei des Proletariats nur gebildet werden, wenn die Klasse sich auf dem Kurs zum offenen Konflikt mit dem Kapitalismus befand. Doch die Aufgabe der Vorbereitung auf eine solche Situation, der Schaffung einer Basis für die zukünftige Partei konnte nur von einer Fraktion ausgeübt werden, die es als ihre Aufgabe ansieht, eine ‚Bilanz‘ der vergangenen Siege und Niederlagen zu ziehen.
Bezüglich der UdSSR führte Bilans Gesamtsicht der Situation, der sich das Proletariat gegenübersah, zur Ablehnung von Trotzkis Perspektive eines Angriffs des Weltkapitals auf den Arbeiterstaat – und somit der Notwendigkeit für das Proletariat, die UdSSR gegen einen solchen Angriff zu verteidigen. Stattdessen sah sie, dass in einer Periode der Reaktion es die unvermeidliche Tendenz eines isolierten Arbeiterstaates war, in das System von kapitalistischen Bündnissen gezogen zu werden, die den Boden für einen neuen Weltkrieg bereiteten. Daher die Ablehnung jeglicher Verteidigung der UdSSR als unvereinbar mit dem Internationalismus.
Es ist richtig, dass Trotzkis Schriften aus jener Zeit oft lebendige Einsichten in die durch und durch reaktionären Tendenzen enthalten, die die globale Lage beherrschten. Aber woran es Trotzki mangelte, war eine strenge Methode, ein wirkliches Konzept zum Historischen Kurs. So erlag Trotzki trotz des totalen Triumphes der Reaktion und trotz seiner Einsicht in das Herannahen eines Krieges einem falschen Optimismus, der im Faschismus die letzte Karte der Bourgeoisie gegen die Gefahr einer Revolution und im Antifaschismus in gewisser Weise einen Indikator für die Radikalisierung der Massen erblickte, der meinte, dass zur Zeit der Streiks unter der Volksfront in Frankreich 1936 ”alles möglich war”, oder die Behauptung für bare Münze nahm, dass im gleichen Jahr eine Arbeiterrevolution in Spanien im Gange sei. Mit einem Wort, Trotzkis Unkenntnis über die wahre Natur der Periode beschleunigte das Abgleiten des Trotzkismus in die Konterrevolution, während ihre Klarheit über dieselbe Frage Bilan in die Lage versetzte, an der Verteidigung der Klassenprinzipien festzuhalten, selbst zum Preis einer fürchterlichen Isolation.
Sicherlich forderte diese Isolation ihren Tribut von der Fraktion; so wurde ihre Klarheit nicht ohne große Auseinandersetzungen innerhalb ihrer eigenen Reihen verteidigt. Zunächst gegen die Positionen der Minderheit über den spanischen Bürgerkrieg, als der Druck, an der illusorischen ”spanischen Revolution” teilzunehmen, immens war und die Minderheit ihm mit ihrer Entscheidung, in den Milizen der POUM mitzukämpfen, erlag. Die Unnachgiebigkeit der Mehrheit wurde größtenteils deswegen durchgehalten, weil sie sich weigerte, die Ereignisse in Spanien isoliert zu behandeln, und diese als Ausdruck des weltweiten Kräfteverhältnisses betrachtete. Dann gegen Gruppen wie die Union Communiste oder die LCI (Ligue des Communistes Internationalistes, die belgische Hennaut-Gruppe), deren Positionen jenen der Minderheit ähnelten und die Bilan vorhielten, außerstande zu sein, eine Klassenbewegung als solche zu erkennen, wenn diese nicht von der Partei angeführt würde, und in der Partei eine Art Deus ex machina zu erblicken, ohne die die Massen nichts erreichen könnten. Bilan antwortete, dass das Fehlen einer Partei in Spanien das Produkt der Niederlagen sei, die das Proletariat international erlitten habe. Sich mit den spanischen Arbeitern völlig solidarisch erklärend, bestand Bilan dennoch darauf, dass dieser Mangel an programmatischer Klarheit dazu geführt habe, dass ihre anfänglichen, spontanen Reaktionen von ihrem eigenen Terrain auf das bürgerliche Terrain des interimperialistischen Krieges gedrängt worden seien.
Die Ansicht der Fraktion über die Ereignisse in Spanien wurde durch die Realität bestätigt; doch kaum hatte sie diese Feuerprobe bestanden, wurde sie schon in die nächste und noch größere gedrängt – Vercesis (einer der Haupttheoretiker innerhalb der Fraktion) Aneignung einer Konzeption, die alle vorherigen Analysen der Fraktion über die historische Periode in Frage stellte: die Theorie der Kriegswirtschaft.
Diese Theorie war das Ergebnis einer Flucht in den Immediatismus. Unter Berufung auf die Fähigkeit des Kapitalismus, den Staat und seine Kriegsvorbereitungen dafür zu nutzen, die Massenarbeitslosigkeit, die die erste Phase der Wirtschaftskrise der 30er Jahre charakterisiert hatte, teilweise wieder zu absorbieren, zogen Vercesi und seine Anhänger die Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus irgendwie eine tiefe Veränderung vollzogen hätte, mit der er seine historische Überproduktionskrise überwunden hätte. Mit dem Hinweis auf den elementaren marxistischen Grundsatz, dass der Hauptwiderspruch in der Gesellschaft der zwischen der ausbeutenden und ausgebeuteten Klasse sei, verstieg sich Vercesi dann zur Schlussfolgerung, dass der imperialistische Weltkrieg nicht mehr die Antwort des Kapitalismus auf seine inneren ökonomischen Widersprüche sei, sondern ein Akt der interimperialistischen Solidarität, die das Ziel habe, die revolutionäre Arbeiterklasse zu massakrieren. Somit bedeute, wenn der Krieg sich nähert, dies lediglich, dass die proletarische Revolution eine immer größere Gefahr für die herrschende Klasse werde. Tatsächlich bestand der Haupteffekt der Theorie der Kriegswirtschaft während dieser Periode darin, die Kriegsgefahr vollkommen herunterzuspielen. Lokale Kriege und punktuelle Massaker könnten, so wurde argumentiert, denselben Job für den Kapitalismus verrichten wie ein Weltkrieg. Das Ergebnis war, dass die Fraktion bei der Vorbereitung auf die Folgen, die der Krieg unvermeidlich für die Organisationsarbeit haben würde, völlig versagte und sich mit Kriegsbeginn fast völlig auflöste. Und Vercesis Theoretisierungen über die Bedeutung des Kriegs, als er dann ausbrach, vervollständigte die Schlappe: Der Krieg bedeute das „gesellschaftliche Verschwinden des Proletariats“ und mache jede organisierte militante Aktivität zwecklos. Das Proletariat könne nur auf den Weg der Kämpfe zurückkehren, die dem Ausbruch der „Krise der Kriegswirtschaft“ folgen (nicht ausgelöst durch das Wirken des Wertgesetzes, sondern durch die Erschöpfung der materiellen Mittel zur Fortsetzung der Kriegsproduktion). Die Konsequenzen dieses Aspektes der Theorie über das Kriegsende werden noch kurz untersucht werden, doch ihre erste Wirkung bestand darin, Unordnung und Demoralisierung in den Reihen der Fraktion zu säen.
In der Periode nach 1938, als Bilan, in Erwartung neuer revolutionärer Attacken durch die Arbeiterklasse, durch Octobre ersetzt wurde, wurden die Originalanalysen von Bilan von einer Minderheit am Leben erhalten und weiterentwickelt, die keinen Anlass sah, die Tatsache in Frage zu stellen, dass der Krieg nahe bevorstand, dass es einen neuen interimperialistischen Konflikt um die Aufteilung der Welt geben werde und dass die Revolutionäre auch unter widrigen Umständen ihre Aktivitäten aufrechterhalten müssten, um ein Verlöschen der Flamme des Internationalismus zu verhindern. Diese Arbeit wurde vor allem von jenen Militanten fortgesetzt, die nach 1941 die italienische Fraktion wiederbelebten und bei der Bildung der französischen Fraktion in den letzten Kriegsjahren behilflich waren.
Die Gauche Communiste de France setzt das Werk von Bilan fort
Diejenigen, die dem Werk Bilans treu blieben, hielten auch an ihrer Interpretation darüber fest, wohin sich der Kurs wendet – nämlich hin zur Feuersbrunst des Krieges. Diese Auffassung gründete sich fest auf den realen Erfahrungen der Klasse – 1871, 1905 und 1917; und auch die Ereignisse in Italien 1943 schienen dies zu bestätigen. Hier gab es eine authentische Klassenbewegung mit einer klaren Antikriegs-Ausrichtung, die nicht ohne Echo in der anderen geschlagenen europäischen Achsenmacht, in Deutschland blieb. Als die italienische Bewegung auch noch einen mächtigen Drang zur Sammlung der versprengten proletarischen Kräfte in Italien selbst entwickelte, schloss der französische Kern der Linkskommunisten in Übereinstimmung mit der italienischen Fraktion im Exil und in Italien daraus, dass „der Weg zur Gründung der Partei nun offen ist“. Doch während eine große Zahl von Militanten die sofortige Gründung der Partei darunter verstand, und zwar auf einer noch nicht genau definierten Basis, ließ die französische Fraktion (insbesondere der Genosse Marco – MC –, der Mitglied sowohl der italienischen als auch der französischen Fraktion war) nicht von ihrer rigorosen Herangehensweise los. Entgegen der Auflösung der italienischen Fraktion und der überstürzten Gründung der Partei bestand die französische Fraktion auf einer Untersuchung der italienischen Situation auch im Lichte der allgemeinen Weltlage und sträubte sich dagegen, von einem sentimentalen ‚Italozentrismus‘ mitgerissen zu werden, der etliche Mitglieder der italienischen Fraktion erfasst hatte. Die Gruppe in Frankreich (die spätere Gauche Communiste de France) war auch die erste, die erkannte, dass sich der Kurs nicht geändert hatte, dass die Bourgeoisie die notwendigen Lehren aus ihrer Erfahrung von 1917 gezogen hatte und dem Proletariat eine weitere entscheidende Niederlage beigebracht hatte.
Im Text ‚Die Aufgabe der Stunde – Parteigründung oder Bildung von Kadern‘, der in der Augustausgabe von Internationalisme 1946 (wiederveröffentlicht in der International Review Nr. 32), veröffentlicht worden war, gibt es eine beißende Polemik gegen den Wankelmut der anderen Strömungen des proletarischen Milieus jener Tage. Der Hauptinhalt der Polemik zielt darauf ab aufzuzeigen, dass die Entscheidung, die PCInt in Italien zu gründen, auf einer falschen Einschätzung der historischen Periode fußte und letztendlich zur Abschwörung von der marxistischen Konzeption der Fraktion zugunsten einer voluntaristischen und idealistischen Herangehensweise führte, die eine Menge mit dem Trotzkismus zu tun hatte, für den Parteien zu jeder Zeit und ohne jeglichen Bezug zur reellen historischen Situation, in der sich die Arbeiterklasse befindet, ‚errichtet‘ werden können. Doch der Artikel konzentriert sich – wahrscheinlich, weil die PCInt selbst, von einer aktivistischen Stampede ergriffen, kein wirklich zusammenhängendes Konzept des historischen Kurses entwickelt – auf die Analysen, die von anderen Gruppen des Milieus, insbesondere von der belgischen Fraktion der Linkskommunisten, die mit der PCInt personell verknüpft war, entwickelt wurden. In der Vorkriegsperiode war die von Mitchell 1 angeführte belgische Fraktion der aktivste Opponent gegen Vercesis Theorie der Kriegswirtschaft gewesen; ihre nach dem Krieg verbliebenen Überreste wandelten sich nun zu begeisterten Fürsprechern dieser Theorie. Diese enthielt die Idee, dass die Krise der Kriegswirtschaft tatsächlich nur nach dem Krieg ausbrechen könne, daher „ist die Nachkriegsperiode der Zeitpunkt, an dem die Umwandlung des imperialistischen Kriegs in einen Bürgerkrieg stattfindet... Die gegenwärtige Situation kann somit als die der ‚Umwandlung in den Bürgerkrieg‘ bezeichnet werden. Mit dieser Analyse als Ausgangspunkt wird die Lage in Italien als besonders fortgeschritten erklärt, um so die sofortige Konstituierung der Partei zu rechtfertigen, während die Unruhen in Indien, Indonesien und anderswo, die von etlichen konkurrierenden Imperialismen und den lokalen Bourgeoisien sicher im Zaum gehalten werden, als Anzeichen des antikapitalistischen Bürgerkrieges gesehen werden.“ Die katastrophalen Konsequenzen der totalen Missdeutung des wirklichen historischen Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen lagen auf der Hand; sie verleiteten die belgische Fraktion dazu, interimperialistische Konflikte als Ausdrücke einer der Revolution zustrebenden Bewegung anzusehen.
Ebenfalls bemerkenswert ist, dass der Artikel von Internationalisme eine weitere Theorie des Kurses kritisierte, die von den RKD (Revolutionäre Kommunisten Deutschlands, einer Gruppe, die sich während des Krieges vom Trotzkismus abgespaltet hatte, um internationalistische Positionen zu verteidigen) vorgestellt wurde. Nach Internationalisme „sucht (die RKD), wenn auch vorsichtig, Zuflucht in der Theorie des Doppelkurses, d.h.einer simultanen und parallelen Entwicklung des Kurses zur Revolution und eines anderen Kurses zum imperialistischen Krieg. Die RKD haben offensichtlich nicht verstanden, dass die Entwicklung eines Kurses zum Krieg vorrangig durch die Schwächung des Proletariats und die Abschwächung der Gefahr einer Revolution bedingt wird.”
Im Gegensatz dazu war Internationalisme in der Lage, deutlich zu erkennen, dass die Bourgeoisie ihre Lehren aus den Erfahrungen von 1917 gezogen und brutale Präventivmaßnahmen gegen die Gefahr einer durch das Kriegselend provozierten revolutionären Erhebung ergriffen hatte, dass sie der Arbeiterklasse besonders in Deutschland eine entscheidende Niederlage zugefügt hatte: „Dass der Kapitalismus einen Imperialistischen Krieg ‚beendet‘, der sechs Jahre ohne jegliches revolutionäres Auffllackern angedauert hat, zeigt die Niederlage des Proletariats und dass wir uns nicht am Vorabend grosser revolutionärer Kämpfe befinden, sondern in den Nachwehen einer Niederlage. Diese Niederlage fand 1945 mit der physischen Zerstörung des revolutionären Zentrums, das das deutsche Proletariat darstellte, statt, und sie war um so entscheidender, als sich das Weltproletariat der Niederlage, die es erlitten hat, nicht bewusst war“
Internationalisme lehnte also nachdrücklich alle voluntaristischen und aktivistischen Schemata zur Gründung einer neuen Partei in solch einer Periode ab und beharrte darauf, dass die Aufgabe der Stunde die ‚Bildung von Kadern‘ sei – in anderen Worten, die Fortsetzung der Arbeit der linken Fraktionen.
Jedoch gab es eine ernsthafte Schwachstelle in der Argumentation der GCF – nämlich die im obigen Artikel zum Ausdruck gebrachte Schlussfolgerung, dass „der Kurs in Richtung eines dritten imperialistischen Krieges eingeschlagen wurde... Unter den gegenwärtigen Umständen sehen wir keine Kraft, die imstande wäre, diesen Kurs zu stoppen oder zu ändern.“ Eine weitere Theoretisierung dieser Position ist in dem Artikel „Die Evolution des Kapitalismus und die neuen Perspektiven“ enthalten, der 1952 veröffentlicht wurde (wiederveröffentlicht in International Review Nr. 21). Dies ist ein fruchtbarer Text, da er die Arbeit der GCF hinsichtlich des Verständnisses des Staatskapitalismus als universelle Tendenz im dekadenten Kapitalismus und nicht als bloßes Phänomen, das sich auf die stalinistischen Regimes beschränkt, zusammenfasst. Doch sein Versäumnis besteht darin, dass er keinen klaren Unterschied zwischen der Integration der alten Arbeiterorganisationen in den Staatskapitalismus und der Integration des Proletariats an sich macht: „Das Proletariat findet sich jetzt mit seiner eigenen Ausbeutung ab. Es ist also geistig und politisch im Kapitalismus integriert.“ Gemäß Internationalisme nimmt die permanente Krise des Kapitalismus in der Epoche des Staatskapitalismus nicht mehr die Form einer ‚offenen Krise‘ an, die die Arbeiter aus der Produktion wirft und sie so dazu zwingt, gegen das System zu handeln. Stattdessen erreicht sie ihren Höhepunkt im Krieg. Und nur im Krieg – den die GCF schon wieder nahen sah – könne der proletarische Kampf einen revolutionären Inhalt annehmen. Andernfalls könne die Klasse „sich selbst lediglich als ökonomische Kategorie des Kapitals ausdrücken“. Was Internationalisme dabei übersah, war, dass die eigentlichen Mechanismen des Staatskapitalismus unter den Bedingungen einer Wiederaufbauperiode nach den massiven Kriegszerstörungen dem Kapitalismus erlaubten, in eine ‚Boom‘-Phase zu treten, in der interimperialistische Antagonismen, wenngleich sie akut blieben, einen neuen Weltkrieg nicht absolut notwendig machten, und dies trotz der Schwäche des Proletariats.
Kurz nachdem dieser Text verfasst worden war, führten die Bemühungen der GCF, ihre Kader angesichts dessen zu erhalten, was sie als das Herannahen eines Weltkrieges verstand (eine Schlussfolgerung, die angesichts des Koreakrieges gar nicht so irrational war), zum ‚Exil‘ ihres führenden Genossen MC nach Venezuela und zur raschen Auflösung der Gruppe. Sie zahlte somit einen hohen Preis für ihre Schwäche, die Perspektive nicht mit genügender Klarheit zu erblicken. Doch die Auflösung der Gruppe bestätigte auch ihre Diagnose der konterrevolutionären Natur dieser Periode. Es ist kein Zufall, dass die PCInt im gleichen Jahr ihre erste große Spaltung durchmachte. Die ganze Geschichte dieser Spaltung ist dem internationalen Publikum noch nicht zugänglich gemacht worden, aber es scheint, als sei etwas Klarheit dabei herausgekommen. Kurz gesagt, fand die Spaltung zwischen der Tendenz um Damen auf der einen Seite und der von Bordiga inspirierten Tendenz auf der anderen statt. Die Damen-Tendenz stand, soweit es ihre politischen Positionen betrifft, dem Geist von Bilan näher – d.h. sie teilte die Bereitschaft Bilans, die Positionen der Kommunistischen Internationalen in ihren frühen Jahren in Frage zu stellen (z.B. über die Gewerkschaften, nationale Befreiung, Partei und Staat, etc.). Doch neigte sie stark zum Aktivismus und entbehrte der theoretische Strenge von Bilan. Dies traf besonders auf die Frage des Historischen Kurses und der Bedingungen für die Parteigründung zu, denn ein Besinnen auf die Methodik Bilans hätte dazu geführt, die Gründung der PCInt in Frage zu stellen. Dazu war die Damen-Tendenz oder – präziser – die Gruppe Battaglia Comunista jedoch nie gewillt. Bordigas Strömung schien sich im Gegensatz dazu bewusster darüber zu sein, dass diese Periode eine Periode der Reaktion war und dass die aktivistische und auf die Rekrutierung von Mitgliedern abzielende Herangehensweise der PCInt sich als fruchtlos erwiesen hat. Unglücklicherweise war Bordigas Werk in der Periode nach der Spaltung, gleichwohl es viel Wertvolles auf allgemeiner Ebene enthielt, völlig abgeschnitten von den Fortschritten, die während der 30er Jahre von der italienischen Fraktion erzielt worden waren. Die politischen Positionen seiner neuen ‚Partei‘ waren kein Fortschritt, sondern ein Rückgriff auf die schwächsten Analysen der KI, zum Beispiel über die Gewerkschaften und die nationale Frage. Und ihre Theorie über die Partei sowie ihr Verhältnis zur historischen Bewegung basierte auf semi-mystischen Spekulationen über die ‚Invarianz‘ und über die Dialektik zwischen der ‚historischen Partei‘ und der ‚formalen Partei‘. Mit einem Wort, unter diesen Ausgangsbedingungen konnte keine der Gruppen, die aus der Spaltung entstanden waren, irgendetwas Wertvolles zum Verständnis des Proletariats über das historische Kräfteverhältnis beitragen, und diese Frage war eine ihrer wesentlichen Schwächen seither geblieben.
Dezember 2000
(Der Teil 2 dieses Artikels folgt in der Internationalen Revue Nr. 30 vom November 2002)
[i] Mitchell starb 1945 in Folge seiner Inhaftierung im Konzentrationslager Buchenwald während des Krieges.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Deutsche Revolution XIII (Teil 2)
- 3565 Aufrufe
2. Eine Niederlage, die das Ende der weltweiten revolutionären Welle bedeutete
Wir haben in einem früheren Artikel aufgezeigt, wie die internationale Isolierung der Revolution in Russland – infolge der gescheiterten Ausdehnung der Revolution nach Westeuropa – zur Entartung der Komintern und zum Aufstieg des russischen Staatskapitalismus führte, was wiederum die Niederlage der Arbeiterklasse in Deutschland beschleunigte
Nach dem Abschluss des Geheimabkommens von Rapallo war der Kapitalistenklasse nicht verborgen geblieben, dass der russische Staat dabei war, die Komintern zu seinem Instrument zu machen. Gegen diese Entwicklung stemmte sich in Russland eine starke Opposition, die sich im Jahre 1923 durch eine Reihe von Streiks in der Gegend von Moskau sowie durch eine immer lauter werdende Opposition innerhalb der bolschewistischen Partei äußerte. Im Herbst 1923 hatte sich Trotzki nach langem Zögern endlich zu einem entschlosseneren Kampf gegen die wachsende staatskapitalistische Orientierung durchgerungen. Auch wenn die Komintern infolge der Politik der Einheitsfront und der Befürwortung des Nationalbolschewismus immer opportunistischer wurde und um so mehr degenerierte, je stärker sie durch den russischen Staat stranguliert wurde, gab es noch einen internationalistisch gesinnten Kern in ihr, der weiterhin an der weltrevolutionären Orientierung festhielt. Nachdem das deutsche Kapital sein “Bündnisversprechen”, das es als “unterdrückte Nation” Russland gegenüber gelobt hatte, fallengelassen hatte (1), fühlte sich dieser internationalistische Kern in der Komintern desorientiert, weil nunmehr die Aussichten auf eine revolutionäre “Entlastung” und Erneuerung immer geringer zu werden schienen. Aus Sorge vor dem emporkommenden Staatskapitalismus in Russland selbst und in der Hoffnung auf einen revolutionären Wiederaufschwung suchten sie verzweifelt nach einem letzten Strohhalm, nach der letzten Möglichkeit eines revolutionären Wiederaufbäumens.
“Da habt ihr, Genossen, endlich den Sturm, auf den wir so viele Jahre voller Ungeduld gewartet haben und welcher das Antlitz der Welt verändern wird. Die stattfindenden Ereignisse werden eine kolossale Bedeutung erlangen. Die deutsche Revolution bedeutet den Zusammenbruch der kapitalistischen Welt”. (Trotzki)
Überzeugt von dem weiterhin vorhandenen revolutionären Potenzial und davon, dass die Gelegenheit zum Aufstand noch nicht verstrichen war, setzte er sich dafür ein, dass seitens der Komintern alles in Bewegung gesetzt wird, um eine revolutionäre Entwicklung zu unterstützen.
Gleichzeitig hatte sich in Bulgarien und in Polen die Lage weiter zugespitzt. Bereits am 23. September hatten die Kommunisten in Bulgarien mit Unterstützung der Komintern einen Aufstandsversuch unternommen, der allerdings scheitern sollte. Im Oktober und November brach in Polen eine breite Streikwelle aus, an der sich ca. zwei Drittel der Industriearbeiter des Landes beteiligten, wobei die KP Polens von der Kampfbereitschaft der Arbeiter überrascht wurde. Ebenso wie diese Streiks wurden auch aufstandsartige Kämpfe Anfang November 1923 niedergeschlagen.
Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Auseinandersetzungen innerhalb der russischen Partei sprach sich Stalin gegen die Unterstützung der Bewegung in Deutschland aus, da sie eine direkte Bedrohung für den russischen Staatsapparat hätte werden können, innerhalb dessen er einige der wichtigsten Positionen innehatte. “Meiner Meinung nach müssen die deutschen Genossen gebremst und nicht angespornt werden.” (Brief Stalins vom 5.8.23 an Sinowjew)
Die Komintern verirrt sich im Abenteuer des Aufstands
Sich mit letzter Hoffnung an die Wiederbelebung einer revolutionären Situation klammernd, beschloss die Führung der Komintern (EKKI) eigenständig und zunächst ohne Absprache und Beratung der Lage mit der KPD, die Entwicklung zu forcieren und sich auf einen Aufstand in Deutschland vorzubereiten.
Nachdem am 11. September in Moskau die Nachricht von der Beendigung der Politik des “passiven Widerstands” Deutschlands gegen Frankreich und der Aufnahme deutsch-französischer Verhandlungen eintraf, drängte das EKKI auf ein Losschlagen Ende September in Bulgarien und kurze Zeit später in Deutschland. Die Vertreter der KPD wurden im September nach Moskau gerufen, um mit dem EKKI den Aufstand vorzubereiten. Diese Beratungen, an denen auch Vertreter der kommunistischen Parteien aus den Nachbarländern anwesend waren, dauerten nahezu einen Monat, von Anfang September bis Anfang Oktober.
Damit vollzog die Komintern eine erneute, verheerende Wende. Nach der katastrophalen Politik der Einheitsfront mit den konterrevolutionären sozialdemokratischen Kräften, deren zerstörerische Auswirkungen wir noch sehen werden, nach dem Flirt mit dem Nationalbolschewismus nun eine Verzweiflungstat - das Abenteuer eines Aufstandsversuches, ohne dass die Bedingungen für seine erfolgreiche Durchführung vorhanden waren.
Ungünstige Bedingungen
Auch wenn die Arbeiterklasse in Deutschland weiterhin der zahlenmäßig stärkste und konzentrierteste Teil des internationalen Proletariats war, der neben dem russischen am heftigsten gekämpft hatte, war die Kampfeswelle international weiter rückläufig und die Arbeiterklasse in Deutschland selbst stand 1923 relativ isoliert da.
Gegenüber der Lage in Deutschland schätzte das EKKI das Kräfteverhältnis, das sich nach dem Schachzug der SPD-geführten Regierung im August in Deutschland klar zugunsten der Bourgeoisie entwickelte, falsch ein. Um die Strategie des Feindes zu durchschauen, muss sich eine international organisierte und zentralisierte Organisation auf eine richtige Analyse der Verhältnisse durch ihre örtlichen Sektionen stützen können. Doch gerade die KPD hatte sich am stärksten durch ihre national-bolschewistische Politik blenden lassen und nicht die wirkliche Entwicklung des Kräfteverhältnisses erkannt, die in Deutschland die Schwächen der Bewegung offengelegt hatte.
· Bis August war die Bewegung hauptsächlich auf ökonomische Forderungen beschränkt geblieben. Noch hatte die Arbeiterklasse keine eigenständigen politischen Forderungen formuliert. Auch wenn die Bewegung sich immer stärker aus den Fabriken heraus auf die Straße verlagerte, auch wenn die Arbeiter immer häufiger in Vollversammlungen zusammenkamen und Arbeiterräte gebildet wurden, kann man nicht von einer Situation der Doppelmacht sprechen. Mehrere Mitglieder des EKKI meinten, die Bildung von Arbeiterräten würde von der aus ihrer Sicht prioritären Aufgabe der militärischen Vorbereitung des Aufstandes ablenken; die Räte liefen gar Gefahr, zur Zielscheibe der Repression der Regierung zu werden. Denn die neue Regierung hatte die Fabrikräte per Gesetz verboten. Eine Mehrheit im EKKI schlug vor, dass die Sowjets erst nach der Machtergreifung errichtet werden sollten.
· * Anstatt die Lehren aus der katastrophalen Politik der erhofften “nationalen Allianz” zu ziehen, wobei die “Einheitsfrontpolitik” nur eine Vorstufe zu diesem Verhängnis gewesen war, stützte man den angestrebten Aufstand auf eine “Arbeiterregierung”‘ aus SPD und KPD.
· Schließlich fehlte in Deutschland eine unabdingbare Voraussetzung für einen erfolgreichen Aufstand: die revolutionäre Partei. Die KPD, angenagt durch ihre opportunistische Entwicklung und in ihrem Kern gespalten, erfüllte nicht die Bedingungen, um eine wirklich entscheidende politische Rolle in der Klasse zu übernehmen.
Die Aufstandsvorbereitungen
Im Laufe der Beratungen im EKKI wurden folgende Punkte debattiert:
Trotzki drängte darauf, im Voraus ein Aufstandsdatum festzulegen. Er plädierte für den 7. November, den Tag des Oktoberaufstands in Russland sechs Jahre zuvor. Damit wollte er jeglicher zaudernden Haltung einen Riegel vorschieben. Der KPD-Vorsitzende Brandler lehnte es ab, sich auf einen bestimmten Termin festzulegen. So wurde Ende September beschlossen, dass der Aufstand in den nächsten vier bis sechs Wochen stattfinden sollte, d.h. Anfang November.
Da die deutsche Parteileitung sich für zu unerfahren hielt, schlug Brandler vor, dass Trotzki, der eine herausragende Rolle bei der Organisierung des Aufstands im Oktober 1917 in Russland gespielt hatte, selbst nach Deutschland kommen sollte, um zu helfen, den Aufstand zu organisieren.
Diesem Vorschlag widersetzten sich die anderen Mitglieder des EKKI; Sinowjew “beanspruchte” diese Führungsrolle für sich, da er der Vorsitzende des EKKI war. Der Streit um diese Entscheidung war nur vor dem Hintergrund des sich zuspitzenden Führungskampfes in Russland zu verstehen. Schließlich entschied man, ein Kollektivgremium zu schicken, das aus Radek, Guralski, Skoblewski und Tomski zusammengesetzt war.
Das EKKI beschloss, dass die Hilfe auf drei Ebenen erfolgen sollte:
- militärisch: Sie sollte der Schwerpunkt sein. Bürgerkriegserfahrene Offiziere der russischen Roten Armee wurden heimlich nach Deutschland geschickt, um beim Aufbau der Roten Hundertschaften und einer künftigen Roten Armee zu helfen. Auch wirkten sie beim Ausbau eines Nachrichtendienstes in Deutschland mit und hatten die Aufgabe, Kontakt zu oppositionellen Offizieren der Reichswehr zu knüpfen. Zudem sollten besonders erfahrene Mitglieder der russischen Partei an der Grenze bereitstehen, um schnellstmöglich vor Ort eintreffen zu können.
- materiell (Lebensmittel): Rund eine Million Tonnen Getreide sollten an der russischen Westgrenze bereitgestellt werden, damit man einer siegreichen Revolution in Deutschland sofort zu Hilfe eilen konnte.
- propagandistisch: Öffentliche Versammlungen mit dem Titel ‘Der deutsche Oktober steht vor der Tür, wie können wir der deutschen Revolution helfen?’ wurden in Russland abgehalten, wo man über die Perspektiven der Revolution in Deutschland berichtete. Vor allem aber wurden sie genutzt, um zu Spendensammlungen aufzurufen. So wurden Frauen aufgefordert, Eheringe und andere Wertsachen für “die deutsche Sache” zu opfern.
Während die Diskussionen in Moskau noch fortdauerten, hatten Emissäre der Komintern in Deutschland selbst bereits die Vorbereitungen für den Aufstand vorangetrieben. Anfang Oktober hatten sich viele führende Parteimitglieder schon auf eine illegale Situation eingestellt. Während in Moskau zwischen der Führung der KPD und dem EKKI die Aufstandspläne erörtert wurden, scheint eine größere Debatte über die unmittelbaren Perspektiven und die Aufstandsfrage innerhalb der KPD selbst nicht stattgefunden zu haben.
In Deutschland hatte die KPD seit Jahresbeginn, vor allem seit dem Leipziger Kongress, systematisch mit der Aufstellung von Hundertschaften begonnen. Anfangs noch sollten diese bewaffneten Truppen mehr als Schutzformation für Demonstrationen und Arbeiterversammlungen dienen, in denen kampfbereite Arbeiter unabhängig von ihrer politischen Überzeugung mitwirken konnten. Nun erprobten sich diese Hundertschaften in militärischen Übungen, machten Probealarme und spezielle Ausbildungen an Waffen und anderen militärischen Geräten.
Im Vergleich zum März 1921 wurde jetzt mit viel größerem organisatorischen Aufwand vorgegangen und erhebliche Mittel in die militärischen Vorbereitungen gesteckt. So hatte die KPD in der Zwischenzeit ihren Nachrichtendienst aufgebaut. Es gab den M-Apparat (Militärapparat), Z-Gruppen zur Zersetzung der Reichswehr und Polizei, T-Gruppen (Terror). Geheime Waffenlager wurden angelegt, militärische Karten aller Art besorgt.
Die russischen Militärberater gingen davon aus, über eine halbe Million Gewehre zur Verfügung zu haben. Man rechnete mit der Möglichkeit, 50-60.000 Mann schnellstens bewaffnen zu können, während die Reichswehr und die sie unterstützenden rechtsradikalen Wehrverbände mit der Polizei zahlenmäßig ca. 50 mal stärker als die von der KPD geführten Formationen waren.
In dieser Situation wurde von der Komintern ein Plan ausgearbeitet, der sich auf einen militärischen Schlag ausrichtete.
Indem die KPD in einigen Regionen in eine “Arbeiterregierung” mit der SPD eintrete, würde dies die Lage explosiv werden lassen. Man rechnete damit, dass die Faschisten, von Bayern und Süddeutschland aus kommend, nach Sachsen und Mitteldeutschland vorstoßen würden. Gleichzeitig rechnete man mit einem Vorstoß der Reichswehr von Preußen aus. Diesem Vormarsch könne man durch den Aufmarsch von riesigen bewaffneten Arbeitereinheiten entgegentreten und die Reichswehr und die faschistischen Verbände militärisch schlagen, indem man den Gegner bei Kassel in eine Falle locke. Aus den Roten Hundertschaften sollte eine Rote Armee entstehen, von der sächsische Teil nach Berlin, der thüringische nach München marschieren sollte. Die neue, für ganz Deutschland aufgestellte Regierung würde dann Kommunisten, linke Sozialdemokraten, Gewerkschafter und nationalbolschewistische Offiziere umfassen.
Ein Schlüsselelement der Taktik sollte deshalb zunächst der Regierungseintritt der KPD in Sachsen sein.
Aufstand durch ein Regierungsbündnis mit der SPD?
Im August war die SPD der Regierung beigetreten, um mit einer Reihe von Versprechungen die Aufwärtsbewegung zu stoppen.
Obgleich die Regierung am 26. September offiziell das Ende des passiven Widerstands angekündigt und versprochen hatte, Löhne auszuzahlen, brach am 27. September ein Streik im Ruhrgebiet aus. Am 28. September rief die KPD zum Generalstreik im ganzen Reich, zur Bewaffnung der Arbeiter und zur “Erkämpfung einer Arbeiter- und Bauern-Regierung” auf. Am 29. September erklärte die Regierung den Ausnahmezustand, woraufhin die KPD am 1. Oktober den Streik im Ruhrgebiet abbrach.
Wie schon zuvor bestand ihr Ziel nicht darin, die Arbeiterklasse durch die Erhöhung des Drucks aus den Betrieben weiter zu stärken, sondern sich ganz auf den entscheidenden, irgendwann eintretenden Moment zu konzentrieren. Anstatt, wie die Komintern später feststellen musste, durch den Druck aus den Betrieben die jetzt frisch an die Regierung gekommene SPD zu entblößen, wurde die Initiative in den Betrieben gebremst. So wurde die Bereitschaft in der Arbeiterklasse, sich gegen die Angriffe zur Wehr zu setzen, nicht nur durch das Versprechen von Zugeständnissen seitens der Regierung gebremst, sondern auch von der KPD selbst.
Die Komintern sollte später dazu auf dem 5. Kongress feststellen:
“Nach dem Cuno-Streik wurde der Fehler gemacht, elementare Bewegungen bis zum Entscheidungskampf verschieben zu wollen.
Einer der schwersten Fehler war es, dass die instinktive Rebellion der Massen nicht durch Einstellung auf politische Ziele systematisch in bewusst revolutionären Kampfwillen verwandelt wurde...
Die Partei versäumte es, energische, lebendige Agitation für die Aufgaben der politischen Arbeiterräte durchzuführen. Übergangsforderungen und Teilkämpfe aufs engste mit dem Endziel der Diktatur des Proletariats zu verbinden. Die Vernachlässigung der Betriebsrätebewegung machte es auch unmöglich, die Betriebsräte zeitweilig die Rolle der Arbeiterräte übernehmen zu lassen, so dass es in den entscheidenden Tagen an einem autoritativen Zentrum fehlte, um das sich die schwankenden Arbeitermassen hätten sammeln können, die dem Einfluss der SPD entzogen worden waren.
Da auch andere Einheitsfrontorgane (Aktionsausschüsse, Kontrollausschüsse, Kampfkomitees) nicht planmäßig ausgenützt wurden, um den Kampf politisch vorzubereiten, so wurde der Kampf fast nur als Parteisache und nicht als einheitlicher Kampf des Proletariats aufgefasst.”
Durch das Bremsen der Abwehrkämpfe der Arbeiter mit dem Argument, bis zum “Entscheidungstag’ zu warten, machte die KPD den Arbeitern ein Kräftemessen mit dem Kapital und sich selbst die Mobilisierung der durch die SPD-Propaganda verunsicherten Arbeiter unmöglich. So kritisierte die Komintern später: “Die Überhitzung in den technischen Vorbereitungen während der entscheidenden Wochen, die Einstellung auf die Aktionen als Parteikampf und nur auf den ‘entscheidenden Schlag’ ohne vorherige anwachsende Teilkämpfe und Massenbewegungen verhinderten die Prüfung des wirklichen Kräfteverhältnisses und machten eine zweckmäßige Terminsetzung unmöglich (....) Tatsächlich ließ sich nur feststellen, dass die Partei auf dem Wege war, die Mehrheit für sich zu erobern, ohne schon die Führung über sie zu besitzen.” (Die Lehren der deutschen Ereignisse und die Taktik der Einheitsfront)
Zu diesem Zeitpunkt, nämlich am 1. Oktober, revoltierten in Küstrin Mitglieder einer “Schwarzen Reichswehr-Garnison” (d.h. ein mit den Faschisten sympathisierender Verband). Ihre Erhebung wurde von preußischen Polizeitruppen niedergeschlagen. Der demokratische Staat brauchte die Faschisten noch nicht!
Am 9.Oktober traf Brandler aus Moskau mit der neuen Orientierung des Aufstands mittels Regierungseintritt ein. Am 10. Oktober wurde die Bildung einer Regierung mit der SPD in Sachsen und Thüringen beschlossen. Drei Kommunisten traten in die sächsische Regierung ein (Brandler, Heckert, Böttcher), zwei in die thüringische Regierung (Korsch und Tenner).
Während man im Januar 1923 noch auf dem Parteitag gesagt hatte: “Die Beteiligung der KPD an einer Landesarbeiterregierung, ohne Bedingungen an die SPD zu stellen, ohne genügend starke Massenbewegung und ohne ausreichende außerparlamentarische Stützpunkte, kann die Idee der Arbeiterregierung kompromittieren und die Reihen der eigenen Partei zersetzen” (S. 255, Dokumente zur Geschichte der Arbeiterbewegung), war die KPD-Zentrale jetzt bereit, entsprechend den Anweisungen der Komintern praktisch bedingungslos der SPD-Regierung beizutreten. Die KPD hoffte, so einen Ausschlag gebenden Hebel für den Aufstand in der Hand zu haben, denn geplant war, dass die KPD sofort alles unternehmen würde, um für die Bewaffnung der Arbeiter zu sorgen.
Während die KPD mit einer wütenden Reaktion der Faschisten und der Reichswehr gerechnet hatte, war es der SPD-Reichspräsident Ebert, der am 14. Oktober die sächsische und die thüringische Regierung für abgesetzt erklärte. Am gleichen Tag ordnete Ebert den Einmarsch der Reichswehr in Sachsen und Thüringen an.
Der “demokratische” SPD-Reichspräsident schickte also die Reichswehr gegen die “demokratisch gewählte” SPD-Regierung in Sachsen und Thüringen. Wiederum war es die SPD, die im Auftrag des Kapitals eine gewaltsame Niederwerfung der Arbeiter mit einem geschickten politischen Manöver vorbereitete und in die Hand nahm.
Gleichzeitig machten sich faschistische Gruppierungen aus Bayern auf den Weg nach Thüringen. Die KPD beschloss, die Arbeiter zu den Waffen zu rufen. In der Nacht vom 19. zum 20. Oktober verteilte die KPD ein Flugblatt in einer Auflage von 150.000 Exemplaren, in dem die Parteimitglieder angewiesen wurden, sich aller verfügbaren Waffen zu bemächtigen. Gleichzeitig sollte der Generalstreik beschlossen werden, der den Aufstand einleiten sollte.
Chronik einer angekündigten Niederlage
Um diesen Beschluss jedoch nicht als Partei zu fassen, sondern ihn von einer Delegiertenversammlung verabschieden zu lassen, wollte der Parteivorsitzende Brandler am 21. Oktober auf der Arbeiterkonferenz in Chemnitz einen Streikbeschluss erwirken. Zu den ca. 450 Delegierten gehörten u.a. 60 offizielle Delegierte der KPD, sieben offizielle Delegierte der SPD und 102 Vertreter der Gewerkschaften.
Mit dem Argument, die Stimmung zu testen, schlug Brandler auf dieser Versammlung den Generalstreik vor. Daraufhin reagierten vor allem die Gewerkschaftsvertreter und die SPD-Delegierten mit lautem Protest und der Drohung, die Versammlung zu verlassen, falls der Generalstreik beschlossen würde. Von Aufstand war ohnehin keine Rede. Allen voran der anwesende SPD-Minister wandte sich energisch gegen den Generalstreik. Doch anstatt ein Ort der Bündelung des Widerstandes gegen die Angriffe des Kapitals zu sein, gab die Versammlung gegenüber der SPD und den Gewerkschaftsvertretern kleinlaut bei. Selbst die KPD-Delegierten hüllten sich in Schweigen! So beschloss dieses Treffen, auf dem nach den Vorstellungen der KPD der Funken durch den Generalstreiksbeschluss gezündet werden sollte, seine Entscheidung zu vertagen.
Dabei hatte für Brandler und die KPD-Führung von Anfang an außer Frage gestanden, dass die Anwesenden unter dem Eindruck der auf Sachsen vorrückenden Truppen der Reichswehr und dem von Berlin aus geplanten Sturz der sächsischen Arbeiterregierung in eine revolutionäre Hochstimmung geraten und somit selbstverständlich bereit sein würden, sich zu wehren. Nach der Fehleinschätzung der Lage im August hatte die KPD das Kräfteverhältnis und die Stimmung auch diesmalzu diesem Zeitpunkt erneut falsch eingeschätzt.
In der Versammlung von Chemnitz, die von der KPD-Führung als “Dreh- und Angelpunkt” für den Aufstand auserwählt worden war, beeinflusste die SPD noch den Großteil der Delegierten. In den Fabrikkomitees und Vollversammlungen hatte die KPD noch nicht die Mehrheit für sich gewinnen können. Im Gegensatz zu den Bolschewiki im Jahre 1917 hatte die KPD weder die Lage richtig einzuschätzen noch den Lauf der Ereignisse entscheidend zu beeinflussen vermocht. Für die Bolschewiki wurde die Frage des Aufstands erst akut, als sie in den Räten die Mehrheit für sich erobert hatten und die Partei die Ausschlag gebende, führende Rolle spielen konnte.
Die Versammlung in Chemnitz ging auseinander, ohne einen Beschluss für den Streik, geschweige denn für den Aufstand gefasst zu haben. Nach diesem niederschmetternden Abstimmungsergebnis beschloss die Zentrale einstimmig, der Rückzug anzutreten. Nicht nur Brandler, sondern auch die “linken” Mitglieder der Zentrale und alle ausländischen Genossen, die damals in Deutschland anwesend waren, haben ohne Ausnahme diesem Beschluss zugestimmt.
Als die Ortsgruppen der Partei, die überall “Gewehr bei Fuß” standen, von dieser Entscheidung unterrichtet wurden, war die Enttäuschung riesig!
Obwohl es zum genauen Ablauf der Ereignisse in Hamburg unterschiedliche Versionen gibt, scheint die Nachricht von der Annullierung des Aufstands nicht rechtzeitig übermittelt worden zu sein. Überzeugt davon, dass der Aufstand nach Plan läuft, legten die örtlichen Parteimitglieder los, ohne die Bestätigung der Zentrale bekommen zu haben. So schlugen in der Nacht vom 22. zum 23. Oktober in Hamburg die Hundertschaften und die Kommunisten los und kämpften gegen die Polizei nach einem vorher festgelegten Schlachtplan. Die Kämpfe dauerten einige Tage, wobei sich der Großteil der Arbeiter zurückhielt, ja, viele Mitglieder der SPD sich bei den Polizeibehörden meldeten, um gegen die Aufständischen zu kämpfen.
Als am 24. Oktober nachmittags die Nachricht der KPD von der Aufforderung zum Abbruch der Kämpfe eintraf, war ein geordneter Rückzug nicht mehr möglich. Die Niederlage war unvermeidbar.
Am 23. Oktober marschierten Reichswehrtruppen in Sachsen ein. Erneut begann die Repression gegen die KPD. Wenig später, am 13. November, wurde Thüringen von der Reichswehr besetzt. In den anderen Landesteilen kam es zu keinen größeren Reaktionen der Arbeiter. Selbst in Berlin, wo der “linke Flügel” der KPD dominierte, ließen sich nur wenige hundert Mitglieder für Solidaritätsdemonstrationen mobilisieren. Enttäuscht von der Partei, wandten sich große Teile der Arbeiterklasse von ihr ab.
Die Lehren der Niederlage
Der Versuch der Komintern, durch die abenteuerliche Organisierung eines Aufstands in Deutschland die revolutionäre Welle von Kämpfen wieder anzukurbeln und eine Wende in Russland herbeizuführen, war fehlgeschlagen.
1923 stand die Arbeiterklasse in Deutschland in vielerlei Hinsicht isolierter da als zu Beginn der revolutionären Welle 1918/19. Gleichzeitig hatte die Bourgeoisie eine geschlossene Front gegen die Arbeiterklasse gebildet. Die Bedingungen für einen erfolgreichen Aufstand in Deutschland waren nicht vorhanden. Die in der Klasse vorhandene Kampfbereitschaft war im August 1923 von der Bourgeoisie gedämpft worden. Der Druck aus den Betrieben, das Bestreben, zu Vollversammlungen zusammenzukommen, ließ nach.
“Die Gradmesser unseres revolutionären Einflusses waren für uns die Sowjets (...) Die Sowjets gaben den politischen Mantel für unsere verschwörerische, konspirative Tätigkeit ab, sie waren dann auch Organe der Regierung nach der faktischen Machtergreifung.” (L. Trotzki, Kann man eine Konterrevolution oder eine Revolution auf einen bestimmten Zeitpunkt ansetzen?, 1924) Zu einer Bildung von Arbeiterräten, zentrale Voraussetzung für die Machtergreifung, war es in Deutschland 1923 nicht gekommen.
Nicht nur waren die politischen Bedingungen in der Klasse insgesamt noch nicht herangereift, auch und vor allem die KPD selbst hatte sich als unfähig erwiesen, ihre politische Führungsrolle wirklich zu erfüllen. Ihre politische Ausrichtung - die Politik des Nationalbolschewismus bis zum August, ihre Politik der Einheitsfront und der Schutz der Demokratie -trugen zu einer gewaltigen Verwirrung und Entwaffnung der Arbeiterklasse bei. Eine erfolgreiche Erhebung der Arbeiterklasse ist aber nur denkbar, wenn die Arbeiterklasse politisch ausreichend klar ihre Ziele erkennt und eine Partei an ihrer Seite hat, die Stoßrichtung und den Moment zum Handeln klar genug aufzeigen kann.
Ohne eine starke, solide Partei ist der Aufstand nicht denkbar, da nur sie einen Überblick über die Lage hat, die Strategie des Gegners erkennen und die entsprechenden Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Wegen ihrer Fähigkeit zur Analyse der Strategie des Klassenfeindes, ihrer Fähigkeit, die Temperatur in der Klasse, insbesondere in ihren Hauptbataillonen, zu messen und wegen ihrer Fähigkeit, ihr Gewicht im entscheidenden Moment in die Waagschale zu werfen, ist sie unerlässlich.
Die Komintern hatte das Hauptaugenmerk auf die militärische Vorbereitung gelegt. So schilderte Retzlaw –(der Verantwortliche für den militärischen Geheimapparat der KPD) -, dass mit den russischen Militärberatern meist rein strategische Schachzüge diskutiert wurden, wobei die große Masse der Arbeiter nicht einmal erwähnt wurde.
Auch wenn der Aufstand militärstrategisch minutiös geplant werden muss, beschränkt er sich selbst keinesfalls auf eine einfache Militäroperation. Die militärischen Aufstandsvorbereitungen können erst angegangen werden, wenn der politische Reifungs- und Mobilisierungsprozess der Klasse weit genug vorangeschritten ist. Dieser Prozess lässt sich nicht überspringen.
Das heißt nicht, dass die Arbeiterklasse unterdessen ihren Druck vernachlässigen sollte, wie es die KPD 1923 befürwortete. Hatten die Bolschewiki im Oktober 1917 die “Kunst des Aufstands” erfolgreich zur Anwendung bringen können, so war der Aufstandsplan vom Oktober 1923 eine reine Farce, die in einer Tragödie endete. Die Internationalisten in der Komintern, die mit dieser abenteuerlichen Verzweiflungstat nach einem letzten Strohhalm greifen wollten, hatten die Lage falsch eingeschätzt.
Trotzki, der im September offensichtlich schlecht über die Lage im Bilde war, war am meisten davon überzeugt, die Bewegung ginge weiter aufwärts, und er gehörte zu denen, die am heftigsten auf den Aufstand gedrängt hatten.
Die Kritik, die er nach den Ereignissen entwickelte, ist zum großen Teil falsch. Er warf der KPD vor, dass, während sie sich 1921 abenteuerlich und ungeduldig verhalten habe, sie 1923 in das andere Extrem des Abwartens, der Vernachlässigung der eigenen Rolle verfallen sei.
“Die Reife der revolutionären Situation in Deutschland wurde von der Partei zu spät erkannt, (...) so dass die wichtigsten Kampfmaßnahmen verspätet in Angriff genommen wurden.
Die Kommunistische Partei kann nicht gegenüber der wachsenden revolutionären Bewegung des Proletariats eine abwartende Haltung einnehmen. Das ist eigentlich die Stellungnahme des Menschewismus: Die Revolution hemmen, solange sie sich entwickelt, ihre Erfolge ausnutzen, wenn sie halbwegs siegreich ist, und alles anwenden, um sie aufzuhalten.” (L. Trotzki, Kann man eine Konterrevoultion oder eine Revolution an einem bestimmten Zeitpunkt ansetzen?, 1924)
Er betonte zwar zu Recht den subjektiven Faktor und die Tatsache, dass der Aufstand die energische, entschlossene, gezielte und weitsichtige Intervention der Revolutionäre braucht, um gegenüber allen Zögerungen und Schwankungen der Klasse einzugreifen. Darüber hinaus hatte Trotzki die zerstörerische Rolle der Stalinisten erkannt: “...die Stalinsche Führung (...) hemmte und bremste die Arbeiter, wo die Bedingungen einen kühnen revolutionären Angriff diktierten; proklamierte revolutionäre Situationen als bevorstehend, wenn sie bereits verpasst waren; schloss Bündnisse mit Phrasenhelden und Schwätzern aus dem Lager des Kleinbürgertums; hinkte unter dem Schein der Einheitsfrontpolitik ohnmächtig hinter der Sozialdemokratie her.” (Die Tragödie des deutschen Proletariats, Mai 1933)
Aber er selbst hatte sich mehr vom eigenen Willen leiten lassen als von der richtigen Analyse des Kräfteverhältnisses.
Die Oktoberniederlage 1923 bedeutete nicht nur eine physische Schwächung der Arbeiter in Deutschland,
sondern sie sollte auch zu einer tiefgreifenden politischen Desorientierung und Demoralisierung der Arbeiterklasse führen.
Die Welle revolutionärer Kämpfe, deren Höhepunkt 1918/1919 überschritten war, war 1923 beendet. Der Bourgeoisie war es gelungen, der Arbeiterklasse in Deutschland eine entscheidende Niederlage beizufügen.
Die Niederschlagung der Kämpfe in Deutschland, Bulgarien und Polen ließen die Arbeiterklasse in Russland noch isolierter zurück. Zwar gab es noch einige “Nachhutgefechte”, von denen die Kämpfe 1927 in China besonders herausragen, dennoch brach eine lange Ära der Konterrevolution an, die erst mit der Wiederbelebung der Kämpfe 1968 durchbrochen werden sollte.
Die Komintern sollte sich als unfähig erweisen, die wirklichen Lehren aus den Ereignissen in Deutschland zu ziehen.
Die Unfähigkeit der Komintern und der KPD, die wahren Lehren zu ziehen
Auf dem 5. Weltkongress der Komintern 1924 richteten die Komintern und die KPD ihre Hauptkritik darauf, dass die KPD die Taktik der Einheitsfront und der Arbeiterregierung “falsch” ausgelegt habe. Zu einer grundsätzlichen Verwerfung dieser Taktik kam es nicht.
Die KPD trug sogar dazu bei, die SPD von ihrer Verantwortung bei der Niederlage weißzuwaschen, als sie behauptete: “Man kann ohne Übertreibung sagen: die heutige deutsche Sozialdemokratie ist tatsächlich nur noch ein lockeres Gefüge schlecht untereinander verbundener Organisationen mit grundverschiedener politischer Einstellung.”
Sie blieb ihrer opportunistischen und verheerenden Politik gegenüber der verräterischen Sozialdemokratie treu: “Der ständige kommunistische Druck auf die Zeigner-Regierung und den sich mit ihr herausbildenden linken Flügel der SPD werde die Zersetzung der SPD bringen. Es kam darauf an, unter unserer Führung den Massendruck auf die sozialdemokratische Regierung zu steigern, zu verschärfen und die sich herausbildende sozialdemokratische linke Führergruppe im Zuge einer großen Bewegung vor die Entscheidung zu stellen, entweder mit den Kommunisten gemeinsam den Kampf gegen die Bourgeoisie einzuleiten, oder sich zu demaskieren und damit die letzte Illusion der sozialdemokratischen Arbeitermassen zu vernichten.” (9. Parteitag, April 1924)
Seit dem 1. Weltkrieg ist die SPD vollends in den Staat integriert. Diese Partei, der schon soviel Blut aus dem 1. Weltkrieg und der Niederschlagung der Kämpfe an den Fingern klebte, befand sich keineswegs in einem Zersetzungsprozess. Im Gegenteil, als ein Teil des Staatsapparates konnte sie weiterhin einen großen Einfluss auf die Arbeiter ausüben. Dies musste auch Sinowjew im Namen der Komintern feststellen: “Aber den ‘linken’ Sozialdemokraten, (...) die in Wahrheit der schmutzigen, gegenrevolutionären Politik der rechten Sozialdemokraten nur zur Verhüllung dienen - ihnen glaubt ein erheblicher Teil der Arbeiter immer noch.”
Die Geschichte hat seitdem immer wieder bewiesen, dass es nicht möglich ist, eine Partei, die verraten und ihr Klassenwesen geändert hat, zurückzuerobern. Der Versuch, mit Hilfe der SPD die Arbeiterklasse zu führen, war damals schon ein Zeichen der opportunistischen Entartung der Komintern gewesen. Denn während Lenin in seinen Aprilthesen 1917 die Unterstützung der Kerenski-Regierung abgelehnt und die schärfstmögliche Abgrenzung von der Provisorischen Regierung verlangt hatte, bestand die KPD im Oktober 1923 auf überhaupt keiner Abgrenzung und trat bedingungslos in die Regierung mit der SPD ein. Anstatt die Arbeiter zu mobilisieren, hat der Regierungseintritt der KPD sie vielmehr eingeschläfert. Die politische Entwaffnung der Arbeiterklasse und die Repression durch die Reichswehr wurden erleichtert. Eine Aufstandsbewegung kann nur vorankommen, wenn es der Arbeiterklasse gelingt, ihre Illusionen über die bürgerliche Demokratie zu überwinden. Und die Revolution kann nur siegen, wenn die Kräfte, die bürgerliche Demokratie verteidigen, zerschlagen werden.
1923 hat die KPD nicht nur nicht die bürgerliche Demokratie bekämpft, sondern sie hat die Arbeiter gar zur Verteidigung der bürgerlichen Demokratie aufgerufen.
Insbesondere hinsichtlich der SPD stand die KPD im eklatanten Gegensatz zu den Positionen der Komintern, die auf ihrem Gründungskongress diese Partei als den Henker der Revolution in Deutschland 1919 gebrandmarkt hatte.
Später beharrte die KPD nicht nur auf ihren Fehlern, sondern sie erwies sich auch als Vorreiter des Opportunismus. Unter allen Parteien der Komintern wurde sie zu deren treuesten Vasall. Nicht nur war sie zum Vorreiter bei der Einführung der Einheitsfront und Arbeiterregierung geworden, sondern sie setzte auch als erste die Politik der Fabrikzellen und der Bolschewisierung um, die von Sinowjew und Stalin befürwortet wurde.
Durch die Niederlage der Arbeiterklasse in Deutschland erhielt der Stalinismus gewaltigen Auftrieb.
International, aber auch in Russland konnte die Bourgeoisie ihre Offensive fortsetzen und die furchtbarste Konterrevolution gegen die Arbeiterklasse einleiten, unter der sie je gelitten hat. Der russische Staat wurde nach 1923 von den anderen kapitalistischen Staaten und dem Völkerbund völkerrechtlich anerkannt.
1917 hatte die erfolgreiche Machtergreifung der Arbeiterklasse in Russland den Auftakt gebildet für die Auslösung einer weltweiten revolutionären Welle. Das Kapital hatte jedoch den Erfolg der Revolution in den Schlüsselländern, allen voran in Deutschland, verhindern können.
Die Lehren hinsichtlich der erfolgreichen Machtergreifung im Oktober 1917 in Russland wie des Scheiterns der Revolution in Deutschland – und insbesondere die Lehren darüber, wie es der Bourgeoisie gelang, den Sieg der Revolution zu vereiteln, über die Folgen, die daraus für die internationale Dynamik der Kämpfe entstanden und über die daraus resultierende Entartung der Revolution in Russland – all diese Elemente sind ein Bestandteil ein und derselben historischen Erfahrung der Arbeiterklasse.
Damit eine nächste revolutionäre Welle sich entfalten kann und die nächste Revolution erfolgreich ist, muss die Arbeiterklasse sich diese unschätzbare Erfahrung unbedingt aneignen.
DvTheorie und Praxis:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Zerfall [81]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Geschichte der Arbeiterbewegung
- 2920 Aufrufe
Die Verteidigung der proletarischen Perspektive durch die linken Fraktionen
In Zeiten wie heute, wo die Perspektive einer Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Barbarei für die meisten Arbeiter ‚unerreichbar‘ scheint, müssen Revolutionäre mehr denn je die langfristige Natur ihrer Arbeit betonen und dürfen sich nicht von kurzfristigen Betrachtungen beirren lassen. Die Arbeit der Revolutionäre ist stets auf die Zukunft gerichtet und nicht nur ein Kampf für die Verteidigung der unmittelbaren Interessen des Proletariats. Wie die Geschichte gezeigt hat, kann eine Revolution nur erfolgreich sein, wenn sich eine revolutionäre Organisation, wenn sich die Partei den Aufgaben, die sie zu erfüllen hat, gewachsen zeigt.
Doch eine Partei, die imstande ist, ihre Aufgaben zu erfüllen, entsteht weder durch bloße Verkündung noch spontan, sondern ist das Resultat langer Jahre des Aufbaus und der Auseinandersetzungen. In diesem Sinne sind bereits die heutigen Revolutionäre an der Vorbereitung der Gründung der künftigen Partei beteiligt. Es wäre fatal, wenn Revolutionäre die historische Bedeutung ihrer eigenen Arbeit unterschätzen.
Selbst wenn die heutigen revolutionären Organisationen unter schwierigeren Umständen entstanden sind als frühere revolutionäre Organisationen, tragen die heutigen Revolutionäre bereits zum Aufbau einer unerlässlichen Brücke zur Zukunft bei. Doch können sie dies nur dann tun, wenn sie sich als fähig erweisen, ihre Verantwortung mit Leben zu füllen, denn die Geschichte hat uns gezeigt, dass nicht alle Organisationen, die die Klasse in der Vergangenheit produziert hat, dem nachgekommen sind, besonders wenn sie mit der Prüfung eines imperialistischen Krieges oder einer revolutionären Periode konfrontiert waren.
Viele Organisationen degenerierten oder zerfielen unter dem Druck der bürgerlichen Gesellschaft und ihres Gifts des Opportunismus. Auch heute ist der Druck des Opportunismus sehr groß, daher müssen revolutionäre Organisationen einen ständigen Kampf gegen diesen Druck ausfechten.
Das berühmteste Beispiel der Degeneration in der Vergangenheit ist der Fall der deutschen Sozialdemokratie, der SPD, die zur größten Arbeiterorganisation des 19. Jahrhunderts aufstieg, um dann mit anzusehen, wie ihre Führung der Interessen der Arbeiterklasse verriet, als die Bourgeoisie im August 1914 in den Ersten Weltkrieg trat. Ein anderes berühmtes Beispiel ist jenes der bolschewistischen Partei, die, nachdem sie die Vorhut der proletarischen Revolution im Oktober 1917 gewesen war, sich in einen Feind der Arbeiterklasse verwandelte, nachdem sie im sowjetischen Staat integriert worden war.
Doch wann immer eine revolutionäre Organisation degenerierte und die Interessen der Arbeiterklasse verriet, das Proletariat war stets in der Lage, eine neue Fraktion in die Welt zu setzen, die gegen Degeneration und Verrat kämpfte.
„Die historische Kontinuität zwischen der alten und der neuen Klassenpartei kann nur auf dem Wege der Fraktion gesichert werden, deren historische Funktion es ist, eine Bilanz der vergangenen Erfahrungen zu ziehen, die Irrtümer und Unzulänglichkeiten des gestrigen Programms im Lichte einer marxistischen Kritik zu thematisieren, aus diesen Erfahrungen die politischen Prinzipien zu ziehen, die notwendig sind, um das alte Programm zu vervollständigen, und die die Vorbedingung für die Bestimmung des neuen Programms sind, das für die Gründung der neuen Partei lebenswichtig ist. Die Fraktion ist sowohl ein Ort der ideologischen Fermentierung, das Labor des revolutionären Programms in einer Rückzugsperiode als auch Übungsgelände für ihr menschliches Material, die Militanten der künftigen Partei.“ (L’Etincelle, Nr. 10, Januar 1946)[i]
Im ersten Teil dieses Artikels wollen wir einige wichtige Lehren aus früheren Degenerationen und den Auseinandersetzungen der Fraktionen in Erinnerung rufen. Im zweiten Teil werden wir etwas präziser betrachten, wie die Fraktionen sich organisierten, um gegen solch eine Degeneration zu kämpfen.
Das Problem der Fraktion in der Zweiten Internationalen
Als am 4. August 1914 die sozialdemokratische Reichstagsfraktion geschlossen für die Kriegskredite stimmte und somit aktiv die Kriegsmobilisierung des deutschen Imperialismus unterstützte, beging zum ersten Mal in der Geschichte der Arbeiterbewegung eine Partei der Arbeiterklasse Verrat. Für eine bürgerliche Organisation kommt ein Verrat an ihren Klasseninteressen nicht in Betracht. Dies trifft selbst dann zu, wenn sie sich zu einem gegebenen Zeitpunkt weigert, am imperialistischen Krieg teilzunehmen. Im Gegenteil dazu ist die Ablehnung des Internationalismus eine der schlimmsten Vergewaltigungen proletarischer Prinzipien, die eine proletarische Organisation begehen kann, und kennzeichnet ihren Übergang ins bürgerliche Lager.
In Wirklichkeit war dieser Verrat des proletarischen Lagers durch die SPD-Führung lediglich der Höhepunkt eines langen Degenerationsprozesses. Während Rosa Luxemburg[ii] eine der ersten war, die bereits Ende des 19. Jahrhunderts ein Gespür für den Prozess der opportunistischen Verfaulung entwickelt hatten, wurde der volle Umfang dieses Prozesses nicht vor dem Verrat 1914 erkannt. Wie wenig bewusst sich die meisten Revolutionäre über das Ausmaß dieser Degeneration waren, veranschaulicht Lenins ungläubiges Staunen, als er von der parlamentarischen Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten im August 1914 vernahm – er war davon überzeugt, dass die Kopie des Vorwärts (der SPD-Zeitung), die er in der Schweiz erhielt, eine von der deutschen Regierung ausgebrütete Fälschung war.
Wie ereignete sich die Degeneration der SPD?
Damit es zu einem Degenerationsprozess kommt, muss es materielle Bedingungen geben, die solch eine Dynamik in Gang setzen, und die Arbeiterklasse muss politisch geschwächt sein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Arbeiterklasse von Illusionen wie jene über die Möglichkeit eines friedlichen Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus penetriert. Jahre ununterbrochenen Wachstums (trotz des Konjunktur bedingten Aufs und Abs) hatten die materielle Basis für das Aufblühen solcher Illusionen gelegt. Bernstein[iii] repräsentierte diese Illusionen in ihrer extremsten Form, als er behauptete, dass der Kapitalismus durch eine Reihe von Reformen überwunden werden könne und dass „das Ziel nichts, die Bewegung alles ist“.
Rosa Luxemburg fühlte die große Verwirrung, die durch das Erscheinen des Opportunismus in der SPD erzeugt wurde, als sie im März 1899 einen Brief an Leo Jogiches[iv] verfasste:
“Mit einem Wort, dieses ganze Gerede hat den einen Sinn: dass Bebel[v] selbst schon senil geworden ist und die Zügel aus der Hand gleiten lässt; er ist froh, wenn andere kämpfen, aber hat selbst weder die Energie noch das Feuer für eine Initiative... so steht die ganze Partei verdammt schlecht da; absolutes bezholowie, wie die Ruthenen sagen. Niemand leitet, niemand fühlt sich verantwortlich“ (Rosa Luxemburg an Leo Jogiches, 3. März 1899).
In einem weiteren Brief an Jogiches kurze Zeit später erwähnte sie die Intrigen, die Furcht und die Ressentiments ihr gegenüber in der Partei, die auftraten, sobald sie gegen diesen Prozess zu kämpfen begann.
“Dabei habe ich gar nicht die Absicht, mich auf die Kritik zu beschränken, im Gegenteil, ich habe die Absicht und Lust, positiv zu schieben, nicht Personen, sondern die Bewegung in ihrer Gesamtheit, unsere ganze positive Arbeit zu revidieren, die Agitation, die Praxis, neue Wege aufzuzeigen (sofern sich welche finden, woran ich nicht zweifle), den Schlendrian zu bekämpfen etc., mit einem Wort, ein ständiger Antrieb der Bewegung zu sein...Und dann die mündliche und schriftliche Agitation überhaupt, die in alten Formen versteinert ist und auf fast niemanden mehr wirkt, auf eine neue Bahn zu bringen, überhaupt neues Leben in die Presse, die Versammlungen und die Broschüren hineinzubringen“ (Rosa Luxemburg an Leo Jogiches, 1. Mai 1899).
Und als Rosa Luxemburg „Sozialreform oder Revolution“ (April 1899) schrieb, zeigte sie nicht nur ihre Entschlossenheit, gegen diese opportunistischen Abwege zu kämpfen; sie begriff auch, dass dieser Kampf in seiner ganzen programmatisch-theoretischen Dimension verstanden werden muss. Sie unterstrich: “Daher zeigt sich bei denjenigen, die nur den praktischen Erfolgen nachjagen wollen, das natürliche Bestreben, sich die Hände frei zu machen, d.h. unsere Praxis von der ‚Theorie‘ zu trennen, von ihr unabhängig zu machen... Es ist klar, dass diese Strömung, wollte sie sich gegen unsere Grundsätze behaupten, folgerichtig dazu kommen musste, sich an die Theorie selbst, an die Grundsätze heranzuwagen, statt sie zu ignorieren, sie zu erschüttern suchen und eine eigene Theorie zurechtzumachen“ (Rosa Luxemburg, „Sozialreform oder Revolution“, Ges. Werke, Bd 1/1, S. 441).
Die Degeneration wird also stets durch die Infragestellung des politischen Programms ausgedrückt, aber sie trifft auf ihrem Weg nach Oben auf den Widerstand eines Teils der Partei, der weiterhin zu den Prinzipien eben dieses Programms steht.
Der Kampf des linken Flügels der Zweiten Internationalen war daher von Beginn an ein politischer Kampf um die Verteidigung des Marxismus gegen seine Entwaffnung, aber es war zugleich ein Versuch, die Lehren aus den neuen Bedingungen des dekadenten Kapitalismus zu ziehen. Indem sie diese neuen Bedingungen spürten und versuchten, sie in einen neuen Rahmen zu platzieren, versuchten Rosa Luxemburg in „Massenstreik, Partei und Gewerkschaften“ und Anton Pannekoek[vi] in „Taktische Differenzen in der Arbeiterbewegung“, die tiefer verwurzelten historischen Bedingungen des Opportunismus und seiner Unfähigkeit zu begreifen, die neuen Kampfbedingungen im dekadenten Kapitalismus zu verstehen.
Doch der linke Flügel der Sozialdemokratie blieb eine Minderheit, da die Mehrheit der Partei große Schwierigkeiten hatte, diese revisionistischen Ideen zu bekämpfen, seitdem der Parlamentarismus und die wachsende Integration des Gewerkschaftsapparates in den Staat diesen Illusionen ermöglichten, sich zu verbreiten und einen Apparat zu schaffen, der dem Staat loyal und der Arbeiterklasse gegenüber fremd und feindlich war.
Eine Degeneration wird stets von einem spezifischen Teil der Organisation verkörpert, der durch seine Identifizierung mit den Interessen der herrschenden Klasse Schritt für Schritt die fundamentalen Prinzipien der Partei über Bord wirft und als loyaler Vertreter des Staates und des nationalen Kapitals endet. Dieser degenerierende Organisationsteil ist dazu gezwungen, sich jeder Debatte zu widersetzen, ist durch seine Natur monolithisch und beabsichtigt das Mundtotmachen jeder kritischen Stimme. So wurde die Sozialdemokratie, die während der Zeit des Sozialistenverbots (1878-1890) das Zentrum des proletarischen Lebens und vieler kontroverser Debatten gewesen war, immer mehr zu einem Abstimmungsverein, der jede Debatte in der Partei zum Schweigen brachte. Viele Artikel des linken Flügels wurden der Zensur durch die Parteiführung unterworfen, andere Gegner wurden verwirrt, die Führung versuchte, die Linken aus den Redaktionskommissionen zu drängen, und bei Abstimmungen im Parlament wurden die Abgeordneten dazu angehalten, sich der Fraktionsdisziplin zu unterwerfen.
Rosa Luxemburg sah und verdammte diese Trends so deutlich wie möglich. Sie beschloss, nicht der Partei den Rücken zu kehren, sondern für ihre Wiederherstellung zu kämpfen – weil es nicht das Prinzip der Kommunisten ist, „die eigene Haut zu retten“, sondern für die Organisation zu kämpfen.
In einem Schreiben an Clara Zetkin[vii] vom 16. Dezember 1906 bestand sie darauf:
“Mir kommt die ganze Zaghaftigkeit und Kleinlichkeit unseres ganzen Parteiwesens so schroff und schmerzlich zu Bewusstsein wie nie zuvor.( ...)
Aber ich rege mich deshalb über diese Dinge nicht so auf wie du, weil ich mit erschreckender Klarheit bereits eingesehen habe, dass diese Dinge und diese Menschen nicht zu ändern sind, solange die Situation nicht ganz anders geworden ist. Und auch dann – ich habe mir das bereits mit kühler Überlegung gesagt und bei mir ausgemacht – müsen wir einfach mit dem unvermeidlichen Widerstand dieser Leute rechnen, wenn wir die Massen vorwärts führen wollen. Die Situation ist einfach die: August Bebel und erst recht all die anderen haben sich für den Parlamentarismus und im Parlamentarismus gänzlich ausgegeben. Bei irgendeiner Wendung, die über die Schranken des Parlamentarismus hinausgeht, versagen sie gänzlich, ja, noch mehr, suchen alles auf den parlamentarischen Leisten zurückzuschrauben, werden also mit Grimm alles und jeden als ‚Volksfeind’ bekämpfen, der darüber hinaus wird gehen wollen..
Die Massen, und noch mehr die große Masse der Genossen, sind innerlich mit dem Parlamentarismus fertig, das Gefühl habe ich. Sie würden mit Jubel einen frischen Luftzug in der Taktik begrüßen; aber die alten Autoritäten lasten noch auf ihnen und noch mehr auf die oberste Schicht der opportunistischen Redakteure, Abgeordneten und Gewerkschaftsführer. Unsere Aufgabe ist jetzt, dem Einrosten dieser Autoritäten mit möglichst schroffem Protest entgegenzuwirken... Wenn wir gegen den Opportunismus eine Offensive starten, werden die alten Anwälte gegen uns sein.... Das sind Aufgaben, die auf lange Jahre berechnet sind! (Rosa Luxemburg, Briefe, S. 213)
Selbst als die Linken es mit einem wachsenden Widerstand innerhalb der Partei zu tun bekamen, dachte keiner von ihnen daran, sich in einem separaten Körper zu sammeln, ganz zu schweigen daran, die Partei den Opportunisten zu überlassen. Am 19. April 1912 drückte Rosa Luxemburg ihre Ansicht in einem Brief an Franz Mehring[viii] aus:
“Sie werden sicher auch das Gefühl haben, dass wir immer mehr Zeiten entgegengehen, wo die Masse der Partei einer energischen, rücksichtslosen und großzügigen Führung bedarf, und daß unsere führenden Instanzen – Parteivorstand, Zentralorgan, Parlamentsfraktion – immer kleinlicher, feiger und parlamentarisch-kretinhafter werden. Wir müssen also offen dieser schönen Zukunft ins Auge blicken, alle Posten bestzen und festhalten, die es ermöglichen, der offiziellen “Führerschaft“ zum Trotz das Recht der Kritik wahrzunehmen.
J. Marchlewski[ix] betonte in einem Brief an Rosa Luxemburg:
“Daraus erwächst aber für uns die Pflicht, gerade auszuharren, gerade nicht den offiziellen Parteibonzen den Gefallen zu tun und die Flinte ins Korn zu werfen. Auf ständige Kämpfe und Reibungen müssen wir ja gefasst sein... Aber trotz alledem – keinen Fußbreit nachgeben scheint mir die beste Parole“, wie er unterstrich. Und weiter: “wir drei, und ich ganz besonders, was ich betonen möchte, sind der Auffassung, dass die Partei eine innere Krise durchmacht, viel, viel schwerer als zu jener Zeit, da der Revisionismus aufkam. Das Wort mag hart sein, aber es ist meine Überzeugung, dass die Partei dem Marasmus zu verfallen droht, wenn es so weitergeht. In einer solchen Situation gibt es für eine revolutionäre Partei nur eine Rettung: die denkbar schärfste, rücksichtsloseste Selbstkritik“ (Marchlewski, Brief an Block 16.12.1913, in Nettl, Rosa Luxemburg, S. 448).
So verhalf die Degeneration der SPD einer linken Strömung innerhalb der Zweiten Internationalen zur Entstehung, die jedoch mit unterschiedlichen Bedingungen in jedem Land konfrontiert war. Die deutsche SPD war eine der Parteien, die am meisten vom Opportunismus durchdrungen waren, doch erst als die Parteiführung den proletarischen Internationalismus verriet, nahm die linke Strömung eine organisierte Form an.
In den Niederlanden wurde der linke Flügel aus der SDAP (Sociaal-Demokratische Arbeiders Partei) ausgeschlossen und gründete 1909 die SDP (Sozialdemokratische Partei – bekannt als die Tribunisten, dem Titel ihrer Zeitung entlehnt). Jedoch ereignete sich diese Spaltung zu früh – wie wir in unserer Analyse der deutsch-holländischen Linken betonten.[x]
In Russland ging seit 1903 ein tiefer Riss zwischen den Bolschewiki und den Menschewiki in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDARP).
Die Menschewiki erkannten die Entscheidungen der Mehrheit auf dem Kongress von 1903 nicht an und versuchten, durch eine Reihe von Manövern die Bolschewiki aus der Partei zu vertreiben. Die Bolschewiki verteidigten die Parteiprinzipien, die in wachsendem Maße von den Menschewiki untergraben wurden, die ihrerseits nun vom Opportunismus infiziert wurden. In der russischen Sozialdemokratie trat die Penetration durch den Opportunismus zunächst in organisatorischen Fragen auf, aber schon bald betraf es ihre Taktiken, da während der russischen Revolution von 1905 die meisten Menschewiki eine Haltung zu Gunsten der liberalen Bourgeoisie einnahmen, während die Bolschewiki für eine unabhängige Politik der Arbeiterklasse stritten. Ein großer Teil dieses opportunistischen Flügels in der Partei – unter der Fahne der Menschewiki versammelt – lief 1914 ins bürgerliche Lager über, als er auch den proletarischen Internationalismus verriet. Doch die Bolschewiki fochten fast zehn Jahre lang innerhalb der gleichen Partei gegen die Menschewiki, ehe sich 1912 die tatsächliche Spaltung ereignete. Als sie noch als separate Fraktion innerhalb der SDARP organisiert waren, sahen sich die Bolschewiki trotz ihrer tiefen Divergenzen mit den Menschewiki nicht mit einem solchen Degenerationsprozess wie in der SPD konfrontiert. Doch indem sie sich als eine gesonderte Strömung organisierten, indem sie resolut gegen den Opportunismus kämpften und ihr Vertrauen im marxistischen Parteiprogramm behielten, legten sie das Fundament für die spätere Gründung der bolschewistischen Partei und der Kommunistischen Partei 1917/18.
Somit trugen die Bolschewiki noch vor 1914, obwohl sie unter widrigen Umständen arbeiteten, entscheidend zur Erfahrung einer Fraktion bei.
Eine bemerkenswerte Charakteristik der linken Strömungen vor 1914 ist ihr Versäumnis, sich auf internationaler Ebene zu regruppieren oder eine organisierte Form anzunehmen – mit Ausnahme der Bolschewiki. Wie Bilan bemerkte: „Das Problem der Fraktion, das wir in anderen Worten als einen Moment des Wiederaufbaus der Klassenpartei betrachten, war innerhalb der Ersten oder der Zweiten Internationalen so unvorstellbar wie abwegig. Diejenigen, die sich zu dieser Zeit selbst ‚Fraktion‘ oder, etwas allgemeiner, ‚rechter‘ oder ‚linker Flügel‘, ‚unnachgiebige‘, ‚reformistische‘ oder ‚revolutionäre‘ Strömung nannten, waren in den meisten Fällen Gelegenheitsübereinkommen kurz vor oder während eines Kongresses, den Blick darauf gerichtet, eine besondere Tagesordnung zur Debatte zu stellen, aber ohne jegliche organisatorische Kontinuität. Die Bolschewiki waren die Ausnahme...“ („La Fraction dans les partis socialistes de la seconde Internationale“, Bilan, Nr. 24, Oktober 1935). Obgleich es Momente gab, in denen sie ihre Kräfte vereinten und auf den Kongressen gemeinsame Anträge und Verbesserungsvorschläge unterbreiteten (zum Beispiel in Stuttgart 1907 und Basel 1912 über die Kriegsgefahr), kam es zu keinem gemeinsamen Vorgehen des linken Flügels.
Etliche Elemente erklären diese relative Zersplitterung.
Eines davon sind die verschiedenen materiellen Bedingungen in den Mitgliedsländern der 2. Internationalen.
Zum Beispiel waren die Arbeiter in Russland, entsprechend dem ökonomischen Hinterherhinken des Kapitalismus in Russland im Vergleich mit Deutschland, nicht fähig gewesen, dem Kapital dieselben Zugeständnisse abzuringen. Der Einfluss des Gewerkschaftstums in Russland war schwach, die parlamentarische Präsenz der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei war weitaus schwächer als jene der SPD und die demokratischen Illusionen sowie der parlamentarische Kretinismus unvergleichlich kleiner.
Ein anderes Element ist die föderalistische Struktur der Zweiten Internationalen – was es den Revolutionären ungleich schwerer machte, zu einem tiefen Verständnis der verschiedenen Situationen in den einzelnen Ländern zu gelangen. Entsprechend der föderalistischen Struktur gab es keine wirkliche Zentralisierung, und ein Konzept des allgemeinen, zentralisierten Kampfes existierte im linken Flügel noch nicht.
„Lenins Fraktionsarbeit fand allein innerhalb der russischen Partei statt. Er versuchte nicht, sie auf eine internationale Ebene zu stellen. Wir brauchen nur seine Interventionen auf den mannigfaltigen Kongressen zu lesen, um zu sehen, dass seine Arbeit außerhalb der russischen Kreise vollständig unbekannt blieb“ (Bilan, Nr. 24, s.o.: Dieser Artikel ist bereits in unserer International Review, Nr. 64 wiederveröffentlicht worden).
Die Zweite Internationale war in einem gewissen Sinn immer noch ein Ausdruck der aufsteigenden Phase des Kapitalismus, wo die verschiedenen Mitgliedsparteien auf föderaler Ebene existieren konnten – „Seite an Seite“, statt in einem einzigen Körper vereint zu sein.
Die Herausforderung des Krieges für die Revolutionäre
Der Ausbruch des I. Weltkrieges im August 1914, der Verrat der SPD und der Tod der Zweiten Internationalen stellten die Revolutionäre vor eine neue Situation.
Der I. Weltkrieg bedeutete, dass der Kapitalismus weltweit zu einem dekadenten System geworden ist, wodurch die Revolutionäre überall auf der Welt vor denselben Aufgaben gestellt wurden. Dies erforderte eine Intervention der Revolutionäre nicht auf „föderaler“ Ebene, sondern auf einer höheren, zentralisierten Ebene – mit demselben Programm und der Notwendigkeit einer internationalen Vereinigung der revolutionären Kräfte.
Doch sollten die Revolutionäre nach dem Verrat durch die sozialdemokratische Führung der Partei sofort den Rücken kehren und eine eigene Organisation aufstellen?
Die linke Strömung in Deutschland um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht[xi] erfasste die neue Lage sofort. Sie:
- verteidigte den proletarischen Internationalismus und widersetzte sich dem Burgfrieden, den die Gewerkschaften mit der Bourgeoisie schlossen, indem sie die Arbeiter dazu aufrief, sich in einem unnachgiebigen Klassenkampf zu engagieren;
- organisierte sich separat unter dem Namen Spartakusbund, mit dem Ziel, die Partei zurückzuerobern und die chauvinistische, patriotische Führung hinauszubefördern, um zu verhindern, dass die Partei von den bürgerlichen Kräften erdrosselt wird, und gleichzeitig das Fundament für eine neue, noch zu gründende Partei zu legen;
- stellte einen internationalen Kontakt zu anderen internationalistischen Kräften her.
Die deutschen Revolutionäre begannen ohne Zögern mit dieser Arbeit, warteten nicht weitere Arbeiterreaktionen gegen den Krieg ab. Während der 52 Monate des Krieges befanden sich die meisten ihrer Führer im Gefängnis – von wo aus sie ihre Fraktionsarbeit fortsetzten. Die Spartakisten und andere linke Kräfte fanden sich im Angesicht äußerst schwieriger Umstände wieder. Sie mussten einem immer repressiveren Staatsapparat begegnen, wobei die Parteiführung internationalistische Stimmen so offen wie irgendein Polizeiagent denunzierte. Viele Parteimitglieder, die auf Parteitreffen den Internationalismus verteidigten, wurden denunziert und kurze Zeit darauf von der Polizei festgenommen. Unter den schwierigsten Bedingungen der Illegalität fuhren die Spartakisten damit fort, für die Rückeroberung der Partei von der chauvinistischen Führung zu kämpfen, doch bereiteten sie gleichzeitig die Bedingungen für die Gründung einer neuen Partei vor. Ihre Verteidigung eines revolutionären Programms bedeutete, dass sie sich permanent mit dem zentristischen Verhalten innerhalb der SPD auseinandersetzen mussten. Dieser eiserne Kampf der Spartakisten dagegen, dass die Partei von der Bourgeoisie übernommen wird, sollte später als Bezugspunkt für die Genossen der Italienischen Linken dienen, die sich etliche Jahre lang der Führung der Komintern widersetzten.
Die andere wichtige Kraft, die imstande war, eine wirkliche Arbeit als Fraktion nach 1914 zu leisten, waren die Bolschewiki. Mit den vielen ihrer im ausländischen Exil befindlichen Führer engagierten sie sich in einem unermüdlichen Kampf für die Aufrechterhaltung des proletarischen Internationalismus. Lenin und die anderen Bolschewiki waren die Ersten, die die Zweite Internationale für tot erklärten und für die Sammlung der internationalistischen Kräfte einstanden. Sie übten eine aktive Rolle auf der Zimmerwalder Konferenz von 1915 aus, wo sie gemeinsam mit Militanten insbesondere der holländischen Linken einen linken Flügel bildeten.
Ob im Exil oder innerhalb Russlands, sie handelten als die wichtigste treibende Kraft bei der Errichtung des Widerstandes der Arbeiterklasse gegen den Krieg. Es war ganz offenkundig ihr Verdienst, das internationalistische Banner hochgehalten zu haben, die Perspektive eines internationalen Kampfes vorgestellt zu haben (Verwandelt den imperialistischen Krieg in einen Bürgerkrieg), die es der Arbeiterklasse in Russland erlaubte, sich gegen den Krieg zu erheben und den revolutionären Prozess in Gang zu setzen.
Somit waren die Spartakisten und Bolschewiki als Speerspitze einer größeren internationalistischen, revolutionären Bewegung wäh-rend des Krieges unerlässliche Helfer dabei, den Krieg zu beenden und die Kämpfe in Richtung internationale Ausweitung und Überwindung des Kapitalismus zu drängen.
Sie veranschaulichten deutlich, dass keine Fraktion ihre militante Verantwortung erfüllen kann, wenn sie nicht an zwei Fronten kämpft: in der Arbeiterklasse zu intervenieren und gleichzeitig eine revolutionäre Organisation zu verteidigen und zu errichten. Es wäre undenkbar für sie, sich von eine dieser zwei Fronten zurückzuziehen.
Die Frage der Fraktion in der Kommunistischen Internationale
Im Falle der Sozialdemokratie degenerierte die Partei bis zu dem Punkt, wo sie die Interessen der Klasse in einer Kriegssituation verriet. Wir wollen nun einen Blick auf das zweite große Beispiel einer Degeneration werfen – nämlich jene der bolschewistischen Partei.
Einst die Vorhut der Arbeiterklasse und entscheidende Kraft bei der Ermöglichung der Machtergreifung durch die Arbeiterräte im Oktober 1917, wurde die bolschewistische Partei allmählich durch den russischen Staat absorbiert, sobald die internationale Ausweitung der Revolution zum Stillstand gekommen war. Auch hier haben wir im Gegensatz zum anarchistischen Standpunkt, der behauptet, dass jede Partei zum Verrat verdammt ist, einen objektiven, materiellen Hintergrund, der die bolschewistische Partei vom russischen Staat verschlingen ließ.
Wie wir in unserer Präsentation der Geschichte der linken Fraktionen erklärt haben (The Communist Left and the continuity of Marxism – ein Artikel, der in Proletarian Tribune in Russland veröffentlicht worden war und auf unsere Website unter www.internationalism.org/texts/prol_tribune [82]. htm erhältlich ist), „setzten das Zurückfluten der revolutionären Welle und die Isolation der Russischen Revolution einen Degenerationsprozess sowohl innerhalb der Kommunistischen Internationale als auch innerhalb der Sowjetmacht in Russland in Gang. Die bolschewistische Partei verschmolz immer mehr mit dem bürokratischen Staatsapparat, der in umgekehrter Proportion zu den Organen der Macht und Beteiligung des Proletariats in Russland, den Sowjets, Fabrikkomitees und den Roten Garden, stand. Innerhalb der Internationale förderten die Versuche, in einer Phase abnehmender Massenaktivität die Unterstützung durch die Massen zu gewinnen, die opportunistischen ‚Lösungen‘ – die immer stärkere Betonung der Arbeit in den Parlamenten und Gewerkschaften, der Appell an die ‚Völker des Ostens‘, sich gegen den Imperialismus zu erheben, und vor allem die Politik der Einheitsfront, die die hart erarbeitete Klarheit über die kapitalistische Natur der Sozialpatrioten zunichte machte.“
Diese opportunistische Wende, die von der internationalen Schwächung der Arbeiterklasse und der Isolation der Revolution in Russland ausgelöst wurde, artete allmählich in einem völlig selbständigen Prozess der Degeneration aus, der nach einem halben Dutzend Jahren mit der Verkündung des „Sozialismus in einem Land“ auf den 6. Kongress der KI im August 1928 seinen Höhepunkt fand.
Wie bei der Degeneration der SPD vor dem I. Weltkrieg war dieser Prozess auch durch eine allmähliche Zerstörung des Parteilebens gekennzeichnet. Die Kräfte der Partei, die am engsten mit dem Staatsapparat verknüpft und in ihm integriert waren, zogen hinter den Kulissen einmal mehr die Fäden.
Nach einigen sehr frühen Protesten gegen die Erdrosselung des Parteilebens, in denen die wachsende Bürokratisierung der Partei kritisiert wurden (s. die Artikel in International Review Nr. 8-9 über die „Degeneration of the Russian Revolution and the work of the Communist Left in Russia“), wurde eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die oppositionellen Kräfte zum Verstummen zu bringen:
- im Frühjahr 1921 wurden die Fraktionen verbannt;
- lokale Parteisektionen konnten zu Parteibeschlüssen nur ihre Zustimmung oder ihre Ablehnung äußern, Initiativen von örtlichen Sektionen wurden allmählich eliminiert;
- die Delegierten der Parteikonferenzen wurden von den höheren Rängen bestimmt, statt ein Mandat von den lokalen Sektionen zu erhalten und ihnen gegenüber verantwortlich zu sein;
- eine Kontrollkommission wurde eingerichtet, die sich in wachsendem Maße verselbständigte und mit der eisernen Hand des Militarismus über die Partei herrschte;
- immer mehr Macht wurde in den Händen des Organisationsbüros und des Generalsekretärs Stalin konzentriert;
- Oppositionszeitungen wurden an ihrer Veröffentlichung gehindert;
- Oppositionelle wurden zur Zielscheibe bösartiger Verleumdungen.
Wie in der Zweiten Internationale begrenzte sich der Degenerationsprozess nicht auf die bolschewistische Partei; dieser Prozess setzte sich in allen Mitgliedsparteien der Komintern fort. Schritt für Schritt folgten sie dem tragischen Kurs der russischen Partei - ohne notwendigerweise im Staatsapparat der Länder, in denen sie existierten, integriert zu sein, zogen sie es alle vor, die Interessen des internationalen Proletariats jenen des russischen Staats zu opfern.
Einmal mehr reagierte das Proletariat durch die Bildung von „Antikörpern“, durch die Schaffung der Linkskommunisten: „Es ist offenkundig, dass die Notwendigkeit der Fraktion auch ein Ausdruck der Schwäche des Proletariats ist, das entweder zerbrochen ist oder vom Opportunismus gewonnen wurde“ („Vorschlag einer Resolution über die Probleme der linken Fraktion“, Bilan Nr. 17, April 1935, S. 571).
Aber genauso wie der Opportunismus in der Zweiten Internationale eine proletarische Antwort in Form der linken Strömungen provoziert hatte, so widerstanden auch die Strömungen der Linkskommunisten der Flut des Opportunismus in der Dritten Internationale – viele ihrer Sprecher wie Pannekoek und Bordiga[xii] hatten sich bereits als die besten Vertreter des Marxismus in der alten Internationale erwiesen.
Die Gründung der Kommunistischen Linken
Die Kommunistische Linke war im Wesentlichen eine internationale Strömung mit Ablegern in vielen verschiedenen Ländern, von Bulgarien bis Großbritannien und von den USA bis Südafrika. Doch ihre wichtigsten Repräsentanten waren exakt in jenen Ländern anzutreffen, wo die marxistische Tradition am stärksten war: Deutschland, Italien und Russland.
In Deutschland hatte die ausgeprägte marxistische Tradition, gekoppelt mit dem riesigen Einfluss der reellen Bewegung der proletarischen Massen, bereits auf dem Höhepunkt der revolutionären Welle einige der fortgeschrittensten politischen Positionen erzeugt, besonders über die Frage des Parlamentarismus und der Gewerkschaften. Doch der Linkskommunismus als solcher erschien als Antwort auf die ersten Anzeichen des Opportunismus in der deutschen Kommunistischen Partei und der Internationale, und ihre Speerspitze war die KAPD (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands), die 1920 gegründet wurde, nachdem die Linksopposition innerhalb der KPD durch ein haltloses Manöver ausgeschlossen worden war. Obwohl von der KI-Führung als „infantil“ und „anarchosyndikalistisch“ kritisiert, basierte die Ablehnung der alten parlamentarischen und gewerkschaftlichen Taktiken durch die KAPD auf einer profunden marxistischen Analyse der Dekadenz des Kapitalismus, die diese Taktiken obsolet machte und neue Formen der Klassenorganisation forderte – die Fabrikkomitees und die Arbeiterräte; dasselbe kann von ihrer deutlichen Ablehnung der alten „Massenpartei“-Konzeption der Sozialdemokratie zugunsten des Begriffs der Partei als ein programmatisch klarer Nukleus – ein Begriff, der direkt vom Bolschewismus geerbt wurde – gesagt werden. Die kompromisslose Verteidigung dieser Errungenschaften durch die KAPD gegen eine Rückkehr zu den alten sozialdemokratischen Taktiken machte sie zum Kern einer internationalen Strömung, die in einer Anzahl von Ländern Ableger hatte, besonders in den Niederlanden, deren revolutionäre Bewegung durch das Werk Pannekoeks und Gorters[xiii] eng mit Deutschland verknüpft war. Dies soll nicht heißen, dass der Linkskommunismus in Deutschland in den frühen 20er Jahren nicht an wesentlichen Schwächen litt.
In Italien andererseits war der Linkskommunismus – der anfangs eine Mehrheitsposition innerhalb der Kommunistischen Partei Italien innehatte – besonders klar über die Organisationsfrage, und dies versetzte ihn in die Lage, nicht nur einen couragierten Kampf gegen den Opportunismus innerhalb der degenerierenden Internationalen zu führen, sondern auch eine kommunistische Fraktion in die Welt zu setzen, die fähig war, den Schiffbruch der revolutionären Bewegung zu überleben und die marxistische Theorie während der Nacht der Konterrevolution weiterzuentwickeln. Doch in den frühen 20er Jahren basierten seine Argumente zugunsten des Abstentionismus vom bürgerlichen Parlamentarismus, gegen die Vereinigung der kommunistischen Vorhut mit den großen zentristischen Parteien mit dem Zweck, Illusionen über den „Masseneinfluss“ zu erzeugen, gegen die Parolen der Einheitsfront und die „Arbeiterregierungen“ auf einem tiefen Verständnis der marxistischen Methode. Dasselbe trifft auf seine Analysen des neuen Phänomens des Faschismus und auf seine konsequente Ablehnung aller antifaschistischen Fronten mit den Parteien der „demokratischen“ Bourgeoisie zu. Der Name Bordigas ist untrennbar mit dieser Phase in der Geschichte des italienischen Linkskommunismus verbunden, aber trotz der ungeheuren Bedeutung des Beitrags dieses Militanten lässt sich die Italienische Linke ebensowenig auf Bordiga reduzieren wie der Bolschewismus auf Lenin: Beide waren organische Produkte der politischen Bewegung des Proletariats.
Die Isolation der Revolution in Russland war, wie wir festgestellt haben, in einer wachsenden Trennung zwischen der Arbeiterklasse und einer wachsenden bürokratischen Staatsmaschinerie gemündet – der tragischste Ausdruck dieser Trennung war die Unterdrückung des Aufstandes der Kronstädter Arbeiter und Matrosen im März 1921 durch die eigene, bolschewistische Partei, die immer mehr mit dem Staat verwickelt war. Doch just, weil er eine durch und durch proletarische Partei war, erzeugte der Bolschewismus eine große Anzahl innerer Reaktionen gegen die eigene Degenerierung. Lenin selbst – der 1917 der eloquenteste Sprecher des linken Flügels der Partei gewesen war – übte einige höchst relevante Kritiken an dem Rutsch der Partei in den Bürokratismus, besonders gegen Ende seines Lebens; und etwa um die gleiche Zeit wurde Trotzki zum Hauptrepräsentanten einer linken Opposition, die danach trachtete, die Normen der proletarischen Demokratie innerhalb der Partei zu restaurieren, und die damit fortfuhr, die schlimmsten Ausdrücke der stalinistischen Konterrevolution zu bekämpfen, besonders die Theorie vom „Sozialismus in einem Land“. Doch die bedeutendsten linken Strömungen innerhalb der Partei neigten im Wesentlichen, weil der Bolschewismus durch seine Verschmelzung mit dem Staat seine eigene Rolle als proletarische Avantgarde unterminiert hatte, dazu, sich von weniger bekannten Figuren anzuführen zu lassen, die potenziell der Klasse näher standen als dem Staat. Bereits 1919 hatte die Gruppe Demokratischer Zentralismus, angeführt von Ossinski, Smirnow und Sapranow, begonnen, vor der Gefahr des „Austrocknens“ der Sowjets und der wachsenden Abkehr von den Prinzipien der Pariser Kommune zu warnen. Ähnliche Kritik wurde 1921 von der Gruppe Arbeiteropposition, angeführt von Kollontai und Schljapnikow, geübt, obgleich sich letztere als nicht so rigoros und dauerhaft erwies wie die „Dezisten“-Gruppe, die während der 20er Jahre weiter eine wichtige Rolle spielen und eine ähnliche Vorgehensweise entwickeln sollte wie die Italienische Linke. 1923 gab die von Miasnikow angeführte Gruppe Arbeiteropposition ihr Manifest heraus und unternahm eine wichtige Intervention in den Arbeiterstreiks jenes Jahres. Ihre Positionen und Analysen standen jenen der KAPD nahe. All diese Gruppen entstanden nicht nur aus der bolschewistischen Partei; sie fuhren damit fort, innerhalb der Partei für eine Rückkehr zu den ursprünglichen Prinzipien der Revolution zu kämpfen. Doch da die Kräfte der bürgerlichen Konterrevolution innerhalb der Partei an Boden gewonnen hatten, wurde die Fähigkeit der mannigfaltigen Oppositionen, die wahre Natur dieser Konterrevolution zu erblicken und mit jeglicher sentimentalen Loyalität zu ihren organisierten Ausdrücken zu brechen, zur Schlüsselfrage. Dies sollte die grundsätzliche Divergenz zwischen Trotzki und den russischen Linkskommunisten beweisen: Während Ersterer sein Leben lang an dem Begriff der Verteidigung der Sowjetunion und gar an der proletarischen Natur der stalinistischen Parteien gekettet bleiben sollte, sahen die Linkskommunisten, dass der Triumph des Stalinismus – einschließlich seiner „linken“ Wendemanöver, die viele Anhänger Trotzkis verwirrten – den Triumph des Klassenfeindes bedeutete und die Notwendigkeit einer neuen Revolution beinhaltete. Dennoch liefen viele der besten Elemente in der trotzkistischen Opposition – die so genannten „Unversöhnlichen“ – in den späten 20er und frühen 30er Jahren zu den Positionen der Kommunistischen Linken über. Der stalinistische Terror hatte am Ende des Jahrzehnts diese Gruppen nahezu eliminiert.
Im Gegensatz zum opportunistischen Kurs von Trotzki definierte die italienische linke Fraktion um die Zeitschrift Bilan herum die Aufgaben der Stunde korrekt: erstens nicht die elementaren Prinzipien des Internationalismus angesichts des Kurses zum Krieg zu verraten; zweitens eine „Bilanz“ aus dem Scheitern der revolutionären Welle und insbesondere der Russischen Revolution zu ziehen sowie die geeigneten Lehren zu erarbeiten, so dass sie als theoretisches Fundament für die neuen Parteien dienen konnten, die aus dem künftigen Wiedererwachen des Klassenkampfes entstehen würden.
Der Krieg in Spanien 1936–38 war eine besonders harte Prüfung für die damaligen Revolutionäre; viele von ihnen kapitulierten vor den Sirenengesängen des Antifaschismus und vermochten nicht zu sehen, dass der Krieg auf beiden Seiten imperialistisch war, eine Generalprobe für den kommenden Weltkrieg. Bilan jedoch blieb standhaft und rief zum Klassenkampf sowohl gegen die Faschisten als auch gegen die republikanischen Fraktionen der Bourgeoisie auf, genauso wie Lenin beide Lager im Ersten Weltkrieg denunziert hatte. Gleichzeitig waren die theoretischen Beiträge dieser Strömung – die später auch Fraktionen in Belgien, Frankreich und Mexiko umfasste – immens und in der Tat unersetzlich. In ihren Analysen über die Degeneration der Russischen Revolution – die sie niemals zur Infragestellung des proletarischen Charakters von 1917 verleitete -, in ihren Untersuchungen der Probleme einer künftigen Übergangsperiode, in ihrer Arbeit über die Wirtschaftskrise und den Fundamenten der kapitalistischen Dekadenz, in ihrer Ablehnung der Position der Kommunistischen Internationaln für die Unterstützung nationaler Befreiungskämpfe, in ihrer Erarbeitung einer Theorie der Partei und der Fraktion – auf diesen und vielen anderen Gebieten führte die italienische Linksfraktion zweifellos ihre Aufgabe aus, eine programmatische Basis für die proletarischen Organisationen der Zukunft zu legen.
Die Fragmentierung der linkskommunistischen Gruppen in Deutschland wurde durch den Naziterror vervollständigt, auch wenn einige klandestine revolutionäre Aktivitäten auch unter dem Hitlerregime fortgesetzt wurden. Während der 30er Jahre wurde die Vertretung revolutionärer Positionen der deutschen Linken größtenteils von den Niederlanden aus fortgesetzt, besonders durch die Arbeit der Gruppe der Internationalen Kommunisten (GIK), aber auch in Amerika durch eine von Paul Mattick angeführte Gruppe. Wie Bilan blieb die Holländische Linke angesichts all der lokalen imperialistischen Kriege, die den Weg zum globalen Gemetzel ebneten, dem Internationalismus treu und widerstand den Versuchungen einer „Verteidigung der Demokratie“. Sie fuhr damit fort, ihr Verständnis in der Gewerkschaftsfrage, in der Frage neuer Formen von Arbeiterorganisationen in der Epoche des kapitalistischen Niedergangs, der materiellen Wurzeln der kapitalistischen Krise, der Tendenz zum Staatskapitalismus zu vertiefen. Sie hielt auch an der Wichtigkeit von Interventionen im Klassenkampf fest, besonders gegenüber der Bewegung der Arbeitslosen. Doch die Holländische Linke schlitterte, traumatisiert von der Niederlage der Russischen Revolution, immer mehr in die rätekommunistische Negation von politischen Organisationen – und somit jeglicher klaren Rolle für sich selbst. Gekoppelt daran war eine totale Ablehnung des Bolschewismus und der Russischen Revolution, die als bürgerlich von Anbeginn abgetan wurde. Diese Theoretisierungen waren der Keim für ihr künftiges Ableben. Obwohl der Linkskommunismus in den Niederlanden auch unter der Nazibesetzung fortgesetzt wurde und einer bedeutenden Organisation – den Spartacusbond, der sich anfangs zu den Pro-Partei-Positionen der KAPD zurück bewegte - nach dem Krieg zum Aufstieg verhalf, erschwerten die Zugeständnisse der Holländischen Linken in der Organisationsfrage gegenüber dem Anarchismus es ihr, jegliche Art von organisatorischer Kontinuität in späteren Jahren aufrechtzuerhalten.
Die Italienische Linke dagegen hielt die organisatorische Kontinuität auf ihre Art aufrecht, wobei jedoch die Konterrevolution ihren Tribut forderte. Noch vor dem Krieg fiel die Italienische Linke durch die „Theorie der Kriegswirtschaft“, die den drohenden Weltkrieg leugnete, der Auflösung anheim, doch ihre Arbeit wurde besonders durch das Auftreten der französischen Fraktion mitten im imperialistischen Konflikt fortgesetzt. Gegen Ende des Krieges schuf der Ausbruch von Arbeiterkämpfen in Italien weitere Verwirrung in den Reihen dieser Fraktion, wobei die Mehrheit nach Italien zurückkehrte, um gemeinsam mit Bordiga, der seit den späten 20er Jahren politisch inaktiv gewesen war, die Internationalistische Kommunistische Partei Italiens zu gründen, die trotz ihrer Opposition zum imperialistischen Krieg auf einer unklaren programmatischen Basis und einer falschen Analyse der Periode, die als eine der zunehmenden revolutionären Auseinandersetzungen betrachtet wurde, gebildet wurde.
Diese politische Orientierung stand im Gegensatz zur Mehrheit in der französischen Fraktion, die schneller als andere erfasste, dass die Periode eine Periode der triumphierenden Konterrevolution bleibt und dass folglicherweise die Aufgaben der Fraktion noch nicht abgeschlossen waren. Die Gauche Communiste de France setzte also die Arbeit im Geiste von Bilan fort und konzentrierte ihre Energien, auch wenn sie ihre Verantwortung für die Intervention in den unmittelbaren Kämpfen der Klasse nicht vernachlässigte, auf die Arbeit der politischen und theoretischen Klärung und erzielte dabei eine Reihe wichtiger Fortschritte, insbesondere in der Frage des Staatskapitalismus, der Übergangsperiode, der Gewerkschaften und der Partei. Während sie rigoros an der für die Italienische Linke so typischen marxistischen Methode festhielt, war sie ebenfalls in der Lage, einige der besten Beiträge der Deutsch-Holländischen Linken in ihr allgemeines programmatisches Zeughaus zu integrieren.
Während die deutsche und holländische Linke im Prinzip unfähig war, eine wirkliche Arbeit als Fraktion zu leisten, gelang es den Genossen der Italienischen Linken nicht nur, es zu vermeiden, zu früh aus der Komintern geworfen zu werden, sondern es gelang ihnen auch, unter den sehr schwierigen Bedingungen einer illegalen Arbeit in Italien und gegen die wachsende militaristische Disziplin in der Komintern einen heroischen Kampf gegen den Opportunismus und die Stalinisierung zu führen.
Bis kurz vor Ausbruch des II. Weltkrieges hatte sich Bilan durch ihre Klarheit über die Einschätzung der Klassenkräfte, über den historischen Kurs zum Krieg ausgezeichnet – und die Gruppe war bereit, den Antifaschismus selbst um den Preis einer fürchterlichen Isolation abzulehnen. Ihre Ablehnung einer Unterstützung der bürgerlichen Demokratie war die Vorbedingung für ihr Einstehen für den proletarischen Internationalismus im Krieg in Spanien 1936–38 und während des II. Weltkrieges. Dies stand in starkem Kontrast zu den Trotzkisten, die während der 30er Jahre den Versuch unternahmen, in die sozialdemokratischen Parteien einzutreten, um sie als Mittel zum Kampf gegen den aufkommenden Faschismus zu benutzen, und die zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Krieges in Spanien 1936–38 glaubten, der Augenblick einer neuen revolutionären Welle von Kämpfen sei gekommen. Im Gegensatz zum opportunistischen und immediatistischen Verhalten Trotzkis und seiner Anhänger bot Bilan eine historische und politische Klarheit, die als Bezugspunkt nicht nur für die damaligen Internationalisten, sondern auch für politische
Gruppen diente, die am Ende der Konterrevolution 1968 entstanden.
Fraktionen – eine unverzichtbare Waffe für die Verteidigung der Arbeiterklasse
Nachdem wir die beiden Hauptfälle der Degeneration von proletarischen Parteien und die Reaktion des Proletariats durch die Schaffung von „Antikörpern“ – den Fraktionen – in Erinnerung gerufen haben, wollen wir nun an einige Elemente ihres Kampfes erinnern.
Bilan definierte die Funktion und Bedingungen einer Fraktion wie folgt:
„Wie die Partei wird auch die Fraktion durch ein Moment der Klasse ins Leben gerufen und nicht durch den individuellen Willen. Sie tritt notwendig auf, wenn die Partei bürgerliche Ideologien reflektiert, ohne sie bereits auszudrücken, wenn ihre Stellung im Klassenmechanismus sie schon zu einem Anhängsel des bürgerlichen Herrschaftssystems gemacht hat. Die Fraktion lebt und entwickelt sich entsprechend dem Voranschreiten des Opportunismus und wird zum einzigen historischen Ort, wo das Proletariat sich als Klasse organisieren kann...
Im Gegenteil dazu tritt die Fraktion als historische Notwendigkeit der Aufrechterhaltung einer Klassenperspektive und als eine Tendenz auf, die sich der Erarbeitung jener Ideen widmet, deren Fehlen infolge der Unreife des Proletariats den Triumph des Feindes erst möglich gemacht hat. In der Zweiten Internationale waren die Fraktionen als Reaktion auf die Tendenz des Reformismus, das Proletariat allmählich in den kapitalistischen Staatsapparat einzugliedern, entstanden.
In der Zweiten Internationale wuchs die Fraktion und entwickelte ihre Konturen gegenüber der Entwicklung des Opportunismus und der Erarbeitung neuer programmatischer Gegebenheiten, während der Opportunismus versuchte, sie innerhalb der korrupten Massenparteien gefangenzuhalten, um ihr historisches Werk zu brechen. In der Dritten Internationalenfand das kapitalistische Einkreisungsmanöver rund um Russland statt, und der Zentrismus versuchte, die KPs dahin zu bringen, dem Schutz der Wirtschaftsinteressen des proletarischen Staates entgegenzukommen, indem ihnen die Rolle anvertraut wurde, den Klassenkampf überall zum Entgleisen zu bringen.“
(Bilan, Nr. 17, April 1935).
Die Bildung einer Fraktion muss einer Methode folgen. So reicht es nicht aus, lediglich so laut wie möglich zu verkünden, eine Organisation sei am ‚Degenerieren‘, sobald eine kontroverse Debatte begonnen hat. Das Konzept der Degeneration darf sich niemals in Beleidigungen erschöpfen, sondern ist eine politische Einschätzung, die auf materialistischem Wege bewiesen werden muss.
Wie Bilan unterstrich, wird die Bildung einer Fraktion notwendig, wenn alles getan wurde, um zu verhindern, dass die betreffende Organisation in die Hände des Klassenfeindes fällt. Das Konzept der Degeneration zieht daher einen lang hingezogenen, zähen Kampf in Betracht; es berücksichtigt die Tatsache, dass man für die Zukunft arbeitet und jede überhastete Vorgehensweise ablehnt; es steht daher in völligem Gegensatz zur Ungeduld. Eine solche Einschätzung darf niemals einem „Hochgefühl“ oder einer „schlechten Stimmung“ folgen. Kurz: Die Beschuldigung, dass eine Organisation am Degenerieren ist, kann nicht leichtfertig, sorglos erhoben werden, sondern muss auf einer materialistischen Analyse basieren.
Zum Beispiel bezeichnete die KAPD-Delegation auf dem Moskauer Kongress der Komintern 1921 die bolschewistische Partei und die Komintern als einen degenerierenden Körper, der von der Bourgeoisie vereinnahmt worden sei. Zu jenem Zeitpunkt war diese Diagnose jedoch voreilig. Wie wir in unserer Artikelreihe über die Deutsche Revolution (Internationale Revue, Nr. 18–29) gezeigt haben, machte die KAPD durch die Erstellung solch einer Diagnose einen kapitalen Fehler; mit der Konsequenz, dass sie außerstande gesetzt wurde, sich als Fraktion einem wirklichen Kampf innerhalb der Komintern zu stellen.
Eine Fraktion kann erst nach einer langen Debatte, nach einem intensiven Kampf innerhalb der Organisation gebildet werden, wenn sich die Divergenzen nicht mehr auf ein, zwei Punkte beschränken, sondern eine völlig unterschiedliche Orientierungen beinhalten – wenn eine Seite sich auf die Abschaffung von Klassenpositionen zu bewegt und die andere Seite sich dem widersetzt.
Erst wenn solch ein langer Kampf stattgefunden hat, wenn alle vorherigen Schritte sich als unzureichend erwiesen haben, um die Organisation daran zu hindern, sich in Richtung Degeneration zu bewegen, ist die Fraktion eine unbedingte Notwendigkeit. In solchen Fällen, wo die Organisation gen bürgerliche Positionen rutscht, wäre es sogar unverantwortlich, keine Fraktion zu bilden.
Das Verständnis einer neuen historischen Situation...
Die Fraktion ist also durch ihre Verteidigung des Programms, durch ihre Loyalität gegenüber den Klassenpositionen, die von einem bestimmten Teil der Organisation in Frage gestellt werden, charakterisiert. Im Gegensatz zu den opportunistischen, immediatistischen Versuchungen in der Organisation, das Programm im Namen einiger Zugeständnisse an die bürgerliche Ideologie aufzugeben, unternimmt die Fraktion einen theoretisch-politisch-programmatischen Kampf, der zur Etablierung einer Reihe von Gegenpositionen führt – die Teil eines breiteren theoretischen Rahmens sind.
So beschränkten sich die linken Strömungen, die sich den opportunistischen Neigungen vor dem I. Weltkrieg widersetzt hatten, nie auf eine bloße Verteidigung des existierenden Programms, sondern warfen ein Schlaglicht auf die tieferen historisch-politischen Wurzeln der zur Debatte stehenden Fragen und boten einen theoretisch-programmatischen Rahmen zum Verständnis der neuen Situation an. In diesem Sinn ist eine Fraktion mehr als die verkörperte Loyalität zum alten Programm, sie bietet vor allem einen neuen theoretischen Rahmen zum Verständnis der neuen Bedingungen an, denn der Marxismus ist keineswegs ‚unveränderlich‘, sondern bietet stets eine Analyse an, die imstande ist, neue Elemente einer neuen Situation zu integrieren.
„Dies sollte als Beweis dafür dienen, dass die Fraktion nur unter der Bedingung leben, ihre Kader trainieren und die Endziele des Proletariats wirklich repräsentieren kann, wenn sie als eine höhere Stufe in der marxistischen Lageanalyse, im Verständnis der gesellschaftlichen Kräfte in Bewegung innerhalb des Kapitalismus, der proletarischen Positionen zu den Problemen der Revolution auftritt und nicht als bloßer Organismus, der auf den ersten vier Kongressen der KI fußt – die sowieso noch keine Lösung für Probleme, die noch nicht reif waren, enthalten konnten“ (Bilan, ebenda, S. 577).
Ohne die Kritik am Opportunismus vor dem I. Weltkrieg, ohne die theoretische, analytische Arbeit der Internationalisten während des I. Weltkrieges hätten die Revolutionäre nie die neue Situation begriffen. So waren z.B. Rosa Luxemburgs Junius-Broschüre, Lenins Imperialismus – das höchste Stadium des Kapitalismus, Pannekoeks Der Imperialismus und die Aufgaben des Proletariats vitale theoretische Beiträge, die in jener Zeit verfasst worden waren.
Und als die Komintern begann, nach 1920 einen opportunistischen Kurs einzuschlagen, indem sie die alten Kampfmethoden propagierte, demonstrierten die linken Fraktionen, dass die neuen Bedingungen des Kapitalismus eine Rückkehr zur Vergangenheit nicht zuließen. Sie waren die Einzigen, die begonnen hatten, die Auswirkungen der neuen Epoche zu begreifen (auch wenn dies fragmentiert, bruchstückhaft und sehr konfus war).
Der Verteidigungsmechanismus, den eine Fraktion widerspiegelt, ist daher vom Bedürfnis bestimmt, die neue historische Lage zu verstehen. Eine Fraktion ist gezwungen, eine neue theoretische Kohärenz zu präsentieren, indem sie die Organisation auf eine höhere Ebene des Verständnisses führt.
„Sie setzt sich selbst als ein fortschrittlicher Organismus durch, dessen Hauptanliegen es ist, die kommunistische Bewegung auf eine höhere Stufe in der Entwicklung ihrer Doktrin zu drängen, indem er seinen eigenen Beitrag zur internationalen Lösung der neuen Probleme liefert, die von der Erfahrung der Russischen Revolution und der Periode des kapitalistischen Niedergangs gestellt werden“ (Bilan, Nr. 41, Mai 1937)
Da der Kampf einer Fraktion sich nie darauf beschränkt, die alternative Ansicht über eine einzelne Frage entgegenzusetzen, sondern einen weitaus größeren Rahmen umfassen muss, kritisierte Bilan Trotzki, der hauptsächlich als eine „Strömung der Opposition“ gegenüber dem Aufstieg des Stalinismus agieren wollte, aus dem Grund, dass er niemals wirklich die Herausforderung erfasste, denen sich die Revolutionäre zu stellen hatten: „Es war Trotzki, der die Möglichkeit unterdrückte, eine vereinte Fraktion in Russland zu bilden, indem er sie von der Weltebene loslöste und die Bildung von Fraktionen in verschiedenen Ländern verhinderte, indem er die Notwendigkeit einer Opposition für die ‚Wiederherstellung‘ der Kommunistischen Parteien proklamierte. Er reduzierte auf diese Weise den riesigen Kampf der marxistischen Kerne gegen den Block der kapitalistischen Kräfte, die den proletarischen Staat verkörperten (Zentrismus), auf den bloßen Schutz ihrer Interessen, auf einen Kampf, der lediglich Druck auf Letztere ausüben sollte, um eine ungleichmäßige Industrialisierung unter dem Banner des ‚Sozialismus in einem Land‘ und ‚Irrtümer‘ der KPs zu vermeiden, die in die Niederlage führen“ (Bilan, Nr. 17, 1935, S. 576).
... das Engagement in einer langen Schlacht
Es ist fast müßig zu sagen, dass die Bereicherung des Marxismus und die Vertiefung der anstehenden Themen nicht in „einer kurzen Auseinandersetzung“ vollbracht werden kann. So, wie der Aufbau der Organisation alles andere als ein hastiger Versuch ist, ein Kartenhaus zu errichten, sondern die entschlossensten Bemühungen erfordert, so muss eine Fraktion bei der Bekämpfung der Gefahren des Immediatismus, der Ungeduld, des Individualismus, etc. jede Übereilung ablehnen.
Die Degeneration ist stets ein langer Prozess. Eine Organisation kollabiert nie aus heiterem Himmel, sie durchläuft einen Todeskampf. Es ist nicht wie beim Boxkampf, der über 15 Runden geht, sondern es ist ein Kampf um Leben und Tod, der erst mit dem Triumph einer der beiden Seiten endet, weil beide Positionen unvereinbar miteinander sind. Eine Seite, der opportunistische, degenerierende Teil, bewegt sich auf bürgerliche Positionen und auf den Verrat zu, während der Gegenpol den Internationalismus verteidigt. Dies ist ein Kampf, in dem sich ein Kräfteverhältnis entwickelt, das im Falle der Degeneration und des Verrats zum Verschwinden des proletarischen Lebens aus der Partei führt.
Im Falle der SPD und anderer degenerierender Parteien der Zweiten Internationale dauerte dieser Prozess, grob gesagt, ein Dutzend Jahre.
Doch selbst nachdem die SPD-Führung im August 1914 den proletarischen Internationalismus verraten hatte, desertierten die Internationalisten nicht, sondern kämpften drei Jahre lang um die Partei, bis jegliches proletarische Leben aus der SPD verschwunden und die Partei für das Proletariat endgültig verloren war.
Im Falle der Komintern zog sich die Degeneration ungefähr ein halbes Dutzend Jahre hin und stieß auf heftigen Widerstand von Innen. Der Prozess in den ihr angeschlossenen Kommunistischen Parteien ging über mehrere Jahre und war von der Fähigkeit der einzelnen Parteien abhängig, sich der Vorherrschaft durch die russische Partei zu widersetzen, was dem Gewicht der Linkskommunisten in ihnen entsprach.
Den italienischen Linkskommunisten, die die konstantesten und standhaftesten Verteidiger der Organisation waren, gelang es, bis 1926 sich zur Wehr zu setzen, ehe sie aus der Komintern ausgeschlossen wurden. Trotzki gar wurde erst 1927 aus dem Parteikomitee ausgeschlossen und 1928 leibhaftig nach Sibirien deportiert.
Im Gegensatz zu jeglicher kleinbürgerlichen Ungeduld und Unterschätzung der Notwendigkeit einer revolutionären Organisation ist die Fraktion stets für einen langfristigen Kampf ausgelegt. In dieser Beziehung bot der Spartakusbund während des I. Weltkrieges einen unersetzlichen Bezugspunkt für die Arbeit der italienischen Fraktion während der 20er Jahre.
Die Geschichte hat gezeigt, dass diejenigen, die den Kampf um die Verteidigung der Organisation zu früh aufgaben, in die Katastrophe steuern.
Zum Beispiel entschieden sich in Deutschland die Hamburger Internationalisten um Borchert und der Zeitschrift Lichtstrahlen sowie Otto Rühle aus Dresden schnell, die SPD aufzugeben: Sie nahmen rätekommunistische Positionen an und lehnten am Ende des Krieges und inmitten der revolutionären Welle von Kämpfen politische Parteien in Bausch und Bogen ab.
Der Fall der KPD und der KAPD zeigt dasselbe. In Schlüsselfragen wie die Frage der parlamentarischen Wahlen und der Arbeit in den Gewerkschaften entzweit, warf die katastrophale KPD-Führung unter P. Levi die Mehrheit der Organisation hinaus, womit sie sie im April 1920 zur Gründung der KAPD zwang. Statt diese fundamentalen Fragen in einer intensiven Debatte in den Reihen der KPD zu klären, wurden die Debatten durch eine monolithische Vorgehensweise abgewürgt. Die KPD zerbrach also bereits nach zehn Monaten ihrer Existenz in zwei Teile!
Die Komintern schloss die KAPD nach einem Ultimatum im Sommer 1921 aus ihren Reihen aus und machte es ihr unmöglich, als Fraktion innerhalb der Komintern zu arbeiten.
Und es war eine wahre Tragödie der Geschichte, dass die KAPD-Strömung, kaum aus der KPD und der Komintern ausgeschlossen, sofort vom Virus der Spaltungen befallen wurde, weil sich die Partei, sobald tiefgehende Divergenzen in ihren Reihen auftraten, vor dem Hintergrund eines abebbenden Klassenkampfes in zwei Teile spaltete: in die Essener und Berliner Tendenz (1922).
Die Verteidigung des Programms kann folglich nicht vom langen und zähen Kampf um die Verteidigung der Organisation getrennt werden.
Eine neue Organisation zu errichten, bevor der Kampf um die Verteidigung der alten Organisation in einen Sieg oder eine Niederlage geendet hat, bedeutet zu desertieren oder in ein Fiasko zu schlittern.
Den Kampf als Fraktion aufzugeben, indem übereilt eine neue Organisation gebildet wird, birgt das Risiko in sich, dass diese neue Organisation von Natur aus zur Selbstzerstörung veranlagt ist, mit der Gefahr, vom Opportunismus und Immediatismus erdrosselt zu werden. Das Abenteuer der KAPD, 1921 eine Kommunistische Arbeiterinternationale in Deutschland zu errichten, endete in einem wahren Fiasko.
Und als die Italienische Linke, die in der Lage gewesen war, die Tradition der Fraktionsarbeit gegen das Abgleiten einiger ihrer Mitglieder in den Opportunismus und Immediatismus im Zusammenhang mit dem Krieg in Spanien 1936–38 und im Zusammenhang mit den Theorien Vercesis zu verteidigen, 1943 für die überstürzte und prinzipienlose Gründung der PCInt stimmte, schlug auch sie einen gefährlichen Weg ein – mit dem Keim des Opportunismus im eigenen Körper.
Schließlich ist, wie wir gesehen haben, der Prozess der Degeneration niemals auf ein Land beschränkt, sondern ein internationaler Prozess. Wie die Geschichte gezeigt hat, sind verschiedene Stimmen laut geworden, die zwar ein heterogenes Bild ergeben, aber alle sich gegen den opportunistischen und degenerierenden Trend äußerten.
Gleichzeitig muss der Kampf einer Fraktion ebenfalls international sein und kann sich nicht auf die Grenzen eines Landes beschränken, wie das Beispiel der Zweiten und Dritten Internationale zeigt.
Leider waren die linken Fraktionen genauso wie die linken Strömungen innerhalb der Zweiten Internationale, denen es nicht gelungen war, zentralisiert in einer Fraktion zu arbeiten, ebenfalls nicht in der Lage, auf international zentralisierte Weise zu wirken, nachdem sie aus der Komintern ausgeschlossen worden waren.
Die Bildung einer Fraktion erfordert Klarheit und Rigorosität. Dies trifft nicht nur auf programmatischer Ebene zu, wie wir gesehen haben, sondern auch auf ihre organisatorischen Methoden, die ihre proletarische Natur genauso wie ihre programmatischen Positionen ausdrücken.
Während es in bürgerlichen Organisationen übliche Praxis ist, Geheimtreffen abzuhalten, um Intrigen zu spinnen und Komplotte auszuhecken, ist es elementares Prinzip einer proletarischen Organisation, Geheimtreffen zu ächten. Genossen einer Minderheit oder einer Fraktion müssen sich offen treffen, um es allen Genossen der Organisation zu ermöglichen, ihre Treffen zu verfolgen.
Sich jeglicher geheimer und paralleler Organisationen zu widersetzen war Inhalt einer wichtigen Auseinandersetzung in der Ersten Internationale, die die in ihren eigenen Reihen wirkende geheime Allianz Bakunins aufgedeckt hat.
Es ist kein Zufall, dass Bordiga darauf bestand: „...doch ich muss ganz offen sagen, dass diese gesunde, nützliche und notwendige Reaktion nicht im Gewande eines Manövers oder einer Intrige, in Gestalt von Gerüchten, die sich hinter den Kulissen verbreiten, auftreten kann und darf“ (Bordiga auf der 6. Vollversammlung der KI, Februar-März 1926).
Wir werden auf diese Frage im zweiten Teil dieses Artikels näher eingehen, wenn wir die Notwendigkeit betrachten, die Fraktion vor den Angriffen einer degenerierenden Führung zu schützen, die im Fall der SPD bereit gewesen war, Liebknecht in den Schützengraben und damit in den Tod zu schicken und jegliche internationalistische Stimme innerhalb der eigenen Reihen zu denunzieren, oder die, wie im Fall der stalinistischen bolschewistischen Partei, Parteimitglieder durch Repressionsmaßnahmen zum Schweigen gebracht hat.
D.A.
[i] L´Etincelle: Zeitung die von der Gauche Communiste de France, der politischen Vorgängerin der IKS, Ende des Zweiten Weltkrieges veröffentlicht wurde. (s. unser Buch The Italian communist Left und die Broschüre La Gauche Communiste de France)
[ii] Rosa Luxembrug (1870–1919): Eine der bekanntesten Persönlichkeiten der internationalen Arbeiterbewegung. In Polen geboren, arbeitete sie für die Sozialdemokratische Partei in Deutschland (und war auch Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Polens), wurde später als eine wichtige Theoretikerin in der SPD anerkannt, bevor sie eine führende Figur des linken Flügels in der SPD wurde. Während des Ersten Weltkrieges wurde sie wegen ihrer internationalistischen Aktivitäten inhaftiert. Sie wurde befreit im November 1918 durch die Deutsch Revolution. Sie spielte eine aktive Rolle bei der Bildung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) und entwarf ihr Programm Ende 1918. Zwei Wochen später wurde sie ermordet durch Freikorps Truppen im Solde der Regierung, die von ihren vorherigen “Genossen” der SPD geführt wurde, die jetzt die kapitalistische Ordnung verteidigte.
[iii] Eduard Bernstein (1850–1932): Ein enger Mitarbeiter von Engels bis zu dessen Tod 1895. 1896 begann er mit der Veröffentlichung einer Reihe von Artikeln, in denen er sich für eine “Revision” des Marxismus einsetzte. Dies machte ihn zum Haupttheoretiker der opportunistischen Strömung in der SPD.
[iv] Leo Jogiches (1867–1919): Einer der wichtigsten Führer der Sozialdemokratischen Partei Polens und Lettlands (SDKPiL) und während 15 Jahren Rosa Luxemburgs Partner. Er beteiligte sich an der Gründung der KPD und wurde in ihre Führung gewählt. Fünf Tage später wurde er inhaftiert und im März 1919 in seiner Gefängniszelle ermordet.
[v] August Bebel (1840–1913): Eines der Gründungsmitglieder und führende Persönlichkeit der SPD und der Zweiten Internationalen bis zu seinem Tod.
[vi] Anton Pannekoek (1873–1969): Einer der Haupttheoretiker des linken Flügels der Sozialdemokratischen Partei Hollands, und gleichzeitig Militanter in der SPD vor dem Ersten Weltkrieg. Er beteiligte sich an der Gründung der Kommunistischen Partei Hollands und blieb Führer ihres linken Flügels, welcher später zur “Rätekommunistischen” Strömung wurde.
[vii] Clara Zetkin (1873–1960): Mitglied des linken Flügels in der SPD an der Seite von Rosa Luxemburg. Sie war Spartakistin während des Kriegs und ein Gründungsmitglied der KPD.
[viii] Franz Mehring (1846–1919): Ein Führer und Theoretiker des linken Flügels der SPD. Spartakist während den ersten Weltkriegs und eines der Gründungmitglieder der KPD mit Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht u.a.
[ix] Julian Marchlewski (1866–1925): Mit Leo Jogiches und Rosa Luxemburg einer der Führer der SDKPiL. Als Militanter in Deutschland nahm er am Kampf gegen den Krieg und an den ersten Schritten der Kommunistischen Internationalen teil.
[x] „Der Kampf gegen das Sektierertum stellte sich in der SDP von Anfang an. Im Mai 1909 erklärte Mannoury (ein bekannter Mathematiker und Parteiführer), dass die SDP die einzige sozialistische Partei sei, da die SDAP eine bürgerliche Partei geworden sei. Gorter, der vorher aufs heftigste gegen Troelstra gekämpft hatte, stellte sich energisch gegen diese Auffassung. Er war zuerst in der Minderheit und zeigte auf, dass zwar der Revisionismus ins bürgerliche Lager führt, dass aber die SDAP zunächst und vor allem eine opportunistische Partei innerhalb des proletarischen Lagers war. Diese Position hatte direkte Auswirkungen auf der Ebene der Propaganda und der Agitation in der Klasse. So war es immer noch möglich, ohne das geringste theoretische Zugeständnis zusammen mit der SDAP zu kämpfen, wenn sie einen Klassenstandpunkt vertrat.“ (The Dutch and German Communist Left, S. 46)
[xi] Karl Liebknecht (1871–1919). Mitglied der SPD-Parlamentsfraktion, und einer der Abgeordneten, welche 1914 gegen die Kriegskredite stimmten. Er war die bekannteste Persönlichkeit des Spartakusbundes und ein Gründungsmitglied der KPD. Er wurde zur gleichen Zeit wie Rosa Luxemburg von den Freikorps im solde der SPD-Führung ermordet.
[xii] Amadeo Bordiga (1889–1970): 1910 in die Sozialistische Partei Italiens (PSI) eingetreten, gehörte er zu ihrem äusserst linken Flügel. Er war ein entschlosserner Kämpfer gegen den Krieg und den Opportunismus und vertrat 1917 anti-parlamentarische Positionen, womit er sich an der Bildung der „unnachgiebigen sozialistischen Fraktion” innerhalb der PSI beteiligte. Er wurde nach der Abspaltung 1921 von der PSI zum Führer der neuen italienischen Sektion der Kommunistischen Internationale gewählt. 1930 wurde er aus der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) ausgeschlossen und hielt sich bis 1949 von organisatorischen Tätigkeiten fern, als er in die Internationalistische Kommunistische Partei eintrat. Nach der Spaltung von 1952 nahm er an der Bildung der Internationalen Kommunistischen Partei (PCInt) teil, und blieb deren wichtigster Theoretiker bis zu seinem Tod.
[xiii] Herman Gorter (1864–1927): Mit Pannekoek einer der wichtigsten Theoretiker der Holländischen Linken. Er war Gründer der Zeitung De Tribune und eines der Gründungsmitglieder der Holländischen SDP. Er verteidigte die Positionen der Kommunistischen Linken in der Frage derr Gewerkschaften und der Beteiligung an den Parlamenten in seinem “Offenen Brief an den Genosse Lenin”.
Theoretische Fragen:
- Partei und Fraktion [83]
Internationale Revue 29 - Editorial
- 2785 Aufrufe
Naher Osten: Nur das Weltproletariat kann die kapitalistische Barbarei stoppen
Die militärischen Operationen in Afghanistan waren noch nicht beendet, als eine weiteres Gemetzel im Nahen Osten ausbrach. Und während der Schlächtereien im Westjordanland und in Jerusalem wird schon eine neue Intervention in den Irak vorbereitet. Die kapitalistische Welt stürzt buchstäblich ins Chaos und in die Barbarei des Krieges. Jedes neue Blutbad zeugt vom mörderischen Irrsinn dieses Systems.
Der Nahe Osten wird ein weiteres Mal in den Krieg gestürzt. Der israelisch-palästinensische Konflikt, dessen Wurzeln auf die 1916 erfolgte imperialistische Aufteilung dieser Region durch Großbritannien und Frankreich zurückreichen, ist bereits durch vier offiziell „erklärte“ Kriege gekennzeichnet, nämlich diejenigen von 1956, 1967, 1973 und 1982. Doch seit dem Beginn der zweiten Intifada im September 2000 hat dieser Konflikt eine bisher nie erreichte Dimension der Gewalt und der blinden Massaker angenommen. Unter diesem Druck haben sich die mühsam erreichten Vereinbarungen von Oslo und die jahrelangen Verhandlungen um einen Friedensprozess in Luft aufgelöst. Dieser Konflikt reiht sich in die endlose irrsinnige Kriegsspirale ein, welche durch eine Ausbreitung des Chaos und der Barbarei gekennzeichnet ist. Der Krieg ist nicht mehr einfach Produkt des Kampfes zweier imperialistischer Rivalen, sondern Ausdruck einer generellen Entgleisung und des dominierenden Chaos in den internationalen Beziehungen.
Seit dem 11. September gibt es eine enorme Zuspitzung, welche die letzten Stricke in der Politik reißen ließ. Jeder hat begonnen, in derselben zerstörerischen Logik zu handeln wie die Al-Kaida bei den Attentaten auf die Twin-Towers, einer Logik, nach welcher der Mörder gleichzeitig auch Selbstmörder ist. Einerseits gibt es ein Häufung von Selbstmordattentaten durch Kamikaze-Fanatiker, oft junge Leute von 18 oder 20 Jahren, bei denen das einzige Ziel darin besteht, möglichst viele Leute mit sich in den Tod zu reißen. Diese terroristischen Taten sind von den verschiedenen Teilen der nationalistischen Bourgeoisie ferngesteuert, der Hamas, den Al-Aksa-Brigaden, der Hizbollah oder auch direkt durch den israelischen Geheimdienst Mossad manipuliert. Gleichzeitig gehen die Staaten auf ähnliche Weise vor, um ihre eigenen imperialistischen Interessen zu verteidigen, und stürzen sich in blinde kriegerische Abenteuer ohne Ende, die nur Tod und Verwüstung säen. Israel stützt sein aggressives und arrogantes Kriegsgehabe auf die USA ab. So braucht Sharon dieselben Argumente wie Bush um seine kriegerische Flucht nach vorne und den „Kreuzzug gegen den Terrorismus“ zu legitimieren. Dies zeigt sich in der Besetzung und Zerstörung von Städten im Westjordanland mit Panzern, in den Rundumschlägen der israelischen Armee, welche auf alles schießt, was sich bewegt, Ambulanzfahrzeuge unter Beschuss nimmt, Flüchtlingslager bombardiert, ein Haus nach dem anderen durchkämmt, Quartiere vermint, die lebenswichtige Infrastruktur zerstört und die Bevölkerung aushungert und terrorisiert.
Alle Staaten, und vor allem die großen Rivalen der USA, versuchen die Situation möglichst zu ihren Gunsten zu nutzen oder die Pläne der imperialistischen Gegenspieler zu durchkreuzen und zu sabotieren. Die angeblich entrüsteten Reaktionen, die „pazifistischen“ Maskeraden und Vermittlerspielchen vor allem der europäischen Länder schütten nur noch mehr Öl ins Feuer.
Dies trifft vor allem auf diejenigen Teile der herrschenden Klasse zu, welche die Kriegs- und Rüstungsspirale der Politik der kapitalistischen „Falkenfraktion“ von Sharon, Bush und Konsorten in die Schuhe schieben, denen das „humanitäre Völkerrecht“ entgegenzustellen sei. Die weltweit groß eingefädelten Kundgebungen für oder gegen die Politik Sharons oder Bushs, welche Absichten auch immer dahinter stehen mögen, führen immer nur dazu, die Bevölkerung für das eine oder andere Lager zu mobilisieren, die Spannungen zu verschärfen und ein Klima des Hasses zwischen den verschiedenen Interessensgemeinschaften aufrecht zu erhalten.
Die herrschende Klasse will glaubhaft machen, die Verantwortung liege bei diesem oder jenem Staatschef, einer Nation, einem bestimmten Lager oder einer Bevölkerung. Jede nationale herrschenden Klasse behauptet mit größter Heuchelei, sie stehe „im Dienste des Friedens“ und „verteidige die Demokratie und die Zivilisation“. Dies nur, um die eigenen kriminellen Unterfangen zu vertuschen und sich reinzuwaschen.
Bei jeder sich bietenden Gelegenheit erlauben sie sich zu richten und Einzelne aus ihren Reihen vor der Geschichte als „Kriegsverbrecher“ zu verurteilen. Schon die Nürnberger Prozesse, welche die Sieger zwischen 1945 und 1949, nach der zweiten imperialistischen Weltschlächterei, gegen die Naziführer inszenierten, dienten dazu, die monströsen Verbrechen der großen Demokratien in Dresden, Hamburg, Hiroshima und Nagasaki zu rechtfertigen. Um die Bombardierungen in Serbien und dem Kosovo zu legitimieren sowie die direkte Komplizenschaft der Großmächte an den Gräueltaten des Krieges in Ex-Jugoslawien zu vertuschen, wird heute Milosevic vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gestellt.
In gleicher Weise versucht die „internationale Gemeinschaft“ den Krieg in Afghanistan als Mission darzustellen, mit der das Land vom Joch der Taliban befreit werde: angebliche Befreiung der Frauen, Wiederherstellung der Handelsfreiheit und der Freizeitvergnügen (Fernsehen, Radio, Sport, ...). Diese Argumente sich besondern lächerlich, wenn sich gleichzeitig die Konflikte zwischen den zahlreichen Fraktionen und Cliquen zuspitzen, welche seit dem Sturz der Taliban die Zügel des Landes in die Hände genommen haben.
Die Behauptungen der Bourgeoisie, im Dienste des Friedens zu stehen, sind nichts als Lügen.
Wie auch immer die Bourgeoisie handelt, sie verschlimmert nur das weltweite Chaos und die kriegerische Barbarei. Dies ist eines der bezeichnendsten Resultate der historischen Niederlage des Kapitalismus, seines Verfaulens auf der Stelle und der drohenden Zerstörung, die der Menschheit dadurch auferlegt wird. Der Kapitalismus als Ganzes ist dafür verantwortlich, dass der Krieg Alltag geworden ist.
Die einzig Kraft, welche der Menschheit eine Zukunft bieten kann, ist die Arbeiterklasse. Trotz aller Hindernisse, die ihr heute im Wege liegen, ist sie die einzige Klasse, die dem Chaos und der kapitalistischen Barbarei ein Ende bereiten und ein neues System im Dienste der Menschheit errichten kann.
Der Kapitalismus versucht seine krassesten Widersprüche und die Auswirkungen der ökonomischen Krise auf die Peripherie abzuschieben. Das Beispiel von Argentinien zeigt, wie umfangreich die Schwierigkeiten der Arbeiterklasse sind, ihr Bewusstsein als Klasse zu finden und sich nicht in interklassistischen Sackgassen zu verlieren. Auch ist die Arbeiterklasse heute auf einer breiten Ebene mit der Falle des Pazifismus konfrontiert, welcher dieselben interklassistischen Illusionen verstreut, vornehmlich im Gewand der „Antiglobalisierer“ auftritt und nichts anderes als eine Mobilisierung hinter die nationalen Interessen der Bourgeoisie darstellt. Das Proletariat steht angesichts der Angriffe der herrschenden Klasse vor der wichtigen Aufgabe, in seinen Kämpfen ein Bewusstsein über die historischen Ereignisse und die für die Menschheit tödliche Gefahr des Chaos und der kriegerischen Barbarei zu entwickeln. Dies wird seine Entschlossenheit vorwärts zu schreiten und seine Klassenkämpfe zu vereinigen, stärken: „Das kommende Jahrhundert wird entscheidend sein für die Geschichte der Menschheit. Wenn der Kapitalismus seine Herrschaft über den Planeten weiterführen kann, wird die Gesellschaft noch vor dem Jahr 2100 in der totalen Barbarei versinken. Eine Barbarei, neben der diejenige des 20. Jahrhunderts nur wie ein kleiner Kopfschmerz erscheint, eine Barbarei die uns ins Steinzeitalter zurückwirft oder gar zerstört. Wenn es für die Menschheit eine Zukunft gibt, so liegt sie alleine in den Händen des Weltproletariates. Nur die Revolution kann die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise aufheben, welche aufgrund ihrer historischen Krise verantwortlich ist für die gegenwärtige Barbarei.“[i] [84] GF 7.4.02
[i] [85] aus International Review Nr. 104, engl./franz./span. Ausgabe, „Der Beginn des 21. Jahrhunderts... Weshalb hat das Proletariat den Kapitalismus noch nicht überwunden?“
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [78]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Pearl Harbor 1941, Twin Towers 2001
- 4698 Aufrufe
Der Machiavellismus der herrschenden Klasse
Vom ersten Augenblick an hat die Propaganda der amerikanischen Bourgeoisie den schrecklichen terroristischen Angriff gegen das World Trade Center in New York am 11.September mit dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor am 7.Dezember 1941 verglichen. Dieser Vergleich hat ein beträchtliches psychologisches, historisches und politisches Gewicht, denn Pearl Harbor markierte den direkten Eintritt des amerikanischen Imperialismus in den Zweiten Weltkrieg. Geht es nach der gegenwärtigen ideologischen Kampagne, die von der amerikanischen Bourgeoisie, insbesondere von ihren Massenmedien, präsentiert wird, sind die Parallelen einfach, offen und selbstverständlich.
1) In beiden Fällen seien die überrumpelten USA Opfer eines hinterhältigen Überraschungsangriffs gewesen. Im ersten Fall täuschte der japanische Imperialismus heimtückischerweise Verhandlungen mit Washington zur Vermeidung eines Krieges vor, um ohne jegliche Vorwarnung einen Angriff auszuhecken und zu verüben. Im aktuellen Fall seien die USA das Opfer fanatischer, islamistischer Fundamentalisten, die von der Offenheit und Freiheit der amerikanischen Gesellschaft profitierten, um eine Gräueltat von bisher nie gekannten Ausmaßes zu begehen, und deren Schlechtigkeit sie außerhalb der Grenzen einer zivilisierten Gesellschaft stelle.
2) In beiden Fällen waren die von dem Überraschungsangriff verursachten Verluste groß und provozierten Ausschreitungen in der Bevölkerung. Pearl Harbor erforderte 2.043 Todesopfer, zumeist amerikanisches Militärpersonal. In den Twin Towers war der Blutzoll noch höher: nahezu 3.000 unschuldige Zivilisten verloren ihr Leben.
3) In beiden Fällen schlugen die Angriffe auf ihre Täter zurück. Weit entfernt davon, die amerikanische Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen oder sie in den Defätismus und die passive Unterwerfung zu treiben, versetzten Pearl Harbor und die Twin Towers die Bevölkerung, einschließlich des Proletariats, in den größten nationalen Taumel und erlaubten somit die Mobilisierung der Bevölkerung hinter dem Staat und für einen sich lang hinziehenden imperialistischen Krieg.
4) Letztendlich behalte das Gute des demokratischen, amerikanischen Way of Life und seine Militärmacht die Oberhand über das Böse.
Wie alle ideologischen Mythen der Bourgeoisie ist dieses Märchen der beiden, 60 Jahre auseinander liegenden Tragödien, welche Teilwahrheiten auch immer ihm oberflächliche Glaubwürdigkeit verleihen, mit Halbwahrheiten, Lügen und zweckdienlichen Verzerrungen gespickt. Aber dies ist keine Überraschung. Die Politik der bürgerlichen Klasse fußt auf Lügen, Täuschung, Manipulationen und Manövern. Dies trifft besonders zu, wenn es um die schwierige Aufgabe geht, die Gesellschaft für den totalen Krieg moderner Zeiten zu mobilisieren. Die wesentlichen Elemente der ideologischen Kampagne der Bourgeoisie stehen in völligem Gegensatz sowohl zur historischen als auch zur aktuellen Wirklichkeit. Es gibt offenkundige Anzeichen dafür, dass die Bourgeoisie in keinen der beiden Fälle überrascht worden war, dass sie die massiven Todesraten in beiden Fällen für den Zweck politischer Ziele, für die Verwirklichung ihrer imperialistischen Kriegsziele und anderer weitreichender politischer Ziele, willkommen geheißen hat.
Die verschiedenen Merkmale des Krieges in der Aufstiegs- und Dekadenzperiode
Da sowohl Pearl Harbor als auch das World Trade Center von der Bourgeoisie dazu benutzt wurden, die US-Bevölkerung auf den Krieg einzustimmen, ist es notwendig, kurz die politischen Aufgaben zu untersuchen, die sich der Bourgeoisie bei der Vorbereitung eines imperialistischen Krieges im Zeitalter der kapitalistischen Dekadenz stellten. In der Dekadenz hat der Krieg im Vergleich zum Krieg in jener Periode, als der Kapitalismus noch ein aufstrebendes, historisch fortschrittliches System gewesen war, unterschiedliche Merkmale angenommen. In der Aufstiegsperiode konnte der Krieg eine fortschrittliche Rolle annehmen in dem Sinne, dass er die Weiterentwicklung der Produktivkräfte ermöglicht hatte. In diesem Sinne können der amerikanische Bürgerkrieg, der der Zerstörung des anachronistischen Sklavensystems in den Südstaaten gedient und die Industrialisierung der USA in vollem Umfang ausgelöst hatte, und die verschiedenen nationalen Kriege in Europa, die in der Schaffung moderner, vereinigter Nationalstaaten in jedem Land mündeten, die ihrerseits den optimalen Rahmen für die Entfaltung des nationalen Kapitals schufen, als historisch fortschrittlich betrachtet werden. Im Allgemeinen beschränkten sich diese Kriege größtenteils auf das im Konflikt verwickelte Militärpersonal und hatten keine massenhafte Zerstörung der Produktionsmittel, der Infrastrukturen, der Bevölkerungen der einzelnen Krieg führenden Mächte zur Folge.
Der imperialistische Krieg in der kapitalistischen Dekadenz zeichnet sich durch völlig andere Züge aus. Während Nationalkriege in der Aufstiegsperiode die Basis für ein qualitatives Voranschreiten bei der Entwicklung der Produktivkräfte schufen, hat in der Dekadenz das kapitalistische System den Zenit seiner historischen Entwicklung längst überschritten, womit dieser fortschrittliche Gesichtspunkt verschwunden ist. Der Kapitalismus hat die Ausweitung des Weltmarkts beendet, d.h. sämtliche außerkapitalistischen Märkte, die die Ausdehnung des globalen Kapitalismus gefördert hatten, sind in das kapitalistische System integriert worden. Für die vielen nationalen Kapitalien gibt es nur eine Möglichkeit der weiteren Ausdehnung, und die geht auf Kosten ihrer Rivalen – indem sie von Territorien oder Märkten Besitz ergreifen, die von ihren Gegnern kontrolliert werden. Die Verstärkung der imperialistischen Rivalitäten führt zur Entwicklung von imperialistischen Bündnissen, die die Bühne des allgemeinen imperialistischen Krieges bereiten. Weit entfernt davon, sich auf eine Auseinandersetzung zwischen Berufsarmeen zu beschränken, erfordert der Krieg in der Dekadenz die totale Mobilisierung der Gesellschaft, was umgekehrt eine neue Form des Staates zum Aufstieg verhilft, den Staatskapitalismus. Dessen Funktion ist es, die totale Kontrolle über die Gesellschaft bis in ihren letzten Winkel auszuüben, um die Klassenkonfrontationen zu zügeln, die die Gesellschaft zum Zerbersten zu bringen drohen, und um gleichzeitig die Mobilisierung der Gesellschaft für einen modernen, totalen Krieg zu koordinieren.
Gleichgültig, wie erfolgreich sie dabei war, die Bevölkerung ideologisch auf den Krieg vorzubereiten – die Bourgeoisie der Dekadenz bemäntelt ihre imperialistischen Kriege stets mit dem Mythos des Opferseins und der Selbstverteidigung gegen Aggression und Tyrannei. Die Realität der modernen Kriegführung, mit ihrer massiven Zerstörung und ihren enormen Opferzahlen, mit all den Facetten der Barbarei, die auf die Menschheit losgelassen wird – all dies ist so entsetzlich, so grauenhaft, dass selbst ein ideologisch geschlagenes Proletariat nicht leichtherzig in das Gemetzel zieht. Die Bourgeoisie ist daher wesentlich auf die Manipulation der Realität angewiesen, um die Illusion zu erzeugen, dass sie Opfer einer Aggression sei, das keine andere Wahl habe, als zu seiner Selbstverteidigung zurückzuschlagen. So wird zur Rechtfertigung des Konflikts die Notwendigkeit, das Vater- oder Mutterland gegen etwaige Aggressoren oder ausländische Tyrannen zu verteidigen, herangezogen, und nicht etwa die wahren imperialistischen Motive, die den Kapitalismus zum Krieg bringen. Denn der Versuch, die Bevölkerung hinter der Parole „Auf zur Unterdrückung der Welt unter unserer Fuchtel und unter allen Umständen“ zu mobilisieren, ist zum Scheitern verurteilt. Die staatliche Kontrolle über die Massenmedien erleichtert mit all ihren Abarten der Propaganda und Lügen die Gehirnwäsche der Bevölkerung.
Die amerikanische Bourgeoisie ist in ihrer ganzen Geschichte, auch vor dem Beginn der kapitalistischen Dekadenz im frühen 20.Jahrhundert, stets ein Experte im Opfersein gewesen. So lautete zum Beispiel im Krieg gegen Mexiko 1845-48 die Parole „Erinnert euch an Alamo“. Dieser Schlachtruf verewigte das ‚Massaker‘ an 136 amerikanischen Rebellen 1836 in San Antonio, Texas, damals Teil Mexikos, durch die von General Santa Ana geführten Streitkräfte. Natürlich hinderte die Tatsache, dass die „blutrünstigen“ Mexikaner wiederholt ihr Entgegenkommen bei der Aufgabe anboten und Frauen und Kindern vor der letzten Schlacht die Evakuierung aus Fort Alamo gestatteten, die herrschende Klasse der USA nicht daran, die Verteidiger Alamos in den Heiligenschein des Märtyrertums zu rücken. Denn der Zwischenfall war gut geeignet, Unterstützung für einen Krieg zu mobilisieren, der in der US-amerikanischen Annexion eines Teils dessen, was heute den Südwesten der USA bildet, seinen Höhepunkt fand.
Ähnlich diente auch die mysteriöse Explosion an Bord des US-Schlachtschiffes Maine 1898 in Havanna als Voraussetzung für den spanisch-amerikanischen Krieg 1989 und rief die Parole „Erinnert euch an Maine“ ins Leben. In jüngerer Zeit (1964) wurde der angebliche Angriff auf zwei US-Kanonenboote außerhalb vietnamesischer Küstengewässer als Grundlage für die Golf von Tonking-Resolution benutzt, die vom amerikanischen Kongress im Sommer 1964 verabschiedet wurde und die, wenngleich sie keine formelle Kriegserklärung war, den legalen Rahmen für die amerikanische Intervention in Vietnam schuf. Ungeachtet der Tatsache, dass die Johnson-Administration binnen Stunden erfuhr, dass die berichteten „Angriffe“ auf die Maddox und die Turner Joy sich nie ereignet hatten, sondern die Folge eines Irrtums nervöser junger Radaroffiziere gewesen waren, wurde das Kriegsermächtigungsverfahren durch den Kongress gepeitscht, um einen legalen Anlass für einen Krieg zu schaffen, der sich bis zum Fall Saigons 1975 an die stalinistischen Streitkräfte hinziehen sollte.
Es ist offensichtlich, dass die Bourgeoisie den Angriff auf Pearl Harbor benutzte, um eine widerstrebende Bevölkerung hinter die Kriegsbemühungen zu sammeln, genauso wie die Bourgeoisie heute die Gräueltat des 11.Septembers dazu benutzt, Unterstützung für ein neues kriegerisches Unternehmen zu mobilisieren. Doch die Frage bleibt, ob die USA in jeder Beziehung „überrascht“ worden ist und inwieweit der Machiavellismus der US-Bourgeoisie, ob durch Provozierung oder durch ihre eigene Erlaubnis, in diese Angriffe verwickelt war, um einen politischen Nutzen aus dem daraus folgenden öffentlichen Zorn zu ziehen.
Der Machiavellismus der Bourgeoisie
Allzu oft, wenn die IKS den Machiavellismus der Bourgeoisie enthüllt, beschuldigen unsere Kritiker uns, in eine verschwörerische Sichtweise der Geschichte abzugleiten. Jedoch ist ihr Unverständnis in diesem Zusammenhang nicht einfach ein Missverständnis unserer Analyse, sondern schlimmer noch: Sie fallen dem ideologischen Gewäsch der bürgerlichen Apologeten in den Medien und Akademien zum Opfer, deren Job es ist, diejenigen, die versuchen, die Strickmuster und Prozesse innerhalb des politischen, ökonomischen und sozialen Lebens der Bourgeoisie zu ermitteln, als irrationale Verschwörungstheoretiker zu verunglimpfen. Doch ist es nicht einmal kontrovers zu behaupten, dass „Lügen, Terror, Zwang, Doppelspiel, Korruption, Komplotte und politische Attentate“ zum Rüstzeug der ausbeuterischen, herrschenden Klassen in der gesamten Geschichte gehören, ob im Altertum, im Feudalismus oder im modernen Kapitalismus. „Der Unterschied liegt darin, dass Patrizier und Aristokraten ‚Machiavellismus praktizierten, ohne es zu wissen‘, während die Bourgeoisie machiavellistisch ist und es auch weiß. Sie verwandelt den Machiavellismus in eine ‚ewige Wahrheit‘, weil dies ihre Art zu leben ist: Sie hält die Ausbeutung für immerwährend.“ („Warum die Bourgeoisie machiavellistisch ist“, International Review, Nr.31, S.10, 1982) In diesem Sinne ist das Lügen und die Manipulation - ein Mechanismus, der von allen vorhergehenden ausbeutenden Klassen bedient worden war - zum zentralen Merkmal der politischen Funktionsweise der Bourgeoisie geworden, die, indem sie unter den Bedingungen des Staatskapitalismus die gewaltigsten, ihr zur Verfügung stehenden Werkzeuge zur gesellschaftlichen Kontrolle verwenden kann, den Machiavellismus auf eine qualitativ höhere Stufe hebt.
Das Auftreten des Staatskapitalismus in der Epoche der kapitalistischen Dekadenz - einer Staatsform, die die Macht in den Händen der Exekutive, besonders in jenen der permanenten Bürokratie, konzentriert und die dem Staat eine wachsende totalitäre Kontrolle aller Aspekte des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens ermöglicht - hat der Bourgeoisie noch wirkungsvollere Mechanismen zur Durchführung ihrer machiavellistischen Schemata verschafft. „Bei der Organisierung ihres eigenen Überlebens, ihrer Selbstverteidigung hat die Bourgeoisie eine immense Fähigkeit an den Tag gelegt, Techniken zur ökonomischen und sozialen Kontrolle zu entwickeln, die weit außerhalb der Vorstellungskraft der Herrscher im 19.Jahrhundert lag. In diesem Sinne ist die Bourgeoisie im Umgang mit der historischen Krise ihres sozio-ökonomischen Systems ‚intelligent‘ geworden.“ („Bemerkungen über das Bewusstsein der dekadenten Bourgeoisie“, International Review, Nr.31, S.14, IV.Quartal 1982) Die Entwicklung der Massenmedien, die vollständig der staatlichen Kontrolle unterworfen sind, ob in Form formaler, juristischer Mittel oder etwas flexiblerer, informeller Methoden, ist ein zentrales Element im machiavellistischen Ränkeschmieden der Bourgeoisie. „Die Propaganda – also die Lüge – ist eine wichtige Waffe der Bourgeoisie. Und die Bourgeoisie ist sehr gewitzt dabei, Ereignisse zu provozieren, die diese Propaganda füttern, wenn es notwendig sein sollte.“ („Warum die Bourgeoisie machiavellistisch ist“, S.11) Die amerikanische Geschichte ist vollgestopft mit einer Unzahl von Beispielen, die von verhältnismäßig prosaischen, alltäglichen Benebelungen bis hin zu historisch bedeutsamerer Manipulationen reichen. Als ein Beispiel für erstgenannten Typus mag ein Vorfall aus dem Jahre 1955 gelten, als der Pressesprecher des Präsidenten, James Haggerty, ein Scheintreffen inszenierte, um die Arbeitsunfähigkeit von Präsident Eisenhower zu verbergen, der nach einer Herzattacke in einem Krankenhaus in Denver, Colorado, lag. Haggerty traf Vorkehrungen für eine 2000 Meilen lange Reise des gesamten Kabinetts von Washington nach Denver, um die Illusion zu nähren, dass es dem Präsidenten gut genug ginge, um eine Kabinettssitzung zu leiten, obwohl solch ein Treffen nie stattfand. Ein Beispiel für letztgenannten Typus ist die Manipulierung Saddam Husseins im Jahre 1990, als die amerikanische Botschafterin im Irak Saddam mitteilte, dass die USA nicht in den Grenzstreitigkeiten zwischen dem Irak und Kuwait eingreifen würden, und sie ihm weismachte, dass er vom US-Imperialismus grünes Licht für eine Invasion Kuwaits erhalten habe. Stattdessen wurde die Invasion von den USA als Vorwand für den Krieg von 1991 am Persischen Golf benutzt, als ein Mittel, um ihren Status als einzig verbliebene Supermacht nach dem stalinistischen Zusammenbruch und der darauffolgenden Auflösung des westlichen Blocks geltend zu machen.
Dies soll nicht heißen, dass alle Ereignisse in der heutigen Gesellschaft notwendigerweise von den geheimen Entscheidungen eines kleinen Kreises kapitalistischer Führer im Voraus bestimmt werden. Natürlich sind die auftretenden fraktionellen Streitigkeiten innerhalb der führenden Kreise der kapitalistischen Staaten und die Folgen solcher Streitigkeiten keine a priori gefassten Schlussfolgerungen. Genauso wenig sind die Folgen der Konfrontationen mit dem Proletariat in der Hitze des Klassenkampfes stets unter der Kontrolle der Bourgeoisie. Und trotz all der Pläne und Manipulationen können sich auch historische Unfälle ereignen. Doch es geht darum zu begreifen, dass, selbst wenn die Bourgeoisie als ausbeutende Klasse unfähig ist zu einem kompletten, kohärenten Bewusstsein und zu einem akkuraten Verständnis der Funktionsweise ihres Systems und der historischen Sackgasse, die sie der Menschheit anbietet, sie sich dennoch über die sich vertiefende gesellschaftliche und ökonomische Krise im Klaren ist. „Für die Spitzen der Staatsmaschinerie, die das Zepter in der Hand halten, ist es durchaus möglich, zu einer Art Gesamtbild der Lage und der Optionen zu gelangen, die ihnen realistischerweise offenstehen, um ihr zu begegnen.“ („Bemerkungen über das Bewusstsein...“, S.14) Selbst mit einem lückenhaften Bewusstsein ist die Bourgeoisie mehr als fähig, Strategien und Taktiken zu entwickeln sowie die totalitären Mechanismen des Staatskapitalismus zu nutzen, um Erstere einzusetzen. Es liegt in der Verantwortung revolutionärer Marxisten, das machiavellistische Manövrieren und Lügen zu entlarven. Die Augen vor diesem Aspekt der Offensive der herrschenden Klasse bei der Kontrolle der Gesellschaft zu verschließen ist unverantwortlich und spielt in die Hände unserer Klassenfeinde.
Der Machiavellismus der herrschenden Klasse Amerikas in Pearl Harbor
Pearl Harbor stellt ein exzellentes Beispiel für das Treiben des bürgerlichen Machiavellismus dar. Wir nutznießen dabei von mehr als einem halben Jahrhundert historischer Untersuchungen und einer Reihe von Nachforschungen durch das Militär und oppositionelle Parteien. Gemäß der offiziellen Version der Realität war der 7.Dezember 1941 „ein Tag der Niedertracht“, wie Präsident Roosevelt ihn bezeichnete. Er wurde als Mittel zur Mobilisierung der öffentlichen Meinung für den Krieg benutzt. Und er wird immer noch auf diese Weise von den kapitalistischen Medien, den Schulbüchern und in der Popkultur dargestellt, trotz beträchtlicher historischer Beweise dafür, dass der japanische Angriff bewusst von der amerikanischen Politik provoziert worden war. Der Angriff kam nicht aus heiterem Himmel über die amerikanische Regierung, ja, es war eine bewusste politische Entscheidung auf höchster Ebene, das Zustandekommen dieses Angriffs zu erlauben und den massiven Verlust an Menschenleben und Marineinventar hinzunehmen, um einen Vorwand zu haben, Amerikas Eintritt in den Zweiten Weltkrieg sicherzustellen. Eine Anzahl von Büchern und enormes Material im Internet ist über diese Geschichte veröffentlicht worden (1). Wir wollen hier einen Überblick über einige Highlights geben, um die operativen Aspekte des Machiavellismus zu veranschaulichen.
Die Ereignisse von Pearl Harbor fanden statt, als die USA immer mehr auf eine Intervention in den II.Weltkrieg auf Seiten der Alliierten zustrebten. Die Roosevelt-Administration war ganz erpicht darauf, in den Krieg gegen Deutschland zu treten, doch trotz der Tatsache, dass die amerikanische Arbeiterklasse fest im Griff des Gewerkschaftsapparates (in dem die stalinistische Partei eine wichtige Rolle spielte) war, der unter Staatsautorität gestellt wurde, um in allen Schlüsselindustrien den Klassenkampf in Schranken zu halten, und dass sie von der Ideologie des Antifaschismus durchdrungen war, sah sich die amerikanische Bourgeoisie immer noch einer starken Anti-Kriegs-Opposition innerhalb der Bevölkerung gegenüber, einschließlich nicht nur der Arbeiterklasse, sondern auch großer Teile der Bourgeoisie selbst. Meinungsumfragen ermittelten, dass 60 Prozent der Befragten vor Pearl Harbor gegen den Kriegseintritt waren. Und die „America First“-Kampagne sowie andere isolationistische Gruppen erhielten beträchtliche Unterstützung innerhalb der Bourgeoisie. Entgegen ihrer demagogischen demokratischen Gelöbnisse, Amerika aus dem Krieg in Europa rauszuhalten, suchte die Roosevelt-Administration heimlich nach einem Vorwand, um in den Kampf zu treten. Die USA verletzten in steigendem Maße ihre eigene, selbsterklärte Neutralität, indem sie den Alliierten Hilfe anboten und riesige Mengen Rüstungsmaterial im Rahmen des Leih-und-Pacht-Programms verschifften. Die Administration hoffte so, die Deutschen dazu zu provozieren, einen Angriff gegen die amerikanischen Streitkräfte im Nordatlantik zu führen, was als Vorwand für Amerikas Kriegseintritt hätte dienen können. Als der deutsche Imperialismus nicht auf den Köder hineinfiel, rückte Japan in den Mittelpunkt des Interesses. Die Entscheidung, ein Ölembargo gegen Japan zu verhängen, und die Verlegung der Pazifikflotte von der Westküste der USA an einer etwas vorgeschobeneren Position in Hawaii diente dazu, Japan ein Motiv und eine Gelegenheit zu verschaffen, den ersten Schuss gegen die USA abzufeuern und so den Vorwand für eine direkte Intervention in den imperialistischen Krieg zu schaffen. Im März 1941 sagte ein Geheimbericht des Marineministeriums voraus, dass, falls Japan sich dazu entschließe, die USA anzugreifen, es zu einem frühmogendlichen Überfall durch Kampfflugzeuge gegen Pearl Harbor kommen werde. Im Juni 1941 skizzierte der Präsidentenberater Harold Ickes dem Präsidenten in einem Memorandum, dass, wenn Deutschland zunächst Russland angreift, „sich aus dem Ölembargo gegen Japan eine Lage entwickeln könnte, die es nicht nur möglich, sondern auch leichter macht, wirksam in diesen Krieg zu gelangen.“ Im Oktober schrieb Ickes: „Seit langem war ich davon überzeugt, dass unser bester Eintritt in den Krieg die Japan-Schiene ist.“ Kriegssekretär Stimson notierte über den Diskussionsstand mit dem Präsidenten in seinem Tagebuch Folgendes: „Die Frage war, wie wir sie in eine Position manövrieren können, wo sie ohne größere Gefahr für uns den ersten Schuss abgeben. Trotz der Risiken, die zweifellos vorhanden sind, wenn wir die Japaner den ersten Schuss abgeben lassen, machten wir uns klar, dass, um die volle Unterstützung des amerikanischen Volkes zu haben, es wünschenswert war, sicher zu stellen, dass die Japaner dies auch tun, so dass kein Zweifel darüber aufkommt, wer der Aggressor war.“
Der Bericht des Pearl Harbor-Ausschusses der Armee (20.Oktober 1944) behandelte ausführlich diese bewusste, machiavellistische Entscheidung, Menschenleben und Ausrüstung in Pearl Harbor zu opfern, und schlussfolgerte, dass während „der verhängnisvollen Zeitspanne zwischen dem 27.November und dem 6.Dezember 1941... zahlreiche Informationen in die Hände der Spitzen des Staates, der Kriegs- und Marineressorts gelangten, die präzise die Absichten der Japaner anzeigten, einschließlich des exakten Zeitpunkts und Datums des Angriffs.“ (Armeeausschussbericht, Pearl Harbor, Teil 39, 221-230 pp.)
- US-Geheimdienstquellen erfuhren am 24.November, dass „offensive Militäroperationen der Japaner“ in Gang gesetzt worden waren.
- Am 26.November erhielten die US-Geheimdienste „definitiven Beweis für die japanischen Absichten, einen offensiven Krieg gegen Großbritannien und die Vereinigten Staaten zu führen.“
- Auch wurde am 26.November von „einer Konzentration von Einheiten der japanischen Flotte in einem unbekannten Hafen, bereit für offensive Aktionen,“ berichtet.
- Am 1.Dezember kamen „von drei unabhängigen Quellen (...) definitive Informationen, dass Japan dabei ist, Großbritannien und die Vereinigten Staaten anzugreifen, und dafür mit Russland Frieden halte“.
- Am 3.Dezember wurde „mit der Nachricht, dass die Japaner ihre Codes löschten und die Kodiermaschinen zerstörten, endgültig Aufschluss über die kriegerischen Angriffsabsichten Japans gegeben. Dies wurde gedeutet... als Anzeichen für einen unmittelbar bevorstehenden Krieg.“
Diese Geheimdienstinformationen wurden an hochrangige Beamte im Kriegsressort und State Department weitergegeben und dem Weißen Haus mitgeteilt, wo Roosevelt persönlich zweimal täglich Briefings über abgefangene japanische Funksprüche erhielt. Trotz des verzweifelten Drängens von Geheimdienstbeamten, eine „Kriegswarnung“ an die militärischen Befehlshaber auf Hawaii zu schicken, um sich auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff vorzubereiten, entschieden sich die zivilen und militärischen Spitzen gegen ein solches Vorgehen und schickten ihnen stattdessen das zu, was die Behörden eine „harmlose“ Nachricht nannten. Diese Beweise für das Vorab-Wissen vom japanischen Angriff ist von zahlreichen Quellen bestätigt worden, einschließlich journalistischer Berichte und den Memoiren von Beteiligten. Zum Beispiel beinhaltete ein Bericht der United Press, der am 8.Dezember in der New York Times veröffentlicht wurde, folgenden Untertitel: „Angriff wurde erwartet: Es ist jetzt möglich zu enthüllen, dass die Streitkräfte der Vereinigten Staaten eine Woche zuvor erfahren hatten, dass ein Angriff bevorstand, und dass sie nicht unvorbereitet überrascht wurden“ (New York Times, 8.Dezember 1941, S.13). In einem Interview offenbarte die First Lady, Eleanor Roosevelt, 1941, dass „der 7.Dezember (...) überhaupt nicht der Schock war, als der er sich für das Land im Allgemeinen erwies. Wir hatten etwas in dieser Art schon seit langem erwartet“ (New York Times Magazine, 8.Oktober 1944, S.41). Am 20.Juni 1944 teilte der britische Kabinettsminister Sir Oliver Lyttelton der amerikanischen Handelskammer mit, „Japan wurde zum Angriff gegen die Amerikaner auf Pearl Harbor provoziert. Es spricht der Geschichte Hohn, wenn man sagt, dass die Amerikaner in den Krieg gezwungen wurden. Jeder weiß, wem die amerikanischen Sympathien galten. Es ist unrichtig zu sagen, dass Amerika jemals richtig neutral gewesen war, selbst bevor Amerika mit Kampfmitteln in den Krieg trat“ (Prang, „Pearl Harbor: Verdict of History“, S.39-40). Winston Churchill bestätigte das Doppelspiel der amerikanischen Regierenden beim Angriff gegen Pearl Harbor in folgender Passage seines Buches The Grand Alliance: „1946 veröffentlichte eine erstaunliche Kongressuntersuchung ihre Funde, in denen jedes Detail jener Ereignisse enthüllt wurde, die den Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Japan und auf das Nichterfolgen einer Alarmierung der Flotte und Garnisonen in exponierten Lagen durch das Militärressort einleiteten. In 40 Bänden wurde jedes Detail, einschließlich der Entschlüsselung geheimer japanischer Depeschen und ihrer aktuellen Nachrichten, der Welt enthüllt. Die Stärke der Vereinigten Staaten reichte aus, um im Geiste der amerikanischen Verfassung diese harte Feuerprobe zu bestehen. Ich habe auf diesen Seiten nicht die Absicht, ein Urteil über diese schreckliche Episode in der amerikanischen Geschichte zu fällen. Wir wissen, dass all die großen Amerikaner um den Präsidenten, die sein Vertrauen genossen, genauso scharfsinnig wie ich die furchtbare Gefahr fühlten, dass Japan britische oder holländische Besitzungen im Fernen Osten attackiert und die Vereinigten Staaten wohlweislich unbehelligt lässt und dass infolgedessen der Kongress eine amerikanische Kriegserklärung nicht sanktioniert (...) Der Präsident und seine vertrauten Freunde waren sich schon seit langem über die schwerwiegenden Risiken der Neutralität der Vereinigten Staaten im Krieg gegen Hitler und wofür er stand im Klaren und haben unter den Einschränkungen eines Kongresses gelitten, dessen Repräsentantenhaus einige Monate zuvor mit nur einer Stimme Mehrheit der Notwendigkeit einer Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht zugestimmt hatte, ohne die die Armee sich inmitten weltweiter Erschütterungen nahezu aufgelöst hätte. Roosevelt, Hull, Stimson, Knox, General Marshall, Admiral Stark und, als Verbindungsmann zwischen ihnen, Harry Hopkins waren einer Meinung... Ein japanischer Angriff gegen die Vereinigten Staaten bedeutete eine große Erleichterung ihrer Probleme und ihrer Pflicht. Wie können wir uns darüber wundern, dass sie die tatsächliche Form des Angriffs, ja, sogar sein Ausmaß, als unvergleichlich weniger wichtig betrachteten als die Tatsache, dass die ganze amerikanische Nation wie ein Mann und wie nie zuvor für ihre eigene Sicherheit eintreten würde?“ (Winston Churchill, „The Grand Allianz“, S.603)
Roosevelt mag das Ausmaß und die Verluste, die die Japaner auf Pearl Harbor verursacht hatten, nicht geahnt haben, aber er war offenkundig bereit, Schiffe und Menschenleben zu opfern, um die Bevölkerung zu Wut und Krieg aufzustacheln.
Das Attentat gegen die Twin Towers und der Machiavellismus der Bourgeoisie
Gewiss ist es viel schwieriger, das Ausmass des Machiavellismus der amerikanischen Bourgeoisie im Fall des Attentats gegen das World Trade Center abzuschätzen, das im Augenblick der Abfassung dieses Artikels erst gerade ein wenig mehr als drei Monate zurückliegt. Wir profitieren von keinerlei Ergebnissen von seither geführten Untersuchungen, die allenfalls geheime Beweise enthüllen könnten, dass Elemente der herrschenden Klasse auf welche Art auch immer ihre Finger bei diesem Attentat im Spiel oder zumindest davon Kenntnis oder es sogar provoziert hatten. Wie jedoch die Geschichte der herrschenden Klasse, insbesondere die Ereignisse von Pearl Harbor, aufzeigen, ist eine solche Möglichkeit durchaus vorhanden. Wenn wir die jetzigen Ereignisse einzig auf der Grundlage von Medienberichten überprüfen - die wie zufällig allesamt in der gegenwärtigen politischen und imperialistischen Offensive der Regierung eingespannt sind, und der sie auch ihre volle Unterstützung entbieten - können wir eine solche Vermutung gewiss unterstützen.
Stellen wir uns zuerst einmal die Frage, wer denn auf politischer Ebene von diesem Verbrechen profitiert: Das ist zweifellos die amerikanische Bourgeoisie: Diese Feststellung allein genügt, um einigen Argwohn bezüglich des Attentats auf das World Trade Center zu entwickeln. Die amerikanische Bourgeoisie hat denn auch prompt und ohne das geringste Zögern die Ereignisse vom 11. September zu ihrem eigenen Nutzen verwendet, um ihre Projekte sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene voranzutreiben: Mobilisierung der Bevölkerung hinter dem kriegführenden Staat, Verstärkung des staatlichen Repressionsapparates, Behauptung der amerikanischen Supermacht gegenüber der allgemeinen Tendenz aller gegen alle in der internationalen Arena.
Unmittelbar nach dem Attentat haben der politische Apparat Amerikas und die Medien die Mobilisierung der amerikanischen Bevölkerung für den Krieg begonnen. In einer konzertierten Aktion zielten sie darauf ab, das sog. Vietnam-Syndrom, das seit dreissig Jahren die Kriegführung des amerikanischen Imperialismus beeinträchtigt hatte, zu überwinden. Diese "massenpsychologische Fehlfunktion" beinhaltete in allererster Linie eine Abwehr insbesondere der Arbeiterklasse gegenüber der Mobilisierung hinter dem Staat für einen länger andauernden imperialistischen Krieg und war für ein Grossteil dafür verantwortlich, dass die USA den Konflikt mit dem russischen Imperialismus in den 70er und 80er Jahren mittels zwischengeschalteter Länder in lokalen Kriegen austrugen oder aber eher kurzfristige und begrenzte Interventionen mit Luftschlägen und Raketen bevorzugten als Bodenangriffe. Wir haben diese Methode im Golfkrieg oder im Kosovo mitverfolgen können. Diese Widerspenstigkeit ist sicher keine psychologische Fehlfunktion, sondern widerspiegelt eher die Unfähigkeit der herrschenden Klasse, dem Proletariat eine ideologische und politische Niederlage beizufügen, die gegenwärtige Arbeitergeneration hinter dem Staat für den imperialistischen Krieg zu mobilisieren, wie dies bei der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs der Fall gewesen war. Das Editorial einer Spezialausgabe des Magazins Time, unmittelbar nach dem Attentat herausgegeben, zeigt sehr gut auf, wie die gegenwärtige Kampagne einer Kriegspsychose orchestriert worden ist. Der Titel dieser Nummer lautete: "Tag der Gemeinheit" und verleitete von Beginn weg zum Vergleich mit Pearl Harbor. Ein Artikel von Lance Morrow mit dem Titel "Zorn und Züchtigung" unterstrich die Einzelheiten der folgenden ideologischen Kampagne. Obwohl dieser Artikel in einer Publikation erschien, die an den Propagandaanstrengungen teilnahm, illustriert Morrow, wie die Propagandisten der herrschenden Klasse alle Vorteile begriffen hatten, die sie aus dem Attentat auf das World Trade Center ziehen konnten. Um die Bevölkerung hinsichtlich des Krieges mit der hohen Anzahl von Opfern und den dramatischen Bildern zu manipulieren: "Wir können keinen weiteren Tag der Gemeinheit mehr leben, ohne dass in uns ein Gefühl des Zorns entsteht. Befreien wir unseren Zorn!
Wir benötigen ein Gefühl der Wut, das derjenigen gleicht, die auf Pearl Harbor folgte! Eine Entrüstung ohne Mitleid, die sich nicht nach ein oder zwei Wochen in Luft auflöst...
Es handelte sich um Terrorismus nahe der dramatischen Perfektion. Niemals wird das Schauspiel des Bösen eine Produktion von einem solchen Wert produziert haben. Normalerweise sieht das Publikum nur die rauchenden Ergebnisse: Die von einer Explosion zerstörte Botschaft, Kasernen in Ruinen, das schwarz klaffende Loch im Bug eines Schiffes. Diesmal hat aber bereits das erste in den einen Turm einschlagende Flugzeug die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es hat die Medien in Alarm versetzt, hat die Kameras in Bereitschaft gebracht, um die zweite Explosion des Surrealismus festzuhalten...
Gleichzeitig hat der politische Apparat der Bourgeoisie seinen Plan zur Verstärkung des staatlichen Repressionsapparats entrollt. Eine neue "Sicherheitsgesetzgebung" stellte die gesetzgeberische Praxis wieder her, die in der Folge des Vietnam-Kriegs und des Watergate-Skandals diskreditiert worden war. Ebenso wurde eine ganze Reihe von repressiven Massnahmen vorbereitet, debattiert, angenommen und vom Präsidenten in Rekordzeit unterschrieben. Wir haben guten Grund anzunehmen, dass diese Gesetzgebung bereits langfristig vorbereitet worden war, um zum gegebenen Zeitpunkt nur noch in Kraft gesetzt zu werden. Mehr als 1000 Verdächtige, die lediglich arabische Namen oder Kleider trugen, wurden ohne genaue Anklage für unbestimmte Zeit verhaftet. Die Guthaben von der Sympathie mit Bin Laden verdächtigten Organisationen wurden ohne gerichtliches Prozedere eingefroren. Die Einwanderung wurde insbesondere aus den islamischen Ländern eingeschränkt. Dies geschah mehr als eine Antwort auf die ständige Sorge der Bourgeoisie über den ununterbrochenen Strom von Immigranten, die den schrecklichen Bedingungen des Zerfalls und der Barbarei in ihren unterentwickelten Nationen entfliehen.
Unvermittelt ist der Terrorismus die Entschuldigung für die Verschärfung der Wirtschaftskrise und eine Rechtfertigung für die Einschnitte in den Budgets der Sozialprogramme geworden. Die verfügbaren Guthaben wurden jetzt in den Krieg und in die nationale Sicherheit umgeleitet. Die Geschwindigkeit, mit der all diese Massnahmen präsentiert wurden, zeigt sehr gut, dass sie nicht auf die Schnelle erstellt worden sind, sondern dass sie vorbereitet, diskutiert und geplant worden sind, um für alle Fälle gerüstet zu sein.
Auf internationaler Ebene ist das Ziel des Kriegs gegen den Terrorismus nicht so sehr dessen Zerstörung, sondern die gewaltsame Unterstreichung der imperialistischen Vorherrschaft durch die USA, die die einzige Supermacht in einer internationalen Arena bleiben, die von einer zunehmenden Herausforderung für die US-Hegemonie geprägt ist. Der Zusammenbruch des Ostblocks 1989 führte zu einer schnellen Auflösung des Westblocks, weil das Kohäsionsmittel für dessen Zusammenhalt durch den Zusammenbruch des imperialistischen Blocks der UdSSR verschwunden war. Der amerikanische Imperialismus sah sich trotz des offensichtlichen Sieges im Kalten Krieg nun plötzlich einer neuen globalen Situation gegenüber: Die Grossmächte, die ihre ehemaligen Alliierten waren, und auch eine Anzahl von Ländern geringerer Bedeutung begannen nun, die Vorherrschaft der USA herauszufordern und die eigenen imperialistischen Ambitionen zu verfolgen. Die USA haben im vergangenen Jahrzehnt drei grossangelegte Militäraktionen unternommen, um ihre ehemaligen Verbündeten wieder auf ihre Ränge zu verweisen und ihre Vorherrschaft anzuerkennen: gegen den Irak, gegen Serbien und jetzt gegen Afghanistan und das Al-Kaida-Netz. In jedem dieser drei Fälle zwang die Entfaltung des US-Militärapparates die "Verbündeten", also Frankreich, Grossbritannien und Deutschland, sich in die Allianzen einzureihen, die die USA lenkten, oder aber vollständig das Gesicht zu verlieren und aus dem globalen imperialistischen Spiel rauszukippen.
Zweitens ist es bereits jetzt, da die offiziell autorisierte Version der Realität behauptet, dass die USA auf keinen Fall auf diese Attentate gefasst waren, möglich, einzig auf die bürgerlichen Medien bezugnehmend Beweiselemente für den Machiavellismus der amerikanischen Bourgeoisie zu sammeln:
- Die Kräfte, die anscheinend das Attentat gegen das World Trade Center verübten, standen vielleicht nicht unter der Kontrolle des amerikanischen Imperialismus, jedoch waren sie den amerikanischen Geheimdiensten gewiss bekannt. Tatsächlich rekrutierte die CIA schon zu Beginn des Konflikts zwischen afghanischen Klicken und dem russischen Imperialismus 1979 Tausende von islamischen Fundamentalisten, bildete sie aus, bewaffnete sie und gebrauchte sie, um einen heiligen Krieg - den Dschihad - gegen die Russen zu führen. Das Konzept des Dschihad ruhte in der islamischen Theologie, bis es der amerikanische Imperialismus vor zwanzig Jahren erweckte, um es seinen eigenen Zwecken dienstbar zu machen. Militante Islamisten wurden quer durch die ganze islamische Welt rekrutiert, in Pakistan ebenso wie in Saudi-Arabien. Dort hat man erstmals von Bin Ladin als einem Agenten des amerikanischen Imperialismus gehört. Nach dem Rückzug des russischen Imperialismus aus Afghanistan 1989 und dem Zusammenbruch der Regierung in Kabul 1992 hat sich auch der amerikanische Imperialismus zurück gezogen und sich auf den Nahen Osten und den Balkan konzentriert. Als die islamischen Fundamentalisten gegen die Russen kämpften, bezeichnete sie Ronald Reagan als Freiheitskämpfer. Wenn sie heute mit derselben Brutalität gegen den amerikanischen Imperialismus vorgehen, sind sie für den Präsidenten Bush fanatische Barbaren, die ausgelöscht werden müssen. Ganz wie Timothy Mac Veigh, dem fanatischen rechtsextremen, für das Bombenattentat von Oklahoma City 1995 verantwortlichen Amerikaner, der mit der Ideologie des Kalten Kriegs und im Hass gegen die Russen aufgewachsen und von der amerikanischen Armee rekrutiert worden war, genau so haben die von der CIA für den Dschihad angeworbenen jungen Leute niemals in ihrem Leben etwas anderes gekannt als Hass und Krieg. Beide fühlten sich vom amerikanischen Imperialismus nach dem Ende des Kalten Kriegs verraten und richteten ihre Gewalt fortan gegen ihre ehemaligen Lehrmeister.
- - Seit 1996 verfolgte das FBI die Spur einer möglichen Benutzung von amerikanischen Pilotenschulen durch Terroristen, um Jumbo Jets fliegen zu lernen. Die Vorgehensweise der Terroristen war also von Behörden vorweggenommen worden (The Guardian, "FBI failed fo find suspects named before hijackings", 25.9.2001)
- Die deutsche Polizei überwachte das Appartement in Deutschland, in dem das Attentat geplant und koordiniert worden war, während dreier Jahre.
- Das FBI und andere amerikanische Spionageabwehr-Agenturen hatten Warnungen erhalten und Nachrichten abgefangen, gemäss denen am Jahrestag der Zeremonie im Weissen Haus zwischen Clinton, Rabin und Arafat ein Terrorattentat vorgesehen war. Die israelischen und französischen Geheimdienste hatten die Amerikaner gewarnt. Die Amerikaner hatten also gewiss eine Vorstellung über das Bevorstehende. Vielleicht wusste man nicht, dass das World Trade Center das Ziel sein würde, jedoch war es ja bereits 1993 von islamistischen Terroristen als Symbol des amerikanischen Kapitalismus ins Visier genommen worden.
- Das FBI hat im August Zacarias Moussaoui verhaftet, der Verdacht erweckt hatte, weil er in einer Pilotenschule in Minnesota eine Ausbildung beginnen wollte und erklärt hatte, dass er weder am Starten noch am Landen interessiert sei. Anfangs September hatten die französischen Behörden gewarnt, dass Verbindungen zwischen Moussaoui und den Terroristen bestünden. Im November änderte das FBI plötzlich seine Meinung und dementierte eine Verstrickung Moussaouis im Attentat. Auf jeden Fall hat die Tatsache, dass sich die Piloten weder für den Start noch für die Landung interessiert hatten, die Verdachtsmomente erneuert.
- Mohammed Atta, der vermutete Organisator vom 11. September und vermutliche Pilot des ersten in die Zwillingstürme donnernden Flugzeugs, war bei den Behörden wohl bekannt. Er schien aber ein ruhiges Leben geführt zu haben und durfte sich auch frei in den USA bewegen. Obwohl er seit Jahren auf der Liste der durch den Staat zu überwachenden Terroristen figurierte, da der Verstrickung in ein Bombenattentat gegen einen Bus in Israel im Jahr 1986 verdächtigt, war ihm in den letzten zwei Jahren mehrmals die Erlaubnis zur Ein- und Ausreise aus bzw. in Amerika erteilt worden. Von Januar bis Mai 2001 ist er von den Einwanderungsbehörden auf dem internationalen Flughafen in Miami während 57 Minuten festgehalten worden, weil sein Visum abgelaufen und für eine Einreise in die USA nicht mehr gültig gewesen war. Und obwohl er auf der Überwachungsliste der Behörden stand und trotz des Verdachts des FBI, dass Terroristen in den USA Flugschulen besuchen könnten, war es für ihn möglich, in die USA einzureisen und sich in einer Flugschule einzuschreiben. Im April 2001 wurde Atta wegen Fahrens ohne Führerschein angehalten. Da er im Mai nicht vor dem Gericht erschien, ist ein Haftbefehl ausgestellt worden, aber er ist nie ausgeführt worden. Er ist zweimal wegen Fahrens in angetrunkenem Zustand angehalten worden. Atta ist während seines Aufenthalts in den USA niemals unter einem Pseudonym aufgetreten, er reiste, lebte und studierte das Pilotieren unter seinem wirklichen Namen. War das FBI wirklich so inkompetent oder fehlten ihm das nötige Personal oder die Arabischübersetzer, wie es behauptete, oder gibt es eine mehr machiavellistische Erklärung für dieses Verhalten in die Richtung einer konstanten und ständigen Bewahrung seiner Freiheit? Wurde er "Beschützt" oder diente er als Sündenbock ("Terroristen unter uns", Atlanta Journal Constitution, 16.9.2001; The Guardian, 25.9.2001)
- Am 23. August 2001 liess die CIA eine Liste mit 100 vermutlichen Mitgliedern des Neztes um Bin Ladin auftauchen, unter ihnen auch Khalid Al Midhar und Nawaq Alhamzi, die sich an Bord desjenigen Flugzeuges befanden, das auf das Pentagon stürzte.
Bereits drei Jahre vor den angeblich unerwarteten Attentaten vom 11. September haben die Vereinigten Staaten im Geheimen begonnen, den Boden für einen Krieg in Afghanistan zu ebnen. In der Folge der Attentate auf die amerikanischen Botschaften in Dar-es-Salaam in Tansania und in Nairobi in Kenia 1998 hatte Präsident Clinton die CIA beauftragt, mögliche Aktionen gegen Bin Ladin, der jeglicher Kontrolle entglitten war, vorzubereiten. Deswegen waren auch geheime Verhandlungen mit den ehemaligen Sowjetrepubliken Usbekistan und Tadschikistan aufgegleist worden, um dort Militärbasen zu errichten, logistischen Nachschub zu liefern und Informationen zu sammeln. All das hat nicht nur eine militärische Intervention in Afghanistan vorbereitet, sondern erlaubte auch ein beträchtliches Eindringen der USA in die russische Einflusszone in Zentralasien. Deshalb kann man auch sagen, dass die Vereinigten Staaten trotz aller Gegenbeteuerungen nach der durch das Attentat gegen die Twin Towers sich bietende Gelegenheit für eine unverzügliche Intervention bereit waren, eine gewisse Anzahl von strategischen und taktischen Massnahmen umzusetzen, die bereits von langer Hand vorbereitet worden waren.
Es ist durch aus plausibel, dass die USA Bin Ladin quasi dazu gedrängt haben, eine Attacke gegen sie zu lancieren. The Guardian vom 22. September verleitet uns zu dieser Annahme: "Eine Untersuchung unserer Zeitung hat festgestellt, dass Bin Ladin und die Taliban zwei Monate vor den Terrorattentaten gegen New York und Washington Drohungen über eine mögliche militärische Attacke der USA erhalten hatten. Pakistan warnte das Regime in Afghanistan vor dieser Kriegsgefahr, falls sie Bin Ladin nicht ausliefern würden (...) Die Taliban verweigerten eine Unterwerfung, jedoch besteht auf Grund des Ausmasses der Warnungen die Möglichkeit, dass die Attentate Bin Ladins gegen das World Trade Center in New York und gegen das Pentagon in Washington tatsächlich eine präventive Attacke als Antwort auf die angeblichen Drohungen der USA gedacht waren und keinesfalls aus dem Nichts heraus stattfanden. Die Warnungen an die Taliban stammten von einer viertägigen Versammlung von Amerikanern, Russen, Iranern und Pakistani in einem Hotel in Berlin Mitte Juli. Diese Konferenz war die dritte in einer Serie unter dem Titel 'Brainstorming über Afghanistan' und gehört zu einer klassischen diplomatischen Methode unter dem Namen 'Schiene Nr. 2'." Mit anderen Worten ist es durchaus möglich, dass die USA die durch Bin Ladin begangenen Attentate nicht wirklich zu verhindern suchten, sondern sie über diesen halboffiziellen 'diplomatischen Kanal' sogar zu provozieren versuchte, um somit eine Legitimation für die militärische Antwort in die Hände zu bekommen.
- Die gewaltigen Zerstörungen und die Anzahl der Opfer bildeten den Dreh- und Angelpunkt der unmittelbar auf das Desaster folgenden ideologischen Kampagne. Während Wochen haben uns die amerikanische Regierung und die Medien immer wieder eingehämmert, dass die 6000 im World Trade Center umgekommenen Menschen doppelt so viele waren wie in Pearl Harbor. Der Chef des Generalstabs hat diese Zahlen anfangs November in einem Interview mit einer nationalen Fernsehkette wiederholt (NBC am 4.11.2001). Jedoch bestehen berechtigte Zweifel, dass diese wegen ihres emotionalen Gewichts die Propaganda unterstützenden Zahlen masslos übertrieben sind. Zählungen von unabhängigen Presseagenturen haben die Zahl von weniger als 3000 Toten ergeben, was auch den Opfern von Pearl Harbor entspricht. Die New York Times fixiert die Opferzahl bei 2943, die Agentur Associated Press bei 2626 und USA Today bei 2680. Das amerikanische Rote Kreuz, das den Opferfamilien Finanzhilfen entrichtet, hat 2563 Anfragen erhalten. Die Regierung hat dem Roten Kreuz die Herausgabe einer Kopie der offiziellen Opferliste verweigert. Indessen nutzen die Politiker und die Medien aus propagandistischen Zwecken noch immer die Zahl von 5000 bis 6000 Toten oder Vermissten. Diese Zahl ist jetzt auch im öffentlichen Bewusstsein verankert.
- Die amerikanische Regierung hat bis anhin niemals öffentlich die Beweise für die Schuld Bin Ladins an den Attentaten enthüllt. Kürzlich, als die militärischen Operationen noch voll im Gang waren, hat Bush angekündigt, dass Bin Ladin im Falle einer Verhaftung vor ein Militärgericht hinter geschlossenen Türen gestellt würde. So müssen die Ursprünge der Beweise gegen ihn auch nicht veröffentlicht werden. Der Verteidigungsminister Rumsfeld hat klar gesagt, dass er einem toten Bin Ladin den Vorzug vor seiner Verhaftung gebe. So soll ein Prozess verhindert werden. Man muss sich also die Frage stellen, weshalb die USA so sehr darauf bestehen, dass diese sog. offensichtlichen Beweise geheim gehalten werden.
All diese Argumente sind kein Beweis dafür, dass die amerikanische Regierung oder vielleicht die CIA im Voraus über die Attentate auf die Twin Towers auf dem Laufenden waren oder sie gar provoziert haben, jedoch muss man kein Anhänger von Verschwörungstheorien sein, um einen solchen Verdacht zu schöpfen. Wir überlassen die Sorge einer vertieften Erforschung den Historikern, jedoch werden wir weder überrascht noch schockiert sein, wenn wir erfahren, dass die amerikanische Bourgeoisie die Opfer des Attentats auf das World Trade Center in Kauf genommen hat, um ihren politischen Interessen gerecht zu werden.
Ist das Attentat auf die Twin Towers ein neues Pearl Harbor?
Auf historischer Ebene kann entgegen den Behauptungen der Medien bei der aktuellen Situation kein Vergleich zu Pearl Harbor gezogen werden. Pearl Harbor fand nach zwanzig Jahren politischer Niederlagen des Proletariats statt, die es politisch, ideologisch und selbst physisch besiegt hatten. Somit wurde der historische Kurs in Richtung Krieg eröffnet. Diese Niederlagen drückten mit einem kapitalen historischen Gewicht auf das Proletariat: Die Niederlage der russischen Revolution und der revolutionären Welle; die Degeneration des revolutionären Regimes in Russland und der Triumph des Staatskapitalismus unter Stalin; die Degeneration der Kommunistischen Internationale, die eine Waffe des russischen Staates in der Aussenpolitik wurde, was auch einen beträchtlichen Rückfluss der revolutionären Positionen seit dem Gipfel der revolutionären Welle beinhaltete; die Integration der kommunistischen Parteien in ihren jeweiligen Staatsapparaten; die politische und physische Niederlage der Arbeiterklasse durch den Faschismus in Italien, in Deutschland und in Spanien; der Triumph der antifaschistischen Ideologie in den sog. demokratischen Ländern.
Die Auswirkungen dieser Niederlagen haben die historischen Möglichkeiten der Arbeiterbewegung tiefgreifend beeinträchtigt. Die Revolution, die seit den Jahren nach 1917 auf der Tagesordnung, ist niedergeschlagen worden. Das Kräfteverhältnis hatte sich definitiv zu Gunsten der Bourgeoisie verschoben, die nun ihre "Lösung" für die historische Krise des globalen Kapitalismus - den Weltkrieg - durchsetzen konnten. Indessen bedeutete die Tatsache, dass sich das Kräfteverhältnis zu ihren Gunsten verschoben hatte, nicht notwendigerweise, dass die Bourgeoisie nun freie Hand hatte, um ihren politischen Willen durchzusetzen. Selbst wenn der historische Kurs in Richtung Krieg ging, hiess dies nicht, dass die amerikanische Bourgeoisie zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt hätte den Krieg auslösen können. Die Bourgeoisie musste erst noch den Widerstand gegen den Krieg von Seiten des amerikanischen Proletariats in den Jahren 1939-1941 brechen. Dieser Widerstand reflektierte teilweise die zögerliche Haltung der stalinistischen Partei, die insbesondere in den CIO-Gewerkschaften einen beträchtlichen Einfluss ausübte. Diese Haltung war auf die unentschiedene Haltung Moskaus in der Zeit des Nichtangriffspakts mit dem nationalsozialistischen Deutschland zurückzuführen. Die herrschende Fraktion der amerikanischen Bourgeoisie sollte auch auf die aufsässigen Elemente ihrer eigenen Klasse zählen können. Einige hegten Sympathien für die Achsenmächte, andere setzten sich für eine isolationistische Politik ein. Wir haben gesehen, dass der "überraschende" Angriff Japans den Vorwand bot, um die zögernden Elemente hinter dem Staat und den Kriegsanstrengungen zu sammeln. In diesem Sinne kann man sagen, dass Pearl Harbor den letzten Nagel in den politischen und ideologischen Sarg trieb.
Heute ist die Situation ganz anders. Es ist wahr, dass das Desaster mit den Twin Towers nach mehr als einem Jahrzehnt politischer Orientierungslosigkeit und Verwirrung geschehen ist, die sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und den ideologischen Kampagnen der Bourgeoisie über den Tod des Kommunismus breit gemacht haben. Diese Verwirrungen bergen jedoch nicht dasselbe politische Gewicht in sich, wie die Niederlagen der 20er und 30er Jahre, und beeinträchtigen also auch das politische Bewusstsein des Proletariats auf historischer Ebene nicht dermassen. Auch haben sie den historischen Kurs in Richtung zunehmender Klassenkonfrontationen nicht geändert. Die Arbeiterklasse hat trotz dieser Desorientierung für die Rückeroberung ihres Terrrains gekämpft. Auch fehlen nicht Zeichen einer unterirdischen Reifung des Bewusstseins. Desweiteren tauchen Elemente auf der Suche nach politischer Klärung auf, die das proletarische Milieu um die bestehenden revolutionären Gruppen anwachsen lassen. Wir wollen hier keineswegs die seit 1989 in der Arbeiterklasse herrschende politische Orientierungslosigkeit verharmlosen, die durch den Zerfall, der für das vollständige Abgleiten in die Barbarei nicht mehr notwendigerweise einen neuen Weltkrieg benötigt, zusätzlich verschärft wird. Auch wenn die amerikanische Bourgeoisie mit ihrer ideologischen Offensive einen beträchtlichen Erfolg einheimst, auch wenn die Arbeiter in einer kriegerischen Psychose von alarmierendem Ausmass gefangen sind, so wird das globale Kräfteverhältnis nicht von der Situation in einem Land bestimmt, selbst wenn es von der Bedeutung der USA ist. Auf internationaler Ebene ist das Proletariat noch nicht besiegt worden und die Perspektive in Richtung Klassenkonfrontation ist offen. Selbst der zweiwöchige Streik von 23`000 Arbeitern des öffentlichen Sektors in Minnesota in den USA vom Oktober ist Ausdruck der Fähigkeit der Arbeiterklasse, ihren Kampf fortzuführen. Obwohl diese Arbeiter als Vaterlandsverräter hingestellt worden waren, weil sie diesen Streik in einer nationalen Krisensituation begonnen hatten, haben diese Arbeiter ihr Terrain nicht verlassen und haben für Verbesserungen bei den Löhnen und Gratifikationen gekämpft. Während also Pearl Harbor den Abschluss eines Prozesses hin zum imperialistischen Krieg bedeutete, stellt das Attentat auf das World Trade Center für die insbesondere amerikanische Arbeiterklasse lediglich einen Schritt zurück dar. Dieser Rückschritt steht aber im Kontext einer historischen Situation, die nach wie vor günstig für die Klasse ist.
JG
Aktuelles und Laufendes:
- 11. September [75]
Historische Ereignisse:
- Zweiter Weltkrieg [86]
Theoretische Fragen:
- Terrorismus [76]
Erbe der kommunistischen Linke:
Polemik mit dem IBRP
- 3845 Aufrufe
Der Krieg in Afghanistan: Strategie oder Ölprofite?
Der Krieg in Afghanistan: Strategie oder Ölprofite?Inmitten des Tobens des imperialistischen Orkans in Afghanistan haben winzige Gruppen von Internationalisten ihre Ablehnung aller miteinander ringenden Imperialismen verkündet und jede Illusion in die Pazifizierung des Kapitalismus oder in eine Unterstützung irgendwelcher Agenturen mit diesem Ziel denunziert sowie zur Aufnahme des Klassenkampfes aufgerufen, der allein das weltweite kapitalistische System, die Hauptquelle imperialistischer Kriege, überwinden kann.
Diese Gruppen leiten ihre Ursprünge aus dem Erbe der Italienischen und Deutsche Linken her, den einzigen internationalistischen Strömungen, die den Niedergang der Dritten Internationale überlebt hatten, indem sie die internationalistischen Positionen des Proletariats im Sturm des II. Weltkriegs hoch gehalten hatten. Sie sind Teil dessen, was die IKS als das politische Milieu des Proletariats bezeichnet.[i] [87]
Als Beitrag zur Stärkung dieses Milieus untersuchen wir die Stärken und Schwächen ihrer aktuellen Antwort auf den Krieg, so wie wir dies stets tun, wenn solche Ereignisse das eigentliche Dasein revolutionärer Organisationen auf die Probe stellen.
Wir wollen uns hier nicht mit der allgemeinen Herangehensweise der verschiedenen Gruppen befassen: Die IKS hat in ihrer territorialen Presse den Klassencharakter ihrer Antwort bereits anerkannt und aufgezeigt.[ii] [88] Wir streben angesichts der gebotenen Kürze auch nicht an, dabei allumfassend zu sein. Wir werden stattdessen einige bedeutsame Elemente der Erklärung der imperialistischen Barbarei durch eine dieser Gruppen – das Internationale Büro für die Revolutionäre Partei (IBRP)[iii] [89] – diskutieren.
Die Suche nach den materiellen Wurzeln
Es reicht für revolutionäre Organisationen nicht aus zu wissen, dass der US-Staat und die anderen imperialistischen Großmächte dem Terrorismus nicht feindlich gegenüber stehen, wie sie das in den letzten vier Monaten behauptet haben, oder in Kenntnis darüber zu sein, dass sie nicht durch die Interessen der Zivilisation und Humanität geleitet werden, wenn sie einen Krieg auslösen, der Tod und Verderben auf Weltebene verursacht. Die Revolutionäre müssen auch erklären können, was der wahre Grund dieser Barbarei ist, worin die Interessen der imperialistischen Mächte und insbesondere der USA bestehen und ob dieser Alptraum für die Arbeiterklasse irgendwann ein Ende findet.
Das IBRP bietet folgende Erklärung für den Krieg in Afghanistan an: Die USA wollen den Dollar als Weltwährung erhalten und so ihre Kontrolle über die Erdölindustrie bewahren: „... die USA brauchen den Dollar als gültige Währung im internationalen Handel, wenn sie ihre Stellung als globale Supermacht bewahren wollen. Vor allem sind die USA verzweifelt darum bemüht sicherzustellen, dass der internationale Ölhandel auch weiterhin primär in Dollars abgewickelt wird. Dies bedeutet, bei der Bestimmung der Routen für die Öl- und Gaspipelines und vor allem bei der Beteiligung von kommerziellen US-Interessen an der Ausbeutung der Quellen das letzte Wort zu haben. Dies steckt dahinter, wenn offen kommerzielle Entscheidungen durch die sie überwölbenden Interessen des US-Imperialismus als Ganzes gemäßigt werden, wenn der amerikanische Staat politisch und militärisch für langfristige Ziele eingespannt wird, Ziele, die sich oft gegen die Interessen anderer Staaten und in steigendem Maße gegen jene ihrer europäischen ‚Verbündeten‘ richten. Mit anderen Worten, dies ist der Kern der imperialistischen Konkurrenz im 21. Jahrhundert.“ (...)
„Eine gewisse Zeitlang haben sich die europäischen Ölgesellschaften, unter ihnen die italienische ENI, in zahllosen Projekten engagiert, um Öl direkt aus der Region des Kaspischen Meeres und des Kaukasus in europäische Raffinerien zu leiten, und es ist offensichtlich, dass ab dem 1. Januar (als der Euro legales Zahlungsmittel in den Ländern der Europäischen Union wurde) die Projekte für einen alternativen Ölmarkt Gestalt anzunehmen begannen, doch die Vereinigten Staaten denken angesichts der vielleicht schlimmsten Krise, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, nicht daran, von ihrer eigenen ökonomischen und finanziellen Macht abzulassen“ („Imperialismus, Erdöl und die nationalen Interessen der USA“, Seite 8, Revolutionary Perspectives, Nr. 23, vierteljährliche Zeitung der Communist Workers Organisation, die britische Zweigorganisation des IBRP).
Der Krieg ist angeblich darauf hinaus, die potenziellen, vom Taliban-Regime und seinen Al-Qaida-Helfern gebildeten Barrieren zu entfernen, um quer durch Afghanistan eine Route für eine Ölpipeline zu schaffen, durch die ein Teil der Förderung aus den Ölfeldern in Kasachstan transportiert werden soll – all dies Teil einer weiter gefassten Strategie der USA, um den Erdöltransport zu kontrollieren. Die USA wollen sichere und verschiedene Transportwege für die Weltölvorkommen. Hinter diesem Imperativ, so das IBRP, stehe das Schicksal des Dollars und hinter dem Schicksal des Dollars der Supermacht-Status der Vereinigten Staaten. Die Europäer ihrerseits seien an der Verbesserung des Status‘ ihrer soeben flügge gewordenen Währung, den Euro, auf den Ölmärkten interessiert und widersetzten sich aus diesem Grund den USA.
Das eigentliche Ziel der USA im Afghanistan-Krieg sei es, wie das IBRP sagt, ihre Stellung als ‚Weltsupermacht‘ zu erhalten, worunter wir ihre überwältigende militärische, ökonomische und politische Überlegenheit über alle anderen Länder auf diesem Planeten verstehen. Ihre Opponenten wollen diese Stellung begrenzen oder eventuell untergraben. Mit anderen Worten, im Gegensatz zu den Märchengeschichten, die uns von den bürgerlichen Medien präsentiert werden, wonach dies ein Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen Demokratie und Terror sei, enthüllen die Revolutionäre des IBRP die imperialistischen Interessen der Protagonisten. Hinter den imperialistischen Konflikten stecken die rivalisierenden kapitalistischen Mächte, die von der Wirtschaftskrise angetrieben werden.
Hinzu kommt, dass das IBRP Abstand nimmt von seinem Versuch, den gegenwärtigen Krieg (und die wachsende Zuspitzung der imperialistischen Konflikte) als das Resultat des Strebens nach unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteilen zu erklären. Zehn Jahre zuvor sagte das IBRP über den bevorstehenden Golfkrieg, dass „... die Krise am Golf sich wirklich ums Öl und darum dreht, wer es kontrolliert. Ohne billiges Öl fallen die Profite. Die Profite des westlichen Kapitalismus sind bedroht, und aus diesem (und keinem anderen) Grund bereiten die USA ein Blutbad im Nahen Osten vor“. (CWO-Flugblatt, zitiert in International Review Nr. 64).
Der Sieg der USA im Golfkrieg bewirkte jedoch keinerlei signifikante Steigerung der Ölprofite und auch keine bedeutsamen Ölpreisänderungen. Das IBRP scheint dies und auch die Tatsache realisiert zu haben, dass Ex-Jugoslawien keinerlei profitable Märkte für die imperialistischen Mächte bot, die sich dort gegenseitig bekämpften, wie es zunächst annahm, und es scheint nun zu einer breiteren Erklärung der Situation gelangt zu sein. Solch eine Herangehensweise kann nur begrüßt werden, da die Glaubwürdigkeit der Marxisten von ihrer Fähigkeit abhängt, den Imperialismus auf der Grundlage einer globalen und historischen Analyse zu begreifen, die die unmittelbaren ökonomischen Faktoren nicht als Kriegsgrund betrachten. [iv] [90]
Doch trotz dieses Schritts vorwärts sieht das IBRP die imperialistischen Ziele am Schicksal von Währungen hängen, mit anderen Worten: an spezifisch ökonomischen Faktoren. Und es misst der Frage des Erdöls und der Ölpipelines ein entscheidendes Gewicht bei der Rolle des Dollars und der seines neuen Rivalen, des Euros, bei. Beim Öl geht’s für das IBRP so ziemlich‚ „um den Kern der imperialistischen Konkurrenz im 21. Jahrhundert“.
Doch ist die Bewahrung des Status‘ der Vereinigten Staaten als hegemoniale Weltmacht so direkt und so entscheidend von der Rolle des Dollars abhängig, wie das IBRP sagt? Und hängt die Stellung des Dollars als Weltwährung wirklich so direkt von der Kontrolle des Öls durch die USA ab?
Das Erdöl und der Dollar
Auch wenn ein wichtiges Wörtchen bei der kommerziellen Kontrolle der Ölförderung – die meisten der wichtigsten globalen Erdölgesellschaften sind zum Beispiel im Besitz der Amerikaner – den Vereinigten Staaten sicherlich dabei hilft, ihre Wirtschaftsmacht aufrechtzuerhalten, und dies somit ein Faktor der Vorherrschaft des Dollars ist, erklärt dies nicht grundsätzlich die Mittel, durch die der Dollar seine Rolle als Weltwährung erlangte und sie noch heute behauptet.
Der Dollar erreichte seine vorrangige Stellung, bevor das Erdöl zum Haupttreibstoff auf dem Planeten wurde. In der Tat gründet sich die Stärke einer Währung nicht auf der Kontrolle der Rohstoffe.
Japan zum Beispiel kontrolliert praktisch keine Rohstoffe, doch der Yen ist trotz der gegenwärtigen Stagnation der japanischen Wirtschaft eine starke Währung. Umgekehrt hatte die frühere UdSSR riesige Mengen an Erdöl unter ihrer Gewalt, doch verhinderte dies nicht ihren ökonomischen Zusammenbruch; auf sich gestellt, war der Rubel unfähig, eine Weltwährung zu werden.[v] [91] Es war nicht die Kontrolle über die Kohle oder die Baumwollversorgung, die das englische Pfund im 19. Jahrhundert zur Hauptwährung machte.Es ist vielmehr das Übergewicht der Wirtschaft eines Landes im Bereich der Weltproduktion und des Handels sowie sein relatives politisches und militärisches Gewicht, was erklärt, warum gewisse Währungen zur Standardleitwährung für den Weltkapitalismus werden. Das Pfund erlebte einen Höhenflug, weil Großbritannien das erste moderne kapitalistische Land war. Die größere Produktivität seiner Industrien versetzte seine Produkte in die Lage, jene des Rests der Welt, was Preis und Menge anging, zu ersetzen, da anderswo die kapitalistische Produktion erst im Begriff war, Fuß zu fassen. Die ganze Welt verkaufte Rohstoffe an Großbritannien. Und Großbritannien war – wie ein berühmtes Zitat besagt – die „Werkstatt der Welt“. Die Stärke des britischen Militärs, insbesondere der Flotte, und seine Anhäufung von kolonialen Besitzungen vergrößerte noch die Überlegenheit des Pfunds und die Stellung Londons als Finanzzentrum der Welt.
Die Entwicklung des Kapitalismus in anderen Ländern begann die Überlegenheit des britischen Kapitalismus zu untergraben, und seine Konkurrenten begannen, es in Sachen Produktivität zu überholen. Die neuen, durch den Ersten Weltkrieg enthüllten Bedingungen läuteten das Ende des Pfunds ein, und der Zweite Weltkrieg besiegelte sein Schicksal endgültig. In einer Welt, wo rivalisierende kapitalistische Nationen den Weltmarkt bereits unter sich aufgeteilt hatten und sie nur noch danach trachten, durch eine Neuaufteilung des Weltmarkts zu ihren Gunsten zu expandieren, neigt sich in der Frage der militärischen Konkurrenz – des Imperialismus – die Gunst Ländern mit kontinentalen Ausmaßen wie die Vereinigten Staaten mehr zu als den europäischen Ländern, deren relativ kleine Größe einer früheren Phase im kapitalistischen Wachstum entsprachen. Die Auszehrung aller europäischen Mächte einschließlich der Sieger wie Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg steigerte das relative Gewicht der US-Produktion und ihres Anteils am Welthandel enorm und erhöhte daher auch die internationale Nachfrage nach dem Dollar. Und nach der Verwüstung Europas im Zweiten Weltkrieg erreichten die Vereinigten Staaten, stimuliert durch eine phänomenale Steigerung der Rüstungsproduktion, eine haushohe wirtschaftliche Überlegenheit auf Weltebene. Um 1950 bestritten die USA die Hälfte der gesamten Weltproduktion! Der Marshall-Plan von 1947 versorgte die Europäer mit den Dollars, die sie verzweifelt brauchten, um ihre Wirtschaft mit amerikanischen Gütern wieder aufzubauen. Die Dollarüberlegenheit wurde durch das Bretton-Woods-Abkommen und die Gründung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds unter der Ägide der USA global institutionalisiert.
1968 gelangte die Wiederaufbauperiode zu ihrem Ende, und die europäischen sowie japanischen Ökonomien hatten ihre Stellung gegenüber den USA verbessert. Doch trotz der relativen Schwächung der US-Wirtschaft, die zu einer effektiven Abwertung des Dollars führte, bedeutete dies nicht das unmittelbare Ende ihrer vorrangigen Stellung. Weit entfernt davon. Die USA besaßen etliche Mittel, um die neuen Bedingungen zu ihren Gunsten auszunutzen. Die Abkoppelung des Dollars vom Gold 1971 durch Washington ermöglichte es den USA, die Macht des Dollars und die Konkurrenzfähigkeit der amerikanischen Produktion durch die Manipulation des Devisenkurses aufrechtzuerhalten, welche ihre wachsende Auslandsverschuldung niedrig hielt (eine Methode, die Großbritannien in den 30er Jahren benutzt hatte, um die Stellung des Pfunds selbst nach dem Niedergang seiner Wirtschaft und dem Aufstieg der US-Wirtschaft aufrechtzuerhalten). Zu Beginn der 80er Jahre halfen die steigenden Zinssätze und die Deregulierung der Kapitalströme - mit der Konsequenz, dass Finanzspekulationen wie Pilze aus dem Boden wuchsen - dabei mit, die Auswirkungen der Krise auf andere Länder abzuwälzen. Hinter diesen Maßnahmen steckte die militärische Überlegenheit der USA, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unangreifbar geworden war und sicherstellte, dass König Dollar auf seinem Thron bleibt.
Die Rolle des Erdöls bezüglich der Vorrangstellung des Dollars ist daher relativ unbedeutend. Auch wenn es zutrifft, dass es in der ‚ersten Ölkrise‘ 1971–72 den USA durch ihren Einfluss auf die Ölpreispolitik der OPEC gelang, enorme Vermögen von den europäischen und japanischen kapitalistischen Mächten via Saudi-Arabien in die eigenen Taschen zu schleusen, so sind solche Manipulationen kaum die Hauptinstrumente der Dollarüberlegenheit. Was für die Hegemonie des Dollars wirklich zählt, ist die ökonomische, politische und militärische Vorherrschaft der USA auf dem Weltmarkt, auf dem Öl und andere Rohstoffe gekauft und verkauft werden, und diese Dominanz wird hauptsächlich von Faktoren von allgemeinerer und historischer Tragweite bestimmt als von der Kontrolle über das Erdöl.
Das IBRP glaubt jedoch, dass die Zuspitzung der militärischen Abenteuer der USA in Zentralasien Teil langfristiger Vorbeugemaßnahmen zur Besetzung der Ölzentren und der Transportwege des Öls ist, um die europäischen Mächte an der Kontrolle derselben zu hindern, die ihrerseits ins Auge gefasst haben, den Euro zur Hauptwährung in der Ölförderung und im Erdölhandel zu machen. Das angebliche Ziel der USA sei es, den Euro, die gerade flügge gewordene Währung der Europäischen Union, zu stoppen, der nach der Krone des Dollars greife und so die USA als rivalisierender imperialistischer Block überholen wolle.
Doch wenn diese Erklärung richtig ist, müssten die europäischen Mächte sehr viel mehr tun, als ihren Einfluss auf die Erdölindustrie zu steigern, um den Dollar durch den Euro zu ersetzen. Selbst wenn die Europäische Union eine wirklich vereinigte politische und wirtschaftliche Gesamtheit wäre, so betrüge ihr gesamtes BSP nur zwei Drittel desjenigen der Vereinigten Staaten. Obwohl die EU nun eine gemeinsame Währung besitzt, ist sie dennoch in etliche konkurrierende national-kapitalistische Einheiten zersplittert, die ihre wirtschaftliche Stärke gegenüber den Vereinigten Staaten untergraben. Der Europäischen Zentralbank mangelt es im Vergleich zur Federal Reserve der USA an Einigkeit über die Absichten in der Währungs- und Steuerpolitik, was daran liegt, dass sie, bis jetzt zumindest, dazu tendierte, im Kielwasser der Politik der Einzelstaaten zu folgen. Die Wirtschaft Deutschlands, dem stärksten politischen Pol in der Euro-Zone, folgt in der Rangliste den USA und Japan erst auf Platz drei, und dies aus anderen Gründen als wegen des Mangels an Kontrolle über das Öl und die Pipelines.
Auf der politischen und militärischen Ebene ist die Spaltung noch größer. Die EU umfasst mehrere imperialistische Mächte, die sowohl gegeneinander als auch gegen die USA konkurrieren. Europas größte Wirtschaftsmacht, Deutschland, bleibt ein militärischer Pygmäe im Vergleich zu Großbritannien und Frankreich, seinen Hauptrivalen (und dabei muss betont werden, dass eine der größten Militärmächte Europas – Großbritannien – nicht einmal in der Euro-Zone ist). Deutschland ist dabei, seine militärischen Kräfte zu stärken; seine Truppen haben zum ersten Mal seit dem II. Weltkrieg außerhalb der eigenen Grenzen interveniert (Kosovo). Nichtsdestotrotz reicht die Reichweite seiner militärischen Macht nicht weiter als bis zu seinen unmittelbaren Nachbarn in Osteuropa.
Wie die Währungsexperten der Bourgeoisie hervorheben, stellt diese militärische Schwäche und die divergierenden Interessen innerhalb der EU eine ernsthafte Gefahr für den Euro dar: „Glyn Davies, Autor von ‚A History of Money from Ancient Times to the Present Day‘, sagte: ‚die größte langfristige Bedrohung für die Währungsunion in Europa seien die Kriege oder‚ als Kontroverse angesehene Verhaltensweisen von Ländern, die sich im Krieg befinden. Es geht allein um den politischen Aspekt. Wenn man eine starke politische Union hätte, dann kann sie vielen Angriffen widerstehen. Doch wenn es politische Differenzen gibt, kann dies die Währungsunion beträchtlich schwächen.‘“ (International Herald Tribune, 29.12.01)
Daher und aus anderen Gründen wird es der Euro schwer haben, dem Dollar das Vertrauen der Weltwirtschaft streitig zu machen.
Von diesem Standpunkt aus betrachtet, kann der Schutz der Vorherrschaft des Dollars nicht als glaubwürdiger Grund für die riesige Militärkampagne, die in Afghanistan ausgetragen wird, angesehen werden. Wie wir auf unserem letzten internationalen Kongress gesagt haben: „Die USA wollen diese Region wegen des Erdöls kontrollieren – nicht aus rein ökonomischen Gründen, sondern vor allem, weil sie sicherstellen wollen, dass Europa nicht in die Lage versetzt wird, diese Ölquellen im Falle eines Krieges zu nutzen. Wir sollten uns dabei in Erinnerung rufen, dass während des Zweiten Weltkrieges deutsche Truppen 1942 eine Offensive gegen Baku durchführten, um die Kontrolle über diese Ölvorräte zu erlangen, was überlebenswichtig für die Kriegführung war. Heute ist die Situation bezüglich Aserbeidschan und der Türkei etwas anders, für die die Frage des Erdöls mehr eine Frage des unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzens ist. Aber die wahren Einsätze werden nicht auf diesem Feld getätigt.“ („Bericht über die imperialistischen Spannungen“ in International Review Nr. 107)[vi] [92]
Hängt die US-Hegemonie vom Dollar ab?
Die zweite Frage, die vom IBRP gestellt wird, lautet: Hängt der Status der Supermacht der USA von der außergewöhnlichen Rolle des Dollars ab? Nein, würden wir sagen, jedenfalls nicht auf entscheidende Weise, wie das IBRP meint. Wie wir argumentiert haben, ist die militärische Überlegenheit genauso sehr eine Ursache wie auch ein Effekt des Dollarstatus‘. Natürlich ist die ökonomische und monetäre Vorherrschaft der USA in der Weltwirtschaft ein wichtiger Faktor bei ihrer militärischen Überlegenheit. Doch militärisches und strategisches Vermögen rührt nicht automatisch, mechanisch und unmittelbar oder proportional aus der Wirtschaftsmacht her. Es gibt zahllose Beispiele, die dies beweisen. Japan und Deutschland sind nach den Vereinigten Staaten die stärksten Wirtschaftsmächte der Welt, aber immer noch militärische Zwerge, verglichen mit Großbritannien und Frankreich, die, wirtschaftlich zwar schwächer, Nuklearwaffen besitzen. Die UdSSR war wirtschaftlich äußerst schwach, doch auf militärischer Ebene bot sie der amerikanischen Macht 45 Jahre lang die Stirn. Und trotz der relativen wirtschaftlichen Schwächung der USA seit 1969 ist ihre militärische und strategische Macht gegenüber ihren nächsten Rivalen erheblich gewachsen.
Wie jedes andere Land können sich auch die USA nicht auf die Leistungsfähigkeit ihrer Währung verlassen, um ihre imperialistische Stellung automatisch zu garantieren. Im Gegenteil, die USA müssen damit fortfahren, enorme, kostspielige Ressourcen ihren militärischen und strategischen Interessen zu widmen, um zu versuchen, ihre imperialistischen Hauptrivalen zu überlisten und deren Anspruch, die Führung der USA anzufechten, zu dämpfen. Die antiterroristische Kampagne seit dem 11. September hat der USA bemerkenswerte Erfolge in diesem imperialistischen Kampf erbracht. Sie hat die anderen Hauptmächte dazu gezwungen, ihre militärischen und strategischen Ziele zu unterstützen, ohne es ihnen zu erlauben, mehr als nur ein paar Krümel des Prestiges aus ihrer Unterstützung für den schnellen militärischen Erfolg der amerikanischen Streitkräfte über das afghanische Taliban-Regime zu erhalten. Gleichzeitig haben die USA ihr strategisches Gewicht in Zentralasien verstärkt. Die Zurschaustellung ihrer militärischen Überlegenheit war so niederschmetternd, dass ihr Rückzug aus dem ABM-Vertrag mit Russland nur leise Kritik unter ihren früher lautstarken Gegnern in den europäischen Hauptstädten hervorrief. Die USA können nun mühelos die Expansion ihres ‚antiterroristischen‘ Kreuzzuges gegen andere Länder in Angriff nehmen.
Dennoch wäre es schwer zu ermessen, ob die amerikanische Offensive in den letzten drei Monaten die Erdölversorgung für die USA sicherer als zuvor gemacht hat oder die erdrückende Überlegenheit des Dollars über den Euro bedeutend gesteigert hat. Der wirkliche Sieg der USA ergibt sich auf der militärstrategischen Ebene, wie schon im Golfkrieg. Die wirtschaftlichen Nutzeffekte sind genauso schwer fassbar wie in diesem früheren Konflikt.
Die Kontrolle des Erdöls um ökonomischer Vorteile willen war nicht die entscheidende Frage, die die USA dazu veranlasste, Milliarden von Dollar für einen Monat Krieg in Afghanistan auszugeben und die Stabilität Pakistans zu riskieren, wo die beabsichtigten Pipelines weiter verlaufen sollen, nachdem sie Afghanistan verlassen haben.
Die CWO zeigte schon 1997 in einem Artikel („Behind the Talibans stands the US imperialism“), dass das Taliban-Regime die Erdölinteressen der USA nicht wirklich bedroht hatte. Im Gegenteil, die USA betrachteten das Regime als einen Stabilitätsfaktor, verglichen mit den Vorgängern der Taliban. Obgleich es Osama Bin Laden bei sich beherbergte, stellte das Regime kein unüberwindbares Hindernis für eine Verständigung mit den USA und ihren Interessen dar.[vii] [93]
Die Rolle des imperialistische Krieges heute
Die Ära, in der kapitalistische Mächte in den Krieg zogen, um unmittelbare, direkte wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, war die Embryonalphase in der Entwicklung des Kapitalismus, eine Phase, die kaum das 19. Jahrhundert überdauerte. Sobald die kapitalistischen Hauptmächte die Welt in Form von Kolonien oder Einflusssphären unter sich aufgeteilt hatten, wurde die Möglichkeit der Erlangung direkter wirtschaftlicher Vorteile aus dem Krieg immer ungewisser. Als der Krieg zu einer Frage des militärischen Konflikts mit anderen imperialistischen Mächten wurde, traten weiterreichende strategische Fragen in den Vordergrund, die die industrielle Vorbereitung und eine Explosion der Kosten zur Folge hatten. Der Krieg wurde weniger zur Frage wirtschaftlicher Vorteile als zu einer Frage des Überlebens eines jeden Staates auf Kosten seiner Rivalen. Die Ruinierung der meisten kämpfenden kapitalistischen Mächte in den beiden Weltkriegen dieses Jahrhunderts bezeugt, dass der Imperialismus nicht die „höchste Stufe“ des Kapitalismus ist, wie Lenin dachte, sondern Ausdruck seiner dekadenten Periode, in der der Kapitalismus in wachsendem Maße durch die nationalen Grenzen seines eigenen Systems dazu gezwungen ist, Mensch und Maschine auf den Schlachtfeldern zu verdampfen, statt sie im Produktionsprozess zu verwerten.[viii] [94]
Nicht der Krieg dient den Bedürfnissen der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft dient den Bedürfnissen des Krieges, und auch Rohstoffe können diesem allgemeinen Gesetz nicht entkommen. Wenn die imperialistischen Mächte die Rohstoffe kontrollieren wollen, besonders solch wichtige wie Erdöl, dann nicht deshalb, weil die Bourgeoisie, wie das IBRP sagt, glaubt, dass dies dem Wohle ihrer Profite oder Währungen dient, sondern wegen ihrer militärischen Bedeutung.
„Das größte militärische Aufbauprogramm zu Friedenszeiten in der amerikanischen Geschichte wurde vom Haushaltsausschuss für die bewaffneten Streitkräfte gebilligt. Der Haushaltsausschuss für außenpolitische Angelegenheiten nannte die strategische Bedeutung des östlichen Mittelmeerraums und des Nahen Ostens fast ebenbürtig mit jener der Region des Nordatlantikpakts. Stützpunkte in den arabischen Staaten und in Israel seien notwendig, um See- und Flugwege zu schützen. Der Schutz dieser Region sei entscheidend, wie der Bericht aussagt, da in dieser Region gewaltige Ölressourcen liegen, die die freie Welt nun für ihre enorm ausgeweiteten Wiederaufrüstungsbemühungen benötigen.“ (International Herald Tribune, 1951)
Der US-Imperialismus war ganz freimütig gewesen: Die Kontrolle des Erdöls ist zuallererst aus militärischen Gründen wichtig, da sie garantiert, dass das Erdöl in Kriegszeiten zu den eigenen Truppen fließt und die feindlichen Armeen der rivalisierenden Länder von ihm abgeschnitten werden.
Die Enthüllung der wahren Einsätze durch den Afghanistan-Krieg
Obwohl das IBRP anerkennt, dass der Kapitalismus sich in seiner historischen Niedergangsperiode befindet, lässt es diesen theoretischen Rahmen bei seinem Verständnis des imperialistischen Krieges von heute vermissen. Das grundlegende Bedürfnis des Kapitalismus ist immer noch die Akkumulation von Kapital, doch die Produktionsverhältnisse, die einst seine phantastische Entwicklung sicherstellten, hindern ihn nun daran, ausreichende Expansionsfelder zu finden. Die Produktion wird vermehrt ihrer Zerstörung zugeführt, statt zur Reproduktion von Reichtum beizutragen. Die Erkenntnis, dass der Krieg aufgehört hat, für das kapitalistische System als Ganzes profitabel zu sein, auch wenn er immer notwendiger für die Bourgeoisie wird, ist daher keine Verleugnung des marxistischen Materialismus, sondern ein Ausdruck der Fähigkeit, die verschiedenen Phasen, durch welche ein Wirtschaftssystem schreitet, und insbesondere den Übergang von seiner aufsteigenden zu seiner dekadenten Phase zu verstehen. In der letztgenannten Phase und um so mehr in den Perioden der offenen Krise drängt der ökonomische Imperativ die Bourgeoisie immer mehr statt in Richtung eines Krieges aus unmittelbar ökonomischen Gründen in Richtung eines globalen und äußerst selbstmörderischen Kampfes um militärische Überlegenheit unter den rivalisierenden nationalen Einheiten.
Nur wenn wir die Folgen der kapitalistischen Dekadenz auf die heutigen imperialistischen Konflikte deutlich machen, können wir die Arbeiterklasse auf die beträchtlichen Gefahren hinweisen, die im Afghanistan-Krieg und in jenen Kriegen zum Ausdruck kommen, die ihm unvermeidlich folgen werden. Das IBRP neigt dagegen dazu, dem Proletariat ein falsches, tröstliches Bild eines Systems zu vermitteln, das, wie in seiner Jugendzeit, immer noch in der Lage sei, seine militärischen Ziele den Bedürfnissen der wirtschaftlichen Expansion unterzuordnen. Darüber hinaus vermittelt das IBRP mit seiner fehlerhaften Auffassung über den europäischen Imperialismus, der rund um den Euro vereinigt sei, den Eindruck einer relativ stabilen Entwicklung des Weltkapitalismus zu zwei neuen imperialistischen Blöcken. Dabei weisen im Gegenteil die widersprüchlichen und antagonistischen Interessen der europäischen Mächte untereinander wie auch gegenüber den USA auf einen weiteren Schritt im Zerfall des Kapitalismus hin. Sie kündigen das Finale im Zerfall des Kapitalismus an, wo trotz der Versuche Deutschlands, sich als alternativer Pol zu den USA aufzustellen, das imperialistische Chaos die Oberhand gewinnt, wo militärische Konflikte sich katastrophal zu verallgemeinern drohen. Es ist ganz richtig, dass es im Afghanistan-Krieg um die Aufrechterhaltung und Wiederverstärkung der Stellung Amerikas als der Welt einzige Supermacht geht. Doch dieser Status wird nicht von spezifisch wirtschaftlichen Faktoren wie die Kontrolle über das Erdöl bestimmt, wie es sich das IBRP vorstellt. Er ist vielmehr von geostrategischen Fragen abhängig, von der Fähigkeit der USA, eine militärische Vorherrschaft in den Schlüsselregionen der Welt zu erreichen und ihre Rivalen daran zu hindern, ihre Stellung ernsthaft anzufechten. Weltregionen wie Afghanistan hatten lange, bevor das Öl als ‚schwarzes Gold‘ begehrt wurde, ihren strategischen Wert für die imperialistischen Mächte bewiesen. Es ging nicht ums Öl, als der britische Raj zweimal Armeen nach Afghanistan entsandte, bis es ihm schließlich gelang, ein Marionettenregime dort zu installieren. Die Bedeutung Afghanistans liegt nicht darin begründet, dass es ein potenzielles Transitland für die Ölpipelines ist, sondern darin, dass es der geographische Mittelpunkt der imperialistischen Hauptmächte des Nahen und Fernen Ostens sowie Südasiens ist. Seine Kontrolle würde die US-Macht nicht nur in dieser Region, sondern auch in ihrem Verhältnis zum europäischen Imperialismus beträchtlich steigern.
Die Vereinigten Staaten erreichten ihre dominante imperialistische Position im Wesentlichen aufgrund ihres siegreichen Hervorgehens aus zwei Weltkriegen. Auch der Schlüssel zu ihrer Fähigkeit, diese Stellung zu halten, liegt auf der militärischen Ebene.
Como
[i] [95] 1 s. das IKS-Buch The Italian Communist Left und The Dutch-German Communist Left;
[ii] [96] 2 s. zum Beispiel “Revolutionaries denounce imperialist war” in World Revolution 249, November 2001;
[iii] [97] 3 s. www.leftcom.org [98]
[iv] [99] 4 In der Internationalist Communist Review Nr. 10 erkennt das IBRP sogar die Bedeutung der militärstrategischen Fragen über die Wirtschaft an: „Es liegt dann an der politischen Führung und an der Armee, die politische Richtung jedes Staates nur nach einem Imperativ zu etablieren: einer Einschätzung, wie man einen militärischen Sieg erreichen kann, denn dies überwiegt heute den wirtschaftlichen Erfolg.“ („End of the cold war: a new step towards a new imperialist line-up“.
[v] [100] 5 In der Tat war die Rolle des Rubels als dominante Währung in den Ex-Comecon-Ländern des Ostblocks gänzlich abhängig von der militärischen Besetzung ihres Territoriums durch die UdSSR.
[vi] [101] 6 Wir sollten auch betonen, dass das IBRP auch auf Faktenebene falsch liegt, wenn es behauptet, dass “die Region um das Kaspische Meer... das Gebiet mit den größten bekannten Reserven an nicht angezapften Erdöl (ist)”. Die nachgewiesenen Ölreserven der gesamten Ex-UdSSR betragen in etwa 63 Mrd. Barrel, jene der fünf Hauptproduzenten des Nahen Ostens betragen mehr als zehnmal soviel, wobei Saudi-Arabien allein 25% der nachgewiesenen weltweiten Reserven besitzt. Hinzuzufügen ist, dass das
saudische Öl weitaus profitabler ist (in rein ökonomischen Begriffen, von denen das IBRP so angetan ist); seine Förderung kostet nur 1$ pro Barrel und ist frei von den gigantischen Kosten für den Bau von Pipelines über die Gebirge Afghanistans und des Kaukasus.
[vii] [102] Das kürzlich veröffentlichte über Buch Bin Laden, La verité interdit von Jean-Charles Brisard und Guillaume Dasqié (Editions Denoel und in Deutscher Sprache im Pendo Verlag, 2001) enthüllt die inoffizielle Diplomatie zwischen der amerikanischen Regierung und dem Taliban-Regime bis zum 11. September und deutet eine andere Schlussfolgerung über das Verhältnis zwischen den Ölinteressen der USA und der Entwicklung von militärischen Feindseligkeiten mit Afghanistan an als das IBRP. Bis zum 17. Juli 2001 versuchten die USA, die anstehenden Probleme mit dem Taliban-Regime diplomatisch zu lösen, wie die Ausweisung von Osama Bin Laden wegen des Angriffs auf die USS Cole und die amerikanischen Botschaften in Nairobi und Dar-es-Salaam. Und die Taliban waren keineswegs abgeneigt, über solche Fragen zu verhandeln. In der Tat hatten die Taliban nach der Inthronisierung von Bush als US-Präsident eine Wiederaussöhnung vorgeschlagen, die, wie sie hofften, zu einer diplomatischen Anerkennung führen würde. Doch nach dem Juli 2001 brachen die USA effektiv die diplomatischen Beziehungen, indem sie eine brutale, provokative Botschaft an die Taliban gesandt hatten: Sie drohten mit militärischen Aktionen, um Bin Laden zu fassen, und kündigten an, dass sie sich in Diskussion mit dem ehemaligen König Sahir Schah befänden, um die Macht in Kabul wieder zu übernehmen! Dies legt nahe, dass die Kriegsziele der USA bereits vor dem 11. September festgelegt worden waren und dass alles, was es bedurfte, um die Feindseligkeiten zu eröffnen, der Vorwand der terroristischen Gräueltat an diesem Tag war. Es legt ebenfalls nahe, dass nicht die Taliban einen diplomatischen Prozess verhinderten, der möglicherweise zu einem stabilen Afghanistan für die US-Ölinteressen geführt hätte, sondern die US-Regierung, die andere Pläne hatte. Statt der Formel des IBRP: ein Krieg zur Stabilisierung Afghanistans für eine Erdölpipeline, weisen die Zeichen auf einen Krieg hin, der die gesamte Region destabilisiert für das höhere Ziel der militärischen und geostrategischen Überlegenheit Amerikas.
[viii] [103] 8 Das Kapital wird akkumuliert oder verwertet durch die Auspressung von Mehrarbeit der Arbeiterklasse.
Aktuelles und Laufendes:
- Afghanistan [104]
Politische Strömungen und Verweise:
Theoretische Fragen:
- Krieg [27]
Internationale Revue 30
- 2690 Aufrufe
14. Kongress der IKS: Bericht über den Klassenkampf: Die revolutionäre Bewegung und das Konzept des Historischen Kurses, Teil 2
- 1727 Aufrufe
In der letzten Ausgabe der Internationalen Revue
veröffentlichten wir den 1. Teil dieses Artikels. Er umfasst die
Entwicklung des Konzepts des Historischen Kurses in der Zeit von 1848
bis 1952.
Teil 2: 1968-2000
Das Ende der Konterrevolution
Trotz der Fehler, die sie in den 40er und 50er Jahren begangen hatte – insbesondere die Schlussfolgerung, dass ein dritter Weltkrieg bevorstand -, versetzte die prinzipielle Loyalität der GCF gegenüber den Methoden der Italienischen Linken ihren unmittelbaren Nachfolger, die Gruppe Internacionalismo in Venezuela, Ende der 60er Jahre in die Lage zu erkennen, dass sowohl der Wiederaufbauboom der Nachkriegszeit als auch die lange Periode der Konterrevolution sich ihrem Ende neigten. Die IKS hat mehr als einmal die Gelegenheit genutzt, die treffenden Worte aus Internacialismo Nr. 8 im Januar 1968 zu zitieren, aber es schadet nicht, sie noch einmal zu zitieren, da sie ein schönes Beispiel für die Fähigkeit des Marxismus sind, den allgemeinen Kurs der Ereignisse vorwegzunehmen, ohne sich dabei auf prophetische Gaben zu berufen: ”Wir sind keine Propheten, noch können wir behaupten vorherzusehen, wann und wie sich die Ereignisse in der Zukunft entwickeln werden. Doch über eins sind wir uns bewusst und sicher: Der Prozess, in den der Kapitalismus heute gedrängt ist, kann nicht gestoppt werden... und er führt direkt in die Krise. Und wir sind uns gleichfalls sicher, dass der entgegengesetzte Prozess einer sich entwickelnden Kampfbereitschaft der Klasse, dessen Zeuge wir heute sind, die Arbeiterklasse zu einem blutigen und direkten Kampf für die Zerstörung des bürgerlichen Staates führen wird.”
Hier drückte die venezuelanische Gruppe ihr Verständnis aus, dass nicht nur eine neue Wirtschaftskrise zum Vorschein gekommen war, sondern dass es ein Wiedersehen mit einer neuen und ungeschlagenen Generation von Proletariern geben wird. Die Ereignisse vom Mai 68 in Frankreich und die internationale Welle von Kämpfen in den folgenden vier, fünf Jahren waren eine klare Bestätigung dieser Diagnose. Natürlich war eine Komponente dieser Diagnose die Erkenntnis, dass die Krise die imperialistischen Spannungen zwischen den beiden Militärblöcken, die den Globus beherrschten, verschärfen würde; doch der enorme Schwung der ersten internationalen Welle von Kämpfen zeigte, dass das Proletariat nicht gewillt war, sich in einen neuen Holocaust hineinziehen zu lassen. Mit einem Wort, der historische Kurs wies nicht in Richtung Weltkrieg, sondern in Richtung massiver Klassenkonfrontationen.
Eine direkte Konsequenz aus der Wiederbelebung des Klassenkampfes war das Auftreten neuer proletarischer Kräfte nach einer langen Periode, in der revolutionäre Ideen mehr oder weniger aus dem Blickfeld verschwunden waren. Die Ereignisse vom Mai 68 und ihre Nachwirkungen erzeugten eine Fülle neuer politischer Gruppierungen, die durch einen Haufen Konfusionen gekennzeichnet, aber gewillt waren, zu lernen und sich eifrig die wahrhaften kommunistischen Traditionen der Arbeiterklasse wiederanzueignen. Das Beharren von Internacionalismo und ihrer Nachkommen – Révolution Internationale in Frankreich und Internationalism in den USA – auf der Notwendigkeit einer ‚Umgruppierung der Revolutionäre‘ fasste diesen Gesichtspunkt der neuen Perspektive zusammen. Diese Strömungen übernahmen also die Führung und drängten auf Debatten, Korrespondenzen und internationale Konferenzen. Diese Bemühungen ernteten ein großes Echo unter den klarsten der neuen politischen Gruppierungen, denen es nicht schwer fiel zu verstehen, dass eine neue Periode eröffnet war. Dies trifft besonders auf jene Gruppen zu, die sich der ‚internationalen Tendenz‘ angeschlossen hatten, aber es trifft auch auf Gruppen wie Revolutionary Perspectives zu, deren ursprüngliche Plattform das historische Wiedererwachen der Klassenbewegung anerkennt:
”Parallel zur Erneuerung der Krise wurde 1968 mit den Massenstreiks in Frankreich, denen die Erhebungen in Italien, Großbritannien, Argentinien, Polen, etc. folgten, eine neue Periode des internationalen Klassenkampfes eröffnet. Die heutigen Arbeitergenerationen sind, anders als nach dem Ersten Weltkrieg, unbelastet vom Reformismus oder von der Niederlage, wie in den 30er Jahren, was uns Anlass zur Hoffnung in ihre Zukunft und in die der Menschheit gibt. All diese Kämpfe zeigen zur Verlegenheit der modernistischen Dilettanten, dass das Proletariat trotz 50 Jahren nahezu vernichtender Niederlagen nicht im Kapitalismus integriert ist: Mit diesen Kämpfen belebt es die Erinnerung an seine eigene vergangene Geschichte wieder und bereitet sich selbst auf seine wichtigste Aufgabe vor.” (Revolutionary Perspectives Nr. 1, alte Reihe, c. 1974)
Leider hatten die ‚etablierten‘ Gruppen der Italienischen Linken, denen es gelang, während der Nachkriegsperiode eine organisatorische Kontinuität aufrechtzuerhalten, dies nur um den Preis eines Skleroseprozesses erreicht. Weder Battaglia Comunista (Publikation der Partito Comunista Internazionalista) noch Programma Comunista (von der Internationalen Kommunistischen Partei in Italien veröffentlicht) trugen viel Erhellendes zu den Revolten Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bei. Sie richteten ihr Augenmerk auf die Studenten und kleinbürgerlichen Gestalten, die sich zweifellos in diese Revolten gemischt hatten. Für die genannten Gruppen – die, man erinnere sich, einst aufgebrochen waren, um in einer Periode der schlimmsten Niederlage den Kurs zur Revolution anzusteuern – war nun die Nacht der Konterrevolution noch nicht zu Ende. Sie sahen wenig Anlass, sich aus der splendid isolation zu begeben, die sie so lange ‚geschützt‘ hatte. Die Programma-Strömung erlebte in den 70er Jahren durchaus eine Periode beachtlichen Wachstums, doch sie war ein Gebilde, das auf dem Sand des Opportunismus, besonders in der nationalen Frage, gegründet war. Die katastrophalen Konsequenzen dieser Art von Wachstum sollten mit dem Zerbrechen der IKP in den frühen 80er Jahren offensichtlich werden. Was Battaglia angeht, so schaute sie lange Zeit kaum einmal über die italienischen Grenzen. Es dauerte fast ein Jahrzehnt, ehe sie ihren eigenen Appell für internationale Konferenzen der Linkskommunisten formulierte, wobei ihre Beweggründe unklar blieben (die ”Sozialdemokratisierung der Kommunistischen Parteien”).
Die Gruppen, die mit der Bildung der IKS fortfuhren, waren zu dieser Zeit mit einer Auseinandersetzung an zwei Fronten konfrontiert. Zum einen mussten sie Stellung gegen den Skeptizismus unter den existierenden linkskommunistischen Gruppen beziehen, die Alles beim Alten sahen. Zum anderen mussten sie auch den Immediatismus und die Ungeduld vieler neuer Gruppen kritisieren, von denen einige überzeugt davon waren, dass der Mai 68 die Frage der unmittelbar bevorstehenden Revolution gestellt habe (dies war besonders bei denjenigen der Fall, die von der Situationistischen Internationalen beeinflusst waren, welche keine Verbindung zwischen dem Klassenkampf und dem Zustand der kapitalistischen Wirtschaft sah, die gerade in eine neue Phase, die der offenen Krise, eintrat). Doch so wie der ‚Geist von 68‘, die studentischen, rätekommunistischen oder anarchistischen Vorurteile in Bezug auf die Aufgaben und Funktionsweise einer revolutionären Organisation ein beträchtliches Gewicht auf die junge IKS ausübten, so drückten sich diese Einflüsse auch auf ihre Auffassung über den neuen historischen Kurs aus. Die absolut notwendige Verkündung eines neuen historischen Kurses, den der proletarischen Wiedererweckung, tendierte dahin, mit einer Unterschätzung der immensen Schwierigkeiten zusammenzufallen, die vor der internationalen Arbeiterklasse lagen. Dies drückte sich auf vielerlei Weise aus:
- in der Neigung zu vergessen, dass die Entwicklung des Klassenkampfes per se ein unsteter Prozess ist, der Fortschritte und Niederlagen durchmisst, und somit eine mehr oder weniger ununterbrochene Entwicklung zu revolutionären Kämpfen zu erwarten – eine Aussicht, die in gewisser Weise im oben genannten Zitat von Internacionalismo enthalten ist;
- in der Unterschätzung der Fähigkeit der Bourgeoisie, den Verlauf der Krise stufenweise zu gestalten, vielfältige staatskapitalistische Mechanismen zu nutzen, um die Heftigkeit der Krisenfolgen besonders für die zentralen proletarischen Konzentrationen zu reduzieren;
- in der Definition des neuen Kurses als einen ”Kurs zur Revolution”, was beinhaltet, dass das Wiedererwachen der Klasse unvermeidlich in einer revolutionären Konfrontation mit dem Kapital kulminieren würde;
- damit verknüpft war die – im damaligen Milieu sehr starke – Konzentration auf die Frage der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus. Diese Debatte war keineswegs irrelevant, besonders da sie Teil der Bemühungen des neuen Milieus war, sich die Lehren und Traditionen der vergangenen Bewegung wiederanzueignen. Doch die Leidenschaft, mit der sie geführt wurde (was beispielsweise zu Spaltungen zwischen verschiedenen Elementen des Milieus führte), drückte auch eine gewisse Naivität über die Schwierigkeiten aus, eine solche Periode erst einmal zu erreichen, in der solche Fragen wie die Form des Übergangsstaates zu einem akuten Problem für die Arbeiterklasse werden.
In den nächsten Jahrzehnten wurden die Analysen der IKS verfeinert und weiterentwickelt. Es begann die Arbeit der Untersuchung der bürgerlichen Mechanismen zur ‚Kontrolle‘ der Krise und somit der Gründe, warum die Krise unvermeidbar ein lang hingezogener und unsteter Prozess sein wird. Gleichfalls wurde sie nach den Rückflüssen Mitte der 70er Jahre und Anfang der 80er dazu gezwungen anzuerkennen, dass innerhalb des Rahmens einer allgemein aufwärts weisenden historischen Kurve des Klassenkampfes es da und dort wichtige Phasen des Rückzugs geben wird. Ferner hat die IKS 1983 ausdrücklich anerkannt, dass der historische Kurs von keinem Automatismus geregelt wird; so hat sie auf ihrem 5. Kongress eine Resolution verabschiedet, welche den Begriff ”Kurs zur Revolution” kritisierte:
”Die Existenz eines Kurses zu Klassenkonfrontationen bedeutet, dass die Bourgeoisie die Hände nicht frei hat, um ein neues imperialistisches Gemetzel auszulösen: Zunächst muss sie die Arbeiterklasse konfrontieren und schlagen. Aber dies nimmt nicht das Ergebnis dieser Konfrontationen in der einen oder anderen Weise vorweg. Deshalb ist es vorzuziehen, über einen ‚Kurs zu Klassenkonfrontationen‘ zu sprechen statt über einen ‚Kurs zur Revolution‘.” (Resolution über die internationale Lage, veröffentlicht in International Review Nr. 35)
Innerhalb des Milieus verstärkten jedoch die Schwierigkeiten und Rückschläge, die das Proletariat erlitten hatte, die skeptischen und pessimistischen Ansichten, denen sich lange Zeit die ‚italienischen‘ Gruppen verschrieben hatten. Dies kam besonders während der internationalen Konferenzen Ende der 70er Jahre zum Ausdruck, als sich die Communist Workers‘ Organisation (Nachfolgerin der Gruppe um Revolutionary Perspectives) die Ansichten von Battaglia zu Eigen machte, indem sie die Auffassung der IKS ablehnte, dass der Klassenkampf eine Barriere zum Weltkrieg bildet. Die CWO schwankte in ihrer Erläuterung, warum denn der Krieg noch nicht ausgebrochen ist, von der Behauptung, die Krise sei noch nicht tief genug, in dem einen Moment zu der Idee im nächsten Moment, dass die Blöcke in jüngerer Vergangenheit nicht mehr der Vernunft der russischen Bourgeoisie entsprochen hätten, die erkannt habe, dass sie einen Krieg nicht gewinnen kann. Kurz: Alles, nur nicht der Klassenkampf!
Es gab auch innerhalb der IKS selbst ein Echo auf diesen Pessimismus; die spätere Tendenz GCI (2) und insbesondere RC (3), der ähnliche Ansichten übernahm, gingen durch eine Phase, in der sie ‚päpstlicher als Papst‘, sprich: Bilan, waren und argumentierten, dass wir uns auf den Kurs Richtung Krieg befänden.
Ende der 70er Jahre musste daher der erste wichtige Text der IKS über den historischen Kurs, der auf dem 3. Kongress angenommen und in International Review Nr. 18 veröffentlicht wurde, unsere Position gegen den Empirizismus und Skeptizismus definieren, die das Milieu zu beherrschen begannen.
Der Text kreuzte die Klinge mit allen Konfusionen innerhalb des Milieus:
- die im Empirizismus verwurzelte Idee, dass es unmöglich für Revolutionäre sei, allgemeine Voraussagen über den Kurs des Klassenkampfes zu treffen. Gegen diesen Einwand unterstrich der Text die Tatsache, dass ihre Fähigkeit, die künftige Perspektive – und nicht nur die allgemeine Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei – zu definieren, eines der erklärten Charakteristiken des Marxismus ist und stets gewesen war. Im Einzelnen beharrte der Text darauf, dass Marxisten ihre Arbeit stets auf die Fähigkeit gegründet haben, das besondere Kräfteverhältnis zwischen den Klassen in einem gegebenen Zeitraum zu erfassen, wie wir im ersten Teil dieses Berichts bereits sahen. Aus dem gleichen Grunde zeigt der Text auf, dass die Unfähigkeit, die Natur des Kurses zu erkennen, frühere Revolutionäre zu ernsthaften Irrtümern verleitet hatte;
- eine Steigerung dieser agnostischen Ansicht war das besonders vom IBRP vertretene Konzept eines ‚parallelen‘ Kurses zur Revolution und zum Krieg. Wir haben bereits gesehen, wie diese von Bilan und der GCF praktizierte Herangehensweise solch einen Begriff ausschloss; der Text des Dritten Kongresses fährt fort zu argumentieren, dass solch ein Konzept das Resultat des Außerachtlassens der marxistischen Methode selbst sei.
”Erst kürzlich sind noch andere Theorien aufgekommen, denen zufolge ‚mit der Entwicklung der Krise des Kapitalismus beide Ausdrücke des Widerspruchs gleichzeitig verstärkt wurden: Krieg und Revolution schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern entwickeln sich simultan und parallel, ohne dass es für uns möglich wäre zu wissen, welcher vor dem anderen seinen Höhepunkt erreicht‘. Der Hauptirrtum in dieser Konzeption ist, dass sie den Faktor des Klassenkampfes im gesellschaftlichen Leben vernachlässigt, so wie die Auffassung, die die Italienische Linke entwickelte (die Theorie der Kriegswirtschaft), auf einer Überschätzung dieses Faktors basierte. Ausgehend von der Formulierung im Manifest, wonach ‚die Geschichte aller bisher existierenden Gesellschaften die Geschichte von Klassenkämpfen‘ ist, wendete die Italienische Linke dies mechanisch auf die Analysen des imperialistischen Krieges an und erblickte im imperialistischen Krieg eine Antwort auf den Klassenkampf; sie vermochte nicht zu sehen, dass im Gegenteil der imperialistische Krieg nur dank der Abwesenheit oder Schwächung des Klassenkampfes stattfinden kann. Obwohl sie falsch war, ging diese Auffassung von richtigen Prämissen aus; der Fehler lag in der Weise, wie diese Voraussetzungen angewendet wurden. Im Gegensatz dazu räumt die Theorie von dem ‚parallelen und simultanen Kurs sowohl zum Krieg als auch zur Revolution‘ diese fundamentale marxistische Ausgangsbedingung völlig beiseite, da sie der Ansicht ist, dass beide prinzipiellen antagonistischen Klassen in der Gesellschaft ihre eigenen Antworten – imperialistischer Krieg für die eine, Revolution für die andere – völlig unabhängig voneinander, vom Kräfteverhältnis zwischen beiden, von den Konfrontationen und Zusammenstößen zwischen beiden vorbereiten können. Wenn es nicht zur Bestimmung der gesamten historischen Alternative für das gesellschaftliche Leben angewendet werden kann, dann hat das Schema des Kommunistischen Manifestes keinen Daseinsgrund, und wir können den Marxismus neben anderen aus der Mode gekommenen Produkten menschlicher Phantasie im Museum ausstellen.”
Schließlich greift der Text die Argumentation derjenigen auf, die offen über einen Kurs zum Krieg sprachen – ein Argument, das sich einer kurzen Beliebtheit erfreute, das aber seine Stoßkraft mit dem Zusammenbruch des einen der am Krieg beteiligten Blöcke verlor.
In vielerlei Hinsicht hat die Debatte innerhalb des proletarischen Milieus über den historischen Kurs keine großen Fortschritte gemacht, seitdem dieser Text verfasst worden war. 1985 verfasste die IKS eine weitere Kritik am Konzept des parallelen Kurses, das in einem vom 5. Kongress von Battaglia Comunista stammenden Dokument vertreten wurde (International Review Nr. 85: ”The 80s are not the 30s”). In den 90er Jahren wurde in Texten des IBRP erneut sowohl die ‚agnostische‘ Sichtweise, die die Fähigkeit der Marxisten zu allgemeinen Vorhersagen über die Dynamik der kapitalistischen Gesellschaft anzweifelt, als auch der eng damit verknüpfte Begriff des parallelen Kurses bestätigt. So zitierte die CWO in einer Polemik über die Bedeutung vom Mai 68 in Revolutionary Perspectives Nr. 12 einen Artikel aus World Revolution Nr. 216, der eine Diskussion zusammenfasste, die auf einem unserer Londoner Foren über dieses Thema stattgefunden hat. Unserer Artikel hebt hervor, dass ”die offensichtliche Verneinung der Möglichkeit der Vorhersage des allgemeinen Verlaufs der Ereignisse durch die CWO auch eine Ablehnung der Arbeit bedeutet, die auf diesem überlebenswichtigen Gebiet von den Marxisten in der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung ausgeführt worden war”. Die Antwort der CWO ist äußerst lustig: ”Wenn dies der Fall wäre, dann hätten die Marxisten einen schlechten Ruf. Vergessen wir dabei einmal das gebräuchliche (aber irrelevante) Beispiel von Marx nach den Revolutionen von 1848 und schauen stattdessen auf die Italienische Linke in den 30er Jahren. Während sie manch gute Arbeit bei dem Versuch verrichtete, mit der fürchterlichen Niederlage der revolutionären Welle nach dem Ersten Weltkrieg klar zu kommen, theoretisierte sie sich noch vor dem zweiten imperialistischen Gemetzel um ihre eigene Existenz.” ‚Vergessen‘ wir einmal das unglaublich gönnerhafte Verhalten gegenüber der gesamten marxistischen Bewegung: Was wirklich bemerkenswert ist, ist die Unfähigkeit der CWO zu begreifen, dass die Italienische Linke genau aus dem Grunde, weil sie ihre frühere Klarheit über den historischen Kurs verloren hatte, am Vorabend des Krieges ”sich um die eigene Existenz theoretisierte”, wie wir im ersten Teil des Berichts sahen.
Was die bordigistischen Gruppierungen anbetrifft, so ist es kaum ihr Stil, an Debatten zwischen den Gruppen des Milieus teilzunehmen, doch in einem kürzlichen Briefwechsel zwischen einem Kontakt in Australien und unseren beiden Organisationen wies die Gruppe Programma die Möglichkeit von der Hand, dass die Arbeiterklasse eine Barriere zum Weltkrieg sei. Ihre Spekulationen darüber, ob die Wirtschaftskrise in einem Krieg oder in einer Revolution endet, unterscheiden sich inhaltlich nicht von jenen des IBRP.
Wenn sich irgendetwas in der vom IBRP vorgestellten Position geändert hat, dann ist es die Bösartigkeit ihrer Polemik gegen die IKS. Während in der Vergangenheit unsere ”rätekommunistische” Sichtweise der Partei ein Vorwand für den Abbruch der Diskussionen mit der IKS war, konzentrieren sich in der jüngsten Zeit die Gründe für die Ablehnung jeglicher vereinter Bemühungen noch viel schärfer auf unsere Differenzen über den historischen Kurs. Unsere Ansichten in dieser Frage werden als Hauptbeweis für unsere idealistische Methode und für unsere Loslösung von der Realität betrachtet. Ferner sei, gemäß des IBRP, der Schiffbruch unserer historischen Perspektiven, unseres Konzeptes über die ‚Jahre der Wahrheit‘, der wahre Grund für die jüngste Krise in der IKS und die ganze Debatte über die Funktionsweise im Kern eine Ablenkung von dieser zentralen Frage.
Die Folgen des Zerfalls
Auch wenn sich die Debatte innerhalb des Milieus nur wenig entwickelt hat – die Realität hat dies zweifellos getan. Der Eintritt des dekadenten Kapitalismus in seine Zerfallsphase hat die Art, sich der Frage des historischen Kurses zu nähern, zutiefst verändert.
Das IBRP hat uns lange vorgehalten, wir behaupteten, dass die ‚Jahre der Wahrheit‘ bedeuteten, dass die Revolution in den 80er Jahre ausbrechen würde. Was sagten wir wirklich? Im Originalartikel ”Die 80er Jahre – Jahre der Wahrheit” (Internationale Revue Nr. ) argumentierten wir, dass angesichts einer tiefen Verschärfung der Krise und einer Intensivierung der imperialistischen Spannungen, die mit der russischen Invasion Afghanistans deutlich wurde, die kapitalistische Klasse mehr und mehr dazu gezwungen wurde, die Sprache des Trostes und der Illusionen über Bord zu werfen und stattdessen die ‚Sprache der Wahrheit‘, den Ruf nach Blut, Schweiß und Tränen zu gebrauchen, und wir legten uns auf die folgende Vorhersage fest: ”Im heute beginnenden Jahrzehnt wird über die historische Alternative entschieden werden: Entweder wird das Proletariat seine Offensive fortsetzen, mit der Lahmlegung des mörderischen Arms des Kapitalismus in seiner Agonie fortfahren und seine Kräfte zu sammeln, um das System zu zerstören, oder es wird von den Reden und der Repression in die Falle gelockt, ausgelaugt, demoralisiert werden, womit der Weg frei wäre für einen neuen Holocaust, der die Eliminierung der menschlichen Gesellschaft riskiert.”
Es gibt hier gewisse Zweideutigkeiten, besonders was die Suggestion betrifft, dass der proletarische Kampf sich bereits in der Offensive befindet, eine fehlerhafte Formulierung, die aus der bereits angesprochenen Neigung entspringt, die Schwierigkeiten zu unterschätzen, denen sich eine Arbeiterklasse gegenübersieht, die sich von einem defensiven zu einem offensiven Kampf (in anderen Worten: zur politischen Konfrontation mit dem kapitalistischen Staat) bewegt. Doch dessen ungeachtet verbirgt sich hinter dem Begriff der Jahre der Wahrheit eine tiefe Einsicht. Die 80er Jahre sollten sich als ein entscheidendes Jahrzehnt erweisen, aber nicht ganz in dem Sinn, wie der Text es sich vorstellt. Wofür dieses Jahrzehnt steht, war nicht ein entscheidender Fortschritt der einen oder anderen Hauptklasse, sondern eine gesellschaftliche Pattsituation, die in den Prozess des Zerfalls mündete, der eine zentrale und charakteristische Rolle in der gesellschaftlichen Entwicklung einnimmt. So begann dieses Jahrzehnt mit der russischen Invasion Afghanistans, die eine Verschärfung der imperialistischen Spannungen provozierte; doch diesem Ereignis folgten die Massenstreiks in Polen auf dem Fuß, die sehr deutlich demonstrierten, dass es dem russischen Block gleichsam unmöglich war, für den Krieg zu mobilisieren. Der polnische Kampf warf jedoch auch ein Schlaglicht auf die chronische politische Schwäche der Arbeiterklasse. Nicht nur die polnischen Arbeiter standen angesichts der tief sitzenden Mystifikationen, die vom Stalinismus (und der Reaktion gegen ihn) in die Welt gesetzt worden waren, vor besonderen Problemen bei der Politisierung ihres Kampfes in einem proletarischen Sinne; auch die Arbeiter im Westen erwiesen sich, obschon sie in ihren Kämpfen während der 80er Jahre beträchtliche Fortschritte gemacht hatten, als unfähig, eine klare politische Perspektive zu entwickeln. Ihre Bewegung wurde somit vom Zusammenbruch des Stalinismus ‚überwältigt‘; etwas allgemeiner gefasst, sollte der endgültige Beginn der Zerfallsphase die Klasse vor gewaltige Probleme stellen, da Erstere bei fast jeder Wendung den Rückgang im Bewusstsein verstärkte, welcher aus den Ereignissen 1989-91 resultierte.
Mit einem Wort, der Beginn des Zerfalls ist ein Resultat des historischen Kurses, so wie ihn die IKS seit den 60er Jahren festgestellt hatte, da er z.T. durch die Unfähigkeit der Bourgeoisie bedingt ist, die Gesellschaft für den Krieg zu mobilisieren. Aber er hat uns gleichfalls dazu gezwungen, das Problem des historischen Kurses in einer neuen und unvorhergesehene Weise zu stellen:
- Zunächst einmal wurde die Auflösung der beiden imperialistischen Blöcke, die 1945 gebildet worden waren, und die in Gang gesetzte Dynamik des ‚Jeder für sich selbst‘ – sowohl Ausdruck als auch Resultat des Zerfalls – zu einem neuen Faktor, der die Möglichkeit eines Weltkrieges erschwert. Während sich die imperialistischen Spannungen verschärften, hat diese neue Dynamik der Tendenz zur Bildung neuer Blöcke entgegengewirkt. Ohne die Existenz von Blöcken, ohne ein neues Machtzentrum, das zur direkten Herausforderung der US-Hegemonie imstande wäre, ist eine Schlüsselbedingung für die Auslösung eines Weltkrieges nicht vorhanden.
- Gleichzeitig ist diese Entwicklung wenig tröstlich für die Sache des Kommunismus, da sie eine Situation geschaffen hat, in der die Basis einer neuen Gesellschaft auch ohne Weltkrieg und somit ohne die Notwendigkeit, das Proletariat für den Krieg zu mobilisieren, untergraben werden kann. Im ersten Szenario ist es der Nuklearkrieg, der die Möglichkeit des Kommunismus definitiv aufs Spiel setzt, indem er den Planeten oder zumindest einen großen Teil der globalen Produktivkräfte, einschließlich des Proletariats, zerstört. Das neue Szenario sieht die Möglichkeit eines langsameren, aber nicht weniger tödlichen Rutsches in einen Zustand vor, in dem das Proletariat irreparabel zersplittert ist und die natürlichen sowie wirtschaftlichen Fundamente für die gesellschaftliche Umwandlung durch die Zunahme von lokalen und regionalen militärischen Konflikten, von Umweltkatastrophen und durch den gesellschaftlichen Zusammenbruch gleichermaßen ruiniert werden. Ferner kann das Proletariat zwar auf seinem eigenen Terrain gegen den Krieg kämpfen, doch ist dies mit Blick auf die Auswirkungen des Zerfalls weitaus schwieriger.
Dies wird besonders am ‚ökologischen‘ Aspekt des Zerfalls deutlich: Obgleich die Zerstörung der natürlichen Umwelt für sich schon zu einer wirklichen Bedrohung für das Überleben der Menschheit geworden ist – eine Bedrohung, die teilweise von der Arbeiterbewegung bis in die letzten Jahrzehnte hinein nur flüchtig wahrgenommen worden war -, handelt es sich hierbei um einen Prozess, den das Proletariat kaum ‚blockieren‘ kann, ehe es die politische Macht auf Weltebene übernommen hat. Kämpfe in Bereichen wie die Umweltverschmutzung sind durchaus auf Klassenbasis möglich, doch sie gehören aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu den Hauptfaktoren zur Stimulierung des proletarischen Widerstandes.
Wir sehen also, dass der Zerfall des Kapitalismus die Arbeiterklasse in eine schlechtere Lage versetzt als zuvor. In der vorherigen Situation war eine frontale Niederlage der Arbeiterklasse erforderlich, ein Sieg der Bourgeoisie in einer Konfrontation Klasse gegen Klasse, ehe alle Bedingungen für den Weltkrieg vereint sind. Im Rahmen des Zerfalls kann die ‚Niederlage‘ des Proletariats allmählicher, heimtückischer und weitaus weniger zu widerstehen sein. Und ganz zuoberst haben die Auswirkungen des Zerfalls, wie wir oft festgestellt haben, eine zutiefst negative Auswirkung auf das Bewusstsein des Proletariats, auf seinen Sinn für sich selbst, da sie in all ihren verschiedenen Aspekten – die Bandenmentalität, Rassismus, Kriminalität, Drogenmissbrauch, etc. – dazu dienen, die Klasse zu atomisieren, die Spaltungen in ihren Reihen zu vergrößern und sie im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf aufzulösen.
Konfrontiert mit dieser äußerst bedeutenden Veränderung in der Weltlage, erweist sich die Antwort des proletarischen Milieus als völlig unzureichend. Obwohl sie die Auswirkungen des Zerfalls erkennen, sind die Gruppen des Milieus nicht in der Lage, seine Wurzeln – da sie den Begriff des Patts zwischen den Klassen ablehnen – oder seine tatsächliche Gefahr zu sehen. So tut das IBRP die Zerfallstheorie der IKS als nichts Anderes als eine Beschreibung des ”Chaos” ab, was praktisch darauf hinausläuft, nach Möglichkeiten für eine Stabilisierung des Kapitalismus zu suchen. Dies wird zum Beispiel an seiner Auffassung offensichtlich, dass das ”internationale Kapital” nach Frieden in Nordirland trachtet, um friedlich die Früchte der Ausbeutung genießen zu können, doch wird es ebenso deutlich in seiner Ansicht, dass um die Pole der wirtschaftlichen Konkurrenz (USA, Europäische Union, etc.) herum neue Blöcke im Entstehen begriffen sind. Obwohl diese Sichtweise (mit ihrer Weigerung, irgendeine langfristige ”Vorhersage” zu machen) durchaus die Idee eines nahenden Krieges enthalten kann, ist sie häufiger mit einem rührenden Glauben an die Vernunft der Bourgeoisie verknüpft: Da die neuen ”Blöcke” eher ökonomische denn militärische Gebilde sind und da wir nun in eine neue Periode der ”Globalisierung” eingetreten sind, ist die Tür zumindest halb offen für die Vorstellung, dass diese Blöcke, indem sie im Interesse des ”internationalen Kapitals” handeln, eine allseits nützliche Stabilisierung der Welt bis in eine unbestimmte Zukunft hinein erreichen könnten.
Die Ablehnung der Theorie des Zerfalls kann nur in eine Unterschätzung der Gefahren münden, denen die Arbeiterklasse gegenübersteht. Sie unterschätzt das Ausmaß der Barbarei und des Chaos‘, in der sich der Kapitalismus bereits befindet; sie neigt dazu, die Gefahr herunterzuspielen, dass das Proletariat durch die Auflösung des gesellschaftlichen Lebens fortschreitend unterminiert wird; und sie vermag nicht deutlich zu registrieren, dass die Menschheit auch ohne einen dritten Weltkrieg vernichtet werden kann.
Wo stehen wir?
Der Beginn der Zerfallsperiode hat somit die Art und Weise verändert, in der wir die Frage nach dem historischen Kurs stellen. Aber sie hat sie nicht irrelevant gemacht – im Gegenteil. Tatsächlich ist man geneigt, sich noch schärfer auf die zentrale Frage zu konzentrieren: Ist es schon zu spät? Ist das Proletariat bereits besiegt worden? Gibt es irgendein Hindernis gegen den Abstieg in die totale Barbarei? Wie wir gesagt haben, ist eine Beantwortung dieser Fragen heute weniger leicht als in einer Periode, in der der Weltkrieg noch eine konkrete Option für die Bourgeoisie war. So war Bilan beispielsweise in der Lage, nicht nur auf die blutige Niederlage der proletarischen Erhebungen und den folgenden konterrevolutionären Terror in jenen Ländern, wo die Revolution am weitesten gediehen war, hinzuweisen, sondern auch auf die nachfolgende ideologische Kriegsmobilisierung und auf das ‚positive‘ Echo in der Arbeiterklasse gegenüber dem Säbelrasseln der herrschenden Klasse (Faschismus, Demokratie, etc.). Unter den gegenwärtigen Umständen, wo der kapitalistische Zerfall das Proletariat ohne eine einzige direkte Niederlage und ohne diese Art von ‚positiver‘ Mobilisierung verschlingen kann, sind die Zeichen einer unumkehrbaren Niederlage schwerer zu definieren. Nichtsdestotrotz liegt der Schlüssel zum Verständnis des Problems dort, wo er sich schon 1923 oder, wie wir in den Analysen der GCF sahen, 1945 befand – in den zentralen Konzentrationen des Weltproletariats und vor allem in Westeuropa. Haben diese Sektoren in den 80er Jahren (oder, wie es einige gern haben möchten, in den 70ern) ihr letztes Wort gesprochen, oder bergen sie noch genügend Kampfreserven und ein ausreichendes Potenzial für die Entwicklung des Klassenbewusstseins, um sicherzustellen, dass die wichtigen Klassenkonfrontationen noch auf der Tagesordnung der Geschichte stehen?
Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, eine vorläufige Bilanz des letzten Jahrzehnts zu ziehen – der Periode seit dem Kollaps des Ostblocks und dem endgültigen Beginn der Zerfallsphase.
Das Problem ist, dass die ‚Schnittmuster‘ des Klassenkampfes seit 1989 sich von jenen in der Periode nach 1968 unterscheiden. Während jener Periode gab es klar identifizierbare Wellen des Kampfes, mit ihrem Epizentrum in den kapitalistischen Hauptzentren, auch wenn die Schockwellen über den gesamten Globus gingen. Ferner war es möglich, diese Bewegungen zu analysieren und den Fortschritt kenntlich zu machen, den das Klassenbewusstsein in ihnen machte – zum Beispiel über die Gewerkschaftsfrage oder ihr Fortschritt bezüglich des Massenstreiks.
Ferner war es nicht allein die revolutionäre Minderheit, die diese Reflexionen anstellte. Während der verschiedenen Wellen des Kampfes war es offenkundig, dass Kämpfe in dem einen Land direkt Kämpfe in einem anderen Land anregen konnten (beispielsweise die Verbindung zwischen Mai 68 und Italien 69, zwischen Polen 1980 und den folgenden Bewegungen in Italien, zwischen den großen Bewegungen in Belgien in den 80ern und den Arbeiterreaktionen in den benachbarten Ländern). Gleichzeitig war ersichtlich, dass Arbeiter Lehren aus den vorausgegangenen Bewegungen zogen – zum Beispiel in Großbritannien, wo die Niederlage des Bergarbeiterstreiks ein Nachdenken in der Klasse über die Notwendigkeit auslöste, nicht in die Falle lang hingezogener und isolierter Streiks zu laufen, oder in Frankreich und Italien 1986 und 1987, wo verstärkt versucht wurde, sich außerhalb der Gewerkschaften zu organisieren.
Die Situation seit 1989 zeichnete sich nicht durch offen ersichtliche Fortschritte im Klassenbewusstsein aus. Dies soll nicht heißen, dass die Bewegung in den 90er Jahren völlig nichtssagend war. Im Bericht über den Klassenkampf auf dem 13. Kongress stellten wir die prinzipiellen Phasen heraus, die die Bewegung durchlaufen hat:
- der mächtige Einfluss des Zusammenbruchs des Ostblocks, der durch die pausenlosen Kampagnen der Bourgeoisie über den Tod des Kommunismus multipliziert wurde. Dieses historische Ereignis brachte die dritte Welle von Kämpfen zu einem plötzlichen Ende und leitete einen starken Rückgang sowohl im Bewusstsein als auch in der Klassenmilitanz ein, Auswirkungen, mit denen wir es immer noch tun haben, besonders in der Frage des Bewusstseins;
- die Tendenz zur Wiederbelebung der Militanz nach 1992, mit den Kämpfen in Italien, denen 1993 Kämpfe in Deutschland und Großbritannien folgten;
- die großen Manöver der Bourgeoisie in Frankreich 1995, die das Vorbild für ähnliche Operationen in Belgien und Deutschland waren. Hier fühlte sich die herrschende Klasse stark genug, um landesweite Bewegungen zu provozieren, in der Absicht, das Bild der Gewerkschaften aufzupolieren. In diesem Sinne waren diese Bewegungen ein Produkt sowohl der Unordnung innerhalb der Klasse als auch der Erkenntnis der Bourgeoisie, dass diese Unordnung nicht ewig dauert und dass glaubwürdige Gewerkschaften ein sehr wichtiges Instrument zur Kontrolle künftiger Ausbrüche des Klassenwiderstands sind.
- die langsame, aber faktische Entwicklung von Unzufriedenheit und Militanz innerhalb der Arbeiterklasse angesichts der sich vertiefenden Krise wurde nach 1998, mit den massiven Streiks in Dänemark und Norwegen sowie einer Reihe von Kämpfen in den USA, Großbritannien und Frankreich so wie in peripheren Ländern wie Korea, China und Simbabwe, mit großem Nachdruck bekräftigt. Dieser Prozess ist ferner in den vergangenen Jahren durch die Demonstrationen der Transportarbeiter in New York, die Kämpfe der Postangestellten in Großbritannien und Frankreich und insbesondere durch den wichtigen Ausbruch von Kämpfen in Belgien im Herbst 2000 veranschaulicht worden, als wir so manch wirkliches Anzeichen nicht nur einer allgemeinen Unzufriedenheit, sondern auch einer Unzufriedenheit mit der gewerkschaftlichen Führung des Kampfes beobachten konnten.
Keine dieser Bewegungen hatte jedoch einen Einfluss bzw. ein Ausmaß erreicht, mit dem sie imstande gewesen wäre, den massiven ideologischen Kampagnen der Bourgeoisie über das Ende des Klassenkampfes wirklich etwas entgegenzusetzen oder den Arbeitern in der ganzen Welt neues Vertrauen in sich selbst und in ihre eigenen Kampfmethoden einzuflößen; keine von ihnen war vergleichbar mit den Ereignissen vom Mai 68 oder mit dem Massenstreik in Polen 1980 oder selbst mit den ständigen Kämpfen in den 80er Jahren. Selbst die wichtigsten Kämpfe ernteten nur ein geringes Echo innerhalb des Rests der Klasse: Das Phänomen, dass die Kämpfe in einem Land auf Bewegungen anderswo ‚antworten‘, scheint nahezu nichtexistent zu sein. Unter diesen Umständen ist es selbst für die Revolutionäre schwierig, ein klares Strickmuster oder definitive Anzeichen von Fortschritt im Klassenkampf der 90er Jahre zu erkennen. Für die Klasse im Allgemeinen trug die zersplitterte und separate Natur der Kämpfe – zumindest oberflächlich - wenig dazu bei, das Selbstvertrauen des Proletariats, sein Bewusstsein über sich selbst als eine besondere gesellschaftliche Kraft, als eine internationale Klasse mit dem Potenzial, die herrschende Ordnung herauszufordern, zu verstärken oder zu erneuern.
Diese Tendenz unter den desorientierten Arbeitern, den Blick für ihre spezifische Klassenidentität zu verlieren und angesichts einer immer schwierigeren Weltlage sich im Großen und Ganzen machtlos zu fühlen, ist das Ergebnis einer Reihe von miteinander verwobenen Faktoren. Zuunterst ist – und dies ist ein Faktor, der von den Revolutionären immer etwas unterschätzt wurde, eben weil er so elementar ist – die grundsätzliche Stellung der Arbeiterklasse als eine ausgebeutete Klasse, die unter dem Gewicht der gesamten Ideologie der herrschenden Klasse leidet. Zuoberst dieses ‚unveränderlichen‘ Faktors im Leben der Arbeiterklasse stehen die Auswirkungen des Dramas des 20. Jahrhunderts – die Niederlage der revolutionären Welle, die lange Nacht der Konterrevolution und das Beinahe-Verschwinden der organisierten proletarischen Bewegung während dieser Periode. Diese Faktoren bleiben wegen ihrer Natur auch in der Zerfallsphase äußerst mächtig; in der Tat, wenn überhaupt, dann verstärkten sie seine negativen Einflüsse, so wie die negativen Einflüsse sie verstärken. Dies wird besonders an den antikommunistischen Kampagnen deutlich: Historisch stammen sie aus den Erfahrungen der stalinistischen Konterrevolution, die als erste die Lüge verbreitete, Stalinismus ist gleich Kommunismus. Doch der Zusammenbruch des Stalinismus – ein Produkt des Zerfalls par excellence – wird nun seinerseits von der Bourgeoisie dazu benutzt, um auch weiterhin die Botschaft an den Mann zu bringen, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gibt und dass es mit der Klasse vorbei ist.
Um jedoch die besonderen Schwierigkeiten zu begreifen, mit denen es das Proletariat in dieser Phase zu tun hat, ist es notwendig, sich auf die spezifischeren Auswirkungen des Zerfalls auf den Klassenkampf zu konzentrieren. Ohne in die Details zu gehen, über die wir in vielen anderen Texten zu diesem Problem bereits geschrieben haben, können wir sagen, dass diese Auswirkungen auf zwei Ebenen stattfinden: An erster Stelle gibt es die wirklichen materiellen Auswirkungen der Zerfallsphase, an zweiter Stelle steht die Art und Weise, wie die herrschende Klasse diese Auswirkungen benutzt, um die Desorientierungen der ausgebeuteten Klasse zu verstärken. Einige Beispiele:
- der Prozess der Desintegration, der durch die massive und andauernde Arbeitslosigkeit besonders unter den jungen Menschen, durch die Auflösung traditioneller militanter Arbeiterkonzentrationen im Herzen der Industrie hervorgerufen wurde, was die Atomisierung und die Konkurrenz unter den Arbeitern intensivierte. Dieser objektive Prozess, der direkt mit der Wirtschaftskrise verknüpft ist, wird schließlich durch die ideologischen Kampagnen über die ‚postindustrielle Gesellschaft‘ und über das Außer-Mode-kommen des Proletariats weiter verstärkt. Dieser Prozess ist von etlichen Elementen aus dem proletarischen Milieu oder dem Sumpf als ‚Neuzusammensetzung‘ des Proletariats bezeichnet worden; tatsächlich rührt solch eine Terminologie, ähnlich wie die Neigung, in der Globalisierung eine neue Stufe in der kapitalistischen Gesellschaft zu betrachten, aus einer ernsthaften Unterschätzung der Gefahren her, denen sich die Klasse gegenübersieht. Die Fragmentierung der Klassenidentität, die wir besonders im letzten Jahrzehnt erlebt haben, ist kein irgendwie gearteter Fortschritt, sondern eine Manifestation des Zerfalls, die immense Gefahren für die Arbeiterklasse in sich birgt.
- die Kriege, die sich in den Peripherien des Systems ausbreiteten und die sich immer mehr den Kernländern des Kapitals nähern, sind offenkundig eine klare Äußerung des Zerfallsprozesses und beherbergen eine direkte Drohung an das Proletariat in jenen Gebieten, die sie verwüsten, sowohl wegen des Gemetzels und der Zerstörung, die sie begleiten, als auch wegen der ideologischen Vergiftung der Arbeiter, die für diese Konflikte mobilisiert werden. Die Lage im Nahen Osten beweist Letzteres in aller Deutlichkeit. Doch die herrschende Klasse in den Hauptzentren des Kapitals schlägt auch aus diesen Konflikten einen Nutzen – nicht nur bei der Weiterverfolgung ihrer imperialistischen Interessen, sondern auch bei der Verstärkung ihrer Angriffe auf das Bewusstsein der zentralem Bataillone des Proletariats, indem sie Gefühle der Machtlosigkeit, der Abhängigkeit von den ‚demokratischen‘ und ‚humanitären‘ Staaten bei der Lösung der globalen Probleme usw. verstärkt.
- ein anderes wichtiges Beispiel ist der Prozess der ‚Kriminalisierung‘, der sich im letzten Jahrzehnt enorm ausgeweitet hat. Dieser Prozess schließt sowohl die höheren Ränge der herrschenden Klasse (die russische Mafia ist nur die Karikatur eines viel weiter verbreiteten Phänomens) als auch die niederen Schichten der Gesellschaft einschließlich einer beträchtlichen Menge proletarischer Jugendlicher mit ein. Dies ist überall der Fall, ob wir auf Länder wie Sierra Leone, wo Bandenrivalitäten Teil des interimperialistischen Konflikts sind, oder auf die Innenstädte in den entwickelten Ländern schauen, wo nur die Straßenbanden den am meisten marginalisierten Gesellschaftsbereichen ‚Gemeinschaft‘ und eine Quelle des Lebensunterhalts anzubieten scheinen. Gleichzeitig hat die herrschende Klasse, während sie diese Banden zur Organisierung der ‚gesetzwidrigen‘ Seite ihres Geschäfts (Waffen-, Drogenhandel, etc.) benutzt, nicht gezögert, die ‚Gangsta‘-Ideologie mit Musik, Film oder Mode zu verbinden und sie als eine Art falsche Rebellion zu kultivieren, die jeglichen Zugehörigkeitssinn zur Klasse auslöscht, indem die Identität der Bande, ob sie durch lokale, rassische, religiöse oder andere Kategorien bestimmt ist, überhöht wird.
Es könnten noch weitere Beispiele genannt werden; doch letztendlich geht es darum, die beträchtliche Reichweite und Wirkung jener Kräfte hervorzuheben, die in jüngster Zeit als Gegengewicht zur proletarischen Selbstkonstituierung als Klasse fungieren. Nichtsdestotrotz müssen Revolutionäre gegen all die Drangsalierungen, gegen alle Kräfte, die behaupten, das Proletariat sei tot und begraben, weiter darauf bestehen, dass die Arbeiterklasse nicht verschwunden ist, dass der Kapitalismus nicht ohne Proletariat existieren kann und dass das Proletariat nicht ohne den Kampf gegen das Kapital existieren kann. Dies ist elementar für jeden Kommunisten. Doch die Besonderheit der IKS besteht darin, dass sie bereit ist, sich der Analyse des historischen Kurses und des allgemeinen Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen anzuvertrauen. Und an dieser Stelle muss festgestellt werden, dass das Weltproletariat zu Beginn des 21. Jahrhunderts trotz all der Widrigkeiten, denen es gegenübersteht, noch nicht sein letztes Wort gesprochen hat, noch immer die einzige Barriere gegen die vollständige Entwicklung der kapitalistischen Barbarei darstellt und noch immer das Potenzial in sich trägt, massive Klassenkonfrontationen gegen das Innerste des Systems auszulösen.
Dies ist kein abstrakter Glauben und auch keine ewige Wahrheit. Wir werden auch nicht davor zurückschrecken, in Zukunft unsere Analyse gegebenenfalls zu revidieren und anzuerkennen, dass eine fundamentale Verschiebung in diesem Kräfteverhältnis zum Schaden des Proletariats stattgefunden hat. Unsere Argumente basieren auf einer ständigen Beobachtung der Prozesse innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, die uns bisher zur Schlussfolgerung geleitet haben:
- dass trotz der Schläge gegen ihr Bewusstsein im letzten Jahrzehnt die Arbeiterklasse immer noch gewaltige Kampfreserven besitzt, die in einer beträchtlichen Zahl von Bewegungen in dieser Periode sichtbar geworden sind. Dies ist von enormer Bedeutung, denn obgleich man nicht Kampfgeist mit Bewusstsein verwechseln darf, ist die Entwicklung von offenem Widerstand gegen die Angriffe des Kapitals unter den heutigen Bedingungen wichtiger denn je für das Proletariat bei der Wiederentdeckung seiner Identität als Klasse, die eine Vorbedingung für eine allgemeinere Entwicklung des Klassenbewusstseins ist.
- dass sich der Prozess der unterirdischen Reifung fortgesetzt hat und unter anderem durch die Entstehung von ”suchenden Elementen” überall auf der Welt, von einer wachsenden Minderheit demonstriert wird, die ernsthafte Fragen über das herrschende System stellt und nach einer revolutionären Alternative sucht. Diese Elemente bestehen aus einer Mehrheit, die zum Sumpf, zu den mannigfaltigen Ausdrücken des Anarchismus und so weiter strebt. Die gegenwärtige Zunahme von ”antikapitalistischen” Protesten drückt auch – auch wenn von der herrschenden Klasse zweifellos manipuliert und ausgenutzt – eine massive Ausweitung des Sumpfes aus, jener hin und her schwankenden Übergangszone zwischen der Politik der Bourgeoisie und der Politik der Arbeiterklasse. Doch noch viel bedeutsamer in den letzten Jahren ist die beträchtliche Steigerung der Zahl jener Elemente, die direkt den Kontakt zu den existierenden revolutionären Gruppen, besonders zur IKS und dem IBRP, suchen. Dieser Zustrom von Elementen, die weiter gehen als der zweifelnde Sumpf und nach einem wirklichen kommunistischen Zusammenhang suchen, ist die ‚Spitze des Eisberges‘, Zeichen eines tieferen und weiterreichenden Prozesses innerhalb des Proletariats als Ganzes. Ihr Auftreten auf der Bühne wird erhebliche Auswirkungen auf das existierende proletarische Milieu haben, indem sie seine Physiognomie verändern und es dazu zwingen, mit althergebrachten sektiererischen Verhaltensweisen zu brechen.
- Die fortgesetzte Existenz einer proletarischen Bedrohung kann auch in einem gewissen Umfang an ”negativen” Parametern gemessen werden – durch die Untersuchung der Politik und Kampagnen der Bourgeoisie. Wir können dies auf etlichen miteinander verbundenen Ebenen sehen – ideologisch, ökonomisch und militärisch. Auf der ideologischen Ebene ist die Kampagne um den ”Antikapitalismus” solch ein Fall. Zu Beginn des letzten Jahrzehnts zielten die Kampagnen der Bourgeoisie darauf ab, das Durcheinander in der Klasse, die gerade erst durch den Zusammenbruch des Ostblocks einen Schlag erlitten hatte, zu vergrößern; und ihre Themen konnten damals noch offen bürgerlich sein: Die Dutroux-Affäre zum Beispiel bewegte sich völlig im Rahmen der Demokratie. Das Betonen des ”Antikapitalismus” heute ist dagegen ein Zeichen für die Erschöpfung der Mystifikation des ”Triumphs des Kapitalismus”, für die Notwendigkeit des Kapitalismus, dem Potenzial für eine wirkliche Infragestellung des Kapitalismus durch die Arbeiterklasse beizukommen und es zu entstellen. Die Tatsache, dass die antikapitalistischen Proteste die Arbeiter nur marginal als solche mobilisiert haben, vermindert nicht ihren allgemeinen ideologischen Einfluss. Dasselbe kann von der Taktik der Linken in der Regierung gesagt werden. Obwohl ein Großteil der Ideologie der linken Regierungen direkt von den Kampagnen über das Scheitern des Sozialismus und die Notwendigkeit für einen zweiten oder dritten Weg in die Zukunft übernommen wurde, sind diese Regierungen größtenteils nicht einfach zur Aufrechterhaltung der herrschenden Desorientierungen in der Klasse, sondern als Vorbeugemaßnahme installiert worden, um die Arbeiterklasse daran zu hindern, ihren Kopf zu heben, ihre Unzufriedenheit, die sich in ihren Reihen im letzten Jahrzehnt breitgemacht hat, freien Lauf zu lassen.
Auf der wirtschaftlichen Ebene, so haben wir stets argumentiert, wird die Bourgeoisie der Hauptzentren damit fortfahren, jedes zu ihrer Verfügung stehende Mittel zu nutzen, um ihre Ökonomie vor dem Kollaps und davor zu bewahren, dass sie auf ihr wahres Maß zurechtgestutzt wird. Die Logik dahinter ist sowohl ökonomisch als auch sozial. Sie ist ökonomischer Natur in dem Sinn, dass die Bourgeoisie koste es was es wolle ihre Wirtschaft auswringen muss, um ihre eigenen Illusionen über die Aussicht auf Expansion und Wohlstand aufrechtzuerhalten. Doch diese Logik ist auch gesellschaftlicher Natur in dem Sinn, dass die herrschende Klasse immer noch in Angst davor lebt, dass dramatische Abstürze der Wirtschaft massive Reaktionen im Proletariat hervorrufen, die einen viel klareren Blick auf den wahren Bankrott der kapitalistischen Produktionsweise erlauben würden.
Was möglicherweise noch wichtiger ist – in allen großen militärischen Konflikten dieses Jahrzehnts, in denen die zentralen imperialistischen Mächte verwickelt waren (Golfkrieg, Balkan, Afrika) waren wir Zeuge einer extremen Vorsicht der herrschenden Klasse, ihres Widerstrebens, andere Soldaten außer den Berufssoldaten in diesen Operationen einzusetzen, und gar ihres Zauderns davor, das Leben dieser Soldaten aus Angst vor der Provozierung einer Reaktion ‚in der Heimat‘ zu riskieren.
Es ist sicherlich bedeutsam, dass mit der Bombardierung Serbiens durch die NATO der imperialistische Krieg einen weiteren Schritt zu den Kernländern des Systems gemacht hat. Doch Serbien ist nicht Westeuropa. Wir erblicken keinerlei Anzeichen dafür, dass die Arbeiterklasse der Hauptindustrieländer bereit ist, sich hinter ihren Nationalfahnen zu sammeln und direkt für die imperialistischen Hauptkonflikte (und selbst innerhalb solcher Länder wie Serbien sind die Grenzen der Opferbereitschaft in Sicht, auch wenn die massive Unzufriedenheit durch den demokratischen Karneval kanalisiert wurde) anzumustern. Der Kapitalismus ist immer noch dazu gezwungen, seine imperialistischen Spaltungen hinter der Fassade von Bündnissen für humanitäre Interventionen zu maskieren. Dies spiegelt teilweise die Unfähigkeit der zweitrangigen Mächte wider, die US-Vorherrschaft offen herauszufordern, aber es drückt auch die Tatsache aus, dass das System keine ernsthafte ideologische Grundlage für die Zementierung neuer imperialistischer Blöcke besitzt – eine Tatsache, die von den proletarischen Gruppen völlig missachtet wird, die solche Blöcke im Wesentlichen auf ökonomische Funktionen reduzieren. Imperialistische Blöcke sind in ihrer Funktion eher militärisch denn ökonomisch ausgerichtet, doch um auf militärischer Ebene zu operieren, müssen sie auch ideologisch begründet sein. Zurzeit ist es unmöglich abzusehen, welche ideologischen Themen benutzt werden könnten, um einen Krieg zwischen den imperialistischen Hauptmächten heute zu rechtfertigen – alle treten für dieselbe demokratische Ideologie ein, und keiner von ihnen ist in der Lage, mit dem Finger auf ein böses Reich zu zeigen, dass eine große Bedrohung für den eigenen Way of Life abgeben könnte: Der Antiamerikanismus, der in einem Land wie Frankreich gepflegt wird, ist ein müder Abklatsch früherer Ideologien wie der Antifaschismus oder der Antikommunismus. Wir haben geäußert, dass der Kapitalismus der Arbeiterklasse in den entwickelten Ländern immer noch eine schwere und offene Niederlage zufügen muss, eher er die ideologischen Bedingungen für ihre offene Mobilisierung für den Weltkrieg schaffen kann. Doch es gibt starke Beweggründe für die Auffassung, dass dies auch auf die begrenzteren Konflikte zwischen den in der Entstehung begriffenen Blöcken zutrifft, die den Boden für einen allgemeineren Konflikt bereiten. Dies ist ein wirkliches Statement des ‚negativen‘ Gewichts, das das unbesiegte Proletariat auf die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft ausübt.
Wir haben natürlich erkannt, dass im Rahmen des Zerfalls die Arbeiterklasse ohne eine frontale Niederlage und ohne einen großen Krieg zwischen den Zentralmächten überwältigt werden könnte. Es könnte dem Fortschreiten der Barbarei in den zentralen Ländern, einem Prozess des sozialen, ökonomischen und ökologischen Zusammenbruchs unterliegen, vergleichbar, obwohl noch viel alptraumhafter, mit dem, was in Ländern wie Ruanda und dem Kongo bereits eingetroffen ist. Doch auch wenn er viel heimtückischer ist, solch ein Prozess kann kaum unsichtbar bleiben, und wir sind noch ein Stück weit entfernt von ihm – eine weitere Tatsache, die sich ‚negativ‘ in der jüngsten Kampagne über die ‚Asylanten‘ äußerte, welche sich zu einem großen Teil auf die Erkenntnis stützt, dass Westeuropa und Nordamerika Oasen des Wohlstands und der Stabilität sind im Verhältnis zu jenen Teilen Osteuropas und der ‚Dritten Welt‘, die viel direkter von den Schrecken des Zerfalls erfasst sind.
Es kann daher ohne Zögern festgestellt werden, dass der unbesiegte Charakter des Proletariats in den fortgeschrittenen Ländern eine Barriere gegen die vollständige Entfesselung der Barbarei in den Zentren des Weltkapitals bleibt.
Nicht nur, dass die Entwicklung der Weltwirtschaftskrise die Illusionen darüber zerbröckeln lässt, dass wir vor einer glänzenden neuen Zukunft stehen – eine Zukunft, die auf einer ‚neuen Wirtschaft‘ gegründet sei, wo jeder ein Aktionär ist. Hinzu kommt, dass diese Illusion weiter dahinschwindet, sobald die Bourgeoisie gezwungen wird, ihre Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse zu zentralisieren und zu vertiefen, um sie dem wahren Zustand ihrer Wirtschaft ‚anzupassen‘. Obwohl wir noch weit entfernt sind von einem offenen politischen Kampf gegen den Kapitalismus, sind wir wohl kaum ebenso weit entfernt von einer Reihe erbitterter und selbst weltweiter Verteidigungskämpfe, da die siedende Unzufriedenheit innerhalb des Proletariats die Form einer offenen Kampfbereitschaft annimmt. Und es sind diese Kämpfe, in denen die Saat für eine künftige Politisierung gesät wird. Es erübrigt sich fast zu sagen, dass die Intervention der Revolutionäre ein Schlüsselelement in diesem Prozess sein wird.
Somit können die Revolutionäre trotz ihres klaren Blicks für die fürchterlichen Schwierigkeiten und Gefahren für unsere Klasse fortfahren, mit Fug und Recht festzustellen, dass der historische Kurs sich nicht gegen uns gewendet hat. Die Aussicht auf massive Klassenkonfrontationen besteht weiterhin und wird unsere gegenwärtigen und künftigen Aktivitäten bestimmen.
Dezember 2000
1 – Mitchell starb 1945 in Folge seiner Inhaftierung im Konzentrationslager Buchenwald während des Krieges.
2 - Diese Tendenz verließ die IKS, um die Gruppe Communiste Internationliste, die eine Form des Anarcho-Bordigismus predigte und selbst in einer Reihe von kleineren Mini-Gruppen zerbrach.
3 - ein ehemaliger Militantrer der IKS;
4 - Internationale Büro für die Revolutionäre Partei, gegründet von Battaglia Comunista und der CWO:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
- Mai 1968 in Frankreich [105]
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Außerordentliche Konferenz der IKS: Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien
- 3072 Aufrufe
Der Kampf um die Verteidigung organisatorischer Prinzipien
Zu Beginn dieses Jahres beschloss die IKS, den 15. Kongress ihrer Sektion in Frankreich in eine Außerordentliche Internationale Konferenz umzuwandeln. Motiviert wurde der Beschluss durch den offenen Ausbruch einer Krise in der Organisation, die unmittelbar nach unserem 14. Internationalen Kongress im April 2001 folgte. Diese Krise hatte zu einer Abkehr mehrerer Militanter von unserer Organisation geführt, die sich gegenwärtig als, wie sie es nennen, „Interne Fraktion der IKS“ gesammelt haben. Wie wir sehen werden, stellte die Konferenz fest, dass diese Militanten sich selbst vorsätzlich außerhalb der Organisation gestellt haben, auch wenn sie heute jedem gegenüber, der ihnen zuzuhören bereit ist, behaupten, dass sie „ausgeschlossen“ worden seien.
Obwohl die Konferenz sich größtenteils auf organisatorische Fragen konzentrierte, wurde auch die Analyse der internationalen Situation diskutiert und eine Resolution verabschiedet, die in dieser Ausgabe der Internationalen Revue veröffentlicht ist.
Zweck dieses Artikels ist es, Rechenschaft abzulegen über die wichtigste Arbeit der Konferenz, über das Wesen ihrer Diskussionen und Beschlüsse zu organisatorischen Fragen, da dies ihr Hauptzweck war. Er soll ebenso unsere Analyse der selbsternannten „Internen Fraktion der IKS“ darlegen, die sich heute als wahre Vertretung der organisatorischen Errungenschaften der IKS präsentiert, doch in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine neue parasitäre Gruppierung wie diejenigen, mit denen die IKS und andere Organisationen aus dem politischen Milieu des Proletariats bereits in der Vergangenheit konfrontiert waren. Bevor wir uns jedoch mit diesen Fragen beschäftigen, ist es notwendig, eine andere zu berücksichtigen, die Gegenstand vieler Missverständnisse im heutigen proletarischen politischen Milieu gewesen war: die Bedeutung der Fragen der Funktionsweise von kommunistischen Organisationen.
Wir sagen dies, weil wir oft die Bemerkung gehört und gelesen haben, dass „die IKS besessen ist von Organisationsfragen“ oder dass „ihre Artikel über diese Frage von keinerlei Interesse und lediglich interne Angelegenheit der IKS sind“. Solcherlei Beurteilung ist bei jenen Nicht-Militanten, die mit den Positionen des Linkskommunismus sympathisieren, durchaus nachvollziehbar. Wenn man nicht Mitglied einer politischen Organisation des Proletariats ist, ist es natürlich schwierig, die Probleme voll zu erfassen, auf die eine Organisation bei ihrem Funktionieren stoßen kann. So weit, so gut. Dagegen ist es erstaunlich, auf solcherlei Kommentierung bei Mitgliedern von organisierten politischen Gruppierungen zu treffen. Dies ist einer der Ausdrücke der Schwäche des proletarischen politischen Milieus, die aus dem organischen und politischen Bruch zwischen den heutigen Organisationen und jenen der vergangenen Arbeiterbewegung infolge der Konterrevolution resultierte, welche die Klasse vom Ende der 1920er Jahre bis zum Ende der 1960er Jahre in Schach gehalten hatte.
Aus diesem Grund beginnen wir, bevor wir uns mit den die Konferenz betreffenden Fragen befassen, mit einer kurzen Erinnerung an einige organisatorische Lehren der vergangenen Arbeiterbewegung, und zwar auf der Grundlage zweier der bekanntesten: der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) bzw. der I. Internationale (in der Marx und Engels Mitglieder waren) und der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR), aus der die bolschewistische Partei hervorging, die die Führung der einzigen proletarischen Revolution inne hatte, ehe sie infolge ihrer internationalen Isolation degenerierte. Wir werden besonders auf die beiden Kongresse dieser Organisationen schauen, auf denen Organisationsfragen im Mittelpunkt standen: den Haager Kongress der IAA von 1872 und den Kongress der
SDAPR von 1903, bei dem es zur Entstehung der bolschewistischen und menschewistischen Fraktionen gekommen ist, welche in der Revolution 1917 eine direkt entgegengesetzte Rolle spielen sollten.
Die IAA wurde im September 1864 in London auf Initiative einer Reihe von französischen und englischen Arbeiter gegründet. Sie nahm von Anfang an eine zentralisierte Struktur an, mit einem Zentralrat, der nach dem Genfer Kongress 1866 als Generalrat bekannt wurde. Marx sollte eine führende Rolle innerhalb des Rats spielen, da es an ihm lag, eine große Zahl seiner elementarsten Texte zu verfassen, wie die Inauguraladresse der IAA, ihre Statuten, und die Adresse über die Pariser Kommune. Die IAA (oder die „Internationale“, wie die Arbeiter sie nannten) wurde schnell zu einer „Macht“ in den fortgeschrittenen Ländern (vor allem in Westeuropa). Bis zur Pariser Kommune von 1871 sammelte sie eine wachsende Zahl von Arbeitern um sich und war der ausschlaggebende Faktor bei der Entwicklung der beiden wesentlichen Waffen des Proletariats: ihrer Organisation und ihres Bewusstseins. Daher wurde die Internationale zur Zielscheibe wachsender brutaler Angriffe der Bourgeoisie: Presseverleumdung, Infiltration durch Informanten, Verfolgung ihrer Mitglieder, etc. Doch die größte Gefahr drohte der IAA von den Angriffen einiger ihrer Mitglieder gegen die eigentliche Organisationsweise der Internationalen.
Bereits zum Zeitpunkt der Gründung der IAA wurden die provisorischen Regeln von den Pariser Sektionen, die stark von Proudhons föderalistischen Auffassungen beeinflusst waren, auf eine Weise übersetzt, die den zentralisierten Charakter der Internationalen erheblich schwächte. Doch die gefährlichsten Angriffe sollten später erfolgen, mit dem Eintritt der von Bakunin gegründeten Allianz der sozialistischen Demokratie in ihre Reihen. Ersterer sollte fruchtbaren Boden innerhalb wichtiger Sektionen der Internationalen finden; eine Folge ihrer eigenen Schwächen, die umgekehrt das Resultat der Schwächen des Proletariats zu jener Zeit waren, ein Merkmal seines frühen Entwicklungsstadiums.
Diese Schwächen äußerten sich besonders in den rückständigsten Bereichen des europäischen Proletariats, wo es sich gerade von den Klassen der Bauern und Handwerker gelöst hatte. Bakunin, der der Internationalen 1868 nach dem Zusammenbruch der Liga für Frieden und Freiheit beitrat, nutzte diese Schwächen aus, um zu versuchen, die Internationale seinen anarchistischen Auffassungen zu unterwerfen und sie unter seine Kontrolle zu bringen. Das Werkzeug für diese Operation sollte die Allianz der sozialistischen Demokratie sein, die er als eine Minderheit in der Liga für Frieden und Freiheit gegründet hatte.
Letztere war eine Organisation bürgerlicher Republikaner, gegründet auf Initiative von Garibaldi und Victor Hugo, deren Hauptziel es war, mit der IAA um die Unterstützung durch die Arbeiterklasse zu buhlen. Bakunin war ein Führungsmitglied der Liga für Frieden und Freiheit, der er, wie er behauptete, den „revolutionären Impetus“ verliehen und dazu gedrängt habe, eine Fusion mit der IAA vorzuschlagen, die von der IAA auf ihrem Brüsseler Kongress 1868 verweigert wurde. Nach dem Scheitern der Liga für Frieden und Freiheit beschloss Bakunin, der IAA beizutreten, nicht als bloßer Militanter, sondern als Teil der Führung.
“Um sich als Haupt der Internationalen zur Geltung zu bringen, musste er als Haupt einer anderen Armee dastehen, deren absolute Ergebenheit gegen seine Person ihm durch eine geheime Organisation gesichert war. Hatte er seine Gesellschaft einmal offen in die Internationale eingepflanzt, dann rechnete er darauf, jene in alle Sektionen zu verzweigen und sich hierdurch deren absolute Leitung zu verschaffen. Zu diesem Zwecke gründete er in Genf die (öffentliche) Allianz der sozialistischen Demokratie. (...) Aber diese öffentliche Allianz barg in sich eine andere, die ihrerseits durch die noch geheimere Allianz der internationalen Brüder, der Hundert-Garden des Diktators Bakunin, geleitet wurde.“[i] (Ein Bericht über die Allianz, den Marx, Engels, Lafargue und andere Militante im Auftrag des Haager Kongresses der IAA verfassten.)
Die Allianz war also eine öffentliche und eine geheime Gesellschaft, die tatsächlich dazu neigte, eine Internationale innerhalb der Internationalen zu bilden. Ihre geheime Struktur und die geheimen Absprachen, die so ihren Mitgliedern ermöglicht wurden, bezweckten, ihren „Einfluss“ über so viel Sektionen der IAA wie möglich zu sichern, besonders jener, in denen anarchistische Auffassungen auf ein großes Echo stießen. Für sich genommen, stellte die Existenz von mehreren verschiedenen Gedankenrichtungen innerhalb der IAA kein Problem dar. Die Aktivitäten der Allianz, die auf die Ersetzung der offiziellen Strukturen der IAA abzielten, waren dagegen ein ernsthafter Faktor der Desorganisation und bedrohten die eigentliche Existenz Letzterer. Die Allianz versuchte zuerst auf dem Basler Kongress im September 1869, die Kontrolle über die Internationale zu übernehmen, indem sie versuchte, einen Antrag zugunsten der Abschaffung des Erbrechts gegen den vom Generalrat vorgeschlagenen Antrag durchzusetzen. Dieses Ziel vor Augen, unterstützten ihre Mitglieder, insbesondere Bakunin und James Guillaume, wärmstens eine administrative Resolution, die die Macht des Generalrats stärken sollte. Nachdem sie mit ihrem eigenen Anliegen gescheitert war, begann die Allianz (die selbst Geheimstatuten verabschiedet hatte, die auf einer extremen Zentralisierung beruhten) jedoch eine Kampagne gegen die „Diktatur“ des Generalrats, um damit zu erreichen, ihn auf die Rolle eines „Statistik- und Verbindungsbüros“, um den Begriff der Allianz zu benutzen, oder eines bloßen „Briefkastens“, wie Marx ihr entgegnete, zu reduzieren. Entgegen dem Prinzip der Zentralisierung als einem Ausdruck der internationalen Einheit des Proletariats predigte die Allianz den „Föderalismus“, die vollständige „Autonomie der Sektionen“ und die Unverbindlichkeit von Kongressbeschlüssen. In der Tat wollte die Allianz in den Sektionen, die unter ihre Kontrolle geraten waren, tun, was sie wollte. Der Weg zur vollständigen Desorganisation der IAA wäre offen gewesen.
Dies war die Gefahr, der sich der Haager Kongress von 1872 gegenübersah. Dieser Kongress war im Wesentlichen den Organisationsfragen gewidmet. Wie wir in der Internationalen Revue Nr. 19 geschrieben haben, „wurde es nach dem Fall der Pariser Kommune zur absoluten Priorität für die Arbeiterbewegung, den Ballast ihrer eigenen sektiererischen Vergangenheit abzuschütteln, den Einfluss des kleinbürgerlichen Sozialismus zu überwinden. Dieser politische Rahmen erklärte die Tatsache, dass die zentrale Frage, die auf dem Haager Kongress behandelt wurde, nicht die Pariser Kommune selbst war, sondern die Verteidigung der Statuten der Internationalen gegen die Komplotte Bakunins und seiner Anhänger.“ (Der Haager Kongress von 1872: Der Kampf gegen den politischen Parasitismus, MEW 18)
Nach der Bestätigung der Beschlüsse der Londoner Konferenz, die ein Jahr zuvor abgehalten worden war, insbesondere derjenigen, die die Notwendigkeit für die Arbeiterklasse betreffen, ihre eigene politische Partei zu schaffen, und jener über die Stärkung der Autorität des Generalrats, debattierte der Kongress auf der Grundlage eines Berichts einer Untersuchungskommission die Frage der Allianz und beschloss letztendlich den Ausschluss von Bakunin und James Guillaume, der Führer der Jura-Föderation der IAA, die völlig unter der Kontrolle der Allianz stand. Es lohnt sich, gewisse Aspekte im Verhalten von Mitgliedern der Allianz am Vorabend des Kongresses zu beleuchten:
– Mehrere von der Allianz kontrollierte Sektionen (insbesondere die Jura-Föderation sowie bestimmte Sektionen in Spanien und in den Vereinigten Staaten) weigerten sich, ihren Beitrag an den Generalrat zu zahlen, und ihre Delegierten beglichen ihre Schulden (der ausstehenden Beiträge) erst, als sie die Gültigkeit ihres Mandats gefährdet sahen.
– Die Delegierten der von der Allianz kontrollierten Sektionen erpressten den Kongress regelrecht, forderten, dass er seine eigenen Regeln verletze, indem er allein die auf einem imperativen Mandat beruhenden Stimmen berücksichtige, und drohten mit ihrem Rückzug, falls der Kongress nicht ihren Forderungen entspreche.[ii]
– Bestimmte Mitglieder der Allianz weigerten sich, mit der vom Kongress ernannten Untersuchungskommission zu kooperieren oder sie überhaupt anzuerkennen, indem sie diese der „Heiligen Inquisition“ beschuldigten.[iii]
Dieser Kongress war ein Höhepunkt im Leben der IAA (es war der einzige Kongress, an dem Marx und Engels teilnahmen, was erahnen lässt, wie wichtig sie ihn nahmen), aber auch ihr Schwanengesang auf die vernichtende Niederlage der Pariser Kommune und die Demoralisierung, die diese innerhalb des Proletariats ausgelöst hatte. Marx und Engels waren sich dieser Realität bewusst. Daher schlugen sie neben den Maßnahmen, um die IAA vor den Händen der Allianz fernzuhalten, auch vor, dass der Generalrat nach New York umzieht, weit entfernt von den Konflikten, die die Internationale spalteten. Es war zugleich ein Mittel, um der Internationalen zu erlauben, einen natürlichen Tod zu sterben (der auf der Konferenz von Philadelphia 1876 bestätigt wurde), ohne dass ihr Prestige von den bakunistischen Intriganten gefleddert wurde.
Sie und die Anarchisten haben (wenn sie nicht gerade den Konflikt zwischen Marx und Bakunin als persönliche Frage erklärten) die Legende fortleben lassen, dass Marx und der Generalrat Bakunin und Guillaume wegen ihrer unterschiedlichen Vision in der Frage des Staates ausgeschlossen hätten. Kurz, Marx wurde unterstellt, Meinungsverschiedenheiten über allgemeine, theoretische Fragen mit administrativen Mitteln regeln zu wollen. Nichts liegt der Wahrheit ferner.
Der Haager Kongress ergriff keine Maßnahmen gegen die Mitglieder der spanischen Delegation, die Bakunins Ideen teilten und der Allianz angehörten, aber erklärten, dass dies nicht mehr der Fall sei. Auch bestand die „Antiautoritäre IAA“, die nach dem Haager Kongress von den Föderationen gegründet wurde, welche sich weigerten, seine Beschlüsse zu akzeptieren, nicht allein aus Anarchisten, da sie auch die deutschen Lassalleaner umfasste, die eifrige Vertreter des „Staatssozialismus“ waren, um in den Worten von Marx zu sprechen. In der Tat fand der wahre Kampf innerhalb der IAA zwischen denjenigen, die für die Einheit der Arbeiterbewegung (und damit für den bindenden Charakter der Kongressbeschlüsse) standen, und denjenigen statt, die das Recht forderten zu tun, was immer sie wollten, jeder isoliert von den anderen, mit einem Kongress als Versammlung, auf der jeder seine „Ansichten“ mit den Anderen austauschen kann, ohne einen Beschluss zu fassen. Mit dieser informellen Organisationsart wäre es der Allianz leicht gefallen, insgeheim eine wirkliche Zentralisierung der Föderationen durchzuführen, wie Bakunins Korrespondenz ausdrücklich feststellt. Diese „antiautoritären“ Auffassungen in der Internationalen wirken zu lassen wäre der beste Weg gewesen, sie den Intrigen, der versteckten und unkontrollierten Macht der Allianz, mit anderen Worten: den Abenteurern, die sie anführten, auszuliefern.
Der 2. Kongress der SDAPR war Anlass einer ähnlichen Konfrontation zwischen den Vertretern einer proletarischen Auffassung der revolutionären Organisation und jenen einer kleinbürgerlichen Auffassung.
Es gibt Ähnlichkeiten zwischen der Situation der westeuropäischen Arbeiterbewegung zur Zeit der IAA und der Bewegung in Russland zur Jahrhundertwende. In beiden Fällen befand sich die Arbeiterbewegung immer noch im jugendlichen Stadium, wobei der Zeitunterschied zwischen beiden der verspäteten industriellen Entwicklung Russlands entsprach. Die Absicht der IAA war es, die verschiedenen Arbeitervereinigungen, die die Entwicklung des Proletariats geschaffen hatte, in einer vereinten Organisation zu sammeln. Ähnlich war es das Ziel des 2. Kongresses der SDAPR, die verschiedenen Komitees, Gruppen und Zirkel der Sozialdemokratie, welche sich in Russland und im Exil entwickelt hatten, zu vereinen. Nach dem Verschwinden des Zentralkomitees, das auf dem 1. Kongress der SDAPR 1897 gebildet worden war, gab es fast keine formellen Verbindungen mehr zwischen diesen verschiedenen Formationen. Der 2. Kongress sah sich somit wie die IAA einer Konfrontation zwischen der Auffassung einer die Vergangenheit der Bewegung repräsentierenden Organisation, jener der „Menschewiki“ („Minderheit“), und einer Auffassung gegenüber, die die Erfordernisse der neuen Situation ausdrückte, jene der „Bolschewiki“ („Mehrheit“).
Die menschewistische Vorgehensweise war, wie später deutlich wurde (sehr schnell in der Revolution von 1905 und natürlich noch mehr während der Revolution von 1917, als die Menschewiki auf der Seite der Bourgeoisie standen), von bürgerlichen und kleinbürgerlichen Ideologien durchdrungen, insbesondere von der anarchistischen Vielfalt innerhalb der russischen Sozialdemokratie. Insbesondere bestand, wie Lenin bemerkte, „die Opposition [d.h. die Menschewiki] in ihrer Mehrheit aus den intellektuellen Elementen der Partei“, die somit zu Trägern kleinbürgerlicher Auffassungen in der Organisationsfrage wurden. Diese Elemente erhoben infolgedessen „das Banner der Rebellion gegen die unabdingbaren Einschränkungen durch die Organisation, und sie errichteten ihren spontanen Anarchismus zum Kampfprinzip, indem sie mehr ‚Toleranz‘ forderten, etc.“ (Lenin, Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, LW Bd. 7, S. 197ff) Und in der Tat gibt es viele Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten der Menschewiki und jenem der Anarchisten in der IAA (Lenin sprach bei mehreren Gelegenheiten vom menschewistischen „Edelanarchismus“).
Wie die Anarchisten nach dem Haager Kongress, so weigerten sich die Menschewiki, die Beschlüsse des 2. Kongresses der SDAPR anzuerkennen und anzuwenden, indem sie erklärten, dass „der Kongress nicht göttlich ist“ und dass „seine Beschlüsse nicht heilig sind“. Insbesondere war – genauso wie bei den Anarchisten, die zum Krieg gegen das Prinzip der Zentralisierung und gegen die „Diktatur des Generalrats“ übergingen, als sie daran gescheitert waren, die Kontrolle über ihn zu erlangen - ein Grund, warum die Menschewiki begannen, nach dem Kongress die Zentralisierung abzulehnen, die Tatsache, dass einige von ihnen aus den vom Kongress gewählten Zentralorganen herausgewählt wurden. Es gibt sogar Ähnlichkeiten in der Art und Weise, wie die Menschewiki ihre Kampagne gegen Lenins „persönliche Diktatur“ und „eiserne Faust“ führten; sie war ein Widerhall auf Bakunins Beschuldigungen gegen die „Diktatur“ Marx‘ über den Generalrat.
„Betrachte ich das Verhalten der Martow-
leute nach dem Parteitag, (...) so kann ich nur sagen, dass das ein irrsinniger, eines Parteimitglieds unwürdiger Versuch ist, die Partei zu sprengen ... und weshalb? Nur weil man unzufrieden ist mit der Zusammensetzung der Zentralstellen, denn objektiv war das die einzige Frage, in der wir uns trennten, die subjektiven Urteile aber (wie Kränkung, Beleidigung, Hinauswurf, Beseitigung, Verunglimpfung etc. etc.) sind die Frucht gekränkter Eigenliebe und krankhafter Phantasie. Diese krankhafte Phantasie und diese gekränkte Eigenliebe führen geradewegs zu schändlichen Klatschereien, nämlich dazu, dass man, ohne die Tätigkeit der neuen Zentralstellen kennengelernt und ohne sie gesehen zu haben, Gerüchte verbreitet über ihre ‚Arbeitsunfähigkeit‘, über die ‚eiserne Hand‘ eines Iwan Iwanowitsch, die ‚Faust‘ eines Iwan Nikiforowitsch usw. (...) Die russische Sozialdemokratie muss den letzten schwierigen Übergang vollziehen vom Zirkelwesen zum Parteiprinzip, vom Spießertum zur Erkenntnis der revolutionären Pflicht, vom Handeln auf Grund von Klatschereien und Zirkeleinflüssen zur Disziplin.“ (Lenin, Schilderung des II. Parteitags der SDAPR, LW Bd. 7, S. 20)
Es ist bemerkenswert, dass die Waffe der Erpressung, die damals von Guillaume und der Allianz benutzt worden war, auch Teil des menschewistischen Arsenals war. Martow, einer der Führer der Menschewiki, weigerte sich, am Redaktionskomitee der Parteipublikation Iskra teilzunehmen, in das er durch den Kongress gewählt worden war, weil seine Freunde Axelrod, Potressow und Sassulitsch nicht ernannt worden waren.
Aus den Beispielen der IAA und des 2. Kongresses der SDAPR können wir die Bedeutung der Fragen ersehen, die mit der Organisationsweise revolutionärer Formationen zusammenhängen. In der Tat waren dies die Fragen, die die erste Scheidung zwischen der proletarischen Strömung einerseits und bürgerlichen sowie kleinbürgerlichen Strömungen andererseits bewirkten. Diese Bedeutung ist kein Zufall. Sie entspringt exakt der Tatsache, dass einer der Hauptkanäle für die Infiltration von dem Proletariat fremden Ideologien – bürgerlich oder kleinbürgerlich – sich just in ihrer Funktionsweise befindet.
Marxisten haben der Organisationsfrage stets die höchste Aufmerksamkeit geschenkt. Innerhalb der IAA übernahmen Marx und Engels die Führung im Kampf für die Verteidigung proletarischer Prinzipien. Und es war kein Zufall, dass sie eine entscheidende Rolle beim Beschluss des Haager Kongresses spielten, den größten Teil seiner Arbeit der Organisationsfrage zu widmen und dagegen zwei der wichtigsten Ereignisse dieser Periode, mit denen die Arbeiterklasse damals konfrontiert wurde, weitaus weniger Aufmerksamkeit zu schenken: der deutsch-französische Krieg und die Pariser Kommune. Diese Priorität hat die meisten bürgerlichen Historiker dazu verleitet, diesen Kongress als weniger wichtig in der Geschichte der IAA zu betrachten, wohingegen er in Wahrheit der wichtigste war, da er es der späteren 2. Internationalen ermöglichte, neue Fortschritte in der Entwicklung der Arbeiterbewegung zu erzielen.
Auch innerhalb der 2.Internationalen wurde Lenins Beschäftigung mit der Organisationsfrage als „Obsession“ betrachtet. Die Streits, die die russische Sozialdemokratie vom Zaun brach, waren für die anderen sozialistischen Parteien unverständlich, und Lenin wurde als ein „Sektierer“ betrachtet, der nichts anderes als Spaltungen im Kopf habe. Tatsächlich war Lenin stark vom Kampf von Marx und Engels gegen die Allianz inspiriert. Die Gültigkeit dieser Auseinandersetzung sollte durch die Fähigkeit seiner Partei brillant demonstriert werden, die Führung in der Revolution von 1917 zu übernehmen.
Was die IKS angeht, so ist sie der Tradition von Marx und Lenin gefolgt, indem sie den Organisationsfragen die größte Aufmerksamkeit gewidmet hat. Im Januar 1982 widmete die IKS diesen Fragen infolge der Krise von 1981 eine Außerordentliche Konferenz.[iv] Schließlich führte unsere Organisation zwischen 1993 und 1996 eine grundsätzliche Auseinandersetzung, um ihre organisatorischen Belange zu stärken, gegen den „Zirkelgeist“ und für den „Partei-
geist“, wie Lenin sie 1903 definierte. Unsere Internationale Revue Nr. 16 liefert Rechenschaft über den 11. Kongress der IKS, der im Wesentlichen den Organisationsfragen gewidmet war, denen wir damals gegenüberstanden.[v] Wir verfolgten dies weiter durch eine Reihe von Artikeln über Organisationsfragen, die den Kämpfen innerhalb der IAA gewidmet waren (Internationale Revue, Nr. 17-20), und in Form von zwei Artikeln mit dem Titel „Sind wir ‚Leninisten‘ geworden?“ (Internationale Revue, Nr. 23-24) über den Kampf Lenins und der Bolschewiki in der Organisationsfrage. Und endlich publizieren wir in der vorliegenden Ausgabe große Auszüge aus einem internen Dokument über die Frage der Funktionsweise innerhalb der IKS, der als Orientierungstext für den Kampf von 1993–96 diente.
Ein transparentes Verhalten im Angesicht der Schwierigkeiten, auf die unsere Organisation stößt, hat nichts mit irgendeinem „Exhibitionismus“ unsererseits zu tun. Die Erfahrung kommunistischer Organisation ist ein integraler Bestandteil der Erfahrungen der Arbeiterklasse. Daher widmete Lenin dem 2. Kongress der
SDAPR ein ganzes Buch – Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück. Indem sie Rechenschaft über ihr Organisationsleben ablegt, tut die IKS nichts anderes, als ihre Verantwortung im Angesicht der Arbeiterklasse zu erfüllen.
Wenn eine revolutionäre Organisation ihre Probleme und internen Diskussionen veröffentlicht, ist dies natürlich ein gefundenes Fressen für all ihre Feinde, die darauf lauern, sie zu verunglimpfen. Dies ist auch und besonders bei der IKS der Fall. Wie wir auf unserem 11. Kongress gesagt haben: „Natürlich werden wir kein Lob in der bürgerlichen Presse ernten aufgrund der Schwierigkeiten, mit denen unsere Organisation jetzt kämpft. Die IKS ist noch zu klein – sowohl was Größe und Einfluss innerhalb der Arbeiterklasse angeht, so dass die Bourgeoisie noch kein Interesse daran hat, von uns zu sprechen und uns diskreditieren will. Die Bourgeoisie zieht es vor, eine Mauer des Schweigens aufzubauen um unsere Positionen und die Existenz revolutionärer Organisationen überhaupt. Deshalb sind die Verleumdung und die Sabotage unserer Intervention das Steckenpferd einer ganzen Reihe von Gruppen und parasitären Elementen, deren Funktion darin besteht, diejenigen abzuschrecken, die sich auf Klassenpositionen zubewegen, damit in ihnen das Gefühl der Abscheu gegenüber der Mitarbeit an der Entwicklung des proletarischen Milieus entsteht.
(...) Innerhalb der parasitären Bewegung gibt es heute voll entwickelte Gruppen wie die ‚Groupe Communiste Internationliste‘ (GCI) und ihre Abspaltung (wie ‚Gegen den Strom‘), die jetzt aufgelöste ‚Communist Bulletin Group‘ (CBG) aus Großbritannien und die Abspaltung der ehemaligen ‚Externen Fraktion der IKS‘, die alle aus Abspaltungen von der IKS hervorgingen. Aber das Parasitentum ist nicht auf solche Gruppen beschränkt. Es wird auch von unorganisierten Elementen getragen, die sich von Zeit zu Zeit zu Diskussionen treffen und deren Hauptsorge darin besteht, alles mögliche Gerede über unsere Organisation in Umlauf zu bringen.[vi] Zu diesen Leuten gehören oft ehemalige Mitglieder der IKS, die sich dem Druck der kleinbürgerlichen Ideologie ergeben und sich als unfähig erwiesen haben, ihr Engagement in der Organisation aufrechtzuerhalten, oder die darüber frustriert sind, dass die Organisation ihnen nicht die ‚Anerkennung‘ liefert, die sie meinten zu ‚verdienen‘. Oder sie hielten es nicht aus, sich der Kritik der Organisation zu stellen (...) Offensichtlich sind diese Leute völlig unfähig, irgendetwas Konstruktives aufzubauen. Dagegen sind sie sehr wirksam, wenn es darum geht, ihr Gerede zu verbreiten und das mit Schmutz zu besudeln, das zu zerstören und zu diskreditieren, was die Organisation dabei ist aufzubauen.“ (Internationale Revue Nr. 16, deutsche Ausgabe)
Dennoch wird das Gewese der Parasiten die IKS nicht daran hindern, dem gesamten proletarischen Milieu die Lehren seiner eigenen Erfahrung preiszugeben. Im Vorwort zu Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück, 1904, schrieb Lenin: „Sie (die Feinde, die Red.) feixen und sind schadenfroh über unsere Streitigkeiten; sie werden sich natürlich bemühen, einzelne Stellen aus meiner Broschüre, die den Mängeln und Unzulänglichkeiten unserer Partei gewidmet sind, für ihre Zwecke aus dem Zusammenhang zu reißen. Die russischen Sozialdemokraten haben bereits genügend im Kugelregen der Schlachten gestanden, um sich durch diese Nadelstiche nicht beirren zu lassen, um dessenungeachtet ihre Arbeit der Selbstkritik und rücksichtslosen Enthüllung der eigenen Mängel fortzusetzen, die durch das Wachstum der Arbeiterbewegung unbedingt und unvermeidlich ihre Überwindung finden werden. Die Herren Gegner aber mögen versuchen, uns ein Bild der wahren Sachlage in ihren ‚Parteien‘ zu zeigen, das auch nur im entferntesten dem Bild ähnelt, das die Protokolle unseres zweiten Parteitags bieten.“
Wir haben vor, dieselbe Vorgehensweise zu verfolgen, indem wir Rechenschaft über die Probleme der Funktionsweise ablegen, die im Mittelpunkt der Arbeit der Konferenz standen.
Die Ursprünge der jüngsten organisatorischen Schwierigkeiten der IKS
Der 11. Kongress der IKS nahm eine Resolution über ihre Aktivitäten an, die die Hauptlehren aus der 1993 durchlittenen Krise unserer Organisation und aus dem Kampf für ihre Genesung gezogen hatte. Wir veröffentlichten lange Auszüge in der Internationalen Revue Nr. 16, und wir zitieren sie hier erneut, da sie ein Licht auf unsere jüngsten Schwierigkeiten werfen.
„Der Rahmen für das Begreifen des Ursprungs der Schwächen ist eingebettet in den vom Marxismus geführten historischen Kampf gegen den Einfluss der kleinbürgerlichen Ideologie, der in den Organisationen des Proletariats zu spüren ist (...) Insbesondere ging es darum, dass die Organisation in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten genau wie die Bolschewiki von 1903 an den Kampf gegen den Zirkelgeist und für den Aufbau des Parteigeistes stellt (...) Deshalb war die Feststellung des Vorhandenseins eines starken Zirkelgeistes in unserer Anfangsphase ein Teil unserer allgemeinen Analyse, die wir seit langem erarbeitet hatten und die die Wurzeln unserer Schwächen auf den organischen Bruch der kommunistischen Organisationen zurückführte, welcher durch die Konterrevolution seit dem Ende der 20er Jahre entstanden war. Diese Feststellung erlaubte uns jedoch, einen Schritt weiterzugehen als die früheren Ergebnisse und tiefer an die Wurzeln unserer Schwächen heranzukommen. Dadurch haben wir besser das Phänomen verstanden, dass wir früher schon aufgedeckt, aber unzureichend angepackt hatten, nämlich die Bildung von Clans innerhalb der Organisation. Diese Clans waren tatsächlich das Ergebnis des grassierenden Zirkelgeistes, der sich länger am Leben hielt als die Phase, in der die Zirkel eine unvermeidbare Etappe bei der Neugründung der kommunistischen Avantgarde gewesen waren.“
In der Frage der Clans erwähnte unser Artikel über den 11. Kongress folgenden Punkt: „Diese Analyse stützte sich auf die Erfahrung der Arbeiterbewegung (z.B. die Haltung der alten Redakteure der Iskra, auf die Gruppe um Martow, welcher aus Unzufriedenheit mit den Entscheidungen des 2. Kongresses der SDAPR die menschewistische Fraktion gebildet hatte), aber auch auf Erfahrungen in der IKS. Wir können hier nicht in Einzelheiten gehen, aber hervorheben, dass die ‚Tendenzen‘ , die es in der IKS gegeben hat (...) viel eher auf eine jeweilige Clandynamik zurückzuführen waren als auf eine wirkliche Tendenz, die sich auf eine alternative positive Orientierung stützten. Die Haupttriebkraft dieser ‚Tendenzen‘ wurden nicht aufgrund von Divergenzen ihrer Mitglieder mit den Orientierungen der Organisation gebildet (...), sondern eher durch einen Zusammenschluss der Unzufriedenen und der Frustrierten mit den Zentralorganen und die persönliche Gefolgschaft gegenüber den Elementen, die sich als ‚Verfolgte‘ oder als unzureichend ‚anerkannt‘ ansahen.“
Dieser Artikel unterstrich, dass die gesamte IKS (einschließlich jener Militanter, die besonders stark darin verwickelt waren) erkannte, dass sie es mit einem Clan zu tun hatte, der sich einer besonders wichtigen Position in der Organisation bemächtigt hatte und der, obwohl er nicht einfach ein organisches Produkt der Schwächen der IKS war, „eine Vielzahl der gefährlichen Merkmale in sich konzentrierte und bündelte, mit denen die Organisation zu kämpfen hatte und deren gemeinsamer Nenner der Anarchismus war“ (Aktivitätenresolution des 11. IKS-Kongresses, Punkt 5). Die Resolution fuhr fort: „... haben wir nach Begreifen des Phänomens der Clans eine Reihe von schlechten Funktionsweisen aufdecken können, unter denen die meisten territorialen Sektionen litten“ (ebenda).
Sie zog eine Bilanz unserer Organisationsarbeit: „... der Kongress stellt den globalen Erfolg des von der IKS im Herbst 1993 begonnenen Kampfes fest (...) Die manchmal spektakuläre Genesung der von den organisatorischen Schwierigkeiten seit 1993 betroffenen Sektionen (...), die von zahlreichen Teilen der IKS eingebrachten Vertiefungen (...), all diese Tatsachen bestätigen die uneingeschränkte Gültigkeit des begonnenen Kampfes, seiner Methode, seiner theoretischen Grundlagen wie auch seiner konkreten Aspekte.“
Jedoch warnte die Resolution ebenfalls vor jeglicher Art von Triumphalismus: „Das heißt nicht, dass der von uns geführte Kampf aufhören müsse (...) Die IKS muss ihn jederzeit mit der größten Wachsamkeit fortsetzen, mit der Entschlossenheit, jede Schwäche aufzudecken und sie ohne zu zögern anzupacken (...) Tatsächlich zeigt uns die Geschichte der Arbeiterbewegung und auch der IKS, wie die jetzt abgeschlossene Debatte einleuchtend verdeutlicht hat, dass der Kampf für die Verteidigung der Organisation ein ständiger, pausenloser Kampf ist. Insbesondere muss sich die IKS vor Augen halten, dass der von den Bolschewiki geführte Kampf gegen den Zirkelgeist für die Einführung des Parteigeistes Jahre gedauert hat. Das gleiche trifft für unsere Organisation zu, die jede Demoralisierung überwinden und jedem Gefühl der Hilflosigkeit infolge der Dauer des Kampfes entgegentreten muss.“ (ebenda, Pkt. 13)
Und gerade die jüngste Konferenz der IKS hob hervor, dass eine der Hauptursachen unserer organisatorischer Probleme während des letzten Jahrzehnts ein Nachlassen unserer Wachsamkeit angesichts des Wiederauftauchens der Schwierigkeiten und Schwächen war, die die Organisation bereits in der Vergangenheit betroffen hatten. In Wirklichkeit verlor der größere Teil der Organisation die Warnung aus dem Blick, die als Schlussfolgerung in die Resolution des 11. Kongresses aufgenommen worden war. Sie hatte deshalb die größten Schwierigkeiten bei der Identifizierung des wiederauflebenden Clanwesens innerhalb der Pariser Sektion und innerhalb des Internationalen Sekretariats (IS)[vii]; mit anderen Worten: in den beiden Teilen der Organisation, die bereits 1993 am stärksten von dieser Krankheit betroffen waren.
Die Entwicklung der Krise inmitten der IKS und die Bildung der „internen Fraktion“
Das Abgleiten in das Clanwesen vollzog sich im März 2000, als das IS ein Dokument über Fragen der Funktionsweise verabschiedete, das von einer kleinen Zahl von Genossen kritisiert wurde. Während sie die allgemeine Gültigkeit der meisten Gedanken im Text guthießen, besonders über die Notwendigkeit eines größeren Vertrauens unter den verschiedenen Teilen der Organisation, meinten sie, dass das Dokument gewisse Zugeständnisse an demokratistische Illusionen mache und dazu neige, unsere Auffassung über die Zentralisierung in Frage zu stellen. Alles in allem, meinten sie, verleite das Dokument zur Idee, dass „mehr Vertrauen weniger Zentralisierung“ bedeute. Es war nie ein Problem für die IKS gewesen, dass einige Teile der Organisation einen vom Zentralorgan verabschiedeten Text kritisieren. Im Gegenteil, die IKS und ihre Zentralorgane haben stets darauf bestanden, dass jede Meinungsverschiedenheit oder jeder Zweifel offen innerhalb der Organisation ausgedrückt wird, um größtmögliche Klarheit zu erzielen. Das Verhalten des Zentralorgans gegenüber Meinungsverschiedenheiten bestand stets darin, ihnen so ernsthaft wie möglich zu antworten. Doch im Frühjahr 2000 nahm die Mehrheit des IS eine völlig andere Haltung an, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Für diese Mehrheit konnte die Tatsache, dass eine kleine Minderheit von Genossen einen Text des IS kritisiert, nur aus einem Geist der Opposition um der Opposition willen oder aus der Tatsache herrühren, dass einer von ihnen von familiären Problemen betroffen sei oder ein anderer an Depressionen leide. Ein Argument, dass von IS-Mitgliedern benutzt wurde, lautete, dass der Text von einem besonderen Militanten verfasst worden sei und eine andere Aufnahme gefunden hätte, wäre dies das Werk eines anderen Genossen gewesen. Die Antwort auf die Argumente jener Genossen, die anderer Auffassung waren, bestand also nicht darin, Gegenargumente zu suchen, sondern darin, die Genossen zu verunglimpfen oder gar zu versuchen, die Veröffentlichung ihrer Texte mit der Begründung zu verhindern, dass sie „Scheiße in der Organisation verbreiten“ würden, oder dass eine der GenossInnen, die unter dem Druck, der ihr gegenüber ausgeübt wurde, litt, die Antworten, die die anderen Genossen der IKS ihren Texten erteilen würden, nicht „aushalte“. Kurz, das IS betrieb eine völlig heuchlerische Politik, um im Namen der Solidarität die Debatte zu ersticken.
Dieses politische Verhalten, dass den bis dahin geltenden Methoden der IKS völlig fremd ist, erlebte plötzlich eine weitere Degeneration, als ein Mitglied des IS seinerseits begann, einigen der Kritiken beizupflichten, die an dem von der Kommission im März 2000 angenommenen Dokument geübt worden waren. Nachdem er bis dahin von Verleumdungen verhältnismäßig unbehelligt geblieben war, wurde dieser Genosse nun selbst zur Zielscheibe einer Kampagne, die darauf abzielte, ihn zu diskreditieren: Wenn er die eine oder andere Position eingenommen habe, so sei dies deshalb geschehen, weil er „von jemandem manipuliert sei, der ihm nahesteht“. Gleichzeitig bestand die Haltung des IS darin, die Diskussionen über die Frage so weit wie möglich auf Banalitäten zu reduzieren, indem erklärt wurde, dies sei keine „Jahrhundertdebatte“. Und als nachdrücklichere und kritischere Beiträge aufzutauchen begannen, versuchte die Mehrheit des IS, sämtliche Zentralorgane der IKS dahin zu drängen, die Debatte für beendet zu erklären. Das Internationale Büro weigerte sich, dem IS zu folgen. Es beschloss zugleich gegen den Willen der Mehrheit des IS, eine Informationsdelegation zu bilden, die – zum größten Teil aus Mitgliedern zusammengesetzt, die nicht dem IS angehörten – es damit beauftragte, die Probleme der Arbeitsweise zu untersuchen, die in und um das IS herum entstanden waren.
Diese Beschlüsse bewirkten eine weitere „Radikalisierung“ unter der Mehrheit der IS-Mitglieder. Diese erhoben gegenüber der Informationsdelegation alle möglichen Beschuldigungen gegen die andersdenkenden Genossen, hoben alle möglichen besonders ernsthaften „organisatorischen Versagen“ hervor, „warnten“ die Delegation vor dem „dubiosen“ oder „unwürdigen“ Verhalten eines dieser Militanten. Kurz, jene Mitglieder des IS, die die Bildung der Delegation zunächst als Zeitverschwendung angesehen hatten, informierten diese nun über einen schlauen und zerstörerischen Angriff gegen die IKS, was sie eigentlich dazu hätte veranlassen müssen, als erste die Schaffung einer solchen Delegation zu fordern, um eine Untersuchung über diese Militanten einzuleiten. Ein Mitglied des IS – Jonas – sträubte sich nicht nur dagegen, vor der Delegation zu erscheinen, sondern weigerte sich auch von Anfang an, sie überhaupt anzuerkennen.[viii] Gleichzeitig begann er hinter den Kulissen den Gedanken zu verbreiten, dass einer der andersdenkenden Militanten ein staatlicher Agent sei, der die Leute um ihn herum in der Absicht manipuliere, „die IKS zu zerstören“. Andere IS-Mitglieder versuchten anfang Mai 2001, unmittelbar vor dem 14. Kongress der IKS, auf entschiedene Weise, die Informationsdelegation einzuschüchtern mit dem Ziel, dass diese darauf verzichte, dem Kongress einen „vorläufigen Bericht“ vorzulegen, der einen Rahmen für das Verständnis der Probleme, die des IS und der Pariser Sektion betrefen, geliefert hätte.[ix] Am Morgen des Kongresses, kurz vor seinem Beginn, versuchte die Mehrheit des IS ein letztes Manöver: Sie forderte, dass sich das Internationale Büro trifft, um eine Resolution zu verabschieden, die die Arbeit der Informationsdelegation desavouieren sollte. Letztere war da bereits von der Existenz einer Clandynamik innerhalb des IS überzeugt, und zwar weitaus mehr aufgrund des Verhaltens der Mehrheit der IS-Mitglieder als durch das Zeugnis der Genossen, die die Politik des IS kritisiert hatten. Auch die Mehrheit des IB war im Wesentlichen durch die Haltung der IS-Mitglieder auf diesem letzten Treffen vor dem Kongress von der Existenz derselben Dynamik überzeugt worden. Zu diesem Zeitpunkt rechnete das IB aber noch mit der Fähigkeit dieser Militanter, zu Sinnen zu kommen, wie dies bereits für eine wesentliche Anzahl von Militanten der Fall gewesen war, die 1993 von dieser Clandynamik erfasst worden waren. Daher schlug das IB vor, dass alle Militanten, die dem alten IS angehört hatten, wieder in das Zentralorgan gewählt werden sollten. Gleichzeitig schlug es vor, dass die alte Informationsdelegation durch die Einbeziehung anderer Genossen gestärkt und in eine Untersuchungskommission umgewandelt werden sollte. Schließlich schlug es dem Kongress vor, dass dieser sich noch nicht mit den der IS vorauseilenden Schlussfolgerungen befasst, und bat ihn, der neuen Untersuchungskommission sein Vertrauen auszusprechen. Der Kongress ratifizierte einmütig diese Vorschläge.
Zwei Tage nach dem Kongress verletzte ein Mitglied des alten IS die Beschlüsse des Kongresses, indem es in der Pariser Sektion die Information preisgab, wonach das IB mit der Zustimmung des Kongresses beschlossen hatte, sich zurückzuhalten, bis es sich in Gänze und in einem geeigneten Rahmen damit befassen könne. Absicht dieses Mitglieds war es, die Pariser Sektion gegen den Rest der IKS und gegen das Internationale Büro zu stellen. Die anderen Mitglieder der alten IS-Mehrheit unterstützen ihn und weigerten sich, diese offene Verletzung der Organisationsstatuten zu verurteilen.
In Anbetracht der Tatsache, dass der Kongress das souveräne Organ der Organisation ist, ist die bewusste Verletzung seiner Beschlüsse (wie bei den Menschewiki 1903) ein besonders schweres Vergehen. Damals wurde der Militante jedoch nicht mit Sanktionen belegt, abgesehen von einer verbalen Verurteilung seiner Handlung: Die Organisation rechnete auch weiterhin mit der Fähigkeit der Clanmitglieder, sich selbst in den Griff zu bekommen. Tatsächlich war diese Verletzung der Statuten aber nur der erste einer langen Kette von Verstößen durch Mitglieder des alten IS oder jene, die sie überzeugten, ihnen in ihrem offenen Krieg gegen die Organisation zu folgen. Wir haben nicht den Platz, all diese Verstöße hier detailliert aufzulisten und werden uns auf einige charakteristische Beispiele beschränken, für die die Mitglieder der jetzigen „internen Fraktion“ in unterschiedlichem Ausmaß verantwortlich sind:
– der Gebrauch und die Publizierung der Protokolle der Zentralorgane ohne deren Zustimmung;
– Verleumdungskampagnen gegen Mitglieder der Informationskommission, die beschuldigt wurden, „Lügner“ und „Torquemadas“ (nach einem Führer der spanischen Inquisition, was an Alerinis Beschimpfung der Untersuchungskommission des Haager Kongresses als „Heilige Inquisition“ erinnert) zu sein;
– systematische und verleumderische Kampagnen hinter den Kulissen gegen ein Mitglied der Organisation, das ohne den Schatten eines Beweises beschuldigt wurde, ein Abenteurer, ja, ein staatlicher Agent zu sein (die letztgenannte Beschuldigung wurde ausdrücklich von Jonas und einem anderen Mitglied der jetzigen „Fraktion“ genannt, aber auch von anderen, ihnen nahestehenden Militanten suggeriert), mit dem Zweck, andere zu manipulieren, um die IKS zu zerstören;
– ein geheimer Briefwechsel von Mitgliedern des Zentralorgans der IKS mit Militanten in anderen Ländern, um gegen diejenigen Verleumdungen zu verbreiten, die sie nun als „liquidatorische Fraktion“ bezeichnen, und um die Angeschriebenen gegen das Internationale Büro aufzubringen (mit anderen Worten: dieselbe Politik, die Bakunin betrieb, um für seine „Allianz“ zu werben);
– das Abhalten geheimer Treffen im August und September 2001, deren Zweck es war, nicht politische Analysen auszuarbeiten, sondern ein Komplott gegen die IKS auszuhecken. Als die an diesem Treffen beteiligten Militanten die Bildung eines „Arbeitskollektivs“ ankündigten, erklärten sie unter anderem, dass „wir keine Geheimtreffen abhalten“.
Nur durch Zufall und infolge der Ungeschicklichkeit eines dieser Bruderschaftsmitglieder kam das Protokoll eines dieser Geheimtreffen in die Hände der Organisation.
Kurz darauf verabschiedete die Vollversammlung des Internationalen Büros einmütig (das heißt, einschließlich der Stimmen zweier Mitglieder der aktuellen „internen Fraktion“) eine Resolution, deren Hauptpassagen wir hier zitieren:
„1. Nach dem Studium (...) des Protokolls vom Treffen am 20.8. zwischen den sieben Genossen, die das so genannte ‚Arbeitskollektiv‘ gebildet haben, und nach Untersuchung seines Inhalts, wo zum Ausdruck kommt:
– ein offen zur Schau getragenes Bewusstsein darüber, dass sie außerhalb der Statuten handeln und nichts Wichtigeres im Sinn haben, als diese Tatsache vor dem Rest der Organisation zu verbergen;
– ein Betrachten der restlichen Organisation als ‚die anderen‘, ‚sie‘, mit anderen Worten: als Feinde, die, in den Worten eines der Teilnehmer, ‚destabilisiert‘ werden müssen;
– die Absicht, ihre wahren Gedanken und Aktivitäten vor dem Rest der Organisation zu verstecken;
– die Etablierung einer Gruppendisziplin zu gleichen Zeit, als sie die Verletzung der Organisationsdisziplin befürworteten;
– die Erstellung einer Strategie, um die Organisation in die Irre zu führen und ihr die eigene Politik aufzuzwingen;
verurteilt das IB dieses Verhalten, das eine flagrante Verletzung unserer Organisationsprinzipien ist und eine ausgesprochene Illoyalität gegenüber dem Rest der Organisation offenbart (...)
2. Die Aktivitäten der Mitglieder des ‚Kollektivs‘ stellen ein äußerst ernstes organisatorisches Vergehen dar und verdienen die höchste Sanktion. Doch in Anbetracht dessen, dass die Teilnehmer dieses Treffens sich entschieden haben, das ‚Kollektiv‘ aufzulösen, beschließt das IB, auf Sanktionen zu verzichten in der Aussicht, dass die Militanten, die diesen Fehler begangen haben, nicht nur das ‚Kollektiv‘ auflösen, sondern:
– ihr Verhalten einer gründlichen Kritik unterziehen;
– über die Gründe, warum sie sich als Feinde der Organisation benommen haben, vertieft nachzudenken.
In diesem Sinne sollte diese Resolution des IB nicht als eine Unterschätzung des Ernstes des begangenen Fehlers interpretiert werden, sondern als eine Ermutigung für die Teilnehmer des Geheimtreffens vom 20.8., sich über diesen Ernst klar zu werden.“
Konfrontiert mit dem zerstörerischen Charakter ihres Verhaltens, wichen die Mitglieder des „Kollektivs“ einen Schritt zurück. Zwei von denen, die an den geheimen Treffen teilgenommen hatten, erfüllten tatsächlich, was die Resolution gefordert hatte: Sie unterzogen ihre Vorgehensweise einer ernsthaften Kritik und sind heute loyale Militante der IKS. Zwei andere zogen es, obwohl sie zugunsten der Resolution gestimmt hatten, vor, lieber auszutreten, als sich der erforderlichen Kritik zu unterziehen. Was die anderen angeht, so ließen sie ihre guten Vorsätze fallen und bildeten nur ein paar Wochen später die „interne Fraktion der IKS“, wobei sie die „Deklaration zur Bildung eines Arbeitskollektivs“ übernahmen, die sie noch kurz zuvor verworfen hatten.
Kaum war die selbsternannte „Fraktion“ gebildet worden, ließen ihre Mitglieder nichts unversucht, um ihre Angriffe gegen die Organisation und ihre Militanten eskalieren zu lassen, um die absolute Nichtigkeit ihrer politischen Argumente mit den empörendsten Lügen, den ekelhaftesten Verleumdungen und einer systematischen Verletzung unserer Funktionsregeln zu kombinieren, so dass die IKS selbstverständlich gezwungen war, dies zu unterbinden.[x] Eine Resolution, die am 18. November 2001 vom Zentralorgan der Sektion in Frankreich verabschiedet worden war, erklärte: „Die Militanten der ‚Fraktion‘ sagen, dass sie den Rest der Organisation von der Gültigkeit ihrer ‚Analysen‘ überzeugen möchten. Ihr Verhalten und ihre enormen Lügen beweisen, dass auch dies nur eine Lüge ist (...) Mit ihrem gegenwärtigen Verhalten wird es ihnen sicherlich nicht gelingen, auch nur einen Einzigen zu überzeugen (...) Die Exekutivkommission verurteilt vor allem die ‚Taktik‘, die darin besteht, die Statuten der IKS systematisch zu verletzen, um in der Lage zu sein – wenn die Organisation gezwungen wird, zur Selbstverteidigung Maßnahmen zu ergreifen – über die ‚stalinistische Degeneration‘ zu jammern und so die Bildung einer selbsternannten ‚Fraktion‘ zu rechtfertigen.“
Eine der von der „Fraktion“ endlos wiederholten Lügen ist die, dass die IKS sie mit Sanktionen belegt habe, um eine Debatte über fundamentale Fragen zu verhindern. Die Wahrheit ist, dass ihre Argumente von zahllosen Beiträgen einzelner Genossen und ganzer Sektionen der IKS wiederholt und gründlich widerlegt worden waren, wohingegen ihre eigenen Texte es systematisch vermieden, sowohl auf diese Beiträge als auch auf die offiziellen Berichte und Orientierungstexte zu antworten, die von den Zentralorganen vorgestellt worden waren. Dies ist in der Tat eine der von der „Fraktion“ bevorzugten Methoden: ihre eigene Verworfenheit dem Rest der Organisation und ganz besonders der, wie sie es nennen, „liquidatorischen Fraktion“ zu unterstellen. Zum Beispiel beschuldigen sie in einem ihrer ersten „Gründungstexte“, dem „Gegenbericht“ über die IKS-Aktivitäten für das im September 2001 tagende IB-Plenum, die Zentralorgane der IKS, „eine Orientierung (angenommen zu haben), die mit jener bisher in der Organisation (...) vom Ende der Auseinandersetzung 1993–96 bis zum gerade abgehaltenen 14. Kongress geltenden bricht“. Und nur um zu demonstrieren, wie sehr er den Orientierungen des 14. Kongresses zustimmt, lehnt der Autor dieses Dokuments ein paar Wochen später en bloc die vom Kongress verabschiedete Aktivitätsresolution ab, obwohl er für sie gestimmt hatte. In demselben Stil erklärt er scheinheilig, dass „wir uns auf die Auseinandersetzung berufen, die stets (...) für einen strengen statt ‚starren‘ Respekt gegenüber den Statuten gestanden hat. Ohne den hohen Respekt gegenüber den Statuten und ihrer Verteidigung gibt es keine Organisation mehr“. Und noch immer dient dieses Dokument als Plattform für geheime Treffen, deren Teilnehmer sich untereinander klar darüber sind, dass sie sich außerhalb der Statuten bewegen. Nur einige Wochen später beginnen sie, Seiten um Seiten einer vorgeblichen Pseudotheorie zu verfassen, mit der einzigen Absicht, die systematische Verletzung der Statuten zu rechtfertigen.
Wir könnten mit Beispielen derselben Art fortfahren, doch dann würde der Artikel die gesamte Revue füllen. Wir wollen jedoch ein weiteres bedeutsames Beispiel zitieren: den Anspruch der „Fraktion“, der wahre Vertreter der Kontinuität unseres Kampfes von 1993–96 für die Verteidigung der Organisation zu sein. Dies hindert den „Gegenbericht“ nicht daran zu erklären, dass die „Lehren von 1993 sich nicht auf das Clanwesen beschränken. Tatsächlich ist Letzteres nicht einmal ihr prinzipielles Element“. Besser noch, die „Deklaration zur Bildung eines ‚Arbeitskollektivs‘“ fragt: „Clans und Clanwesen: Sind das nicht Begriffe, die in der Geschichte von Sekten und der Freimaurerei angetroffen werden, aber nicht (...) in der Arbeiterbewegung der Vergangenheit? Kann das Alpha und Omega der Organisationsfragen auf die ‚Gefahr des Clanwesens‘ reduziert werden?“ In der Tat beabsichtigen die Mitglieder der „Fraktion“, uns für die Idee zu gewinnen, dass der Begriff des „Clans“ nicht zur Arbeiterbewegung gehört (was falsch ist, da bereits Rosa Luxemburg diesen Begriff benutzte, um die Führungsclique der deutschen Sozialdemokratie zu beschreiben). Dies ist nun wirklich eine radikale Methode, um die Analyse der IKS zu widerlegen, dass das Verhalten dieser Militanten Anzeichen einer Clandynamik ist: „Der Begriff des Clans ist ungültig.“ Und all dies im Namen des Kampfes von 1993–96, dessen wichtigste Dokumente wir lang und breit zitiert haben und die alle auf der fundamentalen Rolle des Clanwesens in den Schwächen der IKS bestehen!
Die Bildung einer parasitären Gruppe
Wie die Allianz innerhalb der IAA, so wurde die „Fraktion“ zu einem parasitären Organismus innerhalb der IKS. Und genauso wie die Allianz, die der IAA offen und öffentlich den Krieg erklärte, nachdem sie gescheitert war, die Kontrolle zu übernehmen, hat der Clan der alten Mehrheit im IS und seiner Freunde beschlossen, unsere Organisation öffentlich anzugreifen, sobald er sich vergegenwärtigte, dass er alle Kontrolle verloren hat und dass sein Verhalten, weit davon entfernt, die Zaudernden um sich zu scharen, es im Gegenteil ermöglicht hat, dass diese Genossen verstanden, was im Kampf um unsere Organisation auf dem Spiel stand. Der entscheidende Moment in diesem qualitativen Schritt im Krieg der „Fraktion“ gegen die IKS war die Vollversammlung des Internationalen Büros zu Beginn des Jahres 2002. Nach ernsthaften Diskussionen fasste dieses Treffen eine Reihe von wichtigen Beschlüssen:
a) die Umwandlung des Kongresses der französischen Sektion, für Mai 2002 geplant, in eine Außerordentliche Internationale Konferenz der gesamten IKS;
b) die Suspendierung der Mitglieder der „Fraktion“ wegen einer ganzen Reihe von Verletzungen der Statuten (einschließlich der Weigerung, ihre Beiträge voll zu bezahlen); die Organisation überließ es ihnen, bis zur Konferenz zur Einsicht zu kommen und zu versprechen, die Statuten zu respektieren, widrigenfalls die Konferenz nur den Schluss ziehen kann, dass sie sich selbst wohl überlegt und aus eigenem Willen außerhalb der Organisation stellen;
c) die prinzipielle Entscheidung, Jonas auszuschließen aufgrund eines detaillierten Berichts der Informationskommission, der ein Licht auf sein Verhalten warf, das demjenigen eines Agent provocateur würdig ist; die endgültige Entscheidung sollte erst getroffen werden, nachdem Jonas die Beschuldigungen gegen ihn unterbreitet wurden und er die Gelegenheit erhalten hatte, sich zu verteidigen.[xi]
Es ist bemerkenswert, dass die beiden Mitglieder der „Fraktion“, die an der Vollversammlung teilnahmen, sich bei der Abstimmung über den ersten Beschluss enthielten. Dies ist ein durch und durch paradoxes Verhalten von Militanten, die ständig erklären, dass die Militanten der IKS insgesamt von der „liquidatorischen Fraktion“ und den „Entscheidungsgremien“ in die Irre geführt und manipuliert seien. Kaum nahm die gesamte Organisation die Gelegenheit wahr, über unsere Probleme kollektiv zu diskutieren und zu entscheiden, gingen unsere tapferen „Fraktionäre“ zur Obstruktion über. Dies ist ein Verhalten, das in völligem Gegensatz zu jenem der linken Fraktionen in der Arbeiterbewegung steht, die stets forderten, dass Kongresse abgehalten werden, um Probleme in der Organisation anzupacken, etwas, was die Rechten systematisch verhinderten.
Was die beiden anderen Entscheidungen anbetraf, so betonte das Internationale Büro, dass die betroffenen Militanten dagegen Berufung einlegen können, und schlug vor, dass Jonas seinen Fall vor einem Ehrengericht, das aus Militanten des politischen Milieus des Proletariats gebildet werden sollte, vortragen kann, wenn er sich zu Unrecht von der IKS beschuldigt wähnt. Ihre Antwort bestand in einer neuen Eskalation. Jonas weigerte sich, sowohl die Organisation zu treffen, um seine Verteidigung darzulegen, als auch Berufung gegenüber der Konferenz einzulegen und um Gehör bei einem Ehrengericht zu ersuchen: So überwältigend sind die Beweise, dass es für alle Militanten der IKS und auch für Jonas selbst klar ist, dass er keine Ehre zu verteidigen hat. Gleichzeitig bekundete Jonas sein vollkommenes Vertrauen in der „Fraktion“. Die „Fraktion“ selbst begann, öffentlich Verleumdungen über die IKS zu verbreiten, zunächst indem sie an andere linkskommunistische Gruppen schrieb, dann indem sie etliche Texte an unsere Abonnenten verschickte, womit offenbar wurde, dass jenes Mitglied der „Fraktion“, das bis zum Sommer 2001 für die Abonnentenkartei verantwortlich gewesen war, die Kartei noch vor der Bildung des „Arbeitskollektivs“, ganz zu schweigen von der „Fraktion“, gestohlen hatte. Aus den Dokumenten, die an unsere Abonnenten geschickt wurden, können wir insbesondere entnehmen, dass die Zentralorgane der IKS gegen Jonas und die „Fraktion“ „gemeine Kampagnen (führen), mit denen sie die politischen Positionen, auf die sie ernsthaft zu antworten unfähig sind, verbergen und in Misskredit zu bringen versuchen“. Der Rest besteht aus der gleichen Brühe. Die Dokumente der „Fraktion“, die außerhalb der IKS verteilt wurden, bezeugen die totale Solidarität der „Fraktion“ mit Jonas und rufen ihn auf, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die „Fraktion“ offenbart so sich selbst als etwas, was sie von Anbeginn gewesen war, als Jonas im Schatten einer Kamarilla der Freunde von Bürger Jonas geblieben war.
Trotz des offenen und öffentlichen Kampfes der Jonas-Kamarilla gegen die IKS sandte unsere Organisation mehrere Briefe an alle Pariser Mitglieder der „Fraktion“, worin diese dazu eingeladen wurden, ihre Verteidigung auf der Konferenz darzulegen. Zunächst ging die „Fraktion“ zum Schein darauf ein, doch im letzten Moment führte sie stattdessen ihre endgültige und erbärmlichste Aktion gegen unsere Organisation aus. Sie weigerte sich, vor der Konferenz zu erscheinen, es sei denn, die Organisation erkenne die „Fraktion“ schriftlich an und nähme alle Sanktionen (einschließlich die des Ausschlusses von Jonas) zurück, die in Übereinstimmung mit unseren Statuten beschlossen worden waren. Indem sie sich über die von der Organisation verabschiedeten Sanktionen beschwerten, forderten diese Militanten ganz einfach, dass wir den ersten Schritt machen, indem wir die Sanktionen zurücknehmen. Dies ist natürlich die einfachste Lösung – sie hätten nichts mehr, worüber sie sich beschweren könnten! Konfrontiert mit dieser Situation, hatten sämtliche Delegationen der IKS trotz ihrer Bereitschaft, den Argumenten dieser Militanten zuzuhören (tatsächlich hatten die Delegationen bereits am Vorabend der Konferenz eine Berufungskommission gebildet, die sich aus Mitgliedern mehrerer territorialer Delegationen zusammensetzte, und berücksichtigt, dass es den Pariser Mitgliedern der „Fraktion“ ermöglicht wurde, ihre Argumente darzustellen), keine andere Alternative, als anzuerkennen, dass diese Elemente sich selbst außerhalb der Organisation gestellt haben. Angesichts ihrer Weigerung, sich selbst vor der Konferenz zu verteidigen und ihre Argumente vor der Berufungskommission darzulegen, stellte die IKS ihr Ausscheiden fest und konnte sie somit nicht mehr als Mitglieder der Organisation anerkennen.[xii]
Die Konferenz verurteilte ebenfalls einstimmig die kriminellen Methoden, die von der Jonas-Kamarilla benutzt wurden und darin bestanden, zwei Delegierte der mexikanischen Sektion zu „kidnappen“ (“mit ihrem Einverständnis“?), sobald diese auf dem Flughafen ankamen. Diese Mitglieder der „Fraktion“ wurden von ihrer Sektion delegiert, ihre Positionen auf der Konferenz zu vertreten, und ihre Flüge waren bereits von der IKS bezahlt worden. Sie trafen sich mit zwei Pariser Mitgliedern der „Fraktion“, die sie mitnahmen und die ihnen die Erlaubnis verweigerten, die Konferenz aufzusuchen. Als wir protestierten und forderten, dass die „Fraktion“ den Flugpreis zurückbezahlt, sollte es den mexikanischen Delegierten nicht gelingen, die Konferenz aufzusuchen, antwortete ein Pariser Mitglied der „Fraktion“ mit unglaublichem Zynismus: „Das ist euer Problem!“ Alle Militanten der IKS haben ihre große Empörung ausgedrückt und eine Resolution angenommen, die die Veruntreuung von IKS-Vermögen und die Weigerung, das von der Organisation ausgegebene Geld zurückzuzahlen, als Offenbarung der kriminellen Methoden der Jonas-Kamarilla verurteilte.Diese Methoden sind denen der Chenier-Tendenz (die 1981 Ausrüstungsgegenstände der Organisation gestohlen hatte) ebenbürtig und überzeugten schließlich auch die letzten Genossen, die noch zögerten, die parasitäre und antiproletarische Natur dieser selbsternannten „Fraktion“ anzuerkennen. Die „Fraktion“ hat inzwischen der IKS geantwortet, indem sie sich weigerte, das politische Material und das Geld, das unser Organisation gehört, zurückzugeben. Die Jonas-Kamarilla ist heute nicht nur zu einer parasitären Gruppe verkommen, deren Natur die IKS bereits in ihren Thesen über den politischen Parasitismus, veröffentlicht (Internationalen Revue Nr. 22, deutsche Ausgabe), analysiert hatte, sondern auch zu einer kriminellen Bande, die nicht nur Verleumdungen und Erpressungen benutzt, um unsere Organisation zu zerstören, sondern sie auch bestiehlt.[xiii]
Die Metamorphose langjähriger Militanter unserer Organisation, die zumeist wichtige Verantwortung in den Zentralorganen ausgeübt hatten, in eine kriminelle Bande erhebt sofort die Frage: Wie ist so etwas möglich? Der Einfluss von Jonas hat natürlich seinen Teil dazu beigetragen, die Mitglieder der „Fraktion“ dazu zu treiben, ihre Angriffe gegen die IKS im Namen eines „verneinenden Zentrismus“ zu „radikalisieren“. Dennoch ist dies nicht ausreichend für eine Erklärung solch einer Degeneration. Die Konferenz hat erst die Basis geschaffen, um unser Verständnis voranzutreiben.
Der politische Rahmen der Konferenz zum Verständnis unserer Schwierigkeiten
Auf der einen Seite stellte die Konferenz fest, dass die Tatsache, dass langjährige Militante einer proletarischen Organisation den Kampf verraten, in dem sie sich seit Jahrzehnten engagiert hatten, kein neues Phänomen in der Arbeiterbewegung ist: Militante aus der ersten Reihe wie Plechanow (der Gründungsvater des Marxismus in Russland) oder Kautsky (die marxistische Eminenz der deutschen Sozialdemokratie, der „Papst“ der II. Internationalen) beendeten ihr politisches Leben in den Reihen der herrschenden Klasse (der Erste unterstützte 1914 den Krieg, der Zweite verurteilte die russische Revolution von 1917).
Ferner stellte die Konferenz die Frage des Clanwesens innerhalb der weiter gefassten Frage des Opportunismus:
„Der Zirkelgeist und das Clanwesen, Schlüsselfragen, die vom Orientierungstext von 1993 gestellt worden waren, sind nur besondere Ausdrücke eines allgemeinen Phänomens: des Opportunismus in Organisationsfragen. Es ist offensichtlich, dass diese Tendenz, die im Falle der verhältnismäßig kleinen Gruppen wie die der russischen Partei 1903 oder der IKS eng mit affinitären Zirkel- und Clanformen verknüpft ist, sich beispielsweise in den Massenparteien der zerfallenden Zweiten oder Dritten Internationalen nicht auf dieselbe Weise ausdrückt.
Nichtsdestotrotz teilen die verschiedenen Ausdrücke desselben Phänomens bestimmte prinzipielle Charakteristiken. Unter ihnen ist die Unfähigkeit des Opportunismus, sich in einer proletarischen Debatte zu engagieren, eine der bemerkenswertesten. Insbesondere ist er unfähig, eine organisatorische Disziplin aufrechtzuerhalten, sobald er sich mit seinen Positionen in der Minderheit wiederfindet.
Es gibt zwei prinzipielle Ausdrücke dieser Unfähigkeit. In Situationen, in denen der Opportunismus sich innerhalb der proletarischen Organisationen im Aufwind befindet, neigt er dazu, die Divergenzen herunterzuspielen, indem er sie entweder als Missverständnisse darstellt, wie es die Bernsteinianer taten, oder systematisch die politischen Positionen des Opponenten annimmt, wie in den frühen Tagen der stalinistischen Strömung.
Wo sich der Opportunismus in der Defensive befindet, wie 1903 in Russland oder in der Geschichte der IKS, reagiert er hysterisch, indem er den Statuten den Krieg erklärt und sich selbst als Opfer der Repression bezeichnet, um der Debatte aus dem Weg zu gehen. Die beiden Hauptcharakteristiken des Opportunismus in solch einer Situation sind, wie Lenin betonte, die Sabotage der Organisationsarbeit und die Inszenierung von Vorfällen und Skandalen.
Der Opportunismus ist seinem Inhalt nach zu einer klaren Herangehensweise bei der theoretischen Klärung und zur geduldigen Überzeugung nicht in der Lage, was die revolutionären Minderheiten während des Weltkriegs, Lenins Verhalten 1917 oder jenes der italienischen Fraktion in den 30er Jahren und anschließend der französischen Fraktion auszeichnete.(...)
Der aktuelle Clan ist eine Karikatur dieser Vorgehensweise. Solange er sich im Besitz der Kontrolle wähnte, versuchte er, die in RI aufkommenden Divergenzen herunterzuspielen (‚keine Jahrhundertdebatte‘), während er sich darauf konzentrierte, diejenigen zu diskreditieren, die ihre Meinungsverschiedenheiten laut äußerten. Sobald die Debatte eine theoretische Dimension zu erreichen begann, wurde der Versuch unternommen, sie vorzeitig zu beenden. Sobald sich der Clan in der Minderheit fühlte13 und noch bevor sich die Debatte entwickeln konnte, wurden Fragen wie die des angeblichen ‚Idealismus‘ des Orientierungstextes zu programmatischen Divergenzen aufgeblasen, um die systematische Ablehnung der Statuten zu rdrechtfertigen.“ (Aktivitätenresolution der ausserordentlichen Konferenz der IKS 2002, Punkt 10)
Die Konferenz anerkannte ebenfalls das Gewicht des kapitalistischen Zerfalls, das auf der Arbeiterklasse lastet:
“Eines der Hauptcharakteristiken der Zerfallsphase besteht darin, dass das Patt zwischen Bourgeoisie und Proletariat die Gesellschaft in eine peinigende und sich dahinschleppende Agonie stürzt. Infolgedessen wird der Prozess der Entwicklung des Klassenkampfes, der Reifung des Bewusstseins und des Aufbaus der Organisation viel langsamer, zähflüssiger und widersprüchlicher sein. Die Konsequenz daraus ist eine Tendenz zur allmählichen Erosion der politischen Klarheit, der militanten Überzeugung und der organisatorischen Loyalität, den hauptsächlichen Gegengewichten zu den politischen und persönlichen Schwächen der einzelnen Militanten. (...)
Da die Opfer solch einer Dynamik begonnen haben, sich den Mangel jeglicher Perspektive zu teilen, was heute das Los einer zerfallenden bürgerlichen Gesellschaft ist, sind sie dazu verdammt, mehr als jeder andere Clan in der Vergangenheit einen irrationalen Immediatismus, eine fieberhafte Ungeduld, einen Mangel an Reflexion und einen radikalen Verlust theoretischer Fähigkeiten – also sämtliche Hauptaspekte des Zerfalls – auszudrücken.“ (ebenda, Punkt 6)
Die Konferenz hob ebenfalls hervor, dass eine grundlegende Ursache für die anfangs unrichtigen Positionen des IS und der gesamten Organisation über die Frage der Funktionsweise und für die organisationsfeindliche Kehrtwende der Mitglieder der „Fraktion“ sowie für die späte Identifizierung dieser Wende durch die IKS das Gewicht des Demokratismus in unseren Reihen ist. Sie beschloss folglicherweise, eine Diskussion über die Frage des Demokratismus auf der Grundlage eines Orientierungstextes zu eröffnen, der vom Zentralorgan der IKS entworfen werden soll.
Schließlich bestand die Konferenz auf der Bedeutung des Kampfes, der in der Organisation vonstatten geht:
“Die Auseinandersetzung der Revolutionäre ist eine ständige Schlacht an zwei Fronten: die Verteidigung und Errichtung der Organisation und die Intervention gegenüber der Klasse als Ganzes. Alle Aspekte dieser Arbeit hängen wechselseitig voneinander ab (...)
Im Zentrum der gegenwärtigen Auseinandersetzung steht die Verteidigung der Fähigkeit der Generation von Revolutionären nach 1968, die richtige marxistische Praxis, die revolutionäre Leidenschaft sowie die Erfahrungen von Jahrzehnten des Klassenkampfes und der organisatorischen Auseinandersetzung an eine neue Generation weiterzureichen. Es ist daher im Wesentlichen dieselbe Auseinandersetzung, ob sie nun innerhalb der IKS oder außerhalb, gegenüber den suchenden, vom Proletariat sekretierten Elementen, bei der Vorbereitung der künftigen Klassenpartei geführt wird.“ (ebenda, Punkt 20)
IKS
[i] aus: Ein Komplott gegen die IAA – Bericht über das Treiben Bakunins (MEW Bd. 18 S. 337)
[ii] Die Reaktion auf diese Drohungen waren bezeichnend: „Ranvier protestiert gegen die Drohung von Splingard, Guillaume und anderen, sie würden den Saal verlassen, da sie mit ihrem Verhalten beweisen, dass SIE, und nicht wir es sind, die sich IM VORAUS über die zur Diskussion stehenden Fragen abgesprochen haben“. „Morago [ein Mitglied der Allianz] spricht von der Tyrannei des Rates, doch ist es nicht Morago selber, der dem Kongress die Tyrannei seines Mandats aufzwingen will?“ (Intervention von Lafargue)
[iii] James Guillaume erklärte: „Alerini meint, dass die Kommission nur moralische Überzeugungen hat, und keine materiellen Beweise; er gehörte zur Allianz und ist stolz darauf (...) ihr seid die Heilige Inquisition; wir verlangen eine öffentliche Untersuchung und stichhaltige Beweise.“
[iv] s. die Artikel „Krise im revolutionären Milieu“, Internationale Revue Nr. 8, „Bericht zur Struktur und Funktionsweise der Organisation der Revolutionäre“, Internationale Revue Nr. 22 und „Presentation of the ICC’s 5th Congress“ in der International Review Nr. 35
[v] „Der 11. Kongress der IKS: Der Kampf zur Verteidigung und zum Aufbau der revolutionären Organisation“
[vi] Dies ist der Fall beim „Cercle de Paris“, der Ende der 1990er Jahre von Ex-Militanten der IKS, welche Simon (einem Abenteurer, der 1995 aus der IKS ausgeschlossen wurde) nahestanden, gegründet wurde und ein Pamphlet mit dem Titel „Que ne pas faire“ herausgegeben hatte, welches aus einem Haufen Verleumdungen gegen unsere Organisation bestand und sie als stalinistische Sekte darstellte.
[vii] mit anderen Worten: die ständige Kommission des Zentralorgans der IKS, des Internationalen Büros (IB), das sich aus Militanten aller territorialen Sektionen zusammensetzt;
[viii] Mit anderen Worten: er nahm dasselbe Verhalten an, wie James Guillaume vor dem Haager Kongress der IAA.
[ix] Auch dieses Verhalten, eine Informationskommission einzuschüchtern, ist nicht neu: Utin, der das Verhalten Bakunins vor der Untersuchungskommission des Haager Kongresses bezeugt hatte, wurde von einem Anhänger Bakunins körperlich angegriffen.
[x] In einem Zirkular vom November 2001 an alle Sektionen listete das Internationale Büro diese Vergehen gegen unserer Statuten auf. Hier ist ein kurzer Auszug aus dieser Liste:
– „das Streuen von Informationen über interne Fragen (...);
– die Weigerung dreier Mitglieder des Zentralorgans, an Treffen teilzunehmen, wo ihre Anwesenheit aufgrund der Statuten erforderlich war;
– das Verschicken eines Bulletins an die Privatadresse von Genossen in totaler Verletzung unserer zentralisierter Funktionsmechanismen und in Verletzung unserer Statuten;
– die Weigerung, ihre Beiträge in vollem Umfang, wie er von der IKS beschlossen wurde, zu bezahlen (die Mitglieder der ‚Fraktion‘ hatten ausdrücklich beschlossen, nur 30% ihrer Beiträge zu zahlen);
– die Weigerung, die Zentralorgane über den Inhalt einer angeblichen ‚Geschichte des IS‘ in Kenntnis zu setzen, die unter bestimmten Militanten zirkulierte und die völlig unerträgliche Angriffe gegen die Organisation und einige ihrer Militanten enthält;
– Erpressung durch die Drohung, interne Dokumente der Organisation und besonders ihrer Zentralorgane außerhalb der Organisation zu veröffentlichen.“
[xi] s. „Mitteilung an unsere Leser“, Weltrevolution Nr. 111
[xii] So wie die Bakunisten den Beschluss des Haager Kongresses als einen Trick anprangerten, um sie daran zu hindern, ihre Positionen vorzustellen, denunzierte die Jonas-Kamarilla die Feststellung der IKS, dass sie die Organisation verlassen haben, als einen versteckten Ausschluss, der bezweckte, ihre Meinungsverschiedenheiten zum Schweigen zu bringen.
[xiii] Zum Beispiel versucht die „Fraktion“ nun, die Gruppen des proletarischen Milieus gegeneinander auszuspielen und ihre Unterschiedlichkeiten überzubetonen. Auf dieselbe Weise hat ihr Bulletin Nr. 11 eine schmeichelnde Verführungskampagne gegenüber Elementen des parasitären Milieus wie dem „Cercle de Paris“, dem die Mitglieder der „Fraktion“ seine Verurteilung in der Vergangenheit nachsahen, betrieben. Einmal mehr nahmen sie das Verhalten von vollendeten „anti-autoritären“ Bakunisten an, die sich ihrerseits nach dem Haager Kongress mit den „staatssozialistischen“ Lassalleanern verbündet hatten.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee, sondern eine Notwendigkeit: Die Debabtte um die "proletarische Kultur"
- 3137 Aufrufe
Die Debatte über die „proletarische Kultur“
Die vorangegangenen Artikel dieser Reihe untersuchten, wie die kommunistische Bewegung in den 20er, 30er und 40er Jahren, den dunkelsten Jahren der Konterrevolution, darum gekämpft haben zu begreifen, was aus der ersten proletarischen Diktatur, die sich in den Grenzen eines Landes etabliert hatte, geworden war – die Sowjetmacht in Russland. Künftige Abhandlungen werden einen Blick auf die Lehren werfen, die die Revolutionäre aus dem Hinscheiden dieser Diktatur gezogen und auf ein künftiges proletarisches Regime angewendet haben. Doch bevor wir diese Richtung weiter verfolgen, müssen wir zu jenen Tagen zurückkehren, als die Russische Revolution noch am Leben war, um einen Schlüsselaspekt der kommunistischen Umwandlung zu studieren, der während dieser entscheidenden Periode aufgekommen war, wenn auch nicht gelöst wurde. Wir meinen hier die Frage der „Kultur“.
Wir tun dies nicht ohne ein gewisses Zögern, weil dieses Thema so weitläufig ist und der Begriff Kultur so oft missbraucht wird. Dies trifft vor allem auf dieses Zeitalter der Zersplitterung zu, das wir als den Zerfall des Kapitalismus bezeichnen. In früheren Phasen des Kapitalismus wurde die „Kultur“, das ist wahr, allgemein mit der „Hochkultur“ identifiziert, mit den künstlerischen Produkten der herrschenden Klasse; eine Sichtweise, die all ihre „marginalisierten“ Ausdrücke ignoriert oder über sie hinweggeht (so sei zum Beispiel auf die klassische bürgerliche Verachtung gegenüber den kulturellen Ausdrücken von eroberten primitiven Gesellschaften hingewiesen). Heute wird uns dagegen erzählt, dass wir in einer „multikulturellen“ Welt leben, wo sämtliche kulturellen Ausdrücke gleichermaßen gültig sind und wo praktisch jeder Teilaspekt des gesellschaftlichen Lebens selbst zur „Kultur“ wird (die „Kultur der Gewalt“, die „Kultur der Raffgier“, die „Kultur der Abhängigkeiten“ usw. usw.) Solche Vereinfachungen machen es unmöglich, zu einem allgemeinen, einheitlichen Begriff der Kultur als Produkt sämtlicher Epochen der menschlichen Geschichte bzw. der menschlichen Geschichte als Ganzes zu gelangen. Ein besonders schädlicher Missbrauch dieser Haltung zur Kultur wird im aktuellen imperialistischen Konflikt in Afghanistan ersichtlich: Wir werden aufgefordert, dies als einen Konflikt zwischen Kulturen, zwischen Zivilisationen – noch genauer: zwischen der „westlichen Zivilisation“ und der „muslimischen Gesellschaft“ – anzusehen. Dies ist zweifellos eine Frage, die sich dazu eignet, den wahren Kern zu verschleiern: dass es nur eine Zivilisation auf dem Planeten gibt, die dekadente Zivilisation des Weltkapitals.
Im Gegensatz dazu definierte Trotzki im Vertrauen auf die monistische Herangehensweise des Marxismus die Kultur folgendermaßen: „Erinnern wir uns daran, dass„Kultur“ ursprünglich ein gepflügtes, bestelltes Feld im Unterschied zum Urwald und noch ungenutzten Boden bedeutete. Kultur stand im Gegensatz zur Natur, das heisst, man unterschied zwischen dem, was der Mensch durch seine Anstrengungen erwarb, und dem, was die Natur ihm schenkte. Diese Antithese ist auch heute noch von grunglegender Bedeutung.
Kultur ist alles, was vom Menschen im Laufe seiner gesamten Geschichte geschaffen, gebaut, gelernt und erobert wurde; ihr stehen die Gaben der Natur, einschliesslich der Naturgeschichte des Menschen selbst als einer Tierart, gegenüber. Die Wissenschaft, die den Menschen als ein Erzeugnis der tierischen Entwicklung erforscht, wird (biologisch) Anthropologie genannt. Doch von dem Augenblick an, in dem der Mensch sich vom Tierreich trennte – und das geschah, als er zum ersten Mal primitive Werkzueuge aus Stein und Holz ergriff und seine Glieder mit ihnen bewehrte -, begann die Schöpfung und Anhäufung von Kultur, das heisst aller Arten von Kenntnissen und Fertigkeiten im Kampf mit der Natur und zum Zweck ihrer Unterwerfung.“ (Trotzki, Kultur und Sozialismus, 1926). Dies ist in der Tat eine sehr weitgefasste Definition – eine Verteidigung der materialistischen Ansicht, dass die Entstehung des Menschen und damit die Entwicklung von der Natur zur Kultur ein Produkt sind, das so grundlegend und universal ist wie die Arbeit.
Es bleibt jedoch das Problem, dass nach dieser Definition Politik und Wirtschaft in ihrem weitesten Sinn selbst Ausdrücke der menschlichen Kultur sind und wir Gefahr laufen, den Blick dafür, worüber wir reden, zu verlieren. Jedoch hebt Trotzki in einem anderen Essay, „Der Mensch lebt nicht nur von der Politik“, hervor, dass, um das reale Verhältnis zwischen Politik und Kultur zu verstehen, es notwendig sei, neben der weitestmöglichen Definition eine „enger gefasste“ Definition der politischen Sphäre zu schaffen, „die einen bestimten Teil der sozialen Aktivitäten charakterisiert, direckt verbunden mit dem Kampf um die Macht, und entgegengesetzt der ökonomischen und kulturellen Arbeit.“Wir können ohne weiteres dasselbe über den Begriff der Kultur sagen, den swir in diesem Zusammenhang zum großen Teil auf Bereiche wie die Kunst, die Erziehung und die „Alltagsprobleme“ (der Titel einer Sammlung von Abhandlungen, die die beiden o.g. Artikel enthält) anwenden werden. Von dieser Warte aus betrachtet, erscheinen die kulturellen Aspekte der Revolution zweitrangig oder zumindest abhängig von den politischen und ökonomischen Sphären. Und dies ist in der Tat der Fall: Wie Trotzki in dem Text, den wir in dieser Ausgabe wiederveröffentlichen, zeigt, ist es närrisch, eine wirkliche kulturelle Renaissance zu erwarten, solange die Bourgeoisie noch nicht besiegt worden ist und die materiellen Grundlagen einer sozialistischen Gesellschaft noch nicht gebildet worden sind. Genauso stellt Letztere, auch wenn wir das Problem der Kultur weiterhin auf das Reich der „Kunst“ einengen, die tiefsten Fragen über die Natur der Gesellschaft, die die Revolution zu bilden beabsichtigt. Es ist zum Beispiel kein Zufall, dass Trotzkis ausgefeiltester Beitrag zur marxistischen Theorie der Kunst, „Literatur und Revolution“, mit einer ausführlichen Vision über die Natur des Menschen in einer fortgeschrittenen kommunistischen Gesellschaft schließt. Denn wenn Kunst der Ausdruck der menschlichen Kreativität par excellence ist, dann verschafft sie uns einen unersetzlichen Schlüssel zum Verständnis darüber, wie die menschliche Gattung sein wird, wenn sie einmal die Ketten der Klassenausbeutung endgültig gebrochen hat.
Um uns selbst in diesem riesigen Bereich zu orientieren, beabsichtigen wir, uns eng an Trotzkis Schriften über diese Angelegenheit zu halten, die zwar nicht so bekannt sind, aber mit Sicherheit den klarsten Rahmen zu schaffen, um die Vorgehensweise bei diesem Problem herzuleiten.[i] Und ehe wir mit eigenen Worten formulieren, was Trotzki selbst bereits gesagt hatte, wollen wir lange Auszüge aus zwei Kapiteln von Literatur und Revolution wiederveröffentlichen. Das zweite dieser Kapitel konzentriert sich auf sein anregendes Porträt einer zukünftigen Gesellschaft. In dieser Internationalen Revue veröffentlichen wir einen Auszug aus dem ersten dieser Kapitel mit dem Titel „Was ist proletarische Kultur und ist sie möglich“, das eine besonders wichtige Komponente in Trotzkis Beitrag zur Debatte über die Kultur innerhalb der bolschewistischen Partei und der revolutionären Bewegung in Russland ist. Um diesen Beitrag richtig einzuschätzen, ist es notwendig, seinen historischen Hintergrund zu beschreiben.
Die Debatte über die „proletarischKultur“ im revolutionären Rusland
Die Tatsache, dass die Kulturdebatte keinesfalls zweitrangig war, wird durch die Tatsache veranschaulicht, dass sie Lenin dazu veranlasste, die folgende Resolution zu entwerfen, die auf dem Proletkult-Kongress 1920 von der kommunistischen Fraktion vorgestellt wurde:
1. In der Sowjetrepublik der Arbeiter und Bauern muss das gesamte Bildungswesen, sowohl auf dem Gebiet der politischen Bildung im allgemeinen als auch auf dem Gebiet der Kunst im besonderen, vom Geist des Klassenkampfes durchdrungen sein, den das Proletariat zur Verwirklichung der Ziele seiner Diktatur führt, d. h. für den Sturz der Bourgeoisie, für die Aufhebung der Klassen, für die Abschaffung jeglicher Ausbeutung des Menschen durch den menschen.
2. Deshalb muss das Proletariat sowohl durch seine Vorhut, die Kommunistische Partei, als auch durch die ganze Masse der verschiedenen proletarischen Organisationen überhaupt als aktivste und ausschlaggebende Kraft an der gesamten Volksbildung mitwirken.
3. Die ganze Erfahrung der neueren Geschichte und insbesondere der über ein halbes Jahrhundert währende revolutionäre Kampf des Proletariats aller Länder seit dem Erscheinen des „Kommunistischen Manifests“ haben unwiderleglich bewiesen, dass nur die Weltanschauung des Marxismus die Interessen, die Auffassungen und die Kultur des revolutionären Proletariats richtig zum Ausdruck bringt
4. Der Marxismus hat seine weltgeschichtliche Bedeutung als Ideologie des revolutionären Proletariats dadurch erlangt, dass er die wertvollsten Errungenschaften des bürgerlichen Zeitalters keineswegs ablehnt, sondern sich umgekehrt alles, was in der mehr als zweitausendjährigen Entwicklung des menschlichen Denkens und der menschlichen Kultur wertvoll war, angeeignet und es verarbeitet. Nur die weitere Arbeit auf dieser Grundlage und in dieser Richtung, inspiriert durch die praktische Erfahrung der Diktatur des Proletariats, dieses seines letzten Kampfes gegen jegliche Ausbeutung, kann als Aufbau einer wirklichen Kultur anerkannt werden.
5. Der gesamtrussische Kongress des Proletkult, der diesen prinzipiellen Standpunkt unwandelbar vetritt, weist alle Versuche, eine eigene, besondere Kultur auszuklügeln, sich in eigenen, abgesonderten Organisationen abzukapseln, die Arbeitsgebiete des Volkskommisariats für Bildungswesen und des Proletkults voneinander abzugrenzen oder eine „Autonomie„ des Proletkults innerhalb der Institutionen des Volkskommissariats für Bildungswesen herzustellen usw., als theoretisch falsch und praktisch schädlich aufs entschiedenste zurück. Der Kongress macht es im Gegenteil allen Organisationen des Proletkults zur unabdingbaren Pflicht, sich alsHilfsorgane des Volkskommissariats für Bildungswesen zu betrachten und ihre Aufgaben, die einen Teil der Aufgaben der Diktatur des Proletariats bilden, unter der allgemeinen Leitung der Sowjetmacht (Insbesondere des Volkskommissariats für Bildungswesen) und der Kommunistischen Partei Russlands zu lösen.“ (Lenin, Resolutionsentwurf, Bd. 31, S. 307)
Die Bewegung der proletarischen Kultur, kurz: Proletkult, war 1917 mit der Absicht gebildet worden, eine politische Orientierung für die kulturelle Dimension der Revolution zu schaffen. Sie wird häufig mit Alexander Bogdanow in Verbindung gebracht, der ein Mitglied der bolschewistischen Fraktion in in ihren ersten Jahren gewesen war, aber mit Lenin über eine Reihe von Themen aneinander geraten war, und zwar nicht nur über die Bildung der Ultimatistischen[ii] Gruppe nach 1905, sondern auch, was viel bekannter ist, über Bogdanows Verarbeitung der Ideen Machs und Avenarius im Reich der Philosophie und, etwas allgemeiner, über seine Bemühungen, den Marxismus mit vielfältigen theoretischen Systemen wie sein Begriff der „Strukturlehre“ zu vervollständigen. Wir können hier nicht auf jedes Detail im Denken Bogdanows eingehen; nach dem bisschen, was wir darüber wissen (nur bestimmte Arbeiten sind aus dem Russischen übersetzt worden), war er trotz seiner Mängel in der Lage, einige wichtige Einsichten zu entwickeln – insbesondere über die Frage des Staatskapitalismus in der Epoche des kapitalistischen Niedergangs. Genau aus diesem Grund verlangen seine Ideen eine viel ausführlichere Kritik, und zwar von einem deutlich proletarischen Standpunkt aus.[iii] Proletkult war jedoch keineswegs auf Bogdanow begrenzt; Bucharin und Lunascharski, um nur die beiden führenden Bolschewiki zu nennen, waren ebenfalls mit der Organisation verbunden und teilten nicht immer Lenins Standpunkt über sie. Bucharin z.B., dem es oblag, die Resolution auf dem Proletkult- Kongress zu präsentieren, beanstandete bestimmte Elemente in Lenins Resolutionsentwurf, die daraufhin in einer etwas modifizierten Form präsentiert wurde.
Proletkult blühte während der heroischen Phase der Revolution auf, als die Entfesselung der revolutionären Energien einer riesigen Welle von Ausdrücken und des Experimentierens an der Künstlerfront Auftrieb gab, wobei viele von ihnen sich ausdrücklich mit der Revolution identifizierten. Darüber hinaus beschränkte sich das Phänomen nicht auf Russland, wie die Entwicklung von Bewegungen wie den Dadaismus und den Expressionismus in Deutschland oder etwas später den Surrealismus in Frankreich und anderswo bezeugte. In den Jahren zwischen 1917 und 1920 schnellte die Mitgliederzahl des Proletkults auf ungefähr eine halbe Million hoch, mit über 30 Zeitschriften und ungefähr 300 Gruppen. Für Proletkult war der Kampf an der kulturellen Front genauso wichtig wie der Kampf an der politischen und ökonomischen Front. Er sah sich selbst als führende Kraft im Kulturkampf, während die Partei den politischen Kampf und die Gewerkschaften den wirtschaftlichen Kampf anführten. Er schuf zahlreiche Studios, damit Arbeiter zusammenkommen und sich an Experimenten in Malerei, Musik, im Drama, in der Poesie und in anderen Kunstbereichen beteiligen konnten und gleichzeitig zu neuen Formen des Gemeinschaftslebens, der Erziehung und so weiter ermutigt wurden. Es sollte betont werden, dass die Explosion des gesellschaftlichen und kulturellen Experimentierens in Russland während dieser Periode sich viel weiter erstreckte als der Proletkult selbst und unter anderem Namen auftrat. Doch die Bedeutung der Diskussionen im Proletkult damals und heute liegt darin, dass er versuchte, diese Phänomene innerhalb einer marxistischen Interpretation festzulegen. Die sich dahinter verbergende Leitidee war, wie der Name andeutet, dass das Proletariat, wenn es sich vom Joch der bürgerlichen Ideologie befreien sollte, seine eigene Kultur entwickeln musste, die auf einem radikalen Bruch mit der hierachischen Kultur der alten herrschenden Klasse basierte. Proletarische Kultur würde egalitär und kollektiv sein, während bürgerliche Kultur elitär und individualistisch ist; so wurden z.B. Experimente mit Orchestern ohne Dirigenten und mit kollektiv geschaffenen Gedichten und Gemälden unternommen. Zusammen mit der futuristischen Bewegung, mit der Proletkult eine enge, aber manchmal auch kritische Beziehung unterhielt, gab es eine starke Neigung, alles zu erhöhen, das modern, urban und Maschinen gestützt war, im Gegensatz zu den ländlichen Vorlieben für das Mittelalter, die bis dahin die russische Kultur dominiert hatten.
Die Kulturdebatte wurde zu einer brennenden Frage in der Partei, nachdem der Bürgerkrieg siegreich beendet worden war. Es war dieser Punkt, an dem Lenin begann, die Bedeutung des Kulturkampfes zu betonen: „...und zugleich müssen wir zugeben, dass sich unsere Auffassung vom Sozialismus grundlegend geändert hat. Diese grundlegende Änderung besteht darin, dass wir früher das Schwergewicht auf den politischen Kampf, die Revolution, die Eroberung der Macht usw. legten und auch legen mussten. Heute dagegen ändert sich das Schwergewicht soweit, dass es auf die friedliche organisatorische ‚Kultur‘arbeit verlegt wird. Ich würde sagen, dass sich das Schwergewicht für uns auf blosse Kulturarbeit verschiebt, gäbe es nicht die internationalen Beziehungen, hätten wir nicht die Pflicht, für unsere Position in internationalem Masstab zu kämpfen. Wenn man aber davon absieht und sich auf die inneren ökonomischen Verhältnisse beschränkt, so reduziert sich bei uns jetzt das Schwergewicht der Arbeit tatsächlich auf blosse Kulturarbeit.“ (LW, Bd. 33, Seite 460)
Doch für Lenin hatte dieser Kulturkampf eine andere Bedeutung als für Proletkult, da er mit dem Wechsel von der Periode des Bürgerkriegs zur Wiederaufbauperiode der NEP verbunden war. Für Lenin bestand das Problem, dem sich die Sowjetmacht gegenübersah, nicht in der Schaffung einer neuen proletarischen Kultur: Diese erschien ihm in Anbetracht der internationalen Isolation des russischen Staates und der fürchterlichen kulturellen Rückständigkeit der russischen Gesellschaft (Unwissenheit, Vorherrschaft von Religionen und „asiatischer“ Gebräuche, etc.) völlig utopisch. Für Lenin mussten die russischen Massen erst das Laufen lernen, bevor sie rennen konnten, was bedeutete, dass sie noch nicht den Schritt zur Verinnerlichung der wichtigsten Errungenschaften der bürgerlichen Kultur gemacht, geschweige denn eine proletarische geschaffen hatten. Diese Vorgehensweise entsprach der Forderung, dass das Sowjetregime zu lernen habe, wie man Handel treibt: Mit anderen Worten, es sollte von den Kapitalisten lernen, um in einer kapitalistischen Umgebung zu überleben. Gleichzeitig war Lenin in wachsendem Maße darüber besorgt, dass das Wachstum der Bürokratie ein direktes Resultat der kulturellen Rückständigkeit Russlands war: Der Kampf für kulturellen Fortschritt war also auch ein Bestandteil des Kampfes gegen die wachsende Bürokratie. Aus diesem Grund konnte nur ein gebildetes und kulturelles Proletariat das staatliche Management in die eigenen Hände nehmen. Gleichzeitig wurde die neue Bürokratenschicht größtenteils als ein Auswuchs des bäuerlichen Konservatismus in Russland und des Mangels an moderner Kultur betrachtet.
Die auf dem Proletkult-Kongress vorgebrachte Resolution schien, obgleich sie vor der Annahme der NEP (Neue ökonomische Politik) verfasst worden war, diesen Sorgen Rechnung zu tragen. Ihr stärkster Punkt war, dass sie darauf beharrte, dass der Marxismus die kulturellen Errungenschaften der Vergangenheit keinesfalls ablehnte, sondern tatsächlich all das Gute aus ihnen verinnerlichte. Dies war eine klare Zurückweisung des „Ikonologismus“ von Proletkult, seiner Tendenz, alle vorherigen kulturellen Entwicklungen zu leugnen. Auch wenn Bogdanow selbst sich dieser Frage differenzierter annäherte, so gibt es doch keinen Zweifel, dass die immediatistische und ouvrieristische Haltung in Proletkult weit verbreitet war. Auf seiner ersten Konferenz wurde z.B. die Ansicht ausgedrückt, dass „alle Kultur der Vergangenheit als bürgerlich bezeichnet werden kann, dass dabei – ausser den Naturwissenschaften und technischen Kenntnissen (...) nichts lohnendes zu retten sei, und dass das Proletariat seine Arbeit mit der Zerstörung der alten Kultur beginnen und unmittelbar nach der Revolution mit dem Aufbau einer neuen fortfahren soll“ (aus: „Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution“ von Richard Stites 1989 – eine sehr sorgfältige Untersuchung der zahlreichen kulturellen Experimente in den frühen Jahren der Revolution). In Tambow planten 1919 „die lokalen Anhänger des Proletkult alle Bücher in den Bibliotheken zu verbrennen und glaubten, dass mit dem beginnenden neuen Jahr die Regale nur noch mit proletarischen Werken aufgefüllt würden.“ (ebenda).
Entgegen dieser vergangenheitsbezogenen Sichtweise beharrte Trotzki in „Literatur und Revolution“ darauf, „...dass wir Marxisten immer mit der Tradition gelebt haben und dass wir gerade deshalb Revolutionäre geworden sind“. Die Überhöhung des Proletariats, wie es zu einem beliebigen Zeitpunkt ist, war nie die Haltung der Marxisten gewesen, die das Proletariat in seiner historischen Dimension betrachten, welche die entfernteste Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, wenn das Proletariat sich in der menschlichen Gemeinschaft auflösen wird, umschließt. Mittels sprachlicher Ironie wurde aus Proletkult oft „ein Kult des Proletariats“, der nur äußerlich radikal ist und leicht eingeholt werden kann vom Opportunismus, welcher auf einer beschränkten und unmittelbaren Vision der Klasse aufblüht. Derselbe Ouvrierismus fand seinen Ausdruck in der Neigung Proletkults zu behaupten, dass die proletarische Kultur nur das Produkt der Industriearbeiter sein könne. Doch wie Trotzki in Literatur und Revolution feststellte, waren die besten Künstler nicht notwendigerweise Arbeiter; die gesellschaftliche Dialektik, welche die radikalsten Kunstwerke herstellt, ist weitaus komplexer als die reduktionistische Ansicht, dass sie von den individuellen Mitgliedern der revolutionären Klasse kommen müsse. Dasselbe, wollen wir hinzufügen, trifft auf das Verhältnis zwischen der sozialen und politischen Revolution des Proletariats einerseits und neuen künstlerischen Durchbrüchen zu: Es gibt eine grundlegende Verbindung zwischen beiden, aber sie ist weder mechanisch noch national. Zum Beispiel: Während Proletkult versuchte, eine neue, „proletarische“ Musik in Russland zu kreieren, fand mit dem Durchbruch des Jazz eine der durchschlagendsten Entwicklungen in zeitgenössischer Musik im kapitalistischen Amerika statt.
Lenins Resolution drückte auch seinen unversöhnlichen Gegensatz zur Neigung von Proletkult aus, sich selbst auf autonome Weise, fast wie eine eigene Partei, mit Kongressen, einem Zentralkomitee und so weiter, zu organisieren. Und in der Tat schien diese Organisationsweise auf einer realen Verwechslung zwischen politischer und kultureller Sphäre zu beruhen, eine Tendenz, die beiden zu verschmelzen, und, im Falle Bogdanows, gar eine Versuchung, die kulturelle Sphäre als die wichtigere anzusehen.
Wir sollten dabei allerdings immer kritisch im Auge behalten, dass es sich hier um jene Periode handelte, in der Lenin sich feindlich gegen jede Form des Dissidententums in der Partei wandte. Wie wir in früheren Artikeln dieser Reihe bemerkt hatten, wurden 1921 die „Fraktionen“ verbannt, und linke Gruppen und Strömungen innerhalb der Partei gerieten ins volle Feuer, das 1923 in der physischen Repression gegen linkskommunistische Gruppen kulminierte. Und einer der Gründe für Lenins unüberbrückbaren Gegensatz zu Proletkult bestand darin, dass Letztere dazu neigte, zu einer Anlaufstelle für gewisse Dissidenten in und rund um der Partei zu werden. Die Betonung des Egalitarismus und der spontanen Kreativität der Industriearbeiter durch Proletkult kreuzte sich mit den Ansichten der Arbeiteropposition, und 1921 ließ eine Gruppe, die sich die Kollektivisten nannte, einen Text auf dem Proletkult-Kongress herumgehen, in dem neben der Sympathie für die Arbeiteropposition wie auch für Proletkult auch die Ansichten Bogdanows über die Philosophie und seine Analyse des Staatskapitalismus vertreten wurde, die eigentlich die NEP kritisierte. Ein Jahe später stellte die Gruppe Arbeiterwahrheit ähnliche Ansichten vor; Bogdanow wurde wegen Verwicklung in letztgenannter Gruppe kurzzeitig inhaftiert, obwohl er abstritt, sie in irgendeiner Weise unterstützt zu haben. (Nach dieser Episode zog sich Bogdanow aus der aktiven Politik zurück und konzentrierte sich auf die wissenschaftliche Arbeit.) So ist Lenins Beharren darauf, dass Proletkult sich selbst mehr oder minder in der staatlichen „Kulturinstitution“, dem Volkskommissariat für Erziehung, aufzulösen habe, in diesem Zusammenhang zu betrachten.
Unserer Ansicht nach ist die direkte Unterordnung der künstlerischen Bewegungen unter den Übergangsstaat nicht die richtige Antwort auf die Verwechslung zwischen der künstlerischen und der politischen Sphäre; tatsächlich neigt sie dazu, beides zu vermischen. Laut Senowia Sochor in Revolution und Kultur war Trotzki gegen Lenins Bemühungen, Proletkult im Staat verschwinden zu lassen, auch wenn er mit vielen Kritiken Lenins an Proletkult übereinstimmte; in „Literatur und Revolution“ stellt er eine deutlichere Grundlage zur Bestimmung der kommunistischen Politik gegenüber der Kunst vor: „Die marxistische Methode bietet die Möglichkeit, die Entwicklungsbedingungen für die neue Kunst zu beurteilen, all ihre Quellen zu beobachten und die fortschrittlichsten unter ihnen durch kritische Durchleuchtung der Wege zu unterstützen – mehr aber nicht. Die Kunst muss ihre Wege auf eigenen Füssen zurücklegen. Die Methoden des Marxismus sind nicht die Methoden der Kunst. Die Partei lenkt das Proletariat, nicht den historischen Prozess. Es gibt Gebiete, auf denen sie kontrolliert und fördert. Und es gibt Gebiete auf denen sie nur fördert. Es gibt schliesslich Gebiete, auf denen sie sich nur orientiert. Auf dem Gebiet der Kunst ist die Partei nicht berufen zu kommandieren. Sie kann kann und soll schützen, fördern und lediglich indirekt lenken. Sie kann und soll den verschiedenen Künstlergruppen, die sich aufrichtig um eine Annäherung an die Revolution bemühen, den bedingten Kredit ihres Vertrauens gewähren, um ihre künstlerische Gestaltung zu fördern. Und schon auf keinen Fall kann und wird die Partei sich auf den Standpunkt einer literarischen Clique stellen, die andere literarische Cliquen bekämpft, teilweise einfach nur, weil sie Konkurrenten sind.“ (Kapitel 7 „Die Parteipolitik in der Kunst“) 1938 äußerte sich Trotzki in Erwiderung auf die nazistischen und stalinistischen Absichten, die Kunst auf ein bloßes Anhängsel der Staatspropaganda zu reduzieren, noch deutlicher: „Wenn zur besseren Entwicklung der materiellen Produktion die Revolution ein sozialistisches Regime mit einer zentralisierten Kontrolle aufbauen muss, so muss zur Entwicklung der intelektuellen Kreativität ein Regime der individuellen Freiheit im anarchistischen Sinne etabliert werden. Keine Autorität, kein Diktat, nicht die geringsten Order von oben.“ (ebenda)
Trotzki ging auch bei dem allgemeinen Problem der proletarischen Kultur tiefer als Lenin: Während Lenins Resolution Raum für diese Auffassung ließ, lehnte sie Trotzki rundweg ab; und er tat dies auf der Basis gründlicher Überlegungen über die Natur des Proletariats als die erste revolutionäre Klasse in der Geschichte als eigentumslose und ausgebeutete Klasse. Dieses Verständnis, ein Schlüssel, um praktisch jeden Aspekt des proletarischen Klassenkampfes zu begreifen, wird in jenem Auszug aus „Literatur und Revolution“ äußerst deutlich aufgeführt, den wir im Anschluss an diesem Artikel veröffentlichen. Es gibt auch eine sehr kurze Zusammenfassung dieser Thesen über proletarische Kultur in der kurzen Einleitung zu diesem Buch: „Es ist grundfalsch, der bürgerlichen Kultur und der bürgerlichen Kunst die proletarische Kultur und die proletarische Kunst gegenüberzustellen. Diese letztgenannte wird es überhaupt nicht geben, da das proletarische Regime provisorisch, vorübergehend ist. Der historische Sinn und die moralische Grösse der proletarischen Revolution bestehen darin, dass sie den Grundstein für eine klassenlose, ersmals wahrhafte menschliche Kultur legt.“
„Literatur und Revolution“ wurde in der Periode von 1923–24 verfasst – mit anderen Worten, in genau jener Periode, in welcher der Kampf der Linken gegen die emporkommende stalinistische Bürokratie ernst zu werden begann. Trotzki schrieb dieses Buch in seinem Sommerurlaub. In gewisser Weise vermittelt es ein Bild von den Spannungen und Anstrengungen in der täglichen „politischen“ Auseinandersetzung innerhalb der Partei. Doch in einer anderen Beziehung war es auch Teil des Kampfes gegen den Stalinismus. Nachdem der ursprüngliche Proletkult im Anschluss an der Parteikontroverse 1920–21 einem rapiden Niedergang anheimfiel, erlebten Teile von ihm Mitte der 20er Jahre eine Wiedergeburt als falscher Radikalismus, der eines der Gesichter des Stalinismus ist. So verschaffte 1925 einer seiner Ableger, die Gruppe Proletarische Schriftsteller eine „kulturelle“ Ausrede für die Kampagne der Bürokratie gegen den Trotzkismus: „Trotski leugnet die Möglichkeit einer proletarischen Klassenkultur und Kunst mit dem Argument, dass wir auf eine klassenlose Gesellschaft zuschreiten. Doch mit demselben Argument verwerfen die Menschewiki die Notwendigkeit der Klassendiktatur, eines Klassenstaates und so fort. Die Standpunkte Trotzkis und Voronskis sind Trotzkismus angewandt auf Fragen der Ideologie und der Kunst“. Hier dient die Phraseologie der „Linken“ über eine Kunst ausserhalb von Klassen zur Kaschierung von opportunistischen Beschneidungen der kulturellen Aufgaben des Proletariates“. An anderer Stelle behauptete sie, dass „...der bemerkenswerte Erfolg der proletarischen Literatur nur durch den politischen und wirtschaftlichen Fortschritt detr arbeitenden Massen in der Sowjetunion möglich war.“ (“First Phase of the Cultural Revolution in Soviet Russia“, Wiliam G. Rosenberg, 1990). Doch dieses „politische und kulturelle Wachstum“ wurde nun unter dem Banner des „Sozialismus in einem Land“ ausgeführt. Stalins monströse ideologische Revision, die die Diktatur des Proletariats mit dem Sozialismus verschmolz, um beide zu untergraben, erlaubte so gewissen Strängen von Proletkult zu behaupten, dass auf den Fundamenten einer sozialistischen Wirtschaft die proletarische Kultur tatsächlich errichtet worden sei.
Auch Bucharin lehnte Trotzkis Kritik der proletarischen Kultur ab, und zwar aus dem Grund, weil er nicht verstand, dass die Übergangsperiode zur kommunistischen Gesellschaft ein äußerst lang hingezogener Prozess sein kann. Infolge des Phänomens der ungleichen Entwicklung würde die Periode der proletarischen Diktatur lang genug dauern, so dass eine gesonderte proletarische Kultur entstehen kann. Dies war auch die theoretische Grundlage für die Abschaffung der Perspektive der Weltrevolution zugunsten des Aufbaus des „Sozialismus“ im isolierten Russland[iv].
Das blutige und grausame Register der stalinistischen Staaten auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene ist Beweis genug, dass das, was in diesen Ländern aufgebaut wurde, nicht das Geringste mit Sozialismus zu tun hat. Doch die völlige kulturelle Leere dieser Regimes, ihre Unterdrückung aller wirklichen künstlerischen Kreativität zugunsten der ekelerregendsten Art des totalitären Kitsches liefert eine weitere Bestätigung, dass sie niemals ein Ausdruck des Fortschritts zu einer wahrhaft menschlichen Kultur war, sondern ein besonders brutales Produkt dieses senilen und morbiden kapitalistischen Systems. Die Art und Weise, wie der stalinistische Apparat in Russland ab den 30er Jahren das ganze „avantgardistische“ Experimentieren in Kunst und Erziehung ablegte, ist zusammen mit der so genannten „Kulturrevolution“ in den 60er Jahren in China der wohl schlagendste Beweis dafür. Die traurige Geschichte der stalinistisch-maoistischen Leviathane bieten keine sonst wie gearteten Lehren über die kulturellen Themen, mit denen die Arbeiterklasse in der zukünftigen Revolution konfrontiert ist.
CDW
[i] Eines der Resultate der Konterrevolution ist, dass die linkskommunistische Tradition, die den Marxismus während dieser Periode bewahrte und weiterentwickelte, wenig Zeit und Gelegenheit hatte, den allgemeinen Bereich von Kunst und Kultur zu untersuchen; und jene Beiträge, die geleistet worden waren (z.B. Rühle, Bordiga und andere), harren ihre Ausgrabung und Synthese.
[ii] Die „Ultimatisten“ waren zusammen mit den „Otsovisten“ eine Tendenz innerhalb des Bolschewismus, die nicht mit den parlamentarischen Taktiken der Partei nach dem Aufstand von 1905 einverstanden waren. Der Streit mit Lenin über Bogdanows philosophische Motive erhitzte sich, als er mit den mehr direkten politischen Divergenzen kombiniert wurde, und endete mit dem Ausschluss Bogdanows aus der bolschewistischen Gruppe 1909. Bogdanows Gruppe verblieb innerhalb der breiteren russischen solzialdemokratischen Partei und veröffentliche die Zeitschrift Vpered (Vorwärts) für die nächsten paar Jahre. Auch hier muss eine kritische Geschichte dieser frühen „linken“ Trends im Bolschewismus erst noch geschrieben werden.
[iii] siehe dazu: Revolution and Culture, The Bogdanov-Lenin Controversy von Senovia Sochor, Cornell University, 1988; um sich ein Bild über die Hauptunterschiede zwischen Lenin und Bogdanow zu machen. Der Ausgangspunkt des Autors ist jedoch eher akademisch als revolutionär. In der Frage des Staatskapitalismus verhielt sich Bogdanow kritisch gegenüber Lenins Neigung, ihn als eine Art Vorzimmer zum Sozialismus zu betrachten, und schien ihn als einen Ausdruck des kapitalistischen Abstiegs anzuerkennen (Kap. 4 in o.g. Schrift).
[iv] s. Isaac Deutscher, Der unbewaffnete Prophet. Deutschers Kapitel über Trotzkis Schriften über die Kultur ist genauso brillant wie der Rest der Biographie, und wir haben ausgiebig davon für diesen Artikel Gebrauch gemacht. Es enthüllt jedoch auch das tragische Schicksal des Trotzkismus. Deutscher stimmt zu 99% der Ansicht Trotzkis über „proletarische Kultur“ zu, macht jedoch eine höchst bedeutende Konzession gegenüber Bucharins Idee, dass ein isoliertes „Übergangsregime“ jahrzehntelang oder länger existieren könne. Laut Deutscher und dem Nachkriegs-Trotzkismus waren die stalinistischen Regimes, die außerhalb der UdSSR etabliert wurden, genauso wie die UdSSR selbst allesamt „Arbeiterstaaten“, gefangen in einer etwas zwielichtigen Welt zwischen einer proletarischen Revolution zur nächsten – und „Trotzki unterschätzte zweifellos die Dauer der Diktatur des Proletariates und den damit unvermeidlich verbundenen bürokratischen Charakter.“ In Wahrheit war dies nichts anderes als eine kritische Verteidigung des stalinistischen Staatskapitalismus.
Theoretische Fragen:
- Kultur [107]
Dokumente aus dem Organisationsleben: Die Frage der Funktionsweise in der IKS
- 3132 Aufrufe
Die Frage der Funktionsweise der Organisation in der IKS
Die IKS hat kürzlich
eine Außerordentliche Konferenz abgehalten, die den Organisationsfragen
gewidmet war. In unserer Territorialpresse und in der nächsten Ausgabe der
Internationalen Revue werden wir auf die Arbeit dieser Konferenz zurückkommen.
Da die hier behandelten Fragen große Ähnlichkeiten mit bereits in der
Vergangenheit behandelten aufweisen, sahen wir es als nützlich an, Auszüge aus
einem internen Dokument (das von der IKS einstimmig angenommen worden war) zu
veröffentlichen, das als Grundlage im Kampf zur Verteidigung der Organisation
diente. Wir haben diese Auseinandersetzung in den Jahren 1993–1995 geführt und
darüber auch in der International Review Nr. 82 (engl./frz./span. Ausgabe)
anlässlich des 11. Kongresses der IKS Rechenschaft abgelegt.
Der auf der Vollversammlung
des IB1 im Oktober 1993 vorgelegte Aktivitätenbericht stellt die Existenz bzw.
das Fortdauern von organisatorischen Schwierigkeiten in einer großen Anzahl von
Sektionen der IKS fest. Der Bericht für den 10. Internationalen Kongress hatte
bereits in aller Ausführlichkeit diese Schwierigkeiten behandelt. Er hatte vor
allem auf die Notwendigkeit einer größeren internationalen Einheit der
Organisation, auf eine lebendigere und strengere Zentralisation bestanden. Die
gegenwärtigen Schwierigkeiten sind ein Beweis dafür, dass die damals
eingeleiteten, diesbezüglichen Anstrengungen nicht ausreichend waren. Die im
Verlauf der letzten Periode verzeichneten Unregelmäßigkeiten in der
Funktionsweise bringen das Vorhandensein von Verzögerungen und Lücken im Verständnis
dieser Fragen zum Ausdruck. Wir haben den Rahmen unserer Prinzipien in
Organisationsfragen aus den Augen verloren. Diese Situation verlangt von uns
die Verantwortung, die auf dem 10. Kongress aufgeworfenen Fragen nach
tiefgreifender anzugehen. Es ist notwendig, dass die Organisation, die
Sektionen und alle Militanten sich nochmals über diese Grundfragen und
besonders über die Prinzipien beugen, die eine für den Kommunismus kämpfende
Organisation benötigt.
Ein solches
Nachdenken war bereits im Anschluss an die Krise von 1981/82, von der die IKS
damals erschüttert wurde (Verlust der Hälfte der Sektion in Großbritannien,
Verlust von ca. 40 Militanten), erfolgt. Die Grundlage dieser Reflexionen hatte
der Bericht über „Die Struktur und die Funktionsweise der Organisation“
(Internationale Revue Nr. 22), der auf der Außerordentlichen Konferenz im
Januar 1982 angenommen worden war,
gebildet. In diesem Sinn bleibt dieses Dokument nach wie vor ein Bezugspunkt
für die Gesamtheit der Organisation2. Der nun folgende Text ist als Zusatz,
Illustration und Aktualisierung (aufgrund der inzwischen gemachten Erfahrungen)
des Textes von 1982 zu verstehen. Insbesondere möchte er die Aufmerksamkeit der
Organisation und der Militanten auf die Erfahrung nicht nur der IKS, sondern
auch anderer revolutionärer Organisationen in der Geschichte lenken.
1. Die Wichtigkeit des Problems in der Geschichte
Die Frage der
Struktur und der Funktionsweise der Organisation stellte sich in allen Phasen
der Arbeiterbewegung. Jedesmal waren die Auswirkungen dieser Fragestellung von
größter Bedeutung. Dies ist kein Zufall. In der Organisationsfrage findet man
auf konzentrierte Weise eine ganze Reihe von wichtigen Aspekten der
revolutionären Perspektive des Proletariats:
die Grundeigenschaften
der kommunistischen Gesellschaft und der Beziehungen, die sich unter ihren
Mitgliedern herausbilden;
das Wesen des
Proletariats als Erschaffer des Kommunismus;
die Natur des
Klassenbewusstseins, die Eigenschaften seiner Entwicklung sowie seine
Vertiefung und Ausdehnung in der Klasse;
die Rolle der
kommunistischen Organisation im Prozess der Bewusstseinsbildung im Proletariat.
Die Folgen der
Entwicklung von Meinungsverschiedenheiten zu Organisationsfragen wirken sich
oft dramatisch oder sogar katastrophal auf das Leben der politischen
Organisationen des Proletariats aus. Das ist so aus folgenden Gründen:
Solche
Meinungsverschiedenheiten sind in letzter Instanz Anzeichen des Eindringens von
dem Proletariat feindlich gesinnten Ideologien, die aus der Bourgeoisie oder
dem Kleinbürgertum stammen.
Mehr als in anderen
Fragen wirken sich Meinungsverschiedenheiten hier notwendigerweise auf die
Funktionsweise der Organisation aus; sie können gar ihre Einheit und Existenz
überhaupt bedrohen.
Insbesondere neigen
sie dazu, eine persönliche und somit emotionale Form anzunehmen.
Unter den vielen
historischen Beispielen dieses Phänomens wollen wir zwei der bekanntesten
herausgreifen:
den Konflikt zwischen
dem Generalrat der I. Internationalen und der Allianz;
die Spaltung zwischen
Bolschewiki und Menschewiki während des 2. Kongresses der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Russlands (SDAPR) 1903.
Im ersten Beispiel
ist es klar, dass die Bildung der Internationalen Allianz für die
sozialistische Demokratie innerhalb der I. Internationalen ein Ausdruck des
Einflusses der kleinbürgerlichen Ideologie war, mit der die Arbeiterbewegung
sich in ihren ersten Schritten immer wieder auseinandersetzen musste. Es ist
also keineswegs ein Zufall, wenn sich die Allianz hauptsächlich aus Vertretern
von Handwerkern (Uhrenarbeiter aus dem Schweizer Jura beispielsweise) oder aus
Gebieten, in denen das Proletariat noch schwach entwickelt war (wie in Italien
und hauptsächlich in Spanien), zusammensetzte.
Die Bildung der
Allianz stellte für die Gesamtheit der I. Internationalen aus folgenden Gründen
eine Gefahr dar:
Sie war eine
„Internationale in der Internationalen“ (Marx), die zugleich innerhalb und
ausserhalb derselben existierte, was für sich selbst schon eine Infragestellung
der Einheit bedeutete.
Sie arbeitete
klandestin und setzte ihr Treiben trotz des Auflösungsbeschlusses der I.
Internationalen fort.
Sie widersetzte sich
den Auffassungen der I. Internationalen auf Organisationsebene, hauptsächlich
in der Frage der Zentralisierung (Verteidigung des Föderalismus), obwohl sie
selbst übrigens ultrazentralistisch in Gestalt des mit eiserner Hand von
Bakunin beherrschten Zentralkomitees funktionierte. Sie forderte von ihren
Mitgliedern „die strengste Disziplin auf der Grundlage der totalen
Selbstverleugnung und Selbstaufopferung“ (Bakunin).
Die Allianz stellte
eine totale Verneinung der Grundlagen dar, auf denen die Internationale
gegründet worden war. Um zu verhindern, dass sie in die Hände der Allianz fällt
und zerstört wird, haben Marx und Engels auf dem Kongress von Den Haag 1872 den
Vorschlag gemacht, ihren Sitz nach New York zu verlegen, dem der Generalrat
zustimmte. Sie wussten, dass diese Verlegung zu einem langsamen Absterben der
I. Internationalen führen würde (was 1872 auch geschah). Nach der
Niederschlagung der Pariser Kommune, die einen schweren Rückschlag für die
Klasse bewirkte, haben sie dieses Ende einer Degenerierung vorgezogen, die alle
positiven Errungenschaften der Jahre 1864 bis 1872 diskreditiert hätte.
Der Konflikt zwischen
der I. Internationalen und der Allianz hat sich sehr stark um Marx und Bakunin
personalisiert. Letzterer, der der Internationalen erst 1868 nach seiner
gescheiterten Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Demokraten in der Liga für
Frieden und Freiheit beitrat, beschuldigte Marx, Diktator des Generalrats und
somit der gesamten IAA zu sein.3 Das war eine vollständig falsche Anschuldigung
(es reicht aus, hierzu die Protokolle der Treffen des Generalrats und der
Kongresse der Internationalen zu studieren). Marx seinerseits hat völlig
richtig die Intrigen des heimlichen Chefs der Allianz denunziert. Diese
Intrigen sind durch den geheimen Charakter und die sektiererischen Auffassungen
der Allianz erleichtert worden. Die sektiererische und konspirative Konzeption
sowie das Charisma Bakunins begünstigten seinen persönlichen Einfluss auf seine
Anhänger und die Ausübung seiner Autorität als „Guru“. Mit der Behauptung,
Opfer einer Verfolgungskampagne zu sein, säte er Verwirrung und gewann einige
Anhänger unter einer gewissen Anzahl von schlecht informierten oder gegenüber
den Ideologien des Kleinbürgertums offenen Arbeitern.
Die gleichen
Charakteristiken beobachtet man bei der Spaltung zwischen den Bolschewiki und
den Menschewiki, die sich von Anbeginn über Organisationsfragen auftat.
Wie sich später
bestätigte, war das Vorgehen der Menschewiki vom Eindringen bürgerlicher und
kleinbürgerlicher Ideologien in die russische Sozialdemokratie bestimmt (obwohl
auch gewisse Vorstellungen der Bolschewisten die Folge einer
bürgerlich-jakobinistischen Sichtweise waren). Lenin stellte in Ein Schritt
vorwärts, zwei Schritte zurück dazu fest, „dass die Opposition in ihrer
Mehrheit aus den intelektuellen Elementen der Partei...” bestand, und ein
Vehikel kleinbürgerlicher Organisationsauffassungen war. (LW Bd.7, S 197ff)
Zweitens
vernachlässigte die Organisationsauffassung, die von den Menschewiki auf dem 2.
Kongress vertreten wurde und die Trotzki lange geteilt hatte (obwohl er sich
deutlich von ihnen besonders in der Frage der Natur der Revolution in Russland
sowie der Aufgaben des Proletariats in ihr distanziert hatte), die Bedürfnisse
des revolutionären Kampfes des Proletariats und barg die Zerstörung der
Organisation in sich. Einerseits war sie unfähig, eine klare Unterscheidung
zwischen Parteimitgliedern und Sympathisanten vorzunehmen, wie dies die
Meinungsverschiedenheit zwischen Lenin und Martow, dem Führer des
menschewistischen Flügels, über den Punkt 1 der Statuten zum Ausdruck brachte4.
Andererseits war sie vor allem der Ausdruck einer vergangenen Periode der
Arbeiterbewegung (als die Allianz noch
von der sektiererischen Phase der Arbeiterbewegung gekennzeichnet war):
„Unter der
Bezeichnung ‚Minderheit‘ haben sich in der Partei heterogene Elemente zusammen
gefunden, die den bewussten oder unbewussten Wunsch vereint, Zirkelbeziehungen
aufrecht zu erhalten, der Partei vorausgehende Organisationsformen. Gewisse
bedeutende Mitglieder der alten einflussreichsten Zirkel, die es nicht gewihnt
sind in Organisationsfragen eingeschränkt zu werden, die sich der
Parteidisziplin fügen müssen, neigen dazu, gedankenlos di e allgemeinen
Parteiinteressen mit ihren Zirkelinteressen zu verwischen, die tatsächlich in
der Phase des Zirkelwesens zusammenfallen mochten.“ (Lenin, Ein Schritt
vorwärts, zwei Schritte zurück) Insbesondere erhoben dies Elemente aufgrund
ihrer Kleinbürgerlichen Haltung „...das Banner der Rebellion gegenn die
unabdingbaren Einschränkungen durch die Organisation, und sie errichteten ihren
spntanen Anarchismus zum Kampfprinzip (...), indem sie mehr ‚Toleranz‘
forderten, etc.“ (a.a.O.)
Drittens führten der
Zirkelgeist und der Individualismus der Menschewiki zur Personalisierung von
politischen Fragen. Der dramatischste Augenblick des Kongresses, der einen
unüberbrückbaren Graben zwischen den beiden Gruppen schuf, war die Nominierung
für die diversen verantwortlichen Instanzen der Partei, insbesondere für die
Redaktion der Iskra, die als die eigentliche politische Führung angesehen wurde
(während das Zentralkomitee hauptsächlich für Organisationsfragen zuständig
war). Vor dem Kongress bestand die Redaktion aus sechs Mitgliedern: Plechanow,
Lenin, Martow, Axelrod, Starover (Potressow), Vera Sassulitsch. Aber nur die
drei Erstgenannten waren wirklich Redakteure, während Letztere praktisch nichts
taten oder sich damit begnügten, Artikel zu senden5. Um den in der alten
Redaktion herrschenden Zirkelgeist zu überwinden, schlug Lenin dem Kongress
eine Formel vor, die die Ernennung einer
geeigneteren Redaktion ermöglichen sollte, ohne dass dies als Misstrauensvotum
gegenüber jenen drei Militanten erschien: Der Kongress wählte eine kleinere
Redaktion aus drei Mitgliedern, die dann darüber hinaus in Übereinstimmung mit
dem Zentralkomitee weitere Mitglieder kooptieren sollte. Nachdem dieser
Vorschlag zunächst von Martow und den anderen Redakteuren akzeptiert wurde,
änderte Martow am Ende der Debatte seine Meinung, als er mit Lenin über die
Frage der Statuten in einen Gegensatz geriet (und als evident wurde, dass diese
alten Genossen Gefahr liefen, ihre Stellung zu verlieren): Er verlangte nun vom
Kongress (in der Tat schlug Trotzki eine Resolution in diesem Sinn vor), dass
die alte Redaktionskommission mit ihren sechs Mitgliedern „bestätigt“ wird. Es
war schließlich Lenins Vorschlag, der den Ärger und das Wehklagen der späteren
Menschewiki (Minderheit) auslöste. Martow erklärte „im Namen der Mehrheit der
ehemaligen Redaktion, dass keiner von uns in dieser neuen Redaktion teilnehmen
wird“.
(O.
a.a. LW Bd. 7, S. 318)
Anstelle politischer
Betrachtungen setzte Martow die sentimentale Verteidigung seiner alten Freunde,
den Opfern des „Belagerungszustands, der in der Partei herrscht“. Der
Menschewist Tsarew erklärte: „Wie sollen sich die nicht gewählten Mitglieder
der Redaktion verhalten, wenn der Kongress sie nicht mehr als Teil der
Redaktion sehen will?“ Die Bolschewiki verurteilten die konspiratorische Art
und Weise, wie diese Probleme dargestellt wurden.6 In der Folge lehnten die
Menschewiki die Entscheidungen des Kongresses ab und sabotierten sie. Sie
boykottierten die gewählten Zentralorgane und richteten sytematische,
persönliche Angriffe gegen Lenin. Trotzki beispielsweise bezeichnete ihn als
„Maximilius Lenin“ und bezichtigte ihn, à la Robespierre die „Rolle des
Unbestechlichen zu spielen“ sowie eine „Republik der Tugend und des Terrors“ zu
errichten (Bericht der sibirischen Delegation). Die Ähnlichkeit zwischen den
Anklagen der Menschewiki gegen Lenin und denjenigen der Allianz gegen Marx und
seine „Diktatur“ ist frappierend. Angesichts dieses Verhaltens der Menschewiki,
ihrer Personalisierung von politischen Fragen, ihrer Attacken, die ihn ins
Visier nahmen, und der Subjektivität Martows und seiner Freunde antwortete
Lenin: „Betrachte ich das Verhalten der Martowleute nach dem Parteitag ... so kann ich nur sagen,
dass das ein irrsiniger, eines Parteimitglieds unwürdiger Versuch ist, die
Partei zu sprengen... und weshalb? Nur weil man unzufrieden ist mit der
Zusammensetzung der Zentralstellen, denn objektiv war das die e i n z i g
e Frage, in der wir uns trennten, die
subjektiven Urteile aber ( wie Kränkung, Beleidigung, Hinauswurf, Beseitigung,
Verunglimpfung etc. etc) sind die Frucht gekränkter Eigenliebe und krankhafter
Phantasie. Diese krankhafte Phantasie und diese gekränkte Eigenliebe führen
geradewegs zu schädlichen Klatschereien nämlich dazu, dass man, ohne die
Tätigkeit der neuer Zentralstellen kennengelernt und ohne sie gesehen zu haben,
Gerüchte verbreitet über ihre ‚Arbeitsunfähigkeit‘, über die ‚eiserne Hand‘
eines Iwan Iwanowitsch... Die russische
Sozialdemokratie muss den letzten schwierigen Übergangg vollziehen vom
Zirkelwesen zum Parteiprinzip, vom Spiessertum zur Erkenntnis der
revolutionären Pflicht, vom Handeln auf Grund von Klatschereien und
Zirkeleinflüssen zur Disziplin.“ (Bericht vom 2. Kongress der SDAPR;
LW 7, S. 20)
2. Organisationsprobleme in der Geschichte der IKS
Wie alle anderen Organisationen
des Proletariats hat auch die IKS mit ähnlichen organisatorischen
Schwierigkeiten, mit denen wir uns weiter oben befassten, zu tun gehabt. Unter
diesen Schwierigkeiten sind Folgende zu nennen:
1974: die Debatte in
der Gruppe Révolution Internationale, der späteren französischen Sektion der
IKS, über die Zentralisierung; Bildung und Austritt der „Bérard–Tendenz“;
1978: die Bildung der
„Sam-MM-Tendenz“, die 1979 die GCI gründete;
1981: die Krise der
IKS, Bildung und Austritt der „Chénier-Tendenz“;
1984: das Auftreten
der Minderheit, die sich 1985 als „Tendenz“ konstituieren und dann die IKS
verlassen sollte, um die FECCI zu gründen;
1987/88: die
Schwierigkeiten in der spanischen Sektion, die zum Verlust der Sektion im
Norden des Landes führten;
1988: die Dynamik der
Anfechtung und Demobilisierung in der Pariser Sektion, die infolge des Gewichts
des Zerfalls auf unsere Reihen auf dem 8. Kongress von RI (Révolution
Internationale, der IKS-Sektion in Frankreich) ans Tageslicht getreten waren.
Trotz ihrer
Unterschiede kann man aus diesen Schwierigkeiten eine Reihe von gemeinsamen
Merkmalen destillieren, die an die Probleme anknüpfen, die in der bisherigen
Geschichte der Arbeiterbewegung bereits vorgekommen waren:
das Gewicht der
kleinbürgerlichen Ideologie, insbesondere des Individualismus;
die Infragestellung
des einheitlichen und zentralisierten Charakters der Organisation;
die Bedeutung der
persönlichen und subjektiven Faktoren.
Es würde zuviel Platz
einnehmen, wenn wir nun all diese schwierigen Perioden Revue passieren lassen
würden. Es genügt vollauf, jene Merkmale hervorzuheben, die stets, wenn auch in
unterschiedlichem Ausmaß, präsent waren.
a) Das Gewicht der kleinbürgerlichen Ideologie
Dieses Gewicht wird
deutlich, wenn man untersucht, was aus der Tendenz von 1978 geworden ist: Die
GCI (Group Communiste Internationale) hat sich einer Art von
Anarcho-Bordigismus hingegeben, begeistert sich für terroristische Aktivitäten
und misstraut den Kämpfen des Proletariats in den fortgeschrittenen Ländern,
während sie angebliche proletarische Kämpfe in der Dritten Welt glorifiziert.
In der Dynamik jener Gruppe von Genossen, die die FECCI gründen sollten, haben
wir frappante Ähnlichkeiten mit jenen identifiziert, die die Menschewiki 1903
motiviert hatten (s. den Artikel „Die externe Fraktion der IKS“, Revue
Internationale Nr. 45, engl., franz., span.), insbesondere das Gewicht des
intellektuellen Elements. In der Dynamik der Anfechtung und Demobilisierung,
die die Pariser Sektion betroffen hatte, haben wir bereits die Bedeutung des
Zerfalls hervorgehoben, der das Eindringen der kleinbürgerlichen Ideologie in
unsere Reihen begünstigte, insbesondere in der Form des „Demokratismus“
b) Die Infragestellung des einheitlichen und zentralisierten Charakters der Organisation
Es handelt sich hier
um ein Phänomen, das wir systematisch und bezeichnenderweise während der
verschiedenen Organisationsschwierigkeiten der IKS angetroffen haben:
Den Ausgangspunkt der
Dynamik, die zur „Bérard-Tendenz“ führte, war der Beschluss der Pariser
Sektion, eine Organisationskommission (OK) zu gründen. Eine gewisse Anzahl von
Genossen, besonders die Mehrheit derjenigen, die aus der trotzkistischen LO
(Lutte Ouvrier)e stammten, sahen in diesem embryonalen Zentralorgan die „große
Gefahr einer Bürokratisierung“ der Organisation. Bérard verglich das OK
unaufhörlich mit dem Zentralkomitee von LO (Bérard war mehrere Jahre lang
Mitglied dieser Organisation gewesen), er setzte RI mit dieser trotzkistischen
Organisation gleich. Dieses Argument hatte einen großen Einfluss auf die
anderen Genossen seiner „Tendenz“, denn alle (außer einer) kamen von LO.
Anlässlich der Krise
von 1981 machte sich (mit Unterstützung des dubiosen Elements Chénier, aber
nicht nur mit seiner) die Sichtweise breit, dass jede lokale Sektion eine
eigene Politik bezüglich der Intervention verfolgen könne, was eine totale
Infragestellung des Internationalen Büros (IB) und seines Sekretariats (IS)
bedeutete (man warf diesen Organen insbesondere ihre Auffassung über die Linke
in der Opposition sowie die Provozierung einer stalinistischen Degeneration
vor). Zwar vertrat man die Notwendigkeit von Zentralorganen, doch beschränkte
man sie letztlich auf die Rolle bloßer Briefkästen.
In der ganzen
Dynamik, die zur Bildung der FECCI führte, machte sich erneut die
Infragestellung der Zentralisierung bemerkbar, jedoch mit dem Unterschied, dass
fünf von zehn Mitgliedern der „Tendenz“ im IB waren. Sie wurde hauptsächlich
durch wiederholte Akte der Disziplinverletzung gegenüber dem IB, aber auch gegenüber anderen Instanzen
der Organisation in Frage gestellt: In ihrer gewissermaßen aristokratischen
Haltung betrachteten sich bestimmte Mitglieder der „Tendenz“ als „über den
Gesetzen stehend“. Konfrontiert mit der Notwendigkeit der Disziplin in der
Organisation, erblickten diese Militanten darin eine „stalinistische
Degenerierung“ und wiederholten die Argumente der „Chénier-Tendenz“, die sie
selbst drei Jahre zuvor bekämpft hatten.
Die Schwierigkeiten der
Sektion in Spanien von 1987/88 hängen direkt mit dem Problem der
Zentralisierung zusammen. Die neuen Militanten der Sektion von San Sebastian
gerieten in eine Dynamik, die zur Anfechtung der Sektion von Valencia führte,
die gleichzeitig als Zentralorgan wirkte. In der „baskischen“ Sektion
existierte eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten und politischen Konfusione
bemerkenswerterweise über die Frage der Arbeitslosenkomitees; Konfusionen, die
zu einem beträchtlichen Teil auf die linksextremen Ursprünge gewisser Elemente
dieser Sektion zurückzuführen waren. Doch anstelle einer Diskussion über diese
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Organisation, wurde dies zum Anlass
genommen für eine Art „My-home-is-my-castle“-Politik und für eine prinzipielle
Ablehnung aller Orientierungen von Valencia. Infolge dieser Dynamik verlor die
Sektion in Spanien die Hälfte ihrer Mitglieder.
Im Geist der
Anfechtung und Demobilisierung, der sich 1988 in der französischen Sektion und
besonders in Paris breitmachte, drückte
sich die Infragestellung der Zentralisierung im Wesentlichen gegen das
Zentralorgan der Sektion aus. Am klarsten wurde diese Infragestellung durch ein
Mitglied der Organisation ausgedrückt, das in seinen Texten und in seinem
Verhalten eine dem Anarcho-Rätekommunismus nahe Vorgehensweise entwickelte.
Insbesondere enthielt einer seiner ersten Beiträge eine Kritik der
Zentralorgane und die Idee des Rotationsprinzips bei der Ernennung der
Militanten für dieses Organ.
Die Ablehnung bzw.
Anfechtung der Zentralisierung stellte jedoch nicht die einzige Form der
Infragestellung des Einheitscharakters der Organisation während all der
erwähnten schwierigen Momente dar. Es sei hier eine weitere Manifestation
dieser Dynamik hinzugefügt, die, wie es von Lenin 1903 getan wurde, als
„Zirkel“, ja, gar als „Clan“ beschrieben werden kann. Das heißt, eine
informelle Umgruppierung einer gewissen Anzahl von Genossen auf der Basis nicht
einer politischen Übereinstimmung, sondern von seltsamen Kriterien wie
persönlicher Affinitäten, der Unzufriedenheit über diese oder jene Orientierung
der Organisation oder die Anfechtung eines Zentralorgans.
Alle „Tendenzen“ die
sich bis auf den heutigen Tag innerhalb der IKS formiert hatten, unterlagen
mehr oder weniger dieser Dynamik. Aus diesem Grund führten sie übrigens auch
alle zur Abspaltung. Wir haben jedes Mal darauf hingewiesen: Die Tendenzen
bildeten sich nicht auf der Grundlage einer positiven Orientierung als
Alternative zur von der Organisation eingenommenen Position, sondern als eine
Ansammlung von „Unzufriedenen“, die erst alle ihre Divergenzen in einen
gemeinsamen Topf warfen und anschließend versuchten, sich selbst eine gewisse
Kohärenz zu verleihen. Auf solchen Grundlagen konnte eine Tendenz nichts
Positives hervorbringen, denn ihre Dynamik bestand nicht darin, die
Organisation durch eine möglichst große Klarheit zu stärken, sondern im
Gegenteil in einer (oft unbewussten) Vorgehensweise, die zerstörerisch für die
Organisation ist. Solche Tendenzen waren nicht das organische Produkt der IKS
oder des Proletariats, sondern der Ausdruck des Eindringens von fremden
Einflüssen. Im Allgemeinen handelte es sich hierbei um die kleinbürgerliche
Ideologie. Folglich erscheinen diese Tendenzen
wie Fremdkörper innerhalb der IKS. Deshalb stellen sie eine Gefahr für
die Organisation dar, daher führen sie fast zwangsläufig zu Abspaltungen.7
In gewisser Weise
wies die Bérard-Tendenz die grösste Homogenität auf. Doch es gab kein
gemeinsames Verständnis über die Fragen ihres Ursprungs. Ihre „Homogenität“
basierte im Wesentlichen auf:
dem gemeinsamen
Ursprung (LO) der Mitglieder dieser Tendenz, die sie spontan in einer
gemeinsamen Vorgehensweise und insbesondere in der Ablehnung der
Zentralisierung vereinigte;
dem Charisma von
Bérard, der ein brilliantes Element war und dessen Interventionen weniger
erfahrene Elemente blendeten, die in
ihrer Gesamtheit keine große Ahnung hatten und sich ihm blindlings anschlossen.
Aus diesem
letzgenannten Grund findet man in dieser „Tendenz“ sehr akademistische und
gleichzeitig eher aktivistische Elemente vor. Es erübrigt sich zu sagen, dass
die „Kommunistische Tendenz“ die erste Nummer ihrer Publikation nicht
überlebte.
Was die anderen
„Tendenzen“ der IKS anbelangt, beinhaltete jede ein Allerlei von Positionen.
Tendenz Sam-MM:
tendenzieller Fall der Profitrate als Erklärung für die Wirtschaftskrise (Sam)
plus die proletarische Natur des Übergangsstaates (Sam) plus bordigistische
Ansichten über die Rolle der Organisation (MM) plus Überschätzung der
Klassenkämpfe in der 3. Welt (Ric);
Tendenz Chénier:
Ablehnung der Analyse über die Linke in der Opposition plus Verwandlung von
gewerkschaftlichen Organismen in Organe des Klassenkampfes plus stalinistische
„Degenerierung“ der IKS (dazu verdeckte Praktiken eines vielleicht im Dienste
des bürgerlichen Staates stehenden Individuums);
Tendenz FECCI:
nichtmarxistische Sichtweise des Klassenbewusstseins (ML) plus
rätekommunistische Schwächen (JA und Sander) plus Meinungsverschiedenheiten
über die Intervention der IKS in die gewerkschaftlich organisierten Aktionen
zur Lähmung der Arbeiterklasse (ROSE) plus Ablehnung der Begriffe Zentrismus
und Opportunismus (McIntosh).
Betrachten wir den
zusammengewürfelten Charakter dieser Tendenzen, so muss man sich fragen, worauf
sich denn ihre Vorgehensweise stützte.
Ursprünglich gab es
zweifellos Unzufriedenheiten und Konfusionen über allgemeine politische wie
auch über organisatorische Fragen. Doch nicht jeder Genosse, der in diesen
Fragen anderer Meinung war, schloss sich diesen Tendenzen an. Andererseits
haben gewisse Genossen, die anfangs keine Meinungsverschiedenheiten hatten, sie
im weiteren Verlauf „entdeckt”, um sich der Bildung einer „Tendenz“
anzuschließen Deshalb müssen wir, wie das bereits Lenin 1903 gemacht hat, an einen
anderen Aspekt des Organisationslebens erinnern: an die Bedeutung
„persönlicher“ Fragen und der Subjektivität.
c) Die Bedeutung „persönlicher“ Fragen und der Subjektivität
Die Fragen bezüglich
Verhaltensweisen, Benehmen, Subjektivität, emotionalen Reaktionen von
Militanten sowie der Personifizierung von bestimmten Debatten besitzen keine
„psychologische“ Natur, sind aber eminent politisch. Perönlichkeit,
individuelle Geschichte, Kindheit, emotionale Probleme u. a. erlauben uns
nicht, regelwidrige, abweichende Verhaltensweisen von Mitgliedern der
Organisation zu erklären, die sie in diesem oder jenem Fall angenommen haben.
Hinter solchem Benehmen findet man immer, direkt oder indirekt, Individualismus
oder Sentimentalitäten, welche Ausdruck von nicht-proletarischen Klassen sind:
dem Bürgertum und Kleinbürgertum. Man kann zumeist sagen, dass bestimmte
Persönlichkeiten angesichts des Drucks von solchen ideologischen Einflüssen
zerbrechlicher sind als andere.
Das bedeutet nicht,
dass „persönliche“ Aspekte keine wichtige Rolle im Leben der Organisation
spielen, wie man anhand zahlreicher Beispiele sehen kann:
Die Bérard-Tendenz:
Es genügt die Tatsache aufzuzeigen, dass einige Tage nach der Einsetzung einer
Organisationskommission, die von Bérard nicht anerkannt wurde, derselbe Bérard
gegenüber MC8 folgenden Handel vorschlug: „Ich werde für die
Untersuchungskommission stimmen, wenn du mich für sie vorschlägst. Andernfalls
werde ich kämpfen.” MC machte den Vorfall nicht publik, um Bérard nicht
öffentlich „niederzumachen“ und um zu ermöglichen, dass die Debatte an die
Wurzeln gelangt. Die OK stellte also eine Gefahr der „Bürokratisierung“ dar,
weil Bérard nicht aufgenommen wurde. Kein weiterer Kommentar!
Die
Sam-MM-Tendenz: Sie setzte sich aus drei
Gruppen (teilweise familiärer Natur) zusammen, deren „Anführer“ verschiedene
Vorurteile hatten, welche alle in der Anfechtung der Zentralorgane
zusammenfanden. Da „es keinen Platz für mehrere männliche Krokodile im selben
Teich gibt“ (wie ein afrikanisches Sprichwort sagt), trennten sich die drei
kleinen Krokodile bald darauf. Sam spaltete sich als erster von der GCI ab, um
die Eintagsfliege der „Fraction Communiste Internationaliste“ zu gründen;
später verrließ auch MM die GCI, um die „Movement Communiste“ zu bilden.
Die Chénier-Tendenz:
Persönliche Konflikte und Persönlichkeiten spalteten die englischen Sektion in
zwei Gruppen, welche nicht miteinander sprachen und zum Beispiel in verschiedenen Restaurants essen gingen.
Militante aus dem Ausland, welche diese Treffen besuchten, wurden von dem einen
oder dem anderen Clan vereinnahmt und mit Klatsch über die anderen bedrängt.
Die Krise wurde durch die Manöver von Chénier, der ständig Öl ins Feuer goss,
noch verschlimmert9:
Die EFICC-Tendenz:
Abgesehen von den politischen Differenzen (welche unvereinbar waren) war eine
Hauptquelle für den Werdegang derjenigen, die die EFICC gründeten, der
verletzte Stolz einiger (besonders JA und ML), die es wenig gewohnt waren,
kritisiert zu werden (besonders von MC), und die „Solidarität“, welche ihre
alten Freunde ihnen gegenüber bekunden wollten. Wenn man die Geschichte des
zweiten Kongresses der SDAPR untersucht und die Affäre der „EFICC-Tendenz“
erlebt hat, stößt man auf all die Ähnlichkeiten zwischen diesen beiden Ereignissen.
Doch wie Marx sagte: „die Geschichte wiederholt sich, zuerst als Tragödie und
dann als Farce.”
Persönliche Fragen
spielten nicht nur im Zeitraum sich bildender Tendenzen in verschiedener
Hinsicht eine Rolle. So entwickelten sich zurzeit der Schwierigkeiten in der
spanischen Sektion 1987–88 unter den Genossen aus San Sebastian, die auf einer
unzureichend soliden politischen Grundlage und zu einem erheblichen Umfang
aufgrund der Persönlichkeit integriert worden waren, sehr starke Animositäten
gegenüber gewissen Genossen aus Valencia. Dieser personalisierte Ablauf wurde
besonders betont durch den ungesunden und
entstellten Geist eines der Elemente aus San Sebastian und vor allem
durch die Agitation Albars, der eine Triebkraft des Kerns in Lugo war und dessen
Verhalten dem von Chénier ähnelte: Geheimkontakte und -korrespondenz,
Verunglimpfungen und Verleumdungen, der Einsatz von Sympathisanten, um auf die
Genossen aus Barcelona „einzuwirken”, die schließlich die IKS verließen
Diese
unvermeidlicherweise zu schnelle und oberflächliche Untersuchung, der
organisatorischen Schwierigkeiten, auf die die
IKS im Verlauf ihrer Geschichte gestoßen ist, enthüllt trotzdem zwei
wesentliche Tatsachen:
Diese Schwierigkeiten
sind nicht ungewöhnlich und existierten die gesamte Geschichte der
Arbeiterklasse hindurch.
Die IKS ist von
diesen Arten von Schwierigkeiten wiederholt und häufig konfrontiert worden.
Gerade das letzte
Element muss die Organisation und die Genossen dazu anregen, die
Organisationsprinzipien, welche 1982 von der Außerordentlichen Konferenz im
„Bericht zur Struktur und Funktionsweise der Organisation der Revolutionäre“
und in den Statuten ausgearbeitet worden waren, gründlich zu studieren.
3. Die prinzipiellen Punkte des „Berichts zur Struktur und Funktionsweise“ von 1982 und der Statuten.
Die Grundidee des
Berichts von 1982 ist die Einheit der Organisation. In diesem Dokument war die
Idee zuerst unter dem Gesichtspunkt der Zentralisierung behandelt worden, ehe
sie unter dem Gesichtspunkt der Beziehungen der Militanten zur Organisation
betrachtet wurde. Die Wahl dieser Reihenfolge entsprach den Problemen, auf die
die IKS 1981 gestoßen war, als die Schwächen durch die Anfechtung der
Zentralorgane und der Zentralisierung offenkundig wurden. Heute sind die
meisten Schwierigkeiten, denen sich die Sektionen gegenübersehen, nicht direkt
mit der Frage der Zentralisierung verknüpft, sondern viel mehr mit dem
Organisationsgewebe, mit dem Platz und den Verantwortlichkeiten von Militanten
innerhalb der Organisation. Und selbst wenn Schwierigkeiten bezüglich der
Zentralisierung aufkommen, wie in der französischen Sektion, gehen sie zurück
auf das vorhergehende Problem. Daher ist es bei der Bewertung der verschiedenen
Aspekte des Berichts von 1982 angebracht, mit dem letzten
– Punkt 12 – zu
beginnen, der richtigerweise die Beziehungen zwischen der Organisation und den
Militanten betrifft
3 .1. Die Beziehungen zwischen den Militanten und der Organisation
a) Das Gewicht des Individualismus
Eine grundlegende
Bedingung der Fähigkeit einer Organisation, ihre Aufgaben innerhalb der Klasse
zu erfüllen, ist das richtige Verständnis des Verhältnisses zwischen ihren
Mitgliedern und der Organisation. Dies ist eine in der gegenwärtigen Zeit
besonders schwer zu verstehende Frage, weil es einen organischen Bruch zwischen
den Fraktionen der Vergangenheit und dem Einfluss der Studenten in den
revolutionären Organisationen in der Zeit nach 1968 gegeben hat, der das
Wiederauftauchen eines Lasters aus der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts
bewirkt hat: den Individualismus.“ (Bericht von 1982, Punkt 12)
Es ist notwendig
festzustellen, dass zu den Ursachen des Eindringens des Individualismus, welche
bereits identifiziert wurden, heute noch das Gewicht des Zerfalls hinzukommt.
Im Besonderen fördert der Zerfall die „Atomisierung“ und das „Jeder für sich“.
Es ist wichtig, dass sich die ganze Organisation vollständig bewusst ist über
diesen konstanten Druck, den der verfaulende Kapitalismus in den Köpfen der
Militanten ausübt. Ein Druck, welcher außerhalb einer offen revolutionären Periode nur wachsen kann. In diesem Sinne
sind die folgenden Punkte, die auf die
Schwierigkeiten und Gefahren antworten, welche bereits in der Vergangenheit auf
die Organisation gelauert haben, heute gültiger denn je. Selbstverständlich
darf uns dies nicht entmutigen, sondern im Gegenteil zu noch größerer
Wachsamkeit gegenüber diesen Schwierigkeiten und Gefahren ermutigen.
b) Die „Erfüllung“ der Militanten
„Das gleiche
Verhältnis, das zwischen einem besonderen Organismus (Gruppe oder Partei) und
der Klasse besteht, existiert auch zwischen der Organisation und dem
Militanten. Und ebenso wenig, wie die Klasse
für die Bedürfnisse der kommunistischen Organisation existiert,
existieren kommunistische Organisationen, um die Probleme des individuellen
Militanten zu lösen. Die Organisation ist nicht das Produkt der Bedürfnisse
ihrer Mitglieder. Man ist Militanter in dem Maße, wie man die Aufgaben und die
Funktion der Organisation verstanden hat und ihnen beipflichtet.
Infolgedessen zielt
die Verteilung der Aufgaben und der Verantwortlichkeiten innerhalb der
Organisation nicht auf eine ‚Verwirklichung‘ der einzelnen Mitglieder ab. Die
Aufgaben müssen so verteilt werden, dass die Organisation als ein Ganzes
optimal funktionieren kann. Wenn die Organisation soweit wie möglich die
Situation und das Wohlergehen eines einzelnen Mitglieds berücksichtigt, dann
geschieht dies vor allem deshalb, weil es im Interesse der Organisation ist,
dass alle ihre ‚Zellen‘ in der Lage sind, ihren Teil zur Arbeit der
Organisation beizutragen. Das heißt nicht, dass die Individualität und die
Probleme eines einzelnen Mitgliedes außer Acht gelassen würden; es bedeutet,
dass Ausgangs- und Endpunkt die
Fähigkeit der Organisation sein muss, ihre Aufgaben im Klassenkampf
auszuführen.“ (Bericht, Punkt 12)
Dies ist ein Punkt,
den wir nie vergessen dürfen. Wir stehen im Dienst der Organisation, nicht
umgekehrt. Insbesondere ist Letztere keine Art von Klinik, wo besonders die
psychischen Krankheiten geheilt werden, an denen ihre Mitglieder möglicherweise
laborieren. Dies bedeutet nicht, dass das Revolutionär-Werden nicht dabei
hilft, die persönlichen Schwierigkeiten, die jedermann hat, in einen
Zusammenhang zu stellen, wenn es sie schon nicht alle zusammen überwinden kann.
Ganz im Gegenteil: Ein Kämpfer für den Kommunismus zu werden bedeutet, seiner
Existenz einen tiefen Sinn zu geben. Einen Sinn, der dazu beitragen kann, auch
allen anderen Aspekte des Lebens einen grundsätzlicheren Sinn zu geben (Erfolg
in Beruf oder Familienglück, Kindererziehung, wissenschaftliche oder
künstlerische Tätigkeiten, alles Befriedingungen, die von allen geteilt werden
sollten, aber einem großen Teil der Menschheit versagt bleiben) Die größte
Befriedigung, die ein menschliches Wesen in seinem Leben erfahren kann, ist ein
positiver Betrag für seine Nachfahren, für die Gesellschaft und Menscheit. Was
den kommunistischen Militanten von seinen Mitmenschen unterscheidet und ihm
Sinn gibt in seinem Leben, ist, dass er ein Glied in der Kette ist, die zur
Emanzipation der Menschheit, ihren Eintritt in das “Reich der Freiheit“ führt;
eine Kette, die auch nach seinem Tode weitergeführt wird. Folglich ist das, was
ein Militanter heute vollbrint, unvergleichlich wichtiger als das, was das
größte Genie tun kann, sei es die Entdeckung eines Heilmittels gegen Krebs oder
einer unerschöplichen Quelle umweltfreundlicher Energie. In diesem Sinne muss
die Leidenschaft seines Engagements dem Militanten erlauben, über die
Schwierigkeiten hinauszugehen, auf die jedes menschliche Wesen stößt.
Deshalb muss
angesichts der besonderen Schwierigkeiten, auf die Mitglieder der Organisation
stoßen können, eine politische Haltung eingenommen werden, nicht eine
psychologische. Es ist klar, dass psychologische Aspekte bei Problemen, die
einen Militanten betreffen, durchaus berücksichtigt werden können. Aber sie
müssen grundsätzlich im Rahmen der Organisation gestellt werden, und nicht
umgekehrt. So muss, wenn ein Mitglied häufig seine Aufgaben nicht erfüllen
kann, die Organisation grundsätzlich politisch und in Übereinstimmung mit ihren
Prinzipien und ihrer Funktion reagieren, auch wenn sie selbstverständlich
imstande sein muss, die Besonderheiten der Situation anzuerkennen, in der sich
ein Militanter befindet. Wenn die Organisation es z.B. mit einem Genossen zu
tun hat, der dem Alkoholismus verfällt,
darf sie nicht die Rolle des Psychotherapeuten spielen (eine Rolle, wofür sie
sowieso keine Qualifizierung hat und mit der sie nur riskiert, „Zauberlehrling“
zu sein), sondern sie muss auf ihrem eigenen
Terrain reagieren:
das Problem zur
Sprache bringen, indem es innerhalb der Organisation und mit dem betroffenen
Militanten diskutiert wird;
das Trinken von
Alkohol auf den Treffen und bei Aktivitäten verbieten;
die Militanten dazu
verpflichten, zu Treffen und Aktivitäten nüchten zu erscheinen
Die Erfahrungen haben
reichlich gezeigt, dass dies der beste Weg ist, solche Probleme zu überwinden.
Aus denselben Gründen
darf militantes Engagement nicht als Routine, wie am Arbeitsplatz, betrachtet werden, auch wenn
bestimmte Aufgaben an sich nicht so anregend sind. Im Besonderen ist es
wichtig, dass diese Aufgaben – wie alle Aufgaben im Allgemeinen – so
ausgeglichen wie möglich verteilt werden, damit nicht die einen überlastet
werden, während die anderen nichts zu tun haben. Es ist auch wichtig, dass
jeder Militante die Überzeugung aus seinen Gedanken und aus seinem Verhalten
verbannt, er sei ein „Opfer“ der Organisation, die ihn schlecht behandle und
ihm zuviel Arbeit gebe. Die große Stille, welche es oft in den Sektionen gibt,
wenn es darum geht, freiwillig Aufgaben zu übernehmen, ist vor allem für junge
Militante erschreckend und demoralisierend.10
c) Verschiedene Arten von Aufgaben und die Arbeit in den Zentralorganen
„In der Organisation
gibt es keine ‚erhabene‘ und keine ‚zweitrangige‘, weniger erhabene‘ Aufgaben. Sowohl die Aufgabe der
theoretischen Ausarbeitung als auch die Verwirklichung der praktischen
Aufgaben, die Arbeit innerhalb der Zentralorgane wie auch die spezifische
Arbeit in den örtlichen Sektionen sind gleichermaßen wichtig für die Organisation
und dürfen nicht hierarchisch geordnet werden (nur der Kapitalismus errichtet
solche Hierarchien). Deshalb muss man die Idee als bürgerlich verwerfen,
derzufolge die Berufung eines Mitglieds in ein Zentralorgan einen ‚Aufstieg‘,
den Zugang zu einem ‚Ehrenposten‘ oder zu einem Privileg bedeuten würde. Das
Karrieredenken muss vollkommen aus der Organisation verbannt werden, da es im
Gegensatz steht zu der selbstlosen Aufopferung, die ein charakteristisches
Merkmal der kommunistischen Militanten ist.“ (ebenda)
Dies wurde nicht nur
in der Situation, in der sich die IKS 1981 befand, bekräftigt, sondern hat
darüber hinaus eine allgemeine und permanente Bedeutung.11 In gewisser Hinsicht
war das Phänomen der Anfechtungen in der IKS oft mit der Vorstellung verbunden,
welche die Organisation als „Pyramide“ oder „hierarchisch“ betrachtet, was der
Sichtweise entspricht, die die Erlangung von Verantwortlichkeiten in einem
Zentralorgan als eine Art „Ziel“ für jeden Militanten betrachtet . Dieselbe
Vision sieht die Zugehörigkeit zu einem Zentralorgan, als eine Art Ziel für
jeden Militanten an (die Erfahrung lehrt, dass Anarchisten sozusagen oft
hervorragende Bürokraten sind).
Darüber hinaus muss
man nur den Widerwillen betrachten, mit dem die Organisation einen Militanten
von seiner Verantwortung in einem Zentralorgan entbindet, das Trauma, das eine
solche Maßnahme provoziert, um einzusehen, dass dies ein echtes Problem ist. Es
ist klar, dass solche Traumen der bürgerlichen Ideologie direkt Tribut zollen.
Aber es genügt nicht, völlig davon überzeugt zu sein, um ihm zu entkommen.
Angesichts einer solchen Situation ist es wichtig, dass die Organisation und
ihre Militanten alles bekämpfen, was das Eindringen solcher Ideologien
begünstigt:
Mitglieder von
Zentralorganen dürfen weder von besonderen Privilegien profitieren noch sie
akzeptieren, insbesonders die Vernachlässigung von Aufgaben und der Disziplin,
welche für alle Mitglieder der Organisation gültig sind.
Sie dürfen mit ihrem
Verhalten und ihrer Ausdrucksweise anderen Genossen nicht ihre Mitgliedschaft
in diesem oder jenem Zentralorgan „spüren“ lassen: Solch eine Mitgliedschaft
ist keine Medaille, die man überheblich zur Schau trägt, sondern eine besondere
Aufgabe, die mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Verantwortung übernommen
werden muss wie alle anderen.
Es gibt keine
„Begünstigung durch die Alten“ in den Zentralorganen, eine Art von
„Karrierestruktur”, wie in bürgerlichen Firmen und Verwaltungen, deren
Beschäftigte angeblich auf der hierarchischen Leiter zum Erfolg klettern
können. Im Gegenteil: Um sich auf die Zukunft vorzubereiten, muss die
Organisation dafür Sorge tragen, dass auch auf der höchsten Ebene
Verantwortlichkeiten an junge Militante übertragen werden, sofern diese ihre
Fähigkeit gezeigt haben, Verantwortung zu übernehmen (erinnert sei dabei, dass
Lenin vorschlug, gegen den Widerstand des “alten“ Plechanow den 22jährigen
Trotzki in die Redaktion der Iskra aufzunehmen. Wir wissen, was aus dem Einen
und dem Anderen wurde).
Was die Bedürfnisse der
Organisation angeht, ist es erforderlich und zweckmäßig, Militante im
Zentralorgan zu ersetzen, ohne dass dies als Sanktion, als eine Art
Degradierung oder Vertrauensentzug gesehen und dargestellt wird. Die IKS
verlangt weder die Rotation von Aufgaben wie die Anarchisten noch erkennt sie
die Lebenserfahrung von Leuten als Ausschlag gebend bei der Verteilung von
Verantwortlichkeiten an, wie dies in der Académie française oder in der Führung
der Kommunistischen Partei Chinas der Fall ist.
d) Ungleichheit zwischen Militanten
„Auch wenn es
unterschiedliche Fähigkeiten unter Individuen und Militanten gibt, welche durch
die Klassengesellschaft aufrechterhalten und verschärft werden, besteht die
Rolle der Organisation nicht darin, wie die utopischen Sozialisten
vorzutäuschen, diese abschaffen zu können. Die Organisation muss versuchen, die
politischen Kapazitäten ihrer Militanten maximal voranzutreiben, da diese eine
Vorbedingung für ihre eigene Stärkung sind. Doch sie behandelt diese nie als
eine Frage der individuellen Schulbildung oder einer Gleichmacherei der
individuellen Erziehung.
Die wirkliche
Gleichheit zwischen Militanten ist die, das Maximum für das Leben der
Organisation zu geben (”Jeder nach seinen Fähigkeiten”, eine von Saint-Simon
stammende, von Marx übernommene Formulierung). Die wirkliche ‚Erfüllung‘ als
Militanter besteht darin, alles zu tun, um die Organisation zu unterstützen,
ihre Aufgaben, welche sie von der Klasse erhalten hat, zu verwirklichen.”
(ebenda)
Gefühle von
Eifersucht, Rivalität, Konkurrenz oder „Minderwertigkeitskomplexen”, die
zwischen Militanten aufkommen können und mit ihren Ungleichheiten verknüpft
sind, sind typische Ausdrücke des Eindringens der herrschenden Ideologie in die
Reihen der kommunistischen Organisation12. Auch wenn es eine Illusion ist zu
glauben, man könne solche Gefühle vollständig aus den Köpfen aller Mitglieder
der Organisation verbannen, so ist es dennoch wichtig, dass jeder Militante die
permanente Sorge haben muss, sich in seinem Verhalten nicht durch diese Gefühle
steuern zu lassen und sie innerhalb der Organisation zu bekämpfen.
Anfechtungen sind oft
das Resultat solcher Gefühle und Frustrationen. In der Tat ist die Anfechtung
von Zentralorganen oder von Militanten, die ein „größeres Gewicht“ als andere
haben (wie gerade die Mitglieder der Zentralorgane), die typische Haltung von
Militanten oder Teilen der Organisation, welche „Komplexe“ gegenüber anderen
haben. Deshalb nimmt dies oft die Form einer Kritik um der Kritik willen an
(und nicht über das, was wirklich gesagt bzw. getan wurde) gegenüber allem, was
eine „Autorität“ repräsentiert (das klassische Verhalten des Halbwüchsigen, der
gegen seinen Vater aufbegehrt). Als Ausdruck des Individualismus deckt sich das
Protestlertum exakt mit einer anderen Erscheinung des Individualismus: dem
autoritären Verhalten, dem „Gefallen an der Macht“13. Das Protestlertum kann
aber auch unauffälligere Formen annehmen, die nicht weniger gefährlich sind, im
Gegenteil, denn sie sind schwerer zu erkennen. Es drückt sich gleichermaßen im Streben aus, den Platz dessen (Militanter
oder Zentralorgan) einzunehmen, der angefochten wird, und dabei zu hoffen, so
den Grund seines Komplexes zu beseitigen.
Ein anderer Aspekt,
den es zu beachten gilt, wenn neue Genossen zur Organisation stoßen, ist das Misstrauen von Seiten alter
Genossen, die befürchten, die Neuen könnten sie „in den Schatten stellen”,
besonders dann, wenn die Neuen über wichtige politische Kapazitäten verfügen.
Dies ist ein echtes Problem: Einer der Hauptgründe für die Feindschaft
Plechanows gegen Trotzki bei dessen Aufnahme in die Redaktion der Iskra war die
Angst, dass sein eigenes Ansehen durch dieses brilliante Element geschmälert
würde.14 Was zu Beginn des 20. Jahrhundert gültig war, ist heute aktueller denn
je. Wenn die Organisation (und ihre Militanten) nicht fähig ist, solche
Verhaltensweisen loszuwerden oder zumindest zu neutralisieren, wird sie nicht
fähig sein, ihre Zukunft im revolutionären Kampf vorzubereiten.
Schließlich ist es
bezüglich der Frage der „individuellen Erziehung“, die im Bericht von 1982
aufgegriffen wurde, wichtig zu unterstreichen, dass der Eintritt in ein
Zentralorgan in keiner Weise als ein Mittel zur „Schulung“ von Militanten zu
sehen ist. Der Ort, an dem sich die Militanten formen, sind ihre Aktivitäten
innerhalb der „Basisorganismen der Organisation“ (Statuten), der lokalen
Sektionen. In diesem Rahmen eignen sie sich ihre Fähigkeiten an und
vervollkommnen sich, um einen besseren Beitrag zum Leben der gesamten
Organisation zu leisten (theoretische, organisatorische und praktische
Fähigkeiten, das Verantwortungsbewusstsein usw.) Wenn die lokalen Sektionen
nicht fähig sind, diese Rolle zu spielen, bedeutet dies, dass ihre
Funktionsweise, ihre Aktivitäten und Diskussionen sich nicht auf dem Niveau
befinden, auf dem sie sich befinden sollten. Wenn die Organisation neue
Genossen für die Erfüllung besonderer Aufgaben in den Zentralorganen oder
spezifischen Kommissionen heranzieht (zum Beispiel um gerüstet zu sein für
Situationen, in denen diese Organe durch die Repression lahmgelegt sind), dann
geschieht dies keineswegs zur Befriedigung eines „Schulungsbedürfnisses“ für
die betroffenen Militanten, sondern um der Organisation als Ganzes zu
ermöglichen, ihre Verantwortung wahrzunehmen.
e) Die Beziehungen zwischen den Militanten
„Auch wenn sie die
Narben der kapitalistischen Gesellschaft tragen, (...) dürfen die Beziehungen
zwischen den Militanten nicht im flagranten Widerspruch zu dem von den
Revolutionären verfolgten Ziel stehen (...) und müssen notwendigerweise auf der
Solidarität und dem gegenseitigen Vertauen beruhen, die ein Kennzeichen der
Zugehörigkeit der Organisation zu jener Klasse sind, die den Kommunismus
verwirklichen wird.” (Auszug aus der Plattform der IKS)
Dies bedeutet
insbesondere, dass das Verhältnis der Militanten durch Brüderlichkeit und nicht
durch Feindschaft geprägt sein soll. Im Besonderen :
darf die
Praktizierung einer politisch-organisatorischen und nicht „psychologischen“
Herangehensweise gegenüber Genossen, die in Schwierigkeiten stecken, nicht als
Funktion einer unpersönlichen oder administrativen Maschinerie verstanden
werden. Die Organisation und ihre Militanten müssen verstehen, wie sie in
solchen Fällen ihre Solidarität zeigen, ohne zu vergessen, dass Brüderlichkeit
nicht Nachgiebigkeit bedeutet;
deutet das Aufkommen
feindschaftlicher Gefühle unter Militanten, die den anderen als Feind
betrachten, an, wie sehr der Blick für den Daseinsgrund der Organisation
verloren gegangen ist. Es signalisiert, dass es notwendig ist, sich die
Grundlagen des militanten Engagements wiederanzueignen.
Außerhalb solcher
extremen Fälle, die in der Organisation keinen Platz haben, ist es klar, dass
Abneigungen in Letzterer nicht total verschwinden können. In solchen Fällen
darf das Funktionieren der Organisation solche Abneigungen nicht fördern,
sondern muss sie im Gegenteil verringern und neutralisieren. Insbesondere
bedeutet die notwendige Offenheit, die unter Genossen existieren muss, nicht
Rücksichtslosigkeit oder Respektlosigkeit. Ferner sollten Beleidigungen absolut
aus den Beziehungen zwischen Militanten verbannt werden.
Doch dies heisst
keinesfalls, dass die Organisation sich als eine „Gruppe von Freunden“ oder als
eine Ansammlung solcher Gruppen ansehen darf.15
Tatsächlich ist eine
der größten Gefahren, die die Organisation ständig bedroht, ihre Einheit in
Frage stellt und sie zerstören kann, die Gründung von „Clans”, auch wenn dies
nicht absichtlich und bewusst geschieht. In einer Clandynamik fußt das
gemeinsame Vorgehen nicht auf wirklicher politischer Übereinstimmung, sondern
vielmehr auf Freundschaft, Loyalität, gemeinsamen persönlichen Interessen oder
geteilten Frustrationen. Oft ist eine solche Dynamik in dem Maße, wie sie nicht
auf gemeinsamen politischen Übereinstimmungen basiert, von der Existenz von
„Gurus“ und „Leitwölfen“ begleitet, welche die Einheit des Clans garantieren
und ihre Kraft aus einen besonderen Charisma schöpfen. Diese können die
politischen Fähigkeiten und die Urteilskraft anderer Militanter lahmlegen,
indem sie als „Opfer“ dieser oder jener Politik der Organisation präsentiert
werden oder sich selbst als solches darstellen. Wenn eine solche Dynamik
entsteht, entscheiden die Mitglieder oder Sympathisanten des Clans nicht
infolge einer bewussten und rationalen Wahl über ihre Haltung und die
Entscheidungen, die sie treffen, sondern als Resultat der Claninteressen, die
dazu neigen, sich gegen jene der Organisation zu richten.16
Im Besonderen werden
alle Interventionen, die eine Position beziehen, welche ein Clanmitglied (bzw.
das, was es sagt oder tut) herausfordert, als eine „persönliche Abrechnung“ mit
ihm oder dem ganzen Clan betrachtet. Ferner neigt in einer solchen Dynamik ein
Clan oft dazu, eine monolithische Front zu präsentieren (und es vorzuziehen,
seine schmutzige Wäsche innerhalb der Familie zu waschen), die begleitet wird
von einer blinden Disziplin, indem man sich ohne Diskussion um die
Orientierungen des „Rudelführers“ schart.
Es ist eine Tatsache,
dass einzelne Mitglieder der Organisation aufgrund ihrer Erfahrungen,
politischen Kapazitäten oder der Bestätigung ihrer Einschätzungen durch die
Realität eine größere Autorität erlangen können als andere Militante. Das Vertrauen,
welches ihnen die anderen Militanten spontan entgegenbringen, auch wenn sie
deren Standpunkt im Moment nicht mit Sicherheit teilen, ist eine normale Sache
im Leben der Organisation. Es kann auch vorkommen, dass die Zentralorgane oder
einzelne Militante vorübegehend um Vertrauen ersuchen, auch wenn sie noch nicht
unmittelbar alle Elemente haben, um ihre Überzeugung fundiert darlegen zu
können oder die Bedingungen für eine klare Debatte in der Organisation noch
nicht existieren. Im Gegenteil dazu ist es nicht normal, definitiv mit einer
Position einverstanden zu sein, nur weil sie von dem Genossen X vertreten wird.
Sogar die größten Namen in der Geschichte der Arbeiterbewegung haben Fehler
gemacht. In diesem Sinne kann das Festhalten an Positionen nur auf einer
wirklichen Übereinstimmung basieren, für welche eine unerlässliche Bedingung
die Qualität und Tiefe der Debatte ist. Dies ist auch die beste Garantie für
die Solidität und Dauerhaftigkeit einer Position innerhalb der Organisation,
die nicht einfach in Frage gestellt werden kann, nur weil Genosse X seine
Meinung geändert hat. Die Militanten sollten nicht ein für allemal daran
„glauben“, was ihnen selbst von einem Zentralorgan gesagt wird. Ihr kritischer
Geist muss ständig aktiv sein (auch wenn dies nicht heißt, dass sie ständig
kritisieren müssen). Dies verleiht den Zentralorganen wie auch den Militanten,
welche ein großes „Gewicht“ haben, die Verantwortung, nicht bei jeder
Gelegenheit und wahllos die „Argumente der Autorität“ zu nutzen. Im Gegenteil,
sie müssen jede Tendenz zum „Hinterherdackeln“, zu oberflächlichen Argumenten
ohne Überzeugung und ohne Nachdenken bekämpfen.
Eine Clandynamik kann
auch von der Vorgehensweise einer nicht notwendigerweise bewussten
„Infiltration“ geprägt sein, das heißt,
die Besetzung von Schlüsselpositionen in der Organisation (wie den
Zentralorganen zum Beispiel, aber nicht nur) mit Clanmitgliedern oder Personen,
die vom Clan überzeugt werden können. Das ist eine gebräuchliche Praxis und
wird systematisch in den bürgerlichen Parteien angewandt. Es muss von einer
kommunistischen Organisation entschieden zurückgewiesen werden. Sie muss
gegenüber diesen Methoden sehr wachsam sein. Besonders bei der Besetzung der
Zentralorgane „ist es notwendig, die Fahigkeit (der Kandidaten), kollektiv zu
arbeiten, zu berücksichtigen“ (Statuten). Es ist ebenfalls wichtig, bei der
Auswahl jener Militanten, die in solchen Organen arbeiten sollen, darauf zu
achten, dass die Möglichkeit einer Clandynamik bezüglich Affinitäten und
persönlichen Verbindungen zwischen den betroffenen Militanten möglichst gering
gehalten wird. Deshalb muss die Organisation besonders soweit wie möglich
vermeiden, dass zwei Militante, die in einer privaten Beziehung zusammenleben,
für die gleiche Kommission nominiert werden. Ein Mangel an Wachsamkeit auf
diesem Gebiet kann sehr schädliche Konsequenzen für die politische Kapazität
der Militanten und der ganzen Organisation haben. Bestenfalls könnte das
fragliche Organ, gleichgültig wie die Qualität seiner Arbeit ist, vom Rest der
Organisation als „Gang von Freunden“ übelgenommen werden und damit zu einem
bedeutsamen Verlust der Autorität des Organs führen. Schlimmstenfalls endet
dieses Organ in einem Verhalten als abgesonderter Clan, mit allen Gefahren, die
dies beinhaltet, oder wird von den Konflikten zwischen den Clans in ihm gar
gelähmt. Im beiden Fällen kann die Existenz der ganze Organisation davon
betroffen sein.
Letztendlich kann
eine Clandynamik den Boden schaffen, auf dem eine Praxis ausgeübt wird, die der
des bürgerlichen Wahlspektakels näher steht als jener der kommunistischen
Militanz:
Kampagnen zur
Verführung derjenigen, die der Clan für sich gewinnen will oder um deren Stimme
bzw. Unterstützung für diese oder jene Nominierung für besondere
Verantwortlichkeiten er wirbt17;
Verleumdungskampagnen
gegen diejenigen, die den Clan ablehnen oder „Posten“ besetzen, die von
Mitgliedern des Clans begehrt werden, oder die einfach ein Hindernis für seine
Ziele sind.
Warnungen vor der
Gefahr, ein Verhalten anzunehmen, das dem kommunistischen Militanten fremd ist,
sollten nicht als „Kampf gegen Windmühlen“ betrachtet werden. Tatsächlich war
die Arbeiterbewegung in ihrer Geschichte
häufig mit dieser Art von Benehmen, diesem beredten Zeugnis für den Druck der
herrschenden Ideologie in ihren Reihen, konfrontiert. Auch die IKS kann dem
nicht entweichen. Anzunehmen, dass die IKS von jetzt an immun gegen diese Plage
sei, ist keine politische Klarsicht, sondern religiöser Glaube. Im Gegenteil,
das zunehmende Gewicht des Zerfalls, der das Ausmaß der Atomisierung (und somit
die Suche nach einem Schutz), Irrationalitat, emotionalen Herangehensweise und
Demoralisierung noch verstärkt, kann nur die Bedrohung steigern, die von einem
derartigen Verhalten ausgeht. Dies muss gegenüber den Gefahren, die dies
darstellt, noch wachsamer machen.
Das heisst nicht,
dass sich in der Organisation eine ständiges Misstrauen unter den Genossen
breitmachen soll. Das Gegenteil ist der Fall. Das beste Mittel gegen Misstrauen
ist Wachsamkeit gegenüber Situationen, die das Misstrauen nähren könnten. Diese
Wachsamkeit muss gegenüber jederlei Verhalten ausgeübt werden, das zu solchen
Gefahren führen können. Insbesondere bei informellen Diskussionen unter
Genossen und Fragen, welche das Leben der Organisation betreffen, gilt: Wenn
sie in einem gewissen Umfang schon unumgänglich sind, so müssen sie wenigstens
so weit wie möglich begrenzt werden und in verantwortlicher Art geführt werden.
Während der formale Rahmen der Organisation, der bei den lokalen Sektionen
beginnt, für zuverlässige Protokolle und Diskussionen wie auch für ein wirklich
bewusstes und politisches Nachdenken am geeignetesten ist, lässt der
„informelle“ Rahmen Spielraum für unverantwortliche Haltungen und ist darüber
hinaus von Subjektivität gekennzeichnet. Besonders wichtig ist, allen
Verleumdungskampagnen gegen Mitglieder der Organisation (wie natürlich auch der
Zentralorgane) den Weg zu versperren. Diese Wachsamkeit gegenüber solches
Verhalten muss gegenüber sich selbst wie auch gegenüber anderen ausgeübt
werden. Auf diesem Gebiet wie auch auf vielen anderen, müssen sich die
erfahrensten Militanten und besonders die Mitglieder der Zentralorgane
vorbildlich verhalten und immer die Wirkung dessen bedenken, was sie sagen. Und
was sie sagen ist noch wichtiger und schwerwiegender gegenüber neuen Genossen:
welche die Opfer von
Verleumdungen nicht gut kennen und das, was gesagt wird, wörtlich nehmen;
welche Gefahr laufen,
entweder sich dieser Art von Benehmen anzupassen oder von dem Bild, das die
Organisation bietet, angeekelt und demoralisiert werden;
Um diesen Teil über
die Beziehungen zwischen der Organisation und ihren Militanten zu schließen,
ist es notwendig, zu betonen und daran
zu erinnern, dass die Organisation nicht einfach die Summe ihrer Militanten
ist. Im historischen Kampf für den Kommunismus bringt das kollektive Wesen des
Proletariats als Teil seiner selbst ein anderes kollektives Wesen ans
Tageslicht, die revolutionäre Organisation. Kommunistische Militante sind
diejenigen, die ihr Leben dafür widmen, dieses kollektive und vereinigte Wesen,
das ihre Klasse ihnen anvertraut, am Leben zu erhalten, es fortzuentwickeln und
zu verteidigen. Alle anderen Konzeptionen, besonders jene, welche die
Organisation als die Summe ihrer Militanten betrachtet, sind von der
bürgerlichen Ideologie beeinflusst und bilden eine tödliche Gefahr für die
Existenz der Organisation.
Nur mittels dieser
kollektiven und einheitlichen Auffassung der Organisation kann die Frage der
Zentralisierung verstanden werden.
3.2. Die Zentralisierung der Organisation
Diese Frage stand im
Zentrum des Aktivitätenberichts, welchen wir auf dem 10. Internationalen
Kongress präsentierten. Darüber hinaus betreffen die Schwierigkeiten, mit denen
die meisten Sektionen konfrontiert sind, nicht direkt die Frage der
Zentralisierung. Schließlich ist es weitaus einfacher, die Frage der
Zentralisierung zu verstehen, wenn man die Frage der Beziehungen zwischen der
Organisation und ihren Militanten begriffen hat. Daher ist dieser Teil des
vorliegenden Textes weniger detailliert als der erste Teil und größtenteils aus
Auszügen des grundlegenden Textes Bericht zur Struktur und Funktionsweise von
1982 zusammengestellt, zu welchem wir wegen der Verständnislosigkeit, die sich
in letzter Zeit breitgemacht hat, notwendigerweise Kommentare hinzufügen.
a) Die Einheit der Organisation und die Zentralisierung
„Der Zentralismus ist
kein abstraktes oder frei wählbares Prinzip für die Organisationsstruktur. Er
stellt die Konkretisierung ihres Einheitscharakters dar. Er spiegelt die
Tatsache wider, dass die Organisation als ein einheitlicher Körper Position
bezieht und in der Klasse handelt. In der Beziehung zwischen den verschiedenen
Teilen der Organisation und dem Ganzen überwiegt das Ganze (...) Wir müssen
resolut die Auffassung verwerfen, derzufolge einzelne Teile der Organisation
gegenüber der Klasse oder der Organisation Positionen oder Einstellungen
vertreten können, die ihnen im Gegensatz zu den von ihnen als falsch erachteten
Positionen der Organisation, als richtig erscheinen: (...) Wenn die
Organisation einen falschen Weg einschlägt, besteht die Verantwortung der
Mitglieder, die glauben, eine richtige Position zu verteidigen, nicht darin,
sich in ihre eigene kleine Ecke zurückzuziehen, sondern einen Kampf innerhalb
der Organisation zu führen, um damit beizutragen, sie wieder auf den richtigen
Weg zu bringen.” (ebenda, Punkt 3)
“In der Organisation
setzt sich das Ganze nicht aus der Summe der Teile zusammen. Die einzelnen
Teile erhalten ein Mandat für die
Durchführung einer besonderen Aufgabe
(territoriale Presse, lokale Intervention usw.) und sind somit gegenüber
der gesamten Organisation für die Durchführung des Mandats verantwortlich.”
(ebenda, Punkt 4)
Diese kurzen
Abstecher zum Bericht von 1982 zeigen
deutlich, dass das Beharren auf die Frage der Einheit der Organisation die
prinzipielle Achse dieses Dokuments ist. Die veschiedenen Teile der
Organisation können nur als Teile des Ganzen, als Delegationen und Instrumente
dieses Ganzen begriffen werden. Ist es notwendig zu wiederholen, dass diese
Auffassung ständig in allen Teilen der Organisation präsent sein muss?
Nur auf dieser Basis,
dem Beharren auf die Einheit der Organisation, bringt der Bericht die Frage des
Kongresses (welcher hier keine Rolle spielt) und der Zentralorgane ein.
„Das Zentralorgan ist
ein Teil der Organisation, und als solches ist es der Organisation gegenüber
verantwortlich, wenn diese zu ihrem Kongress zusammenkommt. Jedoch handelt es
sich um einen Teil, der zur Aufgabe hat, das Ganze zum Ausdruck zu bringen und
zu repräsentieren. Deshalb sind die Positionen und Beschlüsse des Zentralorgans
immer höherwertig gegenüber denen, die andere Teile der Organisation getrennt
davon getroffen haben.” (ebenda, Punkt 5)
“Im Gegensatz zu
bestimmten Auffassungen, insbesondere der so genannten ‚leninistischen‘, ist
das Zentralorgan ein Instrument der Organisation und nicht umgekehrt. Es ist
nicht die Spitze einer Pyramide, wie das eine hierarchische und militärische
Auffassung von der Organisation der Revolutionäre meinen könnte. Die
Organisation besteht nicht aus dem Zentralorgan plus Militante, sondern stellt
ein dichtes und vereinigtes Netz dar, innerhalb dessen alle Teile miteinander
verbunden sind und zusammenwirken. Man muss deshalb das Zentralorgan eher als
den Kern einer Zelle auffassen, der den Stoffwechsel eines lebendigen
organischen Einheit koordiniert.” (ebenda)
Dieses Bild ist
grundlegend für das Verständnis der Zentralisierung. Es alleine, erlaubt uns im
Besonderen das Verständnis dafür, weshalb es in einer einheitlichen
Organisationen mehrere Zentralorgane mit verschiedenen Verantwortlichkeiten
geben kann. Wenn wir die Organisation wie eine Pyramide betrachten, deren
Spitze das Zentralorgan ist, wären wir mit einer unmöglichen geometrischen
Figur konfrontiert: mit einer Pyramide, die eine Spitze hat und aus vielen kleinen Pyramiden besteht, die alle
eine eigene Spitze haben. In der Praxis wäre eine solche Organisation genauso
abwegig wie diese geometrische Figur und könnte auch nicht funktionieren. Es
sind die Administrationen und die Unternehmen der Bourgeoisie, welche eine
pyramidenhafte Architektur haben. Damit Letztere funktionieren, werden die
Verantwortlichkeiten zwangsläufig von oben nach unten delegiert. Dies ist nicht
der Fall bei der IKS, die gewählte Zentralorgane auf den verschiedenen
territorialen Ebenen hat. Solch eine Funktionsweise entspricht genau der
Tatsache, dasss die IKS eine lebendige Einheit (wie die einer Zelle in einem
Organismus) ist, in der die verschiedenen organisatorischen Momente Ausdruck
des einheitlichen Ganzen sind.
In einer solchen
Auffassung, welche detailliert in den Statuten ausgedrückt wird, kann es keine
Konflikte und Widersprüche zwischen den verschiedenen Strukturen der Organisation
geben. Es können durchaus Meinungsverschiedenheiten irgendwo in der
Organisation entstehen. Aber das ist Teil des normalen Lebens. Doch wenn
Meinungsverschiedenheiten zu Konflikten
führen, bedeutet dies, dass irgendwo diese Auffassung über die Struktur
verlorengegangen ist und sich eine andere Sichtweise eingeschlichen hat, welche
nur zu Gegensätzen zwischen den verschiedenenen „Spitzen“ führt. In einer
solchen Dynamik, welche zum Auftauchen mehrerer „Zentren“ und dadurch zu
Konflikten zwischen ihnen führt, ist die Einheit der Organisation und somit
ihre ganze Existenz in Frage gestellt.
Die Fragen der
Organisation und des Funktionierens sind nicht nur von höchster Wichtigkeit,
sie sind auch am schwierigsten zu begreifen.18 Viel mehr als andere Fragen ist
ihr Verständnis mit der Subjektivität der Militanten verbunden, welche ein
wichtiges Einfallstor für das Eindringen fremder Ideologien in das Proletariat
sein kann. Als solche sind sie Fragen, die par excellence niemals endgültig
beantwortet werden. Es ist daher wichtig, dass sie Gegenstand anhaltender
Wachsamkeit auf Seiten der Organisation und aller ihrer Militanten sind.
14. Oktober 1993
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Kriegsdrohungen gegen den Irak
- 2888 Aufrufe
Das Versinken in die kriegerische Barbarei
Täglich konkretisiert sich die Gefahr eines neuen Krieges gegen den Irak. Bush jun. beabsichtigt, einen Schritt weiter zu gehen als sein Vater 1991. Er möchte dem Irak nicht nur eine neue militärische Niederlage bereiten, sondern diesmal auch gleich das Regime von Saddam Hussein zerschlagen. Diese neuen Kriegsdrohungen passen in die allgemeine Situation der immer größeren Allgegenwart des Krieges in der internationalen Arena. Ein Jahr nach den Attentaten vom 11. September und dem von den USA der ganzen Welt, insbesondere den als „Achse des Bösen“ bezeichneten Ländern, erklärten „Krieg gegen den Terror“ hat sich die Situation nur verschlimmert.
Offensichtlich klärten die Zerschlagung des Talibanregimes und der Krieg gegen die al-Kaida in Afghanistan nichts: Die große internationale antiterroristische Koalition unter straffer Kontrolle des Weißen Hauses war nicht von Dauer. Hinter der Flut der Reportagen und offiziellen Mitteilungen über die „internationale Solidarität“ anlässlich der Erinnerungsfeierlichkeiten vom 11. September haben sich nun die Kritiker gegenüber der amerikanischen Politik insbesondere in Europa und in den arabischen Ländern viel offener geäußert. In Afghanistan selbst zeigten das Attentat vom 5. September auf dem Markt von Kabul, das ca. 30 Tote und Hunderte von Verletzten forderte, und einige Stunden später das Attentat gegen den Präsidenten Karzai die Zerbrechlichkeit eines Regimes, das auf Gedeih und Verderb vom Weißen Haus abhängt.
Seit einem Jahr kann man aber hauptsächlich einer Zunahme von kriegerischen Spannungen in anderen Ländern beiwohnen. Zu Sommerbeginn drohte ein neuer, möglicherweise mit Atomwaffen geführter Krieg zwischen Indien und Pakistan auszubrechen, dessen Risiken nach wie vor bestehen (s. International Review Nr. 110, engl./frz./span. Ausgabe). Ebenso hat sich die Situation in Palästina verschlimmert. Und jetzt zeichnet sich eine Neuauflage des Golfkrieges von 1991 ab. „Die Ära des Friedens“, die uns Bush sen. noch 1989 anlässlich des Zusammenbruchs des Ostblocks versprochen hatte, offenbart sich nun als eine Ära einer seit dem Zweiten Weltkrieg beispiellosen Intensivierung der kriegerischen Barbarei. Diese Entwicklung bestätigt klar die Analysen und Voraussagen, die die Revolutionäre angesichts des einschläfernden Geredes der Hauptdirigenten der Weltbourgeoisie gemacht hatten.
Der Militarismus und der Krieg in der aktuellen Periode
In der Internationalen Revue Nr 13 gab unser Orientierungstext Militarismus und Zerfall, der noch vor dem Golfkrieg geschrieben worden war, einen Analyserahmen für die imperialistischen Rivalitäten in der kapitalistischen Welt für die Periode nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der darauf folgenden Auflösung des westlichen Blocks: „Seit dem Anfang des Jahrhunderts war der Krieg die entscheidendste Frage, vor der die Arbeiterklasse und ihre revolutionären Minderheiten standen. (...) Der Grund dafür liegt darin, dass der Krieg die konzentrierteste Form der Barbarei des dekadenten Kapitalismus ist, der seinen Todeskampf und die Bedrohung, die er für das Überleben der Menschheit darstellt, am deutlichsten zum Ausdruck bringt. Mehr noch als während der vergangenen Jahrzehnte wird gegenwärtig die kriegerische Barbarei (obgleich z.B. Bush und Mitterand immer von einer ‘neuen Friedensordnung’ reden) ein ständiger und überall vorhandener Faktor der Weltlage sein, wobei immer mehr entwickelte Länder daran beteiligt sein werden.“ (Punkt 13)
Weiter schrieben wir damals: „Der allgemeine Zerfall der Gesellschaft stellt die letzte Phase des Zeitraums der Dekadenz des Kapitalismus dar. In dieser Phase werden die typischen Merkmale der Dekadenzperiode nicht hinfällig: die historische Krise der kapitalistischen Wirtschaft, der Staatskapitalismus und auch die grundlegenden Phänomene wie der Militarismus und der Imperialismus. Weil der Zerfall als die Spitze der Widersprüche erscheint, in die der Kapitalismus in seiner Dekadenz verfällt, werden die typischen Merkmale dieser Periode noch verschärft. (...) Das gleiche trifft für den Militarismus und Imperialismus zu, wie man es schon während der 80er Jahre feststellen konnte, als das Phänomen des Zerfalls in Erscheinung trat und sich verbreitete. Und wenn die Welt jetzt nicht mehr nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in zwei Blöcke gespalten ist, ändert das auch nichts an dieser Wirklichkeit. Denn die Bildung zweier imperialistischer Blöcke ist nicht die Ursache für den Militarismus und den Imperialismus. Das Gegenteil ist der Fall: die Bildung der Blöcke ist nur die extremste Konsequenz, ein Ausdruck des Versinkens des dekadenten Kapitalismus im Militarismus und im Krieg. Bei der Beziehung zwischen der Bildung der Blöcke und dem Imperialismus gibt es gewisse Parallelen zwischen dem Verhältnis Stalinismus und Staatskapitalismus. Genau so wenig wie das Ende des Stalinismus die historische Tendenz des Staatskapitalismus infrage stellt, von dem er nur ein Ausdruck war, kann das gegenwärtige Verschwinden der Blöcke keinesfalls zu einer Abschwächung des Imperialismus und seines Gewichtes in der Gesellschaft führen. Der grundlegende Unterschied liegt in der Tatsache, dass das Ende des Kapitalismus einerseits der Eliminierung einer besonders abartigen Form des Staatskapitalismus entspricht, andererseits ist das Ende der Blöcke nur der Auftakt einer noch barbarischeren, abartigeren, chaotischeren Form des Imperialismus.“ (Punkt 5)
Ab Januar 1991 zeigte der Golfkrieg, „dass gegenüber der für den Zerfall typischen Tendenz zum allgemeinen Chaos, welche wiederum durch den Zusammenbruch des Ostblocks beschleunigt wurde, es keinen anderen Ausweg für den Kapitalismus gibt als den Einsatz von Waffen. Sein Versuch, die verschiedenen Teile eines Körpers zusammenzuhalten, der auseinander bricht, kann nur mit Gewalt erfolgen. Deshalb sind die Mittel selber, die er einsetzt, um dieses immer blutiger werdende Chaos einzudämmen, selber ein gewaltiger Faktor der Verschärfung der kriegerischen Barbarei, in die der Kapitalismus immer mehr versinkt.“ (Punkt 8)
Deshalb besteht „heute die Perspektive einer Vervielfachung und Ausweitung von lokalen Kriegen und Interventionen der großen Mächte, die die bürgerlichen Staaten bis zu einem gewissen Grad ohne Zustimmung des Proletariats führen können“ (Resolution des 13. Kongresses der IKS 1999, International Review Nr. 97, engl./frz./span. Ausgabe)
Die gegenwärtige Lage bestätigt die Zunahme der permanenten Barbarei in einer vom „Jeder-für-sich“ und der allgemeinen Konkurrenz zwischen den großen als auch kleinen imperialistischen Mächten beherrschten kapitalistischen Welt. In diesem Kontext haben die nationalen Bourgeoisien, allen voran die USA, die in der Bevölkerung ein Klima der Psychose und der nationalen Hysterie entfacht und aufrechterhalten haben, aber auch all die anderen Staaten, die eine Rolle in der globalen Arena spielen, eine neue Etappe in der Mobilisierung ihrer Armeen zur Kriegsführung eingeleitet. Auch haben sie die Verteidigungsbudgets beträchtlich gesteigert.
Wenn die Attacken vom 11. September, wie Bush gesagt hat, ein „Kriegsakt“ waren, so waren sie „ein Akt eines kapitalistischen Krieges, ein Moment des permanenten imperialistischen Krieges, der die Epoche der Dekadenz des Kapitalismus kennzeichnet.“ (Resolution der außerordentlichen Konferenz der IKS im April 2002 zur internationalen Lage) Im Gegenzug zu den Attentaten vom 11. September haben die USA in Afghanistan im Namen des Krieges gegen den Terror intervenieren können. Sie haben sich als Herren im Herzen Zentralasiens installiert: in Afghanistan, Tadschikistan, Usbekistan und auch in Georgien. Dieses Land ist heute als Folge der amerikanischen Präsenz enormen Pressionen durch Russland ausgesetzt. Die USA steuern aber viel weitreichendere strategische Zielsetzungen an.
Das Ziel der amerikanischen Bourgeoisie ist die Sicherung der Kontrolle nicht nur über diese Region, die sich ehemals im Besitz Russ-
lands befand, sondern über den Nahen und Mittleren Osten bis zum indischen Subkontinent. Mit Nordkorea auf der Liste der “Achse des Bösen“ wollen die USA auch China und Japan herausfordern. Dieses Vorgehen zielt auf die Einkreisung der westeuropäischen Mächte und vor allem auf die Blockade des deutschen Imperialismus ab, der der gefährlichste imperialistische Rivale ist und der über die slawischen Gebiete nach Osten expandieren will.
In diesem Kontext stehen die Kriegsdrohungen gegen den Irak.
Welche Interessen stehen hinter diesem Kriegsplan?
Weshalb diese Hartnäckigkeit gegenüber Saddam Hussein?
Ganz klar stellt der Irak unter Saddam Hussein heute keine reale Gefahr dar. Während seine Armee noch vor 1991 als die fünftgrößte der Welt galt, wurde sie in der Folge stark dezimiert und hat seit dem Ende des Golfkrieges zwei Drittel ihres Bestandes verloren. Was das seither bestehende Embargo anbelangt, so hat es nicht nur die Wiederaufrüstung der irakischen Armee verhindert, sondern auch die Beschaffung von Ersatzteilen. Beinahe das gesamte militärische Material des Iraks stammt aus der Zeit vor dem Golfkrieg, was selbst die New York Times vom 26. 8. 2002 zugibt.
Weiter haben die USA seither über den Irak unter dem Vorwand, Massaker an der kurdischen und schiitischen Minderheit zu verhindern, sowohl im Norden als auch im Süden Flugverbotszonen verhängt. Der irakischen Luftwaffe ist es somit untersagt, die Hälfte des eigenen Territoriums zu überfliegen.[i] Die USA haben nun eine „nukleare Gefahr“ hervorgezaubert. Im Bericht des Internationalen Instituts für strategische Studien (IISS) wird dieses Argument zugunsten „eines bedeutenden Vorrats an biologischen und chemischen Waffen“ zurückgestellt. Auf diesem Bericht beruht jetzt auch die „potentielle irakische Gefahr“.
Offensichtlich ist die von der Regierung Bush zur Rechtfertigung einer Intervention beschworene allgegenwärtige Gefahr nichts als eine Propagandalüge. Unter denjenigen, die die Politik der USA offen kritisieren, gibt es solche, die einen anderen Grund für den amerikanischen Wunsch nach einer Intervention nennen: Die USA wollten die Kontrolle über die irakischen Ölreserven, die zweitgrößten der Welt, sicherstellen. Le Monde Diplomatique schrieb im Oktober 2002 dazu: „Die Kontrolle über die zweitgrößten Reserven an Rohöl in der Welt würde es dem amerikanischen Präsidenten erlauben, den ganzen globalen Erdölmarkt umzustürzen. Unter einem amerikanischen Protektorat könnte der Irak seine Produktion innert Kürze verdoppeln, was als unmittelbare Folge einen Preissturz nach sich ziehen würde und somit vielleicht zu einer Ankurbelung des Wachstums in den USA führen könnte.“
Zuerst muss man dazu sagen, dass die Idee, das irakische Öl könnte die amerikanische Wirtschaft antreiben (oder - eine sich mehr „marxistisch“ gebende Variante derselben Argumentation - den USA eine „Erdölrente“ sichern), lässt einige sehr wichtige Aspekte außer Betracht: Der erhöhten Förderung müssten fünf Jahre von hohen Investitionen vorausgehen, bevor aus dem irakischen „Manna“ wirklich Profit gezogen werden könnte.[ii] Zudem unterliegt bereits die heutige Förderung weitgehend einem amerikanischen Diktat: politisch durch die Exportkontrolle unter Führung der UNO; militärisch durch die amerikanischen Bomber, die die ganze Erdölindustrie des Irak im Visier haben; wirtschaftlich durch den Einfluss der großen amerikanischen Erdölfirmen.
Man muss vielmehr man auf der Tatsache beharren, dass das Interesse aller großen Mächte am Nahen Osten hauptsächlich ein strategisches ist. Dieses Interesse ging selbst der Entdeckung des Erdöls in dieser Region voraus. Bereits im 19. Jahrhundert trugen Großbritannien, Russland und Deutschland um Irak, Iran und Afghanistan das seinerzeit so genannte „Große Spiel“ um Einfluss aus. Dieses Gebiet gewann mit dem Bau des Suezkanals, einer strategischen Verbindung Großbritanniens zu seiner Kronkolonie Indien, noch mehr an Bedeutung. Heute bleibt die geostrategische Bedeutung dieser Region vollumfänglich bestehen, jedoch ist sie durch die strategische Bedeutung des Erdöls als unabdingbarer Rohstoff für die Wirtschaft und den Krieg erweitert worden. Wenn die USA zu einer absoluten Kontrolle über Erdöllieferungen an Europa oder Japan gelangen würden, würde dies bedeuten, dass sie in der Lage wären, im Falle einer schweren internationalen Krise starken Druck auf ihre Kontrahenten auszuüben. Sie müssten nicht einmal mehr mit nackter Gewalt drohen, um diese Länder gefügig zu machen.
Mit diesem erneuten Gewaltbeweis gegenüber dem Irak wollen die USA ihre Glaubwürdigkeit und ihre Autorität sowohl in der Region als auch auf dem ganzen Planet wirkungsvoll verstärken. Der Golfkrieg von 1991 zielte hauptsächlich darauf ab, die ehemals im Westblock Verbündeten wieder hinter den USA aufzureihen. Diese Verbündeten begannen nach der Auflösung des „Reichs des Bösen“ (wie es Reagan genannt hatte), dem Ostblock und der UdSSR, die Hegemonie der USA infrage zu stellen. Die Operation war von einem zeitweiligen Erfolg gekrönt, jedoch begannen die Ex-Alliierten schon bald, seit Ende Sommer 1991, mit der Entwicklung des Kriegs in Ex-Jugoslawien erneut ihre eigenen Karten zu spielen (an allererster Stelle Deutschland, das Slowenien und Kroatien zur Abspaltung gedrängt hatte). In dieser Zeit begnügten sich die USA mit der Vertreibung der irakischen Truppen aus Kuwait ohne weitere Behelligung Saddam Husseins. Dafür gab es verschiedene Gründe. Die Zusammenarbeit von Saudi-Arabien und Frankreich war an die Bedingung geknüpft, Saddam Hussein am Ruder zu belassen. Hätten sich die USA nicht an diese Abmachung gehalten, wäre die Koalition, die ja ein Ziel von Bush sen. war, schnell auseinander gebrochen. Jedoch waren auch alle „Alliierten“ inklusive den USA am Erhalt der Macht Saddam Husseins interessiert, damit dieser weiterhin seiner Rolle als lokaler Gendarm bei den Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden im Norden und der Schiiten im Süden gerecht werden konnte. Diese Feindseligkeiten hätten die ganze Region destabilisieren können. Die Tatsache, dass die USA heute jegliche diesbezügliche Vorsicht missen lassen, dass sie die Gefahr der Opposition einer gewissen Anzahl von Mächten und mehrerer wichtiger arabischer Länder gegen ihr Vorgehen in Kauf nehmen, dass sie selbst das Risiko einer weiteren Destabilisierung der Situation in dieser Region auf sich nehmen, zeigt nichts anderes als die Verschärfung der globalen Situation seit 1991. Es bedeutet ein weiteres Abtauchen ins wachsende Chaos, das immer blutiger wird. Wie wir bereits vor mehr als zehn Jahren angekündigt haben, sind die USA zu einer Flucht nach vorn unter Anwendung ihrer militärischen Kraft genötigt, wenn sie ihre Führerschaft bewahren wollen.
Ein weiteres Verdienst des jetzigen Vorgehens gegen den Irak ist die Sprengung der europäischen Front. Das ist ein exzellentes Mittel zur Spaltung der europäischen Mächte, hauptsächlich zwischen Großbritannien auf der einen und Frankreich und vor allem Deutschland auf der anderen Seite. Großbritannien bleibt die Hauptstütze in einem Krieg gegen den Irak. Nicht aus Solidarität gegenüber den USA handelt die britische Bourgeoisie auf diese Weise, sondern weil sich Großbritannien schon immer entschieden für eine Vertreibung von Saddam Hussein eingesetzt hat, um wieder vermehrt Einfluss in dieser ehemaligen britischen Kolonie ausüben zu können. Es ist also ein reiner Zufall, dass ihre Interessen mit denjenigen der USA übereinstimmen. Sie erwarten von den USA auch eine Entschädigung für die militärische Unterstützung. Im Gegensatz dazu hat sich Frankreich immer gegen eine neue militärische Intervention auf irakischem Boden gestellt und die Verbindung zu Saddam Hussein selbst nach dem Golfkrieg weiter gepflegt (wie auch mit Libanon und Syrien). Frankreich hat im UNO-Sicherheitsrat auch immer die Beendigung des Embargos gegen den Irak verlangt. Auch Deutschland hat immer versucht, seine Position im Nahen Osten durch eine Achse Berlin-Bagdad über den Balkan und die Türkei zu verstärken.
Ein waghalsigeres Unterfangen als in Afghanistan
Der Norden wie der Süden Iraks sind schon von unzähligen, nicht enden wollenden englisch-amerikanischen Luftangriffen heimgesucht worden, welche unter diversen Vorwänden als Generalprobe der Kriegsoperation dienen (so z.B. am 27. August, als die Entdeckung von Radaranlagen in einer demilitarisierten Zone dazu diente, den Flughafen von Mossul als Zielscheibe zu benutzen). In diesem Sinne hat sich das Weiße Haus mit strategischen Basen zur Intervention abgesichert (in Kuwait sind nahezu 50’000 amerikanische Soldaten stationiert). Im Vergleich zum Golfkrieg von 1991 kann das Weiße Haus nun die Schwächen der einen durch die Unterstützung der anderen wettmachen. So ist zum Beispiel die Türkei bereit, von jetzt den amerikanischen Geschwadern an als Basis im Hinterland zu dienen. Die Arabischen Emirate, Kuwait, Oman, Bahrain und vor allem Katar würden wohl als strategische Regionalbasen dienen.[iii] Jordanien wird mit seinem Territorium der Neutralisierung der Westgrenze Iraks, nahe zu Israel, dienen.
Nichtsdestotrotz scheint dieses Unterfangen noch riskanter als das Kriegstreiben in Afghanistan, da die Vereinigten Staaten im jetzigen Fall die Drecksarbeit vor Ort nicht anderen (wie der afghanischen Nordallianz) überlassen können, und trotz des Rückzugs aus der afghanischen Militäroperation mit „null Toten“ kann das Vietnamsyndrom wiedererweckt werden. Auch die Bereitstellung einer breiten demokratischen Opposition auf diesem Terrain für die Zeit „nach Saddam Hussein“ ist weit davon entfernt, schon eine klare Tatsache zu sein. Eine weitere Schwierigkeit ist die viel größere Vielfalt von entgegengesetzten Einflüssen auch auf regionaler Ebene, als dies in Afghanistan der Fall ist. Die kurdischen und schiitischen Minderheiten sind aus amerikanischer Sicht nicht zuverlässig, die Ersteren, da unter Druck mehrerer europäischer Mächte beeinflussbar, die Letzteren, da in Abhängigkeit vom iranischen Staat und im Dienste seiner Interessen stehend. Hinzu kommen die Vorbehalte der Türkei mit ihrer Sensibilität gegenüber der kurdischen Frage einerseits, wobei Saddam Hussein immerhin noch die Grenze absichert; andererseits und vor allem wegen der Anziehung, die die Türkei gegenüber der Europäischen Union verspürt, die umgekehrt den Druck auf sie verstärkt. Das andere Risiko betrifft das Image der amerikanischen Bourgeoisie, deren Ruf als „Wegbereiter des Friedens“ im Nahen Osten in den gesamten arabischen Staaten definitiv getrübt wird und deren in dieser Region erreichte Positionen längerfristig geschwächt werden.
Schon bei ihrer Absicht, der Welt ihre Vision einer „ernsthaften Gefahr“ aus dem Irak einzuhämmern, sehen sich die Vereinigten Staaten zwangsweise mit einem ersten Hindernis konfrontiert: Die amerikanische Bourgeoisie kann sich, anders als bei ihren vorangegangenen Militärinterventionen, auf keine Vorschrift des Völkerrechts stützen, um ihr Kriegstreiben zu rechtfertigen. Während 1991 Saddam Husseins Intervention in Kuwait als Vorwand zur Entfesselung des Golfkriegs diente, gibt es heute keine rechtliche Absicherung für einen Präventivkrieg. Mit dem neu von der amerikanischen Bourgeoisie gegenüber dem Irak verwendeten Begriff des „potentiellen Angreifers“ versucht sie in der Tat, jeglichen rechtlichen Rahmen auf der Ebene internationaler Beziehungen abzuschaffen und neue Regeln durchzusetzen. Diese Regeln, falls geduldet, würden unterschiedslos jede Invasion in beliebigen Territorien durch beliebige Nationen rechtfertigen und eine weitere Türe zur Verschärfung des Chaos öffnen. Diese Schwäche in der amerikanischen Strategie wird oft und ausgiebig von denjenigen Großmächten ideologisch ausgeschlachtet, die heute vorgeben, sich an die von der UNO erteilten „legalen Mandate“ zu halten. Das ist im übrigen der Grund, weshalb die Vereinigten Staaten, um ihr Handeln zu „legitimieren“, sich über die Beschlüsse der UNO und des Sicherheitsrats hinwegsetzen und die Risiken eines Misserfolgs in Kauf nehmen mussten. Dies wiederum hat Saddam Hussein einen ersten diplomatischen Erfolg beschert, als er die Zulassung von Waffeninspektoren auf irakischem Territorium erklärte: Russland, China und Frankreich, drei der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, haben sofort die irakische Position begrüßt und erklärt, als Konsequenz müsse, um die Arbeit der Inspektoren zu organisieren, auf eine Militäraktion verzichtet werden. Das Tauziehen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Irak, aber auch anderen Staaten ist also keineswegs schon im voraus entschieden.
Die Spaltungen innerhalb der amerikanischen Bourgeoisie
Der Golfkrieg wurde „legal“ im Rahmen von UNO-Resolutionen, der Kosovokrieg „illegal“ im Rahmen der NATO und die Militärkampagne in Afghanistan unter dem Banner des „Unilateralismus“ der Amerikaner geführt. Diese Politik verschärft natürlich die Feindseligkeit der anderen Staaten gegenüber Onkel Sam. Gleichzeitig lässt diese Situation das Anwachsen des Antiamerikanismus seit dem Golfkrieg von 1991 ermessen, und zwar vor allem unter der Mehrheit der europäischen Mächte. Sahen sich damals die Großmächte noch zur Beteiligung an Militäroperationen gezwungen, so tritt heute Kritik und sogar offene Opposition zum amerikanischen Vorgehen an den Tag. In Frankreich wird die Absicht Bushs, den Irak anzugreifen und Saddam Hussein zu stürzen, letztlich als krankhafte Besessenheit eines „Rambos“ präsentiert. In Deutschland, wo seit mehr als einem Jahrzehnt als goldene Regel der Diplomatie gilt, die Vereinigten Staaten wegen eigenen imperialistischen Ambitionen nicht vor den Kopf zu stoßen, hat Schröder mit der kategorischen Ablehnung jeglicher Beteiligung Deutschlands an Militärinterventionen im Irak jetzt einen Bruch vollzogen.[iv] Auch Mächte von untergeordneterer Bedeutung wie Spanien erlauben sich, an der Politik des Weißen Hauses betreffend den Irak oder den Nahen Osten Kritik zu üben.
Dieser Widerspruch findet seinen Wiederhall in Debatten und den in der amerikanischen Bourgeoisie aufgetretenen „Unstimmigkeiten“. Gewiss, schon beim Ausbruch des 2. Weltkriegs sind, betreffend der Notwendigkeit eines amerikanischen Kriegseintritts, Unstimmigkeiten in der US-Bourgeoisie ausgebrochen, nämlich zwischen den „Isolationisten“ und den „Interventionisten“. Während das republikanische Lager insgesamt „isolationistische“ Positionen vertrat, stammten die „Interventionisten“ hauptsächlich aus der demokratischen Partei. 1941 hat die von Roosevelt wohlbedacht provozierte Katastrophe von Pearl Harbor (s. Der Machiavellismus der herrschenden Klasse, Internationale Revue Nr. 29) den „Interventionisten“ ermöglicht sich durchzusetzen. Heute ist diese Kluft verschwunden. Aber die Widersprüche der amerikanischen Politik haben neue interne Divergenzen hervorgerufen, die sich nicht mehr wirklich mit denjenigen der traditionellen Parteien decken. Wohlverstanden: In der amerikanischen herrschenden Klasse existieren keine Zweifel über die Notwendigkeit, ihre weltweite imperialistische Vorherrschaft bewahren zu müssen, und dies zuallererst auf militärischem Terrain. Die divergierenden Beurteilungen betreffen vielmehr die folgende Frage: Müssen die Vereinigten Staaten die Dynamik akzeptieren, die sie zum Alleingang drängt, oder sollen sie sich um die Gunst anderer kümmern und Rücksicht nehmen auf eine gewisse Anzahl Verbündeter, wenngleich eine solche Allianz heute keinerlei Stabilität hat? Diese beiden Positionen erscheinen deutlich im Bezug auf die beiden im Brennpunkt stehenden Kriegsherde: den israelisch-palästinensischen Konflikt und die geplante Militärintervention im Irak. Als Ausdruck dieser Widersprüche zeigt sich die amerikanische Politik schwankend zwischen der vollumfänglichen Unterstützung Sharons mit der Absicht, sich Arafats zu entledigen, und den gleichzeitigen Diskursen über die unabwendbare Schaffung eines palästinensischen Staates. Der 11. September bedeutete den Antrieb zu einer Politik der quasi bedingungslosen Unterstützung Israels, wobei jedoch klar ist, dass die von Sharon und anderen noch radikaleren Fraktionen der israelischen Bourgeoisie geführte Flucht nach vorn mit der Politik der Panzer den Konflikt in eine endlose Spirale blinder Gewalt treibt, was zu einer selbstmörderischen Isolation Israels und indirekt der Vereinigten Staaten beiträgt.[v] Überdies irritiert die offene amerikanische Unterstützung Sharons viele arabische Staaten, die eigentlich nicht bedingungslose Anhänger Arafats wären. Dies könnte einen Großteil der herrschenden Klassen der arabischen Länder (v.a. Ägypten, Saudi-Arabien, Syrien) den Mächten der Europäischen Union näher bringen. Die Letzteren erklären jetzt nach dem eigenen Scheitern in der Rolle als „Wegbereiter des Friedens“ offen ihre Ablehnung einer Absetzung Arafats und schlüpfen so in die Rolle des Spielverderbers mit der Absicht, sich mittels Diplomatie die Kastanien aus dem Feuer zu holen.
Die Divergenzen, welche die amerikanische Bourgeoisie in Mitleidenschaft ziehen, sind in der republikanischen Führung zu Tage getreten. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, Vizepräsident Dick Cheney und Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice verteidigen die Position einer Intervention im Alleingang und dies so bald als möglich. Demgegenüber äußern sich andere hohe Köpfe des republikanischen Lagers wie Colin Powell, James Baker oder Henry Kissinger (mit der Unterstützung gewisser Wirtschaftskreise, in denen sich angesichts der im Falle eines amerikanischen Alleingangs hohen Kosten einer Militäroperation wegen der „Konjunktur der gegenwärtigen Wirtschaftskrise“ Nervosität breit macht) zurückhaltend; noch bevorzugen sie die Alternative Zuckerbrot und Peitsche.
Wenn auch die „Falken“, die Anhänger einer energischen Vorgehensweise und Verfechter einer schnellen Intervention der Vereinigten Staaten im Irak, sich durchgesetzt zu haben scheinen, verunmöglichen die dadurch in der amerikanischen Bourgeoisie aufgetauchten Probleme jegliche Sicherheit. Dies zeigen in aller Deutlichkeit die jüngsten, Aufsehen erregenden Erklärungen Al Gores, der bei den letzten Präsidentschaftswahlen (um Haaresbreite) von Bush überrundete Kandidat der Demokraten, der die Offensichtlichkeit einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung aus dem Irak abstreitet und die internationale Strategie Bushs folgendermaßen kritisiert: „Nach dem 11. September trafen wir weltweit auf Sympathie, Wohlwollen und Unterstützung. Dies haben wir verschwendet und an deren Stelle sind im Laufe eines Jahres Angst, Beklemmung und Unsicherheit getreten, nicht hinsichtlich bevorstehender Taten von Terroristen, sondern in Hinsicht auf die unsrigen, unsere Taten!“ (Le Monde vom 26. September). Und dann, als mangle es noch an Ausdrücklichkeit, kündigen zwei demokratische Abgeordnete an, sich nach Bagdad zu begeben, um die Risiken abzuschätzen, denen im Falle eines Kriegs die Zivilbevölkerung ausgesetzt würde. Sie ziehen bei dieser Gelegenheit am selben Strick wie gewisse Gegner der USA, die entschlossen sind, die amerikanische Kriegsinitiative im Irak zu sabotieren. Man täusche sich aber nicht betreffend die Initiative gewisser Demokraten, welche es gegenwärtig zu ihrem Ziel erklärt haben, den Krieg gegen den Irak, so wie von Bush vorgesehen, zurückzustellen. Diese Initiative soll keinesfalls der kriegerischen Seite des amerikanischen Imperialismus in den Rücken fallen, sondern, wie schon erwähnt, Vorkehrungen treffen gegen eine schon heute durch das amerikanische Säbelrasseln immer mehr fortscheitende Isolierung der Vereinigten Staaten[vi], welche wiederum die Streitpunkte der amerikanischen Führung verschärft.[vii]
Wahrhaftig drücken diese Uneinigkeiten, die innerhalb der weltweit mächtigsten herrschenden Klasse zu Tage treten, einzig den fundamentalen Widerspruch aus, in dem sich diese Bourgeoisie befindet: „Gegenüber einer Welt, die von der Dynamik des “Jeder-für-sich„ beherrscht wird, und wo insbesondere die früheren Vasallen des amerikanischen Gendarms danach streben, sich so weit als möglich aus der erdrückenden Vorherrschaft dieses Gendarmen zu befreien, die sie wegen der Bedrohung durch den gegnerischen Block ertragen mussten, besteht für die USA das einzige Mittel zur Aufrechterhaltung ihrer Autorität darin, sich auf das Instrument zu stützen, bei dem sie gegenüber allen andern Staaten eine haushohe Überlegenheit besitzen: die militärische Gewalt. Aber aufgrund dieses Einsatzes geraten die USA selber in einen Widerspruch:
– einerseits, falls sie auf den Einsatz oder die Zurschaustellung ihrer militärischen Überlegenheit verzichten, kann das die anderen, sie herausfordernden Staaten nur ermuntern, noch weiter vorzudrängen bei dieser Herausforderung;
– andererseits, falls sie diese rohe Gewalt anwenden, und selbst und vor allem wenn sie es dank dieses Mittels schaffen, die imperialistischen Appetite ihrer Gegner vorübergehend zurückzudrängen, werden diese aber danach streben, die erstbeste Gelegenheit zu ergreifen, um sich zu revanchieren und wieder versuchen, aus der US-Vorherrschaft auszubrechen.
Wenn die USA diese militärische Überlegenheit als Trumpfkarte ins Spiel bringen, bewirken sie das Gegenteil – je nachdem ob die Welt in Blöcke geteilt ist wie vor 1989, oder wenn die Blöcke nicht mehr bestehen. Als die Blöcke noch bestanden, neigte das Zur-Schau-Stellen dieser Überlegenheit dazu, das Vertrauen der Vasallen gegenüber ihrem Führer zu verstärken, da er die Fähigkeit besaß, sie wirkungsvoll zu verteidigen; deshalb stellt diese Karte dann einen Faktor des Zusammenhaltes um die USA dar. Wenn die Blöcke nicht mehr bestehen, bewirken die Demonstrationen der Stärke der einzig übrig gebliebenen Supermacht im Gegenteil nur, dass die Dynamik des “Jeder-für-sich„ nur noch verstärkt wird, solange es keine Macht gibt, die mit ihr auf dieser Ebene konkurrieren kann. Deshalb kann man die Erfolge der gegenwärtigen Konteroffensive der USA keinesfalls als endgültig ansehen oder als Überwindung ihrer Führungskrise.“ (Resolution des 12. Kongresses der IKS, Internationale Revue Nr. 19). Folglich treibt die Absicht der Vereinigten Staaten, ihre Führung zu stärken, sie zur Entfesselung des Krieges, was wiederum in sich die Unmöglichkeit birgt, ihre Ziele längerfristig zu verwirklichen. In der heutigen Weltlage führt dieser Widerspruch, für den es keine Lösung gibt, zwangsweise zu einem unaufhörlichen Antrieb der Kriegsspirale.
Die Entwicklung der gegenwärtigen Situation steht daher ganz im Zeichen derselben Kriegspolitik wie sie damals im Golfkrieg, dann in Ex-Jugoslawien und in Afghanistan verfolgt wurde, jetzt jedoch auf einer höheren Stufe des Wagnisses und der Gefahr des Chaos. Die Politik des Weltpolizisten wirkt als aktiver Faktor des wachsenden Kriegschaos, des Versinkens in der Barbarei mit zunehmend unkontrollierbaren Konsequenzen. Sie bringt immer destabilisierendere Risiken mit sich, namentlich auf dem asiatischen Kontinent vom Nahen Osten bis Zentralasien, vom indischen Subkontinent bis Südostasien. Derartige Risiken enthüllen die tödliche Gefahr, der die gesamte Menschheit durch die kriegerischen Konfrontationen in der Zerfallsperiode des Kapitalismus ausgesetzt ist. Wenn auch ein Dritter Weltkrieg nicht unmittelbar bevorsteht, muss sich die Arbeiterklasse bewusst sein, dass es nur ein einziges Mittel gibt, die Zerstörung der Menschheit durch den Kapitalismus zu verhindern: dieses System muss gestürzt werden.
Wim (29. September)
[i] Hier zeigt sich einmal mehr der Machiavellismus der amerikanischen Bourgeoisie, die 1991 die kurdische Minderheit im Norden und die schiitische im Süden mitten im Golfkrieg zur Rebellion angestiftet hatte und dann, sobald der Aufstand begonnen hatte, in der Operation Wüstensturm zynisch die Nationalgarde von Saddam Hussein, die sich aus Elitetruppen zusammen setzte, bestehen ließ, damit sie diese Minderheiten niederschlagen konnten. In der Folge wurde nach Beendigung des Krieges die Niederschlagung dieser Minderheiten auf ideologischer Ebene von der amerikanischen Bourgeoisie ausgenutzt, um den blutrünstigen Charakter der Herrschaft Saddam Husseins aufzuzeigen und somit im Nachhinein den Golfkrieg und die Errichtung von entmilitarisierten Zonen unter direkter Kontrolle der USA zu rechtfe rtigen, ”um die lokale Bevölkerung zu schützen“.
[ii] s. The Economist, 14. 9. 2000
[iii] Den Vorbehalten namentlich Saudi-Arabiens, wo eine schiitische Beteiligung in einer zukünftigen ”demokratischen“Regierung Missgunst auslöst, ist Rechnung getragen worden. Der Stützpunkt von Al-Charg, der während des Golfkrieges und vor allem im Krieg von Afghanistan in so großem Masse von den amerikanischen Streitkräften benutzt wurde, wird nun demontiert und zu einer im Aufbau begriffenen Basis in Al-Udeid verlegt, an der westkatarischen Küste südlich von Doha, wo sie für die Vereinigten Staaten dieselbe Rolle wie Al-Charg zu spielen hat.
[iv] Nicht ohne eine gute Dosis Heuchelei, da mehrere Hundert deutsche Spezialisten für chemische und biologische Waffen, die dem Irak Zugang zu eben diesen Waffen besorgt hatten, heute als ”technische Berater“in dieser Region im Dienste der Amerikaner präsent sind. Und auch Schröder bemühte sich, nachdem er mit Hilfe seiner offenkundig antiamerikanischen Stellungnahme die Wahlen gewonnen hatte, schon am Tage darauf eiligst darum, Blair einen Besuch abzustatten. Schröder bat diesen, so ein englischer Diplomat, eine Wiederversöhnung mit Washington zu fördern, welches in heftiger Weise seine Verbitterung ausgedrückt hatte. Dies bedeutet allerdings keineswegs, dass die deutsche Bourgeoisie nun beabsichtigen würde, sich hinter die herrschende Klasse der USA zu stellen, sondern lediglich dass sie bevorzugt, wieder zu ihrer alten behutsamen Diplomatie zurückzukehren, die ihr bis jetzt so gut bekommen ist.
[v] Überdies bedingt die durch die Wirtschaftsprobleme Israels ausgelöste wachsende Unzufriedenheit angesichts der enormen Opfer in der Bevölkerung im Strudel der Kriegswirtschaft eine Kluft in der Politik der nationalen Einheit in Israel selbst. Dies zeigt auch der Rücktritt Shlomo Ben Amis, des ehemaligen Arbeitsministers von Yehud Barak, von seinem Abgeordnetenmandat.
[vi] Anhand der politischen Laufbahn Al Gores selbst sind derartige Illusionen zurückzuweisen, da ebendieser 1991 zur damals demokratischen Minderheit gehörte, welche für den Golfkrieg gestimmt hatte.
[vii] Überzeugender Ausdruck dieser wachsenden Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten ist der kürzlich erstattete Besuch des japanischen Premierministers Koizumi in Nordkorea. Dieser herzliche Besuch in einem Land, welches von den Amerikanern zur Achse des Bösen gerechnet wird, bedeutet eine direkte Herausforderung gegenüber den USA.7 Überzeugender Ausdruck dieser wachsenden Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten ist der kürzlich erstattete Besuch des japanischen Premierministers Koizumi in Nordkorea. Dieser herzliche Besuch in einem Land, welches von den Amerikanern zur Achse des Bösen gerechnet wird, bedeutet eine direkte Herausforderung gegenüber den USA.
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [78]
Theoretische Fragen:
- Krieg [27]
Leo Trotzki: „Literatur und Revolution“
- 4647 Aufrufe
Proletarische Kultur und proletarische Kunst?
Jede herrschende Klasse entwickelt ihre eigene Kultur und folglich auch ihre eigene Kunst. Die Geschichte kennt die Kultur der Sklavenhalter des Ostens und der klassischen Antike, die Feudalkultur des europäischen Mittelalters und die bürgerliche Kultur, die zur Zeit die Welt beherrscht. Daraus folgt anscheinend selbstverständlich, dass das Proletariat seine eigene Kultur und seine eigene Kunst schaffen müsste.
Das Problem ist aber bei weitem nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint. Die Gesellschaft, in der die Sklavenhalter herrschten, existierte im Verlaufe von sehr vielen Jahrhunderten. Dasselbe gilt vom Feudalismus. Die bürgerliche Kultur, selbst wenn man sie erst vom Zeitpunkt ihres offenen und stürmischen Auftretens, d. h. von der Renaissancezeit an rechnet, existiert fünf Jahrhunderte, wobei sie ihre volle Blüte erst im 19. Jahrhundert erreichte, eigentlich erst in dessen zweiter Hälfte. Die Bildung einer neuen Kultur um eine herrschende Klasse erfordert, wie die Geschichte zeigt, viel Zeit und erreicht ihren Höhepunkt in einer Epoche, die dem politischen Verfall der Klasse vorausgeht.
Hat denn nun das Proletariat überhaupt genügend Zeit, eine „proletarische“ Kultur zu schaffen? Im Unterschied zum Regime der Sklavenhalter, der Feudalen und der Bourgeoisie betrachtet das Proletariat seine Diktatur als eine kurzfristige Übergangszeit. Wenn wir allzu optimistische Ansichten hinsichtlich des Übergangs zum Sozialismus entlarven wollen, erinnern wir daran, dass die Epoche der sozialen Revolution im Weltmaßstab nicht Monate, sondern Jahre und Jahrzehnte dauern wird – Jahrzehnte, aber nicht Jahrhunderte und schon gar nicht Jahrtausende. Kann denn das Proletariat in dieser Zeit eine neue Kultur entwickeln? Zweifel daran sind um so berechtigter, als die Jahre der sozialen Revolution Jahre eines erbitterten Klassenkampfs sein werden, in denen die Zerstörungen mehr Raum einnehmen werden als der Aufbau einer neuen Kultur. In jedem Falle wird das Proletariat selbst seine Hauptenergie auf die Eroberung der Macht, deren Behauptung, Festigung, deren Anwendung bei der Lösung der allerdringlichsten Daseinsbedürfnisse und auf den weiteren Kampf richten müssen, so dass der Möglichkeit planmäßigen kulturellen Aufbaues sehr enge Grenzen gesetzt sind. Und umgekehrt: Je vollständiger das neue Regime gegen politische und kriegerische Erschütterungen abgesichert sein wird, je günstiger sich die Bedingungen für kulturelles Schaffen gestalten werden, um so mehr wird sich das Proletariat in der sozialistischen Gemeinschaft auflösen, sich von seinen Klassenmerkmalen befreien, das heißt also, nicht mehr Proletariat sein. Mit anderen Worten: In der Epoche der Diktatur kann von der Schaffung einer neuen Kultur, d. h. von einem Aufbau in allergrößtem historischem Maßstab keine Rede sein; und jener mit nichts Früherem vergleichbare kulturelle Aufbau, der einsetzt, wenn die Notwendigkeit der eisernen Klammern der Diktatur entfällt, wird schon keinen Klassencharakter mehr tragen. Hieraus muss man die allgemeine Schlussfolgerung ziehen, dass es eine proletarische Kultur nicht nur nicht gibt, sondern auch nicht geben wird; Und es besteht wahrhaftig keinerlei Veranlassung dazu, dies zu bedauern: Das Proletariat hat ja gerade dazu die Macht ergriffen, um ein für allemal der Klassenkultur ein Ende zu setzen und der Menschheitskultur den Weg zu bahnen. Das scheinen wir nicht selten zu vergessen.
Die formlosen Gespräche über die proletarische Kultur in Analogie und Antithese zur bürgerlichen finden ihren Nährboden in der äußerst unkritischen Gleichsetzung des geschichtlichen Schicksals des Proletariats mit dem der Bourgeoisie. Die oberflächliche, rein liberale Methode der formalen historischen Analogien hat mit Marxismus nichts gemein. Es gibt keine materielle Analogie der historischen Bahnen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse.
Die Entwicklung der bürgerlichen Kultur setzte einige Jahrhunderte früher ein, bevor die Bourgeoisie mit Hilfe einer Reihe von Revolutionen die Staatsgewalt in ihre Hände nahm. Schon als die Bourgeoisie noch ein halb rechtloser dritter Stand war, spielte sie auf allen Gebieten des kulturellen Aufbaues eine große, ständig wachsende Rolle. Das kann man besonders deutlich am Beispiel der Architektur verfolgen. Die gotischen Kirchen sind nicht plötzlich, nicht in einer schlagartigen religiösen Begeisterung erbaut worden. Der Entwurf zum Kölner Dom, seine Architektur und seine Skulptur stellen die Summe von Bauerfahrungen der Menschen dar, die, beginnend mit den Vorrichtungen des Höhlenbewohners, die Elemente dieser Erfahrungen zu einem neuen Stil zusammenfassten, der die Kultur der Epoche, d. h. letzten Endes ihre soziale Struktur und ihre Technik, zum Ausdruck brachte. Die alte, in Zünften und Gilden organisierte Vorbourgeoisie war die tatsächliche Erbauerin der Gotik. Als sich die Bourgeoisie entwickelt und konsolidiert hatte, d. h. als sie reich geworden war und die Gotik schon bewusst und aktiv durchlaufen hatte, schuf sie sich einen eigenen Architekturstil – aber schon nicht mehr für die Kirchen, sondern für ihre eigenen palastartigen Häuser. Sie stützte sich hierbei auf die Errungenschaften der Gotik, wandte sich der Antike, vorwiegend der römischen Architektur zu, benutzte auch die maurische, unterwarf alles dies den Vorbedingungen und Bedürfnissen der neuen städtischen Gemeinschaft und schuf die Renaissance (in Italien gegen Ende des ersten Viertels des XV. Jahrhunderts). Spezialisten mögen nachrechnen – und sie tun es auch – mit welchen ihrer Elemente die Renaissance der Antike verpflichtet ist und mit welchen der Gotik, sowie welche von diesen das Übergewicht haben. Auf jeden Fall beginnt die Renaissance nicht vor dem Augenblick, in dem die neue Gesellschaftsklasse, kulturell gesättigt sich stark genug fühlt, das Joch des gotischen Bogens abzuschütteln und die Gotik sowie alles, was ihr voraufging, als Material zu betrachten und die technischen Elemente der Vergangenheit frei den eigenen künstlerischen Bauzwecken unterzuordnen. Das bezieht sich auch auf alle anderen Künste mit dem Unterschied, daß die „freien“ Künste infolge ihrer größeren Elastizität, d. h. infolge der geringeren Abhängigkeit vom Verwendungszweck und vom Material, die Dialektik der Überwindung und der Aufeinanderfolge der Stile nicht mit einer derartigen steinernen Überzeugungskraft offenbaren.
Zwischen der Renaissance und der Reformation, die zur Aufgabe hatten, der Bourgeoisie günstigere ideelle und politische Existenzbedingungen innerhalb der feudalistischen Gesellschaft zu verschaffen, und der Revolution, die (in Frankreich) der Bourgeoisie die Macht übertrug, vergingen drei bis vier Jahrhunderte, in denen die materielle und ideelle Macht der Bourgeoisie wuchs. Die Epoche der großen Französischen Revolution und der aus ihr entstandenen Kriege lassen das materielle Kulturniveau vorübergehend sinken. Aber danach setzt sich das kapitalistische Regime als „natürlich“ und „ewig“ fest ...
Auf diese Weise wurde der grundlegende Sammlungsprozeß der Elemente der bürgerlichen Kultur und deren Kristallisation zu einem Stil von den sozialen Eigenschaften der Bourgeoisie als der besitzenden Ausbeuterklasse bestimmt: Sie entwickelte sich innerhalb der feudalistischen Gesellschaft nicht nur materiell, war nicht nur mit ihr vielfältig verflochten und zog nicht nur den Reichtum an sich, sondern brachte auch die Intelligenz auf ihre Seite, gründete eigene Kulturstützpunkte (Schulen, Universitäten, Akademien, Zeitungen, Zeitschriften), lange bevor sie sich an der Spitze des dritten Standes offen des Staates bemächtigte. Es genüge, daran zu erinnern, daß die deutsche Bourgeoisie mit ihrer unvergleichlichen technischen, philosophischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Kultur bis zum Jahre 1918 die Macht in den Händen einer feudalbürokratischen Kaste beließ und sich erst dann entschloß, oder richtiger: sich gezwungen sah, die Macht unmittelbar in die eigene Hand zu nehmen, als sich das materielle Gerüst der deutschen Kultur in einen Scherbenhaufen zu verwandeln begann.
Man könnte einwenden: Die Kunst der Sklavenhalter wurde in Jahrtausenden geschaffen, die bürgerliche in Jahrhunderten; warum sollte die proletarische nicht in Jahrzehnten geschaffen werden können? Die technischen Grundlagen des Daseins sind heute ganz andere, und deshalb ist auch das Tempo ein anderes. Dieser scheinbar so überzeugende Einwand geht in Wirklichkeit am Kern der Sache vorbei. Zweifellos tritt in der Entwicklung einer neuen Gesellschaft der Zeitpunkt ein, in dem die Wirtschaft, der kulturelle Aufbau und die Kunst eine äußerst weitgehende Freiheit in ihrer Bewegung nach vorn erhalten. Über das Tempo können wir heute nur Mutmaßungen anstellen. In einer Gesellschaft, die alle beklemmenden und abstumpfenden Sorgen um das tägliche Brot abgeworfen hat, für die in Gemeinschaftsrestaurants gute, bekömmliche, schmackhafte Speisen zubereitet werden in einer alle befriedigenden Auswahl; in der öffentliche Wäschereien gute Wäsche – für alle – gut waschen; in der die Kinder satt, gesund und vergnügt sind – alle Kinder – und die Grundelemente der Wissenschaft verschlingen wie Eiweiß, Luft und Sonnenwärme; in der die Elektrizitätswerke und der Rundfunk nicht mehr so primitiv arbeiten wie heute, sondern wie ein unerschöpflicher Wasserfall zentralisierter Energie, der auf einen Knopfdruck planmäßig reagiert; in der es keine „überflüssigen“ Esser gibt; in der der befreite Egoismus des Menschen – eine gewaltige Kraft! – voll und ganz auf die Erkenntnis, Umgestaltung und Verbesserung des Weltalls gerichtet ist – in einer solchen Gesellschaft wird die Dynamik der kulturellen Entwicklung alles übersteigen, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Aber das wird erst nach dem langen und mühseligen Weg zur Paßhöhe eintreten, der noch vor uns liegt. Wir aber sprechen gerade von der Epoche der Paßbezwingung.
Aber ist denn unsere heutige Zeit nicht dynamisch? In höchstem Grade. Aber ihre Dynamik konzentriert sich auf die Politik. Auch Krieg und Revolution sind dynamisch – aber in ungeheurem Umfange auf Kosten der Technik und der Kultur. Zugegeben, der Krieg hat eine große Reihe technischer Erfindungen mit sich gebracht. Aber das Elend, das er verursachte, hat für lange Zeit deren praktische Anwendung in der Revolutionierung des Seins hinausgeschoben. Dies bezieht sich auf das Radio, die Luftfahrt und auf viele chemische Entdeckungen. Die Revolution schafft ihrerseits die Voraussetzungen für die neue Gesellschaft. Aber sie vollzieht dies mit den Methoden der alten Gesellschaft: mit dem Klassenkampf, mit Gewalt, Ausrottung und Zerstörung. Wenn die proletarische Revolution nicht gekommen wäre, wäre die Menschheit an ihren Widersprüchen erstickt. Der Umsturz rettet die Gesellschaft und die Kultur, aber mit den Methoden der grausamsten Chirurgie. Alle aktiven Kräfte konzentrieren sich in der Politik, im revolutiönaren Kampf – alles übrige rückt in den Hintergrund, und alles, was stört, wird mitleidlos niedergetrampelt. In diesem Prozeß gibt es natürlich eigene, private Ebbe- und Fluterscheinungen: Der Kriegskommunismus wird von der NEP abgelöst, die ihrerseits verschiedene Stadien durchläuft. Aber in ihren Grundzügen ist die Diktatur des Proletariats keine Produktions- und Kulturorganisation der neuen Gesellschaft, sondern ein revolutionäres Kampfregime im Kampf für diese Gesellschaft. Das darf man nicht vergessen. Der Historiker der Zukunft wird, so müßte man denken, die Kulmination der alten Gesellschaft auf den zweiten August 1914 zurückführen, als die tobsüchtig gewordene Macht der bürgerlichen Kultur die ganze Welt in Blut und Feuer des imperialistischen Krieges tauchte. Der Anfang der neuen Geschichte der Menschheit wird wahrscheinlich auf den 7. November 1917 zurückgeführt werden. Die grundlegenden Etappen der Menschheitsentwicklung werden vermutlich etwa folgendermaßen festgelegt werden: außergeschichtliche „Geschichte“ des Urmenschen; antike Geschichte, die sich auf der Sklaverei entwickelte; das Mittelalter – mit der Arbeit der Leibeigenen; der Kapitalismus mit der Lohnausbeutung und schließlich die sozialistische Gesellschaft mit ihrem hoffentlich schmerzlosen Übergang zur obrigkeitslosen Kommune. Auf jeden Fall werden die 20, 30 oder 50 Jahre, die die proletarische Weltrevolution dauern wird, in die Geschichte als äußerst schwieriger Übergang von einer Gesellschaftsordnung zur anderen eingehen, auf keinen Fall aber als selbständige Epoche einer proletarischen Kultur.
Jetzt, in den Jahren einer Atempause, können bei uns in der Sowjetrepublik in dieser Hinsicht Illusionen entstehen. Wir haben die Fragen der kulturellen Betriebsamkeit auf die Tagesordnung gesetzt. Wenn man in Gedanken Linien von unseren heutigen Sorgen auf eine lange Reihe von Jahren hinaus in die Zukunft zieht, dann könnte man sich eine proletarische Kultur zurechtdenken. In Wirklichkeit aber steht unser Kulturbetrieb, so wichtig und lebensnotwendig er ist, immer noch vollkommen im Zeichen der europäischen Revolution und der Weltrevolution. Wir sind nach wie vor Soldaten auf dem Vormarsch. Wir haben nur einen Rasttag. Da muß man sich sein Hemd waschen, die Haare schneiden und kämmen und vor allen Dingen sein Gewehr reinigen und einfetten. Unsere gesamte gegenwärtige wirtschaftlich-kulturelle Arbeit ist nichts anderes als eine Gelegenheit, uns zwischen zwei Schlachten und Feldzügen ein wenig in Ordnung zu bringen. Die Hauptkämpfe stehen uns noch bevor – und sind vielleicht gar nicht mehr so fern. Unsere Epoche ist noch nicht die Epoche einer neuen Kultur, sondern nur ein Vorhof zu ihr. Wir müssen in erster Linie die wichtigsten Elemente der alten Kultur unserem Staat dienstbar machen, und sei es nur, um der neuen den Weg zu bahnen.
Dies wird besonders deutlich, wenn man die Aufgabe, wie es sich auch gehört, in ihrem internationalen Ausmaß betrachtet. Das Proletariat ist die besitzlose Klasse geblieben, die es früher war. Infolgedessen waren die Grenzen für ihren Anschluß an die Elemente der bürgerlichen Kultur, die für immer zum Inventar der Menschheit geworden sind, sehr eng gesetzt. In einem gewissen Sinne kann man zwar sagen, daß auch das Proletariat, mindestens das europäische, seine eigene Epoche der Reformation hatte, vorwiegend in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als es, ohne schon direkt nach der Staatsmacht zu greifen, sich günstigere rechtliche Voraussetzungen für seine Entwicklung innerhalb des bürgerlichen Regimes erobert hatte. Aber erstens hat die Geschichte der Arbeiterklasse für diese „Reformationszeit“ (des Parlamentarismus und sozialer Reformen), die zum größten Teil mit der Periode der II. Internationale zusammenfiel, etwa so viele Jahrzehnte bewilligt wie der Bourgeoisie Jahrhunderte. Zweitens wurde das Proletariat in dieser Vorbereitungsperiode keinesfalls eine reichere Klasse, und es hat auch keine Macht in seiner Hand konzentriert – im Gegenteil, vom sozialen und kulturellen Standpunkt verelendete es immer mehr. Die Bourgeoisie kam zur Macht, voll ausgerüstet mit den kulturellen Möglichkeiten ihrer Zeit; das Proletariat jedoch kommt an die Macht, voll ausgerüstet mit dem dringenden Bedürfnis, sich der Kultur zu bemächtigen. Die Aufgabe des Proletariats, das die Macht erobert hat, besteht vor allen Dingen darin, den ihm vorher nicht dienstbar gewesenen Kulturapparat – die Industrie, die Schulen, Verlage, die Presse, die Theater u. a. m. in die Hand zu bekommen und sich dadurch den Weg zur Kultur freizumachen.
Bei uns in Rußland wird diese Aufgabe noch erschwert durch die Armut unserer gesamten Kulturtradition und durch die materiell so vernichtenden Ereignisse des letzten Jahrzehnts. Nach der Eroberung der Macht und nach fast sechs Jahren des Kampfes um ihre Erhaltung und Konsolidierung ist unser Proletariat gezwungen, alle seine Kräfte auf die Schaffung der elementarsten materiellen Voraussetzungen für die Existenz und auf die Aneignung des Alphabets im wahren, buchstäblichen Sinn des Wortes zu richten. Nicht umsonst haben wir uns die Aufgabe gestellt, zum zehnjährigen Jubiläum der Sowjetmacht das Analphabetentum zu liquidieren.
Irgend jemand mag vielleicht einwenden, daß ich den Begriff der proletarischen Kultur zu weit fasse. Eine voll entfaltete Kultur des Proletariats wird es tatsächlich nicht geben, aber immerhin wird es der Arbeiterklasse, bevor sie sich in der kommunistischen Gesellschaft auflöst, gelingen, der Kultur ihren Stempel aufzudrücken. Einen derartigen Einwand müßte man in erster Linie als eine schwerwiegende Abweichung von den Positionen der proletarischen Kultur registrieren. Es ist nicht zu bezweifeln, daß das Proletariat während seiner Diktatur der Kultur ihren eigenen Stempel aufdrücken wird. Aber von da bis zur proletarischen Kultur ist es noch sehr weit, wenn man sie als ein entfaltetes und innerlich harmonisiertes System von Kenntnissen und Fertigkeiten auf allen Gebieten des materiellen und geistigen Schaffens auffaßt. Die Tatsache, daß Dutzende Millionen von Menschen zum ersten Male die Kunst des Lesens und Schreibens und die vier Grundrechenarten erlernen, wird allein schon zu einem neuen Kulturfaktor werden, und zwar zu einem ungeheuren. Die neue Kultur wird ja ihrem ganzen Wesen nach keine aristokratische sein, für eine privilegierte Minderheit, sondern eine allgemeine, für die Massen und das Volk bestimmte. Die Quantität wird auch hier in Qualität umschlagen: Zugleich mit der zunehmenden Massenverbreitung der Kultur wird sich ihr Niveau heben und ihr ganzes Aussehen verändern. Aber dieser Prozeß wird sich erst in einer Reihe von historischen Etappen entwickeln. Nach Maßgabe der Erfolge wird die Klassenbindung des Proletariats schwächer werden und folglich auch der Boden für eine proletarische Kultur schwinden.
Aber die Spitzen der Klasse? Ihre geistige Avantgarde? Kann man denn nicht sagen, daß sich in dieser, wenn auch dünnen Schicht jetzt schon die Entwicklung einer proletarischen Kultur vollzieht? Haben wir denn nicht eine sozialistische Akademie? Rote Professoren? Mit einer solchen, sehr abstrakten Fragestellung begeht man einen groben Fehler. Man faßt die Sache so auf, als ließe sich die proletarische Kultur im Laboratoriumsverfahren entwickeln. In Wirklichkeit bildet sich das Grundgewebe der Kultur auf der Basis der wechselseitigen Beziehungen und der gegenseitigen Einflußnahme zwischen der Intelligenz der Klasse und der Klasse selbst. Die bürgerliche Kultur – die technische, politische, philosophische und künstlerische – wurde im Zusammenwirken der Bourgeoisie mit ihren Erfindern, Führern, Denkern und Dichtern geschaffen. Der Leser schuf den Schriftsteller und der Schriftsteller – den Leser. In unvergleichlich größerem Umfang muß dies für das Proletariat gelten, weil seine Wirtschaft, Politik und Kultur nur auf der schöpferischen Selbständigkeit der Massen aufgebaut werden kann. Die Hauptaufgabe der proletarischen Intelligenz ist in den nächsten Jahren allerdings nicht eine Abstraktion der neuen Kultur – solange für sie noch nicht einmal das Fundament gelegt ist – sondern eine äußerst konkrete kulturelle Betätigung, d. h. die systematische, planmäßige und, natürlich, kritische Weitergabe der notwendigsten Elemente der Kultur, die schon da ist, an die zurückgebliebenen Massen. Man darf die Kultur einer Klasse nicht hinter ihrem Rücken entwickeln. Um sie aber gemeinsam mit der Klasse – in enger Anpassung an ihren allgemeinen historischen Aufstieg - aufzubauen, ist es notwendig, den Sozialismus zu verwirklichen, wenn auch nur ins Unreine. Auf dem Wege dahin werden die Klassenmerkmale der Gesellschaft nicht verschärft, sondern im Gegenteil – sie werden verschwommener, lösen sich direkt proportional den Erfolgen der Revolution in nichts auf. Der befreiende Sinn der Diktatur des Proletariats besteht ja gerade darin, daß diese nur eine vorübergehende, kurzfristige Erscheinung ist – ein Mittel, den Weg freizumachen, den Grundstein zu legen für eine klassenlose Gesellschaft und die Solidarität der gegründeten Kultur.
Um den Sinn der kulturschaffenden Periode in der Entwicklung der Arbeiterklasse konkreter zu erklären, nehmen wir die historische Reihenfolge nicht der Klassen, sondern der Generationen. Ihre Kontinuität liegt darin, daß jede der Generationen ihren Beitrag zu der bisher von früheren Generationen angesammelten Kultur in ihrer Entwicklung und nicht im Zustand des Verfalles leistet. Doch bevor sie dieses tut, muß die neue Generation durch eine Lehre gehen. Sie erfaßt die vorhandene Kultur und gestaltet sie nach ihrer Art um, die sich mehr oder weniger von der Art der älteren Generation unterscheidet. Diese Aneignung ist noch nichts Schöpferisches, d. h. es werden noch keine neuen kulturellen Werte geschaffen, sondern nur die Voraussetzung dafür. Das Gesagte kann auch – in gewissen Grenzen – auf das Schicksal der sich zu historischem Schöpfertum erhebenden Massen der Werktätigen übertragen werden. Man muß nur hinzufügen, daß das Proletariat, sobald es das Stadium der kulturellen Lehrzeit verläßt, aufhört, Proletariat zu sein. Wollen wir noch einmal daran erinnern, daß die bürgerliche Spitze des dritten Standes ihre kulturelle Lehrzeit unter dem Dach der feudalen Gesellschaft durchgemacht hat; bereits in deren Schoß hat sie die alten herrschenden Stände kulturell überflügelt und ist zu einem Motor der Kultur geworden, bevor sie zur Macht gelangte. Mit dem Proletariat überhaupt, und dem russischen im besonderen, verhält es sich genau umgekehrt: Es ist gezwungen, die Macht zu ergreifen, bevor es sich die Grundelemente der bürgerlichen Kultur angeeignet hat; es ist gezwungen, die bürgerliche Gesellschaft gerade deshalb mit revolutionärer Gewalt zu stürzen, weil diese ihm keinen Zutritt zur Kultur gewährt. Ihren Staatsapparat sucht die Arbeiterklasse in eine mächtige Pumpe zu verwandeln, um den Durst der Volksmassen nach Kultur zu stillen. Das ist eine Arbeit von immenser historischer Wichtigkeit. Aber das ist, wenn man nicht leichtfertig mit Worten spielt, noch nicht die Schaffung einer besonderen proletarischen Kultur. Unter der Bezeichnung „proletarische Kultur“, „proletarische Kunst“ u. a. m. figurieren bei uns kritiklos in drei von etwa zehn Fällen die Kultur und die Kunst der kommenden kommunistischen Gesellschaft, in zwei Fällen von zehn – die tatsächliche Aneignung einzelner Elemente der vorproletarischen Kultur durch einzelne Gruppen des Proletariats, und schließlich herrscht in fünf von zehn Fällen – eine derartige Verwirrung von Begriffen und Wörtern, daß man sich darin überhaupt nicht mehr zurechtfinden kann.
Nachstehend ein frisches Beispiel – eines von hundert – einer liederlichen, unkritischen und gefährlichen Verwendung des Begriffs „proletarische Kultur“: „Die wirtschaftliche Basis und das entsprechende System des Überbaues“, schreibt Genosse Sisow, „stellen die kulturelle Charakteristik einer Epoche dar (feudal, bürgerlich, proletarisch).“ Auf diese Art und Weise wird die Epoche der proletarischen Kultur in demselben Sinn wie die bürgerliche aufgefaßt. Aber das, was hier als proletarische Epoche bezeichnet wird, ist nur eine kurze Übergangszeit von einer Gesellschaftsform zur anderen: vom Kapitalismus zum Sozialismus. Der Erreichung des bürgerlichen Systems ist ebenfalls eine Übergangsperiode voraufgegangen, aber im Gegensatz zur bürgerlichen Revolution, die, nicht ohne Erfolg, danach strebte, die Herrschaft der Bourgeoisie zu verewigen, hat die proletarische Revolution zum Ziel, die Existenz des Proletariats als Klasse in einer möglichst kurzen Zeit zu liquidieren.
Die Dauer dieser Zeit hängt unmittelbar von den Erfolgen der Revolution ab. Ist es nicht geradezu ungeheuerlich, diese Tatsache zu vergessen und die proletarische Epoche mit der feudalen und bürgerlichen in eine Reihe zu stellen?
Wenn dem aber so ist, folgt dann daraus, daß wir auch keine proletarische Wissenschaft haben? Können wir denn nicht tatsächlich behaupten, daß die Theorie des historischen Materialismus und die Kritik von Marx an der politischen Ökonomie unschätzbare wissenschaftliche Elemente der proletarischen Kultur sind?
Natürlich ist die Bedeutung des historischen Materialismus und der Mehrwerttheorie unermeßlich groß, sowohl für die klassenmäßige Ausrüstung des Proletariats wie auch für die Wissenschaft überhaupt. Im „Kommunistischen Manifest“ allein schon gibt es mehr echte Wissenschaft als in ganzen Bibliotheken historischer und historisch-philosophischer professoraler Kompilationen, Spekulationen und Falsifikationen. Kann man aber sagen, daß der Marxismus an sich ein Produkt der proletarischen Kultur sei? Und kann man denn behaupten, daß wir uns tatsächlich schon des Marxismus – nicht nur für politische Kampfaufgaben, sondern auch für umfangreiche wissenschaftliche Aufgaben bedienen?
Marx und Engels sind aus der kleinbürgerlichen Demokratie hervorgegangen und sind selbstverständlich in deren Kultur und nicht in einer Kultur des Proletariats erzogen worden. Wenn es nicht die Arbeiterklasse mit ihren Streiks, ihrem Kampf, ihren Leiden und Aufständen gegeben hätte, dann hätte es natürlich auch keinen wissenschaftlichen Kommunismus gegeben, weil dann dazu keine historische Notwendigkeit bestanden hätte. Das zusammenfassende Denken der bourgeoisen Demokratie erhebt sich in Gestalt ihrer kühnsten, ehrlichsten und weitblickendsten Vertreter – getrieben von den kapitalistischen Widersprüchen – bis zur genialen Selbstverleugnung, ausgerüstet mit dem ganzen kritischen Arsenal, das dank der Entwicklung der bourgeoisen Wissenschaft zur Verfügung stand. Das ist die Herkunft des Marxismus.
Das Proletariat fand im Marxismus nicht sofort seine Methode und hat sie bis zum heutigen Tage bei weitem nicht völlig gefunden. Diese Methode dient heute vorwiegend – fast ausschließlich – politischen Zielen. Eine breite erkenntnismäßige Anwendung und methodologische Entwicklung des dialektischen Materialismus liegt noch völlig in der Zukunft. Nur in einer sozialistischen Gesellschaft wird der Marxismus aus einer einseitigen Waffe des politischen Kampfes zu einer Methode des wissenschaftlichen Schaffens, zum wichtigsten Element und Instrument der geistigen Kultur.
Daß die gesamte Wissenschaft in mehr oder weniger großem Umfang die Tendenzen der herrschenden Klasse wiedergibt, steht fest. Je näher eine Wissenschaft den wirklichen Problemen der Meisterung der Natur (Physik, Chemie, Naturwissenschaften) überhaupt steht, um so größer ist ihr nicht klassenbedingter, allgemein menschlicher Beitrag. Je enger eine Wissenschaft mit der sozialen Mechanik der Ausbeutung (politische Ökonomie) verstrickt ist, oder je abstrakter sie die gesamte menschliche Erfahrung verallgemeinert (Psychologie nicht im experimentellphysiologischen, sondern im sogenannten „philosophischen“ Sinn), um so mehr ist sie dem Klasseneigennutz der Bourgeoisie unterworfen, um so nichtiger ihr Beitrag zur Gesamtsumme des menschlichen Wissens. Auf dem Gebiet der experimentellen Wissenschaften gibt es ebenfalls verschiedene Stufen der wissenschaftlichen Gewissenhaftigkeit und Objektivität, die von der Großzügigkeit der Schlußfolgerungen abhängt. In der Regel richten sich die bürgerlichen Tendenzen am ungezwungensten in den Gipfelsphären der methodologischen Philosophie, der „Weltanschauung“ ein. Deshalb ist eine Säuberung des wissenschaftlichen Gebäudes von unten bis oben oder richtiger von oben bis unten erforderlich, denn man muß in den obersten Etagen anfangen. Aber es wäre naiv anzunehmen, daß das Proletariat, bevor es die von der Bourgeoisie ererbte Wissenschaft für den sozialistischen Aufbau anwendet, diese in ihrer Gesamtheit kritisch überarbeiten müsse. Das ist fast dasselbe, als wenn man mit den Moralisten und Utopisten erklären würde: vor dem Aufbau einer neuen Gesellschaft müsse sich das Proletariat auf die Höhe der kommunistischen Moral erheben. In Wirklichkeit wird das Proletariat die Moral wie auch die Wissenschaft erst dann radikal umbauen, wenn es, und sei es erst im Rohbau, eine neue Gesellschaft aufgebaut hat. Aber geraten wir da nicht in einen Teufelskreis? Wie soll man eine neue Gesellschaft mit Hilfe der alten Wissenschaft und der alten Moral aufbauen? Hier muß man nun schon ein wenig Dialektik zu Hilfe nehmen, dieselbe, die man bei uns so verschwenderisch sowohl in die lyrische Poesie wie in den Kanzleibetrieb in die Kohlsuppe wie in die Buchweizengrütze[i] hineinstopft. Gewisse Stützpunkte und gewisse wissenschaftliche Methoden, welche das Bewußtsein von dem ideellen Joch der Bourgeoisie befreien, braucht die proletarische Avantgarde, um an die Arbeit gehen zu können; sie erkämpft sie sich und hat sie sich teilweise schon erkämpft. Ihre grundlegende Methode hat sie unter verschiedenen Umständen in vielen Kämpfen erprobt. Aber von da bis zur proletarischen Wissenschaft ist es noch sehr weit. Die revolutionäre Klasse wird den Ablauf ihres Kampfes nicht verlangsamen, nur weil ihre Partei noch nicht entschieden hat, ob die Hypothese von den Elektronen und Ionen, die psychoanalytische Theorie Freuds, die Homogenese der Biologen, die neuen mathematischen Relativitätsoffenbarungen u. a. m. zu akzeptieren sind oder nicht. Nach der Eroberung der Macht erhält das Proletariat allerdings bedeutend größere Möglichkeiten, sich der Wissenschaft zu bemächtigen und sie zu revidieren. Aber auch dies ist schneller gesagt als getan. Das Proletariat vertagt keineswegs seinen sozialistischen Aufbau, bis seine neuen Gelehrten, von denen viele noch in kurzen Höschen herumlaufen, alle Instrumente und Kanäle der Erkenntnis überprüft und gereinigt haben werden. Das Proletariat wirft das unverkennbar Unnötige, Falsche und Reaktionäre ab und benutzt auf den verschiedenen Gebieten seines Aufbaus die Methoden und Resultate der gegenwärtigen Wissenschaft, wobei es je nach Notwendigkeit einen gewissen Prozentsatz in ihr enthaltener reaktionärer Klassenligatur mit in Kauf nimmt. Das praktische Ergebnis rechtfertigt sich im großen und ganzen selbst, denn die unter die Kontrolle der sozialistischen Zielsetzung gestellte Praxis wird allmählich die Theorie, ihre Methoden und Ergebnisse kontrollieren und auswählen. Inzwischen werden auch die unter den neuen Verhältnissen erzogenen Gelehrten herangewachsen sein. Auf jeden Fall muß das Proletariat seinen sozialistischen Aufbau bis zu einer recht bedeutenden Höhe führen, d. h. bis zu einer tatsächlichen materiellen Sicherstellung und kulturellen Sättigung der Gesellschaft, bevor eine Generalreinigung der Wissenschaft von oben bis unten durchgeführt werden kann. Damit will ich gar nichts gegen jene marxistische kritische Arbeit sagen, die bereits in Form von Zirkeln oder von Seminaren auf verschiedenen Gebieten durchgeführt wird oder um deren Durchführung man sich bemüht. Diese Arbeit ist notwendig und fruchtbar. Man muß sie in jeder Weise erweitern und vertiefen. Aber man muß auch das marxistische Augenmaß bei der Bewertung des gegenwärtigen spezifischen Gewichts derartiger Experimente und Versuche im Gesamtmaßstab unserer historischen Tätigkeit bewahren.
Schließt denn aber das Gesagte die Möglichkeit aus, daß aus den Reihen des Proletariats hervorragende Gelehrte, Erfinder, Dramaturgen oder Dichter schon in der Periode der revolutionären Diktatur erscheinen können? Keineswegs, es wäre aber äußerst oberflächlich, Leistungen, und wären sie noch so wertvoll, schon als proletarische Kultur zu bezeichnen, weil sie von Personen vollbracht wurden, die aus dem Arbeitermilieu stammen. Man darf den Begriff Kultur nicht in kleine Münzen individueller Alltagsbedürfnisse verzetteln und die Erfolge einer Kultur, einer Klasse, nicht nach den proletarischen Pässen einzelner Erfinder und Dichter beurteilen. Die Kultur ist ein organisches Ganzes von Wissen und Können, die die ganze Gesellschaft oder mindestens deren herrschende Klasse charakterisiert. Sie umfaßt und durchdringt alle Gebiete menschlicher schöpferischer Tätigkeit, indem sie diese in ein einheitliches System bringt. Individuelle Errungenschaften wachsen über dieses Niveau hinaus und heben es nach und nach.
Gibt es diese organische Wechselbeziehung zwischen unserer heutigen proletarischen Dichtkunst und dem kulturellen Schaffen der Arbeiterklasse im ganzen? Es ist vollkommen offensichtlich, daß es sie nicht gibt. Einzelne Arbeiter oder Gruppen wenden sich jener Kunst zu, die von den bürgerlichen Intelligenzlern geschaffen wurde, und benutzen deren Technik vorläufig noch ziemlich eklektisch. Doch wohl dazu, um ihre eigene, innere proletarische Welt auszudrücken? Das ist es eben, daß dem bei weitem nicht so ist. Dem Schaffen proletarischer Dichter fehlt das Organische, das allein durch ein tiefgehendes inneres Zusammenwirken der Kunst und durch den Stand und die Entwicklung der Kultur als Ganzes erreichbar ist. Das sind literarische Werke begabter oder talentierter Proletarier, jedoch keine proletarische Literatur. Aber ist das vielleicht eine ihrer Quellen ?
Selbstverständlich werden sich in der Arbeit heutiger Generationen viele Keime, Triebe und Quellen finden lassen, von denen aus ein ferner geschäftiger Nachfahre Verbindungslinien zu verschiedenen Sektoren der zukünftigen Kultur wird ziehen können, ähnlich wie die heutigen Kunsthistoriker Verbindungslinien von den Kirchenmysterien zum Theater Ibsens oder von der Malerei der Mönche – zum Impressionismus und Kubismus ziehen. Im Haushalt der Kunst wie auch im Haushalt der Natur geht nichts verloren, und alles ist mit allem verbunden.
Aber faktisch, konkret, lebensfähig entwickelt sich das heutige Schaffen der Dichter, die aus dem Proletariat stammen, bei weitem noch nicht auf der Ebene, auf der sich der Prozeß der Vorbereitung der Voraussetzungen für die künftige sozialistische Kultur bewegt: ein Prozeß, der die Massen in Bewegung bringt
Leo Trotzki
[i] Ein uralter Volksspruch: Kohlsuppe und Grütze sind unsere Nahrung
Theoretische Fragen:
- Kultur [107]
„Volksaufstand“ in Argentinien
- 3401 Aufrufe
Nur das Proletariat auf seinem Klassenterrain kann die Bourgeoisie zurückdrängen
Die Ereignisse in Argentinien zwischen dem Dezember 2001 und dem Februar 2002 haben großes Interesse unter den politisch bewussten Elementen überall auf der Welt geweckt. Sie haben unter kämpferischen Arbeitern am Arbeitsplatz Diskussionen und Nachdenken ausgelöst. Einige trotzkistische Gruppen haben sogar vom „Beginn der Revolution“ gesprochen.
Unter den Linkskommunisten hat das IBRP (Internationale Büro für die revolutionäre Partei) mehrere Artikel diesen Ereignissen gewidmet und eine Deklaration veröffentlicht, derzufolge in „Argentinien (...) die verheerende Wirtschaftskrise eine machtvolle und entschlossene proletarische Bewegung auf einem Klassenterrain und in Selbstorganisation belebt (hat), die einen Bruch zwischen den Klassen ausdrückt“.[i]
Das Interesse, das die sozialen Erhebungen in Argentinien weckten, ist verständlich und völlig legitim. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 hat die internationale Lage keinerlei proletarische Massenbewegungen mit denselben Ausmaßen wie die Streikbewegung in Polen 1980 oder die Kämpfe im argentinischen Cordoba 1969 mehr erlebt. Die Bühne des Weltgeschehens wurde von Kriegen (der Golfkrieg 1991, Jugoslawien, Afghanistan, Nahost ...) dominiert, von den noch verheerenderen Auswirkungen der fortschreitenden Weltwirtschaftskrise (Massenentlassungen, Arbeitslosigkeit, sinkende Löhne und Renten) und von den verschiedenen Ausdrücken des kapitalistischen Zerfalls (Umweltzerstörung, Häufung von „natürlichen“ und „zufälligen“ Katastrophen, die Entwicklung von religiösem und sozialem Fanatismus, Kriminalität etc.).
Diese Situation – deren Ursachen wir bereits im Detail analysiert haben[ii] – ist ein Grund, warum politisierte Elemente den Ereignissen in Argentinien, die einen Bruch in dieser ununterbrochenen Folge von „schlechten Neuigkeiten“ zu markieren scheinen, so große Aufmerksamkeit schenken: In Argentinien haben Straßenproteste ein bisher nie dagewesenes Bäumchen-wechsle-dich-Spiel der Präsidenten verursacht (fünf in 15 Tagen) und dabei die Form von „selbstorganisierten“ Nachbarschafts-Versammlungen angenommen, die lautstark „alle Politiker“ ablehnen.
Revolutionäre haben die Pflicht, solche gesellschaftlichen Bewegung genau zu verfolgen, um Stellung zu beziehen und zu intervenieren, wo immer die arbeitende Klasse einen Ausdruck findet. Es trifft sicherlich zu, dass die Arbeiter an der Welle der Mobilisierung in Argentinien teilgenommen haben und dass in einigen isolierten Kämpfen klare Klassenforderungen formuliert wurden sowie das offizielle Gewerkschaftstum konfrontiert wurde. Wir erklären uns solidarisch mit diesen Auseinandersetzungen, doch der beste Beitrag, den wir als eine revolutionäre Organisation leisten können, besteht darin, die Ereignisse so klar wie möglich zu analysieren. Diese Klarheit entscheidet über die Fähigkeit revolutionärer Organisationen, adäquat zu intervenieren und dabei den historischen und internationalen Rahmen zu berücksichtigen, der von der marxistischen Methode definiert wird. Das Schlimmste, was die Vorhutorganisationen des Proletariats tun können, wäre, Illusionen innerhalb der Arbeiterklasse zu streuen, indem sie ihre Schwächen stark redet und ihre Niederlagen mit Siegen verwechselt. Weit entfernt davon, dem Proletariat zu helfen, die Initiative zu erringen, seine Kämpfe auf seinem eigenen Terrain weiterzuentwickeln und sich selbst als einzige gesellschaftliche Kraft in totalem Gegensatz zum Kapitalismus zu behaupten, würde dies eine solche Wiederbelebung weitaus schwieriger gestalten.
Von dieser Perspektive aus betrachtet, heißt die Frage, die wir uns selbst zu stellen haben: Worin besteht die Klassennatur der Ereignisse in Argentinien? Handelt es sich um eine Bewegung, in der das Proletariat seine „Selbstorganisation“ und seinen „Bruch“ mit dem Kapitalismus vollziehen kann, wie das IBRP sagt? Unsere Antwort kann nur lauten: NEIN. Das Proletariat in Argentinien ist von einer Bewegung der Klassen übergreifenden Revolte durchtränkt und verwässert worden, einer Bewegung des Volksprotestes, die nicht die Stärke des Proletariats, sondern seine Schwäche ausdrückt. Die Klasse ist nicht imstande gewesen, sowohl ihre Autonomie als auch ihre Selbstorganisation zu behaupten.
Das Proletariat hat kein Bedürfnis, sich mit Illusionen abzufinden und sich krampfhaft an sie zu klammern. Was es benötigt, ist, den Faden seiner eigenen revolutionären Perspektiven wieder aufzunehmen, sich selbst auf der gesellschaftlichen Bühne als die einzige Klasse zu behaupten, die in der Lage ist, der Menschheit eine Zukunft anzubieten und dabei die anderen nicht-ausbeutenden Gesellschaftsschichten mit sich zu ziehen. Dabei muss das Proletariat der Realität ins Gesicht schauen und darf nicht Angst vor ihr haben. Um sein Klassenbewusstsein weiterzuentwickeln und um seinen Kampf den auf dem Spiel stehenden Schicksalsfragen anzupassen, darf es nicht mit der schonungslosesten Kritik an seinen eigenen Schwächen und Fehlern, mit einem gründlichen Nachdenken über die Schwierigkeiten geizen, denen es auf seinem Weg begegn et. Die Ereignisse in Argentinien werden dem Weltproletariat – und dem Proletariat in Argentinien, dessen Kampffähigkeit noch lange nicht erschöpft ist – als eine klare Lektion dienen: Klassen übergreifende Revolten schwächen nicht die Macht der Bourgeoisie, sondern das Proletariat.
Der Zusammenbruch der argentinischen Wirtschaft ist eine deutliche Manifestation der sich verschlimmernden Krise.
Wir wollen uns hier nicht auf eine detaillierte Analyse der Wirtschaftskrise in Argentinien einlassen. Wir verweisen unsere Leser auf unsere territoriale Presse. (s. insbesondere Weltrevolution, Nr. 110 und 111)Von besonderer Bedeutung in dieser Situation ist der brutale Anstieg der Arbeitslosigkeit von 7% im Jahr 1992 auf 17% im Oktober 2001 und schließlich auf 30% im Verlauf nur eines Monats (Dezember 2001) sowie – zum ersten Mal seit der spanischen Kolonialära – das Auftreten von Hunger, und das in einem Land, das bis vor kurzem noch als dem „europäischen Niveau“ sehr nahestehend galt und dessen hauptsächliche Produkte ausgerechnet Fleisch und Weizen sind.
Weit entfernt davon, ein lokales Phänomen zu sein, das durch Korruption oder den Wunsch, „wie Europäer zu leben“, verursacht worden ist, ist die argentinische Krise eine neue Episode in der Verschärfung der kapitalistischen Wirtschaftskrise. Diese Krise ist weltweit und betrifft alle Länder. Doch bedeutet dies nicht, dass sie alle von ihnen in derselben Weise oder in demselben Ausmaß betrifft. „Obwohl sie kein Land ausspart, wirkt sich die Weltkrise am verheerendsten nicht in den mächtigsten, hochentwickelten Ländern aus, sondern in den Ländern, die zu spät die weltwirtschaftliche Arena betreten haben und denen der Weg zur Weiterentwicklung von den alten Mächten endgültig versperrt worden war.“ („The proletariat of Western Europe in the centre of the generalisation of the class struggle“, International Review Nr. 31, engl./frz./span.) Darüber hinaus haben die mächtigsten Länder angesichts der sich verschlimmernden Krise Maßnahmen ergriffen, um sich gegen sie zur Wehr zu setzen und sie auf die schwächsten Länder abzuwälzen („Liberalisierung“ des Welthandels, „Globalisierung“ von Finanztransaktionen, Investitionen in den Schlüsselsektoren der schwächsten Länder auf dem Weg der Privatisierungen, die Politik des IWF, etc. – d. h. all das, was „Globalisierung“ genannt wird). Es handelt sich hier um nichts anderes als die durch die größten Länder erzwungene Anwendung einer ganzen Reihe von staatskapitalistischen Maßnahmen auf die gesamte Weltwirtschaft, was den Zweck verfolgt, sich selbst vor der Krise zu schützen und zu ermöglichen, die schlimmsten Auswirkungen auf die Schwächsten abzulenken (s. „Bericht über die Wirtschaftskrise“ in Internationale Revue Nr. 28). Die von der Weltbank gelieferten Zahlen (World Development Indicators 2001) sind in diesem Zusammenhang vielsagend: Zwischen 1980 und 2000 erhielten private Kreditgeber von den lateinamerikanischen Ländern 192 Milliarden Dollar mehr zurück, als sie ihnen geliehen hatten, während 1999–2002, also in nur zwei Jahren, diese Differenz nicht weniger als 86,2 Milliarden Dollar betrug, das heißt, nahezu die Hälfte des Betrages der 20 Jahre zuvor. Der IWF seinerseits bewilligte zwischen 1980 und 2000 diesen Ländern Kredite in Höhe von 71,3 Milliarden Dollar, während diese Länder in der gleichen Periode 87,7 Milliarden Dollar zurückzahlten!
Und die Situation in Argentinien ist nur die Spitze des Eisberges. Hinter Argentinien gibt es weitere Länder, die, aus verschiedenen Gründen (Erdölfelder, strategische Position, etc.) genauso wichtig, potenzielle Kandidaten für den nächsten ökonomischen und politischen Kollaps sind: Venezuela, Türkei, Mexiko, Brasilien, Saudiarabien ...
Eine autonome proletarische Bewegung oder eine blinde, chaotische, Klassen übergreifende Revolte?
Wie das IBRP in seiner italienischen Zeitschrift kurz und bündig feststellte, antwortet der Kapitalismus auf Hunger mit noch mehr Hunger. Es machte ebenfalls klar, dass die vielfältigen „wirtschaftlichen Lösungen“, die von den Regierungen, der Opposition oder „alternativen Bewegungen“ wie das Sozialforum von Porto Alegre vorgeschlagen werden, keine Alternative anbieten. Dieses raffinierte Gebräu der Demagogen ist nach und nach von den Tatsachen der jetzt 30 Jahre dauernden Krise diskreditiert worden (s. den „Bericht über die Wirtschaftskrise“ in der Internationalen Revue Nr. 28 und „30 Jahre offene Wirtschaftskrise des Kapitalismus“ in der Internationalen Revue, Nrn. 24–26). Es zieht daher die richtige Schlussfolgerung, dass es „nutzlos ist, sich selbst etwas vorzumachen: Auf dieser Stufe der Krise hat der Kapitalismus nichts anderes anzubieten als allgemeine Armut und Krieg. Nur das Proletariat kann diesen tragischen Kurs aufhalten.“ (IBRP-Website, oben zitiert)
Und dennoch schätzt das IBRP die Protestbewegung in Argentinien wie folgt ein:
“Spontan gingen Proletarier raus auf die Straßen und zogen junge Leute, Studenten und wesentliche Bereiche des proletarisierten Kleinbürgertums mit sich, die wie sie selbst pauperisiert waren. Gemeinsam richteten sie ihren Ärger gegen die kapitalistischen Heiligtümer: all die Supermärkte und Geschäfte im Allgemeinen, die wie die Bäckereien im Gefolge vorsintflutlicher Brotrevolten angegriffen wurden. In der Hoffnung, die Rebellen einzuschüchtern, fand die Regierung keine bessere Antwort, als eine brutale Repression anzuzetteln, die in Dutzenden von Toten und Tausenden von Verletzten mündete. Die Revolution wurde jedoch nicht ausgelöscht, sondern verbreitete sich stattdessen auf den Rest des Landes und begann in wachsendem Maße einen Klassencharakter anzunehmen.“
Wir können drei Komponenten in der sozialen Bewegung Argentiniens unterscheiden:
– Zuerst die Angriffe auf die Supermärkte, die im Wesentlichen von Randschichten, Verlumpten und auch von den jungen Arbeitslosen ausgeführt wurden. Diese Bewegungen sind von der Polizei, privatem Wachschutz und den Ladeninhabern grausam unterdrückt worden. In mehreren Fällen sind sie ausgeartet in Wohnungseinbrüchen in armen Wohngegenden und in der Ausplünderung von Büros, Warenhäuser, etc.[iii] Die Hauptkonsequenz aus dieser „ersten Komponente“ der sozialen Bewegung waren tragische Konfrontationen unter Arbeitern gewesen, wie dies durch die blutige Konfrontation zwischen den piqueteros, die sich Nahrungsmittel aneignen wollten, und Arbeitern der Läden des Zentralmarkts von Buenos Aires am 11. Januar verdeutlicht wurde (s. dazu Weltrevolution Nr. 111). Für die IKS ist dieser Gewaltausbruch innerhalb der Arbeiterklasse (eine Veranschaulichung der Methoden, die den verlumpten Schichten des Proletariats eigen sind) ein Ausdruck ihrer Schwäche, nicht ihrer Stärke. Diese gewaltsamen Konfrontationen zwischen verschiedenen Teilen der Arbeiterklasse sind ein Hindernis für ihre Einheit und können nur den Interessen der herrschenden Klasse dienen.
– Die zweite Komponente war die Bewegung der cacerolas (Kochtopfschläger) gewesen. Diese setzte sich vornehmlich aus den „Mittelklassen“ zusammen, die wegen der Beschlagnahme und Abwertung ihrer Ersparnisse im so genannten „kleinen Bankurlaub“ (dem corralito) aufgebracht waren. Diese Schichten sind in einer verzweifelten Situation. „In Argentinien wird die Armut mit hoher Arbeitslosigkeit kombiniert, in die die ‚neuen Armen‘, Ex-Angehörige der Mittelklassen, infolge der zerfallenden gesellschaftlichen Mobilität fallen; die Umkehrung der Immigrationswelle in das Land zu Beginn des 20. Jahrhunderts“ (aus einer Website, die Zusammenfassungen der argentinischen Presse enthält). Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, Rentner, einige Bereiche des Industrieproletariats teilten mit dem Kleinbürgertum das fürchterliche Los des corralito: Die Mühen eines Lebens voller Arbeit, angespart, um die kümmerliche staatliche Rente aufzubessern, haben sich buchstäblich in Nichts aufgelöst. Jedoch verleiht keines dieser Merkmale der Bewegung der cacerolas einen proletarischen Charakter: Sie bleibt eine Klassen übergreifende Volksrevolte, die von nationalistischem und ‚ultra-demokratischem‘ Denken geprägt ist.
– Die dritte Komponente wird von einer Reihe von Arbeiterkämpfen gebildet. Es hat Streiks von Lehrern in den meisten der 23 Provinzen Argentiniens, eine landesweite, kämpferische Bewegung von Eisenbahnarbeitern und einen Streik von Bankangestellten gegeben. Die Kämpfe im Ramos-Mejias-Krankenhaus in Buenos Aires führten zu Zusammenstößen sowohl mit der uniformierten Polize, als auch mit den Gewerkschaften. Während der letzten beiden Jahre gab es zahllose Mobilisierungen von Arbeitslosen mit denjenigen, die sich engagierten, Straßen im ganzen Land zu blockieren (die berühmten piqueteros).
Selbstverständlich können Revolutionäre einen solchen Kampfgeist, der von der Arbeiterklasse in Argentinien an den Tag gelegt wird, nur begrüßen. Doch wie wir stets gesagt haben, ist der Kampfgeist der Arbeiter, so groß er ist, nicht das einzige, ja, nicht einmal ein Hauptkriterium, das uns ermöglicht, das Kräfteverhältnis zwischen den beiden fundamentalen Klassen in der Gesellschaft, der Bourgeoisie und dem Proletariat, klar zu ermessen. Die erste Frage, die wir beantworten müssen, ist diese: Kann die Dynamik dieser Arbeiterkämpfe, die überall im Land und in vielen verschiedenen Industriebranchen ausgebrochen sind, zu einer Massenbewegung führen, die imstande wäre, die Feuerschneisen zu überspringen, die von der herrschenden Klasse gelegt worden sind (besonders von der demokratischen Opposition und von den Gewerkschaften)? Die Realität der Ereignisse zwingt uns, mit „nein“ zu antworten. Gerade weil die Arbeiterkämpfe zerstreut blieben und sich als unfähig erwiesen, sich zu einer massiven, vereinten Bewegung der gesamten Arbeiterklasse zu entwickeln, zeigte sich das Proletariat in Argentinien nicht imstande, sich selbst an die Spitze der Bewegung des sozialen Protestes zu stellen und den Rest der nicht-ausbeutenden Schichten in sein Kielwasser zu ziehen. Im Gegenteil, weil die Arbeiter außerstande waren, die Führung der Bewegung zu übernehmen, wurden ihre eigenen Kämpfe von der hoffnungslosen Revolte anderer gesellschaftlicher Schichten durchtränkt und vergiftet. Auch wenn sie selbst Opfer des Kollapses der argentinischen Wirtschaft sein mögen, haben Letztere keine historische Zukunft. Für Marxisten wird die einzige Methode, die es uns erlaubt, in solch einer Situation klar zu sehen, in der Frage zusammengefasst: Wer führt die Bewegung an? Welche Klasse hat die Initiative ergriffen und den Ereignissen ihre Dynamik aufgeprägt? Nur wenn sie diese Frage richtig beantworten können, können Revolutionäre zum Fortschritt des Proletariats in Richtung seiner eigenen Befreiung und daher zur Befreiung der Menschheit von dem tragischen Kurs beitragen, auf den der Kapitalismus zusteuert.
Und hier begeht das IBRP einen verhängnisvollen Fehler in der Methode. Es ist nicht das Proletariat, das neben den Studenten die jungen und großen Bereiche des Kleinbürgertums mit sich gezogen hat: Im Gegenteil, die verzweifelte, konfuse und chaotische Revolte wild durcheinander gewürfelter Volksschichten hat die Arbeiterklasse durchtränkt und in die Irre geführt. Schon eine oberflächliche Überprüfung der Positionen, Forderungen und Mobilisierungsmethoden der Nachbarschafts-Versammlungen, die in Buenos Aires gewuchert und sich übers ganze Land ausgebreitet haben, demonstrieren dies mit brutaler Deutlichkeit. Was wurde in der Ankündigung des „weltweiten cacerolazo“ am 23. Februar 2002, die auf ein weites Echo in mehr als 20 Städten auf vier Kontinenten stieß, gesagt? „Globale cacerolazo. Wir sind alle Argentinier – jedermann auf die Straßen in New York – Porto Allegre – Barcelona – Toronto – Montreal (fügt eure Städte und eure Länder hinzu); die räuberische Weltbank – Alca – die Multis – weg mit ihnen allen! Regierungen und Politiker sind korrupt, keiner von ihnen sollte bleiben, keiner von ihnen! Lang leben die Volksversammlungen! Argentinisches Volk, erhebe dich!“ Dieses „Programm“, das all den Ärger über die „Politiker“ artikuliert, ist dasselbe wie jenes, das tagtäglich von jenen selbst ernannten Politikern von der extremen Rechten bis zur extremen Linken und selbst von „ultraliberalen“ Regierungen vertreten wird, die alle wissen, wie man den Ultraliberalismus, die Multis, die Korruption, etc. „kritisiert“.
Darüber hinaus ist diese Bewegung des „Volksprotestes“ stark vom extremen und reaktionären Nationalismus geprägt worden. In allen Demonstrationen der Nachbarschafts-Versammlungen ist dasselbe Ziel bis zum Erbrechen wiederholt worden: „ein anderes Argentinien schaffen“, „unser Land auf eigenen Fundamenten wiederaufbauen“. Auf der Internet-Seite der vielen Nachbarschafts-Versammlungen gab es nationalistische Debatten wie: „Sollen wir die Auslandsschulden zurückbezahlen?“ „Sollen wir den Peso oder den Dollar benutzen?“ Eine Website schlägt lobenswerterweise die „Erziehung und Bewusstwerdung“ der Leute und die Eröffnung einer Debatte über Rousseaus Gesellschaftsvertrag vor und ruft zur Rückkehr zu den Klassikern Argentiniens im 19. Jahrhunderts wie San Martín oder Sarmiento auf. Man muss mit Blindheit geschlagen sein (oder Märchen für bare Münze nehmen), übersähe man, dass dieser Nationalismus auch die Arbeiterkämpfe infiziert hat: Die Arbeiter von TELAM führten ihre Demonstration mit argentinischen Flaggen an; in einem Arbeiterbezirk von Groß-Buenos Aires begann eine Nachbarschafts-Versammlung mit der Ablehnung der Zahlung einer neuen Gemeindesteuer und endete mit dem Singen der Nationalhymmne.
Weil sie Klassen übergreifend und ohne Perspektive war, konnte diese Bewegung nichts anderes tun, als dieselben reaktionären Lösungen fordern, die zur tragischen Situation geführt haben, in die die Bevölkerung gestürzt wurde. Doch diese Wiederholung des Alten, diese Suche nach der guten, alten Zeit ist ein beredtes Zeugnis des Charakters dieser impotenten und zukunftslosen gesellschaftlichen Revolte. Wie von einem Teilnehmer der Versammlungen in aller Offenheit geäußert wurde: „Viele haben gesagt, dass wir keine Vorschläge machen, dass alles, was wir tun können, darin besteht zu opponieren. Und wir können mit Stolz sagen, dass dies richtig ist, wir sind gegen das etablierte System des Neoliberalismus. Wie der Bogen, der durch Unterdrückung überspannt wird, sind wir die Pfeile, die gegen die totalitäre Vorherrschaft des ultra-liberalen Denkens abgeschossen werden. Unsere Aktion wird von unseren Leuten unterstützt werden, Zentimeter für Zentimeter, um das älteste Volksrecht, den Volkswiderstand, auszuüben.“ (entnommen der Website)
Zwischen 1969 und 1973 waren in Argentinien die Ereignisse in Cordoba, der Mendoza-Streik, das Anschwellen der Streiks, die das Land überschwemmten, der Schlüssel zur sozialen Revolution. Obgleich sie weit entfernt von einem aufständischen Charakter waren, markierten diese Kämpfe die Wiederbelebung des Proletariats, das die gesamte politische und gesellschaftliche Tagesordnung des Landes beeinflusste.
Doch im Argentinien vom Dezember 2001 ist die Situation angesichts der Verschlimmerung des kapitalistischen Zerfalls nicht mehr dieselbe. Das Proletariat ist heute mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert, Hindernisse, die noch überwunden werden müssen, um sich selbst zu behaupten und seine Klassenidentität und Autonomie weiterzuentwickeln. Anders als in der Periode zu Beginn der 70er Jahre ist die soziale Lage in Argentinien heute durch eine Klassen übergreifende Bewegung gekennzeichnet, die die Stärke des Proletariats verwässert und sich als unfähig erwiesen hat, mehr als nur flüchtig auf die politische Situation einzuwirken. Die Bewegung der cacerolas hat sicherlich eine große Leistung vollbracht, die es wert ist, ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen zu werden – den Sturz von fünf Präsidenten innerhalb von 15 Tagen. Aber all dies ist nur kurzlebig. Welche Clique auch immer an der Regierung ist, es ist immer noch die Bourgeoisie, die die Macht in Argentinien so wie anderswo in den Händen hält. Nun beklagen sich die Volksversammlungen auf ihren Websites bitterlich darüber, dass sich die Bewegung auf mysteriöse Weise soweit zerstreut hat, dass es dem raffinierten Duhalde gelungen ist, die Ordnung wiederherzustellen, ohne die galoppierende Verarmung wenigstens zu mindern und ohne einen Wirtschaftsplan zu haben, der auch nur zur minimalsten Lösung führt.
Die Lehren aus den Ereignissen in Argentinien
In der gegenwärtigen historischen Periode, die wir als die Zerfallsphase des Kapitalismus bezeichnen, läuft das Proletariat ernsthaft Gefahr, seine Klassenidentität, das Vertrauen in sich selbst zu verlieren, in seine revolutionären Fähigkeiten, sich selbst als eine autonome und bestimmende gesellschaftliche Kraft in der gesellschaftlichen Entwicklung zu etablieren. Diese Gefahr ist das Produkt von mehreren miteinander verknüpften Faktoren:
– der Schlag gegen das Bewusstsein des Proletariats infolge des Zusammenbruchs des Ostblocks und der Fähigkeit der Bourgeoisie, dies mit dem „Zusammenbruch des Kommunismus“ und dem „historischen Scheitern des Marxismus und des Klassenkampfes“ zu identifizieren;
– das Gewicht des Zerfalls des kapitalistischen Systems, das soziale Bande aushöhlt und eine Atmosphäre der Konkurrenz selbst innerhalb des Proletariats fördert;
– die Angst vor der Politik und Politisierung, die eine Konsequenz der Form ist, die die Konterrevolution (durch die Mittel des Stalinismus aus dem „Inneren“ der proletarischen Bastion und der Parteien der Kommunistischen Internationalen) angenommen hat, und des enormen historischen Schlages ist, der durch die Degeneration zweier der besten Kreationen der politischen Fähigkeiten und des Bewussteins des Proletariats innerhalb des Zeitraums von nur einer Generation ausgeübt worden war: zunächst der sozialistischen Parteien und schließlich, keine zehn Jahre später, der kommunistischen Parteien.
Diese Gefahr könnte letztendlich das Proletariat daran hindern, angesichts des vollkommenen Zusammenbruchs der gesamten Gesellschaft, wohin die historische Krise des Kapitalismus führt, die Initiative zu ergreifen. Argentinien zeigt deutlich diese potenzielle Gefahr: Die allgemeine Lähmung der Wirtschaft und die heftigen Erschütterungen im politischen Apparats der Bourgeoisie konnten vom Proletariat nicht dazu genutzt werden, sich selbst als eine autonome gesellschaftliche Kraft zu etablieren, um für seine eigenen Ziele zu kämpfen und die anderen Gesellschaftsschichten in sein Kielwasser zu ziehen. Untergetaucht in einer Klassen übergreifenden Bewegung, die typisch für den Zerfall der bürgerlichen Gesellschaft ist, ist das Proletariat in eine sterile und zukunftslose Revolte gezwängt worden.
Aus diesem Grund sind die Spekulationen von den Trotzkisten, Anarchisten und der „Antiglobalisierungsbewegung“ im Allgemeinen über die Ereignisse in Argentinien, die als „Beginn der Revolution“, als eine „neue Bewegung“ oder als „praktische Demonstration, dass eine andere Gesellschaft möglich ist“, dargestellt werden, sehr gefährlich.
Weitaus Besorgnis erregender ist, dass das IBRP diesen konfusen Schwärmereien durch den Beitrag der eigenen Illusionen über die „Stärke des Proletariats in Argentinien“ Vorschub leistet.[iv]
Diese Spekulationen entwaffnen die jungen Minderheiten, die das Proletariat weltweit hervorbringt und die angesichts einer auseinanderbrechenden Welt nach einer revolutionären Alternative suchen. Daher ist es uns wichtig, die Gründe für die Annahme des IBRP zu erklären, dort auf eine „gigantische Klassenbewegung“ gestoßen zu sein, wo sich in Wahrheit nur die Windmühlen der Klassen übergreifenden Revolte bewegen.
Zunächst einmal sei gesagt, dass das IBRP stets das Konzept des historischen Kurses abgelehnt hat, mit dem wir versuchen, die Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie in der gegenwärtigen Lage zu verstehen, die mit der historischen Wiederbelebung des Proletariats seit 1968 geschaffen wurde. Für das IBRP erscheint all dies als reiner Idealismus, als ein Absturz in „Prognosen und Vorhersagen“.[v] Seine Ablehnung dieser historischen Methode verleitet es zu einer immediatistischen und empiristischen Sichtweise, sowohl was das Militär als auch was den Klassenkampf angeht. Dabei lohnt es sich, die Analyse des IBRP über den Golfkrieg in Erinnerung zu rufen, die ihn als „den Beginn des III. Weltkrieges“ darstellte. Dieselbe photographische Methode verleitete das IBRP dazu, die Palastrevolution, die das Ceausescu-Regime in Rumänien zu Fall brachte, als eine „Revolution“ darzustellen: „Rumänien ist das erste Land in den Industrieregionen, wo die Weltwirtschaftskrise eine wahre und authentische Volksrevolution zum Leben erweckt hat, die in den Sturz der Regierung mündete (...) in Rumänien sind alle objektiven und fast alle subjektiven Bedingungen versammelt, um den Aufstand in eine wahre und authentische soziale Revolution umzuwandeln.“ („Ceausescu ist tot, aber der Kaptialismus ist immer noch am Leben“ in Battaglia Comunista, Januar 1990)
Wer jegliche Art von Analyse des historischen Kurses ablehnt, liefert sich auf Gedeih und Verderb den unmittelbaren Ereignissen aus. Das Fehlen jeglicher Methode, um die historische Weltlage und das wirkliche Kräfteverhältnis zwischen den Klassen zu analysieren, verleitet das IBRP zur Idee, dass wir an dem einen Tag am Rande des III. Weltkriegs stehen und an dem anderen Tag vor einer proletarischen Revolution. Wie das Proletariat – gemäß der „analytischen Methode“ des IBRP – von einer Situation, in der es sich für die Vorbereitung eines Dritten Weltkrieges hinter der Fahne des Nationalismus anwerben lässt, unversehens in eine Situation gerät, wo es bereit ist, einen revolutionären Angriff zu starten, bleibt für uns ein Geheimnis, und wir warten noch immer auf eine kohärente Erklärung des IBRP für diese Sprünge.
Im Gegensatz zu diesem demoralisierenden Hin und Her sind wir selbst davon überzeugt, dass nur eine globale und historische Vision die Revolutionäre davor bewahrt, zum Spielball der Ereignisse zu werden und fälschlicherweise Volksrevolten für proletarischen Klassenkampf zu halten.
Das IBRP verspottet ohne Ende unsere Theorie über den Zerfall des Kapitalismus, indem es sagt, dass „sie benutzt wird, um alles zu erklären“. Dennoch ist das Konzept des historischen Kurses sehr wichtig, um eben diese Unterscheidung zwischen Revolten und dem Klassenkampf des Proletariats zu machen. Solch eine Unterscheidung ist wichtig in unserer Zeit. Die gegenwärtige Lage des Kapitalismus führt in der Tat zu Protesten, Tumulten, Zusammenstößen zwischen Klassen, Schichten und Fraktionen. Die Revolte ist die faule und welke Frucht einer in ihren Grundfesten erschütterten, sterbenden Gesellschaft. Sie hilft nicht, ihre Widersprüche zu überwinden, sondern verschlimmert sie stattdessen. Sie ist der eine Teil der Alternative, die im Kommunistischen Manifest für den Klassenkampf in der ganzen Geschichte dargestellt worden war: „ein Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endet oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen“. Es ist diese zweite Alternative, der „gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen“, die das Fundament für das Konzept des Zerfalls des Kapitalismus bildet. Dies ist das Gegenteil zum Klassenkampf des Proletariats, der, falls er auf seinem eigenen Klassenterrain Ausdruck findet und seine Autonomie durch sein Streben nach Ausweitung und Selbstorganisation bewahrt, das Potenzial besitzt, um die „selbständige Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl“ (ebenda) zu werden. All die Bemühungen der bewusstesten Elemente des Proletariats und, etwas allgemeiner, der kämpfenden Arbeiter müssen danach trachten zu vermeiden, die Volksrevolte mit dem autonomen Klassenkampf zu verwechseln, müssen danach streben, das Gewicht des allgemeinen gesellschaftlichen Zerfalls daran zu hindern, dass das Proletariat in die Sackgasse blinder Revolten gezerrt wird. Während das Terrain der Revolte zu einer fortschreitenden Auszehrung der Fähigkeiten des Proletariats führt, führt das Terrain des Klassenkampfes zur revolutionären Zerstörung des kapitalistischen Staates in allen Ländern.
Die proletarische Perspektive
Während die Ereignisse in Argentinien klar die Gefahr aufzeigen, der das Proletariat gegenübersteht, falls es zulässt, auf das verrottete Terrain des Klassen übergreifenden „Volks“aufstandes gezerrt zu werden, wird das Endspiel der sozialen Evolution zur Barbarei oder Revolution jedoch nicht hier ausgespielt werden, sondern in den weltgrößten Arbeiterkonzentrationen und besonders in Westeuropa.
“Eine soziale Revolution ist nicht einfach das Zerschlagen der Ketten, der Zusammenbruch der alten Gesellschaft. Sie ist auch und gleichzeitig eine Handlung zum Aufbau einer neuen Gesellschaft. Sie ist kein mechanischer Vorgang, sondern eine gesellschaftliche Tatsache, die mit den Antagonismen der menschlichen Interessen, mit dem Streben und den Kämpfen der Klassen verknüpft ist.“ (International Review Nr. 31, engl./frz./span.) Die mechanistischen und vulgären materialistischen Visionen erblicken in der proletarischen Revolution nur einen Aspekt in der Explosion des Kapitalismus, doch sie sind nicht in der Lage, den wichtigsten und entscheidendsten Aspekt zu sehen – die revolutionäre Zerstörung des Kapitalismus durch die bewusste Aktion der proletarischen Klasse, das heißt, durch den, wie Lenin und Trotzki ihn nannten, „subjektiven Faktor“. Diese vulgärmaterialistischen Sichtweisen verhindern die Wahrnehmung des Ernstes der historischen Situation, die gekennzeichnet ist durch den Eintritt des Kapitalismus in die letzte Phase seiner Dekadenz: seinen Zerfall. Stattdessen gibt sich der mechanistische und betrachtende Materialismus mit dem „objektiv revolutionären“ Aspekt zufrieden: mit der unerbittlichen Verschlimmerung der Wirtschaftskrise, den gesellschaftlichen Erschütterungen, der Verkommenheit der herrschenden Klasse. Der Vulgärmaterialismus geht leichtfertig über die Gefahren für das Bewusstsein des Proletariats und für die Entwicklung seiner Einheit und seines Selbstvertrauens hinweg, die im Zerfall des Kapitalismus verborgen sind (genauso wie in seinem ideologischen Gebrauch durch die herrschende Klasse).[vi]
Doch der Schlüssel zur revolutionären Perspektive in unserer Epoche ist gerade die Fähigkeit des Proletariats, die „subjektiven“ Elemente (Selbstvertrauen, Vertrauen in seine revolutionäre Zukunft, Einheit und Klassensolidarität) in seinem Kampf zu entwickeln, die es ihm in wachsendem Maße erlauben, dem Gewicht des sozialen und ideologischen Zerfalls des Kapitalismus entgegenzuwirken und Letzteren zu überwinden. Und in eben jenen großen Arbeiterkonzentrationen Westeuropas existieren die günstigsten Bedingungen für diese Entwicklung. „Soziale Revolutionen fanden nicht da statt, wo die herrschende Klasse am schwächsten war und ihre Strukturen am wenigsten entwickelt waren, sondern im Gegenteil da, wo ihre Strukturen hinsichtlich der Produktivkräfte den höchsten Punkt erreicht haben und wo die Klasse, die die neuen Produktionsverhältnisse trägt und dazu bestimmt ist, die alte Klasse zu ersetzen, am stärksten ist (...) Marx und Engels richteten ihre Perspektive nach den Punkten aus, wo das Proletariat am stärksten, konzentriertesten und am besten positioniert war, um die gesellschaftliche Umwandlung durchzuführen. Obwohl die Krise die unterentwickelten Länder gerade infolge ihrer wirtschaftlichen Schwäche und ihres Mangels an Spielraum für Manöver am brutalsten trifft, dürfen wir nicht vergessen, dass die Quelle der Krise in der Überproduktion, also in den Hauptzentren der kapitalistischen Entwicklung liegt. Dies ist ein weiterer Grund, warum die Bedingungen für eine Antwort auf die Krise und für ihre Überwindung im Wesentlichen in den Hauptzentren ruhen.“[vii]
In der Tat muss die deformierte Vision des IBRP, die einen Klasseninhalt in den Ereignissen in Argentinien zu erblicken vermeint, im Zusammenhang mit seiner Analyse des Potenzials des Proletariats in den peripheren Ländern des Kapitalismus betrachtet werden, die insbesondere in seinen „Thesen über kommunistische Taktik in den Ländern der kapitalistischen Peripherie“ zum Ausdruck kommt, welche auf dem 6. Kongress von Battaglia Comunista verabschiedet worden waren (veröffentlicht in Italien in Prometeo, Nr. 13, Juni 1997, und auf Englisch in Internationalist Communist Nr. 16). Diesen Thesen zufolge schaffen die Bedingungen in den Ländern der Peripherie „ein größeres Potenzial für die Radikalisierung des Bewusstseins als in den großen Metropolen“. Infolgedessen „besteht die Möglichkeit, dass die Zirkulierung des kommunistischen Programms unter den Massen leichter sein wird und der ‚Aufmerksamkeitsgrad‘, den kommunistische Militante dort erzielen können, höher ist als in den gesellschaftlichen Gebilden des fortgeschrittenen Kapitalismus.“ Wir haben diese Analyse bereits im Detail zurückgewiesen (s. International Review Nr. 100, „The class struggle in the countries of the capitalist periphery“, engl./frz./span.Ausgabe), so dass es unnötig ist, dies hier erneut zu tun. Was wir dennoch sagen wollen, ist, dass die verzerrte Sichtweise des IBRP über die Bedeutung der gegenwärtigen Revolte in Argentinien eine Veranschaulichung nicht nur seiner Unfähigkeit ist, die Idee des kapitalistischen Zerfalls oder des historischen Kurses zu begreifen, sondern auch der Unrichtigkeit dieser Thesen.
Unsere Analyse bedeutet absolut nicht, dass wir die Kämpfe des Proletariats in Argentinien und in anderen Zonen, wo der Kapitalismus schwächer ist, mit Verachtung strafen oder unterschätzen. Sie bedeutet einfach, dass Revolutionäre, als die Vorposten des Proletariats und mit einer klaren Vision von der Marschrichtung der proletarischen Bewegung als Ganzes ausgestattet, die Verantwortung haben, deutlich und exakt auf die Stärken und Grenzen des Arbeiterkampfes hinzuweisen, darauf, wer die Verbündeten sind und welche Richtung sein Kampf einschlagen sollte. Um dem gerecht zu werden, müssen Revolutionäre sich mit all ihrer Kraft der opportunistischen Versuchung – durch Ungeduld, Immediatismus oder einen historischen Mangels an Vertrauen in das Proletariat – entgegenstemmen und dürfen nicht eine Klassen übergreifende Revolte (wie wir sie in Argentinien gesehen haben) mit einer Klassenbewegung verwechseln.
Adalen, 10. März 2002
[i] Die Deklaration befindet sich auf der Website des IBRP (www.ibrp.org [108]) und trägt den Titel „A lesson from Argentina: Either the Revolutionary Party and Socialism or Generalised Poverty and War“.
[ii] s. unsere Artikel über den Zusammenbruch des Ostblocks in der Internationalen Revue Nr. 12, über die Frage „Why the proletariat has not yet overthrown capitalism?“ in der International Review Nr. 103-104 (engl./frz./span. Ausgabe) sowie den „Bericht über den Klassenkampf“ in der letzten und vorliegenden Nummer der Internationalen Revue Nr. 30.
[iii] Die Zeitung Pagina vom 12. Januar 2002 veröffentlichte „einen sensationellen Bericht, demzufolge in einigen Wohngegenden von Groß-Buenos Aires die Plünderungen sich von den Geschäften zu den Wohnungen verlagert haben“.
[iv] Im Gegensatz dazu hat der PCI in Le Proletaire eine klare Position eingenommen, was schon im Titel dieses Artikels deutlich wird: „Die Cacerolazos können Präsidenten stürzen. Um gegen den Kapitalismus zu kämpfen, ist der Klassenkampf notwendig“, der den Klassen übergreifenden Charakter der Bewegung entlarvt und sagt, dass „ein Weg, dieser Politik zu trotzen, nicht existiert: Der Kampf gegen den Kapitalismus, der Arbeiterkampf vereint alle Proletarier nicht hinter populistischen Absichten, sondern hinter jenen der Klasse; der Kampf ist nicht national, sondern international; das endgültige Ziel des Kampfes ist nicht die Reform, sondern die Revolution.“
[v] zu unserer Auffassung über den historischen Kurs siehe die Artikel in der Internationalen Revue Nrn. 5, 29 und der vorliegenden Nummer. Wir haben mit dem IBRP über diese Konzeption in Artikeln der International Review Nr. 36 und 89 (engl./frz./span. Ausgabe) polemisiert.
[vi] „Die verschiedenen Elemente, die die Stärke der Arbeiterklasse bilden, stoßen direkt mit den verschiedenen Erscheinungsweisen des ideologischen Zerfalls zusammen:
– solidarische und kollektive Aktionen sehen sich einer Atomisierung des „Nach-mir-die-Sintflut“ gegenüber;
– das Bedürfnis nach einer Organisation steht dem gesellschaftlichen Zerfall gegenüber, der Desintegration von sozialen Beziehungen, auf die jede Gesellschaft baut;
– das Vertrauen des Proletariats in die Zukunft und in seine eigene Stärke wird ständig durch die alles durchdringende Hoffnungslosigkeit und den Nihilismus innerhalb der Gesellschaft untergraben;
– Bewusstsein, Klarheit, der zusammenhängende und einheitliche Gedanke, der Sinn für Theorie haben eine harte Zeit, um sich der Flucht in die Illusion, in Drogen, Sekten, in den Mystizismus, die Ablehnung oder Zerstörung des Gedankens zu erwehren, die für unsere Epoche kennzeichnend sind.“ (“Der Zerfall: letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus“ in der Internationalen Revue Nr. 13)
[vii] ebenda
Geographisch:
- Argentinien [109]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Internationale Revue - 2003
- 3724 Aufrufe
Internationale Revue 31
- 2843 Aufrufe
15. Kongress der IKS: Resolution über die internationale Lage
- 2599 Aufrufe
Resolution über die internationale Lage
Wir veröffentlichen hier ein Dokument, das am 15. Kongress der IKS angenommen wurde, zur Analyse der internationalen Lage. Dieser Kongress hat im Frühjahr 2003 stattgefunden.
1. Mit der massiven US-Offensive gegen den Irak betreten wir eine neue Stufe auf dem Abstieg des Kapitalismus in die militärische Barbarei, die eine Verschlimmerung aller anderen offenen Feindschaften oder Spannungsherde auf dem Globus in Gang setzt. Abgesehen von den fürchterlichen Verwüstungen, von denen die unglückliche Bevölkerung Iraks erfasst ist, kann dieser Krieg auch anderswo nur das Schüren der imperialistischen Spannungen und des militärischen Chaos bewirken. Die Kriegsvorbereitungen haben bereits den ersten offenen Riss zwischen Amerika auf der einen Seite und der einzigen anderen Macht, die sich als Kandidat für die Führungsrolle in einem neuen antiamerikanischen Block positionieren könnte, Deutschland, auf der anderen Seite verursacht. Die Spaltungen zwischen den Grossmächten in der Irak-Frage haben das Ende der NATO und vielleicht gar der UN eingeläutet, während gleichzeitig offensichtlich wurde, dass Europa, weit davon entfernt, bereits ein Block zu sein, von tiefgehenden Divergenzen in Schlüsselfragen der internationalen Beziehungen zerrissen ist. Sie haben einen anderen Pol in der „Achse des Bösen“, Nordkorea, dazu veranlasst, sein eigenes Spiel in der Krise zu treiben, mit der Gefahr, dass dies mittelfristig das Kriegsszenario auf den Fernen Osten ausweiten wird. Unterdessen spielt auch der dritte Pol der Achse, Iran, die Nuklearkarte. In Afrika wird Frankreichs vorgeblicher Anspruch, eine „pazifistische“ Macht zu sein, durch die wachsende Verwicklung seiner Truppen im blutigen Krieg an der Elfenbeinküste entlarvt. Die Folgen des Irakkrieges werden beileibe kein nahöstliches „Westdeutschland“ bewirken, wie einige leichtsinnige bürgerliche Kommentatoren voraussagten, sondern dienen allein dazu, eine Zone der Instabilität zu schaffen, was zur unmittelbaren Konsequenz die Verschärfung des palästinensisch-israelischen Konflikts und die Provozierung neuer terroristischer Angriffe rund um den Globus hat. Der Krieg gegen den Terrorismus verbreitet Terror auf den ganzen Planeten – nicht nur durch die Massaker, die er gegen seine unmittelbaren Opfer an den Fronten der imperialistischen Rivalitäten verübt, sondern auch in der Gestalt einer wachsenden Besorgnis in weiten Kreisen der Bevölkerung darüber, was die Zukunft für die Gesamtheit der Menschheit noch bereithält.
2. Es ist kein Zufall, dass das Aufschaukeln der imperialistischen Spannungen mit einem erneuten Sturz in die Weltwirtschaftskrise „zusammenfällt“. Dies ist nicht nur vom offenkundigen Zusammenbruch schwächerer (aber ökonomisch immer noch wichtigen) Volkswirtschaften wie die Argentiniens manifestiert worden, sondern auch und vor allem durch die Rückkehr der offenen Rezession in die US-Wirtschaft, deren durch Schulden angetriebenes Wachstum in den 90er Jahren – als Triumph der „neuen Wirtschaft“ dargestellt – die große Hoffnung für das gesamte Weltwirtschaftssystem, insbesondere für die Länder Europas, war. Diese famosen Jahre sind nun, wo die US-Wirtschaft einer deutlich steigenden Arbeitslosigkeit, dem Fall in der Industrieproduktion, dem Rückgang der Konsumausgaben, Börsenschwankungen, Firmenskandalen und Bankrotten und der Rückkehr des defizitären Bundeshaushaltes entgegentreibt, endgültig vorbei.
Um eine Vorstellung vom Ernst der derzeitigen Wirtschaftslage zu erhalten, sei auf den Zustand der britischen Wirtschaft hingewiesen, die unter den europäischen Hauptländern noch als am besten positioniert galt, um die von den USA ausgelösten globalen Stürme abzuwettern. Tatsächlich jedoch wurden, unmittelbar nachdem Schatzkanzler Brown erklärt hatte, dass „Großbritannien besser platziert ist als in der Vergangenheit, um mit dem weltwirtschaftlichen Rückgang fertigzuwerden“, offizielle Zahlen bekanntgegeben, die aufzeigen, dass die britische Produktion – in der Hightech-Branche genauso wie in den traditionellen Industrien – sich auf dem niedrigsten Stand seit der Rezession von 1991 befindet und dass monatlich 10000 Jobs in diesem Bereich verschwinden.
Zusammen mit den Opfern, die die steigende Spirale von Rüstungsausgaben erfordert, hat der Rutsch in die offene Rezession bereits eine ganz neue Runde von Angriffen gegen den Lebensstandard der Arbeiterklasse (Entlassungen, „Modernisierung“, Streichungen von Sozialausgaben, besonders bei den Renten, etc.) eingeleitet.
3. Die Situation, der die Arbeiterklasse gegenübersteht, ist also unerhört ernst. Seit über einem Jahrzehnt hat die Arbeiterklasse den längsten Rückgang ihrer Kämpfe seit dem Ende der konterrevolutionären Periode in den späten 60er Jahren erlebt. Konfrontiert mit dem Doppelschlag des Krieges und der Wirtschaftskrise, hat die Arbeiterklasse beträchtliche Schwierigkeiten bei der Entwicklung ihrer eigenen Kämpfe, selbst auf der grundlegendsten Ebene der wirtschaftlichen Selbstverteidigung, gehabt. Auf der politischen Ebene waren ihre Schwierigkeiten gar noch ausgeprägter, da ihr allgemeines Bewusstsein für die riesige historische Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet, im letzten Jahrzehnt einen Schlag nach dem anderen erlitten hat. Und gerade jene Kräfte, deren erste Aufgabe es ist, die politischen Schwächen im Proletariat zu bekämpfen, die Kräfte des Linkskommunismus, sind in einem desolaten Zustand wie nie zuvor seit dem Wiederauftreten revolutionärer Kräfte Ende der 60er. Der unerhörte Druck einer zerfallenden kapitalistischen Ordnung tendiert dazu, die lang anhaltenden, opportunistischen und sektiererischen Schwächen im politischen Milieu des Proletariats weiter zu verstärken, was in eine ernste theoretische und politische Regression mündete, welche dazu neigt, den Ernst der Lage, der sich das Proletariat und seine revolutionären Minderheiten gegenübersehen, zu unterschätzen und jedes wirkliche Verständnis der Natur und Dynamik der gesamten historischen Epoche zu trüben.
4. Angesichts des Zusammenbruchs des rivalisierenden russischen Blocks Ende der 80er Jahre und der rapiden Auflösung des eigenen westlichen Blocks heckte der US-Imperialismus einen strategischen Plan aus, der im folgenden Jahrzehnt immer offener zu Tage trat. Gestärkt als einzig verbliebene Supermacht, würden die USA alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass keine neue Supermacht – in Wirklichkeit kein neuer imperialistischer Block – entsteht, der ihre „neue Weltordnung“ herausfordern könnte. Die hauptsächlichen Methoden dieser Strategie wurden nachdrücklich durch den ersten Golfkrieg von 1991 demonstriert:
– eine massive Zurschaustellung der militärischen Überlegenheit der USA, die das Regime von Saddam Hussein als Prügelknaben benutzte;
– der Druck auf die anderen Mächte, an der US-Operation teilzunehmen und ihr so einen Hauch von Legitimation zu verschaffen, und die Beschaffung eines beträchtlichen Anteils der enormen Gelder, die für die Operation erforderlich waren, bei Erstgenannten. Besonders Deutschland – der einzig wahre Kandidat für die Führung eines neuen antiamerikanischen Blocks – sollte das meiste bezahlen.
5. Wenn es das vorrangige Ziel des Golfkriegs war, eine wirksame Warnung an all diejenigen zu richten, die die US-Hegemonie herausfordern wollten, so muss er als gescheitert betrachtet werden. Binnen eines Jahres provozierte Deutschland den Krieg auf dem Balkan in der Absicht, seinen Einfluss auf einer strategischen Schlüsselposition Europas und des Nahen Osten auszuweiten, Es dauerte einen Gutteil des Jahrzehnts, ehe die USA, durch den Krieg im Kosovo, ihre Autorität in dieser Region durchsetzen konnte, nachdem nicht nur Deutschland (das Kroatien verdeckt unterstützte), sondern auch Frankreich und ihr angeblich treuer Verbündeter Großbritannien durch die heimliche Unterstützung Serbiens sich als widerspenstig erwiesen hatten. Das Chaos auf dem Balkan war ein deutlicher Ausdruck für die Widersprüche, denen sich die USA gegenübersahen: Je mehr sie danach trachteten, ihre ehemaligen Verbündeten zu disziplinieren, desto mehr Widerstand und Feindseligkeit riefen sie hervor und desto weniger waren sie in der Lage, Letztere für militärische Operationen zu rekrutieren, von denen diese wussten, dass sie letztlich gegen sie selbst gerichtet sind. Daher das Phänomen, dass die USA in wachsendem Maße dazu gezwungen sind, ihre Abenteuer allein zu meistern, und sich immer weniger auf die „legalen“ internationalen Strukturen wie die UN und die NATO verlassen, die immer mehr als Hindernisse für die US-Pläne fungieren.
6. Nach dem 11. September 2001 – höchstwahrscheinlich mit der Komplizenschaft des US-Staates verübt – wechselte die globale Strategie der USA auf eine höhere Ebene. Sofort wurde der „Krieg gegen den Terrorismus“ als permanente und weltweite Militäroffensive angekündigt. Angesichts der wachsenden Herausforderung durch ihre imperialistischen Hauptrivalen (ausgedrückt durch die Streitereien über das Kyoto-Protokoll, die europäische Militärkraft, die Manöver bei der Bildung einer Polizei für den Kosovo, etc.) schlugen die USA eine Politik der massiveren und direkteren Militärinterventionen ein, mit dem strategischen Ziel der Umzingelung Europas und Russlands durch die Erlangung der Kontrolle über Zentralasien und Nahost. Auch im Fernen Osten hat der US-Imperialismus durch die Einbeziehung Nordkoreas in die „Achse des Bösen“ und durch die Erneuerung seiner Interessen im „Kampf gegen den Terrorismus“ in Indonesien nach dem Bombenanschlag auf Bali seine Absicht ausgedrückt, direkt im Hinterhof Chinas und Japans zu intervenieren.
7. Die Ziele dieser Intervention sind keinesfalls auf die Frage des Öls beschränkt, das ausschließlich als eine Quelle des kapitalistischen Profits betrachtet wird. Die Kontrolle über den Nahen Osten und Zentralasien aus geostrategischen Gründen war das Objekt heftiger interimperialistischer Rivalitäten, lange bevor das Erdöl zu einem lebenswichtigen Bestandteil der kapitalistischen Wirtschaft wurde. Und auch wenn es natürlich notwendig ist, die riesigen Ölförderkapazitäten im Nahen Osten und im Kaukasus zu kontrollieren, wird die US-Militäraktion dort nicht auf Veranlassung der Erdölgesellschaften ausgeführt: Den Erdölgesellschaften wird lediglich die Rückerstattung offener Rechnungen gestattet, vorausgesetzt, sie passen in den vorrangigen strategischen Plan, der die Fähigkeit miteinschließt, die Ölversorgung der potenziellen Feinde Amerikas zu unterbrechen und somit jegliche militärische Herausforderung schon im Keim zu ersticken. Besonders Deutschland und Japan sind weitaus abhängiger vom Öl aus dem Nahen Osten als die USA.
8. Das verwegene Projekt der USA, einen stählernen Ring um ihre imperialistischen Hauptrivalen zu errichten, liefert also die wirkliche Erklärung für den Krieg in Afghanistan, für den Anschlag gegen den Irak und für die erklärte Absicht, sich danach mit dem Iran zu befassen. Doch die Erhöhung des Einsatzes durch die USA hat eine gemeinsame Antwort ihrer Hauptherausforderer hervorgerufen. Der Widerstand gegen die US-Pläne wurde von Frankreich angeführt, das damit drohte, von seinem Vetorecht im UN-Sicherheitsrat Gebrauch zu machen. Doch noch bedeutsamer ist die offene Herausforderung durch Deutschland, das bis dahin dazu neigte, im Dunklen zu agieren, und dabei Frankreich gestattete, die Rolle des erklärten Widersachers der US-Ambitionen zu spielen. Heute jedoch betrachtet Deutschland das US-Abenteuer im Irak als eine reale Bedrohung seiner Interessen in einem Gebiet, das seit der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Mittelpunkt seiner imperialistischen Ambitionen gestanden hatte. Es hat daher eine weit offenere Herausforderung an die USA gerichtet als jemals zuvor; ferner hat seine resolute „Anti-Kriegs“-Haltung Frankreich den Rücken gestärkt, das bis kurz vor dem Kriegsausbruch noch angedeutet hatte, dass es den Kurs wechseln und an der militärischen Aktion teilnehmen könnte. Mit dem Kriegsausbruch nahmen diese Mächte eine gemäßigte Haltung an, doch historisch war ein echter Meilenstein gesetzt. Diese Krise hat auf das Dahinscheiden nicht nur der NATO (deren Irrelevanz sich an ihrer Unfähigkeit zeigte, kurz vor dem Krieg in der Frage der „Verteidigung“ der Türkei zu einer Übereinkunft zu kommen), sondern auch der UN aufmerksam gemacht. Die amerikanische Bourgeoisie betrachtet diese Institution zunehmend als Mittel ihrer Hauptrivalen und äußert offen, dass sie keine Rolle beim „Wiederaufbau“ des Irak spielen werde. Die Abschaffung solcher Institutionen des „internationalen Rechts“ stellen einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung des Chaos in den internationalen Beziehungen dar.
9. Der Widerstand gegen die US-Pläne durch ein Bündnis zwischen Frankreich, Deutschland, Russland und China zeigt, dass angesichts der massiven Überlegenheit der USA ihre Hauptrivalen keine andere Wahl haben, als sich dagegen zusammenzutun. Dies bestätigt, dass die Tendenz zur Bildung eines neuen imperialistischen Blocks ein realer Faktor in der gegenwärtigen Situation bleibt. Doch es wäre ein Fehler, eine Tendenz mit einem Fait accompli zu verwechseln, vor allem weil in der Periode des kapitalistischen Zerfalls die Bewegung zu einer Bildung eines neuen Blocks ständig von den Gegentendenzen aller Länder, ihre eigenen unmittelbaren, nationalen Interessen vor alle anderen zu stellen – die Tendenz des Jeder-für-sich – behindert wird. Die tiefen Zerwürfnisse zwischen den europäischen Ländern in der Frage des Krieges gegen den Irak haben demonstriert, dass „Europa“ weit davon entfernt ist, einen kohärenten Block zu bilden, wie einige Elemente der revolutionären Bewegung geneigt sind zu argumentieren. Abgesehen davon beruhen solche Argumente auf einer Verwechslung von Wirtschaftsallianzen und realen imperialistischen Blöcken, die vor allem militärische Formationen sind, die sich auf einen Weltkrieg orientieren. Und hier kommen zwei weitere wichtige Faktoren ins Spiel: erstens die unbestrittene militärische Dominanz der USA, die es für ihre Rivalen unter den Großmächten noch unmöglich macht, irgendeine kriegsähnliche Herausforderung gegen die USA zu richten; und zweitens der unbesiegte Charakter des Proletariats, was bedeutet, dass es noch nicht möglich ist, die gesellschaftlichen und ideologischen Bedingungen für neue Kriegsblöcke zu schaffen. Daher nimmt der Krieg gegen den Irak, so sehr er die imperialistischen Rivalitäten zwischen den Großmächten ans Tageslicht bringt, dieselbe Grundform an wie alle anderen Hauptkriege in dieser Phase: ein „verdeckter“ Krieg, dessen wirkliches Ziel hinter einem Sündenbock, gebildet von einer dritt- oder viertrangigen Macht, versteckt ist und in dem die Hauptmächte darauf achten, nur Berufsarmeen einzusetzen.
10. Die Krise der US-Führung hat den britischen Imperialismus in eine immer widersprüchlichere Position manövriert. Nach dem Ende der besonderen Beziehungen erfordert es die Verteidigung der britischen Interessen, eine „vermittelnde“ Rolle zwischen Amerika und den europäischen Hauptmächten und unter den letztgenannten Mächten selbst zu spielen. Obzwar als Pudel der USA präsentiert, hat die Blair-Regierung eine bedeutende Rolle bei der Verursachung der gegenwärtigen Krise gespielt, indem sie darauf beharrte, dass Amerika nicht im Alleingang Irak erledigt, sondern den Weg über die UN geht. Großbritannien war auch der Schauplatz eines der größten „Friedens“märsche, wobei große Fraktionen der herrschenden Klasse, nicht nur ihre linksextremistischen Anhängsel, die Demonstrationen organisierten. Die starken „Antikriegs“gefühle von Teilen der britischen Bourgeoisie drücken ein echtes Dilemma der herrschenden Klasse Großbritanniens aus, da das wachsende Schisma zwischen Amerika und den anderen Großmächten ihre „zentristische“ Rolle in steigendem Maße ungemütlich macht. Besonders das britische Argument, dass die UN eine zentrale Rolle bei der Regelung der Post-Saddam-Ära spielen soll und dass dies durch bedeutende Zugeständnisse gegenüber den Palästinensern begleitet werden muss, wird von der USA politisch ignoriert. Obgleich es bis jetzt keine echte Alternative innerhalb der britischen Bourgeoisie gibt, herrscht über die Blair-Linie in den auswärtigen Beziehungen und über seine allzu enge Anbindung an das US-Abenteurertum wachsende Unruhe. Der Morast, der sich jetzt im Irak auftut, kann diese Unruhe nur verstärken.
11. Obwohl die USA fortfahren, all den anderen Hauptmächten ihre erdrückende militärische Überlegenheit zu demonstrieren, neigt der immer offenere Charakter ihrer imperialistischen Ambitionen dazu, ihre politische Autorität zu schwächen. In beiden Weltkriegen und im Konflikt mit dem russischen Block waren die USA in der Lage, sich selbst als der größte Schutzwall der Demokratie und des Existenzrechts der Nationen, als Verteidiger der freien Welt gegen Totalitarismus und militärische Aggressionen zu positionieren. Doch seit dem Zusammenbruch des russischen Blocks sind die USA dazu genötigt worden, selbst die Rolle des Aggressors zu spielen; und während unmittelbar nach dem 11. September die USA noch in gewisser Weise in der Lage waren, ihre Aktionen in Afghanistan als einen Akt der Selbstverteidigung zu präsentieren, ist die Rechtfertigung für den gegenwärtigen Krieg im Irak vollends fadenscheinig geworden, wohingegen ihre Rivalen sich angesichts der Einschüchterungsversuche der USA als die größten Verteidiger der demokratischen Werte profilieren.
Die ersten Wochen der Militärhandlungen haben hauptsächlich dazu gedient, der politischen Autorität der USA weitere Schwierigkeiten zu bereiten. Anfangs als einen Krieg dargestellt, der sowohl schnell als auch sauber sein werde, kommt jetzt zum Vorschein, dass die Kriegspläne, die von der gegenwärtigen Administration entworfen worden waren, ernsthaft das Ausmaß unterschätzten, in dem die Invasion Gefühle der nationalen Verteidigung in der irakischen Bevölkerung provozieren würde. Auch wenn die Allgegenwart von Saddams Sondereinheiten sicherlich eine Rolle dabei spielten, durch ihre gewohnten Methoden des Zwangs und Terrors den Widerstand der regulären Truppen zu stärken, so gab es daneben auch allgemein feindselige Reaktionen gegen die amerikanische Invasion, die dabei keinesfalls von einer großen Begeisterung für das Saddam-Regime begleitet waren. Selbst die schiitischen Organisationen, auf deren „Aufstand“ gegen Saddam man gezählt hatte, haben erklärt, dass es die erste Pflicht eines jeden Irakers sei, sich den Invasoren entgegenzustellen. Die Verlängerung des Krieges kann nur dazu dienen, das Elend der Bevölkerung zu verschlimmern, ob durch Hunger und Durst oder durch die Intensivierung des Bombardements, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass dies zu einem Anwachsen der Feindseligkeit der Bevölkerung gegen die USA beitragen wird. Die Belagerung und Einnahme Bagdads schwört ein wahrhaftiges Blutbad herauf.
Die USA haben also große Schwierigkeiten, sich selbst als „Befreier“ des irakischen Volkes darzustellen. Darüber hinaus vertieft der Krieg die Spaltungen in der irakischen Gesellschaft, insbesondere zwischen denjenigen, die sich mit den USA verbündet haben, und denjenigen, die gegen die Invasion gekämpft haben. Diese Spaltungen können nur dazu führen, Unordnung und Instabilität im Post-Saddam-Irak zu schaffen, und den Anspruch der USA untergraben, der Überbringer von Frieden und Wohlstand in der Region zu sein. Im Gegenteil, der Krieg schürt bereits die Spannungen in der gesamten Region, wie der Einfall der Türkei in den Nordirak, die Annahme einer antiamerikanischen Position durch Syrien und das erneute Säbelrasseln zwischen Indien und Pakistan demonstrieren.
Somit kann der gegenwärtige Krieg, weit entfernt davon, die Krise der amerikanischen Führung zu lösen, sie nur auf eine höhere Stufe stellen.
Dekadenz und Zerfall
12. Das Abgleiten in den Militarismus ist ein Ausdruck par excellence für die Sackgasse, in der sich die kapitalistische Produktionsweise befindet – für ihre Dekadenz als Produktionsweise. Wie in den beiden Weltkriegen und im Kalten Krieg zwischen 1945 und 1989 sind die Kriege in der 1989 eingeleiteten Periode die schlagendsten Manifestationen der Tatsache, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu einem Hindernis für den menschlichen Fortschritt geworden sind. Nicht nur, dass diese fürchterlichen Zahlen der Zerstörung (und der Produktion der Zerstörungsmittel) eine schwindelerregende Verschwendung der menschlichen Arbeitskraft in einer Periode darstellen, wo die Produktivkräfte objektiv in der Lage sind, den Menschen von allen Formen wirtschaftlicher Mühsal und Armut zu befreien, sie sind darüber hinaus gleichermaßen Produkt und aktiver Faktor in einer Dynamik, die das eigentliche Überleben der Menschheit bedroht. Diese Dynamik hat sich während der Dekadenzperiode weiter beschleunigt: Wir müssen nur das Ausmaß an Tod und Zerstörung vergleichen, das der Erste und der Zweite Weltkrieg bewirkt haben, wie auch die globale Ausweitung dieser Konflikte, um dies zu verstehen. Hinzu kommt, dass, auch wenn der dritte Weltkrieg zwischen dem russischen und dem amerikanischen Block – ein Krieg, der sicherlich zur Auslöschung der Menschheit geführt hätte – nie stattgefunden hat, die Stellvertreterkriege, die sie über vier Jahrzehnte lang miteinander ausgefochten haben, allein genausoviel Tote verursachte haben wie die beiden Weltkriege zusammen. Dies sind nicht nur mathematische oder technische Fakten; sie bezeugen eine qualitative Vertiefung der Tendenz des Kapitalismus zur Selbstzerstörung.
13. Es ist für jeden Beobachter der internationalen Szenerie ersichtlich, dass 1989 den Beginn einer völlig neuen Phase im Leben des Kapitalismus markierte. 1990 versprach Bush senior eine neue Weltordnung des Friedens und Wohlstands. Und für die intellektuellen Apologeten der herrschenden Klasse bedeutete das Ende des „kommunistischen Experiments“ einen neuen Aufschwung des Kapitalismus, der nun endlich ein wahrhaft „globales“ System geworden sei, ausgerüstet mit wundersam neuen Technologien, die aus seinen Wirtschaftskrisen eine Sache der Vergangenheit machen würden. Auch würde der Kapitalismus nicht mehr vom Widerspruch zwischen Bourgeoisie und Proletariat behelligt werden, weil in der „neuen Wirtschaft“ die Arbeiterklasse und ihr Klassenkampf aufhören würden, zu existieren. So unübersehbar war die Morgendämmerung des neuen Zeitalters der Globalisierung, dass selbst ihre am meisten veröffentlichten Opponenten – die globale, antikapitalistische Bewegung – praktisch alle wesentlichen Annahmen ihrer Apologeten teilten. Für den Marxismus jedoch war der Zusammenbruch des stalinistischen Blocks der Kollaps eines Teils eines längst globalen kapitalistischen Systems; und die Periode, die von diesem seismischen Ereignis eingeleitet worden war, stellt kein Aufblühen, keine Verjüngung des Kapitalismus dar, im Gegenteil, sie kann nur als die Endphase der kapitalistischen Dekadenz verstanden werden – als die Phase, die wir als Zerfall bezeichnen, als das „Aufblühen“ aller angehäuften Widersprüche einer längst senilen Gesellschaftsordnung.
14. Die Rückkehr der offenen Wirtschaftskrise in den späten 60er Jahren hatte bereits das letzte Kapitel im klassischen Zyklus der kapitalistischen Dekadenz – Krise, Krieg, Wiederaufbau, neue Krise – eingeleitet. Von nun an war es dem Kapitalismus eigentlich nicht mehr möglich, einen Wiederaufbau zu betreiben nach einem dritten Weltkrieg, der wahrscheinlich die Auslöschung der Menschheit oder im günstigsten Fall einen Rückfall von unkalkulierbaren Proportionen bedeuten würde. Die historische Wahl, die die Menschheit jetzt hat, lautet nicht mehr nur: Revolution oder Krieg, sondern: Revolution oder die Zerstörung der Menschheit.
15. 1968 war das Jahr der historischen Wiederbelebung des proletarischen Kampfes als Antwort auf das Auftauchen der Krise, was einen Kurs zu massiven Klassenkonfrontationen eröffnete. Ohne dieses wiedererwachte Proletariat zu besiegen, wird die herrschende Klasse nicht fähig sein, die Gesellschaft in den Krieg zu führen, der, selbst wenn er sicherlich die Selbstzerstörung des Kapitalismus bedeuten würde, das „logische“ Ergebnis der fundamentalen Widersprüche des Systems bleibt. Diese neue Periode von Arbeiterkämpfen manifestierte sich in drei internationalen Wellen (68–74, 78–81, 83–89), doch der Zusammenbruch des Ostblocks 1989 verursachte mit seinen Begleitkampagnen über den Sturz des Kommunismus und das Ende des Klassenkampfes einen erheblichen Bruch mit der gesamten Periode. Die Arbeiterklasse hatte zwar keine vernichtende historische Niederlage erlitten, und die Drohung eines dritten Weltkrieges, die bereits durch die Wiederbelebung des Klassenkampfes in Schach gehalten worden war, wurde durch neue objektive Barrieren gegen die Wiedererschaffung von imperialistischen Blöcken, insbesondere durch die ausgeprägte Tendenz des „Jeder-für-sich“ in der neuen Periode, nun noch weiter nach hinten auf der historischen Tagesordnung gerückt. Dennoch sah sich die Arbeiterklasse, deren Kämpfe in der Periode von 1969–1989 die Bourgeoisie daran gehindert hatten, ihre „Lösung“ der Wirtschaftskrise durchzusetzen, nun immer mehr den Konsequenzen aus ihrem eigenen Scheitern gegenüber, ihre Kämpfe auf eine höhere, politische Stufe zu stellen und der Menschheit eine Alternative anzubieten. Die Zerfallsperiode, das Resultat dieses „Patts“ zwischen den beiden Hauptklassen, bringt der ausgebeuteten Klasse keinerlei positiven Früchte ein. Obwohl die Kampfbereitschaft der Klasse auch in dieser Periode nicht ausgetilgt wurde und ein Prozess der unterirdischen Reifung des Bewusstseins immer noch konstatiert werden konnte, besonders in Gestalt „suchender Elemente“, kleiner politisierter Minderheiten, trat der Klassenkampf überall den Rückzug an und tut dies noch heute. Die Arbeiterklasse sah sich in dieser Periode nicht nur mit ihren eigenen politischen Mängeln konfrontiert, sondern auch mit der Gefahr, ihre Klassenidentität unter dem Gewicht eines sich auflösenden Gesellschaftssystems zu verlieren.
16. Diese Gefahr ist nicht grundsätzlich das Resultat der Reorganisation der Produktion und der Arbeitsteilung nach den Erfordernissen der Wirtschaftskrise (z.B. die Umschichtung vom sekundären auf den tertiären Bereich in vielen entwickelten Ländern, Computerisierung, etc.); sie resultiert auch und zuerst aus den allgegenwärtigen Tendenzen des Zerfalls (die beschleunigte Atomisierung der gesellschaftlichen Beziehungen, Kriminalisierung) und
– noch viel wichtiger – aus dem systematischen Angriff gegen die historische Perspektive des Proletariats, der im Schatten des Zusammenbruchs des „Kommunismus“ von der Bourgeoisie ausgeübt wurde. Der Kapitalismus kann in der Tat nicht ohne eine Arbeiterklasse funktionieren, aber die Arbeiterklasse kann zeitweise jedes Bewusstsein über ihre Existenz als Klasse verlieren. Dieser Prozess wird täglich spontan und objektiv vom Zerfall gefördert, und die herrschende Klasse tut ihr Übriges, bewusst alle Manifestationen des Zerfalls zu benutzen, um die Klasse noch weiter zu atomisieren. Der aktuelle Aufstieg der Rechtsextremen, die aus den Ängsten in der Bevölkerung, von verzweifelten Flüchtlingen aus den von Krieg und Krise am meisten betroffenen Ländern überflutet zu werden, Kapital schlugen, ist ein Beispiel dafür, wie auch das Ausnutzen der Ängste vor dem Terrorismus für die Stärkung des Repressionsarsenals des Staates.
17. Obgleich der Zerfall des Kapitalismus aus dieser historischen „Sackgasse“ zwischen den Klassen resultiert, ist diese Situation beileibe nicht statisch. Die Wirtschaftskrise, die am Anfang sowohl des Kriegskurses als auch der proletarischen Antwort stehen kann, vertieft sich weiter, doch im Gegensatz zur Periode von 1968–89, als das Ergebnis der damaligen Klassenkonfrontationen nur der Weltkrieg oder die Weltrevolution sein konnte, eröffnet die neue Periode eine dritte Alternative: die Zerstörung der Menschheit nicht durch einen apokalyptischen Krieg, sondern durch ein allmähliches Fortschreiten des Zerfalls, der nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit des Proletariats untergraben könnte, als eine Klasse zu antworten, und der den Planeten durch eine Spirale von regionalen Kriegen und ökologischen Katastrophen gleichermaßen unbewohnbar machen könnte. Um einen Weltkrieg zu führen, müsste die Bourgeoisie zunächst die Hauptbataillone der Arbeiterklasse offen konfrontieren, besiegen und sie anschließend dazu mobilisieren, mit Begeisterung hinter den Bannern und der Ideologie eines neuen imperialistischen Blocks zu marschieren. In dem neuen Szenario könnte die Arbeiterklasse schleichend und indirekt besiegt werden, wenn es ihr nicht gelingt, auf die Krise des Systems zu antworten, und sie hinnimmt, dass sie immer tiefer in den Pfuhl des Zerfalls gedrängt wird. Kurz: die Klasse und ihre revolutionären Minderheiten werden mit einer viel gefährlicheren und schwierigeren Perspektive konfrontiert.
18. Die Notwendigkeit für Marxisten zu begreifen, dass es einen grundsätzlichen Wechsel im Szenario für die Menschheit gegeben hat, wird von der wachsenden Bedrohung für die natürliche Umwelt unterstrichen, die von der bloßen Fortsetzung der kapitalistischen Produktion ausgeht. Immer mehr Wissenschaftler schlagen Alarm wegen der Möglichkeiten eines „positiven Feedbacks“ im Prozess der globalen Erwärmung, zum Beispiel im Fall des Amazonas-Gebiets, wo die kombinierten Auswirkungen von Rodungen und anderer Eingriffe genauso wie die steigenden Temperaturen die Zerstörungsrate dramatisch beschleunigen. Wenn die Vernichtung ungebremst weitergeht, würde dies weitere Massen von Kohlendioxyd in die Atmosphäre freigeben, was die globale Temperatur noch weiter ansteigen lassen würde. Hinzu kommt, dass die Intensivierung der ökologischen Gefahren nur massive destabilisierende Auswirkungen auf die Gesellschaftsstrukturen, auf die Wirtschaft und auf die interimperialistischen Beziehungen haben kann. In diesem Bereich kann die Arbeiterklasse nur wenig tun, um diesen Abwärtstrend aufzuhalten, bis sie die politische Macht auf Weltebene übernommen hat; und je länger sich die Weltrevolution verzögert, desto größer ist die Gefahr, dass das Proletariat überwältigt und die eigentliche Grundlage des gesellschaftlichen Wiederaufbaus untergraben wird.
19. Trotz der sich anhäufenden Gefahren akzeptiert die Mehrheit der linkskommunistischen Gruppen nicht das Konzept des kapitalistischen Zerfalls, auch wenn sie ihre sichtbaren Manifestationen im wachsenden Chaos auf internationaler und gesellschaftlicher Ebene durchaus sehen. In der Tat hat die neue und beispiellose Periode des Zerfalls, weit davon entfernt, einen klaren Blick auf die Perspektive zu verschaffen, mit der die Arbeiterklasse konfrontiert ist, für eine große theoretische Verwirrung gesorgt. Die bordigistischen Gruppen haben nie eine feste Theorie der Dekadenz besessen, auch wenn sie den Kurs zum imperialistischen Krieg in dieser Epoche durchaus anerkennen und daher noch immer in der Lage sind, auf internationalistische Weise zu antworten. Auch sind sie nicht in der Lage, das Konzept des historischen Kurses zu übernehmen, das während der 1930er-Jahre von der italienischen Fraktion erarbeitet worden war – der Gedanke, dass der imperialistische Weltkrieg zuvor eine Niederlage und aktive Kriegsmobilisierung des Proletariats erfordert. Ihnen mangelt es also an den beiden fundamentalen theoretischen Stützpfeilern des Konzeptes des Zerfalls. Das IBRP hat, obwohl es den Begriff der Dekadenz akzeptiert, ebenfalls das Konzept der Italienischen Linken über den historischen Kurs abgelehnt. Darüber hinaus zeigen jüngste Verlautbarungen dieser Strömung, dass ihnen ihr Verständnis des Dekadenzkonzeptes abhanden kommt. Eine Polemik gegen die Auffassung der IKS zum Zerfall enthüllt ganz offensichtlich die Inkohärenz der Positionen, die sie nun anzunehmen gedenken:
„Die Tendenz zum Zerfall, die die apokalyptische Sichtweise der IKS überall aufzuspüren vermeint, würde in der Tat beinhalten, dass die kapitalistische Gesellschaft sich am Rande des Abgrunds befindet, wenn dies zuträfe. Jedoch ist dies nicht der Fall, und wenn die IKS die Phänomene der zeitgenössischen Gesellschaft etwas dialektischer untersuchen würde, würde dies offensichtlich werden. Während auf der einen Seite die alten Strukturen kollabieren, entstehen auf der anderen Seite neue. Deutschland zum Beispiel hätte sich nicht wiedervereinigen können ohne den Zusammenbruch der Deutschen Demokratischen Republik und dem Zusammenbruch des russischen Blocks. Die Länder der Comecon hätten der EU nicht beitreten können ohne die Auflösung der Comecon, etc. Der Prozess des Zusammenbruchs ist gleichzeitig ein Prozess des Wiederaufbaus. Obwohl die IKS anerkennt, dass es eine Tendenz zur Neuzusammensetzung gibt, betrachtet sie diese im Angesicht der vorherrschenden Tendenz zu Zerfall und Chaos als unbedeutend. (...) Der IKS ist es nicht gelungen zu demonstrieren, wie diese Tendenz der kapitalistischen Infrastruktur entspringt. Die Schwierigkeit, mit der sie es zu tun hat, besteht in der Tatsache, dass es die Tendenz zur Neuzusammensetzung ist, die den Kräften der kapitalistischen Infrastruktur entspringt. Insbesondere die fortschreitende Wirtschaftskrise, die aus der verminderten Profitabilität des Kapitals herrührt, zwingt das schwächere Kapital in Handelsblöcke, und somit sind die Handelsblöcke die Auswahl, aus denen die künftigen imperialistischen Blöcke gebildet werden.“ (Revolutionary Perspectives, Nr. 27)
Angesichts dieser Hypothese ist es notwendig, folgende drei Punkte festzuhalten:
– Der Marxismus hat stets darauf beharrt, dass der Beginn der Epoche des Abstiegs des Kapitalismus die historische Alternative zwischen Sozialismus oder Barbarei stellt. Bevor sie Häme über die „apokalyptische Sichtweise“ der IKS ausschütten, sollten sich die Genossen des IBRP fragen, ob sie den Ernst der Weltlage und die zerstörerische Dynamik, der das Kapital aufgrund seiner historischen Sackgasse ausgesetzt ist, nicht unterschätzen.
Es geht nicht darum, den Zeitpunkt des endgültigen Zusammenbruchs zu benennen; die Tendenz zum Zusammenbruch wohnt der gesamten dekadenten Periode seit, als der alte Rahmen des Wirtschaftswachstums zerbrach und der buchstäbliche Zusammenbruch des Systems allein von den entsprechenden Maßnahmen der herrschenden Klasse aufgehalten wurde – durch staatliche Kontrolle der Wirtschaft und die Flucht in den Krieg, der selbst die Gefahr des Zusammenbruchs in einem viel zerstörerischen Ausmaß als durch das einfache Stottern des Wirtschaftsmotors heraufbeschwört. Darüber hinaus bedeutet die Zerfallsphase eine reale Beschleunigung dieses nach unten gerichteten Momentums. Dies wird vielleicht am offensichtlichsten auf der Ebene der interimperialistischen Beziehungen, wo die internationale Konkurrenz am gnadenlosesten und anarchischsten ist. Auf der ökonomischen Ebene hingegen ist die herrschende Klasse besser in der Lage, die Gefahr der entfesselten Konkurrenz zwischen den nationalen Kapitalien abzuschwächen (z.B. erkannte die US-Bourgeoisie die Notwendigkeit, ihren wirtschaftlichen Hauptrivalen, Japan, zu stützen).
– In der Dekadenzperiode gibt es keine „dialektische“ Harmonie zwischen „Neuzusammensetzung“ und Zerfall. Der Zerfall ist die endgültige Phase einer Tendenz zu Chaos und Katastrophe, die bereits vom ersten Kongress der Dritten Internationalen identifiziert worden war. In der dekadenten Epoche wird der Krieg eines Jeden-gegen-jeden – keine Erfindung von Hobbes, ssondern die fundamentale Realität einer Gesellschaft, die auf der allgemeinen Warenwirtschaft beruht – keineswegs durch die Bildung riesiger „staatskapitalistischer Trusts“ und imperialistischer Blöcke ad acta gelegt; wie Bucharin schon 1915 feststellte. Diese Gebilde heben die grundlegende Anarchie des Kapitals vielmehr auf eine noch höhere und noch destruktivere Stufe. Dies ist die Tendenz, die der „kapitalistischen Infrastruktur“ entspringt, wenn diese nicht mehr in Übereinstimmung mit ihren eigenen Gesetzen wachsen kann. Auf der einen Seite gibt es in dieser Epoche keine spontane Tendenz zur Wiederherstellung. Wenn die Genossen damit den Wiederaufbau meinen, dann geschah dies nach der fürchterlichen physischen Vernichtung durch den imperialistischen Krieg und ist zudem für den heutigen Kapitalismus nicht mehr möglich. Auf der anderen Seite: Wenn sie meinen, dass die „Neuzusammensetzung“ eine natürliche und friedliche Evolution des „modernen“ Kapitalismus ausdrückt, würde dies, so scheint es, den Einfluss „autonomistischer“ Theorien aufzeigen, die die katastrophistische Sichtweise ablehnen, die dem Marxismus innewohnt. Auch weist die Teil-Akzeptanz der Ideologie der Globalisierung, der Mikrochip-Revolution, etc. auf eine tatsächliche Konzession gegenüber den aktuellen bürgerlichen Kampagnen über einen neuen Aufstieg des Kapitalismus hin.
– Schließlich: Wenn „Neuzusammensetzung“ bedeutet, dass neue imperialistische Blöcke bereits gebildet sind, so beruht dies auf einer falschen Identifikation von Handelsbündnissen mit imperialistischen Blöcken, die einen fundamental militärischen Charakter haben. Die Irak-Krise hat insbesondere gezeigt, dass „Europa“ heute in seinen Beziehungen zu den USA total gespalten ist. Die Faktoren, die die Bildung neuer Blöcke verhindern, bleiben weiterhin gültig: tiefgehende Spaltungen unter den potenziellen Mitgliedern eines deutschen Blocks; die massive militärische Überlegenheit der USA; der Mangel an einer ideologischen Basis für neue Blöcke, was selbst ein Ausdruck der unbesiegten Natur des Proletariats ist.
Die Irrationalität des Krieges in der Dekadenzperiode
20. Die Zerfallsperiode zeigt deutlicher als alles andere die Irrationalität des Krieges in der Dekadenz auf – die Tendenz seiner zerstörerischen Dynamik, autonom und in wachsendem Maße unvereinbar mit der Logik des Profits zu werden. Dies passt nahtlos zu den Grundbedingungen der Akkumulation in der dekadenten Periode. Die Unfähigkeit des Kapitals, in neue „außerhalb liegende Produktionsgebiete“ zu expandieren, behindert immer mehr die „natürliche“ Funktionsweise der Marktgesetze, die, sich selbst überlassen, in eine katastrophale Wirtschaftsblockade münden würden. Die Kriege der Dekadenz machen, anders als die Kriege in der Aufstiegsperiode, ökonomisch keinen Sinn. Im Gegensatz zur Ansicht, Krieg sei „gut“ für die Gesundheit der Wirtschaft, drückt der Krieg heute ihre unheilbare Erkrankung aus und verschlimmert sie. Darüber hinaus hat sich die Irrationalität des Krieges im Verhältnis zu den eigenen Gesetzen des Kapitals während des Verlaufs der Dekadenzperiode noch vergrößert. So verfolgte der Erste Weltkrieg noch ein klares, sichtbares „ökonomisches“ Ziel – im Wesentlichen der Griff nach den Kolonien der Rivalen. In einem gewissen Sinn war dieses Element auch im II. Weltkrieg präsent, obgleich sich bereits zeigte, dass es keine automatische Verknüpfung zwischen wirtschaftlicher Rivalität und militärischen Konfrontationen gibt: So lag die III. Internationale in den frühen 20er Jahren mit ihrer Ansicht falsch, dass der nächste imperialistische Konflikt zwischen den USA und Großbritannien stattfinden werde.
Was den Eindruck vermittelte, dass der II. Weltkrieg eine rationale Funktion für den Kapitalismus besäße, war die lange Wiederaufbauperiode, die ihm folgte und die viele Revolutionäre zur Schlussfolgerung verleitete, dass das Hauptmotiv des Kapitals für den Krieg darin bestünde, Kapital zuerst zu zerstören und daraufhin wieder aufzubauen. In Wirklichkeit war der Krieg nicht das Ergebnis der erklärten Absicht des Nachkriegswiederaufbaus, sondern wurde dem Kapital durch die unbarmherzige Logik der imperialistischen Konkurrenz aufgezwungen, die aus hauptsächlich strategischen Gründen die totale Vernichtung des Gegners erfordert.
Dies ändert nichts an der Tatsache, dass der Kurs zum Krieg im Wesentlichen ein Resultat der wirtschaftlichen Sackgasse des Kapitalismus ist. Doch die Verknüpfung zwischen Krise und Krieg ist keine mechanische Verbindung. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Kapitalismus zur Zeit des Ersten Weltkrieges waren lediglich in embryonaler Form vorhanden; der Zweite Weltkrieg brach aus, nachdem der erste Schock der Depression gerade verdaut war. Die Verschlimmerung der Wirtschaftskrise schafft zwar die allgemeinen Bedingungen für die Verschärfung der imperialistischen Rivalitäten, doch die Geschichte der Dekadenz zeigt, dass die rein ökonomischen Rivalitäten sich in wachsendem Maße den strategischen Interessen unterordnen mussten. Dies drückt umgekehrt die tiefe Ausweglosigkeit aus, in der sich der Kapitalismus befindet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der globale Konflikt zwischen dem amerikanischen und russischen Block fast ausschließlich von strategischen Gesichtspunkten dominiert, da Russland zu keiner Zeit sich als ernsthafter Wirtschaftsrivale der USA positionieren konnte. Und seitdem ist klar, dass der Weltkrieg nicht die ökonomischen Probleme des Kapitalismus lösen kann, dass er statt dessen zur finalen Selbstzerstörung des gesamten Systems führt.
Ferner demonstriert auch die Art, wie die Periode der Blöcke zu Ende ging, die ruinösen ökonomischen Kosten des Militarismus: Der schwächere russische Block brach zusammen, weil er nicht imstande war, die ökonomischen Kosten für das Wettrüsten zu schultern (und gleichermaßen unfähig war, das Proletariat für den Krieg zu mobilisieren, um sich vom strategischen und wirtschaftlichen Würgegriff zu befreien, den der stärkere US-Block angelegt hatte). Und entgegen aller Voraussagen, dass der „Fall des Kommunismus“ den kapitalistischen Unternehmern eine glänzende neue Zukunft verschaffen würde, hat die Wirtschaftskrise seither ihre Verwüstungen fortgesetzt, im Westen genauso wie in den früheren Ostblockländern.
Heute beinhaltet der US-Krieg gegen den Terrorismus auch die Verteidigung der unmittelbaren Wirtschaftsinteressen der USA zuhause und rund um den Globus. Die Kriegslüsternheit der USA wird von der rapiden Erschöpfung der Optionen für ihre Wirtschaft noch weiter angestachelt werden. Doch im Wesentlichen wird sie von den Strategien der USA diktiert, um ihre weltweite Führerschaft aufrechtzuerhalten und zu stärken. Die immensen Kosten, die sich im ersten Golfkrieg 1991, in Serbien 1999, Afghanistan 2001 und im Golfkrieg von 2003 auftürmten, weisen das oberflächliche Argument zurück, dass diese Kriege zu Gunsten der multinationalen Erdölgesellschaften oder in Hinblick auf die saftigen Verträge für den Nachkriegswiederaufbau ausgefochten wurden. Der wahrscheinliche Wiederaufbau im Iraks nach dem Krieg wird zudem von einem ideologischen und politischen Bedürfnis motiviert sein: Er wird eine unerlässliche, aber nicht ausreichende Bedingung für die amerikanische Vorherrschaft in diesem Land sein.
Der Krieg ruiniert das Kapital – er ist sowohl ein Produkt seines Niedergangs als auch treibender Faktor bei dessen Beschleunigung. Die Entwicklung einer blutigen Kriegswirtschaft bietet keine Lösung der Krise des Kapitalismus, wie einige Elemente der italienischen Fraktion in den 30er-Jahren annahmen. Die Kriegswirtschaft existiert nicht für sich selbst, sondern weil der Kapitalismus in der Dekadenz dazu gezwungen ist, einen Krieg nach dem anderen zu führen und zunehmend die gesamte Wirtschaft den Kriegsbedürfnissen unterzuordnen. Dies bewirkt einen gewaltigen Aderlass in der Wirtschaft, da Rüstungsausgaben letztlich unfruchtbar sind. In diesem Sinn gibt uns der Zusammenbruch des russischen Blocks eine Ahnung von der Zukunft des Kapitals, denn die Unfähigkeit des Ostblocks, einem sich beschleunigenden Rüstungswettlauf standzuhalten, war einer der Schlüsselfaktoren für sein Ableben. Und obwohl dies ein vom US-Block bewusst verfolgtes Resultat war, bewegt sich heute die USA selbst auf einen ähnlichen Zustand hin, auch wenn dies in einem langsameren Tempo geschieht. Der gegenwärtige Krieg am Golf und – allgemeiner – der ganze „Krieg gegen den Terrorismus“ ist mit einem starken Anstieg der Rüstungsausgaben verknüpft, um die Wehretats des Rests der Welt in den Schatten zu stellen. Doch der Schaden, den dieses ungesunde Projekt für die US-Wirtschaft bewirken wird, ist unkalkulierbar.
21. Die zutiefst irrationale Natur des Krieges in der dekadenten Periode wird auch durch seine ideologischen Rechtfertigungen demonstriert, eine Realität, die bereits mit dem Aufstieg des Nazismus in der Periode vor dem Zweiten Weltkrieg enthüllt wurde. So ist in Afrika ein Land nach dem anderen Bürgerkriegen ausgesetzt, in denen marodierende Banden ohne den Anschein eines ideologischen Vorwandes töten und verstümmeln sowie die ohnehin zerbrechliche Infrastruktur ohne jede Aussicht auf eine Nachkriegsrenaissance zerstören. Die Flucht einer wachsenden Zahl von Staaten in den Terrorismus und besonders das Wachstum des islamistische Terrorismus mit seinen Selbstmord- und Todesphantasien sind weitere Ausdrücke einer Gesellschaft in voller Verwesung, gefangen in einer tödlichen Spirale der Zerstörung um ihrer selbst willen. Gemäß den Genossen von CWO, „stellt (al-Qaida) einen Versuch dar, einen unabhängigen nahöstlichen Imperialismus zu installieren, der auf dem Islam und den Grenzen des Ummayal-Reiches im 8. Jahrhundert beruht. Es ist nicht einfach eine Bewegung, die Zerfall und Chaos ausdrückt“. (RP, Nr. 27) Tatsächlich ist ein solch reaktionäres und unrealistisches Ziel nicht rationaler als Bin Ladens zweite heimliche Hoffnung, dass seine Aktionen uns dem Jüngsten Gericht einen Schritt näher bringt. Der Islamismus ist eine reine Kreatur des Zerfalls.
Im Gegensatz dazu präsentiert sich die Rechtfertigung des Krieges durch die demokratischen Großmächte immer noch allgemein im Gewand des Humanitarismus, der Demokratie und anderen fortschrittlichen und rationaler Ziele. In der Tat herrscht eine große Kluft zwischen den Rechtfertigungen, die die imperialistischen Staaten anbieten, und den wirklich niederträchtigen Motiven und Handlungen, die dahinter stecken. So schimmert die ganze Irrationalität des Vorhabens der USA allmählich durch den ideologischen Nebel hervor: ein neues Imperium, in dem eine einzige Macht unangefochten und für immer herrscht. Die Geschichte, und insbesondere die Geschichte des Kapitalismus, hat bereits die Hohlheit solcher Träume aufgezeigt. Doch dies hat nicht die Entwicklung einer neuen und zutiefst rückwärtsgewandten Ideologie verhindert, um das ganze Projekt zu rechtfertigen: das Konzept eines neuen und humanen Kolonialismus, das von einer Reihe amerikanischer und britischer Ideologen heute ernst genommen wird.
Der Klassenkampf
22. Es ist äußerst wichtig, den Unterschied zwischen dem historischen Gewicht der Klasse und ihrem unmittelbaren Einfluss auf die Situation zu begreifen. Unmittelbar kann die Klasse nicht die gegenwärtigen Kriege verhindern und befindet sich womöglich auf dem Rückzug, aber dies ist nicht dasselbe wie eine historische Niederlage. Die Tatsache, dass die Bourgeoisie nicht fähig ist, die Klasse für den direkten interimperialistischen Konflikt zwischen den Großmächten zu mobilisieren, und ihn statt dessen auf zweit- und drittrangige Staaten „ablenken“ muss, wobei nur Berufssoldaten rekrutiert werden, ist ein Ausdruck für dieses historische Gewicht der Klasse.
Selbst im Zusammenhang mit diesen „abgelenkten“ Kriegen ist die Bourgeoisie, wenn sie die Einsätze, die auf dem Spiel stehen, erhöhen will, dazu gezwungen, Präventivmaßnahmen gegen die Arbeiterklasse zu ergreifen. Die Organisation der pazifistischen Demonstrationen in einer nie da gewesenen Dimension (sowohl in der Größe dieser Demonstrationen als auch bezüglich ihrer internationalen Koordination) bezeugt die Unruhe der herrschenden Klasse über die sich steigernde Feindseligkeit gegen ihren Kriegskurs sowohl in der Bevölkerung im Allgemeinen als auch in der Arbeiterklasse im Besonderen. Im Moment geht der Hauptstoß der pazifistischen Kampagnen dahin, ihre Klassen übergreifende, demokratische Natur, ihre Appelle an die UN und die pazifistischen Absichten der Rivalen Amerikas hervorzuheben. Doch noch während die Reden vom Podium der Proteste ausgespuckt werden, gibt es bereits einen starken Zug zur ouvrieristischen Demagogie, zum Gerede über die Mobilisierung der Macht der Gewerkschaften, über illegale Streikaktionen, wenn der Krieg ausbricht, und selbst zur Wiederaufwärmung klassischer internationalistischer Parolen wie: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“ Hinter dieser Rhetorik wird das Wissen der Bourgeoisie darübers deutlich, dass der Kriegskurs die Konfrontation mit dem Widerstand ihres Hauptopfers, die Arbeiterklasse, auf Dauer nicht vermeiden kann, auch wenn die aktuelle Klassenopposition zum Krieg sich auf vereinzelte, isolierte Reaktionen von Arbeitern oder auf die Aktivitäten einer kleinen revolutionären Minderheit beschränkt.
23. All dies ist Beweis genug, dass sich der historische Kurs nicht gewendet hat, auch wenn im Zerfall die Bedingungen, unter denen er sich entfaltet, sich sichtlich geändert haben. Was mit dem Zerfall hinzu gekommen ist, ist die Möglichkeit einer historischen Niederlage nicht durch einen Frontalzusammenstoß zwischen den Hauptklassen, sondern durch ein langsames Dahinsiechen der Fähigkeit des Proletariats, sich selbst als eine Klasse zu konstituieren, was es erschweren würde, den „Point of no Return“ wahrzunehmen, da dieser bereits vor dem definitiven katastrophalen Ende erreicht wäre. Das ist die tödliche Gefahr, vor der die Klasse heut steht. Doch wir sind davon überzeugt, dass dieser Punkt noch nicht erreicht ist und dass das Proletariat seine Fähigkeit beibehalten hat, seine historische Mission wiederzuentdecken. Um das wirkliche Potenzial innerhalb des Proletariats zu berücksichtigen und die Verantwortung anzunehmen, die es den Revolutionären aufzwingt, ist es um so wichtiger, nicht mit einer immediatistischen Analyse der Lage zu beginnen.
24. Ohne einen klaren historischen Rahmen für das Verständnis der aktuellen Lage der Klasse ist es allzu naheliegend, in ein immediatistisches Verhalten zu fallen, das zwischen euphorischer Stimmung und schwärzestem Pessimismus schwanken kann. In der gegenwärtigen Periode wird der Haupttrend im proletarischen Milieu von falschen Hoffnungen über massive Klassenbewegungen getragen: So sah eine Zahl von Gruppen im Aufruhr in Argentinien im Dezember 2002 den Beginn einer Bewegung zur proletarischen Erhebung, obwohl die Bewegung sich nicht auf das fundamentale Klassenterrain stellte. Auch der Streik der Feuerwehrleuten in Großbritannien wurde als Brennpunkt des massiven Klassenwiderstandes gegen den Kriegskurs interpretiert. Oder es gab, bei Abwesenheit offener gesellschaftlicher Bewegungen, eine Neigung, den großen Haufen der gewerkschaftlichen Organismen als Basis für die Vorbereitung auf die künftige Wiederbelebung des Klassenkampfes zu betrachten.
25. Im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen historischen Kurs bleibt die Perspektive des Klassenkampfes die Wiederbelebung der Massenkämpfe als Antwort auf die sich vertiefende Krise. Diese Kämpfe werden der Dynamik des Massenstreiks folgen, die typisch ist für die wirkliche Klassenbewegung in der Epoche der Dekadenz: Sie werden nicht im Voraus von einem bereits bestehenden Organ organisiert. Nur durch die Tendenz zu Massenkämpfen wird die Klasse ihre Klassenidentität wiedererlangen, die eine unerlässliche Vorbedingung für die eigentliche Politisierung des Kampfes ist. Doch wir sollten in Erinnerung behalten, dass solchen Bewegungen unvermeidlich eine Reihe von Geplänkeln vorausgehen wird, die unter gewerkschaftlicher Kontrolle bleiben, und selbst wenn sie einen massiveren Charakter annehmen, werden sie nicht geradwegs, in „reiner Form“ auftreten, d.h. offen außerhalb und gegen die Gewerkschaften sowie von unabhängigen Versammlungen und Streikkomitees organisiert und zentralisiert. In der Tat wird es für die revolutionären Minderheiten und fortschrittlichen Arbeitergruppen wichtiger denn je sein, die Perspektive der Bildung solcher Organismen innerhalb der kommenden Bewegungen zu verteidigen.
26. Es gab während der 90er Jahre viele solcher Geplänkel, und sie drückten die Gegentendenz zum allgegenwärtigen Rückzug aus. Doch ihr Mangel an jeglicher politischen Dimension wurde von der Bourgeoisie benutzt, um die Unordnung in der Klasse zu steigern. Ein besonders wichtiger Trumpf in den 90ern bestand darin, linke Regierungen zu installieren, die in der Lage waren, dem Arsenal der Bourgeoisie an demokratischer und reformistischer Ideologie einen starken Schub zu geben. In Einklang damit haben die Gewerkschaften eine Reihe von Präventivaktionen organisiert, um die wachsende Unzufriedenheit in der Klasse zu kanalisieren. Am spektakulärsten waren die Streiks in Frankreich im Dezember 1995, welche zum Schein über die Gewerkschaften hinausgingen und sich an der Basis vereinigten, um so zu verhindern, dass dies tatsächlich passiert. Seitdem wurden die Gewerkschaftskampagnen entsprechend der Desorientierung in der Klasse leiser; dennoch kann heute eine Rückkehr zu konfrontativeren Antworten am Beispiel der ausgerufenen oder angedrohten Streiks im öffentlichen Sektor Großbritanniens, Frankreichs, Spaniens, Deutschlands und anderswo festgestellt werden.
27. Der Marxismus hat stets darauf bestanden, dass es nicht ausreichend ist, den Klassenkampf nur aus dem Blickwinkel des Proletariats zu betrachten, da auch die Bourgeoisie einen Klassenkampf gegen das Proletariat und gegen dessen Bewusstwerdung führt. Es war immer ein Schlüsselelement in der Handlungsweise des Marxismus gewesen, die Strategien und Taktiken zu untersuchen, die von der herrschenden Klasse benutzt werden, um ihrem Todfeind zuvorzukommen. Ein wichtiger Teil dessen ist die Analyse, welches Regierungsteam in welchem Moment der Entwicklung des Klassenkampfes und der allgemeinen Gesellschaftskrise von der Bourgeoisie bevorzugt zusammengesetzt wird.
28. Wie die IKS bereits in ihren ersten Tagen bemerkt hat, bestand die anfängliche Antwort der herrschenden Klasse auf die historische Wiederauferstehung des Klassenkampfes Ende der 60er Jahre darin, linke Mannschaften ans Ruder zu setzen und Arbeiterkämpfe abzulenken, indem linke Regierungen der Bewegung als falsche Perspektive angedient wurden. Wir sahen dann, Ende der 70er Jahre, als Antwort auf die zweite internationale Welle von Kämpfen die Annahme einer neuen Strategie, mit der die Rechte wieder an die Regierung gehievt und die Linke in die Opposition entlassen wurde, um den Arbeiterwiderstand von innen zu sabotieren. Zwar fanden sie nie auf sämtliche Länder automatisch Anwendung, doch zumindest in den wichtigsten kapitalistischen Ländern konnten solche Strategien festgestellt werden.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks gab es jedoch, entsprechend dem Rückgang im Bewusstsein der Arbeiterklasse, keine Notwendigkeit mehr, diese Rollenverteilung weiter aufrechtzuerhalten, und in einer Reihe von Ländern wurden mit Blick sowohl auf das Management der Wirtschaftskrise als auch auf das Bedürfnis, die gegenwärtige Flucht des Kapitalismus in den Militarismus als eine neue Form des Humanitarismus darzustellen, Mitte-Links-Regierungen vom Typ des Blair-Regimes in Großbritannien als best geeignete Regierungsteams bevorzugt.
Der aktuelle Aufstieg der rechten Parteien in Regierungsämter bedeutet dagegen nicht, dass die herrschende Klasse zur konzertierten Strategie der Linken in die Opposition zurückkehrt. Das Zustandekommen rechter Regierungen in einer Reihe von zentralen kapitalistischen Ländern ist vielmehr der Ausdruck des Mangels an Kohärenz innerhalb der nationalen Bourgeoisien und zwischen ihnen, was eine der Folgen des Zerfalls ist. Ein grosser Fortschritt im Klassenkampf wäre erforderlich, damit die Bourgeoisie ihre Spaltung überwinden und eine einheitlichere Antwort erteilen würde: zur Strategie der Linken in der Opposition zurückkehren, um einer ernsthaften Wiederbelebungder Klassenbewegung entgegen zu treten, und als letzte Karte die Installierung einer „Linksextremen“ an der Macht im Falle einer direkten revolutionären Bedrohung durch die Arbeiterklasse.
29. Auch wenn die Hauptstoßrichtung der Arbeiterkämpfe sich nicht direkt gegen den Krieg entwickeln wird, sollten die Revolutionäre die Augen offen halten gegenüber den Klassenreaktionen, die da kommen werden. Sie sollten dabei im Kopf behalten, dass die Kriegsfrage immer mehr zu einem Faktor in der Weiterentwicklung eines politischen Bewusstseins darüber werden wird, was im Klassenkampf auf dem Spiel steht, besonders da die Aufblähung der Kriegswirtschaft in wachsendem Maß die Notwendigkeit von Einschnitten im Lebensstandard der Arbeiterklasse mit sich bringen wird. Die immer engere Verknüpfung zwischen der Krise und dem Krieg wird sich zunächst in der Formierung von Minderheiten ausdrücken, deren Ziel es ist, eine internationalistische Antwort gegen den Krieg zu richten, aber sie wird ebenfalls dazu tendieren, die allgemeinere Bewegung zu durchdringen, sobald die Klasse ihr Vertrauen wiederentdeckt hat und die Kriege der herrschenden Klasse nicht mehr als Beweis ihrer eigenen Machtlosigkeit ansieht.
30. Die neue Generation von „suchenden Elementen“, eine Minderheit, die sich hin zu Klassenpositionen bewegt, wird in den künftigen Arbeiterkämpfen eine Rolle von unerhörter Bedeutung haben, die viel schneller und tiefer als die Kämpfe von 68–89 mit ihren politischen Auswirkungen konfrontiert werden. Diese Elemente, die bereits eine langsame, aber bedeutsame Entwicklung des Bewusstseins in der Tiefe ausdrücken, werden dazu aufgerufen sein, der massiven Ausbreitung des Bewusstseins in der gesamten Klasse Beistand zu leisten. Dieser Prozess erreicht seinen höchsten Punkt mit der Bildung der kommunistischen Weltpartei. Doch diese kann nur Wirklichkeit werden, falls die existierenden linkskommunistischen Gruppen ihrer historischen Verantwortung gerecht werden. Besonders heute bedeutet dies, den Gefahren ins Auge zu schauen, die vor ihnen liegen. So wie die Abdankung der Arbeiterklasse gegenüber der Logik des Zerfalls sie der Fähigkeit beraubt, für eine Antwort auf die Krise zu sorgen, der sich die Menschheit gegenüber sieht, so riskiert die revolutionäre Minderheit ihre Zerstörung und Einebnung durch die verkommende Umwelt, von welcher sie umgeben ist und die ihre Reihen in Gestalt des Parasitismus, Opportunismus, Sektierertums und der theoretischen Konfusion penetriert. Die Revolutionäre können heute in die intakten Kapazitäten ihrer Klasse und mit demselben Recht in die Fähigkeit des revolutionären Milieus vertrauen, auf die Erfordernisse zu antworten, die die Geschichte auf ihre Schultern geladen hat. Sie wissen, dass sie ihre Arbeit langfristig sehen und alle immediatistischen Fallstricke vermeiden müssen. Doch gleichzeitig müssen sie begreifen, dass wir nicht alle Zeit der Welt haben und dass ernste Fehler, die heute begangen werden, morgen Hindernisse auf dem Weg zur Formierung der Klassenpartei bilden.
IKS
Fußnoten:
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Zerfall [81]
Erbe der kommunistischen Linke:
Der Arabisch/Jüdische Konflikt: Die Positionen der Internationalisten in den 30er Jahren: Bilan Nr. 30 und 31
- 4593 Aufrufe
Die folgenden Artikel sind 1936 in der Revue BILAN, Organ der Italienischen Linkskommunistischen Fraktion, Nr. 30 und 31 veröffentlicht worden. Es war bitter nötig, dass die Fraktion die marxistische Position gegenüber dem Arabisch/Jüdischen Konflikt entwickelte, da der Generalstreik gegen die jüdische Einwanderung zu einer Reihe von blutigen Pogromen eskaliert war. Auch wenn einige spezifische Aspekte der aktuellen Situation sich geändert haben, fällt auf, in welchem Ausmaß in diesen Artikeln viele Analysen bis auf die heutige Zeit noch Gültigkeit haben. Insbesondere zeigen die Artikel mit großer Genauigkeit auf, wie die “nationalistischen” Bewegungen, sowohl die jüdische wie auch die arabische, auch wenn beide aufgrund von Verfolgung und Unterdrückung entstanden sind, sich mit den rivalisierenden imperialistischen Mächten unentwirrbar verstrickten. Mehr noch, diese Artikel zeigen auf, wie diese Bewegungen benutzt wurden, um die gemeinsamen Interessen der arabischen und jüdischen Arbeiterklasse zu verdunkeln und dies zu einem gegenseitigen Massaker, im Interesse ihrer Unterdrücker führte. Die Artikel zeigen also auf:
– Die zionistische Bewegung ist erst ein realistisches Projekt geworden, nachdem sie vom britischen Imperialismus unterstützt wurde, weil dieser versuchte, wie er es nannte, “ein kleines Irland” im Nahen Osten zu erschaffen, da diese Zone mit der Entwicklung der Erdölindustrie strategisch immer wichtiger wurde.
– Großbritannien unterstützte zwar das zionistische Projekt, spielte aber gleichzeitig ein doppeltes Spiel: Es musste auf den wichtigen arabisch-moslemischen Bevölkerungsanteil in ihrem kolonialen Reich Rücksicht nehmen. Großbritannien benutzte im Ersten Weltkrieg die nationalen arabischen Aspirationen zynisch für sich aus, währenddem es aber beabsichtigten dem osmanischen Reich ein Ende zu setzen, das in Auflösung begriffen war. Sie haben also der arabischen Bevölkerung von Palästina und der restlichen Region alle Arten von leeren Versprechungen gemacht. Diese klassische Politik des “Teilen und Herrschen” hatte zwei Ziele: Das Gleichgewicht zwischen den verschiedenen imperialistischen nationalistischen Ansprüchen die sich in ihrem Reich gegenüberstanden aufrechtzuerhalten, gleichzeitig zu verhindern, dass die ausgebeuteten Massen in der Region ihre gemeinsamen Interessen erkannten.
Die arabische “Befreiungs”-Bewegung, die sich gegen die britische Unterstützung des Zionismus wandte, war genau so wenig antiimperialistisch wie die Elemente in der zionistischen Bewegung, die die Waffen gegen Großbritannien erheben wollten. Die zwei nationalistischen Bewegungen stellten sich also vollständig in den Rahmen des globalen imperialistischen Spiels. Wenn sich eine nationalistische Fraktion gegen seinen alten Unterstützer wandte, musste er Hilfe bei einem anderen Imperialisten suchen. Zur Zeit des israelischen Unabhängigkeitskrieges 1948 war praktisch die ganze zionistische Bewegung offen anti-britisch geworden. Indem sie dies tat, wurde sie ein Instrument des neuen aufsteigenden Imperialismus, der USA, die alles was sie gegen die alten kolonialen Mächte zu ihrer Beseitigung ins Spiel bringen konnten auch einsetzten. Ebenso zeigt BILAN auf, dass der Konflikt zwischen dem arabischen Nationalismus und Großbritannien zur Folge hatte, dass die Türen für den italienischen (und deutschen) Imperialismus aufgestoßen wurden. Danach haben wir gesehen, wie die palästinensische Bourgeoisie wegen ihrem Konflikt mit den USA sich dem russischen Block, später Frankreich und anderen europäischen Mächten zuwandte.
Was sich hauptsächlich geändert hat, seit die Artikel geschrieben wurden, ist, dass es dem Zionismus gelungen ist, einen Staat zu errichten, der grundlegend die Kräfteverhältnisse in der Region verändert hat und dass der dominierende Imperialismus nicht mehr Großbritannien ist, sondern die USA. Aber die Grundlage des Problems bleibt selbst in diesem Fall dieselbe. Die Bildung des Staates Israel, hatte die Vertreibung von zehntausenden von Palästinensern zur Folge, und trieb die Enteignung der palästinensischen Bauern zu ihrem Höhepunkt. BILAN stellt fest, dass diese Entwicklung dem zionistischen Plan innewohnend war. Die Vereinigten Staaten ihrerseits müssen versuchen, ein widersprüchliches Gleichgewicht zwischen der Unterstützung des zionistischen Staates einerseits und andererseits der Notwendigkeit soweit als möglich die “arabische Welt” unter ihrem Einfluss zu halten. In der Zwischenzeit versuchen die Rivalen der USA jeden Antagonismus, der zwischen letzterem und den Ländern dieser Region auftaucht, für sich auszunützen.
Was am meisten auffällt, ist die klare Anprangerung seitens BILAN der beiden Chauvinismen, den arabischen und den jüdischen, die benutzt wurden um die Konflikte in der Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grunde hat die italienische Fraktion jeglichen Kompromiss gegenüber dem wirklichen Internationalismus verworfen. „Für die wirklichen Revolutionäre gibt es natürlich keine ‚palästinensische’ Frage, sondern nur den Kampf aller Unterdrückten des Nahen Ostens, Araber oder Juden, der ein Teil des allgemeinen weltweiten Kampfes der Unterdrückten für die kommunistische Revolution ist.” Sie verwarf also total die stalinistische Politik der Unterstützung des arabischen Nationalismus, unter dem Vorwand den Imperialismus zu bekämpfen. Die seinerzeitige stalinistische Politik wird heute von den trotzkistischen Parteien und anderen Linksextremen aufgenommen, die sich zum Sprachrohr des „palästinensischen Widerstandes“ machen. Diese Positionen sind heute genauso konterrevolutionär wie sie es schon 1936 waren.
Heute werden die Massen beider Seiten zu einem gegenseitigen rasenden Hass ermutigt und der Preis der Massaker ist viel höher als in den 1930er-Jahren. Der unnachgiebige Internationalismus bleibt das einzige Gegenmittel gegen das nationalistische Gift.
IKS, Juni 2002
BILAN Nr. 30 (Mai/Juni 1936)
Die Verschärfung des Arabisch-Jüdischen-Konflikts, die Verstärkung der anti-britischen Orientierung der arabischen Welt, die während des Ersten Weltkriegs eine Bauernfigur des englischen Imperialismus war, hat uns veranlasst, das jüdische Problem und die panarabische Bewegung zu untersuchen. Wir werden dieses Mal versuchen, das erste der beiden Probleme zu behandeln.
Man weiß, dass nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer und der Zerstreuung des jüdischen Volkes, die verschiedenen Länder in die sie geflüchtet waren, wenn sie sie nicht gleich von ihren Territorien verwiesen, (weniger aus religiösen Gründen wie von den katholischen Autoritäten behauptet wurde, sondern aus ökonomischen Gründen, namentlich der Enteignung ihrer Güter und der Annullierung ihrer Kredite), sie gemäß eines päpstlichen Rechtsakts aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die in allen Ländern zum Maßstab wurde, die Lebensbedingungen der Juden reglementierten. Sie wurden gezwungen, in geschlossenen Quartieren (Ghettos) und mit einem erniedrigenden Zeichen versehen, zu leben.
1290 aus England, 1394 aus Frankreich ausgewiesen, emigrierten sie nach Deutschland, Italien und Polen. 1492 aus Spanien und 1498 aus Portugal ausgewiesen, flüchteten sie nach Holland, nach Italien und vor allem ins osmanische Reich, das Nordafrika und den größten Teil von Südosteuropa besetzt hielt. Dort stellten sie und stellen bis heute eine Gemeinschaft dar, die einen jüdisch-spanischen Dialekt spricht, währenddem die, die nach Polen, Russland und Ungarn emigrierten, einen jüdisch-deutschen Dialekt (jiddisch) sprechen. Die hebräische Sprache, die während dieser Zeit die Sprache der Rabbiner blieb, wurde aus der Domäne der toten Sprachen reaktiviert, um die Sprache der Juden in Palästina mit der aktuellen nationalistischen Bewegung zu werden.
Während die Juden im Westen, die zahlenmäßig am Schwächsten waren, und teilweise die der USA, sich durch ihre Präsenz an der Börse und ihren intellektuellen Einfluss durch ihre Anzahl in den liberalen Berufen einen gewissen ökonomischen und politischen Einfluss erworben hatten, konzentrierten sich die großen Massen der Juden in Osteuropa, wo sich schon Ende des 18. Jahrhunderts 80% der Juden Europas aufhielten. Bei der ersten Teilung Polens und der Annexion von Bessarabien kamen sie unter die Herrschaft der Zaren, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts 2/3 der Juden auf ihrem Territorium hatten. Die russische Regierung nahm von Anfang an eine repressive Haltung ein, die von Katherina II. ausging und ihren schärfsten Ausdruck bei Alexander III. fand, der das Judenproblem folgendermaßen lösen wollte: “Ein Drittel muss konvertiert werden, ein Drittel muss auswandern und ein Drittel muss ausgelöscht werden.”
Die Juden wurden in einer bestimmten Anzahl Distrikte der Provinzen im Nordosten (Weißrussland), im Südosten (Ukraine und Bessarabien) und in Polen festgehalten. Dort war ihre Siedlungszone. Sie durften nicht außerhalb der Städte und vor allem nicht in den industrialisierten Gebieten (Bergwerks- und Eisenhütten-Regionen) wohnen. Aber bei genau diesen Juden trat die kapitalistische Durchdringung im 19. Jahrhundert zu Tage und leitete die Klassendifferenzierung ein.
Es war der terroristische Druck der russischen Regierung, der die ersten Impulse für die Kolonisierung Palästinas gab. Jedoch waren die ersten Juden schon während der Vertreibung aus Spanien Ende des 15. Jahrhunderts wieder nach Palästina zurückgekehrt und die erste Landwirtschaftskolonie war 1870 in der Nähe von Jaffa gegründet worden. Aber die erste wirkliche Emigration begann erst nach 1880, als die polizeiliche Verfolgung und die ersten Pogrome die Emigration nach den USA und Richtung Palästina auslösten.
Diese erste Alya (jüdische Immigration) von 1882, die sogenannte “Biluimes”, war mehrheitlich aus russischen Studenten zusammengesetzt, die man als Pioniere der jüdischen Kolonisierung von Palästina sehen kann. Die zweite Alya setzte 1904–05 infolge der Unterdrückung der ersten Revolution in Russland ein. Die Anzahl der Juden, die sich in Palästina niederließen, stieg von 12’000 um 1850, auf 35’000 1882 und auf 90’000 1914.
Das waren alles Juden aus Russland und Rumänien, Intellektuelle und Proletarier, während dem die Juden aus dem Westen, wie die Rothschilds und die Hirschs, sich darauf beschränkten, sich finanziell zu beteiligen, was ihnen einen guten Namen als Philanthropen einbrachte, ohne dass sie ihre wertvolle Persönlichkeit einsetzen mussten.
Bei den “Biluimes” von 1882 waren die Sozialisten noch nicht zahlreich vertreten. Sie setzten bei der damaligen Kontroverse, ob man nach Palästina oder die USA emigrieren sollte, auf letztere. Bei der ersten jüdischen Emigration nach den USA waren die Sozialisten also sehr zahlreich vertreten und bestritten einen guten Teil der Organisationen, der Zeitungen und selbst der kommunistischen Kolonisierungsversuche.
Das zweite Mal tauchte die Frage nach der Richtung der Emigration auf, wie wir bereits gesagt haben, nach der Niederlage der ersten Russischen Revolution und infolge der Verschärfung der Pogrome, die vom Kishinev-Pogrom charakterisiert worden waren. Der Zionismus, der dem jüdischen Volk einen Wohnsitz in Palästina geben wollte und der einen Nationalfond für den Kauf von Land gegründet hatte, spaltete sich am 7. zionistischen Kongress von Baie in eine traditionalistische Strömung, die die Bildung eines jüdischen Staats in Palästina befürwortete und in eine territorialistische, die sich eine Kolonisierung auch anderswo vorstellen konnte, im konkreten Fall in Uganda, das von England angeboten worden war.
Nur eine Minderheit der sozialistischen Juden, die zionistischen Poalés von Ber Borochov, blieben den Traditionalisten treu. Alle anderen sozialistischen Parteien der Juden zu dieser Zeit, wie die Partei der sozialistischen Zionisten und die Serpistes - eine Art Reproduktion im jüdischen Milieu der russischen Sozialrevolutionäre – sprachen sich für den Territorialismus aus. Die älteste und mächtigste jüdische Organisation, der Bund, war, wie man weiß, negativ gegenüber der nationalen Frage eingestellt, wenigstens zu dieser Zeit.
Ein entscheidender Moment für die Bewegung der nationalen Wiedergeburt war der Weltkrieg 1914, und die Besetzung von Palästina durch die englischen Truppen, denen sich die jüdische Legion von Jabotinsky angeschlossen hatte, als die Deklaration von Balfour 1917 veröffentlicht wurde, in der den Juden in Palästina eine Heimstätte versprochen wurde.
Dieses Versprechen wurde während der Konferenz in San Remo 1920 sanktioniert, die Palästina einem britischen Mandat unterstellte.
Die Balfour-Deklaration löste eine dritte Alya aus, aber vor allem die vierte, die zahlenmäßig die stärkste war, fiel mit der Übergabe des palästinensischen Mandats an die Briten zusammen. Schon diese Alya wies einen guten Anteil von Schichten des Kleinbürgertums auf. Man weiß, dass die letzte Immigration nach Palästina die wichtigste und eine Folge der Machtübernahme Hitlers war, schon einen starken Anteil an Kapitalisten aufwies.
Die erste Volkszählung, die 1922 in Hinsicht auf die Zerstörungen des Weltkrieges durchgeführt wurde, ergab nur 84’000 Juden, was 11 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte, diejenige von 1931 schon 175’000. 1934 wiesen die Statistiken schon 307’000 Juden auf eine Gesamtbevölkerung von 1’171’000 auf. Zurzeit wird eine Zahl von 400’000 angegeben.
80 Prozent der Juden wohnen in Städten. Die schnelle pilzartige Entstehung der Stadt Tel Aviv ist ein Ausdruck davon. Die Entwicklung der jüdischen Industrie schreitet schnell voran. 1928 zählte man 3505 Unternehmen, davon 782, die mehr als vier Arbeiter hatten, d.h. insgesamt 18’000 Arbeiter mit einem investierten Kapital von 3,5 Millionen Pfund Sterling.
Die Juden, die auf dem Land wohnen, machen nur 20 Prozent aus. Im Vergleich dazu lebt 65 Prozent der arabischen Bevölkerung auf dem Land. Aber die Fellahs bearbeiten ihre Landgüter mit primitiven Mitteln, im Gegensatz dazu wenden die Juden in ihren Kolonien und Plantagen die intensive kapitalistische Methode unter Ausnutzung der sehr billigen arabischen Arbeitskraft an.
Die Zahlen die wir gegeben haben, zeigen schon eine Seite des aktuellen Konflikts auf. Während 20 Jahrhunderten haben die Juden Palästina verlassen und andere Völker richteten sich an den Ufern des Jordans ein. Auch wenn die Balfour-Deklaration und die Entscheidungen des Völkerbundes vorgaben die Respektierung der Rechte der Besetzer zu schützen, bedeutete die Zunahme der jüdischen Einwanderung die Vertreibung der arabischen Bevölkerung von ihren Ländereien, auch wenn diese vom jüdischen Nationalfonds zu tiefen Preisen gekauft werden.
Es ist nicht aus Humanismus “dem verfolgten und ohne Land lebenden Volk” gegenüber, dass Großbritannien eine pro-jüdische Politik verfolgt. Es sind die Interessen der englischen Hochfinanz, in der die Juden einen überwiegenden Einfluss haben, die diese Politik bestimmt. Andererseits stellt man seit dem Beginn der jüdischen Einwanderung einen Kontrast zwischen dem arabischen und jüdischen Proletariat fest. Zu Beginn stellten die jüdischen Kolonisatoren jüdische Arbeitskräfte ein, um ihren nationalen Eifer gegen die Angriffe der Araber auszunutzen. Kurze Zeit später mit der Verfestigung der Situation zogen die jüdischen Industriellen und Grundstückbesitzer die arabische der anspruchsvolleren jüdischen Arbeitskraft vor.
Die jüdischen Arbeiter, die sich in Gewerkschaften organisieren, sind mehr darauf bedacht, die tiefen Löhne der konkurrierenden arabischen Arbeiter zu bekämpfen anstatt den Klassenkampf zu führen. Das erklärt den chauvinistischen Charakter der jüdischen Arbeiterbewegung, der sich vom Nationalismus und britischen Imperialismus ausnutzen lässt.
Die Basis des aktuellen Konflikts hat natürlich auch Gründe politischer Natur. Der britische Imperialismus möchte trotz der Feindseligkeit der beiden Völker zwei Staaten unter einem gemeinsamen Dach vereinen, sogar einen Bi-Parlamentarismus aufbauen, der je ein jüdisches und ein arabisches Parlament vorsieht.
Im jüdischen Lager stehen auf der Seite der abwartenden Direktive von Weissmann, die Revisionisten des Jabotinsky, welche den offiziellen Zionismus bekämpfen und Großbritannien beschuldigen, entweder abwesend zu sein oder sich seinen Pflichten zu entziehen. Sie möchten die jüdische Emigration auch auf Transjordanien, Syrien und auf die Halbinsel Sinai erweitern.
Die ersten Konflikte, die 1929 auftauchten und sich rund um die Klagemauer abspielten, provozierten laut offiziellen Statistiken 200 Tote auf der arabischen und 130 Tote auf der jüdischen Seite. Zahlen, die in Wirklichkeit sicher untertrieben sind, da die Juden zwar in den modernen Gebieten die Angriffe zurückschlagen konnten, in Hebron, in Safit und in einigen Vororten die Araber zu handfesten Pogromen übergegangen sind.
Diese Ereignisse stoppten die pro-jüdische Politik Großbritanniens, da das britische Kolonialreich zu viele Moslems umfasst, eingeschlossen Indien, was genügend Grund ist, eine vorsichtige Politik zu betreiben.
Aufgrund dieses Verhaltens der britischen Regierung gegenüber der Heimstätte, nehmen die Mehrzahl der jüdischen Parteien, die orthodoxen Zionisten, die generellen Zionisten und die Revisionisten eine oppositionelle Haltung ein. Die sicherste Unterstützung der britischen Politik, die zu dieser Zeit unter einer Labour-Regierung stand, waren die jüdischen Arbeiterorganisationen, die ein Ausdruck der Allgemeinen-Arbeiter-Konföderation darstellte, in der fast die Gesamtheit der jüdischen Arbeiter in Palästina organisiert waren.
Kürzlich hat sich, zwar nur an der Oberfläche, ein gemeinsamer Kampf der jüdischen und arabischen Bewegung gegen die Mandatsmacht entfacht. Das Feuer schwelte, die Explosion brach dann in den Ereignissen vom Mai aus.
Die faschistische italienische Presse hat Sturm gegen die Vorwürfe der “sanktionistischen” Presse geblasen, die behauptete, dass faschistische Agenten die Aufstände in Palästina angefacht hätten. Dieser Vorwurf wurde schon vor kurzem während den Ereignissen in Ägypten erhoben. Niemand kann verneinen, dass der Faschismus ein großes Interesse daran hat, ins Feuer zu blasen. Der italienische Imperialismus hat nie seine Absichten gegenüber dem Nahen Osten verheimlicht, d.h. sich an die Stelle der mandatierten Mächte in Palästina und Syrien zu setzen. Er besitzt übrigens auch eine mächtige Kriegsschiffbasis im Mittelmeer, auf Rhodos und den anderen Inseln des Dodekanes. Der britische Imperialismus zieht aber auch Nutzen vom Konflikt zwischen Arabern und Juden, da nach der alten römischen Formel “divide et impera” man teilen muss, um herrschen zu können. Er muss gleichzeitig der jüdischen Finanzmacht und der Gefahr der nationalistischen arabischen Bewegung Rechnung tragen.
Letztgenannte Bewegung über die wir ein anderes Mal länger schreiben werden, ist eine Konsequenz des Weltkriegs, der die Industrialisierung in Indien, Palästina und Syrien vorangetrieben hat. Diese Entwicklung stärkte die einheimische Bourgeoisie, die sich darum auf die Ausbeutung der einheimischen Massen vorbereitete.
Die Araber beschuldigen Großbritannien, aus Palästina eine jüdische Heimstätte machen zu wollen. Dies würde bedeuten, dass man der einheimischen Bevölkerung den Grund und Boden stiehlt. Sie haben noch einmal Emissäre nach Ägypten, nach Syrien und nach Marokko geschickt, damit diese sich für die Sache der palästinensischen Araber einsetzen mit dem Ziel, eine panislamische nationale Vereinigung voranzutreiben. Von den vor kurzer Zeit stattgefundenen Ereignissen in Syrien ermutigt, wo die Mandatsmacht Frankreich vor dem Generalstreik kapitulieren musste und auch von den Ereignissen in Ägypten, wo die Agitation und Bildung einer nationalen Front London gezwungen hat, mit der Regierung in Kairo gleichberechtigt zu verhandeln. Wir wissen nicht ob der Generalstreik der Araber in Palästina die gleichen Ergebnisse bringt. Wir werden diese Bewegung zusammen mit dem arabischen Problem in einem weiteren Artikel erörtern.
Gatto Mammone
BILAN Nr. 31 (Juni/Juli 1936)
Wie wir im vorangehenden Teil dieses Artikels feststellten, haben die “Biluimes” einen sandigen Streifen im Süden von Jaffa gekauft. Dabei trafen sie auf andere Völkerschaften, die Araber, die sich an ihrer Stelle in Palästina angesiedelt hatten. Es waren aber nur einige Hunderttausende, seien es Fellah-Araber (Bauern) oder Beduinen (Nomaden). Die Bauern bearbeiteten mit sehr primitiven Arbeitsgeräten den Boden der Grundstückbesitzer (Effendis). Der britische Imperialismus wie man sehen konnte, drängte die Grundstückbesitzer und die arabische Bourgeoisie während des Weltkriegs auf seine Seite und versprach ihnen im Gegenzug die Bildung eines arabischen Nationalstaats. Die arabische Revolte hatte eine entscheidende Wirkung auf den Zerfall der türkisch-deutschen Front im Nahen Osten, da es den Aufruf zum heiligen Krieg des osmanischen Kalifen zunichtemachte, was zu Niederlage zahlreicher türkischer Truppen in Syrien führte, ohne jetzt noch die Zerstörung der türkischen Armeen in Mesopotamien zu erörtern.
Aber wenn der britische Imperialismus den arabischen Aufstand gegen die Türkei dank dem Versprechen der Gründung eines arabischen Nationalstaats, der alle Provinzen des alten osmanischen Reichs (einschließlich Palästina) umfasste, hat er zu Schutz seiner eigenen Interessen den Gegenpart, die zionistischen Juden, ebenfalls unterstützt, indem er diesen versprach, auf der administrativen Ebene und bei der Kolonisierung ihnen Palästina zu überlassen.
Gleichzeitig fanden sie eine Übereinkunft mit dem französischen Imperialismus, um ihm Syrien zu überlassen. So trennten sie die Region, die zusammen mit Palästina eine unauflösbare historische und ökonomische Einheit bildet.
Im Brief vom 2. November 1917 von Lord Balfour an Rothschild, Präsident der Zionistischen Föderation in England, in dem er ihm die zustimmende Haltung der britischen Regierung zur Bildung einer Heimstätte für die jüdische Bevölkerung in Palästina mitteilte, und versprach, dass er all seine Anstrengungen für die Realisierung dieses Ziels einsetzen wolle. Zudem ergänzte Lord Balfour noch, dass nichts unternommen werde, was die zivilen Rechte und die Religion der nichtjüdischen Gemeinschaften in Palästina beinträchtige und auch nichts gegen die Rechte und den politischen Status der Juden, den sie in anderen Ländern genossen.
Trotz der Zweideutigkeit dieser Deklaration, die einem neuen Volk erlaubte, sich auf seinem Boden niederzulassen, nahm die gesamte arabische Bevölkerung anfänglich eine neutrale ja sogar befürwortende Haltung gegenüber einer jüdischen Heimstätte ein. Die arabischen Besitzer mit der Furcht vor einem neuen Landwirtschaftgesetz zeigten sich offen für einen Verkauf von Land. Die zionistischen Führer profitierten nur aus Rücksicht auf politische Überlegungen nicht von diesen Angeboten, und billigten sogar die Verteidigung der Allenby-Regierung in Bezug auf den Verkauf von Land.
Bald äußerten sich bei der Bourgeoisie Tendenzen, Palästina territorial und politisch zu besetzen, somit die autochthone Bevölkerung zu enteignen und in die Wüste zurückzuschicken. Diese Tendenz kam vor allem bei den revisionistischen Zionisten zum Vorschein, d.h. in der philofaschistischen Strömung innerhalb der nationalen jüdischen Bewegung.
Die Ackerfläche Palästinas beträgt etwa 12 Millionen "Dounams" (ein Dounam = ein Zehntel eines Hektars), von denen derzeit 5 bis 6 Millionen bewirtschaftet werden. So sahen die Niederlassungen der Juden in der landwirtschaftlich genutzten Fläche von Palästina seit 1899 aus:
1899: 22 Kolonien, 5000 Einwohner, 300.000 dounnams
1914: 43 Kolonien, 12’000 Einwohner, 400.010 dounnams
1922: 73 Kolonien, 15’000 Einwohner, 600.000 dounnams
1931: 160 Kolonien, 70’000 Einwohner, 11.200.000 dounnams
Um den realen Wert dieser Zunahme und des daraus resultierenden steigenden Einflusses zu bewerten, darf man nicht vergessen, dass die Araber immer noch in einer primitiven Art und Weise den Boden bewirtschaften, während die jüdischen Kolonisatoren die modernsten Methoden verwenden.
Das in die Landwirtschaftsbetriebe investierte jüdische Kapital beläuft sich auf mehrere Millionen Dollars, wovon 65 Prozent in die Plantagen einfließt. Obwohl die Juden nicht mehr als 14 Prozent des zu bewirtschaftenden Bodens besitzen, beträgt der Wert ihrer Produkte ein Viertel der Gesamtproduktion. Was die der Orangenplantagen anbetrifft beträgt der Anteil der jüdischen Ernte 55 Prozent des Gesamtertrags.
Die ersten arabischen Reaktionen beginnen im April 1920 in Jerusalem und im Mai 1921 in Jaffa und nehmen die Form von Pogromen an. Sir Herbert Samuel, bis 1925 Hochkommissar in Palästina versuchte die Araber zu beruhigen, indem er die jüdische Immigration stoppte. Gleichzeitig versprach er den Arabern eine repräsentative Regierung und übergab ihnen die besten Teile des staatlichen Bodens.
Nach der großen Einwanderungswelle von 1925, welche ihren Höhepunkt mit 33.000 Einwanderern erreichte, verschlechterte sich die Situation und es entstanden die Bewegungen vom August 1929. Zu diesem Zeitpunkt schlossen sich die beduinischen Stämme von Transjordanien, aufgerufen von der moslemischen Agitation, der palästinensisch arabischen Bevölkerung an.
Infolge dieser Ereignisse hat die parlamentarische Untersuchungskommission, die nach Palästina geschickt wurde, bekannt unter dem Namen Shaw-Kommission, festgestellt, dass diese Ereignisse aufgrund der jüdischen Arbeiter-Immigration und dem “Heißhunger” nach Boden entstanden waren. Die Kommission empfahl der Regierung den Kauf von Boden, um die Fellahs zu entschädigen, denen man den Boden entrissen hatte.
Als nach dem Mai 1930 die gesamte britische Regierung den Schlussfolgerungen der Shaw-Kommission folgte und erneut die jüdische Arbeiter-Einwanderung nach Palästina unterband, reagierte die jüdische Arbeiterbewegung – welche nicht einmal von der Shaw-Kommission angehört wurde – mit einem 24-stündigen Proteststreik, während gleichzeitig die Poalézion in allen Ländern und auch die großen jüdischen amerikanischen Gewerkschaften gegen diese Maßnahmen mit zahlreichen Versammlungen dagegen protestierten.
Im Oktober 1930 definierte eine neue Deklaration, bekannt unter dem Namen Weißbuch, die britische Politik in Palästina. Diese war der zionistischen These auch nicht sehr zugetan. Aber auf die immer größeren Proteste der Juden antwortete die Labour-Regierung im Februar 1931 mit einem Brief von MacDonald, welcher das Recht auf Arbeit, die Einwanderung und die Kolonisierung durch die Juden bestätigte und darüber hinaus den jüdischen Unternehmen erlaubte, jüdische Arbeitskräfte einzustellen, wenn diese den letzteren gegenüber den arabischen den Vorrang gaben – ohne über die eventuelle Arbeitslosigkeit bei den Arabern Rechenschaft abzulegen.
Die palästinensische Arbeiterbewegung beeilte sich, der britischen Arbeiterregierung Vertrauen zu schenken, währenddem alle anderen zionistischen Parteien in einer misstrauischen Oppositionshaltung verblieben.
Wir haben im vorhergehenden Artikel die Gründe des chauvinistischen Charakters der palästinensischen Arbeiterbewegung aufgezeigt.
Die Histadruth - die wichtigste palästinensische gewerkschaftliche Zentrale - hat nur Juden als Mitglieder (80 Prozent der jüdischen Arbeiter sind organisiert). Es ist nur die Notwendigkeit der Hebung des Lebensstandards der arabischen Massen, um die hohen Löhne der jüdischen Arbeitskraft zu schützen, die sie zum Versuch einer Organisierung der Araber veranlasste.
Der Generalstreik der Araber in Palästina kommt nun in seinen vierten Monat. Die Guerilla geht weiter, trotz dem kürzlich erlassenen Dekret, welches die Todesstrafe für Attentäter vorsieht. Jeden Tag finden Überfälle und Handstreiche gegen Züge und Autos statt, ohne die Zerstörungen und Brandanschläge auf jüdische Güter zu zählen.
Diese Vorkommnisse haben der Mandatsmacht schon fast eine halbe Million Pfund Sterling für das Stellen einer Armee und in der Folge der Verminderung von Steuereinnahmen aufgrund des ökonomischen Boykotts der arabischen Massen gekostet.
Erst kürzlich hat der Minister der Kolonien den Gemeinden eine Opferbilanz bekannt gegeben: 400 Moslems, 200 Juden und 100 Polizisten. Bis jetzt sind 1800 Araber und Juden vor dem Richter gestanden, davon wurden 1200 verurteilt, davon waren 300 Juden. Dem Minister zufolge sind ca. 100 arabische Nationalisten in Konzentrationslager deportiert worden. Vier Kommunistenführer (zwei jüdische und zwei armenische) sind gefangen und 60 Kommunisten sind der polizeilichen Überwachung unterstellt. Das sind die offiziellen Zahlen.
Es ist offensichtlich, dass die imperialistische britische Politik in Palästina sich natürlich an einer kolonialen Politik, die allen Imperialisten zu eigen ist, inspiriert. Diese besteht im Wesentlichen darin, sich auf gewisse Schichten der kolonialen Bevölkerung zu stützen (indem sie die verschiedenen Völker oder die verschiedenen Religionsanhänger gegeneinander aufhetzen, aber auch indem sie gewisse Missgunst zwischen den verschiedenen Clans und Führern säen), was dem Imperialismus erlaubt, seine Super-Unterdrückung auf die kolonialen Massen auszuüben, ohne Unterschied von Volks- und Religionszugehörigkeit.
In Marokko und in Zentralafrika sind diese Manöver zwar gelungen, der arabische Nationalismus in Palästina und Syrien stellt jedoch einen sehr kompakten Widerstand dar. Er stützt sich auf die mehr oder weniger unabhängigen Länder, die ihn umgeben ab: auf die Türkei, auf Persien und Ägypten, auf den Irak und Arabische Staaten. Er verbindet sich auch noch mit der Gesamtheit der moslemischen Welt, die mehrere Millionen Menschen zählt.
Trotz der Gegensätze, die unter den verschiedenen moslemischen Staaten bestehen und trotz der britisch-freundlichen Politik einiger von ihnen, wäre die Bildung eines östlichen Blocks, der sich dem Imperialismus entgegenstellte, die wirkliche Gefahr für ihn. Das wäre möglich, wenn das Erwachen und das Nationalgefühl der einheimischen Bourgeoisien das Erwachen der Klassenrevolte der kolonial Ausgebeuteten verhindern, die sowohl mit ihren Ausbeutern wie mit dem europäischen Imperialismus fertig werden müssen. Der Sammlungspunkt eines solchen Blocks wäre die Türkei, die wieder ihre Ansprüche auf die Dardanellen erhebt und ihre Panislamische Politik wiederaufnimmt.
Nun, Palästina ist lebenswichtig für den britischen Imperialismus. Wenn die Zionisten glaubten, sie bekämen ein “jüdisches” Palästina, werden sie in Wirklichkeit nichts anderes als ein “britisches” Palästina erhalten, eine palästinensische Transitverbindung auf dem Landweg zwischen Europa und Indien. Diese Verbindung könnte die maritime des Suezkanals ersetzen, da die Sicherheit dieses Weges von der Etablierung des italienischen Imperialismus in Äthiopien geschwächt wird. Man sollte nicht vergessen, dass die Pipeline von Mossoul (Ölförderungsgebiet) im palästinensischen Hafen von Haïfa endet.
Schließlich muss die britische Politik immer in Rechnung tragen, dass 100 Millionen Moslems das britische Empire bevölkern. Bis jetzt konnte der britische Imperialismus in Palästina die Gefahr der arabischen nationalen Unabgängigkeitsbewegung in Schach halten. Er stellte letzterem den Zionismus entgegen, der, indem er die jüdischen Massen drängte, nach Palästina auszuwandern, sie von ihren Stammländern, wo sie ihren Platz gefunden hätten, wegholte, und schließlich sich eine solide Unterstützung für seine Politik im Nahen Osten sicherte.
Die Enteignung der Ländereien zu lächerlichen Preisen hat die arabischen Proletarier in eine rabenschwarze Armut gestürzt und hat sie in die Arme der arabischen Nationalisten, der Grundstückbesitzer und der aufkommenden Bourgeoisie gestoßen. Letztere profitieren offensichtlich davon und um ihre Ausbeutungspläne auszuweiten, richten die Unzufriedenheit der Fellahs und der Proletarier auf die jüdischen Arbeiter in der gleichen Weise, wie die zionistischen Kapitalisten die Unzufriedenheit der jüdischen Arbeiten gegen die Araber richten. Aus diesen Gegensätzen der jüdischen und arabischen Ausgebeuteten, können der britische Imperialismus und die arabische und jüdische herrschende Klasse nur gestärkt hervorgehen.
Der „offizielle Kommunismus“ hilft den Arabern in ihrem Kampf gegen den Zionismus, der als Instrument des britischen Imperialismus qualifiziert wird.
Schon 1929 hat die nationalistische jüdische Presse eine schwarze Liste der Polizei herausgegeben, auf der die kommunistischen Agitatoren neben dem Großmufti und den nationalen arabischen Führern standen. Zurzeit sind viele kommunistische Militante verhaftet worden.
Nachdem die Losung der „Arabisierung“ der Partei herausgegeben wurde - diese war wie die KPs von Syrien oder von Ägypten von einer Gruppe jüdischer Intellektueller gegründet worden, die als opportunistisch bekämpft wurden – haben die Zentristen heute die Losung „Arabien den Arabern“ herausgegeben, was nur eine Kopie der Losung „Föderation aller arabischen Völker“ ist. Diese Devise der arabischen Nationalisten, d.h. der Grundstückbesitzer (Effendis) und der Intellektuellen, dient dazu, mit der Unterstützung des moslemischen Klerus, den arabischen Kongress im Namen ihrer Interessen zu beherrschen und die Reaktionen der arabischen Ausgebeuteten zu kanalisieren.
Für den wirklichen Revolutionär gibt es natürlich keine palästinensische Frage, sondern einzig der Kampf aller Ausgebeuteten, einschließlich Araber und Juden. Dieser Kampf ist Teil eines allgemeineren Kampfes aller Ausgebeuteten auf der Welt für die kommunistische Revolution.
Gatto Mammone
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Die nationale Frage [38]
Rubric:
Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee, sondern eine Notwendigkeit
- 2803 Aufrufe
Trotzki und die „Kultur des Kommunismus“
In einem vorangegangenen Artikel (Internationale Revue Nr. 30) sind wir auf die Debatte über die „proletarische Kultur“ in den ersten Jahren der Russischen Revolution eingegangen. Unser Artikel war gleichzeitig Einführung eines Auszuges aus Trotzkis Buch Literatur und Revolution, welches unserer Meinung nach den klarsten Rahmen zu dieser Debatte liefert, indem es die Politik einer proletarischen politischen Macht auf der Ebene der Kunst und Kultur beschreibt.
Die hier abgedruckten Auszüge, versehen mit unseren Gedanken dazu, stammen aus einem anderen Kapitel dieses Buches, in welchem Trotzki seine Vision von Kunst und Kultur in einer zukünftigen kommunistischen Gesellschaft entwickelt. Nachdem er den Begriff einer „proletarischen Kultur“ in den vorangegangenen Kapiteln seines Buches verworfen hat, erlaubt er sich nun einen Ausblick auf eine wirklich menschliche Kultur in einer klassenlosen Gesellschaft. Es ist ein Ausblick, der weit über die spezifischen Fragen der Kunst in die Sphären einer verwandelten Gesellschaft reicht.
Wir sind nicht die ersten oder einzigen, welche die Bedeutung dieses Buchkapitels hervorheben. Isaak Deutscher zitiert es ausführlich in seiner Trotzki-Biografie und schlussfolgert: „Seine Vision von der klassenlosen Gesellschaft lag natürlich allem marxistischen Denken zugrunde, das ja vom französischen utopischen Sozialismus beeinflusst war. Aber kein marxistischer Schriftsteller hat vor oder nach Trotzki die grosse Zukunft mit einem solch realistischen Blick und einer solch glühenden Phantasie erschaut.“ („Nicht von der Politik allein“ in Trotzki, Der unbewaffnete Prophet, Urban-Verlag, Seite 196)
Auch Richard Sites machte später in seiner umfassenden Studie über die sozial-experimentellen Strömungen, welche die ersten Jahre der Russischen Revolution begleiteten, eine Verbindung zwischen den Ansichten Trotzkis und der utopistischen Tradition. Das gesamte Kapitel in einem Satz zusammenfassend nennt er es „Die Mini-Utopie oder Hülle einer Welt unter dem Kommunismus“, welche nach seinen Worten von Trotzki mit einer „lyrischen Kontrolle“ beschrieben wurde. Für Sites war dies „ein aussergewöhnlicher Beitrag an den experimentellen Utopismus der die 20er Jahre kennzeichnete“ (Revolutionary Dreams, Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, OUP, 1989, Seite 168, übersetzt von uns). Doch hier gilt es vorsichtig zu sein: In seiner Einführung tendiert Sites dazu, die utopistische Tendenz der marxistischen entgegenzustellen, indem er Trotzkis Bemühungen als mehr utopistisch denn marxistisch darstellt. Für das konventionelle bürgerliche Denken ist der Marxismus utopisch – doch nur in einem negativen Sinn, dass diese Vision der Zukunft lediglich ein Phantasiegebilde sei. Doch nun möchten wir Trotzki zu Wort kommen lassen und wollen dann zu Ende des Artikel darüber nachdenken, ob seine Arbeit wirklich als utopisch abgetan werden kann.
Kunst in der Revolution und Kunst in der kommunistischen Gesellschaft
Das Kapitel greift zu Beginn das wichtigste Argument aus dem Abschnitt über die proletarische Kultur auf: Das Ziel der proletarischen Revolution ist nicht die Schaffung einer brandneuen „proletarischen Kultur“ sondern ein Zusammenfügen aller positiven Aspekte vergangener kultureller Bemühungen in eine wirklich menschliche Kultur. Trotzkis Unterscheidung zwischen revolutionärer Kunst und sozialistischer Kunst verdeutlicht diese Präzisierung:
„Die Kunst der Revolution, die unausweichlich aller Widersprüche der Übergangsgesellschaft wiederspiegelt, darf man nicht mit der sozialistischen Kultur verwechseln, für die eine Basis noch gar nicht geschaffen ist. Andererseits darf man nicht vergessen, dass die sozialistische Kunst aus der Kunst der Übergangszeit erwachsen wird.
Wenn wir auf dieser Unterscheidung bestehen, dann lassen wir uns keinesfalls von irgendwelchen pedantischen schematischen Überlegungen leiten. Nicht ohne Grund hat Engels die sozialistische Revolution einen Sprung aus dem Reich des Zwanges in das Reich der Freiheit genannt. Die Revolution selbst ist noch kein „Reich der Freiheit“. Im Gegenteil, die Züge des „Zwanges“ erlangen in ihr die extremste Entwicklung. Während der Sozialismus zusammen mit den Klassen auch die Klassengesellschaft beseitigt, treibt die Revolution den Klassenkampf bis zur höchsten Intensität. In der Zeit der Revolution ist diejenige Literatur notwendig und fortschrittlich, die den Zusammenschluss der Werktätigen im Kampf gegen die Ausbeuter fördert. Die Revolutionsliteratur muss vom Geist des sozialen Hasses durchdrungen sein, der in der Epoche der proletarischen Diktatur ein schöpferischer Faktor in der Hand der Geschichte ist. Im Sozialismus ist die Solidarität die Grundlage der Gesellschaft. Die ganze Literatur, die ganze Kunst werden auf einen anderen Grundton abgestimmt sein. Diejenigen Gefühle, die wir Revolutionäre nur unter Hemmungen beim Namen nennen – weil diese Namen von scheinheiligen und trivialen Menschen so sehr missbraucht wurden: uneigennützige Freundschaft, Nächstenliebe, herzliche Teilnahme – werden in der sozialistischen Poesie in mächtigen Akkorden aufklingen.“ (Trotzki, Literatur und Revolution, Arbeiterpresseverlag 1994, Seite 227)
Zusammen mit Rosa Luxemburg stellen wir Trotzkis Formulierung des „sozialen Hasses“ in Frage, selbst in der Periode der proletarischen Diktatur. Dieser Ausdruck ist verbunden mit dem Konzept des Roten Terrors, das Trotzki ebenfalls vertrat, vom Spartakusbund jedoch in seinem Programm explizit verworfen wurde.1 .
Doch es gibt keinen Zweifel, dass „Solidarität die Grundlage der Gesellschaft“ im Sozialismus sein wird. Dies führte Trotzki zur Widerlegung des Argumentes, ein solcher „Ausbruch von Solidarität“ stünde im Widerspruch zur künstlerischen Kreativität: „Birgt aber vielleicht, wie die Nietzscheaner befürchten, ein Übermass an Solidarität die Gefahr einer Entartung des Menschen zu einem sentimental passiven Herdenwesen in sich? Keineswegs. Die mächtige Kraft des Wettstreits, die in der bürgerlichen Gesellschaft den Charakter eines Marktwettbewerbs hatte, wird in der sozialistischen Gesellschaftsordnung nicht verschwinden, sondern, um in der Sprache der Psychoanalyse zu sprechen, sublimiert, d.h. eine höhere und produktivere Form annehmen: Sie wird zu einem Kampf um die eigene Meinung, den eigenen Entwurf und um den eigenen Geschmack werden. Je mehr der politische Kampf abebbt – und in einer klassenlosen Gesellschaft wird es ihn nicht mehr geben – desto mehr werden die befreiten Leidenschaften in den Strom der Technik und des Aufbaus einschliesslich der Kunst gelenkt werden, die natürlich allgemeiner, reifer und bewusster sowie zur höchsten Form des sich vervollkommnenden Lebensaufbaus auf allen Gebieten wird und nicht nur ein „schönes“ Anhängsel am Rande.
Alle Sphären des Lebens: die Bodenbearbeitung, die Planung menschlicher Siedlungen, der Bau von Theatern, die Methoden der gesellschaftlichen Kindererziehung, die Lösung wissenschaftlicher Probleme, die Schaffung eines neuen Stils werden alle und jeden einzelnen zutiefst erfassen. Die Menschen werden sich in „Parteien“ teilen: in Fragen über einen neuen gigantischen Kanal, über die Verteilung von Oasen in der Sahara – auch eine solche Frage wird auftauchen – über Klima- und Wetterregulierung, über das neue Theater, über eine chemische Hypothese, über zwei in der Musik sich bekämpfende Richtungen oder über das beste System des Sports. Diese Gruppen werden von keinerlei Klassen- oder Kasteneigennutz vergiftet sein. Alle werden in gleichem Masse an den Errungenschaften der Gesamtheit interessiert sein. Der Kampf wird stets einen rein ideellen Charakter tragen. Er wird nichts von Profitgier, Gemeinheit, Verrat, Bestechlichkeit und von all dem an sich haben, was das Wesen der „Konkurrenz“ in der Klassengesellschaft ausmacht. Aber dadurch wird der Kampf nicht minder packend, dramatisch und leidenschaftlich sein. Da aber in der sozialistischen Gesellschaft alle Probleme – darunter auch diejenigen, die früher elementar und automatisch gelöst wurden (Alltagsleben) oder sich in der Obhut besonderer Priesterkasten befanden (Kunst) – Allgemeingut werden, so kann man mit voller Gewissheit sagen, dass es für kollektive Interessen und Leidenschaften und für den individuellen Wettbewerb ein äusserst weites Feld und eine unbegrenzte Anzahl von Anlässen geben wird. Die Kunst wird dementsprechend keinen Mangel an Entladungen der gesellschaftlichen Nervenenergie und an jenen kollektiv-psychischen Impulsen haben, die zur Ausbildung neuer Kunstrichtungen und zu Stilwechsel zwingen. Die ästhetischen Schulen werden ihrerseits „Parteien“ um sich gruppieren, d.h. nach Temperament, Geschmack und Geistesrichtung sich unterscheidende Gruppen. In diesem selbstlosen, angespannten Kampf auf einem ständig höher werdenden Fundament der Kultur wird die menschliche Persönlichkeit mit ihrer unschätzbaren Eigenschaft, sich nie mit dem Erreichten zu begnügen, wachsen und alle Kanten abschleifen. Wahrlich, wir haben keinen Grund, uns vor einer Einschläferung der Persönlichkeit oder Verarmung der Kunst in der sozialistischen Gesellschaft zu fürchten.“ (ebenda, Seite 228)
Trotzki untersucht danach, welcher Kunststil oder Schule der revolutionären Periode am nächsten steht. In einem gewissen Masse haben diese Überlegungen eine eher lokale und zeitlich begrenzte Bedeutung, da sie sich auf Kunstströmungen beziehen, welche schon lange verschwunden sind, wie der Symbolismus oder der Futurismus. Zudem sind mit dem stetigen Versinken des Kapitalismus in seine dekadente Phase und der Zuspitzung der Kommerzialisierung, des Egoismus und der Atomisierung verschiedenste Kunstströmungen und Schulen verschwunden. In den 30er Jahren schon hatte das „Manifest der internationalen futuristischen Künstler und revolutionären Schriftsteller“, von Trotzki in Zusammenarbeit mit André Breton und Diego Riviera geschrieben, diese Entwicklung vorausgesagt: „Die Kunstschulen der letzten Jahrzehnte, der Kubismus, der Futurismus, der Dadaismus und der Surrealismus haben sich alle abgelöst ohne dass eine zur vollen Blüte kam (...) Es gibt keinen Ausweg aus dieser Sackgasse nur mit künstlerischen Mitteln. es handelt sich um eine Krise der Zivilisation. (...) Wenn sich die gegenwärtige Gesellschaft nicht wieder aufrichten kann geht die Kunst unweigerlich zugrunde, so wie die Kunst Griechenlands unter den Ruinen der Sklavengesellschaft untergegangen ist.“ (von uns übersetzt) Eine zukünftige Revolution wird mit grosser Wahrscheinlichkeit an die kollektivsten künstlerischen Bewegungen, welche sich mit der Revolution identifizieren und von den Schulen der Vergangenheit inspiriert sind ohne sie lediglich zu kopieren, einen neuen Impuls weitergeben. Es gilt noch anzufügen, dass Trotzki, der sich zur Beschreibung der Kunst in der revolutionären Periode für den Begriff „Realismus“ entschied, jedoch keinesfalls die positiven Beiträge verschiedener Schulen zurückwies, auch wenn sich deren Anliegen – wie im Falle des Symbolismus – weit von den sozialen Grundlagen des Alltags wegbewegten oder eher eine Flucht vor der Realität darstellten:2 „Im Gegenteil, der neue Künstler verwendet alle Methoden und Prozesse, die in der Vergangenheit entwickelt wurden, um das neue Leben zu erfassen. Dies ist kein künstlerischer Eklektizismus, denn die Einheit der Kunst wird durch eine aktive Wahrnehmung der Welt und des Lebens gebildet.“
Dies steht in Verbindung mit Trotzkis genereller Sichtweise zur Kultur, die wir im vorgängigen Artikel (Internationale Revue Nr. 30) beschrieben haben, welche sich gegen den Pseudo-Radikalismus wandte, der alles aus der Vergangenheit über Bord werfen will.
Trotzki verwendete dieselbe Methode bezüglich des Problems der grundlegenden literarischen Formen wie der Komödie und der Tragödie. Entgegen denjenigen, welche der Komödie und der Tragödie keinerlei Platz in der Kunst der Zukunft einräumten, liefert uns Trotzki eine Methode, um zu sehen, an was bestimmte kulturelle Errungenschaften in der geschichtlichen Evolution der sozialen Formationen gebunden sind. Die antike griechische Tragödie einerseits drückte die unpersönliche Dominanz der Götter über die Menschen aus, welche damit die relative Machtlosigkeit des Menschen gegenüber der Natur in den archaischen Gesellschaften widerspiegelte. Die Tragödie Shakespears andererseits, welche tief gebunden war an die Geburtswehen der bürgerlichen Gesellschaft, stellte einen Schritt vorwärts dar, weil sie sich auf individuellere menschliche Emotionen konzentrierte: „Als die bürgerliche Gesellschaft die Beziehungen atomisierte, hatte sie zur Zeit ihres Aufstiegs ein grosses Ziel, das Befreiung der Persönlichkeit hiess. Aus ihm wuchsen die Dramen Shakespears und Goethes „Faust“. Der Mensch betrachtet sich als Mittelpunkt des Weltalls und damit auch der Kunst. Dieses Thema reichte für Jahrhunderte. Im Wesentlichen war die ganze neue Literatur der Durcharbeitung dieses Themas gewidmet, aber das ursprüngliche Ziel – die Befreiung der Persönlichkeit und ihre Qualifizierung – verblasste und wurde auf das Gebiet der neuen entseelten Mythologie in dem Masse abgedrängt, in dem die Haltlosigkeit der bürgerlichen Gesellschaft sich durch ihre unerträglichen Widersprüche offenbarte.“ (ebenda, Seite 240)
Trotzki zeigt danach auf, dass die Bedingungen, welche die Tragödie entstehen liessen, nicht an die Vergangenheit gebunden sind, sondern noch lange in der Zukunft weiterexistieren werden. Denn der Mensch ist (wie Marx es formulierte) im Grunde genommen ein leidendes Wesen, welches andauernd konfrontiert ist mit dem Konflikt zwischen seinen unbegrenzten Anstrengungen und dem objektiven Universum, das ihn herausfordert: „Der Zusammenprall des Persönlichen mit dem Überpersönlichen ist jedoch nicht nur auf religiöser Basis und nicht nur auf der Grundlage einer über den Menschen hinauswachsenden menschlichen Leidenschaft möglich. Das Überpersönliche ist vor allen Dingen das Gesellschaftliche. Solange der Mensch seine gesellschaftliche Organisation nicht meistert, erhebt sie sich über ihn als Schicksal. Ob sie hierbei ihren religiösen Hintergrund abwirft oder nicht, sie bleibt auf jeden Fall eine zweitrangige Angelegenheit, die vom Grad der Hilflosigkeit des Menschen abhängt. Der Kampf Babeufs für den Kommunismus in einer Gesellschaft, die für ihn noch nicht reif war, war der Kampf eines antiken Helden gegen das Schicksal. Das Schicksal Babeufs hat alle Male einer echten Tragödie ebenso wie das Schicksal jener Gracchen, deren Namen sich Babeuf beigelegt hatte. Die Tragödie isolierter persönlicher Leidenschaften ist für unsere Zeit zu fade. Aber weshalb? Weil wir in einer Epoche der sozialen Leidenschaften leben. Die Tragödie unserer Epoche ist der Zusammenstoss der Persönlichkeit mit dem Kollektiv oder der Zusammenprall zweier feindlicher Kollektive in einer Persönlichkeit.
Unsere Zeit ist wieder eine Zeit der grossen Ziele. Durch sie ist sie geprägt. Aber die Grösse dieser Ziele liegt eben darin, dass der Mensch danach strebt, sich vom Mystischen und allerlei sonstigem ideellen Nebel zu befreien, seine Gesellschaft und sich selbst nach einem Plan umzubauen, den er selbst geschaffen hat. Das ist natürlich gewaltiger als das kindliche Spiel in der Antike, das ihrem kindlichen Alter zu Gesicht stand, oder als die Mönchsphantasien des Mittelalters oder der Hochmut des Individualismus, der die Persönlichkeit vom Kollektiv trennt, um sie dann, nachdem sie rasch bis auf den letzten Grund ausgeschöpft war, in die Leere des Pessimismus zu stossen oder sie erneut vor dem leicht aufgefrischten Apis-Stier auf alle viere niederzuwerfen.
Die Tragödie stellt daher eine hohe Form der Literatur dar, weil sie eine heroische Spannung der Bestrebungen und eine Begrenztheit der Ziele, Konflikte und Leiden voraussetzt. (...) Ob die Kunst der Revolution Zeit haben wird, eine „hohe“ revolutionäre Tragödie zu geben, ist schwer vorauszusehen. Aber die sozialistische Kunst wird die Tragödie wiederauferstehen lassen. Und natürlich ohne Gott. Die neue Kunst wird eine atheistische Kunst sein. Sie wird auch die Komödie zu neuem Leben erwecken, denn der neue Mensch wird auch lachen wollen. Sie wird dem Roman eine neues Leben einflössen. Sie wird der Lyrik alle Rechte einräumen, weil der neue Mensch besser und stärker lieben wird, als es die Menschen früher getan haben, und weil er sich über die Probleme von Geburt und Tod Gedanken machen wird.
Die neue Kunst wird alle alten, von der Entwicklung des schöpferischen Geistes geschaffenen Formen wiederauferstehen lassen. Die Zersetzung und der Zerfall dieser Formen haben keineswegs absolute Bedeutung, d.h. sie bedeuten nicht, dass sie mit dem Geist der neuen Zeit absolut unvereinbar wäre. Der Dichter der neuen Epoche muss nur die menschlichen Gedanken auf eine neue Art durchdenken und die menschlichen Gefühle neu durchleben.“ (ebenda Seite 240-242)
Vor allem sticht in diesem Abschnitt hervor, dass Trotzki fast dieselbe Herangehensweise entwickelt wie Marx in den Grundrissen – das Vorwerk zum Kapital, welches bis 1939 unveröffentlicht blieb und von Trotzki vermutlich nie gelesen wurde. Wie Trotzki geht es Marx um die Dialektik in den Veränderungen der Form des künstlerischen Ausdrucks, in Verbindung mit der materiellen Entwicklung der Produktivkräfte und den darin liegenden menschlichen Werten. Diese Passage ist dermassen klärend, dass wir sie in ihrer ganzen Länge zitieren: „Bei der Kunst bekannt, dass bestimmte Blütezeiten derselben keineswegs im Verhältnis zur allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft, also auch der materiellen Grundlage, gleichsam des Knochenbaus ihrer Organisation, stehn. Z.B. die Griechen verglichen mit den Modernen oder auch Shakespare. Von gewissen Formen der Kunst, z.B. dem Epos, sogar anerkannt, dass sie in ihrer weltepochemachenden, klassischen Gestalt nie produziert werden können, sobald die Kunstproduktion als solche eintritt; also dass innerhalb des Bereichs der Kunst selbst gewisse bedeutende Gestaltungen derselben nur auf einer unentwickelten Stufe möglich sind. Wenn dies im Verhältnis der verschiedenen Kunstarten innerhalb des Bereichs der Kunst selbst der Fall ist, ist es schon weniger auffallend, dass es in Verhältnis des ganzen Bereichs der Kunst zur allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft der Fall ist. Die Schwierigkeit besteht nur in der allgemeinen Fassung dieser Widersprüche. Sobald sie spezifiziert werden, sind sie schon erklärt.
Nehmen wir z.B. das Verhältnis der griechischen Kunst und dann Shakespeares zur Gegenwart. Bekannt, dass die griechische Mythologie nicht nur das Arsenal der griechischen Kunst, sondern ihr Boden. Ist die Anschauung der Natur und der gesellschaftlichen Verhältnisse, die der griechischen Phantasie, und daher der griechischen Kunst zugrunde liegt, möglich mit selfactors (automatische Spinnmaschinen) und Eisenbahnen und Lokomotiven und elektrischen Telegraphen? Wo bleibt Vulcan gegen Roberts et Co., Jupiter gegen den Blitzableiter und Hermes gegen den Crédit mobilier (französische Aktienbank)? Alle Mythologie überwindet und beherrscht und gestaltet die Naturkräfte in der Einbildung und durch die Einbildung; verschwindet also mit der wirklichen Herrschaft über dieselben. Was wird aus der Fama neben Printinghouse square? Die griechische Kunst setzt die griechische Mythologie voraus, d.h., die Natur und die gesellschaftlichen Formen selbst schon in einer unbewusst künstlerischen Weise verarbeitet durch die Volksphantasie. Das ist ihr Material. Nicht jede beliebige Mythologie, d.h. nicht jede beliebige unbewusst künstlerische Verarbeitung der Natur (hier darunter alles Gegenständliche, also die Gesellschaft eingeschlossen). Ägyptische Mythologie konnte nie der Boden oder der Mutterschoss griechischer Kunst sein. Aber jedenfalls eine Mythologie. Also keinesfalls eine Gesellschaftsentwicklung, die alles mythologische Verhältnis zur Natur ausschliesst, alles mythologisierende Verhältnis zu ihr; also vom Künstler eine von Mythologie abhängige Phantasie verlangt.
Von einer andren Seite: Ist Achilles möglich mit Pulver oder Blei? Oder überhaupt die „Iliade“ mit der Druckerpresse oder gar Druckmaschine? Hört das Singen und Sagen und die Muse mit dem Pressbengel nicht notwendig auf, also verschwinden nicht notwendige Bedingungen der epischen Poesie?
Aber die Schwierigkeit liegt nicht darin zu verstehn, dass griechische Kunst und Epos an gewisse gesellschaftliche Entwicklungsformen geknüpft sind. Die Schwierigkeit ist, dass sie uns noch Kunstgenuss gewähren und in gewisser Beziehung als Norm und unerreichbare Muster gelten.
Ein Mann kann nicht wieder zum Kind werden, oder er wird kindisch. Aber freut ihn die Naivität des Kindes nicht, und muss er nicht selbst wieder auf einer höhern Stufe streben, seine Wahrheit reproduzieren? Lebt in der Kindernatur nicht in jeder Epoche ihr eigener Charakter in seiner Naturwahrheit auf? Warum sollte die geschichtliche Kindheit der Menschheit, wo sie am schönsten entfaltet, als eine nie wiederkehrende Stufe nicht ewigen Reiz ausüben? Es gibt ungezogene Kinder und altkluge Kinder. Viele der alten Völker gehörten in diese Kategorie. Normale Kinder waren die Griechen. Der Reiz ihrer Kunst für uns steht nicht im Widerspruch zu der unentwickelten Gesellschaftsstufe, worauf sie wuchs. Ist vielmehr ihr Resultat und hängt vielmehr unzertrennlich damit zusammen, dass die unreifen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen sie entstanden und alleine entstehen konnte, nie wiederkehren können.“ (Einleitung zu den Grundrissen, MEW Bd. 42, Seite 43-45)
In beiden Abschnitten ist der Ausgangspunkt derselbe: um jede einzelne Kunst verstehen zu können, muss sie in ihrem historischen Kontext verstanden werden, und dabei im Kontext der Entwicklung der menschlichen Produktivkräfte. Nur dies erlaubt uns, die grundlegenden Wechsel, welche die Kunst während der verschiedenen historischen Perioden gekannt hat zu verstehen. So wie Trotzki beschreibt, dass die Dimension der Tragik nie gänzlich aus der Kunst ausgeschlossen sein wird, da der menschlichen Umgebung nie gänzlich fern, stellt Marx fest, dass die wirkliche theoretische Herausforderung weniger in der Feststellung liegt, künstlerische Ausdrücke stünden im Zusammenhang mit der sozialen Entwicklung, sondern viel mehr im Verständnis, weshalb die kreativen Schöpfungen der „Kindheit der Menschheit“ noch über Jahrhunderte für die gegenwärtige und zukünftige Menschheit nachhallen können. Mit anderen Worten: wie ausser mit Bezugnahme auf das „stumme Genie“ Feuerbachs oder die idealistische Art der bürgerlichen Moralisten, kann uns das Studium der Kunst helfen, die wirklichen grundlegenden Charakteristiken der menschlichen Aktivität und des menschlichen Wesens als solches zu begreifen?
Die Vereinigung von Kunst und Industrie
Trotzki wendet sich nun dem praktischen Verhältnis zwischen Kunst, Industrie und Bau in der revolutionären Periode zu. Er konzentriert sich vor allem auf das Feld der Architektur, den Überschneidungspunkt zwischen Kunst und Bau. Sicherlich, auf dieser Ebene war das von Armut geplagte Russland immer noch dazu verdammt, zerstörte Gebäude und Strassen wieder aufzubauen. Doch trotz der extrem knappen Ressourcen konnte das revolutionäre Russland eine neue Synthese von Kunst und praktischen Gebäuden entwickeln. Dies war vor allem der Fall mit der konstruktivistischen Schule um Tatlin, welcher vermutlich am besten bekannt ist durch seinen Entwurf des Monuments der Dritten Internationale. Doch Trotzki schien unzufrieden mit diesen Experimenten und unterstrich, dass kein wirklicher Wideraufbau stattfinden könne, solange die grundlegenden ökonomischen Probleme nicht gelöst seien (und dies konnte sicher nicht in Russland alleine geschehen). Er engagierte sich eher darin, zu untersuchen, welche Möglichkeiten dem zukünftige Kommunismus zur Verfügung stehen, wenn einmal die grundlegenden politischen, militärischen und ökonomischen Probleme gelöst sind. Für Trotzki war dies ein Projekt, welches nicht eine Minderheit von Spezialisten umfassen sollte, sondern eine Kollektive Anstrengung sein musste: „Es unterliegt keinem Zweifel, dass in der Zukunft – und je weiter um so mehr – derartige monumentale Aufgaben wie die Planung neuer Garten-Städte, vorbildlicher Häuser, Eisenbahnen und Häfen – nicht nur die am Wettbewerb beteiligten Ingenieure und Architekten, sondern auch die breiten Volksmassen mitreissen werden. Das ameisenartige Durcheinander von Stadtvierteln und Strassen wird Steinchen für Steinchen unmerkbar von Geschlecht zu Geschlecht ersetzt durch den titanischen Bau von Dorf-Städten, nach der Karte und mit dem Zirkel. Um diesen Zirkel werden sich echte Volksgruppen dafür und dagegen bilden, eigenartige bautechnische Parteien der Zukunft, mit Agitation, mit Leidenschaften, Meetings, Abstimmungen. In diesem Kampf wird die Architektur von neuem, aber schon auf höherer Ebene, von den Gefühlen und Stimmungen der Massen durchdrungen sein, und die Menschheit wird sich plastisch erziehen, d.h. sie wird sich daran gewöhnen, die Welt als gefügigen Ton zum formen immer vollkommenerer Lebensformen zu betrachten. Die Wand zwischen Kunst und Industrie wird fallen. Der zukünftige hohe Stil wird kein verzierender, sondern ein gestaltender sein. Darin haben die Futuristen recht. Es wäre allerdings ein Fehler, wollte man dies als eine Liquidierung der Kunst, als ihre Selbstaufgabe vor der Technik auslegen.(...) Bedeutet dies etwa, dass die Industrie die Kunst ganz in sich aufsaugen oder dass die Kunst die Industrie zu sich auf den Olymp emporheben wird? Diese Frage kann man so und anders beantworten, je nachdem, ob wir von der Industrie oder von der Kunst her an sie herangehen. Aber im objektiven Endergebnis wird es zwischen den antworten keinen Unterschied geben. Beide bedeuten eine gigantische Erweiterung der Sphäre und eine nicht weniger gigantische Steigerung der künstlerischen Qualifikation der Industrie, wobei wir damit ausnahmslos die gesamte produktive Tätigkeit des Menschen meinen: Die mechanisierte und elektrifizierte Landwirtschaft wird ein Teil dieser Industrie werden. (ebenda, Seite 245-247)
Hier liefert uns Trotzki eine Konkretisierung der Vision von Marx in den Ökonomischen und philosophischen Manuskripten: Der Mensch, befreit von der entfremdeten Arbeit, wird eine Welt „im Einklang mit den Gesetzen der Schönheit“ schaffen.3
Die Landschaften der Zukunft
Trotzki beginnt danach seine Vision zu beschreiben und erlaubt sich eine sehr malerische Darstellung der Städte und Landschaften der Zukunft: „Aber nicht nur zwischen der Kunst und der Industrie wird die Trennwand fallen, sondern gleichzeitig auch zwischen der Kunst und der Natur. Nicht in jenem Rousseauschen Sinne, dass die Kunst sich dem Naturzustand nähern wird, sondern im Gegenteil, dass die Natur „künstlicher“ werden wird. Die gegenwärtige Verteilung von Berg und Tal, von Feldern und Wiesen, Steppen, Wäldern und Meeresküsten darf man keinesfalls als endgültig bezeichnen. Gewisse Veränderungen – und nicht einmal geringe – hat der Mensch bereits im Bild der Natur hervorgebracht; aber das sind im Vergleich zu dem, was noch kommen wird, nur schülerhafte Experimente. Wenn der Glaube nur versprach, Berge zu versetzen, so ist die Technik, die nichts „auf Treu und Glauben“ hinnimmt, wirklich imstande, Berge abzutragen und sie zu versetzen. Bis jetzt machte man das zu industriellen Zwecken (Bergwerke) oder für Verkehrszwecke (Tunnels); in Zukunft wird das in unvergleichlich grösserem Ausmass geschehen, je nach den Erfordernissen des gesamten Produktions- und Kunstplans. Der Mensch wird sich mit der Neuregistrierung der Berge und Flüsse befassen und die Natur überhaupt ernstlich verändern. Schliesslich wird er die Erde, wenn auch nicht nach seinem Vor- und Ebenbild, so doch nach seinem Geschmack umbauen. Wir haben keinen Grund zu der Befürchtung, dass dieser Geschmack ein schlechter sein wird.
Der eifersüchtige und scheeläugige Kljujew hat in seinem Streit mit Majakowski behauptet, dass es „einem Liedschöpfer nicht anstände, sich um Hebekräne zu kümmern“ und dass „in des Herzens Hochöfen (und nicht in irgendwelchen anderen) des Lebens rotes Gold geschmolzen“ wird. In diesen Streit hat sich Iwanow-Rasumnik eingemischt: ein Narodnik, der auch linker Sozialrevolutionär gewesen ist – womit alles gesagt ist. Die Poesie des Hammers und der Maschine, in deren Namen angeblich Majakowski auftritt, erklärt Iwanow-Rasumnik als eine vergängliche Episode, die Poesie der „nicht handgemachten Erde“ dagegen als „die ewige Poesie der Welt“. Erde und Maschine werden einander als ewiger und unvergänglicher Quell der Poesie gegenübergestellt, und selbstverständlich gibt der immanente Idealist, der vorsichtige und fade Halbmystiker Rasumnik dem Ewigen den Vorzug vor dem Vergänglichen. In Wirklichkeit ist aber dieser Dualismus von Erde und Maschine falsch: Gegenüberstellen kann man dem rückständigen Bauernacker eine Weizenfabrik, sei es eine Plantage oder ein sozialistischer Betrieb. Die Poesie der Erde ist nicht ewig, sondern veränderlich, und der Mensch hat erst dann angefangen, artikulierte Lieder von sich zu geben, als er zwischen sich und die Erde Werkzeuge und Geräte, die ersten ganz primitiven Maschinen gestellt hat. Ohne den Hackenpflug, die Sichel und die Sense gibt es keinen Kolzow. Bedeutet das etwa, das die Erde des Hakenpflugs vor der Erde mit dem Elektropflug den Vorzug der Ewigkeit hat? Der neue Mensch, der sich erst jetzt projektiert und verwirklicht, wird nicht wie Kljujew, und nach diesem auch Rasumnik, die Auerhahnbalz und das Netz für den Stör dem Hebekran und dem Dampfhammer gegenüberstellen. Der sozialistische Mensch will und wird die Natur in ihrem ganzen Umfang einschliesslich der Auerhähne und der Störe mit Hilfe von Maschinen beherrschen. Er wird beiden ihren Platz anweisen, und zeigen wo sie weichen müssen. Er wird die Richtung der Flüsse ändern und den Ozeanen Regeln vorschreiben. Die idealistischen Tröpfe mögen glauben, dies werde langweilig werden – aber dafür sind sie eben Tröpfe. Natürlich wird dies nicht bedeuten, dass der ganze Erdball in Planquadrate eingeteilt wird und das die Wälder sich in Parks und Gärten verwandeln. Wildnis und Wald, Auerhähne und Tiger wird es wahrscheinlich auch dann noch geben, aber nur dort, wo ihnen der Mensch den Platz anweist. Und er wird dies so gescheit einrichten, dass selbst der Tiger den Baukran nicht bemerken und melancholisch werden, sondern wie in Urzeiten weiterleben wird. Die Maschine ist auf allen Lebensgebieten ein Werkzeug des modernen Menschen. Die gegenwärtige Stadt ist vergänglich, aber sie wird sich nicht in dem alten Dorf auflösen. Im Gegenteil, das Dorf wird sich grundsätzlich zur Stadt erheben. Das ist die Hauptaufgabe. Die Stadt ist vergänglich; aber sie kennzeichnet die Zukunft und weist ihr den Weg, während das gegenwärtige Dorf völlig in der Vergangenheit ruht.“ (ebenda, Seite 247-249)
In diesem Abschnitt findet sich eine scharfsichtige Zurückweisung der heutigen Primitivisten, welche die „Technologie“ für all die Krankheiten des sozialen Lebens verantwortlich machen und versuchen, zu einem idyllischen Traum von Einfachheit zurückzukehren, wie bevor die Schlange der Technologie in den Garten eingedrungen sei. Wie wir schon in anderen Artikeln gezeigt haben (siehe Internationale Revue, Nr. 13, Der Kapitalismus vergiftet die Erde), bedeutet eine solche Auffassung in Wirklichkeit einen Schritt zurück zu einer vor-menschlichen Vergangenheit und damit der Eliminierung der Menschheit. Trotzki zweifelt nicht an der Stadt als Wegweiser. Doch nicht in ihrer heutigen Form. Da er die heutige Stadt als ein Übergangsphänomen anerkennt, sind wir überzeugt, dass er sich voll und ganz in Übereinstimmung mit Marx und Engels Vorstellungen einer neuen Synthese zwischen Stadt und Land befindet. Und diese Vorstellungen haben nichts am Hut mit der zerstörerischen Verstädterung des Globus, die der Kapitalismus der Menschheit heute aufbürdet. Trotzki sieht den Schutz der Wildnis als Teil des Planes zur Verwaltung des Planeten. Heute zeigt die Verschmutzung der Umwelt, und nicht zuletzt die Bedrohung durch die Zerstörung der grossen Waldgebiete, noch mehr als in den Zeiten Trotzkis auf, wie lebenswichtig ein solcher Schutz ist. Heute sind wir mit der reellen Gefahr konfrontiert, dass es keine Tiger oder Wälder mehr zu beschützen gibt und die proletarische Macht der Zukunft wir sofort drakonische Massnahmen ergreifen müssen, um dem ökologischen Holocaust ein Ende zu bereiten. Doch gibt es keinerlei Zweifel: Die kommunistische Erholung der Natur wird auf der Basis der wichtigsten Fortschritte in Wissenschaft und Technik beruhen.
Die Befreiung des Alltagslebens
Trotzki wendet sich nun der Organisierung des Alltagslebens im Kommunismus zu: „Wovon heutzutage einzelne Enthusiasten nicht immer sehr gescheit träumen – hinsichtlich der Theatralisierung des Alltags und der Rhythmisierung des Menschen selbst – das fügt sich gut und nahtlos in diese Perspektive ein. Der Mensch wird, wenn er seine Wirtschaftsordnung rationalisiert, d. h. mit Bewusstsein erfüllt und seinem Vorhaben unterworfen hat, in seinem gegenwärtigen trägen und durch und durch verfaulten häuslichen Alltag keinen Stein auf dem anderen lassen. Die zentnerschwer auf der heutigen Familie lastenden Sorgen um die Ernährung und Erziehung werden von ihr genommen und Gegenstand der öffentlichen Initiative und des unerschöpflichen kollektiven Schaffens werden. Die Frau wird endlich aus dem Zustand der Halbsklaverei befreit werden. Neben der Technik wird die Pädagogik – im breitesten Sinn der psychophysischen Formung neuer Generationen – zur Beherrscherin der öffentlichen Meinung werden. Die pädagogischen Systeme werden mächtige „Parteien“ um sich scharen. Die sozialerzieherischen Experimente und der Wettbewerb verschiedener Methoden werden eine Entfaltung erfahren, von der man heute noch nicht einmal träumen kann. Die kommunistische Daseinsform wird nicht wie ein Korallenriff zufällig entstehen, sondern bewusst aufgebaut, durch die Idee überprüft, ausgerichtet und korrigiert werden. Wenn das Dasein aufhört, eine Elementargewalt zu sein, wird es aufhören schal zu sein. Der Mensch, der es gelernt hat, Flüsse und Berge zu versetzen und Volkspaläste auf den Gipfel des Montblanc oder auf dem Meeresgrund des atlantischen Ozeans zu bauen, wird seinem Alltag natürlich nicht nur Reichtum, Farbigkeit und Spannung verleihen, sondern auch höchste Dynamik. Die Hülle des Alltags wird – kaum entstanden – unter dem Ansturm neuer technischer und kultureller Erfindungen und Errungenschaften wieder gesprengt werden. Das Leben der Zukunft wird nicht eintönig sein.“ (ebenda, Seite 249-250)
Das Erwachen des Unbewussten
Im letzten Abschnitt des Buches erreicht Trotzkis Vision ihren Höhepunkt, wenn er sich von den Berggipfeln hinab begibt in die menschliche Psyche: „Mehr noch. Der Mensch wird endlich daran gehen, sich selbst zu harmonisieren. Er wird es sich zur Aufgabe machen, der Bewegung seiner eigenen Organe – bei der Arbeit, beim Gehen oder im Spiel – höchste Klarheit, Zweckmässigkeit, Wirtschaftlichkeit und damit Schönheit zu verleihen. Er wird den Willen verspüren, die halbbewussten und später auch die unterbewussten Prozesse im eigenen Organismus: Atmung, Blutkreislauf, Verdauung und Befruchtung zu meistern, und wird sie in den erforderlichen Grenzen der Kontrolle durch Vernunft und Willen unterwerfen. Das Leben, selbst das rein psychologische, wird zu einem kollektiv-experimentellen werden. Das Menschengeschlecht, der erstarrte Homo sapiens, wird erneut radikal umgearbeitet und – unter seinen eigenen Händen – zum Objekt kompliziertester Methoden der künstlichen Auslese und des psychophysischen Trainings werden. Das liegt vollkommen auf der Linie seiner Entwicklung. Der Mensch hat zuerst die dunklen Elementargewalten aus der Produktion und der Ideologie vertrieben, indem er die barbarische Routine durch wissenschaftliche Technik und die Religion durch Wissenschaft verdrängte. Dann hat er das Unbewusste aus der Politik vertrieben, indem er die Monarchie und die Stände durch die Demokratie und durch den rationalistischen Parlamentarismus und schliesslich durch die kristallklare Sowjetdiktatur ersetzte. Am schlimmsten hat sich die blinde Naturgewalt in den Wirtschaftsbeziehungen festgesetzt – aber auch dort vertreibt sie der Mensch durch die sozialistische Organisation der Wirtschaft. Dadurch wird ein grundlegender Umbau des traditionellen Familienlebens ermöglicht. Im tiefsten und finstersten Winkel des Unbewussten, Elementaren und Untergründigen hat sich die Natur des Menschen selbst verborgen. Ist es denn nicht klar, dass die grössten Anstrengungen des forschenden Gedankens und der schöpferischen Initiative darauf gerichtet sein werden? Das Menschengeschlecht wird doch nicht darum aufhören, vor Gott, den Kaisern und dem Kapital auf allen Vieren zu kriechen, um vor den finsteren Vererbungsgesetzen und dem Gesetz der blinden Geschlechtsauslese demütig zu kapitulieren! Der befreite Mensch wird ein grösseres Gleichgewicht in der Arbeit seiner Organe erreichen wollen, eine gleichmässigere Entwicklung und Abnutzung seiner Gewebe, um schon allein dadurch die Angst vor dem Tode in die Grenzen einer zweckmässigen Reaktion des Organismus auf Gefahren zu verweisen, weil es gar keinen Zweifel daran geben kann, dass gerade die äusserste Disharmonie des Menschen – die anatomische wie die psychologische – die ausserordentliche Unausgeglichenheit der Entwicklung der Organe und Gewebe dem Lebensinstinkt eine verklemmte, krankhafte und hysterische Form der Angst vor dem Tode verleiht, die den Verstand trübt und den dummen und erniedrigenden Phantasien von einem Leben nach dem Tode Nahrung gibt.
Der Mensch wird sich zum Ziel setzen, seiner eigenen Gefühle Herr zu werden, seine Instinkte auf die Höhe des Bewusstseins zu heben, sie durchsichtig klar zu machen, mit seinem Willen bis in die letzten Tiefen seines Unbewussten vorzudringen und sich so auf eine Stufe zu erheben – einen höheren gesellschaftlich-biologischen Typus, und wenn man will – den Übermenschen zu schaffen.
Bis zu welchem Ausmass der Selbstbeherrschung der Mensch der Zukunft es bringen wird – das ist ebenso schwer vorauszusehen wie jene Höhen, zu denen er seine Technik führen wird. Der gesellschaftliche Aufbau und die psychisch-physische Selbsterziehung werden zu zwei Seiten ein und desselben Prozesses werden. Die Künste: Wortkunst, Theater, bildende Kunst, Musik und Architektur – werden diesem Prozess eine herrliche Form verleihen. Genauer gesagt: Jene Hülle, in die sich der Prozess des kulturellen Aufbaus und der Selbsterziehung des kommunistischen Menschen kleiden wird, wird alle Lebenselemente der gegenwärtigen Künste bis zur Leistungsfähigkeit entfalten. Der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner; sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer und seine stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des Aristoteles, Goethe oder Marx erheben. Und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen.“ (ebenda, Seite 250-252)
Um auf die Aussagen dieses letzten Abschnitts einzugehen wäre ein ganzer Artikel notwendig. Um aber den vorliegenden Artikel abzuschliessen, müssen wir zur Frage zurückkehren die zu Beginn gestellt wurde: Kann Trotzkis Bild vom Leben in einer kommunistischen Zukunft als eine Form von Utopismus, ausserhalb des reellen Rahmens der materiellen Möglichkeiten betrachtet werden?
Hier können wir Bezug nehmen auf Bordigas Aussage, dass der Unterschied zwischen Marxismus und Utopismus nicht darin liegt, dass sich letzterer vor allem der Beschreibung der Zukunft widmen würde und ersterer nicht, sondern im Unterschied zu den Utopisten der Marxismus, durch die Umschreibung des Proletariates und seine Identifizierung mit ihm als die eigentlich kommunistische Klasse, die wirkliche Bewegung entdeckt hat, welche den Kapitalismus überwinden und den Kommunismus errichten kann. Durch die Überwindung aller abstrakten Schemen, welche auf einfachen Idealen und Wünschen aufbauen, ist der Marxismus absolut berechtigt, die gesamte Geschichte der Menschheit zu untersuchen um sein Verständnis über die wirklichen Möglichkeiten der menschlichen Spezies zu entwickeln. Wenn Trotzki vom durchschnittlichen Individuum spricht, welches im Kommunismus die Höhen eines Aristoteles, Goethe oder Marx erreicht, stützt sich diese Aussage auf die Anerkennung, dass diese ausserordentlichen Individuen selbst Produkt breiterer sozialer Kräfte waren und daher als Meilensteine angesehen werden können, die den Weg in die Zukunft weisen. Als Indikatoren wie das menschliche Wesen einst sein könnte, wenn es die Fesseln der Klassenprivilegien und der ökonomischen Armseligkeit hinter sich gelassen hat.
Trotzki schrieb Literatur und Revolution 1924, zur Zeit als die Unruhe der stalinistischen Konterrevolution ihn voll umgab. Seine Vision ist um so mehr ein Zeugnis seines tiefen Vertrauens in die kommunistische Perspektive der Arbeiterklasse. In den heutigen Tagen des kapitalistischen Zerfalls, in denen alleine der Gedanke an den Kommunismus mehr als je zuvor nicht nur als Utopie, sondern als gefährliche Illusion verschrien wird, bleibt Trotzkis Portrait einer zukünftigen Menschheit eine wichtige Inspirationsquelle für eine neue Generation von revolutionären Militanten.
CDW
Fußnoten:
1 „Die proletarische Revolution verwendet keinen Terror für die Durchsetzung ihrer Ziele: sie betrachtet den Massenmord mit Hass und Aversion. Sie gebraucht solche Mittel nicht, da sie keinen Kampf gegen Individuen sondern gegen Institutionen führt.“ Dies heisst jedoch nicht, dass die Spartakisten gegen die Klassengewalt waren, welche nicht dasselbe bedeutet.
2 Wenn Trotzki den Begriff Realismus verwendete, sprach er von etwas breiterem als von der eigentlichen Schule des Realismus die ihr goldenes Zeitalter im 19ten Jahrhundert hatte. Er meinte damit „einen realistischen Monismus im Sinne einer Philosophie des Lebens, und nicht ein „Realismus“ im Sinne des traditionellen Arsenals der literarischen Schulen“. Es ist ebenfalls interessant, den Standpunkt Trotzkis nach seiner letzten Konfrontation mit der surrealistischen Bewegung kennen zu lernen, mit der er wichtige Übereinstimmungen hatte. Wir werden in einem Artikel darauf zurückkommen. Rückblickend kann man anfügen, dass Trotzkis Definition des Realismus nichts zu tun hatte mit der eindimensionalen Banalität des „Sozialistischen Realismus“, den die stalinistische Bürokratie hervorgebracht hatte. Im Gegensatz zur besten Tradition der Bolschewiki, welche über eine florierendes Aufstreben der Künste in den ersten Jahren der Revolution verfügt hatte, verlangte der „Sozialistische Realismus“ von der Kunst, lediglich Vehikel politischer Propaganda, und zudem einer reaktionären Propaganda zu sein, da sie sich in den Dienst des stalinistischen Terrors und den Aufbau eines staatskapitalistischen Kasernenregimes zu stellen hatte. Es ist sicher kein Zufall, dass der „Sozialistische Realismus“ sich in der Form wie auch im Inhalt nicht vom Nazi-Kitsch unterscheiden konnte. Wie Trotzki und Breton im Manifest der Internationalen Föderation schrieben: „Der Styl der offiziellen sowjetischen Malerei wird als „Sozialistsicher Realismus“ bezeichnet – eine solche Etikette konnte nur von einem Bürokraten an der Spitze des Departements der Künste eingeführt werden (...) Nur mit Abscheu und Horror kann man die Gedichte und Romane lesen oder die Bilder und Skulpturen betrachten, in denen Staatsdiener, bewaffnet mit Feder, Bürste und Pinsel, und bewacht durch Staatsdiener mit Revolvern, die „grossen genialen Führer“ glorifizieren, welche über keinen Funken von Genialität oder Grösse verfügen. Die Kunst der stalinistischen Epoche bleibt der schlagendste Ausdruck des Niedergangs der proletarischen Revolution.“
3 Siehe dazu die Artikelserie über die Manuskripte von 1844 und die darin enthaltene Vision des Kommunismus. Internationale Revue, Nr. 70 und 71, franz., engl., span.
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Der historische Kampf der Revolutionäre gegen die pazifistischen Illusionen
- 3357 Aufrufe
Nachstehend veröffentlichen wir einen Artikel von Leo Trotzki neu, den er um die Mitte des Jahres 1917 schrieb, einige Wochen nach seiner aufgrund der revolutionären Erhebung im Februar erfolgten Rückkehr aus den USA. Das Zarenregime war durch eine provisorische „demokratisch bürgerliche“ Regierung abgelöst worden. Seither herrschte in Russland eine Situation der Doppelmacht, mit einer bürgerlichen Herrschaft in der Form der provisorischen Regierung einerseits und der Arbeiterklasse, die sich in Arbeiterräten, den Sowjets, organisiert hatte, andererseits. Die provisorische Regierung wie auch die Parteien, die damals in den Räten die Mehrheit besaßen, die Menschewiki und die Sozialrevolutionäre (SR), setzten sich für eine Fortsetzung des Kriegs gegen den Willen des Proletariats ein, eine Fortsetzung des imperialistischen Programms des russischen Kapitals, das durch Abkommen mit den anderen Mächten der Entente (Frankreich und Großbritannien) gegen Deutschland-Österreich verbunden war.1
Der Grund für die Wiederveröffentlichung dieses Textes liegt nicht allein im Interesse für die Geschichte, sondern vor allem in seiner brennenden Aktualität trotz aller Unterschiede zwischen der heutigen Situation und derjenigen von 1917. Obwohl wir heute weder mit einem Weltkrieg noch einer revolutionären Situation konfrontiert sind, sind die zentralen Fragen, die der Artikel „Der Pazifismus – Wasserträger des Imperialismus“ behandelt, grundsätzlich die gleichen, die sich für das Proletariat heute in allen Ländern stellen, unabhängig davon, welche Parolen die Pazifisten oder die Kriegstreiber in den verschiedenen Ländern herausgeben.
Trotzki stellte sich im Ersten Weltkrieg von Anfang an auf die Seite der Internationalisten, die alle kriegführenden Lager und die Sozialpatrioten, die das Proletariat für das Gemetzel mobilisierten, an den Pranger stellten. Im Herbst 1914 gehörte er mit seinem Beitrag „Der Krieg und die Internationale“ zu den Ersten, welche die Verräter der Sozialdemokratie angriffen, die dem Imperialismus ihres jeweiligen Nationalstaats im Namen des „Fortschritts“ oder der „Vaterlandsverteidigung“ unter die Arme griffen. Doch die Revolutionäre der Vergangenheit entlarvten nicht nur die Kriegsgurgeln und die Sozialchauvinisten wie Plechanow und Scheidemann, sondern auch die Neutralen und die Pazifisten, vor allem die Sozialpazifisten wie Turati und Kautsky. Lenin schrieb im Januar 1917, dass es eine grundsätzliche Einheit zwischen den beiden Kategorien gebe und dass beide – Sozialchauvinisten und Sozialpazifisten – Diener des Imperialismus seien: „Die einen dienen ihm, indem sie den imperialistischen Krieg als „Vaterlandsverteidigung“ darstellen, die anderen verteidigen den gleichen Imperialismus, indem sie ihn mit Phrasen über den ‚demokratischen Frieden‘ verschleiern, den imperialistischen Frieden, der sich heute ankündigt. Die imperialistische Bourgeoisie braucht Diener der einen und der anderen Sorte, der einen und der anderen Schattierung: Sie braucht die Plechanows um die Völker aufzufordern sich gegenseitig mit dem Ruf ‚Nieder mit den Angreifern‘ abzuschlachten; sie braucht aber auch die Kautskys, um die durch die Hymnen und Loblieder zu Ehren des Friedens irritierten Massen zu trösten und zu beruhigen“. Die Internationalisten haben die pazifistischen Losungen, die man jetzt wieder vernimmt, schon immer zurückgewiesen.
Aktualität der Fragen
Der Pazifismus ist nichts Neues. Seine Wesenszüge sind immer und überall die gleichen: die gesellschaftliche Ordnung, die notwendigerweise Kriege hervorbringt, nicht in Frage stellen; die herrschende bürgerliche Logik verteidigen, insbesondere die Demokratie; „die Lehre der sozialen Harmonie zwischen den verschiedenen Klasseninteressen“ propagieren (wie Trotzki sagte) und ihre Entsprechung auf der Ebene der Beziehungen zwischen Nationalstaaten, die „stufenweise Milderung der nationalistischen Konflikte“.
Das enorme Gewicht der gegenwärtigen pazifistischen Propaganda misst sich an der Breite der „Antikriegs“demonstrationen, welche die Bourgeoisie organisiert hat: Es gibt darunter solche, die am gleichen Tag weltweit mehr Leute mobilisiert haben als jede frühere Demonstration für die gleiche „Sache“. Wie wir bereits in Artikeln in der Territorialpresse (World Revolution, Révolution Internationale, Weltrevolution etc.) aufgezeigt haben, besteht die spezifische Funktion dieser Propaganda darin, die Infragestellung des Kapitalismus zu verhindern, das Verständnis darüber zu verhindern, dass der Krieg ein Ausdruck der imperialistischen Rivalitäten zwischen allen Ländern ist, eine Folge der kapitalistischen Konkurrenz, in der jeder Staat seine nationalen Interessen verficht.
Es ist schlicht und einfach eine „Politik der nationalen Einheit“ hinter der jeweiligen Bourgeoisie, die von einige Staaten, insbesondere von Deutschland und Frankreich, betrieben wird, wo die Propaganda offen antiamerikanische Töne anschlägt und von praktisch allen politischen Fraktionen der nationalen Bourgeoisie unterstützt und betrieben wird. Das Ziel ist dabei, antiamerikanische Gefühle in der Bevölkerung zu schüren, indem die USA als die einzigen Kriegstreiber dargestellt werden, als der imperialistische Gegner „Nummer 1“ schlechthin, und die Ablehnung des Krieges auf ein bürgerliches und sogar patriotische Terrain abzulenken. Demgegenüber war die Losung Karl Liebknechts und der Internationalisten während dem Ersten Weltkrieg: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land!“2
Heute wie in der Vergangenheit ist der Pazifismus die beste Gehirnwäsche für den Krieg. Diese Ideologie ist ein echtes Gift gegen die Arbeiterklasse. Abgesehen davon, dass eine solche Mystifizierung betrieben wird, um eine bestimmte nationalistische Ideologie zu verschleiern, hat der Pazifismus auch noch ein ganz besonderes Ziel: die Furcht der Arbeiter vor der Kriegsdrohung und ihre Ablehnung gegen den Krieg aufzugreifen, um ihr Bewusstsein zu vergiften und sie dazu zu bringen, ein bürgerliches Lager gegen das andere zu unterstützen.
Aus diesem Grund räumte die Bourgeoisie dem Pazifismus immer dann, wenn es darum ging, die Proletarier von der mörderischen Logik des Krieges zu überzeugen, einen wichtigen Platz ein im Rahmen der breiten Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen imperialistischen Fraktionen des Weltkapitals.
Der Pazifismus wird nicht durch die Forderung nach Frieden definiert. Alle wollen den Frieden. Auch die Kriegstreiber selber berufen sich ständig darauf, dass sie den Krieg nur deshalb wollen, um dann später den Frieden besser gewährleisten zu können. Was den Pazifismus ausmacht, ist, dass er vorgibt, man könne für den Frieden an sich kämpfen, ohne die Grundlage des kapitalistischen Systems zu berühren. Die Proletarier, die durch ihren revolutionären Kampf in Russland und Deutschland den Ersten Weltkrieg beendeten, wollten auch, dass der Krieg aufhöre. Aber ihr Kampf hatte nur deshalb Erfolg, weil sie es verstanden, den Kampf nicht MIT den „Pazifisten“ zu führen, sondern trotz ihnen und GEGEN sie. Von dem Zeitpunkt an, wo es klar wurde, dass der revolutionäre Kampf darauf hinaus lief, die imperialistische Schlächterei abzubrechen, standen die Proletarier in Russland und Deutschland plötzlich nicht nur den „Falken“ innerhalb der Bourgeoisie gegenüber, sondern auch und insbesondere all diesen Pazifisten der ersten Stunde (Menschewiki, Sozialrevolutionäre, Sozialpatrioten), die mit der Waffe in der Hand das verteidigten, worauf sie am wenigsten verzichten konnten und was ihnen am liebsten war: den bürgerlichen Staat. Zu diesem Zweck mussten sie die Revolte der Ausgebeuteten gegen den Krieg ihrer Spitze gegen das Kapital berauben.
Zwischen dem Pazifismus und den Revolutionären gibt es eine Klassengrenze. Die Revolutionäre, die Internationalisten wie Lenin, Luxemburg und Trotzki kämpften für die Betätigung der proletarischen Massen auf ihrem Klassenterrain, für die Verteidigung ihrer Lebensbedingungen: „Entweder machen die bürgerlichen Regierungen den Frieden, wie sie den Krieg machen, dann bleibt bei jedem Ausgang des Krieges der Imperialismus die herrschende Macht, und dann geht es unvermeidlich immer weiter neuen Rüstungen, Kriegen und dem Ruin, der Reaktion, der Barbarei entgegen. Oder ihr rafft euch zum Kampf um die politische Macht, um euren Frieden nach außen und nach innen zu diktieren.“ (Rosa Luxemburg, Spartacus, Nr. 4 vom April 1917, Wilsons Sozialismus)
Trotz der unterschiedlichen historischen Situation sind die wichtigsten Fragen, die sich heute angesichts der Allgegenwart des Krieges und der immensen pazifistischen Kampagne stellen, die gleichen wie diejenigen, die Trotzki in „Der Pazifismus – Wasserträger des Imperialismus“ aufwarf.
Der Zusammenhang zwischen Pazifismus und Demokratie
Trotzki zeigte auf, dass der Pazifismus und die Demokratie von gleicher Herkunft sind. Die Vorstellung von der Gleichheit und der Freiheit eines jeden Individuums in der kapitalistischen Gesellschaft ist gemäss der bürgerlichen Auffassung die Bedingung für den Vertrag zwischen dem Arbeiter und seinem Ausbeuter. Und zufolge dieser gleichen Ideologie sollten auch die Beziehungen zwischen den Nationen denselben Gesetzen der Gleichheit und der „Vernunft“ gehorchen. „Doch hier kam ihr der Krieg in die Quere, der ebenfalls eine Methode der Problemlösung darstellt, allerdings unter vollständiger Außerachtlassung der ‚Vernunft‘. (...) Die kapitalistische Realität allerdings behandelt das Ideal des ewigen Friedens, das auf der Harmonie der Vernunft gründen soll, noch erbarmungsloser als die Ideale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Der Kapitalismus hat zwar die Technik auf rationaler Grundlage entwickelt, war aber nicht in der Lage, die wirtschaftlichen Bedingungen rational zu regeln.“
Trotzki entlarvte nicht nur die offiziellen Pazifisten à la Wilson und diejenigen der „Opposition“ à la Bryan3, sondern auch das Kleinbürgertum, das „mit all seinen Traditionen und Illusionen der Hüter der demokratischen Ideologie“ ist.
Was Trotzki aber nicht voraussehen konnte, war das enorme Gewicht, das diese demokratische Ideologie 80 Jahre später in der letzten Phase des Kapitalismus, in derjenigen des kapitalistischen Zerfalls, annehmen würde. Mangels Perspektive in dieser Gesellschaft drängt sich die demokratische Ideologie, die der verallgemeinerten Warenproduktion entspricht, spontan auf. „Die bürgerliche Demokratie verlangte gesetzliche Gleichheit für einen freien Wettbewerb“, sagte Trotzki. Der Wettbewerb, die Konkurrenz, das „Jeder-für-sich“ werden im kapitalistischen Zerfall auf die Spitze getrieben mit der Atomisierung, der extremen Entfremdung und dem Krieg eines jeden gegen jeden. In dieser letzten Phase des Kapitalismus durchdringt die demokratische Ideologie alle Verhältnisse in der Gesellschaft, und die Demokratie wird zur Rechtfertigung und zum Vorwand für alles und jeden: Chirac und Schröder widersetzen sich der Intervention im Irak im Namen der Demokratie; Bush und Powell beschließen die Intervention, um angeblich den arabischen Völkern die Demokratie zu bringen. Man kann im Namen der Demokratie foltern, man kann die Folter im Namen der Demokratie verbieten und man kann auch auf demokratische Art foltern, das heißt dann, wenn es notwendig ist im Sinne von Artikel X des Gesetzes Y, das ja demokratisch verabschiedet worden ist.
Es ist kein Zufall, wenn heute der Pazifismus wieder einmal der Botschafter der demokratischen Ideologie ist. Es ist nicht mehr naiv, sondern zynisch, wenn die pazifistischen Organisationen dem Krieg die „Menschenrechte“ und die „humanitäre Hilfe” entgegen setzen und dabei vertuschen, dass alle Kriege spätestens seit Reagan und vor allem seit dem Zusammenbruch des Ostblocks durch die westlichen Mächte im Namen der Menschenrechte und unter dem Banner der „humanitären Interventionen” geführt wurden.
Die Pazifisten und die Demokraten rufen die „Bevölkerung“ im allgemeinen, die „Bürger” dazu auf, sich gegen den Krieg zu mobilisieren, während die Revolutionäre immer aufgezeigt haben, dass einzig der Kampf des Proletariats auf seinem eigenen Klassenterrain, für seine eigenen Ziele dem Krieg ein Ende bereiten kann. Mit dem Pazifismus wird das Proletariat nur an die Verteidigung des einen imperialistischen Lagers gegen das andere gekettet: Es kann dabei einzig die eigene Klassenidentität verlieren, indem es sich in der „Bevölkerung“ im allgemeinen auflöst, in allen anderen Klassen, mitten in einer riesigen Bewegung der „Bürger“, in der es unmöglich ist, seine eigenen Interessen geltend zu machen, die Interessen einer Klasse, die kein Vaterland hat, und keine Grenzen und nationalen Interessen zu verteidigen. Die heutigen Trotzkisten haben das Programm Lenins, Trotzkis und Luxemburgs schon vor langem verraten4, und dies beweisen sie einmal mehr, indem sie aktiv an den pazifistischen Mobilisierungen teilnehmen, wo sie sich in der Art vernehmen lassen: „Eine möglichst breite, aktive, breit gefächerte Bewegung gegen den Krieg zu entfalten ist ein notwendiges Element, um den Krieg zu stoppen, um die Bedingungen zu schaffen, damit das irakische Volk selber über seine Zukunft bestimmen kann.“ (Flugblatt vom 5.3.2003 der „Bewegung für den Sozialismus”, einer Filiale der 4. Internationale). Solche demokratischen und pazifistischen Illusionen zu verbreiten heißt aktiver Bestandteil des ideologischen und politischen Apparates des eigenen Imperialismus zu sein.
Die Lehre der gesellschaftlichen Harmonie und der Regelung der nationalen Konflikte
Trotzki verspottete die Illusionen der Pazifisten, die an die Möglichkeit der Abschwächung der Konflikte zwischen imperialistischen Staaten glaubten: „Wenn wir die Möglichkeit einer stufenweisen Milderung der Klassenkämpfe annehmen wollen, dann müssen wir dies ebenso bei den nationalistischen Konflikten tun.”
Obwohl sich die nationalen Konflikte seit dem Ersten Weltkrieg vervielfacht haben, trotz aller Massaker des 20. Jahrhunderts, die tausend Mal bewiesen haben, dass der Militarismus und der Krieg zur dauerhaften Lebensform des dekadenten Kapitalismus geworden sind, fordern die Pazifisten immer noch die Anwendung des Völkerrechts und die Einigung auf ein formelles Verfahren im Rahmen der UNO.
Die heutigen Trotzkisten setzen alles daran, die Erinnerung an Trotzki durch den Dreck zu ziehen. Die LCR in Frankreich bezieht nicht nur eine leidenschaftlich antiamerikanische Position, die perfekt mit der imperialistischen Politik der französischen Bourgeoisie harmoniert, sondern fordert darüber hinaus, dass „Frankreich sein Vetorecht in der UNO gegen den Ausbruch des Krieges einsetzt“, um damit „unsere Solidarität mit den Demokraten des Iraks“ auszudrücken. So beharren die Trotzkisten auf der Anwendung der Regeln der UNO, deren Vorgänger Wilsons Völkerbund war – und all das im Namen der Demokratie. Man müsste sie fragen, ob sie je etwas von einem gewissen Trotzki gehört oder gelesen haben.
Der Pazifismus bereitet die Kriege vor
Der Artikel „Der Pazifismus – Wasserträger des Imperialismus” zeigt auch, mit welchen Kniffen die Pazifisten die Massen für den Militarismus und den Krieg mobilisieren. Sie argumentieren nach der Art: „Alles in unseren Kräften liegende zur Verhinderung des Krieges‘ bedeutet, den oppositionellen Massen ein Ventil mittels harmlosen Manifesten zur Verfügung zu stellen, in denen der Regierung für den Fall des Kriegsausbruchs die Garantie gegeben wird, dass die pazifistische Opposition dann kein Hindernis darstellen wird.“
Wenn Trotzki vom Pazifismus Wilsons und dem dröhnenden Widerstand Bryans gegen den Krieg schreibt, so denkt man unwillkürlich an Schröder, den Altachtundsechziger, und Fischer, den früheren Linksextremen, die wirklich die besten Vertreter sind, die sich der deutsche Imperialismus aussuchen konnte, denn “wenn Schröder den Krieg erklären kann, und selbst Fischer ihn in der Kriegsfrage unterstützt, dann muss es sich gewiss um einen gerechten und notwendigen Krieg handeln.“
Mit der Wiederveröffentlichung dieses Textes von Trotzki wollen wir unsere Leser auch ermuntern, sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und den Lehren zu beschäftigen, die man daraus für den Krieg, aber auch für den Pazifismus ziehen kann. Eine wesentliche Waffe der Arbeiterklasse ist ihr Bewusstsein. Dieses bildet sich, indem es sich wesentlich auch auf die Geschichte der Arbeiterklasse stützt, eine Geschichte, die wie diejenige der Klassengesellschaften insgesamt schon viel zu lange dauert. Dem Kapitalismus muss eine Ende gesetzt werden, bevor er der Menschheit ein Ende setzt.
SM (März 2003)
Leo Trotzki 1917:: Der Pazifismus – Wasserträger des Imperialismus
Niemals gab es auf der Welt so viele Pazifisten wie heute, da sich in allen Ländern die Menschen gegenseitig töten. Jede historische Epoche bringt nicht nur ihre eigene Technik und ihre eigene politische Form hervor, sondern ebenso ihre spezifische Heuchelei. Früher töteten sich die Völker gegenseitig im Namen der christlichen Lehre von Liebe und Menschlichkeit. Heute beziehen sich darauf nur noch rückwärts gewandte Regierungen. Fortschrittliche Nationen ziehen sich gegenseitig das Fell im Namen des Pazifismus über die Ohren. Wilson zerrte Amerika im Namen des Völkerbundes und des ewigen Friedens in den Krieg.
Kerenski und Tseretelli rufen nach einer Offensive im Dienste eines baldigen Friedens.
Unserer Epoche mangelt es an der empörten Satire eines Juvenal. Auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass sich selbst die mächtigsten satirischen Waffen im Vergleich zur triumphierenden Niederträchtigkeit und der kriecherischen Dummheit, zwei in diesem Krieg entfesselten Elementen, als machtlos und illusorisch erweisen.
Der Pazifismus ist von gleicher Herkunft wie die Demokratie. Die Bourgeoisie unternahm einen großen historischen Anlauf, um alle menschlichen Beziehungen im Einklang mit der Vernunft zu regeln, alle blinden und beschränkten Traditionen durch Institutionen der kritischen Vernunft zu ersetzen. Die Zünfte mit ihren Produktionsbeschränkungen, die politischen Institutionen mit ihren Privilegien, der monarchische Absolutismus – all dies waren Überreste aus dem Mittelalter. Die bürgerliche Demokratie verlangte gesetzliche Gleichheit für einen freien Wettbewerb sowie den Parlamentarismus als Mittel zur Regelung der öffentlichen Angelegenheiten. Sie trachtete danach, auch die nationalen Beziehungen in diesem Sinne zu regeln. Doch hier kam ihr der Krieg in die Quere, der ebenfalls eine Methode der Problemlösung darstellt, allerdings unter vollständiger Außerachtlassung der „Vernunft“. Also begann sie, die Menschen in den Gedichten, der Philosophie, der Ethik und der Betriebswirtschaft zu lehren, dass es für sie viel nützlicher sei, den ewigen Frieden einzuführen. Dies ist die logische Argumentationsweise des Pazifismus.
Der angeborene Fehler des Pazifismus ist grundsätzlich der gleiche wie derjenige der bürgerlichen Demokratie. Ihre Kritik kratzt lediglich an der Oberfläche der gesellschaftlichen Erscheinungen und hat nicht den Mut, in die tieferen Schichten der ökonomischen Tatsachen vorzudringen. Die kapitalistische Realität allerdings behandelt das Ideal des ewigen Friedens, das auf der Harmonie der Vernunft gründen soll, noch erbarmungsloser als die Ideale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Der Kapitalismus hat zwar die Technik auf rationaler Grundlage entwickelt, war aber nicht in der Lage, die Bedingungen rational zu regeln. Er entwickelte Waffen zur gegenseitigen Ausrottung, von denen selbst die „Barbaren“ des Mittelalters nicht zu träumen wagten.
Die schnelle Intensivierung der internationalen Bedingungen und das unablässige Wachstum des Militarismus entzogen dem Pazifismus den Boden. Aber gleichzeitig haben genau diese Kräfte dem Pazifismus ein neues Leben eingehaucht, und zwar ein vom alten Leben genau so verschiedenes, wie sich der blutrote Sonnenuntergang von der rosigen Morgendämmerung unterscheidet.
Die zehn dem Krieg vorausgegangen Jahre wurden als „bewaffneter Friede“ bezeichnet. Die ganze Zeit war aber tatsächlich nichts anderes als ein ununterbrochener Krieg, der in den Kolonialgebieten geführt wurde.
Dieser Krieg wurde auf den Gebieten rückständiger und schwacher Völker ausgetragen, in Afrika, Polynesien und Asien, und ebnete den Weg zum gegenwärtigen Krieg. Seit 1871 hatte es in Europa keinen Krieg mehr gegeben, obwohl es eine Anzahl von kleinen, aber heftigen Konflikten gegeben hatte, und im Kleinbürgertum war die Anschauung systematisch verstärkt worden, dass eine ständig wachsende Armee eine Garantie des Friedens sei und schließlich zu einer neuen internationalen Organisation des Gesetzes führen werde. Die kapitalistischen Regierungen und das Big Business hatten natürlich nichts gegen eine solche „pazifistische“ Interpretation des Militarismus. Gleichzeitig bahnten sich die globalen Konflikte an, und die Weltkatastrophe war da.
Theoretisch und politisch hat der Pazifismus dieselbe Grundlage wie die Lehre der sozialen Harmonie zwischen den verschiedenen Klasseninteressen.
Der Gegensatz zwischen kapitalistischen Nationalstaaten hat dieselbe ökonomische Grundlage wie der Klassenkampf. Wenn wir die Möglichkeit einer stufenweisen Milderung der Klassenkämpfe annehmen wollen, dann müssen wir dies ebenso bei den nationalistischen Konflikten tun.
Das Kleinbürgertum mit all seinen Traditionen und Illusionen ist der Hüter der demokratischen Ideologie. Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte es tiefgreifende innere Veränderungen durch, verschwand aber trotzdem nicht ganz von der Szene. Gleichzeitig mit der Unterminierung der ökonomischen Bedeutung des Kleinbürgertums durch die Entwicklung der kapitalistischen Technik gaben ihm das allgemeine Wahlrecht und der Militärdienst dank seiner numerischen Stärke eine scheinbare politische Bedeutung. Wo der Kleinkapitalist nicht vollständig durch das Big Business seiner Existenz beraubt war, wurde er vollständig dem Kreditsystem unterworfen. Die Vertreter des Big Business hatten das Kleinbürgertum nur noch auf politischer Ebene zu unterwerfen, indem sie es aller Theorien und Vorurteile beraubten und ihm einen fiktiven Wert verliehen. Dies ist die Erklärung der Phänomene, die man in den letzten zehn Jahren vor dem Krieg beobachten konnte, in denen der reaktionäre Imperialismus sich zu einer erschreckenden Höhe aufschwang, während gleichzeitig die illusionären Blüten der bürgerlichen Demokratie mit dem Reformismus und dem Pazifismus hervorkamen. Für seine imperialistischen Ziele unterwarf das Großkapital das Kleinbürgertum, indem es sich auf dessen Klassenvorurteile abstützte.
Frankreich war das klassische Beispiel dieses zweifachen Prozesses. Frankreich ist das Land des Finanzkapitals, das durch ein zahlreiches und allgemein konservatives Kleinbürgertum unterstützt wird. Wegen Auslandkrediten, den Kolonien und dem Bündnis mit Russland und England wurde die obere Schicht der Bevölkerung in all die Interessen und Konflikte des Weltkapitalismus hineingezerrt. Indessen blieb der französische Kleinbürger provinziell bis ins Mark. Er hat eine instinktive Furcht vor Geographie und sein ganzes Leben ist gezeichnet von einem Horror vor dem Krieg, und zwar hauptsächlich deshalb, weil er gewöhnlich nur einen Sohn hat, dem er sein Geschäft und seine Möbel vererben wird. Dieser Kleinbürger entsendet einen radikalen Bourgeois auf das Versprechen hin ins Parlament, dass er ihm durch den Völkerbund einerseits und die russischen Kosaken andererseits, die dem Kaiser den Kopf abhauen würden, den Frieden erhalten werde.
Der radikale Abgeordnete entstammt einem Zirkel provinzieller Anwälte und kommt in Paris nicht nur voller Friedensabsichten an, sondern mit einer höchst vagen Vorstellung über die Lage des Persischen Golfs und ohne jegliche klare Idee davon, warum oder für wen die Bagdadbahn notwendig ist. Aus diesen „radikal pazifistischen“ Abgeordneten ging eine radikale Regierung hervor, die sich sofort bis über die Ohren in einem Netz all der vorangegangenen diplomatischen und militärischen Verpflichtungen der verschiedenen Finanzinteressen der französischen Börse in Russland, Afrika und Asien verhedderte. Die Regierung und das Parlament fuhren unaufhörlich mit ihrer pazifistischen Phraseologie fort, aber gleichzeitig verfolgten sie automatisch eine Außenpolitik, die Frankreich schließlich in den Krieg führte.
Der englische und amerikanische Pazifismus verrichtet trotz der Verschiedenheit der sozialen und ideologischen Bedingungen (auch trotz des Fehlens jeglicher Ideologie in Amerika) im wesentlichen dieselbe Arbeit: Er stellt der Angst des Kleinbürgers vor den welterschütternden Ereignissen ein Ventil zur Verfügung, das ihn schließlich der letzten Überreste seiner Unabhängigkeit beraubt. Seine Vorsicht wird durch nutzlose Begriffe wie Abrüstung, Völkerrecht und Schiedsgerichte eingeschläfert. Und in einem bestimmten Augenblick wird er mit Haut und Haar dem kapitalistischen Imperialismus ausgeliefert, der bereits alle notwendigen Mittel mobilisiert hat: die Technik, die Kunst, die Religion, den bürgerlichen Pazifismus und den patriotischen „Sozialismus“.
Und der französische Kleinbürger schreit: „Wir waren gegen den Krieg, unsere Abgeordneten, unsere Minister, wir alle waren gegen den Krieg. Und nun, da uns der Krieg aufgezwungen worden ist, müssen wir ihn zur Verwirklichung unserer pazifistischen Ideale bis zum siegreichen Ende führen.“ Und der Vertreter des französischen Pazifismus, Baron d’Estournel de Constant, segnet diese pazifistische Philosophie mit einem feierlichen „jusqu’au bout!“ – Krieg bis zum Ende!
Die englische Börse benötigte zur erfolgreichen Kriegführung gerade einen Pazifisten wie den Liberalen Asquith und den radikalen Demagogen Lloyd George. „Wenn diese Männer den Krieg führen,“ sagt das englische Volk, „dann muss das Recht auf unserer Seite sein.“
Und so spielte der Pazifismus im Mechanismus dieses Kriegs die ihm zugewiesene Rolle so wie das Giftgas oder die ständig steigenden Kriegskredite.
In den USA zeigte der Pazifismus des Kleinbürgertums sein wahres Gesicht als Wasserträger des Imperialismus. Dort hatten die Banken und Trusts die Politik im Griff. Schon vor dem Krieg traten die USA aufgrund der außergewöhnlichen Entwicklung der Industrie und des Exports immer mehr auf die internationale Bühne, um ihre Interessen zu verteidigen und gleichzeitig den Imperialismus zu entwickeln. Der europäische Krieg aber beschleunigte diese imperialistische Entwicklung in einem fieberhaften Tempo. Als viele fromme Leute (sogar Kautsky) hofften, dass der Horror der Schlächterei in Europa die amerikanische Bourgeoisie mit einem Horror vor dem Militarismus erfüllen würde, bewegten sich die wirklichen Ereignisse in Europa nicht auf einer psychologischen, sondern auf einer materialistischen Linie und führten so zu gerade gegenteiligen Resultaten. Die Exporte der USA beliefen sich 1913 auf 2466 Millionen Dollars, und stiegen 1916 auf die verrückte Höhe von 5481 Millionen Dollars. Logischerweise machte die Waffenindustrie den Löwenanteil des Exports aus. 1915 importierte die Entente amerikanische Waren im Umfang von 35 Milliarden, während Deutschland und Österreich-Ungarn für kaum mehr als 15 Millionen importierten. So zeigte sich also nicht nur eine Abnahme der gigantischen Profite, sondern die ganze amerikanische Industrie, die ihre Grundlage in der Kriegsindustrie hatte, war nun von einer schweren Krise bedroht. Diese Zahlen müssen wir als Schlüssel für das Verständnis der Aufteilung der „Sympathien“ in Amerika betrachten. Und so riefen die Kapitalisten dem Staat zu: „Du hast die Entwicklung des Kriegsindustrie unter dem Banner des Pazifismus in Gang gebracht, du musst uns nun auch einen neuen Markt finden.“ Wenn der Staat nicht in der Lage war, die „Freiheit der Meere“ zu versprechen (mit anderen Worten die Freiheit, Kapital aus Menschenblut zu pressen), so musste er wenigstens für die bedrohte Kriegsindustrie einen neuen Markt öffnen – und zwar in Amerika selbst. Und so führten die Anforderungen der europäischen Schlächterei zu einer plötzlichen und katastrophalen Militarisierung der USA.
Dieses Geschäft musste die Opposition der breiten Massen hervorrufen. Dieser unbestimmten Unzufriedenheit entgegenzutreten und sie in eine patriotische Kooperation umzuwandeln war die wichtigste Aufgabe der US-amerikanischen Innenpolitik. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass der offizielle Pazifismus Wilsons und der „oppositionelle“ Pazifismus Bryans die mächtigsten Waffen zur Lösung dieser Aufgabe lieferten, nämlich zur Beschwichtigung der Massen durch den Militarismus.
Bryan beeilte sich, der natürlichen Ablehnung von Imperialismus, Militarismus und Steuererhöhungen durch die Farmer und das Kleinbürgertum Ausdruck zu verleihen. Aber während er Wagenladungen voll Petitionen und Abordnungen an seine pazifistischen Kollegen versandte, die sich in den höchsten Stellen der Regierung befanden, unternahm Bryan alle Anstrengungen, um sich von den revolutionären Tendenzen dieser Bewegung zu distanzieren.
”Sollte es zum Krieg kommen”, telegraphierte Bryan im Februar an eine in Chicago stattfindende Anti-Kriegs-Veranstaltung, „dann müssen wir natürlich die Regierung unterstützen, aber bis zu diesem Augenblick ist es unsere heilige Pflicht, alles in unseren Kräften liegende zu unternehmen, um die Menschen vor dem Horror des Krieges zu retten.“ In diesen wenigen Worten liegt das ganze Programm des kleinbürgerlichen Pazifismus. „Alles in unseren Kräften liegende zur Verhinderung des Krieges“ bedeutet, den oppositionellen Massen ein Ventil mittels harmlosen Manifesten zur Verfügung zu stellen, in denen der Regierung für den Fall des Kriegsausbruchs die Garantie gegeben wird, dass die pazifistische Opposition dann kein Hindernis darstellen wird.
Dies war alles, das von Wilson, dem Repräsentanten des offiziellen Pazifismus verlangt wurde, und er gab den Kapitalisten, die den Krieg machten, bereits eine Menge von Beweisen für sein „Bereitschaft für den Kampf“. Und selbst Mr. Bryan befand diese Erklärung für ausreichend, worauf er seinen dröhnenden Widerstand gegen den Krieg beiseite legte, und zwar einzig zum Zweck – den Krieg zu erklären. Mr. Bryan folgte Mr. Wilson, um der Regierung unter die Arme zu greifen. Und nicht nur das Kleinbürgertum, sondern auch die große Masse des Volkes sagte sich: „Wenn unsere Regierung, der ein solcher Pazifist von weltweitem Ruf wie Wilson vorsteht, den Krieg erklären kann, und selbst Bryan die Regierung in der Kriegsfrage unterstützt, dann muss es sich gewiss um einen gerechten und notwendigen Krieg handeln.“ Dies erklärt, warum der fromme und quäkerische Pazifismus, den sich die Demagogen der Regierung gönnten, von der Börse und den Führern der Kriegsindustrie so hoch geschätzt wurde.
Unser eigener menschewistischer, sozialrevolutionärer Pazifismus spielte trotz der Unterschiede in den Bedingungen genau dieselbe Rolle. Die Kriegsresolution, die von der Mehrheit des Allrussischen Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte angenommen worden war, gründete nicht nur auf den allgemeinen pazifistischen Vorurteilen gegenüber dem Krieg, sondern auch auf den Charakteristiken eines imperialistischen Krieges. Der Kongress erklärte, dass „die erste und wichtigste Aufgabe der revolutionären Demokratie“ sei, den Krieg so schnell als möglich zu beenden. Aber all diese Annahmen führen schließlich zu einem einzigen Ziel: Solange die internationalen Anstrengungen zur Beendigung des Krieges nichts fruchten, solange muss die russische revolutionäre Demokratie mit allem Nachdruck verlangen, dass die Rote Armee bereit sein muss für den Kampf, sei er nun defensiv oder offensiv.
Die Revision der alten internationalen Abkommen machen den russischen Kongress vom Willen der Entente-Diplomatie abhängig, und es liegt nicht in der Natur dieser Diplomaten, den imperialistischen Charakter des Krieges zu beseitigen, selbst wenn sie dies könnten. Die „internationalen Anstrengungen der Demokratien“ bringen den Kongress in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den sozialdemokratischen Patrioten, die alle hinter ihren imperialistischen Regierungen stehen. Und diese Mehrheit des Kongresses, die sich selbst zuerst zu blinden Alliierten des Geschäfts mit „der schnellst möglichen Beendigung des Kriegs“ machten, ist nun selbst angesichts der praktischen Konsequenzen des Krieges zu einer definitiven Schlussfolgerung gelangt: zur Offensive. Ein „Pazifismus“, der das Kleinbürgertum mobilisiert und die Offensive unterstützt, wird nicht nur von den Russen, sondern auch vom Entente-Imperialismus wärmstens begrüßt.
Miljukow beispielsweise sagt: „Im Namen unserer Loyalität gegenüber den Alliierten und den alten (imperialistischen) Abkommen muss die Offensive unvermeidbar eingeleitet werden.“
Kerenski und Tseretelli sagen: „Obwohl die Verträge noch nicht revidiert wurden, ist die Offensive unvermeidbar.“
Die Argumente variieren, die Politik bleibt dieselbe. Und es kann gar nicht anders sein, da Kerenski und Tseretelli unauflösbar mit der Regierung von Miljukows Partei verstrickt sind.
Der sozialdemokratisch patriotische Pazifismus von Dan steht, wenn wir zu den Fakten kommen, gleich wie der Quäker-Pazifismus von Bryan im Dienste des Imperialismus.
Aus diesem Grund besteht die wichtigste Aufgabe der russischen Diplomatie nicht darin, die Entente-Diplomatie von dieser oder jener Revision oder Aufhebung zu überzeugen, sondern darin, sie zu überzeugen, dass auf die russische Revolution absoluter Verlass sei und dass man ihr gewiss trauen könne.
Der russische Botschafter Bachmatiev charakterisierte in seiner Rede vom 10. Juni vor dem amerikanischen Kongress die Aktivitäten der Provisorischen Regierung von diesem Standpunkt:
„All diese Ereignisse“, sagte er, „zeigen uns, dass die Macht und die Bedeutung der Provisorischen Regierung jeden Tag anwachsen, und je mehr sie wachsen, je fähiger wird die Regierung sein, alle spalterischen Elemente zu beseitigen, ob sie nun von der Reaktion oder von der Agitation der extremen Linken stammen. Die Provisorische Regierung hat gerade entschieden, alle möglichen Mittel für dieses Ziel anzuwenden, auch wenn Gewalt angewendet werden muss, obwohl sie sich um eine friedvolle Lösung dieser Probleme bemühen wird.“
Es darf darüber keinen Augenblick ein Zweifel bestehen, dass die „nationale Ehre“ unserer sozialdemokratischen Patrioten unerschüttert blieb, während der Botschafter der „revolutionären Demokratie“ begierig darauf aus war, der amerikanischen Plutokratie zu beweisen, dass die russische Regierung bereit sei, das Blut des russischen Proletariats im Namen von Recht und Ordnung zu vergießen. Das wichtigste Element von Gesetz und Ordnung ist die loyale Unterstützung des Entente-Kapitalismus.
Und im gleichen Augenblick, in dem Herr Bachmatiev mit dem Hut in der Hand seine ehrwürdigen Worte an die Hyänen der amerikanischen Börse richtete, betäubten Messieurs Tseretelli und Kerenski die „revolutionäre Demokratie“, indem sie versicherten, dass es unmöglich sei, die „Anarchie der Linken“ ohne Anwendung von Gewalt zu bekämpfen. Sie drohten mit der Entwaffnung der Arbeiter von Petrograd sowie des sie unterstützenden Regiments. Wir sehen nun, dass diese Drohungen genau im richtigen Moment ausgesprochen wurden: Sie waren die bestmögliche Garantie für die Kredite von Amerika.
Herr Bachmatiev könnte zu Mr. Wilson gesagt haben: „Sie sehen jetzt, dass unser revolutionäre Pazifismus sich um keine Haaresbreite vom Pazifismus ihrer Börse unterscheidet. Und wenn sie Mr. Bryan glauben, wieso dann nicht auch Herrn Tseretelli?“
Trotzki
Fußnoten:
1 Für weitere Einzelheiten der Situation im Sommer 1917 in Russland vgl. auch den Artikel „Russische Revolution 1917 – die Juli-Tage“ in Internationale Revue Nr. 20.
2 Diese Formulierung verwendete auch Lenin 1915 in Der Sozialismus und der Krieg. Sie ist durchaus gültig im Rahmen des Kampfes gegen den Opportunismus in der Form des Pazifismus und der Versöhnung mit den nationalen Fraktionen der Bourgeoisie. Sie kann aber nicht verallgemeinert werden, da das Proletariat natürlich nicht irgendeine Fraktion der Bourgeoisie einer anderen vorziehen kann, auch nicht diejenige eines anderen Landes.
3 William Jennings Bryan war mehrere Male Kandidat der Demokraten bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, von 1913–15 Außenminister unter Wilson und Verfechter der Neutralität der USA während dem Ersten Weltkrieg.
4 William Jennings Bryan war mehrere Male Kandidat der Demokraten bei den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen, von 1913–15 Außenminister unter Wilson und Verfechter der Neutralität der USA während dem Ersten Weltkrieg.
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Die Barbarei des Kriegs im Irak: Die bürgerliche Gesellschaft in ihrer wahren, nackten Gestalt
- 2351 Aufrufe
Die bürgerliche Gesellschaft in ihrer wahren, nackten Gestalt
Der gegenwärtige Krieg im Irak offenbart seinen ganzen barbarischen Schrecken. Zwei Wochen nach dem Beginn dieses dritten Golfkriegs – nach demjenigen von 1980–88 zwischen Irak und Iran und demjenigen von 1991 unter der Führung von Bush senior – ist noch nicht klar, wann und wie er enden wird. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, dass er wesentlich länger dauern wird, als es die Prognosen der Administration von Bush junior gewollt haben. Der „saubere Krieg“, den George W. Bush angekündigt hat, enthüllt seine Todesfratze. Jeden Tag hören wir von weiteren zivilen Opfern, von getöteten Proletariern auf beiden Seiten, verstümmelten Kindern in den Spitälern, durch den Bombenhagel Traumatisierten. Zwei Wochen nach diesem neuen Ausbruch des Horrors ist „der ‚saubere Krieg‘ zum schmutzigsten Krieg geworden, zum blutigsten und scheußlichsten. Die ‚intelligenten Waffen‘ werden plötzlich von einer vorsätzlichen Dummheit befallen, die blind tötet, zerstört und ihre hysterische Wut auf die bevölkerten Marktplätze schleudert“ (aus der ägyptischen Tageszeitung Al Achram). Das amerikanische Oberkommando hat zugegeben, Splitterbomben abgeworfen zu haben. In Bagdad ist eine Geburtsklinik des Roten Kreuzes zur Zielscheibe von Bombardierungen geworden. Sie sei am heiterhellen Tag durch Bomben weggefegt worden, die eigentlich den Markt hätten treffen sollen. Einmal mehr ist es die irakische Zivilbevölkerung, die von allen Armeen vor Ort massakriert und terrorisiert wird, auch von den Einheiten der irakischen Armee. Und es gibt nicht allein die Opfer im Hagel der Gewehrkugeln und Raketen, sondern auch all die Kranken, die keine Pflege erhalten, die Kinder, die verschmutztes Wasser trinken müssen, die Opfer der Unterernährung, die seit dem Iran-Irak-Krieg grassiert und sich mit dem Wirtschaftsembargo nach dem Golfkrieg von 1991 verschärft hat.
Saddams Truppen sind den hochgerüsteten Waffen der USA und Großbritanniens militärisch weit unterlegen. Aus diesem Grund weicht das irakische Regime den offenen Schlachten aus und verlegt sich immer mehr auf eine Guerillataktik, die die Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschild benützt. Eine Besatzungsmacht kann aber, selbst wenn sie militärisch weit überlegen ist, größte Schwierigkeiten haben, ihre Herrschaft über ein erobertes Gebiet aufrecht zu erhalten, wie dies Vietnam für die USA und Afghanistan für die Sowjetunion bewiesen haben. Und es wäre falsch zu denken, dass mit der Beseitigung oder dem Tod Saddams alles vorbei wäre. Der Krieg in Israel/Palästina hängt auch nicht von Sharon oder Arafat ab und dauert bereits Jahrzehnte, ohne dass es eine Friedensperspektive gäbe. Die Selbstmordattentate von Hamas sind das Vorbild für den Heiligen Krieg, zu dem Saddam die Moslems aufgerufen hat. Die Freiwilligen aus anderen arabischen Ländern sind bereits zu Hunderten auf dem Weg in den Irak. Um die Guerilla des Vietcong zu bekämpfen, bombardierten die USA die vietnamesischen Dörfer mit Napalm. Welche noch „effizientere“ Waffe wird nun diesmal eingesetzt, um dieser neuen Bedrohung entgegen zu treten?
1915 drückte Rosa Luxemburg ihren Abscheu gegenüber der Barbarei des Kriegs in den folgenden Worten aus: „Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz triefend – so steht die bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt – als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt.“ (Junius-Broschüre) Leider regiert immer noch der gleiche Kapitalismus die Welt, ein Kapitalismus aber, der schon vor 90 Jahren dekadent geworden und heute in seinem Verwesungsprozess begriffen ist.
Die höllische Spirale
Der 11. September und der Kreuzzug gegen den internationalen Terrorismus haben eine wichtige Stufe in der Beschleunigung der imperialistischen Spannungen dargestellt, und der Krieg, der soeben im Irak ausgebrochen ist, stellt eine weitere Konkretisierung dieser Ernsthaftigkeit dar.
In einer Welt, die vom Gesetz des „Jeder-gegen-jeden“ beherrscht wird und wo insbesondere die früheren Verbündeten des westlichen Blocks darauf abzielen, sich so weit wie möglich der US-amerikanischen Vormundschaft zu entledigen, die sie früher angesichts der Drohung des gegnerischen Blocks haben ertragen müssen, besteht das einzige und entscheidende Mittel der USA zur Aufrechterhaltung ihrer Autorität in der militärischen Stärke, denn hier besitzen sie eine absolute Überlegenheit gegenüber allen anderen Staaten. Doch wenn die USA dies tun, begeben sie sich in ein Dilemma: Je mehr sie die nackte Gewalt anwenden, desto mehr werden ihre Gegner dazu gedrängt, die geringste Gelegenheit auszunützen, um sich zu revanchieren und die Vorhaben der einzig übrig gebliebenen Supermacht zu sabotieren; und umgekehrt, wenn die USA darauf verzichten ihre Überlegenheit auszuspielen, so kann dies die Herausforderer nur ermuntern, in ihrer Sabotagearbeit noch weiter zu gehen.
Dieser Widerspruch, in dem sich die USA seit dem Zusammenbruch des Ostblocks befinden, ist die Grundlage für eine sich aufschaukelnde Bewegung zwischen einerseits amerikanischer Offensive, die die Gegner zum Schweigen bringen soll, und andererseits einem neuen Aufflammen der Auflehnung auf erweiterter Stufenleiter. Doch ist eine solche Bewegung naturgemäß nicht einfach eine gleich bleibende Wiederholung, sondern eine Schwingung, die immer heftiger ausschlägt.
Das veranschaulichen gerade die verschiedenen Stufen der Konflikte seit dem Golfkrieg von 1991. Und es wird weiter belegt durch die neue Welle des Widerstands gegen die amerikanische Vorherrschaft, die im Frühling 2002 angerollt ist und seither „historische Rekorde“ gebrochen hat. Frankreich hat die USA mit einer Ausdauer und Entschlossenheit herausgefordert, die zuvor unbekannt war, indem es nun offen die Karte des Vetorechts im UNO-Sicherheitsrat ausgespielt hat. Die Kühnheit des gallischen Hahns kann aber nicht getrennt werden von der Tatsache, dass er alles andere als allein ist und einstimmen kann in ein Konzert zusammen mit dem russischen Bären, dem chinesischen Drachen und vor allem dem deutschen Adler. Dieses Aufbegehren ist der Hintergrund, vor dem ein ‚Wind der Revolte‘ die ganze Welt erfasst hat. Die widerspenstigen Haltungen reichen von der offenen Provokation durch Nordkorea bis zum Verhalten der Türkei oder Mexikos, die beide den USA Knüppel zwischen die Beine geworfen haben, die Türkei auf militärischer Ebene, Mexiko auf dem diplomatischen Parkett.
Auch auf ideologischer Ebene haben sich die Dinge seit 1999 verändert, als die NATO Belgrad noch unter dem Deckmantel einer „militärischen Intervention“ bombardierte, um „die Kosovoalbaner vor dem Völkermord zu retten“. Die humanitären Vorwände der Regierungen Bush und Blair finden keinen Widerhall mehr. Der Krieg hat auch nicht mehr den Schein einer Rechtfertigung, zeigt sich in seiner nackten Gestalt und stinkt unparfümiert.
Der Krieg im Irak ist nicht der Dritte Weltkrieg. Aber die einzige Perspektive, die der im Zerfall begriffene Kapitalismus anbietet, heißt immer noch mehr Krieg und jedes Mal solche, die noch mehr Verheerungen anrichten. Die klassische Alternative der Internationalisten während des Ersten Weltkriegs: „Sozialismus oder Barbarei“ muss heute präzisiert werden: „Sozialismus oder Untergang der Menschheit“.
Die Verantwortung der Arbeiterklasse
Die Barbarei der heutigen Welt hebt die gewaltige Verantwortung hervor, die auf den Schultern des Proletariats lastet, das einer Kampagne und unzähligen Manövern gegenüber steht, die in ihrem Ausmaß neu sind und darauf abzielen, es nicht nur von seiner historischen Perspektive abzulenken, sondern auch vom Kampf zur Verteidigung seiner unmittelbaren und elementaren Interessen. Und dies geschieht in einem Moment, in dem die Weltwirtschaft erneut in die Krise taucht.
Die Kommunisten haben die Aufgabe, die Pazifisten mit der gleichen Energie an den Pranger zu stellen wie die Kriegstreiber. Der Pazifismus ist einer der schlimmsten Feinde des Proletariats. Er schürt die Illusion, dass der ‚gute Wille‘ oder die ‚internationalen Verhandlungen‘ den Kriegen ein Ende setzen könnten, und verbreitet somit die Lüge, nach der es eigentlich einen ‚guten Kapitalismus‘ geben könnte, der den Frieden wahrt und die ‚Menschenrechte‘ beachtet. Die Rolle des Pazifismus besteht darin, die Proletarier vom Klassenkampf gegen den Kapitalismus als ganzes abzulenken (vgl. dazu in dieser Nummer der Internationalen Revue Trotzkis Artikel Der Pazifismus – Wasserträger des Imperialismus).
Aber die Arbeiterklasse ist nicht geschlagen, und das Abtauchen in die Rezession wird sie zwingen, seine Kampfbereitschaft zu entwickeln. Gleichzeitig entlarvt der Krieg immer mehr das wirkliche Wesen der bürgerlichen Gesellschaft und nährt dadurch einen Prozess der unterirdischen Bewusstseinsreifung in Minderheiten der Arbeiterklasse (vgl. dazu, aber auch zur Analyse des gegenwärtigen Krieges die Resolution zur internationalen Lage, die am 15. Kongress der IKS angenommen worden ist und in der vorliegenden Nummer der Internationalen Revue veröffentlicht wird). Das Proletariat stellt auch in der heutigen Situation, die seit dem Beginn der 1990er-Jahre durch große Schwierigkeiten geprägt ist, immer noch eine Bremse gegenüber dem Krieg dar. Das Proletariat ist die einzige Hoffnung für die Menschheit, denn nur es ist durch seine Kämpfe fähig, sich in dieser im Zerfall begriffenen Gesellschaft als Träger einer Alternative gegenüber der kapitalistischen Barbarei zu behaupten.
SM (4. April 2003)
Fußnoten:
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [78]
Theoretische Fragen:
- Krieg [27]
Die Erweiterung der Europäischen Union
- 3058 Aufrufe
Europa: Wirtschaftsbündnis und Terrain für imperialistische Manöver
Fast ein halbes Jahrhundert lang hat die herrschende Klasse jetzt über den Bau Europas gesprochen. Die Einführung einer gemeinsamen Währung – der Euro – wurde als ein bedeutsamer Meilenstein auf dem Weg zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa dargestellt. Dieser Prozess ist angeblich in vollem Gange, seitdem geplant ist, die Europäische Union mit dem 1.Mai 2004 von 15 auf 25 Länder zu erweitern, und der Vorschlag einer europäischen Verfassung bereits erarbeitet worden ist.
Wird sich die herrschende Klasse tatsächlich als fähig erweisen, über den engen Rahmen der Nationen hinauszugehen? Wird sie imstande sein, die ökonomische Konkurrenz und ihre eigenen imperialistischen Antagonismen zu überwinden? Wird sie in der Lage sein, dem Wirtschaftskrieg und den militärischen Konflikten, die so oft den Kontinent auseinandergerissen hatten, tatsächlich ein Ende zu setzen? Mit anderen Worten: Wird sich die Bourgeoisie als fähig erweisen, den Ansatz einer Lösung des Problems der Spaltung der Welt in konkurrierende Nationen durch den Kapitalismus anzubieten, einer Spaltung, die den Tod von zig Millionen Menschen bewirkte und den gesamten Planeten in Blut ertränkte, besonders seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts? Wird die Bourgeoisie tatsächlich fähig sein, die nationalistische Ideologie aufzugeben, die das Fundament ihrer eigenen Existenz als Klasse bildet und die Quelle ihrer ganzen ökonomischen, politischen, ideologischen und imperialistischen Legitimation ist?
Doch wenn all diese Fragen verneint werden, wenn die Vereinigten Staaten von Europa nichts als eine Fata Morgana sind, was für eine Bedeutung hat dann die Bildung und Weiterentwicklung der Europäischen Union? Ist die herrschende Klasse so masochistisch geworden, dass sie ewig einer Unmöglichkeit nachrennt? Weshalb bemüht sie sich darum, ein Haus zu errichten, das nicht lebensfähig ist? Dient es lediglich dem Zweck eines illusorischen Wetteiferns mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Oder reiner Propaganda?
Die Unmöglichkeit, in der Dekadenz des Kapitalismus über den nationalenRahmen hinauszugehen
Wir können die Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens ermessen, wenn wir die Vorbedingungen für seine Lebensfähigkeit berücksichtigen. Nicht nur, dass diese Voraussetzungen für dieses Projekt völlig fehlen, sie sind ganz einfach eine Utopie im gegenwärtigen historischen Zusammenhang. Da die Existenz der verschiedenen nationalen Bourgeoisien eng mit dem Privat- und/oder Staatseigentum verknüpft ist, das sich historisch innerhalb des nationalen Rahmens entwickelt hatte, würde jede wirkliche Vereinigung auf einer höheren Stufe die Entmachtung dieser Nationen bedeuten. Diese Perspektive ist um so unrealistischer, als dass eine kontinentweite Schaffung eines tatsächlich vereinigten Europas nur durch einen Prozess der Enteignung der verschiedenen bürgerlichen Fraktionen in allen Mitgliedsländern stattfinden kann. Dies wäre notwendigerweise ein gewaltsamer Prozess, so wie die bürgerlichen Revolutionen gegen das feudalistische Ancien Régime oder die Unabhängigkeitskriege der neuen Nationen gegen ihre Vormundschaftsmacht. Für einen solchen Prozess wäre es unmöglich, „den politischen Willen der Regierungen“ und/oder „das Verlangen der Völker, Europa zu erschaffen“, zu ersetzen. Während des 19. Jahrhunderts spielte der Krieg stets eine vorrangige Rolle im Prozess der Bildung neuer Nationen, um entweder den inneren Widerstand reaktionärer Bereiche in der Gesellschaft zu eliminieren oder um auf Kosten der Nachbarländer die eigenen Grenzen neu zu ziehen.1 Wir können uns daher leicht ausmalen, was der Prozess der europäischen Vereinigung kosten würde. Dies unterstreicht, dass die Idee einer friedlichen Union von verschiedenen Ländern, so europäisch sie auch sein mögen, entweder eine Utopie oder heuchlerisch und verlogen ist. Denn eine solche Vereinigung zu ermöglichen würde das Auftreten einer neuen gesellschaftlichen Gruppe implizieren, der Trägerin emanzipatorischer supranationaler Interessen, die, gestählt durch einen wahrhaft revolutionären Prozess und mit Hilfe ihrer eigenen politischen (Parteien, etc.) und Zwangsmittel (Streitkräfte, etc.), jene bürgerlichen Interessen enteignet, die an den verschiedenen nationalen Kapitalien gebunden sind, und ihnen ihre Macht aufzwingt.
Ohne uns länger über die nationale Frage auszulassen, ist es klar, dass all jene (ungefähr 100) Nationen, die nach dem Krieg von 1914–18 gegründet worden waren, das Ergebnis nationaler Probleme waren, die während des 19. Jahrhunderts und bis zu Beginn des
20. Jahrhunderts ungelöst geblieben waren. Alle von ihnen waren nationale Totgeburten, die sich als unfähig erwiesen, ihre bürgerliche Revolution zu vervollständigen und mit genügendem Nachdruck eine industrielle Revolution zu initiieren; alle von ihnen fühlten so die Dynamik der massiven Konflikte, die seit dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hatten. Nur jene Länder, die sich während des 19. Jahrhunderts gebildet hatten, waren imstande gewesen, einen ausreichenden Grad an Kohärenz, Wirtschaftskraft und politischer Stabilität zu erreichen. Die sechs größten Mächte von heute waren es bereits, wenn auch in anderer Reihenfolge, am Vorabend des I. Weltkrieges. Selbst bürgerliche Historiker sehen diese Tatsache, doch sie kann nur wirklich im Rahmen des historischen Materialismus erklärt werden.
Um sich auf einem soliden Fundament zu bilden, muss eine Nation auf einer realen Zentralisierung ihrer Bourgeoisie begründet sein, und diese Zentralisierung wird in einem erbitterten, Einheit stiftenden Kampf gegen den Feudalismus des Ancien Régime geschmiedet. Sie muss genügend solide ökonomische Grundlagen für ihre industrielle Revolution besitzen, um sich ihren Platz auf einem Weltmarkt zu sichern, welcher sich noch in der Entstehung befindet. Diese beiden Bedingungen existierten während der Epoche des kapitalistischen Aufstiegs, die sich im Wesentlichen vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum I. Weltkrieg erstreckte. Danach verschwanden diese Bedingungen, und daher war von da an die Entstehung neuer, lebensfähiger nationaler Projekte nicht mehr möglich. Warum also sollte es heute plötzlich wieder möglich geworden sein, etwas durchzuführen, was schon während des 20. Jahrhunderts unmöglich gewesen war? Da keine der neuen Nationen, die seit dem Ersten Weltkrieg gebildet worden waren, in der Lage gewesen war, adäquate Existenzmittel zu sammeln, warum sollte die Entstehung einer neuen Großmacht – wie es die Vereinigten Staaten von Europa wären – plötzlich nun möglich sein?
Die dritte logische Konsequenz einer hypothetischen europäischen Einheit setzt eine Abschwächung der Tendenz zur Verschärfung imperialistischer Antagonismen unter den konkurrierenden Ländern Europas voraus. Doch wie Marx Mitte des 19. Jahrhunderts (im Kommunistischen Manifest) hervorhob, ist der Antagonismus zwischen den einzelnen Fraktionen der Bourgeoisie eine Konstante: „Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem Kampf; anfangs gegen die Aristokratie; später gegen Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortschritt der Industrie in Widerspruch geraten; stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder.“ (Karl Marx, „Manifest der Kommunistischen Partei“, MEW Bd. 4, S. 459-492) Während die Widersprüche zwischen der Bourgeoisie und den Überbleibseln des Feudalismus oder ihrer eigenen rückwärts gewandten Sektoren von der kapitalistischen Revolution größtenteils überwunden worden waren, zumindest in den entwickelten Hauptländern, haben sich im Gegensatz dazu die Antagonismen zwischen den Nationen im gesamten 20. Jahrhundert nur vertieft. Warum also sollten wir erwarten, dass sich dieser Prozess umkehrt, wenn sich die Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse während der gesamten Periode der Dekadenz immer weiter verschärft haben?
In der Tat besteht ein unzweideutiges Kennzeichen einer Produktionsweise, die die Periode ihrer Dekadenz betreten hat, in der Explosion von Antagonismen zwischen den Fraktionen der herrschenden Klasse. Diese können nicht mehr ausreichend Mehrwert aus den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen ziehen, die fortan obsolet geworden sind, und neigen somit dazu, dies durch die Ausplünderung ihrer Rivalen zu tun. Dies traf auf die Dekadenz der feudalen Produktionsweise (1325–1750) zu, als dem Hundertjährigen Krieg die Kriege zwischen den großen europäischen absolutistischen Monarchien folgten: „... Gewalttätigkeiten waren ohne Zweifel ein permanenter und besonderer Charakterzug der mittelalterlichen Gesellschaft. Dennoch erreichten sie während der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert eine neue Dimension (...) Der Krieg wurde zu einem endemischen Phänomen, genährt von gesellschaftlichen Frustrationen (...) Die Generalisierung von Kriegen war vor allem der ultimative Ausdruck von Funktionsstörungen einer Gesellschaft, die sich im Würgegriff von Problemen befand, die sie nicht meisterte. Und so suchte sie Zuflucht in Kriegen, um den Problemen des Alltags zu entgehen.“ (Guy Bois, La Grande dépression médiévale)2.Diese Periode der Dekadenz der feudalen Produktionsweise steht in einem großen Kontrast zum Aufstieg des Mittelalters (1000–1325): „Noch deutlicher als zu Feudalzeiten erlebte die Periode zwischen – grob gesagt – 1150 und 1300 über weite geographische Gebiete hinweg Phasen eines beinahe vollständigen Friedens, dank dessen die wirtschaftliche und demographische Expansion wachsen konnte.“ (P. Contamine, La Guerre au Moyen Age)3 Dasselbe trifft auf die Produktionsweise der Sklavenhaltergesellschaften, auf die Zerstückelung des Römischen Reiches und die Ausbreitung von endlosen Konflikten zwischen Rom und seinen Provinzen zu.
Dies war auch der Fall, als der Kapitalismus seine Dekadenzperiode betrat. Um sich eine Vorstellung von der Kluft zwischen den Existenzbedingungen während des Aufstiegs des Kapitalismus und denen seiner Dekadenz zu machen, wollen wir hier aus Eric Hobsbawns „Das Zeitalter der Extreme“ (1994)2 zitieren, in dem er sehr gut den fundamentalen Unterschied zwischen dem „langen 19. Jahrhundert“ und dem „kurzen 20. Jahrhundert“ aufzeigt: „Wie sollen wir dem kurzen 20. Jahrhundert einen Sinn abgewinnen – Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion? (...) während des Kurzen 20. Jahrhunderts wurden mehr Menschen auf Weisung und mit Erlaubnis ermordet als jemals zuvor in der Geschichte. (...) Es war ohne Zweifel das mörderischste Jahrhundert von allen, über das wir Aufzeichnungen besitzen: mit Kriegszügen von nie gekannten Ausmassen und von nie dagewesener Häufigkeit und Dauer, sowohl was das Niveau, die Häufigkeit und die Dauern dieser Kriege betrifft (und welche in den zwanziger Jahren kaum ein Unterbruch hatten), als auch bezüglich dem Ausmass der grössten Hungersnöte der Geschichte und den systematischen Genoziden. Im Unterschied zum langen 19. Jahrhundert, welches eine Periode des nahezu ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritts zu sein schien und auch wirklich war, sind wir seit 1914 Zeugen eines markanten Rückgangs dieser bis anhin für die entwickelten Länder als selbstverständlich angenommenen Werte. (...) Dies alles änderte um 1914 (...) Kurz gesagt, 1914 leitete die Epoche der Massaker ein (...) Die Mehrzahl der nicht-revolutionären und nicht-ideologischen Kriege der Vergangenheit waren nicht als Kämpfe auf Leben und Tod bis zur totalen Erschöpfung geführt worden. (...) Warum führten die dominanten Mächte unter diesen Umständen der Ersten Weltkrieg bis zum Nichts, also als Krieg, der nur entweder ganz gewonnen oder ganz verloren werden konnte? Der Grund dafür ist, dass dieser Krieg, im Unterschied zu den vorausgegangenen Konflikten mit begrenzten und genau festgelegten Zielen, mit uneingeschränkten Absichten geführt wurde. (...) Dies war ein absurdes und selbstzerstörerisches Ziel, welches zugleich Sieger und Besiegte ruinierte. Letztere führte er in die Revolution, die Sieger zum Zusammenbruch und zur physischen Erschöpfung. (...) Im modernen Krieg werden alle Bürger hineingezogen und die Mehrheit von ihnen wird mobilisiert; sei es, dass er mit Rüstung geführt wird, deren Produktion eine Umleitung der ganzen Wirtschaft erfordert und in unvollstellbarem Umfang eingesetzt wird; sei es, dass er unglaubliche Zerstörungen erzeugt, aber auch die Existenz der in ihn verwickelten Länder dominiert und verändert. So sind alle diese Phänomene dem Krieg des 20. Jahrhunderts eigen. (...) Diente der Krieg dem Wirtschaftswachstum? Es ist klar, dass dem nicht so ist.“4 Der Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenzperiode machte fortan die Entstehung neuer, wirklich lebensfähiger Nationen unmöglich. Die relative Sättigung zahlungskräftiger Märkte – im Verhältnis zu den enormen Bedürfnissen der Akkumulation, die von der Entwicklung der Produktivkräfte geschaffen wurden – , die der Dekadenz des Kapitalismus zugrunde liegt, verhindert jede „friedliche“ Lösung seiner unüberwindlichen Widersprüche. Daher ist seither die Zahl der Handelskriege zwischen den Nationen und die Entwicklung des Imperialismus nur gewachsen. In einem solchen Kontext sind Nationen, die spät die Weltbühne betreten haben, unfähig, ihre Rückständigkeit zu überwinden: Im Gegenteil, der Abstand zu den entwickelten Ländern wächst unerbittlich.
Selbst in der Zeit vor dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts, in einer Epoche, die eigentlich günstig für die Entstehung neuer Nationen gewesen war, war die nationale Einheit Europas ausgeschlossen, weil die Voraussetzungen für diese Einheit nicht existierten; seither ist ihre Existenz noch irrelevanter geworden. Ja, in der gegenwärtigen und finalen Phase der Dekadenz, in der Phase des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft5, sind die Bedingungen für die Entstehung einer neuen Ausgangslage nicht nur noch ungünstiger, sie üben darüber hinaus Druck auf existierende, aber weniger stabile Nationen aus und führen zu deren Auflösung (die UdSSR, Jugoslawien, Tschechoslowakei, etc.) sowie zur Verschärfung der Spannungen selbst zwischen den stärksten und stabilsten Ländern (siehe weiter unten das Kapitel über Europa in der Zerfallsperiode).
Eine historische Parallele:Die absolutistischen Monarchien
Kommt dieser Prozess der europäischen Vereinigung inmitten der kapitalistischen Dekadenz überraschend? Ist er ein Zeichen dafür, dass die kapitalistische Produktionsweise ihre alte Stärke wiederentdeckt hat, dass sie der Dekadenz ein Schnippchen geschlagen hat? Allgemein ausgedrückt: Können wir ein ähnliches Phänomen während der Dekadenz früherer Gesellschaften beobachten, und wenn ja, worin bestand seine Bedeutung?
Die Dekadenz der feudalen Produktionsweise ist in diesem Zusammenhang interessant, da sie Zeuge der Bildung der großen absolutistischen Monarchien war, die über zerstreute Lehnsgüter hinauszugehen schienen, welche so kennzeichnend für die feudale Produktionsweise waren. Während des 16. Jahrhunderts verhalf dies dem absolutistischen Staat im Westen zum Leben. Die zentralisierten Monarchien stellten einen entscheidenden Bruch mit der pyramidenhaften und zerstreuten Souveränität in den mittelalterlichen gesellschaftlichen Gebilden dar. Diese Zentralisierung der monarchischen Macht bewirkte den Aufstieg eines stehenden Heeres und einer Bürokratie, einer nationalen Steuererhebung sowie einer kodifizierten Rechtsprechung und den Beginn eines vereinigten Marktes. Obgleich all diese Elemente als Charakteristikum des Kapitalismus erscheinen mögen – dies um so mehr, als sie mit dem Verschwinden der Leibeigenschaft zusammenfallen – sind sie dennoch ein Ausdruck des verfallenden Feudalismus.
Tatsächlich ging die „nationale Vereinigung“, die auf mannigfaltigen Ebenen von den absolutistischen Monarchien durchgeführt worden war, nicht über den geohistorischen Rahmen des Mittelalters hinaus, sondern drückte vielmehr die Tatsache aus, dass Letzterer zu eng geworden war, um die fortdauernde Entwicklung der Produktivkräfte zu umfassen. Die absolutistischen Staaten stellten eine Form der Zentralisierung der feudalen Aristokratie dar, indem sie ihre Macht stärkten, um der Dekadenz der feudalen Produktionsweise zu widerstehen. Die Zentralisierung der Macht ist in der Tat ein weiteres Kennzeichen der Dekadenz einer jeden Produktionsweise – im Allgemeinen durch eine Wiederverstärkung des Staates, der die kollektiven Interessen der herrschenden Klasse repräsentiert – um einen stärkeren Widerstand gegen die ruinösen Krisen ihres historischen Abstiegs auf die Beine zu stellen.
Wir können eine Analogie dazu in der Bildung der Europäischen Union im Besonderen und in all den regionalen Wirtschaftsabkommen auf der ganzen Welt im Allgemeinen feststellen. Sie sind Versuche, über den zu engen Rahmen der Nation hinauszugehen, um sich der Verschärfung der ökonomischen Konkurrenz in der kapitalistischen Dekadenz zu stellen. Die Bourgeoisie ist daher gefangen zwischen einerseits der immer größeren Notwendigkeit, über den nationalen Rahmen hinauszugehen, um ihre wirtschaftlichen Interessen besser zu verteidigen, und andererseits den nationalen Grundlagen ihrer Macht und ihres Eigentums. Europa ist keinesfalls eine Überwindung dieses Widerspruchs, sondern ein Ausdruck des bürgerlichen Widerstandes gegen die Widersprüche der Dekadenz ihrer eigenen Produktionsweise. Als Louis XIV. die Granden des Reiches dazu einlud, in seinen Hof in Versailles zu ziehen, geschah dies nicht zu ihrem Wohlgefallen, sondern vielmehr um sie zu unter kaiserliche Kuratel zu stellen und sie daran zu hindern, Komplotte in ihren Provinzen gegen ihn zu schmieden. In gewisser Weise ist das strategische Kalkül innerhalb der Europäischen Union dem nicht unähnlich. So zieht es Frankreich vor, Deutschland an Europa gebunden und die Deutsche Mark mit dem Euro verschmolzen zu sehen, statt Zeuge zu werden, wie Deutschland bei seiner Expansion in Mitteleuropa, wo die Deutsche Mark bereits zur heimlichen Leitwährung geworden war, seine historische Interesssen entfaltet. Nach seinem Versuch, die EFTA gegen die EWG zu bilden, zieht es Großbritannien nun vor, in letztgenanntem Verein mitzumachen, um so die Politik der EWG zu beeinflussen bzw. zu sabotieren, statt sich auf seiner Insel zu isolieren, wohingegen Deutschland im Sinn hat, unter dem Mantel der europäischen Fiktion die Entfaltung seiner tatsächlich imperialistischen Ambitionen als künftiger Anführer eines imperialistischen Blocks weiter zu betreiben, der in der Lage ist, mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu rivalisieren.
Europa – eine Kreation des Imperialismus aus Gründen des Kalten Krieges
Die Wurzeln der Europäischen Gemeinschaft lagen in der Existenz des Kalten Krieges, der unmittelbar nach dem II. Weltkrieg folgte. Durch die Wirtschaftskrise und die gesellschaftlichen Verwerfungen destabilisiert, war Europa eine potenzielle Beute des russischen Imperialismus und wurde daher von den Vereinigten Staaten gestützt, um einen Schutzwall gegen die Avancen des Ostblocks zu bilden. Dies wurde dank des Marshallplans erreicht, der im Juni 1947 allen europäischen Ländern in Aussicht gestellt worden war. Auch die Schaffung einer Europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft entsprach dem Kalkül, Europa im Zusammenhang mit einer dramatischen Zuspitzung der Ost-West-Spannungen anlässlich des Koreakrieges zu stärken. Die Schaffung der EWG 1957 vervollständigte die Stärkung des westlichen Blocks auf dem Kontinent. Diese Entwicklung in Europa, die im Wesentlichen auf wirtschaftlichem Gebiet und, mit der Präsenz von Truppen und Waffen der NATO, auf militärischer Ebene erfolgte, beweist, dass Europa, weit davon entfernt, eine friedliche Idylle zu sein, die Hauptbühne von interimperialistischen Konflikten blieb, so wie es in der gesamten Geschichte des Kapitalismus gewesen war.
Im Gegensatz zur Propaganda der herrschenden Klasse war der Friede, der seit dem Ende des II. Weltkrieges in Europa herrschte, nicht die Folge eines Prozesses der europäischen Vereinigung oder der Friedfertigkeit, die plötzlich unter den historischen Rivalen ausgebrochen war, sondern die Folge des Zusammentreffens von drei ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren. So erlaubte die wirtschaftliche Wiederbelebung in Kombination mit keynesianischen Regulierungen dem Kapitalismus, sein Überleben zu verlängern, ohne gezwungen zu sein, sofort Zuflucht zu suchen in einem dritten Weltkonflikt, wie es zwischen dem I. und II. Weltkrieg der Fall gewesen war, als 1929 nach nur zehn Jahren des Wiederaufbaus, zwischen 1919 und 1929, die schlimmste Überproduktionskrise in der Geschichte ausbrach und bis zum Vorabend des II.Weltkrieges anhielt. So bildeten sich im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg zwei imperialistische Blöcke (NATO und Warschauer Pakt), die sich auf dem Kontinent gegenüberstanden; die Vereinigten Staaten und die UdSSR, die beiden jeweiligen Blockführer, waren eine Zeitlang in der Lage, ihre direkten Konfrontationen an die Peripherie zu drängen. Dies hinderte jedoch lokale Konflikte zwischen 1945 und 1989 nicht daran, mehr Opfer zu verursachen als sämtliche Schlachten des II.Weltkrieges zusammen! Und schließlich versperrte die Tatsache, dass das Proletariat ideologisch nicht bereit war, in den Krieg zu ziehen, nachdem es 1968 die historische Bühne wieder betreten hatte, den Weg zur Kriegshetze der beiden imperialistischen Blöcke genau in dem Augenblick, als es für sie immer dringlicher wurde, angesichts der sich ausbreitenden Wirtschaftskrise zu offenen Feindseligkeiten zu schreiten.
Europa – eine leere Hülle und politische Handgreiflichkeiten
Unter ziemlich günstigen Umständen waren die europäischen Staaten in der Lage gewesen, im Wesentlichen auf wirtschaftlicher Ebene zu Übereinkünften zu gelangen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Europas, die europäische Kohle- und Stahlgemeinschaft, die Schaffung einer europaweiten Mehrwertsteuer, der Gemeinsame Markt und das Europäische Währungssystem sind allesamt Beispiele dafür. Im Gegensatz dazu waren die politischen Misshelligkeiten eine Konstante in der Politik der EWG und EU, die unmittelbar nach der Niederlage Deutschlands im Krieg mit der deutschen Frage ihren Anfang nahm. Frankreich wollte ein schwaches und unbewaffnetes Deutschland. Die Vereinigten Staaten hingegen erzwangen wegen der Erfordernisse des Kalten Kriegs den Wiederaufbau eines starken, wiederaufgerüsteten Deutschland, was 1949 zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland führte. 1954 lehnte Frankreich die Ratifizierung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft trotz der Tatsache ab, dass das EWG-Abkommen bereits 1952 von den fünf europäischen Partnern unter dem Druck der Amerikaner unterzeichnet worden war. Das Vereinigte Königreich, das sich geweigert hatte, der 1957 gebildeten EWG beizutreten, versuchte seinerseits, eine weiter gefasste Freihandelszone zu errichten, die alle Länder der OECD umfasste und den Gemeinsamen Markt beinhalten sollte, was ihn so seiner Exklusivität beraubt hätte. Als die Franzosen sich weigerten, taten sich die Briten mit anderen europäischen Ländern zusammen, um am 20. November 1959 mit der Unterzeichnung des Stockholmer Vertrages die European Free Trade Association (EFTA) zu gründen. Bei zwei Gelegenheiten, 1963 und 1967, lehnte Frankreich die EWG-Kandidatur Großbritanniens ab, da es in ihm ein trojanisches Pferd der Amerikaner erblickte. 1967 provozierte Frankreich dabei eine ernste Krise, die sechs Monate andauerte, indem es eine Politik des „leeren Stuhls“ betrieb; sie endete mit einem Kompromiss, der Europa zwar das weitere Überleben ermöglichte, dabei aber das Einstimmigkeitsprinzip bei allen EWG-Beschlüssen etablierte. Nachdem Großbritannien im Januar 1973 der EWG beigetreten war, zögerte es nicht, bei zahllosen Gelegenheiten Sand in das Getriebe der EWG-Politik zu streuen, beginnend mit der Neuaushandlung des Beitrittsvertrages ein Jahr später und im weiteren mit Veränderungen in der EG-Agrarpolitik, Neuverhandlungen über den britischen Beitrag zum EG-Etat (s. Margaret Thatchers berühmtes „Ich will mein Geld zurück“), mit der Weigerung, einer gemeinsamen Währung beizutreten, etc. Erst kürzlich haben die Unstimmigkeiten über das Datum der Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU die Spaltung Europas auf der Ebene seiner imperialistischen Rivalitäten enthüllt. Frankreich verhält sich offen feindselig gegenüber diesem Land, das sich entweder mit Deutschland oder mit den USA eng verbunden fühlt. Letztere haben tatsächlich einen unerhörten Druck ausgeübt, damit die Türkei als künftiger Kandidat akzeptiert wird, sei es durch direkte Telefonate des Präsidenten mit europäischen Führern oder indirekt, via des britischen Lobbyismus, durch eine unterschwellige, aber offiziell abgesegnete Strategie, die da lautet: Je mehr die EU erweitert wird, desto weniger wird sie zur politischen Integration und vor allem zur Entwicklung einer gemeinsamen Politik und Strategie auf der internationalen Bühne in der Lage sein.
Die vollständige Abwesenheit jeglicher gemeinsamen Politik oder der Instrumente für diese Politik (eine gemeinsame Armee), das Fehlen eines substanziellen Etats der EU in der Größenordnung nationaler Etats (derzeit knapp 1,27% des BSP von Euroland!) und der völlig überproportionierte Anteil der Landwirtschaft am EU-Etat (nahezu die Hälfte dessen wird für einen Bereich ausgegeben, der nicht mehr als 4–5% der Wertschöpfung in der EU repräsentiert), etc. – all dies demonstriert deutlich genug, dass die fundamentalen Attribute eines europäischen supranationalen Staates fehlen oder da, wo sie existieren, keine wirkliche Macht oder Unabhängigkeit besitzen. Die politische Funktionsweise der Europäischen Union ist eine reine Karikatur, typisch für die Funktionsweise der Bourgeoisie in der Epoche der Dekadenz. Das Parlament hat keine Macht, der Schwerpunkt des politischen Lebens wird von der Exekutive, dem Rat der Minister, so stark vereinnahmt, dass selbst die Bourgeoisie sich regelmäßig über das „Defizit an demokratischer Legitimation“ beschwert!
Dies ist insofern kaum überraschend, als dass die politische Strategie der Europäer bereits während des Kalten Krieges nur sehr bedingt vorkam und durch die Disziplin des amerikanischen Blocks in engen Grenzen gehalten wurde. Diese Strategie hatte schon zu jener Zeit nur geringe Konsistenz, doch nach dem Fall der Berliner Mauer, der das Verschwinden der beiden Blöcke markierte, verringerte sie sich noch mehr. Seitdem gibt es keine außenpolitische Frage, zu der Europa in der Lage wäre, eine gemeinsame Position zu definieren. Es ist zerrissen zwischen verschiedenen oder gar gegensätzlichen Positionen in der Frage des Nahen Ostens, des Golfkrieges, des Konflikts in Jugoslawien und im Kosovo, etc. Dasselbe trifft auf den Vorschlag der Schaffung einer europäischen Armee zu. Während einige (wie Frankreich und Deutschland zum Beispiel) auf mehr Integration drängen, einschließlich einer größeren Unabhängigkeit gegenüber den verbliebenen Militärstrukturen der NATO, wollen andere (Großbritannien und die Niederlande zum Beispiel) in ihnen verbleiben.
Europa: eine im Wesentlichen wirtschaftliche Übereinkunft
Wenn die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa eine Illusion ist, wenn eine wirkliche, allumfassende europäische Integration ein Aberglauben ist, wenn die Wurzeln der Existenz einer begrenzten europäischen Einigung in den Erfordernissen des Kalten Krieges lagen – was steckt dann hinter der politischen Absicht, heute diese Strukturen zu stärken?
Wie wir gesehen haben, waren die Geburt der Europäischen Gemeinschaft und ihre Erstarkung zuallererst Ausdrücke der Notwendigkeit, den sowjetischen Expansionsdrang nach Europa zu bremsen. Obgleich sie für die imperialistischen Bedürfnisse des amerikanischen Blocks geschaffen wurde und sich gar für die wirtschaftliche Expansion durch Letzteren als nützlich erwies (wie Japan und die „neu industrialisierten Länder“), wurde sie Zug um Zug zu einem ernsthaften wirtschaftlichen Konkurrenten für die Vereinigten Staaten, einschließlich ihrer Domänen in der Hochtechnologie (Airbus, Arianespace, etc.). Dies ist eines der Resultate der wirtschaftlichen Konkurrenz während des Kalten Krieges. Bis zum Fall der Berliner Mauer war die europäische Integration im Wesentlichen ökonomischer Natur. Beginnend als eine Binnenfreihandelszone für Waren und dann als Zollunion gegen andere Länder, wurde sie schließlich zu einem gemeinsamen Markt für Güter, Kapital und Arbeit. Schließlich krönte Europa diese Integration mit der Aufstellung des EU-Regelwerks. Das Ziel dieser wirtschaftlichen Integration war von Beginn an gewesen, Europas Stellung auf dem Weltmarkt zu stärken. Die Schaffung eines erweiterten Marktes, der eine großräumige Ökonomie ermöglichte, sollte die Mittel schaffen, um europäische Firmen gegenüber fremder Konkurrenz, besonders durch die Amerikaner und Japaner, zu stärken. Die Schaffung des Single Act 1985/86 wurde aus der allgemeinen wirtschaftlichen Lage Europas geboren: Europa litt mehr an den zehn Krisenjahren als Japan und die Vereinigten Staaten.
Europa im Angesicht des Zerfalls und des Zusammenbruchs der Blöcke
Seit dem Beginn der 80er Jahre ist der Kapitalismus durch eine Situation gezeichnet, in der die beiden grundsätzlichen und antagonistischen Klassen der Gesellschaft in Konfrontation und Gegensatz zueinander stehen, ohne dass eine von beiden in der Lage ist, ihre Alternative durchzusetzen. Doch noch weniger als all den anderen, vorausgegangenen Produktionsweisen ist es dem gesellschaftlichen Leben unter dem Kapitalismus möglich, ein „Einfrieren“ oder eine „Stagnation“ zu ertragen. Während die Widersprüche des krisengeschüttelten Kapitalismus sich immer weiter verschärfen, können die Unfähigkeit der Bourgeoisie, auch nur den Hauch einer Perspektive für die gesamte Gesellschaft anzubieten, und die Unfähigkeit des Proletariats, sich selbst offen zu behaupten, nur zum Phänomen eines allgemeinen Zerfalls führen, zu einer Gesellschaft, die am lebendigen Leib verrottet. Der Kollaps des Ostblocks 1989 war lediglich der spektakulärste einer Reihe von unmissverständlichen Ausdrücken der Tatsache, dass die kapitalistische Produktionsweise in ihre letzte Lebensphase angelangt ist.
Dies trifft auch auf die ernste Zuspitzung der politischen Verwerfungen in den peripheren Ländern zu, die die Großmächte in wachsendem Maße daran hindert, sie zu benutzen, um im eigenen Gebiet für Ordnung zu sorgen, und sie somit dazu zwingt, immer direkter in militärische Konfrontationen zu intervenieren. Dies wurde bereits in den 1980er Jahren deutlich, im Libanon und vor allem im Iran. Besonders im Iran erlangten die Ereignisse eine bis dahin unbekannte Dimension: Ein Land, das einem Block angehört, ja, wichtiges Mitglied eines Militärbündnisses ist, gerät aus dessen Kontrolle, ohne auch nur ansatzweise unter die Vorherrschaft des anderen Blocks zu gelangen. Dies war nicht die Folge der Schwäche des Blocks als Ganzes, ja, nicht einmal eine Frage der Entscheidung dieses Landes, die auf die Verbesserung der Stellung des nationalen Kapitals abzielt – ganz im Gegenteil, denn diese Politik hätte nur zu einer wirtschaftlichen und politischen Katastrophe geführt. Tatsächlich ließen sich vom Standpunkt der Interessen des nationalen Kapitals die Ereignisse im Iran – nicht einmal illusorisch – rational erklären. Am deutlichsten wird dies durch die Machtergreifung der Geistlichen veranschaulicht, einer Gesellschaftsschicht, die niemals eine Kompetenz im Management der wirtschaftlichen oder politischen Angelegenheiten besessen hatte. Der Aufstieg des islamischen Integrationismus und sein Sieg in einem verhältnismäßig wichtigen Land sind Lehrbeispiele für die Zerfallsphase und sind seitdem durch die Entwicklung dieses Phänomens in etlichen anderen Ländern bestätigt worden.
Hier können wir die Entstehung von Phänomenen erblicken, die den klassischen Charakteristiken der kapitalistischen Dekadenz eine qualitative Änderung attestieren.
Historisch obsolet geworden, entwickeln herrschende Klassen stets eine Reihe von Mechanismen und Strukturen, um die Kräfte zu konfrontieren, die ihre Macht untergraben (wachsende Wirtschaftskrisen und militärische Konflikte, die Verwerfungen des Gesellschaftskörpers, der Zerfall der herrschenden Ideologie, etc.). Was die Bourgeoisie betrifft, bestehen diese Mechanismen im Staatskapitalismus, in einer immer totalitäreren Kontrolle der Zivilgesellschaft, in der Unterwerfung der verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie unter die höheren Interessen der Nation, in der Bildung von Militärbündnissen, um der internationalen Konkurrenz zu begegnen, etc.
Solange die Bourgeoisie in der Lage ist, das Gleichgewicht der Klassenkräfte zu beherrschen, können die Ausdrücke des Zerfalls, Kennzeichen einer jeden dekadenten Produktionsweise, in gewisse Grenzen gehalten werden, die mit dem Überleben ihres Systems vereinbar sind. In der Zerfallsphase selbst jedoch bestehen diese Charakteristiken fort und werden von der wachsenden allgemeinen Krise verschärft, während die Unfähigkeit der herrschenden Klasse, ihre Lösung durchzusetzen, und der Arbeiterklasse, ihre eigenen Perspektiven aufzustellen, das Feld allen Arten gesellschaftlicher und politischer Auflösungserscheinungen überlässt – bis hin zur Explosion des Jeder-gegen-Jeden: „Elemente des Zerfalls können in allen dekadenten Gesellschaften gefunden werden: die Verwerfungen des Gesellschaftskörpers, das Dahinrotten ihrer politischen, ökonomischen und ideologischen Strukturen, etc. Dasselbe traf seit dem Beginn seiner dekadenten Epoche auf den Kapitalismus zu (...) in einer historischen Situation, in der die Arbeiterklasse noch nicht in der Lage ist, in den Kampf um die eigenen Interessen und um die einzig ‚realistische‘ Perspektive – die kommunistische Revolution – zu treten, wo aber auch die herrschende Klasse nicht imstande ist, auch nur den Hauch einer Perspektive für sich selbst zu verschaffen, selbst kurzfristig nicht, hilft die frühere Fähigkeit der Letzteren während der Dekadenzperiode, das Phänomen des Zerfalls zu begrenzen und zu kontrollieren, nicht mehr weiter, sondern fällt unter den wiederholten Schlägen der Krise in sich zusammen.“ (ebenda siehe Fussnote 4)
Die Geschichte zeigt, dass die Gesellschaft, wenn sie in ihren eigenen Widersprüchen verfangen ist, ohne sie lösen zu können, in ein wachsendes Chaos, in endlose Kämpfe zwischen Warlords stürzt. Das Bild des Zerfalls ist voll von wachsendem Chaos und Jeder-gegen-Jeden. Einer der Hauptausdrücke des Zerfalls des Kapitalismus zeigt sich in der wachsenden Unfähigkeit der Bourgeoisie, die politische Lage der verschiedensten Art zu kontrollieren: bei der Disziplin unter ihren verschiedenen imperialistischen Fraktionen, bei der Zügelung ihres imperialistischen Heißhungers, etc. Die Unfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, der Gesellschaft auch nur die leiseste Perspektive anzubieten, führt unvermeidlich zu wachsendem, allgemeinem Chaos.
Ende der 80er Jahre sollte sich diese Diagnose auf spektakulärste Weise bestätigen. Die Auflösung des Ostblocks und der UdSSR, der Tod des Stalinismus, die Auflösung Russlands selbst, dem kurz darauf der Golfkrieg folgte, verliehen diesen Charakteristiken einer zerfallenden Produktionsweise unmissverständlich Ausdruck: die Explosion des „Jeder-für-sich-selbst“, die Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und wachsendes Chaos.
In diesem Zusammenhang müssen wir die Reorientierung der europäischen Politik während der 1990er Jahre sehen. Die bis dahin im Wesentlichen ökonomische Ausrichtung schlug nach dem Fall der Berliner Mauer im Dezember 1989 eine deutlich politischere Richtung ein; der Gipfel von Straßburg beschleunigte den Prozess der Etablierung des Euros und lud die osteuropäischen Länder an den Verhandlungstisch. Zu diesem Zeitpunkt war es beschlossene Sache, dass künftig neue Mitglieder integriert werden würden, und die materiellen Mittel, um dies zu erreichen, führten im Mai 1980 zur Bildung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBAE), zu Investitionen in mannigfaltigen Bereichen, zu Kooperationsprogrammen, etc. Der im Wesentlichen geostrategische Charakter dieser Erweiterung Europas in Richtung Osten wurde durch die Tatsache demonstriert, dass der wirtschaftliche Nutzeffekt sich als nichtexistent oder gar negativ erweisen sollte, wie zum Beispiel die Integration Ostdeutschlands in die Bundesrepublik. Das durchschnittliche Bruttosozialprodukt pro Einwohner in den zehn Kanididaten-Ländern ist nicht einmal halb so groß wie in den 13 EU-Staaten. Die Handelsbeziehungen sind zutiefst asymmetrisch. Während 70% der Exporte der ost- und mitteleuropäischen Länder in die Europäische Union gehen, können Erstere nur 4–5% der Exporte Letzterer für sich verbuchen. Während die östlichen Länder sich in einer empfindlichen Abhängigkeit von der Wirtschaftslage Westeuropas befinden, ist dies umgekehrt nicht der Fall. Ein weiteres Element ihrer Verwundbarkeit rührt aus der Tatsache, dass es ein strukturelles Handelsdefizit in sämtlichen ost- und mitteleuropäischen Ländern gibt, was sie vom Zufluss fremden Kapitals abhängig macht. Die Beschäftigungsquote ist seit 1990 in dieser Region um 20% gesunken, und viele Länder sind noch immer in ernsten ökonomischen Problemen verstrickt.
Die wahren Gründe für die Integration der neuen Kandidaten in die EU sind woanders zu suchen. Der erste Grund ist klar imperialistisch. Was ansteht, ist der Ausverkauf der Überbleibsel des ehemaligen Ostblocks. Der zweite ergibt sich aus den Konsequenzen des Zerfalls selbst: Für die EU ist es lebenswichtig, eine relativ stabile Pufferzone an ihren östlichen Grenzen zu installieren, um sich nicht vom wirtschaftlichen und sozialen Chaos anstecken zu lassen, das von der Auflösung des Ostblocks ausgeht. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist es wichtig, dass die wichtigeren der neuen Mitgliedsländer wirtschaftlich am stärksten und geographisch Westeuropa am nächsten sind (Polen, Tschechien, Slowakei und Slowenien), während die drei baltischen Länder (Estland, Lettland und Litauen) den Zugang Russlands zur Ostsee einschränken. Im Endeffekt ist die EU-Politik gegenüber Osteuropa das Ergebnis der überragenden Stellung der imperialistischen Ziele. Einerseits wetteifert die EU, mit Deutschland an der Spitze, mit den Vereinigten Staaten um das Eigentum der Überbleibsel des alten Ostblocks. Das Ziel der Europäischen Union ist es, so viel ost- und mitteleuropäische Länder wie möglich unter ihren Einflussbereich zu bringen, möglichst einschließlich Russlands, das trotz seiner Anlehnung an Amerika heute Deutschland zum Haupthandelspartner hat. Frankreich auf der anderen Seiten ist ebenfalls an einer Expansion der EU in den Osten interessiert, wenn sie von der EU, und nicht von einem unabhängigen Deutschland, das seine alten Vorkriegsreflexe wiederentdeckt, ausgeführt wird. Deutschland ist seinerseits bereit, diese Strategie zu akzeptieren, weil es dadurch die Betreibung seiner imperialistischen Ambitionen bedeckt halten kann, eingedenk dessen, dass es noch nicht bereit ist, offen die Führungsrolle eines neuen imperialistischen Blocks als Widerpart der Vereinigten Staaten anzunehmen.
Die Bedeutung des Euro
Die Zerfallsphase und der Zusammenbruch der imperialistischen Blöcke sind der Rahmen zum Verständnis für die Schaffung einer einzigen Währung. Sie hat vier Grundlagen:
1) Die erste ist geostrategischer und imperialistischer Natur. Die französische und deutsche Bourgeoisie ist daran interessiert zu verhindern, dass die deutsch-französische Allianz unter dem Druck divergierender imperialistischer Interessen zusammenbricht. Einerseits befürchten die Franzosen, dass ein vereinigtes Deutschland zu einem Expansionsfeld im Osten gelangt, während Frankreich dem nichts entgegensetzen kann. Frankreich ist es gelungen, sicher zu stellen, dass die osteuropäische Währung nicht die Deutsche Mark ist, was dazu geführt hätte, Frankreich wirtschaftlich aus dieser Zone auszuschließen. Andererseits war es die Politik Deutschlands seit 1989 gewesen, unter dem Mantel der EU zu verbleiben, um seine eigenen imperialistischen Interessen zu verbergen. Es hat daher ein großes Interesse daran, Frankreich und andere, zweitrangige europäische Länder an seine Expansionspolitik zu binden. Es ist schon banal, darauf hinzuweisen, dass Mitglieder der deutschen Bourgeoisie geäußert haben, dass „Deutschland heute wirtschaftlich das erreicht hat, was Hitler mit dem Krieg erreichen wollte“!
2) Die zweite Grundlage ist die Notwendigkeit, sich den zerstörerischen Kräften der Krise zu widersetzen, die durch Phänomene wesentlich vergrößert wurden, welche eine Besonderheit der Zerfallsphase sind. Durch die Installierung des Euro machte die EU der Destabilisierung durch Währungsspekulationen ein Ende, unter der sie schon etliche Male in der Vergangenheit gelitten hatte (Spekulationen gegen die Lire, der erzwungene Austritt des englischen Pfunds aus dem EWS, etc.). Schon die Installierung des EWS (Europäisches Währungssystem) 1979 war ein Versuch, eine Währungsschlange zu bilden, die stabiler gegenüber dem Dollar und dem Yen sein sollte, und so die EU besser von der monetären Anarchie abzuschirmen, die mittlerweile besonders in den Ländern an der Peripherie des Kapitalismus Schäden verursacht hatte. Dies ist einer der Hauptunterschiede zur Krise von 1929, unter der zunächst die Vereinigten Staaten und daraufhin die europäischen Länder gelitten hatten. Obwohl die Wurzeln der Überproduktionskrisen sowohl in den 30er Jahren als auch heute in den entwickelten kapitalistischen Ländern liegen, ist es in der gegenwärtigen Krise den Letzteren gelungen, die Hauptauswirkungen der Krise bis jetzt in die Peripherie abzulenken. Während auf der Ebene der interimperialistischen Spannungen ihre zentrifugalen Kräfte sich jederlei Art von Disziplin entzogen haben, ist die Bourgeoisie auf der ökonomischen Ebene noch zu einem Minimum an Zusammenarbeit fähig, worin die eigentliche Essenz ihrer Herrschaft als eine Klasse zum Ausdruck kommt: die Gewinnung von Mehrarbeit. So war, im Gegensatz zu den 30er Jahren, die herrschende Klasse im Wirtschaftsbereich in der Lage, ihre Bemühungen zu koordinieren, um wiederholte Marktzusammenbrüche moderat zu gestalten und die zerstörerischsten Auswirkungen der Krise und des Zerfalls einzuschränken.
3) Die dritte Grundlage ist sowohl wirtschaftlicher als auch imperialistischer Natur. Alle europäischen Bourgeoisien wollen ein starkes Europa, das imstande ist, der internationalen und besonders der amerikanischen sowie japanischen Konkurrenz Paroli zu bieten. Dieses Bedürfnis wird um so heftiger verspürt, als dass die europäischen Länder die Ambition haben, die Nationen Osteuropas einschließlich Russland in ihren Einflussbereich zu holen, was weitaus schwieriger wäre, wenn ihre Ökonomie dollarisiert wird.
4) Der dritte Grund ist rein technischer Art: die Eliminierung der Kosten für den Devisenaustausch innerhalb Euroland und der mit dem Floaten der Austauschraten verknüpften Unsicherheit (einschließlich der Kosten, die das Devisensicherungsgeschäft mit sich bringt). Da der größte Teil des Handels der europäischen Länder innerhalb der EU abgewickelt wird, ließ das Beharren auf verschiedene nationale Währungen im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und Japan die Produktionskosten steigen. Eine einzige Währung war in diesem Sinn eine natürliche Folgerung aus der ökonomischen Integration. Es gab immer weniger wirtschaftliche Argumente, um in einem Markt, in dem Steuern und Handelsregeln größtenteils vereinheitlicht sind, an verschiedenen nationalen Währungen festzuhalten.
Europa – die Basis für einen neuenimperialistischen Block?
Als Vorposten des amerikanischen imperialistischen Blocks in Europa gegründet, wurde die EWG immer mehr zu einer ökonomischen Einheit in Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten. Politisch jedoch blieb sie in der Periode des Kalten Kriegs und bis zum Fall der Berliner Mauer von Letzteren dominiert. Mit dem Verschwinden der beiden imperialistischen Blöcke 1989 fand sich Europa erneut mitten im Zentrum imperialistischer Begierden. Seither haben die Gestaltung und die geostrategischen Interessen der verschiedenen imperialistischen Mächte paradoxerweise nicht in Richtung einer Auflösung, sondern einer größeren Integration Europas gedrängt!
Auf der ökonomischen Ebene unterstützen sämtliche europäischen Bourgeoisien das Projekt eines großen, einheitlichen Marktes, um mit den Amerikanern und Japanern zu konkurrieren. Doch in Fragen ihrer imperialistischen Interessen haben wir gesehen, wie jede der drei Großmächte Europas ihre Karte gegen die beiden anderen ausspielt. Und schließlich ermuntern selbst die Amerikaner die EU zur Erweiterung, wohl wissend, dass, je mehr heterogene Bestandteile und imperialistische Orientierungen in die EU integriert werden, desto weniger die EU in der Lage sein wird, irgendeine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen.
Ein genauerer Blick erspart uns Illusionen über die Fortsetzung der europäischen Integration heute. Jeder Teilnehmer in diesem Prozess nimmt nur infolge seines eigenen temporären imperialistischen Interesses und Kalküls teil. Der Konsens zugunsten einer Erweiterung der Europäischen Union ist in seiner Struktur zerbrechlich, denn er basiert auf heterogenen und divergierenden Grundlagen, die nur infolge einer Änderung in den Konstellationen des internationalen Kräftegleichgewichts zu Stande gekommen waren. Keine der Grundlagen für die Existenz der EU rechtfertigt heute die Schlussfolgerung, dass es bereits Formen eines mit dem amerikanischen Block rivalisierenden neuen imperialistischen Blocks gäbe. Worin bestehen die Hauptgründe, die zu dieser Schlussfolgerung führen?
1) Anders als eine wirtschaftliche Koordinierung, die auf einem Vertrag zwischen souveränen Bourgeoisien beruht, wie heute in der EU, ist ein imperialistischer Block eine Zwangsjacke, der einer Gruppe von Staaten durch die militärische Überlegenheit eines Landes aufgezwängt und nur aufgrund des gemeinsamen Wunsches akzeptiert wird, einer anderen Gefahr zu widerstehen oder ein feindliches Militärbündnis zu zerstören. Die Blöcke im Kalten Krieg erschienen nicht als Resultat langwieriger Verhandlungen und Übereinkünfte, wie die Europäische Union: Sie waren das Resultat des militärischen Kräfteverhältnisses, das auf dem Boden der Niederlage Deutschlands etabliert worden war. Der westliche Block wurde geboren, weil Westeuropa und Japan von den Vereinigten Staaten besetzt worden war, während der Ostblock nach der Okkupation Osteuropas durch die Rote Armee ins Leben gerufen worden war. Genausowenig kollabierte der Ostblock wegen irgendwelcher Änderungen seiner wirtschaftlichen Interessen oder seiner Wirtschaftsbündnisse, sondern weil sein Anführer, der den Zusammenhalt des Blocks durch seine Streitkräfte sicherte, nicht mehr in der Lage war, seine Autorität mit Panzern aufrechtzuerhalten, wie er es während des ungarischen Aufstandes 1956 oder in der Tschechoslowakei 1968 getan hatte. Der westliche Block schied einfach deswegen dahin, weil sein gemeinsamer Feind und damit alles, was ihn zusammengehalten hat, verschwunden war. Ein imperialistischer Block ist stets ein Zweckbündnis, niemals eine Liebesheirat. Wie Winston Churchill einst schrieb, sind militärische Allianzen nicht das Ergebnis der Liebe, sondern der Angst: die Angst vor einem gemeinsamen Feind.
2) Noch fundamentaler ist, dass Europa historisch nie einen homogenen Block gebildet hatte und stets von konfliktträchtigen Begierden zerrissen wurde. Europa und Amerika sind die beiden Zentren des Weltkapitalismus. Die USA als vorherrschende Macht in Nordamerika war durch ihre kontinentalen Dimensionen, durch ihre Lage, die potenzielle Feinde in Europa und Asien auf sicherem Abstand hielt, und durch ihre ökonomische Stärke dazu bestimmt, zur führenden Macht in der Welt zu werden. Wie wir 1999 schrieben:
„Seine ökonomische und strategische Stellung hat im Gegensatz dazu Europa dazu verdammt, zum hauptsächlichen Brennpunkt imperialistischer Spannungen im dekadenten Kapitalismus zu werden. Als Hauptschlachtfeld in beiden Weltkriegen und als der Kontinent, der im Kalten Krieg durch den ‚Eisernen Vorhang‘ geteilt worden war, hatte Europa nie eine Einheit gebildet, und im Kapitalismus wird es diese auch nie erreichen.
Wegen seiner historischen Rolle als Geburtsort des modernen Kapitalismus und seiner geographischen Lage als Halbkontinent von Asien gegenüber Nordafrika war Europa im 20. Jahrhundert zum Schlüssel des imperialistischen Ringens um die Weltherrschaft geworden. Gleichzeitig ist Europa, nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage, militärisch besonders schwierig zu beherrschen. Großbritannien musste selbst zu jenen Zeiten, als es noch ‚die Weltmeere beherrschte‘, zu einem komplizierten System des ‚Kräftegleichgewichts‘ greifen, um Europa in Schach zu halten. Was Deutschland unter Hitler angeht, so war selbst 1941 seine Vorherrschaft über den Kontinent mehr äußerlich als real, solange Großbritannien, Russland und Nordafrika sich in Feindeshand befanden. Selbst den Vereinigten Staaten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges gelang es nie, mehr als die Hälfte des Kontinents zu beherrschen.
Die Ironie will es, dass seit ihrem ‚Sieg‘ über die UdSSR die Position der Vereinigten Staaten in Europa mit dem Verschwinden des ‚Reichs des Bösen‘ beträchtlich geschwächt worden war. Obgleich die einzige Supermacht der Welt eine enorme militärische Präsenz in der Alten Welt aufrechterhält, ist Europa nicht ein unterentwickeltes Gebiet, das von einer Handvoll GI-Kasernen in Schach gehalten werden kann: Vier der führenden G8-Industrieländer sind europäisch (...) wenn Europa heute das Zentrum der imperialistischen Spannungen ist, so vor allem deswegen, weil die Hauptmächte Europas selbst unterschiedliche militärische Interessen haben. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass beide Weltkriege vor allem als Kriege zwischen den europäischen Mächten begannen – so wie die Balkankriege der 1990er Jahre.“ (Bericht über die imperialistischen Konflikte für den 13. Kongress der IKS, Internationale Revue Nr 24)
3) Der Marxismus hat bereits aufgezeigt, dass interimperialistische Konflikte nicht notwendigerweise identisch sind mit Wirtschaftsinteressen. Während in den beiden Weltkriegen sich in der Tat zwei Pole gegenüberstanden, die die wirtschaftliche Hegemonie für sich beanspruchten, war dies im Kalten Krieg nicht mehr der Fall, als der westliche Block alle großen Wirtschaftsmächte um sich scharte gegen den wirtschaftlichen schwachen Ostblock, dessen ganze Stärke auf der Atommacht der UdSSR beruhte. Euroland ist eine perfekte Illustrierung der Tatsache, dass die imperialistischen strategischen Interessen und die Welthandelsinteressen der Nationalstaaten nicht identisch sind. Frankreich und Deutschland, die beiden Nationen, die die Triebkraft der EU darstellen, sind dreimal in den letzten 150 Jahren gegeneinander in den Krieg gezogen, während seit Napoleons Zeiten Großbritannien stets versucht hat, die Spaltungen Kontinentaleuropas aufrechtzuerhalten. „Die Volkswirtschaft der Niederlande zum Beispiel ist vom Weltmarkt im Allgemeinen und von der deutschen Wirtschaft im Besonderen äußerst abhängig. Daher ist dieses Land einer der leidenschaftlichsten Anhänger der deutschen Politik für eine gemeinsame Währung gewesen. Auf imperialistischer Ebene jedoch widersetzt sich die holländische Bourgeoisie gerade wegen ihrer geographischen Nähe zu Deutschland den Interessen ihres mächtigen Nachbarn, wo immer sie kann, und stellt einen der loyalsten Verbündeten der USA in der ‚Alten Welt‘ dar. Wenn der Euro zuallererst ein Eckpfeiler eines künftigen deutschen Blocks wäre, so wäre Den Haag der erste, der sich dem widersetzen würde. Doch in Wirklichkeit unterstützen Holland, Frankreich und andere Länder, die sich vor einer imperialistischen Wiederauferstehung Deutschlands fürchten, die gemeinsame Währung, gerade weil sie nicht ihre nationale Sicherheit, d.h. ihre militärische Souveränität, beeinträchtigt.“ (ebenda) Angesichts der imperialistischen Rivalitäten zwischen den europäischen Ländern selbst und auch in Anbetracht der Tatsache, dass Europa heute sich im eigentlichen Herzen der interimperialistischen Spannungen des Planeten befindet, ist es wenig realistisch anzunehmen, dass wirtschaftliche Interessen allein die europäischen Länder zusammenschweißen können. Dies ist um so mehr ausgeschlossen, als Europa, auch wenn es auf ökonomischer Ebene integriert ist, auf politischer Ebene weit davon entfernt ist, geschweige denn auf militärischer Ebene oder in der Außenpolitik. Wie können wir annehmen, dass Euroland bereits ein imperialistischer Block ist, der mit den Vereinigten Staaten rivalisiert, wenn es nicht einmal zwei wesentlichen Eigenschaften eines imperialistischen Blocks besitzt: eine Armee und eine imperialistische Strategie. Diese Tatsachen demonstrieren täglich, dass ein vereintes Europa eine Utopie ist, was wir insbesondere im Dissens unter seinen Mitgliedsländern und in der Unfähigkeit sehen können, die Regelung internationaler Konflikte zu beeinflussen, selbst wenn diese vor der eigenen Tür, wie in Jugoslawien, stattfinden.
Fritz
Fußnoten:
1 s. unsere Broschüre „Nation oder Klasse“
2 eigene Übersetzung
3 eigene Übersetzung
4 eigene Übersetzung
5 s. unsere Thesen in „Der Zerfall – die letzte Phase des Kapitalismus“ in Internationale Revue Nr. 13.
Geographisch:
- Europäische Union [110]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Europa: Wirtschaftsbündnis und Terrain für imperialistische Manöver
- 2876 Aufrufe
Europa: Wirtschaftsbündnis und Terrain für imperialistische Manöver
Fast ein halbes Jahrhundert lang hat die herrschende Klasse jetzt über den Bau Europas gesprochen. Die Einführung einer gemeinsamen Währung – der Euro – wurde als ein bedeutsamer Meilenstein auf dem Weg zur Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa dargestellt. Dieser Prozess ist angeblich in vollem Gange, seitdem geplant ist, die Europäische Union mit dem 1.Mai 2004 von 15 auf 25 Länder zu erweitern, und der Vorschlag einer europäischen Verfassung bereits erarbeitet worden ist.
Wird sich die herrschende Klasse tatsächlich als fähig erweisen, über den engen Rahmen der Nationen hinauszugehen? Wird sie imstande sein, die ökonomische Konkurrenz und ihre eigenen imperialistischen Antagonismen zu überwinden? Wird sie in der Lage sein, dem Wirtschaftskrieg und den militärischen Konflikten, die so oft den Kontinent auseinandergerissen hatten, tatsächlich ein Ende zu setzen? Mit anderen Worten: Wird sich die Bourgeoisie als fähig erweisen, den Ansatz einer Lösung des Problems der Spaltung der Welt in konkurrierende Nationen durch den Kapitalismus anzubieten, einer Spaltung, die den Tod von zig Millionen Menschen bewirkte und den gesamten Planeten in Blut ertränkte, besonders seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts? Wird die Bourgeoisie tatsächlich fähig sein, die nationalistische Ideologie aufzugeben, die das Fundament ihrer eigenen Existenz als Klasse bildet und die Quelle ihrer ganzen ökonomischen, politischen, ideologischen und imperialistischen Legitimation ist?
Doch wenn all diese Fragen verneint werden, wenn die Vereinigten Staaten von Europa nichts als eine Fata Morgana sind, was für eine Bedeutung hat dann die Bildung und Weiterentwicklung der Europäischen Union? Ist die herrschende Klasse so masochistisch geworden, dass sie ewig einer Unmöglichkeit nachrennt? Weshalb bemüht sie sich darum, ein Haus zu errichten, das nicht lebensfähig ist? Dient es lediglich dem Zweck eines illusorischen Wetteiferns mit den Vereinigten Staaten von Amerika? Oder reiner Propaganda?
Die Unmöglichkeit, in der Dekadenz des Kapitalismus über den nationalenRahmen hinauszugehen
Wir können die Aussichtslosigkeit eines solchen Unterfangens ermessen, wenn wir die Vorbedingungen für seine Lebensfähigkeit berücksichtigen. Nicht nur, dass diese Voraussetzungen für dieses Projekt völlig fehlen, sie sind ganz einfach eine Utopie im gegenwärtigen historischen Zusammenhang. Da die Existenz der verschiedenen nationalen Bourgeoisien eng mit dem Privat- und/oder Staatseigentum verknüpft ist, das sich historisch innerhalb des nationalen Rahmens entwickelt hatte, würde jede wirkliche Vereinigung auf einer höheren Stufe die Entmachtung dieser Nationen bedeuten. Diese Perspektive ist um so unrealistischer, als dass eine kontinentweite Schaffung eines tatsächlich vereinigten Europas nur durch einen Prozess der Enteignung der verschiedenen bürgerlichen Fraktionen in allen Mitgliedsländern stattfinden kann. Dies wäre notwendigerweise ein gewaltsamer Prozess, so wie die bürgerlichen Revolutionen gegen das feudalistische Ancien Régime oder die Unabhängigkeitskriege der neuen Nationen gegen ihre Vormundschaftsmacht. Für einen solchen Prozess wäre es unmöglich, „den politischen Willen der Regierungen“ und/oder „das Verlangen der Völker, Europa zu erschaffen“, zu ersetzen. Während des 19. Jahrhunderts spielte der Krieg stets eine vorrangige Rolle im Prozess der Bildung neuer Nationen, um entweder den inneren Widerstand reaktionärer Bereiche in der Gesellschaft zu eliminieren oder um auf Kosten der Nachbarländer die eigenen Grenzen neu zu ziehen.1 Wir können uns daher leicht ausmalen, was der Prozess der europäischen Vereinigung kosten würde. Dies unterstreicht, dass die Idee einer friedlichen Union von verschiedenen Ländern, so europäisch sie auch sein mögen, entweder eine Utopie oder heuchlerisch und verlogen ist. Denn eine solche Vereinigung zu ermöglichen würde das Auftreten einer neuen gesellschaftlichen Gruppe implizieren, der Trägerin emanzipatorischer supranationaler Interessen, die, gestählt durch einen wahrhaft revolutionären Prozess und mit Hilfe ihrer eigenen politischen (Parteien, etc.) und Zwangsmittel (Streitkräfte, etc.), jene bürgerlichen Interessen enteignet, die an den verschiedenen nationalen Kapitalien gebunden sind, und ihnen ihre Macht aufzwingt.
Ohne uns länger über die nationale Frage auszulassen, ist es klar, dass all jene (ungefähr 100) Nationen, die nach dem Krieg von 1914–18 gegründet worden waren, das Ergebnis nationaler Probleme waren, die während des 19. Jahrhunderts und bis zu Beginn des
20. Jahrhunderts ungelöst geblieben waren. Alle von ihnen waren nationale Totgeburten, die sich als unfähig erwiesen, ihre bürgerliche Revolution zu vervollständigen und mit genügendem Nachdruck eine industrielle Revolution zu initiieren; alle von ihnen fühlten so die Dynamik der massiven Konflikte, die seit dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hatten. Nur jene Länder, die sich während des 19. Jahrhunderts gebildet hatten, waren imstande gewesen, einen ausreichenden Grad an Kohärenz, Wirtschaftskraft und politischer Stabilität zu erreichen. Die sechs größten Mächte von heute waren es bereits, wenn auch in anderer Reihenfolge, am Vorabend des I. Weltkrieges. Selbst bürgerliche Historiker sehen diese Tatsache, doch sie kann nur wirklich im Rahmen des historischen Materialismus erklärt werden.
Um sich auf einem soliden Fundament zu bilden, muss eine Nation auf einer realen Zentralisierung ihrer Bourgeoisie begründet sein, und diese Zentralisierung wird in einem erbitterten, Einheit stiftenden Kampf gegen den Feudalismus des Ancien Régime geschmiedet. Sie muss genügend solide ökonomische Grundlagen für ihre industrielle Revolution besitzen, um sich ihren Platz auf einem Weltmarkt zu sichern, welcher sich noch in der Entstehung befindet. Diese beiden Bedingungen existierten während der Epoche des kapitalistischen Aufstiegs, die sich im Wesentlichen vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum I. Weltkrieg erstreckte. Danach verschwanden diese Bedingungen, und daher war von da an die Entstehung neuer, lebensfähiger nationaler Projekte nicht mehr möglich. Warum also sollte es heute plötzlich wieder möglich geworden sein, etwas durchzuführen, was schon während des 20. Jahrhunderts unmöglich gewesen war? Da keine der neuen Nationen, die seit dem Ersten Weltkrieg gebildet worden waren, in der Lage gewesen war, adäquate Existenzmittel zu sammeln, warum sollte die Entstehung einer neuen Großmacht – wie es die Vereinigten Staaten von Europa wären – plötzlich nun möglich sein?
Die dritte logische Konsequenz einer hypothetischen europäischen Einheit setzt eine Abschwächung der Tendenz zur Verschärfung imperialistischer Antagonismen unter den konkurrierenden Ländern Europas voraus. Doch wie Marx Mitte des 19. Jahrhunderts (im Kommunistischen Manifest) hervorhob, ist der Antagonismus zwischen den einzelnen Fraktionen der Bourgeoisie eine Konstante: „Die Bourgeoisie befindet sich in fortwährendem Kampf; anfangs gegen die Aristokratie; später gegen Teile der Bourgeoisie selbst, deren Interessen mit dem Fortschritt der Industrie in Widerspruch geraten; stets gegen die Bourgeoisie aller auswärtigen Länder.“ (Karl Marx, „Manifest der Kommunistischen Partei“, MEW Bd. 4, S. 459-492) Während die Widersprüche zwischen der Bourgeoisie und den Überbleibseln des Feudalismus oder ihrer eigenen rückwärts gewandten Sektoren von der kapitalistischen Revolution größtenteils überwunden worden waren, zumindest in den entwickelten Hauptländern, haben sich im Gegensatz dazu die Antagonismen zwischen den Nationen im gesamten 20. Jahrhundert nur vertieft. Warum also sollten wir erwarten, dass sich dieser Prozess umkehrt, wenn sich die Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse während der gesamten Periode der Dekadenz immer weiter verschärft haben?
In der Tat besteht ein unzweideutiges Kennzeichen einer Produktionsweise, die die Periode ihrer Dekadenz betreten hat, in der Explosion von Antagonismen zwischen den Fraktionen der herrschenden Klasse. Diese können nicht mehr ausreichend Mehrwert aus den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen ziehen, die fortan obsolet geworden sind, und neigen somit dazu, dies durch die Ausplünderung ihrer Rivalen zu tun. Dies traf auf die Dekadenz der feudalen Produktionsweise (1325–1750) zu, als dem Hundertjährigen Krieg die Kriege zwischen den großen europäischen absolutistischen Monarchien folgten: „... Gewalttätigkeiten waren ohne Zweifel ein permanenter und besonderer Charakterzug der mittelalterlichen Gesellschaft. Dennoch erreichten sie während der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert eine neue Dimension (...) Der Krieg wurde zu einem endemischen Phänomen, genährt von gesellschaftlichen Frustrationen (...) Die Generalisierung von Kriegen war vor allem der ultimative Ausdruck von Funktionsstörungen einer Gesellschaft, die sich im Würgegriff von Problemen befand, die sie nicht meisterte. Und so suchte sie Zuflucht in Kriegen, um den Problemen des Alltags zu entgehen.“ (Guy Bois, La Grande dépression médiévale)2.Diese Periode der Dekadenz der feudalen Produktionsweise steht in einem großen Kontrast zum Aufstieg des Mittelalters (1000–1325): „Noch deutlicher als zu Feudalzeiten erlebte die Periode zwischen – grob gesagt – 1150 und 1300 über weite geographische Gebiete hinweg Phasen eines beinahe vollständigen Friedens, dank dessen die wirtschaftliche und demographische Expansion wachsen konnte.“ (P. Contamine, La Guerre au Moyen Age)3 Dasselbe trifft auf die Produktionsweise der Sklavenhaltergesellschaften, auf die Zerstückelung des Römischen Reiches und die Ausbreitung von endlosen Konflikten zwischen Rom und seinen Provinzen zu.
Dies war auch der Fall, als der Kapitalismus seine Dekadenzperiode betrat. Um sich eine Vorstellung von der Kluft zwischen den Existenzbedingungen während des Aufstiegs des Kapitalismus und denen seiner Dekadenz zu machen, wollen wir hier aus Eric Hobsbawns „Das Zeitalter der Extreme“ (1994)2 zitieren, in dem er sehr gut den fundamentalen Unterschied zwischen dem „langen 19. Jahrhundert“ und dem „kurzen 20. Jahrhundert“ aufzeigt: „Wie sollen wir dem kurzen 20. Jahrhundert einen Sinn abgewinnen – Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion? (...) während des Kurzen 20. Jahrhunderts wurden mehr Menschen auf Weisung und mit Erlaubnis ermordet als jemals zuvor in der Geschichte. (...) Es war ohne Zweifel das mörderischste Jahrhundert von allen, über das wir Aufzeichnungen besitzen: mit Kriegszügen von nie gekannten Ausmassen und von nie dagewesener Häufigkeit und Dauer, sowohl was das Niveau, die Häufigkeit und die Dauern dieser Kriege betrifft (und welche in den zwanziger Jahren kaum ein Unterbruch hatten), als auch bezüglich dem Ausmass der grössten Hungersnöte der Geschichte und den systematischen Genoziden. Im Unterschied zum langen 19. Jahrhundert, welches eine Periode des nahezu ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritts zu sein schien und auch wirklich war, sind wir seit 1914 Zeugen eines markanten Rückgangs dieser bis anhin für die entwickelten Länder als selbstverständlich angenommenen Werte. (...) Dies alles änderte um 1914 (...) Kurz gesagt, 1914 leitete die Epoche der Massaker ein (...) Die Mehrzahl der nicht-revolutionären und nicht-ideologischen Kriege der Vergangenheit waren nicht als Kämpfe auf Leben und Tod bis zur totalen Erschöpfung geführt worden. (...) Warum führten die dominanten Mächte unter diesen Umständen der Ersten Weltkrieg bis zum Nichts, also als Krieg, der nur entweder ganz gewonnen oder ganz verloren werden konnte? Der Grund dafür ist, dass dieser Krieg, im Unterschied zu den vorausgegangenen Konflikten mit begrenzten und genau festgelegten Zielen, mit uneingeschränkten Absichten geführt wurde. (...) Dies war ein absurdes und selbstzerstörerisches Ziel, welches zugleich Sieger und Besiegte ruinierte. Letztere führte er in die Revolution, die Sieger zum Zusammenbruch und zur physischen Erschöpfung. (...) Im modernen Krieg werden alle Bürger hineingezogen und die Mehrheit von ihnen wird mobilisiert; sei es, dass er mit Rüstung geführt wird, deren Produktion eine Umleitung der ganzen Wirtschaft erfordert und in unvollstellbarem Umfang eingesetzt wird; sei es, dass er unglaubliche Zerstörungen erzeugt, aber auch die Existenz der in ihn verwickelten Länder dominiert und verändert. So sind alle diese Phänomene dem Krieg des 20. Jahrhunderts eigen. (...) Diente der Krieg dem Wirtschaftswachstum? Es ist klar, dass dem nicht so ist.“4 Der Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenzperiode machte fortan die Entstehung neuer, wirklich lebensfähiger Nationen unmöglich. Die relative Sättigung zahlungskräftiger Märkte – im Verhältnis zu den enormen Bedürfnissen der Akkumulation, die von der Entwicklung der Produktivkräfte geschaffen wurden – , die der Dekadenz des Kapitalismus zugrunde liegt, verhindert jede „friedliche“ Lösung seiner unüberwindlichen Widersprüche. Daher ist seither die Zahl der Handelskriege zwischen den Nationen und die Entwicklung des Imperialismus nur gewachsen. In einem solchen Kontext sind Nationen, die spät die Weltbühne betreten haben, unfähig, ihre Rückständigkeit zu überwinden: Im Gegenteil, der Abstand zu den entwickelten Ländern wächst unerbittlich.
Selbst in der Zeit vor dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts, in einer Epoche, die eigentlich günstig für die Entstehung neuer Nationen gewesen war, war die nationale Einheit Europas ausgeschlossen, weil die Voraussetzungen für diese Einheit nicht existierten; seither ist ihre Existenz noch irrelevanter geworden. Ja, in der gegenwärtigen und finalen Phase der Dekadenz, in der Phase des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft5, sind die Bedingungen für die Entstehung einer neuen Ausgangslage nicht nur noch ungünstiger, sie üben darüber hinaus Druck auf existierende, aber weniger stabile Nationen aus und führen zu deren Auflösung (die UdSSR, Jugoslawien, Tschechoslowakei, etc.) sowie zur Verschärfung der Spannungen selbst zwischen den stärksten und stabilsten Ländern (siehe weiter unten das Kapitel über Europa in der Zerfallsperiode).
Eine historische Parallele:Die absolutistischen Monarchien
Kommt dieser Prozess der europäischen Vereinigung inmitten der kapitalistischen Dekadenz überraschend? Ist er ein Zeichen dafür, dass die kapitalistische Produktionsweise ihre alte Stärke wiederentdeckt hat, dass sie der Dekadenz ein Schnippchen geschlagen hat? Allgemein ausgedrückt: Können wir ein ähnliches Phänomen während der Dekadenz früherer Gesellschaften beobachten, und wenn ja, worin bestand seine Bedeutung?
Die Dekadenz der feudalen Produktionsweise ist in diesem Zusammenhang interessant, da sie Zeuge der Bildung der großen absolutistischen Monarchien war, die über zerstreute Lehnsgüter hinauszugehen schienen, welche so kennzeichnend für die feudale Produktionsweise waren. Während des 16. Jahrhunderts verhalf dies dem absolutistischen Staat im Westen zum Leben. Die zentralisierten Monarchien stellten einen entscheidenden Bruch mit der pyramidenhaften und zerstreuten Souveränität in den mittelalterlichen gesellschaftlichen Gebilden dar. Diese Zentralisierung der monarchischen Macht bewirkte den Aufstieg eines stehenden Heeres und einer Bürokratie, einer nationalen Steuererhebung sowie einer kodifizierten Rechtsprechung und den Beginn eines vereinigten Marktes. Obgleich all diese Elemente als Charakteristikum des Kapitalismus erscheinen mögen – dies um so mehr, als sie mit dem Verschwinden der Leibeigenschaft zusammenfallen – sind sie dennoch ein Ausdruck des verfallenden Feudalismus.
Tatsächlich ging die „nationale Vereinigung“, die auf mannigfaltigen Ebenen von den absolutistischen Monarchien durchgeführt worden war, nicht über den geohistorischen Rahmen des Mittelalters hinaus, sondern drückte vielmehr die Tatsache aus, dass Letzterer zu eng geworden war, um die fortdauernde Entwicklung der Produktivkräfte zu umfassen. Die absolutistischen Staaten stellten eine Form der Zentralisierung der feudalen Aristokratie dar, indem sie ihre Macht stärkten, um der Dekadenz der feudalen Produktionsweise zu widerstehen. Die Zentralisierung der Macht ist in der Tat ein weiteres Kennzeichen der Dekadenz einer jeden Produktionsweise – im Allgemeinen durch eine Wiederverstärkung des Staates, der die kollektiven Interessen der herrschenden Klasse repräsentiert – um einen stärkeren Widerstand gegen die ruinösen Krisen ihres historischen Abstiegs auf die Beine zu stellen.
Wir können eine Analogie dazu in der Bildung der Europäischen Union im Besonderen und in all den regionalen Wirtschaftsabkommen auf der ganzen Welt im Allgemeinen feststellen. Sie sind Versuche, über den zu engen Rahmen der Nation hinauszugehen, um sich der Verschärfung der ökonomischen Konkurrenz in der kapitalistischen Dekadenz zu stellen. Die Bourgeoisie ist daher gefangen zwischen einerseits der immer größeren Notwendigkeit, über den nationalen Rahmen hinauszugehen, um ihre wirtschaftlichen Interessen besser zu verteidigen, und andererseits den nationalen Grundlagen ihrer Macht und ihres Eigentums. Europa ist keinesfalls eine Überwindung dieses Widerspruchs, sondern ein Ausdruck des bürgerlichen Widerstandes gegen die Widersprüche der Dekadenz ihrer eigenen Produktionsweise. Als Louis XIV. die Granden des Reiches dazu einlud, in seinen Hof in Versailles zu ziehen, geschah dies nicht zu ihrem Wohlgefallen, sondern vielmehr um sie zu unter kaiserliche Kuratel zu stellen und sie daran zu hindern, Komplotte in ihren Provinzen gegen ihn zu schmieden. In gewisser Weise ist das strategische Kalkül innerhalb der Europäischen Union dem nicht unähnlich. So zieht es Frankreich vor, Deutschland an Europa gebunden und die Deutsche Mark mit dem Euro verschmolzen zu sehen, statt Zeuge zu werden, wie Deutschland bei seiner Expansion in Mitteleuropa, wo die Deutsche Mark bereits zur heimlichen Leitwährung geworden war, seine historische Interesssen entfaltet. Nach seinem Versuch, die EFTA gegen die EWG zu bilden, zieht es Großbritannien nun vor, in letztgenanntem Verein mitzumachen, um so die Politik der EWG zu beeinflussen bzw. zu sabotieren, statt sich auf seiner Insel zu isolieren, wohingegen Deutschland im Sinn hat, unter dem Mantel der europäischen Fiktion die Entfaltung seiner tatsächlich imperialistischen Ambitionen als künftiger Anführer eines imperialistischen Blocks weiter zu betreiben, der in der Lage ist, mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu rivalisieren.
Europa – eine Kreation des Imperialismus aus Gründen des Kalten Krieges
Die Wurzeln der Europäischen Gemeinschaft lagen in der Existenz des Kalten Krieges, der unmittelbar nach dem II. Weltkrieg folgte. Durch die Wirtschaftskrise und die gesellschaftlichen Verwerfungen destabilisiert, war Europa eine potenzielle Beute des russischen Imperialismus und wurde daher von den Vereinigten Staaten gestützt, um einen Schutzwall gegen die Avancen des Ostblocks zu bilden. Dies wurde dank des Marshallplans erreicht, der im Juni 1947 allen europäischen Ländern in Aussicht gestellt worden war. Auch die Schaffung einer Europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft entsprach dem Kalkül, Europa im Zusammenhang mit einer dramatischen Zuspitzung der Ost-West-Spannungen anlässlich des Koreakrieges zu stärken. Die Schaffung der EWG 1957 vervollständigte die Stärkung des westlichen Blocks auf dem Kontinent. Diese Entwicklung in Europa, die im Wesentlichen auf wirtschaftlichem Gebiet und, mit der Präsenz von Truppen und Waffen der NATO, auf militärischer Ebene erfolgte, beweist, dass Europa, weit davon entfernt, eine friedliche Idylle zu sein, die Hauptbühne von interimperialistischen Konflikten blieb, so wie es in der gesamten Geschichte des Kapitalismus gewesen war.
Im Gegensatz zur Propaganda der herrschenden Klasse war der Friede, der seit dem Ende des II. Weltkrieges in Europa herrschte, nicht die Folge eines Prozesses der europäischen Vereinigung oder der Friedfertigkeit, die plötzlich unter den historischen Rivalen ausgebrochen war, sondern die Folge des Zusammentreffens von drei ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Faktoren. So erlaubte die wirtschaftliche Wiederbelebung in Kombination mit keynesianischen Regulierungen dem Kapitalismus, sein Überleben zu verlängern, ohne gezwungen zu sein, sofort Zuflucht zu suchen in einem dritten Weltkonflikt, wie es zwischen dem I. und II. Weltkrieg der Fall gewesen war, als 1929 nach nur zehn Jahren des Wiederaufbaus, zwischen 1919 und 1929, die schlimmste Überproduktionskrise in der Geschichte ausbrach und bis zum Vorabend des II.Weltkrieges anhielt. So bildeten sich im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg zwei imperialistische Blöcke (NATO und Warschauer Pakt), die sich auf dem Kontinent gegenüberstanden; die Vereinigten Staaten und die UdSSR, die beiden jeweiligen Blockführer, waren eine Zeitlang in der Lage, ihre direkten Konfrontationen an die Peripherie zu drängen. Dies hinderte jedoch lokale Konflikte zwischen 1945 und 1989 nicht daran, mehr Opfer zu verursachen als sämtliche Schlachten des II.Weltkrieges zusammen! Und schließlich versperrte die Tatsache, dass das Proletariat ideologisch nicht bereit war, in den Krieg zu ziehen, nachdem es 1968 die historische Bühne wieder betreten hatte, den Weg zur Kriegshetze der beiden imperialistischen Blöcke genau in dem Augenblick, als es für sie immer dringlicher wurde, angesichts der sich ausbreitenden Wirtschaftskrise zu offenen Feindseligkeiten zu schreiten.
Europa – eine leere Hülle und politische Handgreiflichkeiten
Unter ziemlich günstigen Umständen waren die europäischen Staaten in der Lage gewesen, im Wesentlichen auf wirtschaftlicher Ebene zu Übereinkünften zu gelangen: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit Europas, die europäische Kohle- und Stahlgemeinschaft, die Schaffung einer europaweiten Mehrwertsteuer, der Gemeinsame Markt und das Europäische Währungssystem sind allesamt Beispiele dafür. Im Gegensatz dazu waren die politischen Misshelligkeiten eine Konstante in der Politik der EWG und EU, die unmittelbar nach der Niederlage Deutschlands im Krieg mit der deutschen Frage ihren Anfang nahm. Frankreich wollte ein schwaches und unbewaffnetes Deutschland. Die Vereinigten Staaten hingegen erzwangen wegen der Erfordernisse des Kalten Kriegs den Wiederaufbau eines starken, wiederaufgerüsteten Deutschland, was 1949 zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland führte. 1954 lehnte Frankreich die Ratifizierung der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft trotz der Tatsache ab, dass das EWG-Abkommen bereits 1952 von den fünf europäischen Partnern unter dem Druck der Amerikaner unterzeichnet worden war. Das Vereinigte Königreich, das sich geweigert hatte, der 1957 gebildeten EWG beizutreten, versuchte seinerseits, eine weiter gefasste Freihandelszone zu errichten, die alle Länder der OECD umfasste und den Gemeinsamen Markt beinhalten sollte, was ihn so seiner Exklusivität beraubt hätte. Als die Franzosen sich weigerten, taten sich die Briten mit anderen europäischen Ländern zusammen, um am 20. November 1959 mit der Unterzeichnung des Stockholmer Vertrages die European Free Trade Association (EFTA) zu gründen. Bei zwei Gelegenheiten, 1963 und 1967, lehnte Frankreich die EWG-Kandidatur Großbritanniens ab, da es in ihm ein trojanisches Pferd der Amerikaner erblickte. 1967 provozierte Frankreich dabei eine ernste Krise, die sechs Monate andauerte, indem es eine Politik des „leeren Stuhls“ betrieb; sie endete mit einem Kompromiss, der Europa zwar das weitere Überleben ermöglichte, dabei aber das Einstimmigkeitsprinzip bei allen EWG-Beschlüssen etablierte. Nachdem Großbritannien im Januar 1973 der EWG beigetreten war, zögerte es nicht, bei zahllosen Gelegenheiten Sand in das Getriebe der EWG-Politik zu streuen, beginnend mit der Neuaushandlung des Beitrittsvertrages ein Jahr später und im weiteren mit Veränderungen in der EG-Agrarpolitik, Neuverhandlungen über den britischen Beitrag zum EG-Etat (s. Margaret Thatchers berühmtes „Ich will mein Geld zurück“), mit der Weigerung, einer gemeinsamen Währung beizutreten, etc. Erst kürzlich haben die Unstimmigkeiten über das Datum der Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der EU die Spaltung Europas auf der Ebene seiner imperialistischen Rivalitäten enthüllt. Frankreich verhält sich offen feindselig gegenüber diesem Land, das sich entweder mit Deutschland oder mit den USA eng verbunden fühlt. Letztere haben tatsächlich einen unerhörten Druck ausgeübt, damit die Türkei als künftiger Kandidat akzeptiert wird, sei es durch direkte Telefonate des Präsidenten mit europäischen Führern oder indirekt, via des britischen Lobbyismus, durch eine unterschwellige, aber offiziell abgesegnete Strategie, die da lautet: Je mehr die EU erweitert wird, desto weniger wird sie zur politischen Integration und vor allem zur Entwicklung einer gemeinsamen Politik und Strategie auf der internationalen Bühne in der Lage sein.
Die vollständige Abwesenheit jeglicher gemeinsamen Politik oder der Instrumente für diese Politik (eine gemeinsame Armee), das Fehlen eines substanziellen Etats der EU in der Größenordnung nationaler Etats (derzeit knapp 1,27% des BSP von Euroland!) und der völlig überproportionierte Anteil der Landwirtschaft am EU-Etat (nahezu die Hälfte dessen wird für einen Bereich ausgegeben, der nicht mehr als 4–5% der Wertschöpfung in der EU repräsentiert), etc. – all dies demonstriert deutlich genug, dass die fundamentalen Attribute eines europäischen supranationalen Staates fehlen oder da, wo sie existieren, keine wirkliche Macht oder Unabhängigkeit besitzen. Die politische Funktionsweise der Europäischen Union ist eine reine Karikatur, typisch für die Funktionsweise der Bourgeoisie in der Epoche der Dekadenz. Das Parlament hat keine Macht, der Schwerpunkt des politischen Lebens wird von der Exekutive, dem Rat der Minister, so stark vereinnahmt, dass selbst die Bourgeoisie sich regelmäßig über das „Defizit an demokratischer Legitimation“ beschwert!
Dies ist insofern kaum überraschend, als dass die politische Strategie der Europäer bereits während des Kalten Krieges nur sehr bedingt vorkam und durch die Disziplin des amerikanischen Blocks in engen Grenzen gehalten wurde. Diese Strategie hatte schon zu jener Zeit nur geringe Konsistenz, doch nach dem Fall der Berliner Mauer, der das Verschwinden der beiden Blöcke markierte, verringerte sie sich noch mehr. Seitdem gibt es keine außenpolitische Frage, zu der Europa in der Lage wäre, eine gemeinsame Position zu definieren. Es ist zerrissen zwischen verschiedenen oder gar gegensätzlichen Positionen in der Frage des Nahen Ostens, des Golfkrieges, des Konflikts in Jugoslawien und im Kosovo, etc. Dasselbe trifft auf den Vorschlag der Schaffung einer europäischen Armee zu. Während einige (wie Frankreich und Deutschland zum Beispiel) auf mehr Integration drängen, einschließlich einer größeren Unabhängigkeit gegenüber den verbliebenen Militärstrukturen der NATO, wollen andere (Großbritannien und die Niederlande zum Beispiel) in ihnen verbleiben.
Europa: eine im Wesentlichen wirtschaftliche Übereinkunft
Wenn die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa eine Illusion ist, wenn eine wirkliche, allumfassende europäische Integration ein Aberglauben ist, wenn die Wurzeln der Existenz einer begrenzten europäischen Einigung in den Erfordernissen des Kalten Krieges lagen – was steckt dann hinter der politischen Absicht, heute diese Strukturen zu stärken?
Wie wir gesehen haben, waren die Geburt der Europäischen Gemeinschaft und ihre Erstarkung zuallererst Ausdrücke der Notwendigkeit, den sowjetischen Expansionsdrang nach Europa zu bremsen. Obgleich sie für die imperialistischen Bedürfnisse des amerikanischen Blocks geschaffen wurde und sich gar für die wirtschaftliche Expansion durch Letzteren als nützlich erwies (wie Japan und die „neu industrialisierten Länder“), wurde sie Zug um Zug zu einem ernsthaften wirtschaftlichen Konkurrenten für die Vereinigten Staaten, einschließlich ihrer Domänen in der Hochtechnologie (Airbus, Arianespace, etc.). Dies ist eines der Resultate der wirtschaftlichen Konkurrenz während des Kalten Krieges. Bis zum Fall der Berliner Mauer war die europäische Integration im Wesentlichen ökonomischer Natur. Beginnend als eine Binnenfreihandelszone für Waren und dann als Zollunion gegen andere Länder, wurde sie schließlich zu einem gemeinsamen Markt für Güter, Kapital und Arbeit. Schließlich krönte Europa diese Integration mit der Aufstellung des EU-Regelwerks. Das Ziel dieser wirtschaftlichen Integration war von Beginn an gewesen, Europas Stellung auf dem Weltmarkt zu stärken. Die Schaffung eines erweiterten Marktes, der eine großräumige Ökonomie ermöglichte, sollte die Mittel schaffen, um europäische Firmen gegenüber fremder Konkurrenz, besonders durch die Amerikaner und Japaner, zu stärken. Die Schaffung des Single Act 1985/86 wurde aus der allgemeinen wirtschaftlichen Lage Europas geboren: Europa litt mehr an den zehn Krisenjahren als Japan und die Vereinigten Staaten.
Europa im Angesicht des Zerfalls und des Zusammenbruchs der Blöcke
Seit dem Beginn der 80er Jahre ist der Kapitalismus durch eine Situation gezeichnet, in der die beiden grundsätzlichen und antagonistischen Klassen der Gesellschaft in Konfrontation und Gegensatz zueinander stehen, ohne dass eine von beiden in der Lage ist, ihre Alternative durchzusetzen. Doch noch weniger als all den anderen, vorausgegangenen Produktionsweisen ist es dem gesellschaftlichen Leben unter dem Kapitalismus möglich, ein „Einfrieren“ oder eine „Stagnation“ zu ertragen. Während die Widersprüche des krisengeschüttelten Kapitalismus sich immer weiter verschärfen, können die Unfähigkeit der Bourgeoisie, auch nur den Hauch einer Perspektive für die gesamte Gesellschaft anzubieten, und die Unfähigkeit des Proletariats, sich selbst offen zu behaupten, nur zum Phänomen eines allgemeinen Zerfalls führen, zu einer Gesellschaft, die am lebendigen Leib verrottet. Der Kollaps des Ostblocks 1989 war lediglich der spektakulärste einer Reihe von unmissverständlichen Ausdrücken der Tatsache, dass die kapitalistische Produktionsweise in ihre letzte Lebensphase angelangt ist.
Dies trifft auch auf die ernste Zuspitzung der politischen Verwerfungen in den peripheren Ländern zu, die die Großmächte in wachsendem Maße daran hindert, sie zu benutzen, um im eigenen Gebiet für Ordnung zu sorgen, und sie somit dazu zwingt, immer direkter in militärische Konfrontationen zu intervenieren. Dies wurde bereits in den 1980er Jahren deutlich, im Libanon und vor allem im Iran. Besonders im Iran erlangten die Ereignisse eine bis dahin unbekannte Dimension: Ein Land, das einem Block angehört, ja, wichtiges Mitglied eines Militärbündnisses ist, gerät aus dessen Kontrolle, ohne auch nur ansatzweise unter die Vorherrschaft des anderen Blocks zu gelangen. Dies war nicht die Folge der Schwäche des Blocks als Ganzes, ja, nicht einmal eine Frage der Entscheidung dieses Landes, die auf die Verbesserung der Stellung des nationalen Kapitals abzielt – ganz im Gegenteil, denn diese Politik hätte nur zu einer wirtschaftlichen und politischen Katastrophe geführt. Tatsächlich ließen sich vom Standpunkt der Interessen des nationalen Kapitals die Ereignisse im Iran – nicht einmal illusorisch – rational erklären. Am deutlichsten wird dies durch die Machtergreifung der Geistlichen veranschaulicht, einer Gesellschaftsschicht, die niemals eine Kompetenz im Management der wirtschaftlichen oder politischen Angelegenheiten besessen hatte. Der Aufstieg des islamischen Integrationismus und sein Sieg in einem verhältnismäßig wichtigen Land sind Lehrbeispiele für die Zerfallsphase und sind seitdem durch die Entwicklung dieses Phänomens in etlichen anderen Ländern bestätigt worden.
Hier können wir die Entstehung von Phänomenen erblicken, die den klassischen Charakteristiken der kapitalistischen Dekadenz eine qualitative Änderung attestieren.
Historisch obsolet geworden, entwickeln herrschende Klassen stets eine Reihe von Mechanismen und Strukturen, um die Kräfte zu konfrontieren, die ihre Macht untergraben (wachsende Wirtschaftskrisen und militärische Konflikte, die Verwerfungen des Gesellschaftskörpers, der Zerfall der herrschenden Ideologie, etc.). Was die Bourgeoisie betrifft, bestehen diese Mechanismen im Staatskapitalismus, in einer immer totalitäreren Kontrolle der Zivilgesellschaft, in der Unterwerfung der verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie unter die höheren Interessen der Nation, in der Bildung von Militärbündnissen, um der internationalen Konkurrenz zu begegnen, etc.
Solange die Bourgeoisie in der Lage ist, das Gleichgewicht der Klassenkräfte zu beherrschen, können die Ausdrücke des Zerfalls, Kennzeichen einer jeden dekadenten Produktionsweise, in gewisse Grenzen gehalten werden, die mit dem Überleben ihres Systems vereinbar sind. In der Zerfallsphase selbst jedoch bestehen diese Charakteristiken fort und werden von der wachsenden allgemeinen Krise verschärft, während die Unfähigkeit der herrschenden Klasse, ihre Lösung durchzusetzen, und der Arbeiterklasse, ihre eigenen Perspektiven aufzustellen, das Feld allen Arten gesellschaftlicher und politischer Auflösungserscheinungen überlässt – bis hin zur Explosion des Jeder-gegen-Jeden: „Elemente des Zerfalls können in allen dekadenten Gesellschaften gefunden werden: die Verwerfungen des Gesellschaftskörpers, das Dahinrotten ihrer politischen, ökonomischen und ideologischen Strukturen, etc. Dasselbe traf seit dem Beginn seiner dekadenten Epoche auf den Kapitalismus zu (...) in einer historischen Situation, in der die Arbeiterklasse noch nicht in der Lage ist, in den Kampf um die eigenen Interessen und um die einzig ‚realistische‘ Perspektive – die kommunistische Revolution – zu treten, wo aber auch die herrschende Klasse nicht imstande ist, auch nur den Hauch einer Perspektive für sich selbst zu verschaffen, selbst kurzfristig nicht, hilft die frühere Fähigkeit der Letzteren während der Dekadenzperiode, das Phänomen des Zerfalls zu begrenzen und zu kontrollieren, nicht mehr weiter, sondern fällt unter den wiederholten Schlägen der Krise in sich zusammen.“ (ebenda siehe Fussnote 4)
Die Geschichte zeigt, dass die Gesellschaft, wenn sie in ihren eigenen Widersprüchen verfangen ist, ohne sie lösen zu können, in ein wachsendes Chaos, in endlose Kämpfe zwischen Warlords stürzt. Das Bild des Zerfalls ist voll von wachsendem Chaos und Jeder-gegen-Jeden. Einer der Hauptausdrücke des Zerfalls des Kapitalismus zeigt sich in der wachsenden Unfähigkeit der Bourgeoisie, die politische Lage der verschiedensten Art zu kontrollieren: bei der Disziplin unter ihren verschiedenen imperialistischen Fraktionen, bei der Zügelung ihres imperialistischen Heißhungers, etc. Die Unfähigkeit der kapitalistischen Produktionsweise, der Gesellschaft auch nur die leiseste Perspektive anzubieten, führt unvermeidlich zu wachsendem, allgemeinem Chaos.
Ende der 80er Jahre sollte sich diese Diagnose auf spektakulärste Weise bestätigen. Die Auflösung des Ostblocks und der UdSSR, der Tod des Stalinismus, die Auflösung Russlands selbst, dem kurz darauf der Golfkrieg folgte, verliehen diesen Charakteristiken einer zerfallenden Produktionsweise unmissverständlich Ausdruck: die Explosion des „Jeder-für-sich-selbst“, die Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und wachsendes Chaos.
In diesem Zusammenhang müssen wir die Reorientierung der europäischen Politik während der 1990er Jahre sehen. Die bis dahin im Wesentlichen ökonomische Ausrichtung schlug nach dem Fall der Berliner Mauer im Dezember 1989 eine deutlich politischere Richtung ein; der Gipfel von Straßburg beschleunigte den Prozess der Etablierung des Euros und lud die osteuropäischen Länder an den Verhandlungstisch. Zu diesem Zeitpunkt war es beschlossene Sache, dass künftig neue Mitglieder integriert werden würden, und die materiellen Mittel, um dies zu erreichen, führten im Mai 1980 zur Bildung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBAE), zu Investitionen in mannigfaltigen Bereichen, zu Kooperationsprogrammen, etc. Der im Wesentlichen geostrategische Charakter dieser Erweiterung Europas in Richtung Osten wurde durch die Tatsache demonstriert, dass der wirtschaftliche Nutzeffekt sich als nichtexistent oder gar negativ erweisen sollte, wie zum Beispiel die Integration Ostdeutschlands in die Bundesrepublik. Das durchschnittliche Bruttosozialprodukt pro Einwohner in den zehn Kanididaten-Ländern ist nicht einmal halb so groß wie in den 13 EU-Staaten. Die Handelsbeziehungen sind zutiefst asymmetrisch. Während 70% der Exporte der ost- und mitteleuropäischen Länder in die Europäische Union gehen, können Erstere nur 4–5% der Exporte Letzterer für sich verbuchen. Während die östlichen Länder sich in einer empfindlichen Abhängigkeit von der Wirtschaftslage Westeuropas befinden, ist dies umgekehrt nicht der Fall. Ein weiteres Element ihrer Verwundbarkeit rührt aus der Tatsache, dass es ein strukturelles Handelsdefizit in sämtlichen ost- und mitteleuropäischen Ländern gibt, was sie vom Zufluss fremden Kapitals abhängig macht. Die Beschäftigungsquote ist seit 1990 in dieser Region um 20% gesunken, und viele Länder sind noch immer in ernsten ökonomischen Problemen verstrickt.
Die wahren Gründe für die Integration der neuen Kandidaten in die EU sind woanders zu suchen. Der erste Grund ist klar imperialistisch. Was ansteht, ist der Ausverkauf der Überbleibsel des ehemaligen Ostblocks. Der zweite ergibt sich aus den Konsequenzen des Zerfalls selbst: Für die EU ist es lebenswichtig, eine relativ stabile Pufferzone an ihren östlichen Grenzen zu installieren, um sich nicht vom wirtschaftlichen und sozialen Chaos anstecken zu lassen, das von der Auflösung des Ostblocks ausgeht. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, ist es wichtig, dass die wichtigeren der neuen Mitgliedsländer wirtschaftlich am stärksten und geographisch Westeuropa am nächsten sind (Polen, Tschechien, Slowakei und Slowenien), während die drei baltischen Länder (Estland, Lettland und Litauen) den Zugang Russlands zur Ostsee einschränken. Im Endeffekt ist die EU-Politik gegenüber Osteuropa das Ergebnis der überragenden Stellung der imperialistischen Ziele. Einerseits wetteifert die EU, mit Deutschland an der Spitze, mit den Vereinigten Staaten um das Eigentum der Überbleibsel des alten Ostblocks. Das Ziel der Europäischen Union ist es, so viel ost- und mitteleuropäische Länder wie möglich unter ihren Einflussbereich zu bringen, möglichst einschließlich Russlands, das trotz seiner Anlehnung an Amerika heute Deutschland zum Haupthandelspartner hat. Frankreich auf der anderen Seiten ist ebenfalls an einer Expansion der EU in den Osten interessiert, wenn sie von der EU, und nicht von einem unabhängigen Deutschland, das seine alten Vorkriegsreflexe wiederentdeckt, ausgeführt wird. Deutschland ist seinerseits bereit, diese Strategie zu akzeptieren, weil es dadurch die Betreibung seiner imperialistischen Ambitionen bedeckt halten kann, eingedenk dessen, dass es noch nicht bereit ist, offen die Führungsrolle eines neuen imperialistischen Blocks als Widerpart der Vereinigten Staaten anzunehmen.
Die Bedeutung des Euro
Die Zerfallsphase und der Zusammenbruch der imperialistischen Blöcke sind der Rahmen zum Verständnis für die Schaffung einer einzigen Währung. Sie hat vier Grundlagen:
1) Die erste ist geostrategischer und imperialistischer Natur. Die französische und deutsche Bourgeoisie ist daran interessiert zu verhindern, dass die deutsch-französische Allianz unter dem Druck divergierender imperialistischer Interessen zusammenbricht. Einerseits befürchten die Franzosen, dass ein vereinigtes Deutschland zu einem Expansionsfeld im Osten gelangt, während Frankreich dem nichts entgegensetzen kann. Frankreich ist es gelungen, sicher zu stellen, dass die osteuropäische Währung nicht die Deutsche Mark ist, was dazu geführt hätte, Frankreich wirtschaftlich aus dieser Zone auszuschließen. Andererseits war es die Politik Deutschlands seit 1989 gewesen, unter dem Mantel der EU zu verbleiben, um seine eigenen imperialistischen Interessen zu verbergen. Es hat daher ein großes Interesse daran, Frankreich und andere, zweitrangige europäische Länder an seine Expansionspolitik zu binden. Es ist schon banal, darauf hinzuweisen, dass Mitglieder der deutschen Bourgeoisie geäußert haben, dass „Deutschland heute wirtschaftlich das erreicht hat, was Hitler mit dem Krieg erreichen wollte“!
2) Die zweite Grundlage ist die Notwendigkeit, sich den zerstörerischen Kräften der Krise zu widersetzen, die durch Phänomene wesentlich vergrößert wurden, welche eine Besonderheit der Zerfallsphase sind. Durch die Installierung des Euro machte die EU der Destabilisierung durch Währungsspekulationen ein Ende, unter der sie schon etliche Male in der Vergangenheit gelitten hatte (Spekulationen gegen die Lire, der erzwungene Austritt des englischen Pfunds aus dem EWS, etc.). Schon die Installierung des EWS (Europäisches Währungssystem) 1979 war ein Versuch, eine Währungsschlange zu bilden, die stabiler gegenüber dem Dollar und dem Yen sein sollte, und so die EU besser von der monetären Anarchie abzuschirmen, die mittlerweile besonders in den Ländern an der Peripherie des Kapitalismus Schäden verursacht hatte. Dies ist einer der Hauptunterschiede zur Krise von 1929, unter der zunächst die Vereinigten Staaten und daraufhin die europäischen Länder gelitten hatten. Obwohl die Wurzeln der Überproduktionskrisen sowohl in den 30er Jahren als auch heute in den entwickelten kapitalistischen Ländern liegen, ist es in der gegenwärtigen Krise den Letzteren gelungen, die Hauptauswirkungen der Krise bis jetzt in die Peripherie abzulenken. Während auf der Ebene der interimperialistischen Spannungen ihre zentrifugalen Kräfte sich jederlei Art von Disziplin entzogen haben, ist die Bourgeoisie auf der ökonomischen Ebene noch zu einem Minimum an Zusammenarbeit fähig, worin die eigentliche Essenz ihrer Herrschaft als eine Klasse zum Ausdruck kommt: die Gewinnung von Mehrarbeit. So war, im Gegensatz zu den 30er Jahren, die herrschende Klasse im Wirtschaftsbereich in der Lage, ihre Bemühungen zu koordinieren, um wiederholte Marktzusammenbrüche moderat zu gestalten und die zerstörerischsten Auswirkungen der Krise und des Zerfalls einzuschränken.
3) Die dritte Grundlage ist sowohl wirtschaftlicher als auch imperialistischer Natur. Alle europäischen Bourgeoisien wollen ein starkes Europa, das imstande ist, der internationalen und besonders der amerikanischen sowie japanischen Konkurrenz Paroli zu bieten. Dieses Bedürfnis wird um so heftiger verspürt, als dass die europäischen Länder die Ambition haben, die Nationen Osteuropas einschließlich Russland in ihren Einflussbereich zu holen, was weitaus schwieriger wäre, wenn ihre Ökonomie dollarisiert wird.
4) Der dritte Grund ist rein technischer Art: die Eliminierung der Kosten für den Devisenaustausch innerhalb Euroland und der mit dem Floaten der Austauschraten verknüpften Unsicherheit (einschließlich der Kosten, die das Devisensicherungsgeschäft mit sich bringt). Da der größte Teil des Handels der europäischen Länder innerhalb der EU abgewickelt wird, ließ das Beharren auf verschiedene nationale Währungen im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und Japan die Produktionskosten steigen. Eine einzige Währung war in diesem Sinn eine natürliche Folgerung aus der ökonomischen Integration. Es gab immer weniger wirtschaftliche Argumente, um in einem Markt, in dem Steuern und Handelsregeln größtenteils vereinheitlicht sind, an verschiedenen nationalen Währungen festzuhalten.
Europa – die Basis für einen neuenimperialistischen Block?
Als Vorposten des amerikanischen imperialistischen Blocks in Europa gegründet, wurde die EWG immer mehr zu einer ökonomischen Einheit in Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten. Politisch jedoch blieb sie in der Periode des Kalten Kriegs und bis zum Fall der Berliner Mauer von Letzteren dominiert. Mit dem Verschwinden der beiden imperialistischen Blöcke 1989 fand sich Europa erneut mitten im Zentrum imperialistischer Begierden. Seither haben die Gestaltung und die geostrategischen Interessen der verschiedenen imperialistischen Mächte paradoxerweise nicht in Richtung einer Auflösung, sondern einer größeren Integration Europas gedrängt!
Auf der ökonomischen Ebene unterstützen sämtliche europäischen Bourgeoisien das Projekt eines großen, einheitlichen Marktes, um mit den Amerikanern und Japanern zu konkurrieren. Doch in Fragen ihrer imperialistischen Interessen haben wir gesehen, wie jede der drei Großmächte Europas ihre Karte gegen die beiden anderen ausspielt. Und schließlich ermuntern selbst die Amerikaner die EU zur Erweiterung, wohl wissend, dass, je mehr heterogene Bestandteile und imperialistische Orientierungen in die EU integriert werden, desto weniger die EU in der Lage sein wird, irgendeine wichtige Rolle auf der internationalen Bühne zu spielen.
Ein genauerer Blick erspart uns Illusionen über die Fortsetzung der europäischen Integration heute. Jeder Teilnehmer in diesem Prozess nimmt nur infolge seines eigenen temporären imperialistischen Interesses und Kalküls teil. Der Konsens zugunsten einer Erweiterung der Europäischen Union ist in seiner Struktur zerbrechlich, denn er basiert auf heterogenen und divergierenden Grundlagen, die nur infolge einer Änderung in den Konstellationen des internationalen Kräftegleichgewichts zu Stande gekommen waren. Keine der Grundlagen für die Existenz der EU rechtfertigt heute die Schlussfolgerung, dass es bereits Formen eines mit dem amerikanischen Block rivalisierenden neuen imperialistischen Blocks gäbe. Worin bestehen die Hauptgründe, die zu dieser Schlussfolgerung führen?
1) Anders als eine wirtschaftliche Koordinierung, die auf einem Vertrag zwischen souveränen Bourgeoisien beruht, wie heute in der EU, ist ein imperialistischer Block eine Zwangsjacke, der einer Gruppe von Staaten durch die militärische Überlegenheit eines Landes aufgezwängt und nur aufgrund des gemeinsamen Wunsches akzeptiert wird, einer anderen Gefahr zu widerstehen oder ein feindliches Militärbündnis zu zerstören. Die Blöcke im Kalten Krieg erschienen nicht als Resultat langwieriger Verhandlungen und Übereinkünfte, wie die Europäische Union: Sie waren das Resultat des militärischen Kräfteverhältnisses, das auf dem Boden der Niederlage Deutschlands etabliert worden war. Der westliche Block wurde geboren, weil Westeuropa und Japan von den Vereinigten Staaten besetzt worden war, während der Ostblock nach der Okkupation Osteuropas durch die Rote Armee ins Leben gerufen worden war. Genausowenig kollabierte der Ostblock wegen irgendwelcher Änderungen seiner wirtschaftlichen Interessen oder seiner Wirtschaftsbündnisse, sondern weil sein Anführer, der den Zusammenhalt des Blocks durch seine Streitkräfte sicherte, nicht mehr in der Lage war, seine Autorität mit Panzern aufrechtzuerhalten, wie er es während des ungarischen Aufstandes 1956 oder in der Tschechoslowakei 1968 getan hatte. Der westliche Block schied einfach deswegen dahin, weil sein gemeinsamer Feind und damit alles, was ihn zusammengehalten hat, verschwunden war. Ein imperialistischer Block ist stets ein Zweckbündnis, niemals eine Liebesheirat. Wie Winston Churchill einst schrieb, sind militärische Allianzen nicht das Ergebnis der Liebe, sondern der Angst: die Angst vor einem gemeinsamen Feind.
2) Noch fundamentaler ist, dass Europa historisch nie einen homogenen Block gebildet hatte und stets von konfliktträchtigen Begierden zerrissen wurde. Europa und Amerika sind die beiden Zentren des Weltkapitalismus. Die USA als vorherrschende Macht in Nordamerika war durch ihre kontinentalen Dimensionen, durch ihre Lage, die potenzielle Feinde in Europa und Asien auf sicherem Abstand hielt, und durch ihre ökonomische Stärke dazu bestimmt, zur führenden Macht in der Welt zu werden. Wie wir 1999 schrieben:
„Seine ökonomische und strategische Stellung hat im Gegensatz dazu Europa dazu verdammt, zum hauptsächlichen Brennpunkt imperialistischer Spannungen im dekadenten Kapitalismus zu werden. Als Hauptschlachtfeld in beiden Weltkriegen und als der Kontinent, der im Kalten Krieg durch den ‚Eisernen Vorhang‘ geteilt worden war, hatte Europa nie eine Einheit gebildet, und im Kapitalismus wird es diese auch nie erreichen.
Wegen seiner historischen Rolle als Geburtsort des modernen Kapitalismus und seiner geographischen Lage als Halbkontinent von Asien gegenüber Nordafrika war Europa im 20. Jahrhundert zum Schlüssel des imperialistischen Ringens um die Weltherrschaft geworden. Gleichzeitig ist Europa, nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage, militärisch besonders schwierig zu beherrschen. Großbritannien musste selbst zu jenen Zeiten, als es noch ‚die Weltmeere beherrschte‘, zu einem komplizierten System des ‚Kräftegleichgewichts‘ greifen, um Europa in Schach zu halten. Was Deutschland unter Hitler angeht, so war selbst 1941 seine Vorherrschaft über den Kontinent mehr äußerlich als real, solange Großbritannien, Russland und Nordafrika sich in Feindeshand befanden. Selbst den Vereinigten Staaten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges gelang es nie, mehr als die Hälfte des Kontinents zu beherrschen.
Die Ironie will es, dass seit ihrem ‚Sieg‘ über die UdSSR die Position der Vereinigten Staaten in Europa mit dem Verschwinden des ‚Reichs des Bösen‘ beträchtlich geschwächt worden war. Obgleich die einzige Supermacht der Welt eine enorme militärische Präsenz in der Alten Welt aufrechterhält, ist Europa nicht ein unterentwickeltes Gebiet, das von einer Handvoll GI-Kasernen in Schach gehalten werden kann: Vier der führenden G8-Industrieländer sind europäisch (...) wenn Europa heute das Zentrum der imperialistischen Spannungen ist, so vor allem deswegen, weil die Hauptmächte Europas selbst unterschiedliche militärische Interessen haben. Wir sollten dabei nicht vergessen, dass beide Weltkriege vor allem als Kriege zwischen den europäischen Mächten begannen – so wie die Balkankriege der 1990er Jahre.“ (Bericht über die imperialistischen Konflikte für den 13. Kongress der IKS, Internationale Revue Nr 24)
3) Der Marxismus hat bereits aufgezeigt, dass interimperialistische Konflikte nicht notwendigerweise identisch sind mit Wirtschaftsinteressen. Während in den beiden Weltkriegen sich in der Tat zwei Pole gegenüberstanden, die die wirtschaftliche Hegemonie für sich beanspruchten, war dies im Kalten Krieg nicht mehr der Fall, als der westliche Block alle großen Wirtschaftsmächte um sich scharte gegen den wirtschaftlichen schwachen Ostblock, dessen ganze Stärke auf der Atommacht der UdSSR beruhte. Euroland ist eine perfekte Illustrierung der Tatsache, dass die imperialistischen strategischen Interessen und die Welthandelsinteressen der Nationalstaaten nicht identisch sind. Frankreich und Deutschland, die beiden Nationen, die die Triebkraft der EU darstellen, sind dreimal in den letzten 150 Jahren gegeneinander in den Krieg gezogen, während seit Napoleons Zeiten Großbritannien stets versucht hat, die Spaltungen Kontinentaleuropas aufrechtzuerhalten. „Die Volkswirtschaft der Niederlande zum Beispiel ist vom Weltmarkt im Allgemeinen und von der deutschen Wirtschaft im Besonderen äußerst abhängig. Daher ist dieses Land einer der leidenschaftlichsten Anhänger der deutschen Politik für eine gemeinsame Währung gewesen. Auf imperialistischer Ebene jedoch widersetzt sich die holländische Bourgeoisie gerade wegen ihrer geographischen Nähe zu Deutschland den Interessen ihres mächtigen Nachbarn, wo immer sie kann, und stellt einen der loyalsten Verbündeten der USA in der ‚Alten Welt‘ dar. Wenn der Euro zuallererst ein Eckpfeiler eines künftigen deutschen Blocks wäre, so wäre Den Haag der erste, der sich dem widersetzen würde. Doch in Wirklichkeit unterstützen Holland, Frankreich und andere Länder, die sich vor einer imperialistischen Wiederauferstehung Deutschlands fürchten, die gemeinsame Währung, gerade weil sie nicht ihre nationale Sicherheit, d.h. ihre militärische Souveränität, beeinträchtigt.“ (ebenda) Angesichts der imperialistischen Rivalitäten zwischen den europäischen Ländern selbst und auch in Anbetracht der Tatsache, dass Europa heute sich im eigentlichen Herzen der interimperialistischen Spannungen des Planeten befindet, ist es wenig realistisch anzunehmen, dass wirtschaftliche Interessen allein die europäischen Länder zusammenschweißen können. Dies ist um so mehr ausgeschlossen, als Europa, auch wenn es auf ökonomischer Ebene integriert ist, auf politischer Ebene weit davon entfernt ist, geschweige denn auf militärischer Ebene oder in der Außenpolitik. Wie können wir annehmen, dass Euroland bereits ein imperialistischer Block ist, der mit den Vereinigten Staaten rivalisiert, wenn es nicht einmal zwei wesentlichen Eigenschaften eines imperialistischen Blocks besitzt: eine Armee und eine imperialistische Strategie. Diese Tatsachen demonstrieren täglich, dass ein vereintes Europa eine Utopie ist, was wir insbesondere im Dissens unter seinen Mitgliedsländern und in der Unfähigkeit sehen können, die Regelung internationaler Konflikte zu beeinflussen, selbst wenn diese vor der eigenen Tür, wie in Jugoslawien, stattfinden.
Fritz
Fußnoten:
1 s. unsere Broschüre „Nation oder Klasse“
2 eigene Übersetzung
3 eigene Übersetzung
4 eigene Übersetzung
5 s. unsere Thesen in „Der Zerfall – die letzte Phase des Kapitalismus“ in Internationale Revue Nr. 13.
Orientierungstext: Das Vertrauen und die Solidarität im Kampf des Proletariats (1. Teil)
- 2894 Aufrufe
Non ridere, non lugere, neque detestari sed intelligere.“ (Lache nicht, weine nicht und fluche nicht – verstehe).Spinoza: Ethik
Die gegenwärtige Debatte in der IKS über die Fragen der Solidarität und des Vertrauens begann 1999/2000 im Zuge einer Antwort auf eine Reihe von Schwächen in diesen zentralen Fragen innerhalb unserer Organisation. Hinter dem konkreten Versagen, Solidarität gegenüber in Schwierigkeiten geratenen Genossen zu manifestieren, wurde eine tiefer liegende Schwierigkeit identifiziert, ein permanentes Verhalten der alltäglichen Solidarität zwischen unseren Militanten zu entwickeln. Hinter den wiederholten Manifestationen des Immediatismus in der Analyse und Intervention bezüglich des Klassenkampfes (insbesondere die Weigerung, das volle Ausmaß des Rückschlags nach 1989 anzuerkennen) und einer deutlichen Neigung, uns mit „unmittelbaren Beweisen“ zu trösten, die angeblich den historischen Kurs bestätigen, entdeckten wir einen fundamentalen Mangel an Vertrauen in das Proletariat und in den Rahmen unserer Analyse. Hinter dem Schaden, der in unserem Organisationsgewebe angerichtet wurde und der sich besonders in RI zu konkretisieren begann, erkannten wir einen Mangel an Vertrauen zwischen verschiedenen Teilen und sMitgliedern der Organisation und in unsere eigene Funktionsweise.
In der Tat war es die Tatsache, dass wir von verschiedenen Manifestationen des Vertrauensmangels in unsere grundlegenden Positionen, in unsere Organisationsprinzipien und zwischen Genossen und Organen konfrontiert wurden, die uns dazu zwang, über die einzelnen Fälle hinauszugehen und diese Fragen in einem allgemeineren, fundamentaleren und somit theoretischeren Zusammenhang zu stellen.
Noch spezifischer, das Wiederauftreten des Clanwesens2 im Herzen der Organisation erfordert eine Vertiefung unseres Verständnisses dieser Fragen. Wie die Aktivitätsresolution des 14. Kongresses der IKS sagt:
„Der Kampf der 90er Jahre war notgedrungen ein Kampf gegen den Zirkelgeist und die Clans. Doch wie wir damals bereits gesagt hatten, waren die Clans die falsche Antwort auf ein reales Problem: jenes der Schwäche des proletarischen Vertrauens und der Solidarität innerhalb unserer Organisation. Daher löste die Abschaffung des existierenden Clans nicht automatisch das Problem der Schaffung eines Parteigeistes und einer wahren Brüderlichkeit in unseren Reihen, das nur das Ergebnis tiefgehender, bewusster Bemühungen sein kann. Obwohl wir damals darauf bestanden, dass der Kampf gegen den Zirkelgeist permanent ist, hielt sich die Idee aufrecht, dass, wie zurzeit der Ersten und Zweiten Internationalen, das Problem hauptsächlich mit einer Phase der Unreife verknüpft ist, die überwunden und hinter uns gelassen werde. In Wahrheit ist das Problem des Zirkelgeistes und Clanwesens heute permanenter und hinterhältiger als zu Zeiten des Kampfes von Marx gegen den Bakunismus oder von Lenin gegen den Menschewismus. Tatsächlich gibt es eine Parallele zwischen den gegenwärtigen Schwierigkeiten der Klasse als Ganzes, ihre Klassenidentität wiederzuerlangen und die elementaren Klassenreflexe der Solidarität mit anderen Arbeitern und jener der revolutionären Organisation wiederzuentdecken, um im alltäglichen Funktionieren einen Parteigeist aufrechtzuerhalten. In diesem Sinn hat die Organisation, indem sie die Fragen des Vertrauens und der Solidarität als zentrale Fragen der Periode stellte, begonnen, an dem Kampf von 1993 wieder anzuknüpfen und ihm eine ‚positive‘ Dimension beizufügen, um sich noch stärker gegen das Eindringen kleinbürgerlicher Abwege der Organisation zu wappnen.“
In diesem Sinn betrifft die aktuelle Debatte direkt die Verteidigung, ja, sogar das Überleben der Organisation. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, um so mehr alle theoretischen und historischen Zusammenhänge dieser Fragen zu entwickeln. So gibt es in Bezug auf die organisatorischen Probleme, mit denen wir es heute zu tun haben, zwei wesentliche Ansatzpunkte. Die Enthüllung der organisatorischen Schwächen und des Unverständnisses, die das Wiederaufleben des Clanwesens ermöglichten, und die konkrete Analyse der Ausbreitung dieser Dynamik ist die Aufgabe des Berichts, den die Untersuchungskommission3 präsentieren wird. Die Aufgabe diese Orientierungstextes besteht dagegen im Wesentlichen darin, einen theoretischen Rahmen zu erstellen, der ein tieferes historisches Verständnis und eine Lösung dieser Probleme ermöglicht.
In der Tat ist es wichtig zu verstehen, dass die Auseinandersetzung um den Parteigeist notgedrungen eine historische Dimension hat. Gerade die Dürftigkeit der Debatte über Vertrauen und Solidarität bis dato war ein Hauptfaktor bei der Ermöglichung des Clanwesens gewesen. Allein der Umstand, dass solch ein Orientierungstext nicht zu Beginn, sondern ein Jahr nach der Eröffnung dieser Debatte verfasst worden ist, bezeugt die Schwierigkeiten, die die Organisation hatte, um diese Fragen in den Griff zu bekommen. Doch der beste Beweis dieser Schwächen ist die Tatsache, dass die Debatte über Vertrauen und Solidarität von einer unerhörten Auszehrung der vertrauensvollen und solidarischen Bindungen zwischen den Genossen begleitet wurde!
In der Tat sehen wir uns mit fundamentalen Fragen des Marxismus konfrontiert, die die eigentliche Grundlage unseres Verständnisses der Natur der proletarischen Revolution bilden und die ein integraler Bestandteil der Plattform und Statuten der IKS sind. In diesem Sinn erinnert uns die Dürftigkeit der Debatte daran, dass die Gefahr der theoretischen Verkümmerung und Sklerose einer revolutionären Organisation stets präsent ist.
Die zentrale These dieses Orientierungstextes ist die, dass die Schwierigkeit, Vertrauen und Solidarität tiefer in die IKS zu verwurzeln, ein fundamentales Problem in der gesamten Geschichte der IKS gewesen ist. Diese Schwäche ist ihrerseits das Resultat wesentlicher Merkmale der historischen Periode seit 1968. Es ist eine Schwäche nicht nur der IKS, sondern der gesamten Generation des betroffenen Proletariats. Wie die Resolution des 14. Kongresses sagte:
„Es ist eine Debatte, die das tiefste Nachdenken der gesamten IKS erfordert, da sie das Potenzial hat, unser Verständnis nicht nur für den Aufbau einer Organisation mit einem wahrhaft proletarischen Leben, sondern auch für die historische Periode, in der wir leben, zu vertiefen.“
In diesem Sinn geht die auf dem Spiel stehende Frage über die Organisationsfrage als solche hinaus. Insbesondere die Frage des Vertrauens tangiert alle Aspekte im Leben des Proletariats und in der Arbeit der Revolutionäre – so wie der Verlust an Vertrauen in die Klasse sich selbst gleichermaßen in der Abschaffung der programmatischen und theoretischen Errungenschaften manifestiert.
1. Die Auswirkungen der Konterrevolution auf das Selbstvertrauen und die Tradition der Solidarität der heutigen Generationendes Proletariats
a) In der Geschichte der marxistischen Bewegung finden wir keinen einzigen fundamentalen Text, der über das Vertrauen wie über die Solidarität verfasst worden ist. Auf der anderen Seite stehen diese Fragen im Zentrum der grundlegendsten Beiträge des Marxismus, von der Deutschen Ideologie und dem Kommunistischen Manifest bis hin zu Sozialreform oder Revolution und Staat und Revolution. Das Fehlen einer spezifischen Diskussion über diese Fragen in der Arbeiterbewegung der Vergangenheit ist kein Anzeichen für ihre relative Unwichtigkeit. Ganz das Gegenteil. Diese Fragen waren so fundamental und selbstverständlich, dass sie nie für sich selbst gestellt wurden, sondern stets in Antwort auf andere Probleme.
Wenn wir heute dazu gezwungen sind, diesen Fragen eine besondere Debatte und eine theoretische Untersuchung zu widmen, so deshalb, weil sie ihre „Selbstverständlichkeit“ verloren haben.
Dies ist das Resultat der Konterrevolution, die in den 1920er-Jahren begann, und des Bruchs in der organischen Kontinuität, die sie verursachte. Aus diesem Grund ist es hinsichtlich der Schaffung von Vertrauen und lebendiger Solidarität innerhalb der Arbeiterbewegung notwendig, zwei Phasen in der Geschichte des Proletariats zu unterscheiden. Während der ersten Phase, die vom Beginn seiner Selbstbehauptung als autonome Klasse bis zur revolutionären Welle 1917–23 reichte, war die Arbeiterklasse trotz einer Reihe von oftmals blutigen Niederlagen in der Lage, mehr oder weniger kontinuierlich ihr Selbstvertrauen und ihre politische und gesellschaftliche Einheit zu formen. Die wichtigsten Manifestationen dieser Fähigkeit waren, in Ergänzung zum Arbeiterkampf selbst, die Entwicklung einer sozialistischen Vision, einer theoretischen Kapazität, einer politischen revolutionären Organisation. All dies, das Werk von Jahrzehnten und Generationen, wurde von der Konterrevolution unterbrochen und gar in sein Gegenteil verkehrt. Nur winzige revolutionäre Minderheiten waren imstande, ihr Vertrauen in das Proletariat in den folgenden Jahrzehnten aufrechtzuerhalten. 1968, mit dem Ende der Konterrevolution, begann sich diese Tendenz erneut umzukehren. Jedoch blieben die neuen Ausdrücke des Selbstvertrauens und der Klassensolidarität durch diese neue und ungeschlagene proletarische Generation in den immediatistischen Kämpfen verwurzelt. Sie beruhten nicht im gleichen Maße wie vor der Konterrevolution auf eine sozialistische Vision, auf die politische Erschaffung einer Klassentheorie und auf das Weiterreichen angesammelter Erfahrung und Kenntnisse von einer Generation an die nächste. Mit anderen Worten, das historische Selbstvertrauen des Proletariats und seine Traditionen der aktiven Einheit und kollektiven Auseinandersetzung gehören zu den Aspekten seiner Auseinandersetzung, die am meisten durch den Bruch in der organischen Kontinuität gelitten haben. Zudem gehören sie zu den schwierigsten Aspekten, die es wiederherzustellen gilt, da sie mehr als viele andere von einer lebenden politischen und sozialen Kontinuität abhängen. Dies erhöht umgekehrt die besondere Verwundbarkeit der neuen Generationen der Klasse und ihrer revolutionären Minderheiten.
In erster Linie war es die stalinistische Konterrevolution, die dazu beitrug, das Vertrauen des Proletariats in seine eigene historische Mission, in die marxistische Theorie und in seine revolutionären Minderheiten zu unterminieren. Infolgedessen neigt das Proletariat nach 1968 mehr als vergangene unbesiegte Generationen der Klasse dazu, unter dem Gewicht des Immediatismus, des Fehlens einer langfristigen Vision zu leiden. Indem sie ihm große Teile seiner Vergangenheit raubte, hielt und hält die Konterrevolution und die heutige Bourgeoisie dem Proletariat eine klare Vision seiner Zukunft vor, ohne die die Klasse kein tiefer gehendes Vertrauen in ihre eigene Kraft entwickeln kann.
Was das Proletariat von jeder anderen Klasse in der Geschichte unterscheidet, ist die Tatsache, dass es vom ersten Tag seiner Entstehung als eine unabhängige, gesellschaftliche Kraft sein eigenes Projekt einer zukünftigen Gesellschaft vorstellte, das auf dem gemeinsamen Eigentum der Produktionsmittel basiert. Als erste Klasse in der Geschichte, deren Ausbeutung auf der radikalen Trennung des Produzenten von den Produktionsmitteln und auf der Ersetzung der individuellen durch die gesellschaftliche Arbeitskraft beruht, wird sein Befreiungskampf durch die Tatsache gekennzeichnet, dass der Kampf gegen die Folgen der Ausbeutung (der allen ausgebeuteten Klassen gemeinsam ist) stets mit der Entwicklung einer Vision der Überwindung der Ausbeutung verknüpft gewesen war. Die erste kollektiv produzierende Klasse in der Geschichte, das Proletariat, ist dazu aufgerufen, die Gesellschaft auf einer bewussten Grundlage neu zu schaffen. Da es als eigentumslose Klasse nicht in der Lage ist, irgendeine Macht in der herrschenden Gesellschaft zu erringen, liegt die historische Bedeutung seines Klassenkampfes gegen die Ausbeutung darin, sich selbst und somit der Gesellschaft im Ganzen das Geheimnis seiner eigenen Existenz als Totengräber der kapitalistischen Anarchie zu offenbaren.
Aus diesem Grund ist die Arbeiterklasse die erste Klasse, deren Vertrauen in die eigene historische Rolle untrennbar verbunden ist mit ihrer eigenen Lösung der Krise der kapitalistischen Gesellschaft.
Diese einmalige Stellung als die einzige Klasse in der Geschichte, die gleichzeitig ausgebeutet und revolutionär ist, hat zwei wichtige Konsequenzen:
– ihr Vertrauen in sich selbst ist vor allem ein Vertrauen in die Zukunft und beruht daher in besonderem Maße auf eine theoretische Vorgehensweise;
– sie entwickelt in ihren Tageskämpfen ein Prinzip, das ihrer historischen Aufgabe, die es zu erfüllen gilt, entspricht – das Prinzip der Klassensolidarität, Ausdruck ihrer Einheit.
In diesem Sinn besteht die Dialektik der proletarischen Revolution im Wesentlichen in der Dialektik des Verhältnisses zwischen dem Ziel und der Bewegung, zwischen dem Kampf gegen die Ausbeutung und dem Kampf für den Kommunismus. Die natürliche Unreife der ersten Gehversuche der Klasse auf der historischen Ebene zeichnet sich durch eine Parallele zwischen der Entwicklung des Arbeiterkampfes und der Theorie des Kommunismus aus. Die Verknüpfung zwischen diesen beiden Polen war anfangs von den Beteiligten selbst noch nicht wirklich verstanden worden. Dies wurde in dem oft blinden und instinktiven Charakter der Arbeiterkämpfe einerseits und im Utopismus des sozialistischen Projektes andererseits widergespiegelt.
Erst die historische Reifung des Proletariats brachte diese beiden Elemente zusammen, konkretisiert durch die Revolution 1848–49 und vor allem durch die Geburt des Marxismus, des wissenschaftlichen Verständnisses der historischen Bewegung und des Ziels der Klasse.
Zwei Jahrzehnte später enthüllte die Pariser Kommune, das Produkt dieser Reifung, den Inhalt des Vertrauens des Proletariats in seine Rolle, seines Strebens nach Übernahme der Führung in der Gesellschaft, um sie in Übereinstimmung mit seiner eigenen politischen Vision umzuwandeln.
Worin liegt der Ursprung dieses erstaunlichen Selbstvertrauens einer mit Füßen getretenen und enteigneten Klasse, die all das Elend der Menschheit in ihren Reihen konzentriert – ein Selbstvertrauen, das bereits 1870 offenbar wurde? Wie der Kampf aller ausgebeuteten Klassen hat der Kampf des Proletariats einen spontanen Aspekt. Das Proletariat ist dazu verurteilt, darauf zu reagieren, was die dominierende Gesellschaft ihm aufzwingt. Doch im Gegensatz zum Kampf aller anderen ausgebeuteten Klassen besitzt der Kampf des Proletariats vor allem einen bewussten Charakter. Die Fortschritte seines Kampfes sind in erster Linie das Produkt seines eigenen politischen Reifungsprozesses. Das Proletariat von Paris war eine politisch gebildete Klasse, die durch verschiedene Schulen des Sozialismus, vom Blanquismus bis hin zum Proudhonismus, gegangen war. Es war diese politische Gestaltung in den darauffolgenden Jahrzehnten, die zu einem großen Umfang die Fähigkeit der Klasse erklärt, die herrschende Ordnung auf diese Weise herauszufordern (ebenso wie sie die Unzulänglichkeiten dieser Bewegung erklärt). Gleichzeitig war 1870 auch das Resultat der Entwicklung einer bewussten Tradition der internationalen Solidarität, welche alle wichtige Arbeiterkämpfe in den 1860er Jahren in Westeuropa auszeichnete.
Anders ausgedrückt, war die Kommune das Produkt einer unterirdischen Reifung, die besonders durch ein größeres Vertrauen in die historische Mission der Klasse und durch eine ausgebildetere Praxis der Klassensolidarität charakterisiert ist.
Mit dem Beginn der Dekadenz wird die zentrale Rolle von Vertrauen und Solidarität hervorgehoben, da die proletarische Revolution auf der historischen Agenda erscheint. Einerseits ist durch die Unmöglichkeit einer organisierten Vorbereitung der Kämpfe via Massenparteien und Gewerkschaften der spontane Charakter des Arbeiterkampfes ausgeprägter.4 Andererseits wird die politische Vorbereitung dieser Kämpfe durch eine Verstärkung der Klassensolidarität und des Vertrauens noch wichtiger. Die fortgeschrittensten Sektoren des russischen Proletariats, die 1905 die ersten waren, die die Waffe des Massenstreiks und der Arbeiterräte entdeckten, gingen durch die Schule des Marxismus, durch eine Reihe von Phasen: die Phase des Kampfes gegen den Terrorismus, der Bildung von politischen Zirkeln, der ersten Streiks und politischen Demonstrationen, des Kampfes um die Bildung der Klassenpartei und der ersten Erfahrungen mit der Massenagitation. Rosa Luxemburg, die die erste war, die die Rolle der Spontaneität in der Epoche der Massenstreiks begriff, beharrte darauf, dass ohne diese Schule des Sozialismus die Ereignisse von 1905 niemals möglich gewesen wären.
Doch es war die revolutionäre Welle von 1917–23 und vor allem die Oktoberrevolution, die am deutlichsten die Natur der Fragen von Vertrauen und Solidarität offenbarten. Die Quintessenz der historischen Krise war in der Frage des Aufstandes enthalten. Zum ersten Mal in der gesamten Geschichte der Menschheit befand sich eine Klasse in der Lage, die Richtung der Weltereignisse mit Bedacht und bewusst zu ändern. Die Bolschewiki griffen auf Engels‘ Konzeption der „Kunst des Aufstandes“ zurück. Lenin erklärte, dass die Revolution eine Wissenschaft ist. Trotzki sprach vom „Algebra der Revolution“. Durch das Studium der Entwicklung der gesellschaftlichen Realität, durch den Aufbau einer Klassenpartei, die in der Lage ist, die historische Prüfung zu bestehen, durch die geduldige und aufmerksame Vorbereitung auf den Moment, wo die objektiven und subjektiven Bedingungen für die Revolution vereint sind, und durch die revolutionäre Kühnheit, die notwendig ist, um die Gelegenheit zu nutzen, beginnt das Proletariat und seine Vorhut durch den Triumph seines Bewusstseins und seiner Organisation, die Entfremdung zu überwinden, die die Gesellschaft dazu verdammt, das hilflose Opfer blinder Kräfte zu sein. Gleichzeitig ist die bewusste Entscheidung, die Macht zu ergreifen und somit im Interesse der Weltrevolution alle Härten solch einer Handlung auf sich zu nehmen, der höchste Ausdruck der Klassensolidarität. Dies ist eine neue Qualität im Aufstieg der Menschheit, der Beginn des Sprungs vom Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit. Und dies ist das Wesen des Selbstvertrauens des Proletariats und der Solidarität in seinen Reihen.
b) Eine der ältesten Maximen in der Militärstrategie ist die Notwendigkeit, das Selbstvertrauen und die Einheit der gegnerischen Armee zu unterminieren. Ähnlich hat die Bourgeoisie stets die Notwendigkeit begriffen, diese Qualitäten innerhalb des Proletariats zu bekämpfen. Insbesondere während des Aufstiegs der Arbeiterbewegung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stand das Bedürfnis, die Idee der Arbeitersolidarität zu bekämpfen, in steigendem Maße im Mittelpunkt der Weltsicht der kapitalistischen Klasse, wie das Aufkommen der sozialdarwinistischen Ideologie, die Philosophie Nietzsches, der „elitäre Sozialismus“ des Fabianismus, etc. bezeugen. Jedoch war die Bourgeoisie bis zum Eintritt ihres Systems in die Dekadenz nicht imstande, das Mittel zu finden, um diese Prinzipien innerhalb der Arbeiterklasse in ihr Gegenteil zu verkehren. Besonders die grausame Repression, die sie gegen das Proletariat von 1848 bis 1870 sowie gegen die Arbeiterbewegung in Deutschland zurzeit des Sozialistenverbotes ausübte, scheiterte – auch wenn sie zu zeitweisen Rückschlägen im Prozess zum Sozialismus führten – daran, das historische Vertrauen der Arbeiterklasse wie auch ihre Traditionen der Solidarität ernsthaft zu beschädigen.
Die Ereignisse des I. Weltkrieges offenbarten, dass diese proletarischen Prinzipien nur „von innen“, nur durch den Verrat durch Teile der Arbeiterklasse selbst, vor allem durch Teile der politischen Organisation der Klasse zerstört werden konnten. Die Liquidierung dieser Prinzipien innerhalb der Sozialdemokratie begann bereits Anfang des 20. Jahrhunderts mit der „Revisionismus“-Debatte. Der destruktive, schädliche Charakter dieser Debatte war nicht nur durch das Eindringen bürgerlicher Positionen und die zunehmende Überbordwerfens des Marxismus offenbar geworden, sondern auch und vor allem durch die Heuchelei, die sich im Organisationsleben breitmachte. Auch wenn die Position der Linken formell übernommen wurde, bestand in Wahrheit das Hauptresultat dieser Debatte darin, die Linken vollkommen zu isolieren – vor allem in der deutschen Partei. Die inoffiziellen Verleumdungskampagnen gegen Rosa Luxemburg, die auf den Korridoren der Parteikongresse als etwas Fremdes, ja, sogar als blutrünstiges Element porträtiert worden war, bereiteten bereits den Boden für ihren Mord im Januar 1919.
In der Tat war das wesentliche Prinzip der Konterrevolution, die in den 1920er Jahren begann, die Zerstörung der bloßen Idee von Vertrauen und Solidarität. Die verabscheuungswürdige Idee des „Sündenbocks“, die Barbarei des Mittelalters, trat erneut im Herzen des industriellen Kapitalismus auf, in der Hexenjagd der Sozialdemokratie gegen die Spartakisten und des Faschismus gegen die Juden, die üble Minderheit, die allein verhindere, dass eine friedliche Harmonie im Nachkriegseuropa einkehrt. Doch es ist vor allem der Stalinismus, der die Speerspitze der bürgerlichen Offensive bildete, indem er die Prinzipien des Vertrauens und der Solidarität mit jenen des Misstrauens und der Denunzierung innerhalb der jungen kommunistischen Parteien ersetzte und das Ziel des Kommunismus und die Mittel zu seiner Erlangung diskreditierte.
Die Zerstörung dieser Prinzipien wurde jedoch nicht über Nacht erreicht. Noch während des II. Weltkrieges bewiesen Zehntausende von Arbeiterfamilien genug Solidarität und riskierten ihr Leben, indem sie staatlich Verfolgte versteckten. Und der Streik des holländischen Proletariats gegen die Deportation der Juden erinnert uns stets daran, dass die Solidarität der Arbeiterklasse die einzig wahre Solidarität mit der Gesamtheit der Menschheit ist. Doch dies war die letzte Streikbewegung im 20. Jahrhundert, auf die die Linkskommunisten Einfluss besessen hatten.5
Wie wir wissen, wurde diese Konterrevolution durch eine neue und ungeschlagene Generation von Arbeitern im Jahre 1968 beendet, die erneut das Selbstvertrauen hatte, die Ausweitung ihres Kampfes und ihrer Klassensolidarität in die eigenen Hände zu nehmen und einmal mehr die Frage der Revolution zu stellen sowie neue revolutionäre Minderheiten zu gebären. Jedoch nahm diese neue Generation, traumatisiert vom Verrat aller großen Arbeiterorganisationen der Vergangenheit, eine skeptische Haltung gegenüber der Politik, gegenüber ihrer eigenen Vergangenheit, ihrer Klassentheorie und ihrer historischen Mission ein. Dies schützte sie nicht gegenüber der Sabotage durch die Linke des Kapitals und hinderte sie daran, die Wurzeln ihres Selbstvertrauens zu erneuern und bewusst ihre große Tradition der Solidarität wiederzubeleben. Was die revolutionären Minderheiten angeht, so sind auch diese davon betroffen. Tatsächlich entstand zum ersten Mal eine Situation, in der revolutionäre Positionen auf ein wachsendes Echo stießen, während die Organisationen, die sie vertraten, selbst von den kämpferischsten Arbeitern nicht anerkannt wurden.
Trotz der Unbekümmertheit und „Anmaßung“ dieser neuen Generation nach 1968, der es anfangs gelang, die herrschende Klasse zu überraschen, steckt hinter ihrer Skepsis gegenüber der Politik ein weitreichender Mangel an Selbstvertrauen. Niemals zuvor haben wir solch einen Gegensatz gesehen zwischen einerseits der Fähigkeit, sich in massiven, größtenteils selbstorganisierten Kämpfen zu engagieren, und andererseits dem Fehlen dieser elementaren Selbstsicherheit, die das Proletariat zwischen 1840 und 1917/18 ausgezeichnet hatte. Und dieser Mangel an Selbstsicherheit hat auch tiefe Spuren in den linkskommunistischen Organisationen hinterlassen. Nicht nur in denen der IKS oder der CWO, sondern auch und nicht weniger in einer Gruppe wie die bordigistische PCInt, die die Konterrevolution überlebt hatte, aber infolge ihrer Ungeduld, von der Klasse als Ganzes anerkannt zu werden, zu Beginn der 80er Jahre auseinanderbrach. Wie wir wissen, haben sowohl der Bordigismus als auch der Rätekommunismus während der Konterrevolution diesen Verlust an Selbstvertrauen theoretisiert, als sie Revolutionäre und Klasse voneinander trennten, indem sie den einen Teil der Klasse aufforderten, misstrauisch gegenüber dem anderen Teil zu sein.6 Darüber hinaus waren sowohl die bordigistische Idee der „Invarianz“ als auch die entgegengesetzte rätekommunistische Idee der „neuen Arbeiterbewegung“ falsche theoretische Antworten auf die Konterrevolution in dieser Frage. Doch auch die IKS, die solche Theoretisierungen ablehnte, war nicht frei von den Beschädigungen des proletarischen Selbstbewusstseins und der Verringerung seiner Basis. (...)
Wir sehen also, wie in dieser historischen Periode alles – der Mangel an Vertrauen der Klasse in sich selbst, der Arbeiter in die Revolutionäre und umgekehrt der Revolutionäre in sich selbst, in ihre historische Rolle, in die marxistische Theorie und in die Organisationsprinzipien, die ein Erbe der Vergangenheit sind, und der gesamten Klasse in die langfristige, historische Natur ihrer Mission – miteinander verknüpft ist.
In Wirklichkeit ist diese von der Konterrevolution übernommene politische Schwäche einer der Hauptfaktoren beim Eintritt des Kapitalismus in die Phase des Zerfalls. Abgeschnitten von seiner historischen Erfahrung, seiner theoretischen Waffen und der Vision seiner historischen Rolle, mangelt es dem Proletariat an das notwendige Selbstvertrauen, um bei der Entwicklung einer revolutionären Perspektive weiter zu schreiten. Mit dem Zerfall wird dieser Mangel an Vertrauen, an Perspektiven zum Schicksal der gesamten Gesellschaft, indem die Menschheit in die Gegenwart eingesperrt wird.7 Es ist daher kein Zufall, dass die historische Periode des Zerfalls vom Zusammenbruch des größten Überbleibsels der Konterrevolution, dem der stalinistischen Regimes, eingeläutet wurde. Aufgrund dieser erneuten Diskreditierung seines Klassenziels und seiner wichtigsten politischen Waffen ist das Proletariat mit einer historisch einmaligen Situation konfrontiert: Eine historisch ungeschlagene Generation von Arbeitern verliert in nicht unbedeutendem Maße ihre Klassenidentität. Um aus dieser Krise herauszukommen, wird sie die Klassensolidarität wieder erlernen, eine historische Perspektive wieder entwickeln, in der Hitze des Klassenkampfes die Möglichkeit und Notwendigkeit für die verschiedenen Teile der Klasse, sich gegenseitig zu vertrauen, wieder entdecken müssen. Das Proletariat ist nicht besiegt worden. Es hat die Lehren aus seinen Kämpfen vergessen, nicht verloren. Was es vor allem verloren hat, ist sein Selbstvertrauen.
Daher gehören die Fragen des Vertrauens und der Solidarität zu den wichtigsten Schlüsseln für den Ausweg aus der historischen Sackgasse. Sie sind zentral für die Zukunft der gesamten Menschheit, für die Verstärkung des Klassenkampfes in den kommenden Jahren, für den Aufbau der marxistischen Organisation, für die konkrete Wiederbelebung einer kommunistischen Perspektive innerhalb dieser Kämpfe.
2. Die Folgen der Schwächen im Vertrauen und in der Solidarität für die IKS
a) Wie der Orientierungstext von 19938 aufzeigt, hatten all die Krisen, Tendenzen und Abspaltungen in der Geschichte der IKS ihre Wurzeln in der Organisationsfrage. Selbst wo wichtige politische Divergenzen bestanden, gab es weder eine Übereinstimmung in diesen Fragen unter den Mitgliedern dieser „Tendenzen“, noch rechtfertigten diese Divergenzen im Allgemeinen eine Abspaltung und sicherlich auch nicht die Art von unverantwortlichen und unreifen Spaltungen, die zur allgemeinen Regel innerhalb unserer Organisation wurden.
Wie der 93er OT hervorhebt, haben all die Krisen also ihren Ursprung im Zirkelgeist und insbesondere im Clanwesen. Wir können daraus schließen, dass während der gesamten Geschichte unserer Strömung das Clanwesen stets die Hauptmanifestation des Mangels an Vertrauen in die Klasse und die Hauptursache für die Infragestellung der Einheit der Organisation gewesen war. Ferner waren die Clans, wie ihre weitere Entwicklung außerhalb IKS bewies, die Hauptträger des Keims der programmatischen und theoretischen Degeneration in unseren Reihen.9
Diese Tatsache, die acht Jahre zuvor ans Tageslicht gebracht wurde, ist dennoch so erstaunlich, dass sie eine historische Reflexion verdient. Der 14. Kongress der IKS begann mit diesem Nachdenken, indem er feststellte, dass in der vergangenen Arbeiterbewegung das vorherrschende Gewicht des Zirkelgeistes und Clanwesens hauptsächlich auf den Beginn der Arbeiterbewegung beschränkt blieb, während die IKS während ihrer gesamten Existenz von diesem Problem geplagt wurde. Die Wahrheit ist, dass die IKS die einzige Organisation in der Geschichte des Proletariats ist, innerhalb der sich die Penetration fremder Ideologien so regelmäßig und überwältigend über den Weg organisatorischer Probleme manifestiert haben.
Dieses unerhörte Problem muss innerhalb des historischen Kontexts der vergangenen drei Jahrzehnte verstanden werden. Die IKS ist der Erbe der höchsten Synthese des Nachlasses der Arbeiterbewegung und der Linkskommunisten insbesondere. (...)
Doch die Geschichte zeigt, dass die IKS das programmatische Erbe viel leichter verinnerlicht als das organisatorische. Das war hauptsächlich die Folge des Bruchs in der organischen Kontinuität, der durch die Konterrevolution verursacht worden war. Erstens, weil es leichter fällt, sich über das Studium politische Position zu Eigen zu machen, als die organisatorischen Fragen zu erfassen, die eher eine lebendige Tradition darstellen, deren Weiterreichen weitaus stärker von der Verbindung zwischen den Generationen abhängt. Zweitens, weil, wie wir bereits gesagt haben, der Schlag gegen das Selbstvertrauen der Klasse, der von der Konterrevolution ausgeübt worden war, hauptsächlich ihr Vertrauen in ihre politische Mission und somit in ihre politischen Organisationen erschüttert hat. Während also die Gültigkeit unser programmatischer Positionen oft von der Realität spektakulär bekräftigt wurde (und seit 1989 wurde diese Gültigkeit selbst von einem wachsenden Teil des politischen Sumpfes bestätigt), erzielte unser organisatorische Aufbau nicht denselben Erfolg. Ab 1989, dem Ende der Nachkriegsperiode, gelang der IKS im numerischen Wachstum, in dem Einfluss unserer Interventionen auf den Klassenkampf, in der Verbreitung unserer Presse oder im Maß der Anerkennung unserer Organisation durch die Klasse in ihrer Gesamtheit kein entscheidender Schritt nach vorn. Es war in der Tat eine paradoxe historische Situation. Auf der einen Seite begünstigten das Ende der Konterrevolution und die Eröffnung eines neuen historischen Kurses die Entwicklung unserer Positionen: Die neue, ungeschlagene Generation war mehr oder weniger offen misstrauisch gegenüber der Linken des Kapitals, den bürgerlichen Wahlen, der Aufopferung für die Nation. Doch auf der anderen Seite war unsere kommunistische Militanz vielleicht weniger respektiert als zurzeit von Bilan. Diese historische Situation führte zu tiefen Zweifeln über die historische Mission der Organisation. Diese Zweifel kamen auf der allgemeinen politischen Ebene manchmal in der Entwicklung von offen rätekommunistischen, modernistischen oder anarchistischen Konzeptionen an die Oberfläche – mehr oder weniger offene Kapitulationen vor dem herrschenden Ambiente. Doch vor allem drückten sie sich auf etwas schamhaftere Weise auf der organisatorischen Ebene aus.
Wir müssen dem hinzufügen, dass sich im Verlaufe des Kampfes der IKS für den Parteigeist ein wichtiger Unterschied zu vergangenen Organisationen auftat, obwohl es auch Ähnlichkeiten mit ihnen gibt – das Erbe unserer Funktionsprinzipien von unseren Vorgängern und ihre Verankerung durch eine Reihe von organisatorischen Kämpfen. Die IKS ist die erste Organisation, die den Parteigeist nicht unter den Bedingungen der Illegalität schmiedet, sondern in einer Atmosphäre, die von demokratischen Illusionen durchtränkt ist. Die Bourgeoisie hat in dieser Frage aus der Geschichte gelernt: Nicht Repression, sondern die Kultivierung einer Atmosphäre des Misstrauens ist die beste Waffe der Liquidierung von Organisationen. Was für die Klasse insgesamt zutrifft, gilt auch für Revolutionäre: Es ist der Verrat von Prinzipien von Innen, der proletarisches Vertrauen zerstört.
Infolgedessen war die IKS nie in der Lage, die Art von lebendiger Solidarität zu entwickeln, die in der Vergangenheit stets in der Klandestinität geschmiedet worden war und die eine der Hauptkomponenten des Parteigeistes ist. Hinzu kommt, dass der Demokratismus der ideale Boden für die Kultivierung des Clanwesens ist, da er die lebende Antithese zum proletarischen Prinzip bildet, wonach Jeder all seine Fähigkeiten für die Allgemeinheit gibt, und den Individualismus, die Unverbindlichkeit und das Vergessen von Prinzipien begünstigt. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass die Parteien der Zweiten Internationalen zu einem großen Teil durch den Demokratismus zerstört worden waren und dass selbst der Triumph des Stalinismus demokratisch legitimiert worden war, wie die Italienische Linke hervorgehoben hat. (...)
b) Es ist offensichtlich, dass das Gewicht all dieser negativen Faktoren von der Eröffnung der Periode des Zerfalls multipliziert wurde. Wir wollen hier nicht wiederholen, was die IKS bereits über dieses Thema gesagt hat. Wichtig ist hier, dass infolge der Tatsache, dass der Zerfall dazu neigt, die sozialen, kulturellen, politischen, ideologischen Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft zu zerfressen, insbesondere durch die Unterminierung des Vertrauens und der Solidarität, es eine spontane Tendenz in der heutigen Gesellschaft gibt, sich in Clans, Cliquen und Banden zu sammeln. Diese Gruppierungen besitzen, sofern sie nicht auf kommerziellen oder anderen materiellen Interessen beruhen, oft einen völlig irrationalen Charakter und basieren auf persönlichen Loyalitäten innerhalb der Gruppe sowie auf einen häufig sinnlosen Hass gegen reale oder eingebildete Feinde. In Wahrheit ist dieses Phänomen teilweise ein Rückfall in atavistische, im heutigen Rahmen vollkommen pervertierte Formen des Vertrauens und der Solidarität, die den Vertrauensverlust in die herrschenden gesellschaftlichen Strukturen und den Versuch widerspiegeln, sich selbst angesichts der wachsenden Anarchie Mut einzuflößen. Überflüssig zu sagen, dass diese Gruppierungen, weit davon entfernt, eine Antwort auf die Barbarei des Zerfalls darzustellen, selbst ein Ausdruck des Letztgenannten sind. Es spricht für sich, dass heute auch die beiden Hauptklassen davon betroffen sind. In der Tat sind im Moment lediglich die stärksten Sektoren der Bourgeoisie mehr oder weniger in der Lage, sich dieser Entwicklung offenbar zu widersetzen. Was das Proletariat anbetrifft, ist das Ausmaß, in dem es im täglichen Leben davon tangiert ist, vor allem ein Ausdruck der Beschädigung seiner Klassenidentität und der daraus resultierenden Notwendigkeit, sich seine eigene Klassensolidarität wiederanzueignen.
Wie der 14. Kongress sagte: Wegen des Zerfalls liegt der Kampf gegen das Clanwesen nicht hinter uns, sondern vor uns.
c) Das Clanwesen ist also der prinzipielle Ausdruck des Verlusts an Vertrauen in die Arbeiterklasse in der Geschichte der IKS. Doch die Form, die es annimmt, ist offenes Misstrauen nicht gegenüber der Organisation, sondern gegenüber einem Teil von ihr. In Wirklichkeit bedeutet seine Existenz die Infragestellung der Einheit der Organisation und ihrer Funktionsprinzipien. Daher entwickelt das Clanwesen, auch wenn an seinem Anfang ein echtes Anliegen und ein mehr oder minder intaktes Vertrauen gestanden haben mag, notwendigerweise ein Misstrauen gegenüber all diejenigen, die sich nicht auf seiner Seite befinden, was zu einer offenen Paranoia führt. Im Allgemeinen sind sich diejenigen, die dieser Dynamik zum Opfer fallen, dieser Realität vollkommen unbewusst. Dies bedeutet nicht, dass ein Clan nicht ein gewisses Bewusstsein darüber besitzt, was er tut. Doch es ist ein falsches Bewusstsein, das dazu dient, sich selbst und Andere zu täuschen.
Der Orientierungstext von 1993 erklärt bereits die Ursache diese Verwundbarkeit, von der in der Vergangenheit solche Militanten wie Martow, Plechanow oder Trotzki betroffen waren: das besondere Gewicht des Subjektivismus in Organisationsfragen. (...)
In der Arbeiterbewegung lag der Ursprung des Clanwesens stets in der Schwierigkeit verschiedener Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten. Mit anderen Worten, es stellte eine Niederlage beim ersten Schritt zum Aufbau einer jeden Gemeinschaft dar. Daher treten Clan-typische Verhaltensweisen in Momenten des Zustroms neuer Mitglieder oder der Formalisierung und Weiterentwicklung organisatorischer Strukturen auf. In der Ersten Internationalen war es die Unfähigkeit des Neuankömmlings Bakunin, „seinen Platz zu finden“, was sich in den bereits herrschenden Ressentiments gegen Marx äußerte. Im Gegensatz dazu ging es 1903 um den Status der „alten Garde“, die das auslöste, was in der Geschichte als Menschewismus einging. Dies hinderte ein Gründungsmitglied wie Lenin natürlich nicht daran, den Parteigeist zu verfechten, oder einen der Neuankömmlinge, der die meisten Ressentiments provozierte
– Trotzki – sich auf die Seite derer zu begeben, die sich vor ihm fürchteten.10 (...)
Gerade weil er den Individualismus überwindet, ist der Parteigeist in der Lage, die Persönlichkeit und die Individualität jedes seiner Mitglieder zu respektieren. Die Kunst des Aufbaus einer Organisation besteht nicht zuletzt darin, Rücksicht auf all diese verschiedenen Persönlichkeiten zu nehmen, d.h. sie maximal zu harmonisieren und ihnen zu ermöglichen, ihr Bestes für das Kollektiv zu geben. Das Clanwesen dagegen kristallisiert sich gerade um das Misstrauen gegen die Persönlichkeit und um deren unterschiedliches Gewicht. Daher ist es so schwierig, eine Clandynamik gleich zu Beginn zu identifizieren. Selbst wenn viele Genosse das Problem spüren, ist die Realität des Clanwesens so schmutzig und lächerlich, dass es Mut erfordert zu erklären, dass „der König ohne Kleider da steht“. Wie peinlich!
Wie Plechanow einst bemerkte, spielen im Verhältnis zwischen Bewusstsein und Emotionen Letztere die konservative Rolle. Doch dies bedeutet nicht, dass der Marxismus die Geringschätzung ihrer Rolle durch den bürgerlichen Nationalismus teilt. Es gibt Emotionen, die der Sache des Proletariats dienen, und es gibt andere, die ihr schaden. Es ist sicher, dass seine Mission nicht ohne eine gigantische Entwicklung der revolutionären Leidenschaften erfolgreich sein wird, ohne einen unerschütterlichen Siegeswillen, ohne ein Fußfassen der Solidarität, der Selbstlosigkeit und des Heroismus, ohne die die Feuerprobe des Kampfes um die Macht und im Bürgerkrieg niemals bestanden werden kann. Und ohne eine bewusste Pflege der gesellschaftlichen und individuellen Eigenschaften der Menschheit kann keine neue Gesellschaft geschaffen werden. Diese Qualitäten sind keine Selbstverständlichkeit. Sie müssen im Kampf geschmiedet werden, wie Marx sagte.
3. Die Rolle des Vertrauens und der Solidarität im Aufstieg der Menschheit
(...) Im Gegensatz zur Haltung der revolutionären Bourgeoisie, bei der der Ausgangspunkt ihrer Radikalisierung die Ablehnung der Vergangenheit war, hat das Proletariat stets bewusst seine revolutionäre Weltanschauung auf die Grundlage all der Errungenschaften der Menschheit gestellt, die ihm vorausgingen. Grundsätzlich ist das Proletariat deswegen in der Lage, solch eine historische Sichtweise zu entwickeln, weil seine Revolution keine besonderen Interessen vertritt, die jenen der Menschheit in ihrer Gesamtheit entgegenstehen. Daher bestand das Vorgehen des Marxismus gegenüber allen theoretischen Fragen, die sich ihm bei seiner Mission stellten, stets darin, die besten Errungenschaften zum Ausgangspunkt zu machen, die ihm hinterlassen worden waren. Für uns ist nicht nur das Bewusstsein des Proletariats, sondern auch jenes der Menschheit insgesamt etwas, was im Laufe der Geschichte angehäuft und weitergereicht wurde. Dies war die Vorgehensweise von Marx und Engels gegenüber der klassischen deutschen Philosophie, der englischen Nationalökonomie oder gegenüber dem utopischen französischen Sozialismus.
Ähnlich müssen wir hier begreifen, dass das proletarische Vertrauen und seine Solidarität spezifische Konkretisierungen der allgemeinen Entwicklung dieser Qualitäten in der menschlichen Geschichte sind. In beiden Fragen ist es die Aufgabe der Arbeiterklasse, über das, was bereits erreicht worden ist, hinauszugehen. Doch um dies zu tun, muss sich die Klasse selbst auf die Grundlage des bereits Erreichten stellen.
Die hier gestellten Fragen sind von fundamentaler historischer Bedeutung. Ohne ein Minimum an elementarer Solidarität wird die menschliche Gesellschaft zu einem Ding der Unmöglichkeit. Und ohne zumindest rudimentärem gegenseitigen Vertrauen ist kein gesellschaftlicher Fortschritt möglich. In der Geschichte führte der Zusammenbruch dieser Prinzipien stets zu ungezügelter Barbarei.
a) Solidarität ist eine praktische Tätigkeit der gegenseitigen Unterstützung zwischen Menschen, die sich beispielsweise in einem Kampf befinden. Sie ist der konkrete Ausdruck der sozialen Natur der Menschheit. Im Gegensatz zu solchen Regungen wie die christliche Nächstenliebe und der Selbstopferung, die die Existenz eines Interessenkonfliktes voraussetzen, ist die materielle Basis der Solidarität die Gemeinsamkeit der Interessen. Daher ist die Solidarität kein utopisches Ideal, sondern eine materielle Kraft, so alt wie die Menschheit selbst. Doch dieses Prinzip, das das effektivste, weil kollektive Mittel zur Verteidigung der eigenen, „niederen“ materiellen Interessen repräsentiert, kann den Anstoß zu den selbstlosesten Handlungen geben, einschließlich der Opferung des eigenen Lebens. Diese Tatsache, die der bürgerliche Utilitarismus nie in der Lage war zu erklären, resultiert aus der einfachen Wahrheit, dass, wo immer gemeinsame Interessen existieren, die einzelnen Teile dem Allgemeingut untergeordnet sind. Solidarität ist also die Überwindung nicht des „Egoismus“, sondern des Individualismus und des Partikularismus im Interesse der Gesamtheit. Daher ist die Solidarität stets eine aktive Kraft, die gekennzeichnet ist durch Initiative, nicht aber durch die Haltung, auf die Solidarität der Anderen zu warten. Wo das bürgerliche Prinzip des Aufrechnens von Vor- und Nachteilen herrscht, ist keine Solidarität möglich.
Obwohl in der Geschichte der Menschheit die Solidarität zwischen den Gesellschaftsmitgliedern ursprünglich vor allen anderen instinktiven Reflexen kam, muss der Bewusstseinsgrad, der für ihre Praktizierung notwendig ist, um so mehr steigen, je komplexer und konfliktreicher die menschliche Gesellschaft wird. In diesem Sinn ist die Klassensolidarität des Proletariats bis heute die höchste Form menschlicher Solidarität.
Dennoch hängt das Aufkommen der Solidarität nicht nur vom allgemeinen Bewusstsein ab, sondern auch von der Pflege sozialer Emotionen. Um sich zu entwickeln, erfordert die Solidarität einen sie begünstigenden kulturellen und organisatorischen Rahmen. Ist ein solcher Rahmen innerhalb einer gesellschaftlichen Gruppe gegeben, ist es möglich, Verhaltensweisen, Traditionen und das „ungeschriebene Recht“ der Solidarität weiterzuentwickeln, die von einer Generation zur nächsten weitergereicht werden können. In diesem Sinn hat die Solidarität nicht nur einen unmittelbaren, sondern auch einen historischen Einfluss.
Doch bleiben solche Traditionen unbeachtet, bekommt die Solidarität einen freiwilligen Charakter. Daher ist die Idee des Staates als die Verkörperung von Solidarität, die insbesondere von der Sozialdemokratie und dem Stalinismus gepflegt wird, eine der größten Lügen in der Geschichte. Solidarität kann niemals gegen den eigenen Willen aufgezwungen werden. Sie ist nur möglich, wenn sowohl jene, die Solidarität ausüben, als auch jene, die Solidarität empfangen, die Überzeugung teilen, dass sie notwendig ist. Solidarität ist der Mörtel, der eine gesellschaftliche Gruppe zusammenhält, der eine Gruppe von Individuen in eine einzige vereinigte Kraft umwandelt.
b) Wie die Solidarität ist auch das Vertrauen ein Ausdruck des sozialen Charakters der Menschheit. Als solcher setzt auch das Vertrauen eine Gemeinsamkeit von Interessen voraus. Es kann nur herrschen im Verhältnis zu anderen menschlichen Wesen, um gemeinsame Ziele und Handlungen zu teilen. Daraus ergeben sich zwei Hauptaspekte: gegenseitiges Vertrauen der Beteiligten, Vertrauen in das gemeinsame Ziel. Die prinzipiellen Grundlagen des sozialen Vertrauens sind also stets ein Maximum an Klarheit und Einheit.
Jedoch ist der wesentliche Unterschied zwischen menschlicher Arbeit und tierischer Aktivität, zwischen der Arbeit des Architekten und der Bildung eines Bienenstocks, wie Marx es formulierte, der Vorsatz dieser Arbeit auf der Grundlage eines Plans.11 Daher ist Vertrauen stets mit der Zukunft verknüpft, mit etwas, was in der Gegenwart nur in Form einer Idee oder einer Utopie existiert. Gleichzeitig ist gegenseitiges Vertrauen daher immer konkret, basierend auf der Fähigkeit einer Gemeinschaft, die erforderlichen Aufgaben zu erfüllen.
So ist das Vertrauen im Gegensatz zur Solidarität, die eine Handlung ist und nur in der Gegenwart existiert, eine Verhaltensweise, die vor allem auf die Zukunft gerichtet ist. Dies verleiht ihm den merkwürdig geheimnisvollen Charakter, der schwierig zu definieren oder zu identifizieren ist, der schwierig weiterzuentwickeln und aufrechtzuerhalten ist. Es gibt kaum einen anderen Bereich im menschlichen Leben, wo es so viel Täuschung und Selbsttäuschung gibt. In der Tat basiert das Vertrauen auf der Erfahrung, auf das „Learning by doing“, um realistische Ziele zu setzen und die geeigneten Mittel dafür zu entwickeln. Doch aufgrund seiner Funktion, etwas Neues, was bisher noch nicht existiert hat, in die Welt zu setzen, verliert es nie seinen „theoretischen“ Aspekt. Keine der großen Errungenschaften der Menschheit wäre ohne diese Fähigkeit möglich gewesen, unbeirrt an einer realistischen, aber – angesichts des Fehlens jeglichen unmittelbaren Erfolges – schwierigen Aufgabe festzuhalten. Es ist die Erweiterung des Bewusstseinsgrades, die ein wachsendes Vertrauen ermöglicht, während das Schwanken der blinden und unbewussten Kräfte in Natur, Gesellschaft und im Individuum zur Zerstörung dieses Vertrauens neigen. Es ist nicht so sehr die Existenz von Gefahren, die das menschliche Vertrauen untergraben, sondern vielmehr die Unfähigkeit, sie zu begreifen. Doch da das Leben ständig neue Gefahren produziert, ist das Vertrauen eine besonders zerbrechliche Qualität, die Jahre der Entwicklung benötigt, aber über Nacht zerstört werden kann.
Wie die Solidarität kann Vertrauen weder dekretiert noch erzwungen werden, sondern erfordert eine adäquate Struktur und Atmosphäre für seine Entwicklung. Was Solidarität und Vertrauen zu solch schwierigen Fragen macht, ist die Tatsache, dass sie Angelegenheiten nicht nur des Kopfes, sondern auch des Herzens sind. Es ist notwendig, „Vertrauen zu empfinden“. Das Fehlen von Vertrauen beinhaltet umgekehrt die Herrschaft von Furcht, Ungewissheit, Zweifeln und Lähmung der bewussten kollektiven Kräfte.
c ) Während sich heute die bürgerliche Ideologie – in ihrer Überzeugung, dass allein die Eliminierung der Schwachen im Konkurrenzkampf ums Überleben die Vervollkommnung der Gesellschaft sichert – mit dem angeblichen „Tod des Kommunismus“ tröstet, sind diese bewussten und kollektiven Kräfte die Grundlage für den Aufstieg der Menschheit. Schon die Vorgänger der Menschheit gehörten mit Sicherheit zu jenen hoch entwickelten tierischen Spezies, deren soziale Instinkte ihnen einen entscheidenden Vorteil im Überlebenskampf verliehen. Diese Spezies trugen bereits die rudimentären Merkmale der kollektiven Stärke in sich: Die Schwachen wurden beschützt, und die Stärken der individuellen Mitglieder wurden zu Stärken der Gesamtheit. Diese Aspekte waren elementar bei der Entstehung der Menschheit, deren Sprößlinge länger hilflos blieben als andere Spezies. Auch mit der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und der Produktivkräfte hörte das Individuum niemals auf, von der Gesellschaft abhängig zu sein. Die sozialen Instinkte (Darwin nannte sie „altruistisch“), die bereits in der Tierwelt existieren, nahmen in zunehmendem Maße einen bewussten Charakter an. Selbstlosigkeit, Mut, Loyalität, Hingebung zur Gemeinschaft, Disziplin und Ehrlichkeit wurden in den frühen kulturellen Ausdrücken der Gesellschaft gerühmt – die ersten Ausdrücke einer wahrhaft menschlichen Solidarität.
Aber der Mensch ist vor allem die einzige Spezies, die Gebrauch macht von selbst hergestellten Werkzeugen. Es ist die Aneignungsweise von Subsistenzmitteln, die das Handeln der Menschheit in die Zukunft lenkt.
„Beim Tier erfolgt die Handlung unmittelbar nach dem Eindruck: Es sucht seine Beute oder sein Futter, und in einem packt es zu, begreift, isst oder tut das, was für sein Verständnis notwendig ist, und dies verinnerlicht es als Instinkt (...) Beim Menschen jedoch entsteht zwischen dem Eindruck und der Handlung eine lange Kette von Gedanken und Erwägungen. Woher kommt dieser Unterschied? Es ist schwerlich zu übersehen, dass er eng mit dem Gebrauch von Werkzeugen verbunden ist. Auf dieselbe Weise, wie zwischen dem Eindruck und der Handlung der Gedanke steht, so gelangt das Werkzeug zwischen dem Menschen und dem, was er zu erlangen trachtet. Ferner muss zwischen seinem Eindruck und seinem Gebrauch ein Gedanke stehen, da das Werkzeug zwischen dem Menschen und dem äußeren Objekt steht.“ Er nimmt ein Werkzeug in die Hand, „folglich macht sein Geist denselben Umweg und folgt nicht dem ersten Eindruck.“
Zu lernen, nicht dem ersten Eindruck zu folgen, ist eine gute Beschreibung des Sprungs aus der Tierwelt in die Menschheit, aus dem Reich der Instinkte in das Reich des Bewusstseins, vom immediatistischen Gefängnis der Gegenwart zu zukunftsgerichteten Handlungen. Jede wichtige Entwicklung in der frühen menschlichen Gesellschaft wurde von einer Verstärkung dieses Aspekts begleitet. So wurden mit dem Auftreten von sesshaften landwirtschaftlichen Gesellschaften die Alten nicht mehr getötet, sondern als jene geschätzt, die in der Lage waren, Erfahrungen weiterzureichen.
Im so genannten primitiven Kommunismus war dieses embryonale Vertrauen in die Macht des Bewussteins zur Bändigung der Naturgewalten äußerst zerbrechlich gewesen, während die Kraft der Solidarität innerhalb einer jeden Gruppe weitaus mächtiger gewesen war. Doch bis zum Erscheinen von Klassen, Privateigentum und des Staates verstärkten sich diese beiden Kräfte, so ungleich sie gewesen waren, gegenseitig.
Die Klassengesellschaft riss diese Einheit auseinander, indem sie den Kampf zur Bändigung der Natur verstärkte und dabei die soziale Solidarität durch den Kampf der Klassen innerhalb ein und derselben Gesellschaft ersetzte. Es wäre falsch anzunehmen, dass dieses allgemeine gesellschaftliche Prinzip durch die Klassensolidarität ersetzt wurde. In der Geschichte der Klassengesellschaften ist das Proletariat die einzige Klasse, die zu einer wahren Solidarität fähig ist. Während die herrschenden Klassen stets Ausbeuter gewesen waren, für die Solidarität nie mehr als eine momentane Gelegenheit ist, beinhaltete der reaktionäre Charakter der ausgebeuteten Klassen, dass ihre Solidarität notgedrungen einen heimlichen, utopischen Charakter besaß, wie dies für das „Gemeineigentum an Gütern“ des Frühchristentums oder der Sekten im Mittelalter galt. Der wesentliche Ausdruck der sozialen Solidarität innerhalb einer Klassengesellschaft vor dem Aufstieg des Kapitalismus bestand in den Überbleibseln der Naturalwirtschaft, einschließlich der Rechte und Pflichten, welche die gegensätzlichen Klassen immer noch aneinanderbanden. All dies wurde schließlich von der Warenwirtschaft und ihrer Verallgemeinerung im Kapitalismus zerstört.
„Wenn in der gegenwärtigen Gesellschaft die sozialen Instinkte noch einige Gültigkeit besitzen, so nur dank der Tatsache, dass die allgemeine Warenproduktion noch ein sehr junges Phänomen ist, kaum 100 Jahre alt, und dass in dem Maße, wie der Urkommunismus verschwindet und (...) dieser aufhört, eine Quelle sozialer Instinkte zu sein, eine neue und viel stärkere Quelle entsteht, der Klassenkampf der aufsteigenden, ausgebeuteten Volksklassen.“
Mit der Entwicklung der Produktivkräfte wuchs das Vertrauen der Gesellschaft in ihre Fähigkeit, die Naturgewalten zu beherrschen, in beschleunigtem Maße. Der Kapitalismus leistete den bei weitem wichtigsten Beitrag in diese Richtung und kulminierte im 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert des Fortschritts und Optimismus. Doch gleichzeitig unterminierte er, indem er die Menschen im Konkurrenzkampf gegeneinander stellte und den Klassenkampf in einem unerhörten Maße verschärfte, in nie dagewesener Weise einen anderen Pfeiler des sozialen Selbstvertrauens – das der gesellschaftlichen Einheit. Darüber hinaus ordnete er den Menschen in dem Maße, wie er ihn von den blinden Naturgewalten befreite, neuen, blinden Kräften innerhalb der Gesellschaft selbst unter, die von der Warenproduktion ausgelöst wurden, deren Gesetze außerhalb der Kontrolle oder gar des Verständnisses – „hinter dem Rücken“ – der Gesellschaft stehen. Dies führte seinerseits zum 20. Jahrhundert, dem tragischsten in der Geschichte, das große Teile der Menschheit in unaussprechliche Verzweiflung stürzte.
In ihrem Kampf für den Kommunismus gründet sich die Klasse selbst nicht nur auf einer Entwicklung der Produktivkräfte, die vom Kapitalismus erreicht wurde, sondern stellt einen Teil ihres Vertrauens in die Zukunft auch auf den Boden wissenschaftlicher Errungenschaften und der theoretischen Einblicke, die von der Menschheit bereits geschaffen worden waren. Gleichermaßen schließt das Erbe der Klasse im Ringen um eine wirksame Solidarität die gesamten Erfahrungen der Menschheit bis heute ein, um soziale Bande, einheitliche Ziele, Freundschaftsbeziehungen, Verhaltensweisen wie Respekt und Achtung vor unseren brüderlichen Mitstreitern, etc. zu schmieden.
In der Internationalen Revue Nr. 32 (November 2003) werden wir den zweiten und abschließenden Teil dieses Textes veröffentlichen. Darin werden die folgenden Fragen behandelt:
- die Dialektik des Selbstvertrauens des Proletariats: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
- das Vertrauen, die Solidarität und der Parteigeist sind nie definitive Errungenschaften
- kein Parteigeist ohne individuelle Verantwortung.
Fußnoten:
1 Die Fussnoten, die dem ursprünglichen Text neu hinzugefügt wurden, befinden sich unten auf der Seite. Diejenigen, die sich bereits im Text befanden, stehen nun am Schluss des Artikels.
2 Die IKS hat die Fragen der Umwandlung des Zirkelgeistes in das Clanwesen, der Clans, die in unserer Organisation aufgetreten sind und den Kampf gegen diese Schwächen, den wir ab 1993 geführt haben, in verschiedenen Arikeln analysiert und beschrieben, vgl. dazu insbesondere „Die Frage der Funktionsweise in der Organisation der IKS“ und „Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien“ in der Internationalen Revue Nr. 30.
3 Es handelt sich dabei um die Untersuchungskommission, die durch den 14. Kongress der IKS ernannt wurde, vgl. dazu „Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien“ in der Internationalen Revue Nr. 30.
4 Vgl. dazu den Artikel „Der Kampf des Proletariats im aufsteigenden und im dekadenten Kapitalismus“ in der IKS-Broschüre Die Gewerkschaften gegen die Arbeiterklasse. Wir weisen in diesem Artikel nach, aus welchen Gründen sich die Kämpfe des 20. Jahrhunderts (und später) im Gegensatz zu denjenigen des 19. Jahrhunderts nicht auf vorbestehende Massenorganisationen der Klasse abstützen können.
5 Im Februar 1941 riefen die antisemitischen Maßnahmen der deutschen Besatzungsmacht eine Massenmobilisierung der holländischen Arbeiter hervor. Der Streik brach am 25. Februar in Amsterdam aus und breitete sich am Tag darauf auf zahlreiche andere Städte aus, namentlich auf Den Haag, Rotterdam, Groningen, Utrecht, Hilversum, Haarlem und griff selbst auf Belgien über, bevor er brutal durch die Repressionskräfte unterdrückt wurde, insbesondere durch die SS. Vgl. dazu unser Buch „The Dutch and German Communist Left“, S. 316 ff. (auf Englisch und Französisch).
6 Die rätistische Auffassung über die Parteifrage, die durch die Holländische Kommunistische Linke entwickelt wurde, und die bordigistische Auffassung, eine Abwandlung der Italienischen Linken, scheinen sich auf den ersten Blick radikal zu widersprechen: Während diese davon ausgeht, dass die kommunistische Partei die Aufgabe hat, die Macht zu ergreifen und die Diktatur im Namen des Proletariats auszuüben, selbst wenn die Gesamtheit der Klasse dagegen ist, so betrachtet jene umgekehrt jede Partei, einschließlich die kommunistische Partei, als eine Gefahr für die Klasse, da sie notwendigerweise dazu bestimmt sei, ihre Macht gegen die Interessen der Revolution zu missbrauchen. Effektiv aber stimmen beide Auffassungen darin überein, dass sie eine Trennung, ja einen Gegensatz herstellen zwischen der Partei und der Klasse und dass sie dieser gegenüber grundsätzlich einen Mangel an Vertrauen entgegenbringen. Für die Bordigisten ist die Klasse in ihrer Gesamtheit nicht in der Lage, die Diktatur auszuüben, und deshalb ist es für sie notwendigerweise die Partei, die diese Aufgabe übernehmen muss. Entgegen allem Anschein hat der Rätismus nicht mehr Vertrauen in das Proletariat, denn er geht davon aus, dass dieses dazu verurteilt ist, seine Macht abzugeben, sobald eine Partei existiert.
7 Zu unserer Analyse des Zerfalls vgl. insbesondere "Der Zerfall: letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus" in Internationale Revue Nr. 13.
8 Dieser Text wurde in der Internationalen Revue Nr. 30 unter dem Titel "Die Frage der Funktionsweise der Organisation in der IKS" veröffentlicht.
9 „Dies geschieht deshalb, weil In einer Clandynamik (...) das gemeinsame Vorgehen nicht auf wirklicher politischer Übereinstimmung (fußt), sondern vielmehr auf Freundschaft, Loyalität, gemeinsamen persönlichen Interessen oder geteilten Frustrationen. (...) Wenn eine solche Dynamik entsteht, entscheiden die Mitglieder oder Sympathisanten des Clans nicht infolge einer bewussten und rationalen Wahl über ihre Haltung und die Entscheidungen, die sie treffen, sondern als Resultat der Claninteressen, die dazu neigen, sich gegen jene der Organisation zu richten.“ („Die Frage der Funktionsweise der Organisation in der IKS“ in der Internationalen Revue Nr. 30, S. 41) Sobald die Militanten eine solche Haltung annehmen, drehen sie der ernsthaften theoretischen Arbeit, dem Marxismus, den Rücken zu und werden zu Trägern einer Tendenz zur theoretischen und programmatischen Degenerierung. Um nur ein Beispiel zu zitieren sei an die clanhafte Gruppierung erinnert, die 1984 in der IKS auftauchte und dann die "Externe Fraktion der IKS" wurde; diese stellte schließlich unsere Plattform, die sie angeblich verteidigen wollte, total in Frage und warf die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus über Bord, die das Vermächtnis der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Linken war.
10 Als Trotzki im Herbst 1902 in Westeuropa ankam, nachdem er der Verbannung in Sibirien entflohen war, ging im bereits der Ruf eines sehr talentierten Journalisten voraus (eines seiner Pseudonyme, die er erhielt, war "Pero", die Feder). Er wurde bald einmal ein enger Mitarbeiter der Iskra, die von Lenin und Plechanow herausgegeben wurde. Im März 1903 schrieb Lenin Plechanow, um ihm vorzuschlagen, Trotzki in die Redaktion der Iskra zu kooptieren, doch Plechanow lehnte ab: In Tat und Wahrheit ging es darum, dass Plechnow fürchtete, das Talent des jungen (23-jährigen) Militanten werfe einen Schatten auf sein eigenes Prestige. Dies war eines der ersten Anzeichen eines Abgleitens Plechanows, der vorher der Hauptverantwortliche für die Verbreitung des Marxismus in Russland gewesen war und schließlich seine Karriere als Sozialchauvinist im Dienst der Bourgeoisie beendete.
11 „Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln, und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor es sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit erheischt“ (Das Kapital, Erster Band, Buch 1, 5. Kapitel).
A Rosa Luxemburg: Die Revolution in Russland.
B Hans-Christian Anderson: Des Königs Kleide.Es muss hinzugefügt werden, dass Andersons Geschichten manchmal realistischer sind als die Märchen, die das Clanwesen uns auftischt.
C Anton Pannekoek: Marxismus und Darwinismus.
D Karl Kautsky: Ethische und materialistische Geschichtsauffassung.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Vorwort zur russischen Ausgabe der Broschüre Dekadenz des Kapitalismus
- 2524 Aufrufe
Die russische Publikation der IKS-Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus zeugt vom Wiedererwachen revolutionärer Elemente in einem Land mit einer einst sehr starken proletarischen politischen Tradition. Diese Tradition wurde dann aber erstickt unter der schrecklichen Last der stalinistischen Konterrevolution. Die IKS ist sich durchaus bewusst, dass es ohne diesen Wiederaufbruch von Revolutionären nicht zur Übersetzung unserer Broschüre gekommen wäre. Wir begrüßen sie daher als Beitrag zur Klärung der kommunistischen Positionen in Debatten, die gegenwärtig sowohl im russischen Milieu selbst stattfinden als auch zwischen diesem Milieu einerseits und den Ausdrücken eines wirklichen Kommunismus auf internationaler Ebene andererseits.
Die Einleitung früherer Ausgaben dieser Broschüre enthält schon eine Geschichte des Konzepts der Dekadenz in der marxistischen Bewegung. Sie zeigt, dass dieses Konzept seit Marx und bis zur Kommunistischen Internationalen und den Linksfraktionen, die auf die Entartung und den Tod der Kommunistischen Internationalen mit Widerstand reagierten, keineswegs eine rein moralische oder kulturelle Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft war. Dies wäre die vulgäre Interpretation der „Dekadenz“ in der Gestalt der Missbilligung verschiedener Formen der Kunst, der Mode und gesellschaftlicher Sitten. Im Gegensatz dazu aber leitet sich der marxistische Begriff der Dekadenz in folgerichtiger Weise aus den dem historischen Materialismus eigenen Voraussetzungen ab. Er bildet den Grundstein des Beweises dafür, dass erstens der Kapitalismus als Produktionsweise seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in seinem historischen Niedergang begriffen ist, und zweitens, dass diese Periode gleichzeitig die proletarische Revolution auf die Tagesordnung der Geschichte gesetzt hat. Dieses Vorwort zur russischen Ausgabe soll sich auf den überaus wichtigen Beitrag zum Konzept des historischen Kurses konzentrieren, der von der direkten Erfahrung der russischen Arbeiterklasse und den theoretischen Bemühungen ihrer revolutionären Minderheiten stammt.
Wir wollen uns hier kurz fassen, weshalb wir diesen Beitrag in der Form einer Chronologie wiedergeben. Weitere Dokumente, die vielleicht von den russischen Genossen selbst geschrieben werden, sollen sich mit mehr Tiefgang dieser Frage widmen. Die chronologische Form wird hier der Aufzeichnung der wichtigsten Etappen dieses Prozesses nützlich sein, zu dem die russische Fraktion der Arbeiterbewegung ihren Beitrag für das Verständnis des Proletariats insgesamt leistete.
1903: Die Spaltung in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands in Bolschewiki und Menschewiki lässt sich nicht einfach auf die Organisationsfrage einer Arbeiterpartei unter den repressiven Umständen des Zarismus zurückführen. Bis zu einem gewissen Grade kann in Russland schon auf die totalitären Umstände vorgegriffen werden, mit denen die Arbeiterklasse in der bevorstehenden revolutionären Epoche konfrontiert sein wird, einer Epoche, in der es der Arbeiterklasse nicht mehr möglich sein wird, dauerhafte Massenorganisationen aufrechtzuerhalten. Russland nämlich sieht sich, der eigenen Rückständigkeit zum Trotze, einem stark konzentrierten Proletariat gegenüber und ist unfähig, die Arbeiterbewegung in einen legalen und demokratischen Rahmen zu zwingen. Lenin verwirft das menschewistische Konzept einer „breiten“ Arbeiterpartei und besteht auf der Notwendigkeit einer disziplinierten Partei von militanten Revolutionären mit einem eindeutigen Programm. Lenin greift demnach schon auf die Organisationsform der Partei vor, die ihre allgemeine Notwendigkeit in der Epoche erhält, in welcher der unmittelbare Kampf für die Revolution an die Stelle des Kampfes um Reformen innerhalb der bürgerlichen Ordnung tritt.
1905: „Die heutige russische Revolution steht auf einem Punkt des geschichtlichen Weges, der bereits über den Berg, über den Höhepunkt der kapitalistischen Gesellschaft hinweggeschritten ist“ (Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, Werke Bd. 2, S. 149). Mit seinen Massenstreiks und der Entdeckung der Sowjets als Organisationsform kündigt das russische Proletariat das Herannahen der neuen Epoche an, in der die alten gewerkschaftlichen Methoden unbrauchbar sein würden. Während Rosa Luxemburg mit prägnanter Schärfe die Dynamik des Massenstreiks aufzeigt, beginnt seinerseits der linke Flügel der russischen Sozialdemokratie die ersten Lehren aus den Ereignissen von 1905 zu ziehen: Lenin unterstreicht die dialektische Beziehung zwischen der Partei, der Organisation der Minderheit der Revolutionäre, und den Sowjets. In ihrer Eigenschaft als allgemeines Organ der Gesamtheit der Klasse stellen die Sowjets die Grundlage einer revolutionären Diktatur dar. Lenins Position steht damit im Gegensatz zu derjenigen der „Super-Leninisten“, die unmittelbar nach dem Auftreten der Sowjets dazu aufrufen, sie in der Partei aufgehen zu lassen. Trotzki ist sich der Wichtigkeit der Sowjets noch deutlicher bewusst; sie sind für ihn die für den Massenstreik und den Kampf um die proletarische Macht geeignete Organisationsform. In seiner Theorie der permanenten Revolution nähert er sich der Schlussfolgerung an, dass die geschichtliche Entwicklung die Möglichkeit einer bürgerlichen Revolution in rückständigen Ländern wie Russland bereits hinter sich gelassen hat: Von nun an muss jede wahre Revolution von der Arbeiterklasse geführt werden, sich sozialistische Ziele aneignen und sich auf Weltebene ausdehnen.
1914–1916: Von allen gegen den weltweiten imperialistischen Krieg gerichteten proletarischen Strömungen sind die Bolschewiken um Lenin am klarsten. Lenin zeigt, dass es in diesem imperialistischen Massaker weder nationale noch demokratische oder fortschrittliche Ziele zu verteidigen gibt, und er ruft die Losung der „Verwandlung des imperialistischen Krieges in einen Bürgerkrieg“ aus. Er verwirft damit die Argumente der Sozialchauvinisten, die sich mit Marx’ Worten schmücken, nur um deren Geist zu ersticken. Der Krieg hat die Türen zu einer neuen Epoche geöffnet, wo die proletarische Revolution nunmehr kein weit entferntes Ziel ist, sondern unmittelbar auf der Tagesordnung der Geschichte steht. In seinem Buch Imperialismus, das höchste Stadium des Kapitalismus, beschreibt Lenin den imperialistischen Kapitalismus als ein im Niedergang begriffenes System. Zur gleichen Zeit zeigt Bucharins Buch Imperialismus und Weltwirtschaft, dass das Eintauchen des Kapitalismus in den Militarismus das Resultat der Schaffung einer Weltwirtschaft ist, welche die objektive Grundlage für eine höhere Produktionsform verbreitet hat, selbst nun aber sich als barbarisches Hindernis in den Weg ihrer Verwirklichung stellt. Diese These geht Hand in Hand mit derjenigen von Rosa Luxemburg über die historischen Grenzen des kapitalistischen Systems. Diese These, welche sie in ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals vertritt, bildet einen fundamentalen Bezugspunkt in unserer Broschüre. Wie Rosa Luxemburg erkennt auch Bucharin, dass in einer von imperialistischen Riesen geprägten Weltordnung die „nationalen Befreiungskämpfe“ jeglichen Sinn verloren haben. Schließlich zeigt die Arbeit Bucharins, dass er erfasst hat, welche Form diese neue kapitalistische Wirtschaft auf Weltebene annehmen wird: die eines Kampfes auf Leben und Tod zwischen riesigen „staatskapitalistischen Trusts“. Damit nimmt er vorweg, dass die im Krieg angenommene staatliche Form des Kapitals zur bewährten Organisationsform des Kapitals während seiner ganzen niedergehenden Periode wird.
1917: Von neuem zeigt das russische Proletariat die Einheit zwischen Theorie und Praxis. Es erhebt sich gegen den imperialistischen Krieg, stürzt den Zarismus, organisiert sich in Sowjets und richtet sich ein auf die revolutionäre Machtübernahme. Nun sieht sich Lenin konfrontiert mit der „alten Garde“ der Bolschewisten, welche sich an veraltete, aus einer vorhergehenden Periode stammende Formeln klammern. Um diesen entgegenzutreten, schreibt Lenin seine Aprilthesen, in denen er erklärt, dass das Ziel des Proletariats in Russland keine zwitterhafte „demokratische Revolution“ sein kann, sondern der proletarische Aufstand als erster Schritt zu einer sozialistischen Weltrevolution. Hier wiederum gilt die Oktoberrevolution als praktischer Beweis der marxistischen Methode, die von den Aprilthesen angewandt worden ist. Und es sind eben diese Aprilthesen, die von den „orthodoxen Marxisten“, die nicht zur Einsicht des Anbruchs einer neuen Periode gelangt sind, als „anarchistisch“ verachtet werden.
1919: In Moskau wird die Kommunistische Internationale ins Leben gerufen, als Schlüssel zur weltweiten Ausweitung der proletarischen Revolution. Die Plattform der Komintern bassiert auf der Anerkennung, dass „ein neues Zeitalter angebrochen ist – das Zeitalter des Niedergangs des Kapitalismus, seiner inneren Auflösung, das Zeitalter der proletarischen kommunistischen Revolution“ und dass in der Konsequenz das alte Minimalprogramm überholt ist, und mit ihm auch die von der Sozialdemokratie verwendeten Methoden zu dessen Umsetzung. Von da an galt der Begriff der Dekadenz des Kapitalismus als Grundstein des kommunistischen Programms.
1920–27: Die Tatsache, dass die Ausdehnung der Revolution gescheitert ist, ebnet der Bürokratisierung des russischen Staates und der bolschewistischen Partei den Weg. Letztere identifiziert sich fälschlicherweise mit dem russischen Staat. Ein Prozess innerer Konterrevolution beginnt, der seinen Höhepunkt Ende der 20er Jahre im Triumph des Stalinismus erreicht. Doch gegen die Degenerierung der bolschewistischen Partei und der von ihr dominierten Kommunistischen Internationalen bildet sich Widerstand von Seiten der Linkskommunisten in Ländern wie Deutschland, Italien und Russland selbst. Die kommunistische Linke verwirft die Tendenz, alte sozialdemokratische Praktiken wieder zu beleben. Demnach richtet sie sich gegen den Parlamentarismus und gegen Allianzen mit ehemaligen, mittlerweile aber ins bürgerliche Lager übergegangenen sozialistischen Parteien. In Russland zum Beispiel gibt es die Arbeitergruppe Miasnikovs, die 1923 gegründet wird. Sie bringt besonders deutlich ihre Ablehnung der Taktik der Einheitsfront der Kommunistischen Internationale zum Ausdruck. Gleichzeitig kritisiert diese Gruppe den Verlust der politischen Kontrolle des Proletariats über den „Sowjetstaat“. Als die Stalinisten ihren Sieg ausbauen, sind die russischen Linkskommunisten unter den ersten, die begreifen, dass der Stalinismus einzig die bürgerliche Konterrevolution verkörpert. Sie sehen, das sich die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse selbst in einer vollkommen verstaatlichten Wirtschaft erhalten können.
1928–1945: Eine ganze Generation von Revolutionären wird durch den stalinistischen Terror vernichtet oder verbannt. Die politische Stimme der russischen Arbeiterklasse ist während Jahrzehnten zum Schweigen verdammt. Damit fällt die Aufgabe, die notwendigen Lehren aus dieser Niederlage zu ziehen und das Wesen und die Charakteristiken des stalinistischen Regimes zu verstehen, den Linkskommunisten in Europa und Amerika zu. Dies ist keine leichte Aufgabe. Es muss mit zahlreichen irrigen Theorien abgerechnet werden, so zum Beispiel mit der Theorie Trotzkis vom „entarteten Arbeiterstaat“, bevor die wesentliche Essenz aus dieser Erfahrung wirklich gefasst werden kann: Das bedeutet, dass das stalinistische Regime des integralen Staatskapitalismus mit seinem totalitären politischen Apparat und seiner auf den Krieg ausgerichteten Wirtschaft vor allem ein Produkt des dekadenten Kapitalismus ist. Denn der Kapitalismus dieser Epoche ist ein vom Krieg lebendes System. In dieser Epoche stützt sich der Kapitalismus auf den Staat, um einen explosiven Ausbruch der tiefer liegenden ökonomischen und sozialen Widersprüche zu verhindern. Die kommunistische Linke widerlegt deutlich die Illusionen über einen stalinistischen Staatskapitalismus, der einen Weg zur Lösung dieser Widersprüche verkörpern oder dem Kapital sogar ein zunehmendes Wachstum ermöglichen würde. Die kommunistische Linke zeigt deutlich die schrecklichen sozialen Kosten, welche die stalinistische Industrialisierung in den 30er Jahren gefordert hat. Letztere hat die Voraussetzungen für nur noch zerstörerische imperialistische Konflikte geschaffen. Die gierige Beteiligung der UdSSR an der zweiten Aufteilung des Erdballs bestätigt die Argumente der kommunistischen Linken, wonach das stalinistische Regime sehr wohl seine eigenen Appetite hat. Es ist eine Bestätigung der kommunistischen Linken in ihrer Ablehnung jeglicher Zugeständnisse gegenüber Trotzkis Aufforderung zur „Verteidigung der UdSSR gegen imperialistische Angriffe“.
1945–1989: Die Sowjetunion wird zum Führer einer der beiden imperialistischen Blöcke, die mit ihren Rivalitäten die internationale Lage während vier Jahrzehnten dominieren werden. Dabei ist der stalinistische Block weit weniger entwickelt als sein westlicher Rivale. Er ist eingeschränkt durch die Last eines enormen Militärsektors, zu unbeweglich in seinen politischen und wirtschaftlichen Strukturen, als dass er sich den Forderungen des kapitalistischen Weltmarkts anpassen könnte. Dies zeigen wir auch in unseren Thesen über die ökonomische und politische Krise im Ostblock, die als Anhang in eben dieser Broschüre erscheinen. Ende der 60er Jahre bricht die Wirtschaftskrise des Kapitalismus einmal mehr offen aus, nachdem sie in der Nachkriegszeit von der Wiederaufbauperiode überschattet gewesen ist. Die Krise versetzt der UdSSR und ihren Satellitenstaaten unaufhörlich Rückschläge. Dabei ist der stalinistische Apparat unfähig, auch nur die geringste wirtschaftliche oder politische „Reform“ umzusetzen, ohne dass sein gesamtes Gefüge in Frage gestellt würde. Zudem ist es ihm unmöglich, Kriegsmobilisierungen durchzuführen, da er sich nicht auf die Loyalität des eigenen Proletariats stützen kann (als konkreter Beweis dazu dient der Massenstreik in Polen 1980). Somit zerfällt das stalinistische Gebäude unter der Last seiner Widersprüche. Entgegen der lügnerischen Propaganda über den Untergang des Kommunismus ist es in Tat und Wahrheit ein besonders schwacher Teil der weltweiten kapitalistischen Wirtschaft, der zusammenbricht, einer Wirtschaft, die insgesamt keine Lösung auf ihre historische Krise finden kann.
1989: Der Untergang des russischen Blocks führt zur schnellen Auflösung des Westblocks, dem es nun an einem „gemeinsamen Feind“ mangelt, um seine Geschlossenheit begründen zu können. Diese enorme Veränderung der Weltlage bedeutete den Eintritt des dekadenten Kapitalismus in eine neue und zugleich in seine letzte Phase, die Phase des Zerfalls. Die wichtigsten Merkmale dieser Phase werden ebenfalls von den „Thesen“ im Anhang dieser Broschüre beleuchtet. Hier beschränken wir uns darauf, die Lage in Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion als charakteristisch für diese neue Phase zu bezeichnen: Auf internationaler Ebene, während nun ein chaotischer Kampf des Jeder-gegen-jeden an die Stelle der ehemals bipolaren imperialistischen Rivalitäten getreten ist, verteidigt Russland weiterhin seine imperialistischen Ziele, wenn auch weniger „übermütig“ als früher. Auf nationaler Ebene droht die territoriale Einheit Russlands aufgrund nationalistischer Aufstände und zahlreicher mörderischer Kriege wie gegenwärtig in Tschetschenien auseinander zu brechen; auf wirtschaftlicher Ebene geht der Mangel an jeglicher finanzieller Stabilität einher mit der Arbeitslosigkeit und einer galoppierenden Inflation; auf sozialer Ebene gibt es einen beschleunigten Zerfall der Infrastruktur, eine immerzu wachsende Umweltverschmutzung, eine zunehmende Zahl an psychisch Erkrankten und Drogenabhängigen, einen Zuwachs an kriminellen Banden auf allen Stufen, auch auf den höchsten Verwaltungs- und Regierungsebenen.
Dieser innere Zerfallsprozess bewirkt, dass viele Menschen sich sehnsüchtig an die „guten alten Zeiten“ des Stalinismus erinnern. Aber es kann keinen Schritt zurück mehr geben: In allen Ländern ist der Kapitalismus heute ein System in tödlicher Krise. In schreiender Weise stellt es die Menschheit vor die Alternative zwischen dem Versinken in der Barbarei und der kommunistischen Weltrevolution. Das gegenwärtige Wiedererwachen revolutionärer Elemente in Russland zeigt deutlich, dass die Alternative der kommunistischen Weltrevolution von der sich auf dem Vormarsch befindenden Barbarei nicht für allemal begraben werden konnte.
Unsere Absicht in diesem Vorwort ist es gewesen zu zeigen, dass das Konzept der Dekadenz des Kapitalismus der russischen Arbeiterbewegung keineswegs fremd ist, ebenso wenig wie der Begriff des Kommunismus. Es ist heute die Aufgabe der neuen Generation der Revolutionäre in Russland, die Theorie den stalinistischen Räubern zu entwinden und sie der Arbeiterklasse in Russland und der restlichen Welt zurück zu geben.
IKS, Februar 2001
Fußnoten:
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue 32
- 2841 Aufrufe
160 Jahre nach der Veröffentlichung des Aufsatzes Zur Judenfrage
- 6464 Aufrufe
Marx und die Judenfrage
In der Ausgabe unserer Revue International Nr. 113 (franz./engl./span. Ausgabe) veröffentlichten wir einen Artikel über Polanskis Film Der Pianist, dessen Thema der Aufstand im Warschauer Ghetto 1943 und der Genozid der europäischen Juden durch die Nazis war. 60 Jahre nach dem unbeschreiblichen Horror dieses Vernichtungsfeldzuges könnte man der Ansicht sein, dass der Antisemitismus eine Sache der Vergangenheit ist – die Konsequenzen des antijüdischen Rassismus sind so klar, dass er eigentlich ein für allemal diskreditiert sein müsste. Und dennoch ist dies überhaupt nicht der Fall. Tatsächlich sind die alten antisemitischen Ideologien so schädlich und weit verbreitet wie ehedem, selbst wenn sich ihr Hauptschwerpunkt von Europa in die „muslimische“ Welt und insbesondere zum „islamischen Fundamentalismus“ verschoben hat, der von Osama bin Laden personifiziert wird, welcher in all seinen Verkündungen nie vergisst, die „Kreuzzügler und Juden“ als Feinde des Islams und als willkommene Ziele von Terroranschlägen zu attackieren. Ein typisches Beispiel für diese „islamische“ Version des Antisemitismus ist die Website von „Radio Islam“, dessen Motto „Rasse? Nur eine menschliche Rasse“ lautet. Die Website behauptet, gegen alle Formen des Rassismus gerichtet zu sein, doch bei näherer Inaugenscheinnahme wird deutlich, dass sie sich hauptsächlich mit „dem jüdischen Rassismus gegen Nicht-Juden“ beschäftigt; in der Tat ist dies ein Archiv klassischer antisemitischer Traktate, von den Protokollen der Weisen von Zion, einer zaristischen Fälschung aus dem späten 19. Jahrhundert, die vorgeben, die Aufzeichnungen eines Treffens jüdischer Weltverschwörer zu sein, bis hin zu Hitlers Mein Kampf und den aktuelleren Hetzschriften des Führers der ¸Nation of Islam‘ in den USA, Louis Farrakhan.
Solche öffentlichkeitswirksamen Unternehmungen – und sie nehmen heute massive Ausmasse an – demonstrieren, dass die Religion zu einer der Hauptvehikel für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, für das Schüren pogromartiger Verhaltensweisen, für die Spaltung der Arbeiterklasse und der Unterdrückten allgemein geworden ist. Und wir sprechen hier nicht bloss von Ideen, sondern über ideologische Rechtfertigungen wirklicher Massaker, ob sie nun die orthodoxen Serben, die katholischen Kroaten oder die bosnischen Moslems in Ex-Jugoslawien, die Protestanten und Katholiken in Ulster, die Moslems und Christen in Afrika und Indonesien, die Hindus und Moslems in Indien oder die Juden und Moslems in Israel/Palästina betreffen.
In zwei früheren Artikeln in der Internationalen Revue – „Resurgent Islam, a symptom of the decomposition of capitalist social relations“ (International Review Nr. 109, franz./engl./span. Ausgabe) und „Marxism’s fight against religion: economic slavery is the source of the religious mystification“ (International Review Nr. 110, franz./engl./span. Ausgabe) – zeigten wir, dass dieses Phänomen ein realer Ausdruck des fortgeschrittenen Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft ist. In diesem Artikel wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Juden richten. Nicht nur, weil vor 160 Jahren, 1843, Karl Marx seinen berühmten Aufsatz Zur Judenfrage veröffentlicht hat, sondern auch, weil Marx, dessen gesamtes Leben der Sache des proletarischen Internationalismus gewidmet war, heute als Theoretiker des Antisemitismus zitiert wird – normalerweise, aber nicht immer missbilligend. Auch hier ist die Website von Radio Islam sehr anschaulich: Auf ihr erscheint der Aufsatz von Marx auf derselben Seite wie die Protokolle der Weisen von Zion, obwohl die Website auch Stürmer-ähnliche Karikaturen veröffentlicht, in denen Marx beschimpft wird, weil er selbst ein Jude ist.
Diese Beschuldigung gegen Marx ist nicht neu. Der Aufsatz von Marx wurde 1960 von Dagobert Runes unter dem neuen Titel Eine Welt ohne Juden veröffentlicht. Darin wird behauptet, dass Marx ein früher Protagonist der „Endlösung“ des jüdischen Problems gewesen sei. In der jüngeren Geschichte der Juden erhob der rechte britische Intellektuelle Paul Johnson ähnliche Anschuldigungen und zögerte nicht, eine antisemitische Komponente in dem blossen Wunsch nach Abschaffung des Kaufens und Verkaufens als gesellschaftliche Grundlage zu finden. Zumindest sei Marx ein „sich selbst hassender“ Jude (heute öfter denn je ein Attribut, das das jüdische Establishment jedem jüdischen Nachkommen anheftet, der sich kritisch gegenüber dem israelischen Staat verhält).
Gegenüber all diesen grotesken Verzerrungen ist es unser Ziel in diesem Artikel nicht nur Marx gegenüber denjenigen zu verteidigen, die danach trachten, ihn gegen seine eigenen Prinzipien benutzen, sondern auch zu zeigen, dass das Werk von Marx den einzigen Ausgangspunkt bildet, um das Problem des Antisemitismus zu verstehen und zu überwinden.
Der historische Kontext von Marx‘ Aufsatz Zur Judenfrage
Es macht keinen Sinn, Marx’ Aufsatz ausserhalb seines historischen Kontexts zu präsentieren oder zu zitieren. Zur Judenfrage wurde im Rahmen des allgemeinen Kampfes für den politischen Wechsel im halbfeudalen Deutschland geschrieben. Die Debatte darüber, ob Juden dieselben Bürgerrechte wie dem Rest der Bevölkerung Deutschlands eingeräumt werden sollten, war ein Aspekt in diesem Kampf. Als Herausgeber der Rheinischen Zeitung hatte Marx ursprünglich beabsichtigt, eine Antwort auf die offen reaktionären, antisemitischen Schriften eines gewissen Hermes zu verfassen, der die Juden im Ghetto halten und die christliche Basis des Staates bewahren wollte. Doch nachdem der Linkshegelianer Bruno Bauer mit zwei Essays, Die Judenfrage und Die Fähigkeit der heutigen Juden und Christen, frei zu werden, in den Ring getreten war, fühlte Marx, dass es wichtiger war, gegen das zu polemisieren, was er als den falschen Radikalismus in Bauers Sichtweise ansah.
Wir sollten dabei in Erinnerung rufen, dass in dieser Phase seines Lebens Marx sich im Übergang vom Radikaldemokraten zum Kommunisten befand. Er war im Pariser Exil und gelangte unter den Einfluss französischer kommunistischer Handwerker (vgl. „How the proletariat won Marx to communism“, International Review Nr. 69, franz./engl./span. Ausgabe); in der zweiten Hälfte von 1843 identifizierte er in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie das Proletariat als Träger einer neuen Gesellschaft. 1844 traf er Engels, der ihm half, die Wichtigkeit des Verständnisses der ökonomischen Grundlagen des gesellschaftlichen Lebens zu sehen; die Ökonomischen und philosophischen Manuskripte, im gleichen Jahr verfasst, waren sein erster Versuch, all diese Entwicklung in ihrem wahren Ausmass zu begreifen. 1845 schrieb er die Thesen über Feuerbach, die seinen definitiven Bruch mit dem einseitigen Materialismus von Letzterem ausdrückten.
Die Polemik mit Bauer über die Frage der Bürgerrechte und der Demokratie, in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern veröffentlicht, waren ohne Frage ein Moment in diesem Übergang.
Zu jener Zeit war Bauer ein Sprecher der „Linken“ in Deutschland, obwohl der Keim seiner späteren Entwicklung zu den Rechten bereits in seiner Haltung gegenüber der jüdischen Frage bemerkbar war, als er eine scheinradikale Position einnahm, die letztlich als Entschuldigung dafür endete, nichts zu tun, um den Status quo zu ändern. Laut Bauer war es sinnlos, die politische Emanzipation für die Juden in einem christlichen Staat zu fordern. Es sei sowohl für die Christen als auch für die Juden zunächst notwendig, ihren Glauben und ihre religiöse Identität aufzugeben, um eine wirkliche Emanzipation zu erlangen; in einem wahrhaft demokratischen Staat gebe es kein Bedürfnis nach religiöser Ideologie. In der Tat, wenn überhaupt, dann seien es die Juden, die dabei weitergehen müssen als die Christen: Aus der Sicht der Linkshegelianer war das Christentum die letzte religiöse Hülle, in der sich der Kampf für die Emanzipation des Menschen historisch ausgedrückt hat. Da sie die universalistische Botschaft des Christentums ablehnen, müssten die Juden zwei Schritte tun, während die Christen nur einen machen müssten.
Der Übergang von dieser Sichtweise zu Bauers späterem offenen Antisemitismus ist nicht schwer zu sehen. Marx mag dies gut gespürt haben, doch seine Polemik fängt mit der Verteidigung der Position an, dass das Zugeständnis „normaler“ Bürgerrechte gegenüber den Juden, was er „politische Emanzipation“ nennt, „ein grosser Schritt nach vorn“ sei; in der Tat war sie ein Zug früherer bürgerlicher Revolutionen (Cromwell hatte es den Juden gestattet, nach England zurückzukehren, und der napoleonische Code civile gestand den Juden Bürgerrechte ein). Sie sei Teil eines allgemeineren Kampfes, um die feudalen Barrieren zu beseitigen und einen modernen demokratischen Staat zu schaffen, der insbesondere in Deutschland mittlerweile lange überfällig sei.
Doch Marx war sich bereits darüber bewusst, dass der Kampf für politische Demokratie nicht das endgültige Ziel war. Zur Judenfrage scheint einen bedeutsamen Fortschritt gegenüber einem Text darzustellen, der kurz zuvor geschrieben worden war, die Kritik der Hegelschen Staatstheorie. In diesem Text treibt Marx den Gedanken der Radikaldemokratie bis ins Äusserste, indem er argumentierte, dass wahrhafte Demokratie – allgemeines Wahlrecht – die Auflösung des Staates und der zivilen Gesellschaft bedeuten würde. Im Gegensatz dazu behauptet Marx in Zur Judenfrage, dass eine rein politische Emanzipation – er benutzt gar den Begriff der „vollendeten Demokratie“ – viel zu wenig sei für eine wirkliche menschliche Emanzipation.
In diesem Text erkennt Marx deutlich an, dass die zivile Gesellschaft eine bürgerliche Gesellschaft ist – eine Gesellschaft von isolierten Egos, die auf dem Markt gegeneinander konkurrieren. Es ist eine Gesellschaft der Entfremdung (Es war der erste Text, in dem Marx diesen Begriff benutzte), in der die Mächte, die vom Menschen selbst in Bewegung gesetzt wurden – nicht nur die Macht des Geldes, sondern auch die Staatsmacht selbst – unvermeidlich zu fremden Mächten werden, die das Leben des Menschen beherrschen. Dieses Problem wird nicht durch die Errichtung der politischen Demokratie und der Menschenrechte gelöst. Diese basieren noch immer mehr auf dem Gedanken des atomisierten Bürgers statt auf dem einer wahrhaftigen Gemeinschaft. „Keines der sogenannten Menschenrechte geht also über den egoistischen Menschen hinaus, über den Menschen, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich auf sich, auf sein Privatinteresse und seine Privatwillkür zurückgezogenes und vom Gemeinwesen abgesondertes Individuum ist. Weit entfernt, dass der Mensch in ihnen als Gattungswesen aufgefasst wurde, erschien vielmehr das Gattungsleben selbst, die Gesellschaft, als ein den Individuen äusserlicher Rahmen, als Beschränkung ihrer ursprünglichen Selbständigkeit. Das einzige Band, das sie zusammenhält, ist die Naturnotwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigentums und ihrer egoistischen Person“ (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 366).
Ein weiterer Beweis dafür, dass Entfremdung nicht als Ergebnis der politischen Demokratie verschwindet, war, wie Marx hervorhob, das Beispiel Nordamerikas, wo die Religion formal vom Staat getrennt wurde und dennoch Amerika das Land der religiösen Überwachung und der religiösen Sekten par excellence war.
Also: Während Bauer argumentierte, dass es Zeitverschwendung sei, für die politische Emanzipation der Juden als solche zu kämpfen, verteidigte und unterstützte Marx diese Forderung:
„Wir sagen also nicht mit Bauer den Juden: Ihr könnt nicht politisch emanzipiert werden, ohne euch radikal vom Judentum zu emanzipieren. Wir sagen ihnen vielmehr: Weil ihr politisch emanzipiert werden könnt, ohne euch vollständig und widerspruchslos vom Judentum loszusagen, darum ist die politische Emanzipation selbst nicht die menschliche Emanzipation. Wenn ihr Juden politisch emanzipiert werden wollt, ohne euch selbst menschlich zu emanzipieren, so liegt die Halbheit und der Widerspruch nicht nur in euch, sie liegt in dem Wesen und der Kategorie der politischen Emanzipation“ (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 361). Konkret bedeutet dies für Marx, dass er das Gesuch der lokalen jüdischen Gemeinde, eine Petition zugunsten der Bürgerrechte für Juden zu schreiben, akzeptierte. Diese Vorgehensweise gegenüber politischen Reformen sollte zur charakteristischen Haltung der Arbeiterbewegung während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus werden. Doch Marx blickte bereits auf den weiteren Verlauf der Geschichte – auf die zukünftige kommunistische Gesellschaft –, selbst wenn dies nicht ausdrücklich in Zur Judenfrage gesagt worden war. Dies ist die Schlussfolgerung am Ende des ersten Teils seiner Antwort auf Bauer. „Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine ¸forces propre‘ (eigene Kräfte) als gesellschaftliche Kräfte erkannt und organisiert hat und daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt, erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht“ (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 370).
Marx‘ angeblicher Antisemitismus
Es ist der zweite Teil des Textes, in dem er auf Bauers zweiten Artikel antwortet, der Marx in die Schusslinie der verschiedensten Richtungen geraten liess und der von der neuen Welle des islamischen Antisemitismus dafür missbraucht wird, um dessen obskure Weltsicht zu stützen. „Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld. (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 372). „Das Geld ist der eifrige Gott Israels, vor welchem kein anderer Gott bestehen darf. Das Geld erniedrigt alle Götter des Menschen – und verwandelt sie in eine Ware. Das Geld ist der allgemeine, für sich selbst konstituierte Wert aller Dinge. Es hat daher die ganze Welt, die Menschenwelt wie die Natur, ihres eigentümlichen Wertes beraubt. Das Geld ist das dem Menschen entfremdete Wesen seiner Arbeit und seines Daseins, und dies fremde Wesen beherrscht ihn, und er betet es an. (...) Der Gott des Juden hat sich verweltlicht, er ist zum Weltgott geworden. Der Wechsel ist der wirkliche Gott des Juden. Sein Gott ist nur der illusorische Wechsel“ (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 374/375).
Diese und andere Passagen in Zur Judenfrage sind aufgegriffen worden, um zu beweisen, dass Marx einer der Gründungsväter des modernen Antisemitismus sei, dessen Essay dem rassistischen Mythos des Blut saugenden jüdischen Parasiten Respekt verleiht.
Es ist wahr, dass viele der Formulierungen, die Marx in diesem Abschnitt benutzt, heute nicht mehr auf dieselbe Weise verwendet werden können. Es trifft auch zu, dass weder Marx noch Engels völlig frei von bürgerlichen Vorurteilen waren und dass einige ihrer Verkündungen über besondere Nationalitäten dies widerspiegeln. Aber daraus zu schliessen, dass Marx und der Marxismus unauslöschlich besudelt sind mit dem Rassismus, ist ein Zerrbild seiner Gedanken.
All diese Ausdrücke müssen in ihrem historische Zusammenhange betrachtet werden. Wie Hal Draper im Anhang seines Buches Karl Marx’s Theory of Revolution, Bd. 1 (Monthly Review Press, 1977) erläutert, war die Identifizierung des Judentums mit dem Handel bzw. mit dem Kapitalismus Teil der damaligen Sprache und wurde von einer ganzen Reihe von radikalen und sozialistischen Denkern übernommen, einschliesslich jüdischer Radikaler wie Moses Hess, der zu jener Zeit Einfluss auf Marx (und tatsächlich auf den Aufsatz Zur Judenfrage) hatte.
Trevor Ling, ein Religionshistoriker, kritisierte Marx‘ Aufsatz von einer anderen Seite her: „Marx hatte einen beissenden journalistischen Stil und schmückte seine Seiten mit vielen cleveren und satirischen Redewendungen aus. Seine Schreibweise, von der gerade Beispiele gegeben wurden, ist ein guter, kraftvoller Flugblattstil und beabsichtigte zweifellos, das Blut in Wallung zu bringen, aber hat wenig auf dem Gebiet einer nützlichen soziologischen Analyse zu bieten. Solche groben Oberflächlichkeiten wie ¸Judentum‘ und ¸Christentum‘ entsprechen, wenn sie in dieser Art von Zusammenhang gebracht werden, nicht den historischen Realitäten.; sie sind das Etikett Marx´ eigener, krankhafter Konstrukte“ (T. Ling, Karl Marx and Religion, Macmillan Press, 1980; eigene Übersetzung). Doch ein paar beissende Redewendungen von Marx schaffen üblicherweise schärfere Mittel, um eine Frage tiefgründiger zu untersuchen, als die studierten Abhandlungen der Akademiker. Jedenfalls versucht Marx hier keineswegs, eine Geschichte der jüdischen Religion zu schreiben, die natürlich nicht auf eine blosse Rechtfertigung des Kommerzes reduziert werden kann, nicht zuletzt deshalb, weil ihre antiken Ursprünge in einer gesellschaftlichen Ordnung liegen, in den Geldbeziehungen eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hatten und ihr Inhalt auch die Existenz von Klassenteilungen unter den Juden selbst widerspiegelt hatte (zum Beispiel in den Schmähschriften der Propheten gegen die Korruption der herrschenden Klasse im altertümlichen Israel). Wie wir gesehen haben, benutzt Marx, nachdem er das Bedürfnis der jüdischen Bevölkerung nach denselben „Bürgerrechten“ wie alle anderen Bürger verteidigt hat, die verbale Analogie zwischen Judentum und Warenverhältnisse dazu, um eine Gesellschaft zu fordern, die frei von Warenbeziehungen ist. Dies ist die wirkliche Bedeutung seiner abschliessenden Äusserung: „Die gesellschaftliche Emanzipation des Juden ist die Emanzipation der Gesellschaft vom Judentum.“ (K. Marx, Zur Judenfrage, 1843, Werke Bd. 1, S. 377). Dies hat nichts mit irgendwelchen Komplotten zur physischen Ausrottung der Juden zu tun trotz Dagobert Runes widerlichen Andeutungen; es bedeutet, dass, solange die Gesellschaft von den Warenbeziehungen beherrscht wird, die menschlichen Wesen nicht ihre eigenen gesellschaftlichen Kräfte erobern können und entfremdet von allen anderen bleiben.
Gleichzeitig schuf Marx das Fundament für eine materialistische Analyse der jüdischen Frage – ein Werk, das von späteren Marxisten wie Kautsky und insbesondere Abraham Leon[1] fortgesetzt wurde. Marx hebt im Gegensatz zur idealistischen Erklärung, die versuchte, das hartnäckige Überleben der Juden als Folge ihrer religiösen Überzeugung zu erklären, hervor, dass das Überleben ihrer abgesonderten Identität nur auf der Basis ihrer wahren Rolle in der Geschichte erklärt werden kann: „Das Judentum hat sich nicht trotz der Geschichte, sondern durch die Geschichte erhalten.“ (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 374). Und dies ist in der Tat verknüpft mit der Verbindung zwischen Juden und Geschäft: „Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden.“ (K. Marx, Zur Judenfrage, Werke Bd. 1, S. 372). Und hier benutzt Marx das Wortspiel des Judentums als Religion und des Judentums als Synonym für Handels- und Finanzmacht, das auf einen realistischen Kern fusste: die besondere sozio-ökonomische Rolle, die die Juden innerhalb des alten feudalen Systems gespielt hatten.
Leon gründet in seinem Buch Die jüdische Frage – eine marxistische Interpretation seine gesamte Untersuchung auf diese wenigen klaren Sätze in Zur Judenfrage und auf eine weitere Stelle im Kapital, in der „… die Juden in den Poren der polnischen Gesellschaft“ (K. Marx, Das Kapital, Werke Bd. 25, S. 342), verglichen werden mit den anderen „Handelsvölkern“ in der Geschichte. Ausgehend von den paar Brocken entwickelt er den Gedanken, dass die Juden in der antiken Gesellschaft und im Feudalismus als eine „Volksklasse“ fungierten, die sich grösstenteils auf Handels- und Geldbeziehungen in Gesellschaften beschränkte, die vornehmlich auf Naturalwirtschaft basierten. Besonders im Feudalismus war dies in religiösen Gesetzen kodifiziert, die es den Christen untersagten, Wucher zu treiben. Aber Leon hat Auch gezeigt, dass das Verhältnis des Juden zum Geld nicht immer nur auf den Wucher begrenzt war. Sowohl in der Antike als auch in der Feudalgesellschaft waren die Juden ein ausgeprägtes Handelsvolk und personifizierten die Warenbeziehungen, die noch nicht über die Wirtschaft herrschten, dafür aber die versprengten Gemeinschaften verbanden, in denen die Produktion grösstenteils für den direkten Verbrauch bestimmt war und die Masse des gesellschaftlichen Mehrwerts von der herrschenden Klasse direkt angeeignet und konsumiert wurde. Diese eigentümliche sozio-ökonomische Funktion (die natürlich eine allgemeine Tendenz war und nicht ein absolutes Gesetz für alle Juden) schuf die materielle Basis für das Überleben der jüdischen Gesellschaft innerhalb der feudalen Gesellschaft. Da, wo Juden andere Tätigkeiten ausübten, neigten sie allerdings schnell dazu, sich zu assimilieren.
Doch dies heisst nicht, dass die Juden die ersten Kapitalisten waren (ein Punkt, der im Aufsatz von Marx noch nicht richtig klar war, weil er die Natur des Kapitals noch nicht völlig begriffen hatte); im Gegenteil, es war der Aufstieg des Kapitalismus, der mit einigen der schlimmsten Phasen der antisemitischen Verfolgungen zusammenfiel. Im Gegensatz zum zionistischen Mythos, dass die Verfolgung der Juden eine Konstante in der gesamten Geschichte gewesen sei – und dass sie sich niemals davon frei machen könnten, solange sie sich nicht in einem eigenen Land sammeln[2] –, zeigt Leon auf, dass die Juden, solange sie eine „nützliche“ Rolle in diesen vorkapitalistischen Gesellschaften spielten, normalerweise toleriert und oft besonders geschützt wurden von den Monarchen, die deren finanzielle Geschicke und Dienste benötigten. Erst das Auftreten einer „einheimischen“ Händlerklasse, die begann, ihre Profite zu nutzen, um sie in die Produktion zu investieren (z.B. der englische Wollhandel, Schlüssel zum Ursprung der englischen Bourgeoisie), brachte das Unheil über die Juden, die nun eine überlebte Form der Warenwirtschaft verkörperten und als ein Hindernis bei der Entwicklung ihrer neuen Formen betrachtet wurden. Dies zwang immer mehr jüdische Händler in die einzige ihnen offen stehende Geschäftsform – den Kreditwucher. Doch brachte diese Praxis die Juden in direkten Konflikt mit den Hauptschuldnern in der Gesellschaft – dem Adel auf der einen Seite und den kleinen Handwerkern und Bauern auf der anderen. Es ist zum Beispiel bedeutsam, dass die schlimmsten Pogrome gegen die Juden in Westeuropa in jener Periode stattfanden, als der Feudalismus zu zerfallen begann und der Kapitalismus sich im Aufstieg befand. In England wurden die Juden Yorks und anderer englischer Städte 1189–1190 niedergemetzelt und die gesamte jüdische Bevölkerung vertrieben. Oft wurden die Pogrome vom Adel provoziert, der den Juden grosse Geldbeträge schuldete und in den Kleinproduzenten willige Anhänger fand, die ebenfalls oft bei jüdischen Geldleihern in der Kreide standen; beide hofften, aus der Auslöschung oder Vertreibung der Kreditwucherer, aus der Schuldenaussetzung sowie aus der Inbesitznahme des Privateigentums derselben einen nutzen zu ziehen. Die jüdische Emigration von West- nach Osteuropa in der Morgendämmerung der kapitalistischen Entwicklung bedeutete einen Rückzug auf traditionellere, noch feudal dominierte Gebiete, wo die Juden zu ihrer eigenen, traditionelleren Rolle zurückkehren konnten; im Gegensatz dazu neigten jene Juden, die in Westeuropa zurückblieben, dazu, sich der sie umgebenden bürgerlichen Gesellschaft anzupassen. Besonders eine jüdische Fraktion der kapitalistischen Klasse (verkörpert durch die Rothschild-Familie) war das Produkt jener Periode; parallel dazu entwickelte sich das jüdische Proletariat, obgleich sich sowohl die östlichen als auch die westlichen jüdischen Arbeiter vornehmlich auf die Handwerksbereiche und nicht die Schwerindustrie konzentrierten und die Mehrheit der Juden weiterhin dem Kleinbürgertum, oft in Gestalt der Kleinhändler, angehörte.
Diese Schichten – kleine Händler, Handwerker, Arbeiter – wurden durch den Zerfall des Feudalismus im Osten und durch das Aufkommen einer kapitalistischen Infrastruktur, die bereits viele Züge ihres Verfalls offenbarte, ins tiefste Elend gestossen. Im späten 19. Jahrhundert gab es neue antisemitische Verfolgungen in Russland, die einen neuerlichen jüdischen Exodus, diesmal in den Westen, auslösten, was erneut das jüdische Problem in den Rest der Welt, besonders nach Deutschland und Österreich „exportierte“. Diese Periode war Zeuge der Entwicklung der zionistischen Bewegung, die von links bis nach rechts dafür stritt, dass sich die Lage des jüdischen Volkes niemals normalisieren werde, solange es keine eigene Heimat habe – ein Argument, dessen Sinnlosigkeit, laut Leon, durch den Holocaust selbst bestätigt wurde, da nichts von dem durch das Auftreten einer kleinen „jüdischen Heimat“ in Palästina verhindert werden konnte.[3]
Abraham Leon, der inmitten des Nazi-Holocausts schrieb, zeigt, wie der Antisemitismus, der sich in Nazieuropa ausbreitete, die Dekadenz des Kapitalismus ausdrückt. Auf der Flucht vor den zaristischen Verfolgungen fanden die jüdischen Immigrantenmassen in Westeuropa keinesfalls eine Oase des Friedens und der Ruhe vor, sondern eine kapitalistische Gesellschaft, die bald von unlösbaren Widersprüchen gepeinigt und vom Weltkrieg und von einer Weltwirtschaftskrise verwüstet werden sollte. Die Niederlage der proletarischen Revolution nach dem Ersten Weltkrieg öffnete nicht nur einer zweiten imperialistischen Schlächterei Tür und Tor, sondern auch einer Form der Konterrevolution, die uralte antisemitische Vorurteile bis zum Exzess ausnutzte, indem sie den antijüdischen Rassismus sowohl praktisch als auch ideologisch als eine Basis dafür nutzte, um die Ausmerzung der proletarischen Gefahr zu vervollständigen und die Gesellschaft auf einen neuen Krieg einzustimmen. Wie die Internationale Kommunistische Partei (IKP) in Auschwitz – Das grosse Alibi, so konzentriert sich Leon insbesondere auf den Nutzen, den die Nazis aus den Erschütterungen des Kleinbürgertums zogen, das von der kapitalistischen Krise ruiniert worden war und leichte Beute für eine Ideologie war, die ihm versprach, es nicht nur von seinen jüdischen Konkurrenten zu befreien, sondern ihm auch offiziell zu gestatten, seine Hände über das jüdische Privateigentum auszubreiten (selbst wenn der Nazistaat in der Praxis dem Kleinbürgertum keinesfalls gestattete, davon zu profitieren, sondern den Löwenanteil sich selbst aneignete, um eine totale Kriegswirtschaft zu entfalten und aufrechtzuerhalten).
Gleichzeitig betrachtet Leon die wiederholte Verwendung des Antisemitismus als einen Sozialismus für Narren, als eine falsche Kritik des Kapitalismus, die die herrschende Klasse in die Lage versetzte, gewisse Bereiche der Arbeiterklasse, besonders ihre Randschichten oder jene in die Arbeitslosigkeit Gestossenen, einzubeziehen. In der Tat war der Begriff des ¸National‘-Sozialismus eine der direkten Reaktionen der herrschenden Klasse auf die enge Verknüpfung zwischen der authentischen revolutionären Bewegung und einer Schicht von jüdischen Arbeitern und Intellektuellen, die, wie Lenin hervorgehoben hatte, als heimatlose und verfolgte Elemente der bürgerlichen Gesellschaft sich ganz natürlich zum internationalen Sozialismus hingezogen fühlten. Der internationale Sozialismus wurde als ein Trick der jüdischen Weltverschwörung gebrandmarkt und den Proletariern wurde auferlegt, ihren Sozialismus mit Patriotismus zu kombinieren. Es sollte auch erwähnt werden, dass diese Ideologie ihr Spiegelbild in der UdSSR hatte, wo die Kampagne der Andeutungen gegen den „entwurzelten Kosmopolitismus“ als Mantel für antisemitische Verleumdungen gegen die internationalistische Opposition gegen die Ideologie und Praxis des „Sozialismus in einem Land“ diente.
Dies unterstreicht, dass die Verfolgung der Juden auch auf ideologischer Ebene wirkt und eine rechtfertigende Ideologie benötigt; im Mittelalter war es der christliche Mythos vom Christusmörder, Brunnenvergifter, Ritualmörder christlicher Kinder: Shylock und das Pfund Fleisch.[4] In der Dekadenz des Kapitalismus ist es der Mythos von der jüdischen Weltverschwörung, die sowohl den Kapitalismus als auch den Kommunismus ausgeheckt habe, um den arischen Völkern ihre Herrschaft aufzuzwingen.
In den 1930er Jahren bemerkte Trotzki, dass der Niedergang des Kapitalismus einen fürchterlichen Rückgang auf ideologischer Ebene ausgebrütet hat:
„Der Faschismus entdeckte den Bodensatz der Gesellschaft für die Politik. Nicht nur in den Bauernhäusern, sondern auch in den Wolkenkratzern der Städte lebt neben dem zwanzigsten Jahrhundert heute noch das zehnte oder dreizehnte. Hunderte Millionen Menschen benutzen den elektrischen Strom, ohne aufzuhören, an die magische Kraft von Gesten und Beschwörungen zu glauben. Der römische Papst predigt durchs Radio vom Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein. Kinostars laufen zur Wahrsagerin. Flugzeugführer, die wunderbare, vom Genie des Menschen erschaffene Mechanismen lenken, tragen unter dem Sweater Amulette. Was für unerschöpfliche Vorräte an Finsternis, Unwissenheit, Wildheit! Die Verzweiflung hat sie auf die Beine gebracht, der Faschismus wies ihnen die Richtung. All das, was bei ungehinderter Entwicklung der Gesellschaft vom nationalen Organismus als Kulturexkrement ausgeschieden werden musste, kommt jetzt durch den Schlund hoch; die kapitalistische Zivilisation erbricht die unverdaute Barbarei. Das ist die Physiologie des Nationalsozialismus.“
Diese Elemente kommen alle in den Nazifantastereien über die Juden zusammen. Der Nationalsozialismus machte kein Hehl aus seiner ideologischen Rückentwicklung – er griff offen auf die vorchristlichen Gottheiten zurück. Der Nationalsozialismus war in der Tat eine okkultistische Bewegung, die die direkte Kontrolle über die Regierungsmittel ergriffen hatte; und wie andere Okkultismen betrachtete er sich in einer Schlacht mit einer anderen verborgenen und satanischen Macht – in diesem Fall mit den Juden. Und diese Mythologien, die sicherlich für sich genommen in all ihren psychologischen Aspekten betrachtet werden können, nahmen eine eigene Logik an und speisten den Moloch, der zu den Vernichtungslagern führte.
Jedoch ist diese ideologische Irrationalität niemals getrennt von den materiellen Widersprüchen des kapitalistischen Systems zu sehen – sie ist nicht, wie zahllose bürgerliche Denker zu argumentieren versuchen, der Ausdruck irgendeines metaphysischen Prinzips des Übels, irgendeines unergründlichen Mysteriums. Im Artikel über Polanskis Film Der Pianist in der Internationalen Revuer Nr. 113 zitierten wir die IKP über die kühl-kalkulierende „Vernunft“ hinter dem Holocaust – die Industrialisierung des Mordens, in der ein Maximum an Profit aus jeder Leiche ausgepresst wurde. Doch gibt es noch eine andere Dimension, auf die die IKP nicht eingeht: die Irrationalität des kapitalistischen Krieges selbst. Denn die „Endlösung“ – in der Metapher des Weltkriegs, der erst ihre Voraussetzung schuf – wird durch die ökonomischen Widersprüche provoziert und gibt nicht die Jagd nach Profiten auf, sondern wird zu einem zusätzlichen Faktor in der Verschlimmerung des wirtschaftlichen Ruins. Und auch wenn der Gebrauch von Zwangsarbeit durch die Kriegswirtschaft erforderlich wurde, so war andererseits die ganze Maschinerie der Konzentrationslager eine immense Belastung der deutschen Kriegsanstrengungen.
Die Lösung des jüdischen Problems
160 Jahre später bleibt die Essenz dessen, was Marx als Lösung für das jüdische Problem vorschlug, immer noch gültig: Die Abschaffung der kapitalistischen Verhältnisse und die Bildung einer wirklichen menschlichen Gemeinschaft. Natürlich ist dies auch für alle verbleibenden nationalen Probleme die einzig mögliche Lösung: Der Kapitalismus hat sich als unfähig erwiesen, sie zu lösen. Die jüngste Manifestation des jüdischen Problems, die auf besondere Weise mit dem imperialistischen Konflikt im Nahen Osten verknüpft ist, ist der beste Beweis dafür.
Die „Lösung“, die von der „jüdischen Befreiungsbewegung“, dem Zionismus, vorgeschlagen wird, ist zum Kern des Problems geworden. Die grösste Quelle der jüngsten Wiederbelebung des Antisemitismus ist weder direkt mit einer besonderen ökonomischen Funktion der Juden in den entwickelten Ländern verknüpft noch ein Problem der jüdischen Einwanderung in diese Regionen. Hier hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg der Rassismus auf die Einwanderungswellen aus den früheren Kolonien verschoben; mit der erst jüngst artikulierten Wut über die „Asylsuchenden“ richtet er sich zuallererst gegen die Opfer der ökonomischen, ökologischen und militärischen Verwüstung, die ein zerfallender Kapitalismus auf dem Planeten bewirkt. Der „moderne“ Antisemitismus ist in erster Linie mit dem Konflikt in Nahost verbunden. Israels unverhüllte imperialistische Politik in der Region und die unerschütterliche Unterstützung, die die USA dieser Politik gewähren, haben die alten Mythen von einer jüdischen Weltverschwörung neu entfacht. Millionen von Moslems sind von dem landläufigen Mythos überzeugt, dass „40.000 Juden am 11. September den Twin Towers fernblieben, weil sie im Voraus über den bevorstehenden Angriff gewarnt wurden“ – dass „die Juden es taten“. Ganz zu schweigen davon, dass diese Behauptung von Leuten begeistert aufgestellt wurde, die gleichzeitig Bin Laden verteidigen und zu den terroristischen Angriffen Beifall klatschen![5] Die Tatsache, dass etliche führende Mitglieder der Bush-Clique, die „Neokonservativen“, die heute die tatkräftigsten und ausdrücklichsten Advokaten des „neuen amerikanischen Jahrhunderts“ sind, Juden sind (Wolfowitz, Perle, etc.), ist Wasser auf diesen Mühlen, manchmal mit einem linken Touch versehen. In Grossbritannien gab es erst jüngst eine Kontroverse über die Tatsache, das Tam Dalyell, eine „Antikriegs-“Figur auf der Linken Labours, offen über den Einfluss der „jüdischen Lobby“ auf die US-Aussenpolitik und selbst auf Blair sprach; und er wurde gegen die Vorwürfe des Antisemitismus von Paul Foot von der Socialist Workers Party verteidigt, der lediglich bemängelte, dass er von Juden und nicht von Zionisten sprach. In der gegenwärtigen Praxis wird die Unterscheidung zwischen beiden in wachsendem Masse von den Abhandlungen der Nationalisten und Dschihadisten verwischt, die den bewaffneten Kampf gegen Israel anführen. In den 60er und 70er-Jahren behaupteten die PLO und ihre linksbürgerlichen Anhänger, dass sie in Frieden mit den Juden in einem demokratischen, säkularen Palästina zusammenleben wollen; doch heute ist die Ideologie der Intifada, nämlich der islamische Fundamentalismus, dominierend und macht keinen Hehl aus seinem Wunsch, die Juden aus der Region zu vertreiben oder sie geradewegs auszulöschen. Was den Trotzkismus anbelangt, stand er lange in den Reihen des nationalistischen Pogroms. Wir haben bereits Abraham Leons Warnung erwähnt, dass der Zionismus nichts tun konnte, um die Juden im kriegsumtobten Europa zu retten; heute können wir hinzufügen, dass die Juden, die am meisten von der physischen Zerstörung bedroht sind, just im Heiligen Land des Zionismus leben. Der Zionismus hat nicht nur ein riesiges Gefängnis für die palästinensischen Araber errichtet, die unter seinem erniedrigenden Regime der militärischen Besetzung und der brutalen Gewalt leben; er hat auch die israelischen Juden selbst in eine grauenhafte Spirale des Terrorismus und des Gegenterrors gesperrt, die kein imperialistischer „Friedensprozess“ aufzuhalten vermag.
Der Kapitalismus hat in seiner Dekadenz all die Dämonen des Hasses und der Zerstörung heraufbeschworen, die die Menschheit quälen, und sie mit den verheerendsten Waffen aller Zeiten ausgerüstet. Er hat dem Völkermord in einer nie dagewesenen Weise Vorschub geleistet und zeigt keinerlei Anzeichen, damit aufzuhören; trotz des Holocausts an den Juden, trotz der Rufe des „Nie-wieder!“ haben wir nicht nur die Wiederkehr eines virulenten Antisemitismus gesehen, sondern auch ethnische Massaker, die vergleichbar mit dem Holocaust sind wie das Gemetzel an Hunderttausenden von Tutsis in Ruanda innerhalb weniger Wochen sowie die endlosen Runden ethnischer Säuberungen auf dem Balkan, die in den 90er Jahren Jugoslawien verwüsteten. Die Wiederkehr des Genozids ist charakteristisch für den dekadenten Kapitalismus in seiner finalen Phase – jener des Zerfalls. Diese fürchterlichen Ereignisse verschaffen uns eine Ahnung von der Zukunft, die das Endspiel des Zerfalls in petto hält: die Selbstzerstörung der Menschheit. Und wie bei den Nazis in den 30er Jahren erblicken wir zusammen mit diesen Massakern die Rückkehr der reaktionärsten und apokalyptischsten Ideologien überall auf dem Planeten – der islamische Fundamentalismus, der sich auf Rassenhass und dem Mystizismus des Freitods gründet, ist der deutlichste Beleg hierfür, aber nicht der einzige: Wir können gleichermassen den christlichen Fundamentalismus anführen, der beginnt, Einfluss auf die höchsten Ränge der Macht in der mächtigsten Nation der Erde auszuüben, den wachsenden Griff der jüdischen Orthodoxie auf den israelischen Staat, den Hindufundamentalismus in Indien, welcher, wie sein muslimisches Spiegelbild in Pakistan, mit Nuklearwaffen ausgerüstet ist, die „faschistische“ Wiedergeburt in Europa. Auch sollten wir nicht die Religion der Demokratie ausser acht lassen; so wie bereits während der Periode des Holocausts hat sich die Demokratie, mit den auf US- und britischen Panzern flatternden Fahnen in Afghanistan und im Irak, als die andere Seite der Medaille gezeigt, als Feigenblatt für totalitäre Repression und imperialistischen Krieg. All diese Ideologien sind Ausdrücke eines Gesellschaftssystems, das in einer totalen Sackgasse steckt und der Menschheit nichts als Zerstörung anbieten kann.
Der Kapitalismus in seinem Niedergang hat eine Unzahl von nationalen Antagonismen geschaffen, welche er sich als unfähig zu lösen erwiesen hat; er hat sie vielmehr dazu genutzt, um seinen Kurs zum imperialistischen Krieg zu verfolgen. Der Zionismus, der nur in der Lage war, seine Ziele in Palästina zu erreichen, indem er sich selbst den Erfordernissen zunächst des britischen, schliesslich des amerikanischen Imperialismus unterordnete, ist ein klarer Beleg für diese Regel. Doch im Gegensatz zur antizionistischen Ideologie ist er keineswegs ein Sonderfall. Alle nationalistischen Bewegungen haben in genau derselben Weise gehandelt, einschliesslich des palästinensischen Nationalismus, der als Agent etlicher, kleiner oder grosser imperialistischer Mächte fungiert hat, von Nazideutschland zur UdSSR und zum Irak, nicht zu vergessen einige heutige Mächte in Europa. Rassismus und nationale Unterdrückung sind Realitäten in der kapitalistischen Gesellschaft, doch die Antwort darauf liegt nicht in irgendeinem Schema für nationale Selbstbestimmung oder in der Fragmentierung der Unterdrückten in einer Unmenge von Teilbewegungen (Schwarze, Schwule, Frauen, Juden, Moslems, etc.). Alle diese Bewegungen haben sich als Hilfsmittel für den Kapitalismus erwiesen, die Arbeiterklasse zu spalten und sie daran zu hindern, ihre eigene Identität zu erkennen. Nur durch die Entwicklung dieser Identität, durch ihre praktischen und theoretischen Auseinandersetzungen kann die Arbeiterklasse all die Spaltungen innerhalb ihrer Reihen überwinden und sich selbst zu einer Macht zusammenschweissen, die imstande ist, dem Kapital die Macht zu entreissen.
Dies bedeutet nicht, dass alle nationalen, religiösen und kulturellen Fragen automatisch verschwinden werden, sobald der Klassenkampf eine gewisse Höhe erreicht hat. Die Arbeiterklasse wird die Revolution machen, lange bevor sie sich all der Bürden der Vergangenheit entledigt hat bzw. lange vor dem eigentlichen Prozess der Entledigung; und in der Übergangsperiode zum Kommunismus wird sie mit einer Unmenge an Problemen hinsichtlich des religiösen Glaubens und kultureller oder ethnischer Identitäten konfrontiert werden, wenn sie versucht, die Gesamtheit der Menschen in einer globalen Gemeinschaft zu vereinen. Es ist selbstverständlich, dass das siegreiche Proletariat niemals besondere kulturelle Ausdrücke gewaltsam unterdrücken und noch weniger die Religion ausser Gesetz stellen wird; die Erfahrung der Russischen Revolution hat demonstriert, dass solche Versuche dazu dienen, die Herrschaft solcher überholter Ideologien wieder zu verstärken. Die Mission der proletarischen Revolution besteht, wie Trotzki energisch vertrat, darin, die materiellen Fundamente für die Synthese des Besten aus den vielen verschiedenen kulturellen Traditionen in der Geschichte des Menschen zu legen – für die erste wahrhaft menschliche Kultur. Und somit kehren wir zum Marx von 1843 zurück: Die Lösung der jüdischen Frage ist wirkliche menschliche Emanzipation, die es dem Menschen letztendlich erlauben wird, die Religion abzuschaffen, indem die sozialen Wurzeln der religiösen Entfremdung ausgemerzt werden.
Amos
Fußnoten:
1. Abraham Leon war ein Jude polnischer Herkunft, der in den 20er und 30er Jahren in Belgien aufwuchs. Er begann sein politisches Leben als Mitglied der „Sozialistischen Zionisten“, der Pioniergruppe Haschomair Hatsair, doch er brach mit dem Zionismus, nachdem die Moskauer Prozesse ihn in die trotzkistische Opposition getrieben hatten. Die Tiefe und Klarheit seines Buches zeigt, dass in dieser Periode der Trotzkismus noch eine Strömung der Arbeiterbewegung war; und obwohl es just in jener Zeit geschrieben wurde, als sich dies zu ändern begann (in den frühen 40er Jahren, während der deutschen Okkupation Belgiens), schien der marxistische Unterbau noch durch. Leon wurde 1944 verhaftet und kam in Auschwitz um.
2. Es ist nicht weniger ein Mythos, wie Leon hervorhebt, dass die Probleme der Juden alle auf die Zerstörung des Tempels durch die Römer und die sich „anschliessende“ Diaspora zurückgeführt werden könnten; tatsächlich aber gab es bereits eine grosse jüdische Diaspora in der antiken Welt vor den Ereignissen, die das endgültige Verschwinden der antiken jüdischen „Heimat“ bewirkten.
3. In der Tat war der Zionismus einer von vielen bürgerlichen Kräften, die sich der „Befreiung“ der Juden in Europa widersetzten und ihnen die Erlaubnis verweigerten, nach Amerika oder sonstwohin... ausser nach Palästina, zu fliehen. Der zionistische Held David Ben-Gurion drückte dies in einem Brief an die jüdische Exekutive vom 17.Dezember 1938 sehr deutlich aus: „Das Schicksal der Juden in Deutschland ist kein Ende, sondern ein Anfang. Andere antisemitische Staaten werden von Hitler lernen. Millionen von Juden sehen sich der Vernichtung gegenüber, das Flüchtlingsproblem hat weltweite Ausmasse und Dringlichkeit angenommen. Grossbritannien versucht, die Flüchtlingsfrage von der Palästinafrage zu trennen (...) Wenn die Juden die Wahl hätten zwischen den Flüchtlingen, ihrer Rettung vor den Konzentrationslagern und der Unterstützung eines Nationalmuseums in Palästina, würde das Mitleid die Oberhand behalten und die ganze Energie des Volkes wird sich auf die Rettung von Juden aus etlichen Ländern konzentrieren. Der Zionismus würde nicht nur in der Weltöffentlichkeit, sondern auch in der jüdischen Öffentlichkeit von der Bildfläche verschwinden. Wenn wir einer Trennung zwischen dem Flüchtlingsproblem und dem Palästinaproblem zustimmten, riskierten wir die Existenz des Zionismus.“ (eigene Übersetzung) 1943, als der Holocaust voll im Gange war, schrieb Itzhak Greenbaum, Kopf des Jewish Agency Rescue Comittee, an die zionistische Exekutive, dass, „wenn ich gefragt würde, ob ich Geld von der United Jewish Appeal geben würde, um Juden zu retten, würde ich ¸Nein und noch einmal: Nein‘ sagen. Meiner Ansicht nach müssen wir uns allem entgegenstellen, was die zionistischen Aktivitäten ins zweite Glied stellt.“ (eigene Übersetzung) Solch eine Haltung – welche bis hin zu offener Zusammenarbeit zwischen Nationalsozialismus und Zionismus ging – demonstrierte eine „theoretische“ Annäherung zwischen Zionismus und Antisemitismus, da beide die Ansicht teilen, dass der Judenhass eine ewige Wahrheit ist.
4. Shylock ist ein Charakter in Shakespeares Bühnenstück Der Kaufmann von Venedig. Er wird dargestellt als Archetyp eines jüdischen Wucherers, der der Hauptfigur des Stücks Geld leiht, aber vom Kaufmann „ein Pfund seines eigenen Fleisches“ als Garantie für das Geliehene fordert.
5. Dies bedeutet nicht, dass es keine Verschwörung im Zusammenhang mit dem 11. September gegeben hat; doch sie der fiktiven Kategorie „Juden“ zuzuschreiben dient dazu, die Schuld einer wirklichen Kategorie, der Bourgeoisie nämlich und insbesondere der Staatsmaschinerie der amerikanischen Bourgeoisie, zu verdecken. Siehe unseren Artikel über diese Frage in Internationale Revue, Nr. 29, „Pearl Harbor, Twin Towers – Der Machiavellismus der herrschenden Klasse“.
Politische Strömungen und Verweise:
Theoretische Fragen:
- Religion [112]
Bericht über die Wirtschaftskrise (Auszüge)
- 4007 Aufrufe
Die Festtage der „Wirtschaftsblüte“ brutal beendet
Alle Diskurse über eine angeblich neue Weltordnung nach dem Fall der Berliner Mauer sind schnell durch die Vervielfachung von Kriegen und Genoziden entkräftet worden. Dennoch muss man feststellen, dass all die ideologischen Kampagnen über die „Demokratie“ und die kapitalistische „Prosperität“ ein gewisses Echo gefunden haben und schwer auf dem Bewusstsein der Ausgebeuteten lasten.
Der Zusammenbruch des Ostblocks sollte gigantische „neue Märkte“ eröffnen und eine wirtschaftliche Entwicklung in eine neue Weltordnung des Friedens und der Demokratie einleiten. Im Lauf der 90er Jahre sind diese Vorhersagen über die angebliche Wirtschaftsentwicklung durch eine Medienschlacht über die „aufstrebenden“ Länder wie Brasilien oder diejenigen Südostasiens begleitet worden. Die New Economy trat Ende der 90er Jahre in diese Fussstapfen: Sie sollte nun eine neue Expansionsphase auf der Grundlage einer technologischen Revolution herbeiführen. Wie sieht es mit der Realität aus? Alles lügenhafte Vorhersagen! Nach den ärmsten Ländern der Dritten Welt, die seit zwei bis drei Jahrzehnten einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) pro Kopf einstecken, brach nun die „zweite Welt“ mit dem ökonomischen Desaster der Ostblockländer zusammen. Es folgte der Bankrott Russlands und Brasiliens 1998. Japan befindet sich seit Beginn der 90er-Jahre in einer Krise und acht Jahre später befand sich die gesamte Zone Südostasiens in einem ernsthaften Krankheitszustand. Die Ideologen des Kapitalismus haben die Länder Südostasiens lange als den neuen Entwicklungspol des 21. Jahrhunderts betrachtet. Sie sind bald eines Besseren belehrt worden, denn sie sind zwischenzeitlich alle eines nach dem anderen mehr oder weniger zusammengebrochen. Während sich die E-Economy (Emergent-Economy) in den entwickelten Ländern in den Jahren 2000 und 2001 in einen E-Crash verwandelte, sind die „aufstrebenden“ Länder schon abgestürzt. Die Zerbrechlichkeit dieser Ökonomien ist kaum in der Lage, einige Zehntelprozentpunkte am BIP zusätzlich an Verschuldung zu verkraften. So mussten sich nach der Verschuldungskrise Mexikos zu Beginn der 80er Jahre bald auch andere Länder auf die Liste setzen lassen: Brasilien und Mexiko noch einmal 1994, die Länder Südostasiens, Russland, die Türkei, Argentinien usw. Die Rezession, die die am weitesten entwickelten Länder erfasst hat, wirkt sich nun nicht mehr nur auf die alten technologischen Sektoren (Kohleabbau, Verhüttung usw.) oder die bereits zur Reife gelangten (Schiffbau, Automobilbranche usw.), sondern auch auf diejenigen aus, die eigentlich die Blüte, den Schmelztiegel der „neuen industriellen Revolution“ der New Economy bilden sollten: die Informatik, das Internet, die Telekommunikation, die Raumschifffahrt usw. Hier gehen die Firmenzusammenbrüche in die Hunderte; es folgen Restrukturierungen, Fusionen und Akquisitionen und Hunderttausende von Entlassungen, Lohnkürzungen mit der einhergehenden Verschlechterung der Arbeitsbedingungen.
Mit dem Zusammenbruch der Aktienkurse derjenigen Unternehmen, die am Ursprung der neuen Blütephase des Kapitalismus stehen sollten, und mit der Rezession, die bereits ihre zerstörerische Wirkung entfaltet, beginnen heute die ideologischen Mystifikationen der Bourgeoisie bezüglich der Krise zu erodieren. Deshalb vervielfacht die Bourgeoisie die falschen Erklärungen über die gegenwärtigen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Für sie handelt es sich darum, die Ernsthaftigkeit der Krankheit ihres Wirtschaftssystems zu verheimlichen, um die Bewusstseinsentwicklung des Proletariats über die Sackgasse des Kapitalismus zu verhindern.
Der Kapitalismus versinkt unerbittlich in der Krise
Entgegen den Erklärungen der herrschenden Klasse ist die wirtschaftliche Verschlechterung keineswegs das Produkt des Einsturzes der Twin Towers in den USA, selbst wenn er tatsächlich für gewisse Sektoren wie die Luftfahrt oder den Tourismus noch verschärfende Auswirkungen hatte. Die brutale Verlangsamung des amerikanischen Wachstums beginnt mit dem Platzen der Internet-Blase im März 2000, und das Niveau der wirtschaftlichen Aktivitäten war zu Beginn des Sommers 2001 (siehe Grafik unten) schon schwach. Die Experten der OECD haben dies unterstrichen: „Die wirtschaftliche Verlangsamung hat in den USA im Jahr 2000 begonnen und auch andere Länder erfasst. Sie hat sich in einen weltweiten Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität verwandelt, dem sich nur wenige Länder oder Regionen entziehen konnten.“ (Le Monde, 21.1.2001). Die gegenwärtige Krise ist also nichts spezifisch Amerikanisches.
Der Kapitalismus ist in seine sechste Phase der offenen Rezession seit dem Wiederauftauchen der Krise auf der historischen Bühne Ende der 60er Jahre eingetreten: 1967, 1970–71, 1974–75, 1980–82, 1991–93, 2001–?, ohne den Zusammenbruch der Länder Südostasiens, Brasiliens usw. in den Jahren 1997–98 zu zählen. Seither liegt das Wirtschaftswachstum jedes Jahrzehnt tiefer als im Vorhergehenden(siehe Grafik oben):
1962–69: 5,2%
1970–79: 3,5%
1980–89: 2,8%
1990–99: 2,6%
2000–02: 2,2%
Im Jahr 2002 betrug das Wachstum in der Eurozone kaum 0,7%, während es in den USA immerhin noch auf 2,4% zu liegen kam. Aber auch diese Zahl steht kaum höher als in den 90er Jahren. Wenn man sich im Übrigen auf die wirtschaftlichen Grundlagen beschränkt, hätte die US-Wirtschaft seit 1997 auf der Stelle treten sollen, denn die Profitrate wuchs bereits nicht mehr weiter (siehe Grafik auf Seite 12).
Gemäss den bürgerlichen Kommentatoren charakterisiert die gegenwärtige Rezession die Geschwindigkeit und die Intensität ihrer Entwicklung. Die USA, die bedeutendste Wirtschaft der Welt, sind sehr schnell in die Rezession eingetaucht. Der Rückgang des amerikanischen BIP ist viel stärker als in der vorhergehenden Rezession und die Verschärfung der Arbeitslosigkeit erreicht ein seit der Krise von 1974 nicht mehr gesehenes Niveau. Japan, der zweitstärksten Weltwirtschaftsmacht, geht es nicht besser. Selbst mit negativen realen Zinsen (die Haushalte und Unternehmen Japans verdienen mit der Verschuldung Geld!) rühren sich der Konsum und die Investitionen nicht vom Fleck. Und auch trotz massiven Ankurbelungsmassnahmen taucht die japanische Wirtschaft gerade in die dritte Rezession. Gemäss dem IWF handelt es sich um die stärkste Krise seit 20 Jahren, und Japan könnte das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zwei Jahre hintereinander eine Kontraktion der wirtschaftlichen Aktivitäten erleben. Mit einer Reihe von Wiederankurbelungsplänen fügt Japan der astronomischen Verschuldung der Banken die öffentliche Verschuldung hinzu, die bereits den grössten Umfang aller Industrieländer aufweist. Sie beträgt 2002 130% des BIP und wird 2003 153% erreichen.
Die Verschärfung der Widersprüche des dekadenten Kapitalismus
Im 19. Jahrhundert, in der Periode des aufsteigenden Kapitalismus, befand sich die Bilanz der öffentlichen Finanzen (Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben) von sechs grossen Staaten (USA, Japan, Kanada, Frankreich, Grossbritannien und Italien) nur ausnahmsweise im negativen Bereich und dies hauptsächlich in Kriegszeiten. Sie ist meist stabil bis 1870 und verbessert sich ständig bis 1910. Der Kontrast zur Periode der Dekadenz ist scharf, denn es gibt fast immer ein Defizit mit Ausnahme von vier Jahren am Ende der 20er Jahre und den zwanzig Jahren zwischen 1950 und 1970. Es vergrössert sich sowohl in Kriegs- als auch in Krisenzeiten (siehe Grafik unten).
Das Gewicht der öffentlichen Verschuldung in Prozent am BIP nimmt in der gesamten aufsteigenden Phase ab. Der Anteil übersteigt im Allgemeinen niemals die 50%-Marke. Er explodiert mit dem Eintritt in die Dekadenz und nimmt nur in den Jahren 1950 bis 1980 ab, jedoch ohne jemals unter die 50%-Marke zu fallen. Er steigt danach in den Jahren 1980 bis 1990 (siehe Grafik auf Seite 14).
Dieser Schuldenberg stellt nicht nur in Japan, sondern auch in den anderen entwickelten Ländern ein potenziell destabilisierendes Pulverfass dar. Eine grobe Schätzung der weltweiten Verschuldung der Gesamtheit aller Wirtschaftsakteure (Staaten, Unternehmen, Haushalte, Banken) schwankt zwischen 200 und 300% des Weltsozialprodukts. Das bedeutet konkret zweierlei Dinge: Einerseits hat das System ein monetäres Äquivalent im Umfang des zwei- bis dreifachen Wertes der gesamten globalen Produktion vorgeschossen, um der drückenden Überproduktion entgegenzutreten; anderseits müsste man zwei bis drei Jahre gratis arbeiten, um diese Schulden zu begleichen. Eine solch massive Verschuldung können die entwickelten Ökonomien heute noch ertragen, die „aufstrebenden“ Länder hingegen drohen eines nach dem anderen daran zu ersticken. Diese auf Weltebene phänomenale Verschuldung ist historisch beispiellos und drückt gleichzeitig sowohl die Tiefe der Ausweglosigkeit aus, in der sich der Kapitalismus befindet, als auch seine Fähigkeit zur Manipulation des Wertgesetzes, um die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten. In der vergangenen Periode „haben sich die USA als herrschende Macht das Recht herausnehmen können, ihre Investi-
tionsanstrengungen und das starke Wachstum des Konsums finanzieren zu lassen“ (vgl. Revue Internationale, Nr. 111 „Apres l’euphorie, la gueule de bois“ /„Nach der Euphorie, der Kater“). Kein anderes Land als die USA hätten sich ein dermassen grosses Handelsbilanzdefizit zur Finanzierung des Wachstums leisten können. „Daraus ging eine klassische Überproduktionskrise hervor, die sich in einem Rückgang der Profitkurve und in einer Verlangsamung der Aktivitäten einige Monate vor dem 11. September 2001 manifestierten“ (ebd.). Man kann also in keiner Art und Weise über eine erneute Rückkehr des Wachstums basierend auf einer sog. neuen technologischen Revolution spekulieren. Die theoretischen Diskurse um die New Economy, der Betrug um letztere sowie die kürzlichen beträchtlichen Betrugsfälle führen zu einer ernsthaften Infragestellung der Richtigkeit der nationalen Buchführung auf der Basis der Berechnung des BIP. Das ist insbesondere in den USA der Fall. Seit dem Ausbruch der Enron-Affäre hat man gesehen, dass ein guter Teil der New Economy bloss fiktiv ist. Hunderte von Milliarden Dollars in den Unternehmensbuchführungen haben sich in Nichts aufgelöst. Dieser Zyklus ist übrigens mit einem Börsenkrach beendet worden, der besonders stark die Sektoren betraf, die eben gerade am Anfang dieses neuen Kapitalismus stehen sollten.
Die Fabel vom „schlanken Staat“
“Die direkten Ursachen der Verstärkung des kapitalistischen Staates sind ein Ausdruck der Schwierigkeiten, die von dem Widerspruch zwischen den Produktionsverhältnissen und der Entwicklung der Produktivkräfte herrühren.“ (siehe IKS-Broschüre „Die Dekadenz des Kapitalismus“)
Man versucht uns glauben zu machen, im Zuge von Liberalisierung und „Globalisierung“ hätten die Staaten praktisch keinen Einfluss mehr, dass sie gegenüber den Märkten und den supranationalen Organisationen wie dem IWF, der WTO etc. ihre Eigenständigkeit verloren hätten. Konsultiert man aber die Statistiken, so muss man feststellen, dass trotz den zwanzig Jahren „Neoliberalismus“ das globale ökonomische Gewicht des Staates (genauer gesagt des sogenannten nicht kommerziellen Bereichs: Ausgaben der ganzen öffentlichen Verwaltung und einschliesslich der staatlichen Sozial- und Krankenversicherung) kaum abgenommen hat. Das globale ökonomische Gewicht des Staates nimmt zu, auch wenn dies in einem weniger stetigen Rhythmus geschieht, und erreicht einen Anteil von 45 bis 50% bei den 32 Ländern der OECD, wobei er bei den Vereinigten Staaten einen relativ niedrigen Anteil von etwa 35%, bei den nordischen Ländern einen relativ hohen Anteil von 60% bis 70% ausmacht (siehe Grafik).
Während der ganzen aufsteigenden Phase des Kapitalismus schwankte der Anteil des Staates (des nicht kommerziellen Bereichs) an der Mehrwertproduktion im Bereich von 10%. Im Laufe der dekadenten Phase des Kapitalismus klettert ebendieser Anteil progressiv in die Höhe und nähert sich in den OECD-Ländern im Jahr 1995 einem Wert von 50%. (Quelle: Weltbank, Bericht über die weltweite Entwicklung, 1997).
Diese Statistik enthüllt die künstliche Aufblähung der Wachstumsraten in der Epoche der kapitalistischen Dekadenz, insoweit als die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zum Teil dasselbe zwei Mal in Rechung stellt. Tatsächlich umfasst der Verkaufspreis der Waren die Steuern, deren Betrag der Deckung der Staatsausgaben dient, nämlich die Kosten der Dienste ausserhalb des kommerziellen Bereich (Schulwesen, staatliche Sozial- und Krankenversicherung, Angestellte der öffentlichen Dienste). Die bürgerliche Ökonomie spricht diesen Dienstleistungen denselben Wert zu wie der Summe der Löhne, die den Angestellten bezahlt werden, welche diese Dienste leisten müssen. Nun wird diese Summe in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung dem im kommerziellen Bereich (dem einzigen produktiven Sektor) produzierten Mehrwert hinzugefügt, obwohl sie schon im Verkaufspreis der kommerziellen Güter inbegriffen ist (Berücksichtigung der Steuern und der Sozialversicherungsbeiträge im Preis der Waren). Infolgedessen erhöhen sich in der Periode der Dekadenz das BIP und die Wachstumsrate des BIP künstlich. Sie wachsen insoweit als der Anteil der öffentlichen Ausgaben mit der Zeit zunimmt (von einem 10%igen Anteil um 1913 zu einem 50%igen Anteil um 1995). Dieser Anteil war in der aufsteigenden Phase beinahe konstant geblieben (etwa 10%). Für diese Zeit wird zwar das BIP um 10% zu hoch geschätzt, aber die dieser Phase eigenen Wachstumsraten widerspiegeln die tatsächliche Entwicklung des Produktivsektors. In der Dekadenz hingegen wird die Leistungsfähigkeit des Kapitalismus durch das immense Anwachsen des unproduktiven Sektors – v. a. zwischen 1960 und 1980 – künstlich erhöht. Um das reelle Wachstum in der Dekadenz richtig zu bewerten, muss man vom BIP den seit 1913 wachsenden Anteil des unproduktiven Sektors abziehen. Das sind nahezu 40% des aktuellen BIP!
Betrachtet man das politische Gewicht des Staates, so stellt man auch hier eine deutliche Zunahme fest. Der Staatskapitalismus kann heute und konnte während dem ganzen 20. Jahrhundert keiner bestimmten politischen Schattierung zugeordnet werden. In den Vereinigten Staaten sind es die Republikaner (die „Rechten“), welche die Initiative einer staatlichen Unterstützung zwecks eines Wideraufschwungs ergreifen und die Fluggesellschaften und Versicherungsträger subventionieren. Im übrigen fördert die Regierung unmittelbar deren Erhaltung mithilfe des Gesetzes des „Kapitel 11“, welches den Gesellschaften ermöglicht, sich auf einfache Weise vor ihren Gläubigern zu schützen. Die von Bush angesetzte Wiederbelebung im budgetären Bereich hat gemäss Schätzungen des IWF den Bundesausgleich von einem 2,5%igen Überschuss des BIP im Jahr 2000 zu einem 1,5%igen Defizit des BIP im Jahr 2002 gebracht. Dieses Ausmass ist vergleichbar mit dem der kostspieligsten europäischen Staaten. Die mit der Regierung eng verbundene Zentralbank (die Federal Reserve) hat ihrerseits ihre Zinsen im Zusammenhang mit der immer deutlicher werdenden Rezession nach und nach gesenkt, um zur Ankurbelung des Wirtschaftsapparates beizutragen:
von 6,5% zu Beginn auf 2% zu Ende des Jahres 2001. Dies erlaubt unter anderem den überverschuldeten Haushalten, mehr Kredite abzu-
schliessen oder sie zu einem günstigeren Preis zu erhalten. Schliesslich erfordert der Zusammenhang dieser neuen Orientierung eine Abwertung des Dollars, um die Konkurrenzfähigkeit der amerikanischen Produkte wiederherzustellen und um Teile des Marktes wiederzugewinnen. In Japan wurden die Banken zweimal vom Staat unterstützt und einige wurden sogar verstaatlicht. In der Schweiz war es der Staat, der die gigantische Operation zur finanziellen Unterstützung der nationalen Fluggesellschaft Swissair organisierte. Auch in Argentinien setzt die Regierung mit dem Segen des IWF und der Weltbank ein breites staatliches Arbeitsprogramm ein und versucht damit, Arbeitsplätze wieder entstehen zu lassen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts instrumentalisierten die politischen Parteien den Staat, um ihren eigenen Interessen Vorrang zu verschaffen. In der dekadenten Periode hingegen sind es die globalen ökonomischen und imperialistischen Notwendigkeiten, welche die angemessene Politik diktieren, unabhängig von der politischen Richtung der aktuellen Regierungen. Diese von der Kommunistischen Linken entwickelte grundsätzliche Analyse wurde während dem ganzen 20. Jahrhundert reichlich bestätigt und ist heute mit den noch höheren Einsätzen aktueller denn je.
Die Entwicklung der Militärausgaben
Engels drückte Ende des 19. Jahrhunderts als erster die historische Alternative der dekadenten Phase des Kapitalismus aus: „Sozialismus oder Barbarei“. Rosa Luxemburg entwickelte daraus eine Vielzahl politischer und theoretischer Implikationen und die Kommunistische Internationale baute darauf ihre für die neue Periode charakteristische Formel auf: „Das Zeitalter der Kriege und Revolutionen“. Schliesslich waren es die Linkskommunisten, unter ihnen vor allem die Französische Kommunistische Linke, welche Art und Bedeutung des Krieges sowohl in der aufsteigenden als auch in der dekadenten Phase des Kapitalismus systematisierten und vertieften.
Man kann zweifelsohne bestätigen, dass – im Gegensatz zur aufsteigenden Phase – das Merkmal der kapitalistischen Dekadenz der Krieg in seinen unterschiedlichsten Formen ist: Weltkriege, lokale Kriege usw. Dazu wollen wir, als nützliche knappe historische Ergänzung, Auszüge aus dem Werk Das Zeitalter der Extreme (1994) des Historikers Eric Hobsbawm zitieren. Er beschreibt darin in Form jeweiliger Bilanzen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem „langen 19. Jahrhundert“ und dem „kurzen 20. Jahrhundert“:
“Wie sollen wir dem kurzen 20. Jahrhundert einen Sinn abgewinnen – vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion – diese Jahre, die, wie wir im Nachhinein sehen, eine kohärente und nunmehr abgeschlossene geschichtliche Periode darstellen? (...) Während des kurzen 20. Jahrhunderts wurden mehr Menschen auf Weisung und mit Erlaubnis ermordet als jemals zuvor in der Geschichte. (...) Es war ohne Zweifel das mörderischste Jahrhundert von allen, über das wir Aufzeichnungen besitzen: mit Kriegszügen von nie gekannten Ausmassen, sowohl was das Niveau, die Häufigkeit und die Dauer dieser Kriege betrifft (und welche seit den 20er Jahren kaum einen Unterbruch hatten), als auch bezüglich dem Ausmass der grössten Hungersnöte der Geschichte und den systematischen Genoziden. Im Unterschied zum langen 19. Jahrhundert, welches eine Periode des nahezu ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritts zu sein schien und auch wirklich war (...), sind wir seit 1914 Zeugen eines markanten Rückgangs dieser bis anhin für die entwickelten Länder als selbstverständlich angenommenen Werte. (...) Im Laufe des 20. Jahrhunderts zielten die Kriege zunehmend auf die Wirtschaft und die Infrastruktur der Staaten sowie auf deren zivilen Bevölkerungen. Seit dem Ersten Weltkrieg nahm in allen kriegerischen Ländern mit Ausnahme der Vereinigten Staaten die Zahl der zivilen Opfer im Vergleich zur Zahl der militärischen Opfer immer zu. (...) Um 1914 lag der letzte grosse Krieg ein Jahrhundert zurück (...). Die Mehrzahl der Kriege, welche die Grossmächte betrafen, waren von relativ kurzer Dauer. (...) Die Dauer der Kriege war eine Frage von Monaten oder sogar (wie beim Krieg von 1886 zwischen Preussen und Österreich) von Wochen. Zwischen 1871 und 1914 gab es in Europa keinen Konflikt, der die Armeen der Grossmächte in feindliches Gebiet getrieben hätte. (...) Es gab keinen Weltkrieg. (...) dies alles änderte um 1914 (...) 1914 leitete die „Epoche der Massaker“ ein (...). Im modernen Krieg werden alle Bürger hineingezogen und die Mehrheit von ihnen wird mobilisiert (...), der moderne Krieg wird mit Rüstung geführt, deren Produktion eine Umleitung der ganzen Wirtschaft erfordert und die in unvorstellbarem Umfang eingesetzt wird; der moderne Krieg erzeugt unglaubliche Zerstörungen, dominiert und verändert aber auch in jeder Hinsicht die Existenz der darin verwickelten Länder. Alle diese Phänomene sind also dem Krieg des 20. Jahrhunderts eigen. (...) Diente der Krieg dem Wirtschaftswachstum? Es ist klar, dass dem nicht so ist (...) über diese zunehmende Barbarei nach 1914 gibt es leider keinerlei Zweifel“.
Diese „Epoche der Massaker“, eingeleitet durch den Ersten Weltkrieg und im Gegensatz zum langen, deutlich weniger mörderischen 19. Jahrhundert, wird belegt durch die unterschiedliche Bedeutung der Militärausgaben in der aufsteigenden bzw. dekadenten Phase. Die Bedeutung des Anteils der Militärausgaben am Weltprodukt war während der ganzen aufsteigenden Phase des Kapitalismus relativ gering und quasi beständig, wohingegen sie in der Dekadenz kräftig zugenommen hat. Von 2% des Weltprodukts im Jahr 1860 steigt ihr Anteil auf 2,5% im Jahr 1913, während er 1938 7,2% und in den 1960er Jahren ungefähr 8,4% erreicht. Im Moment des Höhepunktes des Kalten Krieges Ende der 1980er Jahre erreicht der Anteil der Militärausgaben etwa 10% (Quellen: Paul Bairoch für das Weltprodukt und das SIPRI für die Militärausgaben). An den Rüstungsprodukten ist demnach speziell, dass sie im Gegensatz zu einer Maschine oder einem Konsumgut nicht auf produktive Weise verbraucht werden können (sie können die Produktivkräfte nur hemmen oder zerstören). Das bedeutet also eine Sterilisierung des Kapitals. Den 40%, die dem wachsenden Anteil der unproduktiven Ausgaben in der Dekadenzperiode entsprechen, müssen demnach noch 6%-Punkte hinzugefügt werden, welche der relativen Zunahme der Militärausgaben entsprechen, wodurch wir auf ein Weltprodukt schliessen müssen, welches um nahezu die Hälfte zu hoch veranschlagt ist. Dies gibt uns ein wahrheitsgetreueres Bild über die angebliche Leistungsfähigkeit des Kapitalismus im 20. Jahrhundert und der Kontrast zu der Epoche des langen 19. Jahrhunderts mit seinem „nahezu ununterbrochenen materiellen, intellektuellen und moralischen Fortschritt“ wird deutlich.
Die Zukunft bleibt in den Händen der Arbeiterklasse
Zweifelsohne wird mit der Entwicklung der Rezession auf internationalem Niveau die Bourgeoisie eine erneute und gewaltige Verschlechterung des Lebensstandards der Arbeiterklasse durchsetzen. Hinter dem Schleier des Kriegszustandes und im Namen der höheren Interessen der Nation profitiert dabei die herrschende Klasse der Vereinigten Staaten, um Sparmassnahmen durchzusetzen, die aufgrund der Erfordernisse im Zusammenhang einer fortschreitenden Rezession von langer Hand geplant wurden: massive Entlassungen, verschärfte Produktionszwänge, Ausnahmegesetze im Namen des Antiterrorismus, die in Wirklichkeit vor allem als Experimentierfeld zur Erhaltung der herrschenden sozialen Ordnung dienen. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks hatte sich der Rüstungskurs während einiger Jahre verlangsamt, beschleunigte sich aber Mitte der 90er Jahre wieder sehr schnell. Der 11. September 2001 diente der Rechtfertigung einer noch stärkeren Rüstungsentwicklung. Die Militärausgaben der USA machen 37% der weltweiten Militärausgaben aus, welche in allen Ländern spürbar steigen. Überall auf der Welt befinden sich die Arbeitslosenquoten erneut im Ansteigen, mag es auch der Bourgeoisie gelungen sein, einen Teil des realen Ausmasses dieses Phänomens durch die Politik der sozialen Frage – Schaffung unsicherer Jobs und grobe Manipulationen der Statistiken – zu verbergen. Überall in Europa wurden die Budgets nach unten korrigiert und sind erneute Sparmassnahmen programmiert. Im Namen der Budgetstabilität, welche mit den Interessen der Arbeiterklasse nichts gemein hat, ist die herrschende Klasse Europas dabei, die Rentenfrage zu revidieren (Verringerung der Renten und Verlängerung des Berufstätigkeit). Und schon sind neue Massnahmen vorgesehen, um die „Schranken der Wachstumsentwicklung“ zu sprengen, wie es die Experten der OECD verhüllend ausdrücken. Sie sprechen von „einer Schwächung der Rigiditäten“ und „einer Begünstigung des Arbeitskräfteangebots“, währendem sie die Unsicherheit verschärfen und alle Sozialleistungen kürzen (Arbeitslosengeld, Gesundheitsvorsorge, verschiedene Beihilfen, etc.). Mit dem Börsenkrach entblössen die Rentensysteme heute ihr wahres Wesen: Sie sind ein Schwindel, um die Arbeiterklasse noch stärker ihrer Einkommen zu berauben. In Japan hat der Staat eine Restrukturierung für 40% der öffentlichen Institutionen geplant:
17 davon werden geschlossen und 45 weitere sollen privatisiert werden. Nachdem nun die erneuten Attacken auf das Proletariat in Zentren des Kapitalismus erfolgen, nimmt auch die Armut in der Peripherie des Kapitalismus schwindelerregende Ausmasse an. Die Situation der sogenannten „Schwellenländer“ ist in dieser Hinsicht bezeichnend, besonders in Ländern wie Argentinien, Venezuela oder Brasilien. In Argentinien ist das mittlere Einkommen pro Einwohner in den letzten drei Jahren um 2/3 gesunken. Dieses Debakel übertrifft das Ausmass des Zusammenbruchs der Vereinigten Staaten in den 30er Jahren. Die Türkei und Russland stehen dem kaum nach.
Für die Arbeiterklasse ergibt sich aufgrund der ökonomischen Sackgasse, des sozialen Chaos und der wachsenden Misere nur eine mögliche Antwort: Sie muss ihre Kämpfe auf ihrem eigenen Klassenterrain und in allen Ländern massiv steigern. Kein „demokratischer Machtwechsel“, kein Regierungswechsel, keine alternative Politik kann dem Kapitalismus im Todeskampf irgend ein Heilmittel bringen. Die Generalisierung und Vereinigung der weltweiten proletarischen Kämpfe, die einzig auf den Umsturz des Kapitalismus zielen können, sind die einzige Alternative, um die Gesellschaft aus dieser Sackgasse zu befreien. Selten in der Geschichte war die objektive Realität deutlicher, dass man nicht länger die Folgen des Kapitalismus bekämpfen kann, ohne Letzteren selbst zu zerstören. Die erreichte Stufenleiter der Zersetzung des Systems und die ernsthaften Konsequenzen sind derart, dass die Frage der Überwindung des Kapitalismus durch einen revolutionären Umsturz immer deutlicher als der für die Ausgebeuteten einzige „realistische“ Ausgang erscheint und weiterhin erscheinen wird. Die Zukunft bleibt in den Händen der Arbeiterklasse.
(Auszüge des Berichts über die Wirtschaftskrise, vom Dezember 2002; angenommen 15. Kongress der IKS)
Quellen:
– Wachstum de BIP (1962–2001): OECD
– Verschuldungsquote: Paul Masson und Michael Muss: "Long term tendencies in budget deficits and debst", Dokument über die Arbeit des IWF, 95/128 (Dezember 1995)
– Alternatives Economiques (Hors série): Der Zustand der Wirtschaft 2003.
– Maddison: Die Weltwirtschaft 1820–1992, OECD und zwei Jahrhunderte industrielle Entwicklung
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Verantwortung der Revolutionäre angesichts des Krieges
- 2973 Aufrufe
Krieg war immer eine Prüfung für die Arbeiterklasse und die revolutionären Minderheiten.
Die Arbeiter sind die Ersten, die unter den Konsequenzen des Krieges leiden, entweder bezahlen sie den Preis durch eine verschärfte Ausbeutung oder mit ihrem eigenen Leben. Gleichzeitig stellt das vom Kapitalismus erzeugte Proletariat die einzige gesellschaftliche Kraft dar, die fähig ist, der Barbarei des Kapitalismus ein Ende zu setzen, indem sie ihn stürzt.
Dieser neue Golfkrieg, der auf die massive Verschärfung der imperialistischen Spannungen hinweist, zeigt der Welt die Bedrohung für die ganze Menschheit, die vom Weiterbestehen eines Systems ausgeht, das von der Geschichte verurteilt ist und dessen einzige Antwort auf die Krise seiner Wirtschaft die Flucht nach vorne in Krieg und Militarismus ist.
Die bürgerlichen Täuschungen entlarven
Obwohl die Arbeiterklasse zurzeit nicht imstande ist, die Aufgabe, die ihr die Geschichte stellt, durch einen revolutionären Kampf zu lösen, ist es wichtig, diesen neuen Ausbruch der Barbarei als einen möglichen Faktor der Bewusstseinsreifung in ihren Reihen zu sehen. Allerdings unternimmt die Bourgeoisie ihr Möglichstes, damit dieser Konflikt, dessen imperialistischen Charakter sie nicht mehr hinter humanitären Vorwänden oder der Verteidigung des internationalen Rechts verstecken kann, nicht der Entwicklung des Klassenbewusstseins zugute kommt. Zu diesem Zweck verfügt sie in allen Ländern über Medien-Arsenale und Ideologien zur Einpaukerei und Verdummung der Massen.
Welches auch immer die imperialistischen Interessen sind, die die verschiedenen nationalen Fraktionen der Bourgeoisie in Konflikt bringen, ihre Propaganda hat mindestens folgende zwei Themen gemeinsam: Es ist nicht der Kapitalismus, der insgesamt für die kriegerische Barbarei verantwortlich ist, sondern dieser oder jener einzelne Staat, dieses oder jenes Regime; der Krieg ist nicht der unausweichliche Ausdruck des Kapitalismus, sondern es bestehen Möglichkeiten, die Beziehungen zwischen den Nationen zu befrieden.
Gleich wie die Revolution bedeutet der Krieg einen Augenblick der Wahrheit für die Organisationen des Proletariats, der sie zwingt, sich klar zum einen oder andern Lager zu bekennen.
Entschlossen in der Arbeiterklasse intervenieren
Angesichts dieses Krieges, seiner Vorbereitung und seiner Begleitung durch die Bourgeoisie mittels einer Flut von pazifistischer Propaganda, ist es an den revolutionären Organisationen, die alleine einen klaren Klassenstandpunkt verteidigen, sich für eine entschlossene Intervention in ihrer Klasse zu mobilisieren. So war es ihre Verantwortung, lautstark den imperialistischen Charakter dieses Krieges und aller anderen seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts zu brandmarken, den proletarischen Internationalismus zu verteidigen, die allgemeinen Interessen des Proletariats jenen aller Fraktionen der Bourgeoisie entgegenzustellen, jegliche Unterstützung einer jeden nationalen Vereinigung zu verwerfen, die einzig mögliche proletarische Perspektive – die Entwicklung des Klassenkampfes in allen Ländern bis zur Revolution – voranzutreiben.
Die IKS hat ihre Kräfte mobilisiert, um mit allen ihren Möglichkeiten diese Verantwortung wahrzunehmen.
Sie hat durch den Verkauf ihrer Publikationen bei den pazifistischen Demonstrationen, die sich seit Januar in allen Ländern häuften, interveniert, und der Umfang der dabei getätigten Verkäufe zeugt von ihrer Entschlossenheit, mit ihren Positionen zu überzeugen. In einigen Ländern gab es Beilagen zu der territorialen Presse oder es wurden Aufrufe zu ausserordentlichen öffentlichen Veranstaltungen verbreitet. Diese haben in einigen Städten Kontakte und Diskussionen mit Menschen, die die IKS vorher nicht kannten, ermöglicht.
Am Tag nach den ersten Bombardierungen des Irak hat die IKS in grossem Umfang (gemessen an ihren bescheidenen Kräften) ihr Flugblatt in der Arbeiterklasse verbreitet. Dies geschah in den 14 Ländern, in denen die IKS organisatorisch präsent ist (siehe Liste auf der Rückseite unserer Veröffentlichungen), d. h. in 50 Städten auf allen Erdteilen ausser Afrika. In einigen Ländern wie zum Beispiel in Indien setzte die Verteilung des Flugblattes in zwei der wichtigsten Industriezentren die Übersetzung in weitere Sprachen wie Hindi oder Bengali voraus. Zahlreiche Sympathisanten haben uns beim Verteilen geholfen und haben damit die Verbreitung des Flugblattes begünstigt. Das Flugblatt wurde auch – selektiver – an pazifistischen Demonstrationen verteilt. Es wurde auf Russisch übersetzt, um es in Russland, wo die IKS nicht präsent ist, in Umlauf zu bringen. Bereits vom ersten Tag der Bombardierungen an war es in Englisch und Französisch auf der Internetsite der IKS abrufbar. Es wird auf dieser Internetsite nach und nach in allen Sprachen, in die es übersetzt wurde, erscheinen, darunter auch solche wie zum Beispiel Koreanisch, Farsi oder Portugiesisch, die in Ländern gesprochen werden, in denen die IKS nicht präsent ist.
Das revolutionäre Milieu zu seiner Verantwortung aufrufen
Es gibt andere revolutionäre Organisationen der kommunistischen Linken, die ebenfalls mit Flugblättern bei den pazifistischen Demonstrationen interveniert haben. Durch die Verteidigung eines unnachgiebigen Internationalismus gegenüber dem Krieg ohne die geringste Konzession an ein bürgerliches Lager unterscheiden sie sich vom ganzen links angehauchten Wust.
Gemäss ihrer Auffassung über das Vorhandensein eines revolutionären Milieus, das sich genau aus diesen Organisationen zusammensetzt, und auch gemäss der Praxis, die sie seit ihrem Anfang betreibt, hat sich die IKS im Hinblick auf eine gemeinsame Intervention gegenüber dem Krieg an diese Organisationen gewandt. Sie hat in einem an diese Gruppen gerichteten Schreiben erläutert, woraus eine solche Intervention bestehen könnte: „Das Verfassen und die Verbreitung eines gemeinsamen Textes, der den imperialistischen Krieg und die bourgeoisen Begleitkampagnen angreift“ oder „gemeinsame öffentliche Zusammenkünfte, an denen jede Gruppe neben den gemeinsamen Positionen, die uns einen, auch die spezifischen Punkte, die uns unterscheiden, vorstellen könnte“.
Wir veröffentlichen nachstehend den Inhalt unseres Aufrufs und eine erste Analyse der eingegangenen Antworten, die alle negativ sind. Diese Situation zeigt, dass das revolutionäre Milieu insgesamt sich der Tragweite seiner Verantwortung angesichts der aktuellen kriegerischen Situation, aber – schwerwiegender – in Bezug auf die notwendige Umgruppierung der Revolutionäre im Hinblick auf die Gründung der zukünftigen Partei des internationalen Proletariats nicht bewusst ist.
Vorschläge der IKS an die revolutionären Gruppen für eine gemeinsame Intervention gegenüber dem Krieg und Antworten auf unseren Aufruf
Nachstehend veröffentlichen wir zwei Schreiben mit Vorschlägen für eine gemeinsame Intervention gegenüber dem Krieg, die wir den Organisationen der kommunistischen Linken zukommen liessen. Nachdem wir von diesen Organisationen keine Antwort auf unser erstes Schreiben erhalten hatten, haben wir uns entschlossen, einen zweiten Brief mit – wie wir dachten – neuen, bescheideneren und leichter annehmbaren Vorschlägen zu versenden. Von den Organisationen, an die wir unseren Aufruf richteten,
– Bureau Interantional pour le Parti Revolutionnaire (BIPR)
– Partito Comunista Internazionale (Il Comunista, Le Prolétaire)
– Partito Comunista Internazionale (Il Partito Comunista)
– Partito Comunista Internazionale (Il Programma Comunista).
hatten nur das BIPR und der PCI (Le Prolétaire) zu antworten geruht. Dies sagt genug über die Selbstgenügsamkeit der zwei anderen Organisationen.
Unser Brief vom 11. Februar 2003
Genossen,
Die Welt ist auf dem Weg zu einem neuen Krieg mit tragischen Konsequenzen: Abschlachten der Zivilbevölkerung und der Proletarier in irakischen Uniformen, verschärfte Ausbeutung der Proletarier in den „demokratischen“ Ländern, auf die vorwiegend das enorme Wachstum der Militärausgaben ihrer Regierungen zurückfallen wird ... Dieser neue Golfkrieg, dessen Ziele viel weitreichender sind als im Krieg von 1991, könnte effektiv diesen weit hinter sich lassen sowohl bezüglich der Opfer und Leiden, als auch bezüglich der Zunahme der Instabilität, die er im ganzen Gebiet des Nahen Ostens, der bereits besonders stark von den imperialistischen Konflikten ergriffen ist, bringen wird.
Wie immer wenn sich ein Krieg nähert, sind wir auch heute Zeugen einer massiven Entfesselung von Lügenkampagnen mit dem Ziel, dass die Ausgebeuteten die neuen zukünftigen Verbrechen des Kapitalismus hinnehmen. Einerseits wird der vorbereitete Krieg als „Notwendigkeit, einen blutigen Diktator daran zu hindern, die Sicherheit der Welt mit seinen Massenvernichtungswaffen zu bedrohen“ betrachtet. Anderseits wird vorgegeben, dass „der Krieg nicht unvermeidbar sei und dass man sich auf die Tätigkeit der UNO stützen müsse“. Die Kommunisten wissen ganz genau, was diese Reden wert sind: Die Hauptinhaber von Massenvernichtungswaffen sind die Länder, die heute vorgeben, die Sicherheit des Planeten zu gewährleisten, und ihre Anführer haben nie gezögert, sie einzusetzen, wenn sie es für nötig hielten, ihre imperialistischen Interessen zu verteidigen. In Bezug auf die Staaten, die heute zum „Frieden“ aufrufen, wissen wir genau, dass sie dies tun, um ihre imperialistischen Interessen, die durch die Ansprüche der Vereinigten Staaten bedroht werden, besser zu verteidigen, und dass sie morgen nicht zögern werden, ihrerseits Massaker zu entfesseln, wenn ihre Interessen es befehlen. Die Kommunisten wissen auch, dass es nichts zu erwarten gibt von diesem „Räubernest“, wie sich Lenin bezüglich der Vorläuferorganisation der UNO ausdrückte.
Parallel zu den von den Regierungen und ihren Medien organisierten Kampagnen sehen wir auch beispiellose pazifistische Kampagnen – vor allem unter der Führung der Anti-Globalisierungs-Bewegungen – entstehen, die viel lautstärker und massiver sind als diejenigen von 1990–91 anlässlich des Ersten Golfkrieges oder 1999 anlässlich der Nato-Bombardierungen Jugoslawiens.
Der Krieg war immer eine zentrale Frage für das Proletariat und für die Organisationen, die seine Klasseninteressen und seine historische Perspektive, den Kapitalismus umzustürzen, verteidigen. Die Bewegungen, die in den Konferenzen von Zimmerwald und Kienthal eine klare, wahrhaft internationalistische Haltung gegen den Krieg einnahmen, waren die, die sich darauf an die Spitze der Oktoberrevolution 1917, der darauf folgenden revolutionären Welle und die Gründung der Kommunistischen Internationalen stellten. Unter Anderem hat die Geschichte während dieser Periode ebenfalls gezeigt, dass das Proletariat die einzige gesellschaftliche Kraft ist, die sich dem imperialistischen Krieg wirklich widersetzen kann, und zwar nicht durch das Verfolgen kleinbürgerlicher pazifistischer und demokratischer Illusionen, sondern durch das Führen des Kampfes gegen den gesamten Kapitalismus und gegen die pazifistischen Lügen auf dem eigenen Klassenterrain. In diesem Sinne hat uns die Geschichte ebenfalls gelehrt, dass die Anklage der imperialistischen Schlachterei und aller Erscheinungsformen des Chauvinismus durch die Kommunisten unbedingt von einer Anklage des Pazifismus begleitet sein muss.
Es kam der Linken der Zweiten Internationale (besonders den Bolschewiken) zu, mit grösster Klarheit die wirkliche internationalistische Haltung während der ersten imperialistischen Schlachterei zu verteidigen. Und es kam der kommunistischen Linken der Kommunistischen Internationalen (vor allem der italienischen Linken) zu, die internationalistische Position gegenüber dem Verrat der Parteien der Kommunistischen Internationalen und gegenüber dem Zweiten Weltkrieg zu vertreten.
Angesichts des Krieges, der vorbereitet wurde und der Lügenkampagnen, die heute entfesselt werden, ist es klar, dass nur die Organisationen, die an den historischen Kurs der kommunistischen Linken anknüpfen, wirklich in der Lage sind, eine wahrhaft internationalistische Haltung zu verteidigen:
1. Der imperialistische Krieg ist nicht das Resultat einer „schlechten“ oder „kriminellen“ Politik von dieser oder jener besonderen Regierung oder von diesem oder jenem Sektor der herrschenden Klasse: Es ist der Kapitalismus als Ganzes der für den imperialistischen Krieg verantwortlich ist.
2. In diesem Sinne kann die Haltung des Proletariats und der Kommunisten gegenüber dem Krieg keinesfalls sein, sich dem einen oder anderen Lager anzuschliessen – auch nicht auf „kritische“ Art und Weise: Die amerikanische Offensive gegen den Irak anzuklagen bedeutet konkret überhaupt nicht, diesem Land und seiner Bourgeoisie auch nur die geringste Unterstützung zu bringen.
3. Die einzige Position, die den Interessen des Proletariats entspricht, ist der Kampf gegen den Kapitalismus als Ganzes, also gegen alle Sektoren der Bourgeoisie weltweit, nicht mit der Perspektive eines „friedlichen Kapitalismus“, sondern für den Umsturz dieses Systems und die Errichtung der Herrschaft des Proletariats.
4. Der Pazifismus ist bestenfalls eine kleinbürgerliche Illusion mit der Neigung, das Proletariat von seinem Klassenterrain abzubringen; meistens ist er nur ein von der Bourgeoisie zynisch benutztes Instrument, um die Proletarier zur Verteidigung von „friedlichen“ und „demokratischen“ Sektoren der herrschenden Klasse in den imperialistischen Krieg einzubeziehen. Darum ist die Verteidigung der internationalistischen proletarischen Position nicht von der konzessionslosen Anklage des Pazifismus zu trennen.
Die aktuellen Gruppen der kommunistischen Linken teilen alle diese grundsätzlichen Positionen, trotz der Meinungsverschiedenheiten, die zwischen ihnen bestehen. Die IKS ist sich dieser Unterschiede sehr bewusst und hat nie versucht, sie zu vertuschen. Im Gegenteil, sie hat sich immer bemüht, die Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Gruppen in ihrer Presse aufzuzeigen und die Punkte, die sie für verfehlt hält, zu bekämpfen. Vor diesem Hintergrund ist die IKS entsprechend der Haltung der Bolschewiken 1915 in Zimmerwald und der italienischen Fraktion in den 30er Jahren der Meinung, dass es die Verantwortung der wirklichen Kommunisten ist, der ganzen Arbeiterklasse auf breitestmögliche Art und Weise gegenüber dem imperialistischen Krieg und den bürgerlichen Kampagnen die grundlegenden Positionen des Internationalismus aufzuzeigen. Das bedeutet unserer Ansicht nach, dass die Gruppen der kommunistischen Linken sich nicht mit ihren je eigenen Interventionen in ihrer eigenen Ecke zufrieden geben dürfen, sondern dass sie sich zusammenschliessen müssen, um gemeinsam auszudrücken, was ihre gemeinsame Position ausmacht. Für die IKS hätte eine gemeinsame Intervention der unterschiedlichen Gruppen der kommunistischen Linken eine politische Wirkung in der Arbeiterklasse, die weit über die Summe ihrer Kräfte hinausginge, die – wie wir alle wissen – zurzeit ziemlich eingeschränkt sind.
Darum schlägt die IKS den angeschriebenen Gruppen vor, sich zu treffen, um gemeinsam alle möglichen Mittel zu diskutieren, die es der kommunistischen Linke erlauben, geeint für die Verteidigung des Internationalismus zu sprechen, ohne die je eigenen Interventionen der einzelnen Gruppen zu verurteilen oder in Frage zu stellen. Die IKS macht konkret folgende Vorschläge:
– Verfassung und Verbreitung eines gemeinsamen Dokumentes, das den imperialistischen Krieg und die bürgerlichen Begleitkampagnen brandmarkt.
– Gemeinsame öffentliche Versammlungen, in denen jede der Gruppen neben den gemeinsamen Positionen, die uns einen, ihre eigenen Analysen, die uns unterscheiden, vorstellen kann.
Selbstverständlich ist die IKS für jede andere Initiative offen, die es erlaubt, den internationalistischen Positionen ein möglichst breites Gehör zu verschaffen.
Im März 1999 hat die IKS bereits einen ähnlichen Aufruf an die gleichen Gruppen versandt. Leider hat keine von ihnen positiv darauf geantwortet und darum hielt es unsere Organisation für unnötig, einen neuerlichen derartigen Aufruf zum Krieg in Afghanistan Ende 2001 zu lancieren. Wir erneuern heute unseren Aufruf, weil wir denken, dass alle Gruppen der kommunistischen Linken sich über die ausserordentliche Tragweite der heutigen Situation und den extremen Umfang der pazifistischen Lügenkampagnen bewusst sind, und es ihnen am Herzen liegt, alles zu tun, um der internationalistischen Position breitestmögliches Gehör zu verschaffen.
Wir bitten Euch, uns Eure Antwort auf das vorliegende Schreiben so schnell wie möglich an die Postfach-Adresse im Briefkopf zuzustellen. Damit uns diese Antwort so schnell wie möglich erreicht, schlagen wir Euch vor, eine Kopie davon unserer nächstgelegenen Sektion zuzuschicken oder einem Vertreter der IKS zu geben.
Mit kommunistischen Grüssen.
Unser Brief vom 24. März 2003
Genossen,
(...) Offensichtlich müsst Ihr annehmen, dass die Verabschiedung eines gemeinsamen Dokumentes der unterschiedlichen Gruppen der kommunistischen Linken gegen den imperialistischen Krieg und die pazifistischen Kampagnen Verwirrung stiften und die Unterschiede zwischen unseren Organisationen verdecken könnte. Ihr wisst, dass dies nicht unsere Ansicht ist, aber wir versuchen hier nicht, Euch davon zu überzeugen. Das Hauptziel des vorliegenden Briefes ist es, Euch folgenden Vorschlag zu machen: Gemeinsam öffentliche Versammlungen organisieren, in denen jede der teilnehmenden Organisationen der kommunistischen Linken auf vollständig eigene Verantwortung ihre eigene Präsentation machen könnte und die eigenen Argumente in die Diskussion einbringen würde. Es scheint uns, dass ein solches Vorgehen Euer Anliegen berücksichtigt, dass unsere Positionen sich nicht vermischen und dass es zwischen unseren Organisationen keine Vermengung gibt. Gleichzeitig erlaubt es dieses Vorgehen, mit einer maximalen Wirkung (wenn sie auch noch so bescheiden ist) aufzuzeigen, dass es neben den unterschiedlichen bürgerlichen Positionen, die sich zurzeit zeigen (ob sie die Unterstützung des einen oder des anderen militärischen Lagers im Namen der „Demokratie“ oder des „Anti-Imperialismus“ befürworten, oder ob sie sich „pazifistisch“ im Namen „der Einhaltung der internationalen Gesetze“ verstehen oder anderes dummes Zeug), eine internationalistische, proletarische und revolutionäre Haltung besteht, die ausschliesslich von den Gruppen, die an der kommunistischen Linken anknüpfen, verteidigt werden können. Schliesslich muss ein solches Vorgehen es erlauben, dass ein Maximum der Menschen, die sich für die Haltung der kommunistischen Linken und ihre internationalistischen Positionen interessieren, zusammenfinden, um gemeinsam und mit den Organisationen, die diese Haltungen vertreten, zu diskutieren. Gleichzeitig werden sie in der Lage sein, die politischen Meinungsverschiedenheiten, die zwischen ihnen bestehen, so klar wie möglich kennenzulernen.
Damit die Sache klar ist: Dieser Vorschlag zielt nicht darauf ab, es der IKS zu erlauben, ihre Zuhörerschaft dadurch zu vergrössern, dass sie das Wort vor den Menschen ergreift, die üblicherweise die öffentlichen Veranstaltungen Eurer Organisation besuchen. Um das zu belegen, machen wir Euch folgenden Vorschlag: Die öffentlichen Veranstaltungen, die die IKS für die nächste Zeit geplant hat und die selbstverständlich der Frage des Krieges und der diesbezüglichen Haltung des Proletariats gewidmet sind, könnten, wenn Ihr damit einverstanden seid, in öffentliche Versammlungen wie wir sie Euch vorschlagen, umgewandelt werden. Dieses Vorgehen ist besonders in den Städten oder Ländern, in denen Eure eigene Organisation vertreten ist, umsetzbar. Aber unser Vorschlag umfasst auch andere Länder oder Städte: Konkret würden wir mit grosser Befriedigung an der Durchführung einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung mit Vertretern der kommunistischen Linken aus England, Frankreich oder Italien in Köln oder in Zürich teilnehmen. Selbstverständlich halten wir uns bereit, die Vertreter Eurer Organisation, die an diesen öffentlichen Versammlungen teilnehmen, unterzubringen und falls nötig ihre Präsentationen und Interventionen in die Landessprache zu übersetzen.
Wenn dieser Vorschlag Euch zusagt, bitten wir Euch, uns so schnell wie möglich zu informieren (z. B. an die unten aufgeführte Internet-Adresse), damit wir alle nötigen Vorkehrungen treffen können. Auf jeden Fall sind Eure Organisation und deren Vertreter herzlich eingeladen, an unseren öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, um dort Eure Positionen zu vertreten, auch wenn Ihr unseren Vorschlag zurückweist (was wir selbstverständlich bedauern würden).
In Erwartung Eurer Antwort und mit den besten kommunistischen und internationalistischen Grüssen.
Die Antwort des BIPR vom 28. März 2003
Werte Genossen,
Wir haben via Eure Genossen Euren „Aufruf“ für die Einheit der Aktion gegen den Krieg erhalten. Wir sind verpflichtet, ihn aus den Gründen, die Ihr bereits kennt und die wir im Folgenden zusammenfassen, zurückzuweisen.
Beinahe dreissig Jahre nach der ersten Internationalen Konferenz der kommunistischen Linken sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und der IKS nicht kleiner, sondern grösser geworden, und gleichzeitig hat die IKS – wie wir wissen – Spaltungen erlebt. Das heisst, – und das ist klar für jeden, der dem Phänomen auf den Grund geht – dass die IKS von uns nicht als gültige Gesprächspartnerin zur Festlegung einer Einheitsaktion angesehen werden kann.
Einerseits ist es unmöglich, diejenigen „zusammenzunehmen“, welche vertreten, dass die Arbeiterklasse extrem bedroht wird, die, nachdem sie ohne zu reagieren ausserordentlich heftige Angriffe auf die Löhne, die Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen erduldet hat, nun Gefahr läuft, in die Kriegsmaschinerie einverleibt zu werden, und diejenigen, welche – wie die IKS – vertreten, dass der imperialistische Krieg zwischen den Blöcken noch nicht ausgebrochen ist, weil ... die Arbeiterklasse nicht geschlagen ist und also den Krieg selber verhindere. Was hätten wir also gemeinsam zu sagen? Es ist offensichtlich, dass angesichts der herausragenden Tragweite dieses Problems die im Aufruf angesprochenen allgemeinen Grundsätze nicht genügen.
Anderseits kann die Richtigkeit einer Einheitsaktion – gegen den Krieg wie für jedes andere Problem – von politisch genau bestimmten und nicht zweideutigen Gesprächspartnern, die die politischen Positionen teilen, die sie gemeinsam als grundlegend ansehen, dargelegt werden. Wir haben bereits gesehen, dass wir in einem Punkt, den wir für grundsätzlich halten, gegensätzliche Auffassungen haben, aber unabhängig von der Möglichkeit einer späteren politischen Übereinstimmung ist es vorrangig, dass eine hypothetische Einheitsaktion von politisch unterschiedlichen Richtungen die Übereinstimmung aller Bestandteile sieht, hinsichtlich derer sich diese Richtungen verstehen oder unterscheiden. Das heisst, dass eine Einheitsaktion zwischen Teilen unterschiedlicher politischer Strömungen sinnlos ist, wenn die anderen ... Teile mit einer selbstverständlich kritischen und entgegengesetzten Haltung draussen bleiben.
Also, Ihr (die IKS) seid ein Teil einer politischen Richtung, die sich von nun an in mehrere Gruppen teilt, die jede die Strenggläubigkeit der ursprünglichen IKS in Anspruch nimmt, wie es alle bordigistischen Gruppen tun, an die Ihr Euch ausser an uns noch wendet.
Alles was Ihr in Eurem „Aufruf“ bezüglich des engeren Zusammenrückens der Revolutionäre angesichts des Krieges schreibt, sollte vor allem im Kreis Eurer Richtung gelten, wie es auch im Kreis der bordigistischen Richtungen sein sollte.
Offen gesagt, es wäre ernster zu nehmen, wenn ein solcher Aufruf sich eben genau an die FICCI und an die Ex-FECCI richten würde, genau wie es seriöser wäre, wenn Programme Communiste oder Il Comunista–Le Prolétaire einen vergleichbaren Aufruf an die zahlreichen anderen bordigistischen Gruppen der Welt richteten. Warum wäre dies seriöser? Weil dies ein Versuch wäre, die lächerliche – wenn sie nicht dramatisch wäre – Tendenz umzukehren, sich immer mehr aufzuteilen, je mehr die Widersprüche des Kapitalismus sich zuspitzen und die Probleme zunehmen, die sich der Arbeiterklasse stellen.
Es ist nun aber offensichtlich, dass diese dramatische/lächerliche Tendenz auf beide Strömungen zutrifft.
Das ist kein Zufall, und wir kommen auf die andere grundlegende Frage zurück. Die theoretische Haltung und die Methode, die politischen Positionen, die Organisationsauffassung der IKS (wie vom anfänglichen Kommunistischen Programm) haben offensichtlich Mängel, wenn auf ihrer Grundlage jedes Mal Brüche und Spaltungen auftreten, wenn die Probleme des Kapitalismus und die Belange der Klasse sich erschweren.
Wenn 60 Jahre nach der Gründung der Internationalistischen Kommunistischen Partei in Italien und 58 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zwei der drei in der kommunistischen Linken zwischen den Kriegen vorhandene Richtungen sich aufgeteilt haben, muss es dafür einen Grund geben.
Wir beharren darauf: Es handelt sich nicht um ein Fehlen von Wachstum oder mangelnde Verwurzelung in der Arbeiterklasse; diese lassen sich mit der extremen Schwierigkeit die historische Niederlage der stalinistischen Konterrevolution hinter sich zu lassen, begründen.
Im Gegenteil, wir sprechen hier vom Problem der Aufsplitterung dieser politischen Richtungen in eine Konstellation von Gruppen, von denen jede Strenggläubigkeit verlangt. Der Grund dafür findet sich – wie wir es bei mehreren Gelegenheiten vertreten haben – in der Schwäche der Strenggläubigkeit, in ihrer Unfähigkeit also, die Dynamik des Kapitalismus zu verstehen, zu erklären und daraus die politischen Orientierungen herzuleiten, die sich daraus ergeben. Zusammenfassend scheint es uns, dass das Ziel, die Italienische Linke wieder in einem geeinten politischen Rahmen zu vereinen, nun unerreichbar ist, weil zwei ihrer Bestandteile eine hartnäckige Unfähigkeit zeigen, die Geschehnisse in Begriffen, die der Wirklichkeit entsprechen, zu erklären, und es aufgrund dieser Unfähigkeit nur schaffen, sich noch mehr aufzusplittern.
Selbstverständlich bedeutet das für uns keinen Rückzug auf uns selber, und – gleich wie wir in den fernen 76er Jahren die angemessenen Initiativen ergriffen hatten, um das Eis zu brechen und eine neue Dynamik der Debatte im Kreis des proletarischen politischen Lagers auszulösen – werden wir heute versuchen, die geeigneten Initiativen zu ergreifen, um den alten politischen Rahmen, der nun blockiert ist, zu überwinden, und um die revolutionäre und internationalistische Tradition in einem neuen Prozess der Verwurzelung in der Klasse zu erneuern.
Die Antwort der PCI vom 29. März 2003
Genossen,
Wir haben Euren Brief vom 24. März, der auch Euer vorhergehendes Schreiben vom 11. Februar enthielt, erhalten. Wir haben bereits anlässlich einer Versammlung von Lesern die Gelegenheit gehabt, mündlich auf den darin enthaltenen Vorschlag zu antworten und werden darauf öffentlich in den Spalten des Prolétaire zurückkommen. Obwohl es scheint, dass Ihr von der Idee eines gemeinsamen Textes abgekommen seid, enthüllt Euer neuer Vorschlag denselben politischen Frontismus und kann von unserer Seite also nur dieselbe ablehnende Antwort erhalten.
Mit kommunistischen Grüssen.
Stellungnahme zu den Antworten
Dies ist nicht erste Mal, dass die IKS einen Appell an die Gruppen des politischen Milieus des Proletariats zu einer gemeinsamen Intervention angesichts einer sich verschärfenden Weltlage gerichtet hat. Wie unser Brief aussagt, machten wir genau solch einen Aufruf im März 1999 gegen die militärische Barbarei, die im Kosovo ausgelöst wurde. Die Artikel, die wir als Antwort auf die erhaltenen Weigerungen damals schrieben, passen im Wesentlichen auch auf die heutige Situation.[1] Wir sehen es dennoch als notwendig an, kurz Stellung zu beziehen zu den abschlägigen Antworten, die wir wieder einmal erhielten, um klarzustellen, dass sie einer politischen Herangehensweise entspringen, die wir als nachteilig für die Interessen des Proletariats betrachten. Wir werden auf dieses Thema ausführlicher in zukünftigen Artikeln zurückkommen. Der PCI–Le Prolétaire hat gesagt, dass er das Gleiche in seiner Presse tun wird.
Wir werden uns also hier darauf beschränken, auf die Argumente beider Gruppen für die Ablehnung unserer zwei Vorschläge zu antworten: die Verteilung eines Dokuments gegen den Krieg auf der Basis unserer gemeinsamen internationalistischen Positionen sowie die Organisierung von Veranstaltungen, die sowohl die gemeinsame Denunzierung des Krieges als auch die Konfrontation der Meinungsverschiedenheiten zwischen unseren Organisationen zum Ziel haben.
Der PCI und sein kleinster gemeinsamer Nenner
Der sehr kurze Brief des PCI behauptet, dass unser Appell reiner „Frontismus“ sei. Diese Antwort steht in einer Linie mit dem, was auf einem PCI-Lesertreffen in Aix-en-Provence (Frankreich) am 1. März auch mündlich geäussert worden war, wo uns mitgeteilt wurde, dass es die Vision der IKS sei, nach dem „kleinsten gemeinsamen Nenner“ zwischen den Organisation zu suchen. Darüber hinaus stehen diese sehr oberflächlichen Argumente in einem Zusammenhang mit denjenigen, die – etwas ausführlich, aber nicht überzeugender – in einer Polemik gegen uns vorgebracht wurden, die in Le Prolétaire Nr. 465 veröffentlicht wurden. Dies erlaubt uns, einen kurzen Blick auf die organisatorischen Auffassungen des PCI zu werfen.
Um es vorweg zu sagen: Dieser Artikel stellt gegenüber der Haltung des PCI in den 70er und 80er Jahren einen Schritt nach vorn dar. Damals hatten wir es mit einer Organisation zu tun, die sich selbst bereits als die „kompakte und mächtige Partei“, als den einzigen Führer der proletarischen Revolution betrachtete, deren alleiniges Programm nur das „invariante Programm“ von 1848 sein konnte. Heute teilt uns der PCI mit: „Weit davon entfernt zu denken, dass wir ¸allein auf der Welt‘ seien, vertreten wir dennoch die Notwendigkeit einer unnachgiebigen programmatischen Kritik und des politischen Kampfes gegen Positionen, die wir als falsch und gegen die Organisationen, die sie vertreten, erachten.“
Le Prolétaire scheint anzunehmen, dass wir Elemente an uns ziehen wollen, um auf der Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners die Partei zu formen. Dagegen setzen sie eine Methode, die meint, alle anderen Organisationen und ihre Positionen gleichermassen bekämpfen zu müssen; mit anderen Worten: sie machen keinen Unterschied zwischen Organisationen, die eine internationalistische Position vertreten, und trotzkistischen oder stalinistischen Organisationen, die schon vor langem durch ihre mehr oder weniger ausdrückliche Unterstützung des einen oder anderen Lagers im imperialistischen Krieg das Terrain der Arbeiterklasse verlassen haben. Solch eine Methode führt unweigerlich zur Idee, dass sie die einzige Organisation seien, die das Programm der Arbeiterklasse vertrete und konsequenterweise die einzige Basis für den Aufbau der Partei sei – und letztendlich so zu handeln, als seien sie allein auf der Welt, um die Klassenpositionen zu verteidigen.
Der PCI bemerkt ebenfalls, dass die gegenwärtige Situation nichts mit jener von Zimmerwald und Kienthal zu tun habe, und betrachtet somit unsere Bezugnahme auf die Prinzipien von Zimmerwald als untauglich, da sie auf einem unzutreffenden Vergleich beruhe. Sie sind entweder unfähig oder unwillig zu begreifen, was wir sagen.
Man muss nicht einmal Marxist sein, um zu sehen, dass die Situation heute nicht mit jener von 1917 oder gar 1915 – dem Jahr der Zimmerwalder Konferenz – identisch ist. Dennoch haben beide Perioden dieses wichtige Merkmal gemeinsam: Beide Phasen der Geschichte werden vom imperialistischen Krieg dominiert, und für die fortgeschrittenen Elemente der Arbeiterklasse bedeutet dies, dass eine Frage Vorrang vor allen anderen hat – der Internationalismus gegen diesen Krieg. Es liegt in der Verantwortung dieser Elemente, ihre Stimmen gegen die Flutwelle der bürgerlichen Ideologie und Propaganda zu Gehör zu bringen. Über „Frontismus“ und den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ zu reden trägt nicht nur nicht dazu bei, die Meinungsverschiedenheiten unter den Internationalisten zu klären, es ist auch insoweit ein Faktor der Konfusion, als es die realen Divergenzen, die Klassengrenze, die die Internationalisten von der gesamten Bourgeoisie, von den Rechtsradikalen bis hin zu den Linksextremisten, trennt, auf eine Stufe mit den Meinungsverschiedenheiten unter Internationalisten stellt.
Der Vorwurf des „Frontismus“ beruht in der Tat auf einem schweren Irrtum im Hinblick auf die Natur des Frontismus, wie ihn unsere Vorgänger der Kommunistischen Linken verstanden und entlarvt hatten. Dieser Begriff bezog sich auf die Taktiken, die von der Dritten Internationalen angewendet worden waren, als sie versuchte – allerdings mit einer unrichtigen und opportunistischen Methode –, die Isolation der Russischen Revolution zu durch brechen. Später, als sie degenerierte, wurde die Kommunistische Internationale immer mehr zu einem blossen Instrument der Aussenpolitik des russischen Staates und nutzte die frontistische Taktik als ein Instrument dieser Politik. Der Frontismus – zum Beispiel die „Arbeitereinheitsfront von unten“ der KI – war also ein Versuch, eine praktische Einheit zwischen den Parteien der Internationalen, die dem proletarischen Internationalismus treu geblieben waren, und insbesondere den sozialdemokratischen Parteien herzustellen, die 1914 die Kriegsanstrengungen des bürgerlichen Staates unterstützt hatten. Mit anderen Worten: Der Frontismus versuchte, eine Einheitsfront zwischen zwei verfeindeten Klassen, zwischen den Organisationen des Proletariats und jenen zu schaffen, die unwiderruflich in den Händen der Bourgeoisie gelandet sind.
Der PCI schiebt die unterschiedliche historische Periode und die Ablehnung des Frontismus vor, um die wirklichen Fragen und die Verantwortung zu umgehen, die den Internationalisten heute obliegt. Wenn wir an den Geist Lenins in Zimmerwald appellieren, geht es um die Frage von Prinzipien. Was immer der PCI denken mag, wir stimmen ihm über die Notwendigkeit der programmatischen Kritik und des politischen Kampfes zu. Auch wir bekämpfen Ideen, die wir für falsch halten, obgleich wir, da wir die unterschiedliche Natur von bürgerlichen und proletarischen Organisationen begreifen, die Positionen Letzterer bekämpfen, und nicht ihre Organisationen.
„Die eine Partei, die morgen das Proletariat zur Revolution und zur Diktatur führen wird, kann nicht aus der Verschmelzung von heterogenen Organisationen und folglich ihrer Programme geboren werden, sondern aus dem klaren Sieg des einen Programms über die anderen (...) sie muss ein Programm haben, das gleichermassen einmalig und unmissverständlich ist, das authentische kommunistische Programm, welches alle Lehren aus den Schlachten der Vergangenheit synthetisiert.“[2]
Auch wir denken, dass das Proletariat unfähig sein wird, die Revolution zu machen, wenn es nicht imstande ist, eine weltweite kommunistische Partei zur Welt zu bringen, die auf einem einzigen Programm beruht[3], welches die Lehren aus der Vergangenheit synthetisiert. Doch das Problem ist, wie diese Partei entstehen wird. Wir denken nicht, dass sie im Augenblick der Revolution fix und fertig hervorspringen wird wie die Athene aus dem Kopf des
Zeus: Sie muss lange zuvor vorbereitet werden, womit schon jetzt angefangen werden muss. Es war exakt dieser Mangel an Vorbereitung, der bei der Gründung der Dritten Internationalen so schmerzlich vermisst wurde. Zwei Dinge sind notwendig für diese Vorbereitung: erstens, eine klare Linie zwischen den internationalistischen Positionen und all dem Müll der Linksextremisten zu ziehen, die so tief gesunken sind, dass sie diese oder jene Fraktion der Bourgeoisie im imperialistischen Krieg vertreten; und zweitens, Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb des internationalistischen Lagers existieren, zuzulassen und sie der Feuerprobe einer offenen Debatte auszusetzen. Die Bildung der Weltpartei auf dieselbe Ebene zu stellen wie die Verteidigung des Internationalismus gegen den imperialistischen Krieg heute ist purer Idealismus, da es ignoriert, was dringend notwendig ist in der gegenwärtigen Lage und im Namen einer historischen Perspektive, welche sich nur auf der Basis einer massiven Entwicklung des Klassenkampfes und einer Vorarbeit bei der Klärung und Reifung in den revolutionären Minderheiten verwirklichen kann.
Was die Ablehnung von „organisatorischen Verschmelzungen“ durch Le Prolétaire anbelangt, zeigt sie, dass diese Organisation ihre Geschichte vergessen hat: Müssen wir die Genossen daran erinnern, dass der Ruf nach der Gründung der Dritten Internationalen nicht allein an die Bolschewiki adressiert war, nicht einmal allein an jene Sozialdemokraten, die dem Internationalismus treu geblieben waren, wie der Spartakusbund von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Er richtete sich auch an Anarchosyndikalisten wie die spanische CNT, an revolutionäre Syndikalisten wie Rosmer und Monatte in Frankreich, an die Anhänger der Industrieunionen wie die britische Bewegung der Shop Stewards und an die DeLeonisten wie John Macleans schottische SLP. Nur wenige Monate vor der Oktoberrevolution integrierte die bolschewistische Partei noch Trotzkis Zwischenbezirksorganisation, welche einstige menschewistische Internationalisten mit einschloss. Natürlich war dies keine „ökumenische“ Verschmelzung, sondern eine Umgruppierung von proletarischen Organisationen, die während des Krieges dem Internationalismus rund um die Konzeptionen der Bolschewiki treu geblieben waren, deren Gültigkeit sowohl durch die Entwicklung der historischen Ereignisse als auch und vor allem durch die Tat der Arbeiterklasse demonstriert wurden. Diese historische Erfahrung zeigt, dass der PCI Unrecht hat, wenn er sagt, dass eine Verschmelzung von Organisationen gleichbedeutend mit der Verschmelzung von Programmen sei.
Heute würde das Hochhalten des internationalistischen Banners und die Schaffung einer Zone der Debatte innerhalb des internationalistischen Lagers es jenen Elementen, die auf der Suche nach revolutionärer Klarheit sind, erlauben, die irreführende Propaganda der demokratischen, pazifistischen und linksextremistischen Bourgeoisie zu durchschauen und sich selbst im politischen Kampf zu stählen. Der PCI sagt, dass er die IKS, ihr Programm, ihre Analysen und ihre Politik bekämpfen und „einen kompromisslosen politischen Kampf gegen all die Verwirrung Stiftenden (einschliesslich der IKS)“ führen will. Sehr gut, wir nehmen die Herausforderung an. Das Problem ist nur: Damit eine solche Auseinandersetzung (wir meinen natürlich eine politische Auseinandersetzung innerhalb des proletarischen Lagers) auch stattfinden kann, müssen die sich gegenüber stehenden Kräfte fähig sein, sich innerhalb eines bestimmten Rahmens zu treffen – und es kann uns nur Leid tun, dass der PCI es vorzieht, vom bequemen Doktorstuhl aus zu „kämpfen“, statt sich den Unannehmlichkeiten und Realitäten einer offenen Debatte zu stellen – unter dem Vorwand, dass dies eine „ökumenische, demokratische Einheit“[4] sei. Seine Verweigerung gegenüber unserem Vorschlag ist keine „Auseinandersetzung“. Im Gegenteil, sie bedeutet, die wahre und notwendige Auseinandersetzung zugunsten einer idealen und irrealen abzulehnen.
Die Antwort des IBRP
Das IBRP hat vier Gründe für seine Weigerung angeführt, die wir wie folgt zusammenfassen können:
1. Weil die IKS meint, dass es die Arbeiterklasse ist, die den Ausbruch eines imperialistischen Weltkrieges verhindert, kann sie nicht als „ebenbürtiger Partner“ betrachtet werden.
2. Die Kommunistische Linke ist in drei Tendenzen zerbrochen (die Bordigisten, das IBRP und die IKS), von denen zwei (die Bordigisten und die IKS) in verschiedene Gruppen aufgesplittert sind, von denen alle meinen, die einzig „wahre“ zu sein. Für das IBRP ist es unmöglich, auch nur eine einzige gemeinsame Aktion mit diesen „Tendenzen“ anzuvisieren, bis Letztere ihre verschiedenen Komponenten wiedervereinigt haben (die alte „externe Fraktion“ und die aktuelle „interne Fraktion“ der IKS sind laut dem IBRP Teil „unserer Tendenz“): „... es ist wesentlich, dass jegliche hypothetische organisierte Aktionseinheit unter verschiedenen politischen Tendenzen die Konvergenz all der Komponenten beachten sollte, in die derartige Tendenzen aufgespalten sind.“ In diesem Sinne „wäre es seriöser, wenn ein Appell wie dieser genau an die IFIKS und die IKS adressiert würde“.
3. Die Tatsache, dass die IKS Spaltungen erlebt hat, ist angeblich das Resultat ihrer theoretischen Schwächen und folglich „ihrer Unfähigkeit, die Dynamik des Kapitalismus zu begreifen und zu erklären sowie die notwendige politische Orientierung, die daraus resultiert, zu erarbeiten“. Infolgedessen (und in Anbetracht, dass das IBRP uns mit den bordigistischen Gruppen über einen Kamm schert) sieht sich das IBRP selbst heute als den einzigen gesunden Überlebenden der Italienischen Linken.
4. Das Ergebnis aus all dem ist, dass heute allein das IBRP in der Lage ist, „die Initiativen zu ergreifen, die imstande sind, über den alten politischen Rahmen – der nun blockiert ist – hinauszugehen und die revolutionäre sowie internationalistische Tradition in einem neuen Prozess der Verwurzelung in der Klasse zu erneuern.“
Wie man keine „seriöse“ Arbeit verrichtet
Ehe wir uns mit den fundamentalen Fragen befassen, müssen wir den Grund dieser „Fraktionen“ klären, die – laut des IBRP – doch die ersten Adressen unseres Anliegens sein müssten. Soweit es die einstige „externe Fraktion“ der IKS angeht, denken wir, dass es „seriöser“ wäre, wenn das IBRP den Positionen dieser Gruppe (heute bekannt unter dem Namen Internationalist Perspectives) etwas mehr Aufmerksamkeit schenkt: Wenn es dies getan hätte, dann müsste es zur Kenntnis nehmen, dass IP das eigentliche Fundament der IKS-Positionen – die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus – völlig abgeschafft hat, dass diese Gruppe nicht mehr behauptet, unsere Plattform zu vertreten, und sich selbst nicht mehr „Fraktion“ der IKS nennt. Doch einerlei ob diese Gruppe politisch Teil unserer „Tendenz“ ist, wie das IBRP behauptet, oder nicht, es geht an der Sache vorbei. Die Gründe, warum wir unseren Appell nicht auch an diese Gruppe gerichtet haben, haben nichts mit ihren politischen Analysen zu tun, und das IBRP weiss dies nur allzu gut. Diese Gruppe wurde auf der Basis einer parasitären Vorgehensweise, der Verunglimpfungen und Verleumdungen der IKS gegründet, und aufgrund dieser politischen Beurteilung[5] anerkennt die IKS diese Gruppe nicht als Teil der Kommunistischen Linken. Was die Gruppe anbelangt, die heute behauptet, eine „interne Fraktion“ der IKS zu sein, ist die Situation noch schlimmer. Wenn das IBRP das IFIKS-Bulletin Nr. 14 und unsere territoriale Presse (s. unseren Artikel „Die polizeiähnlichen Methoden der IFIKS“, Weltrevolution Nr. 117) gelesen hat, dann weiss es, dass revolutionäre Organisationen nicht gemeinsam mit Elementen zusammenarbeiten können, die sich wie Polizeispitzel zum Nutzen der Repressionskräfte des bürgerlichen Staates benehmen. Es sei denn, das IBRP meint, dass an dieser Verhaltensweise nichts Falsches sei!
Was sind die Bedingungen für eine gemeinsame Arbeit?
Wenden wir uns nun jenen Argumenten zu, die eine ausführlichere Antwort verdienen: die Idee, dass unsere politischen Positionen zu weit voneinander entfernt seien, um in der Lage zu sein, zusammenzuarbeiten. Wir haben bereits hervorgehoben, dass diese Haltung meilenweit von jener Lenins und der Bolschewiki auf der Zimmerwalder Konferenz entfernt ist, wo Letztgenannte ein gemeinsames Manifest mit anderen internationalistischen Kräften unterschrieben trotz der Tatsache, dass die Unterschiede zwischen den Teilnehmern in Zimmerwald sicherlich grösser waren als die Trennlinien zwischen den Internationalisten von heute. Um nur ein Beispiel zu nennen: Auch die Sozialrevolutionäre, die nicht einmal Marxisten waren und 1917 grösstenteils in einer konterrevolutionären Position endeten, nahmen an der Zimmerwalder Konferenz teil.
Es ist schwerlich einzusehen, warum unsere Analyse des Kräfteverhältnisses auf globaler Ebene ein diskriminierendes Kriterium sein soll, das jegliche gemeinsame Intervention gegen den Krieg und, innerhalb dieses Rahmens, eine offene Debatte über diese und andere Fragen verhindert. Wir haben bereits oft genug und in aller Ausführlichkeit auf den Seiten der Revue die Grundlage unserer Position zum historischen Kurs erklärt. Die Methode, die unsere Analyse untermauert, ist dieselbe wie zur Zeit der internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken, die von Battaglia Comunista initiiert und von der IKS Ende der 70er-Jahre unterstützt wurden. Unsere Position ist also nichts Neues für das IBRP. Tatsächlich bezog sich BC zur Zeit der Konferenzen ausdrücklich auf Zimmerwald und Kienthal. „Es ist unmöglich, zu Klassenpositionen oder zur Bildung der Weltpartei zu gelangen, ganz zu schweigen von einer revolutionären Strategie, ohne zuvor die Notwendigkeit zu erfüllen, ein dauerhaftes internationales Informations- und Verbindungszentrum in Gang zu setzen, das die Vorwegnahme und Synthese dessen sein wird, was die künftige Internationale ist, so wie Zimmerwald und Kienthal ein Vorgriff auf die III. Internationale waren.“ (BC-„Letter of Appeal“ an die erste Konferenz 1976; eigene Übersetzung)
Was hat sich seitdem verändert, das eine schwächere Einheit unter den Internationalisten und die Abweisung unseres Vorschlags rechtfertigt, der nicht einmal die Ambition hat, ein „Verbindungszentrum“ zu errichten?
Das IBRP sollte die gegenwärtige Lage etwas genauer wahrnehmen und die Bedeutung jenes Kräfteverhältnisses anerkennen, dessen Analyse durch uns sie als unrichtig erachten. Denn wenn es etwas gibt, was sich seit der Periode der Konferenzen nicht nur einmal verändert hat, dann ist es die Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen und anderer Faktoren durch das IBRP, die den Ausbruch eines neuen Weltkrieges vor 1989 verhinderten. Es hat alle möglichen Erklärungen zu diesem Thema geliefert: An einer Stelle bildet es sich ein, dass der Weltkrieg nicht ausgebrochen war, weil die imperialistischen Blöcke noch nicht ausreichend konsolidiert waren – wo in Wahrheit es niemals in der bisherigen Geschichte zu solch einem konkreten Ausdruck von Blöcken gekommen war wie in Gestalt des amerikanischen und russischen Blocks. An einer anderen Stelle wird der Bourgeoisie unterstellt, dass sie zu erschrocken über die Aussichten eines nuklearen Holocausts gewesen sei, um einen Krieg auszulösen. Und die letzte Entdeckung des IBRP, die es bis zur Desintegration des russischen Blocks unter den Schlägen der Wirtschaftskrise aufrechterhalten hatte, war die Idee, dass der Dritte Weltkrieg wegen der unzureichenden Wirtschaftskrise nicht ausgebrochen sei!
Es lohnt sich, in Erinnerung zu rufen, dass zwei Monate vor dem Fall der Berliner Mauer die IKS erklärte, dass die neue Periode, die sich eröffnete, von der Auflösung der Blöcke gekennzeichnet sein wird. Zwei Monate später schrieben wir, dass diese Situation zu wachsendem Chaos führen wird, das von der Opposition der zweit- und drittrangigen imperialistischen Mächte gegenüber den Versuchen der Vereinigten Staaten genährt wird, seine Rolle als Weltpolizist aufrechtzuerhalten und zu stärken (s. Nr. 60 und 61 der International Review). Das IBRP dagegen begann, nachdem es eine Weile von einer möglichen Expansion der Weltwirtschaft dank des „Wiederaufbaus“ der Ostblockländer[6] gesprochen hatte, die Idee eines neuen Blocks zu vertreten, der auf der Europäischen Union basiert und mit den Vereinigten Staaten rivalisiert. Heute ist klar, dass der „Wiederaufbau“ der Länder des ehemaligen Ostblocks schon lange kein Thema mehr ist, während der Ausbruch des neuen Kriegs im Irak offenbart hat, dass die Europäische Union nie so gespalten, so unfähig zu einer vereinten Aktion auf der aussenpolitischen Ebene, so weit entfernt von der Bildung auch nur des Hauchs eines imperialistischen Blocks wie jetzt war. Dieser Unterschied zwischen der ökonomischen Ebene (die Ausweitung und Vereinheitlichung Europas auf der wirtschaftlichen Ebene mit der Einführung des Euro und dem Eintritt neuer Mitgliedsländer) und der imperialistischen Ebene (die völlige und unübersehbare Unfähigkeit Europas in diesem Bereich) verdeutlicht nur diesen fundamentalen Aspekt in der Dynamik des Kapitalismus in seiner Dekadenzperiode, die sich das IBRP noch immer anzuerkennen weigert: Imperialistische Konflikt sind nicht die direkten Folgen der ökonomischen Konkurrenz, sondern die Konsequenz einer ökonomischen Blockierung auf einer weit globaleren Stufe der kapitalistischen Gesellschaft. Unabhängig von den Meinungsverschiedenheiten zwischen unseren Organisationen haben wir ein Recht zu fragen, worauf das IBRP seine Einschätzung stützt, dass nur es selbst, anders als die IKS, in der Lage sei, „die Dynamik des Kapitalismus“ zu begreifen.
Die Dinge werden nicht klarer, wenn wir zur Analyse des Klassenkampfes kommen. Das IBRP denkt, dass die IKS die Stärke des Proletariats überschätzt, und stimmt nicht mit unserer Analyse des historischen Kurses überein. Und dennoch ist es das IBRP, das eine beträchtliche Neigung hat, von jäher Begeisterung immer dann hinweggerissen zu werden, wenn es glaubt, etwas zu sehen, was wie eine „antikapitalistische“ Bewegung aussieht. Erinnern wir uns, ohne ins Detail zu gehen, einfach daran, wie Battaglia Comunista die Bewegung in Rumänien in einem Artikel mit dem Titel „Ceaucescu ist tot, doch der Kapitalismus lebt immer noch“ begrüsst hatte: „Rumänien ist das erste Land in den Industriegebieten, wo die Weltwirtschaftskrise einen realen und authentischen Volksaufstand zum Leben erweckt hat, dessen Resultat der Sturz der Regierung gewesen war (...) in Rumänien waren alle objektiven Bedingungen und fast alle subjektiven Bedingungen zur Umwandlung des Aufstandes in eine reale und authentische soziale Revolution vorhanden.“ Auch während der Ereignisse in Argentinien 2002 verwechselte das IBRP eine Klassen übergreifende Revolte mit der proletarischen Klassenerhebung: „(Das Proletariat) erschien spontan auf den Strassen und zog die Jugend, die Studenten und grosse Bereiche des pauperisierten und proletarisierten Kleinbürgertums hinter sich. Gemeinsam liessen sie ihren Ärger an den Heiligtümern des Kapitalismus aus: Banken, Büros und vor allem Supermärkte sowie andere Geschäfte, die wie die Brotöfen im Mittelalter gestürmt wurden (...) Die Revolte legte sich nicht, sondern verbreitete sich überall im Land und nahm wachsende Klassenmerkmale an. Der Sitz der Regierung, das symbolische Denkmal der Ausbeutung und der Finanzgier, wurde im Sturm genommen.“[7]
Im Gegensatz dazu hat die IKS trotz ihrer „idealistischen Überschätzung“ der Stärke des Proletariats ständig gewarnt, dass besonders seit 1989 die allgemeine historische Situation die Fähigkeit des Proletariats in Frage stellt, seine eigene Perspektive durchzusetzen, und hat sich stets gegen die immediatistische und kurzzeitige Begeisterung für alles, was wie eine Revolte aussieht, gewandt. Während das IBRP von der Lage in Rumänien aufgewühlt war, schrieben wir: „Angesichts dieser Angriffe wird das Proletariat (in Osteuropa) kämpfen und versuchen, sich zu widersetzen (...) Doch die Frage ist: In welchem Zusammenhang werden diese Streiks erscheinen? Es kann keinen Zweifel an der Antwort geben: in einem Zusammenhang äusserster Konfusion, entsprechend der politischen Schwächen und Unerfahrenheit der osteuropäischen Arbeiterklasse, was die Arbeiter besonders verwundbar macht für die Mystifikationen der Demokratie und der Gewerkschaften sowie für das Gift des Nationalismus (...) Wir können nicht die Möglichkeit ausschliessen, dass grosse Fraktionen der Arbeiterklasse sich für Interessen anwerben und massakrieren lassen, die ihnen völlig fremd sind, nämlich in den Kämpfen zwischen nationalistischen Banden oder zwischen ¸demokratischen‘ und stalinistischen Cliquen (gar nicht zu denken an Grosny, den Krieg zwischen Armenien und Aserbeidschan...)“. Was die Lage im Westen anbetraf, schrieben wir: „Zunächst wird die Öffnung des ¸Eisernen Vorhangs‘, der das Weltproletariat in zwei teilte, den Arbeitern im Westen nicht erlauben, ihren Klassenbrüdern im Osten Anteil an ihrer Erfahrung zu verschaffen (....) im Gegenteil, kurzfristig und für die nächste Zeit werden die starken demokratischen Illusionen der Arbeiter im Osten auf den Westen überschwappen...“[8] Man kann schwerlich behaupten, dass diese Perspektiven seither widerlegt worden seien.
Wir beabsichtigen hier nicht, in eine Debatte über diese Frage zu treten – dies würde eine Menge mehr Ausführungen von uns[9] erfordern – und schon gar nicht behaupten wir, dass das IBRP sich systematisch irrt und dass die IKS ein Monopol auf die Fähigkeit hat, die Lage zu analysieren: Wir wollen lediglich demonstrieren, dass die IBRP-Karikatur einer hoffnungslos „idealistischen“ IKS („idealistisch“, weil unsere Analysen nicht auf einem strikt ökonomischen Materialismus basieren, wie ihn das IBRP favorisiert) und eines IBRP, das allein imstande ist, „die Dynamik des Kapitalismus zu verstehen und zu erklären“, einfach nicht der Wirklichkeit entspricht. Die Genossen des IBRP denken, dass die IKS idealistisch ist. Sei es drum. Was uns angeht, so denken wir, dass das IBRP zu häufig dem banalsten Vulgärmaterialismus anheimfällt. Doch verglichen mit dem, was die Internationalisten gegen den imperialistischen Krieg verbindet, verglichen mit der Verantwortung, die sie übernehmen können, und mit dem Einfluss, den eine gemeinsame Intervention haben könnte, ist dies freilich zweitrangig und sollte sie in keiner Weise daran hindern, die theoretischen Meinungsverschiedenheiten, die sie trennen, zu debattieren, zu vertiefen und zu klären. Wir sind überzeugt davon, dass „die Synthese aller Lehren aus den Schlachten der Vergangenheit“ und die Verifizierung der Lehren ihrer politischen Organisationen nicht nur in der Theorie lebenswichtig für das Proletariat sein werden. Wir sind gleichermassen davon überzeugt, dass es, um dies zu erreichen, notwendig ist, das internationalistische Lager abzugrenzen und innerhalb dieses Lagers die theoretische Konfrontation zu ermöglichen. Le Prolétaire verweigert sich gegenüber dieser Konfrontation aus prinzipiellen Gründen, so zweitrangig sie auch heute sein mögen. Das IBRP verweigert diese Konfrontation wegen der Stimmungslage und der Analyse. Ist dies „seriös“?
Sind Spaltungen ein Kriterium der Diskriminierung?
Der dritte Grund, den das IBRP für seine Verweigerung jeglicher Kooperation mit uns nennt, ist die Tatsache, dass wir Spaltungen erlebt haben: „... zwei der drei Tendenzen in der Kommunistischen Linken zwischen den beiden Kriegen gingen in die Brüche“. Das IBRP hat wohl kaum eine objektive Sicht dessen, was es die Zerrüttung der „IKS-Tendenz“ nennt, nicht nur was die völlig unverantwortliche politische und militante Herangehensweise der parasitären Gruppen, die sich im Orbit der IKS befinden, betrifft, sondern auch bezüglich der Bedeutung einer organisierten politischen Präsenz auf Weltebene. Im Gegensatz dazu ist es völlig klar, dass es eine Fragmentierung unter den Organisationen gibt, die legitimerweise für sich beanspruchen, das Vermächtnis der Italienischen Linken geerbt zu haben. Und was das Verhalten in dieser Situation betrifft, so hat Battaglia Comunista eine 180°-Wende vollzogen, verglichen mit ihrem eigenen Verhalten vor der ersten Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken: „Die Konferenz sollte auch anzeigen, wie und wann eine Debatte über Probleme eröffnet wird (...), die heute die internationale Kommunistische Linke spalten, wenn wir wollen, dass die Konferenz zu einem positiven Schluss kommt und ein Schritt vorwärts zu einem grösseren Ziel wird, zur Bildung einer internationalen Front von Gruppen der Kommunistischen Linken, die so homogen wie möglich sein wird, so dass wir schliesslich den politischen und ideologischen Turm von Babel verlassen und eine Ausblutung der existierenden Gruppen verhindern können.“[10] (2. Brief von BC in Sitzungsberichte der 1. Internationalen Konferenz) Battaglia erkannte zu jener Zeit auch an, dass „der Ernst der Lage (...) die Formulierung präziser und verantwortlicher Positionen erfordert, die auf einer einheitlichen Sicht der mannigfaltigen Strömungen der internationalen kommunistischen Linken beruhen“ (BC’s 1. Brief). Die 180°-Kehrtwende fand bereits auf den Konferenzen statt: Battaglia weigerte sich, Stellung zu beziehen, selbst zu den Divergenzen zwischen unseren Organisationen.[11] Das IBRP weigert sich auch heute. Und die Lage ist keinesfalls weniger ernst geworden.
Darüber hinaus sollte das IBRP erklären, warum die Spaltungen, die die IKS erlebt hatte, eine Disqualifizierung für eine gemeinsame Arbeit mit den anderen Gruppen der Kommunistischen Linken darstellen. Ohne unpassende Vergleiche zu ziehen, lohnt es sich festzustellen, dass zur Zeit der Zweiten Internationalen besonders eine der Mitgliedsparteien bekannt war für ihre „internen Auseinandersetzungen“, ihre „Ideenkonfrontationen“ (oft undurchsichtig für Militante aus anderen Ländern), ihre Spaltungen, für die äusserste Vehemenz in ihren Debatten von Seiten einiger ihrer Fraktionen und für ihre endlosen Debatten über die Statuten. Es war weitverbreitete Ansicht, dass „diese Russen unverbesserlich“ seien und dass Lenin – zu „autoritär“ und „disziplinarisch“ – grösstenteils verantwortlich für die Zersplitterung der SDAP 1903 gewesen sei. In der deutschen Partei lagen die Dinge anders; diese schien mit traumwandlerischer Sicherheit von einem Erfolg zum nächsten zu schreiten, dank der Weisheit ihrer Führer, unter denen ihr erster kein anderer als der „Papst des Marxismus“, Karl Kaultsky, war. Wir wissen, was aus ihnen geworden ist.
Welche Initiativen erfordert die Situation?
Das IBRP meint, dass es die einzige Organisation der Kommunistischen Linken sei, die imstande ist, die „Initiative zu ergreifen“ und „über den alten politischen Rahmen – der nun blockiert ist – hinauszugehen“.
Wir können an dieser Stelle unsere Meinungsverschiedenheit mit dem IBRP nicht in aller Ausführlichkeit darlegen. Auf alle Fälle können wir in Anbetracht, dass Battaglia Comunista die Verantwortung für den Ausschluss der IKS aus den internationalen Konferenzen und für das Ende Letzterer trug, und in Anbetracht, dass es das IBRP ist, das sich heute systematisch jeglichen gemeinsamen Bemühungen durch das internationalistische proletarische Milieu verweigert, lediglich sagen, dass es eine ausserordentliche Frechheit ist, heute zu erklären, dass „der alte Rahmen blockiert ist“.
Soweit wir betroffen sind, bleibt unsere Haltung trotz des Verschwindens eines formalen und international organisierten Rahmens für die Konferenzen unverändert:
– danach zu trachten, auf der Basis internationalistischer Positionen gemeinsam mit den Gruppen der Kommunistischen Linken zu arbeiten (unser Aufruf zu einer gemeinsamen Aktion während der Kriege am Golf 1991, im Kosovo 1999, zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Communist Workers Organisation anlässlich des Jahrestages der Oktoberrevolution 1997, etc.);
– die Verteidigung des proletarischen Milieus (soweit es unsere bescheidenen Mittel erlauben) gegen Angriffe von aussen und gegen die Infiltrierung bürgerlicher Ideologie. Erwähnt sei nur unsere Verteidigung des PCI-Artikels Auschwitz und das grosse Alibi gegen die Attacken der bürgerlichen Presse und die Entlarvung der arabischen Nationalisten in der späten El Oumami, die die PCI sprengten und deren Vermögen stahlen, die Öffentlichkeit, mit denen wir den Ausschluss von Elementen aus unseren Reihen betrieben, die wir als gefährlich für die Arbeiterbewegung beurteilten, unsere Ablehnung der Versuche der Gruppe Los Angeles Workers Voice (die bis kürzlich das IBRP in den USA repräsentierte), Elemente unserer Plattform zu kopieren und zu verfälschen.
Im Gegensatz dazu ist die Geschichte des IBRP mit einer ganzen Reihe von Versuchen gepflastert, „einen neuen Prozess der Verwurzelung in der Klasse“ zu entdecken. Die grosse Mehrheit dieser Versuche scheiterte letzendlich. Diese nicht enden wollende Liste umfasst:
– die so genannte „Vierte Konferenz“ der Kommunistischen Linken, wo die Kräfte, die vom IBRP „seriös ausgewählt“ wurden, faktisch auf die iranischen Kryptostalinisten des UCM begrenzt waren;
– während der 1980er Jahre schuf das IBRP ein neues Rezept für die „Verwurzelung“: die „kommunistischen Betriebsgruppen“, die ein reines Phantasieprodukt blieben;
– das IBRP war von Begeisterung ergriffen über die grandiosen Möglichkeiten, Massenparteien in den Ländern der Peripherie des Kapitalismus zu gründen; dabei kam nichts anderes raus als die kurzlebige und „entwurzelte“ Lal Pataka;
– mit dem Fall der Berliner Mauer ging das IBRP in den alten stalinistischen Parteien des Ostblocks fischen. Auch dabei kam nichts raus.12
Das IBRP sollte nicht beleidigt sein, wenn wir ihm an diese Liste von enttäuschten Illusionen erinnern: Es macht uns keinen Spass, ganz im Gegenteil. Denn wir denken, dass die extreme Schwäche der kommunistischen Kräfte in der Welt noch ein weiterer Grund dafür ist, unsere Reihen durch Taten und brüderliche Auseinandersetzungen über unsere Divergenzen zu schliessen, statt uns selbst als die einzigen Erben der Kommunistischen Linken zu dünken.
Wir werden da sein
Einmal mehr sind wir gezwungen, die beklagenswerte Unfähigkeit der Gruppen der Kommunistischen Linken festzustellen, zusammen einen internationalistischen Bezugspunkt zu schaffen, den das Proletariat und seine fortgeschrittenen oder suchenden Elemente dringend benötigen, da der Planet immer mehr im militärischen Chaos eines verrotteten Kapitalismus versinkt.
Dies verleitet uns nicht dazu, unseren Überzeugungen abzuschwören, und an dem Tag, an dem die anderen Organisationen der Kommunistischen Linken die Notwendigkeit gemeinsamer Aktionen begreifen, werden wir antworten: anwesend!
1. Siehe unsere Artikel über den Appell der IKS gegen den Krieg in Serbien in International Review Nr. 98 und „The marxist method and the ICC‘s appeal over the war in ex-Yugoslavia“ in International Review Nr. 99.
2. Le Prolétaire, s.o.
3. Wir wollen hier nicht auf die Debatte über die bordigistische Vision der „ausschliesslichen“ Partei eingehen; obgleich die Tendenz zur Vereinigung des Proletariats, wie die Geschichte gezeigt hat, zur Bildung einer einzigen Partei führt, bedeutet der Versuch, dies als vages Prinzip und als Vorbedingung für jegliche gemeinsame Aktivitäten von internationalistischen Strömungen zu „dekretieren“, allerdings, der Geschichte den Rücken zu kehren und mit Worten zu spielen. Siehe unsere Artikel über den Appell der IKS gegen den Krieg in Serbien in International Review Nr. 98 und „The marxist method and the ICC‘s appeal over the war in ex-Yugoslavia“ in International Review Nr. 99.
4. Wir gehen hier nicht näher auf die Frage unserer sog. „administrativen Methoden“ ein, die der PCI im gleichen Artikel denunziert; völlig unverantwortlich im übrigen, nimmt er doch das Wort unserer Verunglimpfer für bare Münze. Die wirkliche Frage ist: Gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die für eine kommunistische Organisation inakzeptabel sind – ja oder nein? Können Organisationen dazu veranlasst werden, Militante auszuschliessen, die ihre eigenen Funktionsregeln verletzen – ja oder nein? Die Genossen des PCI täten gut daran, sich die Methoden unserer Vorgänger über diese Art von Frage wieder anzueignen.
5. „Thesen über den politischen Parasitismus“ in: Internationale Revue Nr. 22.
6. Im Dezember 1989 publizierte Battaglia Communista den Artikel „Zerstörung der Illusionen über den Realsozialismus“, in dem man Lesen kann: „Die UdSSR muss sich gegenüber den westlichen Technologien öffnen und der COMECON ebenso, nicht – wie es sich gewisse vorstellen [ist sie IKS gemeint?] - in einem Prozess der Desintegration des Ostblocks und des totalen Desengagements der UdSSR gegenüber Europa, sondern durch die Wiederbelebung der Wirtschaft des COMECON, durch den Wiederaufschwung der Sowjetwirtschaft“.
7. dem Artikel „Ou le parti révolutionanire et le socialisme, ou la misère généralisée et la guerre!“ entnommen, der auf www.ibrp.org [108] veröffentlicht worden war (eigene Übersetzung).
8. in International Review Nr. 60, „Collapse of the Eastern bloc, definitive bankruptcy of Stalinism“ und „New difficulties for the proletariat“.
9. in International Review Nr. 18 „The course of history“ und „The concept of the historic course in the revolutionary movement“, in: International Review Nr. 107.
10 Juni 1976, unsere Heraushebung. Battaglias anfängliche Entschlossenheit war nur von kurzer Dauer, und wir haben ihre Inkohärenz bereits in der International Review Nr. 76 entlarvt.
10. Während der 2. Konferenz weigerte sich Battaglia systematisch, auch nur die kleinste gemeinsame Position anzunehmen: „Wir sind prinzipiell gegen gemeinsame Erklärungen, da es keine politische Übereinstimmung gibt“ (Intervention auf der 2. Konferenz in: Sitzungsberichte...).10 Juni 1976, unsere Heraushebung. Battaglias anfängliche Entschlossenheit war nur von kurzer Dauer, und wir haben ihre Inkohärenz bereits in der International Review Nr. 76 entlarvt.
11. Während der 2. Konferenz weigerte sich Battaglia systematisch, auch nur die kleinste gemeinsame Position anzunehmen: „Wir sind prinzipiell gegen gemeinsame Erklärungen, da es keine politische Übereinstimmung gibt“ (Intervention auf der 2. Konferenz in: Sitzungsberichte...).
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [78]
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Editorial: Das Proletariat angesichts der dramatischen Verschlimmerung aller Widersprüche des Kapitalismus
- 2287 Aufrufe
Die Hitzeperiode des Sommers 2003 hat der ganzen Welt auf tragische Weise offenbart, wie auch in Europa die Entwicklung der Armut und der Unsicherheit die Bevölkerung den Zerstörungen der bisher in diesen Regionen unbekannten so genannten Naturkatastrophen aussetzt. In zahlreichen Ländern Europas ist die Sterberate im August in die Höhe gesprungen und hat in Frankreich eine Rekord erreicht, wo um die 15'000 Tote in direktem Zusammenhang mit der Hitzewelle stehen. Die Opfer sind mehrheitlich alte Menschen, aber auch Behinderte und Obdachlose, die auf der Strasse verdurstet sind. Der Kapitalismus hat sie zu einem Randdasein und zu einer ständig ansteigenden Misere verurteilt. Für die Bourgeoisie handelt es sich um überflüssige Esser, die in ihren Augen unnütz und eine zu grosse Last geworden sind. Sie trachtet ständig danach, die Ausgaben zu ihrer Unterhaltung zu kürzen.
Dieses Drama illustriert – weit davon entfernt ein Unfall der Geschichte zu sein – schonungslos die Situation des Kapitalismus, in dem sich die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse ebenso wie die klimatischen Bedingungen nur verschlechtern können.
Es handelt sich hier lediglich um einen Teil der sozialen Landschaft, in der all die Manifestationen der Verwesung des Kapitalismus das Leben auf Erden für die meisten Menschen in eine Hölle verwandeln: Gewalt, Verbrechen, Drogen, Zunahme des Mystizismus, der Irrationalität, der Intoleranz und des Nationalismus. Abgesehen von den zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert war der Krieg noch niemals so präsent. Die Intensivierung der Spannungen zwischen den Grossmächten, die seit zwei Jahren auch kaum mehr zu verbergen sind, bilden den Hauptfaktor des ständig blutiger werdenden Chaos auf der Welt.
All das Unheil, das heute auf der Menschheit lastet, drückt den Zusammenbruch des Systems aus, das das Leben in der Gesellschaft beherrscht: des Kapitalismus. Aber die zunehmende Gleichzeitigkeit, mit der die erwähnten Elemente auftreten, zeigen die Geschwindigkeit, mit der der Kapitalismus in seiner letzten Phase der Dekadenz, nämlich dem Zerfall, die Menschheit in die Zerstörung treibt.
Die Wirtschaftskrise im Zentrum der Widersprüche des Kapitalismus
Die Bourgeoisie versucht mit allen Mitteln, die Bewusstwerdung über den Bankrott ihres Systems zu behindern. Sie spielt das ganze Unheil herunter. Sie gewöhnt die Bevölkerung daran, das Unannehmbare anzunehmen. Sie treibt jeden dazu, sich angesichts der oft unerträglichen Bilder in den zu Essenszeiten ausgestrahlten Nachrichtensendungen von den Problemen abzuwenden. Das Drama dieses Sommers hat in Frankreich zu einer grossen Anzahl von in den Medien verbreiteten Meinungen geführt, die oft sehr kritisch gegenüber der Regierung ausgefallen sind, aber alle entweder nur Teile des Problems beleuchtet haben oder schlicht falsch gewesen sind, um so die Enthüllung der Hauptursache zu verhindern. Diese liegt nämlich im Umstand, dass die Bourgeoisien aller industrialisierten Länder, die Linke wie die Rechte, von der Wirtschaftskrise an der Gurgel gepackt worden sind und zur Verteidigung der Wettbewerbsfähigkeit des nationalen Kapitals in der internationalen Arena in immer kürzeren Abständen immer heftigere Schnitte in den Sozialbudgets vorgenommen haben, insbesondere im Bereich der Gesundheit. Daraus sind eine Verarmung und eine allgemeine Verschlechterung der Lebensbedingungen hervorgegangen, deren Ausmasse sich in brutaler Weise durch die Hitzewelle dieses Sommers offenbart haben. In der gleichen Art, aber in viel grösserem Ausmass, zeigte die Spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg mit der Auslöschung von 20 Millionen Menschenleben die Tiefe eines gesellschaftlichen Übels auf, das in den schrecklichen Bedingungen und der extremen Schwächung der Bevölkerung in der Folge der Zerstörung des Krieges lag. Auch diese Toten gingen auf Kosten des tödlichen Wahnsinns des Kapitalismus ebenso wie die 10 Millionen, die auf den Schlachtfeldern zurück geblieben waren.
Die Bourgeoisie stellt all diese Übel so dar, als würde zwischen ihnen keinerlei Verbindung bestehen und vor allem, als würden sie in keinerlei Beziehung zum kapitalistischen System stehen, das das Leben der Menschen auf diesem Planeten beherrscht. Für die herrschende Klasse und die Verteidiger ihres Systems sind all diese historischen Ereignisse die Frucht des puren Zufalls: entweder Ausdruck des göttlichen Willens oder schlicht das Resultat der menschlichen Leidenschaften oder Gedanken, kurz der „menschlichen Natur“.
Für den Marxismus ist es im Gegenteil die Wirtschaft, die in letzter Instanz alle anderen Bereiche der Gesellschaft bestimmt: die juristischen Verhältnisse, die Regierungsformen, die Art des Denkens. Diese materialistische Sichtweise hat sich mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz zu Beginn des 20. Jahrhunderts wegen der Auswirkungen der unüberwindbaren wirtschaftlichen Widersprüche auf eklatante Art bestätigt. Seither hat er mit Ausnahme der auf die beiden Weltkriege folgenden Wiederaufbauphasen eine permanente Krise durchgemacht.
In der Periode der Dekadenz haben die Staaten unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Sackgasse in einem übersättigten Weltmarkt die Flucht in Krieg und Militarismus angetreten. Diese sind nun zur Lebensweise des Kapitalismus geworden, wie es die beiden Weltkriege und die ununterbrochene Kette von lokalen, stets destruktiveren Konflikten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs deutlich veranschaulichen. Die beiden Weltkriege und die gegenwärtige Zerfallsphase der Gesellschaft illustrieren, bis zu welchem Grad dieses überholt gewordene System bereits die Menschheit als ganzes bedroht. In seiner Flucht nach vorn drückt der Kapitalismus allen Bereichen des menschlichen Lebens, darin eingeschlossen auch dem Verhältnis des Menschen zur Natur, seinen Stempel auf. Um seine Profite aufrecht zu erhalten plündert der Kapitalismus seit mehr als hundert Jahren in grossem Ausmass die Umwelt. Er hat es so weit getrieben, dass der Umfang der gesamten Verschmutzung, ja das ganze ökologische Desaster eine wirkliche Bedrohung für das gesamte Ökosystem dieses Planeten darstellen.
Der Kapitalismus ist ein Konkurrenzsystem, das den Wettstreit zwischen den Nationen auf die höchste Ebene schraubt. Die Vertiefung der Wirtschaftskrise bedeutet also auch eine Intensivierung ihres Wirtschaftskrieges. Nach dem Verschwinden der beiden nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen imperialistischen Blöcke hat die Aufrechterhaltung einer Koordination der Wirtschaftspolitik zwischen den verschiedenen Staaten zur Verhinderung eines Handelskrieges eine noch umfassendere Verschlechterung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere der Wechselkurse, verhindert. Die Fraktionen der Weltbourgeoisie der am meisten entwickelten Länder haben mit dieser Handlungsweise ihr Bewusstsein darüber zum Ausdruck gebracht, dass eine Wiederholung des Szenarios der 30er-Jahre verhindert werden muss. Damals versuchte sich die Bourgeoisie gegen die Depression mit einer Erhöhung der Zollmauern zu schützen. Mit diesem Vorgehen ist aber der Welthandel massiv reduziert und die Krise verschlimmert worden. Im Lauf der gesamten 90er-Jahre haben die Entscheidungen der Welthandelsorganisation (WTO) Zollhindernisse und protektionistische Massnahmen eliminiert, jedoch hauptsächlich diejenigen der schwächsten zugunsten derjenigen der stärksten Länder.
Anlässlich der Abschlüsse von Abkommen zwischen den Mitgliedern dieser Organisation wird auch ein Kräfteverhältnis zwischen ihnen festgesetzt. Auf dieser Grundlage werden die Regeln für die Fortsetzung des Wirtschaftskrieges definiert. Ob ein solches Abkommen wie kürzlich an der Ministerkonferenz in Cancun vom 10. bis 14. September scheitert, verändert überhaupt nichts an den Beziehungen und am Kräfteverhältnis zwischen den reichsten und den anderen Ländern. Auch wenn die Globalisierungsgegner mit ihrer lügnerischen Propaganda etwas anderes behaupten. Sie stellen die Tatsache, dass in Cancun kein Abkommen hat erzielt werden können, als einen Sieg für die Drittwelt-Länder dar.[1] Das ist eine mystifizierende Argumentationsweise, gemäss der die Lösung der tragischen Probleme des niedergehenden Kapitalismus nicht in der Überwindung dieses Systems, sondern im Kampf zwischen dem Norden, den entwickelten Ländern, und dem Süden, den unterentwickelten Ländern, liege. Man muss sich jetzt, da diese ekelhafte Propaganda erneut entwickelt wird, daran erinnern, dass sie von 1960 bis 1980 als Rechtfertigung für die Einbeziehung der Bauernmassen in die Konflikte und Guerillabewegungen im allgemeinen zu Gunsten des russischen Blocks gedient hat, der ebenso imperialistisch wie der gegnerische amerikanische Block war. Eine solche Positionierung der Globalisierungsgegner darf uns nicht erstaunen. Seit einigen Jahren treten sie mit ihrem Slogan „Eine andere Welt ist möglich“ auf und prangern mit ihren Thesen den Liberalismus an und fordern einen stärkeren Staat. Die Bourgeoisie unterstützt diese Bewegung mit allen Kräften, um der Entwicklung eines Klassenbewusstseins des Proletariats gegenüber dem Scheitern des Kapitalismus entgegenzutreten. Diese angeblich „andere Welt“ ist weder neu noch sozial, es ist die, in der wir gegenwärtig leben, in der der Staat entgegen allen anderen Auffassungen der Hauptpfeiler zur Verteidigung der Interessen der Bourgeoisie und des Kapitalismus ist und bleiben wird.
Der Staat als Speerspitze der Angriffe
Auch wenn die Bourgeoisie die schreiende Tatsache nicht verleugnen kann, dass die Wirtschaftskrise der Grund für die Angriffe gegen die Arbeiterklasse ist, so versucht sie diese Tatsache doch zu vernebeln, indem sie den „mangelndem Bürgersinn von gewissen unmoralischen Wirtschaftsführern“, die „schlechte Unternehmensführung“ von gewissen anderen an den Pranger stellt ... kurz: Sie unternimmt alles, um einmal mehr zu verhindern, dass die wirklich grundlegende Frage gestellt wird, nämlich diejenige nach der Unausweichlichkeit der Wirtschaftskrise als Folge der unüberwindbaren Widersprüche des Kapitalismus. Heute muss der Staat selbst, ob nun mit einer linken oder einer rechten Regierung, im Namen der gesamten Bourgeoisie schwere und allgemeine Angriffe wie gegen die Altersversicherungen führen. Das kann nur eines bedeuten: Der Kapitalismus ist je länger desto weniger in der Lage, der Klasse, die er ausbeutet, die Lebensgrundlagen zuzugestehen. In unserer letzten Ausgabe von der International Review Nr. 114 (engl./frz./span. Ausgabe) haben wir aufgezeigt, wie der Staat in verschiedenen Ländern solche Angriffe gegen die Altersvorsorge (Frankreich, Österreich, Brasilien) und gegen die Sozialfürsorge oder die Arbeitslosenunterstützung (Deutschland, Holland, Polen) aufgegleist hat. Zurzeit sieht die italienische Regierung ebenfalls Reformen beim Altersvorsorgesystem vor, das immer wieder als eines der „teuersten der Europäischen Union“ angeprangert wird. Seit dem Frühling kommt es auf allen Kontinenten, in allen Ländern und in allen Sektoren unaufhörlich zu neuen Reduktionen der Staatsausgaben und zu Massenentlassungen. Zur Illustration zitieren wir hier die aktuellsten:
– Philips hat in fünf Jahren bereits 120 Produktionsstandorte geschlossen oder verkauft und seit dem Mai 2001 50'000 Stellen gestrichen. Das Unternehmen wird weitere 50 seiner noch 150 Standorte schliessen, was noch einmal 170'000 Arbeiter betrifft.
– Schneider Electric mit 75'000 Lohnabhängigen in 130 Ländern wird nochmals 1'000 Stellen in Frankreich streichen.
– ST Microélectronics kündigt die Schliessung des Standortes in Rennes in Frankreich an, was 600 Stellen betrifft.
– 10% der Angestellten von Cadence Design System (Kalifornien), also 500 Personen, werden entlassen.
– Volkswagen kündigt die Entlassung von 3'933 Arbeitern in Sao Bernardo do Campo in Brasilien an. Angesichts der Gefahr von Arbeitermobilisierungen droht der Chef des Unternehmens mit der Entlassung eines jeden, der sich an einem Streik beteiligen sollte.
– Matra Automobile schliesst eine Fabrik in Frankreich und entlässt 1'000 Arbeiter;
– Giat Industries (Waffenproduktion in Frankreich) kündigt die Entlassung von 3'750 Arbeitern bis 2006 an.
– Das Tabakunternehmen Altadis streicht 1'700 Stellen in Spanien und Frankreich.
– Das in der Metallherstellung tätige Unternehmen Eramet entlässt in Europa 2'000 Arbeiter.
Angesichts des verengten Weltmarktes hat nur die Anhäufung eines Schuldenberges künstlich Abhilfe schaffen können. Jetzt aber sehen sich die öffentlichen und privaten Unternehmen zusätzlich gezwungen, einen Teil ihrer Belegschaft abzubauen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Arena zu bewahren. Der Staat regelt in letzter Instanz die Entlassungsmodalitäten. Er trifft auch die nötigen Vorkehrungen, damit der Stellenabbau nicht zu zusätzlichen Ausgaben für ihn selbst führen. So werden überall die Arbeitslosenleistungen gesenkt. Nach den Massnahmen des deutschen Staates in diesem Frühjahr hat nun der französische Staat damit begonnen, Tausende von Arbeitern von den Arbeitslosenlisten zu streichen. Ein einige Monate zuvor verabschiedetes Gesetz hat ihn dazu in die Lage versetzt.
Die Aufgabe der linken und linksextremen Fraktionen der Bourgeoisie im Zusammenhang mit der Verschärfung der Krise besteht darin zu verhindern, dass die Arbeiterklasse das System selbst grundlegend in Frage stellt. Sie vergiften das Bewusstsein der Arbeiterklasse mit der Verkündung, dass Lösungen innerhalb des Systems möglich seien. Dem Staat müsse nur wieder eine zentralere Rolle, wie sie ihm der Liberalismus streitig gemacht habe, zurück gegeben werden. Nun kann man aber gut sehen, dass es der Staat selbst ist, ob nun mit einer linken oder einer rechten Regierung, der die massivsten Angriffe seit Ende der 60er-Jahre orchestriert. Ganz entgegen der These einer Abnahme der Rolle des Staates in der Gesellschaft erhält dieser eine immer gewichtigere Stellung im Dienste der Verteidigung der Interessen des nationalen Kapitals. Folgende Beispiele illustrieren dies sehr gut:
– 1998 ist der japanische Staat den Banken zu Hilfe geeilt, um ihren Zusammenbruch zu verhindern.
– Am 23. September desselben Jahres hat die amerikanische Zentralbank gleich gehandelt, indem sie die Fondsgesellschaft „Long Term Capital Management“ kurz vor dem Konkurs rettete.
– Der französische Staat handelt heute mit der Hilfestellung für Alstom (Herstellung der TGV) nicht anders.
In all diesen Fällen sind staatskapitalistische Massnahmen mit dem Ziel ergriffen worden, Unternehmen zu erhalten, die entweder im Industriebereich als strategisch wichtig beurteilt werden oder deren Konkurs noch grössere Finanzkatastrophen nach sich gezogen hätte. Es handelt sich gewiss nicht um soziale Massnahmen, was die Ankündigung von beinahe 5'000 Entlassungen bei Alstom und von 10'500 Entlassungen in 15 Banken in Japan, die öffentlich Unterstützung erhalten, bezeugt. Wenn diese Banken im letztgenannten Fall tatsächlich weitere Unterstützung vom Staat erhalten wollen, haben sie keine andere Wahl, als sich seinen Anweisungen zu beugen: Sie müssen durch eine Abmagerung ihre Bilanzen verbessern, die 50 Milliarden Dollar zweifelhafter Guthaben aufweisen, die höchst wahrscheinlich nie wieder eingetrieben werden können. Und diese Schätzungen, die der Staat veröffentlicht hat, sind gemäss unabhängigen Analysten noch weit von der schlimmeren Realität entfernt (gemäss BBC News vom 19.9.2003).
Zurück zu den Lebensbedingungen der Arbeiterklasse des 19. Jahrhunderts
Die Bourgeoisie gefällt sich darin, die Arbeiterklasse immer wieder an die Lebensbedingungen des 18. und 19. Jahrhunderts zu erinnern, damit sie die aktuellen Lebensbedingungen akzeptiert: Die Arbeiter seien in ungesunden Elendsquartieren zusammengepfercht gewesen und hätten unerträgliche Arbeitsbedingungen mit Arbeitstagen bis zu 18 Stunden erdulden müssen.
Die daraus resultierende Schwächung der Arbeitskraft drohte eine Fessel für die Ausbeutung und die kapitalistische Akkumulation zu werden. Weiter wurde das sich entwickelnde Elend in den Industriestädten zu einer wachsenden Quelle für tödliche Epidemien in erster Linie für die Arbeiterklasse selbst, aber auch die übrige Bevölkerung – das Kleinbürgertum und das Bürgertum – war davon betroffen. Aus diesem Grund fiel die Entwicklung des Kampfes der Arbeiter für Reformen und eine Verbesserung der Bedingungen mit den allgemeinen Interessen des Kapitalismus zusammen. Der Kapitalismus hatte zu diesem Zeitpunkt seine historischen Grenzen noch nicht erreicht. Diese Situation wird sehr gut in einem Zitat aus Marxens Lohn, Preis und Profit zum Kampf für eine Verkürzung des Arbeitstages veranschaulicht: „(Die offiziellen Ökonomen) drohten (für den Fall einer Einführung des Zehnstunden-Tages) mit Abnahme der Akkumulation, Steigerung der Preise, Verlust der Märkte, Schrumpfung der Produktion, daher entspringendem Rückschlag auf die Löhne und schliesslichem Ruin ... Schön, was war das Resultat? Steigerung des Geldlohns der Fabrikarbeiter trotz der Verkürzung des Arbeitstages, grosse Zunahme der Zahl der beschäftigten Fabrikarbeiter, anhaltendes Fallen der Preise ihrer Produkte, wunderbare Entwicklung der Produktivkraft ihrer Arbeit, unerhört fortschreitende Ausdehnung der Märkte für ihre Waren“ (MEW, Bd. 16, S. 110). Im Gegenzug ist der Kapitalismus mit der Beendigung der progressiven Phase und dem Eintritt in die Niedergangsperiode durch seine eigenen Widersprüche dazu getrieben worden, die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse immer massiver anzugreifen. Alle die Widerstandskämpfe der Arbeiterklasse im 20. Jahrhundert haben zwar die Heftigkeit der Angriffe mildern können, jedoch waren sie ausser Stande, die allgemeine Tendenz zur Verschlechterung der Lebensbedingungen umzukehren. Einzig die Überwindung des Kapitalismus wird dazu in der Lage sein.
Immer grössere Katastrophen aufgrund der Umweltzerstörung
Schlammfluten, die die Wellblechhütten verschlingen; Wirbelstürme, die sie davontragen; Erdbeben, die die billig gebauten Häuser, die mehr aus Sand als aus Zement bestehen, einstürzen lassen; Tausende von Menschenleben, die diese entfesselten Naturgewalten aufgrund der elenden Bedingungen fordern, unter denen die Leute schutzlos ausgeliefert wohnen – das ist seit Jahrzehnten das gemeinsame Schicksal der von der Armut geprägten Regionen der Dritten Welt. Doch mittlerweile verschonen solche Katastrophen die Zentren der industrialisierten Welt nicht mehr, die ebenfalls immer mehr Verarmte zählen und wo man seit einigen Jahren die Folgen der Klimaveränderung auf der Erde handfest spürt. Auch wenn die Unterschiede beträchtlich sind, so wird je länger je deutlicher, dass die Situation der Dritten Welt das Abbild dessen ist, was die grossen industrialisierten Länder erwartet, und nicht umgekehrt. Obwohl die Menschheit aufgrund des enormen Fortschritts bei der Produktivkraftentwicklung, die der Kapitalismus gebracht hat, noch nie so nah an der Fähigkeit war, die Gewalten der Natur zu bändigen, um mit ihr in Einklang zu leben, so wird doch Europa, die Wiege dieses Systems, immer ohnmächtiger gegenüber der elementaren Natur, wie dies ein kurzer Rückblick über lediglich ein Jahr verdeutlicht:
– Sommer 2003: Die Hitzewelle war auch Ursache der grössten Waldbrände, die je in diesen Regionen beobachtet worden waren und zahlreiche Menschenleben forderten. Fast 20% der Waldfläche Portugals sind dabei abgebrannt.
– Januar 2003: Die Kältewelle, die Europa heimsuchte, tötete ebenfalls viele Menschen, was mittlerweile zur Normalität geworden ist, wenn das Quecksilber im Winter unter Null Grad fällt: etwa tausend Todesopfer in Russland, einige Dutzend in Westeuropa. Diese letzte Zahl mag im Vergleich zu anderen als gering erscheinen, doch darf man dabei nicht vergessen, dass solche Kältetote eine neue Erscheinung sind.
– September 2002: Eine Sintflut ging auf die Cevennen (im Südosten Frankreichs) nieder, die alles zerstörte, was ihr im Weg stand, und eine drei Departemente umfassende Region in Morast verwandelte. Bilanz: rund vierzig Todesopfer, weggespülte Brücken, unterbrochene Eisenbahnlinien, Autobahnen, Telefonleitungen.
– August 2002: Das Gebiet zwischen dem Schwarzen Meer und Ostdeutschland, Bayern, Tschechien und Österreich versank in den Fluten der Elbe, der Donau und ihrer Nebenflüsse, die alle über die Ufer traten. Die Überschwemmungen waren die Folgen von ununterbrochenen Regengüssen, trafen das Land, die Städte, sowohl kleine als auch grosse: 100'000 Personen in Dresden evakuiert, ganze Quartiere von Prag, Wien beschädigt, Eisenbahnbrücken weggerissen, Chemiefabriken in Gefahr, gigantische finanzielle Verluste und vor allem Dutzende von Toten überall.
Ähnlich wie die anderen Aspekte des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft unterstreicht die Bedrohung der Umwelt die Tatsache, dass bei ausbleibender Revolution des Proletariats die Gefahr immer grösser wird, dass der Ausbreitung der Zerstörung und des Chaos einen Punkt erreicht, von dem an es kein Zurück mehr gibt und der Kampf für die Revolution und den Aufbau einer neuen Gesellschaft verunmöglicht wird (in Internationale Revue Nr. 13, siehe: „Ökologie: der Kapitalismus vergiftet die Erde“).
Das Chaos und der Krieg sind die einzige Perspektive, die der Kapitalismus anbietet
Wie wir in diesen Spalten schon verschiedentlich dargelegt haben, ist die einzig übrig gebliebene Supermacht dauernd dazu gezwungen, auf dem militärischen Feld die Initiative zu ergreifen, dort wo sich ihre gewaltige Übermacht gegenüber allen Rivalen offenbart, um ihnen gegenüber die je länger je mehr in Frage gestellte Führung auf der ganzen Welt zu verteidigen. Seit dem ersten Golfkrieg sind die grössten Konflikte immer wieder die Folge einer Flucht nach vorn der Vereinigten Staaten gewesen, die in einem unüberwindbaren Widerspruch gefangen sind: Jede neue Offensive bringt zwar die Rebellion gegen die amerikanische Vorherrschaft für eine Weile zum Schweigen, schafft aber gleichzeitig die Voraussetzungen für das nächste Aufflammen, da neue Frustrationen erzeugt werden und sich antiamerikanische Gefühle entwickeln. Die Eskalation, die seit September 2001 die USA (unter dem Vorwand des Krieges gegen den Terrorismus und die „gefährlichen Diktatoren“) dazu verleitet hat, Afghanistan und den Irak, ohne sich um die UNO und die NATO zu kümmern, militärisch zu besetzen, gehorcht genau dieser Logik. Doch hat keiner der früheren Kriege eine für die USA so schwierige Lage geschaffen wie diejenige in Afghanistan und v.a. im Irak.
Der militärische Sieg über Saddam Husseins Irak fiel der amerikanischen Bourgeoisie zwar sehr leicht, sie rechnete aber nicht mit so schwerwiegenden Problemen, wie sie sich nun bei der Besetzung und der Kontrolle des Landes stellen. Die Einlösung der schönen Versprechen der Bush-Administration über den Wiederaufbau und die Demokratie im Irak wird angesichts der immer tieferen militärischen Verstrickungen ihrer Truppen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Die Folgen, die sich aus dieser Situation ergeben, sind vielschichtig.
Bei ihrem Versuch, die Ordnung aufrecht zu erhalten und die Lage zu kontrollieren, sind die Vereinigten Staaten gezwungen, die Stärke der Besatzungstruppen zu vergrössern. Es sind Zeichen einer schwindenden Zustimmung zu dieser Mission, wenn die freiwilligen Berufssoldaten immer schwieriger zu finden sind und die Truppen vor Ort offen ihren Missmut oder gar Nervosität ausdrücken, wenn sie auf alles, was sich bewegt, gleich schiessen aus Angst davor, sonst selber aufs Korn genommen zu werden.
Bevor Bush die USA in diese neue militärische Offensive warf, verkündete er, dass die Befreiung dieses Landes die geopolitische Landschaft der ganzen Region auf den Kopf stellen werde. Tatsächlich war es ein nicht eingestandenes Ziel dieser Offensive, durch die amerikanische Herrschaft über den Irak den Einfluss in der ganzen Region zu vergrössern und sie insbesondere als Mittel zur Einkreisung Europas zu benützen. Ein solches Szenario beinhaltete aber notwendigerweise die Fähigkeit der USA, in allen Spannungsherden die „Pax americana“ durchzusetzen, und zwar insbesondere im explosivsten, nämlich dem israelisch-palästinensischen. Bush verkündete denn auch eine baldige Regelung desselben. Es war durchaus zutreffend davon auszugehen – wie dies Bush auch tat –, dass die Entwicklung der Lage im Irak Konsequenzen auf die von Jerusalem besetzten Gebiete haben würde. Dies bewahrheitet sich heute auch, aber anders als es Bush erwartet hat, durch die Verschärfung der Zusammenstösse in diesen Gebieten. Der gegenwärtige Misserfolg der amerikanischen Bourgeoisie im Irak stellt in der Tat ein Hindernis dar für ihre Versuche, den ungehorsamen Verbündeten Israel zu zügeln, der eigentlich die „Road Map“ respektieren sollte, die er aber ständig sabotiert. Solche Schwierigkeiten der amerikanischen Bourgeoisie, ihre Ansprüche gegenüber Israel durchzusetzen, sind nicht neu und erklären teilweise den Misserfolg der verschiedenen Friedenspläne in den letzten 10 Jahren. Doch waren die Folgen noch nie so ernsthaft wie heute. Dies wird durch die kurzsichtige Politik veranschaulicht, die Sharon fähig ist, dem Nahen Osten aufzuzwingen, und die einzig auf der Suche nach der Eskalation der Zusammenstösse mit den Palästinensern beruht mit dem Ziel, sie aus den besetzten Gebieten zu vertreiben. Selbst wenn in dieser Region – wie überhaupt auf der Welt – ein Frieden ohnehin nicht möglich ist, wird die von Sharon, dem Schlächter von Sabra und Schatila[2], gespielte Karte nur zu noch mehr Blutbädern führen, die das Palästinenserproblem für Israel keineswegs lösen. Im Gegenteil, dieses Problem wird vielmehr als Bumerang zurückkehren, insbesondere durch einen noch weniger als heute kontrollierbaren Wildwuchs des Terrorismus. Eine solche Entwicklung wird wiederum die USA in ein noch schlechteres Licht rücken, ohne dass sie aber ihren besten Verbündeten in der Region deshalb fallen lassen könnten.
Der Fehlschlag der Vereinigten Staaten im Irak untergräbt ihren Kredit und ihre Autorität in der ganzen Welt, worüber sich ihre Rivalen nur freuen können und was sie auch auszunützen versuchen. Frankreich, der lauteste dieser Rivalen, hat vertreten durch Chirac in der Vollversammlung der UNO unter dem Vorwand, gegenüber seinem „immerwährenden grossen Verbündeten“ die unterschiedlichen Meinungen auszudrücken, die Gunst der Stunde genutzt und sich die Dreistigkeit erlaubt, Bush darauf hinzuweisen, dass dieser mit der Intervention im Irak, die er trotz der Vorbehalte von zahlreichen Ländern, so auch Frankreichs, durchgeführt hat, einen Fehler begangen habe. Mehr Anlass zur Sorge bildet für die USA allerdings der Umstand, dass es ihnen bis heute trotz wiederholten Aufrufen nicht gelungen ist, abgesehen von Grossbritannien, das sich seit Beginn an der Militäroperation beteiligt hat, eine andere Grossmacht zur Verstärkung des Kontingents der Besatzungstruppen im Irak zu verpflichten. Spanien, das keine Grossmacht ist, hat nur gerade eine symbolische Armeeeinheit entsandt. Einzig Polen, das eine noch weniger grosse Macht darstellt, hat positiv auf die amerikanischen Lockrufe reagiert, mit denen es eingeladen worden ist, zusammen mit den Grossen dieser Welt in der Sonne zu defilieren. Es wird für die USA auch schwierig werden, viele Freiwillige zu finden, die mit ihnen zusammen die Stabilisierung und den Wiederaufbau des Irak finanzieren.
Die amerikanische Bourgeoisie befindet sich in einer Sackgasse, die ihrerseits eine Folge der ausweglosen Situation auf der ganzen Welt ist, die aufgrund der gegenwärtigen historischen Bedingungen nicht mit einem Kurs auf einen neuen Weltkrieg gelöst werden kann. Da dieser radikale bürgerliche Ausweg aus der gegenwärtigen Weltkrise, der die sichere Vernichtung der Menschheit bedeuten würde, nicht vorhanden ist, versinkt diese immer mehr im Chaos und der Barbarei, welche Kennzeichen der letzten Phase des Zerfalls des Kapitalismus sind.
Die gegenwärtige relative Schwäche der Vereinigten Staaten hat den Ehrgeiz ihrer Rivalen angestachelt, wieder in die Offensive zu gehen. So fand am 20. September in Berlin ein Treffen zwischen G. Schröder, J. Chirac und T. Blair statt, bei dem sich die drei Chefs auf die Absicht einigten, Europa mit einem selbständigen operationellen Generalstab auszustatten, welchem Ansinnen bisher die britische Bourgeoisie entgegen stand. Diese Schritte hin zu unbestreitbaren Rivalen der USA können nicht erstaunen, da Grossbritannien auch für die Kosten des irakischen Schlamassels aufkommen muss und dringend einen Ausgleich bei seinen Bündnissen suchen muss, um gegenüber dem amerikanischen Einfluss Gegensteuer geben zu können. Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Erklärung Blairs zum Abschluss dieses Treffens: „Wir haben bei der europäischen Verteidigung immer mehr eine gemeinsame Position“ (zit. nach der französischen Tageszeitung Le Monde vom 23. September). Zudem haben die 25 Mitglieder des Erweiterten Europas anlässlich der UNO-Vollversammlung im September wahrscheinlich auf Initiative von Deutschland und Frankreich geschlossen für einen Text gestimmt, der die Bedrängnis der USA hinsichtlich der Politik gegenüber ihrem Verbündeten Israel nur zuspitzen kann, da mit diesem Votum der Beschluss Sharons, Arafat des Landes zu verweisen, verurteilt worden ist[3]. Mit dieser symbolischen Abstimmung wurde das Ansehen der USA aufs Korn genommen, um es weiter zu untergraben.
Von den 25 Mitgliedern des Erweiterten Europas, die nun implizit die USA kritisiert haben, hatte eine Mehrheit vor dem Ausbruch des Irakkrieges wohl oder übel die amerikanische Option gegenüber derjenigen des Trios Frankreich, Deutschland, Russland unterstützt. Diese Tatsache wie auch die neuerliche Entwicklung der britischen Position hinsichtlich des europäischen selbständigen operationellen Generalstabs veranschaulichen ein Merkmal der Phase, die durch die Auflösung der imperialistischen Blöcke eröffnet worden ist; die IKS wies nach dem ersten Golfkrieg bereits darauf hin: „In der neuen historischen Epoche, in die wir jetzt eingetreten sind – und die Ereignisse am Persischen Golf liefern eine Bestätigung dafür – gibt es überall auf der Welt immer mehr Konflikte, in denen die Tendenz des ‚Jeder-für-sich‘ dominiert, und in denen die Bündnisse zwischen Staaten keine grössere Stabilität bringen, wie das bei den Blöcken der Fall war, sondern sie werden nur ein Ergebnis der jeweiligen Verhältnisse sein.“ (in: Internationale Revue Nr. 13, siehe: „Militarismus und Zerfall“) Es kommt nicht von ungefähr, dass die Revolutionäre die Sitten der Bourgeoisie mit denjenigen von Ganoven verglichen haben. Doch während in der Vergangenheit sowohl bei den einen als auch bei den anderen gewisse Regeln herrschten, die darauf abzielten, ihre Verbrechen abzusegnen, lösen sich diese Regeln heute auf, und übrig bleiben nur noch Taten ohne Moral und Gesetz. Schröder veranschaulichte dies kürzlich sehr deutlich, als er nach einem Treffen mit G. Bush am Rande der Arbeiten der UNO-Versammlung erklärte, voll und ganz mit ihm einverstanden zu sein, während er bisher zusammen mit Frankreich das antiamerikanische Bollwerk darstellte.
Die Verantwortung der Arbeiterklasse
Mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und der Auflösung des westlichen Blocks verschwand Anfang der 1990er-Jahre die Gefahr eines weltumspannenden Atomkrieges, der die Menschheit vernichtet und damit den Widersprüchen des Kapitalismus ein brutales Ende bereitet hätte. Die Rahmenbedingungen haben sich verändert, indem zwar die Möglichkeit eines Weltkrieges für eine gewisse Zeit von der Tagesordnung verschwunden ist, aber diese Widersprüche sich weiterhin durch immer weiter zugespitzte Erscheinungen des kapitalistischen Zerfalls ausdrücken, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens prägen. Dies ist keineswegs ein Grund zur Beruhigung, denn „der Zerfall führt, wie sein Name sagt, zum Auseinanderbrechen und zum Verfaulen der Gesellschaft, ins Nichts. Seiner eigenen Logik und seinen letzten Konsequenzen überlassen, führt er die Gesellschaft zum gleichen Ergebnis wie der Weltkrieg. Brutal von einem thermonuklearen Bombenhagel in einem Weltkrieg getötet zu werden oder durch die Verschmutzung, die Radioaktivität der Atomkraftwerke, den Hunger, die Epidemien und die Massaker der verschiedenen kriegerischen Konflikte (bei denen auch Atomwaffen eingesetzt werden können) zerstört zu werden, all das läuft aufs gleiche hinaus“ (in: Internationale Revue Nr. 13, siehe: „Der Zerfall: letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus“).
In der Zeit, als die Zerstörung der Gesellschaft einzig aufgrund des imperialistischen Krieges drohte, genügte der Umstand, dass die Kämpfe des Proletariats das entscheidende Hindernis auf dem Weg zu diesem Ziel darstellten, um eben diese Zerstörung zu verhindern. Im Gegensatz zum verallgemeinerten imperialistischen Krieg, der zu seiner Entfesselung die Unterwerfung des Proletariats unter die Ideale der Bourgeoisie voraussetzt, braucht der Zerfall keineswegs die Unterjochung der Arbeiterklasse, um die Menschheit in den Abgrund zu reissen. So wie die Kämpfe des Proletariats in diesem System den wirtschaftlichen Zusammenbruch nicht verhindern können, sind sie auch nicht in der Lage, den Zerfall zu bremsen. Um der Gefahr, die der Menschheit durch den Zerfall droht, zu begegnen, genügen die Abwehrkämpfe der Arbeiter gegen die Auswirkungen der Krise nicht mehr: Einzig die kommunistische Revolution kann sie beseitigen.
Trotz dem Schlag gegen die Bewusstseinsentwicklung des Proletariats, den der Zusammenbruch des Ostblocks darstellte und dessen Folgen auf der Ebene des Klassenkampfes noch bei weitem nicht überwunden sind, hat die Arbeiterklasse keine grössere Niederlage einstecken müssen; ihre Kampfbereitschaft bleibt im wesentlichen intakt. Einerseits stellt die unausweichliche Verschärfung der kapitalistischen Krise die Ursache für den fortschreitenden Zerfall dar, andererseits und gleichzeitig ist sie der wesentliche Antrieb für den Kampf und die Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse, die ihrerseits die Voraussetzung für ihre Fähigkeit darstellen, dem ideologischen Gift der verfaulenden kapitalistischen Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Die Krise entlarvt die eigentlichen Ursachen der ganzen Barbarei, der diese Gesellschaft unterworfen wird, und erlaubt es somit dem Proletariat, sich der Notwendigkeit einer radikalen Änderung des Systems und der Unmöglichkeit, innerhalb desselben gewisse Aspekte zu verbessern, bewusst zu werden. Obwohl aber der Verteidigungskampf erforderlich ist, genügt er allein nicht, um den Weg zur Revolution zu bereiten. Das Proletariat muss die Mittel und die Ziele seines Kampfes begreifen, und dies kann nur das Resultat einer bewussten Anstrengung auf seiner Seite sein. In diesem Prozess haben die revolutionären Organisationen eine massgebliche Rolle zu spielen. Nur so kann es die Tragweite seines Kampfes, die Taktik und die Fallen verstehen, die ihm der Klassenfeind stellt, und eine immer grössere Einheit in seinen Reihen herstellen.
LC (3. Oktober 2003)
Fußnoten:
1. José Bové ist Wortführer der Bauern-Konföderation und einer der bekanntesten französischen Anführer der Antiglobalisierungsbewegung. Die französische Bourgeoisie rückt ihn ständig ins Scheinwerferlicht. Er unterhält gute Beziehungen zur Linken und zur extremen Linken in diesem Land. Am Fest der Humanité (Tageszeitung der kommunistischen Partei Frankreichs) vom 10. September erklärte er, dass man „Cancun köpfen“ müsse.
2. Sharon führte im September 1982 mit einer besonders barbarischen Gründlichkeit die israelische Strafexpedition in den beiden palästinensischen Flüchtlingslagern in West-Beirut durch, bei der Tausende von Männern, Frauen und Kindern getötet und verletzt wurden.
3. Die Hauptrivalen der USA in Europa haben es geschafft, die sehr unbequeme Position der USA in dieser Angelegenheit auszunützen. Obwohl diese den Beschluss Israels öffentlich kritisiert haben, können sie es sich doch nicht erlauben, ihrem Verbündeten in den Rücken zu fallen, so dass sie schliesslich von ihrem Vetorecht in der UNO Gebrauch machen müssen, um zu verhindern, dass Israel durch eine Resolution verurteilt wird.
Theoretische Fragen:
- Zerfall [81]
Orientierungstext: Das Vertrauen und die Solidarität im Kampf des Proletariats (2. Teil)
- 2777 Aufrufe
Das Vertrauen und die Solidarität im Kampf des Proletariats (2. Teil)
Wir veröffentlichen hier den zweiten Teil eines Orientierungstextes, der während des Sommers 2001 in der IKS diskutiert und an der ausserordentlichen Konferenz im März 2002 angenommen wurde.1 Der erste Teil wurde in der Internationalen Revue Nr. 31 publiziert und behandelte die folgenden Themen:
– Die Auswirkungen der Konterrevolution auf das Selbstvertrauen und die Tradition der Solidarität bei den heutigen Generationen des Proletariats.
– Wie die IKS von den Schwächen beim Vertrauen und der Solidarität betroffen ist.
– Die Rolle des Vertrauens und der Solidarität in der Geschichte der Menschheit.
4. Die Dialektik des Selbstvertrauens der Arbeiterklasse:Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Da die Arbeiterklasse die erste Klasse in der Geschichte ist mit einer bewussten, historischen Vision, ist es logisch, dass die Grundlagen ihres Vertrauens in ihre eigene Mission ebenfalls historisch sind und die Gesamtheit ihres Werdegangs verkörpern. Daher basiert vor allem dieses Vertrauen in entscheidendem Masse auf der Zukunft und somit auf einem theoretischen Verständnis. Und daher ist die Stärkung der Theorie das bevorzugte Mittel zur Überwindung der angeborenen Schwächen der IKS auf dieser Ebene. Vertrauen ist per Definition stets Vertrauen in die Zukunft. Die Vergangenheit kann nicht verändert werden, daher richtet sich das Vertrauen nicht direkt an sie.
Jede im Aufstieg befindliche, revolutionäre Klasse stellt ihr Vertrauen in ihre spezifische Mission auf die Grundlage nicht nur ihrer gegenwärtigen Stärke, sondern auch ihrer vergangenen Erfahrungen und Errungenschaften. Dennoch war das Vertrauen der revolutionären Klassen der Vergangenheit und der Bourgeoisie im Besonderen hauptsächlich in der Gegenwart verwurzelt – in der wirtschaftlichen und politischen Macht, die sie in der herrschenden Gesellschaft bereits erlangt hatten. Da das Proletariat niemals eine solche Macht innerhalb des Kapitalismus besitzen kann, kann es nie solch eine Vorherrschaft der Gegenwart geben. Ohne die Fähigkeit, von seiner vergangenen Erfahrung zu lernen, und ohne eine wirkliche Klärung und Überzeugung in Bezug auf sein Klassenziel kann es niemals das Selbstvertrauen erlangen, um die Klassengesellschaft zu überwinden. In diesem Sinn ist die Arbeiterklasse, mehr als jede andere vor ihr, eine historische Klasse im wortwörtlichen Sinne. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind die drei unerlässlichen Komponenten ihres Selbstvertrauens. Es ist daher kein Wunder, dass der Marxismus, die wissenschaftliche Waffe der proletarischen Revolution, von seinen Gründern historischer oder dialektischer Materialismus genannt wurde.
a) Dies eliminiert überhaupt nicht die Rolle der Gegenwart in der Dialektik des Klassenkampfes. Gerade weil das Proletariat eine ausgebeutete Klasse ist, muss es seinen kollektiven Kampf für die Klasse als eine Gesamtheit entwickeln, um sich seiner wahren Stärke und seines zukünftigen Potenzials bewusst zu werden. Diese Notwendigkeit für die gesamte Klasse, Vertrauen zu erlangen, ist ein völlig neues Problem in der Geschichte der Klassengesellschaft. Das Selbstvertrauen der revolutionären Klassen der Vergangenheit, die Ausbeuter waren, beruhte stets auf einer klaren Hierarchie innerhalb jener Klassen in der Gesellschaft insgesamt. Es basierte auf der Fähigkeit, andere zu kommandieren und dem eigenen Willen unterzuordnen und damit auf der Kontrolle über den Produktions- und Staatsapparat. In der Tat ist es charakteristisch für die Bourgeoisie, dass selbst in ihrer revolutionären Phase andere für sie kämpften und dass, einmal an der Macht, sie immer mehr ihre Aufgaben an bezahlte Knechte „delegierte“.
Das Proletariat kann seine historische Aufgabe nicht an irgend jemanden delegieren. Daher muss die gesamte Klasse Selbstvertrauen entwickeln. Und daher ist das Vertrauen in das Proletariat stets auch Vertrauen in die Klasse als Ganzes, niemals nur in einen Teil der Klasse.
Es ist diese Tatsache, eine ausgebeutete Klasse zu sein, die ihrem Vertrauen einen schwankenden und gar ziellosen Charakter verleiht, der mit der Bewegung des Klassenkampfes auf- und abschwillt. Mehr noch, revolutionäre politische Organisationen selbst sind tief von dem Auf und Ab betroffen, bis zu dem Grad, dass die Weise, wie sie sich organisieren, sammeln und wie sie in der Klasse intervenieren, von dieser Bewegung abhängt. Und wie wir wissen, waren in Perioden schwerer Niederlagen nur winzige Minderheiten in der Lage gewesen, ihr Vertrauen in die Klasse aufrechtzuerhalten.
Doch diese Schwankungen im Vertrauen sind nicht nur mit dem Auf und Ab des Klassenkampfes verknüpft. Als eine ausgebeutete Klasse kann das Proletariat jederzeit, auch in der Hitze revolutionärer Kämpfe, einer Krise seines Selbstvertrauens zum Opfer fallen. Die proletarischen Revolutionen „unterbrechen sich ständig in ihrem eigenen Lauf, kommen auf das scheinbar Vollbrachte zurück, um es wieder von neuem anzufangen“, etc. Insbesondere „schrecken (sie) stets von neuem zurück vor der unbestimmten Ungeheuerlichkeit ihrer eigenen Zwecke“E(die im Folgenden mit Buchstabenbezeichneten Fussnoten zu den Quellenangaben befinden sich am Ende des Artikels), wie Marx sagte. Die Russische Revolution von 1917 zeigt deutlich, dass nicht nur die Klasse insgesamt, sondern auch die revolutionäre Partei von solchen Schwankungen betroffen ist. Tatsächlich durchlebten die Bolschewiki zwischen Februar und Oktober etliche Krisen des Vertrauens in die Fähigkeit der Klasse, die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. Krisen, die in einer Panik des Zentralkomitees der Bolschewiki angesichts des Aufstandes kulminierte.
Die Russische Revolution ist also die beste Illustration dafür, warum die tiefsten Wurzeln des Vertrauens des Proletariats im Gegensatz zur Bourgeoisie niemals in der Gegenwart liegen können. Während jener dramatischen Monate war es vor allem Lenin, der das unerschütterliche Vertrauen in die Klasse verkörperte, ohne das ein Sieg unmöglich ist. Und er tat dies, weil er nicht einen einzigen Moment lang die theoretische und historische Methode aufgab, die das Kennzeichen des Marxismus ist.
Dennoch ist der Klassenkampf ein unerlässliches Moment in der Entwicklung des revolutionären Vertrauens. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist er der Schlüssel für die gesamte historische Situation. Indem er die Wiedereroberung der Klassenidentität erlaubt, ist er die Vorbedingung für die gesamte Klasse, sich die Lehren der Vergangenheit wieder anzueignen und wieder eine revolutionäre Perspektive zu entwickeln.
Daher müssen wir, wie bei der Frage des Klassenbewusstseins, die eng damit verknüpft ist, zwei Dimensionen dieses Vertrauens unterscheiden: einerseits die historische, theoretische, programmatische und organisatorische Vermehrung des Vertrauens, die von den revolutionären Organisationen repräsentiert wird, und, etwas weiter gefasst, der Prozess der unterirdischen Reifung innerhalb der Klasse sowie andererseits der Grad und die Ausbreitung des Selbstvertrauens in der Klasse insgesamt zu einem gegebenen Moment.
b) Der Beitrag der Vergangenheit zu diesem Vertrauen ist nicht weniger elementar. Erstens, weil die Geschichte unleugbare Beweise für das revolutionäre Potenzial der Klasse enthält. Die Bourgeoisie selbst begreift die Bedeutung der vergangenen Beispiele für ihren Klassenfeind, weswegen sie pausenlos dieses Erbe und vor allem die Oktoberrevolution attackiert. Zweitens gibt es wenige Faktoren, die beruhigender sind als die Fähigkeit, vergangene Irrtümer zu korrigieren und die Lehren aus der Geschichte zu ziehen. Im Gegensatz zur bürgerlichen Revolution, die von einem Triumph zum nächsten eilte, wird der endgültige Sieg des Proletariats durch eine Reihe von Niederlagen vorbereitet. Das Proletariat ist somit in der Lage, vergangene Niederlagen in Elemente für das Vertrauen in die Zukunft umzuwandeln. Dies war eine der Hauptgrundlagen für das Vertrauen, das Bilan in der tiefsten Konterrevolution aufrechterhielt. In der Tat, je tiefer das Vertrauen in die Klasse ist, desto gnadenloser müssen mutige Revolutionäre ihre eigenen Schwächen und die der Klasse kritisieren; je weniger sie es nötig haben, sich etwas vorzumachen, desto mehr sind sie von nüchterner Klarheit und dem Fehlen von sinnloser Euphorie gekennzeichnet. Wie Rosa Luxemburg immer und immer wieder sagte, ist es die Aufgabe der Revolutionäre zu sagen, was Sache ist.
Drittens war die Kontinuität, insbesondere die Fähigkeit, Lehren von einer Generation zur nächsten weiterzureichen, stets fundamental für die Pflege des Selbstvertrauens der Menschheit gewesen. Die verheerenden Auswirkungen der Konterrevolution des 20. Jahrhunderts auf das Proletariat ist der negative Beweis dafür. Um so wichtiger ist es für uns, die Lehren der Geschichte zu studieren, um unsere eigenen Erfahrungen und jene der gesamten Arbeiterklasse an die Generationen von Revolutionären weiterzureichen, die uns folgen werden.
c) Doch es ist die zukünftige Perspektive, die die grösste Grundlage für unser Vertrauen in das Proletariat bildet. Das mag paradox erscheinen. Wie ist es möglich, sein Vertrauen auf etwas zu fussen, das noch gar nicht existiert? Doch diese Perspektive existiert. Sie existiert als ein bewusstes Ziel, als eine theoretische Konstruktion, genauso wie die Bauten, die errichtet werden, bereits im Kopf des Architekten existieren. Das Proletariat ist der Architekt des Kommunismus.
Wir haben bereits gesehen, dass zusammen mit dem Proletariat als einer unabhängigen Kraft in der Geschichte die Perspektive des Kommunismus auftritt: das kollektive Eigentum nicht der Konsummittel, sondern der Produktionsmittel. Diese Idee war das Produkt der Trennung des Produzenten von den Produktionsmitteln durch die Lohnarbeit und die Vergesellschaftung der Arbeit. Mit anderen Worten, sie war ein Produkt des Proletariats, seiner Stellung in der kapitalistischen Gesellschaft. Oder wie Engels im Anti-Dühring formulierte: Der Hauptwiderspruch im Herzen des Kapitalismus ist jener zwischen zwei gesellschaftlichen Prinzipien, dem kollektiven auf der Grundlage der modernen Produktion, repräsentiert vom Proletariat, und dem anarchischem, das auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln basiert, repräsentiert von der Bourgeoisie.
Die kommunistische Perspektive entstand bereits, bevor der proletarische Kampf sein revolutionäres Potenzial enthüllte. Was diese Ereignisse daher klären, ist, dass es der Arbeiterkampf ist, der allein zum Kommunismus führen kann. Doch die Perspektive an sich existierte schon zuvor. Sie basierte hauptsächlich weder auf den vergangenen noch auf den gegenwärtigen Lehren der proletarischen Schlacht. Und selbst in den 1840er-Jahren, als Marx und Engels begannen, den Sozialismus von einer Utopie in eine Wissenschaft umzuwandeln, hatte die Klasse noch keinen Beweis für ihre revolutionäre Macht abgegeben.
Dies bedeutet, dass von Anbeginn die Theorie selbst eine Waffe des Klassenkampfes war. Und bis zur Niederlage der revolutionären Welle war, wie wir gesagt haben, diese Vision ihrer revolutionären Rolle elementar, um der Klasse das Vertrauen zu verleihen, damit es das Kapital konfrontiert.
Somit ist die revolutionäre Theorie neben dem unmittelbaren Kampf und den Lehren der Vergangenheit ein unerlässlicher Faktor des Vertrauens, besonders seiner Entwicklung in die Tiefe, aber langfristig auch in die Breite. Da die Revolution nur ein bewusster Akt sein kann, kann sie nur siegreich sein, wenn die revolutionäre Theorie die Massen erobert.
In der bürgerlichen Revolution war die Perspektive nicht viel mehr als eine Projektion des Geistes vergangener und gegenwärtiger Entwicklungen: die allmähliche Eroberung der Macht innerhalb der alten Gesellschaft. Sofern die Bourgeoisie Theorien über die Zukunft entwickelte, kehrten sich diese in krude Mystifikationen um, die hauptsächlich die Aufgabe hatten, die revolutionäre Leidenschaft zu entflammen. Der unrealistische Charakter dieser Visionen schadete nicht der Sache, der sie dienen sollten. Für das Proletariat dagegen ist die Zukunft der Ausgangspunkt. Weil es nicht allmählich seine Klassenmacht innerhalb des Kapitalismus aufbauen kann, ist die theoretische Klarheit seine unentbehrlichste Waffe.
“Die klassische, idealistische Philosophie postulierte stets, dass die Menschheit in zwei verschiedenen Welten lebt: in der materiellen Welt, in der die Notwendigkeit herrscht, und in der Welt des Kopfes oder des Geistes, in der Freiheit herrscht. (...)Ungeachtet der Notwendigkeit, die Existenz zweier Welten zurückzuweisen, zu der die Menschheit gemäss Plato und Kant gehört, ist es dennoch korrekt, dass die menschlichen Wesen gleichzeitig in zwei Welten leben (...) Die beiden Welten, in denen die Menschheit lebt, sind die Vergangenheit und die Zukunft. Die Gegenwart ist die Grenze zwischen ihnen. Ihre ganze Erfahrung liegt in der Vergangenheit. (...) Sie kann nichts daran ändern, alles, was sie tun kann, ist, ihre Notwendigkeit zu akzeptieren. Somit ist die Welt der Erfahrung, die Welt der Erkenntnis auch eine Welt der Notwendigkeit. Sie unterscheidet sich von der Zukunft. Ich habe keine endgültige Gewissheit über sie. Sie liegt offensichtlich vor mir, als eine Welt, die ich nicht auf der Basis des Wissens erforschen kann, aber in der ich mich durch die Tat behaupten muss. (...) Handeln bedeutet stets, zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen, und auch wenn ich mich zwischen Handeln und Nicht-Handeln befinde, bedeutet dies Akzeptieren oder Nicht-Akzeptieren, Verteidigen oder Angreifen. (...) Doch nicht nur das Gefühl von Freiheit ist eine Vorbedingung der Tat, sondern auch die gegebenen Ziele. Wenn die Welt der Vergangenheit von dem Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung (Kausalität) regiert wird, so die Welt der Tat, der Zukunft von der Zweckhaftigkeit (Teleologie).“F
Noch vor Marx löste Hegel theoretisch das Problem des Verhältnisses zwischen Notwendigkeit und Freiheit, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Freiheit ist, das zu tun, was notwendig ist. Hegel sagte: Mit anderen Worten, nicht durch die Auflehnung gegen die Bewegungsgesetze der Welt, sondern durch ihr Verständnis und ihre Ausnutzung für die eigenen Zwecke vergrössert der Mensch seine Freiheit. „Blind ist die Notwendigkeit nur in dem Masse, wie sie nicht verstanden wird.“G Die Bewegungsgesetze der Geschichte zu verstehen ist deshalb für das Proletariat notwendig, um seine Klassenmission zu erfüllen. Es ist die marxistische Theorie, die Wissenschaft von der Revolution, die der Klasse die Mittel und damit das Vertrauen verleiht, um diese Mission zu verstehen und zu erfüllen. Wenn die Wissenschaft und mit ihr das Vertrauen der Bourgeoisie zu einem grossen Teil auf dem wachsenden Verständnis der Naturgesetze beruhte, so basiert die Wissenschaft und das Vertrauen der Arbeiterklasse auf dem Verständnis von Gesellschaft und Geschichte.
Wie MC in einem der klassischen Texte des Marxismus über diese Frage aufzeigte2, muss die Zukunft in einer revolutionären Bewegung die Vorherrschaft über Vergangenheit und Zukunft ausüben, weil sie ihre Richtung bestimmt. Die Vorherrschaft der Gegenwart führt unweigerlich zu Schwankungen, die eine enorme Verwundbarkeit gegenüber dem Einfluss des Kleinbürgertums schaffen, zur Personifizierung dieser Schwankungen führen. Die Vorherrschaft der Vergangenheit führt zum Opportunismus und somit zum Einfluss der Bourgeoisie als Bastion der modernen Reaktion. In beiden Fällen ist es der Verlust der langfristigen Sichtweise, die zum Verlust der revolutionären Richtung führt.
Wie Marx sagte: „Die soziale Revolution des neunzehnten Jahrhunderts kann ihre Poesie nicht aus der Vergangenheit schöpfen, sondern nur aus der Zukunft.“H
Daraus müssen wir den Schluss ziehen, dass der Immediatismus der Hauptfeind des Vertrauens in das Proletariat ist, nicht nur, weil der Weg zum Kommunismus quälend lang ist, sondern auch, weil dieses Vertrauen in der Theorie und der Zukunft verwurzelt ist, während der Immediatismus die Kapitulation vor der Gegenwart, die Anbetung der unmittelbaren Tatsachen bedeutet. Die ganze Geschichte hindurch war der Immediatismus ein führender Faktor bei der Desorientierung der Arbeiterbewegung gewesen. Er war die Wurzel für all die Tendenzen gewesen, „die Bewegung vor das Ziel“ zu stellen, wie Bernstein es formuliert hat, und so die Klassenprinzipien abzuschaffen. Ob er die Gestalt des Opportunismus annimmt, so wie die Revisionisten zur Jahrhundertwende oder wie die Trotzkisten in den 30er-Jahren, oder die Form des Abenteurertums, wie die Unabhängigen 1919 und die KPD 1921 in Deutschland, diese kleinbürgerliche politische Ungeduld steigerte sich stets bis zum biblischen Verrat an der Zukunft für ein Linsengericht. Die Wurzel dieser Narreteien ist stets ein Verlust an Vertrauen in die Klasse.
Im historischen Aufstieg des Proletariats formen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eine Einheit. Gleichzeitig warnt uns jede dieser „Welten“ vor einer spezifischen Gefahr. Die Gefahr, die die Vergangenheit betrifft, ist, dass ihre Lehren vergessen werden können. Die Gefahr der Gegenwart besteht darin, unmittelbaren, oberflächlichen Erscheinungen zum Opfer zu fallen. Die Gefahr bezüglich der Zukunft ist, dass die theoretische Arbeit vernachlässigt und geschwächt wird.
Dies mahnt uns daran, dass die Verteidigung und Weiterentwicklung der theoretischen Waffen der Klasse die spezifische Aufgabe revolutionärer Organisationen ist und dass Letztere eine besondere Verantwortung dafür haben, das historische Vertrauen in die Klasse zu schützen.
5. Vertrauen, Solidarität und Parteigeist sind niemals endgültige Errungenschaften
Wie wir gesagt haben, sind die Klarheit und die Einheit die wesentlichen Grundlagen der selbstbewussten, gesellschaftlichen Tat. Im Falle des internationalen proletarischen Klassenkampfes ist diese Einheit natürlich nur eine Tendenz, die eines Tages durch einen weltweiten Arbeiterrat möglicherweise verwirklicht wird. Doch politisch sind die Einheitsorganisationen, die im Kampf entstehen, bereits Ausdrücke dieser Tendenz. Ausserhalb dieser organisierten Ausdrücke manifestiert auch die Arbeitersolidarität – auch wenn sie auf individueller Ebene ausgedrückt wird – diese Einheit. Das Proletariat ist die erste Klasse, in der es keine konkurrierenden wirtschaftlichen Interessen gibt, und in diesem Sinn deutet seine Solidarität die Natur der Gesellschaft an, für die es kämpft.
Der wichtigste und dauerhafteste Ausdruck seiner Klasseneinheit ist jedoch die revolutionäre Organisation und das Programm, das sie vertritt. Als solche ist sie die ausgereifteste Verkörperung des Vertrauens in das Proletariat – und auch die komplexeste.
Vertrauen als solches steht auch im Zentrum des Aufbaus einer solchen Organisation. Hier wird das Vertrauen in die proletarische Mission direkt durch das Vertrauen in das politische Programm der Klasse ausgedrückt, in die marxistische Methode, die historische Fähigkeit der Klasse, in die Rolle der Organisation gegenüber der Klasse, in ihre Funktionsprinzipien, das Vertrauen der Militanten und der verschiedenen Bestandteile der Organisation in sich selbst und gegenseitig in die anderen: Insbesondere ist es die Einheit der verschiedenen politischen und organisatorischen Prinzipien, die sie verteidigt, und die Einheit zwischen den verschiedenen Teilen der Organisation, die die direktesten Ausdrücke des Vertrauens in die Klasseneinheit von Zweck und Ziel, des Klassenziels und der Mittel zu seiner Erlangung sind.
Die beiden Hauptaspekte dieses Vertrauens sind das politische und organisatorische Leben. Der erste Aspekt wird durch Loyalität zu politischen Prinzipien, aber auch durch die Fähigkeit ausgedrückt, die marxistische Theorie in Erwiderung auf die Evolution der Wirklichkeit weiterzuentwickeln. Der zweite Aspekt wird durch die Loyalität zu den Prinzipien der proletarischen Funktionsweise und die Fähigkeit ausgedrückt, ein wirkliches Vertrauen und eine wahre Solidarität innerhalb der Organisation zu entwickeln. Die Folge einer Schwächung des Vertrauens auf einer dieser beiden Ebenen wird stets die Einheit – und somit die Existenz – der Organisation in Frage stellen.
Auf der organisatorischen Ebene ist der ausgereifteste Ausdruck dieses Vertrauens, dieser Solidarität und Einheit der, wie Lenin ihn genannt hat, Parteigeist: In der Geschichte der Arbeiterbewegung gibt es drei berühmte Beispiele für die Erlangung solch eines Parteigeistes: die deutsche Partei in den 1870er und 1880er-Jahren, die Bolschewiki von 1903 bis zur Revolution und die italienische Partei sowie die Fraktion, die nach der revolutionären Welle aus ihr hervorging. Diese Beispiele werden helfen, uns die Natur und Dynamik dieses Parteigeistes und die Gefahren, die ihn bedrohen, zu zeigen.
a) Was die deutsche Partei auf dieser Ebene auszeichnete, war, dass sie ihre Funktionsweise auf die Grundlage der Organisationsprinzipien stellte, die von der Ersten Internationalen im Kampf gegen den Bakunismus (und Lassalleanismus) ausgearbeitet worden waren, dass diese Prinzipien in der gesamten Partei durch eine Reihe von organisatorischen Auseinandersetzungen verankert worden waren und dass im Kampf zur Verteidigung der Organisation gegen staatliche Repression eine Tradition der Solidarität zwischen den Militanten und den verschiedenen Teilen der Organisation geschmiedet worden war. Tatsächlich entwickelte die deutsche Partei während dieser „heroischen“ Periode der Klandestinität die Traditionen der kompromisslosen Verteidigung der Prinzipien, des theoretischen Studiums und der organisatorischen Einheit, die sie zum natürlichen Führer der internationalen Arbeiterbewegung machten. Die tägliche Solidarität in ihren Reihen war ein mächtiger Katalysator all dieser Qualitäten. Doch um die Jahrhundertwende war dieser Parteigeist nahezu tot, so dass Rosa Luxemburg feststellte, dass es mehr Menschlichkeit in einem sibirischen Dorf gebe als in der gesamten deutschen Partei.I In der Tat hatte schon lange zuvor das Verschwinden dieser Solidarität den kommenden programmatischen Verrat angekündigt.
b) Doch das Banner des Parteigeistes wurde von den Bolschewiki weitergetragen. Hier finden wir erneut dieselben Charakteristiken. Die Bolschewiki erbten ihre Organisationsprinzipien von der deutschen Partei, verankerten sie in jeder Sektion und in jedem Mitglied durch eine Reihe von organisatorischen Auseinandersetzungen, schmiedeten eine lebendige Solidarität durch Jahre der illegalen Arbeit. Ohne diese Qualitäten hätte die Partei nie die Prüfung der Revolution bestanden. Obwohl zwischen August 1914 und Oktober 1917 die Partei eine Reihe von politischen Krisen durchlitt und wiederholt auf die Penetration von offen bürgerlichen Positionen in ihren Reihen und in ihrer Führung (z.B. die Unterstützung des Krieges 1914 und nach dem Februar 1917) reagieren musste, wurde die Einheit der Organisation, ihre Fähigkeit, Divergenzen zu klären, ihre Irrtümer zu korrigieren und gegenüber der Klasse zu intervenieren, nie in Frage gestellt.
c) Wie wir wissen, war schon lange vor dem endgültigen Triumph des Stalinismus der Parteigeist in der Partei Lenins im vollen Rückgang begriffen. Doch auch im Angesicht der Konterrevolution wurde das Banner hochgehalten, diesmal von der italienischen Partei und daraufhin von der Fraktion. Die Partei wurde zum Erbe der Organisationsprinzipien und -traditionen des Bolschewismus. Sie entwickelte ihre Vision des Parteilebens im Kampf gegen den Stalinismus weiter und bereicherte es später mit der Vision und der Methode der Fraktion. Und dies wurde bewerkstelligt unter den fürchterlichsten Bedingungen, angesichts derer aufs Neue eine lebendige Solidarität geschmiedet werden musste. Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab die Italienische Linke jedoch die Organisationsprinzipien auf, die ihre Pfeiler gewesen waren. In der Tat haben weder die halbreligiöse Parodie des kollektiven Parteilebens, die vom Nachkriegs-Bordigismus entwickelt worden war, noch der föderalistische Informalismus von Battaglia irgendetwas mit dem Organisationsleben der italienischen Partei unter Bordiga zu tun. Besonders das Konzept der Fraktion als solche wurde aufgegeben.
Es waren die französischen Linkskommunisten, die zu den Erben dieser Organisationsprinzipien und des Kampfes für den Parteigeist avancierten. Und heute obliegt es der IKS, das Erbe weiter zu tragen und es am Leben zu erhalten.
d) Der Parteigeist ist keine ewige Errungenschaft. Jene vergangenen Organisationen und Strömungen, die ihn am besten verkörpert hatten, gingen seiner eine nach der anderen vollkommen und endgültig verlustig. (...)
In jedem der geschilderten Beispiele waren die Umstände, unter denen der Parteigeist verschwand, sehr verschieden. Die Erfahrung der langsamen Degeneration einer Massenpartei oder die Integration einer Partei in den Staatsapparat einer isolierten Arbeiterbastion werden vielleicht niemals wiederholt werden. Dennoch gibt es allgemeine Lehren, die man aus jedem dieser Fälle ziehen kann:
– Der Parteigeist verschwand an einem historischen Wendepunkt: in Deutschland zwischen dem aufsteigenden und niedergehenden Kapitalismus, in Russland mit dem Rückzug der Revolution und im Falle der Italienischen Linken zwischen Revolution und Konterrevolution. Heute ist es der Eintritt in die Zerfallsphase, der die Existenz des Parteigeistes bedroht.
– Die Illusion, dass die vergangenen Errungenschaften die Notwendigkeit der Wachsamkeit unnötig machen. Lenins „Kinderkrankheit“ ist ein perfektes Beispiel für diese Illusion. Heute birgt die Überschätzung der organisatorischen Reife der IKS dieselbe Gefahr.
– Es waren der Immediatismus und die Ungeduld, die dem programmatischen und organisatorischen Opportunismus Tür und Tor öffneten. Das Beispiel der Italienischen Linken ist besonders markant, da es sich uns historisch am nächsten befindet. Es war der Wunsch, auf lange Sicht den eigenen Einfluss und die Mitgliederzahl zu erhöhen, der die Italienische Linke 1943–45 dazu veranlasste, die Lehren der Fraktion aufzugeben, und die IKP 1980–81 dazu veranlasste, die programmatischen Prinzipien aufzugeben. Heute ist die IKS ihrerseits mit ähnlichen Versuchungen, gebunden an die Entwicklung der historischen Lage, konfrontiert.
– Dieses Aufgeben war auf der organisatorischen Ebene Ausdruck eines Verlustes des Vertrauens in die Arbeiterklasse, was sich unweigerlich auch auf der politischen Ebene ausdrückte (Verlust programmatischer Klarheit). Bis jetzt geschah dies noch nie mit der IKS selber. Doch waren davon die verschiedenen „Tendenzen“ betroffen, die sich von ihr abspalteten (wie die EFIKS oder der „Pariser Zirkel“, die beide die Analyse über die Dekadenz des Kapitalismus aufgaben).
In den vergangenen Monaten war es vor allem das gleichzeitige Auftreten einer Schwächung unserer theoretischen Bemühungen und Wachsamkeit, einer gewissen Euphorie im Verhältnis zum Fortschritt der Organisation und demzufolge einer Blindheit gegenüber unserem Versagen sowie das Wiederauftreten des Clanwesens, die die Gefahr des Verlustes des Parteigeistes, der organisatorischen Degeneration und theoretischen Sklerose aufdeckten. Die Untergrabung des Vertrauens in unseren Reihen und die Unfähigkeit, entscheidende Schritte in der Weiterentwicklung der Solidarität zu machen, waren entscheidende Faktoren in dieser Tendenz gewesen, die potenziell zum programmatischen Verrat oder zum Verschwinden der Organisation führen kann.
6. Kein Parteigeist ohne individuelle Verantwortlichkeit
Nach dem Kampf von 1993–96 gegen das Clanwesen begannen sich Misstrauen gegenüber den politischen und sozialen Beziehungen zwischen den Genossen ausserhalb des formellen Rahmens der Treffen und mandatierter Aktivitäten breit zu machen. Freundschaften, Liebesbeziehungen, soziale Bande und Handlungen, Gesten der persönlichen Solidarität, politische und andere Diskussionen unter Genossen wurden manchmal praktisch als notwendiges Übel, ja, als das bevorzugte Terrain der Entwicklung des Clanwesens behandelt. Im Gegensatz dazu wurden die formellen Strukturen unserer Aktivitäten als eine Art von Garantie gegen die Rückkehr des Clanwesens angesehen.
Solche Reaktionen gegen das Clanwesen enthüllen die ungenügende Verinnerlichung unserer Analyse und eine Preisgabe gegenüber der Gefahr, die von ihm ausgeht. Wie wir gesagt haben, tritt das Clanwesen teilweise als eine falsche Antwort auf das reale Problem eines Mangels an Vertrauen und Solidarität in unseren Reihen auf. Ferner war die Zerstörung der Beziehungen des gegenseitigen Vertrauens und der Solidarität zwischen den Genossen grösstenteils das Werk des Clanwesens und die Voraussetzung seiner weiteren Entwicklung. Es war in erster Linie das Clanwesen, das den Geist der Freundschaft zerstörte: Wirkliche Solidarität richtet sich niemals gegen Dritte und schliesst niemals gegenseitige Kritik aus. Das Clanwesen zerstört die unerlässliche Tradition der politischen Diskussionen und der sozialen Bande zwischen den Genossen, indem sie in „informelle Diskussionen“ hinter dem Rücken der Organisation umgewandelt werden. Indem es die Atomisierung steigert und das Vertrauen zerstört, indem es auf unverantwortliche Weise in das persönliche Leben von Genossen eingreift und sie sozial von der Organisation isoliert, untergräbt das Clanwesen die natürliche Solidarität, die sich auch ausdrückt in der „Pflicht der Organisation, die Augen offen zu halten“ gegenüber persönlichen Schwierigkeiten der Mitglieder.
Es ist unmöglich, das Clanwesen zu bekämpfen, indem man dessen Waffen benutzt. Nicht das Misstrauen gegenüber der vollen Entwicklung des politischen und sozialen Lebens ausserhalb der Sektionstreffen, sondern ein wirkliches Vertrauen in diese Tradition der Arbeiterbewegung macht uns gegenüber dem Clanwesen resistenter.
Diesem ungerechtfertigten Misstrauen gegenüber dem „informellen“ Leben einer Arbeiterorganisation liegt die kleinbürgerliche Utopie einer Garantie gegen den Zirkelgeist zugrunde, die nur zu einem illusorischen Dogma eines Katechismus gegen das Clanwesen führen kann. Solch eine Herangehensweise neigt dazu, die Statuten in starre Gesetze, das Recht, die Augen offen zu halten, in eine Überwachung und die Solidarität in ein leeres Ritual umzuwandeln.
Eine Erscheinungsweise der kleinbürgerlichen Zukunftsangst ist der morbide Dogmatismus, der einen Schutz gegen die Gefahr des Unvorhergesehenen anzubieten scheint. Diese Haltung verleitete die „alte Garde“ der russischen Partei dazu, Lenin ständig zu beschuldigen, die Prinzipien und Traditionen des Bolschewismus aufgegeben zu haben. Es ist eine Art von Konservatismus, der den revolutionären Geist untergräbt. Niemand ist vor dieser Gefahr gefeit, wie die Debatte über die polnische Frage zeigte, in der nicht nur Wilhelm Liebknecht, sondern auch teilweise Engels eine solche Haltung eingenommen hatte.
In Wirklichkeit ist das Clanwesen, gerade weil es eine Ausgeburt labiler Zwischenschichten ohne jegliche Zukunft ist, nicht nur fähig, sondern faktisch auch dazu verdammt, ständig wechselnde Formen und Charakteristiken anzunehmen. Die Geschichte zeigt, dass das Clanwesen nicht nur die Form der Unverbindlichkeit der Boheme und der von den Deklassierten sehr beliebten parallelen Strukturen annimmt, sondern auch in der Lage ist, die offiziellen Strukturen der Organisation wie auch das Auftreten des kleinbürgerlichen Formalismus und der Routiniertheit zu nutzen, um seine parallele Politik zu fördern. Während in einer Organisation, wo der Parteigeist schwach und die Streitsucht stark ist, ein informeller Clan die besten Erfolgsaussichten hat, sucht das Clanwesen in einer strengeren Atmosphäre, in der ein starkes Vertrauen in die Zentralorgane herrscht, den Erfolg im formalistischen Auftreten und in der Ausnutzung der offiziellen Strukturen für seine Zwecke. In Wirklichkeit enthält das Clanwesen beide Seiten dieser Medaille. Historisch ist es dazu verdammt, zwischen diesen beiden, sich scheinbar gegenseitig ausschliessenden Polen hin und her zu schwanken. Im Falle der Politik Bakunins sehen wir beide in einer „höheren Synthese“ zusammengefasst: die von der offiziellen Allianz verkündete absolute, individuelle, anarchistische Freiheit und das von der geheimen Allianz eingeforderte blinde Vertrauen sowie ihr bedingungsloser Gehorsam.
„Wie die Jesuiten, aber nicht mit dem Ziel der Knechtschaft, sondern der Emanzipation der Menschen, hat sich jeder von ihnen seinem eigenen Willen entsagt. Im Komitee wie in der gesamten Organisation ist es nicht das Individuum, das denkt, wünscht und handelt, sondern das Ganze“, schreibt Bakunin. Was diese Organisation auszeichnet, ist, wie er fortfährt, „das blinde Vertrauen, das bekannten und respektierten Persönlichkeiten geschenkt wird“.J
Es ist klar, welche Rolle die sozialen Beziehungen in einer solchen Organisation spielen sollen:
„Alle Gefühle der Zuneigung, all die verhätschelnden Empfindungen der Vertrautheit, Freundschaft, Liebe, Dankbarkeit müssen in ihm durch die kalte Leidenschaft der revolutionären Aufgabe erstickt werden.“K
Hier sehen wir deutlich, dass der Monolthismus keine Erfindung des Stalinismus ist, sondern bereits im clanmässigen Mangel an Vertrauen in die historische Aufgabe, in das kollektive Leben und in die proletarische Solidarität enthalten ist. Für uns ist dies nicht neu oder überraschend. Es ist die altbekannte kleinbürgerliche Furcht vor der individuellen Verantwortlichkeit, die heutzutage zahllose höchst individualistische Existenzen in die Arme diverser Sekten treibt, wo sie aufhören können, zu denken und selbst zu handeln.
Es ist gewiss eine Illusion zu glauben, dass man das Clanwesen ohne die Verantwortlichkeit der individuellen Mitglieder der Organisation bekämpfen kann. Und es wäre paranoid zu denken, dass individuelle Überzeugung und Wachsamkeit durch eine „kollektive“ Überwachung ersetzt werden könnten. In Wahrheit verkörpert das Clanwesen einen Mangel an Vertrauen sowohl in das reale kollektive Leben als auch in die Möglichkeit einer realen individuellen Verantwortlichkeit.
Worin besteht der Unterschied zwischen Diskussionen unter Genossen ausserhalb der Treffen und den „informellen Diskussionen“ des
Clanwesens? Ist es die Tatsache, dass Erstere, nicht jedoch Letztere der Organisation mitgeteilt werden? Ja, auch wenn es nicht möglich ist, über jede Diskussion formell zu berichten. Weitaus fundamentaler und entscheidender ist jedoch das Verhalten, mit dem eine solche Diskussion geführt wird. Dies ist der Parteigeist, den wir alle weiterentwickeln müssen, da dies niemand für uns erledigt. Dieser Parteigeist wird immer ein toter Buchstabe bleiben, wenn die Militanten nicht lernen, gegenseitiges Vertrauen zu haben. Ebenso wenig kann es eine lebendige Solidarität ohne das persönliche Engagement jedes Militanten auf dieser Ebene geben.
Wenn der Kampf gegen den Zirkelgeist allein von der Gesundheit der formellen kollektiven Strukturen abhinge, gäbe es nie ein Problem des Clanwesens. Clans entwickeln sich aufgrund der Schwächung der Wachsamkeit und des Verantwortlichkeitssinns auf der individuellen Ebene. Daher widmet sich ein Teil des Orientierungstexts von 19933 der Identifizierung der Verhaltensweisen, gegen die sich jeder Genosse selbst wappnen muss. Diese individuelle Verantwortlichkeit ist unerlässlich nicht nur im Kampf gegen das Clanwesen, sondern auch für die positive Weiterentwicklung eines gesunden proletarischen Lebens. In einer solchen Organisation haben die Militanten gelernt, selbst zu denken, und ihr Vertrauen ist in einem tiefgreifenden theoretischen, politischen und organisatorischen Verständnis der Natur der proletarischen Sache verwurzelt, und nicht in der Loyalität oder Furcht gegenüber diesem oder jenem Genossen oder Zentralkomitee.
“Der neue Kurs muss mit dem Gefühl eines jeden in dem Apparat – vom einfachen bis zum höchsten Funktionär – beginnen, dass niemand die Partei terrorisieren kann. Unsere Jugend muss die revolutionären Parolen erobern, sie in Fleisch und Blut übernehmen. Sie muss ihre eigene Meinung und ihr eigenes Profil gewinnen und in der Lage sein, mit einem Mut für ihre eigene Meinung zu kämpfen, der einer tiefen Überzeugung und einem unabhängigen Charakter entspringt. Raus mit dem passiven Gehorsam, mit der mechanischen Orientierung an die Amtsträger, mit der Unpersönlichkeit, der Kriecherei und des Karrierismus in unserer Partei! Ein Bolschewik ist nicht nur ein diszipliniertes Wesen, nein, er ist eine Person, die an die Wurzeln der Dinge geht und seine eigene Meinung bildet und sie nicht nur im Kampf gegen den Feind, sondern auch in seiner eigenen Partei vertritt.“L
Und Trotzki fügt hinzu: „Der grösste Heroismus in militärischen Angelegenheiten und in der Revolution ist der Heroismus der Wahrheitsliebe und Verantwortung.“M Kollektive und individuelle Verantwortung hängen, weit entfernt davon, sich gegenseitig auszuschliessen, voneinander ab und bedingen sich gegenseitig.
Wie Plechanow argumentierte, ist die Eliminierung der Rolle des Individuums in der Geschichte mit einem Fatalismus verbunden, der mit dem Marxismus unvereinbar ist.“Während einige Subjektivisten – darauf aus, das ‚Individuum‘ mit der grösstmöglichen Rolle in der Geschichte auszustatten – sich geweigert haben, die historische Entwicklung der Menschheit als einen gesetzmässigen Prozess anzuerkennen, waren einige ihrer aktuelleren Gegner, die versucht haben, die gesetzmässige Natur jener Entwicklung deutlicher herauszuarbeiten, augenscheinlich darauf aus, zu vergessen, dass die Geschichte von Menschen gemacht wird und dass die Handlungen der Individuen daher überaus wichtig in der Geschichte sein können.“N
Eine solche Verkennung der individuellen Verantwortung ist mit dem kleinbürgerlichen Demokratismus verbunden, mit dem Wunsch, unser Prinzip des „Jeder-nach-seinen-Fähigkeiten“ durch die reaktionäre Utopie der Egalisierung aller zu ersetzen. Dieses Projekt, das bereits im 1993er Orientierungstext verurteilt wurde, ist weder das Ziel der heutigen Organisation noch das der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft.
Eine unserer Aufgaben ist es, aus dem Beispiel all der grossen Revolutionäre (die berühmten und all die namenlosen Kämpfer unserer Klasse) zu lernen, die unsere programmatischen und organisatorischen Prinzipien nicht verrieten. Dies hat nichts mit einem Personenkult zu tun. Wie Plechanow in seiner berühmten Schrift über die Rolle des Individuums schlussfolgerte:“Es liegt nicht nur an den ‚Pionieren‘ und an den ‚grossen‘ Männern allein, dass ein weites Betätigungsfeld sich eröffnet hat. Es wartet auf all diejenigen, die Augen zum Sehen, Ohren zum Hören und Herzen haben, um ihre Mitmenschen zu lieben. Das Konzept der Grösse ist ein relatives. Im moralischen Sinn ist jeder gross, der, um das Neue Testament zu zitieren, ‚sein Leben für seine Freunde hingibt‘.“P
Anstelle einer Schlussfolgerung
Daraus folgt, dass die Verinnerlichung und Vertiefung der Fragen, die wir vor mehr als einem Jahr zu diskutieren begonnen haben, heute von grösster Priorität sind.
Es ist die Aufgabe des Bewusstseins, einen politischen und organisatorischen Rahmen zu schaffen, der die Pflege des Vertrauens und der Solidarität am meisten begünstigt. Diese Aufgabe steht im Mittelpunkt des Organisationsaufbaus, dieser schwierigsten aller Künste und Wissenschaften. Auf der Grundlage dieser Arbeit erfolgt die Stärkung der Einheit der Organisation, dieses „heiligsten“ Prinzips des Proletariats. Und wie bei jeder anderen kollektiven Gemeinschaft gehört zu ihrer Vorbedingung die Existenz allgemeingültiger Verhaltensregeln. Konkret haben die Statuten, die Texte von 1981 über Funktion und Funktionsweise und jener von 1993 über die organisatorische Frage bereits die Elemente für solch einen Rahmen beigesteuert. Es ist notwendig, wiederholt auf diese Texte zurückzukommen, vor allem dann, wenn die Einheit der Organisation in Gefahr ist. Sie müssen der Ausgangspunkt einer ständigen Wachsamkeit sein. Es ist notwendig, sie, ihren Geist und die von ihnen verkörperte Methode noch tiefer zu verinnerlichen.
In diesem Rahmen ist der Gedanke, dass diese Fragen leicht und unkompliziert sind, eine falsche Auffassung, die in unseren Reihen überwunden werden muss. Gemäss dieser Herangehensweise reicht es aus, das Vertrauen zu erklären, damit es existiert. Und da Solidarität eine aktive Handlung ist, reiche es aus, „sich ans Werk zu machen“. Nichts liegt der Wahrheit ferner! Der Aufbau der Organisation ist ein extrem kompliziertes und noch delikateres Unternehmen. Es gibt kein anderes Produkt in der menschlichen Kultur, das so schwierig und zerbrechlich ist wie das Vertrauen. Nichts anderes ist schwerer aufzubauen und leichter zu zerstören. Aus diesem Grund ist im Angesicht dieses oder jenes Vertrauensmangels durch diesen oder jenen Teil der Organisation die erste Frage, die gestellt werden muss, die, was kollektiv getan werden muss, um Misstrauen oder gar Furcht in unseren Reihen abzubauen. Was die Solidarität angeht, so lebt die Arbeiterklasse in einer bürgerlichen Gesellschaft und ist umgeben von Faktoren, die gegen die Solidarität arbeiten, auch wenn diese für sie „praktisch“ und „natürlich“ ist. Darüber hinaus führt die Penetration fremder Ideologien zu abwegigen Auffassungen über diese Fragen, wie der Haltung, man müsse aus Solidarität die Veröffentlichung von Texten bestimmter Genossen verweigern, oder der Anwendung von „Küchenpsychologie“, mit welcher Methode aus dem persönlichen Leben von Genossen die Herkunft bestimmter politischer Divergenzen abgeleitet und erklärt werden soll.4 (...)
Insbesondere im Kampf um das Vertrauen muss unsere Losung Geduld und noch einmal Geduld lauten.
Die marxistische Theorie ist unsere hauptsächliche Waffe im Kampf gegen den Vertrauensverlust. Allgemein ausgedrückt, ist sie das bevorzugte Mittel gegen den Immediatismus und zur Verteidigung einer langfristigen Vision. Sie ist die einzig mögliche Grundlage für ein wirkliches, wissenschaftliches Vertrauen in das Proletariat, das umgekehrt die Basis des Vertrauens all der verschiedenen Teile der Klasse in sich selbst und gegenüber dem anderen ist. Spezifisch ausgedrückt, ermöglicht uns nur eine theoretische Vorgehensweise, zu den tiefsten Wurzeln der organisatorischen Probleme zu gelangen, die als theoretische und historische Themen im eigenen Namen behandelt werden müssen. Ähnlich muss die IKS in Abwesenheit einer lebendigen Tradition in dieser Frage und in Ermangelung einer Feuerprobe durch die Repression sich selbst bei der bewussten und gewollten Weiterentwicklung einer Tradition der aktiven Solidarität in ihren Reihen auf die Grundlage einer Untersuchung der vergangenen Arbeiterbewegung stellen.
Wenn uns die Geschichte gegenüber den Gefahren des Clanwesens besonders verwundbar gemacht hat, so hat sie uns auch die Mittel gegeben, um selbiges zu überwinden. Insbesondere dürfen wir nie vergessen, dass der internationale Charakter der Organisation und die Einrichtung von Informationskommissionen unerlässliche Mittel zur Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen in Momenten der Krise sind, wenn dieses Vertrauen beschädigt wird und verloren geht.
Der alte Liebknecht sagte über Marx, dass er sich der Politik als Studienobjekt angenähert habe.P Wie wir gesagt haben, ist es die Vergrösserung der Zone des Bewusstseins im gesellschaftlichen Leben, die die Menschheit von der Anarchie blinder Kräfte befreit, die Vertrauen schafft, die Solidarität bewirkt, die den Sieg des Proletariats möglich macht. Um die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu überwinden und die gestellten Fragen zu lösen, muss die IKS sie studieren. Denn wie der Philosoph sagte: „Ignorantia non est argumentum“ (“Ignoranz ist kein Argument“, aus Spinoza: Ethik).
IKS, 15.6.2001
Fußnoten:
1 Für Einzelheiten zu dieser Konferenz siehe: „Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien“ in Internationale Revue Nr. 30.
2 MC war unser Genosse Marc Chirik, der 1990 starb. Er erlebte 1917 die Revolution in seinem Geburtsort Kischiniev (Moldau). Mit 13 Jahren wurde er schon Mitglied der Kommunistischen Partei Palästinas, doch wurde er später ausgeschlossen, da er mit den Positionen der Kommunistischen Internationale zur nationalen Frage nicht einverstanden war. Er emigrierte nach Frankreich, wo er der KPF beitrat, bevor er auch hier wieder zusammen mit den Mitgliedern der Linken Opposition ausgeschlossen wurde. Er wurde zunächst Mitglied der (trotzkistischen) Ligue Communiste und dann der Union Communiste, welche er 1938 verliess, um der Italienischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken (IKL) beizutreten, da er deren Position zum spanischen Bürgerkrieg im Gegensatz zu derjenigen der Union Communiste teilte. Während des Kriegs und der deutschen Besetzung Frankreichs erachtete es das Internationale Büro der IKL, das durch Vercesi geführt wurde, als sinnlos, die Arbeit der Fraktion fortzusetzen. MC setzte sich aber für den Wiederaufbau der Italienischen Fraktion um einen kleinen Kern in Marseille ein. Im Mai 1945 widersetzte er sich dem Entscheid der Konferenz der Italienischen Fraktion, die Fraktion aufzulösen und der kürzlich gegründeten Internationalistischen Kommunistischen Partei individuell beizutreten. Er trat der Französischen Fraktion der Kommunistischen Linken bei, die 1944 gegründet worden war und dann den Namen Gauche Communiste de France (GCL) annahm. Ab 1964 in Venezuela, dann ab 1968 wieder in Frankreich spielte MC eine entscheidende Rolle beim Aufbau der Gruppen, die später die IKS gründen sollten, indem er ihnen die politischen und organisatorischen Erfahrungen vermitteln konnte, die er in den verschiedenen Organisationen, in denen er Mitglied gewesen war, hatte sammeln können. Für mehr Einzelheiten aus der politischen Biographie unseres Genossen vgl. unsere Broschüre La Gauche communiste de France (frz.) und zwei Artikel der International Review Nr. 65 und 66 (engl./frz./span.Ausgabe).
MCs Text, der hier erwähnt wird, ist ein Beitrag zu einer internen Debatte der IKS im März 1984 und trägt den Titel „Revolutionärer Marxismus und Zentrismus in der Gegenwart und der heutigen Debatte in der IKS“.
3 Der Text, auf den wir uns hier beziehen, ist der Orientierungstext „Die Frage der Funktionsweise in der IKS“, in der Internationalen Revue Nr. 30.
4 Diese Stelle bezieht sich besonders auf Vorkommnisse, auf die wir bereits in unserem Artikel „Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien“ in der Internationalen Revue Nr. 30 eingegangen sind, in dem wir über die Ausserordentliche Konferenz von März 2002 und die Organisationsprobleme berichten, die dazu geführt haben, diese Konferenz einzuberufen: „Es war nie ein Problem für die IKS gewesen, dass einige Teile der Organisation einen vom Zentralorgan verabschiedeten Text kritisieren. Im Gegenteil, die IKS und ihre Zentralorgane haben stets darauf bestanden, dass jede Meinungsverschiedenheit oder jeder Zweifel offen innerhalb der Organisation ausgedrückt wird, um grösstmögliche Klarheit zu erzielen. Das Verhalten des Zentralorgans gegenüber Meinungsverschiedenheiten bestand stets darin, ihnen so ernsthaft wie möglich zu antworten. Doch im Frühjahr 2000 nahm die Mehrheit des IS eine völlig andere Haltung an, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen war. Für diese Mehrheit konnte die Tatsache, dass eine kleine Minderheit von Genossen einen Text des IS kritisiert, nur aus einem Geist der Opposition um der Opposition willen oder aus der Tatsache herrühren, dass einer von ihnen von familiären Problemen betroffen sei oder ein anderer an Depressionen leide. Ein Argument, das von IS-Mitgliedern benutzt wurde, lautete, dass der Text von einem besonderen Militanten verfasst worden sei und eine andere Aufnahme gefunden hätte, wäre dies das Werk eines anderen Genossen gewesen. Die Antwort auf die Argumente jener Genossen, die anderer Auffassung waren, bestand also nicht darin, Gegenargumente zu suchen, sondern darin, die Genossen zu verunglimpfen oder gar zu versuchen, die Veröffentlichung ihrer Texte mit der Begründung zu verhindern, dass sie „Scheisse in der Organisation verbreiten“ würden, oder dass eine der GenossInnen, die unter dem Druck, der ihr gegenüber ausgeübt wurde, litt, die Antworten, die die anderen Genossen der IKS ihren Texten erteilen würden, nicht „aushalte“. Kurz, das IS betrieb eine völlig heuchlerische Politik, um im Namen der Solidarität die Debatte zu ersticken.“
E Marx, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte.
F Karl Kautsky, Ethische und materialistische
Geschichtsauffassung.
G Hegel, Enzyklopädie der philosophischen
Wissenschaften.
H Marx, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte.
I Rosa Luxemburg, Korrespondenz mit Konstantin
Zetkin.
J Bakunin, Appell an die Offiziere der russischen
Armee.
K Bakunin, Der revolutionäre Katechismus.
L Trotzki, Der neue Kurs.
M Trotzki, Über Routinismus in der Armee und
anderswo.
N Plechanow, Über die Rolle des Individuums in der
Geschichte.
O a.a.O.
P Liebknecht, Karl Marx.
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Internationale Revue - 2004
- 3747 Aufrufe
Internationale Revue 33
- 2807 Aufrufe
Attentate in Madrid
- 2651 Aufrufe
Der Kapitalismus sät den Tod
Am Donnerstag, 11. März um sieben Uhr morgens, erschüttern zwei Bomben ein Arbeiterquartier in Madrid. Ebenso blind wie am 11. September 2001 oder bei den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg oder in Guernica haben die Bomben des kapitalistischen Kriegs eine Zivilbevölkerung ohne Verteidigungsmöglichkeit getroffen. Die Bomben haben ohne Diskriminierung Männer, Frauen, Kinder, Junge und auch aus „muslimischen“ Ländern Immigrierte getötet, deren Familienangehörige – Gipfel des Elends – in gewissen Fällen aus Angst davor, aufgrund ihres illegalen Aufenthalts verhaftet und ausgewiesen zu werden, nicht einmal wagten, zur Identifikation der Leichen zu kommen.
Es handelt sich gleich wie bei den Angriffen auf die Twin Towers um einen Kriegsakt. Dennoch besteht ein bedeutender Unterschied zwischen den beiden Ereignissen: Im Gegensatz zum 11. September, als das Ziel aus einem grossen Symbol der Macht des amerikanischen Kapitalismus bestand - auch wenn tatsächlich die offensichtliche Absicht existierte zu töten, um den Effekt von Horror und Terror zu verstärken - handelt es sich diesmal in keiner Weise um einen symbolischen Akt, sondern um einen direkten Schlag gegen die Zivilbevölkerung als integralem Bestandteil des Krieges. Beim 11. September handelte es sich um ein Ereignis von weltweiter Tragweite, um ein beispielloses Massaker auf amerikanischem Boden, dessen erste Opfer die Arbeiter und Angestellten der New Yorker Büros waren. Es lieferte dem amerikanischen Staat den Vorwand, den er sich selbst konstruierte, indem er nichts gegen die Vorbereitungen der Attentate, über die er im Bilde war, unternahm, um eine neue Periode in der Entfaltung und im Gebrauch seiner imperialistischen Macht zu eröffnen. Die USA haben laut verkündet, dass sie von nun an in ihrem Krieg gegen den Terrorismus zur Verteidigung ihrer Interessen allein und überall in der Welt zuschlagen würden. Das Attentat vom 11. März ist nicht mit der Eröffnung einer neuen Periode, sondern mit der Banalisierung des Horrors gleichzusetzen. Es handelt sich nicht mehr darum, Ziele mit möglichst hohem Propagandawert, sondern direkt die Arbeiterklasse zu treffen. In den Zügen der Vororte von Atocha verkehrten um sieben Uhr morgens bestimmt keine Chefs oder Mächtige wie in den Luxusbüros der Twin Towers.
Heute gehört es zum guten Ton, die Verbrechen des Nationalsozialismus und Stalinismus zu verurteilen. Aber während dem gesamten Zweiten Weltkrieg haben die demokratischen Mächte die Zivilbevölkerung bombardiert - und hauptsächlich die Arbeiter - mit dem Ziel, Terror zu verbreiten und am Ende des Kriegs mit der Zerstörung ganzer Arbeiterquartiere jegliche Möglichkeit eines proletarischen Aufstands zu unterbinden. Die Tag und Nacht stets umfangreicheren Bombardierungen deutscher Städte am Kriegsende sind eine scharfe Verurteilung der ekelhaften Heuchelei der Regierungserklärungen, die bei anderen anprangern, was sie selber ohne zu zögern ausführen (Irak, Tschetschenien, Kosovo sind nur einige Beispiele der in letzter Zeit ausgetragenen imperialistischen Rivalitäten von denen hauptsächlich die Zivilbevölkerung betroffen ist). Man kann sagen, dass die Attentäter von Madrid gute Schüler waren.1
Entgegen allen Prognosen ist in den auf das Attentat von Atocha folgenden Wahlen die Regierung Aznar geschlagen worden. Die Presse hat den Sieg des Sozialisten Zapatero auf zwei Gründe zurückgeführt: Es haben viel mehr Arbeiter und Junge an den Wahlen teilgenommen und es herrschte eine starke Wut gegen die hinterhältigen Versuche der Regierung Aznar, die die Schuld an den Attentaten der baskischen Terrororganisation ETA in die Schuhe schob, um so der Frage des Irakkriegs auszuweichen.
Wir haben bereits anlässlich des Attentats auf die Twin Towers unterstrichen, wie sich in den Arbeiterquartieren von New York spontane Solidariätsbekundungen und eine Ablehnung der nach Revanche trachtenden Kriegspropaganda ausgedrückt haben2, sie aber nicht autonom waren und diese Reaktionen der Solidarität somit nicht ausreichend waren, um eine Klassenreaktion hervorzurufen. Sie wurden statt dessen in eine pazifistische Bewegung gegen den Irakkrieg umgemünzt. Ebenso kann man sagen, dass mit der Abwahl Aznars viele die Manipulationsversuche der Regierung zurückweisen wollten, wohingegen die Tatsache der Wahlteilnahme bereits einen Sieg für die Bourgeoisie darstellt, denn man teilt so die Idee, dass man gegen den Krieg stimmen könne.
Weshalb dieses Verbrechen?
Für die revolutionäre Arbeiterklasse ist es unabdingbar die Realität zu verstehen, wenn sie sie ändern will. Allererste Verantwortung für die Kommunisten ist es also, die Ereignisse zu analysieren, mit allen Kräften Anstrengungen für das Verständnis zu unternehmen, damit das Proletariat in der Lage ist, einen wirklichen Widerstand zu entfalten, der auch auf der Höhe der Gefahren ist, die es bedrohen und die im Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft liegen. Wenn der Terrorakt von Madrid tatsächlich ein Kriegsakt war, handelt es sich gleichwohl um einen neuen Typ von Krieg, wo die Bomben nicht mehr einem bestimmten Land oder einem besonderen imperialistischen Interesse zuzuordnen sind. Die erste Frage, die wir uns also stellen müssen: Wer hat von dem Verbrechen in Atocha profitiert?
Zuerst kann man feststellen, dass das bei der amerikanischen Bourgeoisie bestimmt nicht der Fall war. Auf den ersten Blick könnte das Attentat die zentrale These der amerikanischen Propaganda aufwerten, dass es sich um einen Weltkrieg gegen den Terrorismus handeln würde, in den alle Länder verstrickt wären. Hingegen macht es die Behauptung der Amerikaner vollständig unglaubwürdig, wonach sich die Situation im Irak verbessert habe und die Macht bald an einen irakischen Staat übergeben werden könne. Die Machtübernahme der sozialistischen Fraktion der spanischen Bourgeoisie ist allerdings eine Gefahr für die strategischen Interessen der USA. Wenn Spanien seine Truppen aus dem Irak zurück zieht, so ist das für die USA nicht nur auf militärischer Ebene ein harter Schlag, sondern auch auf politischer, da ihr Anspruch auf eine Führungsrolle in der Koalition der Willigen gegen den Terrorismus beeinträchtigt wird.
Die spanischen Sozialisten sind ein Flügel der Bourgeoisie, der sich immer mehr nach Frankreich und Deutschland ausrichtete und auch die Karte der europäischen Integration spielte. Ihre Regierungseinsetzung hat sofort eine Periode scheinheiliger Machenschaften eröffnet, deren Ausgang man heute noch schwerlich präzis voraussagen kann. Unmittelbar nach seinem Wahlsieg hat Zapatero angekündigt, dass die spanischen Truppen aus dem Irak zurück gezogen würden. Gleich darauf machte er einen Rückzieher und liess verlauten, dass die Truppen unter der Bedingung der Übergabe des Besatzungskommandos an die UNO bleiben würden. Das spanische Lavieren stellt nicht nur die Teilnahme in der amerikanischen Koalition im Irak, sondern auch seine Rolle als trojanisches Pferd in Europa und überhaupt im Spiel der Allianzen in der europäischen Union in Frage. Bisher haben Spanien, Polen und Grossbritannien - jedes Land aufgrund eigener Interessen - gemeinsam eine pro-amerikanische Koalition gegen die französisch-deutschen Ambitionen gebildet, die alle europäischen Länder in Opposition zu den USA bringen wollten. Polen wollte sich mit der Entsendung von Truppen in den Irak das amerikanische Wohlwollen und eine starke Stütze gegen die deutschen Druckversuche für den kritischen Augenblick des Beitritts zur EU erkaufen. Es stellt sich also die Frage (wenn Spanien tatsächlich die amerikanische Koalition verlassen und sich nach Europa und nach einer pro-deutschen Ausrichtung orientieren sollte, was sehr wahrscheinlich ist), ob Polen stark genug sein wird, um ohne die Unterstützung Spaniens den Oppositionskurs gegen Deutschland und Frankreich fortzusetzen. Die letzten privaten Erklärungen des polnischen Premierministers, die auch gleich wieder dementiert wurden, dass sie von den USA um den Finger gewickelt worden seien, lassen darüber gewisse Zweifel aufkommen.
Für die USA ist es also ein harter Schlag. Sie riskieren nicht nur einen Alliierten im Irak zu verlieren, sondern vor allem eine Unterstützung in Europa.3 Mit dem Wegfall von Spanien und Polen droht die Kapazität der USA, den Weltpolizisten zu spielen, nachhaltig geschwächt zu werden.
Wenn die USA und die Fraktion um Aznar die grossen Verlierer des Attentats sind, wer hat dann gewonnen? Es sind offensichtlich Frankreich und Deutschland sowie die pro-sozialistische Fraktion Spaniens, die eher nach Europa ausgerichtet ist. Ist also ein durch zwischengeschaltete Islamisten von französischen und spanischen Geheimdiensten geplanter Schlag vorstellbar?
Beginnen wir mit dem Argument, dass solche Dinge in Demokratien nicht vorkommen. Wir haben bereits4 gezeigt, wie die Geheimdienste gegebenenfalls eine direkte Rolle in den Konflikten und Abrechnungen innerhalb der nationalen Bourgeoisien spielen können. Das Beispiel der Entführung und Ermordung von Aldo Moro in Italien ist diesbezüglich besonders aufschlussreich. Die Ermordung Aldo Moros ist als ein Verbrechen der linksextremen Roten Brigaden präsentiert worden, aber es handelte sich in Tat und Wahrheit um das Werk der italienischen Geheimdienste, die diese Terrorgruppe infiltriert hatten. Aldo Moro ist von der herrschenden pro-amerikanischen Fraktion der italienischen Bourgeoisie getötet worden, weil er vorschlug, die italienische kommunistische Partei (damals von der UdSSR beeinflusst) in die Regierung aufzunehmen.5 Der Versuch der Einflussnahme auf Wahlergebnisse, d.h. auf die Reaktionen eines wichtigen Bevölkerungsteils, durch die Sprengung eines Vorortszugs ist eine Operation von ganz anderer Tragweite als die Ermordung eines Mannes zur Beseitigung eines störenden Elements innerhalb der Bourgeoisie. In einer solchen Situation gibt es zu viele Ungewissheiten. Insbesondere hing das erwartetet Resultat (die Niederlage der Regierung Aznar und ihre Ersetzung durch eine sozialistische Regierung) von der Reaktion der Regierung Aznar selbst ab. Die Wahlanalysten stimmen darin überein, dass die Wahlresultate sehr stark von den unglaubwürdigen und zunehmend verzweifelten Versuchen der Regierung bestimmt wurden, die Verantwortung für die Attentate auf die ETA abzuwälzen. Es wäre auch ein ganz anderes Resultat in Betracht gekommen, wenn Aznar in der Lage gewesen wäre, das Ereignis zu seinen Gunsten auszunutzen, indem er die Wählenden für einen Kampf für die Demokratie und gegen den Terror mobilisiert hätte. Die Risiken einer solchen Operation wären also zu gewichtig gewesen. Wenn man dann noch die Unfähigkeit des französischen Geheimdienstes selbst zur Ausführung einer kleinen Operation (man erinnere sich an die Versenkung des Greenpeace-Schiffs Rainbow Warrior oder an die jämmerliche Aktion zur Befreiung von Ingrid Bettancourt im brasilianischen Dschungel) in Betracht zieht, kann man sich nur schlecht vorstellen, dass die französische Regierung sich eine solche Operation bei einem europäischen „Freund“ erlauben würde.
Was für ein Krieg?
Wir haben gesagt, dass es sich beim Attentat von Atocha genauso wie bei demjenigen auf die Twin Towers um einen Kriegsakt handeln würde. Aber um was für einen Krieg handelt es sich? In der ersten Periode der Dekadenz des Kapitalismus konnte man die imperialistischen Kriege klar festmachen: In den grossen imperialistischen Schlachten von 1914 und 1939 standen sich die Grossstaaten mit ihrem ganzen nationalen, militärischen und diplomatischen Arsenal gegenüber. In der Periode der grossen imperialistischen Blöcke (1945–1989) trugen die rivalisierenden Blöcke ihre Konflikte auf Nebenschauplätzen aus. Es war damals schon schwieriger, die wirklichen Befehlshaber in diesen Kriegen zu identifizieren, die oft als Auseinandersetzungen um die nationale Befreiung dargestellt wurden. Mit dem Eintritt des Kapitalismus in die Zerfallsphase sind mehrere Tendenzen aufgetaucht, die man heute in den terroristischen Attentaten erkennen kann:
„- die Entwicklung des Terrorismus, der Geiselnahmen als Mittel der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Staaten mit Verletzung aller der ‘Gesetze’, die der Kapitalismus in der Vergangenheit verabschiedet hatte, um diese Konflikte zwischen den Fraktionen der herrschenden Klasse zu ‘regeln’, ...
- die Entfaltung des Nihilismus, das Ansteigen der Zahl der Selbstmorde unter Jugendlichen, der Hoffnungslosigkeit ...
- die Ausbreitung des Drogenkonsums, das heute zu einem Massenphänomen wird, das zu einer weiteren Korruption im Staat und in den Finanzorganismen beiträgt ...
- das Wuchern von Sekten, das Erstarken von religiösen Einstellungen auch in den fortgeschrittenen Ländern, die Verwerfung eines rationellen, zusammenhängenden, aufeinander aufbauenden Denkens ...“ 6
Diese Thesen sind 1990 veröffentlicht worden, zu einer Zeit also, als die Ausführung solcher Attentate (beispielsweise diejenigen in Strassen von Paris 1986/87) von Ländern dritter oder vierter Ordnung wie Syrien, Libanon oder Iran ausgingen: Der Terrorismus war so etwas wie die Atombombe der Armen. Kaum 15 Jahre später sehen wir im Auftauchen des sog. islamistischen Terrorismus ein neues Phänomen: Die Desintegration von ganzen Staaten, das Auftauchen von Kriegsherren, die sich junger Kamikazes bedienen, deren einzige Perspektive im Leben der Tod ist. Der Terrorismus dient dazu, die Interessen dieser Kriegsherren auf dem internationalen Schachfeld voranzubringen.
Wie auch immer die noch im Dunkeln liegenden Details des Attentats von Madrid aussehen mögen, es ist doch offensichtlich, dass es mit den Ereignissen der amerikanischen Besetzung des Iraks zusammenhängt. Man kann sich vorstellen, dass die Ambition des Anstifters des Attentats war, die Bevölkerung des spanischen Kreuzfahrer-Landes für die Teilnahme an der Besetzung des Iraks zu bestrafen. Der Krieg im Irak ist heute aber keineswegs mehr nur mit dem Widerstand einiger unverbesserlicher Anhänger Saddam Husseins gegen die Besetzung zu erklären. Im Gegenteil: Dieser Krieg tritt soeben in eine neue Phase ein. Er wandelt sich in eine Art internationaler Bürgerkrieg. Im Irak finden die Zusammenstösse immer häufiger nicht nur zwischen dem Widerstand und den amerikanischen Truppen statt, sondern zwischen den diversen Kräften der Saddam-Anhänger, der wahabitisch inspirierten Sunniten (zu denen sich auch Ossama bin Laden zählt), den Schiiten, Kurden und Turkmenen. In Pakistan entwickelt sich mit dem Bombenattentat gegen eine schiitische Prozession (mit 40 Toten) und der umfangreichen Militäroperation der pakistanischen Armee in Waziristan an der afghanischen Grenze ein Bürgerkrieg. In Afghanistan können all die Erklärungen über die Festigung der Regierung Karzai nicht darüber hinweg täuschen, dass die Regierung nur Kabul und die nähere Umgebung kontrolliert, und dies auch nur unter grössten Anstrengungen. Der Bürgerkrieg im gesamten Süden des Landes verrichtet weiterhin ein zerstörerisches Werk. In Israel und Palästina verschlechtert sich die Situation mit dem Einsatz von Kindern zum Transport von Bomben durch die Hamas. In Europa flammt der Konflikt zwischen Albanern und Serben in Kosovo wieder auf. Die Kriege in Ex-Jugoslawien sind bei weitem noch nicht beendet, sondern sind vorerst aufgrund der massiven militärischen Präsenz der Besatzungstruppen auf Eis gelegt.
Wir haben es hier nicht mehr mit einem klassischen imperialisitschen krieg zu tun, sondern mit dme allgemeinen Zerfall der Gesellschaft in bewaffnete Banden. Man kann eine Analogie mit dem China an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert machen. Wenn die Phase des Zerfalls des Kapitalismus durch eine Pattsituation im Kräfteverhältnis zwischen den reaktionären Kapitalisten und dem revolutionären Proletariat gekennzeichnet ist, so war die Situation im Reich der Mitte gekennzeichnet von einer Blockade zwischen der herrschenden feudal-absolutistischen Klasse und ihren Mandarinen und dem aufsteigenden Bürgertum, das aber wegen seiner Entwicklung zu schwach war, um das imperiale Regime zu stürzen. So ist das Reich in zahlreiche Gebiete zerfallen, die alle durch einen Kriegsherren beherrscht wurden. Es gab unaufhörlich Konflikte, die auf der Ebene der historischen Entwicklung jeglicher Rationalität entbehrten.
Die Tendenz zur Desintegration der kapitalistischen Gesellschaft hemmt in keiner Weise die Verstärkung des Staatskapitalismus noch befördert sie die Umwandlung des kapitalistischen Staates in einen Beschützer der Gesellschaft. Im Gegensatz zu dem, was uns die herrschende Klasse der entwickelten Länder glauben machen möchte – beispielsweise dadurch, dass sie die spanische Bevölkerung gegen den Terror oder gegen den Krieg an die Urne ruft – sind die Grossmächte keineswegs Bollwerke gegen den Terrorismus oder den sozialen Zerfall. Sie sind die dafür eigentlich Verantwortlichen. Vergessen wir nicht, dass die Achse des Bösen heute – Bin Laden und andere Herren der gleichen Art – gestern noch Kämpfer für die Freiheit gegen das sowjetische Reich des Bösen waren, dass sie vom westlichen Block sowohl finanziert als auch bewaffnet wurden. Und dabei kann man es bei weitem nicht bewenden lassen: In Afghanistan haben sich die USA wenig empfehlenswerter Kriegsherren der Nordallianz und im Irak der kurdischen Peschmerga bedient. Ganz im Gegensatz zu allen Eintrichterungen verstärkt sich der kapitalistische Staat angesichts der kriegerischen Tendenzen und den zentrifugalen Kräften mehr und mehr.
Die imperialistischen Mächte welcher Grössenordnung auch immer zögern niemals, Kriegsherren oder terroristische Banden zu ihrem Vorteil zu gebrauchen.
Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft nimmt aufgrund der globalen Ausdehnung und der weitaus grösseren Dynamik, als sie alle vorausgehenden Gesellschaftsformationen auswiesen, noch schrecklichere Züge als in der Vergangenheit an. Wir unterstreichen hier einen Aspekt: Die Todessehnsucht, die auf der jungen Generation lastet. Le Monde vom 26. März zitiert einen Psychologen im Gaza-Streifen: „Ein Viertel aller jungen Knaben älter als 12 haben nur einen Traum: Sterben als Märtyrer.“ Der Artikel fährt fort: „Der Kamikaze ist in den Strassen von Gaza zu einer respektierten Figur geworden, kleine Kinder binden sich falsche Sprengstoffgürtel um, um die Erwachsenen nachzuahmen.“
1990 haben wir bereits folgendes geschrieben: „Für die Arbeiterklasse ist es von grösster Bedeutung und damit auch für die Revolutionäre in ihren Reihen, dass sie sich von der tödlichen Bedrohung durch den Zerfall für die Gesellschaft bewusst ist ... (Sie) müssen mit aller Energie jegliche Tendenzen innerhalb der Arbeiterklasse bekämpfen, die versuchen, sich über die Wirklichkeit hinwegzutrösten, die Augen vor der ganzen Tragweite der Weltlage zu verschliessen.“7 Dieser Aufruf ist leider weitum unverstanden geblieben oder unter den mageren Kräften der kommunistischen Linken sogar verachtet worden.
Eine Klasse von Geiern
Die spanische Bourgeoisie war nicht direkt für die Attentate von Atocha verantwortlich. Jedoch hat sie sich wie ein Geier auf die Kadaver der Proletarier gestürzt. Selbst noch als Leichname haben die Arbeiter so der herrschenden Klasse als Nahrung für die Propagandamaschinerie für die Nation und die Demokratie gedient. Mit der Parole „das vereinte Spanien wird niemals besiegt werden“ hat sich die gesamte Bourgeoisie der durch die Attentate provozierten Gefühle bedient, um die Arbeiter an die Wahlurnen zu drängen, die viele unter anderen Umständen hätten links liegen lassen. Unabhängig von den Resultaten ist die hohe Wahlbeteiligung bereits ein Sieg für die Bourgeoisie, da sie zum Ausdruck bringen, dass ein grosser Teil der spanischen Arbeiter geglaubt hat, dass sie sich dem bürgerlichen Staat zu ihrem Schutz gegen den Terrorismus anvertrauen können und dass sie dafür die demokratische Einheit der spanischen Nation verteidigen müssen.
Schlimmer noch: über die nationale Einheit um die Verteidigung der Demokratie hinaus wollten sich die verschiedenen Fraktionen der spanischen Bourgeoisie der Attentate bedienen, um die Unterstützung der Bevölkerung im allgemeinen und der Arbeiterklasse im besonderen für ihre strategische und imperialistische Ausrichtung zu gewinnen. Mit dem Finger zeigte Aznar auf den baskischen Separatismus als dem Schuldigen, er wollte so das Proletariat für die Stärkung des Polizeistaates gewinnen. Die Sozialisten haben die Verantwortung Aznars für das Engagement an der Seite der USA und die Präsenz von spanischen Truppen im Irak verurteilt und wollten so eine andere strategische Ausrichtung, die Allianz mit dem französisch-deutschen Tandem herbeiführen.
Das Verständnis für die durch den kapitalistischen Zerfall herbeigeführte Situation wird also für das Proletariat um so notwendiger, wenn es seine Unabhängigkeit als politische Klasse angesichts der bürgerlichen Propaganda, die die Proletarier in einfache, vom demokratischen Staat abhängige Bürger umwandelt, wieder finden und verteidigen will.
Die Wahlen sind vorbei, die Krise bleibt
Mit diesen Wahlen hat die Bourgeoisie einen Sieg errungen, aber sie hat nicht die Wirtschaftskrise beseitigen können. Die heutigen Angriffe bleiben nicht mehr nur auf der Ebene dieses oder jenes Unternehmens, dieses oder jenes Wirtschaftszweigs, sondern sie betreffen das ganze Proletariat. In diesem Sinn bringen die nun in allen europäischen Ländern (und auch in den USA mit dem Verschwinden von Rentenplänen in den Börsenkatastrophen im Stil von Enron) vorgetragenen Angriffe gegen das Rentensystem und die Sozialversicherungen eine neue Situation hervor, auf die die Arbeiterklasse eine Antwort finden muss. Unser Verständnis dieser Situation wird im in dieser Nummer publizierten Bericht über den Klassenkampf dargelegt. Angesicht der Kriegsbarbarei und des sozialen Zerfalls kann und muss sich die Arbeiterklasse auf die Höhe der Gefahr schwingen, nicht nur auf der Ebene der unmittelbaren Verteidigung gegen ökonomische Angriffe, sondern vor allem auf der Ebene des allgemeinen politischen Verständnisses der Todesdrohung gegen die gesamte Menschheit. Rosa Luxemburg äusserte sich diesbezüglich schon 1915: „Der Weltfriede kann weder durch internationale Schiedsgerichte kapitalistischer Diplomaten noch durch diplomatische Abmachungen über ,Abrüstung‘ (...) und dergleichen utopische oder in ihrem Grunde reaktionäre Projekte gesichert werden. Imperialismus, Militarismus und Kriege sind nicht zu beseitigen und nicht einzudämmen, solange die kapitalistischen Klassen unbestritten ihre Klassenherrschaft ausüben. Die einzige Sicherung und die einzige Stütze des Weltfriedens ist der revolutionäre Wille und die politische Aktionsfähigkeit des internationalen Proletariats.“8
Geographisch:
- Spanien [113]
Theoretische Fragen:
- Terrorismus [76]
Das proletarische politische Milieu angesichts des Krieges
- 3463 Aufrufe
<<>> Die Geissel des Sektierertums im internationalistischen Lager>
<<>><<>>>Das Ende des Jahres 2003 war durch einen ernsten Schritt des weltweiten Kapitalismus in Richtung Untergang gekennzeichnet: der Schritt besteht aus dem zweiten Golfkrieg und dem Entstehen einer militärischen Zwickmühle in einem für die ganze Welt bedeutenden strategischen Gebiet. Dieser Krieg ist von entscheidender Wichtigkeit für das neue imperialistische Gleichgewicht, denn mit dem angloamerikanischen Eingreifen, der Besetzung des Irak und der Opposition der verschiedenen imperialistischen Kräfte, die von nun an mehr und mehr zu den USA gegensätzliche Positionen einnehmen. Auf diese neue Schlachterei und die Propaganda der Bourgeoisie konnten die wichtigsten revolutionären Gruppen der internationalen kommunistischen Linken noch einmal mit eindeutigen internationalistischen Positionen antworten. Gegen die ideologischen bürgerlichen Kampagnen haben diese Gruppen das ABC des Marxismus verteidigt. Das bedeutet sicher nicht, dass diese Organisationen alle übereinstimmende Positionen vertreten. Wir müssen aus unserem Blickwinkel sogar sagen, dass die meisten Wortmeldungen bedeutsame Schwächen aufwiesen. Dies betrifft besonders das Verständnis der Phase der offenen imperialistischen Konflikte seit dem Zusammenbruch des Ostblocks, der Auflösung des gegnerischen Blockes und die Tragweite dieser Konflikte. Die Unterschiede sind Ausdruck der Heterogenität im schwierigen Reifungsprozess der Arbeiterklasse, die sich auch auf der Ebene ihrer revolutionären Vorhut ausdrückt. In diesem Sinne können die Unterschiede kein Element eines grundsätzlichen Gegensatzes zwischen Angehörigen des gleichen revolutionären Lagers sein, solange die Klassengrundsätze nicht vernachlässigt werden. Sie zeigen hingegen die absolute Notwendigkeit einer ständigen Debatte zwischen diesen Organisationen. Eine solche öffentliche Debatte ist nicht nur Voraussetzung für die Klärung im revolutionären Lager, sondern auch ein klarer Faktor der Abgrenzung gegenüber den linksradikalen Gruppen des politischen Lagers der Bourgeoisie (Trotzkismus, Anarchismus). Sie Muss es den heranwachsenden Kräften ermöglichen, sich gegenüber den verschiedenen Angehörigen des proletarischen Lagers zu orientieren.>Unsere Organisation hat in diesem Sinn einen Aufruf an die anderen revolutionären Organisationen gerichtet. Er erfolgte beim Ausbruch des zweiten Golfkrieges und hatte eine gemeinsame Initiative (Dokumente, öffentliche Versammlungen…) zum Ziel, um „die internationalistischen Standpunkte so weit wie möglich zu verbreiten“:
„Die aktuellen Gruppen der kommunistischen Linken teilen alle diese grundsätzlichen Positionen, trotz der Meinungsverschiedenheiten, die zwischen ihnen bestehen. Die IKS ist sich dieser Unterschiede sehr bewusst und hat nie versucht, sie zu vertuschen. Im Gegenteil, sie hat sich immer bemüht, die Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Gruppen in ihrer Presse aufzuzeigen und die Punkte, die sie für verfehlt hält, zu bekämpfen. Vor diesem Hintergrund ist die IKS entsprechend der Haltung der Bolschewiken 1915 in Zimmerwald und der italienischen Fraktion in den 30er-Jahren der Meinung, dass es die Verantwortung der wirklichen Kommunisten ist, der ganzen Arbeiterklasse auf breitestmögliche Art und Weise gegenüber dem imperialistischen Krieg und den bürgerlichen Kampagnen die grundlegenden Positionen des Internationalismus aufzuzeigen. Das bedeutet unserer Ansicht nach, dass die Gruppen der kommunistischen Linken sich nicht mit ihren je eigenen Interventionen in ihrer eigenen Ecke zufrieden geben dürfen, sondern dass sie sich zusammenschliessen müssen, um gemeinsam auszudrücken, was ihre gemeinsame Position ausmacht. Für die IKS hätte eine gemeinsame Intervention der unterschiedlichen Gruppen der kommunistischen Linken eine politische Wirkung in der Arbeiterklasse, die weit über die Summe ihrer Kräfte hinausginge, die – wie wir alle wissen – zurzeit ziemlich eingeschränkt sind. Darum schlägt die IKS den angeschriebenen Gruppen vor, sich zu treffen, um gemeinsam alle möglichen Mittel zu diskutieren, die es der kommunistischen Linke erlauben, geeint für die Verteidigung des Internationalismus zu sprechen, ohne die je eigenen Interventionen der einzelnen Gruppen zu verurteilen oder in Frage zu stellen.“1
Dieser Aufruf wurde an folgende Organisationen verschickt:
- Bureau International pour le Parti Révolutionnaire (BIPR)
- Partito Comunista Internazionale (Il Comunista, Le Prolétaire)
- Partito Comunista Internazionale (Il Partito, genannt „von Florenz“)
- Partito Comunista Internazionale (Il Programma Comunista).
Leider wurde er entweder mit schriftlichen Antworten abgelehnt – von PCI-Le Prolétaire und dem BIPR – oder ignoriert. In unserer Internationalen Revue 32 haben wir die Antworten und unsere Stellungnahme zum Schweigen der anderen Gruppen bereits dargelegt.
Mit dem vorliegenden Artikel verfolgen wir zwei Ziele. Einerseits zeigen wir mit der Analyse der Stellungnahmen der wichtigsten proletarischen Gruppen zum Krieg zu zeigen, dass tatsächlich ein politisches proletarisches Milieu existiert, das sich durch seine Treue zum proletarischen Internationalismus von den verschiedenen linken verbalrevolutionären und von allen offen bürgerlichen Organisationen unterscheidet. Anderseits konzentrieren wir uns auf einige Unterschiede, die zwischen uns und diesen Gruppen bestehen, um zu erklären, dass sie fehlgeleiteten Vorstellungen dieser Gruppen entspringen. Gleichzeitig zeigen wir, dass sie eine gewisse Einheit des Handelns gegenüber der weltweiten Bourgeoisie nicht verunmöglichen. Mehr noch, wir beweisen, dass diese Unterschiede, so schwerwiegend sie auch sein mögen, von diesen Gruppen als Vorwand verwendet werden, um ein solches gemeinsames Handeln abzulehnen.
Es gibt tatsächlich ein politisches proletarisches Milieu, was seine verschiedenen Bestandteile auch immer darüber denken mögen.
In unserem Aufruf an die revolutionären Gruppen haben wir die Kriterien, die unserer Meinung nach trotz der Divergenzen in anderen Fragen eine minimale Basis für die Abgrenzung des revolutionären vom konterrevolutionären Lager ermöglichen, dargestellt:
1. Der imperialistische Krieg ist nicht das Resultat einer „schlechten“ oder „kriminellen“ Politik von dieser oder jener besonderen Regierung oder von diesem oder jenem Sektor der herrschenden Klasse: Es ist der Kapitalismus als Ganzes der für den imperialistischen Krieg verantwortlich ist.
2. In diesem Sinne kann die Haltung des Proletariats und der Kommunisten gegenüber dem Krieg keinesfalls sein, sich dem einen oder anderen Lager anzuschliessen – auch nicht auf „kritische“ Art und Weise: Die amerikanische Offensive gegen den Irak anzuklagen bedeutet konkret überhaupt nicht, diesem Land und seiner Bourgeoisie auch nur die geringste Unterstützung zu bringen.
3. Die einzige Position, die den Interessen des Proletariats entspricht, ist der Kampf gegen den Kapitalismus als Ganzes, also gegen alle Sektoren der Bourgeoisie weltweit, nicht mit der Perspektive eines „friedlichen Kapitalismus“, sondern für den Umsturz dieses Systems und die Errichtung der Herrschaft des Proletariats.
4. Der Pazifismus ist bestenfalls eine kleinbürgerliche Illusion mit der Neigung, das Proletariat von seinem Klassenterrain abzubringen; meistens ist er nur ein von der Bourgeoisie zynisch benutztes Instrument, um die Proletarier zur Verteidigung von „friedlichen“ und „demokratischen“ Sektoren der herrschenden Klasse in den imperialistischen Krieg einzubeziehen. Darum ist die Verteidigung der internationalistischen proletarischen Position nicht von der konzessionslosen Anklage des Pazifismus zu trennen. (ebenda)
Alle Gruppen, an die wir den Aufruf gerichtet hatten, erfüllten, wie wir zeigen werden, mit ihren Stellungnahmen diese minimalen Kriterien.
Der PCI Programma Comunista gibt eine sehr richtige Einschätzung der aktuellen Phase: “Der Todeskampf einer auf der Aufteilung in Klassen beruhenden Produktionsweise ist viel wilder als man es sich vorstellen könnte. Die Geschichte lehrt es uns: während der soziale Unterbau von unaufhörlichen Spannungen und Widersprüchen durchzogen wird, mobilisiert die herrschende Klasse ihre Energien für ein Überleben um jeden Preis - und so spitzen sich die Gegensätze zu, die Tendenz zur Zerstörung nimmt zu, die Konfrontationen auf wirtschaftlicher, politischer und militärischer Ebene vervielfältigen sich. Die gesamte Gesellschaft mit allen Schichten und Klassen wird von einem Fieber erfasst, das sie zerfleischt und jedes Organ befällt.“2
Il Partito von Florenz und Le Prolétaire tragen mit der Feststellung, dass der Krieg nicht von diesem oder jenem , den man als den Bösen bezeichnen kann, ausgelöst wird, sondern aus einer imperialistischen Auseinandersetzung auf weltweiter Ebene entsteht, zur Einschätzung der Lage bei:
– „Die Eurofront – soweit sie auch Widerstand leistet – ist keine Kraft des Friedens, die sich einer kriegerischen Dollarfront widersetzt, sondern ein Lager in der allgemeinen innerimperialistischen Auseinandersetzung, in die sich die Herrschaft des Kapitals stürzt.“3
– „Der Krieg gegen den Irak ist trotz der Ungleichheit der Kräfte kein Kolonialkrieg, sondern in jeder Hinsicht ein imperialistischer Krieg auf beiden Seiten, obwohl der geschlagene Staat kleiner und weniger entwickelt ist, ist er trotzdem ein bourgeoiser Staat und Ausdruck einer kapitalistischen Gesellschaft.“4
– „Das sogenannte Friedenslager, das heisst die imperialistischen Staaten, die den Angriff der USA auf den Irak als schädlich für ihre Interessen hielten, fürchtet sehr, dass die durch ihren schnellen Sieg gestärkten USA sie ihre Opposition teuer bezahlen lassen wird, zuerst durch ihre Verdrängung aus der Region. Die dreckigen imperialistischen Rivalitäten zwischen den Staaten nehmen zu. Die Amerikaner erklären, dass Frankreich und Russland grosszügig auf ihre gigantischen Schuldguthaben gegenüber dem Irak verzichten sollten, während man sich auf der anderen Seite darüber entrüstet, dass die Verträge für den „Wiederaufbau“ des Landes zum Vornherein grossen amerikanischen Unternehmen zugeteilt werden, und dass die Vermarktung des Erdöls in die gleichen Hände fäll Bezüglich dieses berühmten „Wiederaufbaus“ und dem wirtschaftlichen Wohlergehen, das dem irakischen Volk versprochen wurde, genügt es , sich vor Augen zu halten, wie es um den Wiederaufbau Afghanistans und die Situation in Ex-Jugoslawien steht – zwei Regionen in denen die westlichen Truppen noch immer präsent sind – um zu verstehen, dass für die Bourgeoisie auf beiden Seiten des atlantischen Ozeans nur der Wiederaufbau der für eine rentable Produktion notwendigen Infrastruktur zählt, um damit das Wohlergehen der kapitalistischen Unternehmen zu sichern.“5
Diese Positionen lassen also einer kritischen Unterstützung des einen oder des anderen Lagers keinerlei Platz. Ganz im Gegenteil stellen sie für diese Gruppen das eherne Fundament dar für eine Anklage gegen alle diese Länder und politischen Kräfte, die auf verlogene Art und Weise ihre eigenen imperialistischen Pläne hinter der Verteidigung des Friedens verstecken.
So stellt Il Partito fest: „Die angebliche, gemeinsame Verdammung des Krieges (durch die westlichen Länder, adR) ist unbestreitbar zweideutig, weil diese Haltung eine unterschiedliche, ja gegensätzliche Herkunft und Bedeutung für die antagonistischen Klassen hat. Die ,europäische Partei‘, die das Grosskapital und die Hochfinanz von dieser Seite des Atlantiks vertritt, und die heute immer stärker mit den Amerikanern konkurriert und rivalisiert, ist gegen diesen Krieg. Das heisst nicht, dass die Finanzmagnaten persönlich auf die Strasse gehen, um ihre Spruchbänder hochzuhalten, aber sie halten das Kommando über die einflussreichen Medien, die Parteien und die systemtreuen Gewerkschaften sicher in der Hand, um die beeinflussbare öffentliche Meinung nach rechts oder nach links auszurichten. Für das Kapital sind die Kriege manchmal tatsächlich ,notwendig‘, obwohl sie oft ,ungerecht‘ sind. Es ist ausserordentlich leicht, dies zu unterscheiden: Die Kriege, die man gewinnt, sind ,notwendig‘, die ,ungerechten‘ sind die, welche von Anderen gewonnen werden. Zum Beispiel: für die europäischen Kapitalisten, bereit, Jugoslawien auf schreckliche Art unter sich aufzuteilen, waren die Bombardierungen Belgrads (die beinahe schlimmer waren als die heutigen über dem Irak) ,notwendig‘; hingegen die Bombardierungen Bagdads, wo die fetten Ölverträge von der neuen, von den ,Befreiern‘ eingesetzten ,demokratischen Verwaltung‘ annulliert werden und also verloren gehen, sind ,ungerecht‘“.6
Der Programma Comunista schreibt: „Keinen Mann und kein Geldstück für die imperialistischen Kriege: offener Kampf gegen die eigene nationale Bourgeoisie, italienisch oder US-amerikanisch, deutsch oder französisch, serbisch oder irakisch.“7
Il Partito Comunista: „Die französischen und die deutschen Regierungen – unterstützt von Russland und China – sind gegen diesen Krieg, aber nur um ihre eigenen imperialistischen Interessen, die durch die Offensive der USA im Irak und in der ganzen Region bedroht sind, zu verteidigen.“8
Das BIPR: „Der eigentliche Feind der USA (…) ist der Euro, der anfängt, die absolute Vorherrschaft des Dollars auf gefährliche Art zu bedrohen.“9
Aus allen oben stehenden Überlegungen folgt, dass die einzige konsequente Haltung der tödliche Kampf gegen das Kapital, in welchem Gewand sich dieses auch immer zeigt , und die bedingungslose Anklage des Pazifismus ist. Das tun diese Gruppen und vor allem das BIPR:
– “Europa – insbesondere die deutsch-französische Achse – versucht, die militärischen Pläne der Amerikaner zu durchkreuzen, indem es jetzt die Karte des Pazifismus ausspielt, und es hat damit eine ideologische Falle gestellt, in die bereits Viele getappt sind. Aufgrund der Tatsachen wissen wir genau, dass jeder beliebige europäische Staat, wenn er die Notwendigkeit dafür gespürt hat, nicht gezögert hat, seine wirtschaftlichen Interessen mit Waffengewalt geltend zu machen. Heute zeichnet sich in vielen Stellungnahmen der ,Gehorsamsverweigerer‘ bereits ein neuer über-nationaler, europäischer Nationalismus ab. Sogar die Bezugnahme auf ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Werte, im Gegensatz zum zugespitzten Individualismus der Amerikaner, ist die Voraussetzung für das zukünftige Einschwenken auf die Ziele der europäischen Bourgeoisie in ihrer entscheidenden Auseinandersetzung mit der amerikanischen Bourgeoisie.“10
– „Ein grosser Teil der ,linken‘ Parlamentarier und ihr verwandter Bewegungen (grosse Bereiche der Anti-Globalisierungs-Bewegung) beruft sich auf ein Europa der Menschenrechte und der sozialen Werte, das dem zugespitzten Individualismus der Amerikaner entgegensteht. Er versucht damit vergessen zu machen, dass das gleiche Europa – bezüglich der ,sozialen Werte‘ – die Renten verkleinert hat und mit Nachdruck neue Einschnitte fordert (die sogenannten ,Reformen‘ der Altersvorsorge); das gleiche Europa hat bereits Millionen Arbeiter entlassen, und übt jetzt Druck aus, um die Kraft der Arbeit auf eine Wegwerfware zu reduzieren
– mit einer fortschreitenden, zerstörerischen Verelendung.“11
Alles Vorangehende zeigt also das Bestehen eines gemeinsamen Lagers, das den Grundsätzen des Proletariats treu ist, das Lager der kommunistischen Linken, und das unabhängig vom Bewusstsein, das die verschiedenen Gruppen, aus denen es sich zusammensetzt, davon haben.
Das verhindert wie gesagt nicht, dass teilweise schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten zwischen der IKS und diesen Gruppen bestehen, wie wir im Folgenden noch genauer sehen werden. Das Problem ist nicht das Bestehen dieser Meinungsverschiedenheiten an sich, sondern dass diese Gruppen sie als Rechtfertigung für ihre Weigerung heranziehen, eine besonders ernste Situation gemeinsam zu beantworten und dass sie gleichzeitig nichts tun, dass diese Fragen in einer ernsthaften, öffentlichen Debatte geklärt werden.
Falsche Bezugnahmen auf Lenin, um das Ausbleiben einer gemeinsamen Aktion zu rechtfertigen
In der Internationalen Revue 32 haben wir den Frontismusvorwurf des Prolétaire und den Idealismusvorwurf des BIPR beantwortet, die damit den angeblich fehlgeleiteten Charakter vieler Analysen der IKS beweisen wollen. Ausser einem in der Nummer 466 des Prolétaire erschienen Artikel haben wir keine Antwort darauf bekommen. Für diese Organisation rechtfertigt die Absicht, die Uneinigkeit, die uns in der Frage des revolutionären Defätismus entzweit, zu überwinden, vollständig die Kritik des Frontismus, die sie bezüglich unseres Aufrufes zu einer gemeinsamen Aktion an uns richtet.
Wir müssen also angesichts dieses Artikels des Prolétaire auf die Frage des revolutionären Defätismus zurückkommen. Der Prolétaire-Artikel enthält ein neues Element, auf das wir uns im Folgenden konzentrieren:
„Es ist unwahr, dass die Organisationen, die in diese Kategorie eingestuft werden, sich im Grunde im Wesentlichen einig sind, dass sie eine gemeinsame Position teilen, nicht einmal nur in der Frage des Krieges und des Internationalismus. Im Gegenteil widersprechen sie sich in politischen und programmatischen Fragen, die in Zukunft lebenswichtig für den proletarischen Kampf und für die Revolution sein werden, genauso wie sie sich bereits heute widersprechen, was die Ausrichtungen und Handlungsanweisungen angeht, die den wenigen Kräften, die Klassenpositionen suchen, zu geben sind. Besonders in der Frage des Krieges haben wir das Schwergewicht auf den Begriff des revolutionären Defätismus gelegt, weil dieser seit Lenin die kommunistische Haltung in den imperialistischen Kriegen kennzeichnet. Die IKS hingegen stellt sich gegen den revolutionären Defätismus. Wie sollte es also möglich sein, zusammen eine gemeinsame Haltung auszudrücken, die im Grunde genommen, wenn man nur ein wenig an der Oberfläche kratzt, wenn man über die schönen und grossen Sprüche über den Sturz des Kapitalismus und die Diktatur des Proletariats hinweggeht, gar nicht besteht? Eine gemeinsame Aktion wäre nur mit der Einwilligung möglich, unvereinbare Widersprüche auszuradieren oder abzumildern, das heisst, sie vor den Augen der Proletarier, an die man sich richten will, zu verstecken - nur mit der Einwilligung, den Aktivisten aus anderen Ländern, die man erreichen will, ein falsches Bild einer ,kommunistischen Linken‘, die sich im Wesentlichen einig ist, zu zeigen, das heisst, sie zu täuschen. Seine Positionen zu tarnen – auf das laufen die Einigungsvorschläge, in der Hoffnung, einen unmittelbaren oder zufälligen Erfolg zu erzielen, nämlich gewollt oder ungewollt hinaus , ist das nicht die klassische Definition des Opportunismus?“12 (Unterstreichungen im Original)
Die PCI stellt sich gegenüber unserem Einwand beharrlich taub, dass „über ,Frontismus‘ zu reden ... nicht nur dazu bei(-trägt), die Meinungsverschiedenheiten zu klären, es ist auch insoweit ein Faktor der Konfusion, als es die realen Divergenzen, die Klassengrenzen, die die Internationalisten von der gesamten Bourgeoisie, von den Rechtsradikalen bis hin zu den Linksextremisten, trennt, auf eine Stufe mit den Meinungsverschiedenheiten unter Internationalisten stellt.“ (Internationalen Revue 32)
Aus Unwissenheit (das heisst aus Schludrigkeit in der Kritik von politischen Positionen, was kein kleiner Mangel für eine revolutionäre Organisation ist) oder vielleicht aus dem Bedürfnis nach einer einfachen Polemik, fasst die PCI auch die Haltung der IKS zur Frage des revolutionären Defätismus nicht zusammen. Sie beschränkt sich auf die Feststellung, dass „die IKS gegen den revolutionären Defätismus“ sei, und lässt so das Feld für jegliche Interpretation unser Haltung offen, darin inbegriffen – warum auch nicht – dass die IKS im Falle eines Angriffs anderer Länder für die „Verteidigung des Vaterlandes“ wäre. Wir rufen hier also unsere Position zu dieser Frage in Erinnerung, die wir bereits in der Zeit des ersten Golfkrieges entwickelt hatten. Im Artikel „ Das proletarische politische Milieu im Angesicht des Golfkrieges“ von 1991 befürworten wir das Folgende: “Dieser Begriff wurde von Lenin während dem Ersten Weltkrieg geprägt. Er entsprach dem Willen, die Winkelzüge der ,Zentristen‘ anzuprangern, welche, obwohl sie ,im Prinzip‘ einverstanden waren, jede Beteiligung an dem imperialistischen Krieg zurückzuweisen, es befürworteten zu warten, bis die Arbeiter der ,feindlichen‘ Länder bereit waren, den Kampf gegen den Krieg aufzunehmen, bevor sie die Arbeiter ,ihrer eigenen‘ Länder dazu aufriefen. Um diese Haltung zu untermauern argumentierten sie, wenn die Arbeiter eines Landes denen der feindlichen Länder zuvorkämen, begünstigten sie deren Sieg im imperialistischen Krieg. Lenin entgegnete sehr richtig auf diesen bedingten ,Internationalismus‘, dass die Arbeiterklasse eines Landes keine gemeinsamen Interessen mit der Bourgeoisie ,ihres‘ Landes hat, und er unterstrich besonders, dass die Niederlage dieser Bourgeoisie den Kampf der Arbeiterklasse nur begünstigen konnte, wie man es bereits am Beispiel der Pariser Kommune (die aus der Niederlage gegen Preussen hervorging) und am Beispiel der Revolution von 1905 in Russland (das im Krieg gegen Japan geschlagen worden war) gesehen hatte. Aus dieser Feststellung zog er den Schluss, dass jedes Proletariat die Niederlage ,seiner‘ eigenen Bourgeoisie ,wünschen‘ musste. Dieser letzte Standpunkt war bereits damals falsch, weil er die Revolutionäre jedes Landes dazu verleitete, für ,ihr‘ Proletariat die günstigsten Bedingungen für die proletarische Revolution zu behaupten, obwohl die Revolution weltweit – und zuerst in den entwickelten Ländern (die alle am Krieg beteiligt waren) – hätte stattfinden müssen. Trotzdem hat die Schwäche dieser Position bei Lenin nie zu einer Infragestellung des unnachgiebigsten Internationalismus geführt (es ist sogar diese Unnachgiebigkeit, die ihn zu einer solchen ,Entgleisung‘ verleitete). Es wäre Lenin niemals in den Sinn gekommen, die Bourgeoisie des ,feindlichen‘ Landes zu unterstützen, obwohl sich eine solche Haltung logischerweise aus seinen ,Wünschen‘ hätte ableiten können. Diese unstimmige Position wurde im Gegensatz dazu mehrmals von bürgerlichen Parteien mit ,kommunistischer‘ Färbung benutzt, um ihre Teilnahme am imperialistischen Krieg zu begründen. So haben zum Beispiel die französischen Stalinisten nach der Besiegelung des deutsch-russischen Paktes von 1939 plötzlich die Tugenden des ,proletarischen Internationalismus‘ und ,revolutionären Defätismus‘ wiederentdeckt – Tugenden, die sie seit langem vergessen hatten, und die sie mit der gleichen Geschwindigkeit wieder verdrängten, als Deutschland 1941 den Krieg gegen die Sowjetunion eröffnete. Den gleichen „revolutionären Defätismus“ konnten die italienischen Stalinisten nutzen, um nach 1941 ihre Politik an der Spitze des ,Widerstandes‘ gegen Mussolini zu begründen. Heute rechtfertigen die Trotzkisten der Länder (und sie sind zahlreich), die in den Kampf gegen Saddam Hussein verwickelt sind, ihre Unterstützung des Letzteren im Namen des gleichen ,revolutionären Defätismus‘“.13
Es ist also nicht das Unterfangen der IKS, das fraglich ist, sondern dieses seiner Kritiker, die die Lehren der Arbeiterbewegung aus der ersten weltweiten revolutionären Welle von 1917–1923 nicht gezogen haben.
Kann man nach dieser Klarstellung der Frage des revolutionären Defätismus weiterhin der Ansicht sein, die von uns aufgezeigten Meinungsverschiedenheiten stellten ein Hindernis dar für eine gemeinsame Antwort der verschiedenen Gruppen auf den Krieg? Trotz der Irrtümer der Gruppen, an die wir unseren Aufruf gerichtet hatten, denken wir, dass ihre internationalistische Ausrichtung nicht in Frage gestellt ist. Diese Gruppen, die den revolutionären Defätismus verteidigen, sind tatsächlich nicht gleich wie die stalinistischen und trotzkistischen Verräter, die die Unklarheit des Begriffes von Lenin für die Rechtfertigung des Krieges verwenden. Es handelt sich um proletarische politische Gruppen, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage waren, bezüglich einiger Fragen der Arbeiterbewegung „Nägel mit Köpfen zu machen“.
Sektierertum gegenüber der Kommunistischen Linken und Opportunismus gegenüber den Linken
Erinnern wir uns daran, dass das BIPR der Ansicht ist, dass die Unterschiede zur IKS für eine gemeinsame Antwort auf die Frage des Krieges zu gross sind.
Der folgende Ausschnitt aus einem Flugblatt von Battaglia Comunista, einer der beiden Gruppen des BIPR, drückt trotzdem eine grundsätzliche Übereinstimmung in der Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen Bourgeoisie und Proletariat aus – genau die Frage, in der gemäss BIPR die Standpunkte so weit entfernt sind:
„Unter einigen Gesichtspunkten ist es für den Krieg nicht mehr notwendig, die Arbeiterklasse für die Fronten anzuwerben: es genügt, dass sie zu Hause bleibt, in den Fabriken und in den Bureaus, um für den Krieg zu arbeiten. Das Problem stellt sich dann, wenn diese Klasse anfängt, sich zu weigern für den Krieg zu arbeiten, und damit sofort ein ernstes Hindernis für die Entwicklung des Krieges selber wird. Das – und nicht die noch so grossen Kundgebungen der pazifistischen Staatsbürger und noch weniger die Mahnwachen mit den Predigten des Papstes – ist eine Bremse für den Krieg: das kann den Krieg beenden.“14 (Unterstreichung im Original)
Dieser Ausschnitt drückt die richtige Idee aus, dass Krieg und Klassenkampf nicht zwei unabhängige Variablen, sondern Gegensätze sind: je mehr das Proletariat der Bourgeoisie auf den Leim geht, desto freiere Hand hat sie, ihre Kriege zu führen; je mehr diese Klasse sich weigert, für den Krieg zu arbeiten, desto stärker wird sie „sofort ein ernstes Hindernis für die Entwicklung des Krieges selber“. So wie diese Idee hier in den Worten von Battaglia Comunista15 ausgedrückt wird, ist sie jener, die unserem Begriff vom historischen Kurs unterlegt ist, sehr ähnlich. Der historische Kurs als geschichtliches Resultat der zwei oben aufgezeigten Entwicklungslogiken: die dauernde Neigung des Kapitalismus zum Krieg, und die geschichtliche Neigung der ungeschlagenen Arbeiterklasse, die entscheidende Auseinandersetzung mit der feindlichen Klasse zu suchen. Battaglia dagegen hat die Gültigkeit dieser Position immer bestritten, indem sie uns des Idealismus bezichtigte. Auf diesen und auf andere Punkte, in denen Battaglia uns vorwirft, die aktuelle Situation nicht zu verstehen und uns in unseren „Idealismus“ zu flüchten, haben wir ausführlich in vielen Artikeln und zahlreichen Polemiken geantwortet.16
Von einer Organisation, die sich in der Einschätzung der Meinungsverschiedenheiten mit der IKS derart kleinlich zeigt, könnte man eine ähnliche Haltung gegenüber allen anderen Gruppen erwarten. Dem ist ganz und gar nicht so.
Wir beziehen uns hier auf die Haltung des BIPR, wie sie sich bei seiner Sympathisantengruppe, die sie im nordamerikanischen Raum vertritt, der Internationalist Workers Group (IWG) (mit der Publikation Internationalist Notes), zeigt. Diese Gruppe ist zusammen mit Anarchisten aufgetreten und hat eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung mit Red and Black Notes und mit der Ontario Coalition Against Poverty (OCP), die eine typische linke, aktivistische Gruppe zu sein scheint, abgehalten. Die IWG hat kürzlich eine solidarische Stellungnahme mit inhaftierten „Genossen“ der OCP, die wegen Vandalismus während den letzten Kundgebungen gegen den Krieg in Toronto verhaftet worden waren, veröffentlicht. Sie hat auch eine öffentliche Versammlung zusammen mit „anarcho-kommunistischen Genossen“ in Québec abgehalten.
Obwohl wir von der Notwendigkeit überzeugt sind, in den Debatten der politischen Gruppen, die zwischen revolutionären und bürgerlichen Haltungen schwanken, anwesend zu sein, um dort den Einfluss der kommunistischen Linken geltend zu machen, brachte uns – und das ist noch milde ausgedrückt – die hier angewendete „Methode“ aus der Fassung. Diese weist eine Grosszügigkeit auf, die in vollständigem Widerspruch steht zur harten Strenge, die das europäische BIPR zeigt. Diesen methodischen und also prinzipiellen Unterschied eingedenk, meinten wir, auch an die IWG den Aufruf für ein gemeinsames Vorgehen richten zu müssen. Dies machten wir mit einem Schreiben, das unter anderem das Folgende aussagte:
„Wenn wir es richtig verstehen, beruht die Absage des BIPR vor allem auf die aus Sicht des BIPR zu grossen Unterschiede zwischen unseren Grundsätzen. Wir zitieren den Brief, den wir vom BIPR erhalten haben: ,Eine gemeinsame Aktion gegen den Krieg oder zu jedem anderen Problem kann nur ins Auge gefasst werden zwischen genau definierten und politisch unzweideutig identifizierten Partnern, die jene Grundsätze teilen, die wir für grundlegend halten.‘“
Wir haben währenddessen von der Internetseite des BIPR und auch aus anderer Quelle (letzte Nummer der Internationalist Notes und Flugblätter von Red&Black) erfahren, dass Internationalist Notes in Kanada eine gemeinsame Versammlung mit Anarcho-Kommunisten in Québec und mit libertären Rätekommunisten und Anti-Armuts-Aktivisten in Toronto abgehalten hat. Es ist offensichtlich, dass die Unterschiede in einigen Fragen zwischen IKS und BIPR unbedeutend sind im Vergleich zu den Gegensätzen zwischen der kommunistischen Linken einerseits und anderseits den Anarchisten (auch wenn sie dem Anarchismus das Wort „kommunistisch“ aufkleben), und die Aktivisten gegen die Armut scheinen auf ihrer Internetseite nicht einmal eine antikapitalistische Haltung einzunehmen. Auf dieser Grundlage können wir nur schlussfolgern, dass das BIPR zwei unterschiedliche Strategien bezüglich seiner Intervention zum Krieg hat: eine auf dem nordamerikanischen Kontinent – und eine andere in Europa. Die Gründe des BIPR, eine gemeinsame Aktion mit der IKS in Europa abzulehnen, sind offensichtlich in Kanada und Amerika nicht gegeben.
Wir richten darum dieses Schreiben ausdrücklich an Internationalist Notes als Vertreter des BIPR in Nordamerika, um den Vorschlag, den wir dem gesamten BIPR schon unterbreitet hatten, noch einmal aufzunehmen.“17
Wir haben nie eine Antwort auf diesen Brief erhalten, was an sich schon ein Vorgehen bedeutet, das der revolutionären kommunistischen Politik fremd ist. Ein Vorgehen, das eine politische Stellungnahme nur den eigenen Launen und dem Weg des geringsten Widerstandes überlässt.18 Dass wir keine Antwort erhalten haben, ist sicher kein Zufall, sondern der Tatsache zu verdanken, dass eine glaubwürdige Antwort ohne Selbstkritik nicht möglich gewesen wäre. Überdies ist die Politik des IWG in Nordamerika sicher nicht eine Eigenart der amerikanischen Genossen, sondern zeigt das typische Gesicht des BIPR, das Sektierertum und Opportunismus vereinigt: Sektierertum in den Beziehungen mit der kommunistischen Linken, und Opportunismus mit allen Anderen.19
Allgemeiner verstanden liegt der Grund für die Ablehnung unseres Aufrufes nicht in den tatsächlich bestehenden Unterschieden zwischen unseren Organisationen, sondern eher in einem ebenso sektiererischen wie opportunistischen Willen, von einander getrennt zu bleiben, um in seiner Ecke seine politische Tätigkeit ruhig fortzusetzen, ohne Gefahr zu laufen, kritisiert zu werden, oder mit den unermüdlichen „Hinterfragern“ und „Störenfrieden“ der IKS zu tun zu haben.
Eine solche Haltung dieser Gruppen ist weder zufällig noch neuartig. Sie erinnert an die der niedergehenden 3. Internationale, die sich der kommunistischen Linken verschloss – das heisst der klarsten und entschlossensten Strömung in der Definition der revolutionären Positionen – und sich gleichzeitig breit der Rechten „öffnete“ mit ihrer Fusionspolitik gegenüber den zentristischen Bewegungen ( die „Terzini“ in Italien, die USPD in Deutschland) und der „Einheitsfront“ mit der Sozialdemokratie, der Verräterin und Henkerin der Revolution. Internationalisme, Organ der kommunistischen Linken in Frankreich (Vorläuferin der IKS), bezieht sich auf diese opportunistische Haltung der kommunistischen Internationalen, als es in den 40er-Jahren die 1942 auf einer opportunistischen Basis erfolgte Gründung der internationalistischen kommunistischen Partei Italiens, gemeinsame Vorgängerin aller bordigistischen kommunistischen Parteien Italiens und von Battaglia Comunista, kritisierte: „Es ist nicht im Mindesten überraschend, dass wir heute, 23 Jahre nach der Diskussion zwischen Lenin und Bordiga anlässlich und über die Gründung der Kommunistischen Partei Italiens, Zeuge der Wiederholung des gleichen Fehlers werden. Die Methode der kommunistischen Internationale, die so wütend von der Fraktion der Linken (von Bordiga) bekämpft wurde, und deren Auswirkungen katastrophal für das Proletariat waren, wird heute von der Fraktion selber für den Aufbau der kommunistischen Partei Italiens verwendet.“20
In den 30er-Jahren nahmen die Trotzkisten die gleiche opportunistische Haltung namentlich gegenüber der italienischen Linken ein.21 Und als es wegen der Gründung der PCInt einen Bruch innerhalb dieser italienischen Linken gab, erinnerte die Haltung der neuen Partei gegenüber der kommunistischen Linken Frankreichs an die Haltung der Trotzkisten. Obwohl man zu dieser Zeit im Gegensatz zum Trotzkismus und zur kommunistischen Internationalen nicht von einer Entartung der neu gegründeten PCInt sprechen konnte, und wenn man auch heute nicht von einer Entartung des BIPR oder des PCI sprechen kann, so bleibt trotzdem die Gründung der PCInt ein Schritt zurück im Vergleich zu der Aktivität und dem Niveau der Aufklärung durch die Fraktion der italienischen Linken (mit ihrer Zeitschrift Bilan) in den 30-er Jahren. Internationalisme kritisierte diesen Opportunismus mit folgenden Worten:
– „Genossen, es gibt zwei Methoden der Umgruppierung: es gibt die des ersten Kongresses der kommunistischen Internationalen, der allen Gruppen und Parteien, die sich kommunistisch nannten, einlud, um ihre Positionen zu konfrontieren. Und es gibt jene von Trotzki, der 1931 die internationale Opposition und das Sekretariat „umorganisierte“ , indem er vorher sorgfältig und ohne Erläuterung die italienische Fraktion und andere Gruppen, die vorher dazu gehört hatten, ausschaltete (die alten Genossen werden sich an ein Protestschreiben, das die italienische Fraktion an alle Sektionen der internationalen Opposition verschickte, erinnern, in dem dieses willkürliche und bürokratische Vorgehen Trotzkis gebrandmarkt wurde)“.22
– „Der PCI wurde in den fiebrigen Wochen 1943 gegründet. Man liess nicht nur die positive Arbeit, die die italienische Fraktion in dem langen Zeitraum von 1927–1944 geleistet hatte, beiseite, sondern in etlichen Punkten war die Position der neuen Partei hinter diejenige der nicht-parlamentarischen Fraktion Bordigas von 1921 zurückgefallen. Namentlich in der Frage der Einheitsfrontpolitik, wo im Rahmen von lokalen Kundgebungen den stalinistischen Parteien Vorschläge zur Bildung einer Einheitsfront gemacht wurden, namentlich bezüglich der Beteiligung an Gemeinde- und Parlamentswahlen, wo die alte Position der Enthaltung aufgegeben wurde, namentlich bezüglich des Antifaschismus, wo die Türen der Partei den Mitgliedern des Widerstandes weit geöffnet wurden, um nicht nur von der Gewerkschaftsfrage zu reden, in der die Partei völlig die alte Haltung der kommunistischen Internationalen Aufnahm, also die Haltung der Fraktion, die innerhalb der Gewerkschaften für die Eroberung dieser Gewerkschaften kämpft, und ging sogar noch weiter auf diesem Weg für die Bildung von gewerkschaftlichen Minderheiten (Die Position und die Politik der revolutionären gewerkschaftlichen Opposition. Mit einem Wort, unter dem Namen der Partei der internationalen kommunistischen Linken haben wir ein italienisches Gebilde von klassischem trotzkistischen Zuschnitt ohne die Verteidigung der UdSSR. Gleiche Bekanntmachung der Partei unabhängig vom reaktionären Kurs, gleiche opportunistische Praxispolitik, gleiche unfruchtbare Massenagitation, gleiches Misstrauen gegenüber der Theoriediskussion und der Auseinandersetzung der Ideen, sei es innerhalb der Partei oder mit den anderen revolutionären Gruppen.“23
Battaglia Comunista trägt also noch heute das Markenzeichen des ursprünglichen Opportunismus. Wie wir es oben bereits gesagt haben, glauben wir trotzdem an die Möglichkeit und die Notwendigkeit einer Debatte zwischen den verschiedenen Angehörigen des revolutionären Lagers, und wir geben sicher wegen einer Zurückweisung nicht auf, so unverantwortlich diese auch sein mag.
Ezechiele (Dezember 2003)
Aktuelles und Laufendes:
- Irak [78]
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Die „andere Globalisierung“
- 2766 Aufrufe
Eine ideologische Falle für die Arbeiterklasse
Der Erfolg des Europäischen Sozialforums (ESF) im letzten November in Paris zeigt deutlich, wie die „andere Globalisierung“1 während dem letzten Jahrzehnt Fuss fassen konnte. Nach einer zögerlichen Anlaufszeit mit einer eng begrenzten Anhängerschaft (die Bewegung zog sogleich weltumspannend „Denker“ und Akademiker an und war in dieser Hinsicht begrenzter als bezüglich der geographischen Ausdehnung) wies die Bewegung bald alle Merkmale einer ideologischen Strömung im traditionellen Sinn auf: ein populärer Ruf dank den radikalen Demonstrationen in Seattle 1999 während dem Gipfeltreffen der Welthandelsorganisation (WTO), dann die Medienstars, allen voran unstreitbar José Bové, und schlussendlich die unmisslichen Events: das Weltsozialforum (WSF), welches in Porto Alegre (Brasilien) stattfand und eine Alternative zum Davoser Forum, dem Treffen der weltwirtschaftlichen Drahtzieher, darstellen soll. Porto Alegre sollte zum Symbol der Bürger-Selbstverwaltung werden; hier fanden die ersten drei Treffen des WSF (2001, 2002 und 2003) statt.
Seither stieg diese Welle weiter an: Während das WSF neue Kontinente erobert und im Januar 2004 in Indien stattfand, spriessen Abkömmlinge auf regionaler Ebene (das Europäische Sozialforum ist nur ein Ausdruck davon, weitere finden wir zum Beispiel in Afrika). Die Instrumente dieser Bewegung, Zeitungen und Zeitschriften, Meetings und Demonstrationen, erfahren einen atemberaubenden Aufschwung. Wer sich heute mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, sieht sich zwangsläufig mit einer Ideenflut der „anderen Globalisierung“ konfrontiert.
Dieser rasche Aufschwung wirft eine Reihe von Fragen auf: Woher kommt das hohe Tempo, die Mächtigkeit und die grosse Ausdehnungskraft dieser Bewegung? Und: warum gerade jetzt?
Für die Anhänger der „anderen Globalisierung“ ist die Antwort einfach: ihre Bewegung ist derart erfolgreich, weil sie wirkliche Lösungen für die Probleme der Menschheit aufzeigt. Nach dem oben gesagten bleiben uns die Anhänger der „anderen Globalisierung“ noch die Antwort auf eine weitere Frage schuldig: weshalb schenken die Medien (selbst weitgehend unter Kontrolle der von ihnen jäh verpönten „transnationalen Unternehmen“) den Worten und Taten dieser Bewegung so viel Aufmerksamkeit?
Tatsächlich drückt der Erfolg der „anderen Globalisierung“ eine reale Notwendigkeit aus und dient realen Interessen. Die Frage ist nur, wer hat diese Bewegung nötig und welchen Interessen dient sie? Dient sie, ihrem eigenen Anspruch zufolge, den Interessen unterdrückter Bevölkerungsgruppen (arme Bauern, Frauen, Pensionäre, Arbeiter, „Aussätzige“ etc.) oder vielmehr der herrschenden Gesellschaftsordnung, von der sie ja gefördert und finanziert wird?
Um diese Fragen zu beantworten, untersucht man am Besten die gegenwärtigen ideologischen Bedürfnisse der bürgerlichen Klasse. Fakt ist, dass die herrschende Klasse nach dem besten Mittel sucht, um dem Bewusstseinsprozess des Proletariats einen entschiedenen Rückschlag zu versetzen.
Als erstes Muss die Wirtschaftskrise betrachtet werden. Seit ihren Anfängen Ende der 60er-Jahre, ist sie nun so weit fortgeschritten, dass sich die Bourgeoisie diesbezüglich zu einer relativ realistischen Sprache gezwungen sieht.
Der schamlose Trug, wonach die zweistelligen Wachstumsraten der asiatischen „Drachen“ (Südkorea, Taiwan, etc.) die Prosperität des Kapitalismus in der dem Zusammenbruch des Ostblocks folgenden Periode zeigen sollen, ist nicht länger haltbar. Denn die „Drachen“ speien kein Feuer mehr. Auch die „Tiger“ (Indonesien, Thailand, etc.), die den selben Weg hätten einschlagen sollen, brüllen nicht mehr, sondern betteln um die Gnade ihrer Kreditoren. Der nächste Trug war der, welcher an die Stelle der „aufstrebenden Länder“ die „aufstrebende New Economy“ setzte. Er hielt noch weniger lang an: das Wertgesetz holte die „New Economy“ bald von den spekulativen Höhenflügen herunter und stürzte manches Unternehmen ins Verderben.
Den „Kontext der Rezession“ lasten sich die nationalen Bourgeoisien gegenseitig an. Mit dieser Beschönigung aber kann die Verschärfung der ökonomischen Krise im Herzen des Kapitalismus kaum verschleiert werden. Gleichzeitig wird uns endlos gesagt, wir müssten „einen Effort leisten“, den „Gürtel enger schnallen“, um die Wirtschaft wieder auf einen Wachstumspfad zu bringen. Ein solches Gerede wird aber niemals die Angriffe der Bourgeoisie auf die Arbeiterklasse gänzlich verschleiern können. Die sich verschärfende Krise verlangt nach immer härteren und ausgedehnteren Angriffen, die zudem mehr denn je simultan sein müssen, um die Interessen der Herrschenden bewahren zu können.
Solche Attacken provozieren zwangsläufig Reaktionen in der Arbeiterklasse, die sich zwar je nach Land und Zeit unterscheiden, aber in ihrer Gesamtheit zur Entwicklung des Klassenkampfes führen. Für Elemente der Arbeiterklasse kann eine solche Situation der Funke sein, der das Klassenbewusstsein entfacht. Wenn auch die derzeitige Entwicklung des Klassenbewusstseins nicht spektakulär ist, so taucht nichtsdestotrotz heute im Proletariat eine Reihe von Fragen auf, etwa über die wahren Gründe hinter den Angriffen der bürgerlichen Klasse, über die tatsächliche Situation der Wirtschaftskrise, aber auch über die wirklichen Ursachen der in der ganzen Welt andauernd ausbrechenden Kriege. Es wird auch die Frage gestellt, wie diese Katastrophen wirksam bekämpft werden können. Jedenfalls können sie nicht länger einfach der „menschlichen Natur“ angehängt werden.
Derartige Fragen stecken noch in ihren Anfängen und stellen noch lange keine Gefahr für die politische Herrschaft des Kapitalismus dar. Nichtsdestotrotz: heute schon Muss sich die herrschende Klasse mit ihnen auseinandersetzen und nach Wegen suchen, sie im Keime zu ersticken. Hierin zeigt sich das Hauptanliegen des ideologischen Apparats der „anderen Globalisierung“: eine Reaktion der herrschenden Klasse gegen die Anfänge einer Bewusstseinsentwicklung in der Arbeiterklasse. Erinnern wir uns an das zentrale, endlos wiederholte Thema nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der sogenannten sozialistischen Länder: „Der Kommunismus ist tot, lang lebe der Liberalismus! Die Konfrontation zwischen den zwei Welten ist vorbei, was umso besser ist, da sie die Ursache von Krieg und Armut war. Künftig kann es nur noch die eine Welt geben: die Welt des liberalen demokratischen Kapitalismus, Quelle des Friedens und Wohlstands.“
Bald war es klar, dass diese „brandneue“ Welt wie seit jeher Kriege entfachen, Armut und Barbarei verbreiten würde, auch nach dem Zusammenbruch des „Evil Empire“ (in den Worten von US-Präsidenten Reagan). Und weniger als zehn Jahre nach der triumphalen Versicherung, es könne nur eine Welt geben, sind wir Zeuge der wiedererweckten Idee, eine „alternative Welt“ zum Liberalismus sei möglich. Die herrschende Klasse hat offensichtlich die Langzeiteffekte ihrer Systemkrise auf das Klassenbewusstsein verstanden. Sie will die Arbeiterklasse von der Entwicklung einer eigenen Perspektive für eine „andere Welt“ abbringen, in der die Bourgeoisie nicht wie bei der „anderen Globalisierung“ keinen Platz hätte.
Die Grundlagen der Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse und das Ziel des bürgerlichen Angriffs
Die Fragen von suchenden Elementen in der Arbeiterklasse lassen sich hauptsächlich unter folgenden drei Überschriften zusammenfassen:
– Was ist die Realität der heutigen Welt?
– Mit welcher Perspektive kann diese verändert werden?
– Wie können wir eine solche Perspektive erreichen?
Diese drei Fragen gehören zum zentralen Anliegen der Arbeiterbewegung seit ihren Anfängen. Die Arbeiterklasse kann die grundlegenden Ursachen dieser Situation verstehen. Sie kann begreifen, dass es nur eine Perspektive gibt, die eine Alternative zu dieser Situation eröffnen kann. Diese Klasse ist fähig, ihre eigene revolutionäre Rolle in dieser Situation zu verstehen und deshalb kann sie sich die Waffen zum Umsturz des Kapitalismus aneignen und den Kommunismus errichten.
Die Bourgeoisie besitzt die Fähigkeit, den Prozess dieses Klassenbewusstseins und die damit verbundenen historischen Gefahren zu verstehen. Wir können auf nahezu zwei Jahrhunderte Erfahrung zurückgreifen, die uns zeigt, dass diese Fähigkeit der Bourgeoisie nicht unterschätzt werden darf. Sie führt dazu, dass die Ideologie der „anderen Globalisierung“, trotz ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen, im wesentlichen auch auf den oben erwähnten drei Themen aufbaut.
Das erste dieser Themen – die Realität der heutigen Welt – zeigt unmittelbar, wie sehr die Ideologie der „anderen Globalisierung“ ein integraler Teil des bürgerlichen Mystifikationsapparats ist. Diese Ideologie teilt nämlich gänzlich die Lügen über die gegenwärtige wirtschaftliche Situation des Kapitalismus. Bei den Anhängern der „anderen Globalisierung“ ebenso wie bei den Anarchisten und Linksextremen wird die Realität der kapitalistischen Systemkrise versteckt hinter der andauernden Denunzierung der „riesigen Trusts“. Wenn ganze Gebiete der Erde in ein Wirtschaftsdesaster verfallen, ist dies die Schuld der multinationalen Trusts. Wenn Armut die ganze Welt befällt und bis zum Herzen der industrialisierten Länder vordringt, so ist dies die Schuld der multinationalen Trusts und deren Profitgier. Überall auf der Erde gibt es genügend und grenzenlosen Reichtum, der für alle Menschen genügen würde, wenn da nicht eine rücksichtslose Minderheit den gesamten Reichtum an sich reissen würde. In diesem scheinbar kohärenten Schema fehlt allerdings ein kritisches Element, um die Realität der weltweiten Situation und ihrer Entwicklung zu verstehen: die unabwendbare Krise, die den Bankrott des Kapitalismus aufzeigt.
Für die herrschende Klasse war es immer von grösster Bedeutung, die Realität von der Vergänglichkeit ihres Systems zu verbergen, welches dazu verurteilt ist, eines Tages von der historischen Bühne zu verschwinden. Die Herrschenden versuchen daher, die zunehmenden Erschütterungen des Kapitalismus herunterzuspielen. Sie starten also ihr Gerede über das „Licht am Ende des Tunnels“ und über die schönen Zeiten, die uns „gleich um die Ecke“ erwarten. Aber während sie dieses Gerede entfalten, verschärft sich die Situation zunehmend. Die Bourgeoisie will die alte Lüge neu verpackt wissen und verpasst ihr daher mit der „anderen Globalisierung“ einen neuen Anstrich.
Dies hindert die Bewegung für eine „andere Globalisierung“ aber nicht daran, für eine Alternative zur gegenwärtigen Welt zu werben; oder besser gesagt für mehrere Alternativen. Dies betrifft das zweite der oben genannten Themen. Jeder Teil der Bewegung bringt seine eigene, sich von den anderen ein klein wenig unterscheidende Kritik an der heutigen Welt an: ihre Ideen können ökologisch gefärbt, geprägt von bestimmten ökonomischen Theorien oder kulturellen, nahrungsspezifischen oder sexuellen Orientierungen sein...die Liste liesse sich endlos ergänzen. Und sie erschöpfen sich nicht in blosser Kritik: jeder dieser Teile bietet seine eigene Lösung an. Damit musste aus dem Slogan „andere Globalisierung“ der Plural „andere Welten sind möglich“ werden. Die Vorschläge reichen von einer Welt ohne genmanipulierte Nahrungsmittel bis zu einer Welt der Selbstverwaltung, realisiert wohlverstanden über den Weg des klassischsten Staatskapitalismus. Da keine dieser politischen Alternativen den Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft durchbrechen könnte, stellen natürlich noch so viele solche Varianten keine Gefahr für die herrschende Klasse dar. Diese Alternativen bringen nichts als mehr oder weniger wichtige, mehr oder weniger utopische Verbesserungen der kapitalistischen Gesellschaft hervor, die alle mit der Herrschaft der Bourgeoisie verträglich sind. Tatsächlich ist die Bourgeoisie mit dieser Palette von „Lösungen“ gegen die Mängel des Systems gewappnet für die Konfrontation mit der Arbeiterklasse. Alle diese „Lösungen“ helfen, die einzige Perspektive, die fähig ist, dieser Barbarei und Armut ein Ende zu setzen, zu verschleiern: der Umsturz des dem Tode geweihten Kapitalismus, dem Ursprung aller dieser Mängel.
Das dritte Thema der Antiglobalisierungsbewegung ergibt sich aus den zwei ersten: nachdem der wahre Grund der kapitalistischen Armut und Barbarei und die einzige Perspektive, die alldem ein Ende setzen könnte, verschleiert sind, bleibt nur noch, die einzige hierfür fähige Kraft einzudämmen. Zu diesem Zweck unterstützt die Antiglobalisierungsbewegung eine Vielzahl von Bauernrevolten in der 3. Welt, José Bovés Bauernkonföderationen in Europa oder verzweifelte Angriffe des lokalen Kleinbürgertums gegen korrupte Diktaturen. Offensichtlich zeugen alle diese Revolten von einer Reaktion gegen die Misere, von der ein Grossteil der Menschheit betroffen ist. Aber bei keiner dieser Revolten findet sich auch nur die geringste Spur einer Lösung, um die von ihnen angegriffene kapitalistische Herrschaft auch umzustürzen.
Während mehr als eineinhalb Jahrhunderten hat die Arbeiterbewegung gezeigt, dass das Proletariat die einzige Kraft ist, welche die Gesellschaft verändern kann. Das Proletariat ist nicht die einzige Klasse, die gegen den Kapitalismus revoltiert, wohl aber die einzige, die den Schlüssel zur Überwindung des Kapitalismus bei sich trägt. Hierzu muss es sich nicht nur auf internationaler Ebene zusammenschliessen; es muss auch als autonome Klasse handeln, unabhängig von allen anderen Gesellschaftsklassen. Die Bourgeoisie ist sich darüber vollauf im klaren. Mit der Unterstützung von allen diesen nationalistischen kleinbürgerlichen Kämpfen will sie das Proletariat in eine Sackgasse drängen und der Entwicklung seines eigenen Bewusstseins und seiner eigenen Perspektive einen Riegel vorschieben.
Die Gefahr, welche die Bourgeoisie mit dieser Art von Mystifikation bannen will, ist nicht neu: das Proletariat hat seit dem Anbruch der kapitalistischen Dekadenz anfangs des 20. Jahrhunderts die potentielle Fähigkeit, den Kapitalismus umzustürzen. Und die herrschende Klasse begriff diese Gefahr seit dem Ersten Weltkrieg und der revolutionären Welle, die mit der Oktoberrevolution 1917 begann und während mehreren Jahren – von Deutschland 1919 bis China 1927 – an den Grundfesten des Kapitalismus rüttelte. Die Bourgeoisie wartete nicht bis 1990, um ihre Kampagnen zu starten. Schon seit über einem Jahrhundert sieht sich die Arbeiterklasse bezüglich der wahren Natur der Wirtschaftskrise, der kommunistischen Perspektive und des Potentials des Klassenkampfs ideologischen Angriffen ausgesetzt. Die Antiglobalisierungswelle ist also fest im bürgerlichen Denken verankert. Das Auftauchen dieser Bewegung drückt aber dennoch eine Veränderung der Klassenkonfrontation auf ideologischer Ebene aus. Diese Veränderung zwingt die herrschende Klasse, ihre mystifizierenden Methoden gegen das Proletariat anzuwenden.
Die Bourgeoisie braucht eine ideologische Erneuerung...
„Ein Gewinnerteam wechselt man nicht aus“, pflegen Sportkommentatoren zu sagen. Und weil die Voraussetzungen der bürgerlichen Mystifikationen, um die Arbeiterklasse von der Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins abzuhalten, keine grundsätzliche Veränderung durchmachen, ändert sich auch nicht die Art dieser Mystifikationen, wie wir oben gesehen haben. Als Vehikel dieser Mystifikationen zur Verschleierung des historischen Bankrotts der kapitalistischen Produktionsweise dienen traditionellerweise die Parteien der Linken (Stalinisten, Sozialdemokraten). Diese bieten der Arbeiterklasse falsche Alternativen und unterminieren jegliche Perspektive ihrer Kämpfe.
Diese Parteien haben schon seit dem Ausgang der 60er-Jahre, als die gegenwärtige Krise ihren Anfang nahm, und vor allem durch das Wiederauftauchen des Proletariats auf der historischen Bühne nach vier Dekaden der Konterrevolution (die wichtigen Streiks vom Mai 1968 in Frankreich, der „heisse Herbst“ von 1969 in Italien, etc.) ihre ideologische Wirkungskraft verloren. Der kraftvollen Zunahme der proletarischen Kämpfe entgegneten die linken Parteien, indem sie ihre Idee einer alternativen Regierungsweise hervorbrachten, welche den Forderungen der Arbeiter angeblich entgegenkommen würde. Teil dieser „Alternative“ war, dass der Staat bedeutend mehr Einfluss in der Wirtschaft haben sollte. Letztere war seit 1967 und mit dem Ende der Wiederaufbauperiode nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt von zunehmenden Erschütterungen. Die linken Parteien riefen die Arbeiterklasse zur Mässigung oder gar zum Stopp ihrer Kämpfe auf: sie sollte stattdessen ihrem Wunsch nach Veränderung an der Wahlurne Ausdruck verleihen und die Linke in die Regierung hieven. Diese würde die Interessen der Arbeiter begünstigen. Seither hat sich die Linke (besonders die Sozialdemokraten, aber zum Beispiel in Frankreich auch die „Kommunisten“) an zahlreichen Regierungen beteiligt. Dabei verteidigt sie nicht die Interessen der Arbeiter, sondern greift deren Lebensbedingungen an, um die Krise besser managen zu können. Darüber hinaus aber versetzte der Zusammenbruch des Ostblocks und der sogenannten „sozialistischen“ Regime Ende der 1980er-Jahre der Glaubwürdigkeit der „kommunistischen“ Parteien, welche diesen Regimes Rückhalt boten, einen herben Rückschlag. Damit ging auch ihr Einfluss in der Arbeiterklasse zurück.
Die sich verschärfende Krise bringt die Arbeiterklasse dazu, den Kampf wieder aufzunehmen. Gleichzeitig entsteht innerhalb der Arbeiterklasse allmählich eine Reflexion über die tatsächlichen Gesellschaftsverhältnisse. Zugleich geraten die Parteien, welche traditionellerweise die Interessen des Kapitals innerhalb der Reihen der Arbeiterklasse verteidigten, in ernsthaften Misskredit. Es fällt ihnen daher schwerer, ihre vergangene Rolle weiterhin zu spielen. Deshalb reihen sie sich bei den Manövern gegen die Debatten und die Unruhen innerhalb der Arbeiterklasse nicht an vorderster Front ein. Im Rampenlicht steht dagegen die Antiglobalisierungsbewegung. Diese hat die Mehrzahl der Themen, die ehemals zum Rüstzeug der linken Parteien gehörten, übernommen. Daher finden sich die linken Parteien (vor allem die „kommunistischen“) in der Antiglobalisierungsbewegung derart heimisch, mögen sie auch diskret und „kritisch“ bleiben. Diese Diskretion verhilft der Antiglobalisierungsbewegung lediglich zu einem „innovativen“2 Erscheinen und verhindert, dass diese im Voraus in Misskredit gerät.
Die bemerkenswerte Übereinstimmung der Mystifikationen der „alten Linken“ und der „anderen Globalisierung“ zeigt sich in machen zentralen Themen.
...oder wie eine alte Idee neu verpackt wird
Um einen Überblick über die Hauptthemen in der „anderen Globalisierung“ zu bekommen, wenden wir uns den Schriften der ATTAC3 zu, dem wichtigsten „theoretischen“ Organ dieser Bewegung.
ATTAC hatte ihre offizielle Geburtsstunde im Juni 1998 aufgrund mehrerer Kontaktaufnahmen, die einem Editorial von Ignacio Ramonet in der Dezemberausgabe 1997 der französischen Le Monde Diplomatique folgten. Das seitherige Wachstum der Mitgliederzahlen auf 30’000 Ende 2000 deutet den Erfolg dieser Organisation an. Zur Mitgliedschaft gehören über 1000 Organisationen (Gewerkschaften, Gemeinschaftsgruppen, lokale Vereinigungen von Ratsdelegierten), mehrere hundert französische Parlamentsmitglieder, viele Staatsangestellte, darunter vor allem Lehrer, und zahlreiche, in 250 lokale Komitees gruppierte Berühmtheiten aus Politik und Kunst.
Ausgangspunkt dieser mächtigen ideologischen Organisation war die Idee von der „Tobin Tax“, die wir James Tobin, Nobelpreisträger in Ökonomie, verdanken. Tobin zufolge würde eine Steuer von 0,05% auf grenzüberschreitende Finanztransaktionen ermöglichen, diese zu regulieren und eine wuchernde Spekulation zu verhindern. Vor allem aber könnten mit dieser Steuer, so ATTAC, die Fonds armen Ländern als Entwicklungshilfe zugewiesen werden.4
Warum eine solche Steuer? Um, so ATTAC, im selben Zuge diesen Finanztransaktionen entgegenzutreten und zugleich von ihnen zu profitieren (was zumindest widersprüchlich ist, denn warum soll man eine Profitmöglichkeit zerstören wollen?). Sie symbolisieren die Globalisierung der Wirtschaft, die – verallgemeinert – die Reichen reicher und die Armen ärmer macht.
Ausgangspunkt von ATTACs Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft ist folgender: „Die Globalisierung der Finanzwelt verschärft die wirtschaftliche Unsicherheit und die soziale Ungleichheit. Sie übergeht und degradiert den Volksentscheid, die demokratischen Institutionen und die Souveränität von Staaten auf Kosten des allgemeinen Interesses. Stattdessen vertritt sie die gänzlich spekulative Logik, welche die Hauptinteressen der transnationalen Unternehmen und Finanzmärkte ausdrückt.“5
Was ist der ATTAC zufolge die Ursache für diese Wirtschaftsentwicklung? Wir finden darauf folgende Antworten: „Eine der bedeutendsten Fakten des späten 20. Jahrhunderts war die wachsende Macht der Finanzen in der Wirtschaftswelt: dies ist der Prozess der finanziellen Globalisierung, das Resultat der von den Regierungen der G7 auferlegten politischen Entscheide.“
Die Erklärung dieses Wandels im ausgehenden 20. Jahrhundert folgt später: „Im Rahmen des ,fordistischen‘ Kompromisses6, der bis in die 1970er wirkte, kamen Bosse und Lohnempfänger zu einer Übereinkunft, indem eine Aufteilung der Produktivitätssteigerung innerhalb des Unternehmens vereinbart wurde. Dadurch konnte die Aufteilung von Mehrwert erhalten bleiben. Das Aufkommen des Aktionärskapitalismus bedeutete den Untergang dieses Regimes. Das traditionelle Modell, bekannt als das ,Teilhabermodell‘ und verstanden als Interessensgemeinschaft dreier Partner innerhalb des Unternehmens, musste einem neuen ,Aktionärsmodell‘ weichen. Dieses räumt den Interessen der Besitzer von Börsenkapital, mit anderen Worten den Unternehmensfonds selbst, oberste Priorität ein.“7 Und weiter: „Hauptzweck der an der Börse notierten Unternehmen ist es, ,Aktionärswert zu schaffen‘, also eine Wertsteigerung der Aktien zu erzielen, um Mehrwert zu erzeugen und den Reichtum der Aktionäre zu vergrössern.“8
Folgen wir weiter der Argumentation der Antiglobalisierungsbewegung, so verursachte die neue Richtung der Regierungen der G7 einen Wandel in der Geschäftswelt. Die multinationalen Unternehmen und grossen Finanzinstitutionen konnten aus der Warenproduktion keinen Profit mehr erzielen und „übten daher Druck auf Unternehmen aus, damit diese auf Kosten produktiver Investition grösstmögliche Dividenden ausschütten“.
Die bisher aufgeführten Zitate der Antiglobalisierungsbewegung genügen, um folgende drei Aspekte zu verdeutlichen:
– diese Bewegung hat nichts neuartiges erfunden
– die Ideologie dieser Bewegung ist gänzlich bürgerlich
– die Ideen der Antiglobalisierungsbewegung sind eine Gefahr für die Arbeiterklasse
Die heutigen „Transnationalen“, die sich angeblich der Kontrolle des Staates entziehen, sind den „Multinationalen“, die von den linken Parteien wegen denselben Sünden schon in den 1970er-Jahren angegriffen wurden, bemerkenswert ähnlich. Tatsächlich ist es einerlei, ob man sie „multinational“ oder „transnational“ nennt: diese Unternehmen haben durchaus eine Nationalität, nämlich diejenige der Mehrheit ihrer Aktionäre. Die Multinationalen sind im Allgemeinen die grossen Unternehmen der mächtigsten Staaten – allen voran der USA. Zusammen mit den militärischen und diplomatischen Waffen gehören sie zu den Instrumenten der imperialistischen Politik dieser Staaten. Und wenn dieser oder jener Nationalstaat (wie etwa die „Bananenrepubliken“) dem Diktat irgendeines riesigen Multinationalen unterworfen ist, so bedeutet das grundsätzlich nur, dass jener bestimmte Staat derjenigen Grossmacht unterliegt, auf der dieses multinationale Unternehmen basiert.
Schon während der 1970er-Jahre verlangte die Linke nach „mehr Staat“, um die Macht dieser „modernen Monster“ zu beschränken und den von ihnen produzierten Reichtum gerechter zu verteilen. Bis hierher haben ATTAC & Co also absolut nichts Neues hervorgebracht. Vor allem müssen wir die trügerische Idee verwerfen, als wäre der Staat jemals ein Instrument zur Interessensverteidigung der Ausgebeuteten gewesen. Das Gegenteil ist der Fall: der Staat ist ein Instrument zur Verteidigung der herrschenden Ordnung und also der Interessen der Herrschenden und Ausbeutenden. Unter bestimmten Umständen mag der Staat, um seine Rolle besser wahrzunehmen, sich diesem oder jenem Teil der herrschenden Klasse entgegensetzen. Dies zeigt sich etwa anhand einiger Massnahmen der britischen Regierung in der Wachstumsphase des Kapitalismus. Die britische Regierung verabschiedete Gesetze, um die Ausbeutung der Arbeitskraft, besonders der Kinder, einzugrenzen. Obwohl mancher Kapitalist diese Gesetze als seinen Interessen zuwider laufend empfand, konnten sie verhindern, dass die Arbeitskraft – Quelle allen kapitalistischen Wohlstands – schon vor ihrer Volljährigkeit en masse zerstört würde. Als zweites Beispiel sei an die Massnahmen des Nazistaates erinnert, der bestimmte Sektionen der herrschenden Klasse (vor allem die jüdische Bourgeoisie) verfolgte, was natürlich nicht im Interesse der Unterdrückten geschah.
Der Wohlfahrtsstaat ist vor allem ein Mythos mit dem Ziel, die Unterdrückten dahin zu bringen, den Fortgang der kapitalistischen Unterdrückung und die Herrschaft der Bourgeoisie zu akzeptieren. Im Niedergang der kapitalistischen Wirtschaft zeigt der Staat – ob „links“ oder „rechts“ – sein wahres Gesicht: Löhne werden eingefroren, „Sozialbudgets“, Ausgaben im Gesundheitssektor, Arbeitslosenunterstützung und Renten werden gekürzt. Und wenn die Arbeiter sich weigern, solche Opfer zu erbringen, so ist es wiederum der Staat, der ihnen mit Schlagstock, Tränengas und Verhaftungen, und, wenn alles nichts nützt, mit Kugeln, entgegentritt.
Die Anhänger der Antiglobalisierungsbewegung wollen in der besten Tradition der klassischen Linken tatsächlich die Vorstellung von einem Staat verbreiten, der fähig wäre, die Interessen der Unterdrückten gegen die multinationalen Konzerne zu verteidigen. Deshalb sprechen sie von einem möglichen „guten Kapitalismus“, der dem „schlechten Kapitalismus“ entgegengesetzt wäre.
Nun aber wird diese Idee durch die „Entdeckung“ von ATTAC, dass Profit der Hauptzweck des Kapitalisten ist, zu einer äusserst grotesken Karikatur, begleitet vom Gerede über Unterschiede zwischen „Aktionären“ und „Teilhabern“. ATTAC erklärt uns nun, dass Kapitalisten investieren, um Profite zu machen - eine Charakteristik, die seit der Geburtsstunde des Kapitalismus ihre Gültigkeit hat.
Was die „strikt spekulative Logik“ anbetrifft, ausgelöst angeblich durch die „Globalisierung der Finanzwelt“, so wurde dafür kaum an irgendeinem Treffen der G7 oder durch die Machtübernahme eines Ronald Reagan oder einer Margaret Thatcher der Startschuss gesetzt. Die Spekulation ist so alt wie der Kapitalismus selbst. Im 19. Jahrhundert hob Marx schon hervor, dass bei einer sich anbahnenden Überproduktionskrise die Spekulation der produktiven Investition tendenziell vorgezogen wird. Die Bourgeois verstanden pragmatisch, dass bei einer Sättigung des Marktes die von ihnen mit eigens gekauften Maschinen produzierten Waren möglicherweise nicht abgesetzt werden können. Dadurch kann weder der in ihnen enthaltene Mehrwert (erzeugt durch die Arbeiter, welche die Maschinen in Bewegung setzten), noch der Wert des Startkapitals realisiert werden. Aus diesem Grund schienen Handelskrisen, wie Marx bemerkte, als Resultat der Spekulation, während in Wirklichkeit die Spekulation nichts anderes als ein vorzeitiges Krisenwarnzeichen ist. In gleicher Weise sind die Spekulationen, die wir heute wahrnehmen, nicht Resultat eines fehlerhaften Verhaltens dieser oder jener kapitalistischen Gruppe, der es an Bürgernähe fehlt, sondern Ausdruck der allgemeinen Krise des Kapitalismus.
Hinter der grotesken Stupidität der „wissenschaftlichen Analysen“ von den „Antiglobalisierungsexperten“ steckt eine Idee, die von den Verteidigern des Kapitalismus seit langer Zeit benutzt wurde, um die Arbeiterklasse von einer revolutionären Perspektive abzubringen. Mitte des 19. Jahrhunderts versuchte der kleinbürgerliche Sozialist Proudhon, die „guten“ von den „schlechten“ Seiten des Kapitalismus zu scheiden und setzte sich für eine Art „fairen Handel“ und industrielle Selbstverwaltung (Kooperativen) ein.
Später war es die reformistische Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung, und darin besonders ihr Haupttheoretiker Bernstein, der die Vorstellung eines Kapitalismus vertrat, der zunehmend den Interessen der Ausgebeuteten genügen könnte, wenn nur der Druck der Arbeiterklasse ihn dazu zwingen würde. Dies sollte im Rahmen der bürgerlichen Institutionen wie etwa dem Parlament geschehen. Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse sollte es demnach sein, den „guten“ Kapitalisten ihren Triumph über die „schlechten“ Kapitalisten zu sichern. Denn Letztere würden aufgrund ihres Egoismus oder ihrer Kurzsichtigkeit die „positive“ Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft verhindern.
Heute sind es ATTAC und ihre Sympathisanten, welche eine Rückkehr zum „fordistischen Kompromiss“ vorschlagen, der vor masslosen Aufblähung der Finanzsphäre existiert und unter Arbeitern und Kapitalisten die „Aufteilung des Mehrwerts garantiert“ haben soll. Die Bewegung der „anderen Globalisierung“ erweitert damit die Palette des bürgerlichen Mystifikationsapparates:
– indem sie der Idee Vorschub leistet, der Kapitalismus könnte von seinen Angriffen gegen die Arbeiterklasse ablassen; in Wirklichkeit aber entspringen diese Angriffe einer Krise, die vom System nicht überwunden werden kann;
– indem sie davon ausgeht, dass die Grund-
lagen für einen „Kompromiss“ zwischen Arbeit und Kapital vorhanden wären;
Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Arbeiter davon abgehalten werden, gegen die kapitalistische Produktionsform zu kämpfen, welche tatsächlich verantwortlich ist für die zunehmende Ausbeutung, die um sich greifende weltweite Barbarei und das sich zuspitzende Elend. Vielmehr werden die Arbeiter dazu angehalten, eine abstruse chimärische Version desselben Systems zu verteidigen. Sie sollten also mit anderen Worten anstelle ihrer eigenen Interessen diejenigen ihres Todfeindes, der Bourgeoisie, verteidigen.
Es ist heute oberste Priorität, die Antiglobalisierungsbewegung zu denunzieren und auf breiter Ebene zu intervenieren, um gegen ihre Ideen zu kämpfen. Diese Priorität gilt für alle proletarischen Elemente, die sich bewusst sind, dass heute die einzige alternative Weltordnung diejenige des Kommunismus ist, und dass der Kommunismus einzig durch eine absolut standfeste Opposition gegen die Bourgeoisie und alle ihre Ideologien erbaut werden kann. Die „andere Globalisierung“ ist nur die jüngste Verkörperung dieser Ideologie. Sie muss ebenso energisch wie die Sozialdemokratie und der Stalinismus bekämpft werden.
Günter
Aktuelles und Laufendes:
- Soziale Foren [114]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Gegen die Mystifikationen des Europäischen Sozialforums
- 206983 Aufrufe
Nur eine andere Welt ist möglich: Der Kommunismus!
Zwischen dem 12. und 15. November 2003 wurde in Paris das „Europäische Sozialforum“ (ESF) abgehalten, eine Art europäischer Ableger des Weltsozialforums, das mehrere Jahre hintereinander im brasilianischen Porto Allegre stattgefunden hatte (2002 wurde das ESF in Florenz, Italien, abgehalten, und für 2004 ist es in London geplant). Das ESF hat mittlerweile beträchtliche Dimensionen angenommen: Laut den Organisatoren nahmen rund 40.000 Menschen aus allen möglichen europäischen Ländern (von Portugal bis Osteuropa) teil, ein Programm von 600 Seminaren und Workshops in den verschiedensten Tagungsorten (Theatergebäude, Rathäuser, prestigeträchtige öffentliche Gebäude) erstreckte sich über ganz Paris, und zum Abschluss fand eine Grossdemonstration von 60–100.000 Menschen mit den unverbesserlichen italienischen Stalinisten von Rifondazione Comunista an der Spitze und den Anarchisten der CNT als Nachhut statt. Auch wenn sie wenig öffentliche Aufmerksamkeit ernteten, fanden neben dem ESF zeitgleich zwei weitere „europäische Sozialforen“ statt, eines für die Mitglieder des Europäischen Parlaments, das andere für Gewerkschafter. Und als seien drei „Foren“ nicht genug, organisierten die Anarchisten ein „Libertäres Sozialforum“ (LSF) in der Pariser Metro, zur gleichen Zeit wie das ESF und bewusst als Alternative zu ihm dargestellt.
„Eine andere Welt ist möglich!“ Dies war einer der grossen Slogans des ESF. Und es besteht kein Zweifel daran, dass für viele der Demonstranten am 15. November, vielleicht gerade unter den jungen Leuten, die erst politisch aktiv werden, ein wahrhaftes und drückendes Bedürfnis bestand, gegen den Kapitalismus und für eine „andere Welt“ im Gegensatz zur heutigen mit ihrer grenzenlosen Armut und ihren endlosen und abscheulichen Kriegen zu kämpfen. Zweifellos wurden einige von ihnen durch das Gemeinschaftsgefühl auf diesem Zusammentreffen inspiriert. Doch das Problem ist nicht nur zu wissen, dass „eine andere Welt möglich“ – und notwendig – ist, sondern auch und vor allem zu wissen, welche Art von Welt sie sein soll und wie man sie errichtet.
Eine Antwort auf diese Frage kann das ESF schwerlich anbieten. Angesichts der Unmenge und Unterschiedlichkeit der teilnehmenden Organisationen (von Organisationen der „Jungen Manager“ und „Jungen Unternehmer“ über christliche Vereinigungen bis hin zu Trotzkisten wie LCR und SWP, Stalinisten der KPF und von Rifondazione und selbst Anarchisten wie Alternative Libertaire) fällt es schwer zu glauben, dass das ESF auch nur eine kohärente Antwort oder überhaupt eine Antwort geben kann. Jedermann ist darum bemüht, seine eigenen Ideen zur Geltung zu bringen, daher die enorme Mannigfaltigkeit der Themen, die in Flugblättern, Debatten und Slogans zum Ausdruck kamen. Jedoch stellt sich bei näherem Hinschauen heraus, dass die Ideen, die aus dem ESF kommen, erstens nichts Neues enthalten und zweitens auch absolut nichts „Antikapitalistisches“ in sich bergen.
Die breite Mobilisierung rund um das ESF plus die Öffentlichkeit, die diese Masse an Themen der „Antiglobalisierungs“-Tendenz in so vielen linken und linksextremen Gruppen erfuhr, veranlasste die IKS dazu, mit aller Entschlossenheit, die in unseren Kräften steht, bei diesem Ereignis zu intervenieren. Da wir vermuteten, dass die „Debatten“ des ESF im Voraus inszeniert wurden (ein Verdacht, der von etlichen Teilnehmern dieser Debatten uns gegenüber bestätigt wurde), konzentrierten sich unsere Militanten, die von überall aus Europa herkamen, auf den Verkauf unserer Presse und auf die Teilnahme an den informellen Diskussionen rund um das ESF und während der Abschlussdemonstration. Ausserdem waren wir auf dem LSF anwesend, um in den Debatten zu intervenieren und die Perspektive des Kommunismus gegen den Anarchismus in den Vordergrund zu rücken.
Eine Welt ohne Handel und Austausch?
„Die Welt steht nicht zum Verkauf“ ist ein beliebter Slogan, der in vielen Versionen konkretisiert wurde: „Die Kultur steht nicht zum Verkauf“ für die Künstler und Theaterangestellten1, „Die Gesundheit steht nicht zum Verkauf“ für die Krankenschwestern und das Krankenhauspersonal oder „Die Erziehung steht nicht zum Verkauf“ für die Lehrer.
Wer wäre nicht berührt von solchen Slogans? Wer möchte schon gern seine Gesundheit oder die Erziehung seiner Kinder verkaufen?
Doch wenn wir die Realität hinter diesen Slogans betrachten, beginnen wir, den Braten zu riechen. Tatsächlich bereitet das, was vorgeschlagen wird, dem „Ausverkauf der Erde“ kein Ende, sondern begrenzt ihn allenfalls: „Befreiung der sozialen Dienste von der Logik des Marktes“. Was bedeutet dies konkret? Wir alle wissen, dass, seitdem der Kapitalismus existiert, alles bezahlt werden Muss, selbst der Gesundheitsdienst oder das Erziehungswesen. All jene Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, die die „Antiglobalisierer“ angeblich „von der Logik des Marktes befreien“ wollen, sind tatsächlich Teil des Gesamtlohns der Arbeiter, ein Teil, der üblicherweise vom Staat verwaltet wird. Weit entfernt davon, „von der Logik des Marktes befreit“ zu sein, ist das Lohnniveau, jenes Äquivalent an Produktion, das an die Arbeiterklasse zurückgeht, eine Frage des Marktes und betrifft den Kern der kapitalistischen Ausbeutung. Das Kapital bezahlt seine Arbeitskraft stets so gering wie möglich, mit anderen Worten: mit einem Minimum dessen, was für die Reproduktion der nächsten Arbeitergeneration notwendig ist. Heute, wo die Welt in eine immer tiefere Krise stürzt, benötigt jedes nationale Kapital immer weniger Hände und Muss jene Hände, die es noch benötigt, immer geringer entlohnen, wenn es nicht von seinen Konkurrenten auf dem Weltmarkt eliminiert werden will. In dieser Situation kann die Arbeiterklasse die Reduzierung ihrer Löhne – wie „sozial“ sie auch sein mag - nur durch ihren eigenen Kampf abwehren, und nicht, indem man den kapitalistischen Staat dazu auffordert, seine Löhne von den Marktgesetzen zu „befreien“, etwas, wozu der Staat vollkommen unfähig wäre, selbst wenn er wollte.
In der kapitalistischen Gesellschaft kann das Proletariat kraft seines eigenen Kampfes bestenfalls eine günstigere Aufteilung des Sozialprodukts erzwingen: Es kann die Mehrwertrate, die die kapitalistische Klasse extrahiert, zu Gunsten des variablen Kapitals – d.h. der Löhne – reduzieren. Aber dies in heutigem Zusammenhang zu tun, erfordert zunächst ein hohes Kampfniveau (wie wir nach der Niederlage der Kämpfe in Frankreich im Mai 2003 sahen, die stürmischen Angriffen gegen den Soziallohn folgten) und kann zweitens nur von vorübergehender Natur sein (wie wir nach der Bewegung von 1968 gesehen haben).
Nein, die Idee, dass „die Welt“ nicht zum Verkauf steht, ist nichts anderes als ein erbärmlicher Schwindel. Die eigentliche Natur des Kapitalismus besteht genau darin, dass alles zum Verkauf steht, und die Arbeiterbewegung weiss dies seit 1848: „Sie hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt (...) Die Bourgeoisie hat alle bisher ehrwürdigen und mit frommer Scheu betrachteten Tätigkeiten ihres Heiligenscheins entkleidet. Sie hat den Arzt, den Juristen, den Pfaffen, den Poeten, den Mann der Wissenschaft in ihre bezahlten Lohnarbeiter verwandelt.“ So formulierten es Marx und Engels im Kommunistischen Manifest: Es zeigt nur, wie gültig ihre Prinzipien heute bleiben!
Fairer Handel statt freier Handel?
„Fairer Handel, nicht freier Handel!“ war ein anderes Hauptthema auf dem ESF, das durch die Anwesenheit französischer Kleineigentümer mit ihrem „Bio“-Käse und anderen Produkten grossen Auftrieb erhielt. Wer sehe denn nicht auch gern die Bauern und kleinen Handwerker in der Dritten Welt anständig von den Früchten ihrer Arbeit leben? Wer möchte denn nicht die Dampfwalze der Agrarindustrie dabei aufhalten, die Bauern von ihrem Land zu werfen und zu Millionen in die Slums von Mexiko City und Kalkutta zu pferchen?
Doch wie in der Frage des Marktes sind auch hier schöne Gefühle ein schlechter Ratgeber.
Zunächst einmal ist an der „Freihandels“-Bewegung überhaupt nichts Neues. Das Geschäft mit der Wohltätigkeit (mit Gesellschaften wie Oxfam, die selbstverständlich auf dem ESF anwesend waren) hat „Freihandel“ für Handwerke praktiziert und seit über 40 Jahren deren Produkte in ihren Geschäften verkauft, ohne auch nur im Mindesten verhindert zu haben, dass Millionen von Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika in die Armut gestürzt wurden.
Darüber hinaus ist dieser Slogan aus den Mündern der „Antikapitalisten“ gleich zweifach heuchlerisch. Jemand wie José Bové, Präsident der französischen Bauernunion, kann ausgiebig den antikapitalistischen Superstar spielen, indem er die Lebensmittelindustrie und den Teufel McDonalds denunziert. Dies hindert jedoch die Mitglieder derselben Bauernunion nicht daran, für die Forderung zu demonstrieren, die Subventionen, die sie im Rahmen der europäischen Agrarpolitik2 bekommen, aufrechtzuerhalten. Indem sie die Preise der französischen Agrarprodukte mit ihren Subventionen niedrig hält, ist gerade die EU-Agrarpolitik eines der Hauptinstrumente für die Aufrechterhaltung des unfairen Handels zum Vorteil des einen und unvermeidlich zum Nachteil des anderen. Ähnlich bedeutet „fairer Handel“ für die amerikanische Stahlindustrie, für die die Gewerkschafter in Seattle demonstriert hatten und wofür sie seither berühmt geworden sind, Zolltarife auf den Import „ausländischer“ Stahlprodukte, die billiger produziert werden, zu erheben. Letztendlich ist „fairer Handel“ lediglich ein anderer Name für Handelskriege.
Im Kapitalismus ist der Begriff der „Fairness“ ohnehin eine Illusion. Wie Engels es bereits 1881 in einem Artikel sagte, als er den Begriff des „gerechten Lohns“ kritisierte: „Die Gerechtigkeit der politischen Ökonomie, wie sie in Wirklichkeit die Gesetze fixiert, die die bestehende Gesellschaft beherrschen, diese Gerechtigkeit ist ganz anders auf der einen Seite – auf der des Kapitals.“ (Engels, Ein gerechter Tagelohn für ein gerechtes Tagewerk, 7. Mai 1881, Werke Bd. 19, S. 249/250)
Der dreisteste Schwindel in diesem ganzen Geschäft mit dem „fairen Handel“ ist die Idee, dass die Anwesenheit von „antiglobalistischen“ Demonstranten in Seattle oder Cancun die Verhandlungsführer aus den Drittweltländern ermutigt habe, gegen die Forderungen der „reichen Länder“ aufzubegehren. Wir wollen hier nicht näher auf die Tatsache eingehen, dass der Gipfel von Cancun in einer bitteren Niederlage für die schwächeren Länder endete, da die Europäer nicht ihre Agrarpolitik ändern und die Amerikaner damit fortfahren, die amerikanischer Farmer massiv gegen die Billigimporte aus den armen Ländern zu subventionieren. Nein, was wirklich widerwärtig ist, ist, darauf zu vertrauen, dass die Regierungsmitglieder und die Bürokraten der Drittweltländer an diesen Verhandlungen teilnahmen, um die Bauern und Armen zu vertreten. Das Gegenteil ist der Fall! Um nur ein Beispiel zu nehmen: Als Brasiliens Lula die US-Zolltarife denunzierte, die auf importierten Orangensaft erhoben wurden, um die amerikanische Orangenindustrie zu schützen, da hatte er nicht die armen Bauern im Sinn, sondern die enormen kapitalistischen Orangenplantagen Brasiliens, wo die Arbeiter ähnlich schuften wie auf den Orangenplantagen Floridas.
Keine Unterstützung des bürgerlichen Staates!
Der gemeinsame Faden, der sich durch all diese Themen zieht, ist folgender: Gegen die „Neoliberalen“ und die „transnationalen“ Gesellschaften (jene üblen „Multis“, gegen die die antiglobalistischen Vorgänger bereits in den 70er-Jahren gewettert hatten) werden wir dazu angehalten, unser Vertrauen in den Staat zu setzen oder, noch besser, den Staat zu stärken. Die „Antiglobalisten“ behaupten, dass das Business die Macht vom „demokratischen“ Staat konfisziert habe, um seine eigenen „kommerziellen“ Gesetze durchzusetzen, und dass daher der „Widerstand der Bürger“ notwendig sei, um die Staatsmacht und den „öffentlichen Dienst“ wiederzubeleben.
Welch ein Gaunerstück! Nirgendwo ist heute der Staat präsenter als in der Wirtschaft, auch in den Vereinigten Staaten. Es ist der Staat, der den Weltmarkt reguliert, indem er die Leitzinsen, Zolltarife usw. festlegt. Der Staat ist der Hauptakteur in der nationalen Binnenwirtschaft, mit öffentlichen Ausgaben von – abhängig von Land zu Land – 30 bis 50 % des BSP und mit ständig wachsenden Staatsdefiziten. Noch wichtiger als dies ist Folgendes: Wann immer die Arbeiter kapieren, dass sie ihre Lebensbedingungen gegen die Angriffe der Kapitalisten verteidigen müssen – wer, wenn nicht die Polizeikräfte des Staates, stellt sich ihnen gleich von Anbeginn in den Weg? Zu fordern – wie es die „Antiglobalisten“ tun“ – dass der Staat gestärkt werden soll, damit er uns gegen die Kapitalisten verteidigt, ist wirklich ein gigantischer Schwindel: Der bürgerliche Staat ist dafür da, die Bourgeoisie gegen die Arbeiter zu beschützen, und nicht umgekehrt. 3
Es kommt nicht von ungefähr, dass das ESF diesen Aufruf fabriziert, den Staat und besonders seine linken Fraktionen zu unterstützen, die als die besten Vertreter der „Zivilgesellschaft“ gegen den „Neoliberalismus“ vorgestellt werden. Wie das Sprichwort sagt, bestimmt der die Melodie, der auch zahlt, und es ist äusserst aufschlussreich, einen Blick auf die Finanziers der 3,7 Millionen Euro Kosten für das ESF zu werfen:
– Zunächst einmal trugen die lokalen Behörden von Seine-St.Denis, Val de Marne und Essonne mehr als 600.000 Euros dazu bei, während die Stadt von St.Denis allein 570.000 Euros abzweigte.4 In der Tat ist es die französische „Kommunistische“ Partei – jene stalinistische Schurkenbande – die nach Jahren der Komplizenschaft an den vom stalinistischen Staat in Russland begangenen Verbrechen und nach Jahrzehnten der Sabotage des Arbeiterkampfes ihre politische Unschuld käuflich wiedererwerben möchte.
– Die französische Sozialistische Partei ist durch die Angriffe, die sie in ihrer Regierungszeit gegen die Arbeiter unternommen hatten, am meisten diskreditiert, und es ist wahr, dass die Zuhörer auf dem ESF nicht die Gelegenheit versäumten, sich über Laurent Fabius (einen bekannten sozialistischen Führer) lustig zu machen, als er es wagte, sich in den Debatten einzumischen. Man könnte meinen, dass die PS nicht versessen auf das ESF ist, doch ganz im Gegenteil! Die Stadt Paris (kontrolliert von der PS) trug eine Million Euro zur Begleichung der Kosten des ESF bei.
– Und die französische Regierung? Eine rechte, durch und durch neoliberale französische Regierung, in Artikeln, Flugblättern und Plakaten von der gesamten Linken, von den Anarchisten bis zu den Stalinisten, denunziert – wird sie nicht wenigstens beunruhigt sein, wenn sie sieht, dass das Forum so viele Menschen anzieht? Nein, überhaupt nicht! Durch die persönliche Anordnung des Präsidenten Jacques Chirac trug das Aussenministerium 500.000 Euros für das ESF bei.
Wer zahlt, möchte sicherlich einen Profit erzielen! Das ESF wurde von der gesamten französischen Bourgeoisie, von der Linken bis zur Rechten, grosszügig finanziert und ausgehalten. Und nun beabsichtigt die gesamte französische Bourgeoisie, von links bis rechts, vom unbestreitbaren Erfolg des ESF zu nutzniessen, und zwar besonders auf zwei Ebenen:
– Erstens ist das ESF ein Mittel für den linken Flügel des Staatsapparates, sich selbst zu erneuern (nachdem er durch die Jahre an der Regierung diskreditiert wurde, wo er den Lebensbedingungen der Arbeiter einen Schlag nach dem anderen versetzt und die Verantwortung für die imperialistische Politik des französischen Imperialismus übernommen hatte). Da politische Parteien nicht mehr in Mode sind, verkleiden sie sich als „Vereine“, um sich selbst einen Hauch von „Bürger“, „Demokratie“, „Netzwerk“ zu verleihen: Die KPF trat in der Form ihrer „Espace Karl Marx“ auf, die PS mit ihrer „Fondation Léo Lagrange“ und „Jean Jaurès“.5 Wir sollten betonen, dass nicht nur die Linke ein Interesse daran hat, uns ihre vergangenen Untaten vergessen zu machen – was eh jedem klar ist. Die gesamte herrschende Klasse hat ein Interesse daran, die gesellschaftlichen Fronten zu kaschieren, sicherzustellen, dass die Arbeiterkämpfe – ja, viel allgemeiner, der Abscheu und das Hinterfragen, die durch die kapitalistische Gesellschaft provoziert werden – in die Richtung der alten reformistischen Rezepte gelenkt werden, und zu verhindern, dass es zu einer Bewusstseinsbildung kommt, die notwendig ist, um die kapitalistische Ordnung zu stürzen und all ihren Krankheiten ein Ende zu bereiten.
– Zweitens hat die gesamte französische Bourgeoisie ein Interesse an der Ausweitung und Stärkung der deutlich antiamerikanischen Atmosphäre auf dem ESF. Die enorme Zerstörung und der fürchterliche Menschenverlust in den beiden Weltkriegen und vor allem die Wiederbelebung des Klassenkampfes sowie das Ende der Konterrevolution 1968 haben dazu beigetragen, den Nationalismus zu diskreditieren, den die Bourgeoisie dazu benutzt, um die Völker wie 1914 oder 1939 in das Gemetzel zu schicken. Konsequenterweise haben, auch wenn es nicht so etwas wie einen „europäischen Block“ und noch weniger eine „europäische Nation“ gibt, die Bourgeoisien der verschiedenen europäischen Länder, besonders in Frankreich und Deutschland, ein Interesse daran, das Entstehen eines antiamerikanischen und eines vagen „pro-europäischen“ Gefühls zu ermutigen, mit der Absicht, die Verteidigung ihrer eigenen imperialistischen Interessen gegen den US-Imperialismus als die Verteidigung einer „anderen“ oder gar „antikapitalistischen“ Weltsicht zu präsentieren. Zum Beispiel ist die „antiglobalistische“ Unterstützung für einen Bann gegen den Import von amerikanischen GMOs nach Frankreich im Namen der „Ökologie“ und der „Verteidigung der öffentlichen Gesundheit“ in Wahrheit nichts anderes als eine Episode im Wirtschaftskrieg, dazu bestimmt, der französischen Forschung Zeit zu geben, mit ihren amerikanischen Rivalen auf diesem Gebiet gleichzuziehen.6
Moderne Marketingtechniken verkaufen Produkte nicht mehr direkt, sie benutzen ein ganzes System, das sowohl subtil als auch effektiver ist: Sie verkaufen eine „Weltsicht“, einen „Life Style“, dem sie Produkte beifügen, die angeblich jenen Stil verkörpern. Die Organisatoren des ESF nutzen exakt dieselbe Methode: Sie offerieren uns eine unwahre „Weltsicht“, in der Kapitalismus nicht mehr kapitalistisch ist, die Nationen nicht mehr imperialistisch sind und eine „andere Welt“ ohne kommunistische Revolution möglich ist. Sodann versuchen sie im Namen dieser „Vision“, uns alte Produkte mit längst überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum unterzujubeln: die so genannten „kommunistischen“ und „sozialistischen“ Parteien, bei dieser Gelegenheit als „Bürgerinitiativen“ verkleidet.
Da die französische Bourgeoisie die Gelder für dieses Ereignis herausgerückt hat, ist es nur normal, dass ihre politischen Parteien die ersten sein wollen, die vom ESF profitieren. Doch sollten wir uns nicht einbilden, dass diese Angelegenheit allein von der französischen herrschenden Klasse inszeniert worden war – bei weitem nicht. Die Kampagne zur Erneuerung der Glaubwürdigkeit des linken Flügels der Bourgeoisie, in mannigfaltigen europäischen und weltweiten „Sozialforen“ praktiziert, dient der gesamten kapitalistischen Klasse weltweit.
Eine andere libertäre Welt?
Das „Libertäre Sozialforum“ war ausdrücklich als eine Alternative zum eher „offiziellen“ Forum angekündigt worden, das von den grossen bürgerlichen Parteien organisiert worden war. Man mag sich die Frage stellen, wie alternativ Ersteres tatsächlich war: Einer der Hauptorganisatoren des LSF (die Alternative Libertaire) nahm auch als aktiver Part am ESF teil und die LSF-Demonstration schloss sich nach einem kurzen „unabhängigen“ Bummel der grossen ESF-Demo an.
Wir beabsichtigen nicht, ausführlich darüber zu berichten, worüber auf dem LSF gesprochen wurde, und wollen nur einige der wichtigen Themen erwähnen.
Wir wollen mit der „Debatte“ über „selbstverwaltete Räume“ (Hausbesetzungen, Wohngemeinschaften, Dienstleistungsnetzwerke, „Alternative Cafés“, etc.) beginnen. Wenn wir das Wort „Debatte“ in Anführungszeichen setzen, dann deshalb, weil die Diskussionsleitung alles Mögliche tat, um die Diskussion auf blosse Beschreibungen der entsprechenden „Freiräume“ durch die Teilnehmer zu beschränken und jede Art der kritischen Einschätzung selbst aus dem anarchistischen Lager zu verhindern. Es wurde schnell offenbar, dass „self-management“ etwas sehr Relatives ist: Ein Teilnehmer aus Grossbritannien erklärte, dass sie ihren „Freiraum“ für die erkleckliche Summe von £ 350.000 (500.000 Euros) erkauft haben; andere zählten die Gründung eines „Freiraums“ .... im Internet auf, eine Kreation der, wie wir alle wissen, US DARPA.7
Noch verräterischer war die Praxis, die diese vielfältigen „Freiräume“ vorschlugen: eine freie und „alternative“ Pharmazie (d.h. Amateur-Kräutermittel), legale Beratungsdienste, Cafés, Austausch von Diensten, etc. Mit anderen Worten, eine Mischung aus kleinen Ladenbesitzern und Sozialdiensten, die gerade von den staatlichen Kürzungen abgeschafft wurden. Mit anderen Worten: Das Äusserste im anarchistischen Radikalismus ist es, staatliche Funktionen zu übernehmen, ohne dafür bezahlt zu werden.
Eine andere Debatte über „unentgeltliche öffentliche Dienste“ enthüllte in aller Vollständigkeit die Leere des offiziellen, ehrbaren Anarchismus. Es wurde behauptet, dass die „öffentlichen Dienste“ irgendwie eine Opposition gegen die Marktwirtschaft in sich trügen, indem sie Bedürfnisse der Bevölkerung umsonst befriedigen – und „selbstverwaltet“ selbstverständlich, mit Kundenkomitees, Produzentenkomitees und Gemeindekomitees. Diese Komitees und die „lokalen Komitees“, die derzeit vom französischen Staat für die Bewohner der Pariser Vorstädte aufgebaut werden, gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Die Frage wurde so gestellt, als sei es möglich, eine institutionelle Opposition innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft zu installieren, zum Beispiel indem man einen unentgeltlichen öffentlichen Verkehr etabliert.
Ein weiteres Kennzeichen des Anarchismus, das auf dem LSF stark zum Vorschein kam, ist seine tief verwurzelte elitäre und erzieherische Natur. Der Anarchismus will nicht wahrnehmen, dass eine „andere Welt“ aus dem Zentrum der gegenwärtigen Widersprüche in der Welt entstehen kann. In Folge dessen kann er sich einen Übergang von der heutigen zur künftigen Welt lediglich in der Form des „guten Beispiels“ vorstellen, das von den „selbstverwalteten Räumen“ auf erzieherische Weise gegen die Krankheiten des heute vorherrschenden „Produktivismus“ vorexerziert werden soll. Doch wie Marx bereits vor mehr als einem Jahrhundert sagte: Wenn eine neue Gesellschaft dank der Erziehung des Volkes entsteht, wer erzieht dann die Erzieher? Denn diejenigen, die vorhaben, die Erzieher zu sein, sind selbst von der Gesellschaft geformt, in der wir leben, und ihre Ideen von einer „anderen Welt“ bleiben in Wahrheit tief verankert in der Welt von heute.
Im Kern servierten uns die beiden „Sozialforen“ in der Verkleidung neuer und revolutionärer Ideen nichts anderes als altes Gedankengut, das sich seit langem als untauglich, wenn nicht vollständig konterrevolutionär gezeigt hatte.
Die „selbstverwalteten Räume“ erinnern an die Kooperativen und an ähnliche Gesellschaften des 19. Jahrhunderts, ganz zu schweigen von den Arbeiter-„Kollektiven“ unserer Zeit (von Lip in Frankreich bis hin zu Triumph in Grossbritannien), die entweder bankrott gingen oder gewöhnliche kapitalistische Unternehmen blieben, eben weil sie gezwungen waren, innerhalb der kapitalistischen Marktwirtschaft zu produzieren und zu verkaufen. Sie erinnern ebenfalls an jene „Gemeinschafts“-Unternehmen der 70er-Jahre (Hausbesetzungen, Gemeinschaftskomitees, „freie Schulen“), die darin endeten, als soziale Dienste in den bürgerlichen Staat integriert zu werden.
All diese Ideen mittels einer radikalen Umwandlung kraft kostenloser öffentlicher Dienste erinnern an den Reformismus, der bereits eine Illusion der Arbeiterbewegung um 1900 gewesen war und der 1914 den totalen Bankrott erlebte, als er Partei ergriff für „seinen eigenen“ Staat, um dessen „Errungenschaften“ gegen den imperialistischen „Aggressor“ zu verteidigen. Diese Ideen erinnern an die Schaffung des „Wohlfahrtsstaates“ durch die herrschende Klasse nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, um das Management und die Mystifikation der Arbeitskraft (insbesondere durch den „Beweis“, dass die Millionen von Opfern nicht umsonst gestorben seien) zu rationalisieren.
Unsere Welt geht mit einer neuen Welt schwanger
Im Kapitalismus wie in jeder Klassengesellschaft ist es absolut unvermeidlich, dass die vorherrschenden Gedanken die Gedanken der herrschenden Klasse sind. Es ist nur deshalb möglich, die Notwendigkeit und die materielle Möglichkeit einer kommunistischen Revolution zu verstehen, weil innerhalb der kapitalistischen Welt eine Gesellschaftsklasse existiert, die diese revolutionäre Zukunft bereits in sich verkörpert: die Arbeiterklasse. Im Gegensatz dazu können wir, wenn wir nur einfach versuchen, uns „vorzustellen“, wie eine „bessere“ Gesellschaft auf der Basis unserer Wünsche und Vorstellungen, wie sie heute von der kapitalistischen Gesellschaft (und entsprechend dem Modell unserer anarchistischen „Erzieher“) geformt werden, aussehen müsste, nichts anderes tun, als die gegenwärtige kapitalistische Welt „neu zu erfinden“, indem wir entweder dem reaktionären Traum der Kleinproduzenten, die nicht weiter blicken können als bis zum Ende ihres „selbstverwalteten Raumes“, oder dem mega-monströsen Delirium eines wohltätigen Weltstaates à la George Monbiot anheimfallen.8
Der Marxismus dagegen, innerhalb der kapitalistischen Welt von heute die Voraussetzungen der neuen Welt zu entdecken, die die kommunistische Revolution zum Leben erwecken müssen, falls die Menschheit ihrem Verderben entgehen will. Wie es das Kommunistische Manifest 1848 formulierte: „Die theoretischen Sätze der Kommunisten beruhen keineswegs auf Ideen, auf Prinzipien, die von diesem oder jenem Weltverbesserer erfunden oder entdeckt sind. Sie sind nur allgemeine Ausdrücke tatsächlicher Verhältnisse eines existierenden Klassenkampfes, einer unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung.“9
Wir können drei gesonderte, aber miteinander verwobene Hauptelemente in dieser „unter unsern Augen vor sich gehenden geschichtlichen Bewegung“ unterscheiden.
Das erste ist die Umwandlung, die der Kapitalismus im Produktionsprozess der gesamten menschlichen Spezies bereits vollzogen hat. Ein ganz alltägliches Objekt dieser Umwandlung ist die Arbeit, die nicht mehr das Werk eines selbstgenügsamen Handwerkers oder lokaler Fabrikation ist, sondern die gemeinsame Arbeit von Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Männern und Frauen, die an einem Netzwerk teilhaben, das sich über den ganzen Planeten erstreckt. Durch die kommunistische Weltrevolution von den Zwängen der kapitalistischen Marktverhältnisse für die Produktion und der privaten Aneignung ihrer Früchte befreit, wird die Zerstörung allen lokalen, regionalen und nationalen Partikularismus die Grundlage für die Konstitution einer einzigen menschlichen Gemeinschaft auf Weltebene sein. Der Fortschritt in der gesellschaftlichen Umwandlung und die Bekräftigung eines jeglichen Aspektes des gesellschaftlichen Lebens in dieser weltweiten Gemeinschaft wird zum Verschwinden aller Unterschiede zwischen den ethnischen Gruppen, den Völkern und Nationen (wozu die Bourgeoisie heute ermutigt, um die Arbeiterklasse zu spalten) führen. Es ist absehbar, dass Bevölkerungen und Sprachen so weit vermischt werden, bis keine Europäer, Afrikaner oder Asiaten (und schon gar nicht Katalanen, Bretonen und Basken!) mehr existieren, sondern eine vereinte menschliche Spezies, deren intellektuelle und künstlerische Produktion in einer einzigen Sprache ihren Ausdruck finden, die von allen verstanden und unendlich reicher, präziser und harmonischer als jene sein wird, in denen die begrenzte und zerfallende Kultur von heute ihren Ausdruck findet.10
Das zweite Hauptelement, das mit dem ersten eng verknüpft ist, ist die Existenz einer Klasse in der kapitalistischen Gesellschaft, die an ihrem höchsten Punkt diese Realität eines internationalen und vereinten Produktionsprozesses verkörpert und ausdrückt. Ob sie amerikanische Stahlarbeiter, britische Arbeitslose, französische Behördenangestellte, deutsche Maschinenschlosser, indische Programmierer oder chinesische Bauarbeiter sind, all diese Arbeiter haben eins gemeinsam: dass sie immer unerträglicher ausgebeutet werden durch die globale kapitalistische Klasse und dass sie sich dieser Ausbeutung nur entledigen können, wenn sie die kapitalistische Ordnung an sich stürzen.
Wir sollten an dieser Stelle zwei Aspekte in der Natur der Arbeiterklasse hervorstreichen:
– Zuallererst ist die Arbeiterklasse, anders als die Bauern oder kleinen Handwerker, ein Geschöpf des Kapitalismus, das unabdingbare Notwendigkeit für diese Gesellschaft ist ohne diesem sie nicht leben kann. Der Kapitalismus konnte die Bauern und die Handwerker unterdrücken, sie auf den Status von Proletariern reduzieren – oder zur Arbeitslosigkeit verdammen, wie in der gegenwärtigen dekadenten Ökonomie. Doch der Kapitalismus kann nicht ohne das Proletariat existieren. So lange wie der Kapitalismus existiert, wird auch das Proletariat existieren. Und so lange das Proletariat existiert, wird es in sich das revolutionäre kommunistische Projekt des Sturzes des Kapitalismus und des Aufbaus einer anderen Welt tragen.
– Ein anderes fundamentales Kennzeichen der Arbeiterklasse liegt in der Bewegung und der Vermischung von Völkern, um auf die Bedürfnisse der kapitalistischen Produktion zu antworten. „Die Arbeiter haben kein Vaterland“, wie das Manifest sagt, nicht nur weil sie kein Eigentum besitzen, sondern auch weil sie dem Kapital und dessen Anforderungen an die Arbeitskraft auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Die Arbeiterklasse ist durch ihre eigentliche Natur eine Klasse von Immigranten. Um sich davon zu überzeugen, müssen wir lediglich die Bevölkerung in jeder grösseren Industriestadt betrachten: Die Strassen sind voller Männer und Frauen aus allen Herren Länder. Doch dies trifft auch auf die unterentwickelten Länder zu: An der Elfenbeinküste sind viele Landarbeiter Burkinabé, südafrikanische Bergarbeiter kommen aus allen Landesteilen, aber auch aus Simbabwe und Botswana, Arbeiter am Persischen Golf kommen aus Indien, Palästina oder von den Philippinen, in Indonesien gibt es Millionen von ausländischen Arbeitern in den Fabriken. Diese Realität der Arbeiterexistenz – die das Vermischen der Völker vorausnimmt, von der wir weiter oben gesprochen hatten – demonstriert die Zwecklosigkeit des von Anarchisten und Demokraten lieb gewonnenen Ideals lokaler oder regionaler „Gemeinschaften“. Um nur ein Beispiel zu nehmen: Was kann der schottische Nationalismus der Arbeiterklasse Schottlands, die sich zum Teil aus asiatischen Immigranten zusammensetzt, bestenfalls anbieten? Nichts natürlich. Die einzig wahre Gemeinschaft, die Arbeiter, die von ihren Wurzeln gekappt wurden, finden können, ist die weltweite Gemeinschaft, die sie nach der Revolution errichten werden.
– Das dritte Hauptelement, das wir hier unterstreichen wollen, kann in einer einzigen Statistik zusammengefasst werden: In allen Klassengesellschaften, die dem Kapitalismus vorausgingen, bearbeiteten (mehr oder weniger) 95% der Bevölkerung das Land, und der Mehrwert, den sie produzierten, reichte gerade aus, um die anderen 5% (Kriegsherren und die Kirche, aber auch Kaufleute, Handwerker, etc.) zu ernähren. Heute hat sich diese Logik in ihr Gegenteil verkehrt, da in den entwickeltsten Ländern selbst die Produktion von materiellen Waren immer weniger Arbeiter beschäftigt. Mit anderen Worten: Auf der Ebene der physischen Kapazität des Produktionsapparates hat die Menschheit einen Grad an Überfluss erreicht, der alle Ziele und Ambitionen möglich macht.
Bereits unter dem Kapitalismus haben die menschlichen Produktionskapazitäten eine – im Vergleich zur gesamten früheren Geschichte – qualitativ neue Situation geschaffen: Während zuvor der Mangel und manchmal auch der nackte Hunger das Los breiter Bevölkerungsmassen war, vor allem wegen der natürlichen Grenzen der Produktion (niedrige Produktivität auf dem Land, geringe Ernten), sind unter dem Kapitalismus die einzigen Gründe für Mangel die kapitalistischen Produktionsverhältnisses selbst. Die Krise, die die Arbeiter auf die Strasse wirft, wird nicht von einem unzureichenden Produktionsniveau verursacht: Im Gegenteil, sie ist das direkte Resultat der Unmöglichkeit alles zu verkaufen, was produziert wird.11 Darüber hinaus hat in den so genannten „fortgeschrittenen“ Ländern ein immer weiter wachsender Teil der Wirtschaftsaktivitäten absolut keinen Nutzen ausserhalb des kapitalistischen Systems selbst: Finanz- und Börsenspekulation aller Art, astronomische Rüstungsetats, Modeartikel, „künstliche Alterung“, womit bezweckt wird, die Erneuerung des Produkts zu forcieren, Werbung etc. Wenn wir weiter schauen, wird deutlich, dass der Gebrauch der globalen Ressourcen auch von der wachsend irrationalen – ausser vom Standpunkt der kapitalistischen Profitabilität – Funktionsweise der Wirtschaft beherrscht wird: Stunden, die Millionen von Menschen auf dem täglichen Weg von und zur Arbeit verbringen, oder der Transport von Frachten auf der Strasse statt auf der Schiene, um auf die unvorhersehbaren Erfordernisse eines anarchischen Produktionsprozess zu reagieren etc. Kurz, das Verhältnis zwischen dem Zeitaufwand für die Produktion zur Befriedigung der Minimalbedürfnisse (Lebensmittel, Kleidung, Obdach) und dem für die Produktion „über das Minimum hinaus“ (um es mal so zu formulieren) ist vollständig umgekippt.12
Die Geburt einer planetarischen Gemeinschaft
Wenn wir auf Demonstrationen oder vor den Fabriktoren unsere Presse verkaufen, werden wir häufig mit derselben Frage konfrontiert: „Was ist denn Kommunismus, wenn Ihr sagt, dass er nie existiert hatte?“ In einer solchen Lage versuchen wir, eine Antwort zu geben, die sowohl allgemein als auch kurz ist, und wir antworten daher oft: „Der Kommunismus ist eine Welt ohne Klassen, ohne Nationen und ohne Geld.“ Auch wenn diese Definition sehr einfach klingt (und negativ, denn sie definiert den Kommunismus als etwas „ohne...“), enthält sie dennoch die grundlegenden Kennzeichen einer kommunistischen Gesellschaft:
– Sie wird ohne Klassen sein, weil sich das Proletariat nicht selbst befreien kann, indem es eine neue ausbeutende Klasse wird: Das Wiederauftreten einer ausbeutenden Klasse nach der Revolution würde tatsächlich die Niederlage der Revolution und das Überleben der Ausbeutung bedeuten.13 Das Verschwinden der Klassen entspringt ganz natürlich den Interessen einer siegreichen Arbeiterklasse, ihrer eigenen Emanzipation. Eines der ersten Ziele der Klasse wird darin bestehen, die Arbeitszeit zu reduzieren, indem die Arbeitslosen und die Massen ohne Arbeit in der Dritten Welt, aber auch das Kleinbürgertum, die Bauern und sogar die Mitglieder der gestürzten Bourgeoisie in den Produktionsprozess integriert werden.
– Sie wird ohne Nationen sein, weil der Produktionsprozess bereits weit über den nationalen Rahmen hinausgegangen ist und dabei die Nation als organisatorischen Rahmen für die menschliche Gesellschaft überflüssig gemacht hat. Durch die Schaffung der ersten weltweiten Gesellschaft ist der Kapitalismus bereits über den nationalen Rahmen hinaus geschritten, innerhalb dessen er geboren wurde. So wie die bürgerliche Revolution alle feudalen Partikularitäten und Grenzen (Steuern auf den Transport von Waren innerhalb der nationalen Grenzen, spezifische Gesetze, Gewichte und Masseinheiten, die in dieser oder jener Stadt und Region galten) zerstört hat, so wird die proletarische Revolution der letzten Spaltung der Menschheit, die Spaltung in Nationen, ein Ende bereiten.
– Sie wird ohne Geld sein, weil der Begriff des Austausches keine Bedeutung im Kommunismus hat, dessen Überfluss die Befriedigung der Bedürfnisse jedes Gesellschaftsmitglieds erlauben wird. Der Kapitalismus hat die erste Gesellschaft geschaffen, wo der Warenaustausch auf die Gesamtheit der Produktion ausgeweitet ist (im Gegensatz zu früheren Gesellschaften, wo der Warenaustausch im Wesentlichen auf Luxusgüter oder bestimmte Artikel beschränkt blieb, die, wie das Salz, nicht überall produziert werden konnten). Heute wird der Kapitalismus durch seine Unfähigkeit stranguliert, alles auf dem Markt zu verkaufen, was er zu produzieren imstande ist. Die eigentliche Tatsache des Kaufens und Verkaufens ist zu einer Barriere für die Produktion geworden. Der Austausch wird daher verschwinden. Mit ihm wird auch die Idee der Ware verschwinden, einschliesslich der allerersten Ware: die Lohnarbeit.
Diese drei Prinzipien sind den Gemeinplätzen der bürgerlichen Ideologie diametral entgegengesetzt, nach der es eine gierige und gewalttätige „menschliche Natur“ gibt, die die Spaltungen zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten oder zwischen Nationen verewigt. Natürlich eignet sich diese Idee der „menschlichen Natur“ bestens für die Bourgeoisie, rechtfertigt sie doch ihre Klassenherrschaft und hindert die Arbeiterklasse daran, klar und deutlich zu identifizieren, was tatsächlich für das Elend und die Massaker, die die Menschheit heute überwältigen, verantwortlich ist. Aber dies hat rein gar nichts mit der Realität zu tun: Während die „Natur“ (d.h. das Verhalten) anderer Tierarten von ihrer natürlichen Umgebung bestimmt wird, wird die „menschliche Natur“ um so mehr von unserer gesellschaftlichen, nicht natürlichen Umgebung bestimmt, je mehr die Herrschaft des Menschen über die Natur voranschreitet.
Das umgewandelte Verhältnis zwischen Mensch und Natur
Die drei Punkte, die wir oben hervorgehoben haben, sind nicht mehr als äusserst kurze Skizzen. Dennoch haben sie tiefergehende Auswirkungen auf die kommunistische Gesellschaft von morgen.
Es ist richtig, dass Marxisten es stets vermieden haben, „Blaupausen“ zu entwerfen, erstens, weil der Kommunismus von der wirklichen Bewegung der grossen Massen der Menschheit aufgebaut wird, und zweitens, weil wir uns den Kommunismus noch viel weniger vorstellen können, als ein Bauer des 11. Jahrhunderts sich den modernen Kapitalismus vorstellen konnte. Dies hindert uns jedoch nicht daran, einige der allgemeineren Charakteristiken anzugeben, die aus dem folgen, was wir gerade gesagt haben (aus Platznot sehr kurz, versteht sich).
Wahrscheinlich wird die radikalste Änderung dem Verschwinden des Widerspruchs zwischen dem Menschen und seiner Arbeit entspringen. Die kapitalistische Gesellschaft hat den in einer Klassengesellschaft stets existierenden Widerspruch zwischen der Arbeit, mit anderen Worten: die Tätigkeit, die wir nur ausüben, weil wir dazu gezwungen werden, und der Freizeit, mit anderen Worten: die Zeit, in der wir unsere Aktivitäten (natürlich nur begrenzt) frei wählen können, auf die Spitze getrieben.14 Die Nötigung, die uns zu arbeiten zwingt, ist einerseits auf den Mangel, der uns durch die Grenzen der Arbeitsproduktivität aufgezwungen wird, und andererseits auf die Tatsache zurückzuführen, dass ein Teil der Früchte der Arbeit von der ausbeutenden Klasse angeeignet wird. Im Kommunismus wird dieser Mangel nicht mehr existieren: Zum ersten Mal in der Geschichte wird die menschliche Spezies frei produzieren, und die Produktion wird ausschliesslich auf die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse ausgerichtet sein. Wir können sogar annehmen, dass die Wörter „Arbeit“ und „Freizeit“ aus der Sprache verschwinden werden, da keine Aktivität aus schlichter Notwendigkeit unternommen wird. Die Entscheidung, zu produzieren oder nicht, wird nicht allein von der Nützlichkeit des zu produzierenden Dings abhängen, sondern auch von der Lust oder dem Interesse am Produktionsprozess selbst.
Die eigentliche Idee der „Befriedigung von Bedürfnissen“ wird ihren Charakter ändern. Grundbedürfnisse (Lebensmittel, Kleidung, Obdach) werden einen immer weniger wichtigen Platz einnehmen, während die Bedürfnisse, die von der gesellschaftlichen Entfaltung der Spezies bestimmt werden, immer mehr in den Vordergrund rücken. Es wird keine Unterscheidung mehr zwischen „künstlerischer“ und nicht-künstlerischer Arbeit geben. Der Kapitalismus ist eine Gesellschaft, die den Widerspruch zwischen „Kunst“ und „Nicht-Kunst“ auf die äusserste Spitze getrieben hat. Erst mit dem Aufstieg des Kapitalismus begann der Künstler, sein Werk zu unterzeichnen, und wurde die Kunst zu einer spezifischen Tätigkeit, die von der täglichen Produktion abgetrennt wurde. Heute hat diese Tendenz mit einer fast totalen Trennung zwischen den „schönen Künsten“ auf der einen Seite (unverständlich für die grosse Mehrheit der Bevölkerung und reserviert für eine dünne intellektuelle Minderheit) und der industrialisierten Kunstproduktion der Werbung und der „Popkultur“, beide reserviert für die „Freizeitaktivitäten“, ihren Höhepunkt erreicht. All dies ist nichts anderes als die Folge des Widerspruchs zwischen dem Menschen und seiner Arbeit. Mit dem Verschwinden dieses Widerspruchs wird auch der Widerspruch zwischen „nützlicher“ und „künstlerischer“ Produktion verschwinden. Schönheit, die Befriedigung der Sinne und des Geistes werden ebenfalls fundamentale menschliche Bedürfnisse sein, die der Produktionsprozess befriedigen Muss.15
Auch die Erziehung wird ihren gesamten Charakter ändern. In jeder Gesellschaft ist es der Zweck der Erziehung von Kindern, ihnen zu erlauben, ihren Platz in der erwachsenen Gesellschaft einzunehmen. Unter dem Kapitalismus bedeutet das „Einnehmen seines Platzes in der erwachsenen Gesellschaft“ für sie, ihren Platz in einem System brutaler Ausbeutung einzunehmen, wo diejenigen, die nicht profitabel sind, faktisch keinen Platz haben. Der Zweck der Erziehung (den uns die „alternativen Kosmopoliten“ als nicht „zum Verkauf“ stehend aufschwatzen) ist es daher vor allem, die neue Generation mit Fähigkeiten auszustatten, die notwendig sind, um das nationale Kapital gegen seine Konkurrenten auf dem Weltmarkt zu stärken. Es ist ebenfalls klar, dass der Kapitalismus absolut kein Interesse daran hat, ein kritisches Verhalten gegenüber seiner eigenen gesellschaftlichen Organisation zu fördern. Kurz, der Zweck der Erziehung ist nichts anderes, als junge Menschen zu unterwerfen und sie nach der kapitalistischen Gesellschaft und den Erfordernissen ihres Produktionsprozesses zu gestalten; kein Wunder also, dass Schulen immer mehr zu Lernfabriken werden und die Lehrer wie Arbeiter am Fliessband wirken.
Im Kommunismus wird im Gegensatz dazu die Integration der Jungen in die erwachsene Welt die grösstmögliche Schärfung all ihrer physischen und intellektuellen Sinne fordern. In einem Produktionssystem, dass von den Erfordernissen des Profits völlig befreit sein wird, wird sich die erwachsene Welt dem Kind allmählich, entsprechend der Entwicklung seiner Fähigkeiten, öffnen, und der junge Erwachsene wird nicht mehr der peinigenden Erfahrung ausgesetzt sein, die Schule zu verlassen, um in einen grimmigen Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt geworfen zu werden. So wie es keinen Widerspruch mehr zwischen „Arbeit“ und „Freizeit“ oder „Produktion“ und „Kunst“ geben wird, so wird es auch keinen Gegensatz zwischen der Schule und der „Welt der Arbeit“ geben. Die Wörter „Schule“, „Fabrik“, „Büro“, „Kunstgalerie“, „Museum“ werden verschwinden17 oder ihre Bedeutung völlig verändern, da die Gesamtheit der menschlichen Aktivität in einem harmonischen Bemühen zusammengefasst sein wird, um die physischen, intellektuellen und sinnlichen Bedürfnisse der Spezies zu entwickeln und zu befriedigen.
Die Verantwortung des Proletariats
Kommunisten sind keine Utopisten. Wir haben hier versucht, äusserst kurze und notwendigerweise beschränkte Skizzen dessen zu entwerfen, wie der neuen Gesellschaft aussehen Muss, die der heutige Kapitalismus in seinem Schoss trägt. In diesem Sinn ist der Slogan der „alternativen Kosmopoliten“, dass „eine andere Welt möglich ist“ (oder gar „andere Welten möglich sind“), eine reine Mystifikation. Nur eine andere Welt ist möglich: der Kommunismus.
Aber die Geburt dieser neuen Welt ist beileibe nicht unvermeidlich. In diesem Zusammenhang gibt es keinen Unterschied zwischen dem Kapitalismus und den anderen Klassengesellschaften, die ihm vorausgingen, wo „Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Bnaron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte (...) in stetem Gegensatz zueinander (standen), (....) einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf (führten), einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.“18 Mit anderen Worten: gleichgültig, wie notwendig sie ist, ist die kommunistische Revolution nicht unausweichlich. Der Übergang vom Kapitalismus in die neue Welt wird nicht möglich sein ohne die Gewalt der proletarischen Revolution als ihre unvermeidliche Geburtshelferin.19 Doch die Alternative unter den Bedingungen eines fortgeschrittenen Zerfalls der heutigen Gesellschaft ist die Vernichtung nicht nur der beiden „kämpfenden Klassen“, sondern der gesamten menschlichen Art. Daher die gigantische Verantwortung, die auf den Schultern der weltweiten revolutionären Klasse lastet.
Von der heutigen Situation aus betrachtet, mag die Entwicklung der revolutionären Fertigkeiten des Proletariats als solch ein unmöglicher, abgehobener Traum erscheinen, dass die Versuchung gross ist, heute „irgendetwas zu tun“, selbst wenn dies bedeuten sollte, sich auf jene alten Schurken der stalinistischen und sozialistischen Parteien, anders ausgedrückt, den linken Flügel des bürgerlichen Staatsapparates, einzulassen. Doch für die revolutionären Minderheiten ist der Reformismus kein Notbehelf, den man mangels besserer Alternativen anwendet. Er ist im Gegenteil ein tödlicher Kompromiss mit dem Klassenfeind. Der Weg zur Revolution, der allein eine „andere Welt“ schaffen kann, wird lang und schwierig sein, aber es ist der einzige Weg, der existiert.
Geographisch:
- Europa [30]
Aktuelles und Laufendes:
- Soziale Foren [114]
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Klassenkampfbericht
- 3039 Aufrufe
Die Entwicklung des Klassenkampfs im Kontext der allgemeinen Angriffe und des fortgeschrittenen Zerfalls des Kapitalismus
Wir veröffentlichen nachstehend den im Herbst 2003 anlässlich der Zusammenkunft des Zentralorgans der IKS präsentierten und angenommenen Klassenkampfbericht.1 Dieser Bericht bestätigt die Analysen der Organisation über die Beständigkeit des Kurses hin zu Klassenkonfrontationen (der durch den internationalen Aufschwung des Klassenkampfs 1968 einsetzte) trotz dem schwerwiegenden Rückschlag, den das Proletariat auf der Bewusstseinsebene seit dem Zusammenbruch des Ostblocks hat einstecken müssen. Der Bericht stellte sich die besondere Aufgabe, eine Einschätzung des unmittelbaren und langfristigen Einflusses der Verschärfung der Wirtschaftskrise und der kapitalistischen Angriffe auf die Arbeiterklasse vorzunehmen. So stellt er fest, dass die „breiten Mobilisierungen vom Frühling 2003 in Frankreich und in Österreich einen Wendepunkt im Klassenkampf seit 1989 darstellen. Sie sind ein erster bedeutender Schritt in der Wiederaneignung der Kampfbereitschaft in der Arbeiterklasse nach der längsten Rückflussperiode seit 1968.”
Wir sind noch weit von einer internationalen Welle massiver Kämpfe entfernt, da sich die Kampfbereitschaft auf internationaler Ebene noch in embryonalem und heterogenem Zustand befindet. Man muss jedoch die beträchtliche Verschlimmerung der Entwicklungsperspektiven des Kapitalismus sowohl bezüglich des Abbaus des Wohlfahrtsstaates als auch die Zuspitzung der Ausbeutung in allen Formen und schliesslich die Entwicklung der Arbeitslosigkeit einbeziehen, die zusammen als Hefe in der Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse wirken. Der Bericht betont insbesondere die Tiefe, aber auch die Langsamkeit der Wiederaufnahme des Klassenkampfs.
Seit der Niederschrift dieses Berichts haben sich die Merkmale des Wechsels in der Dynamik in der Arbeiterklasse nicht verändert. Die seitherige Entwicklung illustriert eine im Bericht angesprochene Tendenz, dass erst isolierte Manifestationen des Klassenkampfs den gewerkschaftlich vorgegebenen Rahmen verlassen. Die territoriale Presse der IKS hat über solche Kämpfe vom Ende des Jahres 2003 im Transportwesen in Italien und bei der Post in Grossbritannien berichtet. Diese Kämpfe haben die Basisgewerkschaften auf den Plan gerufen, um Sabotagearbeit zu verrichten. Auch besteht die bereits vor diesem Bericht von der IKS aufgezeigte Tendenz zum Auftauchen von nach revolutionärer Kohärenz suchenden Elementen fort.
Das ist ein sehr langer Weg, den die Arbeiterklasse wird zurück legen müssen. Die Kämpfe, zu denen sie gezwungen sein wird, werden den Schmelztiegel der Reflexion darstellen, die durch die Verschärfung der Krise verstärkt und durch die Intervention der Revolutionäre befruchtet wird. Durch sie kann die Klasse ihre Identität und ihr Selbstvertrauen wieder gewinnen, an den historischen Erfahrungen anknüpfen und die Klassensolidarität entwickeln.
Der Klassenkampfbericht für den 15. Kongress der IKS2 unterstrich den unausweichlichen Charakter einer Antwort der Arbeiterklasse auf die qualitative Entwicklung der Krise und auf die scharfen Angriffe auf eine neue Generation ungeschlagener Arbeiter. Die Antwort besteht aus einer langsamen, aber bedeutsamen Wiederaneignung der Kampfbereitschaft. Der Bericht identifizierte eine Verbreitung und eine zwar noch embryonale aber doch wahrnehmbare Vertiefung der unterirdischen Reifung des Bewusstseins. Er betonte die Bedeutung der Tendenz zu massiveren Kämpfen für die Wiederaneignung der Klassenidentität und des Selbstvertrauens durch die Arbeiterklasse. Er zeigte auf, dass mit der objektiven Entwicklung der Widersprüche des Systems die Herausbildung eines ausreichenden Klassenbewusstseins – insbesondere bezüglich der Zurückgewinnung der kommunistischen Perspektive – die entscheidende Frage für die Zukunft der Menschheit wird. Er setzte den Akzent auf die historische Bedeutung des Auftauchens einer neuen Generation von Revolutionären und betonte, dass dieser Prozess trotz des Rückgangs der Kampfbereitschaft und des Klassenbewusstsein in der Gesamtheit der Arbeiterklasse schon seit 1989 in Gang ist. Der Bericht zeigte also die Grenzen des Rückflusses auf und betonte, dass der historische Kurs in Richtung massiver Klassenkonfrontationen bestehen bleibt und dass die Arbeiterklasse in der Lage ist, den erlittenen Rückschlag zu überwinden. Gleichzeitig ging der Bericht auf die Fähigkeit der herrschenden Klasse ein, all die Implikationen dieser Entwicklung zu erfassen und ihnen entgegen zu treten. Er stellte diese Entwicklung in den Kontext der negativen Auswirkungen des Zerfalls des Kapitalismus. Er wies auf die enorme Verantwortung der revolutionären Organisationen angesichts der voranschreitenden Bemühungen der Arbeiterklasse und der neuen Generationen von kämpfenden Arbeitern und Revolutionären hin.
Beinahe unmittelbar nach dem 15. Kongress und in der auf den Irakkrieg folgenden Periode hat die Mobilisierung der Arbeiter in Frankreich (sie gehört zu den bedeutendsten Mobilisierungen seit dem Zweiten Weltkrieg) diese Perspektiven schnell bestätigt. In der Revue Internationale 114 haben wir eine erste Bilanz dieser Bewegung gezogen und festgestellt, dass diese Kämpfe die These eines angeblichen Verschwindens der Arbeiterklasse widerlegen. Der Artikel bekräftigt, dass die gegenwärtigen Angriffe „die Hefe im langsamen Reifungsprozess der Bedingungen für das Auftauchen von massiven Kämpfen bilden, die notwendig für die Wiederaneignung der proletarischen Klassenidentität und für die schrittweise Auflösung der Illusionen hauptsächlich in die mögliche Reformierbarkeit des Systems sind. Die Massenaktionen werden die Wiedererrichtung des Bewusstseins über die eigene Ausbeutung sowie über die Bedeutung als Trägerin einer anderen historischen Perspektive für die Gesellschaft sein. Deshalb ist die Krise der Verbündete des Proletariats. Der Weg, den sich die Arbeiterklasse für diese eigene revolutionäre Perspektive bahnen muss, ist jedoch keine Autobahn. Er wird schrecklich lang, von Fallen besetzt sein, die der Feind ihr stellen wird.“ Die im Klassenkampfbericht vom 15. Kongress herausgearbeiteten Perspektiven haben sich somit nicht nur durch die Entwicklung einer neuen Generation von suchenden Elementen auf internationaler Ebene bestätigt, sondern auch durch die Arbeiterkämpfe.
Der vorliegende Klassenkampfbericht beschränkt sich also auf eine Aktualisierung und eine genauere Überprüfung der langfristigen Bedeutung gewisser Aspekte der letzten Arbeiterkämpfe.
2003: Ein Wendepunkt
Die breiten Mobilisierungen vom Frühling 2003 in Frankreich und in Österreich stellen in den Klassenkämpfen seit 1989 einen Wendepunkt dar. Sie sind ein erster wichtiger Schritt in der Wiederaneignung der Kampfbereitschaft der Arbeiter nach der längsten Rückflussperiode seit 1968. Die 90er-Jahre haben sicher schon sporadische, aber doch wichtige Ausdrücke dieser Kampfbereitschaft gesehen. Die Gleichzeitigkeit der Bewegungen in Frankreich und Österreich indessen sowie weiter die Tatsache, dass die deutschen Gewerkschaften gleich unmittelbar danach die Niederlage der ostdeutschen Metallarbeiter3 organisierten, um präventiv gegen den proletarischen Widerstand vorzugehen, beleuchten die Entwicklung seit Beginn des neuen Jahrtausends. Diese Ereignisse bestätigen die Tatsache, dass die Arbeiterklasse angesichts der dramatischen Verschärfung der Krise und den stets massiveren und allgemeineren Angriffen zunehmend zum Kampf gezwungen ist, und dies trotz dem noch immer fehlenden Selbstvertrauen.
Diese Änderung betrifft nicht nur die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, sondern auch ihren Geisteszustand, die Perspektive, in deren Rahmen sich ihre Aktivitäten abspielen. Es gibt derzeit Anzeichen eines Verlusts von Illusionen nicht nur über die typischen Mystifikationen der 90er-Jahre (die IT-Revolution, die individuelle Bereicherung an der Börse usw.), sondern auch über diejenigen, die durch die Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgerufen worden sind, so die Hoffnung auf ein besseres Leben für die nachfolgende Generation und einen geruhsamen Lebensabend für diejenigen, die die Lohnarbeit überlebt haben.
Der Artikel in der Revue Internationale 114 erinnert an die massive Rückkehr des Proletariats auf der historischen Szene 1968 und an das Wiederauftauchen einer revolutionären Perspektive, die nicht nur eine Antwort auf die Angriffe auf unmittelbarer Ebene darstellten, sondern vor allem auch auf die Auflösung von Illusionen über eine bessere Zukunft, die der Kapitalismus in der Nachkriegszeit scheinbar verhiess. Im Gegensatz dazu, was uns eine vulgäre und mechanistische Deformation des historischen Materialismus glauben machen wollte, sind solche Wendungen im Klassenkampf, selbst wenn sie durch unmittelbare Verschlechterung der materiellen Lebensbedingungen verursacht werden, immer das Resultat einer veränderten Wahrnehmung der Zukunft. Die bürgerliche Revolution in Frankreich ist nicht mit dem Ausbruch der Krise des Feudalismus (die bereits seit längerem schwelte) explodiert, sondern als es offensichtlich wurde, dass der Absolutismus dieser Krise nicht mehr die Stirn bieten konnte. In der gleichen Weise begann die Bewegung, die zur ersten weltweiten revolutionären Welle führen sollte, nicht im August 1914, sondern erst, als die Illusionen über eine schnelle militärische Lösung des Weltkrieges zerstört waren.
Deshalb auferlegen uns die kürzlich stattgefunden Kämpfe die Hauptaufgabe, ihre historische Bedeutung zu verstehen.
Eine langsame Entwicklung der sozialen Situation
Nicht jeder Wendepunkt im Klassenkampf hat dieselbe Bedeutung und Tragweite wie 1917 oder 1968. Diese Daten bezeichnen einen Wechsel des historischen Kurses, während 2003 lediglich den Anfang des Endes einer Rückflussphase innerhalb des allgemeinen Kurses hin zu massiven Klassenkonfrontationen darstellt. Von 1968 bis 1989 war der Klassenkampf bereits von mehreren Rückfluss- und Aufschwungphasen gekennzeichnet. Insbesondere führte die Ende der 70er-Jahre entfesselte Dynamik schnell zum Höhepunkt der Massenstreiks im Sommer 1980 in Polen. Das Ausmass der veränderten Bedingungen zwang die Bourgeoisie damals zu einer unverzüglichen Änderung der politischen Orientierung: Die Linke wurde in die Opposition versetzt, um die Kämpfe besser von innen her zu sabotieren.4 Es ist auch notwendig, zwischen der gegenwärtigen Änderung bei der Wiederaneignung der Kampfbereitschaft durch die Arbeiterklasse und dem Aufschwung in den 70er- und 80er-Jahren zu unterscheiden.
Auf viel allgemeinerer Ebene muss man in der Lage sein, zwischen einer Situation zu unterscheiden, in der man eines Morgens aufwacht und die Welt ist nicht mehr dieselbe wie am Vortag, und Änderungen, die beinahe von der Allgemeinheit beinahe unbemerkt vor sich gehen wie beispielsweise der Gezeitenwechsel. Die gegenwärtige Entwicklung gehört unbestreitbar letzterer an. In diesem Sinn bedeuten die Mobilisierungen vor Kurzem gegen die Angriffe auf das Rentenwesen in keiner Weise eine unmittelbare und spektakuläre Anpassung der Situation, die eine sofortige und grundlegende Entfaltung der politischen Kräfte der Bourgeoisie zur Gegenwehr verlangen würde.
Wir sind noch weit von einer internationalen Welle massiver Kämpfe entfernt. In Frankreich war der massive Charakter der Mobilisierungen vom Frühling 2003 hauptsächlich auf das Erziehungswesen beschränkt. In Österreich war die Mobilisierung zwar breiter, dafür aber zeitlich auf einige Aktionstage im öffentlichen Sektor beschränkt. Der Metallarbeiterstreik in Ostdeutschland war in keiner Art und Weise ein Ausdruck einer unmittelbaren Kampfbereitschaft der Arbeiter, sondern eher eine für die noch am wenigsten kämpferischen Teile der Klasse (die noch von der kurz nach der deutschen Wiedervereinigung aufgetretenen Massenarbeitslosigkeit traumatisiert sind) aufgestellte Falle, um allgemein den Eindruck zu erwecken, dass sich ein Kampf nicht lohne. Weiter sind die Nachrichten über die Bewegungen in Frankreich und Österreich teilweise einem vollständigen Black Out unterlegen, ausser ganz am Ende der Bewegung, wo sie zur Verbreitung eines entmutigenden Bildes benutzt wurden. In anderen für den Klassenkampf zentralen Ländern wie Italien, Grossbritannien, Spanien oder die Beneluxländer gab es bis kürzlich keine Massenmobilisierungen. Ausrücke einer der grossen Gewerkschaftszentralen entgleitenden Kampfbereitschaft wie der wilde Streik des Personals von British Airways in Heathrow, bei Alcatel in Toulouse oder in Puertollano in Spanien im vergangenen Sommer (siehe dazu die Révolution internationale 339) blieben punktuell und isoliert.
Selbst in Frankreich verunmöglichten die ungenügende Entwicklung der Kampfbereitschaft und vor allem deren verbreitete Abwesenheit die Ausdehnung dieser Bewegung über den Erziehungssektor hinaus.
Sowohl auf internationaler also auch auf nationaler Ebene befindet sich die Kampfbereitschaft also noch im embryonalen Stadium und ist noch sehr heterogen. Der bisher wichtigste Ausdruck ist der Kampf der Lehrer in Frankreich im letzten Frühling und er ist in erster Linie das Resultat einer Provokation der Bourgeoisie, die darin bestand, diesen bestimmten Sektor schwerer anzugreifen, um die Antwort auf die Rentenreform, die die ganze Arbeiterklasse betrifft, auf diesen Sektor zu polarisieren.5 Angesichts der grossangelegten Manöver der Bourgeoisie muss man auch die grosse Naivität, ja Blindheit der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit inklusive die suchenden Gruppen und Teile des politisch-proletarischen Milieus (hauptsächlich die Gruppen der kommunistischen Linken) und selbst vieler unserer Sympathisanten feststellen. Im Augenblick ist die Bourgeoisie nicht nur in der Lage, die ersten Ausdrücke der Unzufriedenheit bei den Arbeitern in Schach zu halten und zu isolieren, sondern sie kann sogar mit mehr oder weniger Erfolg (mehr in Deutschland als in Frankreich) diese noch relativ schwache Kampfbereitschaft gegen die langfristige Entwicklung der allgemeinen Kampfbereitschaft wenden.
Noch viel wichtiger als das Vorangegangene ist die Tatsache, dass die Bourgeoisie noch nicht zur Strategie der Linken in der Opposition zurückkehren muss. In Deutschland hat die Bourgeoisie die grösste Wahlfreiheit zwischen einer linken oder einer rechten Regierung. Anlässlich der Offensive Agenda 2010 gegen die Arbeiter haben sich 95% der Delegierten sowohl der SPD als auch der Grünen zugunsten eines Verbleibs in der Regierung ausgesprochen. Grossbritannien und Deutschland bildeten in den 70er und 80er-Jahren die Avantgarde der Weltbourgeoisie bei der Umsetzung der Politik der Linken in der Opposition als geeignetstem Mittel gegen die Arbeiterklasse. Und selbst Grossbritannien ist in der Lage, mit der linken Regierung die soziale Front unter Kontrolle zu halten.
Im Unterschied zur Situation, die Ende der 90er-Jahre vorherrschte, können wir heute nicht mehr von einer Politik der Linken an der Regierung als vorherrschende Orientierung der europäischen Bourgeoisie sprechen. Vor fünf Jahren war die Welle der linken Wahlsiege auch an die Illusionen über die ökonomische Lage gebunden. Heute muss sich die Bourgeoisie angesichts der Tiefe der gegenwärtigen Krise darum kümmern, dass die Regierungen ab und zu wechseln, um die demokratischen Illusionen zu stärken.6 Wir müssen uns in diesem Kontext daran erinnern, dass die deutsche Bourgeoisie schon im letzten Jahr zwar die Wiederwahl Schröders begrüsst hat, aber auch zum Ausdruck gebracht hat, dass sie mit einer konservativen Regierung Stoiber durchaus auch zufrieden gewesen wäre.
Der Bankrott des Systems
Die Tatsache, dass die ersten Scharmützel des Klassenkampfs in einem langen und schwierigen Prozess von Klassenkämpfen hin zu massiveren Kämpfen in Frankreich und Österreich stattfinden, ist vielleicht gar nicht so zufällig, wie es scheint. Wenn zwar das französische Proletariat für seinen explosiven Charakter bekannt ist, was teilweise auch erklärt, dass es 1968 an der Spitze des internationalen Wiederaufschwungs des Klassenkampfs stand, so kann man das schwerlich von der österreichischen Arbeiterklasse der Nachkriegszeit behaupten. Was diese beiden Länder jedoch gemeinsam haben, das ist die Tatsache, dass die massiven Angriffe das Rentenwesen zum zentralen Inhalt hatten. Man muss auch bemerken, dass die deutsche Regierung, die gegenwärtig dabei ist, die weitreichendste Attacke in Westeuropa auszulösen, noch sehr vorsichtig bezüglich der Frage der Renten zu Werke geht. Frankreich und Österreich hingegen befinden sich unter denjenigen Ländern, in denen hauptsächlich wegen der politischen Schwäche insbesondere der rechten Bourgeoisie die Renten bisher viel weniger unter Beschuss geraten waren. Deshalb werden in diesen Ländern die Erhöhung der Anzahl der bis zur Rente zu arbeitenden Jahre sowie die Rentenkürzungen viel bitterer wahrgenommen.
Die Verschärfung der Krise zwingt also die Bourgeoisie dazu, mit der Verzögerung des Rückzugs in den Ruhestand ein soziales Zückerchen zu streichen. Bisher liess gerade dieses Zückerchen die Arbeiter die bittere Pille der unerträglichen Ausbeutungsbedingungen der letzten Jahrzehnte schlucken und es maskierte auch das tatsächliche Ausmass der Arbeitslosigkeit.
Angesichts der in erschreckendem Ausmass zu Beginn der 70er-Jahre wieder auftauchenden Geissel reagierte die Bourgeoisie mit wohlfahrtsstaatlichen Massnahmen. Diese Massnahmen sind vom ökonomischen Standpunkt aus betrachtet ein Nonsens und bilden heute einen der Hauptgründe für die unermessliche öffentliche Verschuldung. Der gegenwärtige Abbau des Wohlfahrtsstaats öffnet der tiefgreifenden Frage nach der Zukunftsperspektive des Kapitalismus die Tür.
Nicht alle kapitalistischen Angriffe rufen dieselben Verteidigungsreaktionen der Arbeiterklasse hervor. Es ist viel leichter, gegen Lohnsenkungen oder die Verlängerung des Arbeitstags zu kämpfen als gegen die Verminderung des relativen Lohns, die das Resultat einer Zunahme der Arbeitsproduktivität (aufgrund der Technologieentwicklung) und also des Akkumulationsprozesses des Kapitals selbst ist. Diese Realität beschreibt Rosa Luxemburg in folgenden Worten: „Eine Lohnverringerung, die eine Herabsetzung der reellen Lebenshaltung der Arbeiter herbeiführt, ist ein sichtbares Attentat der Kapitalisten gegen die Arbeiter und wird von diesen (...) in der Regel mit sofortigem Kampf beantwortet, in günstigen Fällen auch abgewehrt. Hingegen das Sinken des relativen Lohns wird anscheinend ohne die geringste persönliche Teilnahme des Kapitalisten bewirkt, und dagegen haben die Arbeiter innerhalb des Lohnsystems, das heisst auf dem Boden der Warenproduktion, gar keine Möglichkeit des Kampfes und der Abwehr.“7
Der Anstieg der Arbeitslosigkeit stellt die Arbeiterklasse vor dieselben Schwierigkeiten wie die Intensivierung der Ausbeutung (Angriff auf den relativen Lohn). Wenn der kapitalistische Angriff der Arbeitslosigkeit die Jungen betrifft, die noch nie gearbeitet haben, enthält sie nicht die explosive Dimension wie bei Entlassungen, schlicht da gar niemand entlassen werden muss. Die Existenz einer höheren Arbeitslosigkeit jedoch stellt einen antreibenden Faktor der unmittelbaren Arbeiterkämpfe dar, weil sie für eine wachsende Anzahl von noch beschäftigen Arbeitern eine ständige Gefahr repräsentiert, aber auch weil dieses gesellschaftliche Phänomen Fragen hervorruft, deren Antwort nicht um die Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Wandels umhin kommt. Rosa Luxemburg fügt bezüglich des Kampfs gegen die relative Lohnsenkung hinzu: „Der Kampf gegen das Sinken des relativen Lohns bedeutet deshalb auch den Kampf gegen den Warencharakter der Arbeitskraft, das heisst gegen die kapitalistische Produktion im ganzen. Der Kampf gegen den Fall des relativen Lohns ist also nicht mehr ein Kampf auf dem Boden der Warenwirtschaft, sondern ein revolutionärer, umstürzlerischer Anlauf gegen den Bestand dieser Wirtschaft, er ist die sozialistische Bewegung des Proletariats.“
Die 1930er-Jahre zeigten, wie mit der Massenarbeitslosigkeit die absolute Verarmung explodiert. Wäre der Arbeiterklasse nicht im voraus eine Niederlage zugefügt worden, wäre das allgemeine, absolute Gesetz der Kapitalakkumulation Gefahr gelaufen, sich ins Gegenteil zu kehren: das Gesetz der Revolution. Die Arbeiterklasse hat ein historisches Gedächtnis, das mit der Vertiefung der Krise langsam aktiviert wird. Die Massenarbeitslosigkeit und die Lohnsenkungen wecken heute mit der allgemeinen Verunsicherung und der generalisierten Verarmung wieder die Erinnerung an die 30er-Jahre. Der Abbau des Wohlfahrtsstaates wird die marxistische Sichtweise bestätigen.
Wenn Rosa Luxemburg darauf hinweist, dass die Arbeiter auf dem Terrain der Produktion von Konsumgütern nicht die geringste Möglichkeit haben, sich gegen die relative Lohnsenkung zur Wehr zu setzen, so ist das weder Fatalismus noch Pseudoradikalismus, wie ihn die letzte Essener Tendenz der KAPD mit der Parole „die Revolution oder nichts“ vertreten hat, sondern die Erkenntnis, dass der Kampf nicht in den Grenzen der unmittelbaren Verteidigungskämpfe bleiben kann und mit einer weitest möglichen politischen Vision geführt werden muss. In den 80er-Jahren sind die Fragen der Arbeitslosigkeit und der Intensivierung der Ausbeutung bereits gestellt worden, jedoch oft auf eine eingeschränkte und lokale Weise. Die englischen Minenarbeiter achteten nur auf die Rettung ihrer Arbeitsplätze. Die heutige qualitative Vertiefung der Krise erlaubt, dass Fragen über die Arbeitslosigkeit, die Armut, die Ausbeutung in umfassender und auf politische Art gestellt werden. Das ist auch bei der Rente, der Gesundheit, der Versorgung von Arbeitslosen, den Lebensbedingungen, der Länge des Arbeitslebens und bei der Zukunft der kommenden Generationen der Fall. In noch sehr embryonaler Form ist das in den letzten Kämpfen gegen die Angriffe auf das Rentenwesen identifizierte Potential vorhanden. Diese langfristige Lehre ist am wichtigsten. Sie ist von grösserer Tragweite als der Rhythmus, mit dem die unmittelbare Kampfbereitschaft nun wieder hergestellt wird. Rosa Luxemburg erläutert, dass die direkte Konfrontation mit den zerstörerischen Auswirkungen der objektiven Mechanismen des Kapitalismus (Massenarbeitslosigkeit, Intensivierung der relativen Ausbeutung) die Auslösung von Kämpfen zunehmend erschwert. Deshalb werden sie auf der Ebene der Politisierung auch bedeutsamer, selbst bei einem langsameren Rhythmus und mühsameren Verlauf.
Die Schemata der Vergangenheit überwinden
Mit der Vertiefung der Krise kann es sich das Kapital nicht mehr leisten, bedeutende materielle Zugeständnisse zu machen um damit das Ansehen der Gewerkschaften aufzupolieren, wie dies 1995 in Frankreich noch der Fall war.8 Trotz der gegenwärtigen Illusionen der Arbeiter sind die Möglichkeiten der Bourgeoisie, die keimende Kampfbereitschaft für gross angelegte Manöver zu missbrauchen, eingeschränkt. Diese Grenzen zeigen sich daran, dass die Gewerkschaften gezwungen sind, allmählich wieder ihre Rolle als Saboteure der Kämpfe zu übernehmen: „Heute wird wieder auf das in der Geschichte des Klassenkampfes eher klassische Schema zurückgegriffen: Die Regierung schlägt hart zu, die Gewerkschaften widersetzen sich und predigen zunächst die Gewerkschaftseinheit, um die Arbeiter massenhaft hinter sich zu scharen und unter gewerkschaftlicher Kontrolle einzupacken. Dann eröffnet die Regierung Verhandlungen, und die Gewerkschaften geben die Einheit auf, um besser die Spaltung und Verwirrung in die Reihen der Arbeiter hinein zu tragen. Diese Methode, die auf der gewerkschaftlichen Spaltung gegenüber dem Anstieg des Klassenkampfs aufbaut, ist für die Bourgeoisie die bewährteste, um allgemein den gewerkschaftlichen Rahmen zu halten, wobei der Verlust des Ansehens soweit wie möglich auf den einen oder anderen bereits im voraus bestimmten Gewerkschaftsapparat konzentriert wird, der einige Federn lassen muss. Dies bedeutet aber, dass die Gewerkschaften heute wieder der Feuerprobe unterworfen werden und dass die unweigerliche Entwicklung der kommenden Kämpfe für die Arbeiterklasse erneut das Problem der Auseinandersetzung mit ihren Feinden stellen wird, in der sie ihre Klasseninteressen verteidigen und die Erfordernisse des Kampfes erkennen muss.“9
Auch wenn die Bourgeoisie heute bei der Durchführung von gross angelegten Manövern gegenüber der Arbeiterklasse noch kaum beunruhigt ist, so wird die Verschlimmerung der wirtschaftlichen Lage dazu tendieren, dass immer häufiger spontane, punktuelle, isolierte Konfrontationen zwischen Arbeitern und Gewerkschaften stattfinden.
Die Wiederholung des klassischen Schemas der Konfrontation mit der gewerkschaftlichen Sabotage, die nun wieder auf die Tagesordnung kommt, begünstigt so die Möglichkeit für die Arbeiter, sich auf die Lehren der Vergangenheit zu beziehen.
Das sollte uns aber nicht zu einer schematischen Haltung verleiten, die für das Verständnis der zukünftigen Kämpfe und die Intervention in ihnen einfach auf den Rahmen und die Kriterien der 1980er-Jahre abstellt. Die gegenwärtigen Kämpfe sind diejenigen einer Klasse, die erst wieder zu ihrer ganz elementaren Klassenidentität zurückfinden muss. Die Schwierigkeit zu verstehen, dass man zu einer gesellschaftlichen Klasse gehört, und die fehlende Erkenntnis darüber, dass man einem Klassenfeind gegenübersteht, sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Auch wenn die Arbeiter noch ein Grundgefühl für die Notwendigkeit der Solidarität haben (da dies zu den proletarischen Daseinsbedingungen gehört), müssen sie wieder einen Begriff dafür gewinnen, was die Klassensolidarität wirklich ist.
Um die Rentenreform umzusetzen, musste die Bourgeoisie nicht auf die gewerkschaftliche Sabotage der Ausweitung der Bewegung zurückgreifen. Der Kern ihrer Strategie bestand darin, dass die Lehrer als Hauptziel spezifische Forderungen aufstellten. Zu diesem Zweck sollte dieser Sektor, der bereits durch frühere Angriffe arg betroffen war, nicht nur den allgemeinen Angriff auf die Renten über sich ergehen lassen, sondern darüber hinaus einen zusätzlichen besonderen, nämlich den Plan der Dezentralisierung des nicht unterrichtenden Personals, auf welchen der Sektor in der Tat die Mobilisierung ganz konzentrierte. Zentrale Forderungen für sich zu beanspruchen, die den Kampf zur Niederlage verurteilen, ist immer das Merkmal einer wesentlichen Schwäche der Arbeiterklasse, die sie noch überwinden muss, um bedeutend voranzukommen. Ein Beispiel, das diese Notwendigkeit veranschaulicht, ist dasjenige der Kämpfe von 1980 in Polen, wo die Illusionen bei den Arbeitern über die westliche Demokratie es ermöglichten, dass die Forderung nach „freien Gewerkschaften“ schliesslich zuoberst auf der Forderungsliste stand, die der Regierung vorgelegt wurde, was das Tor zur Niederlage und zur Unterdrückung der Bewegung aufstiess.
In den Kämpfen in Frankreich im Frühjahr 2003 führten der Verlust der Klassenidentität und des Begriffs der Arbeitersolidartität dazu, dass die Lehrer schliesslich akzeptierten, dass ihre besonderen Forderungen vor die allgemeine Frage der Angriffe auf die Renten gestellt wurden. Die Revolutionäre dürfen nicht davor zurückschrecken, diese Schwäche der Klasse einzugestehen und ihre Intervention danach auszurichten.
Der Klassenkampfbericht des 15. Kongresses legt besonderes Gewicht auf das Wiedererstarken der Kampfbereitschaft, das es dem Proletariat erst erlauben wird voran zu kommen. Doch hat dies nichts mit einer operaistischen Anbetung der Kampfbereitschaft als solcher zu tun. In den 30er-Jahren gelang es der Bourgeoisie, die Kampfbereitschaft der Arbeiter auf den Weg der Kriegsvorbereitung zu lenken. Die Wichtigkeit der heutigen Kämpfe besteht darin, dass sie den Ort der Bewusstseinsentwicklung in der Arbeiterklasse darstellen können. Auch wenn es unmittelbar lediglich und bescheiden um die Wiedererlangung der Klassenidentität durch das Proletariat geht, so ist dies doch der Knackpunkt für die Wiederbelebung des kollektiven und historischen Gedächtnisses des Proletariats und für die Entfaltung der Klassensolidarität. Diese ist die einzige Alternative zur wahnsinnigen bürgerlichen Konkurrenzlogik, wo jeder gegen jeden kämpft.
Die Bourgeoisie ihrerseits macht sich keine Illusionen darüber, dass diese Frage nebensächlich wäre. Bis heute hat sie alles daran gesetzt zu verhindern, dass eine Bewegung losbricht, die den Arbeitern ihre Zugehörigkeit zu einer und derselben Klasse in Erinnerung rufen könnte. Die Lehre aus 2003 ist, dass sich mit der Zuspitzung der Krise der Arbeiterkampf unweigerlich entwickeln wird. Es ist nicht so sehr die Kampfbereitschaft als solche, die die herrschende Klasse beunruhigt, sondern vielmehr die Gefahr, dass die Auseinandersetzungen das Bewusstsein der Arbeiterklasse nähren. Die Bourgeoisie ist heute in dieser Frage nicht weniger, sondern mehr in Sorge als in der Vergangenheit, und zwar weil die Krise heute tiefer und globaler ist. Ihre Hauptsorge besteht darin, dass immer dann, wenn die Kämpfe nicht vermieden werden können, wenigstens deren positiven Auswirkungen auf das Selbstvertrauen, auf die Solidarität und das Nachdenken in der Arbeiterklasse in Grenzen gehalten werden, d.h. dafür zu sorgen, dass aus dem Kampf die falschen Lehren gezogen werden. In den 80er-Jahren hat die IKS gelernt, in den damaligen Kämpfen in jedem Einzelfall das Hindernis für den Fortschritt der Bewegung zu erkennen und die Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften und den Linken auf den Punkt zu bringen. Oft war es die Frage der Ausweitung der Kämpfe. Konkrete Vorstösse in den Vollversammlungen, mit denen wir dazu aufriefen, zu den anderen Arbeitern zu gehen, stellten den Sprengstoff dar, mit dem wir den Boden für das allgemeine Voranschreiten der Bewegung ebneten. Die wichtigsten Fragen heute – was ist der Klassenkampf, was sind seine Ziele, seine Methoden, wer sind die Gegner, welches sind die zu überwindenden Hindernisse? – scheinen die Antithese der Fragen der 80er-Jahre zu sein. Sie scheinen „abstrakter“ zu sein, da sie unmittelbar weniger umsetzbar sind, eine Rückkehr zum Ausgangspunkt der Ursprünge der Arbeiterbewegung darstellen. Die heutigen Fragen anzugehen erfordert mehr Geduld, eine langfristige Sicht, tiefere politische und theoretische Fähigkeiten für die Intervention. Eigentlich sind die gegenwärtig wesentlichen Fragen nicht abstrakter, sondern schlicht globaler. Es ist weder abstrakt noch rückständig, in einer Vollversammlung zur Frage der Forderungen der Bewegung zu intervenieren oder die Gewerkschaften dabei zu entlarven, wie sie jede wirkliche Perspektive einer Ausweitung verhindern. Der allgemeine Charakter dieser Fragen weist den weiteren Weg. Vor 1989 scheiterte das Proletariat genau deshalb, weil es die Frage des Klassenkampfes zu eng stellte. Und weil das Proletariat in der zweiten Hälfte der 90er-Jahre in der Gestalt von Minderheiten das Bedürfnis nach einer globaleren Sichtweise zu spüren begonnen hat, hat umgekehrt die Bourgeoisie, die sich der potentiellen Gefahr bewusst ist, die Antiglobalisierungbewegung geschaffen, um den auftauchenden Fragen eine falsche Antwort zu liefern.
Darüber hinaus sind die linken Teile des Kapitals, insbesondere die Linksextremen, zu Meistern in der Kunst geworden, die Auswirkungen des Zerfalls der Gesellschaft gegen die Arbeiterkämpfe einzusetzen. Während die Wirtschaftskrise eine tendenziell allgemeine Infragestellung des Systems begünstigt, hat der Zerfall gerade die gegenteilige Wirkung. Während der Bewegung in Frankreich im Frühjahr 2003 und beim Metallarbeiterstreik in Deutschland sahen wir, wie die Gewerkschaftsaktivisten im Namen der „Ausweitung“ oder der „Solidarität“ die Mentalität kultivierten, die Minderheiten von Arbeitern beseelt, wenn sie anderen Arbeitern den Kampf aufzuzwingen versuchen und ihnen dabei die Verantwortung für eine Niederlage der Bewegung zuschieben, wenn sie sich weigern, in die Aktionen einbezogen zu werden.
Während der Märzaktion 1921 in Deutschland waren die tragischen Szenen, die sich vor den Fabriken abspielten, als die Arbeitslosen versuchten, die Arbeiter davon abzuhalten, die Arbeit wieder aufzunehmen, ein Ausdruck der Verzweiflung angesichts des Abebbens der revolutionären Welle. Die Aufrufe der französischen Linksextremen im letzten Frühjahr, die Schüler von den Abschlussprüfungen abzuhalten, das Theater der westdeutschen Gewerkschafter, die die ostdeutschen Metallarbeiter – die keinen langen Streik für die 35-Stunden-Woche machen wollten – an der Wiederaufnahme der Arbeit hindern wollten, sind gefährliche Angriffe gegen den eigentlichen Begriff der Arbeiterklasse und der Solidarität. Sie sind umso gefährlicher, als sie die Ungeduld, den Unmittelbarkeitswahn und den sinnlosen Aktivismus fördern, welche Erscheinungen ohnehin charakteristisch für den Zerfall sind. Wir sind vorgewarnt: Obwohl die kommenden Kämpfe zwar ein Ort der Bewusstseinsentwicklung sind, unternimmt die Bourgeoisie alles, um sie in einen Friedhof des proletarischen Nachdenkens zu verwandeln.
Hier sehen wir für die kommunistische Intervention wertvolle Aufgaben: „geduldig erklären“ (Lenin), weshalb die Solidarität nicht verordnet werden kann, sondern ein gegenseitiges Vertrauen zwischen den verschiedenen Teilen der Klasse voraussetzt; erklären, warum die Linke, im Namen der Arbeitereinheit, alles unternimmt, um diese Einheit zu zerstören.
Die Grundlage unseres Vertrauens in die Arbeiterklasse
Alle Teile des proletarischen politischen Milieus anerkennen die Bedeutung der Krise bei der Entwicklung der Kampfbereitschaft der Arbeiter. Aber die IKS ist unter den gegenwärtig existierenden Strömungen die einzige, die davon ausgeht, dass die Krise das Klassenbewusstsein der grossen Massen anregt. Die anderen Gruppen beschränken in ihrer Analyse die Rolle der Krise auf den Umstand, dass sie die Arbeiter rein physisch zum Kampf drängt. Für die Rätisten zwingt die Krise die Klasse mehr oder weniger mechanisch zur Revolution. Für die Bordigisten bringt das Erwachen des „Klasseninstinkts“ den Inhaber der Klassenbewusstseins, d.h. die Partei, an die Macht. Für das IBPR kommt das Klassenbewusstsein von aussen, von der Partei. Unter den suchenden Gruppen, meinen die Autonomen (die sich insofern auf den Marxismus berufen, als sie die Notwendigkeit der Autonomie des Proletariats gegenüber den anderen Klassen betonen) und die Operaisten, dass die Revolution das Ergebnis der Arbeiterrevolte und eines individuellen Wunsches nach einem besseren Leben sei. Diese falschen Auffassungen wurden durch die Unfähigkeit der jeweiligen Gruppen verstärkt zu verstehen, dass das Scheitern einer proletarischen Antwort auf die Krise von 1929 eine Folge der vorangegangenen Niederlage der weltweiten revolutionären Welle war. Eine Konsequenz dieses mangelnden Verständnisses ist die immer noch kursierende Idee, wonach der imperialistische Krieg für die Revolution die günstigeren Voraussetzungen schaffe als die Krise (vgl. dazu unseren Artikel „Warum die Alternative Krieg oder Revolution“ in: Revue Internationale, Nr. 30).
Demgegenüber stellt der Marxismus die Frage, wie folgt: „Die wissenschaftliche Begründung des Sozialismus stützt sich nämlich bekanntermassen auf drei Ergebnisse der kapitalistischen Entwicklung: vor allem auf die wachsende Anarchie der kapitalistischen Wirtschaft, die ihren Untergang zu einem unvermeidlichem Ergebnis macht, zweitens auf die fortschreitende Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, die die positiven Ansätze der künftigen sozialen Ordnung schafft, und drittens auf die wachsende Machte und Klassenerkenntnis des Proletariats, das den aktiven Faktor der bevorstehenden Umwälzung bildet.“10
Rosa Luxemburg unterstrich das Verhältnis zwischen diesen drei Gesichtspunkten und der Rolle der Krise und schrieb dazu: „Die Sozialdemokratie leitet ihr Endziel ebenso wenig von der siegreichen Gewalt der Minderheit wie von dem zahlenmässigen Übergewicht der Mehrheit, sondern von der ökonomischen Notwendigkeit und der Einsicht in diese Notwendigkeit ab, die zur Aufhebung des Kapitalismus durch die Volksmasse führt und die sich vor allen in der kapitalistischen Anarchie äussert.“11
Während der Reformismus (und heutzutage die Linke des Kapitals) Verbesserungen dank der staatlichen Intervention und Gesetzen, die die Arbeiter schützen würden, verspricht, enthüllt die Krise, „dass das Lohnsystem nicht ein Rechtsverhältnis, sondern ein rein ökonomisches ist“.12
Unter den Angriffen, denen die Klasse ausgesetzt ist, beginnt sie das wahre Wesen des Kapitalismus zu verstehen. Dieser marxistische Standpunkt bestreitet überhaupt nicht die Wichtigkeit der Rolle der Revolutionäre und der Theorie für diesen Prozess. Die Arbeiter werden die Bestätigung und die Erklärung für ihre eigenen Erfahrungen in der marxistischen Theorie finden.
Oktober 2003
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Zerfall [81]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Wirtschaftskrise - Die Krise ist ein Ausdruck der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise
- 2314 Aufrufe
Die Krise ist ein Ausdruck der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise
Seit nunmehr über zweieinhalb Jahren kündigt die Bourgeoisie den Aufschwung an und nach jedem Quartal sieht sie sich gezwungen, seinen Beginn wieder zu verschieben. Seit ebenfalls mehr als zweieinhalb Jahren liegen die Ergebnis der Wirtschaftsentwicklung systematisch unter den Vorhersagen, was die herrschende Klasse dazu zwingt, sie ständig nach unten zu revidieren. Die gegenwärtige Rezession hat im zweiten Halbjahr 2000 begonnen und ist somit bereits eine der längsten seit dem Ende der 60er-Jahre. Und auch wenn sich jenseits des Atlantiks erste Anzeichen eines Aufschwungs zeigen, so sind Europa und Japan noch weit davon entfernt. Man Muss auch darauf hinweisen, dass der Aufwärtstrend in den USA hauptsächlich das Produkt eines in den vergangenen 40 Jahren beispiellosen staatlichen Interventionismus und einer Flucht nach vorn in Form einer massiven Verschuldung ist. Bereits machen sich Ängste über eine neue spekulative Blase, diesmal im Immobiliensektor, breit.
Was den auf eine Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten abzielenden staatlichen Interventionismus anbetrifft, so Muss man feststellen, dass die amerikanische Regierung das Budgetdefizit unkontrolliert ansteigen lässt. Im Jahr 2001 schloss der Haushalt mit 130 Milliarden Dollar noch positiv, während das Defizit 2003 gemäss Schätzungen bereits 300 Milliarden (3,6% des BSP) erreichen wird. Heute beunruhigen das Ausmass dieses Defizits sowie die Aussicht des weiteren Anstiegs angesichts des Irakkonflikts und der sinkenden Steuereinnahmen die politische Klasse und die Geschäftskreise in den USA mehr und mehr.
Die drastische Reduktion der Zinsraten durch die Zentralbank hat nicht nur die Unterstützung der wirtschaftlichen Aktivitäten zum Ziel, sondern hauptsächlich die Aufrechterhaltung der Nachfrage der Haushalte durch neue Verhandlungen über ihre Hypothekarschulden. Das abnehmende Gewicht der Zahlungen für Hypothekarkredite erlaubte somit eine Steigerung der von den Banken gewährten Verschuldung. Die Hypothekarschuld der amerikanischen Haushalte ist auf diese Weise auf 700 Milliarden Dollar (mehr als das Zweifache der öffentlichen Verschuldung!) angestiegen. Die Zunahme der gesamten amerikanischen Verschuldung, also des Staates, der Haushalte und Unternehmen erklärt, weshalb die USA schneller als andere Länder wieder auf Wachstumskurs gekommen sind. Allerdings kann er nur gehalten werden, wenn ihre wirtschaftliche Aktivität mittelfristig weiter unterstützt wird, sonst geht es ihnen wie Japan vor mehr als 10 Jahren, als eine spekulative Blase im Immobiliensektor platzte und Rechnungen angesichts vieler ungedeckter Schulden nicht mehr beglichen werden konnten.
Europa wird sich einen solchen Luxus kaum leisten können, denn seine Defizite sind bereits beim Eintritt der Rezession eindrücklich gewesen und diese hat sie nur noch vergrössert. So sind Deutschland und Frankreich, die zusammen das ökonomische Herz Europas bilden, mit einer öffentlichen Verschuldung von 3,8% beziehungsweise 4% des BIP die schlechtesten Schüler der Klasse. Sie befinden sich weit über der im Vertrag von Maastricht fixierten Schwelle (3%) und laufen somit Gefahr, von den Blitzen der europäischen Kommission getroffen, sprich mit den dafür vorgesehenen Bussen bestraft zu werden. Somit sind die Möglichkeiten Europas, eine konsequente Ankurbelungspolitik zu betreiben, eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die USA mit der Abwertung des Dollars gegenüber dem Euro zur Reduktion des Handelsdefizits Europa im Weg stehen, das mehr und mehr Probleme hat, einen Exportüberschuss zu erzielen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die zentralen Länder Europas wie Deutschland, Frankreich, Holland und Italien in einer Rezession befinden und die anderen nicht weit davon entfernt sind.
Diejenigen, die beim Fall der Berliner Mauer noch den Reden der Bourgeoisie über den Beginn eines neuen Wachstumszeitalters und die Öffnung des osteuropäischen Marktes geglaubt hatten, sind bereits eines Besseren belehrt worden. Die Wiedervereinigung Deutschlands stellt in keiner Art und Weise ein Sprungbrett zur deutschen Herrschaft dar, sondern eher eine schwere Last für das Land. Deutschland war einmal die Lokomotive Europas, aber seit der Wiedervereinigung ist es lediglich noch der letzte Wagen, der kaum mehr in der Lage ist, dem Rhythmus des Zuges zu folgen. Die Inflation ist niedrig und kippt beinahe in eine Deflation, die hohen realen Zinsraten zähmen die Aktivitäten noch mehr, und die Existenz des Euro unterbindet von nun an eine Politik der kompetitiven Abwertung der nationalen Währung. Die Arbeitslosigkeit, die Lohnbescheidenheit und die Rezession führen zu einer Stagnation des inneren Marktes, wie sie in vorangegangen Konjunkturabkühlungen in diesem Land noch nie beobachtet worden ist. Weiter wird auch die zukünftige Integration der osteuropäischen Länder schwer auf der Konjunktur lasten.
All das führt unausweichlich zu einem drastischen Anstieg der Angriffe gegen die Arbeitsbedingungen und das Lebensniveau der Arbeiterklasse. Austeritätsmassnahmen, Massenentlassungen und beispiellose Verschärfungen der Ausbeutung der Arbeit stehen auf den Tagesordnungen der Bourgeoisie überall in der Welt. Gemäss den stark untertriebenen offiziellen Statistiken wird die Arbeitslosigkeit in Deutschland bald 5 Millionen betragen und Ende des Jahres 6,1% in den USA sowie 10% in Frankreich. In Europa gibt die französisch-deutsche Achse mit dem Raffarin-Plan und Schröders Agenda 2010 den Ton der Politik an, die überall eingeleitet wird: Zurückfahren des Budgetdefizits, Verminderung der Steuern für hohe Einkünfte, Lockerung der Kündigungsbestimmungen, Reduktion der Arbeitslosenentschädigung und verschiedener Zuschüsse, Verminderung der Rückzahlungen für Pflegekosten und Erhöhung des Rentenalters. Die bereits Pensionierten müssen heute insbesondere die Kosten der Austeritätsmassnahmen tragen, womit definitiv die Idee einer wohlverdienten Ruhe nach dem Arbeitsleben zerschlagen wird. In den USA beobachtet man seit dem Zusammenbruch von Pensionskassen oder deren hohen Verlusten seit dem Börsenkrach eine massive Rückkehr von bereits Pensionierten auf den Arbeitsmarkt. Sie stehen unter dem Zwang zu arbeiten, um zu überleben. Die Arbeiterklasse steht also vor einer umfangreichen Austeritätsoffensive, die übrigens auf ökonomischer Ebene die Rezession nur verlängern und weitere Angriffe nach sich ziehen wird.
Die Krise enthüllt, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse überholt sind
Der ununterbrochene Niedergang der Wachstumsraten seit dem Ende der 60er-Jahre1 entlarvt die durch die Bourgeoisie geschickt während der ganzen 90er-Jahre aufrechterhaltene Lüge über die dank der New Economy, der Globalisierung sowie der neoliberalen Rezepte angeblich wiedergefundene wirtschaftliche Prosperität des Kapitalismus. Die Krise hat denn auch nichts mit der Wirtschaftspolitik zu tun: Wenn sich die keynesianischen Rezepte der 50er- und 60er-Jahre, später die neokeynesianischen der 70er-Jahre erschöpft haben und wenn die neoliberalen Rezepte der 80er- und 90er-Jahre nichts haben lösen können, so ist das darauf zurück zu führen, dass die globale Krise nicht die Folge einer falschen Wirtschaftspolitik ist, sondern einfach die Grundwidersprüche der kapitalistischen Mechanismen offenbart. Wenn die Krise nichts mit der Wirtschaftspolitik zu tun hat, so erst recht nicht mit der Ausrichtung der Regierung. Ob es nun eine linke oder rechte Regierung ist, sie alle haben der Reihe nach alle verfügbaren Rezepte ausprobiert. So sind die gegenwärtigen Regierungen der USA und Englands, die als die glühendsten Vertreter des Neoliberalismus und der Globalisierung gelten, von entgegengesetzter politischer Ausrichtung und wenden heute die weitreichendsten neokeynesianischen Rezepte an, indem sie die öffentlichen Defizite zügellos ansteigen lassen. Wenn man die Austeritätsprogramme der rot-grünen Regierung Schröder und der rechtsliberalen Regierung Raffarin unter die Lupe nimmt, so Muss man feststellen, dass sie sich gleichen wie ein Tropfen dem anderen, dass sie die gleichen Massnahmen anwenden.
Angesichts der sich seit 35 Jahren drehenden Krisenspirale und der ununterbrochenen Austeritätsmassnahmen besteht eine der wesentlichen Verantwortungen der Revolutionäre darin aufzuzeigen, dass die Wurzeln in der historischen Sackgasse des Kapitalismus liegen und dass die im Zentrum der kapitalistischen Produktionsverhältnisses liegende Lohnarbeit2 überholt ist. Tatsächlich vereint die Lohnarbeit gleichzeitig all die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Beschränktheiten der kapitalistischen Produktion des Profits sowie die Hindernisse bei der vollständigen Realisierung des letzteren.3 Die Verallgemeinerung der Lohnarbeit lag der Expansion des Kapitalismus im 19. Jahrhundert zugrunde; seit dem Ersten Weltkrieg ist sie die Grundlage der relativen Beschränktheit des zahlungsfähigen Marktes gemessen an den Notwendigkeiten der Akkumulation. Es liegt in der Verantwortung der Revolutionäre, gegen all die mystifizierenden, also falschen Erklärungen für die Krise anzutreten, die Sackgasse aufzuzeigen: Der Kapitalismus war eine notwendige und fortschrittliche Produktionsweise, die heute historisch überholt ist und die Menschheit ins Verderben führt. Wie bei all den dekadenten Phasen der vergangenen antiken und feudalen Produktionsweisen liegt die Sackgasse im Umstand begründet, dass die grundlegenden gesellschaftlichen Produktionsverhältnisses zu eng geworden sind und keine weitere Entwicklung der Produktivkräfte im bisherigen Ausmass erlauben.4 In der heutigen Gesellschaft stellt die Lohnarbeit diese Bremse für die volle Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dar. Einzig die Aufhebung dieser sozialen Verhältnisse und die Einführung des Kommunismus werden der Menschheit die Befreiung von diesen Widersprüchen bringen.
Seit dem Fall der Berliner Mauer führt die Bourgeoisie unaufhörlich Kampagnen über die „Unmöglichkeit des Kommunismus“, „die Utopie der Revolution“ und die „Auflösung der Arbeiterklasse“ in einer Masse von Bürgern, deren einzige legitime Handlungsweise die „demokratische“ Reform eines Kapitalismus sei, der als der unüberwindbare Horizont der Menschheit dargestellt wird. Im Rahmen dieses ideologischen Angriffs kommt den Globalisierungsgegnern das Protestmonopol zu. Die Bourgeoisie gibt sich alle Mühe, ihnen eine erstrangige Stellung als privilegierte Gesprächspartner und Kritiker zu geben: In den Medien wird den Analysen und Aktionen dieser Strömung viel Platz eingeräumt. Ihre hervorragendsten Vertreter erhalten gelegentlich Einladungen an Gipfeltreffen oder an andere offizielle Veranstaltungen. Der Grund liegt darin, dass sich die ideologischen Versatzstücke der Globalisierungsgegner mit der Kampagne der Bourgeoisie über die „Utopie des Kommunismus“ ideal ergänzen, da sie von den gleichen Voraussetzungen ausgehen: Der Kapitalismus sei das einzig mögliche System und seine Reform somit die einzige Alternative. Diese Bewegung mit der ATTAC an der Spitze und ihren Wirtschaftsexperten vertritt die Auffassung, dass der Kapitalismus so human gestaltet werden könne, dass der „gute und regulierte Kapitalismus“ den „schlechten Finanzkapitalismus“ ersetzen werde. Die Krise sei die Konsequenz der neoliberalen Deregulierung und der Politik des Finanzkapitalismus, der seine Diktatur der 15% zwingendem Ertrag über den Industriekapitalismus errichtet habe. Dies sei anscheinend alles an einer obskuren Versammlung 1979 im sogenannten „Washingtoner Konsens“ entschieden worden. Die Austerität, die finanzielle Instabilität, die Rezessionen usw. seien nichts anderes als die Konsequenz dieses neuen Kräfteverhältnisses, das sich innerhalb der Bourgeoisie zugunsten des Wucherkapitals herausgebildet habe. Daher auch die Forderung nach „Regulierung der Finanzen“, der „Zurückdrängung“ und „Umleitung der Investitionen in die produktive Sphäre“ usw.
In diesem Umfeld allgemeiner Verwirrung über die Ursprünge und Gründe der Krise ist es an den Revolutionären, die Grundlagen für ein klares Verständnis herzustellen und vor allem zu zeigen, dass sie das Produkt des historischen Bankrotts des Kapitalismus ist. Mit anderen Worten haben sie die Aufgabe nachzuweisen, dass der Marxismus auch und gerade auf diesem Gebiet immer noch gültig ist. Leider Muss man aber feststellen, dass die Krisenanalysen der Gruppen des proletarischen Milieus wie des PCInt - Programme Communiste oder des IBRP weit davon entfernt sind, dieser Aufgabe gerecht zu werden und sich von der Ideologie der Globalisierungsgegner abzugrenzen. Gewiss gehören diese beiden Gruppen unbestreitbar zum proletarischen Milieu und unterscheiden sich grundlegend von der Antiglobalisierungsbewegung durch ihre Denunzierung der reformistischen Illusionen und durch die Verteidigung der Perspektive einer kommunistischen Revolution. Ihre eigene Analyse der Krise ist indessen zu weiten Teilen dieser Bewegung abgekupfert.
Einige ausgewählte Beispiele: „Die aus der Spekulation hervorgehenden Gewinne sind so wichtig, dass sie nicht nur für die ,klassischen‘ Unternehmen attraktiv sind, sondern auch für viele andere. Wir erwähnen hier die Versicherungen oder die Pensionsfonds, bei denen Enron ein exzellentes Beispiel darstellt ... Die Spekulation ist ein komplementäres, um nicht zu sagen das hauptsächliche Element der Bourgeoisie, sich den Mehrwert anzueignen ... Es hat sich die Regel eingebürgert, dass der Ertrag von Investitionen in Unternehmen im Minimum 15% betragen Muss. Um bei den Aktien eine solche Wachstumsrate zu erreichen oder zu übertreffen, musste die Bourgeoisie die Ausbeutungsbedingungen der Arbeiterklasse verschärfen: Der Arbeitsrhythmus ist intensiviert, die Reallöhne sind gesenkt worden. Massenentlassungen haben Hunderttausende von Arbeitern betroffen“ (IBRP, in: Bilan et Perspectives, Nr. 4, S. 6). Man kann bereits feststellen, dass es eine seltsame Art der Problemstellung für eine Gruppe ist, die sich als „materialistisch“ versteht und die selbst die IKS als „idealistisch“ auffasst. „Eine Regel hat sich eingebürgert“, sagt uns das IBRP. Hat sie sich von ganz alleine eingebürgert? Wir wollen dem IBRP keine solche Idee unterstellen. Es ist eine Klasse, eine Regierung oder eine gegebene menschliche Organisation, die eine solche Regel aufgestellt hat, aber warum? Weil etwa gewisse Mächtige dieser Erde plötzlich gieriger und böser geworden sind, als dies normalerweise der Fall ist? Weil die „Bösen“ den Sieg über die „Guten“ (oder die „weniger Bösen“) davon getragen haben. Oder ganz einfach, wie es die Auffassung des Marxismus ist, weil die objektiven Bedingungen der Weltwirtschaft die herrschende Klasse dazu gezwungen hat, die Ausbeutung der Arbeiter zu verschärfen. Leider wird in der zitierten Passage das Problem nicht von dieser Seite angegangen.
Weiter, und das ist noch schlimmer, könnte man solche Stellen in irgendwelchem Heftchen der Antiglobalisierungsbewegung finden: Die Finanzspekulation sei zur Hauptquelle des kapitalistischen Profits geworden; die Finanzspekulation habe den Unternehmen ihre Regel von den 15% aufgezwungen; die Finanzspekulation sei verantwortlich für die verschärfte Ausbeutung, die Massenentlassungen und die Lohnsenkungen und schliesslich sei es die Finanzspekulation, die am Ursprung des Deindustrialisierungsprozesses und der Misere auf dem gesamten Planeten stehen würde. „Die Akkumulation der finanziellen und spekulativen Profite nährt den Prozess der Deindustrialisierung und zieht Arbeitslosigkeit und Elend auf dem gesamten Planeten nach sich“ (ebd., S. 7).
Was den PCInt – Programme Communiste anbelangt, so steht es mit dieser Organisation kaum besser, auch wenn sie sich weit allgemeiner hält und sich mit der Autorität Lenins schmückt:
„Das Finanzkapital, die Banken werden aufgrund der kapitalistischen Entwicklung die wirklichen Akteure der Zentralisierung des Kapitals, was zu einer Zunahme der Macht der gigantischen Monopole führt. Im imperialistischen Stadium des Kapitalismus beherrscht das Finanzkapital die Märkte, die Unternehmen, die ganze Gesellschaft, und diese Herrschaft führt wiederum zur finanziellen Konzentration bis zu dem Punkt, an dem ,das Finanzkapital, das in wenigen Händen konzentriert ist und faktisch eine Monopolstellung einnimmt, ziehtkolossale und stets zunehmende Profite aus Gründungen, aus dem Emissionsgeschäft, aus Staatsanleihen usw. , verankert die Herrschaft der Finanzoligarchie und legt der gesamten Gesellschaft einen Tribut zugunsten der Monopolisten auf‘5. Der Kapitalismus entwickelt sich aus dem kleinen Wucherkapital und beendet seine Evolution in der Form eines gigantischen Wucherkapitals“ (Programme Communiste, Nr. 98, S. 1, eigene Übersetzung). Hier haben wir also ein weiteres Beispiel einer Denunzierung des parasitären Finanzkapitals, das auch den radikalsten Globalisierungsgegnern gefallen könnte.6
Man sucht in diesen Textausschnitten vergeblich nach irgendeinem Beweis, dass der Kapitalismus als Produktionsweise überholt sei, dass es der Kapitalismus als Gesamtheit sei, der verantwortlich für die Krisen, die Kriege und das Elend auf der Welt sei. Man sucht vergeblich nach einer Verurteilung der Hauptidee der Globalisierungsgegner, gemäss der das Finanzkapital schuld an der Krise sei, während es eben tatsächlich der Kapitalismus als System ist. Diese beiden Gruppen der Kommunistischen Linken lassen mit der Übernahme einer ganzen Reihe von Argumenten der Globalisierungsgegner die Türe weit offen für die opportunistischen Theorien der linken Analysen. Sie stellen die Krise als Folge der Errichtung eines neuen Kräfteverhältnisses innerhalb der Bourgeoisie zwischen der Finanzoligarchie und dem industriellen Kapital dar. Die Finanzoligopole hätten sich mit der Entscheidung von Washington zur brüsken Erhöhung der Zinsraten über das Unternehmenskapital gestellt.
In Wirklichkeit gab es nie einen Triumph der Banken über die Industriellen, die Bourgeoisie als Gesamtheit ist in ihrer Offensive gegen die Arbeiterklasse zu einer höheren Geschwindigkeit übergegangen.
Die Finanzprofite als Basis eines Wucherkapitalismus?
Die Verurteilung der Entwicklung der Finanzsphäre ist heute ein allen kritischen Ökonomen gemeinsames Thema. Die zurzeit modische Erklärung dieser ,Kritiker des Kapitalismus‘ lautet, dass die Profitrate tatsächlich angestiegen sei, aber dass sich die Finanzoligarchie den Profit angeeignet hätte, sodass die industrielle Profitrate sich nicht bedeutend erhöht hätte. Dies erklärt auch, weshalb die Wirtschaft nicht wieder in Schwung gekommen sei (siehe Grafik). Richtig ist, dass seit Anfang der 80er-Jahre in der Folge des Entscheids von 1979 zur Erhöhung der Zinsraten ein beträchtlicher Teil des Mehrwerts nicht mehr in der Selbstfinanzierung der Unternehmen akkumuliert, sondern in Form von Finanzerträgen verteilt worden ist. Die vorherrschende Antwort auf diese Feststellung lautet, dass das Wachstum der Finanzsphäre eine Folge der Umlenkung des globalen Profits sei, was wiederum die produktive Investition behindern würde. Die Schwäche des Wirtschaftswachstums würde sich so also aus dem Parasitismus der Finanzsphäre ergeben. Daraus leiten sich auch die pseudo-marxistischen ,Erklärungen‘, die sich auf Lenin stützen, ab: „Das Finanzkapital, das in wenigen Händen konzentriert ist und faktisch eine Monopolstellung einnimmt, zieht kolossale und stets zunehmende Profite aus Gründungen, aus dem Emissionsgeschäft, aus Staatsanleihen usw., verankert die Herrschaft der Finanzoligarchie und legt der gesamten Gesellschaft einen Tribut zugunsten der Monopolisten auf.“ (siehe Fussnote 5). Die Finanzprofite würden in den Unternehmen also einen wahrhaftigen Abfluss herbeiführen (den bekannten Ertrag von 15%).
Diese Analyse ist ein Rückschritt in die Vulgärökonomie, in der das Kapital je nach Höhe der relativen Profitrate quasi zwischen produktiver Investition oder Platzierung in der Finanzsphäre auswählen kann. Auf mehr theoretischer Ebene beziehen sich diese Erklärungen der parasitären Finanzsphäre auf zwei Theorien des Werts und des Profits.
Der marxistische Ansatz besagt, dass der Wert vor seiner Verteilung existiert und ausschliesslich im Produktionsprozess durch die Ausbeutung der Arbeitskraft hergestellt wird. Im Band 3 des Kapitals präzisiert Marx, dass der Zins „...ein Teil des Profits (ist), den das fungierende Kapital, statt in die eigne Tasche zu stecken, an den Eigner des Kapitals wegzuzahlen hat“ (MEW 25, S. 351). Diesbezüglich unterscheidet sich Marx radikal von der bürgerlichen Ökonomie, die den Profit als eine Summe der Einkünfte der Faktoren (Einkünfte der Arbeitskraft, Einkünfte des Kapitals, Einkünfte aus dem Boden usw.) darstellt. Die Ausbeutung verschwindet, weil jeder Faktor entsprechend seinem eigenen Beitrag zur Produktion entschädigt wird: „Für die Vulgärökonomie, die das Kapital als selbständige Quelle des Werts, der Wertschöpfung, darstellen will, ist natürlich diese Form ein gefundnes Fressen, eine Form, worin die Quelle des Profits nicht mehr erkenntlich und worin das Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses – getrennt vom Prozess selbst – ein selbständiges Dasein erhält.“ (MEW 25, S. 405 f.) Der Finanzfetischismus besteht aus der Illusion, dass die Ausgabe eines Kapitalanteilscheins (Aktie, Obligation usw.) im eigentlichen Sinn des Wortes Zinsen „produziert“. Mit einem solchen Titel kauft man sich jedoch lediglich das Anrecht auf einen Teil des geschaffenen Werts; es wird auf diese Weise aber noch kein Wert geschaffen. Einzig und allein die Arbeit fügt dem Produkt einen Wert hinzu. Das Kapital, das Eigentum, eine Aktie, ein Sparbuch oder ein Maschinenpark bringen nichts von alleine hervor. Die Menschen produzieren.7 Das Kapital bringt etwas ein, wie der Jagdhund das Wild apportiert. Es schafft nichts, aber es gibt seinem Besitzer das Recht auf einen Anteil dessen, was derjenige, der sich des Kapitals bedient hat, geschaffen hat. In diesem Sinn ist das Kapital weniger ein Objekt als vielmehr ein soziales Verhältnis: Ein Teil der Arbeitsfrucht anderer endet in den Händen des Kapitalbesitzers. Die Antiglobalisierungsideologie stellt diese Ordnung der Dinge auf den Kopf, weil sie die Schaffung von Mehrwert mit seiner Aufteilung verwechselt. Der kapitalistische Profit entsteht ausschliesslich aus der Ausbeutung der Arbeitskraft, es gibt für die Gesamtheit der Bourgeoisie keine Spekulationsprofite (auch wenn der eine oder andere besondere Sektor aus der Spekulation einen Gewinn ziehen kann). Die Börse bringt also keinen Wert hervor.
Die andere Theorie flirtet mit der Vulgärökonomie und versteht den globalen Profit als Summe aus dem industriellen Profit einerseits und dem Finanzprofit anderseits. Die Akkumulationsrate sei schwach, weil der Profit in der Finanzsphäre höher sei als der industrielle Profit. Diese Sichtweise stammt aus dem Nachlass der verstorbenen stalinistischen Parteien, die seinerzeit eine volkstümliche Kritik des Kapitalismus verbreitet haben. Diese besteht darin, dass eine parasitäre Oligarchie (die 200 Familien in Frankreich usw.) den ,legitimen‘ Profit an sich reissen würde. Es handelt sich eigentlich um dieselbe Idee: Gemäss diesem Finanzfetischismus bringt die Börse gleich wie die Ausbeutung der Arbeitskraft Wert hervor. In dieser Überlegung liegt auch die ganze Mystifikation der Tobin-Steuer, die auf eine Regulierung und einen menschlichen Kapitalismus abzielt. Wenn ein Neben- zu einem Hauptwiderspruch erhoben wird, birgt dies die Gefahr eines typisch linken Abgleitens in sich, das darin besteht, den guten Weizen vom schlechten Spreu zu trennen: den investierenden vom spekulierenden Kapitalismus. Das führt zur Sichtweise, dass die Aufblähung des Finanzsektors eine Art Parasitismus auf einem gesunden kapitalistischen Körper sei. Die Krise wird nicht verschwinden, auch nicht nach der Vernichtung des Programme Communiste so teuren gigantischen Wucherkapitals. Auf eine gewisse Weise führt diese Einengung des Blickwinkels auf die Ausweitung des Finanzsektors zu einer Unterschätzung des Ausmasses der Krise: Sie rühre von der parasitären Rolle des Finanzsektors, der den Unternehmen eine zu hohe Profitrate abverlange und sie so an der Realisierung ihrer produktiven Investitionen hindere. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, so würde die „Euthanasie der Rentner“ (Keynes) das Problem lösen.
Diese Konzessionen auf analytischer Ebene an linksbürgerliche „Theorien“ führen dazu, eine gewisse Anzahl von ökonomischen Gegebenheiten als Beweis für die absolute Vorherrschaft des Finanzsektors und seine gegenüber der Wirtschaft praktizierte Blutsaugerei darzustellen. Die Beweisführung lässt einen richtiggehend schwindlig werden: „Die Grossunternehmen lenken ihre Investitionen in die Finanzmärkte, da sie als tragfähiger angesehen werden ... Dieser phänomenale Markt entwickelt sich in weit höherer Geschwindigkeit als derjenige der Produktion ... Was die täglichen monetären Währungstransaktionen im Umfang von 1300 Milliarden Dollar im Jahr 1996 betrifft, so sind davon 5 bis 8% zur Bezahlung von Waren oder Dienstleistungen über Grenzen hinweg getätigt worden ... 85% dieser 1300 Milliarden täglicher Operationen sind also rein spekulativ! Diese Zahlen müssen wieder angepasst werden, denn die 85% sind heute überholt“ (IBRP, in: Bilan et Perspectives, Nr. 4, S.6). Ja, sie sind tatsächlich überholt und die Beträge erreichen mittlerweile 1500 Milliarden Dollar, was den Umfang der Verschuldung der Dritten Welt ausmacht, aber diese Zahlen ängstigen nur die Ignoranten, denn sie machen keinen Sinn! In der Realität zirkulieren diese Gelder lediglich und die Summen sind um so grösser, je schneller sich das Karussell dreht. Es reicht, sich eine Person vorzustellen, die jede halbe Stunde zu spekulativen Zwecken eine Einheit von 100 in eine andere Währung umtauscht: Nach 24 Stunden beträgt die Summe der Transaktionen 4800. Wenn diese Person nun jede Viertelstunde dieselbe Operation vornimmt, so hat sich die Gesamtsumme verdoppelt. Diese Summe ist jedoch rein virtuell, denn die Person besitzt noch immer nur 100 plus 5 oder minus 10 je nach Talent in der Kunst des Spekulierens. Leider macht eine solch mediengerechte Darstellung der Tatsachen, wie sie auch das IBRP betreibt, die Interpretation der Krise als Produkt des parasitären Finanzsektors glaubwürdiger.
Tatsächlich ist die Aufblähung des Finanzsektors durch die Anhäufung nicht akkumulierten (d.h. nicht wieder investierten) Mehrwerts zu erklären. Die Überproduktionskrise und die beschränkt vorhandenen rentablen Akkumulationsfelder führen dazu, dass der Mehrwert in der Form von Einkommen aus dem Finanzsektor verteilt wird. Es ist also nicht das zinstragende Kapital, das sich den produktiven Investitionen entgegenstellen oder sie gar ersetzen würde. Die Aufblähung des Finanzsektors entspricht der Zunahme des nicht mehr profitabel investierbaren Mehrwerts.8 Die Verteilung der Gewinne aus dem Finanzkapital steht nicht automatisch in Widerspruch zur Akkumulation auf der Grundlage der Unternehmensselbstfinanzierung. Wenn die Profite aus der wirtschaftlichen Tätigkeit attraktiv sind, werden die Finanzerträge neu investiert und nehmen so an der Akkumulation der Unternehmen teil. Heute geht es nicht darum zu erklären, weshalb die Profite in der Form von Gewinnen des Finanzkapitals durch die Tür verschwinden, sondern weshalb sie nicht durch das Fenster zurückkommen und wieder produktiv im Wirtschaftskreislauf investiert werden. Wenn ein bedeutender Teil dieser Summen wieder investiert würde, so würde sich dies in einer Erhöhung der Akkumulationsrate ausdrücken. Wenn das aber nicht eintritt, so ist es auf die Überproduktionskrise und also die Verknappung von rentablen Akkumulationsfeldern zurückzuführen.
Der Finanzparasitismus ist ein Symptom, eine Folge der Schwierigkeiten des Kapitalismus und nicht die Ursache der Schwierigkeiten. Die Finanzsphäre ist das Schaufenster der Krise, weil sich in ihr die Börsenblasen, die Währungseinbrüche und die Bankenturbulenzen abspielen. Diese Erschütterungen sind aber die Konsequenzen der Widersprüche, die ihren Ursprung in der produktiven Sphäre haben.
Die Lohnarbeit im Zentrum der Überproduktionskrise
Was spielt sich seit über 20 Jahren ab? Die Austeritätspolitik und die Lohnsenkungen9 erlaubten eine Wiederherstellung der unternehmerischen Profitrate, jedoch haben die gewachsenen Profite nicht zu einer Erhöhung der Akkumulationsrate (also der Investitionen) und somit der Arbeitsproduktivität geführt. Das Wachstum ist somit rezessiv geblieben (siehe Grafik). Kurz gesagt hat die Zurückstutzung der Arbeitskosten die Märkte eingeschränkt und somit zu einem Anwachsen der Finanzerträge und nicht zu einer Reinvestition der Profite geführt. Weshalb aber sind die Reinvestitionen heute so schwach, wenn doch die Unternehmensprofite wiederhergestellt worden sind? Warum kommt die Akkumulation nach dem nunmehr zwanzigjährigen Anstieg der Profitrate nicht wieder in Gang? Marx und später Rosa Luxemburg haben uns gelehrt, dass die Produktionsbedingungen (Auspressung von Mehrwert) eine Sache und die Realisierungsbedingungen dieser in den hergestellten Waren kristallisierten Mehrarbeit eine andere Sache sind. Die in den Produkten kristallisierte Mehrarbeit wird nur zu klingendem und akkumulierbarem Mehrwert, wenn die hergestellten Waren auf den Märkten verkauft worden sind. Dieser fundamentale Unterschied zwischen den Produktions- und Realisierungsbedingungen erlaubt es uns zu verstehen, weshalb es keine mechanische Verbindung zwischen Profitrate und Wachstum gibt.
Die Grafik fasst die Entwicklung des Kapitalismus seit dem Zweiten Weltkrieg sehr gut zusammen. In der aussergewöhnlichen Wachstumsphase während dem Wiederaufbau wachsen alle wichtigen Variablen wie Profit, Akkumulation, Wachstum und Arbeitsproduktivität oder sie bewegen sich auf hohem Niveau bis zum Wiederauftauchen der offenen Krise beim Übergang von den 60er- zu den 70er-Jahren. Die Produktivitätsgewinne beginnen sich seit den 60er-Jahren zu erschöpfen und reissen die anderen Variablen bis zu Beginn der 80er-Jahre mit sich in die Tiefe. Seither befindet sich der Kapitalismus auf ökonomischer Ebene in einer beispiellosen Situation, gekennzeichnet durch eine Konstellation von steigenden Profitraten und gleichzeitig mittelmässiger Arbeitsproduktivität, Akkumulationsrate und also Wachstumsrate. Dieses Auseinanderdriften von Profitrate und den anderen Variablen seit nun mehr als 20 Jahren kann nur im Rahmen der Dekadenz des Kapitalismus verstanden werden. Für das IBRP ist das aber nicht der Fall, es ist der Meinung, dass das Konzept der Dekadenz auf den Abfallhaufen der Geschichte gehöre: „Welche Rolle spielt also das Konzept der Dekadenz in einer militanten Kritik der politischen Ökonomie, d.h. der vertieften Analyse der Phänomene und der Dynamik des Kapitalismus in der gegenwärtigen Periode? Keine ... Mit dem Konzept der Dekadenz kann man weder die Krisenmechanismen erklären, noch das Verhältnis zwischen Krise und Aufblähung des Finanzsektors oder der Grossmachtpolitik zur Kontrolle der Finanzerträge und ihrer Ressourcen anprangern“ (IBRP: Eléments de réflexion sur les crises du CCI). Das IBRP zieht es vor, das Schlüsselkonzept der Dekadenz, das einst zu seinen eigenen Positionen gehörte10, fallen zu lassen, um es durch modische Erklärungen des globalisierungsfeindlichen Milieus wie der Aufblähung des Finanzsektors oder der Finanzrente zu ersetzen, um die Krise und die Politik der Grossmächte zu verstehen. Es geht sogar so weit zu behaupten, dass „.diese Konzepte (es ist hauptsächlich von der Dekadenz die Rede) nicht zur Methode und zum Arsenal zur Kritik der politischen Ökonomie gehören“ (ebd.).
Weshalb ist der Rahmen der Dekadenz unabdingbar für das Verständnis der Krise heute? Weil der ununterbrochene Niedergang der Wachstumsrate seit dem Ende der 60er-Jahre in den Ländern der OECD mit jeweils 5,2%, 3,5%, 2,8%, 2,6% und 2,2% für die 60er, 70er, 80er, 90er-Jahre und 2000–2002 die Rückkehr des Kapitalismus zu seiner durch den Ersten Weltkrieg eröffneten historischen Tendenz bestätigt. Die Klammer der aussergewöhnlichen Wachstumsphase (1950–1975) ist endgültig geschlossen.11 Damit fand der Kapitalismus nach einem letzten Aufbäumen unausweichlich zum Wachstumsrhythmus der Jahre 1914–1950 zurück. Ganz im Gegenteil zum Geschrei unserer Kritiker ist die Dekadenztheorie des Kapitalismus keineswegs das spezifische Produkt der 30er-Jahre.12 Sie stellt das Herzstück des historischen Materialismus dar, das endlich gefundene Geheimnis der Abfolge von Produktionsweisen in der Geschichte, und sie gibt somit den Rahmen zum Verständnis und zur Analyse der Evolution des Kapitalismus und insbesondere der Periode, die mit dem Ersten Weltkrieg einsetzte. Sie ist von allgemeiner Tragweite; sie ist für ein ganzes historisches Zeitalter gültig und hängt in keiner Weise von einer besonderen Periode oder einer momentanen ökonomischen Konjunktur ab. Aber selbst wenn wir die aussergewöhnliche Wachstumsphase zwischen 1950 und 1975 einbeziehen – zwei Weltkriege, die Depression der 30er-Jahre und mehr als 35 Jahre der Krise und Austerität präsentieren eine nüchterne Bilanz der Dekadenz des Kapitalismus: kaum 30 bis 35 (grosszügig gerechnet) Jahre ,Prosperität‘ auf 55 bis 60 Jahre von Krieg und/oder Wirtschaftskrise (und das Schlimmste kommt noch!). Die historische Tendenz zur Bremsung des Wachstums der Produktivkräfte durch die überholt gewordenen kapitalistischen Produktionsverhältnisses ist die Regel, der Rahmen zum Verständnis der Evolution des Kapitalismus, darin eingeschlossen die Ausnahme der Prosperitätsphase nach dem Zweiten Weltkrieg (wir werden darauf in einem nächsten Artikel zurück kommen). Im Gegensatz zur Vorstellung der reformistischen Strömung, die sich von den Ergebnissen des Kapitalismus der Belle Epoque hat vereinnahmen lassen, ist die Verwerfung der Dekadenz ein reines Produkt der Prosperitätsjahre.
Die Grafik zeigt uns übrigens auch deutlich, dass dem Anstieg der Profitrate weder eine Verbesserung der Arbeitsproduktivität noch eine Verringerung des Kapitals zugrunde liegt. Das erlaubt uns auch, endgültig mit dem Geschwätz über die angebliche ,neue technologische Revolution‘ Schluss zu machen. Gewisse von der Informationstechnologie entzückte Universitätsabsolventen sind der Bourgeoisie mit ihrer Kampagne über die New Economy in die Falle gegangen und verwechseln die Frequenz ihres Computers mit der Arbeitsproduktivität: Wenn der Pentium 4 zweihundertmal schneller als die erste Generation dieses Rechners dreht, bedeutet dies noch lange nicht, dass der Büroangestellte zweihundertmal schneller tippt und seine Produktivität entsprechend ansteigt. Die Grafik
zeigt deutlich, dass sich die Arbeitsproduktvität seit den 60er-Jahren im Niedergang befindet. Und der Grund dafür liegt darin, dass trotz der wiederhergestellten Profite die Akkumulationsrate (Investitionen als Grundlage für mögliche Gewinne in der Produktivität) nicht wieder angezogen hat. Die ,technologische Revolution‘ existiert nur in den bürgerlichen Kampagnen und in der Vorstellung derjenigen, die leichtfertig daran glauben. Die empirische Feststellung einer seit den 60er-Jahren ununterbrochenen Verlangsamung der Produktivität (des technischen Fortschritts und der Arbeitsorganisation) widerspricht dem in den Medien vermittelten und gut in den Köpfen verankerten Bild eines technologischen Wandels, einer neuen industriellen Revolution, die heute von der Informatik und der Telekommunikation, dem Internet und von Multimedia getragen werde. Wie kann man die Kraft dieser Mystifikation, die die Realität in unseren Köpfen verdreht, erklären?
Zuallererst Muss man daran erinnern, dass der Fortschritt in der Produktivität nach dem Zweiten Weltkrieg weit spektakulärer war als das, was uns heute als New Economy präsentiert wird. Die Einführung von Arbeitsschichten zu 8 Stunden, die Verallgemeinerung des Fliessbands in der Industrie, die schnellen Fortschritte in der Entwicklung und Verbreitung von neuen Transporttypen (Lastwagen, Zug, Flugzeug, Auto, Schiff), die Ersetzung von Kohle durch billigeres Erdöl, die Einführung von Kunststoffen und die Ersetzung von teureren Materialen, die Industrialisierung der Landwirtschaft, der selbstverständliche Zugang zur Elektrizität, zum Erdgas, zu fliessendem Wasser, zu Radio und Telefon, die Mechanisierung des Haushalts durch die Entwicklung von elektrischen Apparaten usw. sind weit spektakulärer was die Steigerung der Produktivität anbelangt als die neusten Entwicklungen im Bereich der Informatik und Telekommunikation. Deshalb befindet sich das Produktivitätswachstum seit den Goldenen Sechzigern im Niedergang.
Weiter wird eine permanente Verwirrung zwischen dem Auftauchen neuer Konsumgüter und dem Produktivitätsfortschritt aufrecht erhalten. Der Innovationsfluss, die Vervielfachung von noch so aussergewöhnlichen Neuheiten (DVD, GSM-Telefone, Internet usw.) auf der Ebene der Konsumgüter deckt sich nicht mit dem Phänomen der Produktivitätssteigerung. Diese bedeutet nämlich die Fähigkeit, Ressourcen bei der Produktion einer Ware oder Dienstleistung einzusparen. Der Ausdruck technischer Fortschritt Muss immer im Sinn eines Fortschritts der Produktions- und/oder Organisationstechnik verstanden werden, also vom strikten Standpunkt der Einsparung von Ressourcen in der Herstellung einer Ware oder der Ausrichtung einer Dienstleistung. So vorzüglich das numerische Wachstum auch sein mag, es übersetzt sich nicht in ein bedeutendes Wachstum der Produktivität im Produktionsprozess. Das ist der ganze Bluff der New Economy.
Im Gegensatz zu den Behauptungen unserer Kritiker, die die Realität der Dekadenz und die Gültigkeit der theoretischen Beiträge von Rosa Luxemburg verneinen und die aus dem tendenziellen Fall der Profitrate das Alpha und Omega der Evolution des Kapitalismus machen, zeigt der Wirtschaftsgang seit Beginn der 80er-Jahre deutlich, dass der Anstieg der Profitrate nicht wegen eines Anstiegs des Wachstums zustande kam. Es gibt gewiss eine starke Beziehung zwischen der Profitrate und der Akkumulationsrate, aber sie ist weder mechanisch noch einseitig: Es handelt sich um zwei teilweise unabhängige Variablen. Das widerspricht den Behauptungen derjenigen, für die die Überproduktionskrise zwingend vom Fall der Profitrate und der Rückkehr des Wachstums abhängig ist: „Der Widerspruch zwischen Produktion und Realisierung des Mehrwerts erscheint als eine Überproduktion von Gütern und also als Ursache der Sättigung des Marktes, die wiederum dem Akkumulationsprozess im Weg steht. Das System in seiner Gesamtheit ist somit nicht in der Lage, den Fall der Profitrate auszugleichen. Tatsächlich verhält es sich umgekehrt ... Der Wirtschaftszyklus und der Verwertungsprozess machen den Markt ,zahlungsfähig‘ oder ,zahlungsunfähig‘. Diese widersprüchlichen Gesetze regeln den Akkumulationsprozess und nur mit ihnen kann man die ,Krise‘ des Marktes erklären“ (Text von Battaglia Comunista an der ersten Konferenz der Gruppen der kommunistischen Linken, Mai 1977). Heute können wir klar feststellen, dass die Profitrate seit 20 Jahren ansteigt, während das Wachstum bescheiden ist. Die Bourgeoisie hat niemals so viel von Deflation gesprochen wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Dem Kapitalismus gelingt es zwar, profitabel zu produzieren, aber das heisst nicht, dass er automatisch durch diesen Mechanismus auch gleich den zahlungsfähigen Markt schafft, auf dem er die in seinen Produkten kristallisierte Mehrarbeit in klingenden Mehrwert umwandeln kann, was ihm wiederum die Reinvestition des Profits erlauben würde. Die Bedeutung des Marktes hängt nicht mechanisch von der Entwicklung der Profitrate ab. Genau so wie bei den anderen die Entwicklung des Kapitalismus bestimmenden Parametern handelt es sich bei ihm um eine teilweise unabhängige Variabel. Das Verständnis dieses grundlegenden Unterschieds zwischen den Produktions- und den Realisierungsbedingungen erlaubt uns, wie es Marx und meisterhaft vertieft auch Rosa Luxemburg aufgezeigt haben, zu verstehen, weshalb es keinen Automatismus zwischen des Profitrate und dem Wachstum gibt.
Dekadenz und Orientierungen für die Widerstandskämpfe
Die neben der IKS zwei wichtigsten Gruppen der kommunistischen Linken – Programme Communiste und das IBRP – können den Widerstandskämpfen der Arbeiterklasse keine klare und kohärente Orientierung geben, da sie die Dekadenz als Rahmen für das Verständnis der gegenwärtigen Periode und der Krise verwerfen, die Entwicklung des Staatskapitalismus auf allen Ebenen unterschätzen, die Finanzspekulation als Ursache aller Übel auf der Welt bezeichnen. Um sich dessen zu vergewissern, braucht man lediglich ihre Analyse über die Politik der Bourgeoisie bezüglich der Austerität und die Schlussfolgerungen, die sie aus ihrer Analyse der Krise ziehen, zu konsultieren: „Im Lauf der 50er-Jahre sind die kapitalistischen Ökonomien wieder in Schwung gekommen und die Bourgeoisie sah ihre Profite wieder und zwar auf dauerhafte Weise aufblühen. Diese Expansion setzte sich auch im folgenden Jahrzehnt fort und stützte sich auf den Kredit und auf die Unterstützung des Staates. Sie hat unbestreitbar zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter (soziale Sicherheit, Kollektivabsprachen, Lohnerhöhungen...) geführt. Diese von der Bourgeoisie unter dem Druck der Arbeiterklasse gemachten Zugeständnisse führten zu einem Sinken der Profitrate. Dieses unabwendbare Phänomen ist auf die interne Dynamik des Kapitals zurückzuführen ... Im Anfangsstadium des Kapitalismus war die Bourgeoisie in der Lage, mit den aus den Kolonien und von ihren Völkern eingefahrenen Profiten einen gewissen sozialen Frieden zu garantieren, indem sie die Arbeiterklasse am ausgepressten Mehrwert teilhaben liess. Heute ist es nicht mehr so: Die Logik der Spekulation stellt alle in den vergangenen Jahrzehnten von der Arbeiterklasse der ,zentralen Länder‘ erkämpften sozialen Errungenschaften in Frage“ (IBRP, in: Bilan et Perspectives, Nr. 4, S. 5ff.).
Auch hier können wir feststellen, dass die Türen durch das Fallenlassen des Dekadenzrahmens sehr weit für Zugeständnisse gegenüber linken Analysen offen stehen. Das IBRP zieht es vor, die linken Märchen über die ,sozialen Errungenschaften (soziale Sicherheit, Kollektivabsprachen, Lohnerhöhungen...)‘ zu kopieren, die Zugeständnisse der Bourgeoisie unter dem Druck der Arbeiterklasse gewesen seien und in der gegenwärtigen Logik der Spekulation in Frage gestellt würden. Das IBRP würde sich besser auf die von den Gruppen der internationalen kommunistischen Linken (Bilan, Communisme usw. ) überlieferten theoretischen Errungenschaften stützen, die analysierten, dass diese Massnahmen von der Bourgeoisie benutzte Mittel waren, um die Arbeiterklasse an den Staat zu binden und sie von ihm abhängig zu machen!
In der aufsteigenden Phase des Kapitalismus waren die Entwicklung der Produktivkräfte und des Proletariats ungenügend, um die Herrschaft der Bourgeoisie zu bedrohen und auf internationaler Ebene erfolgreich eine Revolution durchzuführen. Deshalb konnte sich die Arbeiterklasse in heftigen Kämpfen mittels eigener Organe, d.h. der Arbeiterparteien und der Gewerkschaften, als Klasse im Kapitalismus konstituieren und zwar gegen all die Sabotageversuche der Bourgeoisie. Die Vereinigung des Proletariats ist mittels der Kämpfe um Reformen herbeigeführt worden und führte zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Klasse: Es wurden Reformen auf ökonomischer und politischer Ebene realisiert. Das Proletariat hat als Klasse die Bürgerrechte im politischen Leben der Gesellschaft erkämpft, oder in den Worten Marxens in Das Elend der Philosophie gesprochen: Die Arbeiterklasse hat das Recht zu leben und „als Klasse für sich selbst“ im gesellschaftlichen Leben zu existieren erkämpft. Sie besitzt als organisierte Klasse eigene Orte für tägliche Versammlungen, hat eigene Ideen und ein gesellschaftliches Programm, eigene Traditionen und Lieder.
Als der Kapitalismus 1914 in seine dekadente Phase trat, hat die Arbeiterklasse unter Beweise gestellt, dass sie in der Lage ist, die bürgerliche Herrschaft umzustürzen: Sie hat die Bourgeoisie zur Beendigung des Krieges gezwungen und eine internationale Welle von revolutionären Kämpfen entfesselt. Seither stellt das Proletariat für die Bourgeoisie eine ständige Gefahr dar. Deshalb kann sie nicht mehr tolerieren, dass die feindliche Klasse auf eigenem Terrain ständige Organisationen besitzt und darin ein eigenes Leben führt und eigene Gedanken hegt. Der Staat weitet seine totalitäre Herrschaft auf alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens aus. Alles wird von seinen allgegenwärtigen Tentakeln umfasst. Alles was sich in der Gesellschaft bewegt, Muss sich bedingungslos dem Staat unterwerfen oder ihm in einem tödlichen Kampf entgegentreten. Die Zeit, in der das Kapital die Existenz von permanenten proletarischen Organen tolerierte, ging endgültig zu Ende. Der Staat hat das organisierte Proletariat als permanente Kraft von der gesellschaftlichen Bühne vertrieben. „Seit dem Ersten Weltkrieg haben sich parallel zur wachsenden Bedeutung des Staates in der Wirtschaft die Gesetze vervielfacht, die die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit regeln und damit einen engen Rahmen schaffen, der den proletarischen Widerstand aufs Minimum beschränken und ihn all seiner Kräfte berauben soll“ (Auszug aus unserer Broschüre: Die Gewerkschaften gegen die Arbeiterklasse). Der Staatskapitalismus bedeutet auf gesellschaftlicher Ebene die Überführung jeglichen Klassenlebens auf das Terrain der Bourgeoisie. Der Staat hat sich in gewissen Ländern über den Umweg der Gewerkschaften, in anderen auf direktem Weg der Streik- oder Hilfskassen und der Kranken- und Arbeitslosenversicherung bemächtigt, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Arbeiterklasse eingerichtet worden waren. Die Bourgeoisie hat die politische Solidarität aus den Händen der Arbeiterklasse gerissen und sie in eine ökonomische Solidarität in den Händen des Staates umgewandelt. Der Staat hat durch die Aufteilung des Lohns in direkte Vergütung durch den Chef und eine indirekte Vergütung durch den Staat auf mächtige Weise die Mystifikation verstärkt, wonach er ein über den Klassen stehendes Organ sei, das die gemeinsamen Interessen und die soziale Sicherheit der Arbeiterklasse garantiere. Der Bourgeoisie ist es auf diesem Weg gelungen, die Arbeiterklasse ideologisch und materiell an den Staat zu binden. So lautete die Analyse der Italienischen Linken und der Belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken anlässlich der ersten in den 30er-Jahren vom Staat errichteten Arbeitslosen- und Hilfskassen.13
Was hat das IBRP der Arbeiterklasse zu sagen? Zuerst, dass die ,Logik der Spekulation‘ verantwortlich sei für die ,Infragestellung aller sozialer Errungenschaften‘ und dass die ,Aufblähung des Finanzsektors‘ das absolute Böse sei. Das IBRP vergisst so beiläufig, dass die Krise und die Angriffe gegen die Arbeiterklasse nicht erst bis zum Auftreten der ,Logik der Spekulation‘ gewartet haben. Glaubt das IBRP wirklich, wie es seine Prosa glauben lässt, dass es der Arbeiterklasse nach einer Überwindung der ,Logik der Spekulation‘ wieder besser gehen würde? Genau das Gegenteil ist der Fall. Diese linke Mystifikation, wonach der Kampf gegen die Austerität vom Kampf gegen die Logik der Spekulation abhängig sei, Muss mit allen Kräften bekämpft werden!
Aber es kommt noch viel schlimmer! Es handelt sich um eine enorme Mystifikation, dem Proletariat glauben zu machen, dass die soziale Sicherheit, die Kollektivabsprachen und selbst der Mechanismus der Lohnerhöhung über die Indexierung oder die automatische Teuerungsanpassung ,durch einen harten Kampf erreichte soziale Errungenschaften‘ seien. Bei der Reduktion der Tagesarbeitszeit, dem Verbot der Kinderausbeutung, dem Verbot der Frauen-Nachtarbeit usw. handelt es sich tatsächlich um Zugeständnisse, die durch einen harten Kampf der Arbeiterklasse in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus erreicht worden sind. Dagegen haben die angeblichen ,sozialen Errungenschaften‘ wie die soziale Sicherheit oder die Kollektivabsprachen in den Sozialverträgen für den Wiederaufbau überhaupt nichts mit dem proletarischen Klassenkampf zu tun. Die Arbeiterklasse war geschlagen, erschöpft vom Krieg, berauscht und mystifiziert durch den Nationalismus, euphorisiert von der Befreiung, kurz: Sie war nicht in der Lage, durch Kämpfe solche Errungenschaften zu erzielen. Die Bourgeoisie der Exilregierungen hat die Initiative für die Ausarbeitung der Sozialverträge für den Wiederaufbau ergriffen. Sie hat all die Mechanismen des Staatskapitalismus auf die Beine gestellt. Die Bourgeoisie hat mitten im Krieg in den Jahren 1943 und 1945 (!) die Initiative zur Versammlung aller ,lebendigen Kräfte der Nation‘, aller ,Sozialpartner‘ durch paritätische Zusammenkünfte von Vertretern der Unternehmer, der Regierung und der verschiedenen Parteien und Gewerkschaften., d.h. in der perfektesten nationalen Übereinstimmung der Résistance ergriffen, um den Wiederaufbau der zerstörten Wirtschaft zu planen und die gesellschaftlich schwierige Phase des Wiederaufbaus auszuhandeln. Es gab keine ,Zugeständnisse der Bourgeoisie unter dem Druck der Arbeiterklasse‘ im Sinn einer auf dem eigenen Terrain kämpfenden und eine eigene Strategie zur Überwindung des Kapitalismus entwickelnden Arbeiterklasse, die die Bourgeoisie dazu gezwungen hätte, einen Kompromiss zu akzeptieren. Jedoch sind Mittel in Übereinstimmung mit allen Teilen der Bourgeoisie (Unternehmer, Gewerkschaften, Regierung) eingesetzt worden, um die Arbeiterklasse sozial zu kontrollieren und so dem Wiederaufbau zum Erfolg zu verhelfen.13 Muss man daran erinnern, dass es auch die Bourgeoisie war, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit eine ganze Palette von Gewerkschaften wie die CFTC in Frankreich oder die CSC in Belgien auf die Beine gestellt hat?
Selbstverständlich verurteilen die Revolutionäre den Zugriff sowohl auf den direkten als auch auf den indirekten Lohn und die Angriffe auf das Lebensniveau, wenn die Bourgeoisie die soziale Sicherheit zusammenstreicht, aber niemals dürfen die Revolutionäre das Prinzip selber des von der Bourgeoisie errichteten Mechanismus zur Bindung der Arbeiterklasse an den Staat verteidigen!14 Die Revolutionäre sollen im Gegenteil die ideologische und materielle Logik, die diesem Mechanismus als angebliche ,Neutralität des Staates‘, der ,vom Staat organisierten sozialen Solidarität‘ usw. zugrunde liegt, anprangern.
Angesichts der allgemeinen Verschärfung der Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise und den Schwierigkeiten der Arbeiterklasse steht sehr viel auf dem Spiel. Deshalb Muss es die Aufgabe der Revolutionäre sein, eine notwendige Vertiefung als Antwort auf die durch die Geschichte gestellten neuen Fragen herbeizuführen. Diese Vertiefung kann aber nicht auf der Grundlage der von der extremen Linken des politischen Apparates der Bourgeoisie verbreiteten Analysen gemacht werden. Einzig auf der Grundlage des Marxismus und der Errungenschaften der kommunistischen Linken und insbesondere ihrer Analyse der Dekadenz des Kapitalismus werden die Revolutionäre auf der Höhe ihrer Verantwortung sein können.
C. Mcl
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue 34
- 2772 Aufrufe
"Volksaufstände" in Lateinamerika:
- 2684 Aufrufe
Der Ausbruch von massiven Klassenkämpfen im Mai 1968 in Frankreich und in der Folge auch in Italien, Grossbritannien, Spanien, Polen und anderswo setzte der konterrevolutionären Periode ein Ende, die seit der Niederschlagung der revolutionären Welle 1917–23 so schwer auf der internationalen Arbeiterklasse gelastet hatte. Der proletarische Riese ist auf der historischen Szene wieder aufgestanden. Diese Kämpfe hatten auch in Lateinamerika ein grosses Echo, zuerst 1969 im „Cordobaza“ in Argentinien. Zwischen 1969 und 1975 führten die Arbeiter in der ganzen Region, vom Süden Chiles bis nach Mexiko an der Grenze zu den USA, einen erbitterten Kampf gegen die Versuche der Bourgeoisie, die Kosten der Wirtschaftskrise auf sie abzuwälzen. Und in den folgenden Kampfwellen, von denen jene von 1977–80 im polnischen Massenstreik kulminierte und jene von 1983–89 von umfangreichen Bewegungen in Belgien, Dänemark und bedeutenden Kämpfen in zahlreichen anderen Ländern gekennzeichnet war, setzte auch das Proletariat Lateinamerikas den Kampf fort, wenn auch nicht auf dieselbe spektakuläre Weise. Es zeigte, dass die Arbeiterklasse einen einzigen und gleichen Kampf gegen den Kapitalismus führt, dass sie eine einzige und gleiche internationale Klasse ist, was auch immer die Unterschiede in den Bedingungen seien.
Heute erscheinen diese Kämpfe in Lateinamerika wie ein ferner Traum. Die aktuelle gesellschaftliche Situation in der Region kennt keine massiven Kämpfe und ähnliche Manifestationen oder gar bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen dem Proletariat und den Repressionskräften. Sie ist von einer allgemeinen gesellschaftlichen Instabilität gekennzeichnet. Der „Aufstand“ in Bolivien im Oktober 2003, die massiven Strassendemonstrationen, die im Dezember innert weniger Tage fünf argentinische Präsidenten aus dem Amt spülten, die venezolanische „Volksrevolution“ von Chavez, der in den Medien breitgetretene Kampf der Zapatistas in Mexiko, all diese und ähnliche Ereignisse haben die gesellschaftliche Bühne dominiert. In diesem Mahlstrom allgemeiner Unzufriedenheit, der sozialen Revolte gegen die sich ausbreitende Verarmung und Verelendung erscheint die Arbeiterklasse als eine unzufriedene Schicht unter anderen, die zu ihrer Verteidigung gegen die Verschlechterung ihrer Lage an der Revolte der anderen unterdrückten und verarmten Schichten der Gesellschaft teilnimmt und in ihnen aufgeht. Angesichts dieser Schwierigkeiten der Arbeiterklasse dürfen die Revolutionäre nicht einfach die Arme verschränken, sondern sie müssen unbeugsam die Unabhängigkeit der Arbeiterklasse verteidigen.
„Die Autonomie des Proletariats gegenüber allen Klassen der Gesellschaft ist die erste Vorbedingung für die Entwicklung des Klassenkampfs hin zur Revolution. Alle Bündnisse mit anderen Klassen oder Schichten und insbesondere jene Bündnisse mit Fraktionen der Bourgeoisie können nur zur Entwaffnung des Proletariats gegenüber seinen Feinden führen, da diese Bündnisse die Arbeiterklasse zur Aufgabe der einzigen Grundlage führen, wo das Proletariat seine Kräfte stärken kann: auf der Grundlage seines Kampfes als Klasse.“(1)
Da einzig die Arbeiterklasse eine revolutionäre Klasse ist, trägt auch nur sie eine Perspektive für die gesamte Menschheit in sich. Doch heute ist sie von Manifestationen des anwachsenden gesellschaftlichen Zerfalls des dahinsiechenden Kapitalismus umzingelt und hat grosse Schwierigkeiten, den Kampf als autonome Klasse mit eigenständigen Interessen aufzunehmen. Mehr denn je muss man in dieser Zeit an Marx erinnern, der schrieb: „Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäss geschichtlich zu tun gezwungen sein wird.“ (2)
Der Klassenkampf in Lateinamerika von 1969 bis 1989
Die Geschichte des Klassenkampfes in Lateinamerika in den letzten 35 Jahren ist Teil des internationalen Klassenkampfes. Sie ist eine Geschichte harter Kämpfe, gewaltsamer Zusammenstösse mit dem Staatsapparat, zeitweiliger Siege und bitterer Niederlagen. Die spektakulären Bewegungen vom Ende der 60er und dem Beginn der 70er-Jahre haben eine Phase von schwierigeren und schmerzhafteren Kämpfen eröffnet. In dieser Phase stellte sich die fundamentale Frage, wie die Klassenautonomie zu verteidigen und zu entwickeln sei, mit noch grösserer Schärfe.
Der Kampf der Arbeiter 1969 in der Industriestadt Cordoba war besonders wichtig. Er manifestierte sich in einer einwöchigen bewaffneten Auseinandersetzung zwischen dem Proletariat und der argentinischen Armee. Die Kämpfe in ganz Argentinien, in Lateinamerika, ja der ganzen Welt sind dadurch stimuliert worden. Es handelte sich um den Beginn einer Kampfwelle, die in Argentinien 1975 mit dem Kampf der Metallarbeiter von Villa Constitución, dem bedeutendsten Zentrum der Stahlproduktion des ganzen Landes, den Höhepunkt erreichte. Die Arbeiter von Villa Constitución waren mit der gesamten Macht des Staatsapparates konfrontiert; denn die herrschende Klasse wollte mit der Niederschlagung dieses Kampfes ein Exempel statuieren. Daraus ergab sich ein sehr hohes Niveau der Auseinandersetzung zwischen Bourgeoisie und Proletariat: „Die Stadt wurde unter militärische Besetzung durch 4.000 Mann gestellt (...) Jedes Viertel wurde systematisch durchkämmt und es wurden Verhaftungen vorgenommen, was aber nur die Wut der Arbeiter provozierte: 20.000 Arbeiter sind in den Streik getreten und haben Fabriken besetzt. Trotz Mordanschlägen und Bombardierungen von Arbeiterhäusern hat sich sofort ein aussergewerkschaftliches Kampfkomitee gebildet. Viermal wurde die Streikführung eingekerkert, aber jedes Mal entstand sofort ein neues Komitee. Wie in Cordoba 1969 haben bewaffnete Arbeitergruppen die Verteidigung der Arbeiterquartiere übernommen und haben den Aktivitäten der paramilitärischen Banden ein Ende bereitet.
Die Aktion der Stahl- und Metallarbeiter, die eine Lohnsteigerung um 70 Prozent forderten, hat sehr schnell von der Solidarität der Arbeiter in anderen Betrieben des Landes – in Rosario, in Cordoba und Buenos Aires – profitiert. In Buenos Aires haben beispielsweise die Arbeiter von Propulsora, die aus Solidarität in einen Streik getreten waren und die ihre ganzen Lohnforderungen (130.000 Pesos monatlich) durchsetzen konnten, entschieden, die Hälfte ihres Lohnes den Arbeitern von Villa Constitución zu spenden.“ (3)
Aus dem gleichen Grund haben die Arbeiter in Chile zu Beginn der 70er-Jahre ihre Klasseninteressen verteidigt und es abgelehnt, sie zugunsten der Volksfront-Regierung Allendes zu opfern: „Der Widerstand der Arbeiter gegen Allende begann 1970. Im Dezember 1970 traten 4.000 Minenarbeiter in Chuquicamata in den Streik und forderten höhere Löhne. Im Juli 1971 legten 10.000 Minenarbeiter in Lota Schwager ihre Arbeit nieder. Beinahe zur gleichen Zeit breitete sich eine Streikwelle in den Minen von El Salvador, El Teniente, Chuquicamata, La Exotica und Rio Blanco aus. Überall wurden höhere Löhne gefordert (...) Im Mai/Juni 1973 setzten sich die Minenarbeiter erneut in Bewegung. In den Minen von El Teniente und Chuquicamata traten 10.000 Arbeiter in den Streik. Die Minenarbeiter von El Teniente forderten eine Lohnerhöhung um 40 Prozent. Allende setzte die Provinzen O’Higgins und Santiago unter Militärkontrolle, weil die von El Teniente ausgehende Lähmung eine ernsthafte Bedrohung für die Wirtschaft darstellte.“ (4)
Wichtige Arbeiterkämpfe haben sich auch in anderen bedeutenden Arbeiterkonzentrationen Lateinamerikas zugetragen. In Lima, Peru, brachen 1976 aufstandsartige Streiks aus. Sie wurden blutig unterdrückt. Einige Monate später traten die Minenarbeiter von Centramin in den Streik. In Riobamba, Ecuador, fand ein Generalstreik statt. Im Januar des gleichen Jahres brach in Mexiko eine Streikwelle aus. 1978 gab es erneut Generalstreiks in Peru. Nach zehn ruhigen Jahren setzten sich 200.000 Metallarbeiter in Brasilien an die Spitze einer Streikbewegung, die von Mai bis Oktober dauerte. In Chile kam es 1976 zu Streiks der Metro-Angestellten von Santiago und der Minenarbeiter. In Argentinien brachen trotz des Terrors der Militärjunta 1976 Streiks in den Elektrizitätswerken und in der Automobilindustrie aus, die in gewaltsame Zusammenstösse zwischen Arbeitern und der Armee mündeten. Die 70er-Jahre waren auch von wichtigen Kampfepisoden in Bolivien, Guatemala und Uruguay gekennzeichnet.
Auch in den 80er-Jahren hat das Proletariat Lateinamerikas an der internationalen Kampfwelle teilgenommen, die 1983 in Belgien begonnen hatte. Die entwickeltsten dieser Kämpfe waren von den entschiedenen Anstrengungen seitens der Arbeiter gekennzeichnet, die Bewegung auszuweiten. So kämpften beispielsweise die Angestellten des Bildungssektors in Mexiko für eine Erhöhung der Gehälter: „Die Forderung der Arbeiter des Erziehungswesens stellte bereits von Beginn an die Frage nach der Ausweitung der Kämpfe, denn es herrschte eine allgemeine Unzufriedenheit gegenüber den Austeritätsplänen. Auch wenn die Bewegung gerade schwächer wurde, als jene im Erziehungswesen begann, streikten und demonstrierten doch 30.000 Angestellte des öffentlichen Sektors ausserhalb der gewerkschaftlichen Kontrolle. Sie erkannten, dass die Ausdehnung und Einheit des Kampfes notwendig waren: Zu Beginn haben die Arbeiter aus dem Süden von Mexiko City Delegierte zu anderen Beschäftigten des Bildungssektors entsandt und sie dazu aufgerufen, sich dem Kampf anzuschliessen. Sie sind auch auf die Strassen gegangen und haben Kundgebungen durchgeführt. Sie haben sich dagegen gewehrt, den Kampf einzig auf die Lehrer einzugrenzen, und haben alle Arbeiter des Erziehungswesens (Lehrer, Verwaltungsangestellte, Handarbeiter) in den Massenversammlungen zusammengerufen, um den Kampf zu kontrollieren.“ (5)
Die gleichen Tendenzen haben sich auch in anderen Teilen Lateinamerikas gezeigt: „Selbst die bürgerlichen Medien haben von einer ‚Streikwelle’ in Lateinamerika gesprochen, mit Kämpfen in Chile, Peru, Mexiko (...) und auch in Brasilien, wo Arbeiter aus Banken, von den Docks, aus dem Gesundheits- und Bildungssektor gleichzeitig gegen das Einfrieren der Löhne protestierten.“ (6)
Die Arbeiterklasse Lateinamerikas hat von 1969 bis 1989 trotz aller Rückschläge, Schwierigkeiten und Schwächen gezeigt, dass sie vollumfänglich am historischen Wiederaufschwung der internationalen Arbeiterklasse teilnahm.
Der Fall der Berliner Mauer und die darauf folgende Propagandaflut der Bourgeoisie über den „Tod des Kommunismus“ haben einen tiefgreifenden Einbruch in den Klassenkämpfen auf internationaler Ebene herbeigeführt. Das hat sich vor allem im Verlust der Klassenidentität des Proletariats gezeigt. Dieser Rückschlag zeitigte bei den Arbeitern Südamerikas weit schädlichere Auswirkungen, da die Entwicklung der Krise und des gesellschaftlichen Zerfalls die verarmten, unterdrückten und verelendeten Massen in den Strudel der interklassistischen Revolten zogen. Das erschwert die schwierige Aufgabe, sich als autonome Klasse zu behaupten und die Distanz gegenüber der „Volksmacht“ und den Volksaufständen zu wahren.
Die schädlichen Auswirkungen des kapitalistischen Zerfalls und der interklassistischen Revolten
Der Zusammenbruch des Ostblocks war sowohl Produkt als auch Beschleunigungsfaktor des Zerfalls des Kapitalismus vor dem Hintergrund einer sich vertiefenden Wirtschaftskrise. Lateinamerika wurde davon mit voller Wucht getroffen. Millionen von Menschen wurden dazu gezwungen, ihr Dorf zu verlassen und sich auf der verzweifelten Suche nach inexistenten Arbeitsplätzen in die Slumsiedlungen der grossen Städte zu begeben, während gleichzeitig Millionen von jungen Arbeitern aus dem Lohnarbeitsprozess ausgeschlossen wurden. Dieses Phänomen ist seit 35 Jahren wirksam und erfuhr in den letzten zehn Jahren eine brutale Verschärfung. Es hat zu einem massiven Wachstum jener Gesellschaftsschichten geführt, die zur nichtausbeutenden und keinen Lohn empfangenden Schichten der Bevölkerung gehören. Diese dem Verhungern nah überlassenen Teile der Gesellschaft, die um ihr tagtägliches Brot kämpfen müssen, nehmen ständig zu.
In Lateinamerika leben 221 Millionen Menschen (41 Prozent der Bevölkerung) in Armut. Diese Zahl ist allein im letzten Jahr um sieben Millionen (von denen sechs Millionen in eine extreme Armut absanken) und in den letzten zehn Jahren um 21 Millionen angestiegen. Gegenwärtig leben 20 Prozent der lateinamerikanischen Bevölkerung in äusserster Armut. (7)
Die Verschärfung des gesellschaftlichen Zerfalls zeigt sich im Wachstum der informellen, scheinselbstständigen Wirtschaft des Strassenverkaufs. Das Ausmass dieses Sektors variiert entsprechend der Wirtschaftskraft eines Landes. In Bolivien übertraf im Jahr 2000 die Zahl der Scheinselbstständigen die der Lohnempfänger (47,8 zu 44,5 Prozent der aktiven Bevölkerung), während in Mexiko das Verhältnis noch 21:74,4 beträgt.
Auf dem ganzen Kontinent leben 128 Millionen Menschen oder 33 Prozent der städtischen Bevölkerung in Elendsquartieren. Diese Millionenmassen leben beinahe ohne jegliche sanitäre Installationen und elektrischen Strom. Ihr Leben ist geprägt von Kriminalität, von Drogen und vom Bandenwesen. In den Elendsvierteln von Rio finden seit Jahren Kämpfe zwischen rivalisierenden Gangs statt, eine Situation, die im Film La Ciudade de Deus anschaulich porträtiert wurde. Die Arbeiter Lateinamerikas und insbesondere jene in den Elendsquartieren sind mit den weltweit höchsten Kriminalitätsraten konfrontiert. Die Zerstörung der familiären Bindungen hat zu einer massiven Zunahme von ihrem Schicksal überlassenen Strassenkindern geführt.
Millionen von Bauern haben immer grössere Schwierigkeiten, dem Boden auch nur die miserabelsten Subsistenzmittel zu entreissen. In einigen tropischen Gebieten hat, neben der Holzindustrie, dies zu einer Beschleunigung der Umweltzerstörung geführt, da die landhungrigen Bauern dazu gezwungen sind, auf den Boden des Regenwaldes vorzudringen. Diese Lösung bringt jedoch nur eine kurze Atempause, da die dünne Humusschicht des Regenwaldes schnell ausgelaugt ist, und endet in einer Spirale der Entwaldung.
Die Zunahme der Schicht der Verelendeten hatte eine bedeutende Auswirkung auf die Fähigkeit des Proletariats, die eigene Klassenautonomie zu verteidigen. Das hat sich ganz klar Ende der 80er-Jahre gezeigt, als in Venezuela, Argentinien und Brasilien Hungerrevolten ausbrachen. Mit Hinweis auf den Aufstand in Venezuela, in dem mehr als Tausend Menschen umkamen und ebenso viele verletzt wurden, warnten wir damals vor den Gefahren solcher Aufstände für das Proletariat: „Die treibende Kraft dieser gesellschaftlichen Tumulte war eine blinde, perspektivlose Wut, die sich über lange Jahre systematischer Angriffe gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen jener, die noch eine Arbeit hatten, aufgestaut hatte. In ihnen entluden sich die Frustrationen von Millionen von Arbeitslosen, von Jungen, die nie gearbeitet haben und die von der Gesellschaft gnadenlos in den Sumpf der Verelendung getrieben wurden. Die Länder der Peripherie des Kapitalismus sind unfähig, diesen Menschen auch nur die geringste Lebensperspektive aufzuzeigen (...)Aufgrund des Mangels einer politischen Orientierung auf eine proletarische Perspektive sind diese Strassenunruhen mit den Brandschatzungen von Autos, den ohnmächtigen Konfrontationen mit der Polizei und später mit den Plünderungen von Lebensmittel- und Elektrowarengeschäften einzig von der Wut und der Frustration angetrieben worden. Die Bewegung, die als Protest gegen die wirtschaftlichen Massnahmen entstanden war, hat sich also sehr rasch in Plünderungen und perspektivlosen Zerstörungen aufgelöst.“ (8)
In den 90er-Jahren wurde die Verzweiflung der nicht-ausbeutenden Schichten in zunehmendem Masse von Teilen des Bürgertums und des Kleinbürgertums ausgenutzt. In Mexiko haben sich die Zapatistas mit ihren Ideen über die „Volksmacht“ und ihrer Eigendarstellung als Repräsentant eben dieser Macht anfangs als Meister darin ausgewiesen. In Venezuela hat Chavez die nicht-ausbeutenden Schichten, vor allem die Bewohner der Elendsviertel, hinter der Idee einer „Volksrevolution“ gegen das alte, korrumpierte System mobilisiert.
Diese Volksbewegungen hatten reale Auswirkungen auf das Proletariat, insbesondere in Venezuela, wo nach wie vor die Gefahr einer teilweisen Verstrickung in einem blutigen Bürgerkrieg zwischen den rivalisierenden Fraktionen der Bourgeoisie besteht.
Die Morgendämmerung des 21. Jahrhunderts hat keine Verminderung der zerstörerischen Auswirkungen der Verzweiflung der nicht-ausbeutenden Schichten mit sich gebracht. Im Dezember 2001 ist das argentinische Proletariat – es ist eines der ältesten und erfahrensten der lateinamerikanischen Arbeiterklasse – in einen Volksaufstand gerissen worden, der in einem Zeitraum von 15 Tagen fünf Präsidenten hintereinander von der Macht weggeputzt hatte. Im Oktober 2003 ist der Hauptsektor der bolivianischen Arbeiterklasse, die Minenarbeiter, ebenfalls in einen blutigen, vom Kleinbürgertum und den Bauern angeführten Volksaufstand verstrickt worden, in dem es zahlreiche Tote und Verletzte gab – und dies alles im Namen der Verteidigung der bolivianischen Gasreserven und der Legalisierung der Koka-Produktion!
Die Tatsache, dass bedeutende Teile des Proletariats von diesen Revolten erfasst worden sind, ist von grosser Bedeutung, weil dies offenbart, dass die Arbeiterklasse die Klassenautonomie weitgehend verloren hat. Anstatt sich als Proletarier mit eigenen Interessen zu verstehen, haben sich die Arbeiter Boliviens und Argentiniens als Bürger verstanden, die gemeinsame Interessen mit den kleinbürgerlichen und nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft teilen.
Die absolute Notwendigkeit einer revolutionären Klarheit
Mit der Verschärfung der Lage wird es weitere Aufstände dieses Typs geben, in denen es, wie das bereits in Venezuela der Fall war, auch blutige Bürgerkriege und Massaker geben kann, die bedeutende Teile der internationalen Arbeiterklasse physisch und ideologisch vernichten können. Angesichts dieser düsteren Perspektive ist es die Pflicht der Revolutionäre, ihre Intervention auf die Notwendigkeit auszurichten, dass das Proletariat einen Kampf zur Verteidigung der eigenen, spezifischen Klasseninteressen führen muss. Unglücklicherweise befinden sich nicht alle revolutionären Organisationen diesbezüglich auf der Höhe der eigenen Verantwortung. Das Internationale Büro der revolutionären Partei (IBRP) verlor gegenüber dem Gewaltausbruch der argentinischen Bevölkerung jeglichen politischen Kompass und schätzte die Lage völlig falsch ein: „Spontan sind die Arbeiter auf die Strassen gegangen und haben die Jungen, Studenten und bedeutende Teile des proletarisierten und wie sie selber verarmten Kleinbürgertums mit sich gezogen. Gemeinsam haben sie ihre Wut gegen die heiligen Stätten des Kapitalismus gerichtet: gegen Banken, Büros, aber hauptsächlich gegen Kaufhäuser und allgemein gegen Geschäfte, die ebenso angegriffen wurden wie die Bäckereien in den mittelalterlichen Brotaufständen. Die Regierung entfesselte eine blutige Repression mit Dutzenden von Toten und Tausenden Verletzten und hoffte so, die Rebellen einzuschüchtern. Das hat aber kein Ende der Revolte herbeigeführt, sondern sie ist im Gegenteil auf den Rest des Landes ausgedehnt worden und nahm immer mehr einen Klassencharakter an. Selbst die Regierungsgebäude, Symbole der Ausbeutung und der finanziellen Plünderung, sind angegriffen worden.“ (9)
Erst kürzlich hat Battaglia Comunista angesichts des sozialen Aufruhrs in Bolivien, der in den blutigen Ereignissen vom Oktober 2003 kulminierte, einen Artikel veröffentlicht, der die indianischen Ayllu (Gemeinderäte) pries: „Die Ayllu hätten nur eine Rolle in der revolutionären Strategie spielen können, wenn sie den gegenwärtigen Institutionen den proletarischen Inhalt der Bewegung entgegengestellt und die archaischen und lokalistischen Aspekte überwunden hätten, d.h. also nur, wenn sie als wirksamer Mechanismus für eine Einheit zwischen Indianern, weissen und farbigen Proletariern zur Errichtung einer Front gegen die Bourgeoisie und jenseits jeglicher rassischer Rivalitäten gewirkt hätten (...) Die Ayllu hätten ein Ausgangspunkt für die Vereinigung und Mobilisierung des indianischen Proletariats sein können, aber das ist noch unzureichend als Grundlage für die Errichtung einer vom Kapitalismus emanzipierten Gesellschaft.“ Dieser Artikel von Battaglia Comunista wurde im November 2003 veröffentlicht, also nachdem sich die blutigen Ereignisse vom Oktober zugetragen hatten, in denen just das indianische Kleinbürgertum das Proletariat und insbesondere die Minenarbeiter zu einer hoffnungslosen Auseinandersetzung mit den Armeekräften verleitete. Ein Massaker, in dem Proletarier geopfert wurden, damit die indianische Bourgeoisie und das indianische Kleinbürgertum ein grösseres „Stück vom Kuchen“ ergattern konnten bei der Neuverteilung von Macht und Profiten, die aus der Ausbeutung der Bergarbeiter und Landarbeiter stammen. Wie einer ihrer Führer, Alvero Garcia, freimütig zugab, haben die Indianer keine verschwommenen Träume über die Ayllu als Ausgangspunkt für eine bessere Gesellschaft.
Der Enthusiasmus des IBRP bezüglich der Ereignisse in Argentinien ist die logische Folge seiner Analyse über die „Radikalisierung des Bewusstseins“ der nicht-ausbeutenden Schichten in den peripheren Ländern: „Die Diversität der sozialen Strukturen, die Tatsache, dass das Aufzwingen der kapitalistischen Produktionsweise das alte Gleichgewicht umkippt und dass die Aufrechterhaltung ihrer Existenz auf die Grundlage und Ausweitung der Verelendung von immer grösseren Massen von Proletarisierten und Enterbten fusst, die politische Unterdrückung und Repression, die notwendig zur Unterjochung der Massen sind, all das führt zu einem grösseren Potenzial für die Radikalisierung des Bewusstseins in den peripheren Ländern als in den Metropolen (...) In vielen dieser (peripheren) Länder ist die ideologische und politische Integration des Individuums in die kapitalistische Gesellschaft noch kein Massenphänomen wie in den Ländern der Metropolen.“ (10)
Gemäss diesem Standpunkt sind diese massiven und gewaltsamen Volksaufstände positiv. In der Vorstellung des IBRP ist das Untertauchen des Proletariats in der Welle des Interklassismus nicht der Ausdruck einer sterilen und zukunftslosen Revolte, sondern die Konkretisierung „einer Radikalisierung des Bewusstseins“. Infolgedessen hat sich das IBRP als völlig unfähig erwiesen, die wirklichen Lehren aus Ereignissen wie die des Dezembers 2001 in Argentinien zu ziehen.
Sowohl in den „Thesen“ als auch in den Analysen der konkreten Situationen begeht das IBRP zwei Fehler, die gewisse Allgemeinplätze der Linken und der Antiglobalisierungsbewegung widerspiegeln. Der erste Fehler ist die theoretische Ansicht, dass die Bewegungen zur Verteidigung nationaler, bürgerlicher oder kleinbürgerlicher Interessen, die mit denen des Proletariats unvereinbar sind (wie die Ereignisse in Bolivien oder der Aufstand vom Dezember 2001 in Argentinien), in Arbeiterkämpfe umgewandelt werden könnten. Der zweite, eher empirische Fehler besteht in der Einbildung, dass diese wundersame Umwandlung auch tatsächlich stattgefunden hat und dass Bewegungen, die vom Kleinbürgertum und von nationalistischen Sprüchen dominiert werden, wirkliche Arbeiterkämpfe sind.
Wir sind bereits in einem Artikel in der Internationalen Revue Nr. 30 („Volksaufstand in Argentinien: Nur auf dem Klassenterrain des Proletariats kann die Bourgeoisie zurückgedrängt werden“) mit dem IBRP bezüglich seiner politischen Desorientierung angesichts der Ereignisse in Argentinien ins Gericht gegangen. Am Ende dieses Artikels fassen wir unseren Standpunkt zusammen: „Unsere Analyse bedeutet absolut nicht, dass wir die Kämpfe des Proletariats in Argentinien und in anderen Zonen, wo der Kapitalismus schwächer ist, mit Verachtung strafen oder unterschätzen. Sie bedeutet einfach, dass Revolutionäre, als die Vorposten des Proletariats und mit einer klaren Vision von der Marschrichtung der proletarischen Bewegung als Ganzes ausgestattet, die Verantwortung haben, deutlich und exakt auf die Stärken und Grenzen des Arbeiterkampfes hinzuweisen, darauf, wer die Verbündeten sind und welche Richtung sein Kampf einschlagen sollte. Um dem gerecht zu werden, müssen sich Revolutionäre mit all ihrer Kraft der opportunistischen Versuchung – durch Ungeduld, Immediatismus oder einen historischen Mangel an Vertrauen in das Proletariat – entgegenstemmen und dürfen nicht eine Klassen übergreifende Revolte (wie wir sie in Argentinien gesehen haben) mit einer Klassenbewegung verwechseln.“ (11)
Das IBRP hat auf unsere Kritik geantwortet (12) und die Position, wonach das Proletariat diese Bewegung angeführt hatte, verteidigt und gleichzeitig die Auffassung der IKS verurteilt: „Die IKS unterstreicht die Schwächen des Kampfes und weist auf die interklassistische und heterogene Natur und die linksbürgerliche Führung hin. Sie beklagt sich über die Gewalt innerhalb der Klasse und über die vorherrschenden bürgerlichen Ideologien wie den Nationalismus. Für die IKS macht der Mangel an kommunistischem Bewusstsein aus dieser Bewegung eine ‚sterile Revolte ohne Zukunft’.“Es ist klar, dass das IBRP unsere Analyse nicht verstanden hat, oder besser: sie ziehen es vor, sie als das zu betrachten, als was sie sie betrachten wollen. Wir können die Leser nur dazu ermutigen, unseren Artikel zu lesen.
Im Gegensatz zu diesem Standpunkt analysiert der Nucleo Comunista Internationalista (NCI) – eine Gruppe, die sich in Argentinien Ende des Jahres 2003 gebildet hat – diese Ereignisse ganz anders und zieht entsprechend auch andere Schlussfolgerungen. In der zweiten Nummer seines Bulletins führte der NCI eine Polemik mit dem IBRP über die Natur der Ereignisse in Argentinien: „Das IBRP sagt fälschlicherweise, dass das Proletariat Studenten und andere soziale Schichten hinter sich gerissen habe. Das ist ein grosser Irrtum, den es mit den Genossen der GCI12 teilt. Tatsache ist, dass die Arbeiterkämpfe, die während des Jahres 2001 stattgefunden haben, die Unfähigkeit des argentinischen Proletariats aufgezeigt haben, nicht nur die Führung der Gesamtheit der Arbeiterklasse, sondern auch der auf den Strassen protestierenden sozialen Bewegung zu übernehmen und alle nicht ausbeutenden Schichten hinter sich zu scharen. Im Gegenteil waren es nicht-proletarische Schichten, die sich in den Ereignissen vom 19. und 20. Dezember an die Spitze stellten. Also können wir sagen, dass die Entwicklung dieser Bewegungen keine historische Zukunft aufwiesen, was sich auch im darauf folgenden Jahr bestätigt hat.“ (13)
Die GCI sagt bezüglich der Verstrickung von Proletariern in Plünderungen Folgendes: „Es gab mehr als nur den Willen, den Unternehmen und Banken soviel Geld wie möglich zu klauen. Es handelte sich um einen allgemeinen Angriff auf die Welt des Geldes, des Privateigentums, der Banken und des Staates, gegen diese Welt, die eine Beleidigung für das menschliche Leben ist. Das ist nicht nur eine Frage der Enteignung, sondern auch eine Behauptung des revolutionären Potenzials, des Potenzials zur Zerstörung einer Gesellschaft, die die Menschen zerstört.“ (14)
Der NCI stellt sich gegen eine solche Sichtweise und präsentiert eine ganz andere Analyse über die Beziehung zwischen diesen Ereignissen und der Entwicklung des Klassenkampfes:
„Die Kämpfe in Argentinien in der Periode 2001–2002 sind kein isoliertes Ereignis, sie waren das Produkt einer längeren Entwicklung, die wir in drei Teile aufteilen können:
a) Erstes Element 2001: Wie wir bereits weiter oben gesagt haben, war 2001 von einer Serie von Kämpfen für typische Arbeiterforderungen geprägt. Ihr gemeinsamer Nenner war die Isolierung gegenüber anderen Abteilungen des Proletariats und die Prägung der Konterrevolution: die Vermittlung, die von der Hegemonie der politischen Führung der Gewerkschaftsbürokratie gesichert war.
Trotz dieser Begrenztheit konnte man bedeutende Manifestationen von Arbeiterselbstorganisation erkennen wie beispielsweise der Minenarbeiter von Rio Turbio im Süden des Landes, in Zanon und in Norte de Salta (zusammen mit den Bauarbeitern und arbeitslosen, ehemaligen Erdölarbeitern). Diese kleinen Arbeiterabteilungen bildeten die Avantgarde, die die Notwendigkeit der Einheit der Arbeiterklasse und der streikenden Proletarier zur Debatte stellten.
b) Zweitens die zwei Tage vom 19. und 20. Dezember: Wir wiederholen, dass dies weder eine von Teilen der Arbeiterklasse noch eine von Arbeitslosen angeführte Revolte war, sondern ein interklassistischer Aufstand. Das Kleinbürgertum war darin das zentrale Element, denn die ökonomischen Angriffe der Regierung De La Rua waren direkt gegen seine Interessen und auch, mit dem Dekret vom Dezember 2001 zur Einfrierung der Bankguthaben, gegen ihre Wählerbasis und politische Unterstützung gerichtet ( ...)
c) Drittens muss man vorsichtig sein und sich davor hüten, die so genannten Volksversammlungen zu verherrlichen, die sich in den kleinbürgerlichen Vierteln von Buenos Aires, weit ab von den Arbeitervierteln, an die Spitze der Bewegung stellten. Dennoch gab es in dieser Zeit eine Entwicklung von sehr bescheidenen Kämpfen auf dem Terrain der Arbeiterklasse, die im Begriff waren zu wachsen: Gemeindearbeiter und Lehrer demonstrierten, forderten die Auszahlung ihrer Löhne; Industriearbeiter kämpften gegen die Entlassungen durch die Unternehmerorganisationen (z.B. die Lastwagenfahrer).
Damals besassen die beschäftigten und unbeschäftigten Arbeiter die Möglichkeit nicht nur einer wahren Einheit, sondern auch der Aussaat einer späteren autonomen Klassenorganisation. Dagegen hat die Bourgeoisie versucht, die Arbeiterklasse mit Hilfe der neuen Bürokratie der Piqueteros zu spalten und irrezuführen. Damit ist die Erfahrung, die eine bedeutende Waffe in den Händen der Arbeiter war, verschmäht worden, wie im Fall der so genannten Nationalversammlung der beschäftigten und unbeschäftigten Arbeiter.
Aus diesen Gründen denken wir, dass es ein Fehler ist, die Kämpfe, die sich 2001 und 2002 hindurch ereigneten, mit den Ereignissen vom 19. und 20. Dezember 2001 zu identifizieren, denn sie unterscheiden sich und das eine ist nicht die Konsequenz des anderen.
Die Ereignisse vom 19. und 20. Dezember hatten absolut keinen proletarischen Charakter, da sie weder von Arbeitenden noch von Arbeitslosen angeführt worden waren. Letztere lieferten die Munition für die Slogans und Interessen des Kleinbürgertums von Buenos Aires, die vollständig verschieden sind von den Zielen des Proletariats ( ...)
Dies zu erwähnen ist sehr wichtig, weil in der Periode der Dekadenz des Kapitalismus das Proletariat Gefahr läuft, die Klassenidentität und das Vertrauen in die eigene Rolle als Subjekt der Geschichte und entscheidende Kraft der gesellschaftlichen Umwandlung zu verlieren. Das ist ein Ergebnis des Rückflusses des Klassenbewusstseins, der wiederum das Resultat des Zusammenbruchs des stalinistischen Blocks und des Gewichts der kapitalistischen Propaganda über die Niederlage des Klassenkampfs auf das Denken der Arbeiter ist. Darüber hinaus hat die Bourgeoisie den Arbeitern eingeredet, dass es keinen Klassengegensatz gebe, dass die Leute vielmehr durch die Beteiligung am bzw. den Ausschluss vom Markt vereint oder getrennt würden. Sie versucht also, den blutigen Graben zwischen Proletariat und Bourgeoisie einzuebnen.
Diese Gefahr hat man in Argentinien während der Ereignisse vom 19. und 20. Dezember 2001 gesehen, in denen die Arbeiterklasse nicht fähig war, sich in eine autonome Kraft im Kampf für die eigenen Interessen zu verwandeln. Sie ist vielmehr in den Strudel der interklassistischen Revolte unter der Führung von nicht-proletarischen Schichten gerissen worden ...“ (s.o.)
Der NCI stellt die Ereignisse in Bolivien in denselben Rahmen: „Natürlich muss man den kämpfenden bolivianischen Arbeitern Respekt zollen und sie voll und ganz unterstützen, dennoch ist es notwendig, die Tatsache klarzustellen, dass die Kampfbereitschaft der Klasse nicht das einzige Kriterium zur Bestimmung des Kräfteverhältnisses zwischen Bourgeoisie und Proletariat ist, da die Arbeiterklasse in Bolivien nicht fähig war, eine massive und vereinte Bewegung zu entwickeln, die hinter sich den Rest der nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft hätte vereinigen können. Das Gegenteil hat sich zugetragen: Die Bauern und die Kleinbürger haben diese Revolte angeführt.
Das bedeutet, dass die bolivianische Arbeiterklasse sich in einer interklassistischen ‚Volksbewegung’ aufgelöst hat. Wir behaupten dies aus verschiedenen Gründen:
a) Die Bauernschaft hat diese Revolte mit zwei Zielsetzungen angeführt: die Legalisierung des Kokaanbaus und die Verweigerung des Verkaufs von Erdgas an die USA.
b) Es wurde die Forderung nach einer konstituierenden Versammlung als Mittel erhoben, um aus der Krise herauszukommen und ‚die Nation wieder aufzubauen’.
c) Nirgendwo hat diese Bewegung den Kampf gegen den Kapitalismus zuvorderst gestellt.
Die Ereignisse in Bolivien weisen eine grosse Ähnlichkeit mit denen in Argentinien 2001 auf, wo das Proletariat ebenfalls durch die Slogans des Kleinbürgertums aufgerieben worden ist. Diese ‚Volksbewegungen’ enthielten tatsächlich einen ziemlich reaktionären Aspekt, indem sie den Wiederaufbau der Nation oder den Rauswurf der ‚Gringos’ und die Rückgabe der Rohstoffe an den bolivianischen Staat propagierten (...) Die Revolutionäre müssen Klartext sprechen und sich illusionslos und ohne Selbsttäuschung auf die Tatsachen des Klassenkampfs stützen. Es ist notwendig, eine proletarische, revolutionäre Position einzunehmen, denn es wäre ein ernster Fehler, eine soziale Revolte mit einem engen politischen Horizont mit einem proletarischen antikapitalistischen Kampf zu verwechseln.“ (15)
Diese Analyse des NCI stützt sich auf die wirklichen Tatsachen und zeigt ganz klar auf, dass das IBRP die eigenen Wünsche zur Realität erhebt, wenn es die Idee der „Radikalisierung des Bewusstseins“ unter den nicht-ausbeutenden Schichten propagiert. Die konkrete Situation in der Peripherie ist die wachsende Zerstörung der gesellschaftlichen Beziehungen, die Propagierung des Nationalismus, des Populismus und anderer ähnlich reaktionärer Ideologien, die alle sehr ernste Folgen für die Fähigkeit des Proletariats haben, die eigenen Klasseninteressen zu verteidigen.
Glücklicherweise scheint diese Tatsache doch nicht vollständig unbemerkt von gewissen Publikationen des IBRP zu bleiben. Die Nummer 30 der Revolutionary Perspectives (Organ der Communist Workers Organisation, der Gruppe des IBRP in Grossbritannien) präsentiert im Editorial „Die imperialistischen Rivalitäten spitzen sich zu, der Klassenkampf muss sich zuspitzen“ ein der Realität viel näheres Bild der Ereignisse in Argentinien und in Bolivien: „Wie in Argentinien waren diese Proteste interklassistisch und ohne klare soziale Zielsetzung. Wir haben dies im Fall Argentiniens gesehen, wo die gewaltsame Agitation vor zwei Jahren den Weg für die Austerität und Verarmung geebnet hatte (...) Während der Ausbruch der Revolte die Wut und die Verzweiflung der Bevölkerung in vielen peripheren Ländern aufzeigt, können solche Ausbrüche gleichwohl keinen Ausweg aus der dort existierenden katastrophalen gesellschaftlichen Lage finden. Der einzige Weg nach vorn ist der Klassenkampf und seine Verbindung mit den Arbeiterkämpfen der Metropolen.“
Der Artikel denunziert indessen unglücklicherweise nicht die Rolle des Nationalismus oder der indianischen Kleinbourgeoisie in Bolivien. So bleibt die offizielle Position des IBRP bezüglich dieser Frage notwendigerweise jene, die von Battaglia Comunista vertreten wird, wonach „die Ayllu ein Ausgangspunkt für die Vereinigung und die Mobilisierung des indianischen Proletariats sein könnten“. Die Realität ist, dass die Ayllu der Ausgangspunkt für die Mobilisierung des indianischen Proletariats hinter dem indianischen Kleinbürgertum, den Bauern und Kokapflanzern in ihrem Kampf gegen die regierende Fraktion der Bourgeoisie waren.
Diese Verirrung von Battaglia Comunista, den „indianischen Gemeinderäten“ ein Potenzial bei der Entwicklung des Klassenkampfes zuzuschreiben, ist vom NCI nicht unbemerkt geblieben. Er sah es als notwendig an, Battaglia zu dieser Frage zu schreiben. Nachdem er betont hatte, was die Ayllu tatsächlich sind, nämlich „ein Kastensystem zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Unterschiede zwischen der Bourgeoisie, gleich, ob weiss, mestizisch oder eingeboren, und dem Proletariat“, richtet der NCI in seinem Brief (datiert vom 14. November 2003) folgende Kritik an Battaglia: „Unserer Ansicht nach handelt es sich bei dieser Position um einen schwerwiegenden Irrtum, da sie dieser traditionellen eingeborenen Institution die Fähigkeit zuspricht, Ausgangspunkt für die Arbeiterkämpfe in Bolivien zu sein, auch wenn sie in der Folge ihre Grenzen aufzeigt. Wir betrachten die Aufrufe der Anführer der Volksrevolte zur Wiederherstellung der mythischen Ayllu als Spaltung zwischen den weissen und den indianischstämmigen Arbeitern. Dies ist auch der Fall bei der Forderung an die herrschende Klasse nach einem grösseren Anteil am Kuchen, der vom Mehrwert, das aus dem bolivianischen Proletariat, gleich, welcher Herkunft, herausgepresst wurde, produziert wird.
Jedoch glauben wir fest daran, dass im Gegensatz zu eurer Erklärung der ‚Ayllu’ niemals als ‚ein Beschleuniger und Integrator in einem einzigen und gemeinsamen Kampf’ wird wirken können, da er von reaktionärer Natur ist und die ‚eingeborene’ Annäherung eine Idealisierung (eine Verfälschung) der Geschichte dieser Gemeinden darstellt, da ‚im Inkasystem die Gemeindeelemente des Ayllu in ein unterdrückerisches Kastensystem im Dienste der Oberschicht, der Inkas, eingebunden waren’ (Osvaldo Coggiola, „L’indigénisme bolivarien“). Aus diesem Grund ist es ein schwerwiegender Fehler zu meinen, dass der Ayllu als Beschleuniger und Integrator der Kämpfe wirken könnte.
Es ist wahr, dass die bolivianische Rebellion von eingeborenen Gemeinschaften von Bauern und Kokapflanzern angeführt worden ist, aber gerade hier liegt auch der grosse Schwachpunkt und nicht etwa die Stärke, da es sich um eine einfache und simple Volksrebellion handelt, in der die Arbeiter nur eine zweitrangige Rolle spielen. Die bolivianische interklassistische Revolte leidet also an der Abwesenheit einer revolutionären Arbeiterperspektive. Im Gegensatz zu den Gedanken gewisser Strömungen des trotzkistischen und guevaristischen Lagers kann man diese Revolte keinesfalls als ‚Revolution’ bezeichnen. Die eingeborenen Bauernmassen setzten sich in keinem Augenblick den Umsturz des kapitalistischen Systems in Bolivien zum Ziel. Im Gegenteil: Wir haben bereits gesagt, dass die Ereignisse in Bolivien sehr stark vom Chauvinismus geprägt sind: Verteidigung der nationalen Würde, Verweigerung des Erdgasverkaufs an Chile, Widerstand gegen die Ausmerzung der Kokapflanze.“
Die Rolle der Ayllu in Bolivien findet in der mexikanischen AZLN (Zapatistische Armee der nationalen Befreiung) ein Ebenbild: Sie hat die eingeborenen Gemeindeorganisationen zur Mobilisierung der indianischen Kleinbourgeoisie, der Bauern und Proletarier von Chiapas und anderen Regionen Mexikos im Kampf gegen die Hauptfraktion der mexikanischen Bourgeoisie gebraucht. Dieser Kampf stand auch im interimperialistischen Spannungsfeld zwischen den USA und gewissen europäischen Mächten.
Diese Sektoren der indianischen Bevölkerung Lateinamerikas sind weder ins Proletariat noch in die Bourgeoisie integriert worden und sind einer extremen Armut und Marginalisierung ausgeliefert. Diese Situation „hat Intellektuelle und gewisse Strömungen des Kleinbürgertums und der Bourgeoisie dazu veranlasst, nach Argumenten zu suchen, weshalb die Indianer ein gesellschaftlicher Körper mit einer historischen Alternative seien und wie sie als Kanonenfutter für den so genannten Kampf für die ethnische Verteidigung zu gebrauchen seien. Tatsächlich befinden sich hinter diesen Kämpfen aber die Interessen der Bourgeoisie. Man hat das nicht nur in Chiapas, sondern auch in Ex-Jugoslawien gesehen, wo die ethnischen Fragen von der Bourgeoisie manipuliert wurden, um einen formellen Vorwand für den Kampf der imperialistischen Mächte zu liefern.“ (16)
Die vitale Rolle der Arbeiterklasse in den zentralen Ländern des Kapitalismus
Das Proletariat ist mit einer sehr ernsthaften Verschlechterung der gesellschaftlichen Umwelt konfrontiert, in der es leben und kämpfen muss. Seine Fähigkeit, ein Vertrauen in sich selbst zu entwickeln, ist vom zunehmenden Gewicht der Hoffnungslosigkeit der nicht-ausbeutenden Schichten bedroht. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Kräfte nutzen diese Situation für ihre eigenen Zwecke aus. Es wäre eine sehr schwerwiegende Vernachlässigung unserer Verantwortung, wenn wir diese Gefahr unterschätzen würden.
Nur durch die Entwicklung der Unabhängigkeit als Klasse und die Behauptung der Klassenidentität, durch die Stärkung des Vertrauens in die Fähigkeiten zur Verteidigung der eigenen Interessen wird das Proletariat zu einer Kraft werden, der es möglich ist, die anderen nicht-ausbeutenden Schichten der Gesellschaft hinter sich zu scharen.
Die Geschichte des Arbeiterkampfes in Lateinamerika zeigt, dass die Arbeiterklasse eine lange und reiche Erfahrung aufweist. Die Anstrengungen der argentinischen Arbeiter 2001 und 2002 zur Wiederaufnahme von unabhängigen Klassenkämpfen (beschrieben in den Zitaten vom NCI (17)) zeigen, dass die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse intakt ist. Sie trifft jedoch auf grosse Schwierigkeiten, die Ausdruck von bereits langanhaltenden Schwächen des Proletariats in der Peripherie des Kapitalismus und der enormen materiellen und ideologischen Kraft des Zerfallsprozesses in diesen Regionen sind. Es ist kein Zufall, wenn die bedeutendsten Ausdrücke der Klassenautonomie in Lateinamerika in den 60er- und 70er-Jahren liegen, mit anderen Worten: vor dem Prozess des Zerfalls und seiner negativen Auswirkungen auf die Klassenidentität des Proletariats. Eine solche Situation verstärkt nur die historische Verantwortung des Proletariats in den industriellen Konzentrationen im Herzen des Kapitalismus. Dort befinden sich die am weitesten vorangeschrittenen und die gegenüber den zersetzenden Auswirkungen des Zerfalls widerstandsfähigsten Teile der Arbeiterklasse. Das Signal zur Beendigung der fünfzigjährigen konterrevolutionären Phase Ende der 60er-Jahre war in Europa ertönt und das Echo hallte in Lateinamerika wider. Aus demselben Grunde wird die Rekonstituierung der Arbeiterklasse als historisches Gegengift zum kapitalistischen Verfall notwendigerweise von den konzentriertesten und politisch erfahrensten Bataillonen der Arbeiterklasse ausgehen, an erster Stelle von jenen in Westeuropa. Das bedeutet nicht, dass die Arbeiter Lateinamerikas keine vitale Rolle in der zukünftigen Generalisierung und Internationalisierung der Kämpfe spielen werden. Von allen Sektoren der Arbeiterklasse in der Peripherie des Systems sind sie gewiss die politisch am fortgeschrittensten. Das beweist die Existenz einer revolutionären Tradition in diesem Teil der Welt und auch das gegenwärtige Auftauchen von neuen Gruppen auf der Suche einer revolutionären Klarheit. Diese Minoritäten sind der Gipfel eines proletarischen Eisbergs, der die unsinkbare Titanic des Kapitals zum Sinken bringt.
Phil
Fußnoten:
1 s. Punkt 9 der Plattform der IKS.
2 Friedrich Engels/Karl Marx, Die heilige Familie, in: MEW, Bd. 2, S. 38.
3 s. Argentinien sechs Jahre nach Cordoba“, in: World Revolution, Nr. 1, 1975, S. 15f.
4 s. Der unaufhaltsame Fall von Allende, in: World Revolution Nr. 268.
5 s. Mexiko: Arbeiterkämpfe und revolutionäre Intervention, in: World Revolution, Nr. 124, Mai 1989.
6 Der schwierige Weg zur Vereinheitlichung des Klassenkampfes, in: World Revolution Nr. 124, Mai 1989.
7 nach Angaben der Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC).
8 s. Kommuniqué an die gesamte Arbeiterklasse, in: Internacionalismo, Organ der IKS in Venezuela, zit. nach: World Revolution Nr. 124, Mai 1989.
9 s. Lektionen aus Argentinien: Positionsbezug des IBRP: Entweder die revolutionäre Partei und der Sozialismus oder die verallgemeinerte Armut und der Krieg, in: Internationalist Communist, Nr. 21, Herbst/Winter 2002.
10 s. Thesen über die kommunistischen Taktiken für die Peripherie des Kapitalismus, siehe: www.ibrp.org [108]. Die IKS kritisiert diese Thesen in: Der Kampf der Arbeiterklasse in den peripheren Ländern des Kapitalismus, in: Revue Internationale Nr. 100.
11 s. Volksaufstand in Argentinien: Nur auf dem Klassenterrain des Proletariats kann die Bourgeoisie zurückgedrängt werden, in: Internationale Revue, Nr. 30, November 2002.
12 s. Arbeiterkämpfe in Argentinien: Polemik mit der IKS“, in: Internationalist Communist, Nr. 21, Herbst/Winter 2002.
13 s. Zwei Jahre nach dem 19. und 20. Dezember, in: Revolucion Comunista, Nr. 2.
14 s. A propos Klassenkampf in Argentinien, in: Communismo, Nr. 49.
15 Die bolivianische Revolte, in: Revolucion Comunista, Nr. 1.
16 s. Einzig die proletarische Revolution kann die Indianer befreien, in: Revolucion Mundial, Nr. 64, September/Oktober 2001. Organ der IKS in Mexiko.
17 s. Révolution Internationale, Nr. 315, September 2001.
Geographisch:
- Süd- und Mittelamerika [115]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Anmerkungen zur Geschichte der imperialistischen Konflikte
- 1916 Aufrufe
Anmerkungen zur Geschichte der imperialistischen Konflikte im Nahen Osten (Teil I)
Im Laufe der vergangenen hundert Jahre war der Nahe Osten oft Schauplatz imperialistischer Kriege.
Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten drei offene Kriege zwischen Israel und seinen feindlichen Nachbarn (1949, 1967, 1973), ein permanenter Kriegszustand zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Kämpfern (mit den bewaffneten Terroristenbanden und Selbstmordattentätern auf der einen und dem israelischen Staatsterror auf der anderen Seite), ein acht Jahre langer Krieg zwischen Iran und Irak, unablässige Scharmützel zwischen kurdischen Nationalisten und dem türkischen Staat, 20 Jahre Krieg in Afghanistan, der Golfkrieg 1991 und die Besetzung des Iraks 2003, die nur eine Verschlimmerung des Kriegszustandes zur Folge hatte.
Kein anderer Teil der Erde zeigt deutlicher, dass der Kapitalismus nur durch Krieg und Zerstörung überleben kann, dass alle Länder – ob gross oder klein – imperialistisch sind, dass keine systemimmanente Auflösung der kapitalistischen Widersprüche möglich ist, dass der Krieg seine eigene Dynamik geschaffen hat und die Arbeiter sich auf dem internationalistischen Terrain vereinigen und gemeinsam jeden Nationalismus bekämpfen müssen.
Diese kurze Geschichte des Nahen Ostens hat zum Ziel aufzuzeigen, dass die Vielzahl der regionalen und lokalen Konflikte in dieser Region nur im Zusammenhang mit dem weltweiten Imperialismus verstanden werden kann.
Der Nahe Osten: Schnittpunkt der imperialistischen Interessen aller kapitalistischer Mächte
Zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer, zwischen Asien, Europa und Afrika gelegen, war der Nahe Osten schon lange bevor seine Erdölvorkommen entdeckt wurden ein umstrittenes Gebiet.
Seit dem Beginn der Expansion des kapitalistischen Europas in diese Region haben die globalen strategischen Interessen die Politik der verschiedenen Mächte bestimmt. Diese haben sich nie nur wegen der Nachfrage nach diesem oder jenem Rohstoff die Stirn geboten.
Schon in seiner frühen Expansionsphase, noch bevor die industrielle Revolution voll in Schwung kam, beeilte sich der britische Kapitalismus, in Indien Fuss zu fassen und seinen französischen Rivalen von dort zu vertreiben. Bereits im frühen 19. Jahrhundert wurde Grossbritannien zur vorherrschenden Macht. Systematisch bemühte sich Grossbritannien darum, strategisch wichtige Stellungen auf dem Weg nach Indien zu besetzen. 1839 wurde Aden (im heutigen Yemen) besetzt und die Briten übernahmen die Polizeifunktion an der Golfküste, wo Piraten die Handelsentwicklung beeinträchtigt hatten.
Aber der Nahe Osten entwickelte sich schnell auch zu einem Expansionsziel des russischen Kapitalismus. Nach den Zusammenstössen mit Persien (1828) und seinen wiederholten Kriegen gegen das osmanische Reich – allein im 19. Jahrhundert führten Russland und die Türkei dreimal Krieg gegeneinander (1828, 1855 und 1877); im Krimkrieg von 1853–56 stiess Russland mit der Türkei, mit Grossbritannien, Frankreich und Italien am Schwarzen Meer zusammen – Russland versuchte, in Richtung Kaukasusregion, Kaspisches Meer und in Richtung der heute unter den Namen Kasachstan und Tadschikistan geläufigen Region zu expandieren. Sein Hauptziel war der Zugang zum Indischen Ozean via Afghanistan und Indien.
Um die russische Expansion in diese Gegend abzuwehren, nahm Grossbritannien zweimal Afghanistan ein (1839–1842 und 1878–1880). Nach seinem Sieg im zweiten Afghanistankrieg errichtete Grossbritannien ein Marionettenregime in diesem Land.[1]
Als sich Ende des 19. Jahrhunderts der deutsche Imperialismus in Richtung Balkan und Naher Osten ausbreitete, beschlossen Grossbritannien und Russland, ihren Konflikt über die Vorherrschaft in Asien beizulegen. Sie einigten sich darauf, das Gebiet rund um Afghanistan aufzuteilen, um dem deutschen Vorrücken Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig installierte Grossbritannien 1893 in Afghanistan die „Durand-Linie“. Durand weitete entgegen den Absichten des afghanischen Königs die Grenze gen Osten durch einen schmalen Landstreifen, den Wakhan, aus, der sich durch das Pamirgebirge bis nach China erstreckt, um eine Pufferzone zwischen Russland und Indien zu installieren. 1907 unterzeichneten Grossbritannien und Russland einen Vertrag, der die Gebiete rund um den Iran aufteilte.
Ausserdem erzielte Grossbritannien 1882 einen strategisch bedeutenden Sieg, indem es Ägypten militärisch besetzte und seinen französischen Widersacher, der den 1869 eröffneten Suez-Kanal gebaut hatte, verdrängte. Der Suez-Kanal wurde zum Dreh- und Angelpunkt der britischen Vorherrschaft im Nahen Osten und war von allerhöchster Bedeutung für die britische Herrschaft in Indien und anderen Teilen Asiens und Afrikas. Noch 1956 entsandten Grossbritannien und Frankreich Truppen, um die Kontrolle über den Kanal zu verteidigen, und widersetzten sich damit den USA.
Von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg hatte Grossbritannien die bestimmende Position im Nahen Osten inne und hielt damit seine europäischen Widersacher Russland und Frankreich in Schach.
Wie oben erwähnt, betrachteten die europäischen Kolonialmächte, als sie ihre Kolonien „einsammelten“ und ihre imperialistischen Ziele definierten, die Frage der Rohstoffe, ob Erdöl oder andere, nicht als vorrangig. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Erdölvorkommen des Nahen Ostens von geringer Bedeutung, und auch andere Rohstoffe spielten keine entscheidende Rolle.[2] Schon damals spielten eher strategische und militärische Erwägungen die Hauptrolle.
Die Natur der imperialistischen Konflikte entwickelte jedoch einen qualitativ neuen Charakter, als die Erdkugel Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen den europäischen Grossmächten aufgeteilt war.
Sobald die europäischen Mächte bei dem Versuch, die Welt unter sich und weiteren aufzuteilen (Nordafrika unter Italien und Frankreich, Ägypten und Fachoda/Sudan unter Frankreich und Grossbritannien, Zentralasien unter Grossbritannien und Russland, der Ferne Osten zwischen Russland und Japan, China unter Japan und Grossbritannien, der Pazifik-
raum unter den USA und Japan, Marokko unter Deutschland und Frankreich), aneinander gerieten, nahmen auch die Spannungen im Nahen Osten stark zu.
Deutschland, das verspätet auf dem Weltmarkt erschienen war und verzweifelt versuchte, sich Kolonien anzueignen, konnte diese bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts nur noch Ländern entreissen, die sich bereits „etabliert“ hatten. Das hatte zur Folge, dass Deutschland vor allem versuchte, die Positionen der alleinigen Weltmacht, nämlich Grossbritanniens, zu untergraben. Schon Ende des 19. Jahrhunderts bemühte sich Deutschland darum, eine militärische Präsenz zu errichten. Doch wie wir gesehen haben, war der deutsche Imperialismus zwar in der Lage, die britischen Interessen in dieser Region zu bedrohen und zu untergraben, aber er war unfähig, die britische Herrschaft zu stürzen. Auch wenn er ein ständiger Herausforderer und „Unruhestifter“ besonders der britischen Interessen war, besass er, anders als der britische Imperialismus, nicht die Mittel, um seine Präsenz in der Region zu erzwingen.
Deutschland versuchte also, sich weiter östlich auf dem Balkan auszuweiten (es ist kein Zufall, dass der Erste Weltkrieg dort ausgelöst wurde, nachdem sich die imperialistischen Gegensätze in zwei Balkankriegen 1912–1913 zugespitzt hatten, während denen das osmanische Reich seine europäischen Gebiete an Bulgarien, Serbien, Griechenland und Albanien verlor). Das sich auflösende osmanische Reich wurde zum Angelpunkt der deutschen imperialistischen Ansprüche im Nahen Osten.
Während Marx noch die territoriale Einheit der Türkei als Barriere gegen die russischen Ambitionen im Nahen Osten unterstützt hatte, erkannte Rosa Luxemburg Anfang des 20. Jahrhunderts, dass sich die Weltlage verändert hatte und die Unterstützung der Türkei ein reaktionäres Projekt geworden war. „Dass bei der Vielfältigkeit der nationalen Fragen, welche den türkischen Staat zersprengen: der armenischen, kurdischen, syrischen, arabischen, griechischen (bis vor kurzem noch der albanischen und makedonischen), bei der Mannigfaltigkeit der ökonomisch-sozialen Probleme in den verschiedenen Teilen des Reiches (…) war für jedermann und namentlich für die deutsche Sozialdemokratie seit langem ganz klar, dass eine wirkliche Regeneration des türkischen Staates eine vollständige Utopie ist, und dass jede Anstrengung, diese verfaulten und zusammenbrechenden Ruinen aufrechtzuerhalten, nur ein reaktionäres Unternehmen darstellen kann.“[3]
Für den deutschen Imperialismus war die Türkei das Schlüsselland für seine Ambitionen.[4] Deutschland unterstützte die Türkei militärisch (es bildete den türkischen Generalstab aus, lieferte Waffen und unterzeichnete 1914 einen Beistandspakt für den Kriegsfall); es wurde auch zum wichtigsten Zulieferer finanzieller und technischer Hilfe. Darum hat „die Position des deutschen Imperialismus ihn in Gegensatz zu den anderen europäischen Staaten im Nahen Osten gebracht. Vor allem zu Grossbritannien. Die Errichtung strategischer Bahnen und die Stärkung des türkischen Imperialismus unter deutschem Einfluss wurden aber hier an einem der weltpolitisch empfindlichsten Punkte für Grossbritannien vorgenommen: in einem Kreuzungspunkt zwischen Zentralasien, Persien, Indien einerseits und Ägypten andererseits.“[5]
Eine weitere Ambition des deutschen Imperialismus zu jener Zeit war der Bau der Bagdadbahn, die den deutschen Truppen als elementarer logistischer Hebel dienen sollte.[6]
Der Zusammenbruch des osmanischen Reiches war entscheidend für die Ausbreitung der imperialistischen Konflikte sowohl auf dem Balkan als auch im Nahen Osten.
Bis zum Ersten Weltkrieg war der grösste Teil des Nahen Ostens unter der Kontrolle des osmanischen Reiches. In Asien kontrollierte die Türkei Syrien (einschliesslich Palästina), einen Teil der arabischen Halbinsel (die damals noch keine festen Grenzen hatte), einen Teil der Kaukasusregion und Mesopotamiens (bis nach Bassorah).
Der Zusammenbruch des osmanischen Reiches führte weder auf dem Balkan noch im Nahen Osten zur Bildung einer grossen Industrienation, die auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig gewesen wäre. Im Gegenteil, der imperialistische Druck führte zu einer Aufsplitterung, zur Bildung einer Reihe von „verkrüppelten Kleinstaaten“. Diese Kleinstaaten auf dem Balkan waren während des gesamten 20. Jahrhunderts und bis in unsere Tage ebenso Objekt der imperialistischen Rivalitäten zwischen den Grossmächten, wie der asiatische Teil der Trümmer des osmanischen Reiches, der Nahe Osten, Schauplatz andauernder imperialistischer Konflikte blieb.
Der Ferne Osten blieb, abgesehen von einigen weniger wichtigen Konflikten, abseits des Ersten Weltkrieges. Im Gegensatz dazu war der Nahe Osten schon immer Schlachtfeld konkurrierender Parteien gewesen.[7] Schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges, lange bevor die Palästinafrage und die Frage eines jüdischen Staates gestellt wurde, war die Region ein imperialistisches Minenfeld gewesen. Wie wir aber sehen werden, trugen die Konflikte um Palästina und einen zionistischen Staat zu einer weiteren Verschärfung in einer Region bei, die ohnehin Brennpunkt imperialistischer Konflikte ist.
Der Fall des osmanischen Reiches und die imperialistischen Konstellationen am Ende des Ersten Weltkrieges
Während des Ersten Weltkrieges versuchten die europäischen Länder, ihre „Verbündeten“ in der Region für ihre Kriegsanstrengungen zu mobilisieren.
Grossbritannien, das zusammen mit Russland Deutschland und die Türkei bekämpfte, versuchte, die arabische Bourgeoisie für ein Bündnis gegen die osmanischen Herrscher zu gewinnen. Es ermutigte alle Unabhängigkeitsbestrebungen gegen die türkischen Herrscher, stachelte Stämme der Hedjas (im westlichen Teil der arabischen Halbinsel) auf und unterstützte Sherif Hussein aus Mekka.
Bereits im Ersten Weltkrieg dienten die lokalen Führer als Schachfiguren in den Machtkämpfen der europäischen Mächte. Die Briten konnten sich mit Hilfe von Lawrence von Arabien, der eine wichtige Rolle als Verbindungsoffizier zu den arabischen Rebellen spielte, deren Kampf gegen die Türken zunutze machen. Auch die jüdischen Einwanderer wurden als Kanonenfutter für den englischen Imperialismus rekrutiert.
Nachdem Deutschland die Türkei im Februar 1915 dazu gedrängt hatte, eine Offensive gegen die englischen Stellungen in Ägypten zu führen, um sich des Suez-Kanals zu bemächtigen (eine Offensive, die bereits nach wenigen Tagen aus Mangel an logistischer Unterstützung und an Waffenlieferungen scheiterte), erwies sich die Türkei als die grosse Verliererin des Krieges.
Dies entfachte umgekehrt die imperialistischen Gelüste sowohl der europäischen Mächte als auch der lokalen arabischen Herrscher. In der Hoffnung, von der Gelegenheit zu profitieren, lieferten sich im Sommer 1917 die von Sherif Hussein kommandierten arabischen Truppen ein richtiggehendes Wettrennen mit der englischen Armee, um sich Teile des türkischen Gebietes zu schnappen. Dieselben Truppen marschierten im Oktober 1918 in Damaskus ein und riefen ein arabisches Königreich aus. So zeigten die arabischen Führer ihre eigenen imperialistischen Ambitionen, nachdem sie als Kanonenfutter für die englischen imperialistischen Interessen in der Türkei gedient hatten. Sie wollten ein „panarabisches Reich“ mit Damaskus als Hauptstadt errichten. Doch diese nationalistischen Ambitionen stiessen sofort mit den englischen und französischen Interessen zusammen: Es gab keinen Raum für die arabischen imperialistischen Ansprüche.
Als das osmanische Reich auseinanderbrach und die deutsch-türkische Niederlage sich abzeichnete, begannen Frankreich und Grossbritannien Pläne zu schmieden, um den Nahen Osten unter sich aufzuteilen.
Die arabischen Staaten wurden von der Aufteilung der Beute ausgeschlossen. Die Bildung einer grossen arabischen Nation, die die Überbleibsel des kollabierten osmanischen Reiches umfassen würde, war historisch unmöglich geworden. Die Hoffnungen der herrschenden Klasse Arabiens, eine grosse arabische Nation aufzubauen, waren zum Scheitern verurteilt, weil die europäischen imperialistischen Haie keinen lokalen Widersacher dulden konnten.
Im Frühjahr 1915 teilten die europäischen Mächte Grossbritannien, Frankreich, Russland, Italien und Griechenland nach Geheimverhandlungen den Nahen Osten unter sich auf. Grossbritannien und Frankreich unterzeichneten im Mai 1916 ein Geheimabkommen (Sykes-Picot-Vertrag), demzufolge
– Grossbritannien die Kontrolle über Haifa, Acca, die Negev-Wüste, Südpalästina, den Irak, die arabische Halbinsel, sowie Transjordanien (heute: Jordanien),
– Frankreich den Libanon und Syrien bekommen erhalten sollte.
Im April 1920 erhielt Grossbritannien das Mandat des Völkerbundes für Palästina, Jordanien, Iran, Irak; Frankreich erhielt das Mandat für Syrien und Libanon und trat die Kontrolle über Mossul (mit seinen reichen Ölquellen) gegen englische Zugeständnisse in Elsass-Lothringen und Syrien ab.
Von da an waren Deutschland als geschlagenes Land und Russland nach der Oktoberrevolution 1917 für eine lange Zeit auf der imperialistischen Bühne im Nahen Osten nicht mehr präsent. Die Zahl der Widersacher in der Gegend sank beträchtlich. Grossbritannien und Frankreich wurden die herrschenden Kräfte, wobei Grossbritannien klar die stärkste Stellung innehielt. Die bestimmenden Kräfte waren während des Krieges und bis in die 30er-Jahre europäisch, die USA spielten noch keine bedeutende Rolle.
Um sein Kolonialreich zu verteidigen, das von anderen Mächten untergraben wurde, musste Grossbritannien ein besonderes Augenmerk auf die strategisch hoch bedeutende Region von Palästina legen. Palästina bedeutete für Grossbritannien die Verbindung zwischen dem Suez-Kanal und dem zukünftigen britischen Mesopotamien. Keiner anderen Macht, weder einer europäischen noch einer arabischen, sollte es erlaubt werden, einen Keil zwischen Mesopotamien und den Suez-Kanal zu treiben. 1916 erklärte Grossbritannien die Kontrolle über Palästina zum ausschliesslichen Ziel seiner Politik.
Bis zum Ersten Weltkrieg, solange das osmanische Reich Bestand hatte, wurde Palästina stets als Teil Syriens angesehen. Aber mit dem Mandat Grossbritanniens für Palästina hatten die imperialistischen Mächte eine neue „Einheit“ geschaffen. Wie alle im Laufe der Dekadenz des Kapitalismus neu geschaffenen „Einheiten“ war auch sie dazu bestimmt, zum permanenten Schauplatz von Konflikten und Kriegen zu werden.
Die lokalen palästinensischen Herrscher waren noch schwächer als die anderen arabischen Herrscher. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Rückständigkeit verfügten sie weder über eine industrielle Basis noch über Finanzkapital, sie hatten keinerlei wirtschaftliches Potenzial und konnten sich nur auf militärische Mittel stützen, um ihre Interessen zu verteidigen.
1919 wurde der erste palästinensische Nationalkongress einberufen und Amin al-Hussein wurde zum Mufti von Jerusalem ernannt. Die palästinensischen Nationalisten nahmen Kontakt mit Frankreich auf, um die englische Herrschaft in Palästina ins Wanken zu bringen. Mit der Hilfe Syriens und der französischen Besatzungstruppen in Syrien wurde ein militärischer Aufstand gegen die Briten organisiert, der indes von der britischen Armee schnell niedergeschlagen wurde.
Gleichzeitig wurden die palästinensischen Herrscher, die ihre Unabhängigkeit in einer Welt beanspruchten, die keinen Raum für einen neuen Nationalstaat bot, mit einem neuen, vom Ausland kommenden „Widersacher“ konfrontiert.
Nach der Balfour-Erklärung von Grossbritannien im November 1917, die Unterstützung bei der Errichtung einer jüdischen Heimstatt in Palästina versprach, nahm die Zahl der jüdischen Einwanderer beständig zu. Die Zionisten begannen einen blutigen Überlebenskampf gegen die palästinensischen Herrscher.
Grossbritannien nutzte die jüdischen Siedler an zwei Fronten. Nachdem es während des Krieges im Kampf gegen den türkischen Rivalen das „Zion Mule Corps“ seiner Armee angegliedert hatte, benutzte Grossbritannien nun die jüdischen Nationalisten gleichzeitig gegen seinen Hauptgegner Frankreich und gegen die arabischen Nationalisten. So stiftete Grossbritannien die Zionisten dazu an, vor dem Völkerbund zu erklären, dass die Juden in Palästina weder französischen noch internationalen, sondern nur britischen Schutz wünschten.
Obwohl in Rivalität miteinander verbunden, handelten Frankreich und Grossbritannien resolut und gemeinsam gegen lokale arabische Nationalisten, sobald sich deren Ruf nach nationaler Unabhängigkeit erhob. So setzten sie nun militärische Mittel ein, um ihre Unabhängigkeitsansprüche der arabischen Nationalisten zu unterdrücken, nachdem sie sich noch während des 1. Weltkrieges gegen die Türken ihrer bedient hatten. Kaum hatte Scheich Feisal im Oktober 1918 in Damaskus ein „unabhängiges arabisches Reich“ proklamiert, das Palästina umfassen sollte, unterwarfen ihn im Juli 1920 französische Truppen – wobei sie Bombenflugzeuge gegen die arabischen Nationalisten einsetzten.
Im März 1918 fanden in Ägypten eine Reihe von Protesten von ägyptischen Nationalisten, Arbeitern und Bauern statt, die soziale Reformen forderten. Sie wurden von der britischen und ägyptischen Armee gemeinsam niedergeworfen, wobei mehr als 3.000 Ägypter getötet wurden. Auch 1920 wurde eine Protestbewegung im irakischen Mossul von Grossbritannien niedergeschlagen.
Die lokale Bourgeoisie hatte in keinem der arabischen Länder oder Protektorate die Mittel, unabhängige, vom kolonialen Zugriff und den „Schutzmächten“ befreite Staaten zu errichten.
Die Forderung nach nationaler Befreiung war nichts anderes als eine reaktionäre Forderung. Während Marx und Engels einige nationalistische Bewegungen unter der einzigen Bedingung unterstützt hatten, dass die Bildung der Nationalstaaten das Wachstum und die Verstärkung der Arbeiterklasse beschleunigen würde, damit Letztere als Totengräber des Kapitalismus handeln konnte, zeigten die Entwicklungen im Nahen Osten dagegen, dass es keinen Raum für die Bildung einer neuen arabischen oder palästinensischen Nation gab. Nachdem der Kapitalismus in die Phase seines Niederganges eingetreten war, konnten – wie auch überall sonst auf der Welt – keine nationale Fraktion des Kapitals eine fortschrittliche Rolle mehr spielen. Unfähig, neue kapitalistische Absatzmärkte zu erobern, konnten die Widersacher nur militärisch reagieren: Die Kolonialmächte verhinderten im Nahen Osten die Bildung einer neuen arabischen Nation, und die lokalen arabischen Bourgeoisien widersetzten sich den Versuchen, einen neuen palästinensischen Nationalstaat zu errichten.
Um die Situation im Nahen Osten nach dem Niedergang des osmanischen Reiches und dem Ende des Ersten Weltkriegs zusammenzufassen, möchten wir folgende Punkte hervorheben:
– Die beiden europäischen Mächte Frankreich und Grossbritannien, die in Rivalität zueinander standen und ihre „Protégés“ gewählt hatten, beherrschten die Region.
– Deutschland und Russland mit ihren starken imperialistischen Ambitionen in der Region wurden zurückgedrängt.
– Die arabische Bourgeoisie war nicht in der Lage, einen lebensfähigen panarabischen Nationalstaat zu schaffen.
– Die neu geschaffene Einheit, das Protektorat Palästina, mit einer verkrüppelten, rückständigen herrschenden Klasse Palästinas an der Spitze, geriet in Konflikt mit einer „Schutz“macht (Grossbritannien), die dazu nicht in der Lage war, und mit dem neuen zionistischen Rivalen, der von aussen einsickerte.
Die arabische Bourgeoisie, die mit den Kolonialmächten aneinander geriet, die sie daran hindern wollten, einen neuen, lebensfähigen Staat zu bilden, widersetzte sich ihrerseits der Bildung einer neuen palästinensischen „Einheit“.
Die USA, Hauptnutzniesser des Ersten Weltkrieges, waren noch nicht bereit. Im Zentrum der imperialistischen Rivalitäten stand nicht die Eroberung von bestimmten Rohstoffen, sondern die Eroberung strategischer Positionen.
Wir sehen, dass die Situation im Nahen Osten die von Rosa Luxemburg während des Ersten Weltkrieges entwickelte Analyse voll und ganz bestätigte: „Der Nationalstaat, die nationale Unabhängigkeit und Einheit, das war das ideologische Banner, unter dem sich im letzten Jahrhundert die grossen bürgerlichen Staaten Zentraleuropas bildeten. Der Kapitalismus ist nicht vereinbar mit dem Partikularismus der Kleinstaaten, mit einem politischen und wirtschaftlichen Zerbröckeln; er braucht ein grösstmögliches zusammenhängendes Gebiet mit einem einheitlichen Zivilisationsniveau, um sich auszubreiten; ohne diese Voraussetzung könnte man weder die gesellschaftlichen Bedürfnisse auf die von der kapitalistischen Warenproduktion erzielte Ebene heben, noch würde der Mechanismus der modernen bürgerlichen Herrschaft funktionieren. Vor ihrer Ausbreitung über die ganze Erdkugel hat die kapitalistische Wirtschaftsweise versucht, sich ein zusammenhängendes Gebiet in den nationalen Grenzen eines Staates zu schaffen (…) Die nationale Phrase dient heute nur dazu, mehr schlecht als recht imperialistische Ansprüche zu maskieren, wenn sie nicht als Kriegsruf in den imperialistischen Konflikten verwendet wird, als einziges und letztes ideologisches Mittel, um die Zustimmung der Volksmassen zu fangen und sie die Rolle des Kanonenfutters in den imperialistischen Kriegen spielen zu lassen.“[8]
DE
Fußnoten:
1. Friedrich Engels, Angriff“, in: MEW Bd. 14, S. 68
2. 1900 betrug der Erdölverbrauch etwa 20 Millionen Tonnen und diese Nachfrage wurde durch die amerikanischen und russischen Quellen abgedeckt (Hauptförderregion war der Golf von Mexiko). Die verschärfte Militarisierung und die Ablösung der Kohle durch Öl in der Industrie und als Treibstoff für Lokomotiven erhöhten die Nachfrage stark. Zwischen 1900 und 1910 hat sich die Erdölproduktion mehr als verdoppelt und erreichte 43.8 Millionen Tonnen. Die Erfindung des Dieselmotors für den Lokomotivantrieb und die Dampfschiffe schufen die technische Grundlage, aber erst die Erfordernisse einer militarisierten Wirtschaft führten zur Verdoppelung der Rohölproduktion. Vor dem I. Weltkrieg spielte der Nahe Osten lediglich eine zweitrangige Rolle in der Erdölversorgung des Weltmarktes. Erst nach dem I. Weltkrieg stieg die Ölförderung im Nahen Osten beträchtlich an.
3. Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre, Absatz 4, in Gesammelte Werke Bd 4, S. 83ff.
4. Der deutsche Imperialismus schwankte zwischen der Unterstützung für die Türkei und für die nationalistischen jüdischen Siedler. Wenn die Zionisten mit deutscher Unterstützung eine jüdische Heimstatt in Palästina eingerichtet hätten, hätte dies einen Konflikt mit dem osmanischen Reich hervorgerufen. Doch Deutschland wollte es nicht riskieren, seine Verbindung mit der Türkei zu lösen, weil diese sein wichtigster Verbündeter im weltweiten Machtkampf mit Grossbritannien war.
5. Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre, Absatz 4, in Gesammelte Werke Bd 4, S. 83ff. Rosa Luxemburg war eine der Ersten, die die historischen Folgen der neuen Bedingungen, die der Anfang der Dekadenz mit sich brachte, erfasste. Schon in ihrem Buch über Die wirtschaftliche Entwicklung Polens 1898 zeigte sie, dass die Kommunisten die Bildung eines polnischen Staates nicht mehr unterstützen konnten. In dem Text Die nationalen Kämpfe in der Türkei und die Sozialdemokratie 1896 und in Die nationale Frage und die Autonomie 1908 zeigte sie den historischen Wandel auf, der zwischen dem Aufstieg und dem Niedergang eingetreten war und jede Unterstützung für die Türkei verunmöglichte.
6. Rohrbach schrieb in seinem Buch Die Bagdadbahn“: „Grossbritannien kann von Europa aus nur an einer Stelle zu Lande angegriffen und schwer verwundet werden: von Ägypten (…) Die Türkei kann aber nur unter der Voraussetzung an Ägypten denken, dass sie über ein ausgebautes Eisenbahnsystem in Kleinasien und Syrien verfügt. Die Bagdadbahn war von Anfang an dazu bestimmt, Konstantinopel und die militärischen Kerngebiete des türkischen Reiches in unmittelbare Verbindung mit Syrien und den Provinzen am Euphrat und Tigris zu bringen. Natürlich war in diesem Plan das Projekt inbegriffen, türkische Truppen nach Ägypten zu transportieren.“ (Paul Rohrbach, zitiert nach Rosa Luxemburg, in: Der Krieg und die deutsche Politik).
7. Obwohl der Nahe Osten ein Nebenkriegsschauplatz des Ersten Weltkrieges war, liessen von den 20 Millionen Opfern etwa 350.000 aus dem Nahen Osten ihr Leben in diesem Krieg. Die türkische und alliierte Seeblockade der arabischen Häfen sowie Epidemien und Hungersnöte erforderten zahlreiche Tote. 30 Prozent der ägyptischen Männer wurden von der britischen und australischen Armee eingezogen, um als Handlanger zu dienen.
8. Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre, Absatz 4, in Gesammelte Werke Bd 4, S. 83ff.
Den Zerfall des Kapitalismus verstehen (Teil I)
- 3717 Aufrufe
In den „Thesen über den Zerfall“ (Erstpublikation in der International Review Nr. 62 und in Deutsch in: Internationale Revue Nr. 13) sowie im Artikel „Der Zerfall des Kapitalismus“ (Internationale Review Nr. 57, engl., franz., span. Ausgabe) haben wir gezeigt, dass der Kapitalismus in eine neue und letzte Phase seiner Dekadenz eingetreten ist, in die des Zerfalls. Sie wird charakterisiert durch die Verstärkung und Zuspitzung aller Widersprüche des System.
Leider sah sich unsere Organisation mit dem Bemühen, diese wichtige Entwicklung im Leben des Kapitalismus zu analysieren, einerseits der blossen Gleichgültigkeit einiger Gruppen der Kommunistischen Linken gegenüber; anderseits sind wir auch auf völliges Unverständnis, ja gar auf Anschuldigungen jeglicher Art gestossen wie z.B. auf den Vorwurf, wir seien von der marxistischen Methode abgekommen.
Die vielleicht groteskeste Stellungnahme kommt von Parti Communiste International (PCI), deren Presseorgane Le Prolétaire und
Il Comunista. In einer von ihr kürzlich publizierten Broschüre mit dem Titel „Le Courant Communiste International: à contre-courant du marxisme et de la lutte de classe“ (Die Internationale Kommunistische Strömung gegen den Marxismus und Klassenkampf) äussert sich diese Organisation zu unserer Analyse des Zerfalls wie folgt: „Wir wollen an dieser Stelle auch keine detaillierte Kritik an dieser nebulösen Theorie anbringen, sondern begnügen uns damit, auf die vom Marxismus und Materialismus am stärksten abweichenden Entdeckungen hinzuweisen.“ Und dies ist auch schon alles, was die PCI zu unserer Analyse zu sagen weiss, während sie an anderer Stelle auf siebzig Seiten gegen unsere Organisation polemisiert.
Nun ist aber die theoretische Reflexion für eine Organisation, die beansprucht, die historischen Interessen der Arbeiterklasse zu vertreten, eine Pflicht ersten Ranges. Diese Reflexion soll die Kampfbedingungen verdeutlichen und die Analysen der Gesellschaft, die sie ja als falsch beurteilt, kritisieren. Diese Notwendigkeit ist um so akuter, da ebendiese Analysen gar von anderen revolutionären Organisationen verteidigt werden. (1)
Das Proletariat und die ihm zugehörigen avantgardistischen Minderheiten brauchen einen globalen Rahmen für das Verständnis der Situation. Ohne einen solchen Rahmen können sie den Ereignissen lediglich mit empirischen und immediatistischen Reaktionen begegnen. Und diese werden durch die Ereignisabfolge selbst überrumpelt.
Die Communist Workers Organisation (CWO) ihrerseits, britischer Zweig des Internationalen Büros für die Revolutionäre Partei (IBRP), geht in drei Artikeln ihrer Presseorgane (2) auf unsere Analyse des Zerfalls des Kapitalismus ein. Wir werden weiter unten die genauen Argumente der CWO betrachten. Vorerst sei nur gesagt, dass ihre Kritik im Prinzip besagt, unsere Analyse sei nicht marxistisch.
Angesichts dieses Urteils (und die CWO ist damit nicht allein unter den revolutionären Organisationen) erscheint es uns wichtig, die marxistischen Wurzeln des Begriffs „Zerfall“ des Kapitalismus aufzudecken und verschiedene Aspekte und Bedeutungen dieses Begriffs zu präzisieren und zu entwickeln. Deshalb haben wir uns für die Veröffentlichung einer Artikelserie mit der Überschrift „Den Zerfall verstehen“ entschieden. Diese Artikelserie versteht sich als Fortsetzung einer früheren, nämlich der vor einigen Jahren erschienenen Serie „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen“ (3). Schliesslich ist der Zerfall ein Phänomen der Dekadenz und kann nicht isoliert von ihr verstanden werden.
Der Zerfall – ein Phänomen der Dekadenz des Kapitalismus
Die marxistische Methode liefert einen materialistischen und historischen Rahmen, um die unterschiedlichen Momente des Lebens des Kapitalismus sowohl in der aufsteigenden als auch in der absteigenden Phase zu charakterisieren.
„Genauso wie der Kapitalismus verschiedene Zeiträume in seiner historischen Entwicklung durchlaufen hat – Entstehung, Aufstieg, Niedergang – beinhaltete jeder dieser Zeiträume auch unterschiedliche und voneinander abgegrenzte Phasen. So gab es z.B. in der aufsteigenden Phase die nacheinander folgenden Phasen des freien Marktes, der Aktiengesellschaften, der Monopole, des Finanzkapitals, der kolonialen Eroberungen und der Entwicklung des Weltmarkts. In der Periode der Dekadenz gibt es auch verschiedene Phasen: Imperialismus, Weltkriege, Staatskapitalismus, permanente Krise und heute der Zerfall. Es handelt sich dabei um verschiedene, nacheinander folgende Ausdrücke des Lebens des Kapitalismus, mit jeweils typischen Charakteristiken, selbst wenn diese Ausdrücke vorher schon bestanden oder beim Anbruch einer neuen Phase gar weiterbestehen.“ (4) Die geläufigste Illustration dieses Phänomens ist zweifelsohne der Imperialismus, der „streng genommen nach 1870 beginnt, als sich der Kapitalismus merklich neu gestaltet. Die Periode der Bildung der Nationalstaaten in Europa und Nordamerika ist abgeschlossen und an Stelle von Grossbritannien als Weltfabrik haben sich verschiedene andere nationale Kapitalfraktionen entwickelt, die sich im Wettbewerb um die Vorherrschaft des Weltmarktes befinden, nicht nur im Wettbewerb um die inneren Märkte, sondern auch um die Kolonialmärkte.“ (5) Der Imperialismus erlangt „jedoch erst mit dem Eintritt des Kapitalismus in die Epoche seiner Dekadenz (...) eine vorherrschende Stellung in der Gesellschaft, in der Politik der Staaten und in den internationalen Verhältnissen (...), so dass er in der ersten Phase seiner Dekadenz diese besonders stark prägt. Dadurch identifizierten viele Revolutionäre der damaligen Zeit ihn mit der Dekadenz des Kapitalismus schlechthin.“ (6)
Die Dekadenzphase des Kapitalismus trägt sehr wohl von Anfang an Elemente des Zerfalls in sich. Kennzeichen davon sind die Auflösung der Gesellschaft, das Versagen ihrer ökonomischen, politischen und ideologischen Strukturen. Nichtsdestotrotz wird der Zerfall erst an einem bestimmten Entwicklungspunkt und unter sehr bestimmten Umständen innerhalb der Dekadenz zu einem oder gar zu dem entscheidenden Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung, indem sie eine besondere Phase eröffnet, nämlich die des Zerfalls der Gesellschaft. Dass diese Phase die Vervollständigung jener Phasen darstellt, die ihr während der Dekadenz vorausgingen, wird von der Geschichte dieser Periode attestiert.
Der erste Kongress der Kommunistischen Internationale (2. bis 6. März 1919) zeigte auf, dass der Kapitalismus in eine neue Epoche, die seines historischen Niedergangs, eingetreten ist, in dem er die Keime des inneren Zerfalls des Systems identifizierte: „Eine neue Epoche ist geboren: die Epoche der Auflösung und des inneren Zusammenbruchs des Kapitalismus, die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats.“ (7) Die gesamte Menschheit sieht sich der Gefahr einer Selbstzerstörung ausgesetzt, sollte der Kapitalismus die proletarische Revolution überleben: „Der Menschheit, deren ganze Kultur jetzt in Trümmern liegt, droht die Gefahr vollständiger Vernichtung. (...) Die alte kapitalistische „Ordnung“ existiert nicht mehr, sie kann nicht mehr bestehen. Das Endresultat der kapitalistischen Produktionsweise ist das Chaos.“ (8) „Heute steht die Verelendung vor uns, nicht nur die soziale, sondern die physiologische, die biologische in ihrer ganzen erschütternde Wirklichkeit.“ (9)
Diese neue Epoche wird auf gesellschaftlicher Ebene durch das historische Ereignis des Ersten Weltkrieges markiert, der sie eröffnet hat: „Wenn der freie Wettbewerb als Regulator der Produktion und der Verteilung in den Hauptgebieten der Wirtschaft von dem System der Trusts und Monopole noch in den dem Kriege vorangegangenen Jahrzehnten verdrängt wurde, so wurde durch den Gang des Krieges die regelnde Rolle den Händen der ökonomischen Vereinigungen entrissen und direkt der militärischen Staatsmacht ausgeliefert.“ (10) Das genannte Phänomen ist nicht von konjunktureller Natur, hervorgerufen durch den Ausnahmezustand des Krieges, sondern eine permanente und unumkehrbare Tendenz: „…hat die völlige Unterordnung der Staatsmacht unter die Gewalt des Finanzkapitals durch diese Massenabschlachtung nicht nur den Staat, sondern auch sich selbst vollends militarisiert und ist nicht mehr fähig, seine wesentlichen ökonomischen Funktionen anders als mittels Blut und Eisen zu erfüllen (…) Die Verstaatlichung des wirtschaftlichen Lebens, gegen welche der kapitalistische Liberalismus sich so sträubt, ist zur Tatsache geworden. Nicht nur zum freien Wettbewerb, sondern auch zur Herrschaft der Trusts, Syndikate und anderer wirtschaftlicher Ungetüme gibt es keine Rückkehr. Die Frage besteht einzig darin, wer künftig der Träger der verstaatlichten Produktion sein wird: der imperialistische Staat oder der Staat des siegreichen Proletariats?“ (11)
Die darauf folgenden acht Jahrzehnte haben diesen eindeutigen Wendepunkt der kapitalistischen Gesellschaft nur bestätigt. Sie erlebten eine massive Entwicklung des Staatskapitalismus und der Kriegsökonomie nach der Krise von 1929, den Zweiten Weltkrieg, die darauf folgende Wiederaufbauphase und den Start eines verrückten nuklearen Wettrennens, den Kalten Krieg, der ebenso viele Tote wie die beiden Weltkriege zusammen gefordert hat, und seit 1967 – mit dem Ende der Wiederaufbauperiode nach dem Krieg – das zunehmende Versinken der Wirtschaft in der Krise. Diese Krise dauert nun schon seit dreissig Jahren an und wird begleitet von einer endlosen Spirale militärischer Erschütterungen. Kurz gesagt: es ist eine Welt, die keine andere Perspektive als die eines unaufhörlichen Todeskampfes anbietet, geprägt durch Zerstörung, Elend und Barbarei.
Eine solche historische Entwicklung kann nur den Zerfall der kapitalistischen Produktionsweise auf allen Ebenen des Gesellschaftslebens – Wirtschaft, Politik, Moral, Kultur etc. – fördern. Offensichtlich wurde dies einerseits durch den irrationalen Wahnsinn und die Bestialität des Nazismus mit seinen Konzentrationslagern sowie durch den Stalinismus mit seinem Gulag und andererseits durch den Zynismus und die Heuchelei ihrer demokratischen Gegenspieler mit ihren mörderischen Bombardierungen, die verantwortlich sind für Hunderttausende von Opfern unter der deutschen (besonders in Dresden) und japanischen Bevölkerung (besonders die beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki), obwohl diese beiden Länder bereits geschlagen waren. Die Kommunistische Linke Frankreichs argumentierte 1947, dass die Zerfallstendenzen des Kapitalismus das Produkt der ihm innewohnenden unüberwindbaren Widersprüche sind: „Angesicht ihres eigenen Zerfalls, wählt die Bourgeoisie immer das geringere Übel, sie flickt hier zusammen und stopft dort ein Loch, obschon sie weiss, dass der Sturm stärker wird“. (12)
Der Zerfall – die Endphase der Dekadenz des Kapitalismus
Die Widersprüche und Manifestationen der Dekadenz des Kapitalismus, die ihre verschiedenen Momente hintereinander auszeichnen, verschwinden nicht mit der Zeit, sondern behaupten sich. So erscheint die Zerfallsphase, die ihren Anfang in den 80er-Jahren nahm, „als das Ergebnis der Anhäufung all der Charakteristiken eines im Sterben liegenden Systems. Die Phase des Zerfalls ist nach einem dreiviertel Jahrhundert Todeskampf der Gipfel einer durch die Geschichte zum Tode verurteilten Produktionsform. Nicht nur, dass das imperialistische Wesen aller Staaten, die Drohung eines neuen Weltkrieges, die Absorption der Gesellschaft durch den Staatsmoloch und die ständige Krise der kapitalistischen Wirtschaft in der Phase des Zerfalls fortbestehen, sie erreichen darüber hinaus im Zerfall ihre höchste Synthese und äusserste Konsequenz“.(13)
Der Beginn der Phase des Zerfalls (Zerfall (14)) ist also kein Blitz aus heiterem Himmel, sondern muss als Kristallisierung eines Prozesses verstanden werden, der schon in den vorhergehenden Etappen des dekadenten Kapitalismus latent war, aber erst ab einem bestimmten Moment zum zentralen Faktor der Situation wurde. Somit kann den Phänomenen des Zerfalls, die, wie erwähnt, die bisherige Dekadenzphase bis anhin begleitet haben, quantitativ und qualitativ nicht dieselbe Bedeutung zugeschrieben werden, die sie seit Beginn der 80er-Jahre haben. Der Zerfall ist nicht einfach eine „neue Phase“, welche die Abfolge früherer Phasen innerhalb der Dekadenz (Imperialismus, Weltkriege, Staatskapitalismus) fortsetzt, sondern die Endphase des Systems.
Die Phase des allgemeinen Zerfalls, der Verwesung der Gesellschaft, wird durch die Tatsache verursacht, dass die Widersprüche des Kapitalismus sich noch weiter verschlimmern, da die Bourgeoisie unfähig ist, der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auch nur den Hauch einer Perspektive anzubieten, und das Proletariat nicht imstande ist, seine eigene Perspektive unmittelbar zu behaupten.
In einer Klassengesellschaft handeln die Individuen, ohne ihr eigenes Leben wirklich und bewusst zu kontrollieren. Das bedeutet aber nicht, dass eine solche Gesellschaft völlig blind und ohne Orientierung bzw. Perspektive funktionieren kann. „Tatsächlich kann sich keine Produktionsform am Leben erhalten, sich entfalten, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sicherstellen, wenn sie nicht in der Lage ist, der gesamten, von ihr beherrschten Gesellschaft eine Perspektive anzubieten. Dies trifft besonders auf den Kapitalismus zu, der die dynamischste Produktionsform der bisherigen Geschichte ist.“ (15)
Dieser immer stärkere Verlust eines Wegweisers für die Gesellschaft ist kennzeichnend für die aktuelle Phase des kapitalistischen Zerfalls. Hier besteht ein wichtiger Unterschied zur Periode des Zweiten Weltkrieges. Der Zweite Weltkrieg legte die Barbarei des kapitalistischen Systems auf erschreckende Weise offen. Aber Barbarei ist nicht gleichzusetzen mit Zerfall. Inmitten der Barbarei des Zweiten Weltkriegs entbehrte die Gesellschaft keiner „Orientierung“: Die kapitalistischen Staaten waren fähig, die gesamte Gesellschaft mit eiserner Hand anzuführen und sie für den Krieg zu mobilisieren. In dieser Hinsicht hat die Periode des Kalten Krieges ähnliche Charakteristiken: Das gesamte gesellschaftliche Leben wurde durch die Staaten kontrolliert, die am blutigen Kampf der beiden Blöcke teilnahmen. Die gesamte Gesellschaft wurde von einer „organisierten“ Barbarei umhüllt. Im Unterschied dazu ist seit Beginn der Zerfallsphase diese „organisierte“ Barbarei durch eine anarchistische und chaotische Barbarei ersetzt worden, in der das „Jeder-für-sich“, die Instabilität von Bündnissen, die Kriminalisierung der internationalen Beziehungen vorherrscht.
Zerfall und Klassenkampf
Im Sinne des Marxismus ändern sich also „die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse (...), verwandeln sich mit der Veränderung und Entwicklung der materiellen Produktionsmittel, der Produktionskräfte. Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was man die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine Gesellschaft auf bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter. Die antike Gesellschaft, die feudale Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft sind solche Gesamtheiten von Produktionsverhältnissen, deren jede zugleich eine besondere Entwicklungsstufe in der Geschichte der Menschheit bezeichnet“. (16) Aber ebenso bilden diese Produktionsverhältnisse den Rahmen für ihre eigene Entwicklung und für den Antrieb des Klassenkampfes, zur Entwicklung der Menschheit. So stellt Engels fest, „dass die ökonomische Produktion und die aus ihr mit Notwendigkeit folgende gesellschaftliche Gliederung einer jeden Geschichtsepoche die Grundlage bildet für die politische und intellektuelle Geschichte dieser Epoche; dass demgemäss (seit Auflösung des uralten Gemeinbesitzes an Grund und Boden) die ganze Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen gewesen ist, Kämpfen zwischen ausgebeuteten und ausbeutenden, beherrschten und herrschenden Klassen auf verschiedenen Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung“. (17) Die Verknüpfungen zwischen den Produktionsverhältnissen und der Entwicklung der Produktivkräfte einerseits und dem Klassenkampf andererseits wurden vom Marxismus nie als simpel und mechanisch aufgefasst, so als werde Letztgenanntes allein von Erstgenanntem bestimmt. In dieser Frage warnte Bilan in Reaktion auf die Linksopposition vor der vulgär-marxistischen Interpretation, dass „die ganze Entwicklung der Geschichte auf das Gesetz der Entwicklung der Ökonomie und der Produktivkräfte reduziert werden kann„, und dass diese Interpretation das neue Element im Marxismus ist im Vergleich zu den vorangegangenen historischen Theorien, welche von der Weiterentwicklung der kapitalistischen Gesellschaft völlig überzeugt waren. Für solch eine vulgär-materialistische Interpretation repräsentiert „der produktive Mechanismus nicht nur die Quelle der Klassenformierungen, sondern er bestimmt auch automatisch das Handeln und die Politik der Klassen und die Menschen, die sie ausführen. Somit wird das Problem des sozialen Kampfes nur simplifiziert. Menschen und Klassen wären nur von den ökonomischen Kräften gesteuerte Marionetten“. (18)
Die Gesellschaftsklassen handeln nicht nach einem durch die wirtschaftliche Entwicklung im Voraus festgesetzten Szenario. Bilan fügt hinzu, dass „die Klassenaktion nur als Folge der historischen Einsicht in die Rolle und die Mittel möglich ist, die für ihren Triumph angemessen sind. Die Klassen sind in ihrem Aufstieg und Niedergang vom ökonomischen Mechanismus abhängig (...) aber für ihren Sieg müssen sie sich eine politische und organische Gestaltung geben, ohne die sie, auch wenn von der Entwicklung der Produktivkräfte auserwählt, riskieren, für lange Zeit Gefangene der alten herrschenden Klasse zu bleiben, die ihrerseits in ihrem Sträuben den Gang der ökonomischen Entwicklung aufhält.“ (19)
An dieser Stelle müssen zwei äusserst wichtige Schlussfolgerungen aus dem Gesagten gezogen werden.
Erstens sind die ökonomischen Mechanismen, obschon bestimmend, selbst auch determiniert, weil der Widerstand der alten Klasse – von der Geschichte zum Tode verurteilt – den Lauf ihrer Entwicklung hemmt. Die Menschheit hat heute beinahe ein Jahrhundert der kapitalistischen Dekadenz hinter sich, die diese Realität veranschaulicht. Um brutale Zusammenbrüche zu vermeiden und die Zwänge der Kriegswirtschaft zu schultern, hat sich der Staatskapitalismus auf Dauer dem Wertgesetz entzogen. (20) Damit stürzt er die Wirtschaft in Widersprüche, die immer unüberwindbarer werden. Weit davon entfernt, die Widersprüche des kapitalistischen Systems zu überwinden, hat solch ein Eskapismus keine andere Konsequenz als die beträchtliche Verschärfung dieser Widersprüche. Bilan zufolge wurde dadurch die historische Entwicklung in einen gordischen Knoten unüberwindbarer Widersprüche gezwängt.
Zweitens ist es der revolutionären Klasse, die durch die Geschichte dazu bestimmt ist, den Kapitalismus zu überwinden, bisher nicht gelungen, diese historische Mission zu erfüllen. Die lange Periode der letzten dreissig Jahre ist eine klare Bestätigung der Analyse Bilans. Diese Analyse gehört in eine Reihe mit den all den anderen marxistischen Positionen. Zwar hat historische Wiederauftauchen des Proletariats 1968 die Bourgeoisie daran gehindert, die Gesellschaft in einen erneuten allgemeinen Krieg zu ziehen, doch war das Proletariat nicht imstande, seine Defensivkämpfe in eine offensive Schlacht zur Zerstörung des Kapitalismus zu verwandeln.
Dieser Rückschlag – für die Analyse ihrer allgemeinen und historisch ursächlichen Faktoren ist in diesem Artikel kein Platz (21) – war entscheidend für den Eintritt des Kapitalismus in seine Zerfallsphase.
Ausserdem ist der Zerfall das Resultat der Schwierigkeiten des Proletariats und trägt gleichzeitig zu ihrer Verschärfung bei: „Und ganz zuoberst haben die Auswirkungen des Zerfalls, wie wir oft festgestellt haben, eine zutiefst negative Auswirkung auf das Bewusstsein des Proletariats, auf seinen Sinn für sich selbst, da sie in all ihren verschiedenen Aspekten – Bandenmentalität, Rassismus, Kriminalität, Drogenmissbrauch, etc. – dazu dienen, die Klasse zu atomisieren, die Spaltungen in ihren Reihen zu vergrössern und sie im gesellschaftlichen Konkurrenzkampf aufzulösen.“ (22)
Tatsächlich: – tendiert das Verhalten der Zwischenschichten oder gar des Lumpenproletariats unter dem Einfluss der Zerfallsphase zu Verhaltensweisen, die den gröbsten Absurditäten des Kapitalismus oder gar anderer, vorhergehender Systeme entsprechen. Ihre hoffnungs- und zukunftslosen Revolten können das Proletariat kontaminieren oder einige Sektoren desselben mit sich reissen;
– beeinträchtigt die allgemeine Atmosphäre des moralischen und ideologischen Zerfalls die Möglichkeiten der Bewusstseinsentwicklung, der Einheit, des Vertrauens und der Solidarität des Proletariats: „Jawohl, die Arbeiterklasse ist nicht durch eine chinesische Mauer von der alten, der bürgerlichen Gesellschaft getrennt. Und wenn die Revolution anbricht, so geht es nicht so zu wie beim Tode eines einzelnen Menschen, wo die Leiche einfach hinausgetragen wird. Wenn die alte Gesellschaft zugrunde geht, kann man ihren Leichnam nicht in einem Sarg vernageln und ins Grab senken. Dieser Leichnam geht mitten unter uns in Verwesung über, er verfault und steckt uns selber an.“ (23);
– die Bourgeoisie die Auswirkungen des Zerfalls gegen das Proletariat einsetzen kann. Dies war besonders der Fall beim ohne Krieg oder Revolution erfolgten Zusammenbruch des alten sowjetischen Blocks, der eine wichtige und typische Demonstration des Zerfalls darstellt. Dieses Ereignis erlaubte der Bourgeoisie, eine enorme antikommunistische Kampagne auszulösen, die in einen wichtigen Rückfluss von Bewusstsein und Kampfkraft in den proletarischen Reihen mündete.
Marxismus contra Fatalismus
Der Übergang von einer niedrigen Produktionsweise zu einer höheren Produktionsweise ist nicht das fatale Produkt der Entwicklung der Produktivkräfte. Dieser Übergang kann nur im Rahmen einer Revolution geschehen, durch die die neue, dominierende Klasse die alte stürzt und neue Produktionsverhältnisse bildet.
Der Marxismus verteidigt den historischen Determinismus, doch dies bedeutet nicht, dass der Kommunismus das unausweichliche Ergebnis der Entwicklung des Kapitalismus ist. Eine solche Ansicht wäre eine vulgärmaterialistische Verfälschung des Marxismus. Tatsächlich bedeutet der historische Determinismus im marxistischen Sinn Folgendes:
1. Eine Revolution ist erst dann möglich, wenn alle Kapazitäten der bisherigen Produktionsweise erschöpft sind: „Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoss der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.“ (24)
2. Vom Kapitalismus gibt es kein Zurück zu früheren Produktionsformen (zum Feudalismus oder anderen vorkapitalistischen Produktionsweisen): Der Kapitalismus kann nur entweder durch die proletarische Revolution überwunden werden oder aber er stürzt die Menschheit in ihre Zerstörung.
3. Der Kapitalismus ist die letzte Klassengesellschaft. Die Gruppe Socialisme ou Barbarie und gewisse Abspaltungen des Trotzkismus (25) verteidigen hingegen eine „Theorie“, welche das Aufkommen einer „dritten Gesellschaft“ ankündigt, die weder kapitalistisch noch kommunistisch sei. Aus marxistischer Sicht ist dies abwegig, denn für den Marxismus sind die „bürgerlichen Produktionsverhältnisse die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses (…) Mit dieser Gesellschaftsformation schliesst daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab“. (26)
Der Marxismus hat das Ergebnis historischer Entwicklung immer in Form von Alternativen gezeichnet: Entweder setzt sich die revolutionäre Klasse durch und eröffnet den Weg zur neuen Produktionsform, oder die Gesellschaft verfällt der Anarchie und Barbarei. Das Kommunistische Manifest zeigt auf, wie sich der Klassenkampf manifestiert hat. „Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.“ (27)
Gegen alle idealistischen Verirrungen, die das Proletariat vom Kommunismus abbringen wollen, definierte Marx den Kommunismus als die „reale Bewegung“ des Proletariats. Marx bestand auf der Tatsache, dass die Arbeiterklasse „keine Ideale zu verwirklichen (hat); sie hat nur die Elemente der neuen Gesellschaft in Freiheit zu setzen, die sich bereits im Schoss der zusammenbrechenden Bourgeoisgesellschaft entwickelt haben.“ (28) In Die Deutsche Ideologie kritisieren Marx und Engels eine solche Vision heftig: „Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen, von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert, daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andrerseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert, was sich nun spekulativ so verdrehen lässt, dass die spätere Geschichte zum Zweck der früheren gemacht wird, z.B., dass der Entdeckung Amerikas der Zweck zugrunde gelegt wird, der französischen Revolution zum Durchbruch zu verhelfen…“ (29)
Angewandt auf die derzeitige Entwicklungsphase des Kapitalismus ermöglicht die marxistische Methode zu verstehen, dass der Zerfall, wenn er auch reell existiert, kein rationales Phänomen der historischen Entwicklung ist. Der Zerfall ist in keiner Weise ein notwendiges Glied in einer Entwicklungskette, die zum Kommunismus führt. Im Gegenteil: die Zerfallsphase birgt die Gefahr einer fortschreitenden Zerstörung der materiellen Grundlagen des Kommunismus. Denn der Zerfall bedeutet eine langsam fortschreitende Zerstörung der Produktivkräfte, möglicherweise bis zu dem Punkt, wo der Aufbau des Kommunismus nicht mehr möglich ist: „Man kann also nicht, wie die Anarchisten, behaupten, dass eine sozialistische Perspektive offen war, als sich die Produktivkräfte zurückbildeten oder auf ihrem Niveau stehen blieben. Der Kapitalismus stellt eine notwendige und unumgängliche Etappe zur Errichtung des Sozialismus dar. Nur der Kapitalismus kann die objektiven Bedingungen für den Sozialismus entwickeln. Aber im aktuellen Stadium des Kapitalismus, und darüber sprechen wir, ist der Kapitalismus eine Bremse zur Entwicklung der Produktivkräfte geworden. Je länger der Kapitalismus andauert, desto mehr verschlechtern sich die Bedingungen für den Sozialismus. Die Frage, die sich heute stellt, ist die zwischen der historische Alternative Sozialismus oder Barbarei.“ (30)
Des Weiteren vernichtet der Zerfall auch allmählich die Grundlagen zur Einheit und Identität der proletarischen Klasse: „.. der Prozess der Desintegration, der durch die massive und andauernde Arbeitslosigkeit besonders unter den jungen Menschen, durch die Auflösung traditioneller militanter Arbeiterkonzentrationen im Herzen der Industrie hervorgerufen wurde, was die Atomisierung und die Konkurrenz unter den Arbeitern intensivierte (…) Die Fragmentierung der Klassenidentität, die wir besonders im letzten Jahrzehnt erlebt haben, ist kein irgendwie gearteter Fortschritt, sondern eine Manifestation des Zerfalls, die immense Gefahren für die Arbeiterklasse in sich birgt.“ (31)
Der Klassenkampf: Motor der Geschichte
Die geschichtliche Etappe des Zerfalls birgt die Gefahr einer Zerstörung der Grundlagen für die kommunistische Revolution in sich. In diesem Sinn unterscheidet sie sich nicht von den anderen Etappen innerhalb der Dekadenzphase des Kapitalismus, die ebenfalls diese Gefahr beinhalteten und von den Revolutionären damals vorgebracht wurden. Verglichen mit den vorhergehenden Phasen gibt es aber dennoch einige Unterschiede:
1. Früher führte der Krieg in eine Wiederaufbauperiode. Doch unter dem Einfluss des Zerfalls ist der Prozess der Menschheitszerstörung zwar langsamer und versteckter, aber unumkehrbar. (32)
2. Früher war die Zerstörungsgefahr mit dem Ausbruch eines Dritten Weltkrieges verknüpft, heute hingegen, in der Etappe des Zerfalls, wirken die unterschiedlichsten Gründe (lokale Kriege, die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts, der langsame Abbau von Produktivkräften, der allmähliche Untergang der produktiven Infrastruktur, die graduelle Zerstörung der gesellschaftlichen Beziehungen) mehr oder weniger gleichzeitig bei der Zerstörung der Menschheit mit.
3. Früher präsentierte sich die Gefahr der Vernichtung in der brutalen Form eines neuen Weltkrieges, heute dagegen hüllt sie sich in einer weniger sichtbaren Kostüm, ist heimtückischer, viel schwerer zu beurteilen und noch schwerer zu bekämpfen. (33)
4. Die Tatsache, dass der Zerfall zentraler Faktor bei der Entwicklung der gesamten Gesellschaft ist, bedeutet, wie schon erwähnt, dass er auf allen Ebenen einen direkten und permanenter Einfluss auf das Proletariat ausübt: Bewusstseinsentwicklung, Einheit, Solidarität, etc.
Dennoch darf das „Verständnis der grossen Gefahren, die für die Arbeiterklasse und die ganze Menschheit vom Zerfall ausgehen, die Arbeiterklasse und mit ihr die revolutionären Minderheiten nicht dazu verleiten, eine fatalistische Haltung einzunehmen.“ (34)
Tatsächlich:
– hat das Proletariat keine bedeutenden Niederlagen erlitten und bleibt seine Kampffähigkeit weiterhin intakt;
– bildet derselbe Faktor, der die grundlegende Ursache des Zerfalls ist – die unabwendbare Verschärfung der Krise – auch „die Bedingung für die Fähigkeit der Klasse, dem ideologischen Gift der Fäulnis der Gesellschaft entgegenzutreten“. (35)
Nur die kommunistische Revolution selbst kann die Gefahr des Zerfalls für die Gesellschaft definitiv bannen. Die Verteidigungskämpfe der Arbeiter gegenüber der Krise reichen dagegen für die Bewältigung dieser Aufgabe nicht aus. Denn das Bewusstsein über die Krise allein kann die Probleme und Schwierigkeiten nicht lösen, mit denen das Proletariat konfrontiert ist und in immer stärkerem Masse konfrontiert wird. Daher muss das Proletariat:
„– ein Bewusstsein darüber, was in der gegenwärtigen historischen Situation auf dem Spiel steht, und insbesondere ein Bewusstsein über die tödlichen Gefahren entwickeln, die der Zerfall für die Menschheit mit sich bringt,
– entschlossen die Weiterentwicklung und Vereinigung seines Klassenkampfes fortsetzen,
– seine Fähigkeit weiterzuentwickeln, den verschiedenen Fallen auszuweichen, den die vom Zerfall selbst befallene Bourgeoisie den Arbeitern stellt…“ (36)
Der Zerfall zwingt das Proletariat dazu, seine Waffen des Bewusstseins, der Einheit, des Selbstvertrauens, der Solidarität, des Willens und des Heroismus zu schmieden. Trotzki nannte dies die subjektiven Faktoren und betonte in seiner Geschichte der Russischen Revolution ihre Wichtigkeit für dieses historische Ereignis. An allen Fronten des proletarischen Klassenkampfes (Engels sprach von dreien: der ökonomischen, der politischen und der theoretischen Front) müssen die Revolutionäre und die fortgeschrittensten Minderheiten des Proletariats diese Qualitäten kultivieren sowie tiefgehend und ausgiebig weiterentwickeln.
Die Zerfallsphase zeigt, dass von den beiden Faktoren, die die historische Weiterentwicklung bestimmen – der ökonomische Mechanismus und der Klassenkampf – der erstere überreif ist und daher die Gefahr der Zerstörung der Menschheit heraufbeschwört. Dadurch wird der zweite zum entscheidenden Faktor. Mehr denn je ist der proletarische Klassenkampf jetzt Motor der Geschichte. Bewusstsein, Einheit, Vertrauen, Solidarität, Wille und Heroismus sind Qualitäten, die das Proletariat im Klassenkampf auf einem völlig anderen, höheren Niveau einbringen kann als die anderen gesellschaftlichen Klassen der Geschichte. Es sind diese Qualitäten, die, aufs Höchste entwickelt, dem Proletariat erlauben, die dem Zerfall innewohnenden Gefahren zu überwinden und den Weg zur kommunistischen Befreiung der Menschheit zu eröffnen.
C. Mir
(*) Notiz
In einem Flugblatt der „IFIKS“ (jene selbst ernannte „Interne Fraktion der IKS“ ist zusammengesetzt aus Ex-Mitgliedern unserer Organisation) mit dem Titel „Fragen an die aktuellen Militanten und Sympathisanten der IKS“, welches im Vorfeld unserer öffentlichen Treffen sowie auf der pazifistischen Demonstration vom 20. März in Paris verteilt wurde, kommentiert diese Gruppe Auszüge aus der am 15. Internationalen Kongress der IKS angenommenen Resolution über die internationale Situation.
Erster Auszug: „Obgleich der Zerfall des Kapitalismus aus einer historischen ‚Sackgasse‘ zwischen den Klassen resultiert, ist diese Situation beileibe nicht statisch. Die Wirtschaftskrise, die am Anfang sowohl des Kriegskurses als auch der proletarischen Antwort steht, vertieft sich weiter, doch im Gegensatz zur Periode von 1968–89, als das Ergebnis der damaligen Klassenkonfrontationen nur der Weltkrieg oder die Weltrevolution sein konnte, eröffnet die neue Periode eine dritte Alternative: die Zerstörung der Menschheit nicht durch einen apokalyptischen Krieg, sondern durch ein allmähliches Fortschreiten des Zerfalls, der nach einer gewissen Zeit die Fähigkeit des Proletariats untergraben könnte, als Klasse zu antworten, und der den Planeten durch eine endlose Spirale von regionalen Kriegen und ökologischen Katastrophen gleichermassen unbewohnbar machen könnte. Um einen Weltkrieg zu führen, müsste die Bourgeoisie zunächst die Hauptbataillone der Arbeiterklasse offen konfrontieren, besiegen und sie anschliessend dazu mobilisieren, mit Begeisterung hinter den Bannern und der Ideologie eines neuen imperialistischen Blocks zu marschieren. In dem neuen Szenario könnte die Arbeiterklasse schleichend und indirekt besiegt werden, wenn es ihr nicht gelingt, auf die Krise des Systems zu antworten, und sie hinnimmt, dass sie immer tiefer in den Pfuhl des Zerfalls gedrängt wird.“ (37)
Kommentar der IFIKS: „Das ist eindeutig die opportunistische Einführung eines ‘dritten Weges’, der im Widerspruch zur klassisch marxistischen These einer historischen Alternative steht. Wie bei Bernstein, Kautsky und ihren Epigonen steht die Idee eines dritten Weges im Widerspruch zur – gemäss dem Opportunismus ‘vereinfachenden’ – historischen Alternative von ‘Krieg oder Revolution’. Es handelt sich hier um eine offene und ausdrückliche Revision einer klassischen These der Arbeiterbewegung“
Zweiter Auszug unserer Resolution:
„Was mit dem Zerfall hinzu gekommen ist, ist die Möglichkeit einer historischen Niederlage nicht durch einen Frontalzusammenstoss zwischen den Hauptklassen, sondern durch ein langsames Dahinsiechen der Fähigkeit des Proletariats, sich selbst als eine Klasse zu konstituieren, was es erschweren würde, den point of no return wahrzunehmen, da dieser bereits vor dem eigentlichen katastrophalen Ende erreicht wäre. Dieser tödlichen Gefahr steht die Klasse heute gegenüber.“
Kommentar der IFIKS:
„Hier drückt sich die opportunistische und revisionistische Tendenz aus, den Klassenkampf zu liquidieren.“
In Wirklichkeit zeigt sich in diesen Zeilen die gezielte Absicht der IFIKS, unserer Organisation mit allen Mitteln Schaden zuzufügen – mit dem Ziel, sie zu zerstören. Die Mitglieder der IFIKS haben nach mehreren Jahrzehnten der Militanz innerhalb der IKS ihre kommunistischen Überzeugungen verloren und den Untergang der IKS beschworen. So sind sie zu den gröbsten Erbärmlichkeiten bereit, um an ihr Ziel zu kommen: Raub, spitzel-ähnliches Verhalten (38) sowie offensichtliche und schamlose Lügen. Doch die IKS hat ihre Positionen keineswegs „revidiert“, seitdem die weissen Ritter der IFIKS nicht mehr da sind, um sie vor der „Entartung“ zu beschützen.
In ihrem auf dem 13. Kongress der IKS angenommenen Bericht über den Klassenkampf, der einstimmig, also auch von den späteren Gründern der IFIKS, angenommen wurde, kann man u.a. lesen:
„Die Gefahren der neuen Periode für die Arbeiterklasse und für die Zukunft ihrer Kämpfe darf nicht unterschätzt werden. Während der Klassenkampf in den 70er und 80er-Jahren definitiv eine Barriere gegen den Krieg darstellte, wird der Prozess des Zerfalls von den Tageskämpfen weder gestoppt noch verlangsamt. Um einen Weltkrieg auszulösen, müsste die Bourgeoisie eine Reihe wichtiger Siege über die zentralen Bataillone der Arbeiterklasse erringen. Heute sieht sich das Proletariat einer längerfristigen, aber nicht minder gefährlichen Bedrohung des ‚Todes auf Raten‘ gegenüber, wo die Arbeiterklasse in wachsendem Masse durch den ganzen Prozess bis zu dem Punkt niedergerungen werden kann, an dem sie die Fähigkeit verliert, sich selbst als Klasse zu behaupten, während der Kapitalismus von einer Katastrophe in die nächste stürzt (lokale Kriege, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, Seuchen, etc.), bis jener Punkt erreicht ist, an dem die Aussicht auf eine kommunistische Gesellschaft auf Generationen hinaus zerstört würde – ganz zu schweigen von der eigentlichen Vernichtung der Menschheit selbst.“ (Internationale Revue, Nr. 25)
Ebenso liest man in einem von der IKS auf ihrem 14. Kongress vom Frühling 2001 (mit der Zustimmung der gleichen künftigen Mitglieder der IFIKS) angenommenen Bericht über den Klassenkampf:
„Gleichzeitig ist diese Entwicklung wenig tröstlich für die Sache des Kommunismus, da sie eine Situation geschaffen hat, in der die Basis einer neuen Gesellschaft auch ohne Weltkrieg und somit ohne die Notwendigkeit, das Proletariat für den Krieg zu mobilisieren, untergraben werden kann. Im ersten Szenario ist es der Nuklearkrieg, der die Möglichkeit des Kommunismus definitiv aufs Spiel setzt, indem er den Planeten oder zumindest einen grossen Teil der globalen Produktivkräfte, einschliesslich des Proletariats, zerstört. Das neue Szenario sieht die Möglichkeit eines langsameren, aber nicht weniger tödlichen Rutsches in einen Zustand vor, in dem das Proletariat irreparabel zersplittert ist und die natürlichen sowie wirtschaftlichen Fundamente für die gesellschaftliche Umwandlung durch die Zunahme von lokalen und regionalen militärischen Konflikten, von Umweltkatastrophen und durch den gesellschaftlichen Zusammenbruch gleichermassen ruiniert werden.“ (Internationale Revue
Nr. 30)
Bezüglich dieser vom Kongress angekommenen Resolution erklärt der Punkt 13, dass „... die Gefahr bleibt, dass der eher schleichende Prozess des Zerfalls die Klasse allmählich überwältigen könnte, ohne dass der Kapitalismus ihre totale Niederlage herbeiführen muss…“ (Resolution zur internationalen Lage des 14. IKS-Kongress, in: Weltrevolution, Nr. 107)
Muss man annehmen, dass die glorreichen Verteidiger der „wahren IKS“ (wie sie sich definieren) am Schlafen waren, als diese Dokumente angenommen wurden, oder dass sich ihre Arme von allein erhoben, um für die Annahme des Berichts zu stimmen? Dann müsste man aber davon ausgehen, dass sie mehr als elf Jahre lang geschlafen haben, da es nämlich in einem im Januar 1990 vom Zentralorgan der IKS angenommenen (und von seinen Mitgliedern vorbehaltlos befürworteten) Bericht heisst: „Während der Weltkrieg gegenwärtig keine und vielleicht nie mehr eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit darstellt, kann diese Bedrohung wiederum noch aus dem Zerfall der Gesellschaft herorgehen. Während die Auslösung eines Weltkrieges die Unterstützung der Arbeiterklasse für die Werte der Bourgeoisie erfordert (...) erfordert der Zerfall überhaupt nicht die Unterstützung der Arbeiter für die Zerstörung der Menschheit.“ (39)
Fußnoten:
1 Wir haben unsererseits zahlreiche Artikel unserer Presse der Kritik diesen unser Erachtens falschen Ansichten gewidmet. An erster Stelle sei die, bezogen auf den Marxismus, fälschliche „Innovation“ mit dem paradoxen Namen „Invarianz“ genannt. Im Namen dieser „Invarianz“ weigert sich die bordigistische Strömung (sie gehört wie die IKS der Kommunistischen Linken an) auf dogmatische Weise, die Realität einer weitreichenden Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft seit 1848 anzuerkennen. Damit widerspricht sie auch der Auffassung, dass das System in seine dekadente Phase getreten ist (siehe unsere Artikel über die Ablehnung der Dekadenztheorie durch die Internationale Kommunistische Partei
(Kommunistisches Programm), in: International Review Nrn. 77 und 78 und über die Ablehnung des IBRP, The Conception of Decadence in Capitalism, in: International Review, Nr. 79 (engl., franz., span. Ausgabe).
2 Es handelt sich um folgende Artikel: War and the ICC (Der Krieg und die IKS) in Revolutionary Perspectives, Nr. 24, Workers’ Struggles in Argentina: Polemic with the ICC (Arbeiterkämpfe in Argentinien: eine Polemik mit der IKS) in Internationalist Communist, Nr. 21 und Imperialsm’s New World Order“ (Die neue Weltordnung des Imperialismus) in: Revolutionary Perspectives, Nr. 27.
3 s. International Review Nrn. 48, 49, 50, 54, 55 und 56 (engl., franz., span. Ausgabe). und in Deutsch Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen in: Internationale Revue Nrn. 10–12.
4 s. Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft, Punkt 3, in: Internationale Revue Nr. 13.
5 s. On Imperialisme, in: Internationale Review
Nr. 19 (engl., franz., span. Ausgabe).
6 s. Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft, in: Internationale Revue Nr. 13.
7s. Richtlinien der Kommunistischen Internationale, angenommen auf dem 1. Kongress, Die Kommunistischen Internationale: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd, 1, Intarlit (1984) und: www.sinistra.net/komintern/dok/1krichtkid.html [116]
8 Ebd.
9 s. Manifest der Kommunistischen Internationale an das Weltproletariat, weitere Quellenangabe siehe Fussnote 7 auf dieser Seite.
10 s. Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft, in: Internationale Revue Nr. 13.
11. Ebd.
12 s. Instabilité et décadence capitaliste, in: Internationalisme Nr. 23.
13 s. Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft, Punkt 3, in: Internationale Revue Nr. 13.
14 Wenn wir den Begriff des Zerfalls benutzen, so beziehen wir uns auf die Phase des Zerfalls. Die Ausdrücke „Phase des Zerfalls“ und „Phänomen des Zerfalls“ sind zu unterscheiden. Wie wir oben gesehen haben, begleitet das Phänomen des Zerfalls mehr oder weniger deutlich den gesamten Prozess der Dekadenz und wird zum bestimmenden Faktor erst in der Zerfallsphase selbst.
15 s. Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft, Punkt 3, Internationale Revue Nr. 13.
16 Karl Marx, Lohnarbeit und Kapital, in: MEW 6, S. 408.
17 Friedrich Engels, Vorwort zur deutschen Neuausgabe des Kommunistischen Manifests von 1883, in: MEW 21, S. 3.
18 s. Les principes, armes de la révolution, in: Bilan, Nr. 5.
19 Ebenda. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass eine Idee nicht auf Anhieb bei den Lesern als unbestreitbar marxistisch empfunden wird, nur weil sie von der linkskommunistischen Strömung Italiens entwickelt wurde. Zumindest sollte diese Tatsache aber die Genossen und Sympathisanten von Organisationen interessieren, die sich zu dieser historischen Strömung zählen – etwa das IBRP oder die verschiedenen sich Internationale Kommunistische Partei nennenden Gruppen.
20 Siehe das Kapitel in unserer Broschüre Die Gewerkschaften gegen die Arbeiterklasse: Der Kampf des Proletariats im aufsteigenden und im dekadenten Kapitalismus.
21 s.Why the proletariat has not yet overtrown capitalism, in: Internationale Review Nr. 103 und 104 (engl., franz., span. Ausgabe).
22 s. Bericht über den Klassenkampf – das Konzept des historischen Kurses in der revolutionären Bewegung, angenommen vom 14. Kongress der IKS; Internationale Revue Nr. 29 und 30.
23 Lenin, Referat über den Kampf gegen die Hungersnot, in: Werke, Bd. 27, S. 432.
24 Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW 13, S. 9.
25 Burnham und seine neue Theorie einer „Managerklasse“.
26 Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW 13, S. 9.
27 Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der kommunistischen Partei, in: MEW 4, S. 462.
28 Karl Marx Der Bürgerkrieg in Frankreich, in: MEW 17, S. 343.
29 Karl Marx/Friedrich Engels Die deutsche Ideologie, in: MEW 3, S. 45.
30 L’évolution du capitalisme et la nouvelle perspective, Kommunistische Linke Frankreichs, Internationalisme, Nr. 46, 1952; wiederveröffentlicht in: InternationaleRevew Nr. 21 (engl., franz., span. Ausgabe/Der Text ist auch in Deutsch erhältlich)
31 Bericht über den Klassenkampf – das Konzept des historischen Kurses in der revolutionären Bewegung, angenommen vom 14. Kongress der IKS, in: Internationale Revue Nrn. 29 und 30.
32 Die Periode des Kalten Krieges zeigte schon mit ihrem wahnwitzigen nuklearen Rüstungswettlauf das Ende jeglicher Möglichkeit eines Wiederaufbaus infolge eines möglicherweise ausbrechenden Dritten Weltkrieges.
33 siehe die Notiz * am Ende des Artikels.
34 s. Der Zerfall der Kapitalistischen Gesellschaft, Punkt 17, in: Internationale Revue Nr. 13.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 s. Resolution über die internationale Situation vom 15. Kongress der IKS, in: Internationale Revue Nr. 31, Hervorhebungen von der IFIKS.
38 s Die Polizeimethoden der IFIKS, in Weltrevolution Nr. 117.
39 s. Der Zusammenbruch des Ostblocks: Destabilisierung und Chaos, in: Internationale Revue Nr. 12.
Theoretische Fragen:
- Zerfall [81]
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Theorie der Dekadenz ist das Herzstück des historischen Materialismus (Teil I):
- 3421 Aufrufe
Von Marx zur Kommunistischen Linken
Wir beginnen hier mit einer neuen Reihe von Texten, die sich der Theorie der Dekadenz widmen.[1] Seit nunmehr einiger Zeit haben sich die Kritiken gegen diese Auffassung gehäuft. Zu einem grossen Umfang waren sie das Werk von Akademikern oder parasitärer Grüppchen. Andere dagegen drückten ein echtes Unverständnis innerhalb des revolutionären Milieus aus oder kamen von suchenden Elementen, die ernsthafte Fragen über die Evolution des Kapitalismus auf historischer Ebene stellten.[2] Wir haben bereits auf den grössten Teil dieser Kritiken geantwortet.[3] Heute jedoch müssen wir erleben, wie sich der Hintergrund der Kritik geändert hat. Es handelt sich nicht mehr um Fragen, Missverständnisse oder Zweifel; sie stellen nicht mehr einzelne Aspekte in Frage. Stattdessen haben wir es mit einer totalen Ablehnung zu tun, mit einer bestimmten Art von Kritik, die auf die Exkommunikation vom Marxismus hinausläuft.
Doch die Theorie der Dekadenz ist nichts Geringeres als die Konkretisierung des historischen Materialismus in der Analyse der Evolution der Produktionsweisen. Sie ist somit der unverzichtbare Rahmen zum Verständnis der historischen Periode, in der wir leben. Zu wissen, ob sich die Gesellschaft noch fortentwickelt oder ob sie am Ende ist, ist entscheidend, um zu begreifen, was in politischer und sozio-ökonomischer Hinsicht auf dem Spiel steht, und um entsprechend zu handeln. Wie in allen vergangenen Gesellschaftsformen drückt auch die Aufstiegsperiode des Kapitalismus den historisch notwendigen Charakter der Produktionsverhältnisse aus, die er verkörpert, d.h. ihre vitale Rolle bei der Ausbreitung der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Die Phase der Dekadenz drückt hingegen die Umwandlung dieser Verhältnisse in eine wachsende Schranke gegen eben diese Entwicklung aus. Dies ist eine der theoretischen Haupterrungenschaften, die uns Marx und Engels hinterlassen haben.
Das 20. Jahrhundert war eines der mörderischsten in der gesamten Geschichte der Menschheit sowohl im Ausmass, in Häufigkeit und Dauer der Kriege, die einen grossen Raum in diesem Jahrhundert einnahmen, als auch hinsichtlich des beispiellosen Ausmasses der menschlichen Katastrophen in dieser Zeit: von den grössten Hungersnöten in der Geschichte bis hin zum systematischen Völkermord und mitten drin Wirtschaftskrisen, die den ganzen Planeten schüttelten und Abermillionen von Proletariern und Menschen in tiefste Armut stürzten. Es gibt im 19. Jahrhundert nichts Vergleichbares. Während der Belle Epoque erreichte die bürgerliche Produktionsweise ungeahnte Höhen: Sie hatte den Erdball vereinheitlicht, hatte einen Grad an Produktivität und technologischer Raffinesse erreicht, von denen man zuvor nur träumen konnte. Trotz der Häufung von Spannungen im gesellschaftlichen Fundament waren die letzten 20 Jahre des Aufstiegs des Kapitalismus (1894–1914) am prosperierendsten; der Kapitalismus schien unüberwindlich, und bewaffnete Konflikte wurden in die Peripherien verbannt. Anders als das „lange 19. Jahrhundert“, das ein Zeitalter fast ununterbrochenem moralischen, intellektuellen und materiellen Fortschritts war, gab es seit 1914 dagegen einen markanten Rückschritt an allen Fronten. Der in wachsender Weise apokalyptische Charakter des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens überall auf dem Planeten und das Menetekel der Selbstzerstörung in einer endlosen Reihe von Konflikten und in gar noch folgenreicheren Umweltkatastrophen sind in keiner Weise eine natürliche Fatalität oder das schlichte Produkt menschlicher Verrücktheit und auch nicht ein Kennzeichen des Kapitalismus von Beginn an: Sie sind eine Manifestation der Dekadenz der kapitalistischen Produktionsweise, die – einst, vom 16. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg[4], ein mächtiger Faktor in der ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklung – mittlerweile zu einer Fessel jeglicher solcher Entwicklung und zu einer Bedrohung für das Überleben der Menschheit an sich geworden war.
Warum sieht sich die Menschheit ausgerechnet jetzt mit der Existenzfrage konfrontiert, wo sie einen Grad an Produktivkraftentwicklung erreicht hat, der sie zum ersten Mal in der Geschichte in die Lage versetzt, sich auf eine Welt ohne materielle Not, auf eine vereinte Gesellschaft zuzubewegsen, die imstande ist, ihren Handlungen die Bedürfnisse, die Wünsche und das Bewusstsein der Menschheit zugrundezulegen? Bildet das Weltproletariat wirklich jene revolutionäre Kraft, die die Menschheit aus dem Schlamassel ziehen kann, in das der Kapitalismus sie geführt hat? Warum können die meisten Kampfformen der Arbeiter in unserer Epoche nicht so aussehen wie im 19. Jahrhundert, wie der Kampf um eine allmähliche Reformierung durch die Gewerkschaften, den Parlamentarismus oder die Unterstützung der Bildung von neuen Nationalstaaten oder bestimmter fortschrittlicher Fraktionen der Bourgeoisie? Es ist unmöglich, sich in der heutigen historischen Lage zurechtzufinden – ganz zu schweigen davon, eine avantgardistische Rolle einzunehmen – ohne eine globale, zusammenhängende Vision zu besitzen, die diese elementaren und kreuzwichtigen Fragen beantworten kann. Der Marxismus – der historische Materialismus – ist die einzige Konzeption von der Welt, die es möglich macht, eine solche Antwort zu liefern. Seine klare und einfache Antwort kann in ein paar Worten zusammengefasst werden; so wie die Produktionsweisen vor ihm ist auch der Kapitalismus kein ewiges System: „Über einen gewissen Punkt hinaus wird die Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke für das Kapital; also das Kapitalverhältnis eine Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Auf diesem Punkt angelangt, tritt das Kapital, d.h. Lohnarbeit, in dasselbe Verhältnis zur Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums und der Produktivkräfte, wie Zunftwesen, Leibeigenschaft, Sklaverei, und wird als Fessel notwendig abgestreift. Die letzte Knechtgestalt, die die menschliche Tätigkeit annimmt, die der Lohnarbeit auf der einen, des Kapitals auf der anderen Seite, wird damit abgehäutet, und diese Abhäutung selbst ist das Resultat der dem Kapital entsprechenden Produktionsweise; die materiellen und geistigen Bedingungen der Negation der Lohnarbeit und des Kapitals, die selbst schon die Negation früherer Formen der unfreien gesellschaftlichen Produktion sind, sind selbst Resultate seines Produktionsprozesses. In schneidenden Widersprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihren bisherigen Produktionsverhältnissen aus.“[5]
Solange der Kapitalismus seine historisch fortschrittliche Rolle erfüllte und das Proletariat noch nicht ausreichend entwickelt war, konnten die Arbeiterkämpfe nicht in eine triumphierende Weltrevolution münden; allerdings erlaubten sie dem Proletariat, sich selbst zu erkennen und als Klasse durch den gewerkschaftlichen und parlamentarischen Kampf um echte Reformen und dauerhafte Verbesserungen ihrer Lebensbedingungen zu behaupten. Von dem Moment an, wo das kapitalistische System in die Dekadenz eintrat, wurde die kommunistische Weltrevolution zu einer Möglichkeit wie zu einer Notwendigkeit. Die Form der Arbeiterkämpfe wurde radikal umgewälzt, auch auf unmittelbarer Ebene: Die Verteidigungskämpfe konnten weder in Form noch im Inhalt durch die Kampfmittel ausgedrückt werden, die im 19. Jahrhundert geschmiedet worden waren, wie die Gewerkschaften und die parlamentarische Repräsentation von politischen Arbeiterorganisationen.
Von den revolutionären Bewegungen gezeugt, die dem Ersten Weltkrieg ein Ende bereiteten, wurde 1919 die Kommunistische Internationale im Wissen darum gegründet, dass die Bourgeoisie nicht mehr eine historisch fortschrittliche Klasse war: „2. Die Niedergangsperiode des Kapitalismus. Nach Abschätzung der ökonomischen Weltlage konnte der 3. Kongress mit vollkommener Bestimmtheit konstatieren, dass der Kapitalismus nach Erfüllung seiner Mission, die Entwicklung der Produktion zu fördern, in unversöhnlichen Widerspruch zu den Bedürfnissen nicht nur der gegenwärtigen historischen Entwicklung, sondern auch der elementarsten menschlichen Existenzbedingungen geraten ist. Im letzten imperialistischen Kriege spiegelte sich dieser fundamentale Widerspruch wider, der durch den Krieg noch verschärft wurde und der die Produktions- und Zirkulationsverhältnisse den schwersten Erschütterungen aussetzte. Der überlebte Kapitalismus ist in das Stadium getreten, in dem die Zerstörungsarbeit seiner zügellosen Kräfte die schöpferischen, wirtschaftlichen Errungenschaften, die das Proletariat noch in den Fesseln kapitalistischer Knechtschaft geschaffen hat, lähmt und vernichtet.“[6]
Von da an war die Erkenntnis, dass der Erste Weltkrieg den Eintritt des kapitalistischen Systems in seine dekadente Periode markierte, gemeinsames Gedankengut der Mehrheit der linkskommunistischen Gruppierungen, die dank dieses historischen Kompasses in der Lage waren, kompromisslos auf dem kohärenten Klassenterrain auszuharren. Die IKS hat lediglich ein Erbe aufgegriffen und weiterentwickelt, das von der deutschen und italienischen Linken in den 30er- und 40er-Jahren des 20. Jahrhunderts und anschliessend von der Gauche Communiste in Frankreich der 40er und 50er-Jahre bereichert und übermittelt wurde.
Entscheidende Klassenauseinandersetzungen sind am Horizont sichtbar. Es ist daher für das Proletariat wichtiger denn je, sich seine eigene Konzeption von der Welt wiederanzueignen, die in fast zwei Jahrhunderten der Arbeiterkämpfe und der theoretischen Ausarbeitung durch seine politischen Organisationen entwickelt worden war. Mehr denn je muss das Proletariat verstehen, dass die gegenwärtige Verschärfung der Barbarei und die ununterbrochene Steigerung der Ausbeutung keine natürliche Sache sind, sondern das Resultat der ökonomischen und gesellschaftlichen Gesetze, die die Welt weiterhin regieren, obwohl sie historisch seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts obsolet sind. Es ist wichtiger denn je für die Arbeiterklasse zu verstehen, dass dieselben Kampfformen, die sie im 19. Jahrhundert gelernt hatte (Minimalprogramm der Kämpfe um Reformen, die Unterstützung progressiver Fraktionen der Bourgeoisie, etc.) und die in der Periode des Aufstiegs des Kapitalismus auch sinnvoll waren, als Letzterer die Existenz eines organisierten Proletariats innerhalb der Gesellschaft noch „tolerieren“ konnte, in der Dekadenzperiode nur in die Sackgasse führen können. Mehr denn je zuvor ist es lebenswichtig für das Proletariat zu begreifen, dass die kommunistische Revolution nicht ein ideeller Traum, eine Utopie ist, sondern eine Notwendigkeit und eine Möglichkeit, die ihre wissenschaftlichen Fundamente im Verständnis der Dekadenz der kapitalistischen Produktionsweise hat.
Zweck dieser neuen Artikelreihe über die Dekadenztheorie ist es, auf all die Einwände, die gegen sie erhoben werden, zu antworten. Diese Einwände sind ein Hindernis auf dem Weg der neuen revolutionären Kräfte zu den Positionen der Kommunistischen Linken; auch untergraben sie die politische Klarheit unter den Gruppen des revolutionären Milieus.
Von Marx zur Kommunistischen Linken
Im ersten Artikel dieser Reihe wollen wir also damit beginnen, entgegen jener Stimmen, die behaupten, dass das Konzept und selbst der Begriff der Dekadenz in den Schriften von Marx und Engels nicht vorhanden waren oder keinen wissenschaftlichen Wert eingeräumt bekamen, nochmals zu wiederholen, dass diese Theorie nicht weniger als der Kern des historischen Materialismus ist. Wir werden aufzeigen, dass dieser theoretische Rahmen, so wie der Begriff „Dekadenz“, durchaus in ihrem Werk vorhanden ist. Hinter dieser Kritik bzw. Preisgabe des Begriffs der Dekadenz verbirgt sich die nackte Ablehnung des eigentlichen Kerns des Marxismus. Es ist völlig verständlich, dass sich die Kräfte der Bourgeoisie gegen die Idee sträuben, dass sich ihr System in der Dekadenz befindet. Das Problem ist jedoch, dass ausgerechnet in dem Moment, wo es überlebenswichtig ist, auf die wirklichen Gefahren für die Arbeiterklasse und die Menschheit hinzuweisen, Gruppen, die von sich behaupten, marxistisch zu sein, just jenes Werkzeug von sich weisen, das von der marxistischen Methode zur Verfügung gestellt wird, um die Realität zu begreifen.[7]
Die Theorie der Dekadenz in den Schriften der Begründer des historischen Materialismus
Entgegen dem, was allgemein behauptet wird, ist die Hauptentdeckung in den Schriften von Marx und Engels nicht die Existenz von Klassen oder des Klassenkampfes, nicht die Werttheorie oder der Mehrwert. All diese Auffassungen wurden von Historikern und Ökonomen bereits zu einer Zeit entwickelt, als die Bourgeoisie noch eine revolutionäre Klasse war, die gegen die feudalen Widerstände ankämpfte. Das fundamental neue Element im Werk von Marx und Engels wohnte in ihrer Analyse des historischen Charakters der Klassenteilung inne, der Dynamik, die der Abfolge der verschiedenen Produktionsweisen zugrundelag; dies ist es, was sie dazu führte, den Übergangscharakter der kapitalistischen Produktionsweise und die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats als Zwischenphase auf dem Weg zu einer klassenlosen Gesellschaft zu begreifen. Mit anderen Worten, das, was den Kern ihrer Entdeckungen bildet, ist nichts anderes als der historische Materialismus: „Was mich betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen, und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war 1. nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloss an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist; 2. dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt; 3. dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet.“[8]
Gemäss unserer Kritiker ist der Begriff der Dekadenz überhaupt nicht marxistisch, ja, steht nicht einmal in den Werken von Marx und Engels. Das einfache Studium ihrer Haupttexte zeigt jedoch, dass dieser Begriff sich sehr wohl im eigentlichen Herzen des historischen Materialismus befindet. So schrieb Engels in seinem „Anti-Dühring“[9] (1877) in diesem Zusammenhang, dass die wichtigste Sache, die Fourier und der historische Materialismus gemeinsam hatten, nichts anderes sei als der Begriff des Aufstiegs und der Dekadenz einer Produktionsweise, die für die gesamte menschliche Geschichte gültig seien: „Am grossartigsten aber erscheint Fourier in seiner Auffassung der Geschichte der Gesellschaft (…) Fourier, wie man sieht, handhabt die Dialektik mit derselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse Hegel. Mit gleicher Dialektik hebt er hervor, gegenüber dem Gerede von der unbegrenzten menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit, dass jede geschichtliche Phase ihren aufsteigenden, aber auch ihren absteigenden Ast hat, und wendet diese Anschauungsweise auch auf die Zukunft der gesamten Menschheit an.“[10]
In der Passage aus den „Grundrissen einer Kritik der politischen Ökonomie“, die in der Einleitung dieses Artikels zitiert wurde, gibt Marx möglicherweise die klarste Definition dessen, was sich hinter dem Begriff der Dekadenzphase verbirgt. Er identifiziert diese Phase als einen besonderen Schritt im Leben einer Produktionsweise. „Über einen gewissen Punkt hinaus…“ – wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse der Produktion zu einem Hindernis für die Weiterentwicklung der Produktionsmittel werden – wird „... das Kapitalverhältnis eine Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit“. Hat die Wirtschaftsentwicklung einmal diesen Punkt erreicht, bewirkt das Festhalten an den jeweiligen gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen – Lohnarbeit, Leibeigentum, Sklaverei – eine fundamentale Behinderung der Weiterentwicklung der Produktivkräfte. Dies ist der Grundmechanismus in der Evolution aller Produktionsweisen: „Auf diesem Punkt angelangt, tritt das Kapital, d. h. Lohnarbeit, in dasselbe Verhältnis zur Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums und der Produktivkräfte, wie Zunftwesen, Leibeigenschaft, Sklaverei, und wird als Fessel notwendig abgestreift.“ Marx definiert die Charakteristiken sehr präzise: „In schneidenden Widersprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihren bisherigen Produktionsverhältnissen aus.“ Diese allgemeine theoretische Definition der Dekadenz wurde von Marx und Engels als ein „operatives wissenschaftliches Konzept“ bei der konkreten Analyse der Entwicklung der Produktionsweisen benutzt.
Das Konzept der Dekadenz in der Analyse der früheren Produktionsweisen
Nachdem sie einen grossen Teil ihrer Energie dafür aufgebracht hatten, die Mechanismen und Widersprüche des Kapitalismus zu entziffern, lag es für Marx und Engels nahe, eine fundierte Studie über seine Geburt aus dem Leib des Feudalismus zu verfassen. So fertigte Engels 1884 eine unvollendete Ergänzung im Zusammenhang mit der von ihm geplanten Neuausgabe „Der Bauernkrieg in Deutschland“ an, deren Zweck es war, einen historischen Gesamtrahmen jener Periode zu liefern, in der die von ihm analysierten Ereignisse stattfanden. Er betitelte diese Ergänzung ausdrücklich „Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie“. Hier einige höchst bedeutsame Auszüge: „Während der wüsten Kämpfe des herrschenden Feudaladels das Mittelalten mit viel Lärm erfüllte, hatte die stille Arbeit der unterdrückten Klasse in ganz Westeuropa das Feudalsystem untergraben, hatte Zustände geschaffen, in denen für den Feudalherrn immer weniger Platz blieb. (…) Während der Adel immer überflüssiger und der Entwicklung hinderlicher, wurden so die Stadtbürger die Klasse, in der die Fortentwicklung der Produktion und des Verkehrs, der Bildung, der sozialen und politischen Institutionen sich verkörpert fand. Alle diese Fortschritte der Produktion und des Austausches waren in der Tat, nach heutigen Begriffen, sehr beschränkter Natur. Die Produktion blieb gebannt in die Form des reinen Zunfthandwerks, behielt also selbst noch einen feudalen Charakter; der Handel blieb innerhalb der europäischen Gewässer und ging nicht über die levantischen Küstenstädte hinaus, in denen er die Produkte des Fernen Ostens eintauschte. Aber kleinlich und beschränkt, wie die Gewerbe und mit ihnen die gewerbetreibenden Bürger blieben, sie reichten hin, die feudale Gesellschaft umzuwälzen, und sie blieben wenigstens in der Bewegung, während der Adel stagnierte. (…) Im fünfzehnten Jahrhundert war also die Feudalität in ganz Westeuropa in vollem Verfall. (…) Überall aber hatten sich – in den Städten wie auf dem Land – die Elemente der Bevölkerung gemehrt, die vor allem verlangten, dass das ewige sinnlose Kriegführen aufhöre, jene Fehden der Feudalherren, die den innern Krieg permanent machten, selbst wenn der fremde Feind im Lande war, jener Zustand ununterbrochener, rein zweckloser Verwüstung, der das ganze Mittelalter hindurch gewährt hatte. (…) Wir sahen, wie der Feudaladel anfing, in ökonomischer Beziehung in der Gesellschaft des späteren Mittelalters überflüssig, ja hinderlich zu werden; wie er auch bereits politisch der Entwicklung der Städte und des damals nur in monarchischer Form möglichen nationalen Staats im Wege stand. Trotz alledem hatte ihn der Umstand gehalten, dass er bis dahin das Monopol der Waffenführung hatte, dass ohne ihn keine Kriege geführt, keine Schlachten geschlagen werden konnten. Auch dies sollte sich ändern; der letzte Schritt sollte getan werden, um dem Feudaladel klarzumachen, dass die von ihm beherrschte gesellschaftliche und staatliche Periode zu Ende, dass er in seiner Eigenschaft als Ritter, auch auf dem Schlachtfeld, nicht mehr zu brauchen sei.“[11]
Diese langen Ausführungen von Engels sind insofern besonders aufschlussreich, als sie uns zurückversetzen sowohl in den Prozess des „Niedergangs des Feudalismus“ als auch gleichzeitig in den „Aufstieg der Bourgeoisie“ und den Übergang zum Kapitalismus. In wenigen Sätzen verkünden sie die vier Hauptzüge der Dekadenzperiode einer jeglichen Produktionsweise und des Übergangs zu einer neuen:
a) Das langsame und allmähliche Auftauchen einer neuen revolutionären Klasse, die der Träger neuer gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse innerhalb der alten, zerfallenden Gesellschaft ist: „Während der Adel immer überflüssiger und der Entwicklung hinderlicher, wurden so die Stadtbürger die Klasse, in der die Fortentwicklung der Produktion und des Verkehrs, der Bildung, der sozialen und politischen Institutionen sich verkörpert fand.“ Die Bourgeoisie repräsentierte das Neue, der Adel stand für das Ancien Régime; erst als ihre Wirtschaftsmacht sich innerhalb der feudalen Produktionsweise einigermassen konsolidiert hatte, fühlte sich die Bourgeoisie stark genug, der Aristokratie die Macht streitig zu machen. Nebenbei bemerkt, widerspricht dies formal der bordigistischen Sichtweise der Geschichte, eine besonders deformierte Vision des historischen Materialismus, die postuliert, dass jede Produktionsweise tendenziell stets aufsteigend sei und allein durch ein brutales Ereignis (Revolution? Krise?) plötzlich und nahezu senkrecht zu Fall gebracht werden könne. Am Ende dieser „erlösenden“ Katastrophe erscheine ein neues gesellschaftliches Regime aus der Tiefe des Abgrunds: „Die marxistische Vision kann als eine Reihe von Zweigen dargestellt werden, von Kurven, die zum Gipfel streben, dem anschliessend ein gewaltsamer, plötzlicher, nahezu vertikaler Fall folgt; und am Ende dieses Falls erhebt sich ein neues gesellschaftliches Regime.“[12]
b) Die Dialektik zwischen dem Alten und dem Neuen auf der Ebene der ökonomischen Struktur: „Alle diese Fortschritte der Produktion und des Austausches waren in der Tat, nach heutigen Begriffen, sehr beschränkter Natur. Die Produktion blieb gebannt in die Form des reinen Zunfthandwerks, behielt also selbst noch einen feudalen Charakter; der Handel blieb innerhalb der europäischen Gewässer und ging nicht über die levantischen Küstenstädte hinaus, in denen er die Produkte des Fernen Ostens eintauschte. Aber kleinlich und beschränkt, wie die Gewerbe und mit ihnen die gewerbetreibenden Bürger blieben, sie reichten hin, die feudale Gesellschaft umzuwälzen, und sie blieben wenigstens in der Bewegung, während der Adel stagnierte. (…) Im fünfzehnten Jahrhundert war also die Feudalität in ganz Westeuropa in vollem Verfall.“ Doch so begrenzt („Kleingewerbe“) der materielle Fortschritt der Bourgeoisie auch war, es reichte aus, die „stagnierende“ Feudalgesellschaft zu stürzen, die sich, wie Engels sagt, „in ganz Westeuropa in vollem Verfall“, befand. Auch dies widerspricht formal einer anderen total absurden, frei erfundenen Theorie, die besagt, dass der Feudalismus ausstarb, da er sich einer effektiveren Produktionsweise gegenübersah, die ihm sozusagen den Rang ablief:
– „Wir haben in den vorhergehenden Seiten gesehen, dass es vielfältige Wege gibt, auf denen eine gegebene Produktionsweise verschwinden kann (...) Sie kann auch von innen aufgebrochen werden, durch eine aufstrebende Produktionsform, bis zu dem Punkt, wo die quantitative Bewegung einen qualitativen Schritt macht und das Neue das Alte stürzt. Dies war beim Feudalismus der Fall, der die kapitalistische Produktionsweise ins Leben setzte.“[13]
– „Der Feudalismus verschwand im Zuge des Erfolges der Marktwirtschaft. Anders als die Sklaverei verschwand er nicht wegen eines Produktivitätsmangels. Im Gegenteil: Die Geburt und Entwicklung der kapitalistischen Produktion wurde durch die wachsende Produktivität der feudalen Landwirtschaft ermöglicht, die die Bauernmassen überflüssig machte und in die Lage versetzte, Proletarier zu werden und genug Mehrwert zu schaffen, um die wachsende Bevölkerung in den Städten zu ernähren. Der Kapitalismus ersetzte den Feudalismus nicht, weil die Produktivität des Letzteren stagnierte, sondern weil er der Produktivität der kapitalistischen Wirtschaft unterlegen war.“[14]
– Im Gegensatz dazu spricht Marx deutlich über „die Zünfte und die Fesseln, die diese der freien Entwicklung der Produktion“, über „Feudalmacht und ihre empörenden Vorrechte“, über „Die industriellen Kapitalisten, diese neuen Potentaten, mussten ihrerseits nicht nur die zünftigen Handwerksmeister verdrängen, sondern auch die im Besitz der Reichtumsquellen befindlichen Feudalherren. Von dieser Seite stellt sich ihr Emporkommen dar als Frucht eines siegreichen Kampfes gegen die Feudalmacht und ihre empörenden Vorrechte sowie gegen die Zünfte und die Fesseln, die diese der freien Entwicklung der Produktion und der freien Ausbeutung des Menschen durch den Menschen angelegt“.[15]
Die Analyse, die von den Gründern des historischen Materialismus erstellt wurde und auf empirischer Ebene durch historische Untersuchungen[16] völlig bestätigt worden war, ist das genaue Gegenteil der Ausschweifungen jener, die die Theorie der Dekadenz ablehnen. Die Analyse der Dekadenz des Feudalismus und des Übergangs zum Kapitalismus wurde im „Kommunistischen Manifest“ deutlich ausgesprochen, wenn Marx von der „aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangenen modernen bürgerlichen Gesellschaft“ spricht, davon, dass Weltmarkt und Kolonialmärkte „einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung (verschafften) (…) Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf (...) Wir haben also gesehen: Die Produktions- und Verkehrsmittel, auf deren Grundlage sich die Bourgeoisie heranbildete, wurden in der feudalen Gesellschaft erzeugt. Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und Verkehrsmittel entsprachen die Verhältnisse, worin die feudale Gesellschaft produzierte und austauschte, die feudale Organisation der Agrikultur und Manufaktur, mit einem Wort die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr. Sie hemmten die Produktion, statt sie zu fördern. Sie verwandelten sich in ebenso viele Fesseln. Sie mussten gesprengt werden, sie wurden gesprengt.“[17]
– Für jene, die lesen können, ist Marx sehr deutlich: Er spricht über eine „zerfallende feudale Gesellschaft“. Warum befand sich der Feudalismus in der Dekadenz? Weil „die feudalen Eigentumsverhältnisse den schon entwickelten Produktivkräften nicht mehr (entsprachen)“. Innerhalb dieser im Ruin befindlichen Gesellschaft sollte der Übergang zum Kapitalismus, zur „aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangenen modernen bürgerlichen Gesellschaft“ beginnen. Marx entwickelte diese Analyse auch in der „Kritik der politischen Ökonomie“: „Nur in den Zeiten des Untergangs des Feudalwesens, wo es aber noch kämpft unter sich – so in England im 14. und ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts – ist ein goldenes Zeitalter für die sich emanzipierende Arbeit“[18] Um die feudale Dekadenz zu charakterisieren, die vom beginnenden 14. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert reichte, benutzten Marx und Engels zahlreiche Begriffe, die keinerlei Zweideutigkeiten bei all jenen zulassen, die ein Minimum an politischer Ehrlichkeit besitzen: „die Feudalität in ganz Westeuropa in vollem Verfall“; „der Adel stagnierte“; „zerfallende feudale Gesellschaft“; „die feudalen Eigentumsverhältnisse (…) verwandelten sich in ebenso viele Fesseln“; „die Zünfte und die Fesseln, die diese der freien Entwicklung der Produktion“[19]
c) Die Entwicklung von Konflikten zwischen verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse: „Während der wüsten Kämpfe des herrschenden Feudaladels das Mittelalten mit viel Lärm erfüllte (...) ununterbrochener, rein zweckloser Verwüstung, der das ganze Mittelalter hindurch gewährt hatte“. Was er sich nicht mehr durch seine ökonomische und politische Vorherrschaft über die Bauernschaft verschaffen konnte, das versuchte der Feudaladel durch Gewalt zu bekommen. Konfrontiert mit wachsenden Schwierigkeiten, genügend Mehrwert aus der Feudalrente zu extrahieren, begann der Adel, sich in endlosen Konflikten selbst in Stücke zu reissen, was keine anderen Konsequenzen hatte, als sich selbst und die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zu ruinieren. Der Hundertjährige Krieg, der Europas Bevölkerung halbierte, und die pausenlosen Erbfolgekriege sind die besten Beispiele dafür.
d) Die Entwicklung von Kämpfen durch die ausgebeutete Klasse: So „hatte die stille Arbeit der unterdrückten Klasse in ganz Westeuropa das Feudalsystem untergraben“ Auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Verhältnisse nimmt die Dekadenz der Produktionsweise die Form einer quantitativen und qualitativen Entwicklung der Kämpfe zwischen den antagonistischen Klassen an: der Kampf der ausgebeuteten Klasse, die ihr Elend um so mehr spürt, je mehr die Ausbeutung durch eine verzweifelte herrschende Klasse bis an ihre Grenzen getrieben wird; Kämpfe jener Klasse, die der Träger der neuen Gesellschaft ist und die sich mit den Kräften der alten gesellschaftlichen Ordnung anlegt (in der Vergangenheit war dies stets eine neue ausbeutende Klasse; unter dem Kapitalismus ist es das Proletariat, eine sowohl ausgebeutete als auch revolutionäre Klasse).
Diese langen Zitate über das Ende der feudalen Produktionsweise und den Übergang zum Kapitalismus demonstrieren schon für sich in aller Deutlichkeit, dass das Konzept der Dekadenz von Marx und Engels nicht nur theoretisch definiert worden war, sondern auch als operatives wissenschaftliches Konzept diente, das sie benutzten, um die Dynamik bei der Aufeinanderfolge der von ihnen untersuchten Produktionsweisen zu enthüllen. Es war daher völlig logisch für sie, dieses Konzept zu benutzen, ob sie nun die primitiven, asiatischen oder antiken Gesellschaften betrachteten. So beleuchteten Marx und Engels in Die deutsche Ideologie, als sie die Entfaltung der Produktionsweise der Sklaverei analysierten, die allgemeinen Kennzeichen der Dekadenz in diesem System: „Die letzten Jahrhunderte des verfallenden Römischen Reichs und die Eroberung durch die Barbaren selbst zerstörten eine Masse von Produktivkräften; der Ackerbau war gesunken, die Industrie aus Mangel an Absatz verfallen, der Handel eingeschlafen oder gewaltsam unterbrochen, die ländliche und städtische Bevölkerung hatte abgenommen“.[20] Auch in der Analyse der primitiven Gesellschaften finden wir den eigentlichen Kern der Definition der Dekadenz einer Produktionsweise von Marx und Engels: „Die Geschichte des Verfalls der Urgemeinschaften (...) ist noch zu schreiben. Bisher hat man dazu nur magere Skizzen geliefert. (…)2. dass die Ursachen ihres Verfalls von den ökonomischen Gegebenheiten herrühren, die sie hinderten, eine gewisse Stufe der Entwicklung zu überschreiten…“[21]
Schliesslich vergleicht Marx im Kapital hinsichtlich der Dekadenz der asiatischen Produktionsweise die Stagnation der asiatischen Gesellschaften mit dem Übergang zum Kapitalismus in Europa: [22] „Revolutionär wirkt der Wucher in allen vorkapitalistischen Produktionsweisen nur, indem er die Eigentumsformen zerstört und auflöst, auf deren fester Basis und beständiger Reproduktion in derselben Form die politische Gliederung ruht. Bei asiatischen Formen kann der Wucher lange fortdauern, ohne etwas andres als ökonomisches Verkommen und politische Verdorbenheit hervorzurufen. Erst wo und wann die übrigen Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise vorhanden, erscheint der Wucher als eines der Bildungsmittel der neuen Produktionsweise, durch Ruin der Feudalherrn und der Kleinproduktion einerseits, durch Zentralisation der Arbeitsbedingungen zu Kapital andererseits.“[23]
Die Herangehensweise von Marx und Engels an die Dekadenz des Kapitalismus
Da gibt es jene, die sehr gut wissen, dass Marx und Engels ausführlichen Gebrauch vom Konzept der Dekadenz für die Produktionsweise vor dem Kapitalismus machten, und dennoch behaupten: „Marx verlieh dem Kapitalismus nur in der historischen Phase eine fortschrittliche Definition, in welcher er die ökonomische Welt des Feudalismus eliminierte und eine Periode kraftvoller Entwicklung der Produktivkräfte hervorrief, die von der früheren Wirtschaftsform gehemmt worden waren; doch ging er nicht weiter in der Definition der Dekadenz, ausgenommen das eine Mal in seinem berühmten ,Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie.“[24] Nichts könnte falscher sein! Ihr ganzes Leben hindurch analysierten Marx und Engels die Entfaltung des Kapitalismus und versuchten ständig, die Kriterien für den Moment seines Eintritts in die Dekadenz zu bestimmen.
So nahmen sie schon frühzeitig, nämlich im Kommunistischen Manifest, an, dass der Kapitalismus seine historische Mission erfüllt habe und dass die Zeit reif sei, zum Kommunismus überzugehen: „Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehn, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen (...) Die Gesellschaft kann nicht mehr unter ihr leben, d.h. ihr Leben ist nicht verträglich mit der Gesellschaft.“[25]
Wir wissen, dass Marx und Engels später erkannten, dass ihre Diagnose übereilt war. So schrieb 1850 Marx: „Bei dieser allgemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte der bürgerlichen Gesellschaft sich so üppig entwickeln, wie dies innerhalb der bürgerlichen Verhältnisse überhaupt möglich ist, kann von einer wirklichen Revolution keine Rede sein. Eine solche Revolution ist nur in den Perioden möglich, wo diese beiden Faktoren, die modernen Produktivkräfte und die bürgerlichen Produktionsformen, miteinander in Widerspruch geraten. (…) Eine neue Revolution ist nur möglich im Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist aber auch ebenso sicher wie diese.“[26]
Und in einem sehr aufschlussreichen Brief an Engels, datiert vom 8. Oktober 1858, ging Marx an die qualitativen Kriterien heran, um den Übergang in die Phase der Dekadenz zu bestimmen, d.h. „die Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner Basis ruhenden Produktion“. Seiner Auffassung nach trafen diese beiden Kriterien auf Europa zu – er nahm 1858 an, dass die Zeit für die sozialistische Revolution auf dem Kontinent reif sei – aber noch nicht auf den Rest des Globus, wo er den Kapitalismus immer noch in seiner aufsteigenden Phase sah: „Die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft ist die Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner Basis ruhenden Produktion. Da die Welt rund ist, scheint dies mit der Kolonisation von Kalifornien und Australien und dem Aufschluss von China und Japan zum Abschluss gebracht. Die schwierige question für uns ist die: auf dem Kontinent ist die Revolution immanent und wird auch sofort einen sozialistischen Charakter annehmen. Wird sie in diesem kleinem Winkel nicht notwendig gecrusht werden, da auf viel grösserm Terrain das movement der bürgerlichen Gesellschaft noch ascendant ist?.“[27]
Im „Kapital“ sagt Marx, über die kapitalistische Produktionsweise: „Das beweist damit nur aufs neue, dass sie altersschwach wird und sich mehr und mehr überlebt.“[28] Und auch 1881 argumentiert Marx im zweiten Entwurf seines Briefes an Vera Sassulitsch, dass der Kapitalismus im Westen in seine dekadente Phase getreten sei: „Obwohl das kapitalistische System im Westen im Verblühen ist, und sich die Zeit nähert, da es nur noch eine ‚archaische‘ Formation sein wird…“[29] Auch hier sind für jene, die des Lesens kundig sind und eine Grundehrlichkeit besitzen, die Begriffe, die Marx benutzt, wenn er über die Dekadenz des Kapitalismus spricht, unzweideutig: „Periode der Senilität“, „repressives Gesellschaftssystem“, „Fessel der Entwicklung der Produktivkräfte“,„ein System, das sich immer mehr überlebt hat“, etc.
Schliesslich schloss Engels diese Untersuchung 1895: „Die Geschichte hat uns und allen, die ähnlich dachten, unrecht gegeben. Sie hat klargemacht, dass der Stand der ökonomischen Entwicklung auf dem Kontinent damals noch bei weitem nicht reif war für die Beseitigung der kapitalistischen Produktion: Sie hat dies bewiesen durch die ökonomische Revolution, die seit 1848 den ganzen Kontinent ergriffen (…) so beweist dies ein für allemal, wie unmöglich es 1848 war, die soziale Umgestaltung durch einfache Überrumpelung zu erobern.“[30] In den Worten von Marx und Engels beweist dies „ein für allemal“ die Dummheiten auf den endlosen Seiten Papier, die von parasitären Elementen über die Möglichkeit der kommunistischen Revolution ab 1848 produziert werden: „Wir haben bei etlichen Gelegenheiten die These vertreten, dass der Kommunismus seit 1848 möglich ist.“[31] Diese Narreteien werden unglücklicherweise zu einem grossen Teil auch von den Bordigisten der PCI geteilt, die uns in einer sehr schlechten Polemik vorwarfen, zusammen mit Marx und Engels zu behaupten, dass „die Bedingungen für den Sturz einer Gesellschaftsform auf ihrem Gipfelpunkt nicht existieren“, und die behaupteten, dass dies „ein ganzes Jahrhundert der Existenz und des Kampfes des Proletariats und seiner Partei in den Mülleimer schmeisst (...) plötzlich kann weder die Geburt der kommunistischen Theorie noch die Bedeutung und die Lehren der Revolutionen des 19. Jahrhunderts begriffen werden.“[32]
Warum ist dieses Argument vollkommen haltlos? Weil in der Zeit, als Marx und Engels „Das Kommunistische Manifest“ schrieben, es in der Tat periodische Verlangsamungen im Wirtschaftswachstum gab, die die Form von zyklischen Krisen annahmen. Bei der Untersuchung dieser Krisen waren sie in der Lage, all die Ausdrücke der fundamentalen Widersprüche des Kapitalismus zu analysieren. Doch die „Empörung der modernen Produktivkräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse“[33] war lediglich eine Jugendrevolte. Das Ergebnis dieser regelmässigen Explosionen war die Stärkung des Systems, das in seiner kraftvollen Wachstumsphase fähig war, sich seiner Kinderkleidung und der letzten feudalen Hindernisse auf seinem Weg zu entledigen. 1850 waren nur zehn Prozent der Weltbevölkerung in die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse integriert. Das System der Lohnarbeit hatte noch seine ganze Zukunft vor sich. Marx und Engels besassen den brillanten Scharfsinn, in den Wachstumskrisen des Kapitalismus die Essenz all seiner späteren Krisen zu erblicken und somit eine Zukunft tiefer Umbrüche vorauszusagen. Wenn sie dazu fähig waren, so, weil jede Gesellschaftsform von Geburt an den Keim all ihrer Widersprüche, die einst zu ihrem Untergang führen werden, in sich trägt. Doch solange diese Widersprüche sich noch nicht bis zu dem Punkt entwickelt hatten, wo sie zu einer ständigen Schranke gegen das Wachstum werden, bilden sie den eigentlichen Motor dieses Wachstums. Die plötzlichen Verlangsamungen in der kapitalistischen Ökonomie im 19. Jahrhundert waren keinesfalls diese permanenten und wachsenden Schranken. So war Rosa Luxemburg, indem sie Marx‘ Intuition über die Frage weiterträgt, wann der Kapitalismus in die Dekadenz eintreten werde – mit „der Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner Basis ruhenden Produktion“ (Marx) – in der Lage, die Dynamik und den Moment hervorzustreichen: „Wenn wir deshalb einerseits (...) die bisherigen Krisen, sozusagen die Jugendkrisen, (...) bereits hinter uns haben, so sind wir andererseits noch nicht bis zu jenem Grade der Ausbildung und der Erschöpfung des Weltmarktes vorangeschritten, der einen fatalen periodischen Anprall der Produktivkräfte an die Marktschranken, die wirkliche kapitalistische Alterskrisen, erzeugen würde. (…) Ist einmal der Weltmarkt im grossen und ganzen ausgebildet und kann er durch keine plötzliche Erweiterung mehr vergrössert werden, schreitet zugleich die Produktivität der Arbeit unaufhaltsam fort, dann beginnt über kurz oder lang der periodische Widerstreit der Produktivkräfte mit den Austauschschranken, der von selbst, durch seine Wiederholung, immer schroffer und stürmischer wird.“[34]
Der Begriff der Dekadenz im Kapital von Marx
Wir sahen oben, dass Marx und Engels vom Begriff der Dekadenz in ihren Hauptwerken über den historischen Materialismus und die Kritik der politischen Ökonomie („Die Deutsche Ideologie“, „Das Kommunistische Manifest“, „Anti-Dühring“, „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“, „Das Nachwort zu Der deutsche Bauernkrieg“), aber auch in einer Reihe von Briefen und Vorworten reichlich Gebrauch machten. Wie aber steht’s mit dem Buch, das das IBRP als Meisterstück von Marx betrachtet. Das Büro behauptet, dass der Terminus Dekadenz „in den drei Bänden des Kapitals nirgendwo auftaucht“.[35] Anscheinend hat das IBRP das Kapital nicht sehr gründlich gelesen, ist doch der Begriff der Dekadenz in allen Teilen, wo Marx sich entweder mit der Geburt oder mit dem Tod des Kapitalismus befasst, allemal präsent!
So bekräftigt Marx in den Seiten des Kapitals seine Analyse der Dekadenz des Feudalismus und, innerhalb Letzterem, des Übergangs zum Kapitalismus: „Obgleich die ersten Anfänge kapitalistischer Produktion uns schon im 14. und 15. Jahrhundert in einigen Städten am Mittelmeer sporadisch entgegentreten, datiert die kapitalistische Ära erst vom 16. Jahrhundert. Dort, wo sie auftritt, ist die Aufhebung der Leibeigenschaft längst vollbracht und der Glanzpunkt des Mittelalters, der Bestand souveräner Städte, seit geraumer Zeit im Erbleichen. (…) Das Vorspiel der Umwälzung, welche die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise schuf, ereignet sich im letzten Drittel des 15. und den ersten Dezennien des 16. Jahrhunderts.“[36]
„Hier fällt die kapitalistische Produktionsweise in einen neuen Widerspruch. Ihr historischer Beruf ist die rücksichtslose, in geometrischer Progressive vorangetriebne Entfaltung der Produktivität der menschlichen Arbeit. Diesem Beruf wird sie untreu, sobald sie, wie hier, der Entfaltung der Produktivität hemmend entgegentritt. Sie beweist damit nur aufs neue, dass sie altersschwach wird und sich mehr und mehr überlebt.“[37]
Nebenbei bemerkt, fasste Marx die Periode der Senilität des Kapitalismus als eine Phase ins Auge, wo der Kapitalismus sich immer mehr „überlebt“ hat, wo er zum Hindernis in der Weiterentwicklung der Produktivität wird. Dies straft auch einer anderen Theorie Lügen, die im Grossen und Ganzen von der Gruppe Internationalist Perspectives erfunden wurde und derzufolge die Dekadenz des Kapitalismus (aber auch des Feudalismus, siehe oben) von einer blühenden Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktivität der Arbeit charakterisiert ist![38]
Schliesslich ruft Marx in einer anderen Passage des „Kapitals“ den allgemeinen Prozess der Aufeinanderfolge der historischen Produktionsweisen in Erinnerung: „Aber jede bestimmte historische Form dieses Prozesses entwickelt weiter die materiellen Grundlagen und gesellschaftlichen Formen desselben. Auf einer gewissen Stufe der Reife angelangt, wird die bestimmte historische Form abgestreift und macht einer höhern Platz. Dass der Moment einer solchen Krise gekommen, zeigt sich, sobald der Widerspruch und Gegensatz zwischen den Verteilungsverhältnissen, daher auch der bestimmten historischen Gestalt der ihnen entsprechenden Produktionsverhältnisse einerseits und den Produktivkräften, der Produktionsfähigkeit und der Entwicklung ihrer Agentien andrerseits, Breite und Tiefe gewinnt. Es tritt dann ein Konflikt zwischen der materiellen Entwicklung der Produktion und ihrer gesellschaftlichen Form ein.“[39]
Hier nimmt er die Terminologie auf, die er in der „Kritik der politischen Ökonomie“ benutzte, wie wir weiter unter untersuchen werden. Doch zunächst sollte unterstrichen werden, dass das, was auf das „Kapital“ zutrifft, auch für die mannigfaltigen Vorbereitungsarbeiten gültig ist, wo der Begriff der Dekadenz hinreichend präsent ist.[40] Der beste Rat, den wir dem IBRP geben können, ist, noch einmal die Schulbank zu drücken und das Lesen zu lernen.
Der Begriff der Dekadenz, wie er von Marx in der Kritik der Politischen Ökonomie definiert wird
So fasst Marx die Hauptresultate seiner Forschungen 1859 im „Vorwort zur Kritik an der Politischen Ökonomie“ zusammen:
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoss der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. In grossen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die im Schoss der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schliesst daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.“[41]
Unsere Kritiker haben die notorische Unehrlichkeit, die Frage der Dekadenz durch systematische Umwandlung und Uminterpretation der Schriften von Marx und Engels zu umgehen. Dies ist besonders bei diesem Auszug aus der „Kritik der politischen Ökonomie“ der Fall, der von ihnen – zu Unrecht, wie wir bereits gesehen haben – als der einzige Ort angesehen wird, wo Marx über die Dekadenz spricht! Doch spricht Marx nach Ansicht vom IBRP in dieser Passage nicht über zwei deutlich unterschiedliche Phasen in der historischen Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, sondern über das periodisch aufkommende Phänomen der Wirtschaftskrise: „Es ist dasselbe, wenn die Vertreter dieser Analyse (der Dekadenz, die Red.) sich gedrängt fühlen, die anderen Worte von Marx zu zitieren, denen zufolge die Produktivkräfte auf einer bestimmten Ebene der Entwicklung des Kapitalismus mit den Produktionsverhältnissen in Widerspruch geraten und so den Prozess der Dekadenz einleiten. Tatsache ist, dass der fragliche Ausdruck sich auf das Phänomen der allgemeinen Krise und des Bruchs im Verhältnis zwischen der Wirtschaftsstruktur und dem ideologischen Überbau bezieht, die Klassenepisoden erzeugen können, welche auf eine revolutionäre Richtung zusteuern, und nicht auf die diskutierte Frage.“[42]
Das Zitat von Marx für sich genommen lässt keinen Raum für Zweideutigkeiten. Es ist klar, unmissverständlich und folgt derselben Logik wie all die anderen Auszüge, auf die sich dieser Artikel bezieht. Von seinem Brief an J. Weydemeyer wissen wir, wie sehr Marx den historischen Materialismus als seinen wirklichen theoretischen Beitrag betrachtete, und als er sagte, dass „in wenigen Worten das Resultat, zu dem ich gelangte, mir als Leitfaden meiner Studien diente.“[43], sprach er exakt über die Evolution von Produktionsweisen, über ihre Dynamik und Widersprüche, die sich im dialektischen Verhältnis zwischen den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften artikulierten. In wenigen Sätzen spannte Marx den gesamten Bogen der menschlichen Evolution: „In grossen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses (...) Mit dieser Gesellschaftsformation schliesst daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.“ Im Gegensatz zu den Behauptungen des IBRP berief sich Marx nicht auf periodische Krisenzyklen, auf regelmässig wiederkehrende Kollisionen zwischen den Produktivkräften und den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen oder auf Perioden des Wechsels in der Profitrate; Marx arbeitete auf einer anderen Ebene, auf der grossen Bühne der Evolution der Produktionsweisen, den historischen „Epochen“. In seinem Auszug, wie auch in all den anderen, die wir zitiert haben, definiert Marx klar und deutlich zwei allgemeine Phasen in der historischen Entwicklung einer Produktionsweise: eine Aufstiegsphase, wo die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse die Entwicklung der Produktivkräfte vorantreiben und erleichtern, und eine dekadente Phase, in der „aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte (...) Fesseln derselben“ werden. Marx macht deutlich, dass dieser Umschwung in einem bestimmten Moment – „über einen gewissen Punkt hinaus“ – stattfindet, und spricht keinesfalls über „periodisch aufkommende und stetig wachsende Kollisionen“, wie es die ungeeignete Interpretation des IBRP tut. Darüber hinaus benutzt Marx bei etlichen Gelegenheiten im Kapital Formulierungen, die mit jenen in der „Kritik der politischen Ökonomie“ identisch sind; und wenn er sich auf den historisch begrenzten Charakter des Kapitalismus bezieht, spricht er über zwei unterschiedliche Phasen seiner Evolution: „… dass die kapitalistische Produktionsweise an der Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke findet, die nichts mit der Produktion des Reichtums als solcher zu tun hat; und diese eigentümliche Schranke bezeugt die Beschränktheit und den nur historischen, vorübergehenden Charakter der kapitalistischen Produktionsweise; bezeugt, dass sie keine für die Produktion des Reichtums absolute Produktionsweise ist, vielmehr mit seiner Fortentwicklung aus gewisser Stufe in Konflikt tritt.“[44], oder auch, wenn er argumentiert, dass der Kapitalismus „altersschwach wird und sich mehr und mehr überlebt“[45].
Wir können dem IBRP nachsehen, wenn es einige Mühe beim Verständnis der „Kritik der politischen Ökonomie“ von Marx hat – jeder kann Fehler machen. Doch wenn die Irrtümer wiederholt werden, selbst wenn es um Zitate aus jenem Werk („Das Kapital“) geht, das das IBRP als seine Bibel betrachtet , dann ist dies mehr als ein einmaliger Ausrutscher.
Was unsere parasitären Kritiker angeht, so stürzen sie sich gern in lange syntaktische Sezierungen. Für die Revue Internationale de Mouvement Communiste (RIMC) „unternimmt die IKS die Mühe, die Phrase ‚So beginnt‘ zu unterstreichen, zweifellos um wie gute Gradualisten, die sie sind, die Betonung auf den fortschrittlichen Charakter der Bewegung zu legen, den sie gläuben identifiziert zu haben. Doch können wir ebensogut die Worte ‚soziale Revolution‘ unterstreichen, die genau das Gegenteil bedeuten, da eine Revolution der gewaltsame Sturz der herrschenden Ordnung ist, mit anderen Worten: ein brutaler und qualitativer Bruch in der Ordnung von Dingen und Ereignissen.“[46] Noch einmal für jeden, der lesen kann: Marx spricht über die Eröffnung einer „Epoche der sozialen Revolution“ (eine „Epoche“ ist eine ganze Periode, in der eine neue gesellschaftliche Ordnung der Dinge etabliert wird), und er argumentiert, dass dieser Wechsel einige Zeit dauern kann, wenn er uns mitteilt, dass diese „Änderung in den ökonomischen Grundlagen von einer mehr oder weniger schnellen Umwälzung begleitet wird“. Lebe wohl, „plötzlicher, gewaltsamer, nahezu vertikaler Fall und am Ende erhebt sich ein neues gesellschaftliches Regime“, Bordigas Ausspruch, der von der RIMC wiederholt wird! Anders als sie verwechselt Marx nicht eine „Änderung im ökonomischen Fundament“ mit einer politischen Revolution. Erstere entfaltet sich langsam innerhalb der alten Gesellschaft, die Revolution ist dagegen kürzer, zeitlich begrenzter, obwohl sie sich auch einige Zeit hinziehen kann, da der Sturz der politischen Macht der alten herrschenden Klasse durch eine neue herrschende Klasse sich normalerweise erst nach zahllosen zurückgeschlagenen Versuchen vollzieht, was zeitweilige Restaurationen nach kurzlebigen Siegen einschliessen kann.
Die politische Bedeutung dieser Kritiken
Was die parasitären Grüppchen anbetrifft, so ist es ihre wesentliche Funktion, die politische Klarheit zu trüben, Marx gegen die Kommunistische Linke aufzustellen und so eine Barriere zwischen den neuen, suchenden Elementen und den revolutionären Gruppen zu errichten. Bei ihnen ist die Sache klar. Wir müssen lediglich zeigen, wie zentral die Dekadenztheorie im Werk von Marx und Engels gewesen war, um ihren Behauptungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, dass dies „eine Theorie (ist), die vom kommunistischen Programm total abweicht (...) solch eine Methode der Analyse hat nichts mit kommunistischer Theorie zu tun (...) vom Standpunkt des historischen Materialismus aus besitzt das Konzept der Dekadenz keinerlei Kohärenz. Es ist kein Bestandteil des theoretischen Arsenals des kommunistischen Programms. Als solches muss es vollkommen abgelehnt werden (...) Kein Zweifel, dass die IKS dieses Zitat (aus dem ersten Entwurf des Briefes von Marx an Vera Sassulitsch) nutzen wird, da in ihm das Wort ‚Dekadenz‘ zweimal vorkommt, was relativ selten bei Marx ist, für dem der Begriff keinerlei wissenschaftlichen Wert hatte.“[47] Solche Behauptungen sind total absurd. Motiviert von einem parasitären, gegen die IKS gerichteten Antrieb, ist das Einzige, was diese Darstellungen gemeinsam haben, der Ausschluss des Dekadenzkonzepts aus den Werken von Marx und Engels. So erscheint für Aufheben[48] „die Theorie des kapitalistischen Niedergangs das erste Mal in der Zweiten Internationalen“, während für die RIMC sie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges in die Welt gesetzt wurde: „Das Ziel dieses Werks ist es, eine globale und definitive Kritik am Konzept der ‚Dekadenz‘ vorzunehmen, das als eines der Hauptverirrungen nach dem Ersten Weltkrieg die kommunistische Theorie vergiftete und wegen seines offensichtlich ideologischen Charakters jegliche wissenschaftliche Arbeit behindert, die die Restaurierung der kommunistischen Theorie bezweckt.“ Schliesslich war für Internationalist Perspectives Trotzki der Erfinder dieses Konzepts: „Das Konzept der Dekadenz des Kapitalismus entstand in der Dritten Internationalen, wo es insbesondere von Trotzki entwickelt worden war...“. Wer soll aus all dem schlau werden? Wenn es etwas gibt, was dem Leser klar sein muss, der sich die Auszüge von Marx und Engels angeschaut hat, die in diesem Artikel benutzt werden, dann die Tatsache, dass der Begriff der Dekadenz seinen wahren Ursprung exakt dort hatte, in ihrer historisch-materialistischen Methode. Nicht nur befindet sich dieser Begriff im Mittelpunkt des historischen Materialismus und ist auf der theoretischen wie begrifflichen Ebene präzise definiert, er wird auch als ein operatives wissenschaftliches Instrument bei der konkreten Analyse der Evolution verschiedener Produktionsweisen benutzt. Und wenn so viele Organisationen der Arbeiterbewegung den Begriff der Dekadenz weiterentwickelt haben, wie viele Schriften der parasitären Gruppen trotz allem erkennen müssen, dann deshalb, weil dieser Begriff im Zentrum des Marxismus steht!
Die Bordigisten der PCI haben die Analyse der Dekadenz, die zwischen 1928 und 1945[49] von der Italienischen Linken im Exil entwickelt wurde, trotz ihrer Beanspruchung der historischen Kontinuität mit ihr niemals akzeptiert. Der Geburtsakt des Bordigismus 1952 war von der Ablehnung dieses Konzepts gekennzeichnet.[50] Während Battaglia Comunista[51] die prinzipiellen Errungenschaften der Italienischen Linken in diesem Punkt aufrechterhielt, entfernten sich die Elemente rund um Bordiga von ihnen, als sie die Parti Communiste Internationale gründeten. Trotz dieses wesentlichen theoretischen Rückschritts verblieb die PCI dennoch stets im internationalistischen Lager der Linkskommunisten. Sie war stets im historischen Materialismus verwurzelt und hat in der Tat, wie auch immer ihr Bewusstseinsgrad gewesen sein mag, immer in grossen Zügen die Analyse der Dekadenz vertreten! Um dies zu belegen, brauchen wir lediglich ihre eigenen Grundsatzpositionen auf der Rückseite ihrer Publikationen zitieren: „Die imperialistischen Weltkriege zeigen, dass die Auflösungskrise des Kapitalismus unvermeidlich der Tatsache geschuldet ist, dass er endgültig in jene Periode eingetreten ist, in der seine Expansion nicht länger historisch das Wachstum der Produktivkräfte belebt, sondern ihre Akkumulation durch wiederholte und wachsende Zerstörungen bindet“ (im Grundsatz sagt die IKS nichts anderes!).[52] Wir können eine Reihe von Passagen aus ihren Texten zitieren, wo der Begriff der Dekadenz des Kapitalismus direkt oder indirekt anerkannt wird: „... während wir auf die zyklische Natur der Krisen und Katastrophen des Weltkapitalismus beharren, schmälert dies keineswegs die allgemeine Definition seines gegenwärtigen Zustands, eines Zustands der Dekadenz, in welcher ‚die objektiven Voraussetzungen für die proletarische Revolution nicht nur reif, sondern überreif sind‘, wie Trotzki es formulierte“.[53] Doch heute versucht sie in einem Pamphlet, das unsere Positionen kritisiert, mehrere Seiten lang eine (sehr schlechte) Polemik gegen das Konzept der Dekadenz zu verfassen, ohne zu realisieren, dass sie sich einmal mehr selbst widerspricht: „... wenn seit 1914 die Revolution und nur die Revolution überall und immer auf der Tagesordnung gestanden hat, d.h. die objektiven Bedingungen allgegenwärtig sind, ist es unmöglich, das Ausbleiben der Revolution zu erklären, ausser man flüchtet sich in subjektive Faktoren: Was fehle, um die Revolution zum Ausbruch zu bringen, sei allein das Bewusstsein des Proletariats. Dies ist ein verzerrtes Echo auf die falschen Positionen des grossen Trotzki Ende der 1930er-Jahre. Auch Trotzki dachte, dass die Produktivkräfte das Maximum dessen erreicht haben, was unter dem kapitalistischen Regime möglich sei, und dass folglicherweise die objektiven Bedingungen für die Revolution reif seien (und dass sie sogar anfangen, ‚überreif‘ zu sein): Das einzige Hindernis sei daher auf der Ebene der subjektiven Bedingungen zu suchen“.[54] Geheimnisvolle Invarianz!
Was Battaglia Comunista anbetrifft, so sei gesagt, dass sie sich trotz ihrer Kontinuitätsansprüche mit den Positionen der Italienischen Fraktion der Internationalen Linkskommunisten[55] auf dem Rückweg zu ihren bordigistischen Wurzeln befinden. Nachdem sie erst die Positionen von Bordiga 1952 abgelehnt und sich gewisse Lehren von der Italienischen Linken im Exil wiederangeeignet hatten, reisst nun ihre ausdrückliche Preisgabe der Dekadenztheorie, die von eben jener Fraktion entwickelt wurde[56], Battaglia Comunista zurück auf die Seite der Parti Communiste Internationale. Es ist eine Rückkehr zu den Quellen, da sowohl in der Gründungsplattform von 1946 als auch in der Plattform von 1952 der Begriff der Dekadenz fehlt. Die politische Vagheit dieser beiden programmatischen Dokumente, wenn es um das Verständnis dieser vom Ersten Weltkrieg eröffneten Periode geht, war die Matrix der Schwächen und Schwankungen von Battaglia Comunista bei der Verteidigung von Klassenpositionen gewesen.
Schliesslich hat diese Untersuchung uns den Blick dafür geschärft, dass die Schriften der Gründungsväter des Marxismus weit entfernt von den verschiedenen Versionen des historischen Materialismus sind, die unsere Kritiker vertreten. Wir warten darauf, dass sie uns mit Hilfe der Schriften von Marx und Engels die Gültigkeit ihrer Sichtweise der Abfolge der Produktionsweisen demonstrieren, so wie wir es in diesem Artikel mit dem Konzept der Dekadenz tun! Bis dahin amüsiert uns ihr fast grandioses Vorgaukeln von marxistischer Kompetenz; in Kenntnis der Werke von Marx und Engels sind wir uns sicher, dass wir unseren Sinn für Humor niemals verlieren werden.
Wenn Schmeicheleien an die Stelle einer politischen Linie treten
Seite um Seite behauptet die „Interne Fraktion der IKS“ (IFIKS[57]), dass sie gegen eine angebliche Degeneration unserer Organisation kämpft, und konzentriert sich dabei auf unsere Analyse des Kräfteverhältnisses, unsere Orientierung bei den Interventionen im Klassenkampf, unsere Theorie des Zerfalls des Kapitalismus, unser Verhalten gegenüber der Umgruppierung von Revolutionären, unsere interne Funktionsweise, etc. Sie argumentiert, dass die IKS sich in ihrem Todeskampf befinde und dass nun das IBRP den Pol der Klärung und Umgruppierung bilde: „Mit der Eröffnung des Kurses zum Opportunismus, Sektierertum und Defätismus durch die offizielle IKS steht nun das IBRP im Mittelpunkt einer Dynamik zum Aufbau der Partei“.[58] Diese Liebeserklärung wird darüber hinaus mit einer armseligen politischen Einverständniserklärung mit den Positionen des IBRP garniert: „Wir sind uns darüber bewusst, dass zwischen dieser Organisation und uns Divergenzen existieren, besonders über Fragen der Analyse-Methoden, weniger über politische Positionen.“[59] Mit einem Federstrich eliminiert die IFIKS, tapfere Verteidiger der Orthodoxie der IKS-Plattform, alle wichtigen politischen Divergenzen zwischen der IKS und dem IBRP. Jedoch gibt es etwas noch Bedeutsameres. Seit rund zwei Jahren wird das, was sich im eigentlichen Zentrum der IKS-Plattform befindet – die Frage der Dekadenz – mehr oder weniger offen vom IBRP in Frage gestellt[60] und zum Gegenstand einer sehr unehrlichen Kritik durch die PCI (Kommunistisches Programm) gemacht. Doch die IFIKS hat nichts Besseres zu tun, als vielsagend ruhig zu bleiben und sich gar zu entschuldigen, dass wir die Verteidigung des analytischen Rahmens der Dekadenz gegen alle Abweichungen der PCI und des IBRP aufgenommen haben: „Auf diese Weise stellt sie den proletarischen Charakter dieser Organisation und des IBRP in Frage und stösst beide an den Rand des proletarischen Lagers“.[61]
Bis jetzt hat es die IFIKS geschafft, nicht weniger als vier Artikel über das Thema „Dekadenz des Kapitalismus“ zu schreiben.[62] Diese Artikel tragen den pompösen Titel „Debatte innerhalb des proletarischen Lagers“, doch der Leser wird nicht den leisesten Hinweis auf die Preisgabe des Konzepts der Dekadenz durch das IBRP finden! Er wird jedoch die gewohnten Ausfälle gegen unsere Organisation vorfinden, in denen lächerlicherweise behauptet wird, dass wir es seien, die die Dekadenztheorie preisgeben! Nicht ein Wort über das IBRP, das ausdrücklich die Dekadenztheorie in Frage stellt, dafür aber die heftigsten Attacken gegen die IKS, die dieses Konzept kompromisslos verteidigt!
Vier Monate nach der Veröffentlichung eines neuen und langen Artikels durch das IBRP, in dem erklärt wird, warum es die Dekadenztheorie, wie sie von der Kommunistischen Linken erarbeitet worden ist [63], in Frage stellt, widmet die IFIKS in der Vorstellung ihres Bulletins, Nr. 24, April 2004, diesem Vorgang zwei Sätze, in der diesem „fundamentalen Beitrag“ Beifall gezollt wird: „Wir begrüssen die Arbeit der Genossen der PCInt, die ihrer Sorge Ausdruck verliehen haben, die Frage zu klären. Wir werden zweifellos die Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen.“ [64] Der Artikel vom IBRP wird natürlich nicht als das betrachtet, was er ist – ein ernster Rückschritt auf programmatischer Ebene – sondern wird als ein Beitrag zur Auseinandersetzung mit unseren angeblichen politischen Verirrungen ausgegeben: „... die Krise, in der die IKS heute immer mehr versinkt, drängt die Gruppen des proletarischen Lagers dazu, zur Frage der Dekadenz zurückzukehren; dies drückt ihre Involvierung in der Auseinandersetzung gegen das opportunistische Abgleiten einer Gruppe aus dem politischen Milieu des Proletariats aus, ihre Beteiligung am Kampf, um zu retten, was vor der Katastrophe des opportunistischen Abgleitens unserer Organisation gerettet werden kann. Wir begrüssen diese Anstrengungen....“.[65]
Wenn Schmeicheleien an Stelle einer politischen Linie treten, so ist dies nicht mehr blosser Opportunismus, es ist Arschkriecherei. Um ihr Verhalten als Gangster und Informanten mit einem pseudo-radikalen Touch zu versehen, entdeckt die IFIKS auf die Schnelle wichtige Differenzen mit der IKS, besonders indem sie sich unserer Analyse des Zerfalls des Kapitalismus entledigt.[66] Die IFIKS musste eliminieren, was politisch am „unpopulärsten“ unter den Gruppen des revolutionären Milieus war, um sich ihnen anzubiedern und von ihnen anerkannt zu werden. So geht sie vor ihnen auf die Knie und umschmeichelt sie. Aber Letztere scheinen den Köder nicht annehmen zu wollen: „Auch wenn wir nicht die Möglichkeit ausschliessen, dass Individuen aus der IKS unseren Reihen beitreten können, so ist es doch völlig unmöglich, dass Gruppen oder Fraktionen, die mit ihren Organisation im Widerstreit stehen, en bloc und mit Positionen zu uns stossen, die mit den unsrigen nicht vereinbar sind (...) Solch ein Resultat kann nur durch eine völlige Infragestellung oder besser: durch einen Bruch mit den praktischen, politischen und allgemein programmatischen Positionen der IKS eintreten, und nicht durch ihre simple Modifizierung oder Verbesserung“.[67] Besser hätten wir es nicht formulieren können! Nachdem sie sich der Theorie des Zerfalls entledigt hat, ist die IFIKS bereit, all die politischen Divergenzen zwischen der IKS und dem IBRP auf ein paar geringfügige Fragen der „Analyse-Methoden“ zu reduzieren; morgen wird sie allemal dazu bereit sein, die Theorie der Dekadenz wegzuwerfen, um Gruppen, die diesen beiden Konzepten feindlich gegenüber eingestellt sind, zu verführen und somit ihre schmutzige und zutiefst unehrliche Arbeit beim Versuch fortzusetzen, die IKS von den restlichen Gruppen des politischen Milieus des Proletariats zu isolieren.
C. Mcl.
Fußnoten:
1. s. die mehrteilige Artikelreihe mit dem Titel Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen, in: Internationale Revue Nr. 10–12.
2. s. unsere Artikel über die Ablehnung der Dekadenztheorie durch die Internationale Kommunistische Partei/Kommunistisches Programm, in: International Review Nr. 77 und 78 und über die Ablehnung des IBRP, The Conception of Decadence in Capitalism, in: International Review, Nr. 79 (engl., franz., span. Ausgabe) und Das Wesen des imperialistischen Krieges, in: Internationale Revue Nr. 16 und Theorien der historischen Krise des Kapitalismus, in: Internationale Revue Nr. 17 und Hinter der Globalisierung der Wirtschaft verbirgt sich die Krise des Kapitalismus, in: Internationale Revue Nr. 18.
3. s. in International Review Nr. 105 und 106 die Antwort auf einen Brief aus Australien und in Nr. 111 und 112 eine Antwort auf die neuen revolutionären Elemente, die in Russland entstanden sind.
4. Streng genommen, vom 16. Jahrhundert bis zu den bürgerlichen Revolutionen, was die feudale Dekadenz anbelangt, und von den bürgerlichen Revolutionen bis 1914, was die Aufstiegsphase des Kapitalismus angeht.
5. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 635.
6. s. Thesen über die Taktik der Komintern, IV. Weltkongress der Kommunistischen Internationale, Hervorhebungen von uns.
7. s. Die Krise ist ein Ausdruck der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise, in: Internationale Revue, Nr. 33, hatten wir bereits die Gelegenheit zu zeigen, dass die Weigerung des IBRP und der PCI(Programme Communiste), sich selbst auf den Rahmen der Analyse zu stützen, die Wurzel ihres Übels ist, in Richtung Linksextremismus sowie alternatives Drittwelttum und weg von der marxistischen Analyse der Krise und der gesellschaftlichen Stellung der Arbeiterklasse zu rutschen.
8. Karl Marx, Brief an J. Weydemeyer, 5. März 1852, in: MEW Bd. 28. S. 507; Hervorhebung von uns.
9. Jene, die gerne Marx gegen Engels ausspielen würden, sollten sich Folgendes merken: „Ich bemerke nebenbei: Da die hier entwickelte Anschauungsweise zum weitaus grössern Teil von Marx begründet und entwickelt worden, und nur zum geringsten Teil von mir, so verstand es sich unter uns von selbst, dass diese meine Darstellung nicht ohne seine Kenntnis erfolgte. Ich habe ihm das ganze Manuskript vor dem Druck vorgelesen, und das zehnte Kapitel des Abschnitts über Ökonomie (aus der Kritischen Geschichte) ist von Marx geschrieben und musste nur, äusserlicher Rücksichten halber, von mir leider etwas verkürzt werden.“ (Engels, Anti-Dühring, in: MEW Bd. 20, S. 9)
10. Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW Bd. 20, S. 243.
11. s. MEW 21, S. 392 ff.
12. Bordiga, Treffen von Rom 1951, veröffentlicht in Invariance, Nr. 4, eigene Übersetzung. Hinsichtlich unserer Kritik an der bordigistischen Auffassung über die historische Evolution siehe unseren Artikel in International Review Nr. 54, S. 14–19.
13. s. Dialectique des forces productives et des rapports de production dans la théorie communiste, veröffentlicht in der Revue Internationale de Mouvement Communiste (RIMC), eigene Übersetzung. gemeinsam verfasst von Communisme ou Barbarie und Communismo L’Union Proletarien sowie erhältlich unter folgender Adresse:https://membres.lycos.fr/rgood/formprod.htm [117].
14. s. 16 theses on the history and state of the capitalist economy, Internationalist Perspectives, eigene Übersetzung; sowie erhältlich unter folgender Adresse: https://users.skynet.be/ippi/4discus1tex.htm [118].
15. Karl Marx, Das Kapital, MEW Bd. 23, S. 743.
16. s. das interessante Buch von Guy Bois, La grande depression médiévale, XIVe et XV siècle, PUF.
17. s. MEW, Bd. 4, S. 463/467.
18. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 409.
19. Ein einfacher Hinweis auf die Analysen von Marx und Engels reicht aus, um auf die grenzenlosen historischen Dummheiten parasitärer Gruppen wie Internationalist Perspectives, Robin Goodfellow (Ex-Communisme ou Barbarie und RIMC-Mitglied), etc. zu antworten, die darin enden, das genaue Gegenteil dessen zu behaupten, was die Gründer des historischen Materialismus und unleugbare historische Fakten aussagen. Wir werden dennoch die Gelegenheit wahrnehmen, in künftigen Artikeln detaillierter auf ihre Schlangenlinien zurückzukommen, weil sie leider junge Elemente, die noch nicht fest in marxistischen Positionen verankert sind, negativ beeinflussen können.
20. Karl Marx/Friedrich Engels, Die deutsche Ideologie“, in: MEW Bd. 3, S. 24.
21. Karl Marx, Brief an V. I. Sassulitsch, in MEW, Bd.19, S. 387.
22. Sie wurde von Marx in Asien lokalisiert, doch sie war keineswegs auf diese geographische Region beschränkt. Historisch entspricht sie den megalithischen, ägyptischen Gesellschaften, etc., die bis 4000 v. Chr. zurückreichen und der Höhepunkt eines langsamen Prozesses einer Gesellschaft war, die sich erstmals in Klassen teilte. Die gesellschaftliche Differenzierung, die sich mit dem Aufkommen von ökonomischem Überschuss und der Entstehung von materiellem Reichtum entwickelte, führte zu einer politischen Macht in der Gestalt eines Königsstaates. Die Sklaverei konnte darin gut existieren, sogar in einem beträchtlichen Umfang (Diener, Arbeiter bei grossen öffentlichen Arbeiten, etc.), doch sie beherrschte nur selten die Landwirtschaft; sie war noch nicht die vorherrschende Produktionsform. Marx gab dazu eine klare Definition im Kapital: „Sind es nicht Privatgrundeigentümer, sondern ist es wie in Asien der Staat, der ihnen direkt als Grundeigentümer und gleichzeitig Souverän gegenübertritt, so fallen Rente und Steuer zusammen, oder es existiert vielmehr dann keine von dieser Form der Grundrente verschiedne Steuer. Unter diesen Umständen braucht das Abhängigkeitsverhältnis politisch wie ökonomisch keine härtere Form zu besitzen als die ist, welche aller Untertanenschaft gegenüber diesem Staat gemeinsam ist. Der Staat ist hier der oberste Grundherr. Die Souveränität ist hier das auf nationaler Stufe konzentrierte Grundeigentum.“ (Das Kapital, Bd. 3, in; MEW Bd. 25, S. 799) All diese Gesellschaften verschwanden zwischen 1000 und 500 v. Chr. Ihre Dekadenz manifestierte sich in periodisch wiederkehrenden Bauernrevolten, in einer gigantischen Entwicklung unproduktiver Staatsausgaben und in unaufhörlichen Kriegen zwischen den Staaten, die in Plünderungen eine Lösung gegen die inneren Produktionshemmnisse zu finden versuchten. Endlose politische Konflikte und mörderische Rivalitäten innerhalb der herrschenden Kaste erschöpften die gesellschaftlichen Quellen, und die geographischen Grenzen der Expansion der Reiche zeigten, dass der äusserste Entwicklungsgrad, der mit den Produktionsverhältnissen vereinbar war, erreicht war.
23. Das Kapital, Bd. 3, in: MEW Bd. 25, S. 610–611.
24. s. Prometeo, Nr. 8, Dezember 2003, eigene Übersetzung.
25. in: Manifest der kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, S. 468. Dieselben verstimmten Charaktere argumentieren, um die Bedeutung dieser Sentenz aus dem Manifest herunterzuspielen, gerne damit, dass dieser Auszug sich nicht auf den allgemeinen Prozess des Übergangs von einer Produktionsweise zur nächsten beziehe, sondern auf die regelmässige Wiederkehr von konjunkturellen Krisen der Überproduktion, die die Möglichkeit revolutionärer Perspektiven eröffneten. Nichts liegt der Wahrheit ferner als dies; der Zusammenhang des Auszugs ist eindeutig und folgt gleich, nachdem Marx den historischen Prozess des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus in Erinnerung gerufen hatte. Darüber hinaus verzerrt das ganze Argument das Ziel des Manifests, den Übergangscharakter der Produktionsweise und damit des Kapitalismus aufzuzeigen; es trachtete nicht danach, eine detaillierte Untersuchung der Funktionstüchtigkeit des Kapitalismus und seiner periodischen Krisen vorzunehmen, so wie dies im Kapital der Fall war.
26. K. Marx/F. Engels, Revue der ‘Neuen Rheinischen Zeitung‘, Mai–Oktober, in:1950, MEW Bd. 7, S. 440.
27. s. MEW, Bd. 19, S. 360.
28. K. Marx, Das Kapital, Bd. 3, in: MEW Bd. 25, S. 273.
29. K. Marx, Brief an V. I. Sassulitsch, in: MEW, Bd.19, S. 396ff.
30. Friedrich Engels, Einleitung zu Die Klassenkämpfe in Frankreich, in: MEW Bd. 22, S. 515.
31. Robin Goodfellow, Communism as a historic necessity, 1.2.2004, eigene Übersetzung. Oder: Die Dekadenztheorie zerrt „die Gesamtheit der kommunistischen Theorie ins Reich der Ideologie und Utopie, wenn sie ausserhalb jeglicher materiellen Basis (in der aufsteigenden Periode, d.Red.) gestellt wird. Die Menschheit stellt sich keine Probleme, die sie nicht praktisch lösen kann. Warum sollten wir unter diesen Umständen diese Positionen geltend machen? Wir sollten sie genauso kritisieren, wie Marx und Engels die utopischen Sozialisten kritisiert hatten. Der wissenschaftliche Sozialismus wäre ansonsten kein Bruch mit dem utopischen Sozialismus, sondern eine neue Episode in ihm.“ Robin Goodfellow, https://members.lycos.fr/resdint [119], eigene Übersetzung.
32. PCI-Pamphlet, Nr. 29, Le Courant Communiste Internationale: a contre-courant de marxisme et de la lutte de classe, eigene Übersetzung.
33. K. Marx/F. Engels, Manifest der kommunistischen Partei, in: MEW Bd. 4, S. 467.
34. Rosa Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, in: Gesammelte Werke Bd. 1/1, S. 385/386.
35. „Welche Rolle spielt denn das Konzept der Dekadenz im Rahmen der militanten Kritik der politischen Ökonomie, d.h. für eine tiefere Analyse der Charakteristiken und der Dynamik des Kapitalismus in der Periode, in der wir leben? Keine. Ja, das Wort selbst taucht nirgendwo in den drei Bänden des Kapitals auf. Mit dem Konzept der Dekadenz kann man die Mechanik der Krise beileibe nicht erklären...“ (Comments on the latest Crisis of the ICC, in: Internationalist Communist, Nr. 21, S. 23, eigene Übersetzung).
36. K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW Bd. 23, S. 743ff.
37. K. Marx, Das Kapital, Bd. 3, in MEW Bd. 25, S. 272/273.
38. „Schliesslich nimmt die Neigung des Kapitals, die Produktivität zu erhöhen und daher die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, in seiner dekadenten Phase nicht ab (...) Die Existenz des Kapitalismus in seiner dekadenten Phase zwingt es – gebunden an der Mehrwertproduktion, die aus lebendigem Kapital herausgezogen wird, aber im Angesicht der Tatsache, dass die Masse des Mehrwerts sich immer mehr verringert, so wie umgekehrt die Mehrarbeit immer weiter wächst – dazu, die Entwicklung der Produktivkräfte in einem immer irrsinnigeren Tempo zu forcieren.“ (Valeur, décadence et technologie – 12 thèses, Perspective Internationaliste, eigene Übersetzung; https:// users.skynet.be/ippi/3thdecad.htm).
39. K. Marx Das Kapital, Bd. 3, MEW Bd. 25, S. 891.
40. „Ideell betrachtet, reichte die Auflösung einer gewissen Bewusstseinsform hin, um eine ganze Epoche zu töten. Reell entspricht diese Schranke des Bewusstseins einem bestimmten Grad der Entwicklung der materiellen Produktivkräfte und daher des Reichtums. Allerdings fand Entwicklung statt nicht nur auf der alten Basis, sondern Entwicklung dieser Basis selbst. Die höchste Entwicklung diese Basis selbst (…) ist der Punkt, worin sie selbst zu der Form ausgearbeitet ist, worin sie mit der höchsten Entwicklung der Produktivkräfte vereinbar, daher auch der reichste Entwicklung der Individuen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, erscheint die weitere Entwicklung als Verfall und die neue Entwicklung beginnt von einer neuen Basis.“ (S. 349); „Die sogenannte historische Entwicklung beruht überhaupt darauf, dass die letzte Form die vergangenen als Stufe zu sich selbst betrachtet, und, da sie selten, und nur unter ganz bestimmten Bedingungen fähig ist, sich selbst zu kritisieren – es ist hier natürlich nicht von solchen historischen Perioden die Rede, die sich selbst als Verfallszeit vorkommen – sie immer einseitig auffasst“ (Karl Marx, Grundrisse der Kritik der Politische Ökonomie, S. 26).
41. Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 13, S. 9. Hervorhebung von uns.
42. s. Prometeo, Nr. 8, Dezember 2003.
43. Karl Marx an J. Weydemeyer, MEW Bd. 28, eigene Übersetzung
44. K. Marx, Das Kapital, Bd. 3, in: MEW Bd. 25, 272
45. Ebd.
46. s. Dialectique des forces productives et des rapports de production dans la théorie communiste, veröffentlicht in der Revue Internationale de Mouvement Communiste (RIMC), eigene Übersetzung. gemeinsam verfasst von Communisme ou Barbarie und Communismo L’Union Proletarien sowie erhältlich unter folgender Adresse:https://membres.lycos.fr/ [120]
rgood/formprod.htm.
47. Ebd. Eigene Übersetzung.
48. s. On decadence: theory of decline or decline of theory ist ein Text der britischen Gruppe Aufheben.
49. s. unser Buch The Italian Communist Left.
50. s. Bordigas kritisches Nachdenken über die Dekadenztheorie, 1951 verfasst: La doctrine du diable au corps, veröffentlicht in Le Proletaire, Nr. 464 (die Zeitung der PCI in Frankreich); ebenfalls Le renversement de la praxis dans la theorie marxiste, wiederveröffentlicht in Programme Communiste, Nr. 56 (die theoretische Zeitschrift der PCI auf Französisch) wie auch die Protokolle des Rom-Treffens 1951, veröffentlicht in Invariance, Nr. 4.
51. Battaglia Comunista ist zusammen mit der Communist Workers Organisation eine der Gründungsorganisationen des Internationalen Büros für die Revolutionäre Partei (IBRP).
52. Im jüngsten Pamphlet, das vollständig der Kritik an unseren Positionen gewidmet war (Le Courant Communiste International: a contre courant du marxisme et de la lutte de classe“) widerspricht die PCI, von ihrer eigenen Prosa berauscht, ihren eigenen Grundsatzpositionen, indem sie argumentiert, dass „die IKS eine ganze Reihe von Phänomenen betrachtet, wie die Notwendigkeit für das Kapital, sich als Vorbedingung für eine neue Akkumulationsphase selbst regelmässig zu zerstören (...) für die IKS sind diese Phänomene angeblich neu und werden als Manifestationen der Dekadenz betrachtet (...) und nicht als Ausdruck der Weiterentwicklung und Stärkung der kapitalistischen Produktionsweise“(S. 8, eigene Übersetzung). Die PCI sollte uns klipp und klar mitteilen, ob „die imperialistischen Weltkriege zeigen, dass die Auflösungskrise des Kapitalismus unweigerlich der Tatsache geschuldet ist, dass der Kapitalismus endgültig in die Periode eingetreten ist, in der seine Expansion historisch das Wachstum der Produktivkräfte nicht mehr anregt, sondern ihre Akkumulation an wiederholten und wachsenden Zerstörungen bindet“– oder ob, wie sie in ihrem Pamphlet argumentiert und wie auch ihre grundsätzlichen Stellungnahmen andeuten, „die Notwendigkeit für das Kapital, sich regelmässig selbst zu zerstören“, keine „Manifestation der Dekadenz“ sei, sondern „der Ausdruck der Weiterentwicklung und Stärkung der kapitalistischen Produktionsweise“! Anscheinend hängt die programmatische Invarianz davon ab, was man sich wünscht, dass es geschehe!
53. Programme Communiste, Nr. 81; eigene Übersetzung.
54. PCI-Pamphlet, Nr. 29; eigene Übersetzung.
55. „Schlussendlich wurde die Partei auf den Grundlagen gegründet, die 1943 von der Fraktion von 1927 bis zum Krieg vertreten wurden, während die politischen Emigranten, jene, die die gesamte Arbeit der Linken Fraktion weiterführten, keine Initiative bei der Gründung der Internationalistischen Kommunistischen Partei 1943 ergriffen.“ (Einführung zur politischen Plattform der Internationalistischen Kommunistischen Partei, Publikationen der Internationalen Linkskommunisten, 1946, eigene Übersetzung).
56. „Was im dekadenten Kapitalismus historisch auf dem Spiel steht. Seit der Eröffnung der imperialistischen Phase des Kapitalismus zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts schwankte die Evolution zwischen imperialistischem Krieg und proletarischer Revolution. In der Epoche des Wachstums des Kapitalismus ebneten Kriege den Weg zur Expansion der Produktivkräfte durch die Zerstörung überholter Produktionsverhältnisse. In der Phase der kapitalistischen Dekadenz haben Kriege keine andere Funktion, als die Zerstörung eines Exzesses von Reichtum auszuführen...“ (Resolution über die Konstituierung des Internationalen Büros der Fraktionen der Kommunistischen Linken, in: Octobre, Nr. 1, Februar 1938, eigene Übersetzung); „Der Krieg 1914-18 markierte das Ende der Expansionsphase des kapitalistische Regimes… Die Endphase des Kapitalismus, die Phase des Niedergangs. Es ist grundsätzlich der Klassenkampf, welcher die historische Entwicklung bestimmt“ (Manifest des Internationalen Büros der Fraktionen der Kommunistischen Linken, Octobre Nr. 3, April 1938)
57. Die so genannte „Interne Fraktion der IKS“, die ein paar Mitglieder um sich sammelte, haben wir ausschlossen, da sie sich wie Spitzel aufführten.
58. s. Bulletin der IFIKS, Nr. 23; eigene Übersetzung.
59. Ebd. Eigene Übersetzung.
60. Wir antworteten bereits im Oktober 2002 auf die ersten Anzeichen dafür, dass das IBRP im Begriff war, den Begriff der Dekadenz preiszugeben (s. Die Dekadenz des Kapitalismus: ein fundamentales Konzept des Marxismus, in: Internationale Revue Nr. 31). Ein Jahr später machten wir eine substanzielle Kritik in der International Review Nr. 115 (s. für weiter Quellenangabe Fussnote 7).
61. s. International Review Nr. 115 (Vorstellung des IFIKS-Bulletins Nr. 22; eigene Übersetzung).
62. s. Bulletin der IFIKS, Nr. 18, 20, 22 und 24.
63. s. Prometeo, Nr. 8, Dezember 2003.
64. s. Bulletin der IFIKS, Nr. 24, April 2004, eigene Übersetzung.
65. Ebd.
66. Diese Elemente teilten die Analyse des Zerfalls, als sie noch Mitglieder der IKS waren (s. dazu unseren Artikel folgenden Artikel aus Seite 19 dieser Internationalen Revue Nr 34.
67. IKP-Pamphlet, Nr. 29, eigene Übersetzung.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Erbe der kommunistischen Linke:
Einleitung zur Resolution über die Entwicklung des Klassenkampfes: Ein Wendepunkt im Klassenkampf
- 2423 Aufrufe
Die Beschleunigung der weltweiten Krise des Kapitalismus engt den Manövrierspielraum der Bourgeoisie zunehmend ein. Sie hat in ihrer Ausbeuterlogik keine andere Wahl, als immer frontalere und gewaltsamere Angriffe gegen das Lebensniveau der Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit zu starten.
Gewaltsame und frontale Angriffe gegen die Arbeiterklasse
Jede nationale Bourgeoisie wendet überall dieselben Massnahmen an: Entlassungspläne, die keinen Sektor aussparen; Arbeitsplatzverschiebungen; Verlängerung der Arbeitszeit; beschleunigter Abbau des Sozialwesens (Rente, Gesundheit, Arbeitslosengelder), Angriffe auf die Löhne; beschleunigte Präkarisierung der Arbeit, des Wohnens; zunehmende Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Alle Arbeiter, ob noch in Beschäftigung oder bereits arbeitslos, noch im Arbeitsleben oder bereits in der Rente, ob in privater oder in öffentlicher Anstellung, sind damit ununterbrochen konfrontiert.
In Italien werden, nachdem gegen das Rentensystem schon ähnliche Massnahmen wie in Frankreich ergriffen worden sind und Fiat eine Entlassungswelle hinter sich hat, 3700 Stellen (mehr als ein Sechstel der Gesamtbelegschaft) bei der Fluggesellschaft Alitalia angekündigt.
In Deutschland hat die rot-grüne Regierung Schröder mit der Umsetzung des Sparprogramms Agenda 2010 begonnen: Senkung der Entschädigung von Pflegekosten, zusätzliche Schnüffelei bei den krankheitsbedingten Absenzen, steigende Krankenkassenbeiträge für alle Lohnempfänger, Erhöhung der Rentenbeiträge sowie Erhöhung des gegenwärtig bei 65 Jahren liegenden Rentenbeginns. Siemens lässt mit Zustimmung der Gewerkschaft IG-Metall und unter Androhung der Produktionsverlagerung nach Ungarn die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich von 35 auf 40 bis 48 Stunden erhöhen. Andere grosse Unternehmen handeln ähnliche Abkommen aus: die Deutsche Bahn, Bosch, Thyssen-Krupp, Continental und die ganze Autobranche (BMW, Opel, Volkswagen, Daimler-Chrysler). Dieselbe Politik ist auch in den Niederlanden anzutreffen. Dieses Land stand lange im Ruf, der Begründer der Teilzeitarbeit zu sein. Der holländische Wirtschaftsminister hat nun angekündigt, dass die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche (ohne Lohnausgleich) ein gutes Mittel sei, um die nationale Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.
In Deutschland wird ab 2005 Hartz IV in Kraft gesetzt und zeigt den Weg auf, auf dem sich alle Bourgeoisien, insbesondere diejenigen Europas, bewegen: Die Arbeitslosen sollen weniger lang und eine geringere Entschädigung erhalten und die Zulassungsbedingungen sollen verschärft werden. Auch soll der Zwang zur Annahme einer schlechter entlohnten Arbeit verstärkt werden.
Diese Angriffe sind nicht auf den europäischen Kontinent begrenzt, sondern erstrecken sich auf die ganze Welt. Der kanadische Flugzeugbauer Bombardier Aerospace sieht die Streichung von 2000 bis 3200 Arbeitsplätzen vor, das amerikanische Telekommunikationsunternehmen AT&T entlässt 12'300 Arbeiter, General Motors streicht 10'000 Stellen, was auch die europäischen Standorte in Schweden und Deutschland bedroht. Die Bank of America kündigt die Streichung von zusätzlichen 4500 Stellen zu den bereits im April bekannt gemachten 12'500 Stellen an. In den USA, wo die Arbeitslosenquote neue Rekordstände erreicht (auch dort spricht man bereits vom „Wachstum ohne Beschäftigung“), leben um die 36 Millionen Menschen (12,5% der Bevölkerung) unter der Armutsschwelle, von denen wiederum 1,3 Millionen im Lauf des Jahres 2003 in unzumutbare Lebensumstände abgerutscht sind. 45 Millionen Menschen haben keinerlei soziale Absicherung. In Israel befinden sich die Gemeinden im Bankrott und die Gemeindeangestellten erhalten seit mehreren Monaten keinen Lohn mehr. Von den schrecklichen Ausbeutungsbedingungen der Arbeiter in der Dritten Welt angesichts der entfesselten Konkurrenz auf den Weltmärkten bei der Senkung der Arbeitskosten wollen wir erst gar nicht sprechen.
Die meisten dieser Angriffe werden als unabdingbare „Reformen“ mit dem Ziel verkauft, dass die Arbeiter die „Opfer“ akzeptieren. Der kapitalistische Staat und jede nationale Bourgeoisie geben vor, dass sie mit diesen angeblichen „Reformen“ nur das allgemeine Wohl verteidigen würden, dass sie für die Zukunft unserer Kinder und aller zukünftigen Generationen handeln würden. Die Bourgeoisie gaukelt uns vor, dass sie die Arbeitsplätze, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, das Rentenwesen retten will, während sie gleichzeitig mit dem umfassenden Abbau des sozialen Schutzes der Arbeiterklasse beschäftigt ist. Damit die Arbeiter diese Opfer leichter schlucken, behauptet sie, dass diese „Reformen“ im Namen der „bürgerlichen Solidarität“ unabdingbar seien: Es soll damit eine grössere Gerechtigkeit und soziale Gleichheit gegen die Verteidigung von kleinlichen korporatistischen Interessen, gegen Einzelinteressen und Privilegien erzielt werden. Wenn die herrschende Klasse von grösserer Gleichheit spricht, so handelt es sich tatsächlich um eine Angleichung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse auf tieferer Ebene. Im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, wo im historischen Kontext eines noch in Ausdehnung begriffenen Kapitalismus die bürgerlichen Reformen weithin zu einer Verbesserung der Bedingungen für die Arbeiterklasse führten, ist der Kapitalismus heute nicht mehr reformierbar. Er kann den Arbeitern nichts mehr anbieten als Elend und wachsende Verarmung. All diese Pseudoreformen sind nicht Ausdruck eines prosperierenden Kapitalismus, sondern im Gegenteil seines unausweichlichen Zusammenbruchs.
Die Arbeiterklasse hat begonnen auf die Angriffe der Bourgeoisie zu antworten
Die Resolution, die wir nachfolgend veröffentlichen, wurde durch das Zentralorgan der IKS im vergangenen Juni angenommen.
Das zentrale Anliegen dieses Textes war aufzuzeigen, dass es einen „Wendepunkt“ in der Entwicklung des Klassenkampfes gibt, worauf wir in unseren Analysen der Lage seit dem Frühjahr 2003 in Frankreich und Österreich angesichts der von der Bourgeoisie angestrengten „Rentenreformen“ hingewiesen hatten. Wir nahmen uns mit diesem Text vor, gewissen Lesern und Sympathisanten, die Zweifel an der Gültigkeit einer solchen Analyse geäussert hatten, erste Elemente einer Antwort zu liefern.
Seither hat die Realität des Klassenkampfes selbst, mit den verschiedenen sozialen Bewegungen, den auf internationaler Ebene vorhandenen Wendepunkt im Klassenkampf sehr viel greifbarer bestätigt.
Trotz der Stärke und Allgegenwart des gewerkschaftlichen Korsetts und der permanenten Kontrolle, die die Gewerkschaften immer noch über die Kämpfe ausüben, trotz der Hemmungen, den Kampf aufzunehmen – einerseits auf Grund der Einschüchterungsmanöver der Bourgeoisie und andererseits in Folge eines mangelnden Vertrauens in die eigenen Kampfmittel – ist es doch klar, dass die Arbeiterklasse begonnen hat, auf die Angriffe der Bourgeoisie zu antworten, auch wenn diese Antwort noch lange nicht dasselbe Niveau erreicht hat wie die Angriffe, denen sie ausgesetzt ist. Bereits die Mobilisierung der italienischen Nahverkehrsangestellten oder der englischen Postangestellten und Feuerwehrleute im Winter 2003, dann der Arbeiter in den FIAT-Fabriken von Melfi in Süditalien im Frühjahr angesichts der Entlassungspläne waren trotz ihrer Schwächen und ihrer Isolierung Teil der Wiederbelebung der Kampfbereitschaft der Arbeiter. Doch heute vervielfachen sich die Beispiele und werden bedeutsamer. In Deutschland haben im vergangenen Juli mehr als 60'000 Arbeiter bei Daimler-Chrysler an Streiks und Protestdemonstrationen gegen die Erpressung und das Ultimatum der Direktion teilgenommen, das darauf hinauslief, entweder gewisse „Opfer“ bei ihren Arbeitsbedingungen zu erbringen, damit die Produktivität gesteigert werden kann – dies insbesondere bei den Arbeitern der Fabrik von Sindelfingen-Stuttgart (Baden-Württemberg) – sowie den Stellenabbau in Sindelfingen, Untertürkheim und Mannheim zu akzeptieren, oder aber die Verlegung der Produktion in andere Gebiete hinzunehmen. Daraufhin haben nicht nur Arbeiter von Siemens, Porsche, Bosch und Alcatel, die von ähnlichen Angriffen betroffen sind, an den Mobilisierungen teilgenommen, sondern zahlreiche Arbeiter von Daimler-Chrysler in Bremen, welche von der geplanten Verlegung der Produktion und der entsprechenden Stellen hätten profitieren sollen, die sich aber trotz dieser bewusst eingesetzten Spaltungsstrategie der Unternehmensdirektion den Demonstrationen angeschlossen haben, was einen sehr bedeutsamen Keim der Arbeitersolidarität darstellt. In Spanien haben die Werftarbeiter in Puerto Real in der Nähe von Cadiz (Andalusien) wie auch in Sestao (in der Region von Bilbao) vor mehreren Wochen einen sehr hart geführten Kampf begonnen, in dem sie versuchen, sich gegen Privatisierungspläne zu wehren, der auf einen Abbau von Tausenden von Stellen hinauslaufen würde. Diesen Plan setzt die Linksregierung trotz anders lautenden früheren Versprechen um.
Erst kürzlich, am 2. Oktober, versammelten sich in Berlin auf einer Demonstration, die die Gewerkschaften und Globalisierungsgegner organisiert hatten und die die „Montagsdemonstrationen“ gegen Hartz IV hätten abschliessen sollen, 45'000 Leute. Am gleichen Tag fand in Amsterdam eine riesige Demonstration gegen die Regierungspläne statt; schon zuvor hatte es bedeutende regionale Mobilisierungen gegeben. Offiziell war von 200'000 Teilnehmern die Rede; es handelte sich somit um die grösste Demonstration der letzten zehn Jahre in den Niederlanden. Trotz der offiziellen Parole, die die Demonstration beherrschte und lautete: „Nein zur Regierung, ja zu den Gewerkschaften!“, war die spontane Reaktion der Teilnehmer die „Überraschung“ und die „Verwunderung“ darüber, dass man so zahlreich war. Es ist im Übrigen daran zu erinnern, dass die Niederlande mit Belgien zu den ersten Ländern gehörte, in denen sich bereits im Herbst 1983 eine internationale Wiederaufnahme der Arbeiterkämpfe angekündigt hatte.
Jede dieser Bewegungen ist ein Zeichen für das Nachdenken in der Arbeiterklasse, das immer weitere Kreise zieht: Die Häufung, die Massivität und der Charakter der Angriffe der Bourgeoisie werden nicht nur dazu führen, die Illusionen zu zerstören, die die herrschende Klasse zu verbreiten versucht, sondern sie zwingen gleichzeitig die Ausgebeuteten auf der Ebene des Bewusstseins zu einer Beunruhigung und einer Infragestellung der Aussichten, die dieses auf Dauer immer unerträglichere Ausbeutungssystem ihnen und ihren Kindern, den zukünftigen Generationen, bietet. Die IKS ist sich ihrer Verantwortung bei der langsam vonstatten gehenden stattfindenden Reifung des Bewusstseins der Arbeiter über den Bankrott des kapitalistischen Systems bewusst und intervenierte entsprechend aktiv in diesen Kämpfen. Sie gab im Juli in Deutschland und im September in Spanien Flugblätter heraus, die breit verteilt werden konnten, um so direkt gegenüber der lokalen Lage zu intervenieren. Am 2. Oktober konnte sie sowohl in Amsterdam als auch in Berlin nationale Verkaufsrekorde mit ihrer Presse erzielen, wie dies auch schon im Frankreich während der Kämpfe im Frühjahr 2003 der Fall gewesen war, was ebenfalls die Merkmale und das Potenzial des gegenwärtigen Wendepunktes verdeutlicht.
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Imperialistische Rivalitäten (Teil I)
- 9971 Aufrufe
Anmerkungen zur Geschichte der imperialistischen Konflikte im Nahen Osten (Teil I)
Im Laufe der vergangenen hundert Jahre war der Nahe Osten oft Schauplatz imperialistischer Kriege.
Nach dem Zweiten Weltkrieg folgten drei offene Kriege zwischen Israel und seinen feindlichen Nachbarn (1949, 1967, 1973), ein permanenter Kriegszustand zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Kämpfern (mit den bewaffneten Terroristenbanden und Selbstmordattentätern auf der einen und dem israelischen Staatsterror auf der anderen Seite), ein acht Jahre langer Krieg zwischen Iran und Irak, unablässige Scharmützel zwischen kurdischen Nationalisten und dem türkischen Staat, 20 Jahre Krieg in Afghanistan, der Golfkrieg 1991 und die Besetzung des Iraks 2003, die nur eine Verschlimmerung des Kriegszustandes zur Folge hatte.
Kein anderer Teil der Erde zeigt deutlicher, dass der Kapitalismus nur durch Krieg und Zerstörung überleben kann, dass alle Länder – ob gross oder klein – imperialistisch sind, dass keine systemimmanente Auflösung der kapitalistischen Widersprüche möglich ist, dass der Krieg seine eigene Dynamik geschaffen hat und die Arbeiter sich auf dem internationalistischen Terrain vereinigen und gemeinsam jeden Nationalismus bekämpfen müssen.
Diese kurze Geschichte des Nahen Ostens hat zum Ziel aufzuzeigen, dass die Vielzahl der regionalen und lokalen Konflikte in dieser Region nur im Zusammenhang mit dem weltweiten Imperialismus verstanden werden kann.
Der Nahe Osten: Schnittpunkt der imperialistischen Interessen aller kapitalistischer Mächte
Zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittelmeer, zwischen Asien, Europa und Afrika gelegen, war der Nahe Osten schon lange bevor seine Erdölvorkommen entdeckt wurden ein umstrittenes Gebiet.
Seit dem Beginn der Expansion des kapitalistischen Europas in diese Region haben die globalen strategischen Interessen die Politik der verschiedenen Mächte bestimmt. Diese haben sich nie nur wegen der Nachfrage nach diesem oder jenem Rohstoff die Stirn geboten.
Schon in seiner frühen Expansionsphase, noch bevor die industrielle Revolution voll in Schwung kam, beeilte sich der britische Kapitalismus, in Indien Fuss zu fassen und seinen französischen Rivalen von dort zu vertreiben. Bereits im frühen 19. Jahrhundert wurde Grossbritannien zur vorherrschenden Macht. Systematisch bemühte sich Grossbritannien darum, strategisch wichtige Stellungen auf dem Weg nach Indien zu besetzen. 1839 wurde Aden (im heutigen Yemen) besetzt und die Briten übernahmen die Polizeifunktion an der Golfküste, wo Piraten die Handelsentwicklung beeinträchtigt hatten.
Aber der Nahe Osten entwickelte sich schnell auch zu einem Expansionsziel des russischen Kapitalismus. Nach den Zusammenstössen mit Persien (1828) und seinen wiederholten Kriegen gegen das osmanische Reich – allein im 19. Jahrhundert führten Russland und die Türkei dreimal Krieg gegeneinander (1828, 1855 und 1877); im Krimkrieg von 1853–56 stiess Russland mit der Türkei, mit Grossbritannien, Frankreich und Italien am Schwarzen Meer zusammen – Russland versuchte, in Richtung Kaukasusregion, Kaspisches Meer und in Richtung der heute unter den Namen Kasachstan und Tadschikistan geläufigen Region zu expandieren. Sein Hauptziel war der Zugang zum Indischen Ozean via Afghanistan und Indien.
Um die russische Expansion in diese Gegend abzuwehren, nahm Grossbritannien zweimal Afghanistan ein (1839–1842 und 1878–1880). Nach seinem Sieg im zweiten Afghanistankrieg errichtete Grossbritannien ein Marionettenregime in diesem Land.[1]
Als sich Ende des 19. Jahrhunderts der deutsche Imperialismus in Richtung Balkan und Naher Osten ausbreitete, beschlossen Grossbritannien und Russland, ihren Konflikt über die Vorherrschaft in Asien beizulegen. Sie einigten sich darauf, das Gebiet rund um Afghanistan aufzuteilen, um dem deutschen Vorrücken Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig installierte Grossbritannien 1893 in Afghanistan die „Durand-Linie“. Durand weitete entgegen den Absichten des afghanischen Königs die Grenze gen Osten durch einen schmalen Landstreifen, den Wakhan, aus, der sich durch das Pamirgebirge bis nach China erstreckt, um eine Pufferzone zwischen Russland und Indien zu installieren. 1907 unterzeichneten Grossbritannien und Russland einen Vertrag, der die Gebiete rund um den Iran aufteilte.
Ausserdem erzielte Grossbritannien 1882 einen strategisch bedeutenden Sieg, indem es Ägypten militärisch besetzte und seinen französischen Widersacher, der den 1869 eröffneten Suez-Kanal gebaut hatte, verdrängte. Der Suez-Kanal wurde zum Dreh- und Angelpunkt der britischen Vorherrschaft im Nahen Osten und war von allerhöchster Bedeutung für die britische Herrschaft in Indien und anderen Teilen Asiens und Afrikas. Noch 1956 entsandten Grossbritannien und Frankreich Truppen, um die Kontrolle über den Kanal zu verteidigen, und widersetzten sich damit den USA.
Von Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg hatte Grossbritannien die bestimmende Position im Nahen Osten inne und hielt damit seine europäischen Widersacher Russland und Frankreich in Schach.
Wie oben erwähnt, betrachteten die europäischen Kolonialmächte, als sie ihre Kolonien „einsammelten“ und ihre imperialistischen Ziele definierten, die Frage der Rohstoffe, ob Erdöl oder andere, nicht als vorrangig. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Erdölvorkommen des Nahen Ostens von geringer Bedeutung, und auch andere Rohstoffe spielten keine entscheidende Rolle.[2] Schon damals spielten eher strategische und militärische Erwägungen die Hauptrolle.
Die Natur der imperialistischen Konflikte entwickelte jedoch einen qualitativ neuen Charakter, als die Erdkugel Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen den europäischen Grossmächten aufgeteilt war.
Sobald die europäischen Mächte bei dem Versuch, die Welt unter sich und weiteren aufzuteilen (Nordafrika unter Italien und Frankreich, Ägypten und Fachoda/Sudan unter Frankreich und Grossbritannien, Zentralasien unter Grossbritannien und Russland, der Ferne Osten zwischen Russland und Japan, China unter Japan und Grossbritannien, der Pazifik-
raum unter den USA und Japan, Marokko unter Deutschland und Frankreich), aneinander gerieten, nahmen auch die Spannungen im Nahen Osten stark zu.
Deutschland, das verspätet auf dem Weltmarkt erschienen war und verzweifelt versuchte, sich Kolonien anzueignen, konnte diese bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts nur noch Ländern entreissen, die sich bereits „etabliert“ hatten. Das hatte zur Folge, dass Deutschland vor allem versuchte, die Positionen der alleinigen Weltmacht, nämlich Grossbritanniens, zu untergraben. Schon Ende des 19. Jahrhunderts bemühte sich Deutschland darum, eine militärische Präsenz zu errichten. Doch wie wir gesehen haben, war der deutsche Imperialismus zwar in der Lage, die britischen Interessen in dieser Region zu bedrohen und zu untergraben, aber er war unfähig, die britische Herrschaft zu stürzen. Auch wenn er ein ständiger Herausforderer und „Unruhestifter“ besonders der britischen Interessen war, besass er, anders als der britische Imperialismus, nicht die Mittel, um seine Präsenz in der Region zu erzwingen.
Deutschland versuchte also, sich weiter östlich auf dem Balkan auszuweiten (es ist kein Zufall, dass der Erste Weltkrieg dort ausgelöst wurde, nachdem sich die imperialistischen Gegensätze in zwei Balkankriegen 1912–1913 zugespitzt hatten, während denen das osmanische Reich seine europäischen Gebiete an Bulgarien, Serbien, Griechenland und Albanien verlor). Das sich auflösende osmanische Reich wurde zum Angelpunkt der deutschen imperialistischen Ansprüche im Nahen Osten.
Während Marx noch die territoriale Einheit der Türkei als Barriere gegen die russischen Ambitionen im Nahen Osten unterstützt hatte, erkannte Rosa Luxemburg Anfang des 20. Jahrhunderts, dass sich die Weltlage verändert hatte und die Unterstützung der Türkei ein reaktionäres Projekt geworden war. „Dass bei der Vielfältigkeit der nationalen Fragen, welche den türkischen Staat zersprengen: der armenischen, kurdischen, syrischen, arabischen, griechischen (bis vor kurzem noch der albanischen und makedonischen), bei der Mannigfaltigkeit der ökonomisch-sozialen Probleme in den verschiedenen Teilen des Reiches (…) war für jedermann und namentlich für die deutsche Sozialdemokratie seit langem ganz klar, dass eine wirkliche Regeneration des türkischen Staates eine vollständige Utopie ist, und dass jede Anstrengung, diese verfaulten und zusammenbrechenden Ruinen aufrechtzuerhalten, nur ein reaktionäres Unternehmen darstellen kann.“[3]
Für den deutschen Imperialismus war die Türkei das Schlüsselland für seine Ambitionen.[4] Deutschland unterstützte die Türkei militärisch (es bildete den türkischen Generalstab aus, lieferte Waffen und unterzeichnete 1914 einen Beistandspakt für den Kriegsfall); es wurde auch zum wichtigsten Zulieferer finanzieller und technischer Hilfe. Darum hat „die Position des deutschen Imperialismus ihn in Gegensatz zu den anderen europäischen Staaten im Nahen Osten gebracht. Vor allem zu Grossbritannien. Die Errichtung strategischer Bahnen und die Stärkung des türkischen Imperialismus unter deutschem Einfluss wurden aber hier an einem der weltpolitisch empfindlichsten Punkte für Grossbritannien vorgenommen: in einem Kreuzungspunkt zwischen Zentralasien, Persien, Indien einerseits und Ägypten andererseits.“[5]
Eine weitere Ambition des deutschen Imperialismus zu jener Zeit war der Bau der Bagdadbahn, die den deutschen Truppen als elementarer logistischer Hebel dienen sollte.[6]
Der Zusammenbruch des osmanischen Reiches war entscheidend für die Ausbreitung der imperialistischen Konflikte sowohl auf dem Balkan als auch im Nahen Osten.
Bis zum Ersten Weltkrieg war der grösste Teil des Nahen Ostens unter der Kontrolle des osmanischen Reiches. In Asien kontrollierte die Türkei Syrien (einschliesslich Palästina), einen Teil der arabischen Halbinsel (die damals noch keine festen Grenzen hatte), einen Teil der Kaukasusregion und Mesopotamiens (bis nach Bassorah).
Der Zusammenbruch des osmanischen Reiches führte weder auf dem Balkan noch im Nahen Osten zur Bildung einer grossen Industrienation, die auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig gewesen wäre. Im Gegenteil, der imperialistische Druck führte zu einer Aufsplitterung, zur Bildung einer Reihe von „verkrüppelten Kleinstaaten“. Diese Kleinstaaten auf dem Balkan waren während des gesamten 20. Jahrhunderts und bis in unsere Tage ebenso Objekt der imperialistischen Rivalitäten zwischen den Grossmächten, wie der asiatische Teil der Trümmer des osmanischen Reiches, der Nahe Osten, Schauplatz andauernder imperialistischer Konflikte blieb.
Der Ferne Osten blieb, abgesehen von einigen weniger wichtigen Konflikten, abseits des Ersten Weltkrieges. Im Gegensatz dazu war der Nahe Osten schon immer Schlachtfeld konkurrierender Parteien gewesen.[7] Schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges, lange bevor die Palästinafrage und die Frage eines jüdischen Staates gestellt wurde, war die Region ein imperialistisches Minenfeld gewesen. Wie wir aber sehen werden, trugen die Konflikte um Palästina und einen zionistischen Staat zu einer weiteren Verschärfung in einer Region bei, die ohnehin Brennpunkt imperialistischer Konflikte ist.
Der Fall des osmanischen Reiches und die imperialistischen Konstellationen am Ende des Ersten Weltkrieges
Während des Ersten Weltkrieges versuchten die europäischen Länder, ihre „Verbündeten“ in der Region für ihre Kriegsanstrengungen zu mobilisieren.
Grossbritannien, das zusammen mit Russland Deutschland und die Türkei bekämpfte, versuchte, die arabische Bourgeoisie für ein Bündnis gegen die osmanischen Herrscher zu gewinnen. Es ermutigte alle Unabhängigkeitsbestrebungen gegen die türkischen Herrscher, stachelte Stämme der Hedjas (im westlichen Teil der arabischen Halbinsel) auf und unterstützte Sherif Hussein aus Mekka.
Bereits im Ersten Weltkrieg dienten die lokalen Führer als Schachfiguren in den Machtkämpfen der europäischen Mächte. Die Briten konnten sich mit Hilfe von Lawrence von Arabien, der eine wichtige Rolle als Verbindungsoffizier zu den arabischen Rebellen spielte, deren Kampf gegen die Türken zunutze machen. Auch die jüdischen Einwanderer wurden als Kanonenfutter für den englischen Imperialismus rekrutiert.
Nachdem Deutschland die Türkei im Februar 1915 dazu gedrängt hatte, eine Offensive gegen die englischen Stellungen in Ägypten zu führen, um sich des Suez-Kanals zu bemächtigen (eine Offensive, die bereits nach wenigen Tagen aus Mangel an logistischer Unterstützung und an Waffenlieferungen scheiterte), erwies sich die Türkei als die grosse Verliererin des Krieges.
Dies entfachte umgekehrt die imperialistischen Gelüste sowohl der europäischen Mächte als auch der lokalen arabischen Herrscher. In der Hoffnung, von der Gelegenheit zu profitieren, lieferten sich im Sommer 1917 die von Sherif Hussein kommandierten arabischen Truppen ein richtiggehendes Wettrennen mit der englischen Armee, um sich Teile des türkischen Gebietes zu schnappen. Dieselben Truppen marschierten im Oktober 1918 in Damaskus ein und riefen ein arabisches Königreich aus. So zeigten die arabischen Führer ihre eigenen imperialistischen Ambitionen, nachdem sie als Kanonenfutter für die englischen imperialistischen Interessen in der Türkei gedient hatten. Sie wollten ein „panarabisches Reich“ mit Damaskus als Hauptstadt errichten. Doch diese nationalistischen Ambitionen stiessen sofort mit den englischen und französischen Interessen zusammen: Es gab keinen Raum für die arabischen imperialistischen Ansprüche.
Als das osmanische Reich auseinanderbrach und die deutsch-türkische Niederlage sich abzeichnete, begannen Frankreich und Grossbritannien Pläne zu schmieden, um den Nahen Osten unter sich aufzuteilen.
Die arabischen Staaten wurden von der Aufteilung der Beute ausgeschlossen. Die Bildung einer grossen arabischen Nation, die die Überbleibsel des kollabierten osmanischen Reiches umfassen würde, war historisch unmöglich geworden. Die Hoffnungen der herrschenden Klasse Arabiens, eine grosse arabische Nation aufzubauen, waren zum Scheitern verurteilt, weil die europäischen imperialistischen Haie keinen lokalen Widersacher dulden konnten.
Im Frühjahr 1915 teilten die europäischen Mächte Grossbritannien, Frankreich, Russland, Italien und Griechenland nach Geheimverhandlungen den Nahen Osten unter sich auf. Grossbritannien und Frankreich unterzeichneten im Mai 1916 ein Geheimabkommen (Sykes-Picot-Vertrag), demzufolge
– Grossbritannien die Kontrolle über Haifa, Acca, die Negev-Wüste, Südpalästina, den Irak, die arabische Halbinsel, sowie Transjordanien (heute: Jordanien),
– Frankreich den Libanon und Syrien bekommen erhalten sollte.
Im April 1920 erhielt Grossbritannien das Mandat des Völkerbundes für Palästina, Jordanien, Iran, Irak; Frankreich erhielt das Mandat für Syrien und Libanon und trat die Kontrolle über Mossul (mit seinen reichen Ölquellen) gegen englische Zugeständnisse in Elsass-Lothringen und Syrien ab.
Von da an waren Deutschland als geschlagenes Land und Russland nach der Oktoberrevolution 1917 für eine lange Zeit auf der imperialistischen Bühne im Nahen Osten nicht mehr präsent. Die Zahl der Widersacher in der Gegend sank beträchtlich. Grossbritannien und Frankreich wurden die herrschenden Kräfte, wobei Grossbritannien klar die stärkste Stellung innehielt. Die bestimmenden Kräfte waren während des Krieges und bis in die 30er-Jahre europäisch, die USA spielten noch keine bedeutende Rolle.
Um sein Kolonialreich zu verteidigen, das von anderen Mächten untergraben wurde, musste Grossbritannien ein besonderes Augenmerk auf die strategisch hoch bedeutende Region von Palästina legen. Palästina bedeutete für Grossbritannien die Verbindung zwischen dem Suez-Kanal und dem zukünftigen britischen Mesopotamien. Keiner anderen Macht, weder einer europäischen noch einer arabischen, sollte es erlaubt werden, einen Keil zwischen Mesopotamien und den Suez-Kanal zu treiben. 1916 erklärte Grossbritannien die Kontrolle über Palästina zum ausschliesslichen Ziel seiner Politik.
Bis zum Ersten Weltkrieg, solange das osmanische Reich Bestand hatte, wurde Palästina stets als Teil Syriens angesehen. Aber mit dem Mandat Grossbritanniens für Palästina hatten die imperialistischen Mächte eine neue „Einheit“ geschaffen. Wie alle im Laufe der Dekadenz des Kapitalismus neu geschaffenen „Einheiten“ war auch sie dazu bestimmt, zum permanenten Schauplatz von Konflikten und Kriegen zu werden.
Die lokalen palästinensischen Herrscher waren noch schwächer als die anderen arabischen Herrscher. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Rückständigkeit verfügten sie weder über eine industrielle Basis noch über Finanzkapital, sie hatten keinerlei wirtschaftliches Potenzial und konnten sich nur auf militärische Mittel stützen, um ihre Interessen zu verteidigen.
1919 wurde der erste palästinensische Nationalkongress einberufen und Amin al-Hussein wurde zum Mufti von Jerusalem ernannt. Die palästinensischen Nationalisten nahmen Kontakt mit Frankreich auf, um die englische Herrschaft in Palästina ins Wanken zu bringen. Mit der Hilfe Syriens und der französischen Besatzungstruppen in Syrien wurde ein militärischer Aufstand gegen die Briten organisiert, der indes von der britischen Armee schnell niedergeschlagen wurde.
Gleichzeitig wurden die palästinensischen Herrscher, die ihre Unabhängigkeit in einer Welt beanspruchten, die keinen Raum für einen neuen Nationalstaat bot, mit einem neuen, vom Ausland kommenden „Widersacher“ konfrontiert.
Nach der Balfour-Erklärung von Grossbritannien im November 1917, die Unterstützung bei der Errichtung einer jüdischen Heimstatt in Palästina versprach, nahm die Zahl der jüdischen Einwanderer beständig zu. Die Zionisten begannen einen blutigen Überlebenskampf gegen die palästinensischen Herrscher.
Grossbritannien nutzte die jüdischen Siedler an zwei Fronten. Nachdem es während des Krieges im Kampf gegen den türkischen Rivalen das „Zion Mule Corps“ seiner Armee angegliedert hatte, benutzte Grossbritannien nun die jüdischen Nationalisten gleichzeitig gegen seinen Hauptgegner Frankreich und gegen die arabischen Nationalisten. So stiftete Grossbritannien die Zionisten dazu an, vor dem Völkerbund zu erklären, dass die Juden in Palästina weder französischen noch internationalen, sondern nur britischen Schutz wünschten.
Obwohl in Rivalität miteinander verbunden, handelten Frankreich und Grossbritannien resolut und gemeinsam gegen lokale arabische Nationalisten, sobald sich deren Ruf nach nationaler Unabhängigkeit erhob. So setzten sie nun militärische Mittel ein, um ihre Unabhängigkeitsansprüche der arabischen Nationalisten zu unterdrücken, nachdem sie sich noch während des 1. Weltkrieges gegen die Türken ihrer bedient hatten. Kaum hatte Scheich Feisal im Oktober 1918 in Damaskus ein „unabhängiges arabisches Reich“ proklamiert, das Palästina umfassen sollte, unterwarfen ihn im Juli 1920 französische Truppen – wobei sie Bombenflugzeuge gegen die arabischen Nationalisten einsetzten.
Im März 1918 fanden in Ägypten eine Reihe von Protesten von ägyptischen Nationalisten, Arbeitern und Bauern statt, die soziale Reformen forderten. Sie wurden von der britischen und ägyptischen Armee gemeinsam niedergeworfen, wobei mehr als 3.000 Ägypter getötet wurden. Auch 1920 wurde eine Protestbewegung im irakischen Mossul von Grossbritannien niedergeschlagen.
Die lokale Bourgeoisie hatte in keinem der arabischen Länder oder Protektorate die Mittel, unabhängige, vom kolonialen Zugriff und den „Schutzmächten“ befreite Staaten zu errichten.
Die Forderung nach nationaler Befreiung war nichts anderes als eine reaktionäre Forderung. Während Marx und Engels einige nationalistische Bewegungen unter der einzigen Bedingung unterstützt hatten, dass die Bildung der Nationalstaaten das Wachstum und die Verstärkung der Arbeiterklasse beschleunigen würde, damit Letztere als Totengräber des Kapitalismus handeln konnte, zeigten die Entwicklungen im Nahen Osten dagegen, dass es keinen Raum für die Bildung einer neuen arabischen oder palästinensischen Nation gab. Nachdem der Kapitalismus in die Phase seines Niederganges eingetreten war, konnten – wie auch überall sonst auf der Welt – keine nationale Fraktion des Kapitals eine fortschrittliche Rolle mehr spielen. Unfähig, neue kapitalistische Absatzmärkte zu erobern, konnten die Widersacher nur militärisch reagieren: Die Kolonialmächte verhinderten im Nahen Osten die Bildung einer neuen arabischen Nation, und die lokalen arabischen Bourgeoisien widersetzten sich den Versuchen, einen neuen palästinensischen Nationalstaat zu errichten.
Um die Situation im Nahen Osten nach dem Niedergang des osmanischen Reiches und dem Ende des Ersten Weltkriegs zusammenzufassen, möchten wir folgende Punkte hervorheben:
– Die beiden europäischen Mächte Frankreich und Grossbritannien, die in Rivalität zueinander standen und ihre „Protégés“ gewählt hatten, beherrschten die Region.
– Deutschland und Russland mit ihren starken imperialistischen Ambitionen in der Region wurden zurückgedrängt.
– Die arabische Bourgeoisie war nicht in der Lage, einen lebensfähigen panarabischen Nationalstaat zu schaffen.
– Die neu geschaffene Einheit, das Protektorat Palästina, mit einer verkrüppelten, rückständigen herrschenden Klasse Palästinas an der Spitze, geriet in Konflikt mit einer „Schutz“macht (Grossbritannien), die dazu nicht in der Lage war, und mit dem neuen zionistischen Rivalen, der von aussen einsickerte.
Die arabische Bourgeoisie, die mit den Kolonialmächten aneinander geriet, die sie daran hindern wollten, einen neuen, lebensfähigen Staat zu bilden, widersetzte sich ihrerseits der Bildung einer neuen palästinensischen „Einheit“.
Die USA, Hauptnutzniesser des Ersten Weltkrieges, waren noch nicht bereit. Im Zentrum der imperialistischen Rivalitäten stand nicht die Eroberung von bestimmten Rohstoffen, sondern die Eroberung strategischer Positionen.
Wir sehen, dass die Situation im Nahen Osten die von Rosa Luxemburg während des Ersten Weltkrieges entwickelte Analyse voll und ganz bestätigte: „Der Nationalstaat, die nationale Unabhängigkeit und Einheit, das war das ideologische Banner, unter dem sich im letzten Jahrhundert die grossen bürgerlichen Staaten Zentraleuropas bildeten. Der Kapitalismus ist nicht vereinbar mit dem Partikularismus der Kleinstaaten, mit einem politischen und wirtschaftlichen Zerbröckeln; er braucht ein grösstmögliches zusammenhängendes Gebiet mit einem einheitlichen Zivilisationsniveau, um sich auszubreiten; ohne diese Voraussetzung könnte man weder die gesellschaftlichen Bedürfnisse auf die von der kapitalistischen Warenproduktion erzielte Ebene heben, noch würde der Mechanismus der modernen bürgerlichen Herrschaft funktionieren. Vor ihrer Ausbreitung über die ganze Erdkugel hat die kapitalistische Wirtschaftsweise versucht, sich ein zusammenhängendes Gebiet in den nationalen Grenzen eines Staates zu schaffen (…) Die nationale Phrase dient heute nur dazu, mehr schlecht als recht imperialistische Ansprüche zu maskieren, wenn sie nicht als Kriegsruf in den imperialistischen Konflikten verwendet wird, als einziges und letztes ideologisches Mittel, um die Zustimmung der Volksmassen zu fangen und sie die Rolle des Kanonenfutters in den imperialistischen Kriegen spielen zu lassen.“[8]
DE
Fußnoten:
1. Friedrich Engels, Angriff“, in: MEW Bd. 14, S. 68
2. 1900 betrug der Erdölverbrauch etwa 20 Millionen Tonnen und diese Nachfrage wurde durch die amerikanischen und russischen Quellen abgedeckt (Hauptförderregion war der Golf von Mexiko). Die verschärfte Militarisierung und die Ablösung der Kohle durch Öl in der Industrie und als Treibstoff für Lokomotiven erhöhten die Nachfrage stark. Zwischen 1900 und 1910 hat sich die Erdölproduktion mehr als verdoppelt und erreichte 43.8 Millionen Tonnen. Die Erfindung des Dieselmotors für den Lokomotivantrieb und die Dampfschiffe schufen die technische Grundlage, aber erst die Erfordernisse einer militarisierten Wirtschaft führten zur Verdoppelung der Rohölproduktion. Vor dem I. Weltkrieg spielte der Nahe Osten lediglich eine zweitrangige Rolle in der Erdölversorgung des Weltmarktes. Erst nach dem I. Weltkrieg stieg die Ölförderung im Nahen Osten beträchtlich an.
3. Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre, Absatz 4, in Gesammelte Werke Bd 4, S. 83ff.
4. Der deutsche Imperialismus schwankte zwischen der Unterstützung für die Türkei und für die nationalistischen jüdischen Siedler. Wenn die Zionisten mit deutscher Unterstützung eine jüdische Heimstatt in Palästina eingerichtet hätten, hätte dies einen Konflikt mit dem osmanischen Reich hervorgerufen. Doch Deutschland wollte es nicht riskieren, seine Verbindung mit der Türkei zu lösen, weil diese sein wichtigster Verbündeter im weltweiten Machtkampf mit Grossbritannien war.
5. Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre, Absatz 4, in Gesammelte Werke Bd 4, S. 83ff. Rosa Luxemburg war eine der Ersten, die die historischen Folgen der neuen Bedingungen, die der Anfang der Dekadenz mit sich brachte, erfasste. Schon in ihrem Buch über Die wirtschaftliche Entwicklung Polens 1898 zeigte sie, dass die Kommunisten die Bildung eines polnischen Staates nicht mehr unterstützen konnten. In dem Text Die nationalen Kämpfe in der Türkei und die Sozialdemokratie 1896 und in Die nationale Frage und die Autonomie 1908 zeigte sie den historischen Wandel auf, der zwischen dem Aufstieg und dem Niedergang eingetreten war und jede Unterstützung für die Türkei verunmöglichte.
6. Rohrbach schrieb in seinem Buch Die Bagdadbahn“: „Grossbritannien kann von Europa aus nur an einer Stelle zu Lande angegriffen und schwer verwundet werden: von Ägypten (…) Die Türkei kann aber nur unter der Voraussetzung an Ägypten denken, dass sie über ein ausgebautes Eisenbahnsystem in Kleinasien und Syrien verfügt. Die Bagdadbahn war von Anfang an dazu bestimmt, Konstantinopel und die militärischen Kerngebiete des türkischen Reiches in unmittelbare Verbindung mit Syrien und den Provinzen am Euphrat und Tigris zu bringen. Natürlich war in diesem Plan das Projekt inbegriffen, türkische Truppen nach Ägypten zu transportieren.“ (Paul Rohrbach, zitiert nach Rosa Luxemburg, in: Der Krieg und die deutsche Politik).
7. Obwohl der Nahe Osten ein Nebenkriegsschauplatz des Ersten Weltkrieges war, liessen von den 20 Millionen Opfern etwa 350.000 aus dem Nahen Osten ihr Leben in diesem Krieg. Die türkische und alliierte Seeblockade der arabischen Häfen sowie Epidemien und Hungersnöte erforderten zahlreiche Tote. 30 Prozent der ägyptischen Männer wurden von der britischen und australischen Armee eingezogen, um als Handlanger zu dienen.
8. Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre, Absatz 4, in Gesammelte Werke Bd 4, S. 83ff.
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Resolution über die Entwicklung des Klassenkampfes
- 3068 Aufrufe
Auf seiner Plenarsitzung im Herbst 2003 hat das Zentralorgan der IKS hervorgehoben, dass ein Wendepunkt in der Entwicklung des Klassenkampfes eingetreten ist:
„Die breiten Mobilisierungen vom Frühling 2003 in Frankreich und in Österreich stellen in den Klassenkämpfen seit 1989 einen Wendepunkt dar. Sie sind ein erster wichtiger Schritt in der Wiederaneignung der Kampfbereitschaft der Arbeiter nach der längsten Rückflussperiode seit 1968.“ Aber dieser Bericht, der auf dieser Plenarsitzung verabschiedet wurde, stellte fest: “Sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene befindet sich die Kampfbereitschaft (...) noch im embryonalen Stadium und ist noch sehr heterogen.“ Und er fuhr fort mit der Feststellung: „Auf viel allgemeinerer Ebene muss man in der Lage sein, zwischen einer Situation zu unterscheiden, in der man eines Morgens aufwacht und die Welt ist nicht mehr dieselbe wie am Vortag, und Änderungen, die von der Allgemeinheit beinahe unbemerkt vor sich gehen wie beispielsweise der Gezeitenwechsel. Die gegenwärtige Entwicklung gehört unbestreitbar letzterer an. In diesem Sinn bedeuten die Mobilisierungen vor Kurzem gegen die Angriffe auf das Rentenwesen in keiner Weise eine unmittelbare und spektakuläre Anpassung der Situation ...“
Acht Monate nach der Verabschiedung dieser Perspektiven durch unsere Organisation ist es notwendig, sich zu fragen, inwieweit sie sich bewahrheitet haben. Das ist das Ziel der vorliegenden Resolution.
1) Was sich zweifellos bestätigt hat, ist, dass es „in keiner Weise eine unmittelbare und spektakuläre Anpassung der Situation“ gegeben hat, denn seit den Kämpfen im Frühjahr 2003 in verschiedenen europäischen Ländern, insbesondere in Frankreich, gab es keine massive oder bemerkenswerte Bewegung im Klassenkampf. Auf dieser Grundlage gibt es kein entscheidendes Element, das es erlauben würde, die Idee zu bestätigen, wonach die Kämpfe des Jahres 2003 tatsächlich einen Wendepunkt in der Entwicklung des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen darstellen. Insofern kann die Überzeugung, dass unsere Analyse richtig ist, nicht auf der Beobachtung der Situation der Arbeiterkämpfe im Laufe des letzten Jahres beruhen, sondern muss auf der Untersuchung aller Elemente der historischen Situation fussen, die die gegenwärtige Phase des Klassenkampfs kennzeichnen. Eine solche Untersuchung beruht darauf, dass man sich den Rahmen der Analyse vergegenwärtigt, den wir uns für die gegenwärtige historische Periode gegeben haben.
2) Im Rahmen dieser Resolution können wir notgedrungen nur in zusammengefasster Form die für die Lage des Klassenkampfes wesentlichen Elemente darlegen:
– Insgesamt ist die Weltlage seit dem Ende der 1960er-Jahre durch das Ende der Konterrevolution gekennzeichnet, die im Laufe der 1920er-Jahre auf das Proletariat niedergegangen war. Das historische Wiederaufflammen der Kämpfe, das insbesondere durch den Generalstreik im Mai 1968 in Frankreich, den „heissen Herbst“ von 1969 in Italien, den „Cordobazo“ in Argentinien im gleichen Jahr, die Streiks im Winter 1970–71 in Polen usw. gekennzeichnet war, eröffnete den Kurs in Richtung Klassenauseinandersetzungen: Trotz der Verschärfung der Wirtschaftskrise war die Bourgeoisie nicht imstande. ihre „traditionelle“ Antwort zu geben, d.h. einen Weltkrieg auszulösen, da die ausgebeutete Klasse aufgehört hatte, unter den Fahnen ihrer Ausbeuter zu marschieren.
– Dieser historische Kurs hin zu Klassenkonfrontationen, und nicht Richtung Weltkrieg, hat sich insofern gehalten, als das Proletariat weder eine direkte noch eine tiefe ideologische Niederlage erlitten hat, die es für die Sache der Bourgeoisie, z.B. für die Demokratie oder den Antifaschismus, mobilisiert hätte.
– Aber diese historische Wiederaufnahme der Kämpfe ist insbesondere während der 1980er-Jahre auf eine ganze Reihe von Schwierigkeiten gestossen, die einerseits durch die von der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse inszenierten Manöver, andererseits aber auch durch den organischen Bruch verursacht wurden, den die kommunistische Avantgarde aufgrund der Konterrevolution erlitt (keine bzw. verspätete Entstehung der Klassenpartei, mangelnde Politisierung der Kämpfe). Einer der wachsenden Faktoren bei den Schwierigkeiten, die die Arbeiterklasse betreffen, ist die Zuspitzung des Zerfalls der todkranken kapitalistischen Gesellschaft.
– Gerade der spektakulärste Ausdruck dieses Zerfalls, nämlich der Zusammenbruch der so genannten „sozialistischen“ Regimes und des Ostblocks Ende der 1980er-Jahre, markierte den Beginn eines bedeutenden Rückgangs des Bewusstseins in der ganzen Klasse aufgrund des Einflusses der dadurch ermöglichten Kampagnen über den „Tod des Kommunismus“.
– Dieser Rückzug der Klasse wurde Anfang der 1990er-Jahre noch durch eine ganze Reihe von Ereignissen vertieft, die das Gefühl der Machtlosigkeit der Arbeiterklasse auf die Spitze trieben:
– die Krise und der Krieg am Persischen Golf 1990–91;
– der Krieg in Jugoslawien seit 1991;
– die zahlreichen anderen Kriege und Massaker in vielen anderen Gegenden der Welt (Kosovo, Ruanda, Timor, etc.), die meist mit Beteiligung der Grossmächte unter der Losung der „humanitären Prinzipien“ stattfanden.
– Der massive Einsatz humanitärer Themen(wie zum Beispiel 1999 im Kosovo), bei denen die grausamsten Ausdrücke des Zerfalls (wie „die ethnische Säuberung“) ausgenutzt wurden, stellte einen zusätzlichen Faktor der Verunsicherung der Arbeiterklasse dar, insbesondere in den fortgeschrittenen Ländern, wo die Klasse aufgefordert wurde, ihren Regierungen für die militärischen Abenteuer Beifall zu spenden.
– Die Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten haben es der Bourgeoisie der fortgeschrittenen Länder erlaubt, eine weitere Ladung an Mystifikationen über das Thema der „terroristischen Bedrohung“, des „notwendigen Kampfes“ gegen diese Bedrohung zu verbreiten – eine Mystifikation, die es insbesondere ermöglichte, den Krieg in Afghanistan Ende 2001 und den Krieg im Irak von 2003 zu rechtfertigen.
– Abgesehen davon erhielt die Wirtschaftskrise, deren unvermeidliche Verschärfung nach 1989 eine Arznei gegen das Gift der Kampagnen über den „Bankrott des Kommunismus“ und die „Überlegenheit des liberalen Kapitalismus“ hätte sein können, im Laufe der 1990er-Jahre einen Aufschub (der sich in einem gewissen Rückgang der Arbeitslosigkeit niederschlug); so hielten sich die Illusionen, die durch diese Kampagnen geschaffen wurden, während dieser Jahre auch mit der Unterstützung der Propaganda über die „Erfolgsgeschichten“ der asiatischen „Drachen“ und „Tiger“ und über die „Revolution der neuen Technologien“.
– Schliesslich zogen in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre in den meisten Ländern linke Parteien in die Regierungen ein, was einerseits durch den Rückgang des Bewusstseins und der Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse, andererseits durch die relative Beruhigung der Wirtschaftskrise ermöglicht wurde; dieser Einzug der Linken in die Regierung erlaubte es der herrschenden Klasse (und dies war das Hauptziel dieser Politik), eine Reihe von wirtschaftlichen Angriffen gegen die Arbeiterklasse zu richten, ohne dabei grössere Mobilisierungen derselben zu riskieren; solche Mobilisierungen sind eine der Bedingungen dafür, dass die Klasse das Selbstvertrauen zurückgewinnen kann.
3) Erst auf der Grundlage dieser Elemente in ihrer Gesamtheit kann man feststellen, dass es wirklich einen Wendepunkt im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen gibt. Man kann sich einen ersten Begriff davon machen, wenn man die unterschiedliche Situation während zweier Momente in einem derjenigen Länder vergleicht, die seit 1968 (aber auch schon während dem 19. Jahrhundert) so etwas wie ein „Labor“ des Klassenkampfes und der dagegen gerichteten Manöver der Bourgeoisie dargestellt haben: in Frankreich. Die beiden wichtigsten Momente waren einerseits die Kämpfe im Herbst 1995 insbesondere im Transportsektor gegen den „Juppé-Plan“ zur Reform der Sozialversicherung und andererseits die Streiks im Frühjahr 2003 im öffentlichen Dienst gegen die Rentenreform, die in diesem Bereich eine Erhöhung des Rentenalters und eine Rentenkürzung bedeutete.
Wie die IKS schon seinerzeit unterstrich, waren die Kämpfe von 1995 die Fortsetzung eines Manövers, das von den verschiedenen Teilen der Bourgeoisie ausgearbeitet worden war und ganz grundsätzlich darauf abzielte, den Ruf der Gewerkschaften in einer Zeit aufzuwerten, wo die wirtschaftliche Lage nicht unmittelbar zu heftigen Angriffen zwang, damit die Gewerkschaften in Zukunft die Kämpfe des Proletariats wirksamer kanalisieren und sabotieren können.
Demgegenüber waren die Streiks im Frühling 2003 die Reaktion auf einen massiven Angriff auf die Arbeiterklasse, der für die Bourgeoisie notwendig geworden war, um der kapitalistischen Krise entgegenzutreten. In diesen Kämpfen zielte die Intervention der Gewerkschaften nicht darauf ab, ihr Image aufzupolieren, sondern die Bewegung so stark wie möglich zu sabotieren und sicherzustellen, dass der Kampf in einer schmerzhaften Niederlage endete.
Trotz dieser Unterschiede gab es auch Merkmale, die den beiden Episoden des Klassenkampfes gemeinsam waren: Der Hauptangriff, der alle Branchen oder mindestens grosse Sektoren der Arbeiterklasse traf (1995 der „Juppé-Plan“ zur Reform der Sozialversicherung, 2003 die Rentenreform im öffentlichen Dienst), wurde von einem spezifischen Angriff auf einen bestimmten Sektor begleitet (1995 die Reform der Altersrenten der Eisenbahner, 2003 die „Dezentralisierung“ eines Teils des Personals im Unterrichtswesen). Diese spezifisch angegriffenen Sektoren traten aufgrund ihrer gesteigerten und breiteren Kampfbereitschaft als Speerspitze der Bewegung auf. Nach einigen Streikwochen wurden diesen spezifischen Sektoren „Zugeständnisse“ gemacht, die die betroffenen Sektoren dazu bewegten, die Arbeit wieder aufzunehmen, was schliesslich einen allgemeinen Streikabbruch begünstigte, da ja die „Avantgarde“ selbst den Kampf aufgegeben hatte. Im Dezember 1995 führte die Rücknahme der Reform der Altersrenten der Eisenbahner zum Abbruch der Bewegung; 2003 trug der „Rückzug“ der Regierung bei den „Dezentralisierungs“-Massnahmen gegenüber bestimmten Teilen des Personals des Erziehungswesens zur Wiederaufnahme der Arbeit im Ausbildungssektor bei.
Doch traf die Wiederaufnahme der Arbeit in den beiden Episoden beileibe nicht auf die gleiche Stimmung:
– Im Dezember 1995 herrschte ein „Siegesgefühl“ vor, obgleich die Regierung am „Juppé-Plan“ festhielt (der zudem die Unterstützung einer der wichtigsten Gewerkschaften, der CFDT, erhalten hatte). Wenigstens in einem Punkt, bei den Altersrenten der Eisenbahner, musste die Regierung schlicht und einfach ihren Plan aufgeben;
– Ende Frühjahr 2003 hingegen wurden die wenigen Zugeständnisse, die hinsichtlich des Status bestimmter Kategorien des Personals im Unterrichtswesen gemacht wurden, keineswegs als Sieg empfunden (dies um so weniger, als die Hauptmasse, die Lehrer, von den Massnahmen und somit auch von deren Rücknahme überhaupt nicht betroffen waren), sondern als Ernüchterung angesichts der Tatsache, dass die Regierung nur gerade so viel nachgeben wollte; und das Gefühl der Niederlage wurde zusätzlich durch die Ankündigung der Behörden verstärkt, dass die Streiktage im Gegensatz zum bisherigen Brauch im öffentlichen Dienst vollumfänglich vom Lohn abgezogen sollten.
Wenn man versucht, eine Gesamtbilanz über diese beiden Episoden des Klassenkampfes zu ziehen, kann man die folgenden Punkte hervheben:
– 1995 begünstigt das in der Arbeiterklasse weitverbreitete Gefühl des Sieges die Erneuerung der Glaubwürdigkeit der Gewerkschaften merklich. (Dieses Phänomen betrifft nicht allein Frankreich, sondern die meisten europäischen Länder, hauptsächlich Belgien und Deutschland, wo man ähnliche bürgerliche Manöver wie jenes in Frankreich erleben konnte. Wir haben in der Presse darauf hingewiesen.)
– 2003 führt das starke Gefühl der Niederlage in den Frühlingstreiks (in Frankreich, aber ebenso in anderen Ländern wie in Österreich) zu keiner grösseren Diskreditierung der Gewerkschaften, denen es gelungen war, eine Entlarvung zu vermeiden, und die in gewissen Fällen sogar als „kämpferischer als die Basis“ erschienen. Dennoch kündigt dieses Gefühl der Niederlage den Beginn eines Prozesses an, in dem die Gewerkschaften Federn lassen müssen, in dem die Vervielfachung ihrer Manöver es erlauben wird aufzuzeigen, dass unter ihrer Führung der Kampf immer in einer Niederlage enden wird und dass ihr Spiel genau darauf abzielt.
In diesem Sinn sind die Perspektiven für die Entwicklung der Kämpfe und des Bewusstseins des Proletariats nach 2003 viel besser als nach 1995, und zwar aus folgenden Gründen:
– Das Schlimmste für die Arbeiterklasse ist nicht eine offene Niederlage, sondern das Gefühl eines Scheinsieges nach einer reellen Niederlage. Das Gefühl eines solchen „Sieges“ (gegen den Faschismus und für die Verteidigung des „sozialistischen Vaterlandes“) bildete das wirksamste Mittel, um das Proletariat während vier Jahrzehnten Mitte des 20. Jahrhunderts in die Konterrevolution zu versenken.
– Die Gewerkschaften als Hauptkontrollinstrument der Arbeiterklasse und als Sabotagemittel ihrer Kämpfe sind in eine Schwächephase geraten.
4) Auch wenn man die Existenz eines Wendepunktes in den Kämpfen und im Bewusstsein der Arbeiterklasse empirisch durch die einfache Überprüfung der Unterschiede zwischen der Situation 2003 und 1995 feststellen kann, stellt sich dennoch die Frage, weshalb dieser Wendepunkt jetzt eintritt und nicht beispielsweise schon vor fünf Jahren eingetreten ist.
Darauf kann man zunächst eine einfache Antwort geben: Es sind die gleichen Gründe, die dafür verantwortlichen sind, dass die Antiglobalisierungsbewegung vor knapp fünf Jahren entstanden war und heute bereits zu einer wahrhaften Institution geworden ist, deren Kundgebungen Hunderttausende mobilisieren und die Aufmerksamkeit aller Medien auf sich ziehen.
Konkreter und präziser kann man als Antwort folgende Elemente benennen:
– Nach der enormen Auswirkung der Kampagne über den „Tod des Kommunismus“ seit Ende der 80er-Jahre musste eine gewisse Zeit, eigentlich ein ganzes Jahrzehnt, vergehen, bis sich der Nebel, die Verwirrung aufgrund dieser Kampagnen verflüchtigte, der Einfluss ihrer „Argumente“ nachliess. Diese Kampagnen waren um so erfolgreicher, als der innere Zusammenbruch dieser Regimes, die sich selbst über ein halbes Jahrhundert hinweg als „sozialistisch“, „proletarisch“ und „antikapitalistisch“ präsentiert haben (und auch so dargestellt wurden), ein enorm wichtiges Ereignis war. Das Weltproletariat benötigte vierzig Jahre, um aus der Konterrevolution herauszufinden, es wird ein gutes Viertel dieser Zeit benötigen, um sich von den Schlägen durch den Tod der Speerspitze eben dieser Konterrevolution, des Stalinismus, zu erholen, dessen „stinkender Kadaver noch immer die Umwelt vergiftet“ (wie wir bereits 1989 geschrieben haben).
– Vor allem die von Bush senior verkündete Idee, dass der Zusammenbruch der „sozialistischen“ Regimes und des Ostblocks die Errichtung einer neuen Weltordnung erlauben würde, musste erst vollständig ad absurdum geführt werden. Dies begann bereits auf brutale Weise mit der Golfkrise und dem anschliessenden Krieg 1990/91, setzte sich dann mit dem Krieg in Jugoslawien fort, der mit der Offensive im Kosovo bis 1999 dauerte. Darauf folgten die Attentate vom 11. September und jetzt der Krieg im Irak, während sich die Situation in Israel-Palästina unaufhörlich verschlechtert. Tagtäglich wird offensichtlicher, dass die herrschende Klasse nicht mehr in der Lage ist, sowohl ihren eigenen imperialistischen Zusammenstössen als auch dem globalen Chaos und der Wirtschaftskrise ein Ende zu bereiten.
– Gerade die letzte Periode und insbesondere der Beginn des 21. Jahrhunderts haben nach den Illusionen der 90er-Jahre über den „Aufschwung“, die „Drachenstaaten“ und die „Revolution der neuen Technologien„ wieder die Wirtschaftskrise des Kapitalismus auf die Tagesordnung gesetzt. Gleichzeitig hat dieser neue Schritt in die Krise die herrschende Klasse zur Intensivierung der ökonomischen Angriffe gegen die Arbeiterklasse, zur Generalisierung der Attacken gezwungen.
– Indessen haben die Gewalt und der immer systematischere Charakter der Angriffe gegen die Arbeiterklasse bisher zu keiner massiven oder spektakulären Antwort geführt. Nicht einmal eine Antwort im Ausmass vergleichbar zu 2003 ist erzielt worden. Weshalb also hat sich - in anderen Worten – der „Wendepunkt“ 2003 nicht in der Form einer ansteigenden Kurve oder in Gestalt einer Explosion von Kämpfen manifestiert (wie beispielsweise 1968 und in den folgenden Jahren)?
5) Auf diese Frage muss man auf verschiedenen Ebenen antworten.
An erster Stelle hat sich, wie wir bereits aufgezeigt haben, der historische Wiederaufschwung der Arbeiterklasse sehr langsam vollzogen: So lagen zwischen den ersten grossen Ereignissen dieses historischen Wiederaufschwungs, nämlich dem Generalstreik im Mai 1968 in Frankreich, und seinem Kulminationspunkt, den Streiks im Sommer 1980 in Polen, mehr als 12 Jahre. Ebenso vergingen zwischen dem Fall der Mauer in Berlin im November 1989 und den Streiks vom Frühling 2003 dreizehneinhalb Jahre, d.h. mehr als zwischen dem Beginn der ersten Revolution in Russland im Januar 1905 und der Oktoberrevolution 1917.
Die IKS hat bereits die Ursachen dieser Langsamkeit analysiert, mit der diese Entwicklung im Vergleich mit derjenigen vor der Revolution 1917 vor sich ging: Heute geht der Klassenkampf von der Wirtschaftskrise des Kapitalismus aus und nicht vom imperialistischen Krieg. Die Bourgeoisie ist in der Lage – das hat sie immer wieder bewiesen – den Rhythmus dieser Krise zu verlangsamen.
Die IKS hat auch andere Faktoren aufgezeigt, die für das langsame Entwicklungstempo der Kämpfe und des Bewusstseins des Proletariats verantwortlich sind. Es handelt sich um Faktoren im Zusammenhang mit dem durch die Konterrevolution verursachten organischen Bruch (weshalb auch die Bildung der Partei in Verspätung begriffen ist) und um den Zerfall des Kapitalismus, insbesondere die Tendenzen zur Hoffnungslosigkeit, zum Eskapismus und zum Rückzug, die alle das Proletariat betreffen.
Um die Langsamkeit dieses Prozesses zu verstehen, muss man übrigens auch die Auswirkungen der Krise selbst in Rechnung stellen: Sie äussert sich durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit, die einen wichtigen Lähmungsfaktor für die Arbeiterklasse darstellt. Das ist insbesondere bei den neuen Generationen der Fall, die zwar traditionellerweise die kämpferischste ist, die aber heute oft in die Arbeitslosigkeit gestürzt wird, bevor sie überhaupt die Erfahrung der assoziierten Arbeit und der Solidarität unter den Arbeitern hat machen können. Heute werden immer mehr Massenentlassungen vorgenommen, die eine Explosivkraft enthalten, auch wenn sie sich in den Fällen von Unternehmungsschliessungen nur schwer in der klassischen Form des Streiks ausdrücken kann, der in solchen Fällen unwirksam wäre. Aber während heute die Arbeitslosigkeit ansteigt, weil Pensionierte üblicherweise ganz einfach nicht mehr ersetzt werden, sind Arbeiter, die erst gar keine Stelle finden, oft orientierungslos.
Die IKS hat des öfteren darauf hingewiesen, dass der unausweichliche Anstieg der Arbeitslosigkeit eines der beweiskräftigsten Elemente des definitiven Bankrotts der kapitalistischen Produktionsweise darstellt, denn die wichtigste historische Funktion dieser Produktionsweise
war die weltweite und massive Ausbreitung der Lohnarbeit. Auf unmittelbarer Ebene aber ist die Arbeitslosigkeit hauptsächlich ein Faktor
der Demoralisierung der Arbeiterklasse und der
Lähmung ihrer Kämpfe. Erst in einer fortgeschritteneren Etappe der Klassenbewegung kann der subversive Charakter dieses Phänomens ein Entwicklungsfaktor des Kampfes und des Bewusstseins werden. Das wird der Fall sein, wenn sich die Perspektive der Überwindung des Kapitalismus wieder in den Reihen der Arbeiterklasse verbreitet, wenn auch noch nicht auf massive, so zumindest auf bedeutsame Weise.
6) Gerade hier liegt ein Grund für den langsamen Entwicklungsrhythmus der Arbeiterkämpfe heute, für die relativ schwache Antwort der Arbeiter auf die zunehmenden Angriffe des Kapitalismus: Es existiert heute ein noch sehr konfuses Gefühl – das in Zukunft aber noch entwicklungsfähig ist – dass es für die Widersprüche des Kapitalismus heute keine Lösung gibt, sei es auf wirtschaftlicher Ebene oder auf den anderen Ebenen seiner historischen Krise wie die permanenten kriegerischen Zusammenstösse, das zunehmende Chaos und die Barbarei, die jeden Tag klarer ihren unüberwindbaren Charakter aufzeigen.
Das Zurückschrecken des Proletariats vor der Ungeheuerlichkeit seiner Aufgaben haben bereits Marx und der Marxismus Mitte des 19. Jahrhunderts aufgezeigt.[1] Dieses Phänomen erklärt teilweise das Paradoxon der gegenwärtigen Situation: Einerseits haben die Kämpfe Mühe, sich trotz des Ausmasses der gegenwärtigen Angriffe gegen die Arbeiterklasse auszubreiten; andererseits sieht man in der Klasse bereits die Entwicklung einer tiefgreifenden Reflexion, obwohl sie gegenwärtig noch weitgehend unterirdisch stattfindet, wovon ein Ausdruck, der sich hartnäckig hält, das Auftauchen einer ganzen Reihe von Elementen und Grup
Fußnoten:
1. s. Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in: MEW Bd. 8, S. 111ff.
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Internationale Revue - 2005
- 3890 Aufrufe
Internationale Revue 35
- 3072 Aufrufe
Anmerkungen zur Geschichte der imperialistischen Konflikte im Nahen Osten (Teil II)
- 2971 Aufrufe
Konflikt im Nahen Osten: Anmerkungen zur Geschichte der imperialistischen Konflikte im Nahen Osten (Teil II)
Am Ende des ersten Teils dieser Artikelserie (Internationale Revue 34) haben wir gesehen, dass die Entwicklung des zionistischen Nationalismus und seine Manipulation durch die Briten im Kampf gegen ihre imperialistischen Rivalen um die Vorherrschaft im Nahen Osten am Ende des Ersten Weltkrieges einen neuen Faktor der Destabilisierung in dieser Region darstellten.
In diesem Artikel beabsichtigen wir zu untersuchen, wie es dazu kam, dass der arabische und der zionistische Nationalismus eine zunehmend wichtige Rolle im Nahen Osten spielten, beide als Faustpfand im komplexen Kräfteverhältnis zwischen den imperialistischen Grossmächten und als Bedrohung der Arbeiterklasse in der Phase nach der Russischen Revolution.
Der Zionismus als Mittel der Spaltung in der Arbeiterklasse
Die kapitalistische Klasse hat stets versucht, die ethnischen, kulturellen und religiösen Unterschiede in der Arbeiterklasse zu benutzen und gar zu verschärfen, "zu teilen und zu herrschen".
Es trifft durchaus zu, dass in den meisten Ländern der Kapitalismus in seiner aufsteigenden Phase fähig war, unterschiedliche ethnische und religiöse Gruppen durch die Proletarisierung ihrer Mitglieder gesellschaftlich zu integrieren. So wurden die rassischen, ethnischen und religiösen Spaltungen in der Bevölkerung wesentlich verringert. Aber der moderne Zionismus ist tief geprägt durch seine Entstehung am Ende dieser aufsteigenden Phase, als die Epoche der Nationalstaatenbildung zu Ende ging und es keinen "Lebensraum"1 für die Entstehung neuer Nationen gab, als das Überleben des Kapitalismus nur noch durch Krieg und Zerstörung möglich war.
Als 1897 der Erste Zionistenkongress in Basel die Forderung nach einem jüdischen Nationalterritorium erhob, lehnte der linke Flügel der Zweiten Internationalen die Bildung neuer territorialer Einheiten bereits ab.
1903 lehnte die SDRAP (Sozialdemokratische Russische Arbeiterpartei) die Existenz einer unabhängigen, separaten jüdischen Organisation in ihren Reihen ab und verlangte, dass sich diese Organisation – "Der Bund" (Allgemeiner Jüdischer Arbeiterverband in Litauen, Polen und Russland) – mit der russischen Territorialpartei verschmilzt. Der Zweite Kongress der RSDAP 1903 setzte die Frage des Bundes nicht nur als ersten Punkt, noch vor der Debatte über die Statuten, auf die Tagesordnung, sondern "wies jegliche Möglichkeit föderaler Beziehungen zwischen der RSDAP und dem Bund als prinzipiell unzulässig zurück". Der Bund seinerseits lehnte damals die Bildung einer "jüdischen nationalen Heimstatt" in Palästina ab.
Der linke Flügel der Zweiten Internationalen vor dem Ersten Weltkrieg wandte sich somit deutlich gegen die Bildung eines jüdischen Staates in Palästina.
Die Geburt des politischen Zionismus fiel mit dem Anstieg der jüdischen Einwanderung in den Nahen Osten und vor allem in Palästina zusammen. Die erste grosse jüdische Siedlerwelle kam nach den Pogromen und der Repression im zaristischen Russland 1882 in Palästina an; die zweite Flüchtlingswelle aus Osteuropa nach der Niederlage der revolutionären Kämpfe von 1905 in Russland. 1850 lebten 12'000 Juden in Palästina, 1882 35'000 und 1914 90'000.
Grossbritannien plante nun, die Zionisten als zuverlässige Verbündete gegen seine europäischen Widersacher, besonders Frankreich, und gegen die arabische Bourgeoisie einzusetzen. Grossbritannien befand sich in einer Position, die es ihm erlaubte, sowohl den Zionisten als auch der aufkommenden panarabischen Bourgeoisie Versprechungen zu machen, wobei es voll auf die Karte des "Teile und herrsche" setzte – eine Politik, die Grossbritannien bis zum Beginn des II. Weltkrieges erfolgreich praktizierte. Während des Ersten Weltkrieges wurde sowohl den Zionisten als auch den ersten panarabischen Nationalisten, als Belohnung für ihre Unterstützung Grossbritanniens im Krieg, der Erhalt Palästinas versprochen. Die Balfour-Deklaration von 1917 sicherte dies den Zionisten just in dem Moment zu, als T.E. Lawrence ("Lawrence von Arabien") vom britischen Auswärtigen Amt den arabischen Stammesführern dasselbe versprach, als Dank für die Inszenierung des arabischen Aufstands gegen das kollabierende Osmanische Reich.
Als Grossbritannien von Völkerbund 1922 das "Palästina-Mandat" erhielt, waren von 650'000 Einwohnern Palästinas 560'000 Muslime und Christen sowie 85'000 Juden. Die Zionisten versuchten nun, so schnell wie möglich die Zahl der jüdischen Ansiedler zu vergrössern, indem sie den Zustrom gemäss ihrer imperialistischen Ziele regulierten. Ein "Kolonialbüro" wurde eingerichtet, um die Ansiedlung der Juden in Palästina zu fördern.
Der Zionismus war aber nicht ausschliesslich ein Instrument der britischen Interessen im Nahen Osten: Er verfolgte auch sein eigenes kapitalistisches Expansionsprojekt, die Errichtung eines eigenen jüdischen Staates – ein Projekt, das im dekadenten Kapitalismus nur auf Kosten der regionalen Widersacher durchgesetzt werden kann und unvermeidlich mit Krieg und Zerstörung verknüpft ist.
Der moderne Zionismus ist also ein typischer Ausdruck der Dekadenz dieses Systems. Er ist eine Ideologie, die nicht ohne militärische Mittel verwirklicht werden kann. Mit anderen Worten: Ohne Krieg, ohne vollständige Militarisierung, ohne Ausgrenzung und ohne "Eindämmungspolitik" ist der Zionismus unmöglich.
Indem sie also die Bildung einer jüdischen Heimstatt unterstützten, haben die englischen "Beschützer" nichts anderes getan, als grünes Licht für die ethnische Säuberung, für die gewaltsame Deportation der ansässigen Bevölkerung zu geben. Diese Politik ist zur ständigen und weit verbreiteten Praxis in allen durch Krieg zerrissenen Ländern geworden. Sie ist zu einem klassischen Merkmal der Dekadenz geworden.2
Obwohl die Politik der ethnischen Säuberung und der Rassentrennung nicht auf das Gebiet des ehemaligen osmanischen Reiches beschränkt war, wurde diese Region dennoch zu einem Zentrum dieser mörderischen Praktiken. Der Balkan hat während des ganzen 20. Jahrhunderts unter der Folge von ethnischen Säuberungen und Massakern gelitten – alle durch die europäischen Mächte und die USA unterstützt und manipuliert. Die herrschende Klasse in der Türkei führte einen schrecklichen Völkermord an den Armeniern durch – das Blutbad, in dem 1'500'000 Armenier durch türkische Truppen getötet wurden, begann 1915 und ging nach dem Ersten Weltkrieg weiter. Im Krieg zwischen Griechenland und der Türkei (März 1921 bis Oktober 1922) wurden 1,3 Millionen Griechen aus der Türkei vertrieben und 450'000 Türken aus Griechenland.
Das zionistische Vorhaben, eine eigene territoriale Einheit zu schaffen, basierte notwendigerweise auf Rassentrennung, Teilung, Zwietracht, Deportation, kurz: auf militärischen Schrecken und Vernichtung – dies alles lange, bevor der zionistische Staat 1948 proklamiert wurde.
Der Zionismus ist eine besondere Form des Kolonialismus, die nicht auf der Ausbeutung der lokalen Arbeitskraft beruht, sondern auf deren Ausgrenzung und Vertreibung. Arabische Arbeiter sollten nicht Teil der "jüdischen Gemeinschaft" sein, sondern wurden auf der Grundlage der Parole "Jüdisches Öl, jüdische Arbeit, jüdische Waren!" rigoros ausgeschlossen.
Die Gesetze, die das britische Protektorat einführte, legten fest, dass die jüdischen Siedler ihr Land den arabischen Grundbesitzern abkauften. Die Besitzrechte waren vor allem in den Händen reicher arabischer Grundbesitzer, für die das Land hauptsächlich ein Spekulationsobjekt bedeutete. Darüber hinaus akzeptierten sie es, die palästinensischen Tagelöhner und Pachtbauern zu vertreiben, wenn dies die neuen Besitzer wünschten. So haben viele Bauern und Landwirtschaftsarbeiter sowohl ihr Land als auch ihre Arbeit verloren. Die Errichtung jüdischer Siedlungen bedeutete nicht nur ihre Vertreibung aus dem Land, sondern auch ihr Sturz in noch grösseres Elend.
Die Zionisten untersagten den Weiterverkauf des Landes an Nicht-Juden, wenn jüdische Siedler es einmal gekauft hatten. Es war nicht nur eine Ware, ein Stück jüdischer Privatbesitz, sondern es war Teil des zionistischen Territoriums geworden, das wie eine Eroberung militärisch verteidigt werden musste.
In der Wirtschaft wurden die arabischen Arbeiter aus ihren Jobs gedrängt. Die zionistische Gewerkschaft Histadrut tat in enger Zusammenarbeit mit anderen zionistischen Organisationen alles, um die arabischen Arbeiter daran zu hindern, ihre Arbeitskraft den jüdischen Kapitalisten zu verkaufen. So wurden die palästinensischen Arbeiter in die Kollision mit den jüdischen Einwanderern gedrängt, die ebenfalls Arbeit suchten.
Die Errichtung einer jüdischen Heimstatt, wie es das britische "Protektorat" versprochen hatte, bedeutete nichts anderes als andauernde militärische Konfrontationen zwischen den Zionisten und der arabischen Bourgeoisie – mit der Arbeiterklasse und den Bauern, die auf dieses blutige Terrain gezogen wurden.
Was war die Haltung der Kommunistischen Internationalen zur imperialistischen Situation im Nahen Osten und zur Bildung einer "jüdischen Heimstatt"?
Die Politik der Kommunistischen Internationalen: eine verhängnisvolle Sackgasse
Rosa Luxemburg hatte während des I. Weltkriegs festgestellt: "In der Epoche dieses entfesselten Imperialismus kann es keine nationalen Kriege mehr geben. Die nationalen Interessen sind nur eine Verschleierung mit dem Ziel, die arbeitenden Volksmassen in den Dienst ihres Todfeindes zu stellen: des Imperialismus". (Junius-Broschüre, Entwurf vom Spartakusbund, im Januar 1916 angenommen.)
Als die russischen Arbeiter im Oktober 1917 die Macht ergriffen hatten, versuchten die Bolschewiki, den Druck, den die Bourgeoisie mit ihren Weissen Armeen auf die Arbeiterklasse ausübten, zu verringern und die Unterstützung der "schuftenden Massen" der Nachbarländer mit der Parole der "nationalen Selbstbestimmung" zu gewinnen – eine Position der SDRAP, die von der Strömung um Rosa Luxemburg bereits vor dem I. Weltkrieg kritisiert wurde (s. die Artikel in Internationalen Review 34, 37, 42, engl., franz. und span. Ausgabe). Anstatt den Druck der Bourgeoisie zu schwächen und die "schuftenden Massen" hinter sich zu scharen, hatte die bolschewistische Politik eine gegenteilige, verhängnisvolle Wirkung. Rosa Luxemburg schreibt in ihrer Broschüre Zur russischen Revolution: "Während Lenin und Genossen offenbar erwarteten, dass sie als Verfechter der nationalen Freiheit ‚bis zur staatlichen Absonderung Finnlands, die Ukraine, Polen, Litauen, die Baltenländer, die Kaukasier usw. zu ebenso vielen treuen Verbündeten der russischen Revolution machen würden, erlebten wir das umgekehrte Schauspiel: Eine nach der anderen von diesen ‚Nationen‘ benutzte die frische geschenkte Freiheit dazu, sich als Todfeindin der russischen Revolution gegen sie mit dem deutschen Imperialismus zu verbünden und unter seinem Schutze die Fahne der Konterrevolution nach Russland selbst zu tragen (…). Statt die Proletarier in den Randländern vor jeglichen Separatismus als rein bürgerlichen Fallstrick zu warnen und die separatistischen Bestrebungen mit eiserner Hand, deren Gebrauch in diesem Falle wahrhaft im Sinne und Geist der proletarischen Diktatur lag, im Keime zu ersticken, haben sie vielmehr die Massen in allen Randländern durch ihre Parole verwirrt und der Demagogie der bürgerlichen Klassen ausgeliefert. Sie haben durch diese Förderung des Nationalismus den Zerfall Russlands selbst herbeigeführt, vorbereitet und so den eigenen Feinden das Messer in die Hand gedrückt, das sie der russischen Revolution ins Herz stossen sollten." (Zur russischen Revolution, Dietz Verlag Berlin 1979)
Als die revolutionäre Welle zurückzuweichen begann, begann der Zweite Kongress der Kommunistischen Internationale im Juli 1920 eine opportunistische Position zur nationalen Frage zu entwickeln, in der Hoffnung, die Unterstützung der Arbeiter und Bauern in den Kolonialländern zu gewinnen. Die Unterstützung angeblich "revolutionärer" Bewegungen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht "bedingungslos", sondern folgte gewissen Kriterien. Punkt 11 der "Thesen über die nationale Frage", die vom Kongress verabschiedet wurden, unterstreicht: "Es ist notwendig, die Bestrebungen der Unabhängigkeitsbewegungen, die in Tat und Wahrheit weder kommunistisch noch revolutionär sind, energisch zu bekämpfen, um die kommunistischen Ansichten hervorzuheben: Die Kommunistische Internationale darf die revolutionären Bewegungen in den Kolonien und rückständigen Ländern nur unter der Bedingung unterstützen, dass die Elemente der reinsten und wahrhaftigsten kommunistischen Parteien gruppiert sind und sich über ihre vorrangigen Aufgaben im Klaren sind: Ihre Aufgabe, die bürgerliche und demokratische Bewegung zu bekämpfen. Die Kommunistische Internationale muss dabei zeitlich begrenzte Beziehungen eingehen und auch Bündnisse mit den revolutionären Bewegungen in den Kolonien und rückständigen Ländern eingehen, dies allerdings ohne jemals mit ihnen zu fusionieren und indem sie immer den unabhängigen Charakter der proletarischen Bewegung – sogar in ihrer embryonalen Form – bewahren".
Punkt 12 der Thesen fährt fort: "Es ist notwendig, den arbeitenden Massen aller Länder und vor allem der rückständigen Länder und Nationen, unermüdlich den von den imperialistischen Mächten mit Hilfe der herrschenden Klassen in den unterdrückten Ländern aufgezogenen Schwindel zu enthüllen. Sie tun, als ob sie die Existenz politische unabhängiger Staaten unterstützen – die in Tat und Wahrheit ökonomisch und militärisch Vasallen sind. Ein schlagendes Beispiel für diesen Schwindel (…) ist die Angelegenheit der Zionisten in Palästina (…). Bei der gegenwärtigen internationalen Sachlage gibt es kein Wohl für die schwachen und unterdrückten Völker ausserhalb der Union der sowjetischen Republiken".
Als aber die Isolierung der Russischen Revolution wuchs und die Komintern3 und die bolschewistische Partei immer opportunistischer wurden, wurden die anfänglichen Kriterien für die Unterstützung bestimmter "revolutionärer Bewegungen" fallen gelassen. Auf ihrem 4. Kongress im November 1922 führte die Internationale die katastrophale Politik der "Einheitsfront" ein, wobei sie darauf bestand: "Die grundlegende gemeinsame Aufgabe aller national-revolutionären Bewegungen besteht darin, die nationale Einheit und die politische Autonomie zu verwirklichen". ("Allgemeine Thesen über die Frage des Orients", Faksimile, Maspero). Während die Kommunistische Linke, vor allem die Gruppe um Bordiga, einen erbitterten Kampf gegen die Politik der "Einheitsfront" führte, erklärte die Kommunistische Internationale: "Die Weigerung der Kommunisten in den Kolonien, sich am Kampf gegen die imperialistische Unterdrückung zu beteiligen, und dies unter dem Vorwand der alleinigen ‚Verteidigung‘ der Klasseninteressen, ist Ausdruck des übelsten Opportunismus, der die proletarische Revolution im Orient nur in Verruf bringen kann".(idem).
Doch es war die Internationale, die dem Opportunismus verfiel. Dieser opportunistische Kurs wurde bereits im September 1920 in Baku auf dem Kongress der Völker des Orients sichtbar, kurz nach dem Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationalen. Der Kongress von Baku richtete sich vor allem an die nationalen Minderheiten in den Nachbarländern der belagerten Sowjetrepublik, wo der britische Imperialismus damit drohte, seinen Einfluss auszuweiten und damit neue Sprungbretter für bewaffnete Interventionen gegen Russland zu schaffen.
"Als Folge eines ungeheuren und barbarischen Blutbades erschien der britische Imperialismus als alleiniger, allmächtiger Herrscher Europas und Asiens" ("Manifest" des Kongresses der Völker des Orients). Indem sie von der falschen Voraussetzung ausging, dass "der britische Imperialismus, indem er alle Widersacher geschwächt und geschlagen hat, allmächtiger Beherrscher Europas und Asiens geworden ist", unterschätzte die Kommunistische Internationale die neue Ebene der imperialistischen Rivalitäten, die durch den Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz entfesselt wurden.
Hatte nicht der Erste Weltkrieg gezeigt, dass alle Länder, ob gross oder klein, imperialistisch geworden waren? Der Kongress von Baku konzentrierte sich stattdessen ausschliesslich auf den britischen Imperialismus: "Grossbritannien, letzte imperialistische Vormacht Europas, hat seine schwarzen Schwingen über den islamischen Ländern des Orients ausgebreitet, es versucht, die Völker des Orients zu unterwerfen, um sie zu versklaven und daraus Beute zu schlagen. Sklaverei! Schreckliche Sklaverei, Verfall, Unterdrückung und Ausbeutung, das bringt Grossbritannien den Völkern des Orients. Verteidigt Euch, Völker des Orients! (…) Bereitet Euch vor für den Kampf gegen den gemeinsamen Feind, den britischen Imperialismus!" (idem).
Die Politik der Unterstützung der "national-revolutionären" Bewegungen und der Appell an eine "anti-imperialistische Front" bedeutete konkret, dass Russland und die bolschewistische Partei, die zunehmend vom russischen Staat vereinnahmt wurde, Bündnisse mit nationalistischen Bewegungen eingingen.
Schon 1920 drängte Kemal Atatürk4 Russland dazu, eine anti-imperialistische Front mit der Türkei zu bilden. Kurz nach der Niederwerfung des Kronstädter Arbeiteraufstandes im März 1921 und dem Beginn des Krieges zwischen Griechenland und der Türkei unterzeichnete Moskau ein Freundschaftsabkommen zwischen Russland und der Türkei. Nach wiederholten Kriegen unterstützte zum ersten Mal eine russische Regierung die Existenz der Türkei als Nationalstaat.
Die Arbeiter und Bauern Palästinas wurden ebenfalls in die Sackgasse des Nationalismus gestossen: "Wir betrachten die nationalistische arabische Bewegung als eine wichtige Kraft, die den englischen Kolonialismus bekämpft. Es ist unsere Pflicht, alles zur Unterstützung dieser Bewegung in ihrem Kampf gegen den Kolonialismus zu tun".
Die Kommunistische Partei Palästinas, gegründet 1922, rief zur Unterstützung des Muftis Hafti Amin Hussein auf. 1922 war Letzterer zum Mufti Jerusalems und Präsidenten des obersten islamischen Rates geworden: Er war einer derjenigen gewesen, die am lautesten die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates forderten.
Ob 1922 in der Türkei, in Persien oder 1927 in China – diese Politik der Kommunistischen Internationalen war verheerend für die Arbeiterklasse. Wegen ihrer Unterstützung der lokalen Bourgeoisien drängte die Komintern die Arbeiter in die blutigen Arme einer sich selbst als "fortschrittlich" gerierenden Bourgeoisie. Dass Ausmass der Ablehnung des proletarischen Internationalismus‘ zeigt sich in einem Aufruf der Kommunistischen Internationalen von 1931, die damals zu einem Werkzeug des russischen Stalinismus geworden war: "Wir rufen alle Kommunisten auf, einen Kampf um nationale Unabhängigkeit und nationale Einheit zu führen, nicht nur innerhalb der engen Grenzen, die der Imperialismus und die Interessen der herrschenden Familienclans eines jeglichen arabischen Landes willkürlich geschaffen haben, sondern diesen Kampf für die Einheit des gesamten Orients auf breiter panarabischer Front zu führen."
Der Kampf innerhalb der Kommunistischen Internationalen zwischen den opportunistischen Konzessionen gegenüber den "nationalen Befreiungsbewegungen" und der Verteidigung des proletarischen Internationalismus wird an der Opposition verschiedener jüdischer Delegationen zum Kongress von Baku ersichtlich.
Eine "Delegation der Bergjuden" konnte noch einen wahrhaften Widerspruch in Worten zum Ausdruck bringen, indem sie erklärte: "Nur der Sieg der Unterdrückten über die Unterdrücker führt uns zum heiligen Ziel: die Bildung einer kommunistischen jüdischen Gesellschaft in Palästina". Die Abordnung der kommunistischen jüdischen Partei (Poale Zion, vorher dem jüdischen Bund angegliedert) rief zur "Besiedlung und Kolonisierung Palästinas nach kommunistischen Prinzipien" auf.
Das Zentralbüro der jüdischen Sektionen der kommunistischen Partei Russlands widersetzte sich entschlossen den gefährlichen Illusionen über die Errichtung einer jüdischen kommunistischen Gemeinschaft in Palästina und der Art und Weise, wie die Zionisten das jüdische Projekt für ihre eigenen imperialistischen Interessen einsetzten. Gegen die Spaltung der jüdischen und arabischen Arbeiter unterstrich die jüdische Sektion der russischen kommunistischen Partei: "Unter Zuhilfenahme des zionistischen Lakaien des Imperialismus zielt die britische Politik darauf ab, einen Teil des jüdischen Proletariats vom Kommunismus wegzuziehen, indem in ihm nationalistische Gefühle und Sympathien für den Zionismus geweckt werden (…) Wir verurteilen auch scharf die Versuche gewisser linkssozialistischer jüdischer Gruppen, den Kommunismus mit dem Festhalten an der zionistischen Ideologie zu verbinden. Wir sehen dies im Programm der so genannten Jüdischen Kommunistischen Partei (Poale Zion). Wir glauben, dass es in den Reihen der Kämpfer für die Rechte und Interessen der Arbeiterklasse keinen Platz für Gruppen gibt, die den nationalistischen Hunger der jüdischen Bourgeoisie auf die eine oder andere Art hinter der Maske des Kommunismus verbergen, indem sie die zionistische Ideologie unterstützen. Sie benutzen kommunistische Parolen, um bürgerlichen Einfluss auf die Arbeiterklasse auszuüben. Wir stellen fest, dass in der gesamten Zeit, in der die jüdische Arbeiterbewegung existierte, die zionistische Ideologie dem jüdischen Proletariat fremd war (…) Wir erklären, dass die jüdischen Massen die einzige Möglichkeit für ihre sozioökonomische und kulturelle Entwicklung nicht in der Erschaffung eines ‚nationalen Zentrums‘ in Palästina sehen, sondern in der Errichtung der Diktatur des Proletariats und der Bildung von sozialistischen Sowjetrepubliken in den Ländern, in denen sie leben." (Kongress von Baku, September 1920, eigene Übersetzung).
Doch während die Spannungen zwischen den jüdischen Siedlern und den palästinensischen Arbeitern und Bauern zunahmen, führte der Niedergang der Kommunistischen Internationale, als sie sich dem russischen Staat unterwarf, zur Spaltung zwischen der zunehmend stalinistischen Kommunistischen Internationalen und der Kommunistischen Linken in der palästinensischen und in anderen Fragen. Während die Kommunistische Internationale die palästinensischen Arbeiter dazu drängte, "ihre eigene" Bourgeoisie gegen den Imperialismus zu unterstützen, verstand die Kommunistische Linke die Auswirkungen der englischen Politik des Teile und Herrsche und die verheerenden Folgen der Komintern-Position, die die Arbeiterklasse in eine Sackgasse führte: "Der englischen Bourgeoisie ist es gelungen, die Klassengegensätze zu verstecken. Die Araber sehen nur gelbe und weisse Rassen und betrachten die Juden als Schützlinge der weissen Rasse" (Proletarier, Mai 1925, Zeitschrift der Kommunistischen Arbeiterpartei Deuschlands, KAPD).
"Für den wahren Revolutionär gibt es natürlich keine ‚Palästinafrage‘, sondern nur den Kampf aller Ausgebeuteten des Nahen Ostens, arabische und jüdische Arbeiter inbegriffen, und dieser Kampf ist Teil des allgemeinen Kampfes aller Ausgebeuteten der ganzen Welt für die kommunistische Revolution" (Bilan, Nr. 31, 1936, Bulletin der italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken).5
(Fortsetzung folgt)
D.
Fußnoten:
1 Der "Lebensraum" war eine Rechtfertigung Hitlers für die Expansion der "arischen Rasse" im Osten, der von slawischen "Untermenschen" besiedelt war.
2 Folgt man der Logik der ethnischen Säuberung, müssten Deutsche und Kelten Europa verlassen und nach Indien und Zentralasien zurückkehren, wo sie einst herkamen; die Lateinamerikaner spanischer Herkunft müssten zur iberischen Halbinsel zurückgeschickt werden. Diese absurde Logik kennt keine Grenzen: Die Südamerikaner müssten alle Südamerikaner europäischer oder anderer Herkunft verjagen, die Nordamerikaner alle afrikanischen Sklaven deportieren, nicht zu reden von sämtlichen europäischen Bevölkerungsgruppen, die im 19. Jahrhundert einwanderten. Wir müssten uns in der Tat fragen, ob nicht die ganze menschliche Spezies zur afrikanischen Wiege zurückkehren sollte, von wo sie einst ihre Emigration begann…?
Seit dem 2. Weltkrieg gab es eine unaufhörliche Folge von Vertreibungen: Drei Millionen Deutsche wurden aus der ehemaligen tschechischen Republik vertrieben; der Balkan war ständiger Schauplatz ethnischer Säuberungen; die Spaltung von Indien und Pakistan 1947 führte zur grössten Vertreibung aller Zeiten, und zwar in beide Richtungen; in den 1990er-Jahren lieferte Ruanda mit den Massakern zwischen Hutus und Tutsis ein besonders blutiges Beispiel: Binnen drei Monate wurden zwischen 300'000 und einer Million Menschen massakriert.
3 d.h. die Kommunistische Internationale.
4 Kemal Atatürk, geboren 1881 in Saloniki, militärischer Held im Ersten Weltkrieg nach seinem Erfolg gegen den alliierten Angriff auf Gallipoli 1915, organisierte 1919 die nationale republikanische türkische Partei und stürzte den letzten osmanischen Sultan. Später spielte er eine wichtige Rolle bei der Gründung der ersten türkischen Republik 1923 nach dem Krieg gegen Griechenland und blieb bis zu seinem Tod 1938 Präsident. Unter seiner Herrschaft zerschlug der türkische Staat die Macht der religiösen Schulen und unternahm ein umfassendes "Europäisierungsprogramm", einschliesslich der Ersetzung der arabischen durch die lateinische Schrift.
5 s. die zwei Arikel aus Bilan 30 und 31, Der Konflikt Juden/Araber: Die Position der Internationalisten in den 30er-Jahren, in: Revue Internationale Nr.31.
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Argentinien: Die Mystifikation der Piquetero-Bewegung
- 2795 Aufrufe
Wir veröffentlichen untenstehend Auszüge eines längeren Artikels der Genossen des Nucleo Comunista Internacional (NCI) aus Argentinien, der eine vertiefte Analyse der Piquetero-Bewegung macht, wobei er deren arbeiterfeindlichen Charakter und die Lügen der linken Gruppen aller Schattierungen anprangert, die "sich der Irreführung der Arbeiterklasse durch falsche Erwartungen gewidmet haben, um ihr glauben zu machen, dass die Ziele und Mittel der Piquetero-Bewegung dem Voranschreiten der eigenen Kämpfe dienen könne."
Diese Aufgabe der Irreführung, der Verfälschung von Ereignissen und der Behinderung des Proletariats daran, die wirklichen Lehren aus dieser Bewegung zu ziehen und sich somit gegen die Fallen des Klassenfeindes zu wappnen – eine Aufgabe, zu der die halb-anarchistische Gruppe GCI(1) einen unschätzbaren Beitrag liefert – wird von den Genossen des NCI deutlich entlarvt.
Nucleo Comunista Internacional:
Der bürgerliche Ursprung und Charakter der Piquetero-Bewegung
Allgemein herrscht die Ansicht vor, dass viele Arbeitslosenorganisationen ihren Ursprung in der Armut, der Arbeitslosigkeit und im Hunger haben, die sich im Laufe der letzten fünf oder sechs Jahre in den grossen Slums von Gross-Buenos Aires, Rosario, Cordoba etc. verschlimmert haben. Das ist nicht der Fall. Der Ursprung der Piquetero-Bewegung liegt in den so genannten "Manzaneras", die von der Gattin des damaligen Gouverneurs der Provinz Buenos Aires, Eduardo Duhalde, gelenkt wurden. Diese hatten eine doppelte Funktion: einerseits die soziale und politische Kontrolle sowie die Ermöglichung einer Mobilisierung ausgedehnter Schichten der verzweifelten Armen zur Unterstützung der von Duhalde repräsentierten bürgerlichen Fraktion und andererseits die Kontrolle über die Verteilung von Nahrungsmitteln an Arbeitslose (ein Ei und ein halber Liter Milch täglich), da es zu diesem Zeitpunkt noch keine Arbeitslosenprojekte, Hilfsprogramme usw. gab. Mit dem exponentiellen Wachstum der Arbeitslosigkeit und den damit einhergehenden Protesten verschwanden die Manzaneras jedoch von der Bühne. Es entstand ein Vakuum, das es zu füllen galt. Eine ganze Reihe von Organisationen, vorwiegend dirigiert von der katholischen Kirche, linken politischen Strömungen usw., sprangen in die Lücke. Der Letzte, der auf der Bühne erschien, war die maoistische Revolutionäre Kommunistische Partei mit ihrer Coriente Clasista y Combativa (Klassenkämpferische Strömung); die Trotzkisten des Partido Obrero (PO) hatten ihren eigenen Apparat für die Arbeitslosen errichtet Polo Obrero (Arbeiterpol), gefolgt von anderen Strömungen.
Diese ersten Organisationen erhielten ihre Feuertaufe in Buenos Aires, bei den Massenblockaden der strategischen Route 3, die Buenos Aires mit Patagonien im äussersten Süden des Landes verbindet. Sie forderten mehr Arbeitslosenunterstützung: Gelder, die von den Konsultativräten kontrolliert und verwaltet werden sollten, in denen die Gemeinden, die Piqueteros, die Kirche, oder, um es anders auszudrücken, der bürgerliche Staat vertreten waren.
Die "Arbeitsprojekte" und die verschiedenen Beihilfen erlaubten es somit der Bourgeoisie, mit Hilfe der mannigfaltigen Piquetero-Organisationen, ob sie nun Peronisten, Trotzkisten, Guevaristen, Stalinisten oder Gewerkschafter der CTA(2) waren, soziale und politische Kontrolle über die Arbeitslosen auszuüben. Diese Organisationen begannen, in die von der Arbeitslosigkeit, dem Hunger und der Marginalisierung am stärksten betroffenen Arbeiterquartiere auszuschwärmen. Die Verbreitung dieser Strukturen wurde vor allem mit Geldern des bürgerlichen Staates ausgeführt. Sie verlangten nur zwei Dinge von den Arbeitslosen, damit diese in den Genuss der Beihilfen und Nahrungsmittelpakete (5 kg) kommen: sich hinter den Fahnen der Organisationen zu mobilisieren und an politischen Aktionen teilzunehmen, sofern diese Organisationen eine politische Struktur besassen, sowie für die Vorschläge der Gruppe zu stimmen, der sie "angehörten". All dies geschah unter der Androhung, das Anrecht auf ihre erbärmlichen Beihilfen von 150 Peso (50 Dollars) pro Monat zu streichen.
Jedoch endeten hier die Verpflichtungen der Arbeitslosen gegenüber der Bewegung keineswegs. Sie mussten eine ganze Reihe von weiteren Pflichten gegenüber den Arbeitslosenorganisationen erfüllen, wobei die Erfüllung dieser Verpflichtungen in einem Heft festgehalten wurde: Jene, die durch die Teilnahme an Treffen und Demonstrationen sowie durch die Zustimmung zu den offiziellen Positionen die höchste Punktzahl erzielten, behielten ihre Beihilfen, während jene, die den offiziellen Positionen nicht zustimmten, Punkte verloren oder eventuell das Recht verwirkten, an den Projekten teilzunehmen. Darüber hinaus nehmen diese Organisationen den Arbeitslosen unter dem Vorwand von "Beiträgen" eine fixe Geldsumme ab. Dieses Geld wird zur Bezahlung der Offiziellen dieser Organisationen, zur Bezahlung von Lokalmieten (Versammlungsräume) benutzt, die von den Arbeitslosenorganisationen und den politischen Gruppen, von denen sie abhängen, gebraucht werden. Die Übergabe dieser Beiträge ist obligatorisch: Eigens zu diesem Zweck begleiten so genannte "Schiedsrichter" eines jeden Bezirkslokals der vielfältigen Arbeitslosenorganisationen die Arbeitslosen zur Bank, wo sie sofort nach Erhalt ihrer Unterstützung den Beitrag übergeben müssen.
Vor den Klassen übergreifenden Ereignissen vom 19. und 20. Dezember 2001 wurde die so genannte Piquetero-Versammlung vom trotzkistischen Polo Obrero, von der maoistischen Coriente Clasista y Combativa und von der Federacion de Tierra y Vivienda (Unterkunft und Wohnungswesen) dominiert.
Die Positionen, die von diesen und den folgenden Versammlungen angenommen wurden, demonstrieren klar das Wesen der diversen Piquetero-Gruppen als Apparate im Dienst des bürgerlichen Staates. Auch der Bruch zwischen dem Polo Obrero und den beiden anderen Strömungen, der zur Bildung des Bloque Piquetero führte, hat nichts an diesem Wesen verändert.
Der Partido Obrero sagt, dass das Ziel der Arbeitslosen oder des "Piquetero-Subjekts", wie der Partido Obrero es gerne in ihrer Monatszeitschrift Prensa Obreara nennt, es sei, die Piquetero-Bewegung in eine Bewegung der Massen zu verwandeln, wobei sie unter Letzteren die Massen der Arbeitslosen, der aktiven Arbeiter und aller Mittelschichten, die in die Arbeiterklasse und zu den Besitzlosen geworfen wurden, verstanden. Das bedeutet, dass die Arbeiterklasse sich in eine breite, Klassen übergreifende Front einreihen und nicht auf dem eigenen Terrain, sondern auf einem ihr völlig fremden Feld kämpfen soll. Das zeigt die Richtigkeit der (auch von uns vertretenen) Position der IKS auf, die die Ereignisse vom 19. und 20. Dezember als eine Klassen übergreifende Revolte klassifizierte.
Der Partido Obrero bemäntelt ihre Worte nicht, wie der schamlose Paragraph auf ihrem 13. Kongress beweist, wenn er sagt: "Wer immer die Ernährung der Massen kontrolliert, kontrolliert die Massen…" Mit anderen Worten: Trotz der Deklamationen des Partido Obrero über seine Nahrungsmittelkontrolle als Mittel, die Kontrolle der Bourgeoisie über die Massen zu beenden, zeigt sie dasselbe Verhalten wie die Bourgeoisie, nämlich die Kontrolle über die Arbeitsprojekte, die Kontrolle über die Nahrungsmittelpakte und somit die Kontrolle über die Arbeitslosen. Das ist nicht nur die Haltung des PO, sondern der Gesamtheit der Strömungen und Gruppen in der Piquetero-Bewegung.
Diese wenigen Beispiele zeigen, dass die Arbeitslosenbewegungen, die die Massenmedien auf nationaler oder internationaler Ebene in Beschlag genommen und die zur Phantasmagorie einer beginnenden "Revolution", der Existenz von "Arbeiterräten" usw. im radikalisierten Kleinbürgertum geführt haben, ein völliger Schwindel sind.
Wenn man wie der PO der Auffassung ist, dass die Piquetero-Bewegung der bedeutendste Ausdruck der Arbeiterbewegung seit dem Cordobazo(3) und den anderen Kämpfen zu jener Zeit sei, dann diskreditiert man die Letzteren, die weder ein Volksaufstand noch in irgendeiner Weise Klassen übergreifend waren, sondern ganz im Gegenteil Arbeiterkämpfe, aus denen Arbeiterkomitees mit verschiedensten Funktionen (Verteidigungskomitees, Solidaritätskomitees usw.) hervorgingen.
Man mag einwenden, dass dies die Position der Führung der Piquetero-Bewegung und ihrer Organisationen sei, dass aber der dynamische Prozess des Piquetero-Phänomens viel wichtiger sei: ihre Kämpfe, ihre Demonstrationen, ihre Initiativen.
Die Antwort darauf ist einfach und dieselbe, die wir in Revolucion Comunista(4) Nr. 2 in unserer Kritik an der Position des IBRP(5) über den "Argentinazo" vom 19. und 20. Dezember gaben: dass es sich bei den Positionen dieser Strömung um idealistisches Wunschdenken handelt. Die Piquetero-Organisationen sind nicht mehr, als was ihre Führer, ihre Chefs sind. Die restlichen Piqueteros, mit ihren maskierten Gesichtern und den brennenden Reifen, sind Gefangene der 150 Peso pro Monat und der fünf Kilo Nahrungsmittel, die ihnen der bürgerliche Staat auf dem Wege dieser Organisationen zugesteht. Und all dies muss, wie wir bereits weiter oben gesagt haben, unter der Androhung des Verlustes der genannten "Beihilfen" getan werden.
Zusammengefasst stellen die Piqueteros absolut keine Entwicklung des Bewusstseins dar, sondern sind ganz im Gegenteil ein Rückschritt im Arbeiterbewusstsein, da diese Organisationen der Arbeiterklasse eine fremde Ideologie einimpfen: Wer immer die Nahrungsmittel verwaltet, verwaltet das Bewusstsein, wie der PO es nennt. Diese bürgerliche Position, diese perverse Logik kann nur zur Niederlage der Arbeiterklasse und der Arbeitslosen führen, denn die Funktion des Linksextremismus ist es, die Arbeiterklasse zu besiegen und ihre Klassenautonomie auszulöschen, gleich, wie "revolutionär" seine Parolen klingen.
Die GCI lügt über das Wesen der Piquetero-Bewegung
Ungenauigkeiten, Halbwahrheiten und Mystifikationen helfen dem Weltproletariat nicht; im Gegenteil, sie verschlimmern die Irrtümer und Beschränktheiten der kommenden Kämpfe. Genau das macht die GCI, wenn sie in ihrer Revue Communisme (Nr. 49, 50 und 51) schreibt: "Das erste Mal in der Geschichte Argentiniens gelang es der revolutionären Gewalt des Proletariats, eine Regierung zu stürzen." Und weiter: "Die Verteilung von enteigneten Waren an das Proletariat und die aus diesen Produkten hergestellten Volksmahlzeiten… Zusammenstösse mit der Polizei und anderen Kräften des Staates, wie die gedungenen peronistischen Strassenbanden, besonders am Tag der Amtseinsetzung des Präsidenten Duhalde…" Die GCI sät mit ihrer Haltung und mit ihren Lügen Verwirrung in der internationalen Arbeiterklasse und hindert sie so daran, die nötigen Lehren aus den Ereignissen in Argentinien 2001 zu ziehen.
Die GCI fährt mit der Verfälschung der Tatsachen fort, wenn sie im Zusammenhang mit dem Aufstieg Duhaldes von einem Kampf der "Bewegung" des Proletariats gegen die peronistischen Strassenbanden spricht. Das ist falsch, dies ist eine Lüge. Bei diesen Zusammenstössen prallten Fraktionen des bürgerlichen Staatsapparates aufeinander, auf der einen Seite der Peronismus und auf der anderen Seite der linksextremistische MST6, der PCA7 und andere, weniger wichtige trotzkistische und guevaristische Gruppen. Die Arbeiterklasse fehlte an diesem Tag.
Einen Augenblick lang könnte man vielleicht annehmen, dass die "Irrtümer" der GCI auf ein Übermass an revolutionärem Enthusiasmus und guten Willen zurück zu führen seien. Wenn man aber den Rest der Zeitschrift liest, kann man sehen, dass dies nicht der Fall ist. Ihre Rolle ist es, Verwirrung zu stiften, was den Interessen der Bourgeoisie dient. Die GCI belügt die internationale Arbeiterklasse und nährt die Mystifikation der Piqueteros, wenn sie sagt: "Die Behauptung des Proletariats in Argentinien wäre ohne die Piquetero-Bewegung nicht möglich gewesen, der Speerspitze der proletarischen Assoziation im letzten Jahrzehnt." Und: "In Argentinien hat die Entwicklung dieser Klassenmacht in den letzten Monaten solch ein Potenzial, dass sich ihr die noch Arbeitenden anschliessen (…) In den letzten Jahren ist ein grosser Kampf durch die Streikposten, die Versammlungen und die koordinierenden Strukturen der Piqueteros koordiniert und artikuliert worden." Es wäre Besorgnis erregend, wenn solche Behauptungen aus dem politisch-proletarischen Milieu kämen, jedoch erstaunt es uns nicht, sie von der GCI zu hören, einer halb-anarchistischen Gruppe, die sich auf die kleinbürgerlichen und rassistischen Positionen Bakunins bezieht. Was uns allerdings beunruhigt, das sind die von ihrer Presse verbreiteten Lügen.
Wie wir bereits oben gesagt haben, ist die Piquetero-Bewegung (abgesehen von Patagonien und Norte de Salta) Erbin der Manzaneras, und die Assoziationstümelei, die von den Streikposten generiert wurde, ist nichts anderes als eine Verpflichtung, die all jenen aufgezwungen wird, die vom "Arbeitsprojekt" oder von Beihilfen nutzniessen, um den Anspruch auf die Krümel nicht zu verlieren, die ihnen der bürgerliche Staat hinwirft. Unter ihnen existiert keine Solidarität, ganz im Gegenteil, hier herrscht das "Jeder für sich selbst und gegen den Anderen", das Trachten nach Beihilfen zum Schaden und auf Kosten des Hungers der Anderen.
Deshalb können wir in keiner Weise die Streikposten als etwas grossartig Bedeutsames für die Arbeiterklasse einordnen, und es ist eine schamlose Lüge, von einer "Koordination" der beschäftigten Arbeiter mit den Piqueteros zu sprechen. Die GCI fährt mit ihrer Verlogenheit fort, wenn sie sagt, dass "das generalisierte Assoziationstum des Proletariats in Argentinien ohne Zweifel die erste Bestätigung für die zunehmenden Autonomie des Proletariats ist (…) die direkte Aktion, eine mächtige Organisation gegen die bürgerliche Legalität, die Aktion ohne die Vermittlung der Vermittlung (…) ein Angriff gegen das Privateigentum (…) dies sind ausserordentliche Bestätigungen der Tendenz des Proletariats, sich zu einer die herrschende Ordnung zerstörenden Kraft zu formieren…" Diese Behauptungen sind zweifelsohne eine klare Demonstration ihrer offenen Absicht, die internationale Arbeiterklasse zu täuschen, um sie daran zu hindern, die notwendigen Lehren zu ziehen. Die GCI erweist der Bourgeoisie und der herrschenden Klasse einen grossen Dienst. Sie kann die Arbeiterklasse nicht beschwindeln, ohne die Bedeutung von Ereignissen, Aktionen und Parolen zu verzerren: Der Schlachtruf "Weg mit ihnen allen" (d.h. die Politiker) ist kein revolutionärer Aufruf, sondern vielmehr ein Aufruf an alle, nach einer "ehrlichen bürgerlichen Regierung" zu suchen.
Man muss sich die Frage stellen, was die GCI eigentlich unter Proletariat versteht. Für diese Gruppe wird das Proletariat nicht durch die Rolle definiert, die es in der kapitalistischen Produktion spielt, d.h. gemäss der Frage, ob es die Produktionsmittel besitzt oder seine Arbeitskraft verkauft. Für die GCI ist das Proletariat eine Kategorie, die neben den Arbeitslosen (die in der Tat Teil der Arbeiterklasse sind) auch das Lumpenproletariat und andere nicht ausbeutende Schichten umfasst, wie wir in ihrer Publikation Comunismo, Nr. 50 sehen können.
Die Position der GCI, das Lumpenproletariat in eine Kategorie mit der Arbeiterklasse zu stecken, bedeutet nichts weniger als den verschleierten Versuch, es als ein neues revolutionäres Subjekt zu präsentieren, um die Arbeitslosen von der Arbeiterklasse zu trennen. Weit entfernt davon, gegen die Linke zu sein, ähneln viele Positionen der GCI jenen des argentinischen Linksextremismus, wie des Partido Obrero, der seinerseits eine Unterkategorie der Arbeiter, die "Piquetero-Arbeiter", kreiert hat. Und wir sehen dies auch, wenn die GCI versucht, ihre Auffassung (die halb anarchistisch und "guerillaistisch" ist und nichts mit Marxismus zu tun hat) über dieses proletarische Subjekt darzulegen, und über die Lumpen sagt, dass sie "die entschlossensten Elemente gegen das Privateigentum" seien, da sie auch die verzweifeltsten Elemente seien.
Angesichts dieser Formulierung stellt sich die Frage: Ist das Lumpenproletariat eine von der Arbeiterklasse abgesonderte gesellschaftliche Schicht? Für die GCI ist dies nicht der Fall, für sie sind die Lumpen der bedrängteste Sektor des Proletariats. Dabei setzt die GCI das Lumpenproletariat mit den Arbeitlosen gleich, was absolut falsch ist. Dies bedeutet absolut nicht, dass die Bourgeoisie nicht versucht, diese abgesonderten Teile von Arbeitern ohne Arbeit durch die Isolation zu demoralisieren, sie zu verlumpen, damit sie ihr Klassenbewusstsein verlieren. Es gibt jedoch einen grossen Unterschied zwischen dem und der Auffassung der GCI, da die Annahme, so rührend sie sein mag, dass das Lumpenproletariat der verzweifeltste Teil der Arbeiterklasse sei und dass diese Verzweiflung dazu führe, "das Privateigentum nicht zu respektieren", falsch ist. Das Lumpenproletariat ist vollständig in der kapitalistischen Gesellschaft des "Nimm, was du kannst und jeder für sich selbst" integriert. Was seine "Respektlosigkeit vor dem Privateigentum" angeht, so ist dies nichts anders als Ausdruck der Verzweiflung dieser Gesellschaftsschicht.
Die unterschwellige Ankündigung der GCI über das Ende des Proletariats ist nichts anderes als ein Echo auf die Ideologien und Theorien, die von der Bourgeoisie in den 1990er-Jahren verbreitet wurden, wenn sie sagt, dass diese zukunftslosen Gesellschaftsschichten Teil des Proletariats seien. Sie leugnet das Wesen der Arbeiterklasse als die einzig revolutionäre Klasse in unserer Epoche und als die einzige Klasse, die die Perspektive des Kommunismus und der Zerstörung des Ausbeutungssystems des Kapitalismus besitzt.
Es ist falsch, die Revolte von 2001 als proletarisch und revolutionär zu charakterisieren. Es ist eine Lüge zu behaupten, die Arbeiterklasse habe das Privateigentum herausgefordert. Die assoziativen Strukturen, auf die sich die GCI bezieht, sind integraler Bestandteil des Staatsapparats, um die Arbeiterklasse zu spalten und aufzulösen, denn wie auch immer die Strukturen der Piqueteros beschaffen sein mögen, sie haben nie über die Zerstörung des Privateigentums nachgedacht noch haben sie eine kommunistische Perspektive aufgestellt.
In Wahrheit wird der ganze Wirbel, den die GCI über die Streikposten und Piquetero-Gruppen veranstaltet, dazu benutzt, die Arbeiterklasse zu spalten und den revolutionären Charakter des Proletariats zu leugnen. Die GCI benutzt eine marxistische Phraseologie, doch ist diese Gruppe nichts anderes als eine Deformation der bürgerlichen Ideologie.
Darüber hinaus hat die GCI einen offenen Angriff gegen die IKS und ihre Position bezüglich der Ereignisse von 2001 lanciert. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Position, die die IKS gegenüber den Ereignissen in Argentinien eingenommen hat, die einzige ist, die im Stande ist, die richtigen Lehren aus diesem Volksaufstand zu ziehen, wohingegen jene des IBRP allein auf dem Fetisch der "neuen Avantgarden" und der "radikalisierten Massen in den peripheren Ländern" basiert. Die GCI hat (wie die Interne Fraktion der IKS) eine nicht-proletarische und anarchistisch-kleinbürgerliche Position angenommen.(...)
Unsere kleine Gruppe hat dieselben Lehren aus der Klassen übergreifenden Revolte in Argentinien gezogen wie die Genossen der IKS. Wir haben uns weder von den Drittwelt-Auffassungen des IBRP noch von der angeblich proletarisch-revolutionären Aktion des Lumpenproletariats, wie sie die GCI vertritt, blenden lassen.
Es ist absurd, die Klassen übergreifende Rebellion in Argentinien mit der Russischen Revolution von 1917 gleichzustellen. Was haben Bezüge auf Kerenski in der Analyse der Erhebung von 2001 zu suchen? Die Antwort lautet: Nichts. (…) Die Analogie in der Antwort der GCI ist offensichtlich. Es geht hier nicht um Irrtümer, überstürzte Analysen oder idealistische Sichtweisen, ganz im Gegenteil, sie ist schlicht und einfach das Produkt ihrer Ideologie, die sie zur materialistischen Dialektik und zum historischen Materialismus auf Abstand hält. Sie macht sich anarchistische Positionen zu Eigen, die eine schwer verdauliche Mischung sind. In ihrer oberflächlichen Terminologie übernimmt sie die kleinbürgerliche Ideologie der verzweifelten und zukunftslosen Mittelschichten.
Die Positionen der IFIKS
In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick auf die Positionen der IFIKS.(8) Obwohl diese Gruppe behauptet, die "wahre IKS" und die "einzige Nachfolgerin des revolutionären Programms der IKS" zu sein, zeigt sie klar, dass sie lediglich eine Nachbeterin der fehlerhaften Analysen des IBRP bezüglich Argentinien ist. Die Antwort dieser Gruppe auf einen von uns publizierten Artikel in Revolucion Comunista gibt eine gute Vorstellung über ihre Positionen.
"… im Gegensatz zu allen anderen kommunistischen Kräften hat die IKS die Wirklichkeit der Arbeiterkämpfe in Argentinien bestritten (…) wir denken, dass die Bewegung in Argentinien eine Bewegung der Arbeiterklasse war (…) Eine schematische Sichtweise geht davon aus, dass das Proletariat der peripheren Länder nichts anderes zu tun habe als zu warten, bis die Arbeiter der zentralen Länder den Weg zur Revolution öffnen. Offensichtlich hat eine solche Sichtweise Auswirkungen und Konsequenzen auf die Orientierungen und selbst auf die militante Haltung gegenüber den Kämpfen. Bereits in den 70er-Jahren zeigte sich in der Presse der IKS dieses unkorrekte, vulgäre, mechanische Unverständnis. Heute denken wir, dass diese Sichtweise mit aller Macht in den gegenwärtigen Positionen der IKS, mit der absoluten und daher idealistischen Vision über den Zerfall, zurückgekehrt ist, was ‚unsere‘ Organisation dazu verleitete, eine indifferente, defätistische und gar denunziatorische Position gegenüber den Kämpfen der argentinischen Arbeiter 2001 und 2002 einzunehmen. (siehe die IKS-Presse zur damaligen Zeit)"(9)
Diese langen Ausführungen aus der Publikation der IFIKS zeigen klar dieselben Irrtümer wie jene des IBRP, hinter dem die IFIKS und auch die GCI auf prinzipienlose Art und Weise hinterher rennen. Sie alle stimmen darin überein, dass der Volksaufstand in Argentinien ein Arbeiterkampf gewesen sei. Nichts könnte falscher sein.
Wahr ist, dass sich die Position der IKS und unserer kleinen Gruppe von denen der anderen kommunistischen Strömungen, insbesondere vom IBRP, unterscheidet. Doch dies ist nicht, wie die IFIKS fälschlicherweise behauptet, eine defätistische Position. Wir sind es leid zu wiederholen, dass es notwendig ist, die Lehren aus den Kämpfen zu ziehen, um keine Fehler zu begehen oder dem Impressionismus anheim zu fallen, wie es offensichtlich diesen Gruppen bezüglich der Piquetero-Erfahrung passiert ist. Wenn man sagt, dass es am 19. Dezember 2001 in Argentinien keinen Arbeiterkampf gegeben hat, heisst dies überhaupt nicht, dass man ein Deserteur des Klassenkampfes ist, wie die IFIKS uns unterstellt. Ihre Auffassung ist typisch für das verzweifelte Kleinbürgertum, das um jeden Preis Arbeiterkämpfe dort sehen will, wo es in der Realität keine gibt.
Die hoch industrialisierten Länder weisen weit günstigere Bedingungen für die revolutionären Arbeiterkämpfe auf als die peripheren Nationen. Die Bedingungen für eine proletarische Revolution, verstanden als Bruch mit der herrschenden Klasse, sind in Ländern, in denen die Bourgeoisie am stärksten ist und die Produktivkräfte einen hohen Entwicklungsstand erreicht haben, weitaus günstiger. (…)
Wie die GCI hat die IFIKS nichts anderes als eine Politik der Verleumdung und Beleidigung der IKS betrieben. Und diese Vorgehensweise hat sie dazu geführt, das Unleugbare zu leugnen und das Inakzeptable zu akzeptieren – an erster Stelle, dass der Kampf 2001 in Argentinien ein Arbeiterkampf gewesen sei – sowie die Mystifikation zu verbreiten, dass die Arbeitslosenbewegung, die "Streikposten" usw. Klassenorgane seien, obwohl die konkrete Praxis des Klassenkampfes das Gegenteil demonstriert.
Für eine proletarische Perspektive
Die Piquetero-Strömungen, die in ihrer Gesamtheit ca. 200'000 beschäftigungslose Arbeiter kontrollieren, sind streng genommen keine Gewerkschaften, aber sie weisen Eigenschaften von solchen auf: Mitgliederbeiträge, blinder Gehorsam gegenüber jenen, die die "Arbeitsprojekte" verwalten bzw. die Lebensmittel verteilen, und vor allem ihr permanenter Charakter. Es ist vollständig gleichgültig, ob sie von linken Parteien oder von der CTA (wie im Fall der FTV) kontrolliert werden. So haben nach den frühen Kämpfen der Arbeitslosen 1996 und 1997 in Patagonien, wo sich die Arbeitslosen in Komitees, Versammlungen usw. selbst organisierten, die linken Parteien es verstanden, als Organe des Kapitals in die Kämpfe der beschäftigten und arbeitslosen Arbeiter zu infiltrieren und sie zu sterilisieren.
Jedoch könnte man einwenden: "Könnten diese Strömungen nicht durch Aktionen der Basis regeneriert werden? Meint ihr etwa, dass die Arbeitslosen vom Kampf ablassen sollen?" Die Antwort ist ganz einfach: NEIN. Die Piquetero-Organsiationen sind Anhängsel der linken Parteien, ob sie nun "unabhängig" sind oder der verlängerte Arm der Hauptgewerkschaften, wie im Falle der CTA für die FTV und ihren offiziellen Führer D‘Elia. Sie sind untrennbarer Bestandteil des Kapitals, des bürgerlichen Apparates. Ihr Zweck ist die Spaltung und Zersplitterung der Kämpfe, die Sterilisierung der Kämpfe der Arbeitslosen, bis diese in einen integralen Bestandteil der urbanen Landschaft umgewandelt sind, ohne revolutionäre Perspektive und isoliert von ihrer Klasse.
Wir sagen keinesfalls, dass die Arbeitslosen vom Kampf ablassen sollen, im Gegenteil: Sie müssen ihr Engagement verdoppeln. Dennoch ist es notwendig, ständig zu erklären, dass die unbeschäftigten Arbeiter ihre Forderungen und Reformen innerhalb des Systems nicht durchsetzen können. Deshalb müssen die Arbeitslosen Seite an Seite mit den Beschäftigten gegen das System kämpfen. Dafür ist es aber notwendig, dass sie aus ihrer Isolation nicht nur gegenüber den Beschäftigten, sondern auch untereinander heraustreten. Eine Isolation, die die Bourgeoisie geschickt durch die linken Parteien und den Piquetero-Strömungen mit ihren eigenen, separaten Gruppen geschaffen hat und mit der sie Spaltungen unter den Arbeitslosen bewirkt hat, die eine Denkweise fördert, die in dem Nachbarn oder Genossen im Bezirk einen potenziellen Gegner und Feind sieht, der dir deine Beihilfen und Nahrungsmittel nehmen könnte.
Diese Falle muss kaputt gemacht werden. Die Arbeitslosen müssen ihre vom Kapitalismus aufgezwungene Isolation durchbrechen und sich mit der gesamten Klasse vereinen, derer sie ein Teil sind. Dazu ist allerdings eine Änderung der Organisationsform notwendig: nicht mit den Mitteln permanenter Organe, sondern indem man dem Beispiel der Arbeiter in Patagonien 1997 oder in Norte de Salta folgt, als Einheit in der Klasse bestand und die Organisation des Kampfes durch Generalversammlungen mit rückrufbaren Mandaten geschah, auch wenn sie letztendlich unter die Kontrolle der linksextremistischen Parteien gerieten.
Dennoch bleibt die Erfahrung aus diesen Kämpfen gültig, da die Arbeitslosen gegen die elenden Beihilfen, die ihnen gegeben werden, gegen die Preissteigerungen im Öffentlichen Dienst usw. kämpfen müssen, was auf gewisse Weise derselbe Kampf ist wie jener, der von den Beschäftigten für Lohnerhöhungen geführt wird. Sie müssen sich unterstützend am Klassenkampf beteiligen und ihre Kämpfe in einen integralen Bestandteil des allgemeinen Kampfes gegen das Kapital umwandeln.
Die Piquetero-Strömungen haben das Wort "Piquetero" geschaffen, um eine Spaltung nicht nur gegenüber den Beschäftigten, sondern auch gegenüber jenen Arbeitslosen zu vollziehen, die nicht in diesen Organisationen sind. Durch die Schaffung neuer gesellschaftlicher Kategorien und neuer gesellschaftlicher Subjekte wie die "Arbeitslosen-Piqueteros" versuche diese Gruppen von Arbeitslosen, Millionen von beschäftigten und arbeitslosen Arbeiter zu spalten und auszuschliessen, was nur der herrschenden Klasse nützt.
Wie im Falle der Zapatistas waren und sind die Piqueteros Instrumente im Dienste des Kapitals. Ihre "Mode" der Kopfschützer, der in Brand gesteckten Autoreifen mitten auf den Strassen ist nur eine "Vermarktung" durch den Kapitalismus, um der Klasse in ihrer Gesamtheit zwei Dinge zu sagen: Einerseits gibt es Millionen von Arbeitslosen, die bereit sind, die Jobs der Beschäftigten für weniger Geld zu übernehmen und auf diese Weise die Entwicklung des Klassenkampfes zu lähmen, und andererseits zeigt das Programm, das die vielfältigen Piquetero-Gruppen aufstellen – mehr Nahrungsmittelpakete und 150 Pesos im Monat an Beihilfen, echte Arbeit in kapitalistischen Fabriken –, dass ausserhalb des Kapitalismus nichts möglich sei, selbst wenn man von einer Arbeiter- und Volksregierung spricht.
Für die arbeitslosen Arbeiter ist es deshalb notwendig, mit den Fallen der Bourgeoisie und mit den Piquetero-Organisationen zu brechen, indem sie sie fallenlassen, da diese zusammen mit den Gewerkschaften und den linken Parteien Bestandteil des Kapitals sind. Entgegen dem, was der Linksextremismus sagt, sind die Arbeitslosen Arbeiter und nicht "Piqueteros". Solch eine Bezeichnung bedeutet die Spaltung der Arbeitslosen von der Gesamtheit der Arbeiterklasse und ihre Transformation in eine Kaste; dies ist der Inhalt der Positionen der Linken des Kapitals.
Die Arbeiter und die Arbeitslosen müssen zur Klasseneinheit streben, da beide Sektoren derselben Gesellschaftsklasse angehören: der Arbeiterklasse. Es gibt keine Lösung innerhalb dieses Systems, da es bankrott ist. Einzig die proletarische Revolution kann dieses System zerstören, das nur Armut, Hunger, Marginalisierung bringt. Dies ist die Herausforderung.
Buenos Aires, 16. Juni 2004
Fußnoten:
1 Groupe Communiste Internationale.
2 Central de los Trabajadores Argentinos, die ihre eigene Gewerkschaft für die Arbeitslosen unter dem Namen Federación de Tierra y Vivienda aufgestellt hat.
3 Arbeiteraufstand in der Industriestadt Cordoba, Argentinien, 1969.
4 die Zeitschrift des NCI.
5 Internationales Büro für die Revolutionäre Partei, s. https://www.ibrp.org [121]
6 Movimiento Socialista de los Trabajadores, die unter dem Namen Izquierda Unida im Parlament sitzt.
7 Partido Comunista de la Argentina (argentinische Stalinisten).
8 die selbsternannte „Interne Fraktion der IKS“; siehe https://www.internationalism.org/links.html [122]
9 IFIKS-Bulletin, Nr. 22, 23. Dezember 2003; unsere Übersetzung.
Geographisch:
- Argentinien [109]
Politische Strömungen und Verweise:
Battaglia Comunista wendet sich von einem marxistischen Schlüsselkonzept ab: der Dekadenz der Produktionsweisen
- 2768 Aufrufe
Die Theorie der Dekadenz im Zentrum des Historischen Materialismus
Battaglia Comunista wendet sich von einem marxistischen Schlüsselkonzept ab: der Dekadenz der Produktionsweisen
In der letzten Ausgabe der Internationalen Revue 34 haben wir ausführlich und gestützt auf Passagen aus ihren Hauptschriften in Erinnerung gerufen, wie Marx und Engels die Begriffe des Aufstiegs und der Dekadenz einer Produktionsweise definierten. Wir sahen, dass der Begriff der Dekadenz sich im eigentlichen Zentrum des historischen Materialismus, in der Analyse der Aufeinanderfolge der verschiedenen Produktionsweisen, befindet. In einem weiteren Artikel werden wir aufzeigen, dass dieses Konzept auch an zentraler Stelle in den Programmen der 2. und 3. Internationalen sowie der marxistischen Linken stand, die aus Letzterer stammte und in denen die Gruppen der Kommunistischen Linken heute ihren Ursprung haben.Wir haben mit der Veröffentlichung einer neuen Artikelreihe1 über die „Dekadenztheorie im Zentrum des Historischen Materialismus“ begonnen, um sowohl auf völlig legitime Fragen zum Thema als auch und vor allem auf die Konfusionen zu antworten, die von jenen in Umlauf gesetzt werden, die dem Druck der bürgerlichen Ideologie nachgegeben und sich von diesem Grundsatz des Marxismus abgewendet haben. Der Artikel, der von Battaglia Comunista veröffentlicht wurde und den schamhaften Titel „Für eine Definition des Konzepts der Dekadenz“2 trägt, ist ein erstklassiges Beispiel dafür. Wir haben bereits die Gelegenheit genutzt, einige seiner Hauptideen zu kritisieren .3 Doch die Publicity, die diesem Artikel gewidmet wurde, seine Übersetzung in drei Sprachen, die Tatsache, dass er innerhalb des IBRP eine Diskussion über die Frage der Dekadenz ausgelöst hat, und die Einleitung, die die CWO4 in ihrer eigenen Zeitschrift5 veröffentlicht hat, veranlassen uns, zum Thema zurückzukehren und noch eingehender darauf zu antworten.
Laut Battaglia machen es zwei Gründe notwendig, „den Begriff der Dekadenz zu definieren“:
– erstens um gewisse Zweideutigkeiten in der gegenwärtig akzeptierten Definition der Dekadenz des Kapitalismus zu entfernen, wovon die schlimmste die Sichtweise vom Absterben des Kapitalismus als „ökonomisch unabwendbar und gesellschaftlich vorhersehbar“ (Revolutionary Perspectives, Nr. 32) sei, mit anderen Worten: eine fatalistische Sichtweise des Todes des Kapitalismus;
– zweitens um die Idee zur Durchsetzung zu verhelfen, dass solange, wie das Proletariat den Kapitalismus noch nicht überwunden hat, „das Wirtschaftssystem sich selbst reproduziert, indem es einmal mehr und auf höherer Ebene all seine Widersprüche aufwirft, ohne auf diese Weise die Bedingungen für seine Selbstzerstörung zu schaffen“ (ebenda). Die Idee der Dekadenz macht also angeblich „keinen Sinn, wenn sie in Bezug auf die Überlebensfähigkeiten der Produktionsweise benutzt wird“ (Internationalist Communist, Nr. 21).
Wir bestreiten die Behauptung, dass der Marxismus auch nur die leiseste Zweideutigkeit enthält, die zu einer fatalistischen Sichtweise vom Ableben des Kapitalismus und damit zur Idee verleiten könnte, dass unter dem Druck der immer überwältigenderen Widersprüche das System sich einfach von der historischen Bühne zurückzieht. Für den Marxismus hatte im Gegenteil die Folge einer Abwesenheit, entweder „…jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaf [geendet] oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.“ (Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, S. 462). Mit anderen Worten: das Verschwinden der Gesellschaft selbst. Wie wir aufzeigen wollen, besteht die einzige Zweideutigkeit in den Ideen von Battaglia Comunista. Wir sollten darauf hinweisen, dass Battaglia unfreiwillig als Sprecher all jener bürgerlichen Ideologen handelt, die behaupten, dass der Marxismus „fatalistisch“ sei, und die die Rolle des „menschlichen Willens“ in der Entwicklung der Geschichte hervorheben. Battaglia stellt selbstredend den Marxismus nicht in Frage. Im Gegenteil, im Namen des Marxismus (oder zumindest der eigenen Version des Marxismus) macht es sich daran, eine Konzeption als „fatalistisch“ zurückzuweisen, die sich, wie wir im letzten Artikel gesehen haben, im eigentlichen Zentrum des Marxismus befindet.
Was den zweiten Grund angeht, den Battaglia für die Definierung des Begriffes der Dekadenz angibt, so steht er im völligen Widerspruch zum Marxismus, für den die kapitalistische Produktionsweise „damit nur aufs neue [beweist], dass sie altersschwach wird und sich mehr und mehr überlebt“,6 und das „kapitalistische System im Westen im Verblühen ist“,7 „…an der Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke findet“.8
Seine methodischen Irrtümer führt Battaglia in die schlimmste Art von Verirrungen: „Selbst in der progressiven Phase (…) tauchten Krisen und Kriege wie auch die Angriffe gegen die Arbeitsbedingungen punktuell immer wieder auf“.9 Battaglia endet so bei den alten bürgerlichen Banalitäten, die die qualitativen Ausweitungen dieser Geisseln während des barbarischen 20. Jahrhunderts minimalisieren, mit der Begründung, dass Krieg und Armut immer existiert haben. Indem es so verfährt, behauptet Battaglia letztendlich, dass die Hauptausdrücke der Dekadenz des Kapitalismus einfach nicht existieren.
Laut Battaglia gibt es ferner keine zwei fundamentalen Phasen in der Evolution der kapitalistischen Produktionsweise, sondern stetig aufeinander folgende Perioden des Aufstiegs und der Dekadenz, die den Hauptphasen der Entwicklung der Profitrate entsprechen.
Bei dieser Sichtsweise nehmen die Kriege der dekadenten Periode – die einen der Ausdrücke der Todeskrise des Systems und eine wachsende Bedrohung für das Überleben der Menschheit darstellen – die Rolle der „Regulierung der Beziehungen zwischen den Sektionen des internationalen Kapitals“ (ebenda) an. Diese Unfähigkeit, die Realität zu begreifen, ist ein Hauptfaktor in der erheblichen Unterschätzung des Ernstes der Weltlage durch das IBRP. Das IBRP steht somit in wachsendem Masse auf Kriegsfuss mit der Realität, was nur seine Fähigkeit aufs Spiel setzen kann, die Welt zu verstehen, deren Analyse Teil seiner Interventionen in der Arbeiterklasse ist. Es verringert den Einfluss dieser Intervention, wenn es sich auf faule und nicht überzeugende Argumente stützt.
Besassen Marx und Engels eine fatalistische Sichtweise der Dekadenz des Kapitalismus?
Battaglia beginnt seinen Artikel mit der Behauptung, dass das Konzept der Dekadenz Zweideutigkeiten enthalte und dass sich die erste in der fatalistischen Sichtweise vom Ende des Kapitalismus zeige: „Die Zweideutigkeit befindet sich in der Tatsache, dass die Dekadenz (oder der fortschreitende Verfall der kapitalistischen Produktionsweise) aus einer Art unabwendbaren Selbstzerstörungsprozesses herrührt, dessen Ursachen nachweislich die wesentlichen Aspekte ihres eigenen Daseins sind (…) das Verschwinden und die Zerstörung der kapitalistischen Wirtschaftsform ist ein historisch gegebenes Ereignis, ökonomisch unvermeidbar und gesellschaftlich vorhersehbar. Dies, eine ebenso infantile wie idealistische Vorgehensweise, endete darin, ein negatives politisches Echo auszustrahlen und die Hypothese in die Welt zu setzen, dass es angesichts des Todes des Kapitalismus ausreiche, Däumchen zu drehen, oder dass es in einer Krisensituation (und nur dann) genug sei, die subjektiven Instrumente des Klassenkampfes als den letzten Impuls für einen Prozess zu schaffen, der ansonsten unumkehrbar ist. Nichts ist falscher als dies.“ (ebenda) Vorweg sei gesagt, dass diese Zweideutigkeit nur in Battaglias Kopf existiert. Marx und Engels, die als Erste diesen Begriff der Dekadenz prägten und davon reichlich Gebrauch machten, waren keineswegs fatalistisch. Für die Begründer des Marxismus gab es keinen unabwendbaren und automatischen Mechanismus hinter der Abfolge der Produktionsweisen; sozioökonomische Widersprüche wurden vom Klassenkampf geregelt, der die Antriebskraft der Geschichte bildet. Um Marx zu zitieren – die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber innerhalb vorgegebener historischer Bedingungen: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten; sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.“10 Oder wie Rosa Luxemburg schrieb: „Der wissenschaftliche Sozialismus hat uns gelehrt, die objektiven Gesetze der geschichtlichen Entwicklung zu begreifen. Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken. Aber sie machen sie selbst. Das Proletariat ist in seiner Aktion von dem jeweiligen Reifegrad der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, aber die gesellschaftliche Entwicklung geht nicht jenseits des Proletariats vor sich, es ist in gleichem Masse ihre Triebfeder und Ursache, wie es ihr Produkt und ihre Folge ist. Seine Aktion selbst ist mitbestimmender Teil der Geschichte. Und wenn wir die geschichtliche Entwickung sowenig überspringen können wie der Mensch seinen Schatten, so können wir sie doch beschleunigen oder verlangsamen.“11Eine alte herrschende Klasse verzichtet niemals auf ihre Macht, sie verteidigt sie mit allen Mitteln und Waffen. Der Begriff der Dekadenz enthält also keinerlei Zweideutigkeit hinsichtlich der Möglichkeit eines „unabwendbaren Prozesses der Selbstzerstörung“. Wie sehr auch immer eine alte Produktionsweise sich auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene aufgelöst haben mag, wenn keine neue gesellschaftliche Kraft aus dem Innern der alten Gesellschaft emporgekommen ist oder wenn sie sich als unfähig erweist, genügend Kraft zu entwickeln, um die alte herrschende Klasse zu stürzen, dann gibt es keinen Tod der herrschenden Gesellschaft oder den Aufbau einer neuen. Die Macht der herrschenden Klasse und ihre Anhänglichkeit an ihren Privilegien sind bedeutende Faktoren beim Überleben einer Gesellschaftsform. Die Dekadenz einer Produktionsweise schafft die Möglichkeit und die Notwendigkeit ihres Sturzes, aber nicht die automatische Entstehung einer neuen Gesellschaft.
Es gibt daher keine „fatalistische Zweideutigkeit“ in der marxistischen Analyse der Aufeinanderfolge von Produktionsweisen, wie Battaglia uns weiszumachen versucht. Marx wies selbst darauf hin, dass, wenn der Ausgang des Klassenkampfes nicht vom Sieg einer neuen Klasse besiegelt wird, die neue Produktionsverhältnisse mit sich bringt, die Periode der Dekadenz einer Produktionsweise zu einer Periode des allgemeinen Zerfalls mutieren wird. Diese historische Möglichkeit wird gleich zu Beginn des Kommunistischen Manifestes entwickelt, wo Marx nach seiner Äusserung, dass die „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen“, mit einem „Entweder…. oder“ fortfährt, um die beiden möglichen alternativen Ausgänge der Klassenwidersprüche zu veranschaulichen: „…..Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.“12
Es gibt viele historische Beispiele von Zivilisationen, die eine solche Pattsituation im Klassenkampf erlebt haben, welche sie zum „gemeinsamen Untergang.“ und somit zur Stagnation, zum Zusammenbruch oder gar zur Rückkehr zu früheren Entwicklungsstufen verurteilte.
Battaglias Bannsprüche, denen zu Folge die Auffassungen über Dekadenz und Zerfall „den Methoden und dem Arsenal der politischen Ökonomie fremd“ (Internationalist Communist, Nr. 21) seien, sind also nichts Anderes als lächerlich. Die Militanten dieser Organisation würden besser daran tun, zu ihren Klassikern zurückzukehren und mit dem Manifest und dem Kapital beginnen, wo die beiden Begriffe einen wichtigen Platz einnehmen (s. Internationale Revue Nr. 34). Manche Gruppen oder Individuen mögen ein Unverständnis oder opportunistische Verirrungen rund um den Begriff der Dekadenz entwickelt haben – und die fatalistische Sichtweise ist sicherlich eine von ihnen. Dies ist eine Frage. Doch die Methode, die darin besteht, den Begriff der Dekadenz zu diskreditieren, indem ihm die Irrtümer angeheftet werden, die von Anderen in seinem Namen begangen werden, ist dieselbe, die die Anarchisten benutzten, um den Begriff der Partei oder der Diktatur des Proletariats auf der Basis der Verbrechen des Stalinismus zu diskreditieren. Eine andere Frage ist die häufig anzutreffende Ungeduld, der Optimismus vieler Revolutionäre, unter ihnen auch Marx. Wie oft ist der Kapitalismus in den Texten der Arbeiterbewegung voreilig begraben worden! Dies traf besonders auf die Kommunistische Internationale und die ihr angeschlossenen Parteien zu, einschliesslich der italienischen Kommunistischen Partei (ob es den Bordigisten gefällt oder nicht): „Die Krise des Kapitalismus ist immer noch offen und wird sich unvermeidlich vertiefen, bis der Kapitalismus dahinstirbt.“ (Lyoner Thesen, 1926)13 Diese verständliche und kleine Sünde ist, auch wenn sie möglichst vermieden werden sollte, nur dann eine Gefahr, wenn die Revolutionäre sich als unfähig erweisen, ihre Fehler zu erkennen, wen sich das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen verändert.
Ein Konzept des historischen Materialismus, das dem Marxismus völlig entgegengesetzt ist
In seinem Kampf gegen den „Fatalismus“, der angeblich der marxistischen Idee der Dekadenz innewohnt, enthüllt Battaglia seine eigene Sicht des historischen Materialismus: „Der widersprüchliche Aspekt der kapitalistischen Produktion, die Krisen, die daraus herrühren, die Wiederholung des Akkumulationsprozesses, der zeitweise unterbrochen wird, der aber frisches Blut aus der Zerstörung des Übermasses an Kapital und Produktionsmitteln erhält, führt nicht automatisch zu seiner Zerstörung. Entweder interveniert der subjektive Faktor, der im Klassenkampf seinen materiellen Angelpunkt und in der Krise seine ökonomisch bestimmende Voraussetzung hat, oder das Wirtschaftssystem reproduziert sich selbst, indem es all seine Widersprüche einmal mehr und auf einer höheren Stufe aufwirft, ohne auf diese Weise die Bedingungen für seine Selbstzerstörung zu schaffen.“ Für Battaglia fährt der Kapitalismus, solange er nicht vom Klassenkampf zerstört worden ist, also fort, „frisches Blut aus der Zerstörung des Übermasses an Kapital und Produktionsmittel“ zu beziehen, womit sich „das Wirtschaftssystem selbst reproduziert, indem es all seine Widersprüche einmal mehr und auf einer höheren Stufe aufwirft“. Hier befindet sich Battaglia im krassen Gegensatz zur Ansicht von Marx über die Dekadenz einer Produktionsweise, insbesondere des Kapitalismus: „Über einen gewissen Punkt hinaus wird die Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke für das Kapital; also das Kapitalverhältnis eine Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit.“14
In seinem zweiten Entwurf des Briefes an Vera Sassulitsch (MEW 19, S. 398) zog Marx in Betracht, dass „...das kapitalistische Systems im Westen im Verblühen ist, und nur noch eine ‚archaische‘ Formation sein wird,“ und im Kapital teilt er uns mit, dass der Kapitalismus „altersschwach wird und sich mehr und mehr überlebt. (siehe oben Fsn 5). Die Begriffe, die Marx benutzt, um die Dekadenz des Kapitalismus zu beschreiben, sind unzweideutig: „altersschwach“, „im Verblühen“, „eine Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit“ etc. Und dennoch meint Battaglia sagen zu können, dass „die Dekadenz (…) bedeutungslos ist, wenn wir die Überlebensfähigkeit einer Produktionsweise in Betracht ziehen“ (Internationalist Communist, Nr. 21)
Mit diesen wenigen Erinnerungen an die marxistische Definition der Dekadenz wird der Leser allein den Unterschied zwischen der von Marx entwickelten historischen und materialistischen Sicht der Dekadenz des Kapitalismus und Battaglias eigener Sichtweise beurteilen können, wonach der Kapitalismus, auch wenn er sicherlich Krisen und wachsende Widersprüche durchläuft,15 sich kontinuierlich erneuert (es sei denn, der Klassenkampf interveniert), „frisches Blut“ erhält und „sich selbst reproduziert, indem er all seine Widersprüche einmal mehr und auf einer höheren Stufe aufwirft“. Es trifft zu, dass Battaglia vorgibt, keine Kenntnis davon zu haben, dass Marx über die Dekadenz schrieb – „bis hin zu der Tatsache, dass das Wort selbst nirgendwo in den drei Bänden, die das Kapital bilden, auftaucht“ (Internationalist Communist, Nr. 21, S. 23) – und dass Marx die Idee der Dekadenz nur ein einziges Mal in seinem gesamten Werk erwähnte: „Marx beschränkte sich selbst darauf, den Kapitalismus lediglich in jener historischen Phase als fortschrittlich zu definieren, als er die Wirtschaftswelt des Feudalismus eliminierte und sich selbst als mächtiges Entwicklungsmittel der Produktionsmittel vorstellte, die von der vorherigen Wirtschaftsform gehemmt worden waren, doch ging er niemals weiter in der Definition des Kapitalismus, ausgenommen in der berühmten Einleitung zu ‚Ein Beitrag zur Kritik der politischen Ökonomie‘“16. Nach unserer Auffassung würde Battaglia, statt hochtrabende Exkommunikationen gegen die Begriffe der Dekadenz und des Zerfalls zu verkünden, die dem Marxismus fremd seien, besser daran tun zu berücksichtigen, was Marx über Weitling feststellen musste: „Ignoranz ist kein Argument.“ Dann sollten die Genossen von Battaglia zu ihren Klassikern zurückgehen, insbesondere zum Kapital, das sie offensichtlich als ihre Bibel betrachten.17 Was uns anbelangt, so verweisen wir den Leser auf die Beschreibung des Marx'schen Konzeptes der Dekadenz in der Internationalen Revue Nr. 34.
Die marxistische Methode auf das Studium gewisser ökonomischer Mechanismen reduziert
Der Prozess der Dekadenz, wie ihn Marx definiert hat, geht weit über eine blosse „kohärente ökonomische Erklärung“ hinaus: Er korrespondiert an erster Stelle mit der historischen Alterung der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse (Lohnarbeit, Leibeigenschaft, Sklaventum, Stammesgesellschaft etc.) auf der Grundlage verschiedener Produktionsweisen (Kapitalismus, Feudalismus, Sklavenhaltergesellschaften, die asiatische Produktionsweise etc.). Der Eintritt in eine Periode der Dekadenz bedeutet, dass sich die eigentlichen Fundamente einer Produktionsweise in der Krise befinden. Das Sekret, die versteckte Gründung einer neuen Produktionsweise, ist „Die spezifische ökonomische Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den unmittelbaren Produzenten ausgepumpt wird. (...) Hierauf aber gründet sich die ganze Gestaltung des ökonomischen, aus den Produktionsverhältnissen selbst hervorwachsenden Gemeinwesens…“ und dies „.das innerste Geheimnis, die verborgne Grundlage der ganzen gesellschaftlichen Konstruktion“ 18 Marx hätte nicht ausdrücklicher sein können. „Hiermit war aber nachgewiesen, dass die Reichtumserwerbung der heutigen Kapitalisten ebensogut in der Aneignung von fremder, unbezahlter Arbeit besteht, wie die der Sklavenbesitzer oder der die Fronarbeit ausbeutenden Feudalherren, und dass sich alle diese Formen der Ausbeutung nur unterscheiden durch die verschiedene Art und Weise, in der die unbezahlte Arbeit angeeignet wird.“19 Die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse sind also mehr als blosse „ökonomische Mechanismen“: Sie sind vor allem gesellschaftliche Verhältnisse zwischen Klassen, da sie den verschiedenen Formen, die die Auspressung von Mehrwert annimmt (Lohnarbeit, Sklaverei, Leibeigentum, Zins etc.), erst die materielle Form verleiht. Wenn eine Produktionsweise in die Dekadenz eintritt, bedeutet dies, dass sich diese spezifischen Verhältnisse zwischen den Klassen in der Krise befinden, dass sie historisch ungeeignet sind. Dies ist der eigentliche Kern des historischen Materialismus in einer Welt, die Battaglia, besessen von seiner „kohärenten ökonomischen Erklärung“, völlig unerschlossen bleibt.
Wie Battaglia sagt: „Auch die Evolutionstheorie ist nicht gültig, der zu Folge der Kapitalismus historisch durch eine progressive Phase und eine dekadente Phase gekennzeichnet ist, falls keine kohärente ökonomische Erklärung gegeben wird (...) Die Untersuchung der Dekadenz unterscheidet entweder diese Mechanismen, die die Verlangsamung des Verwertungsprozesses des Kapitals regulieren, von all den Konsequenzen, die diese mit sich bringen, oder bleibt in einer falschen Perspektive gefangen, die aufgeblasene Prophezeiungen macht (…) Doch das Auflisten dieser ökonomischen und gesellschaftlichen Phänomene, sofern sie identifiziert und beschrieben worden sind, kann für sich genommen nicht als eine Demonstration der dekadenten Phase des Kapitalismus betrachtet werden. Sie sind lediglich Symptome, und die vorrangige Ursache, die sie zum Leben verhilft, muss im Gesetz der Profitkrise gesucht werden.“ (Revolutionary Perspectives, Nr. 32) Einerseits wird hier die Folgerung geäussert, dass heute keine kohärente ökonomische Erklärung der Dekadenz existiert, andererseits verfügt Battaglia vorbeugend, dass jene Phänomene, die klassischerweise dafür benutzt worden waren, um die Dekadenz einer Produktionsweise zu charakterisieren, irrelevant sind.
Bevor wir uns mit einer spezifisch ökonomischen Erklärung befassen, sollten wir darauf hinweisen, dass der Begriff der Dekadenz bedeutet, dass die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse zu eng geworden sind, um die Weiterentwicklung der Produktivkräfte zu gewähren, und dass die Kollision zwischen den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften jeden Aspekt der Gesellschaft betrifft. Die marxistische Analyse der Dekadenz bezieht sich nicht auf eine quantitative ökonomische Ebene ausserhalb der gesellschaftlichen und politischen Mechanismen einer gegebenen Gesellschaftsform. Im Gegenteil, sie bezieht sich auf die qualitative Ebene jenes Verhältnisses, das die Produktionsverhältnisse an die Entwicklung der Produktivkräfte bindet: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein.“20 Die Ära der Dekadenz der alten Gesellschaft wird nicht mit einer Blockade der Entwicklung der Produktivkräfte eröffnet, sondern mit einem endgültigen und unumkehrbaren „Konflikt“. Marx ist sehr genau bei diesem Kriterium: „Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um.“ Um genau zu sein, heisst dies, dass eine Gesellschaft niemals ihr Leben aushaucht, bevor die Weiterentwicklung der Produktivkräfte definitiv von den herrschenden Produktionsverhältnissen gehemmt wird. Die Dekadenz kann als eine Reihe von Funktionsstörungen definiert werden, deren Auswirkungen sich von dem Moment an häufen, wenn das System seine Entwicklungskapazitäten ausgeschöpft hat. Vom marxistischen Standpunkt aus wird die Periode der Dekadenz einer Gesellschaft nicht durch einen völligen und permanenten Stopp im Wachstum der Produktivkräfte charakterisiert, sondern durch quantitative und qualitative Umbrüche, die von diesem konstanten Konflikt zwischen obsoleten Produktionsverhältnissen und der Weiterentwicklung der Produktivkräfte verursacht werden.
Wann immer Marx versuchte, die Kriterien für den Eintritt des Kapitalismus in seine dekadente Periode festzulegen, gab er niemals irgendeine präzise ökonomische Erklärung, sondern höchstens dieses oder jenes allgemeine Kriterium in Zusammenhang mit seiner Krisenanalyse (s. unseren Artikel in der letzten Ausgabe von Internationale Revue). Es wird möglicherweise Battaglia nicht erfreuen, aber Marx benötigte keine nationalen Statistiken oder die ökonomische Wiedergenesung der Profitabilität, die Battaglia benutzt,21 um sich für die Reife des Kapitalismus oder für seine Alterung auszusprechen. Dasselbe trifft auf die anderen Produktionsweisen zu; Marx und Engels machten wenig Gebrauch von den präzisen ökonomischen Mechanismen, um den Eintritt in die Dekadenz zu erklären. Sie charakterisierten diese historischen Wendepunkte auf der Grundlage eindeutig qualitativer Kriterien: das Auftauchen eines allgegenwärtigen Prozesses der Behinderung der Entwicklung der Produktivkräfte, eine qualitative Entwicklung von Konflikten innerhalb der herrschenden Klasse und zwischen der herrschenden Klasse und den ausgebeuteten Klassen, die Überzogenheit des Staatsapparates, die Geburt einer neuen revolutionären Klasse, die in sich die neuen gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse trägt und eine Übergangsperiode herbeiführt, die Vorbote revolutionärer Erschütterungen ist, etc. (s. unseren Artikel in der letzten Ausgabe).
Dies war auch die Methode, die von der Kommunistischen Internationalen angenommen wurde, die nicht wartete, bis alle Komponenten einer „kohärenten ökonomischen Erklärung“ entdeckt waren, um im Ausbruch des I. Weltkrieges die Eröffnung der Periode der kapitalistischen Dekadenz zu identifizieren.22 Der Krieg und eine ganze Reihe anderer qualitativer Kriterien auf anderen Ebenen (gesellschaftlich, ökonomisch und politisch) brachte die KI zur Erkenntnis, dass der Kapitalismus seine historische Mission vollendet hatte. Die gesamte kommunistische Bewegung stimmte dieser Diagnose zu, auch wenn es wichtige Unstimmigkeiten gab, wie jene über ihre wirtschaftlichen Ursachen und die politischen Auswirkungen. Die ökonomischen Erklärungen variierten zwischen jener, die von Rosa Luxemburg auf der Basis der Sättigung des Weltmarkts vertreten wurde,23 und Lenins Erklärung auf der Grundlage seiner Argumente, die er in “Der Imperialismus – das höchste Stadium des Kapitalismus” entwickelt hatte.24
Und dennoch waren alle, auch Lenin, davon überzeugt, dass die „Epoche der fortschrittlichen Bourgeoisie“ zu Ende war und dass die Welt in die Epoche der reaktionären, überlebten Bourgeoisie” eingetreten war.25 In der Tat hatten die Differenzen etwas mit der Analyse der ökonomischen Ursachen der Dekadenz zu tun, vertrat doch Lenin, obwohl tief überzeugt von der Tatsache, dass die kapitalistische Produktionsweise in die Dekadenz eingetreten war, dennoch den Gedanken, dass der Kapitalismus “im grossen und ganzen (...) bedeutend schneller als früher” wächst.26 Trotzki hingegen, der auf derselben theoretischen Grundlage wie Lenin arbeitete, kam kurz darauf zu der Schlussfolgerung, dass die Entwicklung der Produktivkräfte zum Stillstand gekommen ist, während die Italienische Linke behauptete: „Der Krieg von 1914–18 markierte den äussersten Punkt in der Expansionsphase des kapitalistischen Regimes (…) In der letzten Phase des Kapitalismus, in jener seines Niedergangs, wird die historische Entwicklung grundsätzlich durch den Klassenkampf geregelt“ (Manifest des Internationalen Büros der Fraktionen der Kommunistischen Linken, in: Octobre, Nr. 3, April 1938)
Es mag unlogisch erscheinen, die Dekadenz einer Produktionsweise auf der Grundlage ihrer Ausdrücke zu identifizieren, und nicht auf der Grundlage einer Untersuchung ihrer ökonomischen Fundamente, wie Battaglia dies gern möchte, da Erstere „in letzter Instanz“ nichts anderes als das Produkt Letzterer sind. Dies ist jedoch die Art und Weise, wie Revolutionäre – einschliesslich Marx und Engels – in der Vergangenheit gearbeitet haben, nicht weil es im Allgemeinen einfacher ist, die Überbau-Strukturen in einer Dekadenzphase zu erkennen, sondern weil hier die ersten Ausdrücke zuerst historisch in Erscheinung treten. Ehe sie auf der quantitativen ökonomischen Ebene als Hemmnis der Weiterentwicklung der Produktivkräfte auftrat, erschien die Dekadenz des Kapitalismus vor allem als ein qualitatives Phänomen auf der sozialen, politischen und ideologischen Ebene durch die Verschlimmerung der Konflikte innerhalb der herrschenden Klasse, die zum I. Weltkrieg führten, durch den Verrat der Sozialdemokratie und das Überlaufen der Gewerkschaften zum kapitalistischen Lager, durch den Ausbruch eines Proletariats, fähig zum Sturz des bürgerlichen Rechts und zur Etablierung der ersten Massnahmen zur Kontrolle durch die Arbeiterklasse. Auf der Grundlage dieser Charakteristiken identifizierten die Revolutionäre zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Eintritt des Kapitalismus in die Dekadenz.27 .
Auch wartete Marx nicht auf die „kohärenten ökonomischen Erklärungen“, die im Kapital enthalten sind, um im Kommunistischen Manifest das Urteil über die historisch veraltete Natur des Kapitalismus zu fällen: „Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen.“ (Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, in: MEW Bd. 4, S. 468)
Battaglia weigert sich also, die Dekadenz einer Produktionsweise entsprechend der Methode zu definieren, die von unseren Vorgängern, angefangen bei Marx und Engels, angewandt wurden. Offensichtlich unter dem Eindruck, marxistischer als Marx zu sein, denken die Genossen, sie könnten sich als Materialisten profilieren, indem sie pausenlos wiederholen, dass das Konzept der Dekadenz ökonomisch definiert werden müsse, wenn es nicht für null und nichtig erklärt werden soll. Indem es so verfährt, demonstriert Battaglia, dass sein Materialismus von vulgärster Art ist, wie ihnen Engels mitgeteilt hätte, der sich in seinem Brief an J. Bloch sehr ungehalten darüber äusserte: „Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichts sagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus – politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate – Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch die siegende Klasse festgestellt usw. – Rechtsformen, und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse Anschauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schliesslich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten (d. h. von Dingen und Ereignissen, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder so unnachweisbar ist, dass wir ihn als nicht vorhanden betrachten, vernachlässigen können) als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfachen Gleichung ersten Grades. Dass von den jüngeren zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden müssen. Es ist aber leider nur zu häufig, dass man glaubt, eine neue Theorie vollkommen verstanden zu haben und ohne weiteres handhaben zu können, sobald man die Hauptsätze sich angeeignet hat, und das auch nicht immer richtig.“28 Ob es darum geht, die Dekadenz zu definieren, die Ursachen der Kriege zu erklären, das Gleichgewicht der Kräfte oder die gegenwärtige Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft zu analysieren, stets ist der Vulgärmaterialismus die Handelsmarke von Battaglia.29 Und nebenbei sei bemerkt, dass Battaglias Ausflucht in eine „kohärente ökonomische Erklärung“ der Dekadenz des Kapitalismus kaum all jenen Revolutionären gerecht wird, die bereits eine solche Erklärung angeboten haben, von Rosa Luxemburg über die italienische Fraktion30 bis hin zur IKS und gar zur CWO, deren erste Broschüre den Titel trägt „Die ökonomischen Fundamente der Dekadenz“! Es ist charakteristisch für den Marxismus, dass er von den früheren theoretischen Errungenschaften der Arbeiterbewegung ausgeht, um sie zu vertiefen oder zu kritisieren und Alternativen vorzuschlagen… Doch die marxistische Methode gehört nicht zu den Stärken von Battaglia: In der Annahme, dass die revolutionäre Kohärenz erst mit ihnen beginnt, ziehen es die Genossen vor, ganz von vorn anzufangen.
Battaglia leugnet die Haupterscheinungen der Dekadenz
Nachdem es Zweifel über den Wert des (angeblich „fatalistischen“) Konzepts der Dekadenz gesät hat, nachdem es voller Entschiedenheit erklärt hat, dass es keine kohärente ökonomische Erklärung der Dekadenz gibt und dass ohne diese ohne sie wertlos ist, und nach der Umdefinierung der marxistischen Methode geht Battaglia dazu über, die Hauptausdrücke der Dekadenz zu leugnen: „…. es ist absolut unzureichend, sich auf die Tatsache zu beziehen, dass in der dekadenten Phase die Wirtschaftskrise und Kriege ähnlich wie die Angriffe gegen die Arbeitskraft weltweit in einem beständigen und verheerenden Rhythmus auftreten. Auch in der progressiven Phase (…) traten punktuell Krisen und Kriege auf, genauso wie Angriffe gegen die Bedingungen der Arbeitskraft. Ein ausdrückliches Beispiel hierfür sind die Kriege zwischen den grossen Kolonialmächten Ende des 18. Jahrhunderts und während des gesamten 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Diesem Beispiel könnten noch weitere hinzugefügt werden, indem man die sozialen Angriffe und die häufigen militärischen Attacken gegen Klassenrevolten und Aufstände auflistet, die ebenfalls in dieser Periode stattfanden.“ (Revolutionary Perspectives, Nr. 32) Mit anderen Worten: alle Kriege und Krisen seit Beginn des 20. Jahrhunderts bedeuten nichts – sie haben stets existiert!
Mit unglaublicher Sorglosigkeit sowohl gegenüber dem Marxismus als auch gegenüber der schlichten historischen Realität wirft Battaglia mir-nichts-dir-nichts alle theoretischen Errungenschaften der vergangenen Arbeiterbewegung über Bord. Was sagt uns Battaglia? Dass Kriege und Krisen immer existiert haben – was so selbstverständlich wie banal ist. Doch welch Verwirrung stiftet Battaglia damit? Dass es folglich keinen qualitativen Bruch in der Geschichte des Kapitalismus gebe – und das ist schlichtweg blind!
Wenn Battaglia jeglichen qualitativen Bruch in der Entwicklung einer Produktionsweise leugnet, dann lehnt es die Analyse von Marx und Engels ab, die die Existent einer jeden Produktionsweise in zwei qualitativ unterschiedliche Phasen aufteilten. Für jeden, der des Lesens kundig ist, demonstriert die von Marx und Engels benutzte Sprache ohne die leiseste Zweideutigkeit, dass es zwei gesonderte historische Perioden innerhalb einer Produktionsweise gibt: „Über eine gewissen Punkt hinaus wird die Entwicklung…“, Auf einem gewissen Punkt angelangt…“, „kapitalistische System im Westen im Verblühen ist“ etc. Im ersten Artikel dieser Reihe haben wir ebenfalls gesehen, dass Marx und Engels in jeder Produktionsweise, die sie definierten (Urkommunismus, die asiatische Produktionsweise, Sklaverei, Feudalismus und Kapitalismus), eine Phase der Dekadenz ausfindig machten und dass sie diese Phase als qualitativ unterschiedlich zu der ihr vorausgehenden Phase anerkannten. In einem Artikel über die feudale Produktionsweise mit dem Titel „Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie“ (Friedrich Engels: Über den Verfall des Feudalismus und das Aufkommen der Bourgeoisie, MEW Bd. 21, S. 392) demonstrierte Engels die Macht des historischen Materialismus, indem er die feudale Dekadenz durch ihre wesentlichen Ausdrücke definierte: stagnierende Produktivkräfte, ein aufgeblähter (monarchischer) Staat, die qualitative Zuspitzung von Konflikten innerhalb der herrschenden Klasse und zwischen der herrschenden Klasse und den ausgebeuteten Klassen, das Herauskristallisieren eines Übergangs zwischen den alten und neuen Produktionsverhältnissen etc. Dasselbe trifft auf Marx' Definition der kapitalistischen Dekadenz zu, das heisst, in einer Periode, „…die wachsende Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihre bisherigen Produktionsverhältnissen…“,31 und er betrachtet diese Konflikte, Krisen und Erschütterungen als qualitativ verschieden gegenüber der vorausgehenden Periode, da er solche Begriffe wie „…an der Entwicklung der Produktivkräfte eine Schranke findet,“, „altersschwach“, etc. benutzt.
Es ist nur ein Minimum an historischen Kenntnissen notwendig, um die Absurdität von Battaglias Behauptung zu begreifen, dass es keinen qualitativen Bruch zwischen dem Aufstieg und der Dekadenz gebe, der seinen Ausdruck in den Krisen, Kriegen und sozialen Kämpfen findet.
1. Während der Aufstiegsphase des Kapitalismus nahmen seine Wirtschaftskrisen sicherlich sowohl in der Tiefe als auch im Ausmass zu. Doch man muss schon Battaglias Nerven (oder Ignoranz) besitzen, um zu glauben, dass die enorme Krise in den 1930er-Jahren als blosse Fortsetzung der Krisen im 19. Jahrhundert betrachtet werden kann! Beginnen wir damit, dass Battaglia ganz einfach vergisst, wie die Revolutionäre zu jener Zeit die relative Verminderung der Krisen in den letzten 20 Jahren (1894 – 1914) der kapitalistischen Aufstiegsperiode (die das Wachstum des Reformismus begünstigte) konstatierte die Kommunistische Internationale stellte fest: „Die den zwei Dezennien vor dem Krieg waren eine Epoche einer besonders mächtigen Entwicklung. Die Perioden des Aufschwungs zeichneten sich durc lange Dauer und hohe Intensität, die Perioden der Depression durch ihre kurze Dauer aus.“32 Dies passt kaum mit Battaglias „Theorie“ der ständigen Verschlimmerung der Wirtschaftskrisen zusammen. Darüber hinaus benötigt man schon eine gehörige Portion Chuzpe, um zu übersehen, dass die Krise der 1930er-Jahre alle Proportionen der Krisen des 19. Jahrhunderts sprengt, sowohl hinsichtlich ihrer Dauer (knappe zehn Jahre), ihrer Tiefe (Halbierung der Industrieproduktion) als auch hinsichtlich ihres Ausmasses (internationaler denn je). Noch schlimmer: Während die Krisen des kapitalistischen Aufstiegs durch die Steigerung der Produktion und eine Ausweitung des Weltmarktes gelöst wurden, wurde die Krise in den 1930er-Jahren nie überwunden und endete im II. Weltkrieg. Battaglia verwechselt hier die Herzschläge eines wachsenden Organismus mit dem Todesröcheln desselben in seinen letzten Zügen. Was die gegenwärtige Krise anbelangt, so dauert sie nun bereits 30 Jahre, und das Schlimmste kommt noch.
2. Was die sozialen Konflikte betrifft, so trifft es sicherlich zu, dass die gesamte Aufstiegsperiode wachsende Spannungen zwischen den Klassen erlebte, die in allgemeinen politischen Streiks (für das allgemeine Wahlrecht und den 8-Stunden-Tag) und im Massenstreik in Russland 1905 ihren Höhepunkt fanden. Doch man wäre mit Blindheit geschlagen, würde man übersehen, dass die revolutionären Bewegungen zwischen 1917–23 aus ganz anderem Holz geschnitzt waren. Es waren keine lokalen oder nationalen Bewegungen oder gar Aufstände, sondern eine sechsjährige internationale Welle, deren Dauer alle Bewegungen des 19. Jahrhunderts in den Schatten stellte. Es gibt auch einen qualitativen Unterschied: Diese Bewegungen waren zumeist nicht ökonomisch, sondern direkt revolutionär und stellten keine Forderungen nach Reformen, sondern nach der Machtergreifung auf.
3. Was schliesslich den Krieg anbetrifft, so ist der Gegensatz noch frappierender. Während des 19. Jahrhunderts bestand die Funktion des Krieges darin, die Einheit jeder kapitalistischen Nation (nationale Unabhängigkeitskriege) und/oder die für ihre Entwicklung notwendige territoriale Expansion (Kolonialkriege) sicherzustellen. In diesem Sinne war der Krieg trotz der Katastrophen, die er mit sich brachte, ein Moment in der Weiterentwicklung des Kapitalismus; seine Kosten waren einfach eine notwendige Ausgabe für die Erweiterung des Marktes und somit der Produktion. Daher betrachtete Marx bestimmte Kriege als fortschrittlich. Die Kriege jener Periode waren im Allgemeinen :
a) begrenzt auf zwei oder drei benachbart
Länder;
b) von geringer Dauer;
c) ohne grössere Schäden;
d) ein Kampf zwischen stehenden Armeen, die nur einen kleinen Teil der Wirtschaft oder der Bevölkerung mobilisierten;
e) ausgeführt wegen der rationalen Aussicht auf ökonomischem Gewinn;
Sowohl für Sieger als auch für Besiegte bedeuteten sie eine neue wirtschaftliche Expansion. Der deutsch-französische Krieg 1870 ist ein typisches Beispiel hierfür: Er war ein entscheidender Schritt zur Bildung der deutschen Nation; mit anderen Worten, er legte die Fundamente für eine gewaltige Expansion der Produktivkräfte und für die Schaffung des grössten Sektors des europäischen Industrieproletariats. Ferner dauerte dieser Krieg weniger als ein Jahr und verursachte relativ wenig Opfer. Auch bildete er kein ernstes Handicap für das besiegte Land. Während der Aufstiegsperiode waren Kriege im Wesentlichen das Produkt eines expandierenden Systems:
a) 1790–1815: Kriege der Französischen Revolution und des napoleonischen Reiches (die zum Sturz der Feudalmächte in ganz Europa beitrugen);
b) 1850–1873: der Krimkrieg, der amerikanische Bürgerkrieg, Kriege der nationalen Einheit (Deutschland, Italien), mexikanischer und deutsch-französischer Krieg;
c) 1895–1913: spanisch-amerikanischer, russisch-japanischer und Balkankrieg.
Bis 1914 gab es ein Jahrhundert lang keinen richtig grossen Krieg. Die meisten Kriege zwischen den Grossmächten blieben verhältnismässig kurz, dauerten allenfalls Monate oder gar nur Wochen (der Krieg zwischen Preussen und Österreich 1866). Zwischen 1871 und 1914 wurde kein europäisches Land Opfer einer Invasion. Es hat keinen Weltkrieg gegeben. Zwischen 1815 und 1914 wurde kein Krieg zwischen den Grossmächten ausserhalb ihrer Nachbarregionen geführt. All dies änderte sich 1914, als ein Zeitalter des Abschlachtens eingeläutet wurde. 33
In der Dekadenzperiode sind die Kriege das Produkt eines Systems, dessen Dynamik nur in eine Sackgasse führen kann. In einer Periode, in der es nicht mehr um die Schaffung wirklich unabhängiger Nationalstaaten geht, sind alle Kriege imperialistisch. Die Kriege zwischen den Grossmächten a) neigen dazu, Weltkriege zu werden, weil ihre Wurzeln in der Schrumpfung des Weltmarktes im Verhältnis zu den Erfordernissen der Kapitalakkumulation liegen; b) dauern weitaus länger an; c) sind immens zerstörerisch; d) mobilisieren die gesamte Weltwirtschaft und die gesamte Bevölkerung der Krieg führenden Länder; e) haben vom Standpunkt des globalen Kapitals jede fortschrittliche wirtschaftliche Funktion verloren und sind völlig irrational geworden. Sie sind nicht mehr Elemente in der Entwicklung der Produktivkräfte, sondern Mittel zu ihrer Zerstörung. Sie sind nicht mehr Momente in der Expansion der Produktionsweise, sondern Zuckungen eines sterbenden Systems. In der Vergangenheit endeten Kriege mit einem klaren Gewinner, und der Ausgang des Krieges beeinflusste nicht die künftige Entwicklung der Protagonisten, wohingegen in den beiden Weltkriegen sowohl Sieger als auch Besiegte vom Krieg ausgezehrt wurden, zugunsten eines dritten Gangsters, den Vereinigten Staaten. Die Sieger waren nicht im Stande, die Besiegten zu zwingen, Kriegsreparationen zu zahlen (im Gegensatz zum riesigen Lösegeld in Gold, das nach 1870 von Frankreich an Preussen gezahlt wurde). Dies zeigt, wie in der Dekadenzperiode die Expansion der einen Macht nur zum Ruin Anderer führen kann. Früher garantierte die Militärmacht die Eroberungen ökonomischer Positionen. Heute steht die Wirtschaft in wachsendem Masse zu Diensten der Militärstrategie. Die Teilung der Welt in rivalisierende Imperialisten und die daraus resultierenden militärischen Konflikte zwischen ihnen sind zu permanenten Aspekten in der Existenz des Kapitalismus geworden. Dies war das Ergebnis der Analyse unserer Vorgänger, der Italienischen Linken: „Seit der Eröffnung der imperialistischen Phase des Kapitalismus zu Beginn des Jahrhunderts schwankt die Evolution zwischen dem imperialistischen Krieg und der proletarischen Revolution. In der Epoche des kapitalistischen Wachstums öffneten Kriege den Weg zur Ausweitung der Produktivkräfte durch die Zerstörung überholter Produktionsverhältnisse. In der Dekadenzphase haben Kriege keine andere Funktion als die Vernichtung des überschüssigen Reichtums…“ (Resolution über die Bildung des Internationalen Büros der Fraktionen der Kommunistischen Linken, in: Octobre,
Nr. 1, Februar 1938, S. 5) Battaglia lehnt heute diese Analyse ab und behauptet dennoch, Erbe der Italienischen Linken zu sein.
All dies ist in den Analysen der Revolutionäre des letzten Jahrhunderts enthalten,34 und Battaglia amüsiert sich lediglich darüber, indem es versucht, unsere Vorgänger mit der sarkastischen Frage zu ignorieren: „Und wann, folgt man dieser Art, die Frage zu stellen, trat der Übergang von der progressiven zur dekadenten Phase auf? Am Ende des 19. Jahrhunderts? Nach dem Ersten Weltkrieg? Nach dem zweiten?“. Battaglia weiss – oder sollte es wissen – sehr gut, dass für die gesamte kommunistische Bewegung, einschliesslich der Mitgefährten des IBRP, die Communist Workers Organisation, der I. Weltkrieg den Eintritt des Kapitalismus in die Dekadenz bedeutete: „Zurzeit der Bildung der Komintern 1919 wurde es offensichtlich, dass die Epoche der Revolution erreicht war, und ihre Gründungskonferenz erklärte dies.“35
In diesem Artikel haben wir versucht aufzuzeigen, dass es nichts Fatalistisches an der marxistischen Sichtweise der kapitalistischen Dekadenz gibt und dass die Geschichte des Kapitalismus nicht ein endloser Kreis von Wiederholungen ist. Im nächsten Artikel werden wir unsere Kritik an Battaglia fortsetzen und vor allem auf all die Folgen hinweisen, die eintreten, wenn sich vom Begriff der Dekadenz auf der Ebene des politischen Kampfes des Proletariats abwendet.
C.Mcl.
Fußnoten:
1 s. International Review Nrn. Nr. 48, 49, 50, 54, 56, 58 und 60 (engl., frz., span. Ausgabe). Und auf Deutsch: Die Dekadenz verstehen in: Internationale Revue Nrn. 10–12. Und unserer Website.
2 Veröffentlicht auf Italienisch in Prometeo, Nr. 8, Reihe VI (Dezember 2003) und auf Englisch in Revolutionary Perspectives, Nr. 32, dritte Serie, Summer 2004. Eine französische Version ist über die IBRP-Website erhältlich. Weitere Referenzen zur Dekadenztheorie können im Artikel Kommentare über die jüngste Krise der IKS, in Internationalist Communist, Nr. 21, gefunden werden.
3 s. International Review Nrn. 111, 115 und besonders 118. (engl., frz., span. Ausgabe).
4 Die Communist Workers Organisation war mit Battaglia Comunista Mitbegründer des IBRP.
5 In ihrer Einführung zum Artikel von Prometeo schreibt die CWO: „Wir veröffentlichen unten einen Text der Genossen von Battaglia Comunista, der einen Beitrag zur Debatte über die kapitalistische Dekadenz darstellt. Der Begriff der Dekadenz ist ein Teil von Marxens Analyse der Produktionsweisen. Der klarste Ausdruck dafür wird in dem berühmten Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie gegeben, wo Marx feststellt: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein.“ (Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, MEW Bd. 13, S. 9) Zurzeit der Bildung der Komintern 1919 schien es, dass die Epoche der Revolution erreicht war, und ihre Gründungskonferenz erklärte dies. 85 Jahre später erschient dies zumindest fraglich. Innerhalb des 20. Jahrhunderts haben die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse trotz der von zwei Weltkriegen verursachten unerhörten Zerstörung und Leiden die Produktivkräfte in die Lage versetzt, sich in nie gekannter Weise weiterzuentwickeln, und Hunderte von Millionen neuer Arbeiter in die Reihen des Proletariats eingegliedert. Kann unter diesen Umständen argumentiert werden, dass diese Verhältnisse in dem allgemeinen Sinn, den Marx unterstrichen hat, eine Fessel der Produktivkräfte sind? Die CWO hat früher argumentiert, dass nicht die Abwesenheit von Wachstum der Produktivkräfte, sondern die allgemeinen Unkosten, die mit einem solchen Wachstum verbunden sind, betrachtet werden müssen, wenn man die Dekadenz beurteilt. Solch ein Argument öffnet, während es das massive Wachstum der Produktivkräfte anerkennt, die Tür für eine subjektive Beurteilung der allgemeinen Unkosten, die ein solches Wachstum ermöglicht haben. Der Text weiter unten streitet für eine wissenschaftliche Herangehensweise besonders an die Frage der ökonomischen Definition der Dekadenz. Wir hoffen, weitere Texte über dieses Thema in Zukunft veröffentlichen zu können.“ (Revolutionary Perspectives, Nr. 32, unsere Hervorhebung) Wir werden später in dieser Reihe auf die Argumente zurückkommen, die die CWO vorbringt, um den Begriff der Dekadenz, wie er von Marx definiert wurde, in Frage zu stellen: die Dynamik in der Entwicklung der Produktivkräfte, das numerische Wachstum der Arbeiterklasse und die Bedeutung der beiden Weltkriege. Im Moment muss die Veröffentlichung dieser Einführung ausreichen, um unseren Lesern eine Ahnung von dem Entwicklungsgang im Denken der CWO zu geben, die in der Vergangenheit die marxistische Definition der Dekadenz stets als einen zentralen Angelpunkt ihrer Plattform betrachtet hat. In der Tat trug die erste Broschüre der CWO den Titel Die ökonomischen Fundamente der kapitalistischen Dekadenz. Sollen wir heute daraus den Schluss ziehen, dass die ökonomischen Fundamente dieser Broschüre nicht wissenschaftlich waren?
6 Karl Marx: Das Kapital, MEW Bd. 25, S. 273.
7 Karl Marx: Brief an V. I. Sassulitsch, . MEW Bd. 19, S. 387.
8 Karl Marx: Das Kapital, MEW Bd. 25, S. 252.
9 s. Revolutionary Perspectives, Nr. 32, oben zitiert.
10 Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte,in: MEW Bd. 8, S. 115.
11 Rosa Luxemburg, Junius-Broschüre (Die Krise der Sozialdemokratie),in: Werke Bd. 4, S. 61.
12 Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, in: MEW Bd. 4, S. 462.
13 Diese Thesen wurden in Paris von der Imprimerie spéciale de la Librairie du Travail unter dem Titel Plattform der Linken veröffentlicht. Eine andere französische Übersetzung ist über die Edition Programme Communiste erhältlich: Die Krise des Kapitalismus bleibt offen, und ihre weitere Verschlimmerung ist unvermeidlich, veröffentlicht in der Anthologie Nr. 7 von Texten der Parti Communiste International mit dem Titel Die Verteidigung der Kontinuität des kommunistischen Programms.
14 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 635.
15 Wir sollten unsere Leser darauf hinweisen, dass sich nicht einmal Battaglia dessen sicher ist! Anscheinend sind sich die Genossen nicht einmal sicher, ob der Kapitalismus an wachsenden Krisen und Widersprüchen leidet: „Die Verkürzung der Aufschwungsphase der Akkumulation könnte ebenfalls als ein Aspekt der ‚Dekadenz‘ betrachtet werden, doch die Erfahrungen aus dem letzten Zyklus zeigen, dass die Verkürzung der aufsteigenden Phase nicht notwendigerweise die Beschleunigung des Gesamtzyklus der Akkumulation, Krise, Krieg, neue Akkumulation, mit sich bringt.“ (Internationalist Communist, Nr. 21)
16 Revolutionary Perspectives, Nr. 32.
17 In Internationalist Communist, Nr. 21, sagt das IBRP, dass es „ein internationales Dokument/Manifest verteilte (…) (das) neben einem dringenden Aufruf zur internationalen Partei auch beabsichtigt, eine seriöse Einladung an all jene zu sein, die behaupten, zur kommunistischen Avantgarde zu gehören.“ Wenn das IBRP wirklich ernst genommen werden will, dann muss es anfangen, die Fundamente des historischen Materialismus zu begreifen und Polemiken auf der Grundlage wirklich politischer Argumente zu führen, statt Selbstgespräche zu führen und Bannsprüche zu fällen, deren Ursprung in einem Anfall typisch bordigistischen Grössenwahns liegen, welcher sie einbilden lässt, die einzigen Wächter der marxistischen Wahrheit und weltweit der einzige revolutionäre Umgruppierungspol zu sein.
18 Karl Marx Das Kapital, MEW Bd. 25, S. 799/800.
19 Friedrich Engels, Karl Marx, in: MEW Bd. 19, S. 105–106.
20 Karl Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 13, S. 9.
21 „In einfachen Begriffen betrifft das Dekadenzkonzept allein die fortschreitenden Schwierigkeiten beim Verwertungsprozess des Kapitals (…) Die stetig wachsenden Schwierigkeiten im Verwertungsprozess des Kapitals haben zu ihrer Voraussetzung den tendenziellen Fall der durchschnittlichen Profitrate (…) Selbst Ende der 60er-Jahre waren entsprechend der Statistiken, die von internationalen Wirtschaftsorganisationen wie der IWF, die Weltbank und auch das Massachusetts Institute für Technologie sowie jüngst in den Untersuchungen von Ökonomen des marxistischen Gebiets, wie Ochoa und Mosley, herausgegeben wurden, die Profitraten in den USA 30% niedriger als in den 50er-Jahren…“ (Revolutionary Perspectives, Nr. 32)
22 „2. Die Niedergangsperiode des Kapitalismus
Nach Abschätzung der ökonomischen Weltlage konnte der 3. Kongress mit vollkommener Bestimmtheit konstatieren, dass der Kapitalismus nach Erfüllung seiner Mission, die Entwicklung der Produktion
zu fördern, in unversöhnlichen Widerspruch zu den Bedürfnissen nicht nur der gegenwärtigen historischen Entwicklung, sondern auch der elementarsten menschlichen Existenzbedingungen geraten ist. Im letzten imperialistischen Kriege spiegelte sich dieser fundamentale Widerspruch wider, der durch den Krieg noch verschärft wurde und der die Produktions- und Zirkulationsverhältnisse den schwersten Erschütterungen aussetzte. Der überlebte Kapitalismus ist in das Stadium getreten, in dem die Zerstörungsarbeit seiner zügellosen Kräfte die schöpferischen, wirtschaftlichen Errungenschaften, die das Proletariat noch in den Fesseln kapitalistischer Knechtschaft geschaffen hat, lähmt und vernichtet. (…) Was der Kapitalismus heute durchmacht, ist nichts anderes als sein Untergang. Der Zusammenbruch des Kapitalismus ist unabwendbar.“ (Thesen über die Taktik der Komintern des 4. Kongresses, in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen,
Bd. 2, S. 9, Intarlit 1984).
23 „Der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Er ist aber zugleich die erste, die allein, ohne andere Wirtschaftsformen als ihr Milieu und ihren Nährboden, nicht zu existieren vermag, die also gleichzeitig mit der Tendenz, zur Weltform zu werden, an der inneren Unfähigkeit zerschellt, eine Weltform der Produktion zu sein. Er ist ein lebendiger historischer Widerspruch in sich selbst, seine Akkumulationsbewegung ist der Ausdruck, die fortlaufende Lösung und zugleich Potenzierung des Widerspruchs. Auf einer gewissen Höhe der Entwicklung kann dieser Widerspruch nicht anders gelöst werden als durch die Anwendung der Grundlagen des Sozialismus – derjenigen Wirtschaftsform, die zugleich von Hause aus Weltform und in sich ein harmonisches System, weil sie nicht auf die Akkumulation, sondern auf die Befriedigung der Lebensbedürfnisse der arbeitenden Menschheit selbst durch die Entfaltung aller Produktivkräfte des Erdrundes gerichtet sein wird.“ (R. Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, in: Werke Bd. 5, S. 411)
24 Aus allem, was über das ökonomische Wesen des Imperialismus gesagt wurde, geht hervor, dass er charkterisiert werden muss, als Übergangskapitalismus (...) Es ist eben der Parasitismus und die Fäulnis des Kapitalismus, die seineinem höchsten geschichtlichen Stadium, d. h. dem Imperialismus eigen sind (...) Der Imperialismus ust de Vorabend der sozialen Revolution. Das hat sich 1917 im Weltmasstab bestätigt.” (W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in LW Bd. 22, S. 307 und 198).
25 „…Die russischen Sozialchauvinisten (an ihrer Spitze Plechanow) berufen sich auf die Taktik von Marx im Kriege von 1870; die deutschen Sozialchauvinisten (vom Schlage der Lensch, David und Co.) berufen sich auf die Erklärungen von Engels im Jahre 1891, in denen er von der Pflicht der deutschen Sozialisten spricht, im Falle eines gleichzeitigen Krieges gegen Russland und Frankreich das Vaterland zu verteidigen (…) Alle diese Berufungen sind eine empörende Fälschung der Auffassungen von Marx und Engels zugunsten der Bourgeoisie und der Opportunisten (…) Wer sich jetzt auf Marx' Stellungnahme zu den Kriegen in der Epoche der fortschrittlichen Bourgeoisie beruft und Marx' Worte „Die Arbeiter haben kein Vaterland“ vergisst – diese Worte, die sich gerade auf die Epoche der reaktionären, überlebten Bourgeoisie beziehen, auf die Epoche dersozialistischen Revolution –, der fälscht Marx schamlos und ersetzt die sozialistische Auffassung durch die bürgerliche.“ (W. I. Lenin, Sozialismus und Krieg, in: LW Bd. 21, S. 295 ff.)
26 „Es wäre ein Fehler, zu glauben, dass diese Fäul-nistendenz ein rasches Wachstum des Kapitalismus ausschliesst; durchaus nicht, einzelne Industriezweige, einzelne Schichten der Bourgeoisie und einzelne Länder offenbaren in der Epoche des Imperialismus mehr oder minder stark bald die eine, bald die andere dieser Tendenz. Im grossen und ganzen wächst der Kapitalismus bedeutend schneller als früher, aber dieses Wachstum wird nicht nur im allgemeinen immer ungleichmässiger, sondern die Ungleichmässigkeit äussert sich auch im besonderen in der Fäulnis der kapitalkräftigsten Länder (England).“ (W. I. Lenin, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, in: LW Bd. 22, S. 305.)
27 „Wenn der Kapitalismus einmal in die Dekadenz eingetreten ist, wenn er bewiesen hat, dass er in eine historische Sackgasse geraten ist, sind es deshalb hauptsächlich politische Faktoren, die den Zeitpunkt des Kriegsausbruchs bestimmen.“ s. Bericht über die internationale Lage für den 9. Internationalen Kongress, in: International Review Nr. 67 (frz., engl., span. Ausgabe).
28 Engels an Bloch, 21. September 1890, in: MEW Bd. 37, S. 462 ff.
29 In diesen Fragen siehe unsere Kritik an Battaglia Comunista's politischen Positionen in International Review, Nr. 36, Die 1980er sind nicht die 1930er-Jahre; Nr. 41, Welche Methode zum Verständnis des Klassenkampfes; Nr. 50, Antwort an Battaglia über den historischen Kurs; Nr. 79, Die Auffassung des IBRP über die Dekadenz des Kapitalismus und die Kriegsfrage; Nr. 82, Antwort an das IBRP: der Charakter des imperialistischen Krieges; Nr. 83, Antwort an das IBRP: Theorien der historischen Krise des Kapitalismus; Nr. 86, Hinter der Globalisierung der Wirtschaft die Verschlimmerung der kapitalistischen Krise Nr. 108, Polemik mit dem IBRP: der Krieg in Afghanistan – Strategie oder Ölprofite?
30 s. den Artikel aus Bilan, Nr. 10–11, 1934, Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des dekadenten Kapitalismus, in” Internationale Review, Nr. 27 und 28.
31 Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 635
32 s. Thesen zur Weltlage und die Aufgaben der Kommunistische Internationale des 3. Weltkongresse, in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd. 2, S. 9, Intarlit (1984).
33 Dies wurde von Engels lange vor dem Ende des 19. Jahrhunderts vorausgesagt: Friedrich Engels sagt einmal: „Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein „Rückfall in die Barbarei” auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein grosser Friedhof; oder Sieg des Sozialismus, d. h. der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder – Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats. Die Zukunft der Kultur und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert mit männlichem Entschluss in die Waagschale wirft.“ (R. Luxemburg, Juniusbroschüre – Die Krise der Sozialdemokratie, in: Gesammelte Werke Bd. 4, S. 62).
34 „Eine neue Epoche ist geboren: die Epoche der Auflösung und des Zusammenbruchs des Kapitalismus, die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats“ (Richtlinien des 1. Kongresses der Kommunistischen Internationale).
„Der theoretisch klare Kommunismus muss dagegen den Charakter der gegenwärtigen Epoche richtig einschätzen. (Höhepunkt des Kapitalismus; imperialistische Selbstverneinung und Selbstvernichtung; ununterbrochenes Anwachsen des Bürgerkriegen usw.)“ (Leitsätze über die Kommunistischen Parteien und den Parlamentarismus des 2. Kongresses der Kommunistischen Internationale)
„Die III. Kommunistische Internationale, gegründet im März 1919 in der Hauptstadt der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik, Moskau, erklärt feierlich vor der ganzen Welt, dass sie es auf sich nimmt, das grosse Werk, welches von der I. Internationalen Arbeiter-Assoziation begonnen wurde, fortzusetzen und zu Ende zu führen. (…) Die III. Kommunistische Internationale bildete sich beim Ausbruch des imperialistischen Krieges 1914–1918, in welchem die imperialistische Bourgeoisie der verschiedenen Länder 20 Millionen Menschen opferte. (…) „Gedenke des imperialistischen Krieges!” das ist das erste, womit die Kommunistische Internationale sich an jeden Werktätigen wendet, wo er auch leben mag, in welcher Sprache er auch sprechen mag. . Gedenke dessen, dass dank des Bestehens der kapitalistischen Ordnung ein kleines Häuflein von Imperialisten die Möglichkeit hatte, im Verlauf von vier langen Jahren die Arbeiter der verschiedenen Länder zu zwingen, einander den Hals abzuschneiden! Gedenke dessen, dass der Krieg .der Bourgeoisie über Europa und die ganze Welt die fürchterlichste Hungersnot und das entsetzlichste Elend, heraufbeschwor! Gedenke dessen, dass ohne den Sturz des Kapitalismus die Wiederholung von derartigen Raubkriegen nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist. (…) Die Kommunistische Internationale stellt sich zum Ziel: mit allen Mitteln, auch mit den Waffen in der Hand, für den Sturz der internationalen Bourgeoisie und für die Schaffung einer internationalen Sowjetrepublik, als Übergangsstufe zur vollen Vernichtung des Staates, zu kämpfen. Die Kommunistische Internationale hält die Diktatur des Proletariats für das einzige Mittel, welches -die Möglichkeit gibt, die Menschheit von den Greueln des Kapitalismus zu befreien. (Statuten der Kommunistischen Internationale vom 2. Kongress)
Alle drei Zitate in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd. 2, S. 9, Intarlit (1984).
35 Die Einführung der CWO zu Battaglias Artikel in Revolutionary Perspectives, Nr. 32.
Politische Strömungen und Verweise:
- Battaglia Comunista [124]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Italienische Linke [35]
Erbe der kommunistischen Linke:
Der Nucleo Comunista Internacional in Argentinien: Eine Episode im Streben des Proletariats nach Bewusstsein
- 2663 Aufrufe
Der NCI(5) war das Ziel einer furiosen Offensive, die vom "Dreierbündnis" des Opportunismus (das Internationale Büro für die Revolutionäre Partei – IBRP), der Parasiten (die so genannte "Interne Fraktion" der IKS – IFIKS) und eines merkwürdigen, grössenwahnsinnigen Abenteurers, der gleichzeitig Gründer, oberster Führer und einziges Mitglied eines "Zirkels kommunistischer Internationalisten" ist und der für sich selbst die "Kontinuität" mit dem NCI beansprucht, den er aus guten Gründen zerstört haben will, wie er behauptet.(6)
In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie der NCI entstand, wie er den Kontakt zur IKS herstellte, wie sich seine Beziehungen zu unserer Organisation entwickelten und welche Lehren wir dieser Erfahrung entnehmen können. Wir werden uns auch damit befassen, worin die Perspektiven für unsere künftige Arbeit bestehen, jetzt, wo wir den grotesken Betrüger entlarvt haben, dessen Manöver die Unterstützung des IBRP genossen, das versuchte, ihn zu benutzen, um die IKS anzugreifen, selbst wenn es bedeutete, den im Werden begriffenen NCI zu zerstören.
Diese Analyse hat ein doppeltes Ziel: zum einen für den Kampf einer Handvoll Militanter einzutreten, die Ausdruck des Beitrages des argentinischen Proletariats zum allgemeinen Kampf des Weltproletariats sind; zum anderen einige Lehren aus dieser Suche nach einem internationalen kommunistischen Zusammenhang zu ziehen und sowohl die Hindernisse und Schwierigkeiten auf diesem Weg als auch die Stärken, auf wir uns verlassen können, näher zu beleuchten.
Die Geburt des NCI: erste Kontakte mit der IKS
In einem Brief (12. November 2003), der den politischen Werdegang des NCI und seiner Mitglieder erläuterte, stellte sich der NCI selbst als "eine kleine Gruppe von Genossen mit unterschiedlichem politischen Hintergrund, mit unterschiedlichen Aktivitäten in der Massenbewegung und unterschiedlicher politischer Verantwortung (dar). Doch wir alle teilen dieselben politischen Wurzeln: die argentinische Kommunistische Partei (…) Während der 90er-Jahre traten einige von uns der Partito Obrero und der Partito de Trabajadores bei (zwei trotzkische Organisationen, d.Red.), während Andere Zuflucht in gewerkschaftlichen Aktivitäten suchten. Der erste Kern tauchte im Grunde in der Abspaltung einer kleinen Fraktion der PTS, die LOI, auf; nach mehreren Diskussionen im Verlaufe des Jahres 2'000 und Anfang 2003 (Januar – Februar) entschieden wir uns aufgrund prinzipieller Unterschiede, uns nicht mit dieser trotzkistischen Strömung zu vereinigen." Daraufhin begann ein schwieriger Prozess, der die Genossen dazu führte, sich "dank des Internet mit Euren Positionen und jenen der anderen Strömungen vertraut (zu machen), die jenem Milieu angehören, das als Kommunistische Linke bekannt ist. Wir teilten die Dokumente, die meisten von der IKS und dem IBRP, unter uns auf und lasen sie bis Ende 2002".
Verlaufe des Jahres 2003 führte dieses Studium der Positionen der verschiedenen linkskommunistischen Strömungen die Genossen zu den Positionen der IKS: "Was uns an der IKS am meisten fesselte, waren nicht nur Eure programmatischen Fundamente, sondern auch – unter all den Dokumenten, die wir auf Eurer Website zu Rate zogen – die Debatten mit den russischen Genossen, die Frage des historischen Kurses, die Theorie der Dekadenz des Kapitalismus, die Positionen, die die Partei und ihr Verhältnis zur Klasse betreffen, die Analyse der Situation in Argentinien und die Debatte mit dem IBRP über die Parteifrage."
Dieses Studium führte die Gruppe dazu, programmatische Positionen anzunehmen, die sich stark an die Plattform der IKS anlehnen, eine Zeitung herauszugeben (Revolución Comunista, vier Ausgaben zwischen Oktober 2003 und März 2004) und im Oktober 2003 den Kontakt zur IKS herzustellen.
Der Appell des NCI an das politische Milieu des Proletariats
Dann begann ein zweigleisiger Prozess: auf der einen Seite mehr oder weniger systematische Diskussionen über die IKS-Positionen und auf der anderen Seite eine Intervention gegenüber dem Proletariat in Argentinien, die sich auf die brennenden Tagesfragen konzentrierte: vor allem zu verstehen, ob die Ereignisse im Dezember 2001 in Argentinien ein Schritt vorwärts im proletarischen Kampf oder ein Aufstand ohne jegliche Perspektive waren. Ein Artikel, der am zweiten Jahrestag dieser Ereignisse verfasst wurde, stellt klar und deutlich fest, dass "das Hauptziel dieses Schriftstücks ist, die Irrtümer offen zu legen, die von vielen Strömungen in der Presse, in Flugblättern, Broschüren etc. verbreitet wurden, in denen die Ereignisse in Argentinien zwei Jahre zuvor als etwas beschrieben wurden, was sie nicht waren, nämlich ein proletarischer Kampf."
Wir führten übers Internet eine Diskussion über die Gewerkschaftsfrage, die es dem NCI ermöglichte, die Überbleibsel der linksextremistischen Vision einer "Arbeit in den Gewerkschaft, um die Basis gegen die Führung in Stellung zu bringen", zu klären und hinter sich zu lassen. Die Diskussion war brüderlich und aufrichtig, und zu keiner Zeit wurde unsere Kritik als "Drangsalierung" oder "Bannfluch" betrachtet.(7)
Im Dezember 2003 richtete das NCI einen Appell an das politische Milieu zur Abhaltung von internationalen Konferenzen, "mit der präzisen Absicht, einen Pol der Zusammenarbeit und Information zu schaffen, wo die mannigfaltigen Organisationen ihre politischen Divergenzen auf programmatischer Ebene debattieren können und was es ermöglichen könnte, gemeinsame Aktionen gegen die Feinde der Arbeiterklasse, gegen die Bourgeoisie, zu unternehmen, ob durch die Publizierung gemeinsamer Dokumente oder durch die Organisierung von öffentlichen Treffen der fortgeschrittensten Elemente des Proletariats, die deutlich machen, sowohl was uns zu trennt als auch was uns verbindet, oder durch anderen Initiativen, die vorgeschlagen werden."
Es war der IKS klar, dass dieser Appell dem vorherrschenden Sektierertum und der Unverantwortlichkeit der Mehrheit der Gruppen der Kommunistischen Linken vor den Kopf stossen würde. Dennoch unterstützten wir diese Initiative insoweit, als sie auf der Offenheit der Diskussion und der Konfrontation von Positionen basierte und von der Bereitschaft gekennzeichnet war, gemeinsame Aktionen gegen den kapitalistischen Feind zu unternehmen: "Wir begrüssen Euren Vorschlag, eine neue Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken abzuhalten (ein ‚neues Zimmerwald‘, wie Ihr es genannt habt). Die IKS hat stets diese Perspektive vertreten und sich begeistert an den drei Konferenzen beteiligt, die Ende der 1970er und Anfang der 1980er veranstaltet worden waren. Unglücklicherweise sind, wie Ihr sicherlich wisst, die anderen Gruppen der Kommunistischen Linken der Auffassung, dass solche Konferenzen angesichts der tiefen Uneinigkeit unter den mannigfaltigen Gruppen der Kommunistischen Linken nicht auf der Tagesordnung stünden. Wir sind nicht dieser Auffassung, doch wie das Sprichwort sagt: ‚Es braucht nur einen, um sich scheiden zu lassen, aber zwei, um zu heiraten‘. Es ist klar, dass es in der gegenwärtigen Periode keinen Zweifel über die Notwendigkeit einer ‚Heirat‘ (d.h. die Umgruppierung in einer einzigen Organisation) zwischen den verschiedenen Strömungen der Kommunistischen Linken gibt."
In diesem allgemeinen Rahmen stellten wir eine Orientierung vor, um die Arbeit der kleinen Gruppen, die in etlichen Ländern auf der Grundlage von Klassenpositionen erschienen sind bzw. dabei sind, sich ihnen zu nähern, anzuleiten: "Dies bedeutet nicht, dass eine ‚Heirat‘ in der gegenwärtigen Periode unmöglich ist. In Wirklichkeit ist sie, wenn zwei Organisationen zu einer programmatischen Übereinstimmung auf der Basis einer gemeinsamen Plattform kommen, nicht nur möglich, sondern eine Notwendigkeit: Das Sektierertum, von dem viele Gruppen der Kommunistischen Linken betroffen sind (und das zum Beispiel zur Zersplitterung der bordigistischen Gruppierungen in einer Vielfalt von Denkschulen führte, deren programmatische Differenzen schwer nachzuvollziehen sind), ist der Preis, den die Kommunistische Linke noch immer für die fürchterliche Konterrevolution zahlt, welche die Arbeiterklasse in den 1920er-Jahren getroffen hatte" (unser Brief vom 25. November 2003).
Erstes Treffen mit dem NCI
Abgesehen von der IKS kamen die einzigen anderen Antworten auf den Appell(8) von der Internationalen Kommunistischen Partei (Il Partito, bekannt als die "Florenzer PCI") und vom IBRP. Beide waren deutlich ablehnend.
Die Antwort des IBRP erklärte definitiv: "Vor allem sind wir überrascht, dass 23 Jahre nach dem Ende des Zyklus‘ von Internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken (ursprünglich einberufen von der PCInt Italiens), die demonstriert hatten, was wir weiter unten ausführlicher erklären werden, Ihr solch einen Vorschlag mit genau derselben Unaufrichtigkeit vorbringt, wo die Situation eine völlig andere ist."
Wie konnten es diese Neulinge wagen vorzuschlagen, was bereits 23 Jahre zuvor vom IBRP erledigt worden war?(9) Die anmassende Geringschätzung (dieselbe, die Marx bei Proudhon feststellte(10)) gegenüber solchen ersten Bemühungen von Elementen der Klasse durch das IBRP ist wirklich entmutigend!(11) Gerade weil dies aus dem Munde des "einzigen gültigen Pols der Umgruppierung" kommt, um den endlos wiederholten Ausdruck ihrer Bewunderer, die IFIKS, zu benutzen!
Was Il Partito anbelangt, so schiebt sie einfach jede erdenkliche Meinungsverschiedenheit (mit einer Gruppe, die gerade erst ins Leben getreten ist!) vor, angefangen mit der Parteifrage, und dies mit einer Argumentation, die so schwach ist, dass sie schon ans Lächerliche grenzt: "Der vielleicht klarste Punkt ist die Konzeption der Partei. Unsere Partei meint, dass wir die Fortsetzung der historischen Partei sind, die von Marx und Engels geschaffen worden war und die seither niemals aufgehört hat zu existieren trotz der schwierigen Epochen, die sie erlebt hat, und dass die Fackel der marxistischen Lehre dank Organisationen wie die Italienische Kommunistische Linke oder die russische bolschewistische Partei nie erloschen war." Dabei geht es dem NCI gerade darum, die marxistische Lehre am Leben zu erhalten. Doch Il Partito ist jeder Grund gut genug, um eine politische Konfrontation zu vermeiden!
Wie wir aus diesen beiden Antworten ersehen können, wäre es um die Perspektive für neu entstandene Gruppen in der Tat schlecht bestellt, wenn das Lager der Kommunistischen Linken sich allein aus jenen Organisationen zusammensetzen würde, die diese Antworten verfassten. Sie betrachten neue Gruppen aus der luftigen Höhe ihres sektiererischen Schutz-
walls und bieten keine andere Perspektive an als die Integration als Gruppe in die "internationale Umgruppierung" des IBRP oder die individuelle Integration in die PCInt. Diese Positionen sind Lichtjahre entfernt von jenen, die Marx, Engels, Lenin, die Dritte Internationale oder die italienische Fraktion der Kommunistischen Linken vertreten hatten.(12)
Nach dem Scheitern ihres Appells war es also wenig überraschend, dass die Genossen des NCI beschlossen, näher an die IKS zu rücken. Dies veranlasste uns, im April 2004 eine Delegation nach Buenos Aires zu schicken, die viele Diskussionen mit den Mitgliedern des NCI führte, über Themen wie die Gewerkschaftsfrage, die Dekadenz des Kapitalismus, das Funktionieren revolutionärer Organisationen, die Rolle ihrer Statuten und die Einheit der drei Komponenten des politischen Programms des Proletariats: politische Positionen, Funktionsweise und Verhalten. Wir schlugen vor, ein allgemeines Treffen abzuhalten, und die Genossen des NCI beschlossen, regelmässige Diskussionen über die Dekadenz und den Zerfall des Kapitalismus, über die Statuten und unsere Texte über die Organisation und ihre Funktionsweise etc. mit der Zielrichtung zu führen, der IKS beizutreten: "Im Anschluss an den internationalen Besuch der IKS sind die Mitglieder des Kerns einmütig zur Auffassung gelangt, dass dieser Besuch unsere Erwartungen weit übertroffen hat, nicht nur bezüglich des Grades an Übereinstimmung, den wir erreicht haben, sondern auch durch die wichtigen Fortschritte, zu die uns dieser Besuch verhalf (…) So ermöglichte uns dieser Besuch, auch wenn unsere Absicht bereits vorher die Integration in die IKS war, nicht nur diese internationale Strömung als solche konkret kennen zu lernen, sondern auch ihre internationalistische Haltung." (Resolution des NCI, 23. April 2004)
Die Gefahr der Gurus
Im Anschluss an den Besuch unserer Delegation stimmte die Gruppe unserem Vorschlag zu, sich an der Presse der IKS zu beteiligen, indem sie Artikel über die Situation in Argentinien schrieb. Diese Beiträge waren sehr positiv, besonders ein Artikel, der die Piquetero-Bewegung denunzierte und der sich als sehr nützlich erwies, um die pseudo-revolutionären Mythen der Linksextremisten und der "Antiglobalisierungsgruppen" blosszustellen.(13)
Unter den Themen, die mit dem NCI debattiert wurden, wollen wir besonders auf die Debatte über das Verhalten hinweisen, das innerhalb einer proletarischen Organisation herrschen und von dem Charakter der zukünftigen Gesellschaft, für die sie kämpft, inspiriert sein sollte. Rechtfertigt der Zweck die Mittel? Können wir zum Kommunismus gelangen, einer Gesellschaft der freien Gemeinschaft aller menschlichen Wesen, während wir gleichzeitig Verleumdungen, Spitzeldienste, Manipulation, Diebstahl – Praktiken, die jeden Ansatz einer solchen Gemeinschaft zunichte machen – begehen? Sollte der kommunistische Militante edelmütig sein Bestes für die Sache der menschlichen Emanzipation geben oder kann er zur Sache beitragen und gleichzeitig nach seinem persönlichen Profit oder nach persönlicher Macht trachten, indem er andere als Bauernopfer benutzt, die seinen eigenen spezifischen Zielen dienen?
Diese Diskussionen provozierten eine intensive Debatte im NCI über die Frage des Verhaltens der IFIKS, die die Gruppe dazu führte, am 22. Mai 2004 eine Resolution anzunehmen, die diese Bande von Schurken verurteilte und die, "nachdem sie die Publikationen sowohl der IKS als auch der Internen Fraktion der IKS gelesen hat, die Auffassung vertritt, dass Letztere ein Verhalten an den Tag legen, das der Arbeiterklasse und der Kommunistischen Linken fremd ist."(14)
Trotz dieser Fortschritte begann sich dennoch ein Problem bemerkbar zu machen. In einem Brief, geschrieben nach unserem Besuch, wiesen wir bei der Einschätzung seiner Resultate darauf hin, dass "eine kommunistische Organisation nicht ohne eine kollektive und einheitliche Funktionsweise existieren kann. Regelmässige Treffen, mit Strenge und Bescheidenheit durchgeführt, ohne extravagante Ansprüche, aber mit Hartnäckigkeit und intellektueller Strenge abgehalten, sind die Fundamente dieses kollektiven, auf Einheit und Solidarität fussenden Lebens. Selbstverständlich steht das Kollektiv nicht in einem Gegensatz zur Entwicklung der individuellen Initiative und Beiträge. Die bürgerliche Sichtweise des ‚Kollektivs‘ ist genau genommen die einer Summe von Klonen, in der jeglicher Geist einer individuellen Initiative systematisch erstickt wird. Das entsprechende Pendant dieser falschen Sichtweise wurde vom Stalinismus zum einen und von den liberalen Demokraten und Libertären zum anderen entwickelt. Die marxistische Sichtweise ist die eines kollektiven Rahmens, der die individuelle Initiative, Verantwortung und Beiträge ermutigt und entwickelt. Jeder sollte sein Bestes geben, in Übereinstimmung mit dem berühmten Satz von Marx in der Kritik des Gothaer Programms: ‚jeder nach seinen Fähigkeiten‘."
Die Praxis eines Mitglieds des Kerns, den wir B. nennen werden, stand jedoch in völligem Gegensatz zu dieser Orientierung. Angefangen damit, dass er den Zugang zu Computern und zum Internet sowie zur Korrespondenz nach aussen völlig monopolisierte, wobei er auch von dem Vertrauen profitierte, das ihm die anderem Mitglieder der Gruppe entgegenbrachten, wenn er die meisten ihrer Texte ausarbeitete. Darüber hinaus – und im Gegensatz zu den Orientierungen, die während des Aprilbesuchs beschlossen wurden – entwickelte er eine organisatorische Praxis, die darin bestand, so weit wie möglich allgemeine Treffen der Gruppe, wo sich sämtliche Militante artikulieren und über ihre Aktivitäten entscheiden können, zu vermeiden. An Stelle solcher Treffen traf er sich getrennt zumeist mit einem oder zwei Genossen, was ihm erlaubte, ihre gesamten Aktivitäten zu kontrollieren. Diese Praxis ist typisch für bürgerliche Gruppen, wo sich der "Führer", der "Politkommissar" getrennt mit allen Mitgliedern trifft, um sie zu spalten und in Unkenntnis zu halten, was vor sich geht. Dies führte, wie uns die Genossen des NCI später bestätigten, zu einer Situation, in der sie selbst nicht richtig wussten, wer Mitglied der Gruppe war und welche Aufgaben von Bürger B. an Leute verteilt wurden, die sie nicht einmal selbst kannten.(15)
Ein anderes Element in der Taktik dieses Individuums bestand darin, die Entwicklung jeglicher ernsthafter Diskussionen während der raren, mehr oder weniger allgemeinen Treffen zu vermeiden. Die Genossen haben sich beunruhigt gezeigt über die Interventionen des Bürger B., der Diskussionen unter dem Vorwand abbrach, man müsse noch zu "jemand anderen" gehen. Um die Treffen so weit wie möglich von jeglichem Inhalt zu befreien, ermutigte B. zu grösstmöglichem informellen Charakter: Treffen wurden auf gemeinsame Essen reduziert, an denen auch Familienangehörige und Freunde, die nicht der Gruppe angehörten, teilnahmen.
Diese organisatorische Praxis hat nichts mit dem Proletariat zu tun und ist typisch für bürgerliche Gruppen. Sie verfolgt zwei Absichten: Einerseits hält sie die meisten Genossen in einem Zustand der politischen Unterentwicklung, indem sie ihnen die Mittel vorenthält, die ihnen ermöglichen würden, ihr eigenes Urteil weiter zu entwickeln; auf der anderen Seite und entsprechend dem, was wir gerade beschrieben haben, wandelt sie die Genossen in Manövriermasse für die Politik des "grossen Führers" um. In Wahrheit beabsichtigte Bürger B., seine "Genossen"16 als Sprungbrett zu benutzen, um zu einer "Persönlichkeit" innerhalb des politischen Milieus des Proletariats zu werden.
Der Kampf um die Verteidigung der Organisation
Die Pläne dieses Individuums wurden von zwei Faktoren durchkreuzt, die es in seiner arroganten Kalkulation nicht vorhergesehen hatte: zum einen die organisatorische Kohärenz und Beharrlichkeit der IKS und zum anderen die Tatsache, dass die anderen Genossen des NCI trotz ihrer begrenzten Mittel und trotz der obskuren Manöver von Bürger B. grosse Anstrengungen unternahmen, die ihnen schliesslich zu politischer Unabhängigkeit verhalfen.
Ende Juli 2004 unternahm Bürger B. ein dreistes Manöver: Er forderte die sofortige Mitgliedschaft in der IKS und setzte diese Forderung trotz des Widerstands der anderen Genossen durch, die, auch wenn sie ebenfalls beabsichtigten, der IKS beizutreten, fühlten, dass sie sich zunächst einem tief greifenden Assimilierungs- und Klärungsprozess der neuen Ideen unterziehen müssen: Die militante Aktivität der Kommunisten kann nur auf einem soliden Fundament errichtet werden.
Dies versetzte Bürger B. in eine peinliche Lage: Seine "Genossen" waren dabei, klassenbewusste Elemente zu werden, statt nützliche Idioten in seinem ehrgeizigen Plan zu sein, internationaler "Führer" zu werden. Als eine IKS-Delegation Ende August Argentinien besuchte, bestand er darauf, dass sie sofort die Integration des NCI in die IKS verkünden solle. Die IKS wies dieses Ansinnen zurück. Wir haben nichts mit hastigen und voreiligen Integrationen am Hut, die lediglich Gefahr laufen, militante Energien zu vergeuden. Eine Bilanz unseres Besuchs ziehend, schrieben wir: "Während unseres Besuchs habt Ihr die Frage Eurer Integration gestellt. Selbstverständlich reagieren wir mit dem natürlichen Enthusiasmus von Kämpfern für die proletarische Sache, wenn andere Genossen an unserem Kampf teilnehmen wollen (…) Doch wir müssen uns klar darüber sein, dass wir die Frage der Integration neuer Militanter oder der Bildung neuer Sektionen nicht auf derselben Ebene wie ein kommerzielles Unternehmen stellen, das mit allen Mitteln versucht, in einem neuen Markt Fuss zu fassen, oder wie eine linkskapitalistische Gruppe, die nach neuen Anhängern für ihre Politik innerhalb des Staatskapitalismus sucht, (sondern als) ein allgemeines Problem des internationalen Proletariats betrachten, das auf der Grundlage historischer und globaler Kriterien behandelt werden muss (…) Die zentrale Orientierung unserer Delegation bestand darin, mit Euch über das ganze Ausmass der Folgen der militanten Aktivitäten eines Kommunisten zu diskutieren und was es bedeutet, eine vereinte und zentralisierte kommunistische Organisation aufzubauen. (Dies) ist keine technische Frage; sie erfordert eine hartnäckige, kollektive Beständigkeit. Sie kann niemals Früchte tragen, wenn sie nur einem momentanen Impuls folgt (…) was uns angeht, so ist es unsere Absicht, Militante in ihrem unabhängigen Urteil zu schulen, wie auch immer ihre persönlichen oder intellektuellen Fähigkeiten sind, damit sie in der Lage sind, kollektiv am Aufbau und der an der Verteidigung der internationalen Organisation teilzunehmen".
Dies passte Bürger B. nicht in den Kram. "Darüber hinaus ist es höchst wahrscheinlich, dass er bereits im Geheimen Kontakt zur IFIKS aufgenommen hat, während er gleichzeitig fortfuhr, uns mit seinem Begehren zu täuschen, die Integration des NCI in die IKS zu beschleunigen".(17) Dieses Individuum änderte sein Verhalten über Nacht, ohne wenigstens die Ehrlichkeit zu besitzen, seine "Meinungsverschiedenheiten" auszudrücken.
Der Grund ist simpel: Seine Absicht war nicht die Klärung, sondern einfach sein eigener persönlicher Erfolg als ein "internationaler Führer". Nachdem ihm aufging, dass er nicht in der Lage war, seine Ambitionen in der IKS zu befriedigen, entschloss er sich, nach einer ihm angenehmeren Gesellschaft Ausschau zu halten.
Auch zögerte er nicht, zu Intrigen und zum Doppelspiel zu greifen, um eine "Sensation" zu schaffen. Über Nacht verhalf er einem "Zirkel Internationaler Kommunisten" zum Leben, dessen einziges Mitglied er selbst war, wobei er die Unverfrorenheit besass, in diesen "Zirkel" die Mitglieder des NCI – die bar jeder Kenntnis darüber waren – und seine "sehr engen Kontakte" zu ""integrieren". Dieser "Zirkel" schlug vor, dieselbe Methode zu nutzen (die bereits von Stalin praktiziert worden war), um das Verschwinden des NCI sicherzustellen: Er präsentierte sich selbst als die einzig wahre Nachfolge des NCI.(18)
Diese Manöver, die, wie wir gesagt haben, von dem widerwärtigen Bündnis zwischen dem Opportunismus des IBRP und den Parasiten der IFIKS19ermutigt wurden, wurden auf unser Betreiben zusammen mit dem NCI aufgedeckt und entschärft. Die Genossen des NCI waren durch die Manöver des Bürgers B. isoliert gewesen; trotz aller Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, stellten wir den Kontakt zu ihnen wieder her. "Durch Telefonanrufe bei den anderen Genossen des NCI (eine Vorgehensweise, die in den Worten des Bürgers B. angeblich die ‚ekelhafte Methode der IKS‘ war) erfuhren wir, dass sie völlig ahnungslos über die Existenz des ‚Zirkels‘ waren, dessen angebliche Mitglieder sie waren! Sie hatten überhaupt keine Ahnung von der Existenz der widerwärtigen ‚Erklärungen‘ des ‚Zirkels‘ gegen die IKS, die angeblich – um die Worte dieser ‚Erklärungen‘ zu gebrauchen – ‚kollektiv‘, ‚einmütig‘ und ‚nach Konsultierung aller Mitglieder‘ des NCI angenommen wurden. All dies ist vollkommen unwahr." ("Präsentation der Erklärung des NCI")
Sobald der Kontakt wiederhergestellt war, organisierten wir einen Besuch, um mit den Genossen des NCI zu diskutieren und Perspektiven für die Zukunft auszuarbeiten. Wir wurden von den Genossen herzlich und brüderlich empfangen. Während unseres Aufenthaltes beschlossen die Genossen, ihre Erklärung vom 27. Oktober an alle Sektionen des IBRP und den anderen Gruppen der Kommunistischen Linken zu senden, um der Wahrheit zum Sieg zu verhelfen: Im Gegensatz zur Falschinformation, mit der das IBRP hausieren ging (vor allem in seiner italienischen Presse), hat das NCI nicht mit der IKS gebrochen!
Bei etlichen Gelegenheiten riefen die Genossen des NCI Bürger B. an, um ihn zu bitten, zu kommen und sein Verhalten gegenüber dem NCI und der IKS-Delegation zu erläutern. Doch der Herr verweigerte sich einer solchen Begegnung. Auf frischer Tat ertappt, zog dieses feige Individuum es vor, sich wie ein Kaninchen in seinem Bau zu verkriechen.
Trotz des Schocks über die Lügen und Manöver, die von diesem üblen Individuum in ihrem Namen verübt wurden, drückten die Genossen des NCI ihre Absicht aus, ihre politischen Aktivitäten fortzusetzen, soweit sie dazu in der Lage waren. Dank des brüderlichen Empfangs durch den NCI und seines politischen Engagements war die IKS in der Lage, eine zweite öffentliche Veranstaltung in Buenos Aires (5. November) über ein von den Genossen des NCI ausgewähltes Thema zu veranstalten. (20)
Trotz der fürchterlichen materiellen Probleme, mit denen sie in ihrem täglichen Leben konfrontiert sind, erklärten die Genossen unserer Delegation fest entschlossen ihre Absicht, mit ihren militanten Aktivitäten fortzufahren und insbesondere die Diskussion mit der IKS fortzusetzen. Jene Genossen, die arbeitslos sind, beabsichtigen, Arbeit zu finden, nicht nur um sich selbst und ihre Kinder zu ernähren, sondern auch um der politischen Unterentwicklung, in der sie vom Bürger B. gehalten worden waren, zu entkommen (vor allem haben sie ihren Wunsch ausgedrückt, zum Kauf eines PC beizutragen). Indem sie mit Bürger B. und seinen bürgerlichen Methoden brachen, haben sich die Genossen des NCI als wahre Militante der Arbeiterklasse verhalten.
Perspektiven
Die Erfahrungen des NCI sind voller Lehren. An erster Stelle sei genannt, dass der NCI durch die Annahme von programmatischen Positionen, die eng an jenen der IKS angelehnt sind, die Einheit des Weltproletariats und seiner Avantgarde demonstriert hat. Die Arbeiterklasse verteidigt die gleichen Positionen in jedem Land, ungeachtet der politischen Entwicklungen, der imperialistischen Positionen oder der politischen Regimes. Innerhalb dieses einheitlichen Rahmens waren die Genossen in der Lage, Beiträge von allgemeinem Interesse für das gesamte Proletariat zu leisten (Charakter der Piquetero-Bewegung, der sozialen Revolte in Argentinien und Bolivien etc.), und nahmen am internationalen Kampf zur Verteidigung proletarischer Prinzipien teil: ihre klare Denunzierung des Haufens von Ganoven, der sich selbst IFIKS nennt, die Erklärung zur Verteidigung des NCI und proletarischer Verhaltensregeln etc.
Zweitens hat diese Erfahrung ein Schlaglicht auf die Gefahr geworfen, die "Gurus" für die Entfaltung von Gruppen und Genossen auf der Suche nach Klassenpositionen darstellen können. Dieses Phänomen ist alles andere als spezifisch argentinisch,21 es ist ein internationales Phänomen, dem wir in der Vergangenheit oft begegnet sind: Individuen, oftmals brillant, die eine Gruppe als ihr "persönliches Eigentum" betrachten und die aufgrund ihres Misstrauens gegenüber den wirklichen Fähigkeiten der Arbeiterklasse und wegen ihres Durstes nach persönlicher Anerkennung versuchen, die anderen Genossen ihrer persönlichen Kontrolle zu unterwerfen, indem sie deren Entwicklung blockieren und sie zur politischen Unmündigkeit verdammen. Solche Elemente spielen anfangs oft eine dynamische Rolle beim Streben nach revolutionären Positionen, und sei es nur dadurch, dass sie sich an die Spitze der Annäherung und des Denkprozesses seitens der anderen Genossen stellen. Doch im Allgemeinen scheitern solche Elemente, wenn sie nicht gründlich ihre eigene vergangene Herangehensweise in Frage stellen, daran, ihre Annäherung konsequent zu Ende führen, da dies den Verlust ihres eigenen Status als "Guru" bedeuten würde. Eine andere Konsequenz ist der rapide Verlust von Mitgliedern der Gruppe in Folge der Atmosphäre, die in der Gruppe durch die Forderung des Gurus nach Unterwerfung unter seiner eigenen Subjektivität entsteht; dies führt zur Demoralisierung der Anderen, die häufig unter dem ernüchternden Eindruck jegliche politische Aktivität aufgeben, dass politische Positionen schön und gut sein mögen, dass aber die organisatorische Praxis, die menschlichen Beziehungen und das persönliche Verhalten nicht im Mindesten mit dem unterdrückerischen Universum der linken und linksextremistischen Gruppen gebrochen haben.
Drittens hat diese Erfahrung etwas sehr viel Wichtigeres gezeigt: Es ist möglich, diese Gefahr zu bekämpfen und zu bannen. Heute haben die Genossen nicht ohne Schwierigkeiten einen Prozess der Klärung, der Entwicklung ihres eigenen Selbstvertrauens und ihrer kollektiven Kapazitäten begonnen, mit dem Ziel der künftigen Integration in die IKS. Was auch immer das endgültige Ergebnis dieses Kampfes sein wird, der NCI hat demonstriert, dass trotz all der Bemühungen des Gurus, ihre politische Entwicklung zu bremsen, die Genossen sich für die proletarische Sache organisieren und kämpfen können.
Schliesslich entwickelt sich –
und dies ist nicht am unwichtigsten – dank der aktiven Bemühungen der Genossen
um die politischen Positionen der IKS ein Milieu für die proletarische Debatte
in Argentinien. Es wird von grösstem Wert sein für die Klärung und militante
Einbeziehung von proletarischen Elementen, die in diesem Land und in anderen
Ländern Lateinamerikas auftauchen.
C. Mir (3. Dezember 2004)
Fußnoten:
1 s. International Review Nr. 119 (frz., engl., span. Ausgabe).
2 Ebenda.
3 s. die Artikelreihe 1903–1904: The birth of Bolshevism, in: Internationale Review Nr. 116–118 (frz., engl., span. Ausgabe).
4 s. den Artikel Die marxistische und die opportunistische Sichtweise in der Politik des Parteiaufbaus, in: Internationale Revue Nr. 26.
5 Für weitere Informationen siehe die Präsentation der Erklärung des NCI vom 27. Oktober 2004; auf Englisch auf unserer Website: https://en.internationalism.org./ir/119_imposture.html [125].
6 s. den Artikel ‚Circulo de Comunistas internacionalistas‘: Hochstapelei oder Realität? auf unserer Website: https://en.Internationalism.org/ir/119_imposture.html [126].
7 Als ein Beispiel dieser linksextremistischer Überbleibsel weisen wir auf den Gebrauch des Begriffs „Gewerkschaftsbürokratie“ hin, der dazu neigt, die Tatsache zu verbergen, dass die Gewerkschaft als Organisation, von Kopf bis Fuss, ein verlässlicher Diener des Kapitals und ein Feind der Arbeiterklasse ist. In demselben Sinne ermöglicht die Idee, dass die Gewerkschaften „Mittler“ zwischen Kapital und Arbeit sind, ihnen, sich als irgendwie neutrale Organisationen geltend zu machen, die zwischen den beiden wesentlichen Klassen der Gesellschaft, der Bourgeoisie und dem Proletariat, stünden.
8 Die Kopien davon sind uns vom NCI zugesandt worden.
9 Die Art und Weise, wie das IBRP die Dynamik der Konferenzen „auflöste“, bestand darin, sie durch den Gebrauch eines sektiererischen Manövers kaputt zu machen. In: International Review, Nr. 22, (frz., engl., span. Ausgab).
10 Siehe die berühmte Streitschrift von K. Marx Das Elend der Philosophie, in: MEW 4, S. 63 ff.
11 Ist es auch nur im Entferntesten vorstellbar, dass Marx und Engels gleichermassen geantwortet hätten, als die französischen und englischen Arbeiter zu jenem Treffen aufriefen, das die Erste Internationale 1864 ans Tageslicht verhalf, und zwar aus dem Grund, dass sie sich bereits 1848 mit dieser Frage beschäftigt hätten?
12 In einem Brief an die Genossen, der zur Einschätzung des Resultats ihres Appells verfasst wurde, boten wir eine detaillierte Erklärung der Umgruppierungsmethoden an, die die Revolutionäre in der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung benutzt haben, um aufzuzeigen, wie die vielfältigen internationalen Organisationen des Proletariats geschmiedet wurden.
13 Siehe den Artikel über die Piquetero-Bewegung in dieser Ausgabe der Internationalen Revue.
14 Der Text der Resolution kann auf Englisch auf unserer Website vorgefunden werden: https://en.internationalism.org./ir/119_nci_reso.html [127], in der es auch Links zum vollständigen Text als Anhang auf Spanisch gibt.
15 Dies erklärt einen augenscheinlichen Widerspruch in der Herkunft des NCI. Für die Genossen des NCI heute wurde der Nucleo erst im April 2004 gebildet, mit anderen Worten: nach dem ersten Besuch durch die IKS. Zuvor bedeutete die Funktionsweise, die Bürger B. erfolgreich in der Gruppe durchsetzte, und die geringe Kenntnis von den anderen Mitglieder dass der NCI zunächst viel mehr einem informellen Diskussionszirkel ähnelte. Erst nach unserem Besuch, wo wir auf der Wichtigkeit regelmässiger Treffen bestanden, begann der NCI für jedes seiner Mitglieder eine bewusste Existenz anzunehmen.
16 Seine Gerigschätzung gegenüber ihnen war besonders empörend: „Bürger B. verachtete die anderen Mitglieder des NCI, die Arbeiter sind, die in grosser Armut leben, während er selbst Angehöriger eines liberalen Berufes ist und damit prahlte, dass er das einzige Mitglied des NCI ist, das sich eine Reise nach Europa leisten kann“. Siehe unseren Artikel auf Spanisch: Der NCI hat nicht der IKS gebrochen auf unserer Website: https://en.internationalism.org./spanish/ap/180_nci.html [128].
17 s. die Präsentation der Erklärung des NCI“ auf unserer Website https://en.internationalism.org./ir/119_nci_pres.html [129].
18 All die Metamorphosen dieses „Zirkels“, dessen absurde internationale Reputation allein durch seine Beschützer, das IBRP und die IFIKS, aufgebläht wurde, sind in zwei Dokumenten demaskiert worden, die auf unserer spanischen Website (Circulo comunistas internacionalistas: una extrana aparicion und Una nueva… y extrana aparicion) und in einem Artikel auf Englisch (‘Circulo comunistas internacionalistas‘: Imposture or reality?) veröffentlicht wurden. Siehe: https://en.internationalism.org./ir/119_imposture.html [125].
19 Unsere Website hat eine ganze Reihe von Dokumenten veröffentlicht, insbesondere etliche Briefe an das IBRP, in denen auf die beklagenswerte Richtung hingewiesen wurde, in der diese Organisation abdriftet. Kaum hatte Bürger B. hinter dem Rücken der anderen Mitglieder des NCI seinen „Zirkel“ geformt, hatte das IBRP nichts Eiligeres zu tun, als ihm eine Öffentlichkeit anzubieten. Zunächst durch die Veröffentlichung einer italienischen Übersetzung eines Dokuments des „Zirkels“ über die Repression eines Arbeiterkampfes in Patagonien (was umso erstaunlicher ist, als dass das IBRP sich stets geweigert hat, auch nur das kleinste Dokument des NCI zu veröffentlichen) und schliesslich durch die dreisprachige Veröffentlichung (französisch, englisch und spanisch, aber nicht italienisch) einer „Erklärung“ des „Zirkels“, datiert vom 12. Oktober (Gegen die Ekel erregenden Methoden der IKS), die nichts anderes ist als eine Ansammlung von unerhörten Lügen und Verleumdungen gegen die IKS. Drei Wochen und drei Briefe der IKS später veröffentlichte das IBRP auf seiner Website wenigstens ein kleines Kommunique der IKS, das alle Anschuldigungen des „Zirkels“ von sich weist. Seither ist die äusserst verlogene und verleumderische Natur der Behauptungen des Bürgers B. wie auch das Lügengespinst seines „Zirkels“ ohne den Schatten eines Zweifels demonstriert worden. Und bis heute hat das IBRP – während es diskret das Werk von Bürger B. von seiner Website zurückzog – es nicht geschafft, auch nur die geringste Erklärung abzugeben, um die Wahrheit wieder gerade zu rücken. Es ist bemerkenswert, dass Bürger B.'s plötzliche Leidenschaft für das IBRP und dessen Positionen sowie für die IFIKS erst begann, als diesem kleinen Abenteurer gewahr wurde, dass er mit seinen Manövern bei der IKS auf Granit beissen würde. Diese Konvertierung, die noch schneller stattfand als die des St. Paulus auf dem Weg nach Damaskus, veranlasste das IBRP, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, sich hastig zum Sprecher von Bürger B. zu machen. Das IBRP sollte sich einst selbst fragen, wie es kommt (und das nicht nur einmal), dass Elemente, die ihre Unfähigkeit bewiesen haben, sich in die Kommunistische Linke zu integrieren, sich stets dem IBRP zuwandten, nachdem sie mit ihrer „Annäherung“ an die IKS gescheitert sind. Wir werden auf diese Frage in einer späteren Ausgabe dieser Revue zurückkommen.
20 s. unsere spanische Website: https://www.internationalism.org./spanish/ap/179_RPBA.html [130].
21 Auch wenn eingeräumt werden muss, dass die gespaltene Persönlichkeit und Arglist des Bürgers B. schon ans Pathologische grenzt
Geographisch:
- Argentinien [109]
Politische Strömungen und Verweise:
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Die humanitäre und demokratische Scheinheiligkeit
- 2342 Aufrufe
Wenn man für jedes Zeitalter der Menschheit eine charakteristische Unsitte nennen müsste, so wäre es beim Kapitalismus bestimmt die Scheinheiligkeit der herrschenden Klasse. Der berüchtigte mongolische Eroberer Tschingis Khan stapelte nach der Einnahme von Widerstand leistenden Städten die Schädel ihrer Bewohner zu Pyramiden auf, aber er gab nie vor, dass er dies zu ihrem Wohl tun würde. Es war der bürgerlichen und kapitalistischen Demokratie vorbehalten zu verkünden, dass der Krieg "humanitär" sei und dass man die Zivilbevölkerung bombardieren müsse, um genau dieser Bevölkerung den Frieden und die Freiheit zu bringen.
Tsunami: Der Bluff der humanitären Hilfe
Der Tsunami vom Dezember 2004 traf die Küsten des Indischen Ozeans im Zeitpunkt, als sich die letzte Ausgabe der Internationalen Revue (frz./engl./span. Ausgabe) bereits beim Drucker befand. Da wir somit keine Stellungnahme über dieses bedeutende Ereignis der gegenwärtigen Weltlage1 in diese letzte Nummer einfügen konnten, gilt es dies hier nachzuholen. Schon 1902 – vor etwas mehr als 100 Jahren – stellte die Revolutionärin Rosa Luxemburg die Scheinheiligkeit der Grossmächte an den Pranger, die ihre "humanitäre Hilfe" der vom Vulkanausbruch von Martinique heimgesuchten Bevölkerung angedeihen liess, während sie umgekehrt nie einen Augenblick zögerten, die gleichen Leute zu massakrieren, wenn es darum ging, die Herrschaft auf die ganze Welt auszudehnen.2 Wenn wir heute die Reaktion der Grossmächte angesichts der Katastrophe betrachten, die sich Ende 2004 in Südasien ereignet hat, so müssen wir feststellen, dass sich die Dinge nicht zum Besseren verändert haben, im Gegenteil.
Heute wissen wir, dass die Zahl der direkt durch den Tsunami verursachten Toten 300'000 übersteigt, wobei vor allem diejenigen getroffen wurden, die ohnehin mittellos waren; hinzu kommen Hunderttausende von Obdachlosen. Ein solches Ausmass der Katastrophe ist keineswegs einfach "Schicksal". Man kann natürlich nicht den Kapitalismus beschuldigen, dass er das Seebeben verursacht habe, das zur gigantischen Flutwelle führte. Aber ihm sind die totale Nachlässigkeit und die Unverantwortlichkeit der Regierungen dieser Region der Welt und ihrer westlichen Doppelgänger anzulasten, die diese gewaltige menschliche Katastrophe nach sich zogen.3
Alle wussten, dass dieser Teil der Erde besonders erdbebengefährdet ist. "Die örtlichen Experten wussten jedenfalls, dass ein Drama im Anzug war. Im Dezember hatten indonesische Seismologen am Rande einer Physikertagung in Jakarta das Thema mit einem französischen Experten erörtert. Sie waren sich voll der Gefahr von Tsunamis bewusst, denn in diesem Teil der Erde kommt es ständig zu Beben" (Libération, 31.12.04).
Nicht nur die Experten waren im Bilde, sondern auch der ehemalige Direktor des Internationalen Tsunami-Informationszentrums in Hawaii, George Pararas-Carayannis, teilte mit, dass ein grösseres Beben zwei Tage vor der Katastrophe vom 26. Dezember stattgefunden habe. "Der Indische Ozean verfügt über eine Basisinfrastruktur, um Massnahmen gegen Beben zu treffen und Kommunikationsmittel zur Verfügung zu stellen. Und niemand hätte überrascht sein sollen, denn am 24. Dezember war ein Beben mit der Grössenordnung von 8,1 auf der Richterskala gemessen worden. Allein dadurch hätten schon die Behörden gewarnt sein sollen. Aber es fehlt vor allem der politische Wille der betroffenen Länder und eine internationale Abstimmung entsprechend den Massnahmen, wie sie im Pazifik getroffen wurden" (Libération, 28.12.2004).
Niemand hätte überrascht sein dürfen und trotzdem ist das Schlimmste eingetreten, obwohl genügend Informationen über die sich abzeichnende Katastrophe verfügbar waren, um rechtzeitig zu handeln und das Massaker zu verhindern.
Dies ist keine Nachlässigkeit, sondern eine verbrecherische Haltung, die die tiefe Verachtung der herrschenden Klasse für die Bevölkerung und die Arbeiterklasse offenbart, die die Hauptopfer der bürgerlichen Politik der Regierungen vor Ort sind!
Dieses unverantwortliche Handeln der Regierungen verdeutlicht erneut die Lebensform dieser Räuberklasse, die das Leben und die Produktion in dieser Gesellschaft verwaltet. Wenn es darum geht, die Ausbeutung und den kapitalistischen Profit aufrechtzuerhalten, sind die bürgerlichen Staaten bereit, so viele Menschenleben, wie ihnen nötig scheint, zu opfern.
Der abgrundtiefe Zynismus der herrschenden Klasse und die Katastrophe, die die Weiterexistenz dieses tödlichen Ausbeutungssystems für die Menschheit bedeutet, werden noch offensichtlicher, wenn wir die Kosten eines Tsunami-Warnsystems vergleichen mit den gigantischen Summen, die für Rüstungsgüter nur schon in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans, in so genannten "Entwicklungsländern", ausgegeben werden: Der Betrag von 20–30 Millionen Dollar, der nach Schätzungen nötig wäre, um ein System der Erkennung und der Vorwarnung in der Region einzurichten, entspricht gerade dem Preis von einem der 16 Flieger des Typs Hawk-309, die die indonesische Regierung in den 1990er-Jahren in Grossbritannien bestellte. Wenn wir die Militärbudgets von Indien (19 Milliarden Dollar), Indonesien (1,3 Milliarden Dollar) und Sri Lanka (540 Millionen Dollar – dies ist das kleinste und ärmste der drei Länder) betrachten, so springt ins Auge, wie dieses Wirtschaftssystem mit vollen Händen Geld ausgibt, um Tod zu säen, aber umgekehrt äusserst knauserig tut, wenn es darum geht, das Leben der Bevölkerung zu schützen.
Weitere Opfer sind angekündigt worden nach einem neuen Seebeben in der Region, das diesmal die indonesische Insel Nias getroffen hat. Die hohe Zahl der Toten und Verletzten ist auf das beim Häuserbau verwendete Material zurückzuführen, Betonblöcke, die den Erdstössen viel weniger widerstehen können als das Holz, das in der Region das herkömmliche Baumaterial ist. Aber eben, der Beton ist billig und das Holz teuer, und dies umso mehr, als dessen Export in die entwickelten Länder eine wichtige Einnahmequelle der indonesischen Kapitalisten, Mafiosi und Militärs ist. Diese neue Katastrophe mit der Rückkehr der westlichen Medien in die Region, die uns all die guten Taten der NGOs vor Ort zeigen wollen, offenbart auch, was die Folgen der grossen Solidaritätserklärungen waren, die die verschiedenen Regierungen nach dem Seebeben vom Dezember 2004 abgaben.
Was zunächst die Geldspenden betrifft, die die westlichen Regierungen versprachen, so ist das Missverhältnis zwischen den Rüstungsausgaben und dem Geld, das für Rettungszwecke zur Verfügung gestellt wird, noch schreiender als bei den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans: Die Vereinigten Staaten, die zuerst an eine Hilfe in der Höhe von 35 Millionen Dollar dachten ("das, was wir im Irak jeden Morgen vor dem Frühstück ausgeben", wie der amerikanische Senator Patrick Leahy sagte), budgetieren Rüstungsausgaben für 2005/06 von 500 Milliarden Dollar, wobei die Kriegskosten in Afghanistan und Irak noch nicht mit eingerechnet sind. Und sogar hinsichtlich dieser erbärmlichen Hilfszusagen mussten wir darauf hinweisen, dass die westliche Bourgeoisie den Mund mit Versprechen voll nimmt, denen aber dann oft keine Taten folgen. "So hatte diese ‚internationale Gemeinschaft‘ im Dezember 2003 den Erdbebenopfern im Iran 115 Millionen $ zugesagt; bislang hat Teheran aber ganze 17 Mio. $ erhalten. Das Gleiche konnte man in Liberia beobachten: eine Milliarde Dollar wurden versprochen, weniger als 70 Mio. $ sind bislang eingetroffen."4 Die Asian Development Bank gibt heute bekannt, dass vom versprochenen Geld vier Milliarden Dollar immer noch fehlen, und BBC meldet: "Der srilankische Aussenminister Lakshman Kadigamar sagte, dass sein Land noch nichts von dem erhalten habe, was die Regierungen versprochen hätten." In Banda Aceh gibt es nach wie vor kein sauberes Wasser für die Bevölkerung (paradoxerweise sind die Flüchtlinge in ihren Barackenlagern die einzigen, denen die bei weitem ungenügenden Anstrengungen der NGOs zugute kommen). In Sri Lanka leben die Flüchtlinge aus der Region um Trincolamee (um nur ein Beispiel zu nennen) immer noch in Zelten und leiden an Durchfall und Windpocken; 65% der Fischerboote (von denen ein Grossteil der Bevölkerung der Insel abhängig ist) wurde durch den Tsunami zerstört, und sie sind immer noch nicht ersetzt worden.
Die Medien der Bourgeoisie erklären uns natürlich des Langen und Breiten, wie schwierig eine solche gross angelegte Hilfsaktion zu organisieren sei. Es ist sehr aufschlussreich, wenn man diese "Schwierigkeiten", der bedürftigen Bevölkerung zu helfen (was dem Kapital keinen Gewinn einbringt), vergleicht mit der eindrücklichen Logistik der amerikanischen Armee bei der Operation Wüstensturm: Erinnern wir uns daran, dass die Vorbereitung des Angriffs auf den Irak sechs Monate gedauert hat. In diesem Zeitraum wurde gemäss einem Artikel des Army Magazine5 folgendes in Bewegung gesetzt: "Das 22. Support Command erhielt mehr als 12'447 Raupenfahrzeuge, 102'697 Radfahrzeuge, 3,7 Milliarden Liter Treibstoff und 24 Tonnen Post in dieser kurzen Zeitspanne. Unter den Neuigkeiten im Vergleich zu früheren Kriegen sah man diesmal den Einsatz von Schiffen zum schnellen Verladen, den Transport mittels ultramoderner Container, ein effizientes System mit vereinheitlichtem Treibstoff und eine automatisierte Informationsverwaltung". Nun, immer wenn man uns über "logistische Schwierigkeiten" bei humanitären Operationen erzählt, sollten wir uns daran erinnern, welche Fähigkeiten der Kapitalismus zeigt, wenn es darum geht, imperialistische Interessen zu verteidigen.
Doch abgesehen davon, waren selbst die bescheidenen Geldbeträge und die elenden Dienste, die in die Region geschickt wurden, nicht gratis: Die Bourgeoisie gibt kein Geld ohne Gegenleistung aus. Wenn die westlichen Staaten ihre Hubschrauber, Flugzeugträger und Amphibienfahrzeuge in den Indischen Ozean sandten, so rechneten sie damit, an imperialistischem Einfluss in der Gegend zu gewinnen. Wie Condoleezza Rice vor dem amerikanischen Senat anlässlich ihrer Einsetzung als Staatssekretärin 6 unterstrich: "Ich bin einverstanden, wenn man sagt, dass der Tsunami eine wunderbare Gelegenheit geboten hat, um das Mitleid nicht nur der amerikanischen Regierung, sondern des amerikanischen Volkes zu zeigen, und ich denke, dass uns dies viel gebracht hat."7 Ebenso war der Entscheid der indischen Regierung, jede westliche Hilfe abzulehnen, voll und ganz durch den Wunsch begründet, "im Verein mit den Grossen mitzuspielen" und sich als regionale imperialistische Macht zu behaupten.
Die Demokratie zur Vertuschung der Barbarei
Wenn wir uns darauf beschränken würden, das obszöne Missverhältnis zwischen dem, was die Bourgeoisie zur Verbreitung des Todes ausgibt, und den immer elender werdenden Lebensbedingungen der überwältigenden Mehrheit der Weltbevölkerung festzustellen, würden wir nicht weiter gehen als all die guten Seelen, die die Demokratie verteidigen, als die NGOs jeder Couleur.
Aber auch die Grossmächte selber sind eingefleischte Verteidiger der Demokratie, und ihre über das Fernsehen verbreiteten Informationen bemühen sich, uns die Hoffnung zu vermitteln, dass sich dank dem unaufhaltsamen Vormarsch der Demokratie doch noch alles zum Guten wenden werde. Nach den Wahlen in Afghanistan durfte nun auch die Bevölkerung im Irak zum ersten Mal wählen, und Bush junior konnte den bewundernswerten Mut dieser Leute begrüssen, die einer wahrhaftigen Todesdrohung trotzten, um an die Urnen zu gehen und dem Terrorismus eine Absage zu erteilen. In der Ukraine folgte die "orangefarbene Revolution" dem Vorbild Georgiens und beseitigte das korrupte, Russland ergebene Regime durch den heldenhaften Juschtschenko. Im Libanon forderte die mobilisierte Jugend eine Aufklärung der Ermordung des oppositionellen Rafik Hariri und den Abzug der syrischen Truppen aus dem Land. In Palästina erteilten die Wahlen Mahmud Abbas einen klaren Auftrag, dem Terrorismus Einhalt zu gebieten und einen gerechten Frieden mit Israel abzuschliessen. Und in Kirgistan endlich fegte eine "Tulpenrevolution" den alten Präsidenten Akayev weg. Wir stehen also scheinbar vor einem wahrhaften Ausbruch der Demokratie, von "people power", der nun endlich die "Neue Weltordnung" bringen soll, die uns 1989 mit dem Einsturz der Berliner Mauer versprochen wurde.
Aber sobald wir etwas an der Oberfläche kratzen, verschwindet der rosafarbene Anstrich.
So spitzten die Wahlen im Irak nur den Machtkampf zwischen den verschiedenen Fraktionen der irakischen Bourgeoisie zu. Mit mühsamen Verhandlungen zwischen Schiiten und Kurden über die Machtaufteilung und den Grad an Autonomie, der dem kurdischen Teil des Landes gewährt werden soll, geht dieser Kampf weiter. Sie haben zwar einstweilen eine Vereinbarung über bestimmte Regierungsposten abschliessen können, haben aber umgekehrt die delikate Frage um Kirkuk, eine reiche Erdöl-Stadt im Norden des Iraks, auf die lange Bank schieben müssen; über diese Angelegenheit streiten sich Sunniten und Kurden, und sie wird auch weiterhin zu blutigen Zusammenstössen führen. Man kann sich auch fragen, wie weit die kurdischen Führer die irakischen Wahlen überhaupt Ernst nahmen, da sie am selben Tag eine "Umfrage" organisierten, nach der 95% der Kurden ein unabhängiges Kurdistan wünschten. "Die Selbstbestimmung ist ein Naturrecht unseres Volkes, und es hat ein Recht darauf, seine Wünsche zu äussern", sagte der kurdische Führer Barzani, "wenn die Zeit reif ist, wird die Selbstbestimmung Wirklichkeit".8 Die Lage der Kurden lässt für die Stabilität der Region Schlimmes befürchten, denn jeder Versuch von ihrer Seite, ihre Unabhängigkeit zu behaupten, wird von zwei angrenzenden Mächten mit bedeutenden kurdischen Minderheiten als unmittelbare Bedrohung aufgefasst: von der Türkei und dem Iran.
Die irakischen Wahlen stellten für die USA einen Medienerfolg dar, der den Widerstand der Rivalen, namentlich Frankreichs, auf der politischen Ebene beträchtlich dämpfte. Umgekehrt ist aber die Regierung Bush kaum entzückt über die Perspektive eines von Schiiten beherrschten Iraks, die mit dem Iran und somit indirekt auch mit Syrien und dessen Schergen im Libanon, dem Hisbollah, verbündet sind. In diesem Zusammenhang ist die Ermordung Rafik Hariris zu sehen und zu verstehen, des mächtigen politischen Führers und Geschäftsmanns im Libanon.
Die ganze westliche Presse – allen voran die amerikanische und französische – zeigten mit dem Finger auf Syrien. Doch alle Kommentatoren waren sich einig darüber, dass erstens Hariri kein wirklich Oppositioneller war (er war vielmehr Ministerpräsident unter syrischer Vormundschaft während 10 Jahren), und zweitens Syrien zuletzt Nutzniesser des Verbrechens ist; vielmehr war Syrien gezwungen, den Abzug all seiner Truppen bis zum 30. April anzukündigen.9 Umgekehrt sind diejenigen, die aus der Situation Nutzen ziehen, einerseits Israel, das den Einfluss der Hisbollah schwinden sieht, und andererseits die Vereinigten Staaten, die die Gelegenheit beim Schopf packten, um Syrien aus dem Land zu schicken. Heisst dies nun, dass die "demokratische Revolution", die diesen Rückzug ausgelöst hat, ein neues Gebiet des Friedens und des Wohlstands erobert hätte? Es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln, wenn man weiss, dass die heutigen "Oppositionellen" (wie der drusische Führer Walid Dschumblat) nichts anderes als Kriegsherren sind, nämlich die zentralen Figuren des blutigen Libanon-Konflikts von 1975 bis 1990; schon mehrere Bombenanschläge sind in christlichen Gebieten des Libanons verübt worden, während der Hisbollah (mit seinen 20'000 Bewaffneten) Massendemonstrationen abhält.
Auch die erzwungene Absetzung des kirgisischen Präsidenten Akayev kündet nur noch mehr Elend und Unbeständigkeit an. Dieses Land, das zu den ärmsten Zentralasiens gehört und bereits russische und amerikanische Militärbasen auf seinem Territorium hat, sieht sich immer mehr mit Begehrlichkeiten Chinas konfrontiert. Abgesehen davon ist es eine bevorzugte Zwischenstation für den Drogentransport. Unter diesen Bedingungen ist der jüngste "demokratische" Umsturz nichts anderes als ein Moment in der Abrechnung, die die Grossmächte mit Stellvertretern betreiben.
Im 20. Jahrhundert stürzten die imperialistischen Rivalitäten den Planeten zweimal mit Weltkriegen in schreckliche Schlächtereien; darüber hinaus folgte nach 1945 ein Krieg dem anderen – Kriege, die die beiden grossen imperialistischen Blöcke, die aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen waren, einander lieferten, bis 1989 der russische Block zusammenbrach. Am Ende jedes Gemetzels verspricht uns die herrschende Klasse, dass dies nun der letzte Krieg gewesen sei: der Krieg von 1914–18 war der "allerletzte", der Krieg von 1939–45 sollte eine neue Phase des Wiederaufbaus und der von der UNO garantierten Freiheit eröffnen, das Ende des Kalten Krieges 1989 war angeblich der Beginn einer "Neuen Weltordnung" des Friedens und des Wohlstandes. Für den Fall, dass sich die Arbeiterklasse heute Fragen zum Stand dieser "Neuen Ordnung" (des Krieges und des Elends) stellt, erwarten uns in diesen Jahren 2004 und 2005 prunkvolle Triumphfeiern der Demokratie (Landung der Alliierten in der Normandie vom Juni 1944) wie auch Gedenkfeiern an die Schrecken des Nationalsozialismus (aus Anlass der Befreiung der Konzentrationslager). Man kann davon ausgehen, dass die demokratische Bourgeoisie umgekehrt wenig Klamauk zu den 20 Millionen Toten des russischen Gulags veranstalten wird, da doch die UdSSR ihr Verbündeter gegen Hitler war, und ebenso wenig zu den 340'000 Toten in Hiroshima und Nagasaki, zur Erinnerung an die Tage, als die grösste Demokratie der Welt das einzige Mal in der Geschichte die Waffe des Armageddon, die Atombombe, gegen ein bereits besiegtes Land einsetzte.10
Es gibt also keinen Grund, in diese bürgerliche Klasse auch nur einen Funken Vertrauen zu haben, die uns hoch und heilig verspricht, den Frieden und den Wohlstand zu verbreiten. Im Gegenteil: "Geschändet, entehrt, im Blute watend, von Schmutz triefend – so steht die bürgerliche Gesellschaft da, so ist sie. Nicht wenn sie, geleckt und sittsam, Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt – als reissende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit –, so zeigt sie sich in ihrer wahren, nackten Gestalt."11 Gegen diesen makabren Sabbat kann nur das Proletariat einen wirklichen Widerstand aufbauen, der auch tatsächlich fähig ist, dem Krieg ein Ende zu setzen, weil er dem Kapitalismus selber – dem wahren Kriegstreiber – ein Ende bereiten wird.
Nur die Arbeiterklasse hat eine Lösung anzubieten
Gegen Ende des Vietnamkrieges war die amerikanische Armee nicht mehr kampftauglich. Die Soldaten – die meisten von ihnen einberufene – weigerten sich regelmässig, an die Front zu gehen und brachten "übereifrige" Offiziere um. Diese Demoralisierung war nicht die Folge einer militärischen Niederlage, sondern des Umstandes, dass es der amerikanischen Bourgeoisie im Gegensatz zum Krieg von 39–45 nicht gelungen war, das Proletariat für ihre imperialistischen Absichten zu gewinnen.
Bevor sich die Kriegstreiber im Pentagon zur Invasion in den Irak entschieden, überzeugten sie sich davon, dass das "Vietnamsyndrom" überwunden war. Und doch gibt es unter den amerikanischen Arbeitern in Uniform eine immer grössere Weigerung dagegen, ihr Leben für die militärischen Abenteuer ihrer Bourgeoisie hinzugeben: Seit dem Begin des Irakkrieges haben etwa 5'500 Soldaten desertiert, gleichzeitig fehlen bei der Reserve (die rund die Hälfte der Truppen stellt) etwa 5'000 Mann: Diese Gesamtheit von 10'500 Mann macht fast 8% der Truppenstärke im Irak von total 135'000 aus.
Für sich allein bildet dieser
passive Ungehorsam keine Zukunftsperspektive. Aber der alte Maulwurf des
Klassenbewusstseins fährt mit seiner Wühlarbeit fort, und das langsame Erwachen
des Arbeiterwiderstandes gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen
beinhaltet nicht nur Auflehnung, sondern auch die potentielle Zerstörung dieser
alten verfaulenden Welt – eine Umwälzung, die für immer die Kriege, das Elend
und alle Scheinheiligkeit beseitigen wird.
Jens, 9. April 2005
Fußnoten:
1 s. Weltrevolution Nr. 128 und www.internationalism.org/german: [131] Tödliche Flutwelle in Südasien – die wahre Katastrophe ist der Kapitalismus!
2 Rosa Luxemburg, Martinique, Gesammelte Werke Bd. 1/2, S. 249
3 Unmittelbar vor dem Ausbruch des Vulkans Pelée auf Martinique versicherten die staatlichen "Sachverständigen" der Bevölkerung, dass sie von ihm nichts zu befürchten hätten.
4.s. Weltrevolution Nr. 128 und www.internationalism.org/german: [131] Tödliche Flutwelle in Südasien – die wahre Katastrophe ist der Kapitalismus!
5 s. Offizielle Zeitschrift des Amerikanischen Armee-Vereins, s. https://www.ausa.org/www/armymag.nsf/ [132]
6 Das heisst als Aussenministerin.
7 s. Agence France Presse, 18.01.2005, https://www.commondreams.org/headlines05/0118-08.htm [133]
8 Zitiert nach Al Jazira: https://english.aljazeera.net/NR/exeres/350DA932-63C9-4666-9014-2209F872... [134]
9 Bis jetzt konnte die von der UNO geführte Untersuchung einzig feststellen, dass die Ermordung unbedingt die Beteiligung eines in der Region tätigen Geheimdienstes voraussetzte, d.h. der Israelis, der Franzosen, der Syrer oder der Amerikaner. Natürlich kann man auch die These nicht ausschliessen, dass die syrischen Geheimdienste schlicht unfähig waren.Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Vor 100 Jahren: Die Revolution von 1905 in Russland (Teil I)
- 4819 Aufrufe
Die Ereignisse von 1905 fanden statt, als die Periode des Niedergangs des Kapitalismus heraufdämmerte. Dieser Niedergang setzte bereits Zeichen, auch wenn nur eine winzige Minderheit der Revolutionäre jener Zeit in der Lage war, seine Bedeutung für den tief greifenden Wandel zu erahnen, der sich in der Gesellschaft und in den Bedingungen des proletarischen Kampfes vollzog. Im Verlaufe dieser Ereignisse entfaltete die Arbeiterklasse massive Bewegungen über die Fabriken, Branchen und sonstigen Kategorien hinaus. Es gab keine gemeinsamen Forderungen, auch keine klare Unterscheidung zwischen dem Ökonomischen und dem Politischen, wie dies zuvor mit dem Gewerkschaftskampf auf der einen und dem parlamentarischen Kampf auf der anderen Seite der Fall gewesen war. Es gab keine klaren Direktiven von den politischen Parteien oder den Gewerkschaften. Zum ersten Mal schuf die Dynamik einer Bewegung Organe, die Sowjets (oder: Arbeiterräte), welche zur Form werden sollten, in der sich das revolutionäre Proletariat in Russland 1917 und während der revolutionären Welle, die Europa im Anschluss an den Oktober erschütterte, organisieren und Macht ausüben sollte.
1905 nahm die Arbeiterbewegung an, dass die bürgerliche Revolution in Russland noch immer auf der Tagesordnung stand, da die russische Bourgeoisie nicht die politische Macht hatte, sondern dem feudalen Zarismus unterjocht blieb. Doch sollte die führende Rolle, die die Arbeiterklasse in diesen Ereignissen übernahm, diese Idee auf den Kopf stellen. Die reaktionäre Orientierung, die der parlamentarische und gewerkschaftliche Kampf im Begriff war anzunehmen, entsprechend dem Periodenwechsel, der stattgefunden hatte, war beileibe nicht deutlich und sollte es für eine geraume Zeit auch nicht werden. Doch die zweitrangige oder völlig nicht-existente Rolle, die die Gewerkschaften und das Parlament in der Bewegung in Russland spielten, war ein erstes ersichtliches Anzeichen dafür. Die Fähigkeit der Arbeiterklasse, die Leitung ihrer eigenen Zukunft zu übernehmen und sich selbst zu organisieren, weckte Zweifel an der Sichtweise der deutschen Sozialdemokratie und der internationalen Arbeiterbewegung, was die Aufgaben der Partei, ihre Funktion als Richtungsweisende Organisation der Arbeiterklasse anbelangte, und warf ein neues Licht auf die Verantwortlichkeiten der politischen Avantgarde der Arbeiterklasse. Viele Elemente, die später entscheidende Positionen der Arbeiterbewegung in der Phase der kapitalistischen Dekadenz bilden sollten, waren 1905 bereits vorhanden.
Die Revolution von 1905 war Gegenstand vieler Schriften innerhalb der Arbeiterbewegung zu jener Zeit, und die Fragen, die sie stellte, wurden heiss debattiert. Innerhalb des Rahmens einer kleinen Reihe von drei Artikeln wollen wir uns auf bestimmte Lehren konzentrieren, die uns als zentral für die Arbeiterbewegung heute und immer noch als völlig relevant erscheinen: der revolutionäre Charakter der Arbeiterklasse und die ihr innewohnende Fähigkeit, sich dem Kapitalismus historisch entgegenzustellen und der Gesellschaft eine neue Perspektive zu geben; der Charakter der Sowjets, "Die endgültige Form der Diktatur des Proletariats", wie Lenin sagte; die Fähigkeit der Arbeiterklasse, aus der Erfahrung zu lernen, die Lehren aus ihren Niederlagen zu ziehen, die Kontinuität ihrer historischen Schlacht und die Reifung der Bedingungen für die Revolution. Um so zu verfahren, müssen wir zunächst kurz zu den Ereignissen von 1905 zurückkehren, wobei wir uns auf jene beziehen, die Zeugen und Protagonisten zu dieser Zeit waren, wie Trotzki, Lenin, Rosa Luxemburg, und die in ihren Schriften imstande waren, nicht nur die allgemeinen politischen Lehren zu ziehen, sondern auch die intensiven Emotionen, die durch den Kampf in jenen Monaten geweckt wurden, zu vermitteln.(1)
Das revolutionäre Wesen der Arbeiterklasse
Die Russische Revolution von 1905 ist eine besonders deutliche Veranschaulichung dessen, was der Marxismus meint, wenn er vom grundsätzlich revolutionären Charakter der Arbeiterklasse spricht. Sie zeigt die Fähigkeit des russischen Proletariats, von einer Situation, in der es ideologisch von den Werten der kapitalistischen Gesellschaft beherrscht wurde, zu einer Position zu gelangen, in welcher es durch eine massive Kampfbewegung sein Selbstvertrauen entfaltete, seine Solidarität entwickelte und seine historische Stärke entdeckte, bis hin zu dem Punkt, wo es Organe schuf, die es in die Lage versetzte, seine Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. Dies ist ein lebendiges Beispiel für die materielle Kraft, zu der das Klassenbewusstsein des Proletariats wird, wenn es beginnt, sich zu regen. In den Jahren vor 1968 erzählte uns die westliche Bourgeoisie, dass das Proletariat "verbürgerlicht" sei, dass nichts mehr von ihm zu erwarten sei. Die Ereignisse in Frankreich 1968 und die gesamte internationale Welle von Kämpfen, die dem folgten, überführten dies als glatte Lüge. Sie beendeten die längste Periode einer Konterrevolution in der Geschichte, die durch die Niederlage der revolutionären Welle von 1917–23 eingeleitet worden war. Selbst nach dem Fall der Berliner Mauer hörte die Bourgeoisie nicht auf zu erklären, dass der Kommunismus tot und die Arbeiterklasse verschwunden sei – und die Schwierigkeiten, die Letztere erfuhr, schienen ihr Recht zu geben. Die Bourgeoisie hat stets ein Interesse, ihren eigenen Totengräber zu begraben. Doch die Arbeiterklasse existiert weiterhin – es gibt keinen Kapitalismus ohne Arbeiterklasse, und was 1905 in Russland stattfand, zeigt uns, wie sie von einer Situation der Unterwerfung und der ideologischen Konfusion unter dem kapitalistischen Joch in eine Lage gelangen kann, in welcher sie zum Subjekt der Geschichte wird, auf dem alle Hoffnungen ruhen, da sie die Zukunft der Menschheit in ihrem eigentlichen Dasein verkörpert.
Kurze Geschichte der ersten Schritte der Revolution
Bevor wir uns der Dynamik der russischen Revolution von 1905 widmen, müssen wir kurz den internationalen und historischen Kontext in Erinnerung rufen, der Ausgangspunkt der Revolution war. Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts waren von einer besonders ausgeprägten wirtschaftlichen Entwicklung in ganz Europa gekennzeichnet. Es waren die Jahre, in denen sich der Kapitalismus am dynamischsten entwickelte. Die Länder, die im kapitalistischen Sinne fortgeschritten waren, versuchten, in die rückständigen Regionen zu expandieren, sowohl um billige Arbeitskräfte und Rohstoffe zu erschliessen als auch um neue Märkte für ihre Produkte zu schaffen. In diesem Kontext wurde das zaristische Russland, ein Land, dessen Wirtschaft noch sehr rückständig war, zu einem idealen Objekt für den Import grosser Summen ausländischen Kapitals, um eine mittelständische und Grossindustrie zu errichten. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurde die Wirtschaft vollständig umgewandelt: "Einen mächtigen Hebel der Industrialisierung des Landes bildeten die Eisenbahnen."2 Verglichen mit anderen Ländern mit soliderer Industriestruktur wie Deutschland und Belgien, zeigen die von Trotzki zitierten Daten der Industrialisierung Russlands, dass, obwohl die Zahl der Arbeiter im Verhältnis zur riesigen Bevölkerung immer noch relativ bescheiden war (1,9 Millionen verglichen mit 1,56 in Deutschland und 600'000 im winzigen Belgien), Russland dennoch eine moderne Industriestruktur hatte, ebenbürtig mit jener der anderen Weltmächte. Scheinbar aus dem Nichts wurde die kapitalistische Industrie Russlands nicht durch eine innere Dynamik, sondern mithilfe ausländischen Kapitals und ausländischer Technologie geschaffen. Trotzkis Daten zeigen, dass die Arbeitskraft in Russland weitaus konzentrierter als in anderen Ländern war, weil sie überwiegend zwischen den mittleren und grossen Unternehmen aufgeteilt war (38,5% in Unternehmen mit mehr als 1'000 Arbeitern und 49,5% in Unternehmen zwischen 51 und 1'000 Arbeitern, wohingegen es in Deutschland 10% resp. 46% waren). Diese Daten über die Wirtschaftsstruktur erklären die revolutionäre Vitalität eines Proletariats, das ansonsten unterging in einem zutiefst rückständigen Land, welches noch immer von der bäuerlichen Wirtschaft beherrscht wurde.
Darüber hinaus fielen die Ereignisse von 1905 nicht aus heiterem Himmel, sondern waren das Produkt von Ereignissen, die Russland vom Ende des 19. Jahrhunderts an fortlaufend schüttelten. Wie Rosa Luxemburg zeigt: "Dieser Januarmassenstreik in Petersburg spielte sich nun zweifellos unter dem unmittelbaren Eindruck jenes riesenhaften Generalstreiks ab, der kurz vorher, im Dezember 1904, im Kaukasus, in Baku, ausgebrochen war und eine Weile lang ganz Russland in Atem hielt. Die Dezemberereignisse in Baku waren aber ihrerseits nichts anderes als ein letzter und kräftiger Ausläufer jener gewaltigen Massenstreiks, die wie ein periodisches Erdbeben in den Jahren 1903 und 1904 ganz Südrussland erschütterten und deren Prolog der Massenstreik in Batum (im Kaukasus) im März 1902 war. Diese erste Massenstreikbewegung in der fortlaufenden Kette der jetzigen revolutionären Eruptionen ist endlich nur um vier bis fünf Jahre vor dem grossen Generalstreik der Petersburger Textilarbeiter in den Jahren 1896 und 1897 entfernt…"3
Der 9. Januar 20054 ist der 100. Jahrestag des so genannten "Blutigen Sonntags", der am Anfang einer Reihe von Ereignissen im alten zaristischen Russland stand, die das Jahr 1905 hindurch stattfanden und in einer blutigen Repression des Moskauer Aufstandes im Dezember mündeten. Die Aktivitäten der Klasse fanden praktisch pausenlos das ganze Jahr hindurch statt, obwohl die Kampfformen nicht immer dieselben waren und die Kämpfe nicht immer dieselbe Intensität besassen. Es gab drei bedeutende Momente während dieses revolutionären Jahres: die Monate Januar, Oktober und Dezember.
Januar
Im Januar 1905 wurden vier Arbeiter von den Putilow-Werken in St. Petersburg entlassen. Aus Solidarität mit ihnen begann eine Streikbewegung: Es wurde eine Petition für politische Freiheit, für das Recht auf Bildung und den Achtstundentag, gegen die Besteuerung etc. entworfen, die dem Zaren von einer Massendemonstration überreicht werden sollte. Es war die Repression dieser Demonstration, die zum Ausgangspunkt eines einjährigen revolutionären Grossbrandes werden sollte. In der Tat kam der revolutionäre Prozess in Russland auf einzigartige Weise in Fahrt. "Tausende von Arbeitern – wohlgemerkt keine Sozialdemokraten, sondern religionsfromme, kaiserfromme Leute – unter der Führung des Priesters Gapon gehen von allen Stadtteilen aus zum Zentrum der Hauptstadt, zum Platze vor dem Winterpalast, um dem Zaren eine Petition zu überreichen. Die Arbeiter gehen mit Heiligenbildern, und ihr damaliger Führer Gapon versichert dem Zaren schriftlich, er bürge ihm für die Unverletzlichkeit seiner Person und bitte ihn, vor dem Volk zu erscheinen."5 Im April 1904 war Pater Gapon der Spiritus Rector einer "Versammlung russischer Fabrik- und Büroarbeiter in der Stadt St. Petersburg", autorisiert von der Regierung und im geheimen Einverständnis mit dem Polizeioffizier Subatow.6 Wie Lenin sagte, bestand die Rolle dieser Organisation darin, die damalige Arbeiterbewegung zu umklammern und zu kontrollieren, so wie heute, wo dasselbe Ziel mit anderen Mitteln erreicht wird. Doch der Druck, der sich innerhalb des Proletariats aufgebaut hatte, hatte bereits den kritischen Punkt erreicht. "Der legale Arbeiterverein war Gegenstand der besonderen Aufmerksamkeit der Subatowleute. Und nun wächst die Subatowsche Bewegung über ihren Rahmen hinaus, und diese von der Polizei im Interesse der Polizei, zur Unterstützung der Selbstherrschaft, zur Demoralisierung des politischen Selbstbewusstsein der Arbeiter geschaffene Bewegung wendet sich gegen die Selbstherrschaft, wird zu einem Ausbruch des proletarischen Klassenkampfes."7 All dies nahm Gestalt an, als die Arbeiter am Winterpalast ankamen, um dem Zaren ihre Forderungen auszuhändigen, und von den Truppen attackiert wurden, die "die Menge mit der blanken Waffe an(greifen), es wird geschossen gegen die waffenlosen Arbeiter, die auf den Knien die Kosaken anflehten, sie zum Kaiser zu lassen. Nach polizeilichen Mitteilungen gab es mehr als tausend Tote, mehr als zweitausend Verwundete. Die Erbitterung der Arbeiter war unbeschreiblich."8 Die Petersburger Arbeiter hatten an den Zaren, den sie den "Kleinen Vater" nannten, appelliert, und sie waren ausser sich vor Zorn, als er ihre Petition mit bewaffneten Kräften beantwortete. Es war diese tiefe Empörung, die den revolutionären Kampf des Januars auslöste. Dieselbe Arbeiterklasse, die eben noch Pater Gapon und religiösen Ikonen gefolgt war und ihre Petition an den "Kleinen Vater des Volkes" gerichtet hatte, zeigte nun, im Moment der Revolution, eine unvorhergesehene Stärke. Der geistige Zustand des Proletariats veränderte sich in dieser Periode rapide; dies ist typisch für den revolutionären Prozess, in welchem die Proletarier, worin ihr Glauben und ihre Furcht auch immer bestand, entdecken und sich bewusst werden, dass ihre Einheit sie stark macht. "Von einem Ende bis zum anderen ging eine gewaltige Streikwoge über das Land, die seinen ganzen Körper erschütterte. Nach annähernder Schätzung umfasste der Streik 122 Städte und Dörfer, einige Bergwerke des Donezbassins und 10 Eisenbahnen. Die proletarischen Massen wurden bis in ihre Tiefen aufgewühlt. Der Streik zog gegen eine Million Menschen in seinen Bannkreis. Ohne Plan, oft ohne Forderungen, sich immer wieder erneuernd, nur dem Solidaritätsinstinkte gehorchend, beherrschte er fast zwei Monate lang das Land."9 Sich auf Streikaktionen aus Solidarität einzulassen, ohne eine spezifische Forderung zu stellen, da "der nach Millionen zählenden proletarischen Masse ganz plötzlich scharf und schneidend die Unerträglichkeit jenes sozialen und ökonomischen Daseins zum Bewusstsein kam.”10, war sowohl ein Ausdruck als auch ein aktiver Faktor bei der Reifung des Bewusstseins des russischen Proletariats darüber, dass es eine Klasse ist und dass es als solche seinen Klassenfeind konfrontieren muss.
Dem Generalstreik im Januar folgte eine Periode andauernder Kämpfe um ökonomische Forderungen, die überall im Land aufflackerten und wieder erloschen. Diese Periode war weniger spektakulär, aber ebenso wichtig. "Die verschiedenen Unterströme des sozialen Prozesses der Revolution durchkreuzen einander, hemmen einander, steigern die inneren Widersprüche der Revolution (…) nicht nur der Januarblitz des ersten Generalstreiks, sondern noch mehr das darauffolgende grosse Frühlings- und Sommergewitter der ökonomischen Streiks (spielten) eine grosse Rolle". Auch wenn es "keine Sensationsnachrichten vom russischen Kampfplatz" gab, "wird in der Wirklichkeit in der Tiefe des ganzen Reiches die ganze Maulwurfsarbeit der Revolution ohne Rast Tag für Tag und Stunde für Stunde fortgesetzt" (ebenda). In Warschau fanden blutige Konfrontationen statt. In Lodz wurden Barrikaden errichtet. Die Matrosen des Panzerkreuzers Potemkin meuterten auf dem Schwarzen Meer. Diese gesamte Periode bereitete die zweite, stärkere Periode der Revolution vor.
Oktober
"Diese zweite revolutionäre Hauptaktion des Proletariats trägt schon einen wesentlich anderen Charakter als die erste im Januar. Freilich war auch hier der erste Anlass zum Ausbruch des Massenstreiks ein untergeordneter und scheinbar zufälliger: der Konflikt der Eisenbahner mit der Verwaltung wegen der Pensionskasse. Allein die darauf erfolgte allgemeine Erhebung des Industrieproletariats wird vom klaren politischen Gedanken getragen. Der Prolog des Januarstreiks war ein Bittgang zum Zaren um politische Freiheit, die Losung des Oktoberstreiks lautete: ‚Fort mit der konstitutionellen Komödie des Zarismus!‘ Und dank dem sofortigen Erfolg des Generalstreiks, dem Zarenmanifest vom 30. Oktober, fliesst die Bewegung nicht nach innen zurück, wie im Januar, um erst die Anfänge des ökonomischen Klassenkampfes nachzuholen, sondern ergiesst sich nach aussen, in eine eifrige Bestätigung der frisch eroberten politischen Freiheit. Demonstrationen, Versammlungen, eine junge Presse, öffentliche Diskussionen und blutige Massaker als das Ende vom Lied, darauf neue Massenstreiks und Demonstrationen…" (ebenda)
Im Oktober fand eine qualitative Änderung statt, die in der Bildung eines Sowjets in Petersburg ihren Ausdruck fand, welcher zu einem Meilenstein in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung werden sollte. Mit der Ausweitung des Druckarbeiterstreiks auf die Eisenbahnen und Telegrafenämter trafen die Arbeiter auf einer allgemeinen Versammlung die Entscheidung, einen Sowjet zu bilden, der zum zentralen Nervensystem der Revolution wurde. "Der Arbeiter-Delegiertenrat entstand als die Erfüllung eines objektiven, durch den Gang der Ereignisse erzeugten Bedürfnisses nach einer Organisation, die die Autorität darstellen könnte, ohne Traditionen zu haben, einer Organisation, die mit einem Male die zerstreuten, nach Hunderttausenden zählenden Massen umfassen könnte, ohne ihnen viele organisatorische Hemmungen aufzuerlegen, nach einer Organisation, die die revolutionären Strömungen innerhalb des Proletariats vereinigen, die einer Initiative fähig und automatisch sich selbst kontrollieren könnte…".11 Bald darauf wurden Sowjets auch in vielen anderen Städten gegründet.
Die Bildung der ersten Sowjets verlief unbemerkt von einem grossen Teil der internationalen Bewegung. Rosa Luxemburg, die auf der Basis der Revolution von 1905 so meisterhaft die neuen Kennzeichen des Kampfes des Proletariats in der Morgendämmerung einer neuen historischen Epoche – den Massenstreik – analysiert hatte, betrachtete die Gewerkschaften noch immer als die Organisationsform der Klasse.12 Es waren die Bolschewiki (wenn auch nicht sofort) und Trotzki, die den Fortschritt erkannten, den die Bildung dieser Organe für die Arbeiterbewegung darstellte, denn sie begriffen, dass die Sowjets tatsächlich Organe für die Machtergreifung sind. Wir werden diesen Punkt hier nicht weiter ausführen, da wir ohnehin beabsichtigen, uns mit ihm in einem anderen Artikel näher zu befassen.13 Wir wollen nur darauf hinweisen, dass von dem Moment an, wo der Kapitalismus in seine Epoche des Niedergangs getreten war, das Proletariat mit der unmittelbaren Aufgabe des Sturzes des Kapitalismus konfrontiert war. So führten zehn Monate des Kampfes, der sozialistischen Agitation, der Reifung des Bewusstseins, der Änderung des Gleichgewichts der Kräfte zwischen den Klassen ganz "natürlich" zur Schaffung von Organen zur Ausübung von Macht.
"Insgesamt waren die Sowjets ganz simple Streikkomitees, gleich jenen, die stets während wilder Streiks gebildet worden waren. Da die Streiks in Russland in den grossen Fabriken ausbrachen und sich sehr schnell auf die Städte und Provinzen ausbreiteten, mussten die Arbeiter permanent in Kontakt bleiben. Sie trafen sich am Arbeitsplatz und diskutierten, (…) sie sandten Delegationen zu anderen Fabriken (…) Doch diese Aufgaben waren tatsächlich viel breiter gefächert als in den gegenwärtigen Streiks. Die Arbeiter mussten sich wirklich von der schlimmen Unterdrückung durch den Zarismus befreien und waren sich darüber bewusst, dass durch ihre Tat die eigentlichen Fundamente der russischen Gesellschaft umgewandelt wurden. Es ging nicht nur um Löhne, sondern auch um all die allgemeinen, die Gesellschaft betreffenden Probleme. Sie mussten für sich selbst einen zuverlässigen Weg in den vielen Gebieten finden und sich mit politischen Fragen befassen. Als sich der Streik intensivierte und übers ganze Land ausbreitete, was Industrie und Transport zum Erliegen brachte und die Behörden lähmte, waren die Sowjets mit neuen Problemen konfrontiert. Sie mussten das gesellschaftliche Leben organisieren, auf die Aufrechterhaltung der Ordnung wie auf die effiziente Funktionsweise des lebenswichtigen öffentlichen Dienstes achten, kurz: Funktionen erfüllen, die gewöhnlich Sache der Regierung sind. Die Arbeiter führten die von ihnen getroffenen Entscheidungen auch aus."14
Dezember
"Die Gärung nach dem kurzen Verfassungstraum und dem grausamen Erwachen führt endlich im Dezember zum Ausbruch des dritten allgemeinen Massenstreiks im ganzen Zarenreich. Diesmal sind der Verlauf und der Ausgang wieder ein ganz anderer als in den beiden früheren Fällen. Die politische Aktion schlägt nicht mehr in eine ökonomische um wie im Januar, sie erringt aber auch nicht mehr einen raschen Sieg wie im Oktober. Die Versuche der russischen Kamarilla mit der wirklichen politischen Freiheit werden nicht mehr gemacht, und die revolutionäre Aktion stösst somit zum ersten Male in ihrer ganzen Breite auf die starre Mauer der materiellen Gewalt des Absolutismus."15 Aufgeschreckt von der Bewegung des Proletariats, reihte sich die kapitalistische Bourgeoisie hinter dem Zaren ein. Der Regierung gelang es nicht, die liberalen Gesetze, die sie versprochen hatte, durch die Duma zu bringen. Die Führer des Petrograder Sowjet wurden inhaftiert. Doch in Moskau wurde der Kampf fortgesetzt: "Der Gipfel der Revolution 1905 bildete der Dezemberaufstand in Moskau. Die kleine Zahl der Aufständischen, nämlich der organisierten und bewaffneten Arbeiter – sie waren nicht zahlreicher als etwa achttausend – leistete während neun Tagen Widerstand der zaristischen Regierung, die der Moskauer Garnison kein Vertrauen schenken konnte, dieselbe vielmehr hinter Schloss und Riegel halten musste und nur dank der Ankunft des Semenowski-Regiments aus Petersburg den Aufstand zu unterdrücken imstande war".16
Der proletarische Charakter der Revolution von 1905 und die Dynamik des Massenstreiks
Das historische Hauptelement ist bereits umrissen worden, und wir wollen daher hier nur einen Punkt unterstreichen: Die Revolution von 1905 hatte nur einen Hauptprotagonisten, das russische Proletariat, und ihre ganze Dynamik folgte strikt der Logik dieser Klasse. Die gesamte internationale Arbeiterbewegung erwartete eine bürgerliche Revolution in Russland und glaubte, dass es die zentrale Aufgabe der Arbeiterklasse war, sich am Sturz des Feudalstaates zu beteiligen und auf eine Etablierung bürgerlicher Freiheiten zu drängen, wie dies in den Revolutionen von 1789 und 1848 der Fall gewesen war. Doch nicht nur, dass es der Massenstreik der Arbeiterklasse war, der das Ganze anschob, darüber hinaus führte seine Dynamik zur Schaffung von Machtorganen der Arbeiterklasse. Lenin selbst war sich klar genug darüber, als er sagte, dass es abgesehen von ihrem "bürgerlich demokratischen" Charakter und "nach ihrem sozialen Inhalt (…) eine proletarische (Revolution) war, nicht nur in dem Sinne, dass das Proletariat die führende Kraft, die Avantgarde der Bewegung darstellte, sondern auch in dem Sinne, dass das spezifische proletarische Kampfesmittel, nämlich der Streik, das Hauptmittel der Aufrüttelung der Massen und das am meisten Charakteristische im wellenmässigen Gang der entscheidenden Ereignisse bildete." (ebenda) Doch wenn Lenin vom Streik sprach, dürfen wir diesen nicht als 4, 8 oder 24-Stunden-Aktion verstehen, wie heute von den Gewerkschaften allerorten vorgeschlagen. Tatsächlich sollte das, was sich 1905 entwickelte und später Massenstreik genannt wurde, sollte dieses "Meer von Erscheinungen" – wie es Rosa Luxemburg bezeichnete – die spontane Ausweitung und Selbstorganisierung des Kampfes des Proletariats alle grossen Bewegungen von Kämpfen im 20. Jahrhundert charakterisieren. "Der rechte Flügel der Zweiten Internationalen, die Mehrheit, konnte, überrascht von der Gewalttätigkeit dieser Ereignisse, überhaupt nicht verstehen, was vor sich ging, sondern offenbarte seine lautstarke Missbilligung und Abscheu gegenüber der Entwicklung des Klassenkampfes – und liess somit den Prozess erahnen, der ihn in das Lager des Klassenfeindes führen sollte."17 Der linke Flügel, der die Bolschewiki, Rosa Luxemburg und Pannekoek mit einschloss, sah sich bald in seinen Positionen (gegen Bernsteins Revisionismus18 und den parlamentarischen Kretinismus) bestätigt, doch er musste grosse theoretische Anstrengungen unternehmen, um die veränderten Bedingungen im Leben des Kapitalismus vollständig zu begreifen – die Phase des Imperialismus und der Dekadenz – die den Wandel in den Zielen und Mitteln des Klassenkampfes bestimmten. Doch Luxemburg hatte bereits die Voraussetzungen dafür skizziert: "So erweist sich der Massenstreik also nicht als ein spezifisch russisches, aus dem Absolutismus entsprungenes Produkt, sondern als eine allgemeine Form des proletarischen Klassenkampfes, die sich aus dem gegenwärtigen Stadium der kapitalistischen Entwicklung und der Klassenverhältnisse ergibt (…) die heutige russische Revolution steht auf einem Punkt des geschichtlichen Weges, der bereits über den Berg, über den Höhepunkt der kapitalistischen Entwicklung hinweggeschritten ist."19
Der Massenstreik ist nicht einfach eine Bewegung der Massen, eine Art Volksaufstand, der "alle Unterdrückten" umfasst und als solcher positiv ist, wenn wir den Worten der linkskapitalistischen und anarchistischen Ideologie folgen. 1905 schrieb Pannekoek: "Nimmt man die Masse ganz im allgemeinen, das ganze Volk, so findet man, dass bei der gegenseitigen Aufhebung entgegengesetzter Auffassungen und Willen anscheinend nichts übrig bleibt als eine willenlose, launenhafte, zügellose, charakterlose, passive Masse, hin und her schwankend zwischen verschiedenen Antrieben, zwischen aufbäumendem Impuls und dumpfer Gleichgültigkeit – bekanntlich das Bild in dem die liberalen Schriftsteller am liebsten das Volk darstelle. (…) Denn zwischen der kleinsten Einheit, der Einzelpersonen, und dem ganzen Allgemeinen, in dem alle Unterschiede aufgehoben sind, der inerten Massen, kennen sie kein Zwischenglied; sie kennen nicht die Klassen. Demgegenüber ist es die Kraft der sozialistischen Geschichtslehre, dass sie in die unendliche Verschiedenheit der Persönlichkeiten Ordnung und System brachte durch die Verteilung der Gesellschaft in Klassen. (…) Unterscheidet man in der geschichtlichen Massenbewegung die besonderen Klassen, so tritt aus dem zuvor unentwirrbaren Nebelbild auf einmal ein übersichtlicher Kampf der Klassen hervor, mit seinen wechselnden Momenten, von Angriff, Rückzug, Verteidigung, Sieg und Niederlage."20
Während sich die Bourgeoisie und mit ihr die Opportunisten der Arbeiterbewegung mit Abscheu von der "unbegreiflichen" Bewegung in Russland 1905 abwandten, sei es an der revolutionären Linken gewesen, die Lehren aus der neuen Situation zu ziehen: "Daher sind die Massenaktionen eine natürliche folge der imperialistischen Entwicklung des modernen Kapitalismus und bilden immer mehr die notwendige Form des Kampfes gegen ihn. (...) Früher musste die Volkserhebung entweder das ganze Ziel erobern, oder sie waren gescheitert, wenn ihre Macht nicht dazu ausreichte. Unsere Massenaktionen (des Proletariats) können nicht scheitern; auch wenn das gesetzte Ziel nicht erreicht wird, sind sie nicht vergebens, und sogar zeitweilige Rückschläge bauen an dem zukünftigen Sieg mit."21
Der Massenstreik ist kein fertiges Rezept wie der von den Anarchisten propagierte "Generalstreik"22, er ist vielmehr der originäre Ausdruck der Arbeiterklasse, eine bestimmte Art, ihre Kräfte zu sammeln, um ihren revolutionären Kampf vorzubereiten. "Mit einem Wort: Der Massenstreik, wie ihn uns die russische Revolution zeigt, ist nicht ein pfiffiges Mittel, ausgeklügelt zum Zwecke einer kräftigeren Wirkung des proletarischen Kampfes, sondern er ist die Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution."23 Heute haben wir keine direkte oder indirekte Vorstellung, was ein Massenstreik ist, mit der Ausnahme des für die Älteren unter uns wohl bekannten Kampfes der polnischen Arbeiter 1980.24 So wenden wir uns einmal mehr Rosa Luxemburg zu, die einen soliden und klaren Rahmen anbietet: "… dass die Massenstreiks, von jenem ersten grossen Lohnkampf der Petersburger Textilarbeiter im Jahre 1896/1897 bis zu dem letzten grossen Massenstreik im Dezember 1905, ganz unmerklich aus ökonomischen in politische übergehen, so dass es fast unmöglich ist, die Grenzen zwischen beiden zu ziehen. Auch jeder einzelne von den grossen Massenstreiks wiederholt sozusagen im Kleinen die allgemeine Geschichte des russischen Massenstreiks und beginnt mit einem rein ökonomischen oder jedenfalls partiellen gewerkschaftlichen Konflikt, um die Stufenleiter bis zur politischen Kundgebung zu durchlaufen (…) Der Januarmassenstreik 1905 entwickelt sich aus dem internen Konflikt in den Putilow-Werken, der Oktoberstreik aus dem Kampf der Eisenbahner um die Pensionskasse, der Dezemberstreik endlich aus dem Kampf der Post- und Telegraphenangestellten um das Koalitionsrecht. Der Fortschritt der Bewegung im ganzen äussert sich nicht darin, dass das ökonomische Anfangsstadium ausfällt, sondern vielmehr in der Rapidität, womit die Stufenleiter zur politischen Kundgebung durchlaufen wird, und in der Extremität des Punktes, bis zu dem sich der Massenstreik voranbewegt (…) bilden das ökonomische und das politische Moment in der Massenstreikperiode, weit entfernt, sich reinlich zu scheiden oder gar auszuschliessen (…), vielmehr nur zwei ineinander geschlungene Seiten des proletarischen Klassenkampfes in " 25 Hier greift Rosa Luxemburg einen wichtigen Aspekt des revolutionären Kampfes des Proletariats auf: die unzertrennliche Einheit zwischen dem ökonomischen und politischen Kampf. Im Gegensatz zu jenen, die damals sagten, dass der politische Kampf hervorrage, dass er sozusagen der edle Aspekt in der Konfrontation des Proletariats mit der Bourgeoisie sei, erklärt Luxemburg klar und deutlich, wie sich der Kampf vom ökonomischen zum politischen Terrain entwickelt und dann mit Macht zum Terrain des ökonomischen Kampfes zurückkehrt. Dies wird besonders deutlich, wenn man die Texte über die Revolution von 1905 und die Frühjahrs- und Sommerperiode liest. In der Tat sehen wir, wie das Proletariat am blutigen Sonntag mit einer politischen Demonstration begann, indem es um politische Rechte ersuchte, und sich dann, nach der schweren Repression, nicht etwa zurückzog, sondern vielmehr mit neuer Energie und Stärke auf die Bühne trat und sich für die Verteidigung seiner Arbeits- und Lebensbedingungen einsetzte. Aus diesem Grund gab es in den folgenden Monaten einen Anstieg in der Zahl der Kämpfe: "Hier wird um den Achtstundentag gekämpft, dort gegen die Akkordarbeit, hier werden brutale Meister auf dem Handkarren im Sack ‚hinausgeführt‘, anderswo gegen infame Strafsysteme, überall um bessere Löhne, hier und da um Abschaffung der Heimarbeit gekämpft." (ebenda). Diese Periode war auch von grosser Bedeutung, weil sie, wie Rosa Luxemburg betont, dem Proletariat die Gelegenheit gab, im Nachhinein all die Lehren des Prologs zum Januar zu verinnerlichen und ihre Ideen für die Zukunft zu klären. In der Tat: "Der plötzlich durch den elektrischen Schlag einer politischen Aktion wachgerüttelte Arbeiter greift im nächsten Augenblick vor allem zu dem Nächstliegenden: zur Abwehr gegen sein ökonomisches Sklavenverhältnis; die stürmische Geste des politischen Kampfes lässt ihn plötzlich mit ungeahnter Intensität die Schwere und den Druck seiner ökonomischen Ketten fühlen."(ebenda).
Der spontane Charakter der Revolution und das Vertrauen in die Arbeiterklasse
Ein besonders wichtiger Aspekt des revolutionären Prozesses in Russland 1905 war sein ausgesprochen spontaner Charakter. Die Kämpfe entstanden, entwickelten und verstärkten sich. Sie verhalfen neuen Kampfinstrumenten wie dem Massenstreik oder den Sowjets zur Entstehung, ohne dass es den revolutionären Parteien jener Zeit gelang, Schritt zu halten mit den Ereignissen oder gar zunächst die Folgen dessen völlig zu verstehen, was sich da ereignete. Die Stärke des Proletariats innerhalb der Bewegung zur Verteidigung seiner eigenen Interessen ist eindrucksvoll und enthält eine ausserordentliche Kreativität. Lenin erkannte dies in seiner Einschätzung der Revolution von 1905, die er ein Jahr darauf verfasste: "Vom Streik und von Demonstrationen zu einzelnen Barrikaden, von einzelnen Barrikaden zu massenweiser Errichtung von Barrikaden und zum Strassenkampf mit den Truppen. Über den Kopf der Organisationen hinweg ging der proletarische Massenkampf vom Streik zum Aufstand über. Darin liegt die allergrösste geschichtliche Errungenschaft der russischen Revolution, die im Dezember 1905 erreicht wurde, eine Errungenschaft, die wie alle vorangegangenen um den Preis des grössten Opfers erkauft wurde. Vom politischen Massenstreik wurde die Bewegung auf eine höhere Stufe gehoben. Sie zwang die Reaktion, in ihrem Widerstand bis zum letzten zu gehen, und brachte dadurch mit Riesenschritten den Augenblick nahe, in dem die Revolution im Gebrauch der Angriffsmittel ebenfalls bis zum letzten gehen wird. Die Reaktion kann nicht weiter gehen als bis zum Artilleriebeschuss von Barrikaden, Häusern und der Menschenmenge auf den Strassen. Die Revolution kann noch weiter gehen als bis zum Kampf der Moskauer Kampfgruppen, sie kann noch viel, viel weiter gehen, in die Breite und in die Tiefen (…) Den Wechsel in den objektiven Bedingungen des Kampfes, der den Übergang vom Streik zum Aufstand erforderte, hat das Proletariat früher als seine Führer gefühlt. Die Praxis ist, wie stets, der Theorie vorausgegangen."26
Diese Passage von Lenin ist besonders wichtig heute, wenn man bedenkt, dass viele Zweifel, die unter politisierten Elementen und, bis zu einem gewissen Umfang, auch innerhalb proletarischer Organisation vorhanden sind, mit dem Gedanken verknüpft sind, dass es dem Proletariat nie gelingen wird, sich aus seiner Apathie zu befreien, in die es manchmal zu fallen scheint. Was 1905 geschah, straft diesen Gedanken auf bemerkenswerte Weise Lügen, und das Erstaunen, das wir fühlen, wenn wir sehen, dass der Klassenkampf spontan war, drückt lediglich die Unterschätzung des tief greifenden Prozesses aus, der innerhalb der Klasse stattfindet, der unterirdischen Reifung des Bewusstseins, von dem Marx sprach, wenn er den "alten Maulwurf" erwähnte. Das Vertrauen in die Arbeiterklasse, in ihre Fähigkeit, eine politische Antwort auf die Probleme zu geben, die die Gesellschaft heimsuchen, ist eine Grundfrage in der gegenwärtigen Periode. Nach dem Fall der Berliner Mauer und der ihm folgenden bürgerlichen Kampagne rund um das Scheitern des Kommunismus, fälschlicherweise auf das berüchtigte stalinistische Regime gemünzt, hat die Arbeiterklasse Schwierigkeiten, sich selbst als Klasse anzuerkennen und mit einem Ziel, einer Perspektive, einem Ideal, für das es sich zu kämpfen lohnt, zu identifizieren. Dieser Mangel an Perspektive bewirkt automatisch eine Dämpfung des Kampfgeistes, er schwächt die Überzeugung, die notwendig ist, um zu kämpfen, denn man kämpft nicht für Nichts, sondern nur, wenn man etwas anstrebt. Aus diesem Grund sind heute die Abwesenheit von Klarheit über die Perspektive und der Mangel an Überzeugung in sich selbst eng miteinander verknüpft. Solch eine Situation kann im Wesentlichen nur in der Praxis überwunden werden, durch die direkte Erfahrung der Arbeiterklasse über ihre Fähigkeiten und über die Notwendigkeit, für eine Perspektive zu kämpfen. Genau dies geschah in Russland 1905, als "In einigen Monaten sah es vollständig anders aus! Hunderte revolutionäre Sozialdemokraten wuchsen ‚plötzlich‘ zu Tausenden, Tausende wurden zu Führern von 2 bis 3 Millionen Bauern, die Bauernbewegung erzeugte Sympathie im Heere und führte zu Militäraufständen, zu bewaffneten Kämpfen eines Teiles des Heeres gegen einen anderen Teil. "27 Dies war nicht nur für das Proletariat in Russland notwendig, sondern auch für das Weltproletariat, einschliesslich des höchst entwickelten deutschen Proletariats.
"In der Revolution, wo die Masse selbst auf dem politischen Schauplatz erscheint, wird das Klassenbewusstsein ein praktisches, aktives. Dem russischen Proletariat hat deshalb ein Jahr der Revolution jene ‚Schulung‘ gegeben, welche dem deutschen Proletariat 30 Jahre parlamentarischen und gewerkschaftlichen Kampfes nicht künstlich geben können (…) Ebenso sicher wird aber umgekehrt in Deutschland in einer Periode kräftiger politischer Aktionen das lebendige, aktionsfähige revolutionäre Klassengefühl die breitesten und tiefsten Schichten des Proletariats ergreifen, und zwar um so rascher und um so mächtiger, je gewaltiger das bis dahin geleistete Erziehungswerk der Sozialdemokratie ist."28 Wir können, indem wir Rosa Luxemburg sinngemäss wiedergeben, gleichermassen sagen dass auch heute, in dieser Periode der tiefen internationalen Wirtschaftskrise und angesichts der offenkundigen Unfähigkeit der Bourgeoisie, dem Bankrott des kapitalistischen Systems etwas entgegen zu setzen, ein aktives und lebendiges revolutionäres Gefühl die reifsten Teile des Proletariats ergreifen wird, und dies wird besonders in den entwickelteren kapitalistischen Ländern geschehen, wo der Erfahrungsschatz der Klasse am reichsten und am tiefsten verwurzelt ist und wo die revolutionären Kräfte, obschon noch immer schwach, präsenter sind. Dieses Vertrauen, das wir heute in der Arbeiterklasse ausdrücken, ist weder ein Glaubensbekenntnis noch ein blindes, mystisches Vertrauen, sondern beruht exakt auf der Geschichte der Klasse und auf ihre gelegentlich überraschende Fähigkeit, aus der offensichtlichen Trägheit zu erwachen. Wie wir versucht haben aufzuzeigen, ist, obwohl es zutrifft, dass die dynamischen Prozesse, durch welche ihr Bewusstsein reift, oftmals verborgen und schwer zu durchschauen sind, es gewiss, dass diese Klasse historisch wegen ihrer Stellung in der Gesellschaft sowohl als ausgebeutete als auch als revolutionäre Klasse gefordert ist, jene Klasse zu konfrontieren, die sie unterdrückt, die Bourgeoisie. Mit der Erfahrung dieser Auseinandersetzung wird sie das Selbstvertrauen wieder entdecken, dessen sie heute entbehrt:
"Hier sind die Massen schon vorher organisiert, ihre Aktion ist im voraus überlegt und vorbereitet, und nach deren Abschluss bleibt die Organisation zusammen. (…) In unseren Massenaktionen handelt es sich nun allerdings auch um die Eroberung der Herrschaft, aber wir wissen, dass sie nur durch eine hochorganisierte, sozialistische Volksmasse möglich ist. (…) Die Befestigung der Klassenherrschaft, die wir ins Auge fassen, ist nur dadurch möchlich, das jetzt eine bleibende Volksmacht allmählich und unerschütterlich aufgebaut wird, bis zu dem Grade, dass sie die Staatsgewalt der Bourgeoisie durch ihre Wucht einfach zerdrückt und in nichts auflöst."29
Neben der Entwicklung des Selbstvertrauens der Arbeiterklasse gibt es ein weiteres entscheidendes Element im proletarischen Kampf: die Solidarität innerhalb ihrer Reihen. Die Arbeiterklasse ist die einzige Klasse, die einen wirklichen Sinn für Solidarität besitzt, da es in ihr keine divergierenden wirtschaftlichen Interessen gibt – anders als die Bourgeoisie, eine Klasse der Konkurrenz, für die sich die Solidarität lediglich innerhalb des nationalen Rahmens oder gegen ihren historischen Gegner, das Proletariat, ausdrückt. Die Konkurrenz innerhalb des Proletariats wird ihm vom Kapitalismus aufgezwungen, doch die Gesellschaft, die es mit seiner Zeugungskraft und mit seinem Dasein in die Welt setzt, ist eine Gesellschaft, die mit allen Teilungen Schluss macht, eine wirkliche menschliche Gemeinschaft. Die proletarische Solidarität ist eine fundamentale Waffe im proletarischen Kampf; sie stand am Anfang der riesigen Erhebungen in Russland 1905: "Der Funke, der den Brand entfachte, war einer der alltäglichen Zusammenstösse zwischen Arbeit und Kapital – ein Streik in einem Werk. Interessant jedoch ist, dass dieser Streik der 12'000 Putilow-Arbeiter, der am Montag dem, 3. Januar ausbrach, vor allem ein Streik der proletarischen Solidarität war. Der Anlass war die Entlassung von vier Arbeitern. ‚Als die Forderung, sie wieder einzustellen, nicht erfüllt wurde‘ schreibt uns am 7. Januar ein Genosse aus Pertersburg, ‚wurde die Arbeit sofort und sehr einmütig niedergelegt‘"30
Es ist kein Zufall, dass die Bourgeoisie heute versucht, den Begriff der Solidarität zu verzerren, indem sie ihn in einer "humanitären" Form präsentiert oder als "ökonomische Solidarität" aufbereitet, einer der Tricks der neuen, "alternativen" Antiglobalisierungsbewegung, die versucht, der allmählichen Bewusstwerdung entgegenzuwirken, die sich in der Tiefe der Gesellschaft über die Sackgasse, die der Kapitalismus für die Menschheit repräsentiert, entwickelt. Auch wenn die Arbeiterklasse in ihrer Gesamtheit sich noch nicht über die Macht ihrer Solidarität bewusst ist, die Bourgeoisie selbst hat die Lehren nicht vergessen, die das Proletariat in die Geschichte geprägt hat.
1905 war eine grosse Arbeiterbewegung, die aus den Tiefen der revolutionären Seele des Proletariats emporkam und die die schöpferische Macht der revolutionären Klasse zeigte. Heute hat das Proletariat trotz aller Schläge, die die Bourgeoisie in ihrem Todeskampf ausgeteilt hat, seine Fähigkeiten immer noch erhalten. Es liegt an den Revolutionären, ihre Klasse in die Lage zu versetzen, sich die grossen Erfahrungen ihrer vergangenen Geschichte wiederanzueignen und unermüdlich das theoretische und politische Terrain für die Entwicklung des Kampfes sowie des Bewusstseins der Klasse heute und morgen zu bereiten.
"Aber im Sturm der
revolutionären Periode verwandelt sich eben der Proletarier aus einem
Unterstützung heischenden vorsorglichen Familienvater in einen
‚Revolutionsromantiker‘, für den sogar das höchste Gut, nämlich das Leben,
geschweige das materielle Wohlsein im Vergleich mit den Kampfidealen geringen
Wert besitzt. Wenn aber die Leitung der Massenstreiks im Sinne des Kommandos
über ihre Entstehung und im Sinne der Berechnung und Deckung ihrer Kosten Sache
der revolutionären Periode selbst ist, so kommt dafür die Leitung bei
Massenstreiks in einem ganz anderen Sinne der Sozialdemokratie und ihren
führenden Organen zu (…) ist die Sozialdemokratie berufen, die politische
Leitung auch mitten in der Revolutionsperiode zu übernehmen. Die Parole, die
Richtung dem Kampfe zu geben, die Taktik des politischen Kampfes so
einzurichten, dass in jeder Phase und in jedem Moment des Kampfes die ganze
Summe der vorhandenen und bereits ausgelösten, betätigten Macht des
Proletariats realisiert wird…"31 1905 waren die Revolutionäre (zu jener
Zeit Sozialdemokraten genannt) oft überrascht, überfordert von der Heftigkeit
der Bewegung, von ihrer Neuheit sowie von ihren schöpferischen Einfällen. Sie
waren nicht immer in der Lage, die passenden Losungen für, wie Rosa Luxemburg
sagt, "jede Phase, jeden Moment" zu finden, und sie begingen sogar ernste
Fehler. Doch die grundlegende revolutionäre Arbeit, die sie vor und während der
Bewegung leisteten, die sozialistische Agitation, die aktive Beteiligung an den
Kämpfen ihrer Klasse waren unerlässliche Faktoren der Revolution von 1905. Ihre
Fähigkeit, im Anschluss daran die Lehren aus diesen Ereignissen zu ziehen,
bereitete den Boden für den Sieg von 1917.
Ezechiele (5.12.2004)
Fußnoten:
1 Es ist innerhalb des Rahmens dieser Artikel nicht möglich, den ganzen Reichtum dieser Ereignisse oder sämtliche aufgeworfene Fragen zu schildern, und wir verweisen den Leser auf die historischen Dokumente selbst. Ausserdem haben wir eine Reihe von Punkten ausser Acht gelassen, wie die Diskussion über die bürgerlichen Aufgaben (gemäss der Menschewiki), den "demokratisch-bürgerlichen" Charakter (gemäss der Bolschewiki) der Russischen Revolution oder die "Theorie der permanenten Revolution" (laut Trotzki), die alle mehr oder weniger dazu neigen, die Aufgaben des Proletariats innerhalb des nationalen Rahmens und unter den Vorzeichen der Aufstiegsphase des Kapitalismus zu betrachten. Des Gleichen können wir nicht auf die Diskussion in der deutschen Sozialdemokratie, insbesondere zwischen Kautsky und Rosa Luxemburg über den Massenstreik, eingehen
2 Leo Trotzki: 1905.
3 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S.103.
4 22. Januar, entsprechend dem alten Julianischen Kalender, der damals in Russland noch gültig war.
5 V. I. Lenin: Ein Vortrag über die Revolution von 1905, in: LW Bd. 23, S. 244.
6 Subatow war ein hochrangiger Polizeioffizier, der in Übereinstimmung mit der Regierung Arbeiterassoziationen gründete und damit bezweckte, die Konflikte innerhalb eines strikt ökonomischen Rahmens zu halten und sie von jeder Kritik an der Regierung abzuhalten.
7 V. I. Lenin: Der Petersburger Streik, in: LW Bd. 8,
S. 78.
8 V. I. Lenin: Ein Vortrag über die Revolution von 1905, in: LW Bd. 23, S. 244.
9 L. Trotzki: 1905.
10 R. Luxemburg: Massenstreik Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S.112.
11 L. Trotzki: 1905
12 s. unseren Artikel Notes on the mass strike, in: International Review, Nr. 27 (frz., engl., span. Ausgabe).
13 s. unseren Artikel 1905 Revolution: Fundamental Lessons for the Proletariat, in: International Review, Nr. 43, (frz., engl., span. Ausgabe).
14 A. Pannekoek: Die Arbeiterräte (Entwurf von 1941–42), eigene Übersetzung.
15 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S.123.
16 V. I. Lenin: Ein Vortrag über die Revolution von 1905, in: LW Bd. 23, S. 258.
17 s. Die historische Bedingung der Generalisierung des Klassenkampfes, in: International Revue, Nr. 7.
18 Innerhalb der deutschen Sozialdemokratie förderte Bernstein die Idee vom friedlichen Übergang zum Sozialismus. Seine Strömung wurde als revisionistisch bezeichnet. Rosa Luxemburg kämpfte gegen sie als ein Ausdruck einer gefährlichen opportunistischen Verirrung, die die Partei betraf, in ihrem Pamphlet Sozialreform oder Revolution an.
19 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S.149.
20 A. Pannekoek: Marxismus und Theologie, veröffentlicht in der Neuen Zeit 1905, zitiert in: Massenaktion und Revolution.
21 A. Pannekoek: Massenaktion und Revolution, Neue Zeit, 1912.
22 s. Die historischen Bedingungen der Generalisierung des Klassenkampfes, in: International Revue, Nr. 7.
23 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S. 128.
24 s. Polen 1980: Perspektive und Bedeutung der Kämpfe, in: Internationalen Revue Nr. 6.
25 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S. 127/128.
26 V. I. Lenin: Die Lehren des Moskauer Aufstand, in: LW Bd. 11, S. 158/159.
27 V.I. Lenin: Ein Vortrag über die Revolution von 1905, in: LW Bd. 23, S. 244.
28 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S. 145.
29 A. Pannekoek: Massenaktion und Revolution, Neue Zeit, 1912.
30 V.I. Lenin: Revolutionstage, in: LW Bd. 8, S. 102
31 R. Luxemburg: Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2, S.133/134.
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue 36
- 3269 Aufrufe
16. Kongress der IKS: Resolution über die Internationale Situation
- 3053 Aufrufe
1. Rosa Luxemburg schrieb 1916 in der Einleitung der Juniusbroschüre zur historischen Bedeutung des 1. Weltkriegs: „Friedrich Engels sagt einmal: ‘Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei.’ Was bedeutet ein ‘Rückfall in die Barbarei’ auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter, vor 40 Jahren, vorhersagte, vor der Wahl: entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein grosser Friedhof; oder Sieg des Sozialismus, d. h. der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode; den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder – Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats. Die Zukunft der Kultur und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert mit männlichem Entschluss in die Waagschale wirft.“ (Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 4, S. 62)
Der Krieg im dekadenten Kapitalismus
2. Fast 90 Jahre später bestätigt der Verlauf der Geschichte die Klarheit und Genauigkeit der Diagnose Luxemburgs. Rosa behauptete, dass der Konflikt, der im Jahr 1914 begann, eine Periode der Weltkriege eröffnet hatte, die, wenn sie ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte, zur Zerstörung der Zivilisation führt. Nur 20 Jahre, nachdem die erhoffte Rebellion des Proletariats den Krieg gestoppt hatte, aber es nicht geglückt war, dem Kapitalismus ein Ende zu bereiten, brach ein zweiter imperialistischer Weltkrieg aus, der den ersten in der Intensität und dem Ausmass seiner Barbarei weit übertraf, die sich nun nicht nur in einer industrialisierten Massenvernichtung der Menschen auf den Schlachtfeldern zeigte, sondern vor allem im Genozid ganzer Völker, in Massakern grossen Ausmasses an Zivilisten, ob in den Todeslagern von Auschwitz und Treblinka oder in den Feuerstürmen von Coventry, Hamburg, Dresden, Hiroshima und Nagasaki. Allein die Geschehnisse der Periode 1914–45 reichen aus, um zu bestätigen, dass die kapitalistische Gesellschaft unumkehrbar in ihre Epoche des Niedergangs eingetreten war, dass sie ein grundlegendes Hindernis für die Bedürfnisse der Menschheit geworden war.
3. Entgegen der Propaganda der herrschenden Klasse haben die 60 Jahre seit1945 in keiner Weise diese Schlussfolgerung entkräftet – so als könne der Kapitalismus in dem einen Jahrzehnt sich auf seinem historischen Abstieg befinden und ihm im nächsten Jahrzehnt wie durch ein Wunder wieder entwischen. Noch vor Ende des zweiten imperialistischen Gemetzels begannen neue militärische Blöcke um die Kontrolle des Erdballs zu rangeln; die USA zögerten das Ende des Kriegs gegen Japan sogar absichtlich hinaus, nicht um das Leben ihrer Soldaten zu schonen, sondern um in spektakulärer Weise ihre Furcht erregende militärische Stärke zur Schau zu stellen, indem sie Hiroshima und Nagasaki auslöschten – eine Zurschaustellung, die sich nicht in erster Linie gegen das besiegte Japan richtete, sondern gegen den neuen russischen Feind. Doch innerhalb kurzer Zeit hatten beide neuen Blöcke sich mit Waffen ausgerüstet, die nicht nur fähig waren, die Zivilisation zu zerstören, sondern das gesamte Leben auf unserem Planeten auszulöschen. Die nächsten fünf Jahrzehnte lebte die Menschheit im Schatten der gegenseitig angedrohten Zerstörung (Mutually Assured Destruction – MAD). In den „unterentwickelten“ Regionen der Welt hungerten Millionen, aber die Kriegsmaschinerie der grossen imperialistischen Mächte wurde mit allen Ressourcen der menschlichen Arbeit und Genialität versorgt, die ihr unersättlicher Schlund forderte; Millionen starben in den „nationalen Befreiungskriegen“ in Korea, Vietnam, auf dem indischen Subkontinent, in Afrika und im Nahen Osten, durch welche die Supermächte ihre mörderischen Rivalitäten austrugen.
4. MAD war der von der Bourgeoisie vorgeschobene Hauptgrund dafür, dass die Welt von einem dritten und wahrscheinlich letzten imperialistischen Holocaust verschont blieb. Wir sollten also die Bombe lieben lernen. In Tat und Wahrheit wurde ein 3. Weltkrieg aus anderen Gründen verhindert:
– In einer Anfangsphase war es für die neu gebildeten imperialistischen Blöcke notwendig, sich zu ordnen und neue ideologische Themen einzuführen, um die Bevölkerung gegen einen neuen Feind zu mobilisieren. Darüber hinaus ermöglichte der Wirtschaftsboom, der mit dem Wiederaufbau der im 2. Weltkrieg zerstörten Länder verbunden war – finanziert durch den Marshall-Plan –, eine gewisse Beruhigung der imperialistischen Spannungen.
– In einer weiteren Phase, als der durch den Wiederaufbau eingeleitete Boom Ende der 1960er Jahre zu Ende ging, stand der Kapitalismus nicht mehr einem besiegten Proletariat gegenüber wie in der Krise der 30er Jahre, sondern einer neuen Generation von Arbeitern, die durchaus bereit war, ihre eigenen Klasseninteressen gegen die Forderungen ihrer Ausbeuter zu verteidigen. In der Zeit des dekadenten Kapitalismus erfordert ein Weltkrieg eine totale und aktive Mobilisierung des Proletariats: Die internationalen Wellen von Arbeiterkämpfen, die mit dem Generalstreik in Frankreich im Mai 1968 begannen, zeigten, dass die Bedingungen für solch eine Mobilisierung in den 1970er und 1980er Jahren fehlten.
5. Das Endergebnis der langen Rivalität zwischen dem US-amerikanischen und dem russischen Block war somit nicht ein Weltkrieg, sondern der Zusammenbruch des Ostblocks. Ausserstande, wirtschaftlich mit den weit mächtigeren USA zu konkurrieren, unfähig seine starren politischen Institutionen zu reformieren, militärisch eingekreist von seinem Rivalen und – wie die Massenstreiks in Polen 1980 zeigten – nicht in der Lage, das Proletariat hinter seinen Kurs zum Krieg zu ziehen, implodierte der imperialistische russische Block 1989. Dieser Triumph des Westens wurde sofort als die Morgendämmerung einer neuen Periode des Weltfriedens und Wohlstands bejubelt; doch die weltweiten imperialistischen Konflikte nahmen lediglich eine neue Form an, da an die Stelle der Einheit des westlichen Blocks heftige Rivalitäten zwischen seinen früheren Bestandteilen traten und ein wiedervereinigtes Deutschland seine Kandidatur für eine grosse Weltmacht stellte, welche künftig mit den USA konkurrieren wollte. In dieser neuen Phase imperialistischer Konflikte war ein Weltkrieg noch weniger auf der Tagesordnung der Geschichte, und zwar aus folgenden Gründen:
– Die Formierung neuer militärischer Blöcke wurde durch die internen Spannungen zwischen jenen Mächten verzögert, die die logischen Mitglieder eines neuen Blocks gegen die USA wären, insbesondere durch die Spannungen zwischen den wichtigsten europäischen Mächten Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Grossbritannien hat seine traditionelle Politik nicht aufgegeben, mit der es versucht sicherzustellen, dass keine Grossmacht eine Vorherrschaft über Europa aufbauen kann, während Frankreich aus triftigen historischen Gründen den Versuchen Deutschlands, es zu unterwerfen, Grenzen setzt. Mit dem Zusammenbruch der Disziplin in den alten beiden Blöcken geht der vorherrschende Trend in den internationalen Beziehungen in Richtung des „Jeder-für-sich“.
– Hinzu kommt die überwältigende militärische Überlegenheit der USA, verglichen besonders mit Deutschland, die es den Rivalen Amerikas verunmöglicht, die USA direkt herauszufordern.
– Weiter bleibt das Proletariat unbesiegt. Obwohl die Periode, die mit dem Zusammenbruch des Ostblocks eröffnet wurde, das Proletariat in beträchtliche Verwirrung stürzte (im Besonderen durch die Kampagnen über den „Tod des Kommunismus“ und das „Ende des Klassenkampfes“), ist die Arbeiterklasse der kapitalistischen Grossmächte noch immer nicht bereit, sich für ein neues weltweites Blutbad zu opfern.
Aus diesen Gründen nahmen die militärischen Hauptkonflikte in der Periode seit 1989 die Form verlagerter kriegerischer Konflikte an. Das bestimmende Merkmal dieser Kriege ist, dass die führende Weltmacht versuchte, sich der wachsenden Herausforderung ihrer globalen Autorität durch spektakuläre Demonstrationen ihrer Stärke gegenüber viertklassigen Mächten entgegenzustemmen; dies war der Fall beim ersten Golfkrieg 1991, bei der Bombardierung Serbiens 1999 und den „Anti-Terror-Kriegen“ in Afghanistan und im Irak, die dem Angriff von 2001 auf die Twin Towers folgten. Gleichzeitig haben sich diese Kriege zusehends klar als eine globale Strategie seitens der USA offenbart: mit dem Ziel, die totale Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten und in Zentralasien sowie die militärische Umzingelung aller ihrer Hauptrivalen (Europa und Russland) zu erreichen, um ihnen den Zugang zu den Weltmeeren zu versperren und sich in die Lage zu versetzen, ihnen den Ölhahn zuzudrehen.
Neben dieser grossen globalen Strategie war – ihr manchmal untergeordnet, sie manchmal behindernd – die Welt nach 1989 auch Zeuge einer Explosion von lokalen und regionalen Konflikten, die Tod und Vernichtung über ganze Kontinente gebracht haben. Diese Konflikte haben Millionen Tote, Behinderte und Obdachlose in einer ganzen Reihe von afrikanischen Ländern wie dem Kongo, Ruanda, Sudan, Somalia, Liberia oder Sierra Leone hinterlassen. Und jetzt drohen sie, viele Länder im Nahen und Mittleren Osten sowie in Zentralasien in eine Art permanenten Bürgerkrieg zu stürzen. Das weiter wachsende Phänomen des Terrorismus, das oft Intrigen zwischen bürgerlichen Fraktionen ausdrückt, die nicht mehr länger von einem besonderen staatlichen Regime kontrolliert werden, hat die Instabilität weiter anschwellen lassen und bewirkt, dass diese mörderischen Konflikte zurück in die Zentren des Kapitalismus getragen werden (11. September, Bombenanschlag in Madrid...)
6. Deshalb bleibt, auch wenn der Weltkrieg gegenwärtig keine konkrete Bedrohung für die Menschheit ist, wie das für den grösseren Teil des 20. Jahrhunderts der Fall war, das Dilemma zwischen Sozialismus und Barbarei genauso akut wie früher. In gewisser Weise ist die Situation heute noch brenzliger; während ein Weltkrieg die aktive Mobilisierung der Arbeiterklasse erfordert, sieht sich Letztere nun der Gefahr gegenüber, Schritt für Schritt und heimtückisch von einer schleichenden Barbarei überschwemmt zu werden:
– Die Ausbreitung von lokalen und regionalen Kriegen könnte ganze Gebiete des Planeten verwüsten und somit das Proletariat jener Regionen unfähig machen, weiter zum Klassenkampf beizutragen. Dies betrifft sehr deutlich die extrem gefährliche Rivalität zwischen den beiden grossen Nuklearmächten auf dem indischen Subkontinent; aber es trifft ebenso auf die Spirale der militärischen Abenteuer der USA zu. Trotz ihrer Absicht, eine neue Weltordnung unter Aufsicht von Uncle Sam zu schaffen, hat jeder ihrer Kriege das Chaos und die Zersplitterung nur vermehrt, und die historische Krise der US-Führungsrolle hat an Tiefe und Schärfe nur zugenommen. Der Irak liefert heute einen klaren Beweis dafür; ohne auch nur den Anschein eines Wiederaufbaus im Irak zu erwecken, werden die USA zu neuen Angriffen gegen Syrien und den Iran getrieben. Diese Perspektive wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die US-Diplomatie in jüngster Zeit versucht hat, in Bezug auf Länder wie Syrien, Iran und Irak „Brücken zu Europa zu schlagen“. Im Gegenteil: Die gegenwärtige Krise im Libanon ist ein klarer Beweis dafür, dass die USA keine Verzögerung hinnehmen können bei ihrem Versuch, eine vollständige Kontrolle über den Nahen und Mittleren Osten zu erreichen. Dieses Bestreben kann aber die imperialistischen Spannungen auf der ganzen Welt nur noch weiter verschärfen, da keiner der Hauptrivalen der USA es zulassen kann, dass diese in dieser strategisch lebenswichtigen Zone freie Hand haben. Diese Perspektive wird ebenfalls durch die zunehmend dreiste Intervention gegen den russischen Einfluss in den Ländern der ehemaligen UdSSR (Georgien, Ukraine, Kirgisien) und durch die grossen Differenzen hinsichtlich der Waffenlieferung an China bestätigt. Zu einer Zeit, wo China seine wachsenden imperialistischen Ambitionen untermauert, indem es seine Faust gegenüber Taiwan ballt, und dadurch Spannungen mit Japan entfacht, stehen Deutschland und Frankreich an vorderster Stelle bei den Versuchen, das gegenüber China nach dem Massaker auf dem Tienanmen-Platz verhängte Waffenembargo aufzuheben.
– Die gegenwärtige Periode ist nicht nur auf der Ebene der imperialistischen Rivalitäten, sondern auch im Herzen der Gesellschaft von der Philosophie des „Jeder-für-sich“ gekennzeichnet. Die Beschleunigung der gesellschaftlichen Atomisierung und der ganze ideologische Dreck, den diese Philosophie mit sich führt (Gangstertum, die Flucht in den Selbstmord, in die Irrationalität und Verzweiflung), gehen mit der Gefahr einher, die Fähigkeit der Arbeiterklasse dauerhaft zu untergraben, ihre Klassenidentität und so ihre grossartige Klassenperspektive einer anderen Welt wiederzuerlangen, die nicht auf der gesellschaftlichen Auflösung beruht, sondern auf einer wahrhaften Gemeinschaft und Solidarität.
– Neben der Bedrohung durch imperialistische Kriege hat die Aufrechterhaltung einer kapitalistischen Produktionsweise, die schon längst ihr Verfallsdatum überschritten hat, eine neue Bedrohung offenbart, eine, die gleichermassen in der Lage ist, die Möglichkeit eines neuen und menschlichen Projektes zu zerstören: die wachsende Bedrohung für die globale Umwelt. Obwohl eine wissenschaftliche Konferenz nach der anderen vor der steigenden Gefahr insbesondere durch die globale Erwärmung warnt, zeigt sich die Bourgeoisie völlig unfähig, auch nur die geringsten Massnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Der Tsunami in Südostasien zeigte den Widerwillen der Bourgeoisie, auch nur einen Finger zu rühren, um die Gattung Mensch vor der verheerenden Kraft der unkontrollierten Natur zu schützen; die vorhergesagten Folgen der globalen Erwärmung wären weitaus zerstörerischer und weitreichender. Darüber hinaus ist es äusserst schwierig für die Mehrheit des Proletariats, die Umweltzerstörungen als einen Anlass zu betrachten, um gegen das kapitalistische System zu kämpfen, weil die schlimmsten Konsequenzen noch immer weit entfernt zu sein scheinen.
7. Aus all diesen Gründen ist es gerechtfertigt, wenn Marxisten nicht nur zum Schluss kommen, dass die Wahl zwischen Sozialismus oder Barbarei heute so gültig ist wie 1916, sondern auch wenn sie sagen, dass die wachsende Intensität der Barbarei heute die Grundlagen des Sozialismus unterminieren könnte. Sie haben nicht nur Recht, wenn sie sagen, dass der Kapitalismus schon lange eine geschichtlich überholte Gesellschaftsform ist, sondern auch wenn sie den Schluss ziehen, dass seine Niedergangsphase, die mit dem Ersten Weltkrieg begann, heute in ihre Endphase getreten ist, in die Phase des Zerfalls. Es handelt sich nicht um die Verwesung eines Organismus, der schon tot ist; der Kapitalismus verrottet bei lebendigem Leib. Er geht durch einen langen und schmerzhaften Todeskampf, und in seinen Todeszuckungen droht er, die ganze Menschheit mit in den Abgrund zu reissen.
Die Krise
8. Die Kapitalistenklasse kann der Menschheit keine Zukunft mehr anbieten. Sie ist durch die Geschichte bereits verurteilt worden. Und genau aus diesem Grund muss sie alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, um dieses Urteil zu verheimlichen und zu bestreiten, um die marxistische Vorhersage zu entwerten, wonach der Kapitalismus wie schon die früheren Produktionsweisen dazu verurteilt ist, dekadent zu werden und zu verschwinden. Die Bourgeoisie hat deshalb eine Reihe von ideologischen Antikörpern entwickelt, die alle danach streben, diese grundlegende Schlussfolgerung der historisch-materialistischen Methode zu widerlegen:
– Noch bevor die Epoche des Niedergangs wirklich begann, fing der revisionistische Flügel der Sozialdemokratie an, Marxens „katastrophistische“ Sichtweise zu bestreiten und zu argumentieren, dass der Kapitalismus unendlich lange weiter bestehen könnte und dass infolgedessen der Sozialismus nicht mittels revolutionärer Gewalt, sondern durch einen Prozess der ruhigen demokratischen Veränderung kommen würde.
– In den zwanziger Jahren verleitete die erstaunliche Rate des industriellen Wachstums in den USA den „genialen“ Calvin Coolidge dazu, den Triumph des Kapitalismus zu verkünden – am Vorabend des grossen Krachs von 1929.
– Während der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg erklärten bürgerliche Führer wie Macmillan den Arbeitern, sie hätten es „noch nie so gut“ gehabt; Soziologen spintisierten über die „Konsumgesellschaft“ und über die „Verbürgerlichung“ der Arbeiterklasse, während Radikale wie Marcuse „neue Avantgarden“ suchten, die die apathischen Proletarier ablösen sollten.
– Seit 1989 haben wir eine reale Überproduktionskrise der neuen Theorien erlebt, die darauf abzielen, zu erklären, wie anders heute alles sei und wie alles, was Marx dachte, widerlegt worden sei: das Ende der Geschichte, der Tod des Kommunismus, das Ende der Arbeiterklasse, die Globalisierung, die Mikroprozessor-Revolution, die Internet-Wirtschaft, der Aufstieg der neuen wirtschaftlichen Riesen im Mittleren und Fernen Osten, unter denen die neusten China und Indien sind. Diese Ideen sind so aufdringlich, dass sie eine ganze neue Generation von Leuten angesteckt haben, die sich die Frage stellen, welche Zukunft der Kapitalismus dem Planeten anzubieten hat, und – was noch besorgniserregender ist – selbst von Teilen der Kommunistischen Linken aufgegriffen worden sind.
Kurz gesagt, muss der Marxismus immer wieder gegen alle ankämpfen, die bei jedem geringsten Lebenszeichen im kapitalistischen System zu argumentieren beginnen, dass es eine leuchtende Zukunft vor sich habe. Aber der Marxismus, der entgegen diesen Kapitulationen vor dem unmittelbaren Schein an der langfristigen und historischen Sichtweise festgehalten hat, ist in seinem Kampf auch immer wieder durch die harten Schläge der historischen Bewegung unterstützt worden:
– Der selige „Optimismus“ der Revisionisten wurde durch die wirklich katastrophalen Ereignisse von 1914–1918 und durch die revolutionäre Antwort der Arbeiterklasse darauf zerschlagen.
– Calvin Coolidge & Co. wurden hart vor die Realität der tiefsten Wirtschaftskrise in der Geschichte des Kapitalismus gestellt, welche die unzweideutige Katastrophe des zweiten imperialistischen Weltkrieges nach sich zog.
– Diejenigen, die erklärten, die Wirtschaftskrise sei eine Sache der Vergangenheit gewesen, wurden durch die Rückkehr der Krise Ende der 60er Jahre widerlegt; und das internationale Wiederaufleben der Arbeiterkämpfe in Erwiderung auf diese Krise erschwerte es ungemein, an der Legende festzuhalten, wonach die Arbeiterklasse mit der Bourgeoisie eins geworden sei.
Die gegenwärtige Schwemme von Theorien über einen „Neuen Kapitalismus“, „die postindustrielle Gesellschaft“ und dergleichen sind ebenso hinfällig. Bereits sind eine Anzahl von Schlüsselelementen dieser Ideologie durch die gnadenlose Entwicklung der Krise blossgestellt worden: die in die asiatischen Tiger und Drachen gesetzten Hoffnungen lösten sich durch das plötzliche Abgleiten dieser Länder im Jahre 1997 in Luft auf; die Dot.com-Revolution entlarvte sich als ein Trugbild, kaum war sie verkündet worden; die „neuen Industrien“, die um Computer und Kommunikationen aufgebaut wurden, erwiesen sich ebenso anfällig für Rezessionen wie die „alten Industrien“, beispielsweise die Stahlproduktion und der Schiffbau. Und obwohl sie immer wieder totgesagt worden ist, erhebt die Arbeiterklasse weiterhin ihren Kopf wie zum Beispiel 2003 in den Bewegungen in Österreich und Frankreich oder 2004 in den Kämpfen in Spanien, Grossbritannien und Deutschland.
9. Es wäre dennoch ein Fehler, die Wirkungen dieser Ideologien in der gegenwärtigen Periode zu unterschätzen, denn sie beruhen wie alle Mystifikationen auf einer Reihe von Halbwahrheiten, beispielsweise:
– Angesichts der Überproduktionskrise und der unbarmherzigen Anforderungen der Konkurrenz hat der Kapitalismus in den letzten Jahrzehnten mitten in den wichtigsten Zentren seines Systems grosse industrielle Wüsten geschaffen und Millionen von Arbeitern entweder in andauernde Arbeitslosigkeit oder in unproduktive, schlecht bezahlte Jobs im Dienstleistungssektor geworfen; aus dem gleichen Grund hat er grosse Mengen der industriellen Arbeitsplätze in die Niedriglohnzonen der „Dritten Welt“ verlagert. Viele traditionelle Sektoren der industriellen Arbeiterklasse sind durch diesen Prozess dezimiert worden, was die Schwierigkeiten des Proletariats vergrössert hat, seine Klassenidentität zu erhalten.
– Die Entwicklung der neuen Technologien ermöglichte es, sowohl den Ausbeutungsgrad wie auch die Geschwindigkeit der Zirkulation von Kapital und Waren weltweit zu erhöhen.
– Der Rückfluss im Klassenkampf in den letzten zwei Jahrzehnten erschwerte es der neuen Generation, die Arbeiterklasse als das einzige Subjekt der gesellschaftlichen Änderung wahrzunehmen.
– Die Kapitalistenklasse zeigte eine bemerkenswerte Fähigkeit, die Krise ihres Systems zu „handhaben“, indem sie die Gesetze seiner Funktionsweise manipulierte und sogar entstellte.
Andere Beispiele könnten erwähnt werden. Aber keines von ihnen stellt die grundsätzliche Altersschwäche des kapitalistischen Systems in Frage.
10. Die Dekadenz des Kapitalismus bedeutete nie einen endgültigen und brutalen Kollaps des Systems, wie einige Genossen aus dem deutschen Linkskommunismus in den 20er Jahren vorhersagten. Auch nicht einen totalen Stopp in der Entwicklung der Produktivkräfte, wie Trotzki in den 30er Jahren fälschlicherweise dachte. Wie schon Marx bemerkt hatte, zeigt sich die herrschende Klasse in Zeiten der Krise als sehr intelligent, und sie kann aus ihren Fehlern lernen. Die 20er Jahre waren die letzte Periode, in der die Bourgeoisie noch daran glaubte zum Liberalismus und zur „Laisser-faire“-Politik des 19. Jahrhunderts zurückkehren zu können. Und dies aus dem simplen Grund, weil der Erste Weltkrieg, der zwar an sich ein Produkt der ökonomischen Widersprüche des Systems war, ausbrach, bevor sich diese Widersprüche auf einer „rein“ ökonomischen Ebene entfalten konnten. Die Krise von 1929 war die erste Weltwirtschaftskrise in der Periode der Dekadenz des Kapitalismus. Und mit dieser gewonnenen Erfahrung erkannte die herrschende Klasse die Notwendigkeit zu einer grundlegenden Veränderung. Trotz vorgeschützter ideologischer Vorbehalte zweifelte keine ernsthafte Fraktion der herrschenden Klasse mehr daran, dass der Staat die generelle Kontrolle über die Wirtschaft übernehmen sollte; die Notwendigkeit zur Abschaffung jeglichen „Zahlengleichgewichts“ zugunsten von Verschuldung und zahlreichen Finanzschiebereien; die Notwendigkeit, einen enormen Rüstungssektors im Zentrum der Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Aus demselben Grund gab sich der Kapitalismus später alle Mittel, um die wirtschaftliche Autarkie der 30er Jahre zu verhindern. Trotz steigender Tendenz hin zum Wirtschaftskrieg und zum Zusammenbrechen von internationalen Institutionen aus der Zeit der beiden grossen Blöcke haben diese Institutionen mehrheitlich überlebt, weil die grössten kapitalistischen Mächte die Notwendigkeit verstanden haben, der ökonomischen Konkurrenz unter den verschiedenen nationalen Kapitalen gewisse Grenzen zu setzen.
Der Kapitalismus erhält sich durch die bewusste Intervention der Bourgeoisie am Leben, die es sich nicht länger leisten kann, der unsichtbaren Hand des Marktes zu trauen. Doch die Lösungen werden auch zu Problemen:
– Die zunehmende Verschuldung produziert einen Berg von Problemen für die Zukunft;
– das Aufblähen des Staates und des Rüstungssektors erzeugt einen enormen inflationären Druck.
Seit den 70er Jahren haben diese Probleme zu verschiedenen Wirtschaftsstrategien geführt, die abwechslungsweise auf den „Keynesianismus“ und den „Neo-Liberalismus“ setzten, doch keine kann die bestehenden Probleme in den Griff bekommen, geschweige denn eine endgültige Lösung herbeiführen. Bemerkenswert ist jedoch die Entschlossenheit der Bourgeoisie, ihre Wirtschaft um jeden Preis am Leben zu erhalten und ihre Fähigkeit, die Tendenz zum Zusammenbruch durch eine gigantische Verschuldung zu bremsen. Während der 90er Jahre war die US-amerikanische Wirtschaft wegweisend für diese Richtung. Heute, da dieses künstliche „Wachstum“ eingebrochen ist, ist die chinesische Bourgeoisie an der Reihe, die Welt zu überraschen: In Anbetracht der Unfähigkeit der ehemaligen UdSSR und der anderen stalinistischen Staaten Osteuropas, politisch die Notwendigkeit von wirtschaftlichen Reformen zu verstehen, hat es die chinesische Bürokratie (das Aushängeschild des gegenwärtigen „Booms“) fertig gebracht, sich über Wasser zu halten. Gewisse Kritiker der Dekadenzauffassung weisen auf dieses Phänomen hin und wollen damit beweisen, dass das kapitalistische System immer noch in der Lage sei, sich zu entwickeln und ein reelles Wachstum hervorzubringen.
In Tat und Wahrheit aber stellt der gegenwärtige chinesische „Boom“ keineswegs den generellen Niedergang der kapitalistischen Weltwirtschaft in Frage. In Gegensatz zur aufsteigenden Phase des Kapitalismus:
– ist das industrielle Wachstum in China nicht Teil eines globalen Ausdehnungsprozesses; im Gegenteil, es hat einen direkten Zusammenhang mit der Desindustrialisierung und Stagnation der entwickeltsten Ökonomien, welche sich auf der Suche nach billigen Lohnkosten nach China ausgelagert haben;
– hat die chinesische Arbeiterklasse nicht die Perspektive eines stetigen Anstieges des Lebensstandarts, vielmehr ist sie enormen Angriffen auf ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen ausgesetzt und mit einer zunehmenden Verarmung von grossen Teilen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft ausserhalb der grössten Boom-Zonen konfrontiert;
– ist das frenetische Wachstum nicht Teil einer globalen Expansion des Weltmarktes, sondern Teil der vertieften Überproduktionskrise: Wegen der beschränkten Konsumptionskraft der chinesischen Massen ist der Grossteil der Produktion auf den Export in die höchstentwickelten kapitalistischen Staaten ausgerichtet;
– ist die grundlegende Irrationalität der wachsenden chinesischen Wirtschaft ersichtlich durch die grauenhafte Verschmutzung der Umwelt – ein Zeichen dafür, dass der Planet zerstört wird durch den Druck, der auf jeder Nation lastet, ihre natürlichen Ressourcen bis zum Limit auszubeuten, nur um auf dem Weltmarkt bestehen zu können;
– basiert das chinesische Wachstum, gleich wie das ganze System, lediglich auf einem Schuldenberg, welcher niemals durch eine tatsächliches Wachstum des Weltmarktes wieder wett gemacht werden kann.
Die Bourgeoisie ist sich der Zerbrechlichkeit solcher Wachstumsschübe wohl bewusst und durch die chinesische Blase alarmiert. Dies natürlich nicht wegen der schrecklichen Ausbeutung auf der sie beruht – im Gegenteil ist dies ja genau das, was China für Investitionen so attraktiv macht – sondern weil die Weltwirtschaft allzu abhängig wird vom chinesischen Markt und weil die Folgen eines chinesischen Kollapses allzu katastrophal wären, nicht nur für China, das damit in die Anarchie der 30er Jahre zurückgeworfen würde, sondern für die Weltwirtschaft als Ganzes.
11. Das Wachstum der kapitalistischen Wirtschaft widerlegt nicht die Realität der Dekadenz, sondern bestätigt sie im Gegenteil. Dieses Wachstum hat nichts Gemeinsames mit den Akkumulationszyklen im 19. Jahrhundert, welche auf einer realen Expansion der Produktion in die peripheren Zonen beruhte, auf der Suche nach neuen, ausserkapitalistischen Absatzmärkten. Es ist wahr, dass die Dekadenz begann, bevor diese Märkte ausgeschöpft waren und bevor sich der Kapitalismus solche übrig gebliebenen wirtschaftlichen Gebiete durch Produktionsauslagerungen maximal zu Nutzen machte. Das Wachstum in Russland während der 30er Jahre und die Integration der bäuerlichen Subsistenzwirtschaft in der Wiederaufbauperiode nach dem Zweiten Weltkrieg sind Beispiele dafür. Doch der vorherrschende Trend in der gesamten Epoche der Dekadenz ist die Bildung von künstlichen Märkten, welche auf Verschuldung aufbauen.
Es ist heute offensichtlich, dass die frenetische „Konsumption“ der letzten zwei Jahrzehnte ausschliesslich auf einer Verschuldung der Haushalte basierte: eine Billion Pfund in Grossbritannien, 25% des Bruttosozialproduktes in den USA, während die Regierungen eine solche Verschuldung nicht nur anheizen, sondern sie auf einer höheren Ebene auch selber betreiben.
12. In einem gewissen Sinne ist das heutige Wachstum der kapitalistischen Wirtschaft das, was Marx als das „Wachstum im Niedergang“ bezeichnete (Grundrisse): es ist der Hauptfaktor in der weltweiten Umweltzerstörung. Das unkontrollierbare Niveau an Verschmutzung in China, der riesige Anteil der USA am Ausstoss von Treibhausgasen, die brutale Abholzung von noch bestehenden Regenwäldern... je mehr der Kapitalismus „wächst“, desto mehr wird klar, dass er nicht die geringste Lösung für die ökologische Krise hat. Diese kann nur gelöst werden, wenn die Menschheit auf einer neuen Grundlage produziert, „einem Lebensplan für die menschliche Gattung“ (Bordiga), in Einklang mit der Natur.
13. Sei es ein „Boom“ oder eine „Rezession“, die Realität ist dieselbe: Der Kapitalismus kann sich nicht mehr länger von selbst erholen. Es gibt keinen natürlichen Akkumulationszyklus mehr. In der ersten Phase der Dekadenz zwischen 1914 und 1968 ersetzte der Zyklus von Krise – Krieg – Wiederaufbau den alten Zyklus von Expansion und Rückfluss. Doch die GCF (Französische Kommunistische Linke) hatte Recht, als sie 1945 behauptete, dass es keine automatische Tendenz zum Wiederaufbau nach den Zerstörungen des Weltkrieges gab. Was die amerikanische Bourgeoisie dazu brachte, die europäische und japanische Wirtschaft mit dem Marshall-Plan wieder zu beleben, war ihr Bedürfnis, sich diese Zonen der eigenen imperialistischen Einflusssphäre unterzuordnen und zu verhindern, dass diese Länder in die Hände des rivalisierenden Blocks fallen könnten. Der grösste wirtschaftliche „Boom“ des 20. Jahrhunderts war vor allem Resultat der imperialistischen Konkurrenz.
14. In der Dekadenz treiben die ökonomischen Widersprüche den Kapitalismus in den Krieg, doch der Krieg kann diese Widersprüche nicht lösen. Im Gegenteil vertieft er sie. Auf jeden Fall ist der Zyklus von Krise – Krieg – Wiederaufbau heute vorüber, und die heutige Krise, unfähig sich in einem Weltkrieg zu entladen, ist der Hauptfaktor beim Zerfall dieses Systems. Sie führt das System in die Selbstzerstörung.
15. Die Sichtweise, dass der Kapitalismus ein dekadentes System ist, wurde oft als fatalistische Auffassung kritisiert – als Idee eines automatischen Zusammenbruchs und einer spontanen Überwindung durch die Arbeiterklasse, welche die Notwendigkeit der Arbeit einer revolutionären Organisation verneinen würde. Doch die herrschende Klasse hat bewiesen, dass sie ihr System nicht ökonomisch zusammenbrechen lässt. Aber der Kapitalismus wird sich durch seine eigene Dynamik durch Kriege und andere Desaster selber zerstören. In diesem Sinne ist er tatsächlich dazu „bestimmt“ zu verschwinden. Doch die Antwort der Arbeiterklasse ist alles andere als fatalistisch. So formulierte es Rosa Luxemburg 1916 in der Einleitung der schon oben zitierten Juniusbroschüre: „Der Sozialismus ist die erste Volksbewegung der Weltgeschichte, die sich zum Ziel setzt und von der Geschichte berufen ist, in das gesellschaftliche Tun der Menschen einen bewussten Sinn, einen planmässigen Gedanken und damit den freien Willen hineinzutragen. Darum nennt Friedrich Engels den endgültigen Sieg des sozialistischen Proletariats einen Sprung der Menschheit aus dem Tierreich in das Reich der Freiheit. Auch dieser „Sprung“ ist an eherne Gesetze der Geschichte, an tausend Sprossen einer vorherigen qualvollen und allzu langsamen Entwicklung gebunden. Aber er kann nimmermehr vollbracht werden, wenn aus all dem von der Entwicklung zusammengetragenen Stoff der materiellen Vorbedingungen nicht der zündende Funke des bewussten Willens der grossen Volksmasse aufspringt. Der Sieg des Sozialismus wird nicht wie ein Fatum vom Himmel herabfallen. Er kann nur durch eine lange Kette gewaltiger Kraftproben zwischen den alten und neuen Mächten erkämpft werden, Kraftproben, in denen das internationale Proletariat unter der Führung der Sozialdemokratie lernt und versucht, seine Geschicke in die eigene Hand zu nehmen, sich des Steuers des gesellschaftlichen Lebens zu bemächtigen, aus einem willenlosen Spielball der eigenen Geschichte zu ihrem zielklaren Lenker zu werden.“
Der Kommunismus wird die erste Gesellschaft sein, in welcher der Mensch über eine bewusste Kontrolle seiner Produktivkräfte verfügt. Und deshalb gibt es im Kampf der Arbeiterklasse keine Trennung zwischen Zielen und Mitteln, die Bewegung hin zum Kommunismus kann nur eine „bewusste Bewegung der grossen Mehrheit“ sein (Kommunistisches Manifest): Die Vertiefung und Ausbreitung des Klassenbewusstseins ist unverzichtbar für den Erfolg der Revolution und die endgültige Überwindung des Kapitalismus. Dieser Prozess ist von Natur aus sehr schwierig, ungradlinig und heterogen, denn er ist das Produkt einer ausgebeuteten Klasse, welche in der alten Gesellschaft über keine ökonomische Macht verfügt und ständig der ideologischen Dominanz und den Manipulationen der herrschenden Klasse ausgesetzt ist. Keinesfalls gibt es eine Garantie: Im Gegenteil besteht die reale Gefahr, dass die Arbeiterklasse angesichts der immensen Aufgaben ihre historische Verantwortung nicht durchsetzen kann. Dies hätte für die gesamte Menschheit schreckliche Konsequenzen.
Der Klassenkampf
16. Der höchste bisher erreichte Stand des Klassenbewusstseins war der Aufstand vom Oktober 1917. Dies wurde durch die Geschichtsschreibung der Bourgeoisie und all ihre blassen anarchistischen und anderweitig verwandten ideologischen Abklatsche verleugnet, für die der Oktober lediglich ein Putsch machthungriger Bolschewiki gewesen sein soll. Doch der Oktober stellte die grundlegende Erkenntnis für die Arbeiterklasse dar, dass für die Menschheit kein Weg an einer weltweiten Revolution vorbeiführt. Dennoch erfasste dieses Verständnis das Proletariat nicht in genügender Tiefe und Ausdehnung. Die Revolution scheiterte, weil die Weltarbeiterklasse vor allem in Europa unfähig war, ein umfassendes politisches Verständnis zu entwickeln, welches ihr erlaubt hätte, eine angemessene Antwort auf die Aufgaben der neuen Epoche von Kriegen und Revolutionen zu geben, die 1914 angebrochen war. Resultat davon war ab Ende der 20er Jahre der längste und tiefgreifendste Rückschritt, den die Arbeiterklasse in ihrer Geschichte kannte. Dies nicht hauptsächlich auf der Ebene der Kampfbereitschaft, denn die 30er und 40er Jahre erlebten punktuelle Ausbrüche der Kampfbereitschaft der Klasse, sondern vielmehr auf der Ebene des Bewusstseins. Die Arbeiterklasse liess sich aktiv in die antifaschistischen Kampagnen der Bourgeoisie einbinden, so in Spanien zwischen 1936 und 1939, in Frankreich 1936, und in die Verteidigung der Demokratie und des „sozialistischen Vaterlandes“ während dem Zweiten Weltkrieg. Dieser tiefgreifende Rückschritt im Bewusstsein drückte sich durch ein fast totales Verschwinden revolutionärer Minderheiten während den 50er Jahren aus.
17. Das historische Wiederaufbrechen von Kämpfen 1968 zeigte erneut die langfristige Perspektive einer proletarischen Revolution. Doch dies war nur einer kleinen Minderheit der Klasse bewusst, und es drückte sich durch die Wiedergeburt einer internationalen revolutionären Bewegung aus. Die Kampfwellen zwischen 1968 und 1989 stellten bedeutende Fortschritt auf der Ebene des Bewusstseins dar, doch sie tendierten alle dazu, auf den unmittelbaren Kampf ausgerichtet zu sein (die Fragen der Ausbreitung und Organisierung, usw.). Ihr schwächster Punkt war der Mangel an politischer Tiefe, allem voran eine Politikfeindlichkeit, die Resultat der stalinistischen Konterrevolution war. Auf der politischen Ebene war die Bourgeoisie weitgehend fähig, den Takt anzugeben, erst durch das Vorgaukeln einer möglichen Veränderung durch das Einsetzen von linken Regierungen in den 70er Jahren, dann durch eine Sabotage der Kämpfe von innen her, durch eine Linke in der Opposition in den 80er Jahren. Auch wenn die Kampfwellen von 1968 bis 1989 fähig waren, den Kurs Richtung Weltkrieg zu verhindern, so begünstigten ihre Schwächen in einer historischen und politischen Dimension den Übergang zur Phase des Zerfalls des Kapitalismus. Das historische Ereignis, welches diesen Übergang kennzeichnete – der Zusammenbruch des Ostblocks – war einerseits Resultat des Zerfalls, und andererseits ein Faktor seiner Beschleunigung. Die dramatischen Veränderungen Ende der 80er Jahre waren gleichzeitig Produkt der politischen Schwierigkeiten der Arbeiterklasse und – da sie eine Propagandawelle über das Ende des Kommunismus und des Klassenkampfes erlaubten – ein Schlüsselelement eines ernsthaften Rückflusses im Klassenbewusstsein – bis zum Punkt, an dem die Arbeiterklasse selbst ihre grundlegende Klassenidentität aus den Augen verlor. Die Bourgeoisie deklarierte ihren endgültigen Sieg über die Arbeiterklasse, und diese war bis heute nicht fähig, eine wirklich ausreichende Antwort darauf zu geben, um dies zu widerlegen.
18. Trotz all ihrer Schwierigkeiten bedeutete die Rückzugsperiode keineswegs das „Ende des Klassenkampfes“. Die 1990er Jahre waren durchsetzt mit einer ganzen Anzahl von Bewegungen, die zeigten, dass die Arbeiterklasse immer noch über unversehrte Reserven an Kampfbereitschaft verfügte (beispielsweise 1992 und 1997). Doch stellte keine dieser Bewegungen eine wirkliche Änderung auf der Ebene des Klassenbewusstseins dar. Deshalb sind die jüngeren Bewegungen so wichtig; auch wenn es ihnen am spektakulären und sofortigen Einfluss mangelt, den diejenige von 1968 in Frankreich hatte, sind sie doch ein Wendepunkt im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen. Die Kämpfe von 2003–2005 wiesen die folgenden wesentlichen Eigenschaften auf:
– Sie bezogen bedeutende Sektoren der Arbeiterklasse in Ländern im Zentrum des weltumspannenden Kapitalismus mit ein (wie in Frankreich 2003);
– sie traten mit Sorgen auf, die ausdrücklicher auch politische Fragen in den Vordergrund stellten;
– zum ersten Mal seit der revolutionären Welle stand Deutschland wieder als Schwerpunkt der Arbeiterkämpfe da;
– die Frage der Klassensolidarität wurde nun breiter und ausdrücklicher aufgeworfen denn je in den Kämpfen der 80er Jahre, insbesondere in den jüngsten Bewegungen in Deutschland;
– sie wurden begleitet vom Auftauchen einer neuen Generation von Leuten, die nach politischer Klarheit suchen. Diese neue Generation hat sich einerseits im Auftreten von offen politisierten Leuten gezeigt, andererseits in neuen Schichten von Arbeitern, die zum ersten Mal in den Kampf getreten sind. Wie bestimmte wichtige Demonstrationen bewiesen haben, wird das Fundament gelegt für die Einheit zwischen der neuen Generation und derjenigen „von 68“ – sowohl der politischen Minderheit, welche die kommunistische Bewegung in den 60er und 70er Jahren aufgebaut hat, als auch den breiteren Schichten der Arbeiter, welche die reiche Erfahrung der Klassenkämpfe zwischen 68 und 89 in sich tragen.
19. Die unterirdische Reifung des Bewusstseins, die von den empiristischen Fälschern des Marxismus geleugnet werden, die nur die Oberfläche der Wirklichkeit sehen und nicht ihre tieferen, grundlegenden Tendenzen, ist nicht vom allgemeinen Rückfluss im Bewusstsein seit 1989 aufgehoben worden. Es ist ein Merkmal dieses Prozesses, dass er lediglich in einer Minderheit manifest wird. Doch das Wachstum dieser Minderheit ist Ausdruck der fortschreitenden Weiterentwicklung eines breiteren Phänomens in der Klasse. Bereits nach 1989 sahen wir eine kleine Minderheit von politisierten Elementen, welche die bürgerliche Kampagne über den „Tod des Kommunismus“ in Frage stellten. Diese Minderheit ist nun von einer neuen Generation verstärkt worden, die sich mit der ganzen Richtung der bürgerlichen Gesellschaft kritisch auseinandersetzt. Auf allgemeiner Ebene drückt dies den ungeschlagenen Zustand des Proletariats, die Aufrechterhaltung des historischen Kurses zu massiven Klassenkonfrontationen aus, der 1968 eröffnet worden war. Doch auf einer spezifischeren Ebene sind die „Wende“ von 2003 und das Auftreten einer neuen Generation von suchenden Elementen Beweis dafür, dass das Proletariat am Anfang eines zweiten Anlaufs steht, das kapitalistische System zu stürmen, nach dem Scheitern des ersten Versuchs von 1968 bis 1989. Obgleich sich das Proletariat im Alltag mit der scheinbar selbstverständlichen Aufgabe auseinandersetzen muss, sich seiner Klassenidentität wieder zu bemächtigen, liegt hinter diesem Problem auch die Aussicht auf eine viel engere Verknüpfung des unmittelbaren Kampfes mit dem politischen Kampf. Die Fragen, die von den Kämpfen in der Zerfallsphase aufgeworfen werden, scheinen immer abstrakter zu werden, doch tatsächlich drehen sie sich um allgemeinere Fragen wie die Notwendigkeit einer Klassensolidarität gegen die allgegenwärtige Atomisierung, die Angriffe auf den gesellschaftlichen Lohn, die Omnipräsenz des Krieges, die Bedrohung der natürlichen Umwelt des Planeten – kurz: um die Frage, was die Zukunft für diese Gesellschaft bereithält und somit um die Frage einer anderen Art von Gesellschaft.
20. Innerhalb dieses Prozesses der Politisierung sind zwei Elemente, die bis jetzt eine eher hemmende Wirkung auf den Klassenkampf ausübten, dazu bestimmt, zu einer immer wichtigeren Stimulans der künftigen Bewegungen zu werden: die Frage der Massenarbeitslosigkeit und die Frage des Krieges.
Während der Kämpfe der 1980er Jahre, als die Massenarbeitslosigkeit immer unübersehbarer wurde, erlangte weder der Kampf der beschäftigten Arbeiter gegen drohende Entlassungen noch der Widerstand der Arbeitslosen auf den Strassen ein bedeutsames Ausmass. Es gab keine Bewegung von Arbeitslosen, die an das Niveau heranreichte, das in den 30er Jahren erreicht worden war, obwohl diese Zeit eine Periode der tiefen Niederlage der Arbeiterklasse gewesen war. In den Rezessionen der 80er Jahre sahen sich die Arbeitslosen einer fürchterlichen Atomisierung gegenüber; insbesondere grosse Teile der jüngeren Generation von Proletariern hatte nie die Erfahrung des kollektiven Arbeitens und Kämpfens gemacht. Und wenn beschäftigte Arbeiter weitreichende Kämpfe gegen Entlassungen ausfochten, wie in der britischen Bergbauindustrie, dann wurde der negative Ausgang dieser Bewegungen von der herrschenden Klasse benutzt, um Gefühle der Passivität und Hoffnungslosigkeit zu verstärken, was kürzlich durch die Reaktion auf den Bankrott von Rover demonstriert wurde, als den Arbeitern als einzige „Wahl“ jene zwischen der einen oder anderen Führungsriege präsentiert wurde, um das Unternehmen am Leben zu erhalten. Dennoch ist angesichts der Verengung des Manöverspielraums für die Bourgeoisie und ihrer wachsenden Unfähigkeit, den Arbeitslosen auch nur ein Minimum an Unterstützung zu gewähren, die Frage der Arbeitslosigkeit darauf angelegt, eine weitaus subversivere Seite zu entwickeln, indem sie die Solidarität zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen erleichtert und die Klasse insgesamt dazu drängt, tiefer und aktiver über den Bankrott des Systems nachzudenken.
Dieselbe Dynamik kann an der Frage des Krieges beobachtet werden. In den frühen 90er Jahren bewirkten die ersten grossen Kriege in der Zerfallsphase (Golf, Balkan), dass das Gefühl der Machtlosigkeit gestärkt wurde, welches uns durch die Kampagnen rund um den Zusammenbruch des Ostblocks eingeimpft worden war, während der Vorwand der „humanitären Intervention“ in Afrika und auf dem Balkan noch immer den Anschein von Glaubwürdigkeit erwecken konnte. Seit 2001 und dem „Krieg gegen den Terrorismus“ wurde jedoch die Verlogenheit und Heuchelei bei der Rechtfertigung des Krieges durch die Bourgeoisie immer augenscheinlicher, auch wenn das Wachstum riesiger pazifistischer Bewegungen die politische Infragestellung, die dadurch provoziert worden war, grösstenteils verwässert hat. Darüber hinaus haben die jüngsten Kriege einen weitaus grösseren Einfluss auf die Arbeiterklasse, selbst wenn dies noch immer hauptsächlich auf jene Länder begrenzt geblieben ist, die in diesen Konflikten verwickelt sind. In den USA hat sich dies in der Zahl von Arbeiterfamilien manifestiert, die von Tod und Verwundung der Proletarier in Uniform, aber noch schwerwiegender von den furchteinflössenden ökonomischen Kosten der militärischen Abenteuer betroffen sind, die proportional zu den Kürzungen der gesellschaftlichen Löhne gestiegen sind. Und indem immer deutlicher wird, dass die militaristischen Tendenzen des Kapitalismus nicht nur eine ständig wachsende Spirale sind, sondern dazu noch eine, über die die herrschende Klasse immer weniger Kontrolle besitzt, wird das Problem des Krieges und seine Verbindung zur Krise auch zu einem weit tieferen und weiterreichenden Nachdenken darüber führen, was historisch auf dem Spiel steht.
21. Paradoxerweise ist die Brisanz dieser Fragen einer der Hauptgründe dafür, warum die aktuelle Wiederbelebung der Kämpfe so beschränkt und unspektakulär im Vergleich zu jenen Bewegungen ist, die das Wiedererscheinen des Proletariats Ende der 60er Jahre ausgezeichnet hatten. Angesichts der unermesslichen Probleme, wie die Weltwirtschaftskrise, die Zerstörung der globalen Umwelt oder die Spirale des Militarismus mag der tägliche Verteidigungskampf unbedeutend und ohnmächtig erscheinen. Und in einem gewissen Sinn reflektiert dies ein wirkliches Verständnis dafür, dass es keine Lösung für die Widersprüche gibt, die den Kapitalismus heute befallen haben. Doch während in den 70ern die Bourgeoisie eine ganze Palette an Mystifikationen über die Möglichkeiten eines besseren Lebens zur Auswahl hatte, erinnern die jüngsten Versuche der Bourgeoisie, vorzutäuschen, dass wir in einer Epoche des beispiellosen Wachstums und Wohlstands leben, immer mehr an die verzweifelten Versuche eines alten Mannes, den bald bevorstehenden Tod zu bestreiten. Die Dekadenz des Kapitalismus ist die Epoche der sozialen Revolution, weil die Kämpfe der Ausgebeuteten nicht mehr zu einer tatsächlichen Verbesserung ihrer Lebensbedingungen führen können. Und wie schwer es auch sein mag, von der Defensive in die Offensive überzugehen, die Arbeiterklasse wird keine andere Wahl haben, als diesen schwierigen und beängstigenden Sprung zu wagen. Und wie allen solchen qualitativen Sprüngen gehen auch ihm alle Arten von kleinen vorbereitenden Schritten voraus, von Streiks rund um die Brot-und-Butter-Frage bis hin zu winzigen Diskussionsgruppen überall auf dem Globus.
22. Angesichts der Perspektive einer Politisierung des Kampfes spielen revolutionäre politische Organisationen eine einmalige und unersetzliche Rolle. Leider hat die Kombination der wachsenden Auswirkungen des Zerfalls mit seit langer Zeit bestehenden theoretischen und organisatorischen Schwächen und dem Opportunismus in der Mehrheit der politischen Organisationen des Proletariats die Unfähigkeit dieser Gruppen enthüllt, sich der Herausforderung durch die Geschichte zu stellen. Dies wird am deutlichsten von der negativen Dynamik veranschaulicht, in der das IBRP schon seit geraumer Zeit gefangen ist. Nicht nur, dass das Büro total unfähig ist, die Bedeutung der neuen Phase des Zerfalls zu begreifen, schlimmer noch, solchen Schlüsselkonzepten wie jenem der Dekadenz des Kapitalismus den Rücken kehrt; noch viel katastrophaler ist seine Verhöhnung der grundlegenden Regeln der proletarischen Solidarität und Verhaltensweisen durch seinen Flirt mit dem Parasitismus und Abenteurertum. Diese Regression ist um so ernster, als nun die Voraussetzungen für den Aufbau der kommunistischen Weltpartei gelegt werden. Gleichzeitig wirft die Tatsache, dass die Gruppen des proletarischen Milieus sich selbst immer mehr aus dem Prozess ausschliessen, der zur Bildung der Klassenpartei führt, ein Schlaglicht auf die eminent wichtige Rolle, welche die IKS zwangsläufig in diesem Prozess ausüben muss. Es wird immer klarer, dass die künftige Partei nicht das Resultat einer „demokratischen“ Addition der verschiedenen Gruppen des Milieus sein wird, sondern dass die IKS bereits das Skelett der künftigen Partei bildet. Doch damit die Partei Wirklichkeit wird, muss sich die IKS als den Aufgaben gewachsen erweisen, die ihr durch die Entwicklung des Klassenkampfes und das Auftreten einer neuen Generation von suchenden Elementen aufgetragen werden.
IKS
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Krieg [27]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Bilanz des 16. Kongress der IKS: Sich auf den Klassenkampf und das Auftauchen neuer kommunistischer Kräfte vorbereiten
- 2693 Aufrufe
Die IKS führte im letzten Frühjahr ihren 16. Kongress durch. „Der internationale Kongress ist das höchste Organ der IKS“, wie unsere Statuten sagen. Deshalb ist es wie immer nach solchen Ereignissen unsere Aufgabe, der Arbeiterklasse über diesen Kongress zu berichten und seine wichtigsten Orientierungen hervorzuheben.[1]
Die Arbeit dieses Kongresses drehte sich um die Analyse der Wiederbelebung des Kampfes der Arbeiterklasse und die entsprechende Verantwortung, vor die diese Entwicklung unsere Organisation stellt, insbesondere angesichts einer auftauchenden neuen Generation von Leuten, die sich einer revolutionären politischen Perspektive zuwenden.
Gleichzeitig setzt sich offensichtlich die Barbarei des Krieges fort in einer kapitalistischen Welt, die einer unüberwindlichen Wirtschaftskrise gegenübersteht; besondere Berichte über die Krise und die imperialistischen Konflikte wurden am Kongress diskutiert und verabschiedet. Die wesentlichen Elemente dieser Berichte sind in der Resolution zur internationalen Lage enthalten, die wir nachstehend auch veröffentlichen.
Diese Resolution ruft in Erinnerung, dass die gegenwärtige historische Periode nach der Analyse der IKS die letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus ist, die Zerfallsphase, in der die bürgerliche Gesellschaft am lebendigen Leib verrottet. Wie wir bereits bei zahlreichen Gelegenheiten hervorgehoben haben, rührt dieser Zerfall daher, dass angesichts des unabwendbaren historischen Zusammenbruchs der kapitalistischen Wirtschaft keine der beiden sich gegenüberstehenden Klassen in der Gesellschaft, weder die Bourgeoisie noch das Proletariat, es schaffen, ihre eigene Antwort durchzusetzen: den Weltkrieg als Antwort der Bourgeoisie, die kommunistische Revolution als diejenige des Proletariats. Diese historischen Bedingungen bestimmen die wesentlichen Eigenschaften der heutigen bürgerlichen Gesellschaft. Insbesondere kann man nur mit diesem Rahmen der Analyse über den Zerfall die Fortdauer und Verschlimmerung einer ganzen Reihe von Plagen vollständig verstehen, die heute die Menschheit heimsuchen, wobei an erster Stelle die Kriegsbarbarei zu nennen ist, aber auch die unabwendbare Zerstörung der Umwelt oder die schrecklichen Folgen von Naturkatastrophen, wie des Tsunamis im letzten Winter. Die historischen Bedingungen, die der Zerfall nach sich zieht, stellen für das Proletariat eine ebenso schwere Last dar wie für seine revolutionären Organisationen, und sie sind eine der Hauptursachen der Schwierigkeiten, die unsere Klasse und unsere Organisation seit Beginn der 90er Jahre angetroffen haben, wie wir dies in früheren Artikeln bereits aufgezeigt haben.
Die Wiederbelebung des Klassenkampfes
Der 15. Kongress hatte festgestellt, dass die IKS die Krise überwunden hatte, die sie 2001 durchgemacht hatte, und zwar insbesondere deshalb, weil sie verstanden hatte, dass und wie diese Krise ein Ausdruck der schädlichen Effekte des Zerfalls war. Jener Kongress erkannte auch die Schwierigkeiten, die die Arbeiterklasse weiterhin in ihren Kämpfen gegen die Angriffe des Kapitals hatte – vor allem ihr Mangel an Selbstvertrauen.
Doch seit diesem Kongress, der im Frühjahr 2003 tagte, fand eine Änderung statt, wie dies an der Plenarsitzung des Zentralorgans der IKS im Herbst desselben Jahres unterstrichen wurde: „Die breiten Mobilisierungen vom Frühling 2003 in Frankreich und in Österreich stellen in den Klassenkämpfen seit 1989 einen Wendepunkt dar. Sie sind ein erster wichtiger Schritt in der Wiederaneignung der Kampfbereitschaft der Arbeiter nach der längsten Rückflussperiode seit 1968.“ (vgl. Internationale Revue Nr. 34).
Ein solcher Wendepunkt war für die IKS keine Überraschung, da diese Perspektive bereits am 15. Kongress angekündigt wurde. Die Resolution zur internationalen Lage, die der 16. Kongress verabschiedet hatte, präzisierte dies mit den folgenden Worten: „Die Kämpfe von 2003–2005 wiesen die folgenden wesentlichen Eigenschaften auf:
– Sie bezogen bedeutende Sektoren der Arbeiterklasse in Ländern im Zentrum des weltumspannenden Kapitalismus mit ein (wie in Frankreich 2003);
– sie traten mit Sorgen auf, die ausdrücklicher auch politische Fragen in den Vordergrund stellten;
– zum ersten Mal seit der revolutionären Welle stand Deutschland wieder als Schwerpunkt der Arbeiterkämpfe da;
– die Frage der Klassensolidarität wurde nun breiter und ausdrücklicher aufgeworfen denn je in den Kämpfen der 80er Jahre, insbesondere in den jüngsten Bewegungen in Deutschland.“
Diese Resolution des 16. Kongresses stellte auch fest, dass die unterschiedlichen Anzeichen des Wendepunktes im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen begleitet wurden „vom Auftauchen einer neuen Generation von Leuten, die nach politischer Klarheit suchen. Diese neue Generation hat sich einerseits im Auftreten von offen politisierten Leuten gezeigt, andererseits in neuen Schichten von Arbeitern, die zum ersten Mal in den Kampf getreten sind. Wie bestimmte wichtige Demonstrationen bewiesen haben, wird das Fundament gelegt für die Einheit zwischen der neuen Generation und derjenigen „von 68“ – sowohl der politischen Minderheit, welche die kommunistische Bewegung in den 60er und 70er Jahren aufgebaut hat, als auch den breiteren Schichten der Arbeiter, welche die reiche Erfahrung der Klassekämpfe zwischen 68 und 89 in sich tragen.“
Die Verantwortung der IKS gegenüber dem Auftauchen der neuen revolutionären Kräfte
Die andere wesentliche Sorge des 16. Kongresses war folglich zu gewährleisten, dass unsere Organisation auf der Höhe ihrer Fähigkeiten ist, um die Verantwortung gegenüber den auftauchenden neuen Kräfte wahrzunehmen, die sich auf linkskommunistische Klassenpositionen zu bewegen. Dieses Anliegen drückte sich insbesondere in der Aktivitätenresolution aus, die der Kongress ebenfalls verabschiedete: „Der Kampf darum, die neue Generation für Klassenpositionen und die Organisierung zu gewinnen, steht heute im Zentrum all unserer Aktivitäten. Dies betrifft nicht nur unsere Intervention, sondern die Gesamtheit unserer politischen Reflexion, unserer Diskussionen und militanten Anliegen. (...)“
Diese Arbeit der Umgruppierung der neuen militanten Kräfte schliesst notwendigerweise ihre Verteidigung gegen alle Versuche ein, sie zu zerstören oder in Sackgassen zu führen. Diese Verteidigung kann nur erfolgreich sein, wenn die IKS sich auch gegen diejenigen Angriffe verteidigen kann, deren Zielscheibe sie selber ist. Der vorangehende Kongress hatte bereits festgestellt, dass unsere Organisation fähig gewesen war, die hinterlistigen Angriffe der IFIKS[2] abzuwehren, indem wir verhindert hatten, dass diese ihr erklärtes Ziel erreichte, nämlich die IKS oder mindestens die grösstmögliche Anzahl von Sektionen zu zerstören. Im Oktober 2004 unternahm die IFIKS eine neue Offensive gegen unsere Organisation, wobei sie sich auf verleumderische Stellungnahmen eines „Circulo de Comunistas Internacionalistas“ aus Argentinien stützte, der vorgab, Nachfolger des Nucleo Comunista Internacional zu sein, einer Gruppe, mit der die IKS ab Ende 2003 Kontakte gepflegt und Diskussionen geführt hatte. Leider leistete das IBRP seinen eigenen Beitrag zu diesem peinlichen Manöver, indem es auf seiner Website während mehrerer Monate und in verschiedenen Sprachen eine der hysterischsten und lügenhaftesten Erklärungen des Circulos gegen unsere Organisation veröffentlichte. Mit Dokumenten, die wir umgehend auf unsere Website stellten, wehrten wir diesen Angriff ab; seither ist von dieser Seite nichts mehr zu vernehmen. Der „Circulo“ entlarvte sich als das, was er war: eine Erfindung des Bürgers B., eines armseligen Abenteurers in Argentinien. Dieser Kampf gegen die Offensive der „Dreierallianz“ von Abenteurertum (B.), Parasitismus (IFIKS) und Opportunismus (IBRP) war auch ein Kampf für die Verteidigung des NCI, der für das Streben eines kleinen Kerns von Genossen steht, sich den Positionen der Kommunistischen Linken in Zusammenarbeit mit der IKS anzunähern.[3]
„(...) Angesichts dieser Arbeit gegenüber den suchenden Leuten muss die IKS eine entschlossene Intervention umsetzen. Gleichzeitig muss sie ihre ganze Aufmerksamkeit auch auf die Tiefe der Argumentation, die sie in die Diskussionen einbringt, und auf die Frage des politischen Verhaltens richten. Das Hervortreten der neuen kommunistischen Kräfte muss ein starker Ansporn sein, der die Reflexion und die Energien nicht nur der Militanten anregt, sondern auch jener Leute, die durch den Rückfluss im Klassenkampf nach 1989 beeinflusst wurden: Die Auswirkungen der gegenwärtigen historischen Entwicklung werden einen Teil der Generation von 1968 wieder politisieren, die seinerzeit durch die bürgerliche Linke abgelenkt und vergiftet wurde. Sie haben bereits angefangen, ehemalige Militante nicht nur der IKS, sondern auch anderer proletarischer Organisationen wieder zu beleben. Jede dieser Äusserungen dieser Gärung stellt ein kostbares Potential für die Wiederaneignung der Klassenidentität, die Kampferfahrung und für die historische Perspektive des Proletariats dar. Aber diese unterschiedlichen Potentiale können nur umgesetzt werden, wenn sie durch eine Organisation zusammengefasst werden, die das historische Bewusstsein, die marxistische Methode und die organisatorische Herangehensweise hat, welche heute nur die IKS anbieten kann. Dies führt dazu, dass die konstante und langfristige Entwicklung der theoretischen Fähigkeiten, des militanten Verständnisses und der Zentralisierung der Organisation zu entscheidenden Faktoren der historischen Perspektive werden.“
Der Kongress hob die Bedeutung der theoretischen Arbeit in der derzeitigen Situation hervor: „Die Organisation kann ihre Verantwortung sowohl gegenüber den revolutionären Minderheiten als auch gegenüber der Klasse als Ganze nur wahrnehmen, wenn sie fähig ist, den Prozess zu verstehen, der die zukünftige Partei im grösseren Kontext der allgemeinen Entwicklung des Klassenkampfes vorbereitet. Die Fähigkeit der IKS, das veränderte Kräfteverhältnis zwischen den Klassen zu analysieren und in den Kämpfen wie auch gegenüber der politischen Reflexion in der Klasse zu intervenieren, ist langfristig für die Entwicklung des Klassenkampfes wichtig. Aber bereits jetzt, kurzfristig, ist sie entscheidend für die Übernahme unserer führenden Rolle gegenüber der neuen politisierten Generation. Die Organisation muss diese theoretische Reflexion fortsetzen und dabei die grösstmögliche Anzahl von konkreten Lehren aus ihrer Intervention ziehen und die Schemata der Vergangenheit überwinden.“
Schliesslich konzentrierte sich der Kongress auch auf die Frage, mit der unsere Plattform endet: „Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen der Organisation und die Beziehungen zwischen den Militanten tragen notwendigerweise die Narben der kapitalistischen Gesellschaft mit sich, und deshalb können diese Beziehungen keine Inseln der kommunistischen Beziehungen innerhalb des Kapitalismus darstellen. Sie dürfen jedoch nicht in offenkundigem Widerspruch stehen zu dem von den Revolutionären verfolgten Ziel, und sie müssen notwendigerweise auf der Solidarität und dem gegenseitigen Vertrauen beruhen, die ein Kennzeichen der Zugehörigkeit zu der Klasse sind, die den Kommunismus verwirklichen wird.“
Eine solche Aufgabe, wie auch alle anderen, vor die eine marxistische Organisation gestellt wird, erfordert eine theoretische Arbeit: „In dem Masse, wie die Fragen der Organisation und des Verhaltens heute im Zentrum der Debatten sowohl innerhalb wie auch ausserhalb der Organisation stehen, wird eine zentrale Achse unserer theoretischen Arbeit in den kommenden zwei Jahren die Diskussion über die unterschiedlichen Orientierungstexte sein [die diese Themen behandeln]. Diese Fragen führen uns zu den Wurzeln der jüngsten organisatorischen Krisen, berühren die Grundlage unseres militanten Engagements und sind Schlüsselfragen der Revolution in der Epoche des Zerfalls. Sie werden deshalb eine zentrale Rolle bei der Wiedergewinnung der militanten Überzeugung und des Geschmacks für Theorie und die marxistische Methode spielen, die jede Frage mit einer historischen und theoretischen Sichtweise angeht.“
Begeisternde Perspektiven
Die Kongresse der IKS sind für die Gesamtheit der Mitglieder immer Momente der Begeisterung. Wie könnte es auch anders sein, wenn Militante aus drei Kontinenten und aus 13 Ländern zusammen kommen, die alle von den gleichen Überzeugungen beseelt sind und nun alle Aspekte der Perspektiven der historischen Bewegung des Proletariats diskutieren? Doch der 16. Kongress war noch begeisternder als die meisten der früheren.
Fast die Hälfte ihres dreissigjährigen Bestehens der IKS fiel in eine Zeit, in welcher das Proletariat unter einem Rückfluss seines Bewusstseins litt, unter einer Erstickung seiner Kämpfe und einem Versiegen beim Hervortreten neuer militanter Kräfte. Während mehr als einem Jahrzehnt galt in der Organisation die Durchhalteparole. Dies war eine schwierige Prüfung, und eine ganze Anzahl von ihren „alten“ Militanten bestanden sie nicht (insbesondere diejenigen, welche die IFIKS bildeten, und jene, die den Kampf während der Krisen, die wir in dieser Zeit durchmachten, aufgaben).
Heute, wo die Perspektive aufheitert, können wir sagen, dass die IKS insgesamt diese Probe bestanden hat. Und sie ist gestärkt daraus hervorgegangen. Sie hat sich politisch verstärkt, worüber sich die Leser und Leserinnen unserer Presse selber ein Urteil bilden können (und wir erhalten je länger je mehr ermunternde Briefe von ihnen). Aber auch numerisch hat sie sich verstärkt, denn schon heute ist die Zahl der Neubeitritte grösser als diejenige der Austritte, die wir mit der Krise von 2001 erlebten. Und bemerkenswert ist, dass eine bedeutende Anzahl von diesen neuen Mitgliedern junge Leute sind, die nicht die Verbildung erleiden und überwinden mussten, die die Mitgliedschaft in linksbürgerlichen Organisationen nach sich zieht. Junge Leute, deren Dynamik und Begeisterung hundertfach die müden und verbrauchten „militanten Kräfte“ ersetzt, die uns verlassen haben.
Diese Begeisterung, die am 16. Kongress zu spüren war, hatte ein klares Bewusstsein. Sie hatte nichts mit der trügerischen Hochstimmung zu tun, die andere Kongresse unserer Organisation mitgerissen hatte (eine Euphorie, die besonders häufig bei jenen anzutreffen war, die uns mittlerweile verlassen haben). Nach 30 Jahren des Bestehens hat die IKS (manchmal schmerzhaft) gelernt, dass der Weg zur Revolution keine Autobahn ist, sondern vielmehr manche Windung aufweist, voller Hinterhalte und Fallen ist, die die herrschende Klasse ihrem Todfeind, der Arbeiterklasse, aufstellt, um sie von ihrem historischen Ziel abzulenken.[4] Die Mitglieder unserer Organisation wissen heute sehr gut, dass es nicht einfach ist, Militante oder Militanter zu sein; dass es nicht nur eine feste Überzeugung, sondern auch viel Selbstlosigkeit, Hartnäckigkeit und Geduld verlangt.
Das Bewusstsein über die Schwierigkeiten unserer Aufgabe soll uns nicht entmutigen. Es ist vielmehr ein zusätzlicher Aspekt unserer Begeisterung. In letzter Zeit steigt die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an unseren öffentlichen Veranstaltungen spürbar, und wir erhalten je länger je mehr Briefe aus Griechenland, Russland, Moldavien, Brasilien, Argentinien und Algerien, in denen Kontakte direkt fragen, wie sie der Organisation beitreten können, oder vorschlagen, eine Diskussion zu beginnen oder ganz einfach nach Publikationen fragen – alles jeweils mit einer militanten Sorge. All diese Zeichen erlauben es uns davon auszugehen, dass es eine Ausbreitung von kommunistischen Positionen auch in denjenigen Ländern gibt, wo die IKS noch keine Sektion hat, oder lässt sogar die Hoffnung auf die Gründung neuer Sektionen in diesen Ländern zu. Wir heissen diese Genossinnen und Genossen, die sich den kommunistischen Positionen und unserer Organisation zuwenden, willkommen. Wir rufen ihnen zu: „Ihr habt eine gute Wahl getroffen, die einzig mögliche, wenn ihr im Sinn habt, euch in den Kampf für die proletarische Revolution einzureihen. Aber es ist keine einfache Wahl: Ihr werdet nicht sofort Erfolg ernten, ihr werdet Geduld und Hartnäckigkeit brauchen und lernen müssen, nicht aufzugeben, wenn die erreichten Resultate noch nicht den gehegten Hoffnungen entsprechen. Aber ihr seid nicht allein: Die Militanten der IKS sind an eurer Seite und sie sind sich der Verantwortung bewusst, die eure Annäherung ihnen auferlegt. Ihr Wille, der am 16. Kongress zu Ausdruck kam, ist, auf der Höhe dieser Verantwortung zu sein.“
IKS, 2.07.2005
[1] Ein vollständigerer Bericht über die Arbeit des Kongresses wurde in International Review 122 (engl./frz./span. Ausgabe) veröffentlicht.
[2] Die so genannte “interne Fraktion der IKS”, bestehend aus ehemaligen, langjährigen Mitgliedern unserer Organisation, die sich zunächst wie hysterische Fanatiker auf der Suche nach Sündenböcken, später wie Schurken und schliesslich wie Spitzel benahmen.
[3] s. unseren Artikel „Der Nucleo Comunista Internacional, Eine Episode im Streben des Proletariats nach Bewusstsein“, in: Internationale Revue Nr. 35.
[4] Oder besser gesagt: wieder gelernt, da es sich dabei um eine Lehre handelt, derer sich die kommunistischen Organisationen der Vergangenheit sehr bewusst waren, insbesondere die Italienische Fraktion der Kommunistischen Linken, auf welche sich die IKS bezieht.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Die Attentate vom 7. Juli in London und der wilde Streik der Beschäftigten auf dem Londoner Flughafen am 11. August 05
- 3400 Aufrufe
Welche Zukunft für die Menschheit? Imperialistischer Krieg oder Klassensolidarität?
1867 stellte Marx im Vorwort der ersten Ausgabe des berühmten „Kapital“ fest, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse in Grossbritannien, der fortgeschrittensten Industrienation, das Vorbild für die Entwicklung des Kapitalismus in allen anderen Ländern darstellte. Grossbritannien war das „führende Land“ bezüglich der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Ab dieser Zeit beherrschte das aufstrebende kapitalistische System zunehmend die ganze Welt. Hundert Jahre später, 1967, befand sich Grossbritannien erneut in einer bedeutenden symbolischen und wegweisenden Situation, und zwar mit der Entwertung des Sterlings – doch diesmal während des Niedergangs der kapitalistischen Produktionsweise und angesichts ihres zunehmenden Scheiterns. Die Ereignisse vom Sommer 2005 in London haben gezeigt, dass Grossbritannien erneut ein Indikator für die Lage des Weltkapitalismus darstellt. Dieser Sommer in London war einerseits geprägt von den imperialistischen Spannungen, konkret einem tödlichen Konflikt zwischen den verschiedenen Nationalstaaten, und andererseits vom internationalen Klassenkampf, konkret vom Konflikt zwischen den zwei entscheidenden Klassen der Gesellschaft: der Bourgeoisie und dem Proletariat.
Die Anschläge vom 7. Juli in London wurden von Al Kaida als Rache für die Beteiligung britischer Truppen an der Besetzung des Iraks in Anspruch genommen. An diesem Dienstagmorgen, als die Explosionen zu einer Stosszeit des öffentlichen Verkehrs erfolgten, erinnerte dies die Arbeiterklasse erneut brutal daran, dass sie diejenige ist, welche im Kapitalismus den Kopf hinhalten muss. Nicht nur durch Lohnarbeit und die sich ausbreitende Armut, sondern auch mit ihrem Fleisch und Blut. Die vier Bomben in der Londoner U-Bahn und in einem Bus haben 52[1] Arbeiter, meist junge, getötet und Dutzende verstümmelt und traumatisiert. Doch diese Attentate haben eine viel weiterreichende Auswirkung gehabt. Sie vermittelten Millionen von Arbeitern die Botschaft, dass ihre nächste Fahrt zur Arbeit, oder diejenige ihrer Freunde und Angehörigen, möglicherweise die letzte in ihren Leben ist. All die Sympathieparolen der Regierung Blair, des Londoner Bürgermeisters Ken Livingstone (Repräsentant des linken Flügels der Labour Party), der Medien und Chefetagen waren kaum zu übertreffen. Doch mit den Schlagworten „Wir beugen uns nicht vor den Terroristen“ und „London bleibt einig“ versuchte die herrschende Klasse lediglich zu vermitteln, dass das Business weiterlaufen solle, als wäre nichts gewesen. Die Arbeiter müssten eben das Risiko weiterer Explosionen in den Verkehrsmitteln in Kauf nehmen, wenn sie weiterhin von ihrem „bisherigen Lebensstandard“ profitieren wollen.
Der Imperialismus erschüttert das Herz des Kapitalismus
Diese Anschläge waren die blutigsten gegen die Zivilbevölkerung Londons seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein Vergleich mit der imperialistischen Schlächterei von 1939–45 ist mehr als gerechtfertigt. Die Anschläge von London, welche auf den 11. September in New York und den März 2004 in Madrid folgten, zeigen, dass der Imperialismus „zurückschlägt“, und zwar in seine wichtigsten Metropolen.
Es dauerte jedoch nicht wirklich 60 Jahre, bis erneut militärische Anschläge gegen die Bewohner Londons erfolgten. Die Stadt war ab 1972 während beinahe 20 Jahren Ziel von Bomben der „Provisionals“ der IRA.[2] Die Bevölkerung hatte damit schon einen Vorgeschmack des imperialistischen Terrors erhalten. Doch die Grausamkeiten vom 7. Juli 2005 sind keine simple Wiederholung dieser Erfahrungen: Sie wiederspiegeln eine verschärfte Bedrohung und sind Ausdruck der aktuellen, mörderischen Phase des imperialistischen Krieges.
Selbstverständlich waren die terroristischen Attentate der IRA ein Vorläufer der Barbarei der Anschläge von Al Kaida. Sie waren schon ein Zeichen für die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstärkende Tendenz, den Terror gegen die Zivilbevölkerung immer mehr zur bevorzugten Methode des imperialistischen Krieges werden zu lassen.
Dennoch, während der meisten Zeit der IRA-Attentate war die Welt noch in zwei imperialistische Blöcke unter der jeweiligen Kontrolle der USA und Russlands aufgeteilt. Diese Blöcke steuerten mehrheitlich die zweitrangigen, isolierten imperialistischen Konflikte zwischen einzelnen Staaten im selben Lager, wie denjenigen zwischen Irland und Grossbritannien im amerikanischen Block. Der amerikanische Block konnte und durfte nicht zulassen, dass ein solcher Konflikt ein Ausmass annahm, welches die militärische Hauptfront gegenüber dem Rivalen Russland und seinen Satelliten schwächen würde. In Wahrheit waren (und blieben) die Kampagnen der IRA mit dem Ziel, Grossbritannien aus Nordirland zu verjagen, von der finanziellen Unterstützung der USA an die IRA abhängig. Die terroristischen Anschläge der IRA in London stellten zur damaligen Zeit in den Metropolen der hochentwickelten Länder eine Ausnahme dar. Hauptbühne der imperialistischen Auseinandersetzung zwischen den zwei Blöcken durch ihre stellvertretenden Nationen war vielmehr die Peripherie: Vietnam, Afghanistan, Naher Osten.
Die Opfer der IRA waren ebenfalls wehrlose Zivilisten, doch folgten die Ziele dieser Bomben – ausserhalb Irlands – im Allgemeinen einer eher klassischen imperialistischen Logik. Es waren militärische Anlagen wie die Chelsea Barracks 1981 oder der Hyde Park 1982,[3] welche ausgewählt wurden, oder Symbole der wirtschaftlichen Macht wie Bishopsgates in der Londoner City[4] und Canary Wharf 1996.[5] Im Gegensatz dazu sind die Anschläge der Al Kaida auf öffentliche Transportmittel symptomatisch für eine gefährlichere imperialistische Situation auf Weltebene und typisch für die neue internationale Tendenz. Diese ist ein Resultat der Situation, dass es keine imperialistischen Blöcke mehr gibt, welche eine gewisse Ordnung über den kapitalistischen Militarismus bewahren. „Jeder für sich“ ist das Leitmotiv des Imperialismus geworden, gewalttätig und unerbittlich angeführt von den USA in ihrem Bestreben, die Kontrolle über den Globus aufrecht zu erhalten. Die selbstherrliche Strategie Washingtons, vor allem bei der Invasion und Besetzung des Iraks, hat dieses militärische Chaos lediglich zugespitzt. Der ansteigende weltweite Einfluss von Al Kaida und anderen Kriegsherren des Imperialismus im Nahen Osten ist das Produkt dieser alltäglich gewordenen imperialistischen Querelen, über welche die führenden Staaten die Kontrolle verlieren, weil sie alle gegeneinander arbeiten. Die Grossmächte, inklusive Grossbritannien, haben selber aktiv an der Entfaltung des Terrorismus mitgewirkt, in dem sie ihn selber benutzten und manipulierten, um Profit daraus zu schlagen.
Der britische Imperialismus war gezwungen, sich an der amerikanischen Invasion im Irak zu beteiligen. Er erhoffte sich, seine eigenen Interessen in der Region verteidigen und sein Ansehen als gewichtige militärische Macht aufrechterhalten zu können. Indem zur Rechtfertigung einer Beteiligung an der amerikanischen „Koalition“ mit dem berühmten Dossier über die angeblichen Massenvernichtungswaffen der Weg geebnet wurde, spielte der britische Imperialismus seine eigene Rolle, um den Irak in das blutige Chaos zu stürzen. Der britische Staat hat auch die terroristische Kampagne der Al Kaida gegen den westlichen Imperialismus genährt. Sicherlich hat dieser terroristische Feldzug schon vor der Invasion des Irak begonnen, und es sind die Grossmächte, welche ihn zum Leben erweckt hatten. Konkret hat Grossbritannien, genau wie die USA, in den 80er Jahren die Guerilla von Bin Laden geschult und bewaffnet, um die russische Besatzung Afghanistans zu bekämpfen.
Nach dem 7. Juli haben die wichtigsten „Verbündeten“ Grossbritanniens (in Wirklichkeit seine Rivalen) sich nicht gescheut, die Kapitale des Landes als „Londonistan“ zu bezeichnen – ein Refugium für verschiedene radikale islamistische Gruppen, die in Verbindung mit den Terrororganisationen des Nahen Ostens stünden. Der britische Staat hatte sie auf seinem Boden toleriert und gewisse Figuren beschützt in der Hoffnung, sie im Nahen Osten für seine eigenen Zwecke gegen die anderen „verbündeten“ Grossmächte einsetzen zu können. So hat Grossbritannien zum Beispiel 10 Jahre lang den Antrag Frankreichs auf Auslieferung Rachid Ramdas abgeschlagen, der im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen auf die Pariser Metro verdächtigt wird! Die Zentralbehörde des französischen Nachrichtendienstes (laut International Herald Tribune vom 9.8.2005) unterliess es im Gegenzug, ihren britischen Kollegen den Rapport ihres Geheimdienstes vom Juni zukommen zu lassen, in dem über ein geplantes Bombenattentat pakistanischer Al-Kaida-Sympathisanten in London berichtet wurde.
Die imperialistische Politik Grossbritanniens hat mit ihren „Prinzipien“ – „Lasst sie auf die Anderen los, bevor sie uns an den Kragen gehen“ – lediglich die terroristischen Attentate auf eigenem Boden geschürt.
In der gegenwärtigen Phase ist der Terrorismus keine Ausnahme mehr im Krieg zwischen Staaten, sondern zur bevorzugten Methode geworden. Die Ausbreitung des Terrorismus geht grösstenteils einher mit dem Verschwinden stabiler Bündnisse zwischen den imperialistischen Mächten und ist charakteristisch für eine Zeit, in welcher jeder Staat versucht, den Einfluss der anderen zu untergraben und zu sabotieren.
In diesem Zusammenhang ist die Rolle der Geheimdienstaktionen und des psychologischen Krieges durch die mächtigsten imperialistischen Staaten nicht zu unterschätzen, wenn es darum geht, die Rivalen eines bestimmten Staates vor dessen Bevölkerung zu diskreditieren und damit die militärischen Operationen vorzubereiten. Auch wenn keine offiziellen Beweise vorliegen – die wohl auch kaum jemals auftauchen werden – gibt es starke Vermutungen, dass das Attentat auf die Twin Towers und dasjenige gegen die Wohnblöcke in Moskau, die beide jeweils für die USA und Russland die Türe für ein militärisches Abenteuer geöffnet haben, unter Mitwirkung der eigenen Geheimdienste zustande kamen. Auch der britische Imperialismus ist keineswegs ein Unschuldslamm. Sein verdecktes Engagement auf beiden Seiten des terroristischen Konfliktes in Nordirland ist wohlbekannt, so auch die Präsenz seiner Agenten innerhalb der „Real IRA“, der Organisation, die sich zum Attentat von Omagh bekannte.[6] Kürzlich, im September 2005, wurden zwei Mitglieder der SAS (der britischen Sondereinheiten) in Basra von der irakischen Polizei festgenommen, weil sie, laut einigen Journalisten, ein terroristisches Attentat ausführen wollten.[7] Diese Geheimagenten wurden später durch einen Überfall britischer Truppen auf das Gefängnis, in dem sie inhaftiert waren, befreit. Betrachtet man solche Ereignisse, so liegt der Gedanke auf der Hand, dass der britische Imperialismus selber in die tagtägliche Schlächterei im Irak involviert ist: mit der Absicht, seine eigene „stabilisierende“ Präsenz als Besatzungsmacht zu rechtfertigen. Es ist der britische Imperialismus selber, welcher als erster unter den alten Kolonialmächten das Prinzip des „Teile und Herrsche“ einführte, das man im Irak erneut hinter seiner Taktik des Terrors erkennen kann.
Die sich zuspitzende Tendenz zum Einsatz des Terrorismus innerhalb imperialistischer Konflikte trägt alle Zeichen der letzten Phase des niedergehenden Kapitalismus, der Phase des sozialen Zerfalls und der mangelnden langfristigen Perspektive.
Bezeichnend für diese Situation ist, dass die Attentate vom 7. Juli von Kamikazes britischer Herkunft ausgeführt wurden, die in Grossbritannien geboren und aufgewachsen waren. Diese Attentate offenbaren eine selbstzerstörerische Irrationalität, die zunehmend auch im „Herzen“ des Kapitalismus vor allem unter jungen Leuten ihre Früchte treibt. Ob der britische Staat selbst auch in die Attentate verwickelt war, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
Die willkürliche Grausamkeit des imperialistischen Krieges schlägt somit zurück in die kapitalistischen Kernländer, in Sektoren mit der höchsten Konzentration der Arbeiterklasse. New York, Washington, Madrid, London: Zielscheiben sind nicht mehr ausschliesslich Drittweltländer, sondern zunehmend Industriemetropolen. Und die Ziele sind nicht mehr ausdrücklich wirtschaftlicher oder militärischer Natur. Vielmehr geht es um die grösstmögliche Zahl an Zivilopfern.
Schon in den 90er Jahren zeigte sich in Ex-Jugoslawien dieser tendenzielle Rückschlag des imperialistischen Krieges in die kapitalistischen Kernländer. Dann traf es Spanien und jetzt Grossbritannien.
Der Terror des bürgerlichen Staates
Im Juli 2005 wurde die Londoner Bevölkerung von der tödlichen Bedrohung durch terroristische Attentate getroffen. Dabei ist es aber nicht geblieben. Am 22. Juli wurde an der U-Bahnstation Stockwell ein junger brasilianischer Elektriker, Jean Charles de Menezes, auf dem Weg zu seiner Arbeit von der britischen Polizei mit acht Schüssen hingerichtet. Nach offizieller Erklärung hatte ihn die Polizei für einen Selbstmordattentäter gehalten. All dies geschah in einem Land, indem die Polizei ihr integres Bild von Scottland Yard als Garanten für die demokratische Gemeinschaft, für den Frieden und als Hüter der Bürgerrechte pflegt. Dazu passte der nette „Bobby“ von nebenan, der alten Damen über die Strasse hilft. Aber in Wirklichkeit – und dies wurde durch diese jüngsten Ereignisse offensichtlich – unterscheidet sich die britische Polizei nicht grundsätzlich von derjenigen irgendwelcher Diktaturen der so genannten Dritten Welt, wo „Todesschwadronen“ ohne Umschweife für Staatsinteressen eingesetzt werden. In offiziellen Erklärungen wurde die Ermordung von Jean Charles als tragischer Irrtum bezeichnet. Tatsächlich aber erhielten die bewaffneten Einheiten der U-Bahnpolizei seit dem 7. Juli die Anweisung, auf jeden Kamikazeverdächtigen zu „schiessen um zu töten“. Und sogar nach der Ermordung von Jean Charles wurde diese Politik weiterhin energisch verteidigt. Da es aber nahezu unmöglich ist, einen Kamikaze vor der Sprengstoffzündung zu identifizieren oder sich ihm anzunähern, ist die Polizei durch eine derartige Anweisung ermächtigt, auf irgendwelche Personen zu schiessen, und zwar eigentlich ohne Warnung. Unbestreitbar erlaubten die höchsten Etagen der britischen Polizei solche „tragischen Fehler“, in ihrem Verständnis unvermeidbare Nebenwirkungen auf dem Weg zu einer stärkeren Staatsmacht.
Die Ermordung von Jean Charles ist daher kaum als tragischer Unfall zu verstehen. Sie muss im Zusammenhang mit der Funktion des Staates und seiner Repressionsorgane betrachtet werden: Diese Funktion besteht nicht wie vorgegeben im Schutz der Bevölkerung, und der Staat steht auch nicht vor der angeblich schwierigen Wahl zwischen der Verteidigung seiner Bürger und dem Schutz seiner Rechte. In Wahrheit ist die Hauptfunktion des Staates eine andere: die Verteidigung der herrschenden Ordnung für die Interessen der Herrschenden. Das heisst vor allem, dass der Staat sein Monopol der bewaffneten Macht erhalten und zum Ausdruck bringen will. Besonders wichtig ist dies in Kriegszeiten aufgrund der Notwendigkeit, die Staatsmacht zur Schau zu stellen und Repressionsakte durchzuführen. Die Antwort des britischen Staates auf Attentate wie jene vom 7. Juli ist daher vor allem eine Machtdemonstration. Die angebliche Aufgabe, die Verteidigung der Bevölkerung, ist sowieso nur für eine kleine Minderheit hoher Funktionäre realisierbar. Die Demonstration des staatlichen Gewaltmonopols ist ein absolutes Muss, soll die Unterwerfung der eigenen Bevölkerung gesichert und den anderen Staaten Respekt eingeflösst werden. Unter solchen Umständen ist die Verhaftung der wirklichen Täter und Kriminellen nebensächlich oder hat sogar mit dem Hauptanliegen des Staates nichts zu tun.
An dieser Stelle ist ein Vergleich mit Attentaten der IRA 1974 hilfreich. Infolge dieser Attentate gegen Pubs in Birmingham und Guildford[8] hatte die Polizei zehn verdächtige Iren festgenommen. Die Verhafteten wurden zu falschen Geständnissen gezwungen, willkürliches Material wurde in Beweisstücke gegen sie verwandelt und schliesslich wurden sie zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Erst fünfzehn Jahre später gestand die Regierung einen „tragischen Justizirrtum“ ein. Solche Beispiele lassen darauf schliessen, dass diese Massnahmen doch eher Repressalien gegen die „fremde“ und „feindliche“ Bevölkerung sind.
Der 22. Juli hat gezeigt, welche Realität sich hinter der demokratischen und humanitären Fassade des Staates verbirgt – einer Fassade, die in Grossbritannien sehr gut bestückt ist. In seiner Hauptrolle als Zwangsapparat kann der Staat nicht für die Mehrheit der Bevölkerung oder an ihrer Stelle handeln, sondern nur gegen sie.
Das eben Gesagte findet seine Bestätigung in einer ganzen Reihe „antiterroristischer“ Massnahmen, welche von der Regierung Blair im Zuge der Attentatsserie beantragt wurden. Derartige Massnahmen sind gegenüber dem islamischen Terrorismus chancenlos, sie dienen einzig der verschärften Staatskontrolle über die Bevölkerung als Ganzes: die Einführung der Identitätskarte; eine zeitlich unbegrenzte Politik des „Schiessens um zu töten“; Kontrollweisungen, die zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Bevölkerung führen; die offizielle Anerkennung der Überwachung von Telefongesprächen und Internet; eine dreimonatige Inhaftierung von Verdächtigen ohne Anklage; Spezialgerichte, wo Zeugenaussagen hinter verschlossenen Türen und ohne Geschworene erzwungen werden.
Die terroristischen Attentate vom letzten Sommer wurden also vom britischen Staat als Vorwand benutzt, um – wie schon oftmals zuvor – seinen Repressionsapparat zu verstärken. Dieser Ausbau dient der Vorbereitung eines viel allgemeineren und wichtigeren Angriffs gegen einen viel gefährlicheren Staatsfeind: das wieder erstarkende Proletariat.
Die Antwort der Arbeiter
Anders als am 7. Juli blieben am 21. Juli offiziell nur die U-Bahnlinien Victoria und Metropolitan geschlossen. Tatsächlich aber waren wegen Arbeiterprotesten auch die Linien Bakerloo und Northern geschlossen. Die Fahrer hatten sich wegen der unsicheren Lage und mangelnden Sicherheitsgarantien geweigert, ihre Arbeit fortzusetzen. Dieser Protest war immerhin ein punktueller Ausdruck einer längerfristige Perspektive zur Lösung dieser unerträglichen Situation: Die Arbeiter müssen ihre Sache in die eigenen Hände nehmen. Aber die Gewerkschaften reagierten auf dieses Aufflammen der Klasseneigenständigkeit ebenso schnell wie die Notdienste auf die Attentate. Unter gewerkschaftlicher Führung mussten die Fahrer ihre Arbeit wieder aufnehmen, bis dass die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Leitung zu einer Vereinbarung kommen würden. Die Gewerkschaftsseite versicherte zwar, dass jeder Fahrer in seiner Arbeitsverweigerung unterstützt würde – das hiess jedoch nichts anderes, als dass er seinem eigenen Schicksal überlassen wurde.
In den ersten Augustwochen nahm der Widerstand der Arbeiter grössere Ausmasse an: Auf dem Londoner Flughafen Heathrow begann ein wilder Streik, ausgelöst von den Angestellten des Catering-Unternehmens Gate Gourmet, das die Mahlzeiten für British Airways zubereitet. Schnell griff der Streik auf andere Beschäftigte über und löste bei den Gepäckarbeitern von British Airways eine spontane Solidaritätsaktion aus. Etwa 1.000 Arbeiter beteiligten sich insgesamt an dieser Aktion. British Airways musste zusehen, wie ihre Flugzeuge während mehreren Tagen am Boden stehen blieben. Weltweit wurden Bilder von massenhaft gestrandeten und blockierten Passagieren ausgestrahlt.
Der Ungehorsam der Arbeiter und ihre Anknüpfung an die Taktik des Solidaritätsstreiks wurden von den britischen Medien scharf verurteilt. Die Arbeiter hätten angeblich wissen müssen, dass derartige Solidaritätsaktionen „veraltet“ sind, dass nach einstimmiger Meinung der „Experten“ (Juristen und andere Spezialisten der Arbeitswelt) solche Aktionen gänzlich den Geschichtsbüchern angehören und daher auch als illegal erklärt wurden.[9] Indem die Medien die schädlichen Folgen für die Passagiere hervorhoben, versuchten sie den beispielhaften Mut dieser Arbeiter herabzusetzen.
Im Übrigen war von den Medien auch ein etwas versöhnlicherer Ton zu vernehmen, jedoch nicht minder feindlich gegenüber der Sache der Arbeiter. Dabei wurde der Flughafenstreik als ein Resultat der rücksichtslosen Taktik der amerikanischen Eigentümer von Gate Gourmet dargestellt. Diese hatten per Lautsprecher den Arbeitern mit massiven Kündigungen gedroht. Der Streik sei also Ausdruck eines Irrtums gewesen. Er sei die Antwort auf ein unfähiges Management gewesen; die Streikaktionen seien demzufolge eine Ausnahmeerscheinung im Gange der regulären und zivilisierten Industrieverhältnisse und der Beziehungen zwischen Gewerkschaften und Geschäftsführung, die im Normalfall solche Solidaritätsaktionen überflüssig werden liessen. Tatsächlich aber liegt die Hauptursache des Streiks nicht in der Arroganz des kleinen Arbeitgebers. An der brutalen Taktik von Gate Gourmet ist nichts Aussergewöhnliches. Nennen wir nur ein Beispiel unter vielen: Auch Tesco, die grösste und rentabelste Supermarktkette in Grossbritannien hat erst kürzlich angekündigt, dass Absenztage aus Krankheitsgründen zukünftig unbezahlt bleiben. Ebenso sind massive Entlassungen keineswegs ein typisches Zeichen fehlender gewerkschaftlicher Aktivität. Die Zeilen der International Herald Tribune vom 19.8.2005 enthalten folgende Meinung von Sophie Greenyer, Mediensprecherin von British Airways. „Sie sagte, dass es dem Unternehmen im Laufe der Vergangenheit dank der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gelungen ist, sowohl die Anzahl Arbeitsplätze als auch Kosten zu senken. British Airways hat in den letzten drei Jahren 13.000 Stellen gestrichen und seine Kosten um 850 Millionen Sterling vermindert. ‚Wir haben es geschafft, in vernünftiger Weise mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, um diese Ersparnisse zu erreichen’, meinte sie.“
Das Ziel, die Betriebskosten zu senken, hatte British Airways dazu veranlasst, die Gehälter und Lebensbedingungen der Angestellten zu verschlechtern. Gate Gourmet seinerseits wollte es mit bedachten Provokationen möglich machen, gegenwärtige Angestellte durch Arbeitskräfte aus dem osteuropäischen Raum zu ersetzen, welche zu noch tieferen Löhnen und schlechteren Bedingungen arbeiten.
Die von British Airways angestrebten Kostensenkungen sind nichts Aussergewöhnliches. Im Gegenteil: Sei es in der Luftfahrt oder in einem anderen Sektor, die verschärfte Konkurrenz aufgrund zunehmender Marktsättigung ist die normale Antwort des Kapitalismus auf eine sich zuspitzende Wirtschaftskrise.
Der Streik in Heathrow war also kein Zufall, sondern ein Beispiel des Verteidigungskampfes der Arbeiter gegen die zunehmenden Angriffe der Bourgeoisie insgesamt. Der Kampfeswille der Arbeiter ist aber nicht der einzige Aspekt von Belang in diesem Streik. Noch wichtiger sind die illegalen Solidaritätsaktionen anderer Teile der Flughafenbeschäftigten. Diese Arbeiter setzten nämlich ihre eigene Existenzgrundlage aufs Spiel, indem sie den Kampf ausdehnten.
Diese Solidaritätsbekundung war zwar von kurzer Dauer und blieb embryonal. Aber angesichts der von der Bourgeoisie als Antwort auf die Attentate erzeugten Atmosphäre der nationalen Unterordnung war dieser Solidaritätsausdruck dennoch ein kontrastreicher Lichtblick. Zumindest wurde bestätigt, dass sich die Londoner Bevölkerung nicht mehr nur demütig den Interessen des imperialistischen Krieges unterordnet. Zeiten wie 1940, als die nächtlichen „Blitz“-Bombardierungen der deutschen Luftwaffe passiv erduldet wurden, sind vorbei.
Der Streik von Heathrow ist vielmehr Teil einer ganzen Reihe von Arbeitskämpfen seit 2003, die in verschiedenen Erdteilen aufflackerten, so z.B. die Solidaritätsaktion der Arbeiter von Opel in Deutschland oder der Angestellten von Honda in Indien.[10] Nach einer langen, von Desorientierung geprägten Phase seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 findet die weltweite Arbeiterklasse nun ganz langsam und fast unmerklich ihre Kraft wieder. Allmählich tastet sich das Proletariat zu einer deutlicheren Klassenperspektive vor.
Die Schwierigkeiten, welche mit der Entwicklung dieser Perspektive verbunden sind, zeigten sich schnell durch die Sabotage der Gewerkschaften an der Solidaritätsaktion in Heathrow. Die Transport and General Worker’s Union setzte dem Streik der Gepäckarbeiter ein schnelles Ende und die von Gate Gourmet entlassenen Arbeiter sahen sich schliesslich gezwungen, den Ausgang der verlängerten Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Unternehmensführung abzuwarten.
Trotzdem bleibt dieses Zeichen vom mühevollen Wiedererstarken des Klassenkampfes in Grossbritannien von grosser Bedeutung. Denn die englische Arbeiterklasse hat eine längere Zeit der Kampfesschwäche hinter sich. Nach der Konjunktur der Klassenkämpfe des englischen Proletariats 1979 mit dem massiven Streik im öffentlichen Sektor und 1984/85 mit dem Streik der Bergarbeiter folgte eine längere Zeit der Kampfesschwäche. Die englische Arbeiterklasse litt stark unter der Niederlage der oben genannten Streiks von 1984/85, und diese Situation wurde von der Regierung Thatcher bis aufs Äusserste ausgenutzt, indem unter anderem Solidaritätsstreiks als illegal erklärt wurden. Daher ist das Wiederaufkommen von solchen Streiks in Grossbritannien mehr als erfreulich.
Grossbritannien war nicht nur das erste kapitalistische Land. In Grossbritannien zeigten sich auch die ersten Ausdrücke einer weltweiten Arbeiterklasse und ihre ersten politischen Organisationen in Form der Chartisten; in Grossbritannien befand sich auch der Sitz des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation. Heute ist Grossbritannien nicht mehr die Drehachse der Weltwirtschaft, spielt aber noch immer eine Schlüsselrolle in der Weltindustrie. Der Flughafen Heathrow ist der grösste Flughafen der Welt. Die britische Arbeiterklasse hat weiterhin ein bedeutendes Gewicht im weltweiten Klassenkampf.
In Grossbritannien wurde im vergangenen Sommer die politische Situation auf Weltebene aufgedeckt: auf der einen Seite die Tendenz des Kapitalismus zu immer schärferer Barbarei und Chaos, wo es keinen Platz für gesellschaftliche Werte gibt; auf der anderen Seite hat der Flughafenstreik in London zumindest für eine kurze Zeit gezeigt, dass andere gesellschaftliche Prinzipien durchaus existieren, Prinzipien, die auf der unbeschränkten Solidarität der Produzenten gründen – Prinzipien des Kommunismus.
Como
[1] Ohne die vier Kamikaze-Attentäter, die sich in die Luft gejagt haben.
[2] Die „IRA-Provisionals“ nannten sich so, um sich von der sogenannten „offiziellen IRA“ zu unterscheiden, von der sie sich getrennt hatten. Die „offizielle IRA“ spielte im Bürgerkrieg in Nordirland ab den 70er Jahren keine wesentliche Rolle.
[3] Chelsea Barracks ist eine Kaserne mitten in London, in welcher damals das Regiment der Irish Guards stationiert war. Das Attentat im Hyde Park richtete sich gegen eine Militärparade der königlichen Garde.
[4] Die Londoner City ist das Finanzzentrum, mit einer Fläche von ca. einem Quadratkilometer in Central London, einem Teil von Gross-London. Canary Wharf ist ein Wolkenkratzer, Symbol für das neue Geschäftsquartier, das in den alten Londoner Hafenanlagen errichtet wurde.
[5] Eines der mörderischsten Attentate der IRA – gegen das Arndale-Handelszentrum im Zentrum von Manchester 1996 – in einer Zeit, in der die IRA vor allem als Instrument der amerikanischen Bourgeoisie diente, um die britischen Versuche nach einer selbständigeren imperialistischen Politik einzudämmen – gehört schon in die Epoche des Chaos, in der auch die Al Kaida gross geworden ist.
[6] Die „Real IRA“ ist eine Abspaltung der IRA, die sich auf die Fortführung des Kampfes gegen die Briten beruft. Die Gruppe war verantwortlich für einen Bombenanschlag in der Stadt Omagh in Nordirland, bei dem am 15. August 1998 29 Zivilisten getötet wurden.
[7] Siehe die Internetseite: http//www.prisonplanet.com/articles/september2005/270905plantinbombs.html [136].
[8] Die Begründung für diese Attentate lautete, dass die betroffenen Pubs vor allem von Militärangehörigen besucht worden seien.
[9] In Grossbritannien sind Solidaritätsstreiks tatsächlich illegal. Ein entsprechendes Gesetz wurde unter der Regierung Thatcher in den 80er Jahren eingeführt und findet seine Fortsetzung unter der Labour-Regierung Blair.
[10] s. den Artikel auf unserer Website veröffentlicht von der indischen Sektion der IKS: welt/132_indien
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Jahresfeiern zum II. Weltkrieg: Kapitalistische Barbarei und ideologische Manipulationen
- 2861 Aufrufe
Der Frühjahr dieses Jahres stand, besonders in Deutschland, ganz im Zeichen der Feierlichkeiten anlässlich des 60. Jahrestages der sog. Befreiung vom Hitlerfaschismus. Alle bürgerlichen Medien berichteten ausgiebig über die Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Fernsehsender übertrafen sich einander mit altem Filmmaterial über die einstigen Nazigrößen oder über den „Kampf um Berlin“. Spielfilme wie „Der Untergang“ u.a. schilderten plastisch die letzten Tage des Nationalsozialismus. Und in den Printmedien stritten sich bürgerliche Historiker über die Frage, wie es einem Parvenü wie Hitler gelingen konnte, ein ganzes Volk zu verführen.
Was uns angeht, so haben wir hier nicht die Absicht, in diesen vielstimmigen Chor der Antifaschisten mit einzustimmen – einem Chor, dessen hysterischer Refrain uns weismachen will, dass das „Dritte Reich“ sozusagen außerhalb der Geschichte stünde, dass es allein das Werk pathologischer Dämonen vom Schlage eines Hitlers, Goebbels oder Himmlers gewesen sei. Ganz im Gegenteil: wir wollen hier und heute unsere Meinung kundtun, dass das Hitlerregime und der angeblich von ihm allein angezettelte 2. Weltkrieg ganz in der Logik eines Gesellschaftssystems steht, das weltweit – und nicht nur in Deutschland – die Menschheit in die schlimmsten Formen der Barbarei geführt hat. Wir wollen hier und heute deutlich machen, dass der II. Weltkrieg keinesfalls außerhalb der blutigen Tradition des dekadenten Kapitalismus steht, die im I. Weltkrieg ihren Anfang genommen hat und noch heute, 60 Jahre nach dem Sieg der Alliierten über den deutschen Imperialismus, die Menschheit von einem Massaker ins nächste stürzt. Und wir wollen vor allem eins deutlich machen: Entgegen der Propaganda der bürgerlichen Demokraten wie auch der Stalinisten und Trotzkisten war der Sieg der Alliierten über Hitlerdeutschland kein Triumph der Humanität über die Bestialität eines quasi außerhalb der Geschichte stehenden Regimes. Vielmehr steht der 8. Mai 1945 für das (nur vorläufige) Ende eines imperialistischen Bandenkrieges, in dem beide Seiten, ob das verbrecherische Naziregime oder die unheilvolle Allianz zwischen Stalin, Roosevelt und Churchill, bedenkenlos Millionen von Menschen auf dem Altar ihrer imperialistischen Interessen opferten. Der II. Weltkrieg war, um es in einem Satz zu sagen, eine weitere Eskalation im Überlebenskampf des internationalen Kapitals, dessen historische Legitimation spätestens mit dem Ausbruch des I. Weltkrieges verwirkt war.
Ermöglicht wurde der II. Weltkrieg erst durch die blutige Niederschlagung des Proletariats, dem es durch seine revolutionäre Erhebung 1917/18 gelungen war, dem I. Weltkrieg ein Ende zu bereiten. Erst durch die Massakrierung des revolutionären Proletariats in Russland und Deutschland und durch die Enthauptung seiner revolutionären Elite wurde der Weg frei gemacht für die lange Nacht der Konterrevolution, deren schlimmster Alptraum der Triumph des Stalinismus in Russland und des Nationalsozialismus in Deutschland war und die erst mit dem Wiedererwachen der internationalen Arbeiterklasse Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts ein Ende fand.
Uns geht es in dieser Veranstaltung nicht vornehmlich darum, die zweifellos barbarischen Untaten des Naziregimes zu thematisieren. Dies ist zu weiten Teilen und teilweise bis zum Erbrechen von den bürgerlichen Historikern getan worden. Und schon gar nicht wollen wir das Ausmaß des nationalsozialistischen Horrors verharmlosen oder gar negieren. Nur die ewiggestrigen Neonazis können so dummdreist sein, den Holocaust an den Juden durch die nazistische Vernichtungsmaschinerie zu leugnen. Uns geht es stattdessen darum:
· dass bei allem Entsetzen über die Verbrechen der Nazis nicht der Blick darüber verloren geht, dass der Zynismus solcher Massenmörder wie Roosevelt, Churchill oder Stalin der Barbarei eines Hitlers, Himmlers oder Eichmanns in nichts nachstehen,
· dass Erstere nicht nur Brüder im Geiste der Nazis, sondern auch faktisch deren Komplizen und Wegbereiter waren und
· dass die einzig angemessene proletarische Reaktion darauf nicht die Parteinahme für die eine oder andere imperialistische Seite sein kann, sondern allein der bedingungslose internationalistische Kampf des Weltproletariats gegen alle imperialistischen Lager.
Ehe wir uns jedoch diesen Fragen zuwenden, ist es wichtig, festzuhalten, dass – wie wir bereits angedeutet haben – der II. imperialistische Weltkrieg eine weitere blutige Etappe des Kapitalismus in seine historische Sackgasse war. Ebenso wenig wie sein historischer Vorläufer, der Krieg 1914-18 zwischen dem imperialistischen Deutschen Reich unter Kaiser Wilhelm einerseits und den nicht minder imperialistischen Demokratien Großbritanniens, Frankreichs und der USA andererseits, lässt sich auch der Krieg des „Dritten Reichs“ gegen den Rest der Welt auf die simplen Kategorien von Angriffs- bzw. Verteidigungskriegen reduzieren. Bereits Franz Mehring stellte in seinem Artikel „Eine Schraube ohne Ende“ in der sozialdemokratischen Zeitschrift Die Neue Zeit sieben Jahre vor Ausbruch des I. Weltkrieges fest: „Das historische Wesen des Krieges hat (die Arbeiterklasse) aber erst in unvollkommener Weise begriffen, solange sie zwischen Angriffs- und Verteidigungskriegen unterscheidet und diesen Unterschied in irgendwelcher Weise zur Richtschnur ihrer praktischen Politik macht. Der Krieg ist nach dem bekannten Worte von Clausewitz die Fortsetzung der Politik mit gewaltsamen Mitteln; er ist die ultima ratio, der letzte Vernunftgrad, die unzertrennliche Begleiterscheinung der kapitalistischen wie jeder Klassengesellschaft; er ist die Entladung historischer Gegensätze, die sich dermaßen zugespitzt haben, dass es kein anderes Mittel mehr gibt, sie auszugleichen. Damit ist im Grunde schon gesagt, dass der Krieg mit Moral oder Recht überhaupt nichts zu schaffen hat (...) deshalb haben moralische oder rechtliche Gesichtspunkte, wie sie mit der Unterscheidung zwischen Angriffs- und Verteidigungskriegen hervorgehoben werden, mit dem Kriege nichts zu tun. Jeder Krieg ist ein Angriffs- und ein Verteidigungskrieg, nicht etwa so, dass der eine der beiden Gegner angreift und der andere sich verteidigt, sondern so, dass jeder der beiden Gegner sowohl angreift als auch sich verteidigt.“
Was schon für die Kriege im aufsteigenden Kapitalismus galt, trifft auch und noch viel mehr auf die weltweiten Gemetzel im dekadenten Kapitalismus zu. Die Eröffnung des II. Weltkrieges durch Deutschland war nicht die Ausgeburt eines kranken Hirns, sondern schlicht eine Frage des Überlebens für den deutschen Imperialismus und die direkte Folge des I. Weltkrieges. Stranguliert durch die Auflagen des sog. Versailler Friedensvertrages, den die Siegermächte nach Ende des I. Weltkrieges ihm aufzwangen, und isoliert vom Weltmarkt, fristete er lange Zeit ein Pariadasein. Der einzige Ausweg für ihn bestand allein in einem neuerlichen Versuch, die Welt mit kriegerischen Mitteln neu aufzuteilen und neuen Lebensraum für sich selbst zu schaffen.
Dabei konnte sich der Nationalsozialismus als entschlossenster Vertreter des Kurses zum Krieg nicht nur der Unterstützung der deutschen Bourgeoisie sicher sein. Der Siegeszug der NSDAP, der 1933 schließlich zu ihrer Machtergreifung in Deutschland führte, wurde vom britischen Imperialismus – um es vorsichtig auszudrücken – mit Wohlwollen betrachtet. Ging es doch Großbritannien, dessen Machtpolitik stets darin bestand, die Großmächte auf dem europäischen Festland gegenseitig auszuspielen, darum, eine Gegenmacht zum aufstrebenden russischen Imperialismus unter Stalin zu etablieren. Und Letztgenannter scherte sich einen Teufel um die ideologischen Differenzen mit dem Hitlerfaschismus, als er in Gestalt des Hitler-Stalin-Paktes 1939 gemeinsame Sache mit dem deutschen Imperialismus bei der Aufteilung Polens machte.
Selbst in den USA, der Hauptkontrahent Deutschlands, gab es nicht unerhebliche Kreise in der Bourgeoisie, die offen ihre Sympathie für das nazistische Regime in Deutschland bekundeten.
Es war Rosa Luxemburg, die mehr als zwei Jahrzehnte vor Ausbruch des II. Weltkrieges feststellte, dass ein entfesselter Imperialismus zum „Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, (zu) Verödung, Degeneration“, ja zu einem „großen Friedhof“ führt. Nun, ihre Worte erwiesen sich angesichts der rund 60 Millionen Toten des II. Weltkriegs als geradezu prophetisch. Beschränkte sich im I. Weltkrieg der Blutzoll auf die Arbeiter in Uniform, also auf die Frontsoldaten, die zu Hunderttausenden dem Stellungskrieg in Verdun und an der Maas zum Opfer fielen, so erlaubte die sich rasant weiterentwickelnde Militärtechnologie dem Imperialismus, nun auch die Zivilbevölkerung millionenfach zu massakrieren. Dabei waren der Holocaust an den Juden und die Einäscherung Rotterdams und Coventrys durch Nazischergen und durch die deutsche Militärmaschinerie nur die eine Seite der Medaille. Wie wir bereits in unserem Artikel zum „60. Jahrestag der Befreiung der KZs, der Bombardierung Dresdens, Hiroshimas und der Kapitulation Deutschlands“ in der letzten Ausgabe der Weltrevolution geschildert haben, zeigten sich die Alliierten der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion in ihrer Menschenverachtung den nazistischen Massenmördern als durchaus ebenbürtig.
Selbst als die japanischen und deutschen Kriegsgegner militärisch schon am Boden lagen, ließen sie nicht davon ab, eine deutsche Stadt nach der anderen in wahre Feuerhöllen sowie Hiroshima und Nagasaki in radioaktive Wüsten zu verwandeln. Noch heute wollen sie uns weismachen, dass der Bombardierung Dresdens und dem Abwurf der beiden Atombomben auf Japan militärstrategische Erwägungen zu Grunde lagen. Dies ist eine glatte Lüge! Die Gründe für das von den Alliierten angerichtete Inferno unter der Zivilbevölkerung und den Flüchtlingsströmen liegen woanders. So galten die Bombenangriffe auf Dresden, Hamburg, Köln usw. keinesfalls dem Zweck, die deutsche Bevölkerung gegen das Hitlerregime aufzuwiegeln, wie die hanebüchene Begründung der Alliierten lautete. Wenn Bomber-Harris und andere Epigonen des Luftkriegs es vorzogen, die Arbeiterviertel in den deutschen Städten dem Erdboden gleichzumachen, dann geschah dies nicht nur, um die Bevölkerung zu zermürben, sondern auch aus Furcht vor einer Wiederauflage der Novemberrevolution von 1918. Und wenn Roosevelt sich veranlasst sah, Hiroshima und Nagasaki zum Ziel für seine Atombomben auszuwählen, so nicht, weil er etwa das Leben seiner Soldaten schonen wollte, die er zuvor skrupellos seinem imperialistischen Kalkül geopfert hat (siehe z.B. Pearl Harbor). Vielmehr ging es dem US-Imperialismus nach der Niederringung seiner alten Rivalen, Deutschland und Japan, um eine Demonstration der Stärke und einen Einschüchterungsversuch gegenüber seinem neuen Rivalen, der stalinistischen Sowjetunion.
Alles in allem zeigt sich, dass der II. Weltkriegs trotz seiner Exzesse in keiner Weise außerhalb des blutigen Reigens imperialistischer Konflikte vor und nach ihm steht, wie uns besonders die Linksextremisten vorgaukeln, angefangen bei den Trotzkisten bis hin zu den Antideutschen, einer besonders frenetischen Form des Antifaschismus. Wir wissen, dass wir mit dieser Position und all ihren Konsequenzen noch ziemlich allein auf weiter Flur stehen. Doch nicht nur, dass in den letzten Jahren immer mehr suchende Elemente der Arbeiterklasse bereit sind, sich von den Scheuklappen des Antifaschismus zu befreien; wir wissen uns darüber hinaus in der Tradition der Internationalisten der 30er und 40er Jahre, die selbst inmitten des imperialistischen Orkans nie den Kopf verloren und beharrlich die Fahne des internationalen Proletariats hochhielten. In diesem Sinne stimmen wir dem „Manifest der Kommunistischen Linken an die Proletarier Europas“ zu, das im Juni 1944 erstmals veröffentlicht und von der IKS (in Deutschland in der Weltrevolution Nr. 13) wiederveröffentlicht wurde und das mit folgenden Worten beginnt:
„Seit fast fünf Jahren wütet der imperialistische Krieg in Europa mit all seinen Erscheinungen von Elend, Massakern und Zerstörung. An der russischen, französischen und italienischen Front sind Abermillionen Arbeiter und Bauern dabei, sich gegenseitig für die ausschließlichen Interessen eines schmutzigen und blutigen Kapitalismus abzuschlachten, der nur seinen Gesetzen des Profits und der Akkumulation gehorcht. Während der fünf Kriegsjahre, vor allem während des letzten, dem Jahr der Befreiung aller Völker, wie es Euch gesagt wurde, sind die Täuschungsprogramme und viele Illusionen verschwunden und brachten die Maske zu Fall, hinter der sich das widerwärtige Gesicht des internationalen Kapitalismus versteckte. In jedem Land hat man Euch für verschiedene Ideologien mobilisiert, aber mit dem gleichen Ziel und mit dem gleichen Ergebnis: Euch in ein Blutbad zu stürzen, die die einen gegen die anderen, Leidensgenossen gegen Leidensgenossen, Arbeiter gegen Arbeiter.
Der Faschismus und Nationalsozialismus fordern Lebensraum für ihre ausgebeuteten Massen, aber damit machen sie nichts anderes, als ihren fanatischen Willen zu verstecken, sich selbst der tiefgreifenden Krise zu entwinden, die sie von Grund auf untergräbt.
Der britisch-russisch-amerikanische Block will Euch angeblich vom Faschismus erlösen, um Euch Eure Freiheiten und Rechte wiederzugeben. Aber diese Versprechungen sind nur die Köder, um Euch zur Teilnahme am Krieg zu bewegen, um den großen imperialistischen Konkurrenten, nachdem man ihn erzeugt hatte, den Faschismus, zu vernichten, als nicht mehr zeitgemäße Herrschafts- und Existenzform des Kapitalismus.“
IKS im Juni 2005
Historische Ereignisse:
- Zweiter Weltkrieg [86]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Polemik mit dem IBRP: Eine opportunistische Politik der Umgruppierung führt lediglich zu „Fehlgeburten“
- 3216 Aufrufe
Im letzten Artikel dieser Serie („Der Nucleo Comunista Internacional, eine Episode im Streben des Proletariats nach Bewusstsein“, Internationale Revue Nr. 35) haben wir den Weg eines kleinen Kerns von revolutionären Genossen geschildert, welche sich im „Nucleo Comunista Internacional (NCI) zusammengefunden hatten.
Wir haben die Probleme aufgezeigt, auf welche diese kleine Gruppe gestossen ist. Eines ihrer Mitglieder, Bürger B., hatte seine Informatik-Kenntnisse (vor allem über das Internet) benutzt, um die anderen Mitglieder zu isolieren, indem er die Korrespondenz mit Gruppen des politischen proletarischen Milieus monopolisierte. Er zwang ihnen seine Entscheidungen auf oder fällte sie gar hinter ihrem Rücken. Auch versteckte er sein Vorgehen bewusst, da die anderen Mitglieder dieses nicht genehmigen würden, weil er eine Politik entwickelte, welche von einem Tag auf den anderen die Richtung änderte. Genauer gesagt, nachdem er bis zum Sommer 2004 seinen Willen zur sofortigen Integration in die IKS1 gezeigt und behauptet hatte, mit allen programmatischen Positionen und Analysen einverstanden zu sein, und gleichzeitig die Positionen des IBRP verworfen und das unverschämte, verleumderische Verhalten der so genannten „Internen Fraktion der IKS“ (IFIKS) kritisiert hatte, machte er eine unvermittelte Kehrtwende.
Während noch eine Delegation der IKS in Argentinien weilte und eine Reihe von Diskussionen mit dem NCI führte, nahm er Kontakt mit der IFIKS und dem IBRP auf, um ihnen das Angebot einer gemeinsamen Arbeit zu machen und den Namen der Gruppe in „Circulo de Comunistas Internacionalistas“ umzutaufen (und dies alles, ohne der Delegation der IKS oder den anderen Gruppenmitgliedern nur ein Wort zu sagen). „Es ist bemerkenswert, dass Bürger B.s plötzliche Leidenschaft für das IBRP und dessen Positionen sowie für die IFIKS erst begann, als diesem kleinen Abenteurer gewahr wurde, dass er mit seinen Manövern bei der IKS auf Granit beissen würde. Diese Konvertierung, die noch schneller stattfand als die des St. Paulus auf dem Weg nach Damaskus, veranlasste das IBRP, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, sich hastig zum Sprecher von Bürger B. zu machen. Das IBRP sollte sich selbst einst fragen, wie es kommt (und das nicht nur einmal), dass Elemente, die ihre Unfähigkeit bewiesen haben, sich in die Kommunistische Linke zu integrieren, sich stets dem IBRP zuwandten, nachdem sie mit ihrer „Annäherung“ an die IKS gescheitert sind.“ (ebenda)
Soviel wir wissen, hat sich das IBRP diese Frage bisher noch nicht gestellt (auf jeden Fall ist nie etwas in seiner Presse darüber veröffentlicht worden).
Ein Ziel dieses Artikels ist es, unter anderem auf genau diese Frage eine Antwort zu geben, was für das IBRP von Nutzen sein könnte sowie für Elemente, die sich den Positionen der Kommunistischen Linken annähern und beeindruckt sind von der Behauptung des IBRPs, „der alleinige Erbe der Italienischen Kommunistischen Linken“ zu sein. Ganz generell erlaubt es uns zu verstehen, weshalb diese Organisation eine anhaltende Serie von Niederlagen in seine Umgruppierungspolitik der revolutionären Kräfte auf internationaler Ebene erlitten hat.
Die für konfuse Elemente unwiderstehliche Anziehungskraft der Sirenengesänge des IBRP
Die Haltung des Bürgers B., auf einen Schlag eine vollständige Übereinstimmung mit den Positionen des IBRP und mit den (total verleumderischen) Anklagen der IFIKS gegen die IKS zu entdecken, ist nichts mehr als eine Karikatur einer Herangehensweise, die wir schon vorher bei zahlreichen Elementen sehen konnten, die sich erst in eine Diskussion mit unserer Organisation begaben und dann feststellten, dass sie sich in der Türe geirrt hatten. Entweder weil sie unsere Positionen nicht teilten, weil die Anforderungen der Militanz in der IKS für sie allzu eingeengt erschienen, oder weil sie realisierten, dass sie ihre persönliche Politik innerhalb der IKS nicht weiterführen könnten. Oft wandten sich solche Elemente dem IBRP zu, weil ihnen diese Organisation ihre Erwartungen eher erfüllen konnte. Wir haben dies schon verschiedentlich in unserer Presse aufgezeigt. Dennoch ist es die Mühe wert, darauf zurück zu kommen, da es sich nicht um Ausnahmen oder Zufälligkeiten handelt, sondern um ein sich wiederholendes Phänomen, welches bei den Mitgliedern des IBRP eigentlich Fragen aufwerfen sollte.
Schon vor der Geburt des IBRP...
Man findet schon in der Vorgeschichte des IBRP (und auch der IKS) ein Beispiel welches sich mehrmals wiederholen sollte. Wir sind im Jahre 1973-74: Auf einen Aufruf hin einer amerikanischen Gruppe mit dem Namen Internationalism (welche später die Sektion der IKS in den USA wurde) zu einer internationalen Korrespondenz wurde eine Reihe von Treffen unter Gruppen abgehalten, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen. Die regelmässigsten Teilnehmer an diesen Treffen waren Révolution Internationale (RI) aus Frankreich und drei Gruppen aus Grossbritannien: World Revolution (WR), Revolutionary Perspectives (RP) und Workers’ Voice (WV) (benannt nach ihren Publikationen). WR und RP stammten aus Abspaltungen der Gruppe Solidarity, welche anarcho-rätistische Positionen vertrat. WV hingegen war eine kleine Gruppe von Arbeitern aus Liverpool, die mit dem Trotzkismus gebrochen hatten. Durch diese Diskussionen näherten sich die drei englischen Gruppen den Positionen von Révolution Internationale und Internationalism an (welche im Jahr darauf die IKS gründeten). Doch der Vereinigungsprozess dieser drei Gruppen endete in einer Niederlage. Einerseits beschlossen die Elemente von Worker’s Voice mit World Revolution zu brechen, weil sie das Gefühl hatten, von WR betrogen worden zu sein. Diese hatte halb rätistische Positionen zur Russischen Revolution 1917 aufrecht erhalten: Sie sagte zwar, dass es sich um eine proletarische Revolution gehandelt habe, die Bolschewiki jedoch eine bürgerliche Partei gewesen seien, eine Position, von der sie die Genossen von WV überzeugt hatte. Und weil WR nach dem Treffen vom Januar 1974 diese letzten Reste des Rätismus abgeschüttelt hatte und die Position von Révolution Internationale angenommen hatte, bekamen jene Genossen das Gefühl, „betrogen“ worden zu sein, und entwickelten eine starke Ablehnung gegenüber WR (mit der Beschuldigung „vor RI kapituliert zu haben“), was sie dazu führte, im November 1974 eine „Stellungnahme“ zu veröffentlichen, in der die Gruppen, welche kurz darauf die IKS gründen sollten als „konterrevolutionär“ bezeichnet wurden2. RP hingegen hatte die IKS angefragt, als „Tendenz“ mit einer eigenen Plattform integriert zu werden (weil es immer noch Differenzen zwischen dieser Gruppe und der IKS gab). Wir antworteten darauf, dass es nicht unsere Vorgehensweise sei, „Tendenzen“ als solche mit einer eigenen Plattform zu integrieren, auch wenn es in der Organisation unterschiedliche Positionen zu zweitrangigen Fragen der programmatischen Dokumente geben kann. Wir hatten die Türe zu einer Debatte für RP nicht verschlossen, doch diese Genossen begannen sich von der IKS zu entfernen. Sie begannen eine „alternative“ internationale Umgruppierung zu derjenigen der IKS zu starten, und zwar mit WV, der französischen Gruppe „Pour une Intervention Communiste“ (PIC) und der „Revolutionary Workers Group“ (RWG) aus Chicago. Dieser „Block ohne Prinzipien“ (ein Ausdruck Lenins) hatte einen kurzen Atem. Es konnte auch kaum anders sein, denn was die drei Gruppen als einziges verband, war ihre zunehmende Feindschaft gegenüber der IKS. Schlussendlich kam es doch noch zu einer Vereinigung in Grossbritannien zwischen RP und WV (September 1975), welche die „Communist Workers’ Organisation“ (CWO) gründeten. Diese Vereinigung hatte für RP einen hohen Preis: Ihre Mitglieder mussten die Position von WV akzeptieren, nach der die IKS „konterrevolutionär“ sei. Eine Weile lang wurde diese Position auch aufrecht erhalten, auch noch ein Jahr später, als die alten Mitglieder von WV sich von der CWO verabschiedeten und diejenigen, welche von RP stammten - der Intoleranz anderen Gruppen gegenüber bezichtigten!3 Diese „Analyse“ der CWO, welche die IKS als „konterrevolutionär“ bezeichnete, basierte auf folgenden „gewichtigen Argumenten“:
„- die IKS verteidigt das staatskapitalistische Russland nach 1921 und die Bolschewiki;
- sie bezeichnet eine staatskapitalistische Bande wie die trotzkistische Linksopposition als proletarische Gruppe“ (Revolutionary Perspectives Nr. 4).
Kurz darauf, als die CWO mit dem Partito Comunista Internazionalista aus Italien (Battaglia Comunista) zu diskutieren begann, widerrief sie die Bezeichnung der IKS als „konterrevolutionär“ (hätte sie die ehemaligen Kriterien aufrecht erhalten, so hätte sie BC ebenfalls als eine bürgerliche Organisation bezeichnen müssen!).
Ausgangspunkt der Wanderschaft der CWO war die Tatsache, dass die IKS sich geweigert hatte, RP mit einer eigenen Plattform zu integrieren. Diese Wanderschaft endete 1984 in der Gründung des IBRP: Die CWO durfte nach all den vorangegangenen Niederlagen schlussendlich doch noch an einer internationalen Umgruppierung teilhaben.
Die Enttäuschung mit den SUCM
Selbst der Prozess der Formierung des IBRP war demnach schon davon geprägt, dass „von der IKS Enttäuschte“ sich dem IBRP zuwandten. Wir kommen hier nicht auf die drei Konferenzen linkskommunistischer Gruppen zurück, die zwischen 1977 und 1980 nach einem Aufruf von BC im April 1976 stattfanden4. Unsere Presse hat jedoch mehrmals hervorgehoben, dass es total unverantwortlich und nur vom Interesse um ihre eigene kleine Kapelle getrieben war, als BC und die CWO diese Anstrengung abgewürgten, indem sie am Ende der 3. Konferenz eine Abstimmung darüber erzwangen, dass die Frage der Rolle und Funktion der Partei ein zusätzliches Teilnahmekriterium sein solle. Ziel dabei war es, die IKS von zukünftigen Konferenzen auszuschliessen5. Betrachten wir nun die „Konferenz“ von 1984, welche von BC und der CWO als Fortsetzung der drei Konferenzen zwischen 1977 und 1980 dargestellt wurde. Auf dieser „Konferenz“ war neben BC und der CWO die Gruppe „Supporters of the Unity of Communist Militants“ (SUCM), eine Gruppe iranischer Studenten vor allem aus England, welche die IKS gut kannte: Wir hatten mit ihnen schon zuvor diskutiert und erkannt, dass sie trotz allen Beteuerungen, mit der Kommunistischen Linken einverstanden zu sein, im Grunde eine linke Gruppe waren, die dem Maoismus entstammte. Die SUCM wandte sich danach an die CWO, die aber keine Notiz nahm von den Warnungen unserer Genossen in England vor dieser Gruppe. Dank diesen wunderbaren neuen „Rekruten“ konnten die CWO und BC jegliche Auseinandersetzung auf dieser gloriosen 4. Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken verhindern, da sie nun die IKS nicht mehr mit ihrem „Rätismus“ verseuchen konnte, und sich endlich den wichtigen Fragen des Aufbaus der zukünftigen Weltpartei der Revolution widmen6. Realität war aber Folgendes: All die anderen „Kräfte“, welche vom Tandem BC-CWO mit „Seriosität und Klarheit ausgewählt“ wurden (um die Formulierung von BC zu benutzen), sagten ab oder konnten nicht kommen, wie die Gruppe „Kommunistische Politik“ aus Österreich und L`Éveil Internationaliste, oder sie waren zum Zeitpunkt der „Konferenz“ gar schon verschwunden, wie die beiden amerikanischen Gruppen „Marxist Worker“ und „Wildcat“. Absurderweise schien letztere trotz ihrer rätistischen Positionen den „Teilnahmekriterien“, die von BC und der CWO aufgestellt worden waren, zu entsprechen7.
Der Flirt mit der SUCM dauerte nicht lange. Dies jedoch nicht wegen der Klarheit der Genossen von BC und der CWO, sondern ganz simpel deshalb, weil diese Gruppe ihren wahren Charakter nicht lange verbergen konnte und sich in die iranische Kommunistische Partei, eine stalinistische Organisation, eingliederte.
BC und die CWO luden keine anderen Gruppen ein wie zu den Konferenzen der Kommunistischen Linken, um sich nicht mit einem neuen Fiasko lächerlich zu machen8.
Zwei verschiedene Karrieren
Die Anziehungskraft des IBRP für „von der IKS Enttäuschte“ zeigte sich zur selben Zeit auch bei einem Element, das wir hier L. nennen und für einige Zeit sein einziger Repräsentant in Frankreich war. Dieses Element, welches seine Schule bei einer trotzkistischen Organisation gemacht hatte, näherte sich der IKS zu Beginn der 80er Jahre an und wollte in unsere Organisation eintreten. Wir führten mit ihm genaue Diskussionen, baten ihn aber auch um Geduld, weil er trotz voller Übereinstimmung mit unseren Positionen noch starke Überreste seiner linken Vergangenheit zeigte, vor allem einen ausgeprägten Immediatismus. Geduld hatte er aber gerade deshalb sehr wenig: Weil die Diskussionen für seinen Geschmack zu lange dauerten, brach er sie ab und wandte sich den Gruppen zu, die das IBRP bildeten. Von einem Tag auf den anderen übernahm er die Positionen des IBRP, welches auch nicht dieselbe Geduld für eine Integration forderte. Die Überzeugung dieses Elements war denn auch keinesfalls solide, und so verliess er das IBRP auch wieder, um zwischen den verschiedenen bordigistischen Gruppen in der Kommunistischen Linken hin und her zu segeln und danach Mitte der 90er Jahre wieder zum IBRP zurückzukehren. Wir hatten damals das IBRP auf die mangelnde politische Verlässlichkeit dieses Elements aufmerksam gemacht. Doch sie hatten unsere Warnung nicht zur Kenntnis genommen und ihn wieder in ihre Organisation integriert. Und so ist er denn auch, wen wundert es, nicht lange im IBRP geblieben: Ab dem Jahr 2000 „entdeckte“ er ein zweites Mal, dass die angenommenen Positionen ihn doch nicht vollständig überzeugten, und er tauchte an mehreren öffentlichen Diskussionsveranstaltungen der IKS auf, um das IBRP in den Dreck zu ziehen. Die IKS hielt es für notwendig, seine Verunglimpfungen zurückzuweisen und das IBRP dagegen zu verteidigen.
Die Serie von Flirts des IBRP mit von der IKS enttäuschten Elementen beschränkt sich jedoch nicht auf das beschriebene Beispiel.
Ein anderes Element, das ebenfalls aus der Linken kam und wir hier E. nennen, schlug eine ähnliche Laufbahn ein. Mit ihm entwickelte sich der Prozess der Integration in die IKS weiter als mit L., und er wurde nach langen Diskussionen Mitglied unserer Organisation. Es ist eine Sache, mit den Positionen einer Organisation einverstanden zu sein, jedoch eine andere, sich auch in eine kommunistische Organisation zu integrieren. Auch wenn die IKS diesem Element lange erklärt hatte, was es heisst, ein Militanter einer kommunistischen Organisation zu sein, und er dies anerkannt hatte, so erfordert die praktische Erfahrung der Militanz eine permanente Anstrengung zur Überwindung des Individualismus. Wir mussten bald feststellen, dass er keinen Platz in unserer Organisation fand, sondern eine feindselige Haltung gegenüber der IKS entwickelte. Schliesslich verliess er die IKS, ohne jegliche Divergenz gegenüber unserer Plattform zu formulieren (trotz unserer Aufforderung, eine seriöse Diskussion über seine „Vorwürfe“ aufzunehmen). Dies hinderte ihn nicht, kurz darauf seine Übereinstimmung mit den Positionen des IBRP zu entdecken, und dessen Presse veröffentlichte sogar einen Artikel von ihm, der eine Polemik gegen die IKS darstellen sollte.
Um auf die Gruppen zurück zu kommen, welche einen solchen Weg einschlugen: Die Liste der oben angeführten Beispiele ist noch nicht vollständig. Wir möchten noch die Beispiele der „Communist Bulletin Group“ (CBG) in Grossbritannien, Kamunist Kranti in Indien, Comunismo in Mexiko, „Los Angeles Workers’ Voice“ und Notes Internationalistes in Kanada beleuchten.
Die unglückliche Liebe zwischen der CBG und der CWO
In unserer Presse sind schon verschiedenste Artikel zur CBG erschienen9. Wir entwickeln hier nicht eine umfassende Analyse von diesem parasitären Grüppchen, welches von ehemaligen Mitgliedern unserer Organisation gegründet wurde, die 1981 ausgetreten waren und uns dabei Material und Geld gestohlen hatten. Ihr einzige Ziel war es, die IKS in den Dreck zu ziehen. Ende 1983 hatte diese Gruppe folgendermassen auf eine „Adresse an die politischen proletarischen Gruppen“ geantwortet, die vom 5. Kongress der IKS verabschiedet worden war, um „eine bewusste Zusammenarbeit unter allen Gruppen aufzubauen10“: “Wir wollen gegenüber der in dieser Adresse formulierten Stossrichtung und den Anliegen unsere Solidarität ausdrücken ...“. Doch sie übten nicht die geringste Kritik an ihrem Verhalten als Diebe. Wir schrieben ihnen: „So wie wir die grundlegenden Fragen der Verteidigung der politischen Organisationen des Proletariates verstehen, sind wir gezwungen, auf den Brief der CBG zu antworten, dass er für uns wertlos ist. Sie hat sich wohl in der Adresse getäuscht.“
Vermutlich enttäuscht über die Zurückweisung der IKS und sichtbar unter ihrer Isolation leidend, hat sich die CBG schlussendlich der CWO zugewandt, der britischen Organisation des IBRP. Es fand ein Treffen in Edinburgh im Dezember 1992 statt, nachdem schon „eine praktische Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern der CWO und der CBG stattgefunden hatte“. „Eine Vielzahl von Missverständnissen konnte beidseitig geklärt werden. Es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit formeller weiterzuführen. Eine Übereinkunft wurde getroffen, welche die CWO im Januar noch innerhalb der gesamten Organisation bestätigen muss (nachdem ein Bericht erstellt worden ist) und der die folgenden Punkte enthält...“ Darauf folgte eine Liste von Übereinstimmungen zur Zusammenarbeit und speziell: „Die beiden Gruppen werden einen Entwurf für eine vorgeschlagene „populäre Plattform“ diskutieren, der von einem Mitglied der CWO verfasst wird und als Werkzeug zur Intervention dient.“ (Workers’ Voice Nr. 64, Januar-Februar 1996)
Offenbar folgte auf diesen Flirt nichts mehr, da wir seither nie mehr etwas von einer Zusammenarbeit zwischen der CBG und der CWO erfahren haben. Ebenso wenig haben wir je etwas darüber gelesen, weshalb diese Zusammenarbeit scheiterte.
Der Kummer des IBRP in Indien
Ein anderes unglückliches Abenteuer mit „von der IKS Enttäuschten“ war das mit der Gruppe in Indien, die Kamunist Kranti veröffentlichte. Dieser kleine Kern entstammte einer Gruppe von Elementen, mit denen die IKS während der 80er Jahre diskutiert hatte und von denen sich einige an unsere Organisation annäherten und enge Sympathisanten wurden, wobei einer auch in die IKS eintrat. Doch eines dieser Elemente, das wir hier S. nennen und das eine wichtige Rolle in den ersten Diskussionen mit der IKS spielte, schlug einen anderen Weg ein. Möglicherweise aus Angst davor, durch eine Integration in die IKS seine Individualität zu verlieren, gründete er seine eigene Gruppe mit der Zeitschrift Kamunist Kranti.
Das IBRP hatte schon seine Erfahrung mit Rückschlägen in Indien hinter sich. Für diese Organisation machen die Bedingungen, wie sie in Ländern der Peripherie existieren „die Existenz von kommunistischen Massenorganisationen möglich“ (Communist Revue Nr. 3), was für sie offenbar auch heisst, dass es dort leichter sei, kleine kommunistische Gruppen zu bilden, als in den zentralen Ländern des Kapitalismus. Das IBRP leidet aber darunter, dass seine These nicht bestätigt wird durch Gruppen, die seine Plattform annehmen würden. Dieses Leiden war zu jener Zeit besonders gross, da gerade die IKS, deren Analyse als „eurozentristisch“ bezeichnet wurde, eine Sektion in einem dieser Länder der Peripherie hatte, in Venezuela. Offenbar hatte der misslungene Flirt mit der SUCM die Verbitterung des IBRP noch verstärkt. Als das IBRP Diskussionen mit der Gruppe Lal Pataka in Indien aufnehmen konnte, dachte es das grosse Los gezogen zu haben. Doch Lal Pataka war, wie die SUCM, eine vom Maoismus kommende Gruppe, die nicht wirklich mit ihren Wurzeln brechen konnte, trotz Sympathiebekundungen gegenüber den Positionen der Kommunistischen Linken. Auf die Warnungen der IKS gegenüber dieser Gruppe (die genau genommen nur aus einer Person bestand) antwortete das IBRP: „Einige zynische Geister [es handelt sich dabei um die Geister der IKS] denken, dass wir diesen Genossen allzu schnell in das IBRP aufgenommen hätten.“ Während einer gewissen Zeit trat Lal Pataka als der Vertreter des IBRP in Indien auf. Doch 1991 verschwand dieser Name aus der Presse des IBRP und wurde durch Kamunist Kranti ersetzt. Das IBRP setzte viel auf diese „von der IKS Enttäuschten“: Wir hoffen das in der Zukunft ein produktives Verhältnis zwischen dem IBRP und Kamunist Kranti aufgebaut werden kann“. Doch diese Hoffnungen schwanden bald, und man konnte zwei Jahre später in Communist Review Nr. 11 lesen: „Es ist eine Tragödie, dass trotz viel versprechenden Elementen in Indien kein solider Kern von Kommunisten mehr besteht.“ Seither ist Kamunist Kranti vom Erdboden verschwunden. Es existiert aber sehr wohl ein kleiner kommunistischer Kern in Indien der die Zeitschrift Communist Internationalist herausgibt, doch er ist Teil der IKS, und das IBRP „vergisst“, auch nur einmal darauf hinzuweisen.
Mexikanische Enttäuschungen
Zu derselben Zeit, als sich einige Elemente in Indien den Positionen der Kommunistischen Linken annäherten, hatte die IKS eine Diskussion mit einer kleinen Gruppe in Mexiko aufgenommen, dem „Colectivo Comunista Alptraum“ (CCA), das 1986 die Zeitschrift Comunismo herauszugeben begann11. Wenig später bildete sich der „Grupo Proletario Internacionalista“ (GPI), welche Gruppe ab Beginn des Jahres 1987 die Zeitschrift Revolución Mundial herausgab und mit der sich ebenfalls Diskussionen entwickelten12. Von diesem Moment an entfernte sich das CCA von der IKS: Einerseits entwickelte es eine zunehmend akademistische Haltung in seinen politischen Positionen, und andererseits näherte es sich dem IBRP an. Auf jeden Fall ist diesem kleinen Kern das gute Verhältnis zwischen der IKS und dem GPI in den falschen Hals geraten.
Es kannte die Haltung der IKS, die darauf besteht, dass Gruppen der Kommunistischen Linken, die im selben Land existieren enge Verbindungen aufnehmen. Das CCA, das zehnmal weniger Mitglieder hatte als der GPI, befürchtete vermutlich eine Einschränkung seiner „Individualität“ durch die Kontaktaufnahme mit dieser Gruppe. Die Verbindungen zwischen dem IBRP und dem CCA bestanden noch eine Weile, doch als der GPI die Sektion der IKS in Mexiko wurde, verschwand das CCA.
Ein stürmischer „Amerikanischer Traum“
Mit dem „Los-Angeles-Workers’-Voice“-Abenteuer kommen wir nun fast zum Ende dieser langen Liste. Diese Gruppe formierte sich aus Leuten, die dem Maoismus der pro-albanischen Art entstammten. Wir hatten mit diesen Elementen über eine lange Zeit Diskussionen geführt, doch zeigte sich dabei ihre Unfähigkeit, all die Konfusionen zu überwinden, die sie aus der Vergangenheit in einer bürgerlichen Organisation geerbt hatten. Als sich diese kleine Gruppe Mitte der 90er Jahre dem IBRP annäherte, warnten wir dieses vor den Konfusionen der LAWV. Das IBRP verstand diese Warnung nicht und vermutete dahinter wohl die Absicht, seine politische Präsenz auf dem nordamerikanischen Kontinent verhindern zu wollen. Mehrere Jahre lang war die LAWV eine sympathisierende Gruppe des IBRP in den Vereinigten Staaten, und im April 2000 nahm sie an einer Konferenz in Montreal, Kanada, teil, die das Ziel hatte, die Präsenz des IBRP auf dem nordamerikanischen Kontinent zu verstärken. Doch nur kurze Zeit später begannen die Element von LAWV, eine Reihe von Kritiken zu formulieren, und zeigten eine zunehmend anarchistische Haltung (Zurückweisen der Zentralisierung, Bezeichnung der Bolschewiki als eine bürgerliche Partei, usw.). Vor allem aber begannen sie Lügen über das IBRP und im Besonderen über einen Sympathisanten dieser Organisation, AS, der in einem anderen Staat lebte, zu verbreiten. Unsere Presse in den USA prangerte die Verhaltensweisen der LAWV an und drückte unsere Solidarität mit den verleumdeten Genossen aus13. Wir betrachteten es auch als notwendig, an die Warnungen, welche wir zu Beginn der Idylle zwischen dem IBRP und den LAWV ausgesprochen hatten, zu erinnern.
Der andere Teilnehmer an der Konferenz im April 2000, Internationalist Notes, der sich heute als „sympathisierende Gruppe“ des IBRP bezeichnet, gehört ebenfalls zum Lager der „von der IKS Enttäuschten“. Die Diskussion zwischen der IKS und diesen Genossen aus Montreal begann Ende der 90er Jahre. Es handelte sich um einen kleinen Kern, dessen erfahrenstes Element, das wir hier W. nennen, eine lange Geschichte in den Gewerkschaften und in einer linken Organisation hinter sich hatte. Die Diskussionen waren gerade bei den verschiedenen Besuchen von IKS-Mitgliedern in Montreal immer sehr freundschaftlich, und wir gingen davon aus, dass diese Genossen genauso ehrlich sind wie wir. Es war uns immer bewusst, dass die langjährige Vergangenheit von W. in einer linken Organisation ein Hindernis für das vollständige Begreifen der Positionen und Methode der Kommunistischen Linken war. Aus diesem Grund forderten wir den Genossen W. mehrmals auf, eine Bilanz über seine politische Laufbahn zu verfassen, doch er hatte offensichtlich seine Schwierigkeiten damit, denn wir haben diese Bilanz trotz seinen Versprechungen nie erhalten.
Während die Diskussionen mit Internationalist Notes weiter gingen und ohne dass die Genossen uns jemals von einer eventuellen Annäherung an die Positionen des IBRP informierten, erfuhren wir durch eine Erklärung, dass Internationalist Notes eine sympathisierende Gruppe des IBRP in Kanada geworden sei. Die IKS hatte die Genossen in Montreal dazu aufgefordert, die Positionen des IBRP kennen zu lernen und mit dieser Organisation Kontakt aufzunehmen. Unsere Haltung war und ist es nie, „die Kontakte für uns zu behalten“. Ganz im Gegenteil ist es wichtig für Kontakte, die sich der IKS annähern, auch die Positionen der anderen Gruppen der Kommunistischen Linken gut zu kennen. Wenn sie sich uns anschliessen, so soll das in vollem Bewusstsein geschehen14. Wenn Leute, die sich der Kommunistischen Linken annähern, den Positionen des IBRP zustimmen, ist dies an sich kein Problem. Doch überraschte es uns, dass diese Annäherung gewissermassen „im Geheimen“ vor sich ging. Das IBRP hat offenbar nicht dasselbe Interesse wie die IKS daran, dass W. mit seiner linken Vergangenheit bricht. Wir sind davon überzeugt, dass genau darin der Grund für seine Annäherung an das IBRP lag, ohne uns darüber zu informieren.
Die Spezialität des IBRP: politische Fehlgeburten
Man müsste ja fast fasziniert sein vom sich wiederholenden Phänomen, dass Leute, die „von der IKS enttäuscht“ sind, schlussendlich beim IBRP landen. Man könnte fast meinen, es sei ein normaler Vorgang: Nachdem sie herausgefunden hatten, dass die Positionen der IKS falsch sind, wandten sich diese Elemente der Genauigkeit und Klarheit des IBRP zu. Dies haben sich die Genossen des IBPR vermutlich auch jedes Mal eingeredet. Das Problem ist aber folgendes: Von allen Gruppen, die eine solche Richtung eingeschlagen haben, ist heute nur noch eine in den Reihen der Kommunistischen Linken anzutreffen, nämlich genau diejenige, welche als letzte mit uns Kontakt hatte, Internationalist Notes. ALLE anderen Organisationen haben sich entweder aufgelöst oder sind in die Reihen bürgerlicher Organisationen zurückgekehrt wie die SUCM. Das IBRP sollte sich die Frage stellen weshalb, und es wäre interessant zu erfahren, welche Bilanz es der Arbeiterklasse über seine Erfahrungen liefern würde. Möglicherweise helfen die nachfolgenden Überlegungen seinen Genossen, eine solche Bilanz zu machen.
Was den eingeschlagenen Weg dieser Gruppen bestimmte, war offensichtlich nicht die Suche nach einer Klarheit, die sie bei der IKS nicht vorfanden, denn sie endeten in der Aufgabe des kommunistischen Engagements. Die Tatsachen haben klar gezeigt, dass ihre Distanznahme von der IKS jedes Mal Hand in Hand ging mit einer Entfernung von der programmatischen Klarheit und der Methode der Kommunistischen Linken sowie einer Zurückweisung der militanten Arbeit in ihren Reihen. In der Realität war ihr kurzer Flirt mit dem IBRP lediglich eine Etappe vor der Aufgabe des Kampfes in den Reihen der Arbeiterklasse. Es stellt sich also die Frage: Weshalb zieht das IBRP gerade jene an, welche sich in dieser Dynamik befinden?
Auf diese Frage gibt es eine klare Antwort: Weil das IBRP eine opportunistische Sichtweise der Umgruppierung der Revolutionäre hat.
Es ist der Opportunismus des IBRP, welcher es Elementen erlaubt, die sich weigern, einen vollständigen Bruch mit ihrer linken Vergangenheit zu machen, im Kielwasser dieser Organisation ein vorübergehendes „Refugium“ zu finden und damit glauben machen wollen (oder es sich gar selber einreden), ein Engagement in der Kommunistischen Linken zu haben. Das IBRP hat seit der 3. Internationalen Konferenz von Gruppen der Kommunistischen Linken wahrlich immer wieder auf einer „rigorosen Selektion“ im proletarischen Milieu bestanden. Doch in Wirklichkeit ist diese Selektion einseitig gegen die IKS gerichtet, welche nicht mehr „eine nennenswerte Kraft für die Bildung der zukünftigen Weltpartei des Proletariates ist“ und die „für uns [das IBRP] kein Gesprächspartner im Hinblick auf eine gemeinsamen Aktion ist“ („Antwort auf unseren Appell vom 11. Februar 2003 an die Gruppen der Kommunistischen Linken zu einer gemeinsamen Intervention gegen den Krieg“, publiziert in der Internationalen Revue Nr. 32). Daher steht für das IBRP jegliche Zusammenarbeit mit der IKS ausser Frage, sei es auch nur für eine gemeinsame Erklärung des internationalistischen Lagers gegen den imperialistischen Krieg15. Doch diese grosse Rigorosität ist sonst wo kaum vorhanden, vor allem nicht gegenüber Gruppen, die nichts mit der Kommunistischen Linken am Hut haben, oder eindeutig linke Gruppen sind. In der Internationalen Revue Nr. 26 hatten wir geschrieben:
„Um das ganze Ausmass des Opportunismus des IBRP bei seiner Verweigerung gegenüber dem Vorschlag der IKS, einen gemeinsamen Aufruf gegen den Krieg zu verfassen, zu erkennen, ist es aufschlussreich einen Artikel von Battaglia Comunista (BC), der im November 1995 mit der Überschrift „Irrtümer gegenüber dem Balkankrieg“ geschrieben wurde, zu zitieren. BC berichtete darin, dass es von der OCI (Organizazione Comunista Internationale / Che Fare) eine Einladung zu einer nationalen Versammlung in Mailand gegen den Krieg erhalten habe. BC meinte, dass „der Inhalt des Briefes interessant und wesentlich verbessert worden ist im Vergleich zu den Positionen der OCI gegenüber dem Golfkrieg, ihrer „Unterstützung für das vom Imperialismus angegriffene irakische Volk“ und ihrer sehr polemischen Haltung in der Diskussion über unsere angeblichen Indifferenz“. Der Artikel führt dann weiter aus: „Es fehlt der Bezug auf die Krise des Akkumulationszyklus (...) und die wesentliche Analyse ihrer Auswirkungen in der jugoslawischen Föderation. (...) Aber dies scheint kein Hindernis zu sein für eine mögliche gemeinsame Initiative derjenigen, die sich auf dem Klassenterrain gegen den Krieg stellen“. Vor gerade einmal vier Jahren wollte BC in einer Lage, die weniger ernst war als zur Zeit des Kosovokrieges, eine gemeinsame Initiative mit einer mittlerweile völlig konterrevolutionär gewordenen Gruppe ergreifen, um ihre aktivistischen Bestrebungen auszutoben, schreckte aber nicht davor zurück, Nein zur IKS zu sagen – unter dem Vorwand, dass unsere Positionen zu weit von ihren entfernt seien. Das nennt man Opportunismus.“
Diese einseitige Auswahlmethode des IBRP zeigte sich im Jahre 2003 erneut, als es den Vorschlag der IKS zu einer gemeinsamen Stellungnahme gegen den Irakkrieg ausschlug. Wir hatten in der Internationalen Revue Nr. 33 folgendes geschrieben: „Von einer Organisation, die sich in der Einschätzung der Meinungsverschiedenheiten mit der IKS derart kleinlich zeigt, könnte man eine ähnliche Haltung gegenüber allen anderen Gruppen erwarten. Dem ist ganz und gar nicht so. Wir beziehen uns hier auf die Haltung des IBRP, wie sie sich bei seiner Sympathisantengruppe, die sie im nordamerikanischen Raum vertritt, der Internationalist Workers` Group IWG (mit der Publikation Internationalist Notes), zeigt. Diese Gruppe ist zusammen mit Anarchisten aufgetreten und hat eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung mit Red and Black Notes und mit der Ontario Coalition Against Poverty (OCP), die eine typische linke, aktivistische Gruppe zu sein scheint, abgehalten.“ („Das politische proletarische Milieu angesichts des Krieges: Die Geissel des Sektierertums im internationalistischen Lager“)
Wie man sehen kann, zeigt sich der Opportunismus des IBRP in seiner Weigerung, sich klar von Gruppen zu distanzieren, die weit entfernt von der Kommunistischen Linken stehen, die keinen wirklichen Bruch mit den Linken (sprich mit dem bürgerlichen Lager) gemacht haben oder die ganz einfach Linke sind. Diese Haltung hat es schon gegenüber der SUCM oder Lal Pataka gezeigt. Mit einer solchen Methode ist es nicht verwunderlich, dass sich Leute, die nicht fähig sind, eine wirkliche Bilanz ihrer Erfahrungen bei den Linken zu machen, sich in der Gefolgschaft des IBRP wohler fühlen als mit der IKS.
Die Angehensweise der kanadischen Gruppe führt uns eine andere Variante des Opportunismus des IBRP vor Augen: Jeder Teil des IBRP besitzt „die Freiheit zur eigenen Politik“. Was für die europäischen Gruppen absolut nicht in Frage kommt, ist normal für eine amerikanische Gruppe (denn wir haben nicht eine einzige Kritik in Battaglia Comunista oder Revolutionary Perspectives entdeckt, welche die Haltung der kanadischen Genossen kritisiert). Das nennt man Föderalismus - ein Föderalismus, den das IBRP in seinem Programm verwirft, in seiner Praxis jedoch angenommen hat. Es ist dieser geleugnete, jedoch praktizierte Föderalismus, der gewisse Leute, die den Zentralismus der IKS allzu zwanghaft finden, zum IBRP hinzieht.
Wenn das IBRP Elemente rekrutiert, die durch die Überreste ihrer linken Vergangenheit geprägt sind, die Zentralisierung ablehnen und es vorziehen, in ihrer Ecke eine eigene Politik zu betreiben, so sind das die besten Bedingungen zur Vernichtung der Grundlagen einer Organisation, die international lebensfähig ist.
Ein anderer Aspekt des Opportunismus des IBRP ist seine ausgesprochene Nachsicht gegenüber Elementen, die feindlich gegen die IKS eingestellt sind. Wie zu Beginn des Artikels aufgezeigt, war eine der Grundlagen zur Formierung der CWO in England nicht nur der Wille, die eigene „Individualität“ aufrecht zu erhalten (Anfrage von RP zur Integration in die IKS als „Tendenz“ mit einer eigenen Plattform), sondern auch der Widerstand gegen die IKS (die eine Weile lang sogar als „konterrevolutionär“ bezeichnet wurde). Die Haltung der Elemente von Workers Voice innerhalb der CWO „RP als Schutzschild gegen die IKS zu gebrauchen“ findet man später bei vielen anderen Elementen und Gruppen wieder, deren Hauptmotivation die Feindschaft gegen die IKS ist. Dies war im Speziellen der Fall bei L., der sich in der ganzen Gruppe, aus der er stammte (und die viele Mitglieder hatte), immer am hysterischsten gegen unsere Organisation aufführte. Desgleichen E., den wir oben erwähnt haben und der eine enorme Feindschaft gegen die IKS zu entwickeln begann, bevor er die Positionen des IBRP übernahm. Der einzige Text von ihm, den unseres Wissens das IBRP veröffentlichte, war eine harte Attacke gegen die IKS.
Gar nicht zu sprechen von der CBG, mit der die CWO einen Flirt ohne Fortsetzung hatte und deren Verleumdungen (mit allem möglichen schmutzigen Geschwätz) gegen die IKS ihresgleichen sucht!
Doch vor allem in letzter Zeit findet die Öffnung gegenüber dem IBRP auf der Grundlage des Hasses gegen die IKS ihre extremsten Ausdrücke, wie die folgenden zwei Beispiele zeigen: die Annäherung an das IBRP durch die sogenannte „Interne Fraktion der IKS“ (IFIKS) und durch den Bürger B., Gründer, Chef und einziges Mitglied des „Circulo de Comunistas Internacionalistas“ in Argentinien.
Wir gehen hier nicht in die Details bezüglich der Verhaltensweisen der IFIKS, die ihren beseelten Hass gegen unsere Organisation enthüllen16. Wir führen hier in geraffter Form einige ihrer Arbeitsprinzipien auf:
- verabscheuenswürdige Verleumdungen gegen die IKS und einige unserer Genossen (die unter der Hand verbreitet wurden und den Verdacht schürten, dass ein Genosse für die Polizei arbeite und ein anderer die Politik Stalins der „Eliminierung“ der Gründungsmitglieder der Organisation verfolge);
- Diebstahl von Geld und politischem Material der IKS (wie z.B. die Adressliste unserer Abonnenten der französischen Presse);
- Denunzierungen, die den Überwachungsorganen des bürgerlichen Staates die Möglichkeit gaben, die Konferenz unserer Sektion in Mexiko vom Dezember 2002 zu überwachen und die Identität eines unserer Genossen zu erfahren (welcher von der IFIKS als der „Chef“ der IKS dargestellt wurde).
Im Falle des Bürgers B. drückte sich dies durch die Veröffentlichung von mehreren erbärmlichen Communiques über die angeblich „ekelerregenden Methoden der IKS“ aus, welche vergleichbar seien mit den Methoden des Stalinismus und auf einem Lügengebilde aufbauen würden.
Diese unberechenbare Person konnte eine solche Arroganz lediglich deshalb an den Tag legen, weil ihr das IBRP, dem sie durch das Abfassen von Texten, die den Positionen dieser Organisation ähnelten, schmeichelte (vor allem was die Rolle des Proletariates in den peripheren Ländern betrifft), eine ganze Weile lang Glaubwürdigkeit schenkte. Das IBRP hat nicht nur Stellungnahmen und „Analysen“ dieses Elements übersetzt und auf seiner Internetseite publiziert, es hat nicht nur die Gründung des „Circulo“ als „einen wichtigen und bestimmten Schritt heute in Argentinien vorwärts in der Zusammenführung der Kräfte, hin zur internationalen Partei des Proletariates“ begrüsst („Auch in Argentinien tut sich etwas“, Battaglia Comunista, Oktober 2004), es hat sogar in drei Sprachen sein Communique vom 12. Oktober 2004 auf seine Internetseite gestellt, welches eine Anhäufung von widerwärtigen Lügen über die IKS ist.
Die Liebschaft des IBRP mit diesem exotischen Abenteurer hat sich erst abgekühlt, als wir unwiderlegbar aufzeigten, dass diese Anschuldigungen gegen die IKS reine Lügen waren und dass dieser „Circulo“ lediglich ein Bluff war17. Das IBRP hat danach auf sehr diskrete Art und Weise begonnen, die kompromittierendsten Texte dieser Person von seiner Internetseite zurückzuziehen, ohne jedoch dessen Methoden zu verurteilen, auch nicht nachdem wir einen Offenen Brief (7. Dezember 2004) an die Genossen des IBRP geschrieben hatten, in dem wir eine Stellungnahme forderten. Die einzige Reaktion, die wir von dieser Organisation erhalten haben, ist ein Communique auf seiner Internetseite mit dem Titel „Letzte Antworten auf die Anschuldigungen der IKS“, das behauptet, das IBRP sei „Objekt von gewalttätigen und vulgären Attacken der IKS, weil diese wegen einer tiefen und unlösbaren internen Krise in Rage sei“ und dass sie „von nun an nicht mehr antworten werden und den vulgären Attacken keine Beachtung mehr schenken“.
Seine Liebe zum „Circulo“ ist mittlerweile im rauen Wind der Realität erkaltet. Seit die IKS den Bluff des Bürgers B. entlarvt hat, kann man auch auf seiner Internet-Seite, die während eines Monats seine fieberhafte Aktivität zeigte, nur noch eine hoffnungslose Nulllinie feststellen.
Was die IFIKS betrifft, hat das IBRP dieselbe Haltung an den Tag gelegt. Statt die infamen Anschuldigungen dieses Grüppchens gegen die IKS mit Vorsicht zu geniessen, hat ihnen das IBRP Glauben geschenkt, indem es sich mehrmals mit der IFIKS traf. Die IKS hat nach dem ersten Treffen zwischen der IFIKS und dem IBRP im Frühling 2002 diese Organisation auch um ein Treffen angefragt, um ihre eigene Sicht der Dinge darstellen zu können. Dieses Ansinnen wurde jedoch abgelehnt mit dem Argument, für keine der beiden Seiten Stellung beziehen zu wollen. Dies war jedoch eine glatte Lüge, denn die von der IFIKS über die Diskussionen mit dem IBRP geschriebene Zusammenfassung (übrigens nie von diesem dementiert) hielt eine Zustimmung des IBRP bezüglich der Anschuldigungen gegen die IKS fest. Doch dies war nur ein Vorgeschmack der unverantwortlichen Haltung des IBRP. Es ist danach noch weiter gegangen, zunächst durch das keusche Verschliessen der Augen vor dem petzerischen Verhalten der IFIKS, das man eigentlich leicht durch den Besuch ihrer Internetseite erkennen kann: Die Ausrede des IBPR, keine Überprüfung dessen machen zu können, was die IKS zum Treiben der IFIKS sagt, war damit nicht mehr gültig. Das IBRP ist danach noch weiter gegangen, als es den Diebstahl von politischem Material der IKS durch Mitglieder der IFIKS absegnete, indem es die Einladung für die öffentliche Diskussionsveranstaltung des IBRP vom 2. Oktober 2004 in Paris an die Abonnenten von Révolution Internationale gestützt auf eine Adressliste schickte, die von einem Mitglied der IFIKS gestohlen worden war18. Das IBRP hat in derselben Art, wie es versuchte, den „Circulo“ in Argentinien durch die Veröffentlichung der Schweinereien des Bürgers B. auf seiner Internetseite in seinen Dunstkreis zu ziehen, nicht gezögert, mit einer Bande von ehrenamtlichen Denunzianten und Dieben zusammenzuspannen in der Absicht, seinen politischen Einfluss in Frankreich zu verstärken und in Mexiko einen Horchposten zu eröffnen (es verbirgt auch nicht seine Hoffnung, die Elemente der IFIKS für seine Reihen zu gewinnen).
Im Gegensatz zum „Circulo“ existiert die IFIKS noch und publiziert weiterhin ihre Bulletins, die zum grössten Teil Verleumdungen gegen die IKS enthalten. Das IBRP behauptet: „Die Verbindungen mit der IFIKS bestehen und werden andauern“. Wird es eventuell dann erfolgreich sein und die Mitglieder der IFIKS integrieren können, wenn diese müde sind zu behaupten, sie seien die „wahren Verteidiger der richtigen IKS“? Das IBRP geht offenbar seinen opportunistischen Weg bis zum Ende - einen opportunistischen Weg, der die Kommunistische Linke schon heute in grossen Misskredit bringt, auf die es sich nach wie vor beruft. Und wenn das IBRP tatsächlich die Elemente der IFIKS aufnimmt, so wird es sich nicht lange darüber freuen können: Aus seiner eigenen Geschichte sollte es gelernt haben, dass man mit Überresten, die man im Abfall der IKS gefunden hat, nicht viel anstellen kann.
Lügen, Komplizenschaft mit Denunzianten, Verleumdungen und Diebstahl, Verrat an der Ehrlichkeit und den strengen Organisationsprinzipien, welche die Ehre der Italienischen Kommunistischen Linken ausmachten: Genau dorthin führt der Opportunismus. Und das traurigste für das IBRP ist, dass ihm all dies in der Praxis nicht viel bringt. Es hat noch nicht eingesehen, wie eine opportunistische Methode (eine Methode welche die „schnellen Erfolge“ der langfristigen Perspektive vorzieht und auf den Prinzipen herumtrampelt) lediglich auf Sand baut. Das einzige Gebiet, auf dem das IBRP einen Erfolg zu verzeichnen hatte, sind die Fehlgeburten. Nach mehr als einem halben Jahrhundert Existenz ist damit seine Strömung auf eine kleine Sekte mit geringeren politischen Kräften beschränkt als zu deren Anfängen.
In einem nächsten Artikel werden wir auf die Grundlagen der opportunistischen Methode des IBRP zurückkommen, welche in die traurigen Verrenkungen der letzten Zeit führten.
Fabienne
1 Ein überstürztes Vorhaben, welches die anderen Genossen nicht teilten, da sie sich noch nicht zu einem solchen Schritt entscheiden konnten.
2 Siehe Nr. 13 von Workers’ Voice, auf die wir mit einem Artikel in International Review Nr. 2 antworteten, sowie unseren Artikel in World Revolution Nr. 3, „Sectarianism unlimited“.
3 Als die CWO gegründet wurde, bezeichneten wir dieses Ereignis als eine „unvollständige Umgruppierung“ (siehe World Revolution Nr. 5). Sehr schnell sollten die Ereignisse diese Analyse auch bestätigen: Im Protokoll einer Sitzung der CWO zum Austritt der Genossen von Liverpool steht geschrieben: „Es hat sich gezeigt, dass die alte WV die Politik des Zusammenschlusses nie akzeptiert hat, ausser um RP als Schutzschild gegen die IKS zu gebrauchen“ (zitiert aus: „Die CWO, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“, einem Text, der geschrieben wurde von Genossen, die im November 1977 mit der CWO gebrochen hatten, um der IKS beizutreten, publiziert in International Review Nr. 12, engl./franz./span. Ausgabe).
4 Hier ist eine Präzisierung notwendig: Bei der Lektüre der Presse des IBRP oder auch anderer erhält man oft den Eindruck, dass diese Konferenzen einzig und allein das Verdienst von BC gewesen seien, da auf dessen Aufruf von 1976 hin die Konferenz vom Mai 1977 in Mailand stattfand, die erste von insgesamt dreien. Dazu hatten wir uns schon in einem Brief vom 9. Juni 1980 an BC geäussert: „Wenn man sich auf die formellen Aspekte beschränkt, ja dann ist es der Aufruf vom April 1976 von BC, der den Ausgangspunkt bildete. Doch müssen wir euch daran erinnern, Genossen, dass euch schon im August 1968 der Vorschlag zur Abhaltung einer Konferenz von drei unserer Genossen, die euch in Mailand aufsuchten, überbracht wurde? Damals war unsere Organisation kaum mehr als embrionär (...) Unter diesen Umständen war es für uns schwierig, zu einer Konferenz unter verschiedenen Gruppen aufzurufen, die während oder nach dem Mai 68 entstanden waren. Wir dachten, eine Initiative sollte von einer gewichtigeren Gruppe ausgehen, die bekannt und organisiert ist, versehen mit einer regelmässigen und gelesenen Presse, wie das bei euch der Fall war. Aus diesem Grunde haben wir diesen Vorschlag gemacht und in einer Zeit, in der die Arbeiterklasse begann, das schreckliche Joch der Konterrevolution abzuschütteln, auf der Wichtigkeit von solchen Konferenzen bestanden. Doch ihr habt damals mit dem Argument, es gäbe nichts Neues auf diesem Planeten, der Mai 68 sei lediglich eine Studentenrevolte, diesen Vorschlag abgelehnt. Im darauffolgenden Sommer, als die Streikbewegung auf Italien übergriff (...), haben wir euch denselben Vorschlag wieder gemacht, und ihr habt uns dieselbe Antwort gegeben. (...) Als sich dann die Streikbewegung auf ganz Europa ausbreitete, haben wir euch anlässlich eures Kongresses von 1971 erneut denselben Vorschlag gemacht. Und wieder war eure Antwort dieselbe. Als wir darin „keinen Sinn mehr sahen“ haben wir schlussendlich im November 1972 die Initiative zu einer „internationalen Korrespondenz“ ergriffen, basierend auf der Notwendigkeit von Diskussionen unter den Revolutionären angesichts des Wiedererwachens der Arbeiterklasse. Sie wurde durch unsere Genossen von Internationalism ausgerufen, welche die Sektion der IKS in Amerika gründeten. Dieser Vorschlag war an rund zwanzig Gruppen gerichtet (so auch an euch), ausgewählt nach ähnliche Kriterien wie schon bei den vorherigen Aufrufen zu den Konferenzen, mit der Perspektive einer internationalen Konferenz. Ihr habt auf diese Initiative negativ reagiert mit denselben Argumenten, die ihr schon gegen die vorangegangenen Aufrufe ins Feld geführt hattet. (...) Muss man davon ausgehen, dass für diese Organisation (die PCInt) nur Initiativen einen Wert haben, welche aus ihrer eigenen Feder stammen? (...) Unsere Organisation hat immer auf die Abhaltung von internationalen Konferenzen der kommunistischen Gruppen hingearbeitet. Und man kann wahrlich sagen, dass die Initiative des „Partito Comunista Internazionalista“ von 1976 keinesfalls ein „erstes“, sondern eher ein verspätetes Erwachen war und vielmehr eine Antwort 8 Jahre nach unserem Vorschlag von 1968 und 4 Jahre nach demjenigen von 1972. (...) Dies hielt uns jedoch keinesfalls davon ab, darauf sofort positiv zu reagieren. Und man muss bemerken, um mit dieser Frage hier abzuschliessen, dass die Initiative von Battaglia nur Dank unserer Teilnahme nicht ins Wasser fiel, weil wir neben euch die einzigen wirklichen Teilnehmer auf der Konferenz von 1977 in Mailand waren.“ (in den französischen Protokollen der 3. Konferenz unter Gruppen der Kommunistischen Linken publizierter Brief der IKS, welche unter der Verantwortung der IKS herausgegeben wurden)
5 Die von BC angewandte Methode war genauso schlimm wie die parlamentarischen Manöver der Bourgeoisie:
- vor den Konferenzen war kein einziges Mal die Rede davon, ein zusätzliches Teilnahmekriterium über die Parteifrage einzuführen;
- die CWO wurde von BC in langen Gesprächen hinter den Kulissen zur Unterstützung dieses Vorschlages bearbeitet (anstatt offen die Argumente darzulegen, die sie nur für die CWO reservierte);
- einige Monate zuvor hatten wir an einer Sitzung des technischen Komitees zur Vorbereitung der Konferenzen BC gefragt, ob sie die Absicht hätte, die IKS von zukünftigen Konferenzen fern zu halten. Die Genossen antworteten klar und deutlich, es sei besser, mit allen Teilnehmern weiter zu machen, inklusive die IKS.
Nebenbei: Diese Abstimmung – 2 Stimmen für ein neues Teilnahme-Kriterium, 1 dagegen (die IKS) und 2 Enthaltungen – wurde erst nach der Abreise einer anderen Gruppe abgehalten, welche mit der IKS gegen die Einführung eines neuen Kriteriums war.
6 „Heute existiert das Fundament zum Beginn des Prozesses der Klärung über die wirklichen Aufgaben der Partei ... Auch wenn wir weniger Teilnehmer haben als auf der 2. und 3. Konferenz, beginnen wir heute auf einer klareren und seriöseren Basis.“ (Protokoll der Konferenz)
7 Dies zeigt klar, dass es nicht die Auffassung der IKS zur Parteifrage war welche BC und der CWO Schwierigkeiten bereitete, sondern weil wir eine seriöse und genaue Diskussion anstrebten. Und genau diese wollten diese zwei Organisationen nicht.
8 Die Bilanz der 4. Konferenz ist wahrlich surrealistisch: Einerseits wurde sie erst zwei Jahre nach diesem grossen historischen Ereignis veröffentlicht. Andererseits muss man feststellen, dass die Mehrheit der Kräfte, seriös „ausgewählt“ durch BC und die CWO, schon vorher oder kurz danach verschwunden waren. Überdies stellte sich heraus:
- dass das „technische Komitee“ (BC-CWO) unfähig war, ein Vorbereitungsbulletin herauszugeben, und darüber hinaus die Konferenz auf Englisch abgehalten wurde und die Referenztexte von BC nur auf Italienisch publiziert wurden;
- dass die Gruppen, welche die Konferenz organisierten, unfähig waren, auch nur die Hälfte der Interventionen zu übersetzen.
9 siehe vor allem: „Antwort auf die Antworten“ in International Review Nr. 36, engl./franz./span. Ausgabe
10 siehe International Review Nr. 35, engl./franz./span. Ausgabe
11 siehe International Review Nr. 44, engl./franz./span. Ausgabe: „Gruss an Comunismo“
12 siehe „Entfaltung des politischen Lebens und der Arbeiterkämpfe in Mexico“ in International Review Nr. 50, engl./franz./span. Ausgabe
13 siehe unseren Artikel „Verteidigung des revolutionären Milieus“, Internationalism Nr. 122, Sommer 2002
14 Aus diesem Grunde fordern wir sie auch auf, die Diskussionsveranstaltungen dieser Gruppen zu besuchen, besonders diejenigen des IBRP. So hatten wir es auch bei der Diskussionsveranstaltung des IBRP vom 2. Oktober 2004 in Paris gemacht. Wir mussten jedoch feststellen, dass das IBRP die „massive“ Präsenz unserer Sympathisanten nicht sehr schätzte, wie aus ihrer Stellungnahme zu dieser Veranstaltung zu entnehmen war.
15 Siehe dazu unseren Artikel: „Das politische proletarische Milieu angesichts des Krieges: Die Geisel des Sektierertums im internationalistischen Lager“, Internationale Revue Nr. 33
16 Siehe dazu unsere Artikel: „Der Kampf zur Verteidigung der Organisations-Prinzipien“ und „Der 15. Kongress der IKS: Die Organisation angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen verstärken“ in International Review Nr. 110 und 114, engl./ franz./span. Ausgabe
17 Siehe auf dem Internet die verschiedenen Stellungnahmen der IKS zum „Circulo“: „Eine fremdartige Erscheinung“; „Eine erneute fremdartige Erscheinung“; „Bluff oder Realität?“ und ebenfalls in unserer Presse: „Circulo de Comunistas Internacionalistas (Argentinien): Ein demaskierter Bluff“.
18 Siehe dazu unsere Antwort an das IBRP: „Diebstahl und Verleumdungen sind keine Methoden der Arbeiterklasse!“ auf unserer Internetseite.
Politische Strömungen und Verweise:
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue - 2006
- 3650 Aufrufe
Internationale Revue 37
- 3261 Aufrufe
30 Jahre IKS: Von der Vergangenheit lernen, um die Zukunft zu bauen
- 7904 Aufrufe
Die IKS hielt im dreißigsten Jahr ihrer Existenz ihren 16. Kongress ab. In diesem Artikel beabsichtigen wir deshalb, eine Bilanz der Erfahrung unserer Organisation aufzuzeichnen, so wie wir es am 10. und 20. Jahrestag der IKS auch taten. Dies ist kein Zeichen von Narzissmus: Kommunistische Organisationen existieren nicht für sich; sie sind Instrumente der Arbeiterklasse, der ihre Erfahrungen gehören. Dieser Artikel hat deshalb zum Ziel, das Mandat unserer Organisation für ihre 30jährige Existenz sozusagen an die Klasse zurückzugeben. Und wie jedes Mal, wenn man ein Mandat zurückgibt, müssen wir auch diesmal bestimmen, ob unsere Organisation in der Lage gewesen war, ihrer Verantwortung gerecht zu werden, die sie übernahm, als sie gegründet wurde. Wir beginnen daher mit der Frage, worin die Verantwortung der Revolutionäre in der Situation 30 Jahre zuvor bestand und wie sie sich seitdem mit der Änderung der Situation selbst gewandelt hat.
Die Verantwortung der Revolutionäre
In den ersten Jahren der IKS war ihre Verantwortung durch das Ende der tiefen Konterrevolution bestimmt, die das Weltproletariat nach der Niederlage der revolutionären Welle von 1917-23 zerschmettert hatte. Der riesige Streik in Frankreich Mai 1968, der "heiße Herbst" von 1969 in Italien, die Streiks in der polnischen Ostseeregion während des Winters 1970-71 und viele andere Bewegungen hatten gezeigt, dass das Proletariat nach mehr als vier Jahrzehnten der Niederlage wieder aufgetaucht war. Diese historische Regeneration des Proletariats drückte sich nicht nur in einem Wiederaufleben der Kämpfe der Arbeiter und in der Fähigkeit dieser Kämpfe aus, die Zwangsjacke zu sprengen, in der die Linke und vor allem die Gewerkschaften sie auf Jahrzehnte gesteckt hatten (dies war besonders in den wilden Streiks während des "heißen Herbsts" 1969 in Italien der Fall). Eines der bedeutsamsten Anzeichen für das Wiederauftauchen der Arbeiterklasse aus der Konterrevolution war das Erscheinen einer ganzen Generation von Individuen und kleinen Gruppen auf der Suche nach den wirklich revolutionären Positionen des Proletariats, die auf diese Weise das Monopol der stalinistischen Parteien mit ihren trotzkistischen und maoistischen Anhängseln auf die Idee der kommunistischen Revolution in Frage stellten. Auch die IKS war eine Frucht dieses Prozesses, da sie durch die Umgruppierung mehrerer Gruppen gebildet wurde, welche in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Italien und Spanien erschienen waren und die sich in Richtung jener Positionen zubewegten, die von der Gruppe Internacionalismo in Venezuela seit 1964 vertreten wurde. Diese Gruppe stand unter dem Einfluss eines alten Militanten der Kommunistischen Linken, MC, der seit 1952 dort lebte.
Während dieser Anfangszeit wurden die Tätigkeiten der IKS durch drei fundamentale Verantwortungen bestimmt:
- vollständig die Positionen, die Analysen und die Lehren der kommunistischen Organisationen der Vergangenheit in sich aufzunehmen, nachdem diese in Folge der Konterrevolution entweder verschwunden oder völlig verknöchert waren;
- in die internationale Welle von Kämpfen der Arbeiter zu intervenieren, die im Mai 1968 in Frankreich begonnen hatten;
- die Umgruppierung von neuen kommunistischen Kräften, bei der die IKS ein erster Schritt war, fortzusetzen.
Der Zusammenbruch des Ostblocks und der stalinistischen Regimes in Europa im Jahr 1989 schuf eine neue Lage für die Arbeiterklasse, die nunmehr dem vollen Wind all der Kampagnen über den "Triumph der Demokratie", den "Tod des Kommunismus", das "Verschwinden des Arbeiterkampfs" oder sogar der Arbeiterklasse selbst ausgesetzt war. Diese Situation war für eine tiefe Flaute sowohl im Kampfgeist als auch im Bewusstsein des Proletariats verantwortlich.
Die 30jährige Existenz der IKS teilt sich somit in zwei sehr unterschiedliche Perioden von je 15 Jahren auf. In der ersten Periode war es notwendig, an den Fortschritten der Arbeiterklasse in der Entwicklung ihrer Kämpfe und ihres Bewusstseins teilzunehmen, insbesondere durch eine aktive Intervention in diese Kämpfe. In der zweiten Periode sollte es eine der wesentlichen Aufgaben unserer Organisation sein, standhaft zu bleiben angesichts der Welle der Auflösung, die die Arbeiterklasse überschwemmte. Sie war eine Prüfung für die IKS wie für alle anderen kommunistischen Organisationen, da sie nicht immun gegenüber der allgemeinen Atmosphäre sind, die in der Klasse insgesamt herrscht: Die Demoralisierung und der Mangel an Selbstvertrauen in der Klasse wirkten sich auch auf unsere eigenen Reihen aus. Und diese Gefahr war um so größer, als jene Generation, die die IKS gegründet hatte, nach 1968 und zu Beginn der siebziger Jahre in die Politik fand, das heißt im Kielwasser der großen Arbeiterkämpfe, die die Illusion weckten, dass die kommunistische Revolution vor der Tür stünde.
Wenn wir eine Bilanz der 30-jährigen Existenz der IKS ziehen wollen, müssen wir daher prüfen, ob die Organisation in der Lage war, sich mit diesen beiden Perioden im gesellschaftlichen Leben und im Kampf der Arbeiterklasse auseinanderzusetzen. Im Besonderen müssen wir uns anschauen, inwieweit sie in den Prüfungen, denen sie hat gegenübertreten müssen, ihre den historischen Umständen geschuldete Schwächen überwunden hat. Gleichzeitig müssen wir sehen, worin die Stärken der IKS bestehen, die es uns ermöglichen, diese 30 Jahre ihrer Existenz positiv zu beurteilen.
Eine positive Bilanz
Bevor wir fortfahren, sei direkt gesagt, dass die IKS eine sehr positive Bilanz aus diesen 30 Jahren ihrer Existenz ziehen kann. Es ist wahr, dass die Größe unserer Organisation und ihr Einfluss äußerst bescheiden sind. Wie wir schon in dem Artikel zum 20. Jahrestag der IKS sagten: "Der Vergleich zwischen der IKS und den anderen Organisationen in der Geschichte der Arbeiterbewegung, besonders den Internationalen, ist beunruhigend: Während Letztere Millionen, ja zig Millionen von Arbeitern einschlossen oder beeinflussten, ist die IKS überall in der Welt nureiner winzigen Minderheit der Arbeiterklasse bekannt" (Internationale Revue Nr. 16). Die Situation bleibt heute im Wesentlichen dieselbe und ist, wie wir es oft in unseren Artikeln gesagt haben, nur mit den besonderen Umständen zu erklären, unter denen die Arbeiterklasse sich ein weiteres Mal aufgemacht hat auf dem Weg zur Revolution:
- das langsame Tempo des ökonomischen Zusammenbruchs des Kapitalismus, dessen erste Ausdrücke Ende der 1960er Jahre als Initialzündung für das historische Wiederaufleben des Proletariats dienten;
- die Länge und das Ausmaß der Konterrevolution, die die Arbeiterklasse Ende der 1920er Jahre niedergeschmettert hatte und die neuen Generationen von Proletariern von den Erfahrungen früherer Generationen abschnitt, welche die großen Kämpfe des frühen 20. Jahrhunderts angeführt und vor allem die revolutionäre Welle von 1917-23 in Gang gesetzt hatten;
- das extreme Misstrauen jener Arbeiter, die die Gewerkschaften und so genannten „sozialistischen“ oder „kommunistischen“ „Arbeiter“parteien ablehnten, gegenüber jeglicher Art von politischen Organisationen des Proletariats;
- das noch größere Gewicht des Mangels an Selbstvertrauen und der Demoralisierung in Folge des Zusammenbruchs der so genannten "kommunistischen Regimes".
Nachdem dies gesagt ist, sollten wir auch darauf hinweisen, wie weit wir gekommen sind: 1968 war unsere politische Tendenz nichts als ein kleiner Kern in Venezuela und eine winzige Gruppe in einer provinziellen französischen Stadt, die gerade mal dazu fähig war, eine vervielfältigte Zeitschrift zwei oder dreimal im Jahr herauszugeben; heute ist unsere Organisation eine Art Bezugspunkt für all jene geworden, die zu revolutionären Positionen gelangen:
- eine territoriale Presse in zwölf Ländern und sieben Sprachen (englisch, spanisch, deutsch, französisch, italienisch, holländisch und schwedisch);
- mehr als hundert Broschüren und andere Dokumente, die in diesen Sprachen, aber auch auf Russisch Portugiesisch, Bengalisch, Hindi, Farsi und Koreanisch veröffentlicht wurden;
- mehr als 420 Ausgaben unserer theoretischen Publikation, alle drei Monate die Internationale Revue auf Englisch, Spanisch, Französisch und, wenn auch in größeren Abständen, auf Deutsch, Italienisch, Holländisch und Schwedisch.
Seit ihrer Gründung hat die IKS im Durchschnitt alle fünf Tage eine Publikation herausgegeben; heute geben wir ungefähr alle vier Tage eine heraus. Zu all dem kommt nun auch unsere Website "www.internationalism.org" [138] in dreizehn Sprachen hinzu. Auf dieser Webseite werden die gedruckten Artikel der territorialen Presse und der Internationalen Revue, unsere Broschüren und Flugblätter veröffentlicht, aber sie schließt auch die Internet-Publikation IKSonline ein, die es uns ermöglicht, schnell zu den wichtigsten Ereignissen Stellung zu beziehen.
Neben unseren Publikationen sollten wir auch die Tausenden von öffentlichen Diskussionsveranstaltungen erwähnen, die wir seit der Gründung unserer Organisation in fünfzehn Ländern abgehalten haben und zu denen Sympathisanten und Kontakte kommen können, um über unsere Positionen und Analysen zu diskutieren. Auch sollten wir unsere mündlichen Interventionen, den Verkauf unserer Presse, die Verteilung von immer zahlreicheren Flugblättern auf öffentlichen Veranstaltungen, Foren und Versammlungen anderer Organisationen, auf Straßendemonstrationen, vor Betrieben und auf Märkten und Bahnhöfen nicht vergessen - und natürlich nicht unsere Interventionen in den Arbeiterkämpfen.
Um es noch einmal zu sagen: All dies ist wenig genug, wenn wir es zum Beispiel mit den Aktivitäten der Sektionen der Kommunistischen Internationale in den 1920er Jahren vergleichen, als revolutionäre Positionen in einer Tagespresse ihren Ausdruck fanden. Doch wie wir gesehen haben, kann man nur vergleichen, was vergleichbar ist. Das wahre Maß des "Erfolgs" der IKS kann am Unterschied zwischen der IKS und den anderen Organisationen der Kommunistischen Linken abgelesen werden, die 1968 bereits existierten, als die IKS nicht mehr als ein Embryo war.
Die Gruppen der Kommunistischen Linken seit 1968
1968 existierten mehrere Organisationen, die sich als Nachkommen der Kommunistischen Linken betrachteten. Auf der einen Hand gab es jene Gruppen, die zur Tradition des holländischen Linkskommunismus gehörten, im Wesentlichen die „Rätisten“, in Holland verkörpert vom Spartacusbond und von Daad en Gedachte, in Frankreich von der Groupe de Liaison pour l’Action des Travailleurs (Glat) und von Informations et Correspondances ouvrières (ICO) sowie in Großbritannien von Solidarity, deren Ursprünge sich vor allem aus den Erfahrungen der Gruppe Socialisme ou Barbarie speisten, die einer Abspaltung der trotzkistischen IV. Internationale unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entsprang und 1964 wieder verschwand.
Neben der rätistischen Strömung existierte eine andere Gruppe in Frankreich, die ebenfalls von Socialisme ou Barbarie abstammte, nämlich Pouvoir Ouvrier, sowie eine kleine Gruppe um Grandizo Munis (ehemaliger Führer der spanischen Sektion der IV. Internationale), die Ferment Ouvrier Révolutionnaire (FOR, auf Spanisch Fomento Obrero Revolucionario) welche Alarme (Alarma auf Spanisch) herausgab.
römung der Linkskommunisten von 1968 hatte ihre Wurzeln in der Italienischen Linken und umfasste zwei Zweige, die 1952 aus der Spaltung der 1945 nach dem Krieg in Italien gegründeten Partito Comunista Internazionalista hervorgegangen waren. Einerseits die „bordigistische" Internationale Kommunistische Partei, die in Italien Programma Comunista und in Frankreich Le Prolétaire und Programme Communiste herausgab; andererseits die Mehrheit zur Zeit der Spaltung, die Battaglia Comunista und Prometeo herausgab.
Für eine Weile stießen einige dieser Gruppen auf ein großes Echo. "Rätistische" Gruppen wie die ICO erlebten einen Zulauf einer ganzen Reihe von Militanten, die von den Ereignissen im Mai 1968 politisiert worden waren. 1969 und 1970 gelang es ihr, mehrere Zusammenkünfte auf regionaler, nationaler und sogar internationaler Ebene (Brüssel 1969) zu organisieren, die eine beträchtliche Anzahl von Personen und Gruppen zusammenbrachten (einschließlich uns). Doch Anfang der 1970er Jahre verschwand die ICO. Diese Tendenz erschien wieder 1975 mit dem vierteljährlichen Bulletin Echanges et Mouvements, an dem sich Personen aus mehreren Ländern beteiligten, das jedoch nur auf Französisch herausgegeben wurde. Was die anderen Gruppen angeht, so hörten sie entweder auf zu existieren – wie im Falle der GLAT in den Siebzigern, der Gruppe Solidarity 1988 oder des Spartacusbond, der seine Hauptfigur Stan Poppe (der 1991 starb) nicht überlebte - oder stellten ihre Publikationen ein, wie Daad en Gedachte Ende der 90er Jahre.
Auch die anderen Gruppen, die wir oben erwähnt haben, sind verschwunden, wie Pouvoir Ouvrier in den 70er und die FOR in den 90er Jahren.
Bezüglich der Gruppen, die von der Italienischen Linken stammen, kann man kaum sagen, dass es ihnen besser ergangen ist. Seit Bordigas Tod 1970 hat die "bordigistische" Bewegung mehrere Spaltungen erlebt, einschließlich jener, die zur Schaffung einer neuen "Internationalen Kommunistischen Partei" führte, die Il Partito Comunista herausgab. Ende der 70er expandierte die Mehrheitstendenz, die Il Programma Comunista herausgab, rasch in mehreren Ländern und war eine Zeitlang Hauptorganisation linkskommunistischer Herkunft. Aber dieser Fortschritt war größtenteils nur möglich durch eine Öffnung zum Linksextremismus und zur Drittweltbewegung. 1982 brach die Internationale Kommunistische Partei auseinander. Die ganze Organisation klappte wie ein Kartenhaus zusammen, und ihre Mitglieder zerstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Die französische Sektion verschwand für mehrere Jahre, während in Italien nur einige Militante dem „orthodoxen" Bordigismus treu blieben und nach einer Weile wieder mit zwei Veröffentlichungen auf sich aufmerksam machten: I1 Programma Comunista und I1 Comunista. Während die bordigistische Strömung noch eine gewisse Kapazität besitzt, drei mehr oder weniger regelmäßige Monatszeitungen auf Italienisch herauszugeben, ist sie international kaum existent. Die Richtung um Il Comunista wird in Frankreich von Le Prolétaire repräsentiert, die alle drei Monate herauskommt. Die Richtung um Programma Comunista publiziert in Englisch jedes Jahr oder alle zwei Jahre die Zeitschrift Internationalist Papers und noch seltener die Zeitschrift Cahiers internationalistes. Die Richtung um I1 Partito comunista gibt eine italienische "Monatszeitschrift" heraus (die sieben Mal im Jahr erscheint) und bringt alle sechs Monate Comunismo sowie ein- oder zweimal im Jahr La Izquierda Comunista auf Spanisch bzw. Communist Left auf Englisch heraus.
Was die Strömung angeht, die von der Mehrheit der Spaltung von 1952 abstammt und welche sowohl die Presse als auch den Namen Partito Comunista Internazionalista (PCInt) behielt, so haben wir bereits in unserem Artikel "Eine opportunistische Politik der Umgruppierung führt nur zu ‚Fehlgeburten‘“ (Internationale Revue Nr. 36; dt. Ausgabe) ihr Missgeschick bei den Versuchen geschildert, sich international mehr Gehör zu verschaffen. 1984 tat sich die PCInt mit der Communist Workers Organisation (die Revolutionary Perspectives publiziert) zusammen, um das Internationale Büro für die kommunistische Partei (IBRP) zu gründen. Fünfzehn Jahre später, in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren, gelang es diesem Büro endlich, sich über seine ersten beiden Bestandteile hinaus auszubreiten und einige kleine Kerne einzubeziehen, wovon Internationalist Notes der aktivste ist und ein- oder zweimal im Jahr eine Zeitschrift herausgibt, während Bilan et Perspectives in Frankreich weniger als einmal im Jahr etwas herausbringt. Der "Circulo de América Latina" (eine mit dem IBRP sympathisierende Gruppe) besitzt keine regelmäßig erscheinende Presse und gibt sich mit der Veröffentlichung von Stellungnahmen und der Übersetzung der IBRP-Website ins Spanische zufrieden. Das IBRP wurde vor 20 Jahren gebildet (und die Partito Comunista Internazionalista existiert schon 60 Jahre), und dennoch ist das IBRP heute trotz der Tatsache, dass es von all den Gruppen, die behaupten, von der PCInt von 1945 abzustammen, die international am meisten entwickelte ist0JahreIKS#_edn1">[i], kleiner noch als die IKS in ihren Gründungstagen.
Die IKS allein produziert jedes Jahr mehr regelmäßige Publikationen in mehr Sprachen als all die anderen Organisationen zusammengenommen. Insbesondere hat keine der anderen Organisationen eine regelmäßige Zeitschrift in deutscher Sprache, was eindeutig eine Schwäche ist angesichts der Wichtigkeit des deutschen Proletariats sowohl in der Geschichte als auch in der Zukunft der Arbeiterbewegung.
Wir ziehen diesen Vergleich zwischen dem Umfang unserer Organisation und dem der anderen Gruppen nicht aus Konkurrenzdenken. Im Gegenteil zu dem, was manche dieser Gruppen behauptet haben, haben wir nie versucht, auf Kosten Anderer zu expandieren. Nichts liegt uns ferner. Wenn wir mit unseren Kontakten diskutieren, machen wir sie stets auf die Existenz der anderen Gruppen aufmerksam und ermutigen sie, sich mit den Positionen Letzterer vertraut zu machen0JahreIKS#_edn2">[ii]. Auch haben wir die anderen Organisationen stets zu unseren öffentlichen Veranstaltungen eingeladen, damit sie dort sowohl das Wort ergreifen als auch ihre eigene Presse vorstellen (wir haben sogar vorgeschlagen, ihre Militanten in Städten oder Ländern, in denen sie selbst nicht präsent sind, zu beherbergen0JahreIKS#_edn3">[iii]). Wir haben, wenn sich die Gelegenheit bot, auch die Presseerzeugnisse anderer Gruppen in die Buchläden gestellt, wenn diese damit einverstanden waren. Schließlich ist es nie unsere Politik gewesen, nach jenen Militanten dieser Organisationen zu „angeln“, die Meinungsverschiedenheiten mit der Politik oder den Positionen Letzterer entwickelt haben. Wir haben sie stets ermutigt, in ihren Organisationen zu bleiben, um dort zu debattieren und zu klären0JahreIKS#_edn4">[iv].
Tatsächlich erkennen wir – im Unterschied zu den anderen, von uns erwähnten Gruppen, von denen eine jede denkt, die einzige zu sein, die in der Lage ist, die künftige Partei der kommunistischen Revolution zu bilden – an, dass es ein linkskommunistisches Lager gibt, das proletarische Positionen innerhalb der Arbeiterklasse vertritt, und dass alle Gruppen darin nur gewinnen können, wenn sich dieses Lager als Ganzes weiterentwickelt. Freilich kritisieren wir Positionen, von denen wir glauben, dass sie falsch sind, wann immer wir denken, dass dies angebracht ist. Doch diese Polemiken sind Teil der notwendigen Debatte innerhalb des Proletariats, und wir glauben mit Marx und Engels, dass zusammen mit seiner Erfahrung nur die Diskussion und Konfrontation von Positionen ermöglichen, dass sich sein Bewusstsein vorwärts bewegt0JahreIKS#_edn5">[v].
In der Tat bezweckt dieser Vergleich der IKS-Bilanz mit jener der anderen Organisationen der Kommunistischen Linken vor allem zu beleuchten, wie schwach der Einfluss revolutionärer Positionen innerhalb der Klasse ist, was auf die historischen Bedingungen und die Hindernisse zurückzuführen ist, auf die sie auf ihrem Weg zum Bewusstsein stößt. Dies gestattet uns zu verstehen, dass der geringe Einfluss der IKS heute keineswegs eine Demonstration des Scheiterns ihrer Politik oder ihrer Orientierungen ist: Entsprechend der gegenwärtigen Bedingungen kann das, was wir während der letzten dreißig Jahre geleistet haben, als sehr positiv betrachtet werden; es unterstreicht die Gültigkeit unserer Orientierungen in dieser Periode. Wir sollten daher noch genauer untersuchen, wie und warum diese Orientierungen es uns erlaubt haben, die unterschiedlichen Situationen zu meistern, denen wir uns gegenübersahen, seitdem unsere Organisation gegründet worden war. Und um zu beginnen, brauchen wir nur in Erinnerung rufen (wie wir es bereits in den Artikeln getan haben, die anlässlich des 10. und 20. Geburtstages veröffentlicht wurden), worin die fundamentalen Prinzipien bestehen, auf denen die IKS ruht.
Die fundamentalen Prinzipien für den Aufbau der Organisation
Die erste Sache, die wir nachdrücklich betonen sollten, ist, dass diese Prinzipien keine Erfindung der IKS sind. Sie sind von der gesamten Arbeiterbewegung über lange Zeit hinweg ausgearbeitet worden. So ist es alles andere als platonisch, wenn in den „Grundsatzpositionen“, die auf der letzten Seite aller unserer Publikationen abgedruckt sind, festgestellt wird: „Die Positionen der revolutionären Organisationen und ihre Aktivitäten sind das Ergebnis der vorherigen Erfahrungen der Arbeiterklasse und der Lehren, die diese politischen Organisationen aus der Geschichte gezogen haben. So beruft sich die IKS auf die Errungenschaften, die nacheinander erbracht wurden vom Bund der Kommunisten (1847-52) um Marx und Engels, den drei Internationalen (Internationale Arbeiterassoziation 1864-72, Sozialistische Internationale 1889-1914, Kommunistische Internationale 1919-28), den linkskommunistischen Fraktionen, die in den 20er und 30er Jahren aus der Dritten Internationale hervorgegangen waren, insbesondere der Deutschen, Holländischen und Italienischen Linken.“
Während wir unser Erbe aus all den verschiedenen Fraktionen der Kommunistischen Linken beziehen, berufen wir uns, was die Frage des Organisationsaufbaus betrifft, ausdrücklich auf die Gedanken der linken Fraktionen der Kommunistischen Partei Italiens, insbesondere auf jene, die in der Zeitschrift Bilan in den 30er Jahren ausgedrückt worden waren. Die große Klarheit dieser Gruppe trug entscheidend zu ihrer Fähigkeit bei, nicht nur zu überleben, sondern auch das kommunistische Denken auf bemerkenswerte Weise weiterzuentwickeln.
Im Rahmen dieses Artikels können wir nicht dem ganzen Reichtum der Positionen der Italienischen Fraktion gerecht werden. Wir werden uns hier darauf beschränken, einige wesentliche Aspekte zusammenzufassen.
Der erste Punkt, den wir von der italienischen Fraktion übernommen haben, ist ihre Stellung zum Verlauf der Geschichte. Jede der wesentlichen Klassen in der Gesellschaft, die Bourgeoisie und das Proletariat, hat ihre eigene Antwort auf die tödliche Krise der kapitalistischen Ökonomie: Die Antwort Ersterer ist der imperialistische Krieg, die Antwort Letzterer die Weltrevolution. Welche von beiden letztendlich die Oberhand behält, hängt vom Gleichgewicht der Kräfte zwischen beiden Klassen ab. Die Bourgeoisie war nur deshalb in der Lage, den I. Weltkrieg auszulösen, weil sie das Proletariat zuvor politisch besiegt hatte, vor allem durch den Triumph des Opportunismus in den Hauptparteien der Zweiten Internationale. Jedoch führte die Barbarei, die jegliche Illusionen über die Fähigkeit des Kapitalismus wegspülte, der Gesellschaft Frieden und Wohlstand zu bringen und die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse zu verbessern, zu einem Wiedererwachen des Proletariats in Russland 1917 und in Deutschland 1918: Die Arbeiter erhoben sich gegen den Krieg und warfen sich in den Kampf, um den Kapitalismus zu stürzen. Die Niederlage der Revolution in Deutschland, also im wichtigsten Land, öffnete das Tor zum Triumph der Konterrevolution, die sich über die gesamte Welt, besonders aber in Europa mit dem Sieg des Stalinismus in Russland, des Faschismus in Deutschland und der „antifaschistischen“ Ideologie in den „demokratischen“ Ländern ausbreitete. In den 30er Jahren war es eines der Verdienste der Fraktion, verstanden zu haben, dass genau wegen der tiefen Niederlage der Arbeiterklasse die akute Krise des Kapitalismus, die 1929 begonnen hatte, nur zu einem neuen Weltkrieg führen konnte. Auf der Grundlage ihrer Analyse der Periode, die erkannte, dass der Lauf der Geschichte nicht zur Revolution und zur Radikalisierung der Arbeiterkämpfe führt, sondern zum Weltkrieg, war die Fraktion imstande zu begreifen, was in Spanien 1936 passierte, und den fatalen Fehler der Trotzkisten zu vermeiden, die fälschlicherweise diese Vorbereitung auf das zweite imperialistische Gemetzel für den Beginn der proletarischen Revolution hielten.
Die Fähigkeit der Fraktion, das reale Kräfteverhältnis zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat zu identifizieren, war mit einer klaren Konzeption über die Rolle von kommunistischen Organisationen in den verschiedenen Geschichtsperioden verknüpft. Auf der Grundlage der Erfahrung der verschiedenen linken Fraktionen, die zuvor in der Geschichte der Arbeiterbewegung existiert hatten, besonders der bolschewistischen Fraktion in der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands (SDAPR), aber auch von Marx und Engels nach 1847, definierte die Fraktion und ihre Publikation Bilan zwei unterschiedliche Formen der kommunistischen Organisation: die Partei und die Fraktion. Die Arbeiterklasse erzeugt in Perioden intensiver Kämpfe, wenn die von den Revolutionären vertretenen Positionen einen realen Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse ausüben, die Partei. Wenn sich jedoch das Kräfteverhältnis gegen das Proletariat wendet, verschwindet die Partei als solche oder neigt dazu, einem opportunistischen Kurs zu verfallen und zu degenerieren, was sie zum Verrat im Dienste der feindlichen Klasse führt. Es ist die Fraktion, die, kleiner sowohl in ihrer Größe als auch in ihrem Einfluss, dann die Verteidigung der revolutionären Positionen übernehmen muss. Die Rolle der Fraktion ist es, für die Korrektur der Parteilinie zu kämpfen, damit sie in der Lage ist, ihren Part zu spielen, wenn der Klassenkampf wiederbelebt wird. Sollten sich diese Bemühungen als vergebens erweisen, so ist es ihre Rolle, eine programmatische und organisatorische Brücke zu einer neuen Partei zu schaffen, die nur unter zwei Bedingungen gegründet werden kann:
- dass die Fraktion alle Lehren aus den vergangenen Erfahrungen und vor allem aus den vergangenen Niederlagen gezogen hat;
- dass sich das Kräfteverhältnis noch einmal zugunsten des Proletariats neigt.
Eine andere Lehre, die von der Italienischen Linken weitergereicht wurde und die sich ganz natürlich aus dem ergibt, was wir gerade gesagt haben, ist die Ablehnung des Immediatismus, mit anderen Worten: einer Herangehensweise, die den Blick für den langfristigen Charakter des Kampfes des Proletariats und der Intervention der revolutionären Organisationen in ihm verliert. Lenin pflegte zu sagen, dass Geduld eine der Haupttugenden der Bolschewiki war. Er tat nichts anderes, als den Kampf von Marx und Engels gegen die Geißel des Immediatismus fortzusetzen0JahreIKS#_edn6">[vi]. Weil die Arbeiterklasse permanent von der Ideologie des Kleinbürgertums, das heißt von einer gesellschaftlichen Schicht, die keine Zukunft besitzt, durchdrungen wird, ist der Immediatismus eine konstante Bedrohung der Arbeiterbewegung.
Die natürliche Konsequenz des Kampfes gegen den Immediatismus ist eine programmatische Rigorosität bei der Sammlung der revolutionären Kräfte. Anders als die trotzkistische Bewegung, die hastige Umgruppierungen vornehmlich auf der Grundlage einer Übereinkunft zwischen „Persönlichkeiten“ bevorzugte, bestand die Fraktion auf eine gründliche Diskussion über programmatische Grundsätze, bevor sie mit anderen Strömungen verschmolz.
Diese rigorose Grundsatztreue schloss keineswegs Diskussionen mit anderen Gruppen aus. Jene, die fest zu ihren Überzeugungen stehen, haben keine Furcht vor der Konfrontation mit anderen Strömungen. Das Sektierertum dagegen, das sich selbst als „allein in der Welt“ betrachtet und jeden Kontakt mit anderen proletarischen Gruppen ablehnt, ist im Allgemeinen das Kennzeichen eines Mangels an Überzeugung in der Gültigkeit der eigenen Positionen. Gerade weil sie auf dem festen Boden der Erfahrungen der Arbeiterbewegung stand, war die Fraktion imstande, diese Erfahrungen mit einer solchen Kühnheit zu kritisieren, selbst wenn dies bedeutete, Positionen in Frage zu stellen, die von den anderen Strömungen nahezu als ein Dogma betrachtet wurden0JahreIKS#_edn7">[vii]. Während die Deutsch-Holländische Linke auf die Degeneration der Revolution in Russland und auf die konterrevolutionäre Rolle, die die bolschewistische Partei seitdem spielte, reagierte, indem sie das Kind mit dem Bade ausschüttete und die Schlussfolgerung zog, dass sowohl die Oktoberrevolution als auch die Bolschewiki bürgerlich gewesen seien, bestand die Fraktion stets laut und deutlich auf den proletarischen Charakter beider. Indem sie erklärte, dass die Partei eine vitale Rolle beim Triumph der kommunistischen Revolution spielt, bekämpfte sie auch die „rätistische“ Position, in der die holländische Linke endete. Und anders als die Trotzkisten, die sich selbst vorbehaltlos auf die ersten vier Kongresse der Kommunistischen Internationale berufen, lehnte die Fraktion, wie auch die Kommunistische Partei Italiens zu Beginn der 20er Jahre, die unrichtigen Positionen ab, die von diesen Kongressen angenommen worden waren, besonders die Politik der „Einheitsfront“. Tatsächlich ging die Fraktion noch weiter, als sie die Position Lenins und des Zweiten Kongresses zur Unterstützung nationaler Befreiungskämpfe in Frage stellte und stattdessen die von Rosa Luxemburg vertretene Position übernahm.
All diese Lehren wurden angenommen und systematisiert von der Kommunistischen Linken Frankreichs (1945-52), und es war diese Grundlage, auf der die IKS gegründet wurde. Dies hat es ihr ermöglicht, die verschiedenen Feuerproben zu bestehen, besonders jene, die sich aus den Schwächen ergaben, die seit seinem historischen Wiedererwachen 1968 schwer auf dem Proletariat und seinen revolutionären Minderheiten lasteten.
Die Geschichte setzt die Prinzipien der Fraktion einem Test aus
Angesichts dieses Wiederauflebens der Arbeiterklasse war die erste Sache, die verstanden werden musste, die Frage des historischen Kurses. Dies wurde von den anderen Gruppen, die sich als die Erben der Italienischen Linken betrachteten, nur unzureichend begriffen. Die Tatsache, dass sie 1945, als sich die Klasse noch fest im Griff der Konterrevolution befunden hatte, eine Partei gegründet und sich seither einer Kritik an dieser voreiligen Gründung versagt hatten, beweist, dass diese Gruppen (die sich auch weiterhin „Partei“ nannten) außerstande waren, zwischen der Konterrevolution und dem Ende der Konterrevolution zu unterscheiden. Sie sahen im Frankreich des Mai 1968 oder im heißen Herbst in Italien 1969 nur Belangloses für die Arbeiterklasse und spielten diese Ereignisse als bloße Studentenagitation herunter. Dagegen begriffen unsere Genossen von Internacionalismo (insbesondere MC, ein alter Militanter der Fraktion und der GCF) im Bewusstsein der Veränderung des Kräfteverhältnisses die Notwendigkeit, einen Prozess der Diskussion und der Umgruppierung mit jenen Gruppen in Gang zu setzen, die in Folge des historischen Kurswechsels entstanden waren. Diese Genossen baten die PCInt wiederholt, die Diskussion zu eröffnen und zu einer internationalen Konferenz aufzurufen, war doch der Einfluss der PCInt viel größer als der unseres kleinen Kerns in Venezuela. Jedesmal lehnte die PCInt unseren Vorschlag mit der Begründung ab, es habe sich nichts Neues getan. Schließlich begann 1973 doch eine erste Runde von Konferenzen als Folge eines Appells, der von Internationalism formuliert worden war, einer Gruppe in den Vereinigten Staaten, die den Positionen von Internacionalismo und Révolution Internationale, die sich 1968 in Frankreich gebildet hatte, nahe stand. Es war größtenteils diesen Konferenzen zu verdanken, dass neben einer nachhaltigen Heranreifung einer ganzen Reihe von Gruppen und Elementen, die nach dem Mai 1968 zur Politik gelangten, im Januar 1975 die IKS gegründet wurde. Es ist selbstverständlich, dass die von der Fraktion übernommene Haltung, systematisch die Diskussion mit Individuen zu suchen, wenn sie bei aller Konfusion deutlich einen revolutionären Willen demonstrieren, ein entscheidendes Element bei diesem ersten Schritt war.
Auch wenn die jungen Militanten, die die IKS gegründet hatten oder ihr in den ersten Jahren beigetreten waren, sicherlich begeistert dabei waren, laborierten sie nichtsdestotrotz an einer gewissen Anzahl nicht unerheblicher Schwächen, so:
- am Einfluss der Studentenbewegung, die durchtränkt war von kleinbürgerlichem Gedankengut, besonders vom Individualismus und Immediatismus („Revolution jetzt!“ war eine der Studentenparolen von 1968);
- am Misstrauen gegenüber jeder Form von revolutionärer Organisation, die in der Klasse interveniert, in Folge der konterrevolutionären Rolle, die von den stalinistischen Parteien ausgeübt wurde; mit anderen Worten: das Gewicht des Rätismus.
Diese Schwächen betrafen nicht allein die Militanten, die sich in der IKS sammelten. Im Gegenteil, sie äußerten sich noch viel stärker unter den Gruppen und Elementen, die außerhalb unserer Organisation geblieben waren, welche zu einem großen Teil durch die Auseinandersetzungen mit ihnen geformt worden war. Diese Schwächen erklären den kurzlebigen Erfolg der rätistischen Strömung nach 1968. Kurzlebig daher, weil man, wenn man aus seiner eigenen Nutzlosigkeit für den Klassenkampf eine Theorie macht, wenig Überlebenschancen hat. Sie erklären ebenfalls zuerst den Erfolg und dann die Schlappe von Programma Comunista: Nach dem völligen Versagen, die Bedeutung dessen zu begreifen, was sich 1968 ereignete, verlor diese Strömung angesichts der internationalen Entwicklung von Arbeiterkämpfen den Kopf und ließ alle Vorsicht und organisatorische Strenge fahren, die sie einst für gewisse Zeit ausgezeichnet hatte. Ihr Sektierertum und ihr großmäuliger „Monolithismus“ mutierten zu einer Öffnung gegenüber allen Richtungen (außer gegenüber unserer Organisation, die weiterhin als „kleinbürgerlich“ betrachtet wurde), besonders gegenüber einer großen Anzahl von Elementen, die sich gerade unvollständig vom Linksextremismus und besonders von der Drittweltbewegung freigemacht hatten. Ihre desaströse Auflösung 1982 war die logische Quittung dafür, dass sie die Hauptlehren der Italienischen Linken vergessen hat, als deren Erbe sie sich ausgab.
Diese Schwächen traten auch bald in der IKS auf, trotz unserer Entschlossenheit, eine hastige Integration neuer Militanter zu vermeiden. 1991 erlitt unsere Organisation eine schwere Krise, die die Hälfte ihrer Sektion in Großbritannien wegspülte. Diese Krise wurde im Wesentlichen vom Immediatismus genährt, der eine ganze Reihe von Militanten dazu verleitete, das Potenzial des Klassenkampfes zu überschätzen (zu jener Zeit erlebte Großbritannien die massivsten Arbeiterkämpfe in der Geschichte: Mit 29 Millionen Streiktagen im Jahr nahm Großbritannien den zweiten Platz hinter Frankreich 1968 im Rahmen der Statistiken über die Arbeitermilitanz ein). Infolgedessen hielten sie die gewerkschaftlichen Basisorganisationen, die die Bourgeoisie produzierte, als die Gewerkschaften ihren Halt verloren, für proletarische Gruppen. Gleichzeitig verleitete der noch immer mächtige Individualismus zur Ablehnung des einheitlichen und zentralisierten Charakters der Organisation: Jede lokale Sektion, ja jedes Individuum konnte gegen die Disziplin der Organisation verstoßen, wenn man meinte, dass die Orientierungen unrichtig seien. Die immediatistische Gefahr ist eines der Hauptthemen des Berichts über „Die Funktion der revolutionären Organisation“ (Internationale Revue, Sondernummer, dt. Ausgabe), der von der Außerordentlichen Konferenz verabschiedet wurde, die im Januar 1982 abgehalten worden war, um die IKS wieder zurück aufs Gleis zu stellen.
Auch der „Bericht zur Struktur und Funktionsweise der revolutionären Organisation“ (Internationale Revue, Nr. 22, dt. Ausgabe) richtete sich bei seiner Verteidigung einer zentralisierten und disziplinierten Organisation (bei gleichzeitigem Beharren auf die Notwendigkeit der offensten und tiefsten Diskussionen in ihr) gegen den Individualismus.
Dieser erfolgreiche Kampf gegen den Immediatismus und Individualismus bewahrte die Organisation 1981 vor Schlimmeren, doch er eliminierte nicht die Bedrohungen an sich: Insbesondere kristallisierte sich 1984 das Gewicht des Rätismus, mit anderen Worten: die Unterschätzung der kommunistischen Organisation, mit der Bildung einer „Tendenz“ heraus, die das Banner gegen die „Hexenjäger“ erhob, als wir begannen, gegen die Überbleibsel rätistischer Ideen in unseren eigenen Reihen zu kämpfen. Diese „Tendenz“ endete darin, die IKS auf ihrem sechsten Kongress 1985 zu verlassen, um die Externe Fraktion der IKS (EFIKS) zu bilden, die vorgab, die „wirkliche Plattform“ unserer Organisation gegen ihre angebliche „stalinistische Degeneration“ zu verteidigen (dieselben Anschuldigungen wurden bereits von jenen Elementen erhoben, die die IKS 1981 verlassen hatten).
Diese Kämpfe erlaubten es unserer Organisation, ihre Verantwortung in den Kämpfen der Klasse in dieser Periode wahrzunehmen, wie im Bergarbeiterstreik in Großbritannien 1984, im Generalstreik in Dänemark 1985, im riesigen Streik des öffentlichen Dienstes in Belgien 1986, im Streik bei den Eisenbahnen und in den Krankenhäusern in Frankreich 1986 und 1988 sowie im Lehrerstreik in Italien 19870JahreIKS#_edn8">[viii].
Während dieser aktiven Interventionen in den Arbeiterkämpfen in den 80er Jahren vergaß unsere Organisation nicht eine der Hauptsorgen der italienischen Fraktion: die Lehren aus den vergangenen Niederlagen zu ziehen. Nachdem sie mit großer Aufmerksamkeit die Arbeiterkämpfe in Polen 1980 verfolgt und analysiert hatte0JahreIKS#_edn9">[ix], unternahm die IKS, um die Niederlage dieser Kämpfe zu verstehen, eine ausführliche Untersuchung der spezifischen Charakteristiken der stalinistischen Regimes in Osteuropa0JahreIKS#_edn10">[x]. Diese Analyse versetzte unsere Organisation in die Lage, den Zusammenbruch des Ostblocks und der UdSSR zwei Monate vor dem Fall der Berliner Mauer vorauszusehen, zu einer Zeit, als viele Gruppen die Ereignisse in der UdSSR und ihrer Glacis („Perestroika“ und „Glasnost“, Solidarnosc in Polen, die im Sommer 1989 an die Macht kam) als Teil der Politik zur Verstärkung desselben Blocks analysierten0JahreIKS#_edn11">[xi].
Ähnlich ermöglichte die Fähigkeit, den Niederlagen der Klasse klar ins Auge zu blicken - was eine Stärke der Fraktion und nach ihr der Kommunistischen Linken Frankreichs (GCF) gewesen war - es uns, noch vor den Ereignissen im Herbst 1989 vorauszusagen, dass diese eine nachhaltige Flaute im proletarischen Bewusstsein provozieren werden: „Selbst bei seinem Tod erweist der Stalinismus der kapitalistischen Herrschaft noch einen letzten Dienst: bei seinem Zerfall vergiftet sein Körper weiterhin noch die Luft, die das Proletariat atmen muss (...) wird der gegenwärtige Rückfluss des Klassenkampfes – ungeachtet der Tatsache, dass er den historischen Kurs, die allgemeine Perspektive breiterer Zusammenstöße zwischen den Klassen, nicht infragestellt – weiterreichend sein als der Rückfluss, der die Niederlage von 1981 in Polen begleitet hatte.“0JahreIKS#_edn12">[xii]
Diese Analyse stieß nicht auf einhellige Zustimmung im linkskommunistischen Lager. Viele nahmen an, dass, weil der Stalinismus die Speerspitze der Konterrevolution gewesen war, seine jämmerliche Auflösung die Tür zur Entwicklung des Bewusstseins und der Militanz des Proletariats öffnen werde. Dies war auch die Zeit, als das IBRP wie folgt über den Staatsstreich schrieb, der das Ceaucescu-Regime Ende 1989 gestürzt hatte: „Rumänien ist das erste Land in den Industrieregionen, in dem die Weltwirtschaftskrise einem realen und authentischen Volksaufstand zur Entstehung verholfen hat, dessen Resultat der Sturz der herrschenden Regierung war (...) in Rumänien waren alle objektiven Bedingungen und nahezu alle subjektiven Bedingungen für die Umwandlung des Aufstandes in eine wahre und authentische soziale Revolution präsent.“ (Battaglia Comunista, Januar 1990, „Ceaucescu ist tot, aber der Kapitalismus lebt noch immer“, eigene Übersetzung).
Schließlich wurden der Zusammenbruch des Ostblocks und des Stalinismus sowie die Schwierigkeiten, die dadurch für den Kampf der Arbeiterklasse entstanden, nur deswegen von unserer Organisation völlig begriffen, weil sie schon zuvor in der Lage gewesen war, eine neue Phase in der Dekadenz des Kapitalismus auszumachen, nämlich die Zerfallsphase: „Bislang haben sich die Klassenkämpfe seit den letzten 20 Jahren auf allen Kontinenten stark entwickelt und den dekadenten Kapitalismus daran gehindert, seine Antwort auf die Sackgasse seiner Wirtschaft durchzusetzen: die Auslösung der höchsten Stufe seiner Barbarei, einen neuen Weltkrieg. Dennoch ist die Arbeiterklasse noch nicht in der Lage, durch revolutionäre Kämpfe ihre eigene Perspektive durchzusetzen, und auch kann sie noch nicht den Rest der Menschheit diese Zukunft verdeutlichen, die sie in sich trägt. Gerade diese gegenwärtige Pattsituation, wo im Augenblick weder die bürgerliche noch die proletarische Alternative sich offen durchsetzen kann, liegt an der Wurzel dieses Phänomens des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft und erklärt das besondere Ausmaß und die Schärfe der Barbarei der Dekadenz dieses Systems. Und je mehr sich die Wirtschaftskrise zuspitzt, desto stärker wird auch dieser Fäulnisprozess zunehmen.“ (Internationale Revue Nr. 11, „Der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft“)
„Der gegenwärtige Zusammenbruch des Ostblocks ist einer der Ausdrücke des allgemeinen Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft, deren Ursprung in der Unfähigkeit der Bourgeoisie liegt, ihre eigene Antwort auf die offene Krise der Weltwirtschaft, den generalisierten Krieg, durchzusetzen“ (Der Zerfall, letzte Phase der kapitalistischen Gesellschaft“, Internationale Revue Nr.13).
Auch hier bezog die IKS ihre Inspiration aus der Methode der italienischen Fraktion, für die „Erkenntnis keinem Verbot und keiner Ächtung unterworfen sein darf“. Die IKS war in der Lage, diese Analyse zu erarbeiten, weil sie wie die Fraktion darum bemüht war, gegen die Routine zu kämpfen, gegen nachlässiges Denken, gegen die Auffassung, dass es „nichts Neues unter der Sonne“ gibt oder dass „die Positionen des Proletariats seit 1848 unveränderlich sind“ (wie die Bordigisten behaupten). Unsere Organisation sah den Zusammenbruch des Ostblocks und das darauffolgende Verschwinden des westlichen Blocks sowie den ernsthaften Rückzug, den die Arbeiterklasse ab 1989 antrat, voraus, weil sie diese Entschlossenheit verinnerlicht hatte, ständig wachsam gegenüber Ereignissen historischer Tragweite zu sein, auch wenn dies bedeutete, lieb gewonnene und fest etablierte Gewissheiten in Frage zu stellen. In der Tat ist diese Methode der Fraktion, die von der IKS fortgesetzt wird, keine Besonderheit der Erstgenannten, wie fähig die Fraktion auch war, diese Methode anzuwenden. Es war dies die Methode von Marx und Engels, die niemals zögerten, Positionen in Frage zu stellen, die sie zuvor vertreten hatten, falls es die Realität erforderte. Es war dies die Methode von Rosa Luxemburg, die es auf dem Kongress der Sozialistischen Internationale 1896 wagte, die Aufgabe einer der symbolischsten Positionen der Arbeiterbewegung zu fordern: die Unterstützung der polnischen Unabhängigkeit und, allgemeiner, der nationalen Befreiungskämpfe. Es war Lenins Methode, als er zum Erstaunen und gegen die Opposition der Menschewiki und der „Altbolschewiki“ mit den Worten: „Die Theorie, mein Freund, ist grau, aber grün ist der ewige Baum des Lebens“0JahreIKS#_edn13">[xiii], erklärte, dass es notwendig sei, das von der Partei 1903 angenommene Programm neu zu schreiben.
Die Entschlossenheit der IKS, wachsam gegenüber neuen Ereignissen zu sein, trifft nicht nur auf den Bereich der internationalen Situation zu. Sie gilt auch für das Innenleben unserer Organisation. Wir lernten diese Vorgehensweise von der Fraktion, die sich wiederum vom Beispiel der Bolschewiki und davor von Marx und Engels besonders in der Ersten Internationale inspirieren ließ. Die Periode, die dem Zusammenbruch des Ostblocks folgte und die, wie wir gesehen haben, fast die Hälfte des Lebens der IKS ausmacht, war eine neue Prüfung für unsere Organisation, die sich neuen Krisen ausgesetzt sah, so wie sie sie bereits in den 80er Jahren erlebt hatte. Ab 1993 musste sie sich im Kampf gegen den „Zirkelgeist“, wie ihn Lenin während des Kongresses der SDAPR 1903 definiert hatte, engagieren, deren Quelle in der Herkunft der IKS lag, als sie kleine Gruppen zusammenbrachte, in denen Affinitäten mit politischen Überzeugungen vermischt waren. Das Überleben des Zirkelgeistes, kombiniert mit dem wachsenden Druck des Zerfalls, tendierte immer mehr dazu, das Clanverhalten innerhalb der IKS zu fördern und so ihre Einheit, ja sogar ihr Überleben zu bedrohen. Und genauso wie die Elemente, die in der russischen SDAPR am meisten vom Zirkelgeist gezeichnet waren, einschließlich einer Reihe von Gründungsmitgliedern der Partei wie Plechanow, Axelrod, Sassulitsch, Potressow und Martow, sich widersetzt und von den Bolschewiki getrennt hatten, um nach dem Kongress von 1903 die menschewistische Fraktion zu bilden, war eine bestimmte Zahl von „herausragenden Mitgliedern“ der IKS (wie Lenin sie nennen würde) nicht in der Lage, sich dem Kampf zu stellen, und flüchtete aus der Organisation (1995-96). Jedoch wurde der Kampf gegen den Zirkelgeist und gegen das Clanverhalten nicht bis zu seinem Schluss ausgefochten und machte sich 2000-01 erneut bemerkbar. 2001 waren dieselben Ingredienzen wie in der Krise von 1993 vorhanden, doch bei einigen Militanten waren sie verknüpft mit einer Erschöpfung der kommunistischen Überzeugung, die durch den langen Rückzug der Arbeiterklasse und das wachsende Gewicht des Zerfalls verschärft worden war. Dies erklärt, warum langjährige Mitglieder der IKS entweder jegliches Interesse an der Politik verloren oder sich in Erpresser, Schläger und sogar freiwillige Polizeispitzel verwandeln konnten0JahreIKS#_edn14">[xiv]. Kurz vor seinem Tod 1990 behauptete unser Genosse MC, dass die Arbeiterklasse im Begriff sei, einen ernsten Rückzug anzutreten, und sagte, dass wir nun sehen würden, wer die wahren Militanten seien, das heißt Individuen, die nicht angesichts von Problemen ihre Überzeugung verlieren. Jene Elemente, die sich 2001 entweder zurückzogen oder die IFIKS bildeten, demonstrierten diese Veränderung in ihren Überzeugungen. Einmal mehr trachtete die IKS danach, mit derselben Entschlossenheit, die sie bereits bei früheren Gelegenheiten gezeigt hatte, die Organisation zu verteidigen. Und wir verdanken diese Entschlossenheit dem Beispiel der italienischen Fraktion. Auch in den dunkelsten Tagen der Konterrevolution lautete die Parole der Fraktion: „Niemals verraten“. Da der Rückzug der Arbeiterklasse nicht die Rückkehr der Konterrevolution bedeutet, war die Losung der IKS in den 90er Jahren: „Durchhalten“. Einige übten Verrat, doch die Organisation in ihrer Gesamtheit blieb standhaft und wurde sogar noch stärker dank dieser Entschlossenheit, sich den Organisationsfragen mit der größtmöglichen theoretischen Tiefe zu widmen, so wie es seinerzeit Marx, Lenin und die Fraktion getan hatten. Die beiden Texte, die in unserer Internationalen Revue bereits veröffentlicht worden sind („Die Frage des organisatorischen Funktionierens in der IKS“ in Internationale Revue Nr. 30 und „Das Vertrauen und die Solidarität im Kampf des Proletariats“ in Internationale Revue Nr. 31, dt. Ausgabe), sind Zeugnis dieser theoretischen Anstrengungen hinsichtlich der Organisationsfragen.
uf dieselbe Weise antwortete die IKS nachdrücklich jenen, die behaupten, dass die zahlreichen Krisen, die unsere Organisation erlebt hat, ein Beweis für ihr Scheitern sei: „Es scheint, als ginge die IKS durch so viele Krisen, weil sie gegen jegliche Penetrierung durch den Opportunismus kämpft. Weil sie ihre Statuten und den proletarischen Geist kompromisslos verteidigt, hat sie die Wut einer vom zügellosen Opportunismus befallenen Minderheit auf sich gezogen, d.h. die die Prinzipien der Organisationsfragen vollständig aufgegeben haben. Die IKS setzte auf dieser Ebene die Auseinandersetzung der Arbeiterbewegung fort, die insbesondere von Lenin und den Bolschewiki geführt worden war, deren zahlreiche Kritiker ihre häufigen organisatorischen Kämpfe und Krisen geißelten. In derselben Periode war das Leben der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands weitaus weniger bewegt, doch die opportunistische Ruhe, die in ihr herrschte (allein herausgefordert von den ‚Störenfrieden‘ auf der Linken wie Rosa Luxemburg), deutete bereits ihren Verrat 1914 an. Im Gegensatz dazu halfen die Krisen der bolschewistischen Partei, die Kräfte zu entwickeln, die zur Revolution von 1917 führten.“ („Der 15. Kongress der IKS: Es steht heute viel auf dem Spiel – Die Organisation stärken, um sich der Verantwortung zu stellen“, Internationale Revue Nr. 114; engl., franz., span. Ausgabe)
Wir verdanken also die Fähigkeit der IKS, sich in den 30 Jahren ihrer Existenz stets ihrer Verantwortung gestellt zu haben, größtenteils den Beiträgen der italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken. Das Geheimnis hinter der positiven Bilanz, die wir aus den Aktivitäten in dieser Periode ziehen können, liegt in unserer richtig verstandenen Treue zu den Lehren der Fraktion und, allgemeiner, zu der Methode und dem Geist des Marxismus0JahreIKS#_edn15">[xv].
Die Fraktion selbst wurde entwaffnet, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Dies geschah, weil besonders während des spanischen Bürgerkriegs die Fraktionsmehrheit Vercesi bei der Abschaffung jener Prinzipien folgte, die zuvor ihre Stärke gewesen waren. Im Gegensatz dazu war es einem kleinen Kern in Marseille auf der Grundlage eben dieser Prinzipien möglich, die Fraktion während des Krieges neu zu bilden und die theoretische sowie politische Arbeit beispielhaft fortzusetzen. Umgekehrt ließ der Restbestand der Fraktion am Kriegsende ihre Prinzipien fallen, als die Mehrheit beschloss, sich aufzulösen und als Individuen der 1945 gegründeten Partito Comunista Internazionalista beizutreten. Es war daher der Kommunistischen Linken Frankreichs (GCF) überlassen, die fundamentalen Errungenschaften der Fraktion zu übernehmen und die theoretische Arbeit bei der Vorbereitung des politischen Rahmens fortzusetzen, was es der IKS ermöglichte, sich zu bilden, zu existieren und Fortschritte zu machen. In diesem Sinn betrachten wir die Zusammenfassung von 30 Jahren unserer Organisation als eine Huldigung an die außergewöhnliche Arbeit, die von den kleinen Gruppen exilierter Militanter ausgeführt worden war, welche die Fackel der Idee des Kommunismus in der dunkelsten Epoche der Geschichte hochhielten. Ihr Werk wird sich, obgleich heute größtenteils unbekannt und zum großen Teil von jenen ignoriert, die behaupten, die Erben der Italienischen Linken zu sein, als wirkungsvolles Element beim endlichen Sieg des Proletariats erweisen.
Eine neue Generation von kommunistischen Kämpfern
Besonders dank der Lehren, die uns die Fraktion und die GCF hinterlassen haben, übermittelt und unermüdlich bis an seinen letzten Tag weiter ausgearbeitet von unserem Genossen MC, ist die IKS heute fit und bereit, die neue Generation von Revolutionären, die sich unserer Organisation annähert, in unseren Reihen willkommen zu heißen; eine Generation, die sowohl zahlenmäßig als auch in ihrer Begeisterung noch wachsen wird, entsprechend der Tendenz zur Wiederbelebung des Klassenkampfes seit 2003. Der letzte Internationale Kongress merkte an, dass wir Zeuge eines bedeutsamen Ansteigens der Zahl unserer Kontakte und neuer Mitglieder sind: „Und bemerkenswert ist, dass eine bedeutende Anzahl von diesen neuen Mitgliedern junge Leute sind, die nicht die Verbildung erleiden und überwinden mussten, die die Mitgliedschaft in linksbürgerlichen Organisationen nach sich zieht. Junge Leute, deren Dynamik und Begeisterung hundertfach die müden und verbrauchten ‚militanten Kräfte‘ ersetzt, die uns verlassen.“ („Bilanz des 16. Kongresses“, Internationale Revue Nr. 36, dt. Ausgabe)
Für uns Menschen sind 30 Jahre das Durchschnittsalter einer Generation. Die Elemente, die sich uns heute annähern oder die bereits bei uns eingetreten sind, könnten Kinder der Militanten sein, die die IKS gegründet hatten (und sind es manchmal auch).
Was wir im Bericht über die internationale Lage gesagt hatten, der dem 8. Kongress der IKS vorgestellt worden war, wird zur konkreten Realität: „Es war notwendig, dass die Generationen, die von der Konterrevolution der 1930 bis 1950er Jahre geprägt worden waren, den Generation den Platz überließen, die nicht davon geprägt worden waren, damit das Weltproletariat die Kraft fand, sie zu überwinden. So kann man im übertragenen Sinne sagen, dass die Generation, welche die Revolution machen wird, nicht die sein wird, welche die wesentliche historische Aufgabe erfüllt hat, dem Weltproletariat nach der tiefgreifendsten Konterrevolution seiner Geschichte eine neue Perspektive zu eröffnen (obgleich solch ein Vergleich abgeschwächt werden muss, wenn man sieht, dass zwischen der 1968er Generation und der vorhergehenden Generation ein historischer Bruch entstanden war, während es bei den nachfolgenden Generationen eine Kontinuität gibt)“ Was für die Arbeiterklasse zutrifft, gilt auch für ihre revolutionäre Minderheit. Und noch sind die meisten der „alten“ Militanten dabei, auch wenn ihre Haare mittlerweile grau geworden sind (wenn sie nicht schon alle ausgefallen sind!). Die Generation, die 1975 die IKS gründete, ist bereit, die Lehren, die sie von ihren Vorgängern erhalten hat, so wie jene, die sie im Verlauf dieser 30 Jahre hinzugelernt hat, an die „Jüngeren“ zu übermitteln, so dass die IKS mehr und mehr in der Lage ist, ihren Beitrag zur Bildung der künftigen Partei der kommunistischen Revolution zu leisten. Fabienne
0JahreIKS#_ednref1">[i] Insbesondere ist sie die einzige Organisation mit einer bedeutenden Publikation auf Englisch (ein Dutzend Ausgaben pro Jahr).
0JahreIKS#_ednref2">[ii] Es ist aufschlussreich, dass die Genossen, die Internationalist Notes in Montreal veröffentlichen, zuerst die IKS kontaktierten, die sie ermutigte, auch mit dem IBRP in Kontakt zu treten. Am Ende wendeten sich diese Genossen dieser Organisation zu. Desgleichen sagte auf einem Treffen mit uns ein Genosse der CWO (der britische Ableger des IBRP) ganz freimütig, dass ihre einzigen Kontakte in Großbritannien von der IKS kämen, die sie dazu ermutigt hatte, auch mit den anderen Gruppen der Kommunistischen Linken in Kontakt zu treten.
0JahreIKS#_ednref3">[iii] Siehe zum Beispiel den Brief, den wir an die Gruppen der Kommunistischen Linken am 24. März 2003 adressiert und in der Internationalen Revue Nr. 119 (eng., franz., span. Ausgabe, Nr. 32 deutsche Ausgabe) veröffentlicht hatten.
0JahreIKS#_ednref4">[iv] Daher schrieben wir im „Bericht über die Struktur und die Funktionsweise der revolutionären Organisation“: „Innerhalb des proletarischen politischen Milieus haben wir immer diese Position vertreten (dass „wenn die Organisation einen falschen Weg einschlägt, (...) die Verantwortung der Mitglieder, die glauben, eine richtige Position zu verteidigen, nicht darin (besteht), sich selbst auf eine Insel zu retten, sich in eine Ecke zurückzuziehen, sondern einen Kampf innerhalb der Organisation zu führen, um damit beizutragen, sie wieder auf den ‚richtigen Weg zu bringen‘). Dies war insbesondere der Fall, als die Aberdeener Sektion der Communist Workers‘ Organisation (CWO) aus dieser austrat oder als das Nucleo Comunista Internazionalista aus ‚Programma Comunista‘ austrat. Wir haben damals die Überstürzung bei den Spaltungen kritisiert, die sich damals auf keine grundsätzlichen Divergenzen stützten und die in den jeweiligen Organisationen nicht ausreichend in vertieften Debatten geklärt worden waren. Im allgemeinen ist die IKS gegen ‚Spaltungen‘, die sich nicht auf Prinzipienfragen stützen, sondern zweitrangige Fragen als Ursprung haben (selbst wenn die ausgetretenen Genossen später ihre Kandidatur für die Mitgliedschaft in der IKS stellen).“
0JahreIKS#_ednref5">[v] „Für den schließlichen Sieg der im ‚Manifest‘ aufgestellten Sätze verließ sich Marx einzig und allein auf die intellektuelle Entwicklung der Arbeiterklasse, wie sie aus der vereinigten Aktion und der Diskussion notwendig hervorgehn musste.“ (Vorrede zur deutschen Ausgabe des „Kommunistischen Manifest“, 1890). MEW Bd 4, S. 584).
0JahreIKS#_ednref6">[vi] Marx und Engels mussten so innerhalb des Bundes der Kommunisten gegen die Willich-Schapper-Tendenz kämpfen, die die „Revolution jetzt!“ wollte, trotz der Niederlage der Revolution von 1848: „Während wir den Arbeitern sagen: Ihr habt 15,20,50 Jahre Bürgerkrieg durchzumachen, um die Verhältnisse zu ändern, um euch selbst zur Herrschaft zu befähigen, ist statt dessen gesagt worden: Wir müssen gleich zur Herrschaft kommen, oder wir können uns schlafen legen.“ (Protokoll der Sitzung der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten in London, 15. 09. 1850).
0JahreIKS#_ednref7">[vii] „Die Militanten der neuen proletarischen Parteien können nur als Resultat einer tiefgehenden Kenntnis über die Ursachen der Niederlagen erscheinen. Und diese Erkenntnis darf keinem Verbot und keiner Ächtung unterworfen sein.“ (Bilan, Nr. 1, November 1933)
0JahreIKS#_ednref8">[viii] Unser Artikel, den wir anlässlich des 20. Geburtstages der IKS verfasst hatten, geht detaillierter auf unsere Intervention in den Arbeiterkämpfen in dieser Periode ein.
0JahreIKS#_ednref9">[ix] Siehe darüber „Massenstreiks in Polen: Eine neue Bresche ist geschlagen“, „Die internationale Dimension der Arbeiterkämpfe in Polen“, „Die Rolle der Revolutionäre im Lichte der Ereignisse in Polen“, „Perspektiven für den internationalen Klassenkampf: Eine Bresche ist in Polen geschlagen worden“, „Ein Jahr der Arbeiterkämpfe in Polen“, „Bemerkungen zum Massenstreik“, „Nach der Repression in Polen“ in der Internationalen Revue Nr. 23, 24, 26, 27 und 29 (engl., franz., span. Ausgabe)
0JahreIKS#_ednref10">[x] „Osteuropa: Die Wirtschaftskrise und die Waffen der Bourgeoisie gegen das Proletariat“, Internationale Revue Nr. 80 (eng., franz., span. Ausgabe).
0JahreIKS#_ednref11">[xi] Siehe Internationale Revue Nr. 60, „Thesen zur ökonomischen und politischen Krise in der Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern“ in der Internationalen Revue Nr. 12 (dt. Ausgabe) wie auch „20 Jahre IKS“ in der Internationalen Revue Nr. 80 (engl., franz., span. Ausgabe, Nr. 16 deutsche Ausgabe)
0JahreIKS#_ednref12">[xii] „Thesen zur ökonomischen und politischen Krise in der Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern“, s.o.
0JahreIKS#_ednref13">[xiii] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/x01.htm [139]
0JahreIKS#_ednref14">[xiv] Über die Krise der IKS 2001 und das Verhalten der so genannten internen Fraktion der IKS (IFIKS) siehe insbesondere unseren Artikel „Der 15. Kongress der IKS: Es steht heute viel auf dem Spiel – die Organisation stärken, um sich der Verantwortung zu stellen“, Internationale Revue Nr. 114 (engl., franz., span. Ausgabe).
0JahreIKS#_ednref15">[xv] Wenn die anderen Organisationen, die wir zitiert haben, unfähig sind, solche eine positive Bilanz zu ziehen, so, weil ihre Bindung zu den Organisationsprinzipien der Italienischen Linken im Kern platonisch ist.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Partei und Fraktion [83]
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Theorie der Dekadenz im Zentrum des Historischen Materialismus, Teil 3:
- 3270 Aufrufe
Battaglia Comunista wendet sich von einem
Schlüsselkonzept des Marxismus ab: der Dekadenz der Produktionsweisen, II
Im ersten Teil dieser Artikelserie (s. Internationale Revue Nr. 34) erinnerten wir daran, dass für den Marxismus entgegen der Ansicht, die von Battaglia vertreten wurde[1] [140], die Dekadenz des Kapitalismus keine endlose Wiederholung seiner Widersprüche auf einem immer höheren Niveau ist, sondern dass sie, entsprechend der Terminologie von Marx und Engels, die Frage seines Überlebens als Produktionsweise aufwirft. Indem es das Dekadenzkonzept ablehnt, wie es von den Gründern des Marxismus definiert und sukzessive von den Organisationen der Arbeiterbewegung aufgenommen wurde, von denen einige es weiter vertieften, kehrt Battaglia dem historisch-materialistischen Verständnis den Rücken zu. Marx uns lehrt, dass eine Gesellschaft erst dann überwunden werden kann, wenn sie in eine Phase der „Senilität“ getreten ist, wo „ihre Produktionsverhältnisse obsolet und zu einem Hindernis für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte geworden sind“.
„Die universelle Tendenz des Kapitals erscheint hier, die es von früheren Produktionsstufen unterscheidet. Obgleich seiner Natur nach selbst borniert, strebt es nach universeller Entwicklung der Produktivkräfte und wird so die Voraussetzung der neuer Produktionsweise… Diese Tendenz – Die das Kapital hat… und es zu seiner Auflösung treibt…“ (K. Marx, „Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie“ Heft V, Das Kapitel vom Kapital, S. 438.)
An dieser Idee der unvermeidlichen Folge der Produktionsweise ist nichts Fatalistisches, wie Battaglia behauptet. Dies deswegen, weil, auch wenn die Dekadenz einer Produktionsweise eine unerlässliche Vorbedingung für eine „revolutionäre Umgestaltung der ganzen Gesellschaft“ (Marx, Kommunistisches Manifest) ist, es der Klassenkampf ist, der in letzter Instanz einen Schnitt durch die sozio-ökonomischen Widersprüche macht. Und falls dies nicht geschieht, so sinkt die Gesellschaft in eine Zerfallsphase, in den „gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen“, wie Marx es im Kommunistischen Manifest formuliert. Es gibt nichts Automatisches oder Unvermeidliches an der Aufeinanderfolge von Produktionsweisen, nichts, dass den Schluss nahelegt, dass der Kapitalismus angesichts wachsend unüberwindbarer Widersprüche sich einfach von der Bühne der Geschichte zurückziehen wird.
Battaglias Zickzackkurs in der Frage des Dekadenzkonzepts
In der Diskussion rund um die Annahme ihrer Plattform auf der ersten Nationalen Konferenz 1945 übertrug das Zentralkomitee der neugegründeten Partito Comunista Internazionalista (PCInt) einem seiner Militanten – Stefanini, ein früheres Mitglied der italienischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken (1928-45) – die Aufgabe, einen politischen Bericht über die Gewerkschaftsfrage zu präsentieren. In diesem Bericht bekräftigte er die „Konzeption, dass die Gewerkschaften in der Phase der Dekadenz des Kapitalismus notwendigerweise mit dem bürgerlichen Staat verknüpft sind“ (Protokolle der ersten Nationalen Konferenz der PCInt, eigene Übersetzung). Dieser Bericht, der am dritten Tag der Konferenz vorgestellt wurde, stand im Widerspruch zur Plattform, die tags zuvor diskutiert und verabschiedet wurde.[2] [140] Obwohl eine Reihe von Militanten die Position unterstützte, die von Stefanini im Namen des Zentralkomitees vertreten wurde, rief Letzteres am Ende der Diskussion die Konferenz dazu auf, die Positionen anzunehmen, die von der Plattform eingenommen wurden[3] [140], und fühlte sich veranlasst, am Ende der Konferenz einen Antrag zu präsentieren, der zum „Wiederaufbau der CGIL“[4] [140] und „zur Eroberung der Führungsorgane der Gewerkschaft“ aufrief (Antrag des Zentralkomitees zur Gewerkschaftsfrage, eigene Übersetzung, siehe auch Fussnote 3).
Ferner nahm die Plattform, die auf dieser Konferenz (faktisch ein Gründungskongress) gebilligt wurde, trotz ihrer ausdrücklichen Behauptung, dass sie sich in politischer und organisatorischer Kontinuität mit der Italienischen Fraktion befinde (1928-45)[5] [140], und trotz der Anwesenheit von Mitgliedern der Fraktion in der Führung der neuen Partei überhaupt keinen Bezug auf das, was der Mörtel, die politische Kohärenz der Positionen der Fraktion gewesen war: die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus. Gleichzeitig schuf die Partei ein Internationales Büro, um ihre organisatorische Ausweitung ins Ausland zu koordinieren; dieses jedoch vertrat – mit angemessenem Respekt vor der theoretischen Kakophonie – weiterhin die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus in seinen Publikationen![6] [140] Was lediglich aufzeigt, dass es mit einer solchen Umgruppierungsmethode als Grundlage eigentlich in allen politischen Positionen nur eine totale programmatische Heterogenität geben konnte. Wenn wir die Protokolle dieser Konferenz lesen, wird deutlich, welch tiefe politische Verwirrung in ihren Diskussionen herrschte![7] [140]
Angesichts einer solch konfusen politischen Grundlage ist es nicht verwunderlich, dass der Begriff der Dekadenz wie eine Fata Morgana hin und wieder auftaucht. Dies war besonders auf der Gewerkschaftskonferenz der PCInt 1947 der Fall, wo im Gegensatz zur Plattform von 1945 festgestellt wurde: „In der gegenwärtigen Phase der Dekadenz der kapitalistischen Gesellschaft sind die Gewerkschaften dazu bestimmt, als ein wichtiges Instrument für die Politik der Bewahrung zu dienen und somit die exakten Funktionen eines Staatsorgans anzunehmen.“[8] [140] Dieser explosive Cocktail, der auf den eigentlichen Fundamenten der PCInt zusammengebraut wurde, hielt der Nagelprobe der Wirklichkeit nicht lange stand. Die Partei spaltete sich 1952 in zwei Parteien - eine um Bordiga (Programma Comunista), die sich durch eine Rückkehr zu den politischen Positionen der 20er Jahre auszeichnete, und eine um Damen (Battaglia Comunista), die sich etwas ausdrücklicher auf die politischen Beiträge der Italienischen Fraktion bezog.[9] [140] Genau zum Zeitpunkt dieser Spaltung sollte Bordiga gewisse kritische Betrachtungen über das Dekadenzkonzept anstellen.[10] [140] Und was Battaglia angeht, so ließ auch seine politische Plattform, die nach der Spaltung von 1952 angenommen worden war, die Analyse der Dekadenz zunächst außen vor.
Einige Zeit später jedoch nahm Battaglia in seinen Bemühungen, die revolutionären Kräfte zu bündeln, und im Verlauf der Diskussionen mit unserer Organisation schließlich unter dem Eindruck der Dynamik, die durch die Internationalen Konferenzen der Gruppen der Kommunistischen Linken zwischen 1976 und 1980 ausgelöst worden war, die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus an.[11] [140] So veröffentlichte es Anfang 1978 und im März 1979 in seiner Zeitschrift Prometeo[12] [140] sowie als Texte für die ersten beiden Konferenzen[13] [140] zwei lange Untersuchungen über die Dekadenz. Wir erlebten, wie Battaglia auf der Rückseite seiner Publikationen einen neuen programmatischen Punkt aufnahm, der seine Übereinstimmung mit dem Rahmen der Dekadenz bekundete: „... das Anwachsen interimperialistischer Konflikte, von Handelskriegen, Spekulation, allgemeiner lokaler Kriege ist ein Anzeichen für den Prozess der Dekadenz des Kapitalismus. Die strukturelle Krise des Systems drückt das Kapital über seine ‚normalen‘ Grenzen in Richtung einer Lösung auf der Ebene des imperialistischen Krieges“. Nach dem Tod von Damen sen. – dem Gründer der PCInt und Initiator des Konferenzzyklus‘ – im Oktober 1979 und mit Prometeo Nr. 3 im Dezember 1979 (also kurz bevor Battaglia uns am Ende der dritten Konferenz im Mai 1980 ausschloss) verschwand dieser Punkt über die Dekadenz wieder aus den Grundsatzpositionen. Es ist in diesem Zusammenhang auch bemerkenswert, dass die Analyse der Dekadenz, die im Zentrum von Battaglias Beiträgen auf den ersten beiden Konferenzen stand, völlig aus seinen Beiträgen für die dritte Konferenz verschwand, wo wir eine Analyse erblickten, die die gegenwärtige Position vorwegnahm... All dies in sehr diskreter Manier und ohne jegliche Erklärung, weder für seine Leser noch für die anderen Gruppen des politischen Milieus des Proletariats! Abschließend sollten wir noch bemerken, dass Battaglia nun beabsichtigt, etwas abzuschwören, was das IBRP noch in seiner Plattform 1979 bekräftigt hatte: die Existenz eines qualitativen Bruchs, markiert durch den Ersten Weltkrieg, zwischen zwei fundamental unterschiedlichen historischen Perioden in der Evolution der kapitalistischen Produktionsweise, auch wenn dies nicht mehr durch den Gebrauch des marxistischen Konzepts vom Aufstieg und von der Dekadenz einer Produktionsweise erklärt wurde.[14] [140]
Nach diesen vielfältigen politischen Zickzacks besitzt Battaglia die Unverfrorenheit, sich darüber zu beklagen, dass es müde sei, „über nichts zu diskutieren, wo wir doch daran arbeiten müssen zu begreifen, was in der Welt vor sich geht“.[15] [140] Wie kann man auch nicht müde sein, wenn man ständig seine Ansichten wechselt und nie weiß, welche die beste ist, um „zu begreifen, was in der Welt vor sich geht“! Heute kann jeder sehen, dass Battaglia sich bewusst für die Weitsichtgläser entschieden hat, obgleich es an Kurzsichtigkeit leidet.
An diesem Punkt wird der Leser bemerkt haben, dass Battaglia, weit davon entfernt, ein Experte in Sachen Marxismus zu sein, wie es behauptet, eher ein Meister darin ist, auf die Gelegenheit des Augenblicks zu lauern, und eher wie ein schnell die Farbe wechselndes Chamäleon aussieht. Und es ist noch nicht alles. Der jüngste Zickzack war das Sahnehäubchen. Für all jene, die Battaglias Prosa lesen, liegt es nun auf der Hand, dass diese Organisation ein für allemal einen Begriff loswerden will, den es in seinen eigenen Worten in einer Stellungnahme vom Februar 2002, veröffentlicht in Internationalist Communist Review Nr. 21[16] [140], betrachtet „als genauso universell wie Verwirrung stiftend (...) fremd gegenüber der Kritik der politischen Ökonomie (...) fremd gegenüber den Methoden und dem Arsenal der Kritik der politischen Ökonomie“. Wir werden auch gefragt: „Welche Rolle spielt dann das Dekadenzkonzept im Rahmen einer militanten Kritik der politischen Ökonomie, d.h. für eine tiefere Analyse der Charakteristiken und der Dynamik des Kapitalismus in der Periode, in der wir leben? Keine. Bis zu dem Grad, dass das Wort selbst nirgendwo in den drei Bänden des Kapitals erscheint.“[17] [140] Aber warum zum Teufel fühlte sich Battaglia dann zwei Jahre später (in Prometeo Nr. 8, Dezember 2003) genötigt, eine große Debatte über dieses „Verwirrung stiftende“ Konzept anzuzetteln, das „nicht die Mechanismen der Krise erklären kann“, das „fremd gegenüber der Kritik der politischen Ökonomie“ ist, das nur gelegentlich bei Marx auftaucht und das angeblich in seinem Meisterstück überhaupt nicht auffindbar ist? Noch ein Kleiderwechsel. Erinnerte sich Battaglia plötzlich daran, dass die erste Broschüre, die von seiner Schwesterorganisation (die Communist Workers Organisation) veröffentlicht worden war, den Titel The Economic Foundations of Decadence (Die ökonomischen Fundamente der Dekadenz) trug? Die CWO behauptete völlig zu Recht, dass „der Begriff der Dekadenz Bestandteil der Analyse der Produktionsweisen von Marx ist“ und im Mittelpunkt bei der Bildung der Dritten Internationale stand: „Zurzeit der Formierung der Komintern 1919 wurde sichtbar, dass die Epoche der Revolution erreicht worden war, und ihre Gründungskonferenz sprach dies auch aus.“ (Revolutionary Perspectives Nr. 32) Hat Battaglia realisiert, dass es nicht so leicht ist, sich einer solch zentralen Errungenschaft der Arbeiterbewegung wie den marxistischen Begriff der Dekadenz einer Produktionsweise zu entledigen?
Dies im Hinterkopf ist es nicht verwunderlich, dass Battaglia in seinen Beiträgen zur Eröffnung der Debatte nichts zur Definition und Analyse der Dekadenz der Produktionsweisen, wie sie von Marx und Engels entwickelt worden waren, und auch nichts über ihre Bemühungen zu sagen hat, die Umstände und den Zeitpunkt zu skizzieren, in denen dies mit dem Kapitalismus geschieht. Desgleichen ignoriert Battaglia herrisch die Position, die die KI bei ihrer Gründung eingenommen hatte und die den Ersten Weltkrieg als eindeutiges Zeichen für den Beginn der Dekadenzperiode des Kapitalismus analysierte. Auch ist Battaglia, das behauptet, der politische Erbe der Italienischen Fraktion zu sein, sehr schweigsam, was die Tatsache anbetrifft, dass Letztere die Dekadenz zum Rahmen ihrer politischen Plattform gemacht hatte. Statt Stellung für das Erbe zu beziehen, das uns die Begründer des Marxismus hinterlassen und von Generationen von Revolutionären vertieft worden war, zieht es Battaglia vor, mit Bannflüchen (die Idee des Fatalismus) um sich zu werfen und hinsichtlich der Definition der Dekadenz Verwirrung zu verbreiten... und gleichzeitig eine Debatte innerhalb des IBRP sowie eine großangelegte Untersuchung anzukündigen: „Das Ziel unserer Untersuchung wird es sein, zu verifizieren, ob der Kapitalismus sich in seinem Drang, die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, erschöpft hat und, wenn ja, wann, in welchem Ausmaß und vor allem warum.“ Wenn man sich von einem historischen Konzept des Marxismus abwenden will, dann ist es leichter, ein neues Kapitel aufzuschlagen, statt sich zu den programmatischen Errungenschaften der Arbeiterbewegung zu bekennen. Genau dies taten die Reformisten Ende des 19. Jahrhunderts. Was uns angeht, so warten wir mit beträchtlicher Ungeduld auf die Ergebnisse dieser „Untersuchung“; und wir werden sie mit Vergnügen mit der marxistischen Theorie sowie mit der Realität der gegenwärtigen historischen Evolution des Kapitalismus vergleichen. Doch es sollte gesagt werden, dass die Argumente, die von Battaglia bereits benutzt worden waren, nichts Gutes verheißen. Aus diesem kurzen historischen Überblick über die verschiedenen Positionen, die Battaglia zur Dekadenz bezogen hat, wird eines bereits ersichtlich: Die Jungen haben die Alten ersetzt, doch geblieben ist die opportunistische Methode.
Eine Rückkehr zum Idealismus der utopischen Sozialisten
Für Battaglia ist, wie für die utopischen Sozialisten, die Revolution nicht das Produkt irgendeiner historischen Notwendigkeit, deren Wurzeln in der Sackgasse des Kapitalismus liegen, wie Marx, Engels und Luxemburg uns lehren: „Die universelle Tendenz des Kapitals erscheint hier, die es von früheren Produktionsstufen unterscheidet. Obgleich seiner Natur nach selbst borniert, strebt es nach universeller Entwicklung der Produktivkräfte und wird so die Voraussetzung der neuer Produktionsweise…Diese Tendenz – Die das Kapital hat…und es zu seiner Auflösung treibt…“ (Grundrisse, S. 438 s.o.); Aufgabe der ökonomischen Wissenschaft „ist es vielmehr, die neu hervortretenden gesellschaftlichen Missstände als notwendige Folgen der bestehenden Produktionsweise, aber auch gleichzeitig als Anzeichen ihrer hereinbrechenden Auflösung nachzuweisen, und innerhalb der sich auflösenden ökonomischen Bewegungsform die Elemente der zukünftigen, jene Missstände beseitigenden, neuen Organisation der Produktion und des Austausches aufzudecken“ (F. Engels, Anti-Dühring, Kap. II, Gegenstand und Methode); „Vom Standpunkte des wissenschaftlichen Sozialismus äußert sich die historische Notwendigkeit der sozialistischen Umwälzung vor allem in der wachsenden Anarchie des kapitalistischen Systems, die ihn in eine ausweglose Sackgasse drängt.“ (Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, „Die Bernsteinsche Methode“) Für den Marxismus ist die „Auflösung“ (Marx und Engels) bzw. „Sackgasse“ (Luxemburg), die mit der Dekadenz des Kapitalismus auftritt, eine unerlässliche Vorbedingung, um über diese Produktionsweise hinauszugehen, doch beinhaltet dies nicht sein automatisches Verschwinden, da „einzig der Hammerschlag der Revolution, d.h. die Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat“ (Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, „Zollpolitik und Militarismus), den Kapitalismus zum Einsturz bringen kann. Die „Aufhebung“, „Auflösung“ bzw. „Sackgasse“, die mit der Dekadenz des Kapitalismus auftritt, schafft die Bedingungen für die Revolution, sie ist das solide Fundament, ohne das „der Sozialismus auf(hört), eine historische Notwendigkeit zu sein, und er ist dann alles, was man will, nur nicht ein Ergebnis der materiellen Entwicklung der Gesellschaft.“ (Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, „Die Bernsteinsche Methode“). So wie die römische und feudale Dekadenz für die Entstehung der objektiven und subjektiven Bedingungen für neue Produktionsweisen notwendig war, so beweist die Sackgasse des dekadenten Kapitalismus dem Proletariat, dass diese Produktionsweise historisch überholt ist. Es ist anders, als Battaglia denkt: „Der Sozialismus erfolgt also aus dem alltäglichen Kampfe der Arbeiterklasse durchaus nicht von selbst und unter allen Umständen. Er ergibt sich aus den immer mehr sich zuspitzenden Widersprüchen der kapitalistischen Wirtschaft und aus der Erkenntnis der Arbeiterklasse von der Unerlässlichkeit ihrer Aufhebung durch eine soziale Umwälzung.“ (Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, „Praktische Konsequenzen und allgemeiner Charakter der Theorie“, Fußnote 7)
Der Marxismus sagt nicht, dass die Revolution unweigerlich kommt. Er leugnet keinesfalls den Willen als einen Faktor in der Geschichte: Er demonstriert lediglich, dass der Wille allein nicht ausreicht, dass er sich erst in einem materiellen Rahmen realisieren kann, der das Produkt einer Evolution, einer historischen Dynamik ist, welche zu berücksichtigen gilt, damit der Willen zur Geltung kommen kann. Die Bedeutung, die der Marxismus dem Verständnis der „realen Bedingungen“, der „objektiven Bedingungen“ beimisst, ist keine Ablehnung des Bewusstseins und Willens. Im Gegenteil, es ist die einzige feste Grundlage, um beides zu stärken. Wenn der Kapitalismus „sich selbst reproduziert, indem er einmal mehr und auf höherer Ebene all seine Widersprüche aufwirft“ (Battaglia), wo finden wir dann die objektiven Grundlagen für den Sozialismus? Wie Rosa Luxemburg uns erinnert: „Nach Marx ist die Rebellion der Arbeiter, ihr Klassenkampf (...) bloß ideologischer Reflex der objektiven geschichtlichen Notwendigkeit des Sozialismus, die sich aus der objektiven wirtschaftlichen Unmöglichkeit des Kapitalismus auf einer gewissen Höhe seiner Entwicklung ergibt. Selbstverständlich ist damit nicht gesagt – solche Vorbehalte aus dem Abc des Marxismus sind, wie wir sehen werden, für meine ‚Sachverständigen‘ immer noch unentbehrlich -, dass der historische Prozess bis zum letzten Rande dieser ökonomischen Unmöglichkeit ausgeschöpft werden müsse oder auch nur könne. Die objektive Tendenz der kapitalistischen Entwicklung auf jenes Ziel hin genügt, um schon viel eher eine derartig soziale und politische Verschärfung der Gegensätze in der Gesellschaft und Unhaltbarkeit der Zustände hervorzubringen, dass sie dem herrschenden System ein Ende bereiten müssen. Aber diese sozialen und politischen Gegensätze sind selbst in letzter Linie nur ein Produkt der ökonomischen Unhaltbarkeit des kapitalistischen Systems, und sie schöpfen gerade aus dieser Quelle ihre zunehmende Verschärfung just in dem Maße, wie jene Unhaltbarkeit greifbar wird. Nehmen wir hingegen mit den ‚Sachverständigen‘ (wie Battaglia) die ökonomische Schrankenlosigkeit der kapitalistischen Akkumulation an, dann schwindet dem Sozialismus der granitene Boden der objektiven historischen Notwendigkeit unter den Füßen. Wir verflüchtigen uns alsdann in die Nebel der vormarxschen Systeme und Schulen, die den Sozialismus aus bloßer Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit der heutigen Welt und aus der bloßen revolutionären Entschlossenheit der arbeitenden Klassen ableiten wollte“ (...) (Rosa Luxemburg, Antikritik).
Nicht weil die übergroße Mehrheit der Menschen ausgebeutet wird, ist der Sozialismus heute eine historische Notwendigkeit. Ausbeutung herrschte unter der Sklaverei, im Feudalismus und im Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, ohne dass der Sozialismus auch nur den Hauch einer Chance auf Verwirklichung hatte. Damit der Sozialismus zur Realität werden kann, ist es nicht nur notwendig, dass die Mittel zu seiner Verwirklichung (Arbeiterklasse und Produktionsmittel) ausreichend entwickelt sind. Es ist ebenfalls notwendig, dass das System, welches er ersetzen soll – der Kapitalismus -, aufgehört hat, ein für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte unerlässliches System zu sein, und zu einem wachsenden Hindernis für Letztere wird, d.h. dass es in seine Dekadenzphase getreten ist: „Die größte Errungenschaft des proletarischen Klassenkampfes war die Entdeckung der Ansatzpunkte für die Verwirklichung des Sozialismus in den ökonomischen Verhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft. Dadurch ist der Sozialismus aus einem ‚Ideal‘, das jahrtausendelang der Menschheit vorschwebte, zur geschichtlichen Notwendigkeit geworden.“ (Luxemburg, Sozialreform oder Revolution?, „Die ökonomische Entwicklung und der Sozialismus“). Der unvermeidliche Irrtum der Utopisten lag in ihrer Ansicht über den geschichtlichen Prozess. Ihnen zufolge konnte sein Ausgang vom guten Willen bestimmter Gruppen von Individuellen entschieden werden. Babeuf und Blanqui setzten ihre Hoffnung auf kleine Gruppen entschlossener Arbeiter; Saint-Simon, Fourier oder Owen wandten sich gar an das Wohlwollen der Bourgeoisie, um ihre Vorhaben durchzuführen. Das Auftreten des Proletariats als autonome Klasse während der Revolution von 1848 sollte zeigen, dass der Sozialismus nur von einer Klasse erreicht werden konnte. Es bestätigte die These, die Marx bereits im Kommunistischen Manifest aufgestellt hat: Seit der Teilung der Gesellschaft in Klassen war die Geschichte der Menschheit eine Geschichte von Klassenkämpfen gewesen. Ab da konnte die Entwicklung der Gesellschaft nur innerhalb des Rahmens begriffen werden, der diese Kämpfe bestimmte, d.h. im Rahmen der Evolution der gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Menschen miteinander verbinden und sie gleichzeitig in Klassen für die Produktion der Existenzmittel teilen – die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Um zu wissen, ob der Sozialismus möglich ist, muss man beurteilen können, ob diese gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse zu einer Barriere für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte geworden sind und somit eine Ersetzung des Kapitalismus durch den Sozialismus erfordern. Für Battaglia hingegen spielt es keine Rolle, in welchem historischen Zusammenhang sich der Kapitalismus entwickelt: „Der widersprüchliche Aspekt der kapitalistischen Produktion, die Krisen, die daraus herrühren, die Wiederholung des Akkumulationsprozesses, der zeitweise unterbrochen wird, der aber frisches Blut aus der Zerstörung des Übermaßes an Kapital und Produktionsmitteln erhält, führt nicht automatisch zu seiner Zerstörung. Entweder interveniert der subjektive Faktor, der im Klassenkampf seinen materiellen Angelpunkt und in der Krise seine ökonomisch bestimmende Voraussetzung hat, oder das Wirtschaftssystem reproduziert sich selbst, indem es all seine Widersprüche einmal mehr und auf einer höheren Stufe aufwirft, ohne auf diese Weise die Bedingungen für seine Selbstzerstörung zu schaffen.“ (Revolutionary Perspectives Nr. 32) So reicht der Klassenkampf, kombiniert mit der Episode einer Wirtschaftskrise, also aus, um die Möglichkeit eines revolutionären Ausgangs zu eröffnen: „Trotz des unbestreitbaren Erfolges des Kapitalismus, den Klassenkampf einzudämmen, bestehen seine Widersprüche weiter. Als Marxisten wissen wir, dass sie nicht ewig eingedämmt werden können. Die Explosion dieser Widersprüche wird nicht notwendigerweise in eine siegreiche Revolution münden. In der imperialistischen Ära ist der globale Krieg der Weg des Kapitals, seine Widersprüche zu ‚kontrollieren‘, ja zeitweilig zu lösen. Doch ehe dies passiert, bleibt die Möglichkeit, dass der politische und ideologische Zugriff der Bourgeoisie auf die Arbeiterklasse gebrochen wird. Mit anderen Worten: es könnten plötzliche Wellen von Massenkämpfen auftreten, und die Revolutionäre müssen darauf vorbereitet sein. Wenn die Klasse wieder einmal die Initiative ergreift und ihre kollektive Stärke gegen die Attacken des Kapitals nutzt, müssen sich die revolutionären politischen Organisationen in einer Position befinden, die es ihnen ermöglicht, die notwendigen politischen und organisatorischen Auseinandersetzung mit den Kräften der linken Bourgeoisie zu führen.“
Battaglia hält es nicht für notwendig, darüber zu befinden, ob die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse historisch obsolet geworden sind, und hält eine Dekadenzperiode für nichtig, weil das System „frisches Blut aus der Zerstörung des Übermaßes an Kapital und Produktionsmitteln erhält“ und das Wirtschaftssystem nach jeder Krise sich selbst„reproduziert (...), indem es all seine Widersprüche einmal mehr und auf einer höheren Stufe aufwirft“.
Die Vorbedingungen der Revolution
Die Tatsache, dass Marx imstande war zu sagen, dass „die ganze Scheisse“ (Brief Marx an Engels v. 30.04.1868, MEW Bd. 32, S. 75) der politischen Ökonomie schliesslich im Klassenkampf auflöst, auch wenn er einen Gutteil seines Lebens mit der Kritik der politischen Ökonomie verbrachte, zeigt, dass, während der Klassenkampf der Ausschlag gebende Faktor, der Motor der Geschichte ist, Marx einen großen Teil seiner Aufmerksamkeit den objektiven Fundamenten widmete, den ökonomischen, sozialen und politischen Zusammenhängen, in welchen der Klassenkampf sich entfaltet. Dies zu wiederholen, wie es Battaglia tut, heißt offene Türen einrennen, da niemand, von Marx bis zur IKS, behauptet, dass einer dieser Faktoren allein (Wirtschaftskrise oder Klassenkampf) ausreicht, um den Kapitalismus zu stürzen. Was Battaglia des Weiteren nicht begreift, ist, dass selbst diese beiden Faktoren zusammen nicht ausreichen! Der Punkt hier ist, dass Perioden, in denen die Wirtschaftskrise und der Klassenkampf zusammen auftreten, seit den ersten Tagen des Kapitalismus vorgekommen sind, ohne in irgendeiner Weise die Möglichkeit des Sturzes des Kapitalismus heraufbeschworen zu haben. Was Marx durch den historischen Materialismus bewies, war, dass wenigstens drei Faktoren unerlässlich sind: ein krisenhaftes Intermezzo, Klassenkonflikte, aber auch die Dekadenz einer Produktionsweise (in diesem Fall des Kapitalismus). Dies verstanden die Begründer des Marxismus sehr gut: Nachdem sie über eine Reihe von Anlässen, die der Kapitalismus bot, nachgedacht hatten, waren sie stets in der Lage, ihre Diagnose zu revidieren (wir verweisen dabei den Leser auf die kurze Geschichte der Analysen, die Marx und Engels über die Bedingungen und den Moment des Eintreffens der Dekadenz angestellt haben, welche wir in der Internationale Revue Nr. 118 (engl., franz., span. Ausgabe) veröffentlicht haben). Engels sollte diese Untersuchung in seiner Einführung von 1895 zur Marx‘ „Die Klassenkämpfe in Frankreich“ schließen, als er schrieb: „ Die Geschichte hat uns und allen, die ähnlich dachten, unrecht gegeben. Sie hat klargemacht, daß der Stand der ökonomischen Entwicklung auf dem Kontinent damals noch bei weitem nicht reif war für die Beseitigung der kapitalistischen Produktion: sie hat dies bewiesen durch die ökonomische Revolution, die seit 1848 den ganzen Kontinent ergriffen (…) so beweist dies ein für allemal, wie unmöglich es 1848 war, die soziale Umgestaltung durch einfache Überrumpelung zu erobern.“
Doch dies ist nicht alles, denn was Battaglia überhaupt nicht begriffen hat, ist, dass eine vierte Bedingung für den Ausbruch einer Periode erforderlich ist, die eine siegreiche aufständische Bewegung begünstigt: die Eröffnung eines historischen Kurses zu Klassenkonfrontationen. In den 30er Jahren waren die ersten drei Minimalbedingungen (Wirtschaftskrise, soziale Konflikte und die Dekadenzperiode) präsent, doch sie wurden von einem historischen Kurs überlagert, der zum imperialistischen Krieg führte. Dies zu verstehen war der wichtigste Beitrag der Italienischen Fraktion. In Kohärenz mit der Analyse der Kommunistische Internationale, die die durch den I. Weltkrieg eröffnete Periode als das „Zeitalter der Kriege und Revolutionen“ definierte, entwickelte die Fraktion die Analyse des historischen Kurses zu Klassenkonfrontation oder zum Krieg. Die Gauche Communiste de France (1942-52) – und danach die IKS – griffen diese Analyse auf und entwickelten sie weiter, doch sie waren nicht ihre Urheber, wie Battaglia wahrheitswidrig behauptet: „Die schematische Konzeption der historischen Perioden – historisch zur französischen Kommunistischen Linken gehörend, der die IKS ihre Existenz verdankt – charakterisiert historische Perioden als revolutionär oder konterrevolutionär auf der Grundlage abstrakter Überlegungen über die Bedingungen der Arbeiterklasse.“ (Internationalist Communist Nr. 21, eigene Übersetzung) Diese Fälschung der Geburtsurkunde versetzt Battaglia in die Lage, unsere politischen Ahnen wahrheitswidrig der Unglaubwürdigkeit preiszugeben und gleichzeitig das Erbe der Italienischen Fraktion für sich zu beanspruchen, ohne sich wirklich für deren wichtige theoretische Beiträge auszusprechen.
Die Notwendigkeit eines historischen Rahmens für die Erarbeitung von Klassenpositionen
„Die grundlegende und wichtigste Voraussetzung der sozialen Revolution ist ein bestimmtes Niveau der Entwicklung der Produktivkräfte… Es ist ein bestimmtes Entwicklungsniveau der Technik notwendig. Fassen wir die ganze kapitalistische Welt ins Auge: Ist dieses Niveau erreicht? Zwefellos.“ (L. Trotzki: „Europa und Amerika“, 1926) Diese Frage ist in der Tat fundamental, entscheidend für das Proletariat, wie Trotzki sagt, weil zu wissen, ob eine Produktionsweise im Auf- oder Abstieg begriffen ist, bedeutet, sich schlüssig darüber zu sein, ob sie noch fortschrittlich ist im Sinne der Weiterentwicklung der Menschheit oder ob sie, historisch gesehen, ihre besten Tage hinter sich hat. Zu wissen, ob der Kapitalismus der Welt noch etwas zu bieten hat oder ob er überholt ist, beinhaltet folgenschwere Konsequenzen hinsichtlich der Strategie und der politischen Positionen des Proletariats, die sich, je nachdem, radikal voneinander unterscheiden. Trotzki war sich dessen wohl bewusst, als er seine Reflexionen über den Charakter der Russischen Revolution fortsetzte: „Am besten beweist das die Rolle des russischen, noch ganz jungen Proletariats.“ (ebenda) Jene, die der Theorie der Dekadenz den Rücken kehren, sollten über diese Worte Trotzkis nachsinnen. Andernfalls werden sie bei der Schlussfolgerung enden, dass die Menschewiki doch Recht hatten, als sie sagten, dass in Russland in Wahrheit eine bürgerliche Revolution auf der Tagesordnung stand und nicht eine proletarische Revolution, dass die Gründung der Kommunistischen Internationale auf einer Illusion basierte, dass die Kampfmethoden, die im 19. Jahrhundert angewendet wurden, auch heute noch gültig sind und so weiter. Als konsequenter Marxist antwortete Trotzki ohne Zögern: „Aber seit dem kapitalistischen Krieg änderte sich das Bild vollständig. Die Produktivkräfte wachsen nicht, sie zerfallen. Es ist ihnen im Rahmen des Privateigentums allmählich zu eng geworden…Der Rahmen des privaten Eigentumsrechtes auf die Produktionsmittel und der Rahmen jener nationalen Staaten…drücken weit mehr auf die Produktivkräfte als früher.“ (ebenda). Diese Diagnose – das Ende der historisch fortschrittlichen Rolle des Kapitalismus und die Bedeutung des Ersten Weltkrieges als Wendepunkt beim Übergang von seiner aufsteigenden zu seiner dekadenten Phase - wurde von allen Revolutionären jener Zeit geteilt, auch von Lenin: „Aus einem Befreier der Nationen, der er in der Zeit des Ringens mit dem Feudalismus war, ist der Kapitalismus in der imperialistischen Epoche zum grössten Unterdrücker der Nationen geworden. Früher fortschrittlich, ist der Kapitalismus jetzt reaktionär geworden, er hat die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass der Menschheit entweder der Übergang zum Sozialismus oder aber eine jahre-, ja sogar jahrzehntelanger bewaffneter Kampf der „Gross“mächte um die künstliche Aufrechterhaltung des Kapitalismus mittels der Kolonien, Monopole, Privilegien und jeder Art von nationaler Unterdrückung bevorsteht.“ (W. I. Lenin: „Sozialismus und Krieg“, Werke Bd. 21, S. 302)
Wenn man, wie Battaglia, damit argumentiert, dass der Kapitalismus sich selbst „reproduziert (...), indem er all seine Widersprüche einmal mehr und auf einer höheren Stufe aufwirft“, wendet man sich nicht nur von der materialistischen, marxistischen Argumentation über die Möglichkeit einer Revolution ab, wie wir gesehen haben, sondern man hindert sich auch selbst daran zu verstehen, warum Millionen von Menschen sich eines Tages dazu durchringen sollen, ihr Leben in einem Bürgerkrieg aufs Spiel zu setzen, um dieses System durch ein anderes zu ersetzen, denn wie Engels sagte: „Solange eine Produktionsweise sich im aufsteigenden Ast ihrer Entwicklung befindet, solange jubeln ihr sogar diejenigen entgegen, die bei der ihr entsprechenden Verteilungsweise den kürzern ziehn. So die englischen Arbeiter beim Aufkommen der großen Industrie. Selbst solange diese Produktionsweise die gesellschaftlich-normale bleibt, herrscht im ganzen Zufriedenheit mit der Verteilung, und erhebt sich Widerspruch – dann aus dem Schoß der herrschenden Klasse selbst (Saint-Simon, Fourier, Owen) und findet bei der ausgebeuteten Masse erst recht keinen Anklang.“ (Anti-Dühring, Zweiter Abschnitt: Politische Ökonomie) Wohingegen wir bei Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz die materiellen und (in bestimmten Momenten) die subjektiven Verhältnisse haben, in denen das Proletariat die Bedingungen und den Anlass vorfindet, um den Aufstand zu wagen. So fährt Engels fort: „Erst wenn die fragliche Produktionsweise ein gut Stück ihres absteigenden Asts hinter sich hat, wenn sie sich halb überlebt hat, wenn die Bedingungen ihres Daseins großenteils verschwunden sind und ihr Nachfolger bereits an die Tür klopft – erst dann erscheint die immer ungleicher werdende Verteilung als ungerecht, erst dann wird von den überlebten Tatsachen an die sogenannte ewige Gerechtigkeit appelliert. Dieser Appell an die Moral und das Recht hilft uns wissenschaftlich keinen Fingerbreit weiter; die ökonomische Wissenschaft kann in der sittlichen Entrüstung, und wäre sie noch so gerechtfertigt, keinen Beweisgrund sehn, sondern nur ein Symptom. Ihr Aufgabe ist vielmehr, die neu hervortretenden gesellschaftlichen Missstände als notwendige Folgen der bestehenden Produktionsweise, aber auch gleichzeitig als Anzeichen ihrer hereinbrechenden Auflösung nachzuweisen, und innerhalb der sich auflösenden ökonomischen Bewegungsform die Elemente der zukünftigen, jene Missstände beseitigenden, neuen Organisation der Produktion und des Austausches aufzudecken.“ (ebenda)
Es ist genau dies, was Battaglia in seiner Ignoranz gegenüber dem Dekadenzkonzept zu vergessen im Begriff ist: Seine „ökonomische Wissenschaft“ dient nicht mehr dazu, die „gesellschaftlichen Missstände“, die „Anzeichen ihrer hereinbrechenden Auflösung“ aufzuzeigen, woran uns die Gründer des Marxismus erinnerten; sie dient statt dessen dazu, linksextremistische, antiglobalistische Prosa über das Überleben des Kapitalismus durch den Einsatz von Finanzkapital, die Neuzusammensetzung des Proletariats, die auf Mikrochips basierende „neue industrielle Revolution“, etc. neu zu verpacken. „Der lange Widerstand des westlichen Kapitals gegen die Krise des Akkumulationszyklus‘ (oder der Konkretisierung des tendenziellen Falls der Profitrate) hat bisher den vertikalen Kollaps vermieden, der den Staatskapitalismus des Sowjetimperiums mitgerissen hatte. Dieser Widerstand ist von vier grundlegenden Faktoren ermöglicht worden: (1) die Ausgereiftheit der Finanzkontrollen auf internationaler Ebene; (2) eine gründliche Umstrukturierung des Produktionsapparates, die einen schwindelerregenden Anstieg in der Produktivität mit sich brachte... (3) die konsequente Zerschlagung der alten Klassenzusammensetzung, mit dem Verschwinden der veralteten Aufgaben und Rollen und dem Erscheinen neuer Aufgaben, neuer Rollen und neuer proletarischer Kräfte (...) Die Umstrukturierung des Produktionsapparates ist zur gleichen Zeit erfolgt wie die, wie wir sie nennen können, dritte industrielle Revolution im Kapitalismus (...) die dritte industrielle Revolution wird vom Mikroprozessor verkörpert.“ (Prometeo Nr. 8, „Thesen des IBRP über die Arbeiterklasse in der gegenwärtigen Periode und ihre Perspektiven (Entwurf)“)
Als Battaglia noch das Dekadenzkonzept vertrat, bekräftigte es sehr deutlich: „Die beiden Weltkriege und die gegenwärtige Krise sind ein historischer Beweis dafür, was ein System, das so dekadent ist wie der Kapitalismus, für den Klassenkampf bedeutet“.[18] [140] Jetzt hingegen, wo es diesem Konzept den Rücken gekehrt hat, denkt Battaglia, dass „die Lösung des Krieges als das Hauptmittel zur Lösung der Probleme des Kapitals bei der Verwertung erscheint“ und dass Kriege die Funktion haben, „das Verhältnis zwischen den verschiedenen Sektoren des internationalen Kapitals zu regeln“. Oder wie in der IBRP-Plattform von 1997 gesagt wird: „Der globale Krieg kann für das Kapital zeitweilig ein Mittel sein, um seine Widersprüche zu lösen.“[19] [140]
Während Battaglia auf seinem IV. Kongress in den „Thesen über die heutigen Gewerkschaften und die kommunistische Aktion“ noch fähig war, sich auf die folgende Passage aus seiner Gewerkschaftskonferenz 1947 zu beziehen: „In der gegenwärtigen Phase der Dekadenz der kapitalistischen Gesellschaft ist die Gewerkschaft dazu bestimmt, als ein wichtiges Instrument in der Politik der Bewahrung zu dienen und somit die exakten Funktionen eines Staatsorgans zu übernehmen“, wird uns nun erzählt, dass noch heute die Gewerkschaften in der Lage seien, die unmittelbaren Interessen der Arbeiterklasse zu verteidigen, wenn die Profitrate, wie in den letzten zehn Jahren, ansteigt: „Alles, was die Gewerkschaftskämpfe auf dem reformistischen Terrain, d.h. auf dem Terrain der gewerkschaftlichen und institutionellen Vermittlung, im Bereich der Gesundheit, der sozialen Absicherung und Bildung errangen, errangen sie in der aufsteigenden Phase des Zyklus‘ (in den 50er und teilweise in den 70er Jahren)“ Erst als die Profitrate wieder sank, spielten die Gewerkschaften eine konterrevolutionäre Rolle: „Die Gewerkschaften – stets ein Instrument der Vermittlung zwischen Kapital und Arbeit bezüglich des Preises und der Bedingungen für den Verkauf von Arbeitskraft – haben nicht den Inhalt, sondern den Sinn der Vermittlung modifiziert: Es sind nicht mehr Arbeiterinteressen, die repräsentiert und verteidigt werden gegenüber dem Kapital, sondern die Interessen des Kapitals, die verteidigt und vor der Arbeiterklasse maskiert werden. Dies deshalb, weil – besonders in der Periode der Krise des Akkumulationszyklus‘ – die bloße Verteidigung der unmittelbaren Interessen der Arbeiter gegen die Angriffe des Kapitals direkt die Stabilität und das Überleben der kapitalistischen Verhältnisse in Frage stellt.“ (Prometeo Nr. 8, Thesenentwurf, eigene Übersetzung) Die Gewerkschaften haben demzufolge eine doppelte Funktion, je nachdem, ob die Profitrate nach oben oder nach unten geht. Ein wahrhafter Triumph des Vulgärmaterialismus, nicht wahr?
Selbst der Charakter der stalinistischen und sozialdemokratischen Parteien wird in diesem Licht betrachtet. Sie werden nun als Parteien dargestellt, die die unmittelbaren Interessen der Arbeiter vertreten, da sie einst „die Rolle der Vermittlung der unmittelbaren Interessen des Proletariats in den westlichen Demokratien gespielt hatten, in Kontinuität mit der klassischen Rolle der Sozialdemokratie“, wohingegen seit dem Fall der Berliner Mauer „das Scheitern des ‚realen Sozialismus‘ sie dazu führte, zwar ihre Rolle als nationale Parteien aufrechtzuerhalten, aber auch die Klasse als Objekt der demokratischen Vermittlung aufzugeben (...) Tatsache bleibt, dass die Arbeiterklasse sich somit den immer gewaltsameren Angriffen des Kapitals vollkommen ausgeliefert sieht“ (ebenda). Träumen wir? Vergießt Battaglia tatsächlich Tränen darüber, dass bürgerliche Institutionen wie die Stalinisten und Sozialdemokraten angeblich ihre frühere Fähigkeit verloren haben, die unmittelbaren Interessen der Arbeiter zu verteidigen?
Ähnlich verhält es sich mit dem System der sozialen Sicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg: Statt es als eine besonders schädliche Politik des Staatskapitalismus zu sehen, die darauf ausgerichtet war, die Solidarität innerhalb der Arbeiterklasse in eine ökonomische Abhängigkeit vom Staat umzuwandeln, betrachtet Battaglia es als eine Errungenschaft der Arbeiterklasse, als eine wahrhaftige Reform: „Während der 1950er Jahre nahmen die kapitalistischen Ökonomien wieder Fahrt auf (...) Dies wurde unbestreitbar durch eine Verbesserung in den Lebensbedingungen der Arbeiter (soziale Sicherheit, Tarifverträge, Lohnsteigerungen...) manifestiert. Diese Konzessionen wurden unter dem Druck der Arbeiter von der Bourgeoisie zugestanden...“ (IBRP in Bilan et Perspectives, Nr. 4, S. 5 – 7, eigene Übersetzung). Noch schwerwiegender ist die Tatsache, dass Battaglia die „Tarifverträge“, die Vereinbarungen also, die es den Gewerkschaften gestatten, als Polizei in den Betrieben zu agieren, gar als ein Beispiel betrachtet für „soziale Errungenschaften, die durch mächtige Kämpfe (der Bourgeoisie) abgerungen wurden“.
Wir haben hier nicht den Platz, um in die Details all der politischen Rückschritte zu gehen, die Battaglias endgültiger Abkehr vom Rahmen der Dekadenz zur Erarbeitung von Klassenpositionen folgten. Wir werden auf diese Rückschritte in weiteren Artikeln zurückkommen. Wir möchten an dieser Stelle lediglich ein paar Beispiele anführen, die den Leser in die Lage versetzen sollen zu verstehen, dass es zwischen der Abkehr von der Dekadenztheorie und der Annahme typisch linksextremistischer Positionen nur ein kurzer Weg ist, ein fürchterlich kurzer Weg! Und wenn Battaglia uns Seite um Seite erzählt, dass es notwendig sei, den neuen Wandel zu verstehen, der auf der Welt vor sich gehe, und dass wir, die IKS, unfähig seien, dies zu tun[20] [140], dann erkennt es nicht, dass es sich auf demselben Weg befindet, den auch die Reformisten Ende des 19. Jahrhunderts eingeschlagen hatten: Auch damals geschah es im Namen des „Verständnisses der neuen Realitäten im ausgehenden 19. Jahrhundert“, als Bernstein und Co. ihre Revision des Marxismus rechtfertigten. Indem es sich endgültig von der Dekadenztheorie abwendet, glaubt Battaglia einen großen Schritt zum Verständnis der „neuen Realitäten in der Welt“ gemacht zu haben. Tatsächlich ist Battaglia kurz davor, zum 19. Jahrhundert zurückzukehren. Wenn das „Verständnis der neuen Realitäten der Welt“ bedeutet, das marxistische Objektiv der Dekadenztheorie in das Objektiv des Linksextremismus umzutauschen, dann nein danke! Wir können sehr deutlich sehen, dass die wiederholte Abwesenheit des Begriffs der Dekadenz in seinen verschiedenen Plattformen (mit Ausnahme seiner Integration in seine Grundsatzpositionen zurzeit der Internationalen Konferenzen der Gruppen der Kommunistischen Linken) der Ursprung für all die opportunistischen Verirrungen Battaglias seit seiner Gründung ist.
Schlussfolgerung
Trotz ihrer so theoretischen Ansprüche ist die Kritik Battaglias am Dekadenzkonzept letztendlich nicht mehr als eine Wiederauflage jener Kritik, die Bordiga vor 50 Jahren vorgebracht hatte. In diesem Sinn kehrt Battaglia zu seinen ursprünglichen bordigistischen Wurzeln zurück. Die Kritik am angeblichen „Fatalismus“ der Dekadenztheorie wurde bereits von Bordiga auf dem Römischen Treffen 1951 geübt: „Die jüngste Behauptung, dass der Kapitalismus sich auf seinem absteigenden Ast befindet und nicht mehr hochklettern kann, enthält zwei Irrtümer: einen fatalistischen und einen gradualistischen“. Was Battaglias andere Kritik an der Dekadenztheorie angeht, wonach der Kapitalismus „frisches Blut aus der Zerstörung des Übermaßes an Kapital und Produktionsmitteln erhält“ und somit „das Wirtschaftssystem sich selbst reproduziert, indem es einmal mehr und auf höherer Ebene all seine Widersprüche aufwirft“, so wurde auch dies von Bordiga auf besagten Römischen Treffen bereits vorgebracht: „Die marxistische Vision kann durch so viele im Aufstieg befindliche Branchen, die gerade erst ihren Zenit erreichen, dargestellt werden...“; und in seinem Dialog mit dem Tod: „Der Kapitalismus wächst ohne Unterlass und über alle Grenzen hinweg...“ Doch wie wir gesehen haben, ist dies nicht die Sichtweise des Marxismus, weder von Marx: „Die universelle Tendenz des Kapitals erscheint hier, die es von früheren Produktionsstufen unterscheidet. Obgleich seiner Natur nach selbst borniert, strebt es nach universeller Entwicklung der Produktivkräfte und wird so die Voraussetzung der neuer Produktionsweise… Diese Tendenz – Die das Kapital hat… und es zu seiner Auflösung treibt…“ (Grundrisse , S. 438.) noch von Engels „ist es vielmehr, die neu hervortretenden gesellschaftlichen Missstände als notwendige Folgen der bestehenden Produktionsweise, aber auch gleichzeitig als Anzeichen ihrer hereinbrechenden Auflösung nachzuweisen, und innerhalb der sich auflösenden ökonomischen Bewegungsform die Elemente der zukünftigen, jene Missstände beseitigenden, neuen Organisation der Produktion und des Austausches aufzudecken“ (F. Engels, Anti-Dühring).[21] [140]
Was der Marxismus behauptet, ist
nicht, dass die kommunistische Revolution das unvermeidliche Resultat der
tödlichen Widersprüche ist, die den Kapitalismus bis zu den Punkt bringen, wo
er sich selbst unmöglich macht (Engels) und in die Selbstzerstörung treibt
(Marx), sondern dass, wenn das Proletariat nicht in der Lage ist, seine
historische Mission zu erfüllen, die Zukunft nicht in einem Kapitalismus
bestehen wird, der „sich selbst
reproduziert, indem er einmal mehr und auf höherer Ebene all seine Widersprüche
aufwirft“ und der „ohne Unterlass und
über alle Grenzen hinweg“ wächst, wie Battaglia
und Bordiga behaupten. Die Zukunft des Kapitalismus heißt Barbarei. Eine
Barbarei, die seit 1914 nicht aufgehört hat zu wachsen, von der Schlächterei
von Verdun über den Holocaust, den Gulag und Hiroshima bis hin zum Genozid in
Kambodscha und Ruanda. Um zu verstehen, was die Alternative zwischen
Sozialismus und Barbarei bedeutet, muss man die Dekadenz des Kapitalismus
begreifen.
[1] [140] Insbesondere in den folgenden zwei Artikeln: in
Prometeo Nr. 8, Reihe 4 (Dezember 2003), „Für eine Definition des
Dekadenzkonzepts“, verfasst von Damen jun. (erhältlich auf Französisch auf der
IBRP-Website – www.ibrp.org [108] – und auf Englisch in Revolutionary Perspectives
Nr. 32, Reihe 3, Sommer 2004) und in Internationalist Communist Nr. 21,
„Kommentare zur jüngsten Krise in der IKS“, verfasst von Stefanini jun.
[2] [140] „Die Arbeit innerhalb der ökonomischen Gewerkschaftsorganisationen der Arbeiter mit Blick auf ihre Weiterentwicklung und Stärkung ist eine der ersten politischen Aufgaben der Partei (...) Die Partei strebt die Rekonstruktion eines einheitlichen Gewerkschaftsbundes an (...) Die Kommunisten tun in aller Offenheit kund, dass die Funktion der Gewerkschaft nur vervollständigt und nur ausgeweitet werden kann, wenn sie von der politischen Klassenpartei des Proletariats angeführt wird.“ (Punkt 12 der Politischen Plattform der PCInt, 1946, eigene Übersetzung)
[3] [140] „Die Konferenz schlägt nach einer breiten Diskussion des Gewerkschaftsproblems die allgemeine Billigung des Punktes 12 der Politischen Plattform der Partei vor und mandatiert somit das Zentralkomitee, in Übereinstimmung mit dieser Orientierung ein Gewerkschaftsprogramm zu erarbeiten.“ (Protokolle der Ersten nationalen Konferenz der PCInt, eigene Übersetzung)
[4] [140] Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Italienischer Gewerkschaftsbund)
[5] [140] die politische Emigration nicht allein die Arbeit der Linksfraktion leistete, welche die Initiative beim Aufbau des PCInt 1943 ergriff, dass diese Gründung aber doch auf den Grundlagen entstand, die die Emigration ab 1927 bis zum Krieg verteidigte.“ (Einführung zur politischen Plattform der PCInt, Publikation der Internationalen Kommunistischen Linken, 1946, S. 12)
[6] [140] Siehe zum Beispiel die interessante Studie über „Dekadente Akkumulation“ in L’Internationaliste (1946), dem Monatsbulletin der belgischen Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken, oder ihre erste Broschüre mit dem Titel „Entre deux mondes“, veröffentlicht im Dezember 1946: „die Schlacht findet zwischen zwei Welten statt: der dekadenten kapitalistischen Welt und der aufsteigenden proletarischen Welt (...) Mit der Krise von 1913 ist der Kapitalismus in seine Dekadenzphase eingetreten.“
[7] [140] Woher kommt eine solche politische Heterogenität und Kakophonie? In Wahrheit fand die Gründung der PCInt zunächst auf ihrer ersten Konferenz 1943 in Turin statt und schließlich noch einmal auf ihrer Ersten nationalen Konferenz 1945, mit der Verabschiedung ihrer Politischen Plattform. Sie war eine bunt zusammengewürfelte Gruppierung aus Genossen und Kernen mit diversen politischen Horizonten und Positionen, von den Gruppen in Norditalien, die von der Fraktion im Exil und den alten Militanten beeinflusst waren, welche aus der vorzeitigen Auflösung der Fraktion 1945 herkamen, über die Gruppen um Bordiga aus Süditalien, die dachten, dass es möglich sei, die Kommunistischen Parteien wiederzubeleben, und die in der Frage des Charakters der UdSSR konfus blieben, bis hin zu Elementen der Minderheit, die 1936 wegen ihrer Teilnahme an den republikanischen Milizen während des spanischen Bürgerkriegs aus der Fraktion ausgeschlossen worden waren, und der Vercesi-Tendenz, welche am Antifaschistischen Komitee Brüssel teilgenommen hatte. Auf solch einer heterogenen organisatorischen und politischen Grundlage konnte nur der niedrigste gemeinsame Nenner gewählt werden. Man kann nicht allzu viel Klarheit von all dem erwarten, besonders in der Frage der Dekadenz.
[8] [140] Erhältlich auf Französisch auf der Website von Battaglia: „Thesen über die heutigen Gewerkschaft und die kommunistische Aktion“. Solche Widersprüche zum Punkt 12 ihrer Plattform von 1945 über die Gewerkschaftsfrage zeigen sich auch in dem Bericht, der von der Exekutivkommission der Partei über „Die Evolution der Gewerkschaften und die Aufgaben der Internationalistischen Kommunistischen Gewerkschaftsfraktion“ präsentiert wurde, veröffentlicht in Battaglia Comunista Nr. 6, 1948, und verfügbar auf Französisch in Bilan et Perspectives Nr. 5, November 2003).
[9] [140] Für weitere Details aus der Geschichte der Gründung der PCInt und ihrer Spaltung 1952 siehe unser Buch The Italian Communist Left und auch eine Reihe von Artikeln in unserer Internationalen Revue (internationale Ausgabe): „The ambiguities of the PCInt on ‚Partisans‘“ in Nr. 8, „A caricature of the party: the Bordigist party“ in Nr. 14, „Current problems of the revolutionary milieu“ in Nr. 32, „Against the concept of the ‚brillant leader‘“ in Nr. 33, „Response to Battaglia“ und „Against the PCInt’s concept of discipline“ in Nr. 34, „On the 2nd Congress of the PCInt“ in Nr. 36, „The origins of the ICC and the IBRP“ in Nr. 90, „The formation of the PCInt“ in Nr. 91, „Among the shadows of Bordigism and its epigones“ in Nr. 96, „Marxist and opportunist visions of the construction of the party“, Teil 1 in Nr. 103, Teil 2 in Nr. 105.
[10] [140] La doctrine du diable au corps, 1951, wiederveröffentlicht in Le Proletaire, Nr. 464 (die Zeitung der PCI auf Französisch); Le renversement de la praxis dans la theorie marxiste in Programme Communiste Nr. 56 (theoretische Zeitschrift der PCI in Frankreich); Protokolle des Römischen Treffens 1951, veröffentlicht in Invariance Nr. 4.
[11] [140] Es wurden drei Konferenzen abgehalten, die erste zwischen April und Mai 1977, die zweite im November 1978 und die dritte im Mai 1980. Im Verlauf der letzten Konferenz stellte Battaglia ein ergänzendes Beitrittskriterium vor, mit der Absicht, wie sie selbst sagten, unsere Organisation zu eliminieren. Lediglich zwei (Battaglia und die CWO) von fünf teilnehmenden Organisationen (BC, CWO, IKS, NCI, L’Eveil Internationaliste und die GCI als beobachtende Gruppe) akzeptierten dieses Kriterium, das daher nicht formal von der Konferenz akzeptiert wurde. Abgesehen von dieser formellen Frage markierte dieses Vermeiden von inhaltlichen Auseinandersetzungen das Ende dieses Klärungszyklus‘. Die vierte Konferenz, zu der lediglich von Battaglia und der CWO aufgerufen wurde, wurde allein von diesen beiden Gruppen und einer Gruppe iranischer maoistischer Studenten, die SUCM, die bald darauf verschwand, besucht. Der Leser kann Einsicht nehmen in die Protokolle dieser Konferenzen, aber auch in unseren Kommentaren in der Internationalen Revue (internationale Ausgabe) Nr. 10 (erste Konferenz), Nr. 16 und 17 (zweite Konferenz), Nr. 22 (dritte Konferenz) und Nr. 40, 41 (vierte Konferenz).
[12] [140] „Nun da die Krise des Kapitalismus eine Dimension und Tiefe erreicht hat, die ihren strukturellen Charakter nur bekräftigt, stellt sich die Notwendigkeit für ein richtiges Verständnis der historischen Phase, die wir als dekadente Phase des kapitalistischen Systems erleben...“ („Bemerkungen zur Dekadenz“, Teil 1, Prometeo Nr. 1, Reihe 4, erstes Vierteljahr 1978, S. 1, eigene Übersetzung). „Die Bestätigung der Vorherrschaft des Monopolkapitals markiert den Beginn der Dekadenz der bürgerlichen Gesellschaft. Der Kapitalismus hat, nachdem er die Monopolphase einmal erreicht hat, keine fortschrittliche Rolle mehr; dies bedeutet nicht, dass es keine Weiterentwicklung der Produktivkräfte gibt, sondern dass die Bedingungen für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte innerhalb der bürgerlichen Produktionsverhältnisse eine kontinuierliche Degradierung der Mehrheit der Menschheit bedeutet und der Barbarei entgegenstrebt.“ („Bemerkungen über die Dekadenz“, Teil 2, Prometeo Nr. 2, Reihe 4, März 1979, S. 24, eigene Übersetzung).
[13] [140] Wir zitieren aus den Texten, die von Battaglia auf der ersten und zweiten Konferenz vorgestellt wurden. „Krise und Dekadenz“: „Wenn dies geschieht, hört der Kapitalismus auf, ein fortschrittliches System zu sein – und tritt in seine dekadente Phase ein, die sich durch Versuche auszeichnet, seine eigenen Widersprüche zu lösen, indem er neue Formen der Produktionsorganisation kreiert (...) die wachsenden Interventionen des Staates in die Wirtschaft müssen als Anzeichen für die Unmöglichkeit betrachtet werden, die Widersprüche zu lösen, die sich in den gegenwärtigen Produktionsverhältnissen sammeln (...) Dies sind die deutlichsten Anzeichen für die dekadente Phase.“ (erste Konferenz) „Über die Krise und die Dekadenz“: „Exakt in dieser historischen Phase betrat der Kapitalismus seine Dekadenzphase (...) Zwei Weltkriege und die gegenwärtige Krise sind der historische Beweis dafür, was ein System, das so dekadent ist wie der Kapitalismus, für den Klassenkampf bedeutet, was auf der Ebene des Klassenkampfes die Permanenz eines dekadenten Systems bedeutet.“ (zweite Konferenz)
[14] [140] „Der Erste Weltkrieg, das Produkt der Konkurrenz zwischen den kapitalistischen Staaten, markiert einen endgültigen Wendepunkt in der Entwicklung des Kapitalismus. Er bestätigte, dass der Kapitalismus eine neue historische Ära eingeschlagen hat, die Ära des Imperialismus, wo ein jeder Staat Bestandteil der globalen kapitalistischen Ökonomie ist und nicht den Gesetzen entkommen kann, die jene Ökonomie beherrschen (...) Die Geschichtsepoche, in der die nationale Befreiung fortschrittlich für die kapitalistische Welt gewesen war, endete im ersten imperialistischen Krieg 1914 (...) heute können wir sehen, dass es einen markanten Unterschied zwischen politischen Organisationen des Proletariats aus der Vor-Oktober-Periode und jenen aus der darauffolgenden Periode gibt. Während des Aufstiegs des Kapitalismus und seiner Konsolidierung als vorherrschende Produktionsweise schufen bürgerliche nationalistische oder anti-despotische Bewegungen den Rahmen für die Mobilisierung der Massen europäischer Proletarier, was wiederum die Bildung großer Gewerkschafts- und Parteiorganisationen erleichterte. Innerhalb dieser Organe war die Arbeiterklasse in der Lage, ihre eigene Klassenidentität auszudrücken, indem sie ihre eigenen Forderungen stellte, wenn auch im Rahmen der herrschenden bürgerlichen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse (...) Die Gründung der Dritten Internationale, welche die Eröffnung einer proletarischen Weltrevolution ankündigte, signalisierte den Sieg der ursprünglichen Prinzipien des Marxismus. Die kommunistische Aktivität dreht sich nun allein um den Sturz des kapitalistischen Staates, um die Bedingungen für den Aufbau einer neuen Gesellschaft zu schaffen.“
[15] [140] Aus: „Antwort auf die stupiden Beschuldigungen einer Organisation auf dem Weg in die Auflösung“, erhältlich auf der IBRP-Website.
[16] [140] Erhältlich auf Französisch unter folgender Adresse: https://www.geocities.com/Capitol [141] Hill/3303/francia/crisis_du_cci_htm.
[17] [140] Wir sahen in der Internationalen Revue Nr. 35, dass Battaglia das Kapital nicht sehr gut gelesen hat, da der Begriff der Dekadenz sehr deutlich an etlichen Stellen auftaucht. Doch vielleicht ist dies nur ein Versuch von Battaglia, sich selbst einen Hauch von Autorität bei der Suche nach neuen Elementen für die Klassenpositionen zu verleihen. Im ersten Artikel unserer Reihe verwendeten wir über 20 Zitate aus dem Werk von Marx und Engels, von der Deutschen Ideologie bis zum Kapital via Manifest, Anti-Dühring, etc.
[18] [140] Texte, die Battaglia der Zweiten Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken vorstellte.
[19] [140] Erhältlich auf Französisch:https://www.geocities.com/CapitolHill/3303/francia/syndicat_aujourd.htm [142].
[20] [140] „... die IKS (...) eine Organisation, deren methodische und politische Basis außerhalb des historischen Materialismus gelegen ist und die sprachlos ist, um die Abfolge von Ereignissen in der ‚äußeren‘ Welt zu erklären“ (Internationalist Communist Nr. 21).
[21] [140] Was uns anbetrifft, so hat uns, nachdem wir mit dieser Reihe von Artikeln zur Verteidigung des historischen Materialismus bei der Analyse der Entwicklung von Produktionsweisen begonnen hatten, das neuerliche Lesen der Werke von Marx und Engels geholfen, mit großem Vergnügen neue und alte Passagen (wieder) zu entdecken, die völlig bestätigen, was wir hier vorbringen. Daher wiederholen wir unsere Aufforderung an alle Kritiker der Dekadenztheorie, uns auf Zitate der Gründungsväter hinzuweisen, die ihnen zufolge bestätigen, was sie über den historischen Materialismus zu sagen haben.
Internationale Revue 37 - Editorial
- 2508 Aufrufe
Eine neue Periode von Klassenkonfrontationen
Die Mobilisierung der jungen Generation künftiger Proletarier Frankreichs in den Universitäten, Oberschulen und auf den Demonstrationen wie auch die Solidarisierung zwischen den Generationen in diesem Kampf bestätigen die Eröffnung einer neuen Periode von Klassenkonfrontationen. Die faktische Kontrolle des Kampfes durch die allgemeinen Versammlungen (Massentreffen), ihre Kampfbereitschaft, aber auch die Nachdenklichkeit und Reife, die in ihnen zum Ausdruck kam – insbesondere ihre Fähigkeit, den meisten Fallen auszuweichen, die ihnen die herrschende Klasse stellte -, sind Indikatoren dafür, dass eine tiefgehende Bewegung im Klassenkampf im Gange ist. Ihre Dynamik wird Auswirkungen auf die kommenden Arbeiterkämpfe haben.[i] [143] Der Kampf gegen den CPE in Frankreich ist weder ein isoliertes noch ein rein „französisches“ Phänomen: Er ist der Ausdruck einer internationalen Häufung und Reifung des Klassenkampfes. In diesem Prozess sind etliche neue Merkmale zu Tage getreten, die in Zukunft noch an Stärke dazu gewinnen werden.
Wir sind noch immer weit entfernt von einem allgemeinen, massenhaften Kampf, doch wir können bereits Anzeichen für einen Wechsel in der Geisteshaltung innerhalb der Arbeiterklasse erkennen, für ein vertieftes Nachdenken besonders unter den jüngeren Generationen, die nicht das Opfer all der Kampagnen über den Tod des Kommunismus nach dem Zusammenbruch des Ostblocks 16 Jahre zuvor waren. In der „Resolution über die internationale Situation“, verabschiedet vom 16. Kongress und in der Internationalen Revue Nr. 36 veröffentlicht, zeigten wir auf, dass im Jahr 2003 ein „Wendepunkt“ im Klassenkampf stattgefunden hat, dessen Hauptmerkmal sich in der Neigung zu einer größeren Politisierung innerhalb der Arbeiterklasse ausdrückt. Wir warfen einen Blick auf folgende Merkmale des Kampfes:
„Sie bezogen bedeutende Sektoren der Arbeiterklasse in Ländern im Zentrum des weltumspannenden Kapitalismus mit ein (wie in Frankreich 2003);
sie traten mit Sorgen auf, die ausdrücklicher auch politische Fragen in den Vordergrund stellten;
zum ersten Mal seit der revolutionären Welle stand Deutschland wieder als Schwerpunkt der Arbeiterkämpfe da;
die Frage der Klassensolidarität wurde nun breiter und ausdrücklicher aufgeworfen denn je in den Kämpfen der 80er Jahre, insbesondere in den jüngsten Bewegungen in Deutschland;
sie wurden begleitet vom Auftauchen einer neuen Generation von Leuten, die nach politischer Klarheit suchen. Diese neue Generation hat sich einerseits im Auftreten von offen politisierten Leuten gezeigt, andererseits in neuen Schichten von Arbeitern, die zum ersten Mal in den Kampf getreten sind. Wie bestimmte wichtige Demonstrationen bewiesen haben, wird das Fundament gelegt für die Einheit zwischen der neuen Generation und derjenigen von 68 – sowohl der politischen Minderheit, welche die kommunistische Bewegung in den 60er und 70er Jahren aufgebaut hat, als auch den breiteren Schichten der Arbeiter, welche die reiche Erfahrung der Klassenkämpfe zwischen 1968 und 1989 in sich tragen.“
Nicht nur der Kampf gegen den CPE in Frankreich, auch andere Reaktionen gegen die Angriffe der Bourgeoisie haben die Richtigkeit dieser Aspekte vollkommen bestätigt.
Die Simultaneität der Arbeiterkämpfe
In zwei der wichtigsten Nachbarländer Frankreichs waren die Gewerkschaften zeitgleich zum Kampf gegen den CPE gezwungen, angesichts der wachsenden gesellschaftlichen Unzufriedenheit die Initiative zu übernehmen und ausgedehnte Streiks sowie Demonstrationen in einigen Bereichen zu organisieren.
In Großbritannien traten nach einem entsprechenden Aufruf der Gewerkschaften anderthalb Millionen Gemeindeangestellte in den Streik, um gegen die Reform des Rentensystems zu protestieren, die sie zwingen würde, bis 65 statt bis zum Alter von 60 zu arbeiten, um in den Genuss der vollen Rentenbezüge zu kommen. Dieser Ausstand war einer der massivsten Streiks in den letzten Jahren. Die herrschende Klasse inszenierte eine große Propagandakampagne, die die betroffenen Arbeiter als „privilegiert“ gegenüber den Beschäftigten in der Privatindustrie darstellte. Auch die Gewerkschaften taten alles, was sie konnten, um diese Kategorie von Arbeitern – Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes – zu isolieren, die auch weiterhin von der Möglichkeit „profitieren“ möchten, schon mit 60 Jahren in Rente zu gehen. Der Unmut der Arbeiter in Großbritannien war um so größer, als in den letzten Jahren 80.000 Arbeiter infolge des Bankrotts etlicher Rentenfonds ihre Rentenansprüche verloren hatten und gleichzeitig sämtliche Arbeiter einer langen Reihe von Angriffen durch die Blair-Regierung ausgesetzt waren.
In Deutschland folgte der Anstieg der Wochenarbeitszeit von 35 auf 40 Stunden ohne Lohnausgleich gleich nach dem massiven Arbeitsplatzabbau im Staatssektor. Diese Erhöhung der Wochenarbeitszeit ist nur einer der Angriffe, die in der „Agenda 2010“ ausgeheckt wurden, welche vom sozialdemokratischen Bundeskanzler Schröder mit Hartz IV eingeleitet wurde; ein Plan, der auch die Halbierung des Weihnachts- und Urlaubsgeldes für Staatsangestellte beinhaltete und zum ersten Streik im Öffentlichen Dienst seit zehn Jahren führte. Der Streik in Baden-Württemberg dauerte unter Führung der Gewerkschaften zweieinhalb Monate lang. Im ganzen Land begleiteten die öffentlichen Arbeitgeber diesen Ausstand mit einer breit angelegten Medienkampagne gegen ihre eigenen Arbeiter, von der Müllabfuhr bis zu den Krankenhausangestellten (Verfügungen, Drohungen, Streikteilnehmer wegen „Faulheit“ zu ersetzen, da sie sich weigern, 18 Minuten länger am Tag zu arbeiten). Neben der Medienkampagne, die die Angestellten des öffentlichen Dienstes als „privilegiert“ darstellen, da sie Arbeitsplatzsicherheit genössen, halfen auch DGB und Ver.di mit, die Arbeiter untereinander zu spalten, indem sie jeden Angriff als spezifisches Problem darstellten und die Streiks im Öffentlichen Dienst von den Kämpfen in der Privatindustrie isolierten. Unter dem Druck eines wachsenden sozialen Unmuts rief die IG Metall 80.000 Maschinenbauarbeiter in 333 Betrieben für den 28. März zum Streik auf, um Lohnsteigerungen in einem Industriebereich durchzusetzen, in dem die Löhne schon seit geraumer Zeit stagnieren und der erheblich vom Arbeitsplatzabbau und von Fabrikschließungen betroffen ist. Am 28. März (am Tag einer der größten Demonstrationen gegen den CPE in Frankreich) sah sich der sozialdemokratische Arbeitsminister in der Großen Koalition angesichts der Mobilisierung in Frankreich veranlasst, eine Maßnahme – sicher ist sicher – zurückzuziehen, die dem CPE auffallend ähnelte, war es doch die Absicht der deutschen Regierung, die Kündigungszeit für alle Jobs ebenfalls von sechs Monate auf zwei Jahre anzuheben.
Die soziale Unruhe erreichte auch die Vereinigten Staaten. In etlichen Städten wurden große Demonstrationen organisiert, um gegen ein dem Senat vorliegendes Gesetz (nachdem es im Dezember 2005 das Repräsentantenhaus passiert hatte) zu protestieren, das die illegale Einwanderung zu einem kriminellen Vergehen macht und die Repression nicht nur gegen die illegalen Einwanderer selbst verschärft, sondern auch gegen jeden, der ihnen Schutz oder Beistand gewährt. Es ist ebenfalls beabsichtigt, die Intensität der Kontrollen gegen Immigranten zu erhöhen und die Gültigkeit von Aufenthaltsgenehmigungen von sechs auf drei Jahre, bei nur einmaliger Erneuerung, zu reduzieren. Die Krönung all dessen stellt der Vorschlag der Bush-Administration dar, die Grenzbarrieren auszuweiten, die bereits an etlichen Stellen entlang der 3200 Kilometern langen Grenze zu Mexiko (besonders zwischen Tijuana und den südlichen Vororten von San Diego) existieren. In Los Angeles gingen am 27. März, im Anschluss an einer Demonstration von mehr als 100.000 Menschen in Chicago, zwischen 500.000 und einer Million Menschen auf die Straße. Ähnliche Aufläufe fanden in vielen anderen Städten statt, besonders in Houston, Phoenix, Denver und Philadelphia.
Nicht ein Monat vergeht, ohne dass irgendwo auf der Welt Kämpfe stattfinden, die, auch wenn wenig spektakulär, den wesentlichen Merkmalen des internationalen Arbeiterkampfes Ausdruck verleihen und die Saat der Zukunft legen: die Solidarisierung zwischen den Arbeitern über alle Grenzen der Berufsgruppen, Generationen und Nationalitäten hinweg.
Die Entwicklung der Arbeitersolidarität
Diese aktuellen Ausdrücke der Solidarität sind mit einem fast vollständigen Blackout durch die Medien begegnet worden.
Unter anderem fanden wichtige Kämpfe in Großbritannien statt. So traten in Nordirland 800 Postangestellte für fast drei Wochen in einen wilden Streik gegen Bußgelder und den Druck durch das Management, gegen die Erhöhung des Arbeitstempos und steigende Überbelastung. Direkter Anlass für die Mobilisierung der Arbeiter waren Disziplinarmaßnahmen, die gegen zwei Kollegen verhängt wurden, wobei der eine auf einem „katholischen“, der andere auf einem „protestantischen“ Postamt angestellt ist. Die Gewerkschaft der Kommunikationsangestellten zeigte ihr wahres Gesicht und opponierte gegen den Streik. Einer ihrer Sprecher erklärte in Belfast: „Wir weisen die Aktion zurück und fordern sie (die Streikenden, die Red.) auf, zur Arbeit zurückzukehren, wobei wir darauf hinweisen, dass diese Aktion illegal ist.“ Doch die Arbeiter setzten den Kampf, legal oder nicht, fort und zeigten, dass sie nicht der Gewerkschaften bedürfen, um sich zu organisieren.
In einer gemeinsamen Demonstration überquerten sie die „Grenze“, die die katholischen und protestantischen Bezirke voneinander trennt, bewegten sich über die Hauptstraßen des protestantischen Stadtteils, um daraufhin die Hauptstraße des katholischen Stadtteils hinunterzulaufen. Schon in den letzten Jahren haben andere Kämpfe, besonders im Gesundheitswesen, eine reelle Solidarisierung zwischen den Angestellten der verschiedenen Berufe zutage gefördert, doch diesmal kam es zum ersten Mal zu einer Solidarisierung zwischen „katholischen“ und „protestantischen“ Arbeitern in einer Provinz, die seit Jahrzehnten durch einen blutigen Bürgerkrieg zerrissen ist.
Daraufhin machten die Gewerkschaften mit der Hilfe der Linksextremisten eine Kehrtwende und erklärten scheinheilig ihre „Solidarität“, insbesondere durch die Organisierung von Streikposten auf jedem Postamt, so die Arbeiter faktisch voneinander isolierend und den Kampf sabotierend. Ungeachtet dieser Sabotage erweckte die offene Vereinigung von streikenden protestantischen und katholischen Arbeitern auf den Belfaster Straßen Erinnerungen an die großen Arbeitslosendemonstrationen von 1932, als Proletarier beider Seiten zusammenkamen, um gegen Kürzungen beim Stempelgeld zu kämpfen. Doch dies geschah in einer Periode der Niederlage der Arbeiterklasse, die es jenen beispielhaften Aktionen verunmöglichte, die Entwicklung des Klassenkampfes zu fördern. Mittlerweile gibt es jedoch ein größeres Potenzial in den anstehenden Kämpfe, die Politik des Teile-und-herrsche zu besiegen, die die herrschende Klasse praktiziert, um die kapitalistische Ordnung zu beschützen. Die Bedeutung des Kampfes der Postangestellten liegt in der Erfahrung der Klasseneinheit, die außerhalb der Kontrolle der Gewerkschaften in die Praxis umgesetzt wurde. Seine Folgen gehen weit über die lokale Situation seiner Protagonisten, den Postangestellten, hinaus; er bietet ein Beispiel, dem so weit wie möglich gefolgt werden sollte.
Tatsächlich ist dieser Kampf kein isoliertes Ereignis. Im Februar traten in Cottam nahe Lincoln im Zentrum Englands 50 Kraftwerksarbeiter aus Unterstützung ungarischer Immigrantenarbeiter, deren Bezahlung nur die Hälfte dessen betrug, was ihre englischen Kollegen erhalten, in den Streik. Ihre Verträge setzten die Immigrantenarbeiter der Willkür ihrer Arbeitgeber aus, die sie jederzeit kündigen oder ohne weitere Angaben in irgendeine andere Ecke Europas versetzen konnten. Auch hier widersetzten sich die Gewerkschaften dem Streik, sei er doch „illegal“, da weder die ungarischen noch die englischen Arbeiter darüber „demokratisch abgestimmt“ hätten. Die Medien verunglimpften ebenfalls den Streik: Ein lokales Wurstblatt grub einen Akademiker aus, der sagte, dass die Arbeiter des Vereinigten Königreiches zwar „ein gewisses Ehrgefühl“ bewiesen, wenn sie aus Solidarität gegenüber ihren Kollegen streiken. Jedoch seien dagegen „die Ausländer durchwegs in ihren Postämtern geblieben“ (eine überaus gelehrte Behauptung, die dummerweise von den Bildern ungarischer und englischer Arbeiter, die zusammen die Streikposten bildeten, konterkariert wurde). Für die Arbeiterklasse ist die Erkenntnis, dass alle Arbeiter die gleichen Interessen verteidigen, gleich welcher Nationalität sie sind oder wie hoch ihre Bezahlung bzw. Arbeitszeit ist, ein wichtiger Schritt vorwärts in der Entwicklung ihrer Fähigkeit, als vereinte Klasse in den Kampf zu treten.
In Reconvilier im Schweizerischen Jura streikten Ende Januar, nach einem Streik im November 2004, 300 Maschinenarbeiter bei Swissmetal einen Monat lang aus Solidarität mit 27 entlassenen Kollegen. Der Kampf begann ohne die Gewerkschaften, doch diese führten letztendlich die Verhandlungen mit den Bossen und konfrontierten die Arbeiter mit der Wahl, entweder die Lohnkürzungen wegen der Streiktage oder die Entlassungen zu akzeptieren: Die Streikenden wurden faktisch erpresst, entweder Lohnkürzungen oder Entlassungen zu akzeptieren. Wie ein Arbeiter aus Reconvilier sagte: Der Logik des kapitalistischen Systems zu folgen, bedeutet „die Wahl zwischen Pest oder Cholera“. Und eine weitere Welle von 120 Entlassungen ist bereits in Planung. Doch zumindest hat der Streik deutlich die Frage der Fähigkeit der Arbeiter aufgeworfen, sich dieser Erpressung und der Logik des Kapitals zu widersetzen. Ein anderer Arbeiter zog diese Lehre aus der Niederlage des Streiks: „Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir die Kontrolle über die Verhandlungen den Händen anderer überlassen haben.“
Im Juli 2005 traten die Arbeiter der Honda-Fabrik in Gurgaon, einem Vorort von Neu-Delhi, in einen Streik. Zusammen mit Massen von Arbeitern aus den benachbarten Betrieben in dieser Industriestadt und unterstützt von der ansässigen Bevölkerung, sahen sich die Arbeiter einer brutalen Repression und einer Welle von Verhaftungen durch die Polizei ausgesetzt. Am 1. Februar traten 23.000 Angestellte von 123 Flughäfen in einen Streik. Dieser Streik war eine direkte Antwort auf die Absicht des Managements, die Zahl der Flughafenangestellten um 40 Prozent zu reduzieren, und dies mittels der Entlassung von vorwiegend älteren Arbeitern, die wahrscheinlich nie mehr einen Job finden werden. Der Flugverkehr von Delhi und Mombay wurde vier Tage lang lahmgelegt und auch in Kalkutta beträchtlich gestört. Unter dem Vorwand eines Gesetzes gegen „illegale Akte, die den zivilen Flugverkehr gefährden“, erklärten die Behörden den Streik für illegal und entsendeten Polizei und paramilitärische Kräfte in etliche Städte, insbesondere nach Mombay, um die Streikenden zurück zur Arbeit zu zwingen. Als treue Partner der von der Kongresspartei angeführten Regierungskoalition verhandelten Gewerkschaften und Linksextremisten bereits am 3. Februar mit der Regierung. Schließlich riefen sie die Streikenden zu einem Treffen mit dem Premierminister auf und drängten sie gegen das leere Versprechen, die geplanten Entlassungen in den Flughäfen noch einmal zu überprüfen, zurück zur Arbeit. So säten sie den Spaltpilz unter den Arbeitern, zwischen jenen, die den Kampf fortsetzen wollten, und jenen, die der Ansicht waren, dass sie ihn beenden sollten.
Die Kampfbereitschaft der Arbeiter war auch in der Toyota-Fabrik im indischen Bangalore evident, wo Arbeiter 15 Tage lang, ab dem 4. Januar, gegen die Beschleunigung des Arbeitstempos streikten, die eine Häufung sowohl von Unfällen als auch von Bußgeldern durch das Management zur Folge gehabt hatte. Diese Strafen für „unzureichende Produktivität“ wurden systematisch vom Lohn abgezogen. Auch hier stießen die Arbeiter sofort auf den Widerstand der Gewerkschaften, die den Streik für illegal erklärten. Die Repression war massiv: 1500 der 2300 Streikenden wurden wegen „Störung des gesellschaftlichen Friedens“ inhaftiert. Da der Streik jedoch die Unterstützung anderer Arbeiter in Bangalore erhielt, sahen sich die Gewerkschaften und linksextremistischen Organisationen gezwungen, ein „Koordinationskomitee“ in anderen Betrieben in der Stadt einzurichten, das den Streik der Toyota-Arbeiter gegen die Repression unterstützte – um dieses Beispiel spontaner Arbeitersolidarität unter Kontrolle zu halten und zu sabotieren. Ebenfalls im Februar gingen andere Arbeiter in Bangalore auf die Straße, um ihre Unterstützung von 910 Arbeitern von Hindustan Lever in ihrem Kampf gegen Entlassungen zu demonstrieren.
Eine internationale Entwicklung von Kämpfen, die für die Zukunft hoffen lässt
Diese Beispiele bestätigen voll und ganz die Reifung und Politisierung des Kampfes, der mit dem „Wendepunkt“ von 2003 gegen die Rentenreformen besonders in Frankreich und Österreich seinen Anfang genommen hatte. Seither hat es eine Reihe klarer Ausdrücke der Arbeitersolidarität gegeben, über die wir, im Gegensatz zum von den Medien organisierten Blackout, in unserer Presse berichtet haben. Solche Reaktionen fanden ihren Ausdruck insbesondere im Streik bei Daimler-Chrysler im Juli 2004, als die Arbeiter in Bremen die Arbeit niederlegten und für ihre Kollegen in Sindelfingen-Stuttgart demonstrierten, die dazu erpresst werden sollten, entweder auf ihre „Vergünstigungen“ zu verzichten oder den Abbau von 6.000 Arbeitsplätzen zu riskieren, die das Management im letzteren Fall ausgerechnet nach Bremen zu verlagern gedachte.
Dasselbe galt auch für die Gepäckarbeiter in Heathrow, die im August 2005 - inmitten einer Anti-Terror-Kampagne im Zusammenhang mit den Londoner Bombenanschlägen - aus Unterstützung für 670 Arbeiter zumeist pakistanischer Herkunft, die von Gate Gourmet, einem Verpflegungslieferanten für Fluggesellschaften, entlassen worden waren, spontan in den Ausstand getreten waren.
Es gibt weitere Beispiele. Im September 2005 streikten 18.000 Mechaniker bei Boeing gegen den neuen Tarifvertrag, der vom Management vorgeschlagen wurde und mit dem beabsichtigt wird, sowohl die Renten als auch die Gesundheitszulagen zu kürzen. In diesem Konflikt kämpften die Arbeiter gegen die Differenzierung zwischen jungen und alten Arbeitern und zwischen Arbeitern verschiedener Betriebe. Noch deutlicher demonstrierte der Streik bei der New Yorker U-Bahn kurz vor Weihnachten 2005 gegen einen Angriff auf die Renten von künftig Eingestellten die Fähigkeit der Arbeiter, sich solchen Spaltungsmanövern zu verweigern. Trotz massiven Drucks bröckelte die Streikfront größtenteils nicht, da sich die Arbeiter wohl bewusst waren, dass sie für die Zukunft ihrer Kinder und der kommenden Generationen kämpften (was ein Schlag ins Gesicht der ganzen bürgerlichen Propaganda über die Integration bzw. Nicht-Existenz des amerikanischen Proletariats ist).
Im vergangenen Dezember gingen die Arbeiter von SEAT in Barcelona gegen die Gewerkschaften in den Ausstand, die eine „schändliche Vereinbarung“ unterzeichnet hatten, in der sie die Entlassung von 600 Arbeitern akzeptieren.
Im Sommer 2005 sah sich Argentinien mit der größten Streikwelle seit 15 Jahren konfrontiert, die das Gesundheitswesen, Nahrungsmittelveredelungsbetriebe, die U-Bahn von Buenos Aires betraf, aber auch die Gemeindeangestellten etlicher Provinzen und Schullehrer erfasste. An vielen Orten schlossen sich die Arbeiter anderer Betriebe den Demonstrationen der Streikenden an. Dies trat besonders im Fall der Ölindustrie, bei den Amtsangestellten, den Lehrern und den Gemeindeangestellten zutage, denen sich die Arbeitslosen von Caleta Olivia anschlossen. In Neuquen schlossen sich Angestellte aus dem Gesundheitswesen einer Demonstration streikender Lehrer an. In einem Kinderkrankenhaus forderten die Streikenden gleiche Lohnerhöhungen für alle Berufsgattungen. Die Arbeiter begehrten sowohl gegen die brutale Repression als auch gegen die verleumderischen Medienkampagnen auf.
Die Entwicklung eines Gespürs für Solidarität angesichts der massiven und frontalen Angriffe infolge der kapitalistischen Wirtschaftskrise verstärkt die Tendenz, die Barrieren des Handels, der Fabrik oder des Arbeitsplatzes, des Konzerns, der Industriebranche oder der Nationalität zu durchbrechen, die sämtliche nationale Bourgeoisien aufrechtzuerhalten versuchen. Gleichzeitig wird die Arbeiterklasse dazu gedrängt, die Leitung ihres Kampfes selbst zu übernehmen, sich selbst zu behaupten und Stück für Stück das Vertrauen in die eigene Stärke zurückzugewinnen. Dabei muss sie sich all den Manövern der herrschenden Klasse und der Sabotage der Gewerkschaften sowie deren Bemühungen, die Arbeiter isoliert zu halten, widersetzen. In diesem langen und schwierigen Reifungsprozess ist die Anwesenheit der jungen Arbeitergenerationen, die nicht die Auswirkungen des ideologischen Rückzugs nach 1989 erlebt haben, ein wichtiges, gewissermaßen dynamisches Element. Daher legen die heutigen Kämpfe, wie begrenzt und schwach sie auch sein mögen, den Grundstock für die kommenden Kämpfe.
Der Bankrott des Kapitalismus und die Vertiefung der Krise sind die Verbündeten des Proletariats
Offiziell befindet sich die Weltwirtschaft bei guter Gesundheit. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren und auch in Europa im vergangenen Jahr spürbar gesunken. So ist beispielsweise die spanische Wirtschaft dynamischer denn je. Und dennoch gibt es keine Atempause bei den Angriffen gegen die Arbeiterklasse. Im Gegenteil, in der Region von Detroit haben Ford und General Motors (das vom Konkurs bedroht ist) 60.000 Maschinenarbeiter entlassen. Bei SEAT in der Region von Barcelona und bei Fiat in Italien jagt ein Entlassungsplan den anderen.
Überall steht der Staat der Bosse, der oberste Repräsentant des nationalen Kapitals, an vorderster Front, wenn es darum geht, die Arbeiter zu attackieren: bei der wachsenden Prekarisierung der Arbeit (der CNE und CPE in Frankreich) und Flexibilisierung der Arbeitskräfte, bei den Angriffen auf die Renten und das Gesundheitssystem (Großbritannien, Deutschland). Fast überall befindet sich das Gesundheits- und Bildungssystem in der Krise. Die US-Bourgeoisie erklärt, dass sie wegen der Belastung der Bilanzen ihrer Konzerne durch die Renten nicht wettbewerbsfähig genug sei – Renten, die sich durch die Bankrotts und den Zusammenbruch der Börse in Luft aufgelöst haben.
Diese systematische Demontage des Wohlfahrtsstaates (Attacken gegen die Renten, gegen die sozialen Sicherheitssysteme und gegen die Arbeitslosen durch die Reduzierung des Stempelgeldes, Entlassungswellen in jedem Land und jeder Industriebranche, die Verallgemeinerung der Prekarisierung und Flexibilisierung der Arbeit) stürzt die heutigen Proletarier nicht nur in die Armut, sie bedeutet auch, dass das System immer weniger in der Lage ist, die neuen Arbeitergenerationen in den Produktionsprozess einzugliedern.
Überall werden diese Angriffe als „Reformen“ präsentiert, als eine strukturelle Anpassung an die Globalisierung der Weltwirtschaft. Eines ihrer Hauptmerkmale besteht darin, dass sie Junge wie Alte fast simultan treffen. Die Bourgeoisie befindet sich nicht überall im Zustand einer offenen Krise, aber all diese Angriffe sind Demonstrationen der historischen Sackgasse des Kapitalismus, für seinen äußersten Mangel an Perspektiven für die neuen Generationen. Jene Länder, die, wie in Europa, als Wirtschaftsmodelle offeriert werden (Spanien, Dänemark, Großbritannien), verbergen oftmals hinter der Fassade einer „gesunden Wirtschaft“ brutale Angriffe gegen die Arbeiter und eine beträchtliche Steigerung der Armut. Die ideologische Fassade hält der Realität in keiner Weise stand, wie wir dem Beispiel Großbritanniens entnehmen können, das in der ersten Aprilausgabe von Marianne beschrieben wurde: „Das Blair-Wunder drückt sich auch darin aus, dass eins von drei Kindern unterhalb der Armutsgrenze lebt. Eins von fünf Kindern, dass keine drei Mahlzeiten am Tag erhält (in einer Rede in der Toynbee Hall 1999 versprach Blair, ‚Kinderarmut innerhalb einer Generation auszurotten‘. Wie viele Jahre, denkt der Premierminister, macht eine Generation aus?). Von diesen Kindern schlafen fast 100.000 aus Platzmangel im Badezimmer oder in der Küche: Dies ist nicht überraschend, muss man doch bis 1925 zurückgehen, um eine Labour-Regierung zu finden, die weniger Wohnungen bauen ließ wie New Labour! Zehn Millionen sind weder in der Lage, Erspartes anzulegen, noch fähig, das Wenige, was sie haben, zu sichern. Sechs Millionen sind nicht in der Lage, sich wintergerecht zu kleiden. Zwei Millionen Wohnungen – meistens jene von Rentnern – sind unzureichend beheizt. Es wird geschätzt, dass 25.000 Rentner aufgrund des kalten Winters 2004 gestorben sind.“ Kann es eine bessere Demonstration des Bankrotts des kapitalistischen Systems geben als seine Unfähigkeit, nicht nur den Jungen Arbeit zu geben, sondern sie auch vor Kälte, Hunger und Armut zu bewahren?
Die Riots in den französischen Vorstädten sind ein klarer Ausdruck dieser Sackgasse. Wenn wir die Welt als Momentaufnahme betrachten, dann sieht die Situation gewiss verzweifelt aus. Die Welt ist voller Arbeitslosigkeit, Armut, Kriege, Barbarei, Terrorismus, Umweltvergiftung, Unsicherheit und sorgloser Inkompetenz angesichts Naturkatastrophen. Nach dem Hammerschlag gegen die älteren Arbeiter und baldigen Rentner sind nun die jungen Arbeiter und künftigen Arbeitslosen dran! Der Kapitalismus entblößt sein wahres Antlitz: jenes eines dekadenten Systems, das den neuen Generationen nichts anzubieten hat; ein System, das angesichts einer unlösbaren Wirtschaftskrise verfällt; ein System, das seit dem II. Weltkrieg Unsummen in die Produktion von immer tödlicheren und raffinierteren Waffen gesteckt hat; ein System, das seit dem Golfkrieg von 1991 den Planeten mit Blut überzogen hat, entgegen den Versprechungen einer „Ära des Friedens und Wohlstands“, die angeblich dem Zusammenbruch des Ostblocks folgen sollte. Es ist dasselbe bankrotte kapitalistische System, dieselbe in die Enge getriebene kapitalistische Klasse, die Millionen in Armut und Arbeitslosigkeit wirft sowie Tod und Verderben im Irak, in Nahost und in Afrika verbreitet!
Doch es gibt Hoffnung, wie die junge Generation in Frankreich gezeigt hat. Durch die Ablehnung des CPE und die Aufrufe an die Lohnarbeiter sowie an die Generation ihrer Eltern haben sie ein klares Bewusstsein dafür gezeigt, dass alle Generationen betroffen sind, dass ihr Kampf gegen den CPE nur ein Schritt ist und dass der Angriff, den der CPE darstellte, gegen die gesamte Arbeiterklasse gerichtet war.
Nachdem wochenlang Funkstille bei den von der Bourgeoisie angeheuerten Medien geherrscht hatte, verzerrten sie anschließend systematisch die Ereignisse, um sie als bloße Wiederholung der Riots von Oktober-November 2005 darzustellen, indem sie die Nebenvorstellung der Auseinandersetzungen mit der Polizei bzw. der Großtaten der „Chaoten“ während der Demonstrationen ins Scheinwerferlicht rückten. Hinter der bewussten Vermengung der blinden und hoffnungslosen Gewalt in den Vorstädten letzten Herbst mit den diametral entgegengesetzten Kampfmethoden der Studenten und der Arbeiter, die sich ihnen angeschlossen hatten, verbirgt sich die bewusste Absicht der herrschenden Klasse, die Arbeiterklasse anderer Länder daran zu hindern, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es sowohl notwendig als auch möglich ist, für eine andere Zukunft zu kämpfen.
Diese Absicht auf Seiten der herrschenden Klasse ist völlig verständlich. In Anbetracht ihrer klassenbedingten Vorurteile ist sie sich zwar nicht völlig der Perspektive der proletarischen Bewegung bewusst, dennoch begreift sie schemenhaft die Bedeutung und Dimension des Kampfes, der in Frankreich stattgefunden hat. Sie weiß, dass er nicht auf die Arbeiterklasse Frankreichs beschränkt bleibt. Dieser Kampf ist im wesentlichen nur ein Moment in der internationalen Erneuerung des Klassenkampfes, ein Moment allerdings, dessen Dimensionen - über die partikularen Forderungen, um die sich die Studenten anfangs mobilisiert hatten, hinaus - eine wachsende Ablehnung jener Perspektiven, die das kapitalistische System anzubieten hat, durch die Studenten zum Ausdruck bringen. Die zunehmenden Angriffe gegen die Ausgebeuteten können nur noch massivere und vor allem bewusstere Klassenkonfrontationen sowie ein wachsendes Bewusstsein für die Notwendigkeit der Solidarität aller Arbeiter im Kampf provozieren.
WIM, 15. April 2006
[i] [144] Siehe die „Thesen über die Studentenbewegung im Frühjahr 2006 in Frankreich“ in dieser Ausgabe.
Vor 100 Jahren: Die Revolution von 1905 in Russland (Teil II)
- 5334 Aufrufe
Die Sowjets leiten eine neue Periode in der Geschichte des Klassenkampfes ein
Die Revolution von 1905 ereignete sich, als der Kapitalismus im Begriff war, in seine Niedergangsperiode einzutreten. Die Arbeiterklasse sah sich nicht mit einem Kampf um Reformen innerhalb des Kapitalismus, sondern mit einem politischen Kampf gegen den Kapitalismus und für seine Überwindung konfrontiert, in dem die Machtfrage anstelle der Frage der wirtschaftlichen Zugeständnisse im Vordergrund stand. Das Proletariat antwortete auf diese Herausforderung mit der Erschaffung von Mitteln seines politischen Kampfes: des Massenstreiks und der Sowjets. Im ersten Teil dieses Artikels in der Internationalen Revue Nr. 35 betrachteten wir, wie sich die Revolution von einem Appell an den Zaren im Januar 1905 zu einer offenen Herausforderung der herrschenden Klasse im Dezember entwickelte. Wir zeigten, dass es sich hierbei um eine proletarische Revolution handelte, die den revolutionären Charakter der Arbeiterklasse bekräftigte, und dass sie sowohl ein Ausdruck als auch ein Katalysator in der Bewusstseinsentwicklung der revolutionären Klasse war. Wir zeigten, dass der Massenstreik von 1905 nichts mit den Konfusionen der anarcho-syndikalistischen Strömung gemeinsam hatte, die sich ungefähr zur selben Zeit entwickelte (s. die Artikel International Review Nr. 119 und 120, engl./franz./span. Ausgabe) und die den Massenstreik als ein Mittel zur sofortigen ökonomischen Umwälzung des Kapitalismus betrachtete. Rosa Luxemburg erkannte, dass der Massenstreik den ökonomischen Kampf der Arbeiterklasse und ihren politischen Kampf vereinte und auf diese Weise eine qualitative Weiterentwicklung des Klassenkampfes markierte, selbst wenn es in der damaligen Lage nicht möglich war, völlig zu verstehen, dass dies die Folge aus dem historischen Wandel in der kapitalistischen Produktionsweise war: „Der revolutionäre Kampf in Russland, in dem die Massenstreiks als die wichtigste Waffe zur Anwendung kommt, wird von dem arbeitenden Volke und in erster Reihe vom Proletariat gerade um dieselben politischen Rechte und Bedingungen geführt, deren Notwendigkeit und Bedeutung im Emanzipationskampf der Arbeiterklasse Marx und Engels zuerst nachgewiesen und im Gegensatz zum Anarchismus in der Internationale mit aller Macht verfochten haben. So hat die geschichtliche Dialektik, der Fels, auf dem die ganze Lehre des Marxschen Sozialismus beruht, es mit sich gebracht, dass heute der Anarchismus, mit dem die Idee des Massenstreiks unzertrennlich verknüpft war, zu der Praxis des Massenstreiks selbst in einen Gegensatz geraten ist, während umgekehrt der Massenstreik, der als der Gegensatz zur politischen Betätigung des Proletariats bekämpft wurde, heute als die mächtigste Waffe des politischen Kampfes um politische Rechte erscheint.“
Die Sowjets drückten einen gleichermassen wichtigen Wandel in der Weise aus, wie sich die Arbeiterklasse organisierte. Und wie der Massenstreik waren sie nicht ein rein russisches Phänomen. Trotzki betonte wie Luxemburg diesen qualitativen Wandel, auch wenn er sich, wie auch Luxemburg, nicht in der Lage befand, ihre Bedeutung vollständig zu begreifen: „Der Rat organisierte die Arbeitermassen, leitete ihre politischen Streiks und Demonstrationen, bewaffnete die Arbeiter, schützte die Bevölkerung vor Progromen. Aber das gleiche hatten schon vor ihm andere revolutionäre Organisationen getan, taten es zur selben Zeit mit ihm und setzten diese Tätigkeit auch nach seiner Auflösung fort, nur mit dem Unterschied, dass diese Tätigkeiten ihnen auch nicht annähernd jenen Einfluss verschaffte, den der Rat besass. Das Geheimnis dieses Einflusses ist darin zu suchen, dass der Rat als naturgemässes Organ des Proletariats in dem Moment seines unmittelbaren, durch den ganzen Gang der Ereignisse bedingten Kampfes um die Macht entstanden war. Wenn einerseits die Arbeiter selbst und andererseits die reaktionäre Presse den Rat die ‚proletarische Regierung‘ nannten, so entsprach dies der Tatsache, dass der Rat in Wirklichkeit eine revolutionäre Regierung darstellte. Der Rat realisierte die Gewalt, soweit ihm durch die revolutionäre Macht der Arbeiter die Möglichkeit dazu gegeben wurde; er kämpfte unmittelbar um die Gewalt, soweit sie sich noch in den Händen der militärisch-polizeilichen Monarchie befand. Bereits vor der Einsetzung des Rates finden wir in den Kreisen des industriellen Proletariats zahlreiche revolutionäre Organisationen, deren Leitung hauptsächlich von der Sozialdemokratie besorgt wurde. Aber das waren Organisationen im Proletariat; ihr unmittelbares Ziel war – der Kampf um den Einfluss auf die Massen. Der Rat aber schwang sich mit einem Schlage zur Organisation des Proletariats auf, sein Ziel war - der Kampf um die revolutionäre Macht.
Indem der Delegiertenrat zum Brennpunkt der revolutionären Kräfte des Landes wurde, löste er sich dennoch nicht in dem Chaos der Revolution auf, er war und blieb der organisierte Ausdruck des Klassenwillens des Proletariats.“[2]
Die wahre Bedeutung sowohl des Massenstreiks als auch der Sowjets kann nur begriffen werden, wenn man beide in den richtigen historischen Zusammenhang stellt, wenn man begreift, dass der Wandel in den objektiven Bedingungen des Kapitalismus die Aufgaben und Mittel sowohl der Bourgeoisie als auch des Proletariats bestimmte.
Ein Wendepunkt in der Geschichte
Im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts begann der Kapitalismus in eine Periode des historischen Wandels zu treten. Während die Dynamik, die den Kapitalismus in die Lage versetzt hatte, sich über den Globus auszubreiten, noch immer vorhanden war - mit solch neuen Ländern wie Japan oder Russland, die ein starkes Wirtschaftswachstum erlebten -, häuften sich in etlichen Teilen der Welt die Anzeichen wachsender imperialistischer Spannungen und eines Ungleichgewichts in der kapitalistischen Gesellschaft insgesamt.
Das ziemlich regelmässige Muster des ökonomischen Rückgangs und Booms, das von Marx Mitte des Jahrhunderts analysiert worden war, begann sich in der Gestalt von Konjunkturrückgängen aufzulösen, die immer tiefer und länger wurden.
Nach Jahrzehnten des relativen Friedens erlebten das Ende des 19. Jahrhunderts und der Anfang des 20. Jahrhunderts wachsende Spannungen zwischen den rivalisierenden Imperialismen, da es im Kampf um Märkte und Ressourcen zunehmend nur noch darum ging, den anderen Mächten etwas streitig zu machen. Exemplarisch dafür stand der „Kampf um Afrika“, in dem ein ganzer Kontinent binnen 20 Jahren aufgeteilt und der brutalsten Ausbeutung, die es jemals gegeben hatte, unterworfen wurde. Dieser Kampf führte zu sich häufenden diplomatischen Konfrontationen und militärischen Drohgebärden, so wie 1898 der Zwischenfall von Faschoda, als der britische Imperialismus seinen französischen Rivalen dazu zwang, ihm am Oberen Nil zu weichen.
Zur gleichen Zeit stürzte sich die Arbeiterklasse in eine grössere Anzahl von Streiks, die ausgedehnter und intensiver waren als in der Vergangenheit. Zum Beispiel stieg im Deutschen Reich die Zahl der Streiks von 483 im Jahr 1896 auf 1.468 im Jahr 1900, um in den Jahren 1903 und 1904 auf 1.144 bzw. 1.190 zu fallen.[3] In Russland und Belgien breiteten sich 1898 bzw. 1902 Massenstreiks aus, die jenen von 1905 bereits erahnen liessen. Die Entwicklung des revolutionären Syndikalismus und des Anarchosyndikalismus war teilweise eine Konsequenz aus dieser ansteigenden Militanz, doch nahm sie die Form, die sie repräsentierte, aufgrund eines wachsenden Opportunismus in vielen Teilen der Arbeiterbewegung an, wie wir in den Artikelserien, die wir diesem Thema widmeten, aufzeigten.[4]
So war also für beide Hauptklassen diese Periode eine Zeit grossen Wandels, in der neue Herausforderungen qualitativ neue Antworten erforderten. Für die Bourgeoisie markierte sie das Ende der Periode kolonialer Expansionen und den Beginn wachsender imperialistischer Rivalitäten, die 1914 zum Ersten Weltkrieg führten. Für die Arbeiterklasse bedeutete sie das Ende jener Periode, in der noch Reformen innerhalb des von der Bourgeoisie ausgegebenen legalen oder halblegalen Rahmens errungen werden konnten, und den Beginn einer Periode, in der sie ihre Interessen nur durch die Infragestellung des Rahmens des bürgerlichen Staates verteidigen konnte. Dies führte 1917 unweigerlich zum Kampf um die Macht und zur anschliessenden weltweiten revolutionären Welle. 1905 war die „Generalprobe“ für diese Konfrontation, mit vielen Lehren, die damals wie heute für all jene auf der Hand liegen, die ihre Augen benutzen.
Die Lage in Russland
Russland war keine Ausnahme in der historischen Richtung; der Charakter der Entwicklung der russischen Gesellschaft bewirkte nur, dass das Proletariat schneller und härter mit einigen Konsequenzen der aufkommenden Periode konfrontiert wurde. Doch bevor wir diese besonderen Aspekte kurz betrachten werden, ist es notwendig, zunächst mit der Betonung zu beginnen, dass die zugrunde liegende Ursache der Revolution in Bedingungen zu suchen ist, die die gesamte Arbeiterklasse erfährt, wie Rosa Luxemburg unterstrich: „Desgleichen liegt viel Übertreibung in der Vorstellung, als habe der Proletarier im Zarenreich vor der Revolution durchweg auf dem Lebensniveau eines Paupers gestanden. Gerade die jetzt im ökonomischen wie im politischen Kampfe tätigste und eifrigste Schicht der grossindustriellen, grossstädtischen Arbeiter stand in bezug auf ihr materielles Lebensniveau kaum viel tiefer als die entsprechende Schicht des deutschen Proletariats, und in manchen Berufen kann man in Russland gleiche, ja hier und da selbst höhere Löhne finden als in Deutschland. Auch in bezug auf die Arbeitszeit wird der Unterschied zwischen den grossindustriellen Betrieben hier und dort kaum ein bedeutender sein. Somit sind die Vorstellungen, die mit einem vermeintlich materiellen und kulturellen Helotentum der russischen Arbeiterschaft rechnen, ziemlich aus der Luft gegriffen. Dieser Vorstellung müsste bei einigem Nachdenken schon die Tatsache der Revolution selbst und der hervorragenden Rolle des Proletariats in ihr widersprechen. Mit Paupers werden keine Revolutionen von dieser politischen Reife und Gedankenklarheit gemacht, und der im Vordertreffen des Kampfes stehende Petersburger und Warschauer, Moskauer und Odessaer Industriearbeiter ist kulturell und geistig dem westeuropäischen Typus viel näher, als sich diejenigen denken, die als die einzige und unentbehrliche Kulturschule des Proletariats den bürgerlichen Parlamentarismus und die regelrechte Gewerkschaftspraxis betrachten.“[5] Es trifft zu, dass die Entwicklung des Kapitalismus in Russland auf einer brutalen Ausbeutung der Arbeiter basierte, mit langen Arbeitstagen und schlimmen Arbeitsbedingungen, die an das frühe 19. Jahrhundert in Grossbritannien erinnerten. Doch der Arbeiterkampf entwickelte sich schnell im späten neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert.
Diese Entwicklungen konnten insbesondere in den Putilow-Werken in St. Petersburg betrachtet werden, welche Waffen herstellten und Schiffe bauten. Die Werke beschäftigten Zigtausende von Arbeitern und waren fähig, Waren auf einem Niveau herzustellen, das sie in die Lage versetzte, mit ihren entwickelteren Rivalen zu konkurrieren. Die Arbeiter dort entwickelten eine Tradition der Militanz und standen im Mittelpunkt der revolutionären Kämpfe sowohl von 1905 als auch von 1917. Auch wenn die Putilow-Werke mit ihrem Niveau hervorstachen, waren sie dennoch Bestandteil eines allgemeineren Trends zur Entwicklung grösserer Fabriken, die überall in Russland entstanden. Zwischen 1863 und 1891 stieg die Zahl der Fabriken im europäischen Russland von 11.810 auf 16.770, ein Anstieg um ungefähr 42 Prozent, während die Zahl der Arbeiter von 357.800 auf 738.100 anstieg, eine Zunahme von ungefähr 106 Prozent.[6] In Regionen wie St. Petersburg ging die Zahl der Fabriken de facto zurück, während die Zahl der Arbeiter anstieg, was auf einen noch stärkeren Trend zur Konzentration der Produktion und somit des Proletariats hinweist.[7]
Die Lage der Eisenbahnarbeiter in Russland stützte Luxemburgs Argument hinsichtlich der Stellung der entwickeltsten Teile der russischen Arbeiterklasse. Auf materieller Ebene hatten sie einige bedeutende Errungenschaften erzielt: Zwischen 1885 und 1895 stiegen die Reallöhne bei den Eisenbahnen durchschnittlich um 18 Prozent, obwohl dieser Durchschnitt die grossen Lohnunterschiede zwischen Arbeitern mit verschiedenen Tätigkeiten und in unterschiedlichen Regionen des Landes verdeckte. Auf der kulturellen Ebene gab es eine Tradition des Kampfes, die bis in die 1840er und 1850er Jahre zurückreichte, als zunächst Leibeigene für den Eisenbahnbau rekrutiert wurden. Mit dem letzten Viertel des Jahrhunderts wurden die Eisenbahnarbeiter zu einem zentralen Bestandteil des städtischen Proletariats mit einer bedeutenden Kampferfahrung: Zwischen 1875 und 1884 gab es 29 „Zwischenfälle“ und im folgenden Jahrzehnt 33. Als sich die Löhne und Arbeitsbedingungen nach 1895 zu verschlechtern begannen, stellten sich die Eisenbahnarbeiter dieser Herausforderung: „... zwischen 1895 und 1904 war die Zahl der Eisenbahnstreiks dreimal höher als in den vorherigen zwei Jahrzehnten zusammengenommen (...) Die Streiks der späten 1890er Jahre waren entschiedener und weniger defensiv (...) Nach 1900 antworteten die Arbeiter auf das Einsetzen der Wirtschaftskrise mit wachsend militantem Widerstand, bei dem die Metallarbeiter der Eisenbahnen oft in Übereinstimmung mit Handwerkern aus der privaten Industrie handelten, und politische Agitatoren, zumeist Sozialdemokraten, machten bedeutende Fortschritte.“[8] In der Revolution von 1905 sollten die Eisenbahnarbeiter eine Hauptrolle spielen, indem sie ihr Geschick und ihre Erfahrung in den Dienst der gesamten Arbeiterklasse stellten und darauf drängten, den Kampf auszuweiten und von den Streiks zum Aufstand überzugehen. Dies war kein Kampf von Pauperisierten, die durch den Hunger zum Aufruhr getrieben wurden, oder von Bauern in Arbeitermontur, sondern von einem vitalen und klassenbewussten Teil der internationalen Arbeiterklasse. Erst vor diesem Hintergrund gemeinsamer Bedingungen und Kämpfe kamen die besonderen Aspekte der Situation in Russland, der Krieg mit Japan im Ausland und die politische Repression zuhause, zur Geltung.
Die Kriegsfrage
Der Russisch-Japanische Krieg von 1904-05 war eine Folge der imperialistischen Rivalität zwischen diesen beiden neuen kapitalistischen Ländern am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Konfrontation entzündete sich während der 1890er Jahre über die Frage des Einflusses in China und Korea. Zu Beginn des Jahrzehnts wurden die Arbeiten an der Transsibirischen Eisenbahn begonnen, die Russland den Zugang zur Mandschurei ermöglichen sollte, während Japan seine Wirtschaftsinteressen in Korea ausbaute. Die Spannungen zwischen beiden Rivalen wuchsen das ganze Jahrzehnt hindurch, als Russland Japan zwang, sich von seinen Positionen auf dem Festland zurückzuziehen. Und sie spitzten sich zu, als Russland begann, seine eigenen Interessen in Korea zu verfolgen. Japan schlug vor, dass die beiden Länder sich darauf einigen sollten, ihre gegenseitigen Einflusszonen zu respektieren. Nachdem Russland es versäumt hatte zu antworten, startete Japan im Januar 1904 einen Überraschungsangriff gegen Port Arthur. Zunächst schien der Ausgang des Krieges angesichts der riesigen Ungleichheit zwischen den Streitkräften der beiden Widersacher eine klare Sache zu sein, und so wurde der Kriegsausbruch in Russland anfangs mit einem Ausbruch an patriotischer Inbrunst, mit Denunziationen der „frechen Mongolen“ und Studentendemonstrationen zur Unterstützung des Kriegseintritts begrüsst. Doch es kam nicht zum schnellen Sieg. Die Transsibirische Eisenbahn war noch nicht fertiggestellt, so dass die Truppen nicht schnell zur Front transportiert werden konnten. Die russische Armee wurde zurückgeschlagen; im Mai war die Garnison abgeschnitten und die russische Flotte, die zu ihrer Hilfe entsandt wurde, zerstört. Und am 20. Dezember, nach 156tägiger Belagerung, fiel Port Arthur. Auf militärischer Ebene war der Krieg einmalig. Millionen von Soldaten wurden ins Feld geschickt; 1,2 Millionen Reservisten wurden in Russland ausgehoben. Die Industrie konzentrierte sich auf den Krieg, was zu Konjunktureinbrüchen und zur Vertiefung der Wirtschaftskrise führte. In der Schlacht von Mukden im März 1904 kämpften 600.000 Soldaten zwei Wochen lang, 16.000 von ihnen fielen. Es war die grösste Schlacht in der Geschichte und eine erste Andeutung dessen, was 1914 kommen sollte. Der Fall von Port Arthur bedeutete den Verlust der russischen Pazifikflotte und eine Demütigung der Autokratie. Lenin verwies auf die weitergehende Bedeutung dieser Ereignisse: „Aber der militärischen Katastrophe, von der die Selbstherrschaft ereilt wurde, kommt noch grössere Bedeutung zu als Symptom für den Zusammenbruch unseres ganzen politischen Systems. Unwiederbringlich sind die Zeiten dahin, als die Kriege von Söldnern oder den Angehörigen einer vom Volk halb losgelösten Kaste geführt wurden. (...) Die Kriege werden jetzt von den Völkern geführt, und darum tritt heute besonders deutlich eine grosse Eigenschaft des Krieges hervor: dass er vor den Augen von Million und aber Millionen Menschen handgreiflich jenes Missverhältnis zwischen Volk und Regierung aufdeckt, das bis dahin nur einer kleinen bewussten Minderheit sichtbar war. Die Kritik, die von allen fortgeschrittenen russischen Menschen, von der russischen Sozialdemokratie, vom russischen Proletariat an der Selbstherrschaft geübt wurde, ist jetzt durch die Kritik der japanischen Waffen bestätigt worden, so sehr bestätigt worden, dass die Unmöglichkeit, unter der Selbstherrschaft zu leben, sogar von denen immer mehr empfunden wird, die nicht wissen, was die Selbstherrschaft bedeutet, sogar von denen, die das wissen, aber von ganzer Seele die Selbstherrschaft aufrechterhalten möchten. Die Unvereinbarkeit der Selbstherrschaft mit den Interessen der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung, mit den Interessen des ganzen Volkes (abgesehen von einem Häuflein Beamten und Magnaten) kam an den Tag, sobald das Volk in der Tat, mit seinem Blut, die Rechnung für die Selbstherrschaft begleichen musste. Durch ihr dummes und verbrecherisches Kolonialabenteuer ist die Selbstherrschaft in eine Sackgasse geraten, aus der nur das Volk selbst den Ausweg bahnen kann, und zwar nur durch die Vernichtung des Zarismus.“[9]
In Polen waren die ökonomischen Folgen des Krieges angesichts von 25 bis 30 % der Warschauer Arbeiter, die ihre Arbeit verloren hatten, und von 30 bis 50%igen Lohneinbussen katastrophal. Im Mai 1904 gab es Zusammenstösse zwischen Arbeitern und Polizei, wobei Kosaken Letztere verstärkten. Der Krieg fing an, zunehmend eine starke Opposition zu hervorzurufen. Während des Blutigen Sonntags, als die Truppen die Arbeiter, die gekommen waren, um an den Zaren zu appellieren, niederzumetzeln begannen, „haben die Arbeiter von Petersburg nicht umsonst den Offizieren zugerufen, sie kämpften gegen das russische Volk erfolgreicher als gegen die Japaner“[10] Später rebellierten einige Teile des Militärs gegen ihre Lage und begannen, auf die Seite der Arbeiter zu treten: „Die Moral der Soldaten war durch die Niederlagen im Osten und durch die offenkundige Unfähigkeit ihrer Führer auf einen Tiefstand gesunken. Gesteigert wurde die Unzufriedenheit durch das Sträuben der Regierung, ihr Versprechen einer schnellen Demobilisierung zu erfüllen. Das Resultat waren Meutereien in vielen Regimentern und gelegentlich offene Feldschlachten. Berichte über Unruhen solcher Art kamen aus weit weg liegenden Gegenden wie Grodno, Samara, Rostow und Kursk, aus Rembertow nahe Warschau, aus Riga in Lettland und Vyborg in Finnland, aus Wladiwostok und Irkutsk.
Im Herbst hatte auch die revolutionäre Bewegung in der Marine an Stärke gewonnen, mit der Folge, dass im Oktober eine Meuterei in der Marinebasis von Kronstadt im Baltikum losbrach, die nur unter Einsatz von Gewalt niedergeschlagen werden konnte. Ihr folgte umgehend eine weitere Meuterei in der Schwarzmeerflotte in Sebastopol, die an einem bestimmten Punkt drohte, die Kontrolle über die ganze Stadt zu übernehmen.“[11]
In ihrem Appell an die Arbeiterklasse im Mai 1905 zogen die Bolschewiki die Frage des Kriegs und der Revolution zu einer einzigen zusammen: „Genossen! Wir stehen jetzt in Russland am Vorabend grosser Ereignisse. Wir haben den letzten erbitterten Kampf gegen die absolutistische Zarenregierung aufgenommen, und wir müssen diesen Kampf bis zum siegreichen Ende führen. Seht, welches Unglück diese Regierung der Wüteriche und Tyrannen, die Regierung der käuflichen Zarenhöflinge und der Steigbügelhalter des Kapitals über das ganze russische Volk gebracht hat! Die Zarenregierung hat das russische Volk in den wahnwitzigen Krieg gegen Japan getrieben. Hunderttausende junge Menschenleben sind dem Volk entrissen und im Fernen Osten zugrunde gerichtet worden. Es fehlen einem die Worte, um all die Leiden zu beschreiben, die dieser Krieg mit sich bringt. Und worum geht es in diesem Krieg? Um die Mandschurei, die unsere räuberische Zarenregierung China weggenommen hat. Um fremdes Land wird russisches Blut vergossen und unser Land ruiniert. Immer schwerer wird das Leben des Arbeiters und des Bauern, immer fester ziehen ihnen Kapitalisten und Beamte die Schlinge um den Hals, die Zarenregierung aber schickt das Volk aus, fremdes Land zu rauben. Die unfähigen zaristischen Generale und die käuflichen Beamten haben die russische Flotte der Vernichtung preisgegeben, haben Hunderte und Tausende von Millionen Volksvermögen verschleudert, haben ganze Armeen verloren - der Krieg aber wird weiter fortgesetzt und fordert immer neue Opfer. Das Volk wird ruiniert, Industrie und Handel kommen zum Erliegen, Hunger und Cholera drohen auszubrechen, die absolutistische Zarenregierung aber geht in sturer Verblendung den alten Weg: Sie ist bereit, Russland zugrunde gehen zu lassen, wenn nur das Häuflein der Wüteriche und Tyrannen gerettet wird, sie beginnt neben dem Krieg gegen Japan einen zweiten Krieg - den Krieg gegen das ganze russische Volk.“[12]
Staatliche Unterdrückung
Der Krieg diente auch dazu, von der Kampagne abzulenken, die gegen die repressive Polizei der Autokratie angewachsen war. Im Dezember 1903 soll Innenminister Plehwe, so wird berichtet, gesagt haben: „Um eine Revolution zu verhindern, brauchen wir einen kleinen erfolgreichen Krieg.“[13] Die Macht der Autokratie wurde nach dem Attentat auf Zar Alexander II. gestärkt, das 1881 Mitglieder der Gruppe Volkswille verübten, die sich dem Gebrauch des Terrorismus gegen die Autokratie verschrieben hatte.[14] Neue „Notstandsmassnahmen“ wurden eingeführt, um jegliche politische Handlung ausser Gesetz zu stellen, und weit davon entfernt, eine Ausnahme zu sein, wurden sie zur Regel: „Man kann durchaus sagen (...), dass zu keiner Zeit zwischen der Bekanntmachung der Statuten vom 14. August 1881 und dem Sturz der Dynastie im März 1917 die ‚Notstandsmassnahmen‘ nicht in irgendeinem Teil des Landes – und oftmals in grösseren Teilen von ihm – in Kraft waren.“[15] Unter dem „strengeren Recht“ dieser Massnahmen konnten die Gouverneure der davon betroffenen Gebiete Leute drei Monate lang ohne jeden Prozess einsperren, jegliche Versammlungen, ob privat oder öffentlich, verbieten, Fabriken und Geschäfte schliessen sowie Menschen in weit von der Heimat entfernte Gebiete deportieren. Das „Ausserordentliche Dekret“ stellte das betroffene Gebiet faktisch unter Militärrecht, mit willkürlichem Arrest, Inhaftierung und Geldstrafen. Der Einsatz von Soldaten gegen Streiks und Arbeiterproteste wurde allgemein üblich, und viele Arbeiter wurden im Kampf niedergeschossen. Die Zahl der Insassen von Gefängnissen und Strafkolonien wuchs, so wie die Zahl der in entfernte Gebiete des Landes Verbannten.
In dieser Periode stieg der Anteil von Arbeitern beständig an, die wegen Staatsverbrechen angeklagt wurden. Zwischen 1884 und 1890 bestand gerade einmal ein Viertel der Angeklagten aus Handarbeitern; 1901 bis 1903 stieg ihr Anteil auf drei Fünftel. Dies spiegelte den Wandel in der revolutionären Bewegung von einer von Intellektuellen dominierten zu einer aus Arbeitern zusammengesetzten Bewegung wider. Wie ein Gefängniswärter Berichten zufolge kommentiert haben soll: „Wie kommt es, dass immer mehr politische Bauern hierher gebracht werden? Früher waren es Herren, Studenten und junge Damen, doch nun ist es der graue bäuerliche Arbeiter wie wir.“ [16]
Abgesehen von diesen formellen, „legalen“ Formen der Unterdrückung benutzte der russische Staat zwei wenig schmeichelhafte Formen. Auf der einen Seite ermutigte der Staat die Entwicklung von Antisemitismus, indem er sich gegenüber den Pogromen und Massakern blind stellte und gleichzeitig sicherstellte, dass die Organisationen, die die schmutzige Arbeit taten, wie die Union des Russischen Volkes, besser bekannt als die Schwarzhundertschaften, offen vom Zaren unterstützt wurden und seinen Schutz genossen. Revolutionäre wurden als Teil eines organisierten jüdischen Komplotts zur Machtübernahme denunziert. Diese Strategie sollte auch gegen die Revolution von 1905 verwendet werden und auch danach die Arbeiter und Bauern verfolgen.
Auf der anderen Seite trachtete der Staat danach, die Arbeiter friedlich zu stimmen, indem er eine Reihe von „Polizeigewerkschaften“ schuf, die von Leutnant Subatow angeführt wurden. Diese Gewerkschaften waren dazu bestimmt, die revolutionären Leidenschaften der Arbeiterklasse in die Grenzen der unmittelbaren ökonomischen Forderungen zu zwängen, doch die Arbeiter in Russland stiessen zunächst gegen diese Grenzen, um sie dann 1905 zu überrennen. Lenin argumentierte, dass die politische Situation in Russland, wo „die Arbeiter, die einen ökonomischen Kampf führen, nachdrücklich auf die politischen Fragen ‚gestossen‘“[17] werden, bedeutete, dass die Arbeiterklasse von diesen Gewerkschaften Gebrauch machen konnten, solange diese Fallen, die von der herrschenden Klasse für sie aufgestellt wurden, von den Revolutionären aufgedeckt wurden. „In diesem Sinne können und müssen wir zu den Subatow und den Oserow sagen: Macht nur weiter, ihr Herren, macht nur weiter! Soweit ihr den Arbeitern (...) eine Falle stellt, werden wir für eure Entlarvung sorgen. Soweit ihr einen Schritt vorwärts tut – wenn auch nur in der Form eines ‚schüchternen Zickzacks‘, aber immerhin einen Schritt vorwärts -, werden wir sagen: Bitte sehr! Ein wirklicher Schritt vorwärts kann nur eine tatsächliche, wenn auch nur winzige Ellenbogenfreiheit für die Arbeiter sein. Und jede solche Erweiterung wird für uns von Nutzen sein und die Entstehung legaler Vereine beschleunigen, in denen nicht die Lockspitzel Sozialisten fangen, wohl aber die Sozialisten sich Anhänger fangen werden.“[18] In der Tat waren es nicht die Gewerkschaften, die zunächst 1905, schliesslich 1917 gestärkt wurden, sondern eine neue Organisation, die der revolutionären Aufgabe entsprach, ehe das Proletariat dafür geschaffen wurde: die Sowjets.
Bewaffnete Konfrontation mit dem Staat
Während die oben genannten Faktoren helfen zu erklären, warum die Ereignisse von 1905 in Russland stattfanden, geht die wahre Bedeutung dieser Ereignisse weit über Russland hinaus. Worin liegt die Bedeutung von 1905? Was macht 1905 aus?
Eine Auffälligkeit von 1905 war die Entwicklung bewaffneter Kämpfe im Dezember. Trotzki liefert eine eindrucksvolle Darstellung des Kampfes, der in Moskau stattfand, als in den Arbeiterbezirken Barrikaden zur Verteidigung gegen die zaristischen Truppen errichtet wurden, während die sozialdemokratische Kampforganisation einen Guerillakrieg in den Strassen und Häusern ausfocht: „Im folgenden das Bild eines der ersten Gefechte. Durch die Strasse zieht eine georgische Kampfgruppe – eine der verwegensten. Die 24 Mann schreiten ganz offen in Paaren einher. Die Menge warnt sie, dass 16 Dragoner unter Anführung eines Offiziers im Anzuge sind. Die Schützen ordnen sich und schlagen ihre Mausergewehre an. Kaum wird die Patrouille sichtbar, als sie auch schon von der einer Salve in Empfang genommen wird. Der Offizier ist verwundet, die vordersten Pferde bäumen sich, die Reiter geraten in Verwirrung, so dass die Soldaten von ihren Karabinern keinen Gebrauch machen können. Inzwischen geben die revolutionären Schützen etwa hundert Schüsse ab und schlagen die Soldaten, die mehrere Tote und Verwundete zurücklassen, regelrecht in die Flucht. ‚Jetzt aber fort‘, mahnt die Menge, ‚gleich kommt ein Geschütz.‘ Und in der Tat erscheint bald darauf Artillerie auf der Bildfläche. Sofort nach der ersten Salve fallen zahlreiche Tote und Verwundete aus der wehrlosen Menge, die nicht erwartet hat, dass man auf sie schiessen werde. Zu derselben Zeit sind aber die Georgier längst über alle Berge und machen an einer neuen Stelle dem Militär hart zu schaffen... Den Schützen ist nicht beizukommen, weil sie der dichte Panzer der allgemeinen Sympathie unverwundbar macht.“[19] Dennoch ist es nicht der bewaffnete Kampf, gleichgültig, wie mutig, der 1905 auszeichnete. Der bewaffnete Kampf ist in der Tat ein Ausdruck des Kampfes um die Macht zwischen den Klassen, doch er kennzeichnet die letzte Phase, entsteht, wenn das Proletariat sich mit dem Erfolg des Gegenangriffs der herrschenden Klasse konfrontiert sah. Zunächst versuchten die Arbeiter, die Truppen für sich zu gewinnen, doch die bewaffneten Zusammenstösse häuften sich allmählich und wurden blutiger. Der bewaffnete Kampf war eher ein Versuch, die Arbeiterbezirke zu verteidigen, denn die Revolution auszubreiten. Zwölf Jahre später, als die Arbeiterklasse erneut mit dem Militär zusammenstiess, war es ihr erfolgreiches Bemühen, bedeutende Teile der Armee und Marine für sich zu gewinnen, der das Überleben und den Fortschritt der Revolution sicherte.
Darüber hinaus haben bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie eine lange Geschichte. Die frühen Jahre der Arbeiterbewegung in Grossbritannien waren von gewalttätigen Zusammenstössen gekennzeichnet. Beispielsweise gab es 1800 und 1801 eine Welle von Hungerrevolten, von denen einige im Voraus geplant zu sein schienen, mit gedruckten Handblättern, die die Arbeiter dazu aufriefen, sich zu versammeln. Ein Jahr später gab es Berichte über Arbeiter, die nicht nur mit Spiessen, sondern auch mit Geheimorganisationen ausgerüstet waren, welche die Revolution ausheckten. Im folgenden Jahrzehnt breiteten sich, als Antwort auf die Verarmung von Tausenden von Webern, die Ludditen und deren „Army of Redressers“ („Armee der Wiederhersteller“) aus, um den eigentlichen Namen dieser Organisation zu verwenden. Einige Jahre später hegte die „Physical Force Army“ der Chartisten Aufstandspläne. Die Pariser Kommune von 1871 zeigte, wie die gewaltsame Konfrontation zwischen den Klassen offen ausbrach. In Amerika provozierte die brutale Ausbeutung, die mit der rapiden Industrialisierung des Landes einher ging, gewaltsamen Widerstand, wie im Falle der Molly Maguires, die darauf spezialisiert waren, Fabrikbosse zu töten, und Streiks in bewaffnete Konflikte verwandelten.[20] Das Einzigartige an 1905 war nicht die bewaffnete Konfrontation, sondern die Organisation des Proletariats auf einer Klassengrundlage, um seine allgemeinen Ziele zu erlangen. Dies mündete in einem Typ von Organisation, dem Sowjet, mit neuen Zielen, der die Gewerkschaften notwendigerweise überflüssig machte.
Die Rolle der Sowjets
In einer der ersten und wichtigsten Untersuchungen der Sowjets vertritt Oskar Anweiler „die der Wirklichkeit näher stehende Ansicht (…), dass die Sowjets von 1905 und auch die von 1917 sich lange Zeit völlig unabhängig von der bolschewistischen Partei und Ideologie entwickelt haben und ihr Ziel keineswegs von vornherein die Eroberung der Staatsgewalt gewesen ist“.[21] Dies ist eine akkurate Einschätzung der ersten Phase der Sowjets, aber bezogen auf die späteren Stufen wäre es falsch zu suggerieren, dass die Arbeiterklasse damit zufrieden gewesen wäre, weiterhin Pater Gapon hinterher zu marschieren und an ihr „Väterchen Zar“ zu appellieren. Zwischen Januar und Dezember 1905 hat sich etwas verändert. Zu verstehen, was sich geändert und wie es sich verändert hat, ist der Schlüssel zum Verständnis von 1905.
Im ersten Artikel betonten wir den spontanen Charakter der Revolution. Die Streiks von Januar, Oktober und Dezember schienen aus dem Nichts zu kommen und wurden durch scheinbar bedeutungslose Ereignisse ausgelöst, wie die Entlassung zweier Arbeiter aus einer Fabrik. Die Handlungen überwältigten selbst die meisten Scheinradikalen der Gewerkschaften: „Am 12. Oktober begann es in den Werkstätten der Moskau-Kursker- und der Moskau-Kasan-Bahn zu gären. Diese beiden Bahnen sind bereit, schon am 14. Oktober die Kampagne zu eröffnen. Sie werden jedoch vom Eisenbahnverband zurückgehalten, der sich von partiellen Streiks im gegenwärtigen Augenblick keinen Erfolg verspricht. Gestützt auf die Erfahrung der Februar-, April- und Juli-Streiks auf einzelnen Bahnstrecken, bereitete er einen allgemeinen Eisenbahnerstreik zur Zeit der Einberufung der Reichsduma vor. Doch die Gärung hält an. Schon am 3. Oktober waren die Delegierten der Eisenbahner zu einer offiziellen Beratung über die Frage der Pensionskassen in Petersburg zusammengetreten. Diese Versammlung erweiterte nun eigenmächtig den engen Rahmen ihrer Kompetenz und verwandelte sich unter dem Beifall der ganzen Eisenbahnerwelt zu einem unabhängigen gewerkschaftlich-politischen Kongress. Von allen Seiten liefen Begrüssungen und Zustimmungskundgebungen bei dem Kongress ein - die Gärung im Volke erhielt ständig neue Nahrung, sie wuchs mehr und mehr, und der Gedanke, unverzüglich einen allgemeinen Eisenbahnerstreik zu inszenieren, tritt im Moskauer Knotenpunkt immer stärker hervor.“[22]
Die Sowjets entwickelten sich auf einem Fundament, das über den Rahmen der Gewerkschaften hinausging. Die erste Körperschaft, die als Sowjet klassifiziert werden kann, tauchte in Iwanow-Wosnesensk in Zentralrussland auf. Am 12. Mai brach in einer Fabrik jener Stadt, die als das russische Manchester berüchtigt war, ein Streik aus; binnen weniger Tage waren alle Fabriken geschlossen und 32.000 Arbeiter im Ausstand. Auf Anregung eines Fabrikinspektors wurden Delegierte gewählt, um die Arbeiter in Gesprächen zu repräsentieren. Die Delegiertenversammlung, aus 110 Arbeitern zusammengesetzt, traf sich regelmässig in den darauffolgenden Wochen. Ihre Absicht war es, den Streik zu führen, separate Aktionen und Verhandlungen zu vermeiden, die Ordnung und das organisierte Verhalten der Arbeiter sicherzustellen sowie die Arbeit nur auf ihre Anweisung wieder aufnehmen zu lassen. Der Sowjet unterbreitete eine Reihe von sowohl ökonomischen als auch politischen Forderungen, einschliesslich denjenigen nach Achtstundentag, höheren Minimallöhnen, Krankheitsgeld, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Sie bildete sodann eine Arbeitermiliz, um die Arbeiterklasse vor Angriffen der Schwarzhundertschaften zu schützen, Zusammenstösse zwischen Streikenden und jenen zu vermeiden, die noch arbeiteten, und um mit den Arbeitern in entfernteren Gebieten in Kontakt zu bleiben. Die Behörden willigten angesichts der organisierten Stärke der Arbeiterklasse zunächst ein, doch Ende des Monats begannen sie mit dem Verbot der Miliz zu reagieren. Anfang Juni wurde eine Massenversammlung durch Kosaken angegriffen, die einige Arbeiter töteten und andere festnahmen. Die Lage spitzte sich gegen Ende des Monats in Gestalt von Unruhen und weiteren Zusammenstössen mit den Kosaken weiter zu. Im Juli gab es einen neuen Streik, der 10.000 Arbeiter umfasste, aber nach drei Monaten niedergeschlagen wurde. Der einzig sichtbare Erfolg war eine Reduzierung der Arbeitszeit.
Schon in diesen ersten Gehversuchen wird der fundamentale Charakter der Sowjets deutlich: eine Vereinheitlichung der ökonomischen und politischen Interessen der Arbeiterklasse, die, da die Sowjets die Arbeiter auf einer Klassenbasis und nicht auf einer gewerkschaftlichen Grundlage vereinen, unvermeidlich dazu neigt, mit fortschreitender Zeit immer politischer zu werden, was zu einer Konfrontation zwischen der etablierten Macht der Bourgeoisie und der aufkommenden Macht des Proletariats führt. Dass die Frage der Arbeitermiliz im Mittelpunkt des Sowjets von Iwanow-Wosnesensk stand, hatte weniger mit der unmittelbaren militärischen Bedrohung, die sie darstellte, zu tun als vielmehr damit, dass sie die Frage der Klassenmacht stellte.
Diese Tendenz zur Bildung von rivalisierenden Mächten zieht sich durch den ganzen Bericht Trotzkis über 1905 und stellte sich ab 1917 nachdrücklich angesichts der herrschenden Situation der Doppelherrschaft: „Wenn der Staat die Organisation der Klassenherrschaft ist, die Revolution aber die Ablösung der herrschenden Klasse, so muss der Übergang der Macht von der einen Klasse zur anderen notwendigerweise widerspruchsvolle Staatszustände schaffen, vor allem in Form der Doppelherrschaft. Das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen ist keine mathematische Grösse, die sich von vornherein berechnen lässt. Wenn das alte Regime aus dem Gleichgewicht geschleudert ist, kann das neue Kräfteverhältnis sich nur als Resultat ihrer gegenseitigen Nachprüfung im Kampf ergeben. Das eben ist die Revolution.“[23] Zwar trat die Situation der Doppelherrschaft 1905 noch nicht ein, doch die Frage stellte sich von Anfang an: „Der Rat stand von dem Moment seines Entstehens bis zum Augenblicke seines Untergangs unter dem mächtigen Drucke der revolutionären Elementargewalt (...) Jeder Schritt der Arbeitervertretung war im voraus bestimmt und die „Taktik“ war klar. Kampfmethoden brauchten nicht beraten zu werden, man hatte kaum genügend Zeit, sie unter eine Formel zu bringen.“[24] Dies ist die wesentliche Qualität der Sowjets und unterscheidet sie von den Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind eine Waffe im Kampf des Proletariats innerhalb des Kapitalismus; die Sowjets sind eine Waffe in seinem Kampf gegen den Kapitalismus. Im Grunde stehen beide insofern nicht in einem Gegensatz zueinander, als beide aus den objektiven Bedingungen des Klassenkampfes ihrer Zeit entstanden sind und sich in einer Kontinuität befinden, solange sie für die Interessen der Arbeiterklasse kämpfen. Doch sie gerieten in einen Gegensatz, als die gewerkschaftliche Form weiter existierte, obwohl ihr Klasseninhalt – ihre Rolle bei der Organisierung der Klasse und der Entwicklung ihres Bewusstseins – in die Sowjets übergegangen war. 1905 trat dieser Gegensatz noch nicht offen zutage; Sowjets und Gewerkschaften konnten noch nebeneinander existieren und sich bis zu einem gewissen Umfang gegenseitig stärken. Dennoch existierte er insofern hintergründig, als die Sowjets die Gewerkschaften aushebelten.
Die Massenstreiks, die sich im Oktober 1905 ausbreiteten, führten zur Schaffung vieler weiterer Sowjets, mit dem Sowjet von St. Petersburg an der Spitze. Alles in allem konnten zwischen 40 und 50 Sowjets sowie einige Bauern- und Soldatensowjets ausgemacht werden. Anweiler betont ihre ungleiche Herkunft: „Sie entstanden teilweise in Anknüpfung an ältere Organisationen, wie Streikkomitees oder Deputiertenversammlungen, oder unmittelbar durch die Initiative der sozialdemokratischen Parteiorganisationen, die dann einen erheblichen Einfluss im Sowjet ausübten. Häufig waren die Grenzen zwischen einem einfachen Streikkomitee und einem ausgebildeten Arbeiterdeputiertenrat fliessend, und nur in den Hauptzentren der Revolution und der Arbeiterschaft, wie (ausser Petersburg) Moskau, Odessa, Novorossijsk, im Donaubecken, gewannen die Räte eine ausgeprägte organisatorische Gestalt.“[25] Dies mag objektiv zutreffen, schmälert jedoch in keiner Weise ihre Bedeutung als direkte Ausdrücke des revolutionären Kampfes des Proletariats. In ihrer Neuheit wuchsen und schrumpften sie mit den Gezeiten der Revolution: „Die Stärke des Petersburger und der anderen Sowjets lag in dieser revolutionären Verfassung der Massen, in der Unsicherheit der Regierung. In der politischen Hochstimmung der ‚Freiheitstage’ antwortete die Arbeiterschaft bereitwillig auf den Ruf ihres selbstgewählten Organs; sobald sie nachliess und an ihre Stelle Müdigkeit und Enttäuschung traten, verloren auch die Sowjets an Einfluss und Autorität.“[26]
Die Sowjets und die Massenstreiks entstanden aus den objektiven Bedingungen der Arbeiterexistenz, so wie die Gewerkschaften vor ihnen: „Der Arbeiter-Delegiertenrat entstand als die Erfüllung eines objektiven, durch den Gang der Ereignisse erzeugten Bedürfnisses nach einer Organisation, die die Autorität darstellen könnte, ohne Traditionen zu haben, einer Organisation, die mit einem Male die zerstreuten, nach Hunderttausenden zählenden Massen umfassen könnte, ohne ihnen viele organisatorische Hemmungen aufzuerlegen, nach einer Organisation, die die revolutionären Strömungen innerhalb des Proletariats vereinigen, die einer Initiative fähig und automatisch sich selbst kontrollieren könnte und, was die Hauptsache ist, einer Organisation, die man innerhalb 24 Stunden ins Leben rufen könnte.“[27] Aus diesem Grund ist die Form der Sowjets bzw. Arbeiterräte im Jahrhundert nach 1905 immer wieder aufgetaucht, sobald die Arbeiterklasse in die Offensive ging: „Die Bewegung in Polen beweist durch ihren Massencharakter, ihre Schnelligkeit, ihre Ausweitung über die Kategorien und Regionen hinaus nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Möglichkeit der Generalisierung und Selbstorganisation des Kampfes.“[28] „(...) der übliche Gebrauch der Propaganda durch die Behörden basierte auf einer massiven und systematischen Verzerrung der Realität. Die totalitäre Kontrolle aller Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durch den Staat zwang die polnischen Arbeiter dazu, ein Ausmass an Selbstorganisation zu entwickeln, das im Vergleich mit dem, was in früheren Kämpfen erreicht wurde, einen immensen Schritt nach vorn darstellt.“[29]
North, 14. Juni 2005
Diese Artikelserie wird in der nächsten Ausgabe der Internationalen Revue fortgesetzt und in Gänze auf unserer Website veröffentlicht. Die nächste Folge wird sich insbesondere mit den folgenden Themen befassen:
Der Petersburger Sowjet war der Höhepunkt der Revolution von 1905; er ist der vollständigste Ausdruck des Charakters des Sowjets als einer Waffe des revolutionären Kampfes: ein Ausdruck des Kampfes selbst, mit Blick auf seine Weiterentwicklung durch die Organisierung der gesamten Arbeiterklasse.
Die revolutionäre Praxis der Arbeiterklasse klärte die Gewerkschaftsfrage, lange bevor sie theoretisch begriffen wurde. Als sich 1905 Gewerkschaften bildeten, neigten sie dazu, über ihren ursprünglichen Zweck hinauszugehen, da sie vom revolutionären Strom mitgerissen wurden. Nach 1905 zerfielen sie schnell, und 1917 war die Arbeiterklasse in ihrem Kampf gegen den Kapitalismus erneut in den Sowjets organisiert.
Der Gedanke, die Revolution von 1905 sei das Ergebnis der Rückständigkeit Russlands, hat, obwohl falsch, auch heute ein gewisses Gewicht. Gegen diese Idee verwiesen sowohl Lenin als auch Trotzki auf den tatsächlichen Entwicklungsgrad des russischen Kapitalismus.
[1] Rosa Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, Kap. I.
[2] Leo Trotzki, Die Revolution von 1905, Kap. 22: Die Bilanz der Revolution.
[3] Die Internationale Arbeiterbewegung, Bd. 2, Kap. 8, Progress Publishers, Moskau, 1976.
[4] siehe unsere Artikel, Was ist revolutionärer Syndikalismus? und Der Anarchosyndikalismus angesichts eines Epochenwandels: die CGT bis 1914, in: Internationale Revue Nr. 118 und Nr 120 (engl./franz./span. Ausgabe).
[5] R. Luxemburg, Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, in: Werke Bd. 2 Kap. 5.
[6] W.I. Lenin, Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, in: Werke Bd. 3, Anhang II.
[7] ebenda, Anhang III.
[8] Henry Reichman, Railways and revolution, Russia 1905, in: University of California Press, 1987 (eigene Übersetzung).
[9] W.I. Lenin, Der Fall von Port Arthur, Werke Bd. 8 S. 37 f.
[10] W.I.Lenin, Revolutionstage, Kapitel 8. Die Zahl der Toten und Verwundeten, in: Werke Bd. 8 S. 109.
[11] David Floyd, Russia in Revolt, Kap. 6 (eigene Übersetzung).
[12] W. I. Lenin, Der 1. Mai, in: Werke Bd. 8 S. 343 ff.
[13] Ein aktuelleres Werk widerspricht dieser Ansicht und argumentiert, dass diese Aussage „bloss zeigt, dass (...) Plehwe keinen Einwand dagegen zu haben schien, in den Krieg gegen Japan zu ziehen, in der Annahme, dass ein militärischer Konflikt die Massen von politischen Dingen ablenken könnte“ (Ascher, The Revolution of 1905, 2. Kapitel Krieg und politische Umwälzung, eigene Übersetzung).
[14] Lenins Bruder war Mitglied einer Gruppe, die vom Gedankengut der Gruppe Volkswille beeinflusst war. Er wurde 1887 nach einem Attentatsversuch auf Zar Alexander III. gehängt.
[15] Edward Crankshaw, The Shadow of the Winter Palace, Kap. 16, The Peace of the Graveyard (eigene Übersetzung).
[16] Theodor Shanin, Russia 1905-07. Revolution as a moment of truth, Kap. 1: A revolution comes to the boil (eigene Übersetzung).
[17] W. I. Lenin, Was tun?, Kap. IV Die Organisation der Arbeiter und die Organisation der Revolutionäre, Ges. Werke, Bd. 5.
[18] ebenda.
[19] Leo Trotzki, Die Russische Revolution von 1905, Kap. Dezember.
[20] Louis Adamic: Dynamite, Rebel Press, 1984.
[21] Die Rätebewegung in Russland 1905-1921, Kap. II: Die Sowjets in der Russischen Revolution von 1905.
[22] Leo Trotzki, Die Russische Revolution von 1905, Kap. Der Oktoberstreik.
[23] Leo Trotzki, Die Geschichte der Russischen Revolution, Kap. Doppelherrschaft.
[24] Leo Trotzki, Die Russische Revolution von 1905, Kap. Die Entstehung des Arbeiterdelegiertenrates.
[25] Die Rätebewegung in Russland 1905–1921, Kap. II Die Sowjets in der Russischen Revolution von 1905 S. 59.
[26] ebenda S. 69.
[27] Leo Trotzki, Die Russische Revolution von 1905, Kap Die Entstehung des Arbeiterdelegiertenrates.
[28] s. Massenstreiks in Polen 1980: Das Proletariat schlägt eine neue Bresche, in: Internationale Revue Nr. 23 (engl., franz., span. Ausgabe).
[29] s. Die internationale Dimension der Arbeiterkämpfe in Polen, in: Internationale Revue Nr. 24 (engl., franz., span. Ausgabe).
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Wirtschaftskrise - Der Abstieg in die Hölle
- 4148 Aufrufe
Der Abstieg in die Hölle
Die letzte Rezession von 2000/2001 entblösste die theoretischen Hirngespinste über die sogenannte „dritte industrielle Revolution“, basierend auf Mikroprozessoren und neuen Informationstechnologien. Weiter entlarvte der Börsenkrach die Fantastereien über die Entwicklung eines „Eigentümerkapitalismus“, der an die Stelle des Lohnempfängers den Teilaktionär setzen würde (!), eine weitere Version der Legende vom „Volkskapitalismus“, in dem jeder Arbeiter „Kleinbesitzer“ im Sinne eines Aktionärs „seines“ Unternehmens wäre.
Während Europa in den Abgründen der Wirtschaftsflaute versinkt, konnten die Vereinigten Staaten in ihrem Bemühen, die Rezession in Schranken zu halten, Erfolge verzeichnen. Dabei werden wir belehrt, die Triebkraft des amerikanischen Wiederaufschwungs gründe auf dem stärkeren Engagement innerhalb der famosen „neuen Ökonomie“ und der stärkeren Deregulierung sowie Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Die Erstarrung auf dem europäischen Kontinent hingegen fände ihre Erklärung in ihrem Rückstand in eben diesen Bereichen. Um diesem Manko abzuhelfen, orientiert sich die Europäische Union an der sogenannten „Strategie von Lissabon“. Letztere sieht vor, bis 2010 „die wettbewerbsfähigste und dynamischste wissensbasierte Wirtschaft der Welt“ zu errichten. In den von der Europäischen Union verfassten „Leitlinien für Beschäftigung“, auf die sich die neue Verfassung bezieht, lesen wir, dass die Staaten zur Reform der „allzu restriktiven Bedingungen der Gesetzgebungen hinsichtlich Beschäftigung“ angehalten werden, „welche die Dynamik des Arbeitsmarktes betreffen“. Weiter sollen sie „die Vielfalt der Modalitäten in Form von Arbeitsverträgen, vor allem hinsichtlich der Arbeitszeit“ fördern. Die herrschende Klasse versucht, das Blatt zu wenden, indem sie uns die letzte Rezession und den Börsenkrach als Schicksalswende auf dem Wachstumspfad und der Wettbewerbsfähigkeit präsentiert. Von neuem versucht sie sich als Verkünder einer besseren Zukunft - wenn nur die Arbeiter zu einigen zusätzlichen Opfern bereit wären, so dass endlich das Paradies auf Erden Wirklichkeit werden könne.
Im Folgenden soll anhand einer marxistischen Analyse offizieller Statistiken der Bourgeoisie gezeigt werden, dass diese Diskurse und Verordnungen zur Erhöhung der Sparquote äusserst realitätsfremd sind. Ein letzter Abschnitt des Artikels widmet sich der Widerlegung der von Battaglia Comunista (einer anderen revolutionären Organisation) entwickelten Methode zur Analyse der Krise.
Eine Systemkrise
Die letzte Rezession 2000/01 ist die sechste seit den 60er Jahren, welche die kapitalistische Wirtschaft erschütterte, und somit alles andere als ein einfacher Zwischenfall (vgl. Grafik 1). okograph1a
Die Rezessionen von 1967, 1970/71, 1974/75, 1980-82, 1991-93 und 2001/02 wurden tendenziell jedes Mal länger und tiefgreifender. Sie stehen im Kontext einer andauernden Abnahme der durchschnittlichen Wachstumsrate der Weltwirtschaft, die sich jedes Jahrzehnt verschärft. Diese Rezessionen sind also keineswegs unbedeutende Fehltritte auf dem Weg der Errichtung der „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaft der Welt“. Vielmehr verkörpern sie Etappen des langsamen, aber unaufhörlichen Abstiegs in die Hölle, dem die kapitalistische Produktionsweise nicht entgehen kann. Die triumphierenden Diskurse über die „new economy“ sind zahlreich: Liberalisierung der Märkte, EU-Erweiterung, technologische Revolution, Globalisierung sowie wiederholte Medienbluffs über die Leistungen der so genannten Schwellenländer, über die Öffnung der Märkte der Oststaaten und die Entwicklung Südostasiens und Chinas. Nichtsdestotrotz: die Wachstumsrate des Welt-Bruttoinlandprodukts pro Kopf sinkt jedes Jahrzehnt auf ein tieferes Niveau[1] [145].
Sicherlich, betrachtet man einzelne Indikatoren wie Arbeitslosigkeit, Wachstumsrate, Profitrate oder Welthandel, so hat die aktuelle Krise weitaus weniger Bedeutung und ein geringeres Tempo als der Zusammenbruch der Weltwirtschaft in den 30er Jahren. Seit der Krise in den 30er Jahren und insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ökonomien aller Länder allmählich unter die direkte oder indirekte und immer umfassendere Kontrolle ihrer Staaten gebracht. Hinzu kam die Errichtung von Wirtschaftskontrollen auf der Ebene der imperialistischen Blöcke (durch den IWF für den Westblock und den COMECON für den Ostblock)[2] [146]. Mit dem Zusammenbruch der Blöcke verschwanden auch die oben genannten internationalen Institutionen oder wurden zumindest zu einem Rückzug auf der Ebene politischer Bestimmungen gezwungen, wenn auch einige unter ihnen eine beschränkte ökonomische Einflussnahme beibehalten konnten. Diese „Organisation“ der kapitalistischen Produktion erlaubte es während Jahrzehnten, die Systemwidersprüche viel wirksamer als damals in den 30er Jahren im Zaun zu halten. Dadurch erklärt sich auch das zuweilen geringe Tempo der gegenwärtigen Krise. Durch eine Milderung der Folgen aus den Systemwidersprüchen ist aber noch keine Lösung gefunden.
Zunehmend fragilere Erholungsphasen
Die gegenwärtige Wirtschaftsentwicklung lässt sich nicht mit einem Jo-Jo vergleichen, bei dem die Hoch- und Tiefpunkte gleichermassen zum Bewegungsablauf gehören. Die heutige Entwicklung findet im Rahmen einer globalen und unumkehrbaren Tendenz des Niedergangs statt – auch wenn regulierende Interventionen der Staaten und internationalen Institutionen das Tempo dieser Entwicklung mindern mögen.
So steht es etwa mit dem als Musterbeispiel gepriesenen amerikanischen Wiederaufschwung: Die Vereinigten Staaten konnten das Ausmass ihrer Rezession in Grenzen halten, aber nur indem sie neue Ungleichgewichte auf sich nahmen, welche bei der nächsten Rezession für umso grösseren Schaden sorgen werden. Die Folgen für die Arbeiterklasse und alle Ausgebeuteten dieser Welt werden umso dramatischer sein. Es nützt nichts, sich mit der empirischen Feststellung der Abfolge von Rezession und Wiederaufschwung zu begnügen. Denn im Bestreben, die fortschreitende Abnahme der Wachstumsrate der Weltwirtschaft seit den 60er Jahren zu ergründen, sind wir damit noch keinen Schritt weitergekommen. Die wirtschaftliche Entwicklung seit den 60er Jahren verweist auf die grundlegenden Widersprüche des Kapitalismus. Sie besteht aus der Aufeinanderfolge von Rezessionen und Wiederaufschwüngen, wobei die Erholungsphasen auf zunehmend unsicherem Boden gründen. Der in den USA auf die Rezession 2000/2001 folgende Wiederaufschwung basierte im Wesentlichen auf drei äusserst zufallsbedingten Faktoren:
1. einem schnellen und gravierenden Anstieg des Handelsdefizits,
2. einer Wiederbelebung des Konsums, basierend auf zunehmender Verschuldung, auf der Aufhebung der Staatsersparnisse und auf Aussenfinanzierung,
3. einer spektakulären Senkung des Zinssatzes, wodurch eine verschärfte Instabilität internationaler Finanzmärkte angekündigt wird.
1. Ein rekordartiger Anstieg des Handelsdefizits
Seit Ende der 60er Jahre sind die Rezessionen (1967, 1970, 1974/75 und 1980-82) jedes Mal tiefgreifender (Grafik 2, unterbrochene Linie : Wachstumsraten des amerikanischen BIP, ausgezogene Linie: die öffentliche Verschuldung). okograph2 Im Vergleich dazu erscheinen die Rezessionen von 1991 und 2001 weniger bedeutsam und unterbrochen von längeren Erholungsphasen (1983-1990 und 1992-1999). Sind darin etwa die ersten Folgen einer aufstrebenden „new economy“ erkennbar, die von mancherlei Seite so gerne hervorgehoben werden? Sind wir Zeugen eines sich anbahnenden Umschwungs der Tendenz der fortgeschrittensten Volkswirtschaft der Welt? Und wartet dieser Umschwung nur darauf, in andere Erdteile exportiert und verallgemeinert zu werden? Diese Fragen sollen im Folgenden untersucht werden.
Die Feststellung von wirtschaftlichen Wiederaufschwüngen (auch geringer Bedeutung) kann uns nur dann nützlich sein, wenn wir die tiefer liegenden Triebkräfte verstehen. Zu diesem Zweck haben wir die Entwicklung des amerikanischen Staatsdefizits (s. ausgezogene Linie in Grafik 2) der Entwicklung der amerikanischen Wachstumsrate (s. unterbrochene Linie ebd.) gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass erstens jeder Phase des Wiederaufschwungs ein erhebliches Staatsdefizit vorausgeht und zweitens dieses Staatsdefizit jedes Mal das vorangegangene an Ausmass und/oder Länge übertrifft.
Wachstumsrate pro Jahrzehnt
USA Europa
1950–59 4,11 4,72
1960–69 4,41 5,01
1970–79 3,24 3,29
1980–89 2,98 2,24
1990–99 3,00 1,74
(Quelle: BEA und A. Maddison, L’économie mondiale, OECD)
Auch die bisher längsten Phasen des Wiederaufschwungs in den 80er und 90er Jahren ebenso wie die relative Abschwächung der Rezessionen sind vor allem auf ein langfristig erhöhtes Staatsdefizit zurückzuführen. Dasselbe gilt für den Wiederaufschwung, der auf die Rezession 2000/01 folgte. Das „Wachstum“ der USA könnte einer Deflation nur knapp entgehen, würde es sich nicht auf ein Staatsdefizit abstützen, dessen Ausmass und Anstiegstempo historische Rekorde erreicht. Die Kombination von Steuersenkungen (welche v.a. die hohen Einkommen betreffen) und Militärausgaben hatte ein Budgetdefizit von bis zu 3,5 % zur Folge, während es im Jahr 2000 noch bei 2,4 % lag. Ausserdem sollten die für das Jahr 2005 gesetzten Prioritäten entgegen den Versprechungen während dem Präsidentschaftswahlkampf durch eine zusätzliche Erhöhung dieses Defizits umgesetzt werden, unter Berücksichtigung der zunehmenden Rüstungs- und Sicherheitsausgaben sowie bedeutender Steuersenkungen für die Reichsten[3] [147]. Die wenigen Massnahmen, die dem steigenden Staatsdefizit entgegenwirken sollen, werden auf dem Rücken der Ausgebeuteten umgesetzt, denn vorgesehen ist die Streichung von Staatsausgaben, welche den Ärmsten zugesprochen waren[4] [148].
Schliesslich müssen wir auch dem Mythos einer neuen, aufstrebenden Tendenz der Vereinigten Staaten ein Ende setzen. Seit dem starken Einbruch Ende der 60er Jahre verharren die Wachstumsraten pro Jahrzehnt auf einem Niveau von etwa 3%. Sie liegen also unter dem Niveau früherer Jahrzehnte. Und darüber kann auch die um zwei Hundertstel Prozente höhere Wachstumsrate von 1990-99 gegenüber 1980-89 nicht hinwegtäuschen! Dem Versuch, aus diesen zwei Hundertsteln einen Trendwechsel ableiten zu wollen, entgeht jede Glaubwürdigkeit.
Dieser Mythos von einer durch die USA eröffneten neuen Wachstumsphase ist eine Schöpfung der amerikanischen Bourgeoisie in ihrem Bestreben, eine auch noch so geringe europäische Leistungsfähigkeit zu entkräften. Tatsächlich aber konnte Europa bis in die 90er Jahre ihren Rückstand gegenüber der führenden Volkswirtschaft der Welt aufholen[5] [149].
Die grössere Stabilität der amerikanischen Wirtschaft beruht nicht so sehr auf Investitionen im Bereich der so genannten „new economy“ und einer daraus resultierenden höheren Effizienz. Vielmehr beruht sie auf einer durchaus klassischen, enormen Verschuldung aller Wirtschaftsakteure, die im Übrigen ihre finanzielle Grundlage in ausländischen Vermögen haben. Dasselbe gilt für den Anstieg des Staatsdefizits sowie für die weiteren Parameter, welche dem amerikanischen Wiederaufschwung zugrunde liegen. Dies soll im Folgenden gezeigt werden.
2. Eine Wiederbelebung des Konsums durch Verschuldung
Einer der Gründe für das grössere Wachstum in den Vereinigten Staaten liegt in der Konsumförderung der Haushalte. Dafür werden mehrere Mittel eingesetzt:
- spektakuläre Steuersenkung zur Konsumförderung der Reichen, zum Preis einer zusätzlichen Verschlechterung des Staatsbudgets;
- Senkung des Zinssatzes von ehemals 6,5 % Anfang 2001 auf 1 % Mitte 2004, Senkung der Sparquote (Grafik 4), was die Verschuldung der Haushalte auf Rekordhöhe anstiegen liess (Grafik 5) und eine Spekulationsblase auf dem Immobilienmarkt ankündigt.
Eine solche Dynamik des Konsums der Haushalte führt zu folgenden drei Problemen: einer wachsende Verschuldung der Haushalte mit drohendem Immobilienkrach; einem wachsenden Handelsdefizit gegenüber der übrigen Welt (5,7 % des amerikanischen BIP im Jahr 2004 – d.h. über ein Prozent des Welt-BIP – im Vergleich zu 4,8 % im Jahr 2003) und einer immer ungleicheren Einkommensverteilung[6] [150].
Grafik 4 zeigt, dass bis zu Beginn der 80er Jahre die Haushalte 8 bis 9 % ihres Einkommens, nach Abzug der Steuern, sparten. Sodann wurde ein kontinuierlicher Fall der Sparquote bis auf etwa 2 % eingeleitet. Der darauf beruhende Konsum gehört zur Basis des zunehmenden Aussendefizits der USA. Die USA importieren jeweils mehr Güter und Dienstleistungen, verglichen mit ihrem Auslandsabsatz, als die übrige Welt. Letztere wird bei diesem Kurs zu einem immer wichtigeren Kreditgeber der Vereinigten Staaten. Ermöglicht wurde eine solche Entwicklung dadurch, dass Ausländer, welche durch das amerikanische Aussendefizit zu Dollar gelangen, diese direkt auf den amerikanischen Finanzmärkten anlegen können, anstatt sie in andere Devisen umtauschen zu müssen. Dieser Mechanismus lässt die Bruttoverschuldung der USA gegenüber der übrigen Welt aufblähen. Sie stieg von 20 % des BIP um 1980 auf 90 % um 2003 und erreicht damit eine hundertzehnjährige Rekordhöhe[7] [151]. Eine so hohe Schuldenlast gegenüber anderen Ländern schwächt auch die Einkommen aus dem amerikanischen Kapital, aus denen die Zinsen finanziert werden müssen. Fragt sich also, wie lange die amerikanische Wirtschaft diesem Druck noch standhalten kann.
Denn hinzu kommt, dass die oben besprochene Verschuldung der amerikanischen Haushalte Teil einer tendenziellen Zunahme der Gesamtverschuldung der amerikanischen Wirtschaft ist. Diese Verschuldung nimmt gigantische Ausmasse an: Sie übersteigt 300 % des amerikanischen BIP im Jahr 2002 (Grafik 7) okograph7 – genau genommen 360 %, wenn die staatliche Bruttoverschuldung mitberücksichtigt wird. Wollte man die gesamte Verschuldung zurückzahlen, würde dies mehr als drei Jahre Gratisarbeit bedeuten. Hierdurch wird das oben Gesagte bestätigt: kürzere Rezessionsphasen verbunden mit längeren Wiederaufschwungsphasen seit Beginn der 80er Jahre sind kein Argument für eine neue Wachstumsphase, welche auf einer „dritten industriellen Revolution“ gründen würde. Die erwähnten Wiederaufschwungsphasen haben keine „gesunde“ Ausgangslage, sondern beruhen auf einer zunehmend künstlichen Wachstumsbasis.
3. Die Senkung der Zinsrate erlaubt eine Abwertung des Dollars mit Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
Kommen wir zum dritten Faktor des amerikanischen Wiederaufschwungs: dem fortschreitenden Fall der Zinsrate. Diese sank von 6,5 % Anfang 2001 auf 1 % Mitte 2004. Somit wurde der Binnenmarkt gestärkt und eine konkurrenzfähige, deflationäre Dollarpolitik auf dem internationalen Markt ermöglicht.
Die tiefen Zinssätze trieben die Verschuldung weiter an (v.a. durch den dadurch billig gewordenen Hypothekarkredit). Deshalb konnten Konsum und Wohnungsmarkt die Wirtschaftsaktivität ankurbeln und die Ausgaben fördern, trotz rückläufiger Beschäftigungsquoten während der Rezession. Dies zeigt sich im Konsumanteil der amerikanischen Haushalte am BIP, welcher von 1950 bis 1980 um 62 % schwankte und seither kontinuierlich bis auf über 70 % zu Beginn des 21. Jahrhunderts angestiegen ist.
Zu beachten ist aber auch die Antwort auf das amerikanische Handelsdefizit: eine starke Dollarabwertung (ca. 40 %) gegenüber den nicht der führenden Währung angepassten Devisen, also hauptsächlich gegenüber dem Euro (und teilweise auch dem Yen). Das amerikanische Wirtschaftswachstum beruht also auf Pump und vollzieht sich auf dem Rücken der übrigen Welt. Finanziert wird die US-Wirtschaft nämlich von Kapitalströmen ausländischen Ursprungs, ermöglicht durch die hegemoniale Stellung der USA. Tatsächlich wäre jedes andere Land, das sich in derselben Lage befände, zu einem hohen Zinssatz gezwungen, um Kapitalströme anzuziehen.
Die wirtschaftliche Dynamik seit Ende der 60er Jahre
Wir haben gesehen, dass die Erholung nach der Rezession von 2001 noch zerbrechlicher war als alle vorangegangenen. Sie fand während einer Zunahme von Rezessionen statt, welche eine Veranschaulichung des konstanten Niedergangs der Wachstumsrate seit Ende der 60er Jahre sind. Um diese sinkende Tendenz der Wachstumsrate und vor allem ihren unumkehrbaren Charakter zu verstehen, müssen wir die Gründe dafür genauer betrachten.
Mit der Erschöpfung der zu Ende des Zweiten Weltkrieges lancierten Dynamik, als die wieder aufgebaute europäische und japanische Wirtschaft den Markt mit überschüssigen Produkten (im Verhältnis zur den zahlungskräftigen Absatzmärkten) zu überfluten begannen, begann sich das Produktivitätswachstum der Arbeit zu verlangsamen, und zwar seit Mitte der 60er Jahre in den USA und zu Beginn der 70er Jahre auch in Europa (siehe Grafik 8). okograph8
Seit das Wachstum der Produktivität zum Hauptfaktor geworden ist, um dem tendenziellen Fall der Profitrate entgegen zu treten, ist das verlangsamte Wachstum zu einem verstärkenden Faktor für den tendenziellen Fall der Profitrate geworden, sowie auch für den Druck auf andere grundlegende Anteile der kapitalistischen Wirtschaft: vor allem auf die Akkumulationsrate8 [152] und das wirtschaftliche Wachstum9 [153]. Die Grafik 9 okograph9 zeigt klar diesen Fall der Profitrate, der Mitte der 60er Jahre in den USA und zu Beginn der 70er Jahre in Europa begann und bis 1981-82 anhielt.
Wie diese Grafik deutlich zeigt, hörte der Fall der Profitrate zu Beginn der 80er Jahre auf, und die Kurve zeigt seither nach oben. Die grundlegende Frage ist nun die nach den Gründen für diese Umkehr, da die Profitrate eine zusammengesetzte Variable ist, welche durch verschiedene Parameter bestimmt wird, die wir unter den folgenden Übertiteln zusammenfassen können: die Mehrwertrate, die organische Zusammensetzung des Kapitals und die Arbeitsproduktivität10 [154]. Um es bildlich darzustellen und auf den Kern der Sache zu sprechen zu kommen, kann man sagen, dass der Kapitalismus dem tendenziellen Fall der Profitrate entweder „nach oben“ entfliehen kann durch die Intensivierung der Arbeitsproduktivität oder „nach unten“ durch verstärkte Angriffe gegen die Lohnarbeiter. Die in diesem Artikel aufgeführten Daten zeigen deutlich, dass der Anstieg der Profitrate nicht Resultat neuer Fortschritte in der Arbeitsproduktivität ist, die in der Folge einer „dritten industriellen Revolution aufgrund der Mikroprozessoren“ (der so genannten „new economy“) eine Verringerung oder Bremsung des Wachstums der organischen Zusammensetzung des Kapitals nach sich ziehen würde. Nein, er entstand aufgrund direkter und indirekter Lohnbeschneidungen und der anwachsenden Arbeitslosigkeit (siehe Grafiken.
Der heutigen Situation liegt die Tatsache zu Grunde, dass weder die Akkumulation (Grafik 12), noch die Produktivität noch das Wachstum in den letzten 25 Jahren Schritt gehalten haben mit der in de gleichen Zeit wieder gefundenen Rentabilität der Unternehmen. Im Gegenteil blieben all diese grundlegenden Faktoren rückläufig. Normalerweise jedoch wächst in den historischen Perioden, in denen die Profitrate ansteigt, die Akkumulationsrate ebenfalls, und vergrössern sich damit auch die Produktivität und das Wachstum. Wir müssen uns deshalb folgende grundlegende Frage stellen: Weshalb haben trotz einer neuen Gesundung und Aufwärtsbewegung der Profitrate die Kapitalakkumulation und das wirtschaftliche Wachstum nicht mitgezogen?
Die Antwort darauf gibt Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie, und besonders im Kapital, in dem er seine zentrale These der Unabhängigkeit zwischen der Produktion und den Märkten aufstellt: „(…) es ist dann möglich, da Markt und Produktion zwei gegeneinander gleichgültige Momente sind, dass die Erweiterung des einen de Erweiterung der andren nicht entspricht“ (Theorien über den Mehrwert, MEW Bd. 26.2 S. 525). “Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich auseinander. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, die andren durch die Proportionalität der verschiednen Produktionszweige und durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft.“ (MEW Bd. 25 S. 254). Dies heisst, dass die Produktion nicht ihren eigenen Markt schaffen kann (umgekehrt hat aber die Sättigung des Marktes eine Wirkung auf die Produktion, weil die Kapitalisten sie zurückschrauben müssen, um ihren totalen Ruin zu vermeiden). Mit anderen Worten: Der Hauptgrund, weshalb der Kapitalismus in eine Situation gerät, in der zwar die Rentabilität seiner Betriebe wiederhergestellt ist, aber ohne dass die Produktivität, die Investitionen, die Akkumulationsrate und somit ein Wachstum dieser Tendenz folgen, liegt in den unzureichenden zahlungskräftigen Absatzmöglichkeiten.
Es sind auch diese unzureichenden zahlungskräftigen Absatzmöglichkeiten, welche den Grund für die sogenannte Tendenz zur „Verfinanzung der Wirtschaft“10a [155] bilden. Wenn die heutigen überschüssigen Profite nicht wieder investiert werden, dann nicht wegen einer tiefen Rentabilität von investiertem Kapital (wie in der Logik derer, die sich die Krise allein durch den tendenziellen Fall der Profitrate erklären), sondern eben gerade wegen unzureichenden zahlungskräftigen Absatzmärkten. Dies ist in der Grafik 12 deutlich ersichtlich, welche zeigt, dass trotz eines Anstiegs der Profite (die Grenzrate gibt das Verhältnis zwischen Profit und zugefügtem Wert an) als Resultat verschärfter Sparpolitik die Investitionsrate weiter gesunken ist (und ebenso das wirtschaftliche Wachstum), was die Zunahme der Arbeitslosigkeit und der nicht investierten Profite, die in Form von finanziellen Erträgen ausgezahlt werden, erklärt11 [156]. In den USA bildeten finanzielle Erträge (Zinsen und Dividenden, ohne Kapitalgewinne) im Durchschnitt 10% der totalen Erträge zwischen 1952 und 1979. Danach stiegen sie zwischen 1980 und 2003 stetig an bis auf 17%.
Der Kapitalismus ist nur fähig, die Auswirkungen seiner Widersprüche zu kontrollieren indem er den Tag der grossen Abrechnung hinausschiebt. Dies hat die Widersprüche nicht gelöst, sondern nur explosiver gemacht. Die gegenwärtige Krise, klar verdeutlicht durch die Unfähigkeit der seit den 30er Jahren und dem Zweiten Weltkrieg installierten wirtschaftlichen Massnahmen und der eingeschlagenen Politik, ist tiefer und bedeutender bezüglich der Widersprüche des Systems als alle vorangegangenen Krisen.
Battaglia Comunista versucht sich die Krise anders zu erklären
Wir haben gesehen, dass die Erklärungen der herrschenden Klasse keinen Heller wert sind und nichts anders als eine Mystifizierung darstellen, um den historischen Bankrott ihres Systems zu verschleiern. Leider haben auch einzelne revolutionäre politische Gruppen diese Konzepte aufgegriffen (ob freiwillig oder nicht), entweder in den offiziellen Versionen oder in linken und Globalisierungsgegner-Varianten. Wir wollen hier die Analyse genauer betrachten, die von Battaglia Comunista entwickelt wurde12 [157].
Dabei gilt es zu Beginn festzuhalten, dass alles bisher Aufgezeigte eine klare Widerlegung der „Analysen“ über eine „dritte industrielle Revolution“, über die „parasitäre Finanzierung“ des Kapitalismus und die „Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse“ darstellt. Erstere hat Battaglia offenbar direkt von der offiziellen Propaganda der herrschenden Klasse übernommen, die zwei andern den Linken und Globalisierungsgegnern von den Lippen abgelesen13 [158].
Battaglia scheint felsenfest davon überzeugt zu sein, dass sich der Kapitalismus inmitten einer „dritten industriellen Revolution durch die Mikroprozessoren“ befindet und „eine Umstrukturierung seines Produktionsapparates“ sowie eine „konsequente Veränderung der früheren Klassenzusammensetzung“ vornimmt. All dies mache ihm einen „lang anhaltenden Widerstand gegen die Krise des Akkumulationszyklus“ möglich14 [159]. Nun, das zwingt uns wahrlich zu einigen Bemerkungen:
1. Wenn der Kapitalismus sich wirklich inmitten einer „industriellen Revolution“ befinden würde, wie Battaglia sagt, dann sollte doch wenigstens – per Definition – ein Anstieg der Arbeitsproduktivität sichtbar sein. Genau davon scheint Battaglia auch überzeugt, wenn es ohne Zögern und ohne Überprüfung behauptet „die tief greifende Restrukturierung des Produktionsapparates hat eine Schwindel erregende Steigerung der Produktivität mit sich gebracht“, und wenn es wiederholt in der letzten Ausgabe seiner theoretischen Zeitschrift meint: „…eine industrielle Revolution, mit anderen Worten des Produktionsprozesses, hatte immer den Effekt der Erhöhung der Arbeitsproduktivität“15 [160]. Doch haben wir vorher nicht deutlich gesehen, wie sich in der Realität bezüglich der Arbeitsproduktivität genau das Gegenteil abspielt, als es der Bluff der bürgerlichen Propaganda behauptet, welcher von Battaglia aufgegriffen wird? Diese Organisation scheint nicht zu wissen, dass das Anwachsen der Arbeitsproduktivität vor mehr als 35 Jahren einzubrechen begann und seit den 80er Jahren mehr oder weniger stagniert (siehe Grafik 8)16 [161].
2. Wir haben gesehen, wie für Battaglia die „dritte industrielle Revolution durch die Mikroprozessoren“ angeblich dermassen potent ist, dass sie eine „Schwindel erregende Steigerung der Produktivität bewirkt“ habe, welche es möglich mache „das ansteigende Wachstum der organischen Zusammensetzung zu vermindern“. Doch nur schon eine Untersuchung der wirklichen Dynamik der Profitrate zeigt, wie der Rezession von 2000-2001 in den USA schon 199717 [162] eine zeitweilige Rückentwicklung vorangegangen war (siehe Grafik 9), vor allem weil die wunderbare „new economy“ zu einer Vergrösserung des Kapitals geführt hatte, mit anderen Worten: zu einem Anstieg der organischen Zusammensetzung und nicht zu einem Rückgang, wie Battaglia behauptet18 [163]. Die neuen Technologien erlaubten zwar schon einen gewissen Produktivitätszuwachs19 [164], doch war dieser unzureichend, um die Investitionskosten wett zu machen, und zwar trotz des Sinken ihres relativen Preises, was schliesslich bei der organischen Zusammensetzung des Kapitals ins Gewicht fiel und so zu einer Wende in der Profitrate in den USA führte, die seit 1997 wieder sinkt. Diese Feststellung ist wichtig, weil sie alle Illusionen in die Fähigkeit des Kapitalismus, sich von seinen eigenen Gesetzten zu befreien, zerstört. Die neuen Technologien sind keine Zauberformel, die es erlauben würde, Kapital gratis zu akkumulieren.
3. Hinzu kommt: Wenn die Arbeitsproduktivität tatsächlich eine „Schwindel erregende Steigerung“ erleben würde, dann müsste (für jeden der Marx nur einigermassen kennt) auch die Profitrate ansteigen. Und das versucht uns Battaglia auch weis zu machen, ohne es jedoch ausdrücklich zu sagen, wenn sie behauptet: „Im Vergleich zu vorangegangenen industriellen Revolutionen (…) hat diejenige, die auf den Mikroprozessoren beruht (…) auch die Investitionskosten reduziert, in der Wirklichkeit also die Kosten des konstanten Kapitals, was somit den Anstieg der organischen Zusammensetzung vermindert“20 [165]. Wie wir sehen, geht Battaglia nicht davon aus, dass es eine Vergrösserung der Profitrate gegeben hat. Haben die Genossen vergessen, was ihre Schwesterorganisation, die CWO, vor einiger Zeit schrieb: „Wenn die Produktivität schneller wächst als die organische Zusammensetzung des Kapitals, so sinkt die Profitrate nicht, im Gegenteil sie wird ansteigen“ (Revolutionary Perspectives Nr. 16, alte Serie, „Kriege und Akkumulation“, Seite 15-17)? Battaglia zieht es vor, diskret von „der Verminderung des Anstiegs der organischen Zusammensetzung“ zu sprechen, als Resultat „der Schwindel erregenden Steigerung der Produktivität aufgrund der industriellen Revolution, die auf den Mikroprozessoren beruht“, statt vom Anstieg der Profitrate. Weshalb solche sprachliche Windungen? Weshalb wird die Wirklichkeit der Wirtschaft dem Leser vorenthalten? Ganz einfach: weil das Resultat der eigenen Untersuchungen (ob sie nun richtig sind oder nicht) über die Entwicklung der Arbeitsproduktivität das alte Dogma, sich die Krise ausschliesslich durch den tendenziellen Fall der Profitrate zu erklären, ins Wanken bringen würde. Battaglia Comunista hat nie eine Gelegenheit verpasst, ihr altes Credo vom stetigen Fall der Profitrate zu unterstreichen. Diese Organisation ist dermassen besorgt „die Welt zu verstehen“, und zwar ausserhalb der angeblich abstrakten Schemen der IKS, dass sie darob gar nicht bemerkt, wie die Profitrate im letzten Vierteljahrhundert entschieden angestiegen ist (Grafik 9) und nicht gesunken, wie sie immer noch behauptet! Für diese 28-jährige Blindheit gibt es nur eine Erklärung: Wie könnte sie weiterhin gegenüber der Arbeiterklasse über die Krise des Kapitalismus sprechen, ohne gleichzeitig das Dogma des tendenziellen Falls der Profitrate als alleinigen Grund für die Krise in Frage zu stellen, wenn jene seit Beginn der 80er Jahre wieder gestiegen ist?
4. Der Kapitalismus überlebt nicht, indem er durch eine „industrielle Revolution“ aufwärts strebt und „eine Schwindel erregende Steigerung der Produktivität“ erlebt, wie Battaglia vorgibt, sondern indem er abwärts driftet, durch eine drastische Verringerung der Lohnmasse, welche die Welt in eine Misere führt und dabei gleichzeitig seine Absatzmärkte reduziert. Wer aufmerksam die Triebkräfte hinter dem Steigen der Profitrate im letzten Vierteljahrhundert verfolgt, sieht, dass dies nicht wegen einer „Schwindel erregenden Steigerung der Produktivität“ geschieht oder der „Verminderung des Anstiegs der organischen Zusammensetzung“, sondern wegen einer brutalen Sparpolitik auf den Schultern der Arbeiterklasse.
Da die Profitrate seit 25 Jahren ansteigt, ist die gegenwärtige Entwicklung des Kapitalismus eine klare, mit Fakten untermauerte Widerlegung der Argumente derjenigen, die den Mechanismus des „tendenziellen Falls der Profitrate“ zur einzigen Begründung für die ökonomische Krise machen. Wenn die Krise heute trotz der wieder gefundenen Rentabilität der Unternehmen andauert, dann deshalb, weil die Unternehmen nicht wie früher die Produktion erhöhen, sondern weil sie durch ungenügende Absatzmärkte an Grenzen stossen. Dies zeichnet sich durch kärgliche Investitionen und somit ein schwaches Wachstum aus. Battaglia Comunista ist unfähig, dies zu verstehen, da diese Organisation die grundlegende These von Marx über die Unabhängigkeit zwischen der Produktion und Markt (wie schon aufgezeigt) nicht verstanden hat und ihr die absurde Idee entgegenstellt, dass die Entwicklung oder Begrenzung des Marktes von der auf- oder niedergehenden Dynamik der Profitrate abhängig sei21 [166].
Angesichts all dieses Unverständnisses selbst grundlegender Gesetzmässigkeiten können wir Battaglia Comunista gegenüber nur unseren Ratschlag wiederholen: Studiert das ABC der marxistischen ökonomischen Lehre, bevor ihr versucht, Lehrer und Richter der IKS zu spielen! Battaglias Weigerung, uns eine Antwort zu geben, dient lediglich dazu, ihre offensichtliche und wachsende Unfähigkeit, auf unsere Argumente politisch einzugehen, zu verbergen22 [167].
Battaglia behauptet, im Vergleich zu den „abstrakten Schemen der IKS“, die „ausserhalb des historischen Materialismus stehen“, selber „…die Fakten der Krise im Westen mit all ihren finanziellen Aspekten und auf der Ebene der Wiederbelebung, ausgelöst durch die revolutionäre Welle der Mikroprozessoren, gut analysiert zu haben“23 [168]. Wir haben jedoch gesehen, wie Battaglias „Studie“ nichts anderes ist als ein Abklatsch von linken und Globalisierungsgegner-Theorien über den „Parasitismus der Zinsen“24 [169]. Ihre Kopie ist nicht nur ungenügend, sondern überhaupt nicht schlüssig und in sich widersprüchlich, da Battaglia die marxistischen ökonomischen Konzepte schlecht beherrscht, auf die sie sich berufen will. Sie versteht diese Konzepte nicht und schreckt auch nicht davor zurück, sie nach ihren Gutdünken umzuwandeln wie die These von Marx über die Unabhängigkeit von Produktion und Markt. In der geheimnisvollen Welt der Dialektik à la Battaglia wird sie umgewandelt in ein Gesetz der absoluten Abhängigkeit von „ökonomischem Zyklus und dem Prozess der Verwertung, die den Markt „kaufkräftig“ oder „nicht kaufkräftig“ machen“. Wir erwarten von kritischen Beiträgen, die vorgeben, die marxistische Methode der angeblich idealistischen der IKS entgegenzusetzen, mehr als eine Ansammlung von Dummheiten.
Schlussfolgerungen
Bei grundlegenden Fragen der ökonomischen Analyse tappt Battaglia Comunista laufend in die Falle, bei den Erscheinungen stehen zu bleiben, statt deren Wesen mit einem marxistischen Rahmen zu verstehen. Wir haben auch gesehen, wie Battaglia Comunista das Geschwätz der Bourgeoisie über eine „dritte industrielle Revolution“ für bare Münze nimmt, und dies lediglich wegen dem empirischen Erscheinen gewisser neuer Technologien im Mikrotechnologie-Sektor und in der Informatik, wie spektakulär diese auch sein mögen25 [170]. Als Resultat davon gelangt Battaglia zur absolut spekulativen Behauptungen über „Schwindel erregende Steigerungen in der Produktivität“ und eine „Reduktion der Kosten des konstanten Kapitals, die das Anwachsen der organischen Zusammensetzung vermindert“. Doch im Gegenteil, eine handfeste marxistische Analyse über die grundlegenden Kräfte in der Dynamik der kapitalistischen Ökonomie (den Markt, die Profitrate, die Mehrwertrate, die organische Zusammensetzung des Kapitals, die Produktivität der Arbeit, usw.) hat uns nicht nur ermöglicht zu begreifen, dass es sich dabei im Wesentlichen um einen Medien-Bluff handelt, sondern dass die Realität gerade umgekehrt ist als das ganze Geschwätz der Bourgeoisie, welches leider auch von Battaglia Comunista wiedergekäut wird.
Die Krise zu verstehen, ist nicht eine akademische Übung, sondern allem voran eine militante Anstrengung. Wie schon Engels schrieb: “Ihre Aufgabe (der ökonomischen Wissenschaft) ist vielmehr, die neu hervortretenden gesellschaftlichen Missstände als notwendige Folgen der bestehenden Produktionsweise, aber auch gleichzeitig als Anzeichen ihrer hereinbrechenden Auflösung nachzuweisen, und innerhalb der sich auflösenden ökonomischen Bewegungsform die Elemente der zukünftigen, jene Missstände beseitigenden, neuen Organisation der Produktion und des Austausches aufzudecken.“ Und dies wird nur möglich, „(...) wenn die fragliche Produktionsweise ein gutes Stück ihres absteigenden Astes hinter sich, wenn sie sich halb überlebt hat, wenn die Bedingungen ihres Daseins grossenteils verschwunden sind und ihr Nachfolger bereits an die Tür klopft (...)“ (Engels, Anti-Dühring, MEW, Bd. 20, S. 138/139). Dies ist die Bedeutung und das Ziel der Arbeit der Revolutionäre auf der Ebene der ökonomischen Analyse. Sie erlaubt uns, den Rahmen zu verstehen, in dem sich das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen entwickelt und welches ihre bestimmenden Faktoren sind, seit der Kapitalismus in seine dekadente Phase eingetreten ist. Hier liegt auch die materielle und (potentielle) subjektive Basis für die proletarische Revolution. Genau dies versucht die IKS in ihren Analysen immer aufzuzeigen. Doch Battaglia Comunista hat dies durch die Zurückweisung des Konzepts der Dekadenz des Kapitalismus26 [171] und durch die Übernahme einer akademistischen und monokausalen Vision vollständig vergessen. Ihre „wissenschaftliche Ökonomie“ dient nicht mehr dazu „die soziale Härte“, die „Anzeichen der beginnenden Zersetzung“ des Kapitalismus aufzuzeigen, wie es schon die Gründer des Marxismus taten, sondern versucht uns zum Narren zu halten mit linker und Globalisierungsgegner-Prosa über die „Überlebenskapazitäten des Kapitalismus“ durch die „Verfinanzung des Systems“, durch die „Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse“ und vor allem durch die „grundlegenden Wandlungen des Kapitalismus“ aufgrund der „dritten industriellen Revolution, die auf den Mikroprozessoren basiert“, sowie auf den neuen Technologien, usw.
Heute ist Battaglia Comunista völlig desorientiert und weiss nicht mehr, was sie gegenüber der Arbeiterklasse vertreten soll: Ist die kapitalistischen Produktionsweise in der Dekadenz, ja oder nein27 [172]? Ist es die kapitalistische Produktionsweise oder die soziale Struktur des Kapitalismus, die sich in der Dekadenz befindet28 [173]? Ist der Kapitalismus „schon seit über 30 Jahren in der Krise“29 [174], oder erlebt er eine „dritte industrielle Revolution durch die Mikroprozessoren“, die eine „Schwindel erregende Steigerung der Produktivität“ auslöst30 [175]? Ist die Profitrate im Steigen begriffen, wie es die Statistiken belegen, oder ist sie stetig am Sinken wie Battaglia andauernd wiederholt, bis zum Punkt an dem der Kapitalismus gezwungen sei, weltweite Kriege zu entfesseln, um seinen Bankrott zu verhindern31 [176]? Befindet sich der Kapitalismus heute in einer Sackgasse, oder verfügt er über eine „lange Fähigkeit zu überleben“ durch die „dritte industrielle Revolution“32 [177], oder verfügt er sogar über eine „Lösung“ seiner Krise mittels Kriegen: „(…) die kriegerische Lösung scheint das wesentliche Mittel zu sein für die Verwertung des Kapitals“ (Plattform des IBRP)? Dies alles sind entscheidende Fragen, wenn es darum geht, sich in der heutigen Situation zurecht zu finden. Battagila Comunista dreht sich im Kreise und ist unfähig, der Arbeiterklasse auf diese Fragen eine klare Antwort zu geben.
CC
Der Bluff einer neuen industriellen Revolution
Damit sich der Leser / die Leserin besser ein Urteil darüber bilden kann, ob es wirklich eine „dritte industrielle Revolution, die auf dem Mikroprozessor beruht“, gibt, wie dies Battaglia Comunista behauptet, drucken wir nachstehend einige aussagekräftige Abschnitte aus dem Buch von P. Artus über die neue Ökonomie ab (La nouvelle économie, erschienen bei La Découverte), der sich für seine Analyse über weite Strecken marxistischer Werkzeuge bedient: „Die neue Ökonomie beschleunigte das Wachstum von 1992 bis 2000 aufgrund des Zuschusses an verwendetem Kapital, den sie anzog, aber ohne dass dadurch die allgemeine Produktivität der Faktoren (der allgemeine technische Fortschritt) gesteigert worden wäre. In diesem Sinn weicht die neue Ökonomie klar von früheren technologischen Errungenschaften wie der Elektrizität ab. (…) Paradoxerweise kann man sich sogar fragen, ob es die neue Ökonomie wirklich gibt. Wir beobachten in der Tat ein „Aufschäumen“ … (…) Es geht nicht darum, dies zu bestreiten, aber sich zu fragen, ob es sich dabei wirklich um einen technologischen Zyklus handelt. D.h. um eine anhaltende Beschleunigung des technischen Fortschritts und des Wachstums auch über den Zeitpunkt hinaus, in welchem die Investitionsanstrengungen wieder aufhören. (…) Der Sektor der neuen Ökonomie (Telekommunikation, Internet, Produktion von Computern und Software …) stellt 8% der ganzen amerikanischen Wirtschaft dar; und selbst wenn dessen Wachstum schnell ist, vergrössert es das gesamte Wachstum der USA nur um 0.3% pro Jahr. In der übrigen Wirtschaft (den restlichen 92%) hat sich das Wachstum der gesamten Produktivität der Faktoren (d.h. das Wachstum der Produktivität, die für ein gegebenes Kapital und die entsprechende Arbeit möglich ist, der reine technische Fortschritt) in den 1990er Jahren nicht stark beschleunigt. Man beobachtet eine gewaltige Investitionsanstrengung der Unternehmen, die die neuen Technologien in ihr produktives Kapital integrieren, und es ist im wesentlichen diese Investitionsanstrengung, die den Wachstumszuwachs hervorruft, und zwar sowohl bei der Nachfrage (die Investitionen wachsen stark) als auch beim Angebot (das Volumen des vorhandenen produktiven Kapitals wächst um mehr als 6% pro Jahr). Auch diese Situation lässt sich aber nicht lange aufrechterhalten. (…) Wenn es wirklich einen technologischen Zyklus geben soll, so müsste die Kapitalakkumulation in einem bestimmten Augenblick eine Wachstumsbeschleunigung bei der allgemeinen Produktivität hervorrufen, es müsste also spontan ein schnelleres Wirtschaftswachstum geben, ohne dass das produktive Kapital sich weiterhin schneller als das BIP vergrössert (*). Gewisse Leute vertreten angesichts dieser fehlenden neuen Ökonomie die Meinung, dass das Internet keine technologische Errungenschaft sei, die mit den bedeutenden Erfindungen der Vergangenheit verglichen werden könne (Elektrizität, Automobil, Telefon, Dampfmaschine, (…) ein Grund dafür sei, dass die neuen Informationstechnologien nur ältere Techniken ersetzten, sie träten an ihre Stelle, seien aber kein völlig neues Produkt, das einen Zuwachs bei der Nachfrage und dem Angebot nach sich ziehen würde; ein anderer Grund sei, dass die Kosten für die Installation, den Betrieb und die Verwaltung dieser neuen Technologien hoch seien und den Gewinn gleich wieder aufheben würden. (…) Diese Unsicherheiten bei der neuen Ökonomie sind natürlich durch die Rezession der Jahre 2001-2002 verstärkt worden. Es ist klar zum Ausdruck gekommen, dass Ende der 1990er Jahre zuviel investiert worden ist, dass sich die Rentabilität der Unternehmen durch die Investitionen in neue Technologien nicht grundlegend verbessert hat (…)“. (S. 4-8)
*) die Red.: Genau dies ist der Unterschied zwischen einer wirklichen industriellen Revolution und dem vorliegenden Schein einer neuen Ökonomie. Wenn Battaglia Comunista Marx lesen könnte, hätte sie das schon lange begriffen.
[1] [178] Auf den Fall China und Indien können wir aus Platzgründen erst in einer späteren Nummer zurückkommen.
[2] [179] Die Institutionen auf der Ebene der imperialistischen Blöcke sind vor allem Ausdruck eines Kräfteverhältnisses, basierend auf der Wirtschafts- und noch mehr auf der militärischen Macht der führenden Länder dieser Blöcke, also der USA und der UdSSR.
[3] [180] 70% der Steuersenkungen begünstigen Haushalte aus den obersten 20% der Einkommensskala.
[4] [181] Vorgesehen ist die Reduktion von Essensgutscheinen für die unteren Einkommensschichten. Von dieser Massnahme werden etwa 300'000 Personen betroffen sein. Das Budget der Sozialhilfe für arme Kinder ist für den Zeitraum von 5 Jahren eingefroren worden; das Budget zur Krankenversorgung der Ärmsten wurde vermindert.
[5] [182] Die Ökonomien Deutschlands, Frankreichs und Japans zusammen genommen verkörperten um 1950 45 % der US-Wirtschaft, bis in die 1970er Jahre stieg das Verhältnis auf 80 %, im Jahr 2000 lag es bei 70 %.
[6] [183] Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs erzielten 1 % der vermögendsten Haushalte der USA etwa 16 % des amerikanischen Gesamteinkommens. Innerhalb weniger Jahre fiel dieser Anteil und betrug gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nur noch 8 %. Dieses Verhältnis blieb bis zu Beginn der 80er Jahre bestehen und stieg infolge wieder auf die früheren 16 % an (Piketty T., Saez E., Income Inequality in the United States, 1913-1998, in: The Quarterly Journal of Economics, Bd. CXVIII, Nr. 1, S.1-39).
[7] [184] Die Nettoverschuldung trägt u.a. den Einkommen Rechnung, die aus amerikanischen Vermögen im Ausland stammen. Auch diese Nettoverschuldung ist illustrativ: negativ bis im Jahr 1985 (d.h. die Einkommen amerikanischer Vermögen im Ausland übertreffen die Einkommen der in den Vereinigten Staaten angelegten Vermögen aus dem Rest der Welt). Danach nahm diese Nettoverschuldung aber positive Werte an und stieg auf 40 % des BIP im Jahr 2003 (also der umgekehrte Fall: die Einkommen ausländischer Vermögen in den USA übertreffen die Einkommen amerikanischer, im Ausland angelegter Vermögen).
8 [185] Die Akkumulationsrate des Kapitals ist das Verhältnis zwischen Investitionen von neuem fixem Kapital und dem schon bestehenden fixen Kapital.
9 [186] vgl. unseren Artikel „Die Krise wiederspiegelt den Niedergang der kapitalistischen Produktion“ in International Review Nr. 115, engl./franz./span. Ausgabe
10 [187] Diese drei Parameter sind wiederum ableitbar aus und bestimmt durch die Entwicklung der Arbeitszeitdauer, des Reallohns, des Grades der Technisierung der Produktion, des Wertes der Produktions- und Konsumptionsmittel und der Produktivität des Kapitals.
10a [188] Eigene Übersetzung des französischen Begriffs „financiarisation de l’économie“, der unseres Wissens auf deutsch noch nicht existiert.
11 [189]Die Realität hat hier tausendmal alle Theorien widerlegt, die bis zum Erbrechen wiedergekäut werden, wie z.B. vom sozialdemokratischen deutschen Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt: „Die heutigen Profite sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen.“ Die Profite sind tatsächlich da, aber die Investitionen und die Arbeitsplätze nicht!
12 [190] Wir werden auf andere Analysen, die im unbedeutenden akademistischen oder parasitären Milieu existieren, in anderen Artikeln über die Krise zurückkommen, sowie in der Serie „Die Theorie der Dekadenz im Zentrum des Historischen Materialismus“ (Internationale Revue Nrn. 34 ff.)
13 [191] „Die Gewinne aus der Spekulation sind dermassen hoch, dass sie nicht nur für die „klassischen“ Unternehmen attraktiv sind, sondern auch für viele andere wie unter anderem die Versicherungsgesellschaften oder die Pensionskassen, wobei Enron ein wunderbares Beispiel darstellt (…) Die Spekulation ist das ergänzende, wenn nicht sogar hauptsächliche Mittel der herrschenden Klasse, sich den Mehrwert anzueignen (…) Eine Regel hat sich etabliert: 15% als minimaler Profit aus Kapital, welches in Unternehmen investiert wurde (…). Die Akkumulation von Finanz- und Spekulationsprofiten bringt einen Prozess der Deindustrialisierung mit sich und damit Arbeitslosigkeit und eine Misere über den gesamten Planeten.“ (IBRP in Bilan et Perspectives Nr. 4 S. 6-7).
14 [192] „Der lang anhaltende Widerstand des westlichen Kapitals gegen die Krise des Akkumulationszyklus (oder heute gegen die Entwicklung des tendenziellen Falls der Profitrate) hat bis jetzt den vertikalen Zusammenbruch verhindert, der den sowjetischen Staatskapitalismus erschüttert hatte. Ein solcher Widerstand war aufgrund von vier grundlegenden Faktoren möglich: 1. die ausgeklügelten Massnahmen der Finanzkontrolle auf internationaler Ebene; 2. eine tief greifende Umstrukturierung des Produktionsapparates, die zu einer Schwindel erregenden Steigerung der Produktivität geführt hat(…); 3. die konsequente Zerstörung der früheren Klassenzusammensetzung, mit dem Verschwinden überholter Aufgaben und Rollen und dem Auftauchen neuer Aufgaben, neuer Rollen, und einem neuen Typus von Arbeitern (…) Die Umstrukturierung des Produktionsapparates ist zur selben Zeit geschehen wie das, was wir als die dritte industrielle Revolution des Kapitalismus definieren. (…) Die dritte industrielle Revolution ist durch die Mikroprozessoren gekennzeichnet (…)“ (Prometeo, Nr. 8, Dezember 2003, „Thesenvorschlag des IBRP über die Arbeiterklasse in der aktuellen Periode und ihre Perspektiven“).
15 [193] Prometeo, Nr. 10, Dezember 2004, „Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion“.
16 [194] Die etwas schnellere Beschleunigung der Produktivität in den USA in der zweiten Hälfte der 90er Jahre (welche eine Steigerung der Akkumulationsrate erlaubte und das amerikanische Wachstum unterstützte) steht in keinem Gegensatz zum massiven Abfall seit Ende der 60er Jahre (siehe Grafik 8). Wir werden in künftigen Artikeln auf diesen Punkt gesondert eingehen. Wir sollten jedoch hervorheben, dass dieses Phänomen die Basis für ein sehr tiefes Niveau zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, verglichen mit früheren Zeiten des Aufschwungs, ist; dass dieser Aufschwung nur halbherzig stattfindet; dass Zweifel an der Dauerhaftigkeit der Fortschritte in der Produktivität bestehen und dass die Hoffnung auf eine Ausbreitung auf andere wichtige Wirtschaftszweige praktisch ausgeschlossen ist. Überdies wird in den USA ein Computer als Kapital verbucht, während er in Europa als laufende Ausgabe gilt. Die Statistiken der USA haben deshalb den Hang, das BIP (und damit die Produktivität) zu überschätzen im Vergleich zu den europäischen Statistiken, weil jene die Entwertung des Kapitals mitrechnen. Wenn wir diese Abweichungen sowie den Faktor der Arbeitszeit korrigieren, stellen wir fest, dass sich der Unterschied in der Produktivitätssteigerung 1996-2001 zwischen Europa (1,4%) und den USA (1,8%) stark reduziert und dass diese Steigerungen verglichen mit den 5- bis 6%-igen in den 50er und 60er Jahren sehr gering sind.
17 [195] Diese Rückentwicklung ist konjunkturabhängig, da die Profitrate Mitte 2001 einen Höhepunkt erreichte und Ende 2003 wieder auf das Niveau von 1997 gesunken war. Die Ankurbelung wurde erreicht durch eine strikte Kontrolle der Beschäftigung (man sprach von einem „Aufschwung ohne Jobs“), aber auch durch die klassischen Mittel der Steigerung der Mehrwertrate wie die Verlängerung der Arbeitszeit oder die Einfrierung der Löhne, was aufgrund der schwachen Dynamik des Arbeitsmarktes erleichtert wurde. Das Bremsen der Akkumulationsrate erlaubte zudem, das Gewicht der organischen Zusammensetzung des Kapitals zu verringern, welches auf der Rentabilität lastet.
18 [196] Für eine einigermassen seriöse Analyse dieser Frage siehe den Artikel von P. Artus „Karl Marx ist zurück“, publiziert in Flash Nr.2002-04 (https://hussonet.free.fr/marx2e.pdf [197]), sowie sein Buch: „Die new economy“ in der Kollektion Repères-La Découverte, Nr. 303, aus dem wir am Ende dieses Artikels einen Ausschnitt abdrucken.
19 [198] Wobei zu präzisieren ist: „… von verschiedenen Studien wurde belegt, dass ohne die Einführung von flexiblen Arbeitszeiten die „new economy“ den Unternehmen keine Effizienzsteigerung gebracht hätte“ (P. Artus, a.a.O.)
20 [199] Prometeo, Nr. 10, Dezember 2004, „Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion“.
21 [200] „(für die IKS) erscheint dieser Widerspruch zwischen Produktion von Mehrwert und dessen Realisierung als eine Überproduktion von Gütern und deshalb als eine Sättigung der Märkte, die sich dem Akkumulationsprozess entgegenstellt. Dies mache das System als Ganzes unfähig, dem Fall der Profitrate entgegenzuwirken. In Wahrheit ist der ganze Prozess umgekehrt (…). Es sind der ökonomische Zyklus und der Prozess der Verwertung, welche den Markt „zahlungsfähig“ oder „nicht zahlungsfähig“ machen. Man kann sich die „Krise“ der Märkte nur erklären, wenn man von den Widersprüchen ausgeht, die den Akkumulationsprozess regeln.“ (Einführungstext von Battaglia Comunista für die erste Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken).
22 [201] „…wir haben erklärt, dass wir nicht mehr an einer Debatte oder Konfrontation mit der IKS interessiert sind (…) Wenn dies die theoretischen Grundlagen der IKS bilden – und sie tun es -, so soll klar gesagt sein, dass wir keine Zeit, kein Papier und keine Tinte mehr vergeuden, um mit ihnen zu diskutieren oder eine Polemik zu führen“ (Prometeo, Nr. 10, Dezember 2004, „Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion“); und: „Wir sind es müde, über Nichtiges zu diskutieren, wenn es darum geht, zu verstehen, was auf der Welt vor sich geht“ („Antwort auf die stupiden Anschuldigungen einer Organisation auf dem Weg zum Auseinanderbrechen“, publiziert auf der Website des IBRP (https://www.ibrp.org [121])
23 [202] Prometeo, Nr. 10, Dezember 2004, „Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion“
24 [203] Siehe auch den Artikel „Die Krise ist ein Ausdruck der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise“, Internationale Revue Nr. 33, deutsche Ausgabe.
25 [204] Mehr über den Bluff der sogenannten dritten industriellen Revolution im erwähnten Artikel über die Krise in Internationale Revue Nr. 33, aus dem wir hier einen Ausschnitt zitieren: „Die „technologische Revolution“ existiert nur in den bürgerlichen Kampagnen und in der Vorstellung derjenigen, die leichtfertig daran glauben. Die empirische Feststellung einer seit den 60er-Jahren ununterbrochenen Verlangsamung der Produktivität (des technischen Fortschritts und der Arbeitsorganisation) widerspricht dem in den Medien vermittelten und gut in den Köpfen verankerten Bild eines technologischen Wandels, einer neuen industriellen Revolution, die heute von der Informatik und der Telekommunikation, dem Internet und von Multimedia getragen werde. Wie kann man die Kraft dieser Mystifikation, die die Realität in unseren Köpfen verdreht, erklären?
Zuallererst muss man daran erinnern, dass der Fortschritt in der Produktivität nach dem Zweiten Weltkrieg weit spektakulärer war als das, was uns heute als new economy präsentiert wird. (...) Deshalb befindet sich das Produktivitätswachstum im Niedergang (...). Weiter wird eine permanente Verwirrung zwischen dem Auftauchen neuer Konsumgüter und dem Produktivitätsfortschritt aufrecht erhalten. Der Innovationsfluss, die Vervielfachung von noch so aussergewöhnlichen Neuheiten (DVD, GSM-Telefone, Internet, usw.) auf der Ebene der Konsumgüter deckt sich nicht mit dem Phänomen der Produktivitätssteigerung. Diese bedeutet nämlich die Fähigkeit, Ressourcen bei der Produktion einer Ware oder Dienstleistung einzusparen. Der Ausdruck „technischer Fortschritt“ muss immer im Sinn eines Fortschritts der Produktions- und/oder Organisationstechnik verstanden werden, also vom strikten Standpunkt der Einsparung von Ressourcen in der Herstellung einer Ware oder der Ausrichtung einer Dienstleistung. So vorzüglich das numerische Wachstum auch sein mag, es übersetzt sich nicht in ein bedeutendes Wachstum der Produktivität im Produktionsprozess. das ist der ganze Bluff der new economy“.
26 [205] Siehe dazu unsere Artikelserie „ Die Theorie der Dekadenz im Zentrum des historischen Materialismus“, 1. Teil Internationale Revue Nr. 34 auf deutsch, oder ab Nr. 118, engl., franz., span.
27 [206] Dies ist der Grund, weshalb Battaglia Comunista in der Nr. 8 seiner theoretischen Revue eine grosse Studie zur Frage der Dekadenz angekündigt hat: „...das Ziel unserer Recherchen ist es, zu prüfen ob der Kapitalismus seine Kraft zur Entwicklung der Produktivkräfte verbraucht hat, und wenn dies wahr ist, in welchem Masse und vor allem weshalb.“ (Prometeo Nr. 8, Serie VI, Dezember 2003: „Eine Definition des Konzepts der Dekadenz“).
28 [207] „Gewiss sind wir konfrontiert mit einer Form der Ausweitung der Barbarei in der Gesellschaftsformation, den sozialen, politischen und zivilen Verhältnissen, und gewiss – seit den 90er-Jahren - mit einem Rückschritt im Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit (mit der Wiederkehr der Suche nach dem absoluten Mehrwert, noch mehr als diejenige nach dem relativen, im immer reineren Stil des Manchester-Kapitalismus), doch diese „Dekadenz“ betrifft nicht die kapitalistische Produktionsweise, sondern mehr seine Gesellschaftsformation im aktuellen Zyklus der kapitalistischen Akkumulation der fast seit 30 Jahren in der Krise steckt!“ (Prometeo Nr. 10, „Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion“) Wir werden in einer der nächsten Ausgabe unserer Presse auf diese theoretische Fantasie von Battaglia Comunista zurückkommen, die vorgibt, dass sich lediglich die „Gesellschaftsformation des Kapitalismus“ in der Dekadenz befindet, jedoch nicht die kapitalistische Produktionsweise! Erwähnen wir nur kurz, dass im aufgeführten Zitat von Engels sowie in allen Schriften von Marx und Engels (siehe unseren Artikel in der Internationalen Revue Nr. 34) immer von der Dekadenz der kapitalistischen Produktionsweise gesprochen wird, und nicht nur von der Dekadenz der Gesellschaftsformation.
29 [208] „...im aktuellen Zyklus der kapitalistischen Akkumulation, der fast seit 30 Jahren in der Krise steckt! (Prometeo Nr. 10, Dezember 2004, „Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion“).
30 [209] Prometeo Nr. 8, Dezember 2003, „Thesenprojekt des IBRP über die Arbeiterklasse in der gegenwärtigen Periode und ihre Perspektiven“
31 [210] „In der marxistsichen Kritik der politischen Ökonomie existiert ein sehr enger Zusammenhang zwischen der Krise des Akkumulationszyklus des Kapitals und dem Krieg, aufgrund der Tatsache, dass an einem Punkt jedes Akkumulationszyklus, aufgrund des tendenziellen Falls der Profitrate, sich eine absolute Überakkumulation von Kapital ergibt, so dass ein Krieg notwendig wird zur Zerstörung und, um einen neuen Akkumulationszyklus zu beginnen.“ (Prometeo Nr. 8, Dezember 2003, „La guerra mancata“).
32 [211] „Der lange Widerstand des westlichen Kapitals gegenüber der Krise des Akkumulationszykluses (oder gegenüber dem sich verstärkenden tendenziellen Fall der Profitrate) hat bisher einen totalen Kollaps verhindert...“ (Prometeo Nr. 8, Dezember 2003, „Thesenprojekt des IBRP über die Arbeiterklasse in der gegenwärtigen Periode und die Perspektiven“).
Eine Karikatur der Partei : die bordigistische Partei - Antwort an ”Kommunistisches Programm”
- 2855 Aufrufe
Die für die Befreiung der Arbeiterklasse unabdingbare Entwicklung des Klassenbewußtseins ist ein fortdauernder und unaufhörlicher Prozeß. Er wird bestimmt durch das soziale Wesen des Proletariats als eine historische Klasse, die als einzige Klasse die Lösung der unüberwindbaren Gegensätze des Kapitalismus in sich birgt, wobei der Kapitalismus selbst die letzte der in Klassen geteilten Gesellschaften ist. Sowie die historische Aufgabe, die die menschliche Gesellschaft zerreißenden Klassengegensätze aufzulösen, nur das Werk der Arbeiter selbst sein kann, kann das Bewußtsein über diese Aufgabe dem Proletariat keineswegs von außen 'importiert' oder eingetrichtert werden, sondern es ist das Produkt seines wahren Seins, seiner eigenen Existenz. Es ist die wirtschaftliche, soziale und politische Stellung in der Gesellschaft, die die praktischenHandlungen und den historischen Kampf des Proletariats bestimmen.
Diese unaufhörliche Bewegung hin zu einem Bewußtwerdungsprozeß drückt sich in den Versuchen des Proletariats, sich selber zu organisieren und in der Bildung politischer Gruppen innerhalb der Arbeiterklasse, die in der Bildung der Partei gipfelt, aus.
Gerade dieser Frage, der Bildung der Partei, wird in der Nr. 76 von "Programme Communiste" (März '78), dem theoretischen Organ der IKP (Internationale Kommununistische Partei), ein sehr langer Artikel gewidmet: "Auf dem Wege zur 'kompakten und starken' Partei von Morgen"(1). Es muß erst festgestellt werden, daß man mit dem üblichen Schwulst der bordigistischen Sprache, den auf vielen Seiten zu findenden Drehungen und Wendungen- nach denen man sich schließlich auf dem Ausgangspunkt wiederfindet -, dem Einrennen offener Türe und den sich wiederholenden Bestätigungen, die eine Argumentation ersetzen sollen, die wirklich zur Diskussion stehenden Probleme viel schwerer und umständlicher begreifen kann. Die darin bestehende Vorgehensweise, ein Bestätigung dadurch zu beweisen, indem man die früheren Bestätigungen zitiert, welche selbst wieder auf vorherigen Bestätigungen aufgebaut - sodaß es einem fast schwindelig wird - kann nötigenfalls eine Kontinuität der Bestätigungen beweisen, sie kann aber nie eine schlüssige Beweisführung sein. Unter diesen Umständen und trotz unserer festen Absicht, uns nur mit den Bestätigungen auseinanderzusetzen, die die bordigistischen Positionen hinsichtlich der Partei ausdrücken, welche wir für falsch und als zu bekämpfen betrachten, können wir es nicht vollständig vermeiden, auf eine Anzahl anderer Punkte, welche mit diesen Bestätigungen zusammenhängen, zu sprechen zu kommen.
Über die Italienische Fraktion der Kommunistischen Linke
Es wäre sicherlich keine kleine Überraschung für die Mehrzahl der Leser des "Kommunistischen Programms" und wahrscheinlich auch für die Mehrzahl der Mitglieder der IKP plötzlich zu erfahren, daß "trotz ihrer objektiven (7) Grenzen, die 'Linke Fraktion im Ausland' ein Teil der Geschichte"(2) der Italienischen Linke ist und als solche selbst "unsere Fraktion im Ausland zwischen 1928 und 1940" wurde. In diesem Punkt hatte uns "Kommunistisches Programm" eher an eine große Zurückhaltung, ein lastendes Schweigen, wenn nicht gar einfach an ein Mißbilligung der Fraktion gewöhnt. Wie sollte man sonst verstehen, daß innerhalb 30 Jahre Bestehens der IKP sie keine Mühe gescheut hat, in ihren Zeitungen, theoretischen Zeitschriften, Broschüren und Büchern die Texte der Linke von 1920-1926 wiederaufzulegen und erneut zu veröffentlichen, aber gleichzeitig nie weder die Zeit, noch die Mittel, noch den Platz gefunden hat, auch nur einen einzigen Text der Fraktion zu veröffentlichen, die das "Bulletin d'Information", die Zeitschrift "Bilan", die Zeitung "Prometeo", die Bulletins "Il Seme" und soviel andere Texte veröffentlichte ? Es ist dennoch kein reiner Zufall, wenn man in "Kommunistisches Programm" nie weder irgendeine Bezugnahme, noch eine Erwähnung der politischen Positionen, die "unsere" Fraktion verteidigt hat, und auch nie ein Zitat von "Bilan" vorfindet. Einige Genossen der IKP, die einmal davon etwas vage gehört hatten, behaupteten, daß die Partei sich weder auf die politische Aktivität noch auf die Schriften "Bilans" berufe, und andere Genossen der gleichen Partei wußten noch nicht einmal etwas von der Existenz und von dem Namen.
Heute entdeckt man das "Verdienst unserer Fraktion", ein Verdienst, welches - das stimmt - ziemlich begrenzt ist, aber immer noch groß genug, um davor den Hut abzunehmen. Warum heute ? Ist es deshalb, weil die Lücke in der organischen Kontinuität (ein von der IKP so geschätztes Wort), die von 1926 bis...1952 dauert, etwas störend geworden ist und weil man diese Lücke so recht und schlecht stopfen mußte, oder ist es deshalb, weil die IKS so lange schon davon gesprochen hat, so daß man jetzt nicht mehr länger das Schweigen aufrechterhalten kann ? Und warum die Fraktion zwischen 1928 und 1940 einordnen, zumal sie sich - zu Unrecht -erst im Juli 1945 aufgelöst hat, um sich dann in die "Partei" zu integrieren, die endlich in Italien rekonstituiert worden war, nachdem sie in der Zwischenzeit das italienische antifaschistische Komitee in Brüssel verurteilt hatte und seinen Vorkämpfer Vercesi ausgeschlossen hatte.
Es war der gleiche Vercesi, der später ohne Diskussion wieder in die IKP und sogar noch in die Führung aufgenommen wurde. Geschieht all dies aus Unwissenheit, oder weil während des Krieges die Fraktion noch viel weiter in der Richtung gegangen war, die"Bilan" schon vor dem Kriege eingeschlagen hatte, insbesondere in der Frage Rußlands, in der Frage des Staates und der Partei -was die Differenzen zwischen den von "Kommunistisches Programm" verteidigten Positionen und denen "Bilans" noch verstärken sollte. Jedenfalls werden die "Bilan" zugestandenen"Verdienste" schnell durch umso schärfere Kritik zurückgenommen.
"Die Unmöglichkeit - schreibt 'Kommunistisches Programm' - den sozusagen subjektiven (?!) Kreis der Konterrevolution zu zerschlagen, führte bei der Fraktion zu bestimmten Abweichungen, wie z.B. in der nationalen und kolonialen Frage oder in Bezug auf Rußland, nicht so sehr in der Einschätzung, was aus Rußland geworden war, als vielmehr in der Suche nach einem unterschiedlichen Weg gegenüber dem der Bolschewisten in der Ausübung ihrer Diktatur..., ein Weg der in der Zukunft eine Wiederholung der Katastrophe der Jahre 1926-27 verhindern sollte; und auch in einem gewissen Sinne in Bezug auf die Partei oder die Internationala—erwartete die Fraktion auch den Wiederaufbau (der Partei) von der Rückkehr der großen Massen auf den Boden der direkten Auseinandersetzung mit dem Feind."(Programme Communiste, Nr.76, 8.8) (1).
Wenn es stimmt, daß die Treue zu den revolutionären Grundlagen des Marxismus in Zeiten der Niederlagen zweifelsohne ein großes Verdienst ist, so liegt das große Verdienst der Fraktion, wodurch sie sich besonders von den damaligen Gruppen unterscheidet, gerade in dem, was der Artikel des "Kommunistischen Programms" "Abweichungen" nennt. Die Fraktion meinte: "Der Rahmen für die zukünftigen Parteien des Proletariats kann nur aus dem tiefgreifenden Verständnis der Ursachen der Niederlagen hervorgehen. Und dieses Verständnis darf weder durch Verbote noch durch Verfemung beeinträchtigt werden.”(3)
Leute, für welche das Programm etwas "Vollendetes und Unveränderbares" ist, die den Marxismus in ein Dogma verwandelt und Lenin zu einem unantastbaren Propheten gemacht haben, müssen es als unhaltbar annehmen, daß die Fraktion es gewagt hat, (da läuft es einem kalt den Rücken runter !) im Lichte der Realität nicht die Grundlagen des Marxismus, sondern die politischen und programmatischen Positionen der bolschewistischen Partei und der Komintern zu überprüfen. Wenn man innerhalb des theoretischen Rahmens und der kommunistischen Bewegung eine Überprüfung der politischen Positionen, die eine Rolle in Niederlagen gespielt haben, verlangt, die "weder durch Verbote noch durch Verfemung beeinträchtigt werden darf", dann ist das die wildeste Ketzerei; eine "Abschweifung" würde "Kommunistisches' Programm" dazu sagen.
Das große Verdienst der Fraktion -neben ihrem Festhalten am Marxismus und ihren Stellungnahmen zu den großen, wichtigen Fragen, gegen die von Trotzki verlangte Einheitsfront, gegen die Volksfront, gegen die Kollaboration und die Unterstützung des Spanienkrieges, gegen die niederträchtigen Verschleierungsmethoden des Antifaschismus - lag darin, es gewagt zu haben, mit der Methode zu brechen, die damals in der revolutionären Bewegung überhand genommen hatte. Durch diese Methode war nämlich die Theorie zu einem Dogma, die Prinzipien in Tabus verwandelt worden und jedes politische Leben erstickt worden. Ihr Verdienst war es, die Revolutionäre zu Debatten aufgerufen zu haben, was sie nicht zu "Abschweifungen" geführt hat, sondern in die Lage versetzt hat, reiche und wertvolle Beiträge zu dem revolutionären Werk zu leisten.
Bei all ihrer Standhaftigkeit zu ihren Überzeugungen hatte die Fraktion die Bescheidenheit, nicht vorzutäuschen, alle Probleme gelöst zu haben und auf alle Fragen Antworten zu haben: "Wenn wir jetzt mit der Veröffentlichung dieses Bulletins anfangen, glaubt unsere Fraktion nicht, endgültige Lösungen für die schrecklichen Probleme gefunden zu haben, vor denen die Proletarier aller Länder stehen."(4) Und selbst dann, wenn sie überzeugt war, Antworten geliefert
zu haben, verlangte sie nicht von anderen die einfache Anerkennung, die Übernahme dieser Antworten, sondern die kritische Überprüfung, die Konfrontation in den Diskussionen: "Sie (die Fraktion) beabsichtigt nicht, die politisch 'Nahestehenden' dazu zu drängen, mit den von ihnen vorgeschlagenen Lösungen für die augenblickliche Lage einverstanden zu sein. Im Gegenteil, sie ruft alle Revolutionäre dazu auf, die von ihr verteidigten Positionen und grundlegenden politischen Dokumente im Lichte der Ereignisse zu überprüfen." Und im gleichen Sinne schrieb sie: "Unsere Fraktion hätte es vorgezogen, daß solch eine Arbeit (die Veröffentlichung von "Bilan") von einem internationalen Organismus getragen würde, weil wir von der Notwendigkeit der politischen Konfrontation zwischen den Gruppen, die die Arbeiterklasse in den verschiedenen Ländern repräsentieren, überzeugt sind," (Bilan, Nr.1)
Um die bestehenden Unterschiede zwischen den Vorstellungen der Fraktion und den der bordigistischen Partei hinsichtlich der Art und Weise, wie die Beziehungen zwischen den kommunistischen Gruppen aussehen sollen, voll zum Vorschein treten zu lassen, genügt es, das oben aufgeführte Zitat von "Bilan" mit dem nachfolgenden Zitat aus "Kommunistisches Programm" zu vergleichen. So schreibt "Kommunistiches Programm" in Bezug auf ihre eigene sich"Partei" nennende Gruppe "'Parteikern' ? Im Vergleich zur 'kompakten und starken Partei von morgen', ganz gewiß. Aber Partei; eine Partei, die nur auf ihren eigenen Grundlagen wachsen kann, nicht durch die 'Konfrontation' verschiedener Standpunkte, sondern durch den Kampf selbst gegen diejenigen, die ihr'nahezustehen' scheinen." (Kommunistisches Programm, Nr.18, S. 20). Wie kürzlich ein Sprecher der IKP in einer öffentlichen Veranstaltung von "Révolution Internationale" (Sektion der IKS in Frankreich) in Paris sagte: "Wir kommen nicht, um zu diskutieren, auch nicht um unsere Standpunkte mit Euren zu konfrontieren, sondern nur um hier unseren Standpunkt kundzutun. Wir kommen zu eurer Veranstaltung, so wie wir zu den Veranstaltungen der stalinistischen Partei hingehen." Solch eine Einstellung beruht nicht auf der Standhaftigkeit von Überzeugungen, sondern sie beruht auf Selbstgefälligkeit und Arroganz. Das vorgetäuschte "vollendete und unveränderliche" Programm - als dessen Erben und Beschützer die Bordigisten sich ausgeben - verdeckt nichts anderes als einen enormen Größenwahn.
Je mehr ein Bordigist von Zweifeln und Unverständnis erschüttert wird, desto mehr schwanken seine Überzeugungen; und so fühlt er immer stärker das Bedürfnis, morgens nach dem Aufstehen sich auf die Erde zu knien, den Kopf auf die Erde zu beugen, sich auf die Brust zu schlagen und die Litanei der Mohammedaner aufzusagen: "Gott, mein Gott ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet". Oder wie doch irgendwo Bordiga sagte: "Um Mitglied der Partei zu sein, braucht man nicht alles zu verstehen und von allem überzeugt zu sein; es genügt, laß man glaubt und der Partei gehorcht."
Es handelt sich hier nicht darum, ausführlich auf die Geschichte der Fraktion einzugehen, ihre Verdienste und Fehler, die Gültigkeit ihrer Positionen darzustellen. Wie sie selbst sagte, oft habe sie nur herumtasten können, aber ihr Beitrag war umso größer, da sie ein politisch lebendiger Körper war, der es wagte, die Debatte zu eröffnen, ihre Positionen mit anderen zu konfrontieren, sie anderen gegenüberzustellen, denn sie war nicht so verkalkt und größenwahnsinnig wie die bordigistische "Partei". Daher kann man verstehen, daß die Fraktion sich auf die Italienische Linke berufen konnte, wohingegen dies ein großer Mißbrauch ist, wenn die bordigistische Partei von "unserer Fraktion im Ausland" spricht.
Die Konstituierung der Partei
Die für das Proletariat unabdingbare Partei wird auf den soliden Fundamenten eines kohärenten Programms, auf klaren Prinzipien aufgebaut. Diese geben ihr eine allgemeine Orientierung, die möglichst klare Antworten auf die im Klassenkampf entstehenden politischen Probleme beinhalten. Dies hat überhaupt nichts gemein mit dem mythischen "vollendeten und unveränderbaren" Programm der Bordigisten.
"In jeder Periode sehen wir, daß die Möglichkeit der Bildung der Partei bestimmt wird durch die Grundlage der vorherigen Erfahrung und der neuen Probleme, vor denen das Proletariat steht."(Bilan, Nr.1, S.15)
Was für das Programm zutrifft, trifft ebenfalls für die lebendigen politischen Kräfte, die die Partei physisch darstellen, zu. Die Partei ist sicher keine Ansammlung aller möglichen Gruppen und heterogenen politischen Tendenzen. Aber sie ist auch nicht der "monolithische Block", von dem die Bordigisten sprechen, und der übrigens nie außer in ihrer Einbildung bestanden hat. "In jeder Periode, in der die Bedingungen vorhanden sind für die Bildung der Partei, in der sich die Arbeiterklasse als Klasse organisieren kann, wird die Partei auf folgende Punkte gegründet:
auf ein Bewußtsein der am meisten fortgeschrittenen Positionen, welche das Proletariat vertreten muß;
auf die wachsende Kristallisierung der Kräfte, die für die proletarische Revolution handeln können."(Bilan,Nr.1).
Nur sich selbst und niemand anderen aus Prinzip und a priori als einzige für die Revolution handelnde Kraft anzuerkennen, zeugt nicht von revolutionärer Standhaftigkeit, sondern von Sektierergeist.
Als Engels die Bedingungen, unter denen die Erste Internationale gegründet wurde, ausführlich beschrieb, schrieb er: "Die Ereignisse und Wechselfälle im Kampf gegen das Kapital, die Niederlagen noch mehr als die Siege, konnten nicht verfehlen, den Menschen die Unzulänglichkeit ihrer diversen Lieblingsquacksalbereien zum Bewußtsein zu bringen und den Weg zu vollkommener Einsicht in die wirklichen Voraussetzungen der Emanzipation der Arbeiterklasse zu bahnen." (MEW,Bd. 21, "Vorrede zum 'Manifest der Kommunistischen Partei'", englische Ausgabe von 1888, S. 353).
Die Wirklichkeit hat überhaupt nichts zu tun mit diesem Spiegel, vor dem die bordigistische "Partei" die meiste Zeit verbringt, und der ihr nichts anderes zeigt als ihr eigenes Bild. In der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung, d.h. in der Wirklichkeit, zeichnete sich die Bildung der Parteien durch einen Zusammenschluß mit gleichzeitigem Herausschälen der Kräfte, die für die Revolution handeln können, aus. Andernfalls müßte man schlußfolgern, daß niemals eine andere Partei als die bordigistische existiert hat. Einige Beispiele: Der Bund der Kommunisten, dem sich Marx und Engels sowie ihre Freunde anschlossen, war der ehemalige Bund der Gerechten, der aus mehreren Gruppen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich, Belgien und England entstand, wobei sich die Strömung Weitlings aufgelöst hatte. Die Erste Internationale beinhaltete gleichzeitig die Auflösung der Sozialisten ä la Louis Blanc und Mazzini und den Zusammenschluß anderer Strömungen. Die Zweite Internationale bedeutete die Auflösung der Anarchisten und den Zusammenschluß der marxistischen sozialdemokratischen Parteien. Die Dritte Internationale kam nach der Auflösung der Sozialdemokraten und faßte die revolutionären kommunistischen Strömungen zusammen. Das Gleiche finden wir wieder mit der Bildung der sozialdemokratischen Partei in Deutschland, die aus der Eisenacher und der Lassaller Partei hervorgegangen ist. Das Gleiche trifft für die sozialistische Partei Frankreichs zu, die ihren Ursprung in der Partei Guesdes und Lafargue und in der Jaures hat. Wiederum das Gleiche mit der Bildung der sozialdemokratischen Partei in Rußland, die aus isolierten über alle Städte und Gebiete Rußlands zerstreuten Gruppen hervorgegangen war, wobei die Tendenz Struves eliminiert wurde.
Man könnte hier weitere Beispiele aus der Geschichte der Parteigründungen aufführen; man findet immer diese gleiche Bewegung, die sich gleichzeitig durch Auflösung und Zusammenschluß vollzieht. Die kommunistische Partei Italiens selbst konstituierte sich auf der Grundlage der abstentionistischen Fraktion Bordigas und der Gruppe Gramscis nach der Auflösung der Maximalisten Seratis.
Es gibt keine gültigen Kriterien, die absolut und gleich für alle Zeiten währen. Es kommt darauf an, in jeder Epoche klar zu definieren, welche die Kriterien des Zusammenschlusses der Kräfte, und welche die Kriterien der Abgrenzung sind. Und genau das weiß die bordigistische "Partei"nicht, die sich ohne Kriterien mittels einer Zusammenwürfelung von Kräften konstituiert hat: der im Norden gegründeten Partei, Gruppen aus dem Süden mit einem Beigeschmack von Partisanen, der Tendenz Vercesis im antifaschistischen Komitee Brüssels, der aus der Fraktion ausgeschlossenen Minderheit, die 1936 an den republikanischen Milizen im Spanienkrieg teilnahm, und schließlich der 1945 vorzeitig aufgelösten Fraktion. Wie man sehen kann, hat das "Kommunistische Programm" allen Grund dazu, von Unnachgiebigkeit, organischer Kontinuität zu sprechen und Lehren über Standhaftigkeit und revolutionärer Reinheit zu erteilen. In der Verleumdung eines jeden Versuchs der Konfrontation und der Debatten zwischen revolutionären Gruppen handelt es sich hier keineswegs um Prinzipienfestigkeit, auch nicht um politische Kurzsichtigkeit, sondern ganz einfach um die Sorge für den Schutz und den Wohlerhalt der eigenen, kleinen Kapelle.
Im Übrigen variiert (entschuldigt die Invarianz) diese unheimliche - nur verbale - Unnachgiebigkeit der Bordigisten gegen jede "Konfrontation" und um so mehr noch gegen jede Umgruppierung, die von vornherein und ohne jedes Kriterium als ein konfuses Unterfangen abgestempelt wird je nach dem Augenblick und nach dem Geschmack. So haben sie 1949 einen "Aufruf zur internationalen Reorganisierung der revolutionären marxistischen Bewegung" veröffentlicht, den sie 1952 und 1957 wiederholten, in dem man lesen kann: "In Übereinstimmung mit der marxistischen Position...richten heute die Kommunisten der Italienischen Linke einen Aufruf an die revolutionären Arbeitergruppen aller Länder. Sie fordern sie dazu auf, einen langen und schwierigen Weg zu begehen, einen gewaltigen Versuch zu unternehmen, um sich auf internationaler Ebene auf einer strengen Klassenbasis zu sammeln."(Programme Communiste, Nr.18/19 der franz. Ausgabe).
Aber es ist unbedingt notwendig, zwischen der bordigistischen Partei und jeder anderen Organisation unterscheiden zu wissen; man würde den schwersten Fehler begehen, wenn man glaubte, daß das, was der Partei erlaubt ist,- welch als Einzige ein "vollendetes und unveränderbares" Programm besitzt - ebenfalls für eine einfache sterbliche Organisation der Revolutionäre zulässig sein dürfte. Die Partei hat Gründe, die die Vernunft nicht kennt und auch nicht kennen kann. Wenn die Bordigisten zu einer "internationalen Sammlung" aufrufen, dann ist das reines, pures Gold, aber wenn andere revolutionäre Organisationen zu einer einfachen Konferenz zur Kontaktaufnahme und Diskussion aufrufen, dann ist das selbstverständlich die größte Scheiße, "Prinzipienhandel" und ein konfuses Unterfangen...Aber kommt das nicht wirklich daher, daß die Bordigisten sich heute mehr denn je in ihrer Verkalkung verrannt haben und daß sie fürchten, ihre schwankenden Positionen mit den lebendigen, revolutionären Strömungen zu konfrontieren, welche existieren und sich entwickeln ? Oder ziehen sie nicht vielmehr vor, sich zu verschließen und zu isolieren ?
Es ist interessant, die in diesem Sammlungsaufruf vorgebrachten Kriterien in Erinnerung zu rufen, die ja auch in dem kürzlich erschienenen Artikel wiederholt wurden:
- "Die Internationale Kommunistische Partei schlägt den Genossen aller Länder die folgenden Prinzipien und Richtlinien vor:
- 1) Bejahung der Waffen der proletarischen Revolution: Gewalt, Diktatur, Terror;
- 2) Vollständiger Bruch mit der Tradition der Kriegsbündnisse, den Partisanenfronten und den 'nationalen Befreiungen',...
- 3)Historische Negation des Pazifismus, des Föderalismus zwischen den Staaten und der 'nationalen Verteidigung';
Verurteilung der gemeinsamen Sozialprogramme und der politischen Bündnisse mit den nichtlohnabhängigen Klassen;
Ächtung des kapitalistischen Charakters der Sozialstruktur Rußlands;("Die Macht - der Staat in Rußland - wird von einer hybriden und komplexen Koalition ausgeübt, welche die internen Interessen der klein- und halbbürgerlichen Klassen, der versteckten Unternehmer und der internationalen Kapitalistenklasse vertritt': (Schlußfolgerung: Mißbilligung jeder Unterstützung des russischen Militär Imperialismus, kategorischen Defätismus gegen den Amerika)s."
Wir haben somit die sechs Überschriften der Kapitel genannt, die alle durch Kommentare näher erläutert werden; sie hier wiederzugeben wäre allerdings zu lang. Es handelt sich auch nicht darum, im einzelnen diese Punkte hier zu behandeln, obgleich ihre Formulierung zu wünschen übrig lassen, insbesondere was die Frage des Terrors angeht, der als Prinzip und grundsätzliche Waffe der Revolution ausgegeben wird (5) oder weiterhin der subtile Unterschied in der Schlußfolgerung zwischen der einzunehmenden Haltung gegenüber den USA Defätismus) und gegenüber Rußland (Mißbilligung). Oder noch ein anderer Punkt, nämlich diese seltsame (es ist das mindeste, was man sagen kann) Definition der Macht in Rußland, die nicht ganz einfach Staatskapitalismus sei, sondern eine "hybride Koalition der kleinbürgerlichen Klassen... und der internationalen kapitalistischen Interessen". Man könnte ebenso auf die ausdrückliche Abwesenheit anderer Kriterien hinweisen, insbesondere auf die Forderung nach der Anerkennung des proletarischen Charakters der Oktoberrevolution oder weiterhin die Notwendigkeit der Klassenpartei. Uns kommt es hier darauf an zu betonen, daß diese Kriterien in der Tat eine ernsthafte Grundlage darstellen, wenn auch nicht für eine unmittelbare Sammlung, so doch mindestens für eine Kontaktaufnahme und Diskussion zwischen den bestehenden revolutionären Gruppen. Es ist die damals von der Fraktion benutzte Vorgehensweise, die wir auch heute fortsetzen: sie war die Grundlage des internationalen Treffens in Mailand im letzten Jahr. In der Dunkelkammer ihrer Invarianz aber bräuchen die Bordigisten sowas heute nicht mehr..., weil sie ja schon die Partei konstituiert haben (mikroskopisch, aber immerhin eine Partei).
Doch ist dieser Aufruf damals schon von der IKP unterzeichnet worden, werden sich naive Leser fragen ? Ja,... aber es war damals nur die Internationalistische Kommunistische Partei und noch nicht die Internationale Kommunistische Partei, - eine Nuance. Aber diese Internationale Kommunistische Partei war Bestandteil der damaligen Internationalistischen Kommunistischen Partei, und sie gibt sogar vor, in der Mehrheit gewesen zu sein 1 "Ja aber", wird uns geantwortet, damals war sie dabei, ihre Konstitution zu vollenden, -eine Nuance 1 Aber heute beruft sie sich auf den Aufruf als ein Text der heutigen Partei 7
"Ja aber, aber aber....".
Da wir gerade bei diesem Punkt sind: kann man ein für allemal erfahren, seit wann diese "tapfere, mikroskopische Partei" besteht ? Es ist heute Mode - warum eigentlich? - zu bestätigen, daß die Partei erst im Jahre 1952 konstituiert wurde, und der oben zitierte Artikel besteht auf diesem Datum.(6) Jedoch zitiert man in dem oben erwähnten Artikel grundlegende Texte aus dem Jahre 1946, eine Plattform stammt aus dem Jahre 1945, andere ebenso grundlegende Texte aus den Jahren 1948-49-51. Diese erwähnten Texte, der eine so grundlegend wie der andere, von wem stammen sie genau ? Von einer Partei, von einer Gruppe, von einer Fraktion, von einem Kern, von einem Embryo ?
In Wirklichkeit konstituierte sich die IKP im Jahre 1943 im Norden Italiens nach dem Sturz Mussolinis. Dann rekonstituierte sie sich ein zweites Mal nach der "Befreiung" des Nordens von der deutschen Besatzung; dies erlaubte den Gruppen, die sich in der Zwischenzeit im Süden gebildet hatten, sich in die im Norden bestehende Organisation zu integrieren und zu vereinigen. Um sich in diese Partei zu integrieren, spricht sich die Italienische Fraktion der Linken Kommunisten fast einstimmig für die eigene Auflösung aus. Diese Selbstauflösung und die Konstituierungserklärung der Partei rufen in der GCI (Internationalen Kommunistischen Linken) Diskussionen und erbitterte Polemiken hervor, was in Frankreich zu einer Spaltung in der Französischen Fraktion der Linken Kommunisten führt, von der nur die Minderheit dieser Politik zustimmt und sich von der Mehrheit trennt. Diese spricht sich gegen die vorschnelle Auflösung der Italienischen Fraktion aus, verurteilt die Proklamation in Italien kategorisch und öffentlich als künstlich und voluntaristisch; Sie stellt klar den Opportunismus heraus, der als politische Basis dieser neuen Partei gedient hat.(7) Ende 1945 wird der erste Kongreß dieser Partei (IKP) abgehalten, der eine politische Plattform veröffentlicht und eine Zentraldirektion der Partei sowie ein internationales Büro ernennt, das aus Vertretern der IKP, der französischen und belgischen Sektion zusammengesetzt ist. Der Artikel des "Kommunistischen Programms" bezieht sich auf "Elemente einer marxistischen Orientierung, unser Text aus dem Jahr 1946". 1948 gibt es von neuem programmatische Texte der Partei usw. 1951 bricht die erste Krise innerhalb dieser Partei aus, die mit einer Spaltung zwischen 2 IKPs endet, von denen jede beansprucht, die Kontinuität der alten Partei zu sein, worauf "Kommunistisches Programm" nie verzichtet hat.
Heute erfindet man ein neues Datum der Bildung der Bordigistischen Partei. Warum ? Kommt es daher, daß erst im Jahre 1951 "unsere Strömung dieses kritische Bewußtsein hat erreichen können, dank der Kontinuität ihres Kampfes zur Verteidigung einer wirklich allgemeinen und nicht zufällig linken Linie", so daß sie sich "zum organisierten kritischen Bewußtsein, zum handelnden militanten Organismus, zur Partei konstituieren konnte."(Kommunistisches Programm, Nr.18, S. 15) Aber wo waren doch die Bordigisten mit Bordiga zwischen 1943/45 und 1951 ? Was wird bei alle dem aus dem Programm, das seit 1848 immer unverändert geblieben ist: war es während dieser Jahre abhanden gekommen und konnten sie damals "dieses kritische Bewußtsein (noch nicht) erreichen", welches ihnen ermöglichte, 1951 die Partei zu gründen ? Aber waren sie nicht seit 1943/45 als Mitglieder und führende Mitglieder organisiert ? Es ist schwierig, sehr schwierig über solch eine schwerwiegende Frage mit Leuten zu diskutieren, die alle Begriffe verwechseln, die keine Unterscheidungen treffen können und nicht zwischen dem Augenblick der Schwangerschaft und dem der Geburt unterscheiden können. Das sind Leute, die nicht wissen, was sie selber sind, und in welchem Stadium sie sich befinden, die sich "Partei" nennen und gleichzeitig die Notwendigkeit der Konstituierung der Partei herausschreien. Wie kann man Leute ernst nehmen, die nach der Angemessenheit des Tages den Zeitpunkt der Geburt 1943, 1945 oder gar 1952 festlegen, oder gar noch an einem weniger bestimmten Datum, in der Zukunft.
Mit dem Datum der Gründung der IKP verhält es sich genauso wie mit der Links-"Fraktion" im Ausland. Entweder beruft man sich darauf oder man verwirft sie, je nachdem, ob es ihnen paßt. Wie immer das auch mit dem Datum sein mag, was die Bildung der Partei angeht, "können (wir) aber auf Anhieb sagen, daß die Erlangung dieses kritischen Bewußtseins nicht von einer aufsteigenden Bewegung getragen wurde, sondern ganz im Gegenteil ihr weit vorausging."(Kommunistisches Programm, Nr.18, 5.15). Hier haben wir also wieder etwas Eindeutiges. Die Konstituierung der Partei wird keineswegs durch eine aufsteigende, wachsende Bewegung im Klassenkampf bestimmt, "sondern sie geht ihr im Gegenteil weit voraus." Aber warum dann diesen Eifer, gleich hinzufügen, daß es darauf ankomme, "die wahre Partei,...die kompakte und starke Partei aufzubauen, die wir noch nicht sind" ? Im Grunde eine Partei,...die die Partei aufbaut. Mit anderen Worten, eine Partei, die keine ist. Aber warum ist diese Partei, die ein "vollendetes und unveränderbares" Programm besitzt, die ebenso das notwendige kritische und organisatorische Bewußtsein erreicht hat, warum ist sie nicht die "wahre Partei" ? Was fehlt ihr also, um es zu sein ? Sicher ist es keine Frage der Anzahl der Militanten, aber indem sie schreibt:"...die Partei (befand sich)'im Aufbau', und sie wußte, daß sie 'in ihrem Entstehungsprozeß begriffen' und nicht etwa ‚vollendet' war, ... Die Klassenpartei befindet sich immer im ‚Aufbau‘ von ihrer Entstehung bis zu ihrem Verschwinden..."(Kommunistisches Programm, S. 20, Nr.18), betreibt sie nur ein Wortspiel, um besser der erfragten Antwort auszuweichen und gleichzeitig geht sie über die Frage selbst hinweg. Es ist eine Sache zu sagen, daß der Eisprung eine Bedingung einer späteren Geburt ist, es ist allerdings eine andere Sache vorzutäuschen, daß der Eisprung die eigentliche Geburt darstellt, das eigentliche Entstehen eines Lebewesens. Die geniale Originalität des "Kommunistisches Programms" besteht darin zu behaupten, daß beide ein und dasselbe sind. Mit solch einer Scheinargumentation kann man alles Mögliche beweisen. Die Notwendigkeit der Entwicklung und der andauernden Verstärkung einer wirklich existierenden Partei beweist nicht, daß sie schon existiert, genauso wenig wie die Notwendigkeit der Entwicklung und des Wachstums des Kindes nicht beweist, daß das Ei schon ein Kind ist, sondern nur zeigt, daß unter bestimmten Umständen das Ei ein Kind werden kann. Die dem einen gestellten Probleme unterscheiden sich stark von jenen, die dem anderen gestellt werden.
Diese ganze Spitzfindigkeit der durch den dauernden Aufbau existierenden Partei und des durch die schon existierende Partei dauernden Aufbaus dient dazu, auf Schleichwegen die andere bordigistische Theorie der wirklichen Partei und der formalen Partei einzuführen. Eine weitere Spitzfindigkeit ist die, nach der die wirkliche Partei ein reines "historisches"
nicht notwendigerweise in der Realität existierendes Phantom ist, und schließlich die formale Partei, die tatsächlich in der Wirklichkeit existiert, dies aber nicht unbedingt ausdrückt. In der bordigistischen Dialektik ist die Bewegung kein Zustand der Materie und somit etwas Materielles, sondern eine metaphysische Kraft, welche die Materie schafft. So wird die Wendung aus dem Kommunistischen Manifest "diese Organisation der Proletarier zur Klasse, und damit zur politischen Partei" in der bordigistischen Vorgehensweise zu "mittels der Konstituierung der Partei wird das Proletariat zu einer Klasse". Das führt zu widersprüchlichen Schlußfolgerungen, die gleichzeitig auf die Scholastik hinweisen: entweder bestätigt man entgegen jeder Gewißheit der Partei, daß sie seit ihrem Erscheinen nie zu existieren aufgehört hat (sagen wir seit Babeuf und seit den Chartisten) oder man geht von der offensichtlichen Tatsache aus, daß die Partei während längerer Zeiträume in der Geschichte nicht existiert hat, und man gelangt zu der Schlußfolgerung, daß die Klasse dauernd oder nur zeitweilig verschwunden ist (Vercesi, Camatte). Die einzige Beständigkeit des Bordigismus liegt darin, sioh dauernd zwischen beiden Polen in dem Rahmen dieser scholastischen Vorgehensweise hin und herzubewegen.
Um mehr Klarheit zu erzielen, könnte man vielleicht die Frage auf eine andere Art stellen. Die Bordigisten definieren die Partei als eine Doktrin, als ein Programm und als eine Fähigkeit zur praktischen Intervention, als einen Willen zur Handlung. Diese etwas kurzgefaßte Definition der Partei wird heute durch das andere Postulat vervollständigt: das Bestehen der Partei hängt nicht ab und muß im Gegenteil absolut unabhängig sein von einem gegebenen Zeitraum. Nun sagt man uns, daß eine der beiden Grundlagen, das Programm und der Willen zur Handlung, auf die sich die Partei stützt, die erste Grundlage - das Programm - seit dem Kommunistischen Manifest 1848 vollendet und unveränderbar ist. Hier stehen wir vor einem offensichtlichen Widerspruch: das Programm, als Essenz der Partei, ist vollendet, aber die Partei als Umsetzung des Programms befindet sich im unaufhörlichen Aufbau 1 Mehr noch: sie verschwindet sogar ganz und gar. Wie ist das möglich und warum
1852 löst sich der Bund der Kommunisten auf und verschwindet. Warum 7 Haben die Gründer des Programms, Marx und Engels, das Programm verloren 7 Man könnte vielleicht gegen sie vorgeben, daß sie den Willen zur Handlung verloren hätten, indem man sich auf die von ihnen vorgenommene Spaltung gegen die Minderheit (Willich-Schapper) des Bundes bezieht und auf ihre Zurückweisung des voluntaristischen Aktionismus dieser Minderheit verweist. Aber wäre das nicht ein Wandern von einer Absurdität zu einer anderen, noch größeren Absurdität 7 Was bleibt uns also anders übrig als die Auflösung - ob es den Bordigisten paßt oder nicht - durch eine damals eingetretene tiefgreifende Änderung der Situation zu erklären 7 Engels, der darüber Bescheid weiß, erklärt in diesen Begriffen das Verschwinden des Bundes: "Die Niederschlagung der Pariser Juni-Insurrektion von 1848 - dieser ersten großen Schlacht zwischen Proletariat und Bourgeoisie - drängte die sozialen und politischen Bestrebungen der Arbeiterklasse Europas zeitweilig wieder in den Hintergrund... Die Arbeiterklasse wurde beschränkt auf einen Kampf um politische Ellbogenfreiheit und auf die Position eines äußerlichen linkes Flügels der radikalen Bourgeoisie. Wo selbständige proletarische Bewegungen fortführen, Lebenszeichen von sich zu geben, wurden sie erbarmungslos niedergeschlagen...-Sofort nach dem Urteilsspruch (des Prozesses der Kölner Kommunisten im Oktober 1852) wurde der Bund durch die noch verbliebenen Mitglieder formell aufgelöst."(MEW, Bd. 21, S. 353).
Diese Erklärung scheint unsere Bordigisten nicht zu überzeugen. Sie müssen sie im Übrigen vollkommen unnütz finden, denn für sie hat sich die Partei nie wirklich aufgelöst, da sie in der Person von Marx und Engels fortbestand. Um dies zu bejahen, zitieren sie als Stellenangabe einen witzigen Einfall aus einem Brief von Marx an Engels, und wie jedesmal, wenn das ihnen in den Reim paßt, machen sie aus einem Wort, aus einem Satzteil und selbst aus einem witzigen Einfall in einem Brief eine Absolutheit, ein unveränderbares und unwandelbares Prinzip.(8) Was die Existenz der Partei angeht: was war zwischen der Auflösung des Bundes der Kommunisten im Jahre 1852 und der Geburt der Internationalen 1864 geschehen ? Gemäß den Bordigisten überhaupt nichts, das Programm blieb unveränderbar, der Willen zur Handlung war vorhanden, Marx und Engels waren da und die Partei mit ihnen. Nichts, überhaupt nichts Wichtiges schien passiert zu sein. Das scheint aber nicht die Meinung Engels gewesen zu sein, der schrieb: "Als die europäische Arbeiterklasse wieder genügend Kraft zu einem neuen Angriff auf die herrschende Klasse gesammelt hatte, entstand die Internationale Arbeiterassoziation." (MEW,Bd, 21, S.353)
Wenn "Kommunistisches Programm" in seinem Artikel schreibt: ",..die revolutionäre marxistische Partei (ist) nicht das Produkt der unmittelbaren Bewegung, d.h. der Aufstiegs- und Rückflußphasen..."(S.20), verfälscht es entweder aus Unverständnis oder aus Absicht die Debatte, indem dieses kleine Wort "Produkt" - im franz. Text unterstrichen - eingeführt wird. Selbstverständlich, die Notwendigkeit einer Partei resultiert nicht aus besonderen Situationen, sondern aus der allgemeinen historischen Lage der Klasse (dies lernt man im Grundkurs des Marxismus und das ist kein Grund, sich wegen solcher Sachen eines großen Wissens zu rühmen). Die Kontroverse bezieht sich nicht darauf, sondern ob wirklich die Existenz der Partei an die Schwankungen dem Klassenkampfes gebunden ist oder nicht, ob spezifische Bedingungen noch notwendig sind, damit die Revolutionäre tatsächlich - und nicht nur in Worten - die Rolle erfüllen können, die der Partei auszuüben zukommt. Es reicht nicht aus zu sagen, daß ein Kind ein menschliches Produkt ist, um aus dieser Tatsache schlußzufolgern, daß die notwendigen Lebensbedingungen - Luft zum Atmen, Lebensmittel zur Ernährung, Pflege im Allgemeinen - ihm damit gleichzeitig gegeben sind und ohne die Erfüllung dieser Bedingungen ist das Kind unwiderruflich verloren. Die Partei ist eine wirkungsvolle Intervention, eine treibende Kraft, ein tatsächlicher Einfluß im Klassenkampf und dies ist nur möglich, wenn der Klassenkampf in einer aufsteigenden Entwicklung verläuft. Darin liegt der Unterschied zwischen der Partei und ihrer wirklichen Existenz gegenüber der Fraktion oder der Gruppe. Das hat die IKP noch nicht verstanden und will es auch nicht verstehen.
Der Bund der Kommunisten konstituierte sich mit dem Erstarken des Klassenkampfes, der die Welle revolutionärer Kämpfe des Jahres 1848 ankündigte; ebenso löst sich derselbe Bund - wie wir gerade mit Engels festgestellt haben - mit den Niederlagen und dem Zurückweichen des Klassenkampfes auf. Dies ist keine vorübergehende, sondern eine allgemeine Tatsache, welche entlang der ganzen Arbeiterbewegung überprüfbar ist, und nicht anders sein konnte. Die Erste Internationale entstand, als die europäische Arbeiterklasse wieder genügend Kraft zu einem neuen Angriff auf die herrschende Klasse gesammelt hatte." Und wir können uns vollständig den Worten des Berichterstatters des Generalrates auf dem ersten Kongreß der Internationale anschließen, der damals auf die Angriffe der bürgerlichen Presse antwortete: "Nicht die Internationale hat die Streiks der Arbeiter ausgelöst, sondern es sind die Arbeiterstreiks, die der Internationale solche Stärke verleihen."
Die Internationale wiederum, wie beim Bund der Kommunisten, überlebte nicht lange die blutige Niederlage der Pariser Kommune und brach kurz darauf zusammen, trotz der Anwesenheit Marxens und Engels und des "vollendeten und unveränderbaren" Programms in ihrer Mitte.
Um das Gegenteil dessen zu beweisen, was wir gerade festgestellt haben, versucht der Artikel vergeblich zurückzugreifen auf "Konkrete Belege... Es gibt sogar Gebiete, wo ausgesprochen heftige Kämpfe stattgefunden haben (so in England und Nordamerika), wo...die Partei nicht einmal existiert hat."("Kommunistisches Programm", S. 20). Hier handelt es sich um ein Argument, das überhaupt nichts beweist, außer die Tatsache, daß es keine mechanische Verbindung zwischen den Klassenkämpfen und dem Entstehen einer Partei gibt, und daß andere Faktoren bestehen, die dem Prozeß der Konstituierung der Partei entgegenwirken; daß im allgemeinen ein Abstand zwischen den objektiven Bedingungen und den subjektiven, zwischen dem Sein und der Bewußtwerdung besteht. Wenn das Argument Gültigkeit haben soll, dann hätte uns das Gegenteil bewiesen werden müssen, d.h. Beispiele aufgezeigt werden müssen, wo die Partei sich außerhalb Zeiträume und Länder mit steigendem Klassenkampf des Proletariats gegründet hat. Es gibt keine Beispiele. Es sei denn, das einzige Beispiel würde aufgeführt (ganz zu schweigen von der IV. Trotzkistischen Internationale), das Beispiel der IKP. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, nämlich die der Maus, die so groß sein wollte wie der Elefant. Die IKP war niemals eine Partei, außer dem Namen nach.
Die Beispiele des Bundes der Kommunisten und der Ersten Internationale, die Beispiele der Geburt der Zweiten Internationale und ihr niederträchtiger Tod, und mehr noch die Bildung der III. Internationale und ihr schändliches Ende - sie ist stalinistisch geworden - lassen uns zu der end- gültigen Überzeugung gelangen, daß die von der Italienischen Fraktion verteidigten Thesen, auf die wir uns auch vollständig berufen, Gültigkeit besitzen. Es handelt sich um die Unmöglichkeit der Bildung der Partei in einer Periode des zurückweichenden Klassenkampfes.(9) Ganz anders lautet natürlich die Vorstellung des "Kommunistischen Programms": die Rekonstituierung der Partei sollte stattfinden, "bevor das Proletariat aus dem Abgrund, in dem es hinabgestürzt war, wiederaufsteigt. Mehr noch: sie muß diesem Wiederaufschwung der proletarischen Klassenbewegung notwendigerweise vorausgehen."(S.17)
Man versteht, daß der Artikel sich mit Nachdruck auf Lenins "Was Tun ?" bezieht, vor allem auf den Teil, der von dem trade-unionistischen Bewußtsein der Arbeiterklasse handelt. Denn wenn man genau hinsieht, ist das die Grundlage der Argumentationsweise des Artikels der IKP, nicht mal so sehr die Überschätzung der Rolle der Partei und ihre Tendenz zum Größenwahn, sondern ihm liegt vor allem eine himmelschreiende Unterschätzung der Fähigkeit der Bewußtwerdung der Klasse zugrunde ; ein tiefes Mißtrauen der Klasse gegenüber, und um alles zu sagen, eine kaum verdeckte Verachtung der Arbeiterklasse und ihrer Fähigkeit, die Welt zu begreifen.
"Und wenn diese Zukunft für uns Materialisten sicher und unausweichlich ist, so nicht, weil innerhalb der Arbeiterklasse ein 'Reifungsprozeß des Bewußtseins' über ihre historische Mission stattfinden würde. Sie ist unausweichlich, weil die Arbeiterklasse bevor sie es weiß und ohne daß sie es weiß, durch die objektiven Bedingungen dazu getrieben wird, für den Kommunismus zu kämpfen."(S.21, Nr.18, Kommunistisches Programm). Durch den ganzen Artikel hindurch findet man diese verachtenden Komplimente für die Arbeiterklasse: eine rohe und abgestumpfte Masse, die ohne zu wissen und ohne zu verstehen handelt, die aber glücklicherweise von einer Partei geführt wird, die alles versteht, und die das Verständnis an sich ist. Man gestatte uns dieser erdrückenden Verachtung die Meinung des alternden, aber frischen Engels gegenüberzustellen: "Für den schließlichen Sieg der im 'Manifest' aufgestellten Sätze verließ sich Marx einzig und allein auf die intellektuelle Entwicklung der Arbeiterklasse, wie sie aus der vereinigten Aktion und der Diskussion notwendig hervorgehen mußte."(Vorrede für "das Kommunistische Manifest", vierte deutsche Ausgabe, London, I. Mai 1890).
Jeder Kommentar erübrigt sich. Fahren wir fort. Gemäß der bordigistischen Vorstellung erfordert die Rekonstituierung der Partei - die vollständig von den konkreten Bedingungen getrennt ist - die theoretische Reife und den Willen zum Handeln. Weiterhin wird in dem Artikel die folgende Ansicht vertreten, derzufolge die Fraktion "noch nicht die Partei, sondern erst ihr Vorspiel war, so nicht mangels praktischer Arbeit, sondern eher infolge der Unzulänglichkeit ihrer theoretischen Arbeit."(S.25) Das ist eine Ansicht und sie taugt, was sie taugt. Aber was versteht der Artikel gerade unter ausreichender theoretischer Arbeit ? Die Wiederherstellung, die Wiederaneignung, die Aufrechterhaltung des "vollendeten und unveränderbaren" Programms ? Vor allem ohne Überprüfung der Positionen der Vergangenheit, ohne Suche nach einer Antwort auf die neuen Probleme. Es ist vor allem diese Arbeit, die der Artikel der Fraktion zum Vorwurf macht, und die er als schwerwiegende Abweichungen betrachtet. Diese Museumskonservatoren, die ihre eigene Sterilität zum Ideal erhoben haben, würden gern glauben lassen, daß Lenin genau wie sie niemals etwas anderes gemacht hat als die vollendete Theorie Marxens "wiederherzustellen". Vielleicht könnten sie mal darüber nachdenken , was Lenin zu der Frage der Theorie gesagt hat :
"Wir betrachten die Theorie von Marx keineswegs als etwas Abgeschlossenes und Unantastbares: wir sind im Gegenteil davon überzeugt, daß sie nur das Fundament der Wissenschaft gelegt hat, die die Sozialisten nach allen Richtungen weiterentwickeln müssen (von Lenin unterstrichen), wenn sie nicht hinter dem Leben zurückbleiben wollen."(Lenin, "Unser Programm", zweite Hälfte, 1899).
Der Artikel, aus dem dieses Zitat stammt, nennt sich gerade "unser Programm".
Und wie messen unsere Päpste des Marxismus den Grad der theoretischen Reife ? Gibt es solche festgelegten Maßstäbe ? Um nicht willkürlich vorzugehen, müssen die Maßstäbe auch nicht genau festgelegt werden, und es gibt keine bessere Art vorzugehen als die theoretische Reife zu überprüfen in ihrer Umsetzung in politischen Positionen, die man verteidigt.
Wenn man durch dieses Mittel die Reife messen kann, und wenn dies der Hauptmaßstab für die Bildung der Partei ist, dann können wir ruhig aber mit der ganzen notwendigen Überzeugung sagen, daß die Bordigisten nicht im Jahre 1943, auch nicht 1945 und vor allem nicht 1952 die Partei hätten konstituieren sollen, sondern daß sie besser bis zum Jahre 2000 gewartet hätten. Jeder hätte dabei gewonnen, sie als erste.
Wir können noch nicht sagen, wie sich die kompakte und starke Partei von morgen bilden wird, aber, was heute feststeht, ist daß die IKP es nicht ist. Das Drama des Bordigismus ist, das sein zu wollen, was er nicht ist: die Partei, und das nicht sein zu wollen, was er ist: eine politische Gruppe. So erfüllt die IKP nicht - außer in Worten - die Funktionen der Partei, weil sie sie nicht erfüllen kann, und verwirklicht auch nicht die Aufgaben einer politischen Gruppe - die in ihren Augen schäbig sind. Wenn man ihre politische Reife nach ihren Positionen mißt und dabei ihre Entwicklung beobachtet, dann sieht es ganz danach aus, daß sie niemals ihr Ziel erreichen wird, denn bei jedem Schritt vorwärts macht sie gleichzeitig 2 oder 3 Schritte zurück.
M.C.
FUSSNOTEN :
(1): Dieser Artikel ist auch zu finden in deutscher Sprache in "Kommunistisches Programm", Nr.18, Mai 1978.
Soweit die deutsche Übersetzung der IKP mit dem Originaltext übereinstimmte, haben wir diese Übersetzung verwendet. Andernfalls haben wir selbst den Originaltext übersetzt.
(2): Programme Communiste, Nr.76, 5.5. Dieser Satz ist in der deutschen Übersetzung nicht zu finden.
(3) : Bilan, Nr.1, Vorwort, S.3
(4) : idem
(5) : Siehe unseren Artikel "Terror, Terrorismus und Klassengewalt" in dieser Nummer, in dem dieses Thema ausführlich behandelt wird.
(6) : Der Proletarier (franz. Ausgabe "Le Proléaire" vom 8/21 April 1978, Nr. 264) drückt sich noch deutlicher aus: "...die charakteristischen Thesen aus dem Jahre 1951, die den Geburtsakt und die Zugehörigkeitsgrundlagen darstellen."
(7)) : Siehe "L'Etincelle" und "Internationalisme", Veröffentlichungen der linken Kommunisten Frankreichs bis 1952.
(8) : Es ist höchste Zeit, diesem unglaublichen Mißbrauch ein Ende zu setzen, den manche mit Zitaten betreiben, indem sie mit den Zitaten alles mögliche ausdrücken wollen. Dies trifft besonders für die Bordigisten zu, hin‑
sichtlich der Vorstellung Marxens von der Partei. Vielleicht ist es nicht unnütz, den folgenden, etwas überraschenden und rätselhaften Satz aus dem "Kommunistischen Manifest" zu ihrer Aufmerksamkeit zu bringen, und sie darüber zum Nachdenken anzuregen und zu erklären zu versuchen: "Die Kommunisten sind keine besondere Partei gegenüber den anderen Arbeiterparteien."(Kapitel II, "Proletarier und Kommunisten").
(9) : Es ist übrigens bekannt, daß Bordiga mehr als widerwillig der Erklärung der Konstituierung der Partei gegenüberstand und daß er widerwillig dem ihm gegenüber von allen Seiten ausgeübten Druck nachgegeben hat, um sich ihr anzuschließen. Vercesi seinerseits wartete nicht lange, bevor er die Bildung der Partei öffentlich in Frage stellte. Aber wer A sagt, muß auch B sagen. Man kann das Echo dieser Zurückhaltung in dem "Vorentwurf der Prinzipienerklärung für das Internationale Büro der (neuen) internationalen Kommunistischen Linke" finden, den er entworfen hat und in Belgien am Ende des Jahres 1946 veröffentlicht hat. Darin kann man lesen: "Der Prozeß der Umwandlung der Fraktionen in eine Partei wurde von der kommunistischen Linke in seinen großen Linien nach einem Schema festgelegt, das besagt, daß die Partei erst dann in Erscheinung treten kann, wenn die Arbeiter Kampfbewegungen begonnen haben, welche den Rohstoff zur Machteroberung liefern."(Kommunistisches Programm, S. 24)
(erschienen in Internationale Revue Nr:3,1978)
Politische Strömungen und Verweise:
- Bordigismus [212]
Theoretische Fragen:
- Partei und Fraktion [83]
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue 38
- 3200 Aufrufe
1936: Die „Volksfronten“ in Spanien und Frankreich
- 4587 Aufrufe
Wie die Linke die Arbeiterklasse für den Krieg mobilisierte
Vor 70 Jahren, im Mai 1936, brach spontan eine riesige Welle von Arbeiterkämpfen gegen die wachsende Ausbeutung aus, die von der Wirtschaftskrise und der Ausbreitung der Kriegswirtschaft ausgelöst wurde. Im Juli desselben Jahres begann die Arbeiterklasse in Spanien unvermittelt einen Generalstreik und erhob, als Reaktion auf den Militärputsch Francos, die Waffen. Viele Revolutionäre, einschließlich einige der bekanntesten wie Trotzki, interpretierten diese Ereignisse als den Beginn einer neuen internationalen revolutionären Welle. Tatsächlich aber ließen sie sich durch die begeisterte Unterstützung der Massen, durch ein oberflächliches Verständnis der vorhandenen Kräfte und durch den „radikalen“ Charakter einiger ihrer Reden in die Irre führen.
Auf der Grundlage einer klaren Analyse des Kräfteverhältnisses auf internationaler Ebene realisierte die Italienische Kommunistische Linke (in ihrer Zeitschrift Bilan), dass die Volksfronten alles andere als der Ausdruck einer sich entwickelnden revolutionären Bewegung waren. Im Gegenteil, diese deuteten an, dass sich die Klasse immer mehr in der nationalistischen und demokratischen Ideologie verfangen und vom Kampf gegen die Auswirkungen der historischen Krise des Kapitalismus abgelassen hatte. „Die Volksfront hat sich selbst als Auflösungsprozess des proletarischen Klassenbewusstseins erwiesen, als Waffe, die darauf abzielte, die Arbeiter auf dem Terrain des Schutzes der bürgerlichen Gesellschaft in jeglichem Aspekt ihres sozialen und politischen Lebens festzuhalten.“ (Bilan, Nr. 31, Mai – Juni 1936) In aller Eile setzten sich sowohl in Frankreich als auch in Spanien die Politapparate der „sozialistischen“ und „kommunistischen“ Linken an die Spitze dieser Bewegungen. Indem sie die Arbeiter in die falsche Alternative Faschismus/Antifaschismus einsperrten, sabotierten sie die Bewegung von innen, verpflichteten sie zur Verteidigung des demokratischen Staates und heuerten die Arbeiter in Frankreich und Spanien schließlich für das zweite weltweite imperialistische Gemetzel an.
Heute gibt es eine allmähliche Wiederbelebung des Klassenkampfes, und neue Generationen begeben sich auf die Suche nach radikalen Alternativen zum Kapitalismus, dessen Scheitern immer offenkundiger wird. In diesem Zusammenhang prangern „Antiglobalisierungs“bewegungen wie Attac den zügellosen Liberalismus und „die Diktatur des Marktes“ an, der „die politische Macht den staatlichen Händen und somit den Bürgern entrissen hat“, und rufen zur „Verteidigung der Demokratie gegen die Finanzdiktatur“ auf. Die „andere Welt“, die von den Anhängern der „Antiglobalisierung“ vorgestellt wird, nimmt häufig eine Form an, die von der Politik der 30er, 50er oder 70er Jahre inspiriert ist, als der Staat angeblich eine weitaus wichtigere Rolle als unmittelbarer Wirtschaftsfaktor gespielt hatte. Die Politik der Volksfrontregierungen, die mit ihren Programmen der staatlichen Kontrolle über die Wirtschaft, „der Einheit aller Schichten der arbeitenden Bevölkerung gegen die kapitalistische und faschistische Bedrohung“ eine „soziale Revolution“ in Gang gesetzt habe, wird schöngefärbt, um die Behauptung zu stützen, dass „eine andere Welt“, dass eine andere Politik innerhalb des Kapitalismus möglich sei.
Daher ist es absolut wichtig, anlässlich dieses 70. Jahrestages die Zusammenhänge und die Bedeutung der Ereignisse von 1936 in Erinnerung zu rufen:
- die tragischen Lehren aus diesen Erfahrungen ins Gedächtnis zurückzurufen, insbesondere die verhängnisvolle Falle, in die die Arbeiterklasse lief, als sie ihr Terrain, die kompromisslose Verteidigung ihrer spezifischen Interessen, verließ, um sich den Bedürfnissen des einen oder anderen bürgerlichen Lagers zu unterwerfen;
- die Lügen zu entlarven, die über die „Linke“ in Umlauf gesetzt werden und denen zufolge sie die Interessen der Arbeiterklasse während dieser Ereignisse verkörpert hatte, und aufzuzeigen, dass sie in Tat und Wahrheit ihr Henker war.
Die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren von der Niederlage der revolutionären Welle von 1917-23 und dem Triumph der Konterrevolution gekennzeichnet. Sie unterscheiden sich fundamental von der heutigen historischen Periode der Wiederbelebung der Kämpfe und der allmählichen Entwicklung des Bewusstseins. Dennoch stößt auch die neue Generation von Proletariern, die der konterrevolutionären Ideologie zu entkommen versucht, auf dieselbe „Linke“, dieselben Fallen und ideologischen Manipulationen, obgleich diese die neuen Kleider der „Antiglobalisierung“ tragen. Ihnen zu entgehen ist nur durch die Wiederaneignung der so teuer erkauften Lehren aus den vergangenen Erfahrungen des Proletariats möglich.
Stärkte die Volksfront den Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung?
Die Volksfronten behaupteten, dass sie die „Kräfte des Volkes gegen die Arroganz der Kapitalisten und den Aufstieg des Faschismus“ vereinigt hatten. Aber setzten sie wirklich eine Dynamik in Gang, die den Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung stärkte? Waren sie wirklich ein Schritt vorwärts in der Entwicklung der Revolution? Um darauf zu antworten, kann sich eine marxistische Vorgehensweise nicht darin erschöpfen, ausschließlich auf den radikalen Ton der Reden und auf die Gewalt der gesellschaftlichen Eruptionen zu achten, die etliche westeuropäische Länder damals erschütterten. Eine Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen auf internationaler Ebene und für die gesamte historische Periode muss die Grundlage einer solchen Methode sein. In welchem Kontext standen die Stärken und Schwächen des Proletariats und seines Todfeindes, der Bourgeoisie? In welchem Zusammenhang fanden die Ereignisse von 1936 statt?
Das Produkt der historischen Niederlage des Proletariats
Die mächtige revolutionäre Welle zwang die Bourgeoisie dazu, den Krieg zu beenden, brachte die Arbeiterklasse in Russland an die Macht und erschütterte die bürgerliche Herrschaft in Deutschland und in ganz Mitteleuropa bis in ihre Grundfesten. Was folgte, war eine Reihe von blutigen Niederlagen des Proletariats in den 20er Jahren. Die Niederschlagung des deutschen Proletariats erst 1919 und schließlich 1923 durch die Sozialdemokraten der SPD ebnete den Weg für Hitlers Aufstieg zur Macht. Die tragische Isolierung der Revolution in Russland war der Sargnagel für die Kommunistische Internationale und öffnete die Tür zum Triumph der stalinistischen Konterrevolution, die die gesamte alte Garde der Bolschewiki und die Lebenskräfte des Proletariats vernichtete. Schließlich wurde auch der letzte proletarische Funke, in China 1927, gnadenlos ausgelöscht. Der Kurs der Geschichte hatte sich gedreht. Die Bourgeoisie hatte entscheidende Siege über das internationale Proletariat erzielt, der Kurs zur Revolution machte einem unaufhaltsamen Marsch in den Weltkrieg Platz. Dies bedeutete den schrecklichsten Rückfall in die kapitalistische Barbarei.
Dennoch gab es immer noch, trotz dieser niederschmetternden Niederlagen der Bataillone der Avantgarde des Weltproletariats, zum Teil wichtige Episoden der Kampfbereitschaft in der Arbeiterklasse. Dies war besonders in jenen Ländern der Fall, in denen die Arbeiter keine direkte Niederlage, weder physisch noch ideologisch, im Kontext der revolutionären Konfrontationen von 1917-1927 erlitten hatten. So brach auf dem Höhepunkt der Krise in den 30er Jahren ein wilder Streik unter den Bergarbeitern Belgiens aus, der rasch die Dimensionen eines Aufstandes annahm. Er ging von einer Bewegung gegen Lohnkürzungen in den Bergwerken von Borinage aus. Als die Streikenden gefeuert wurden, verbreitete sich die Bewegung über die ganze Provinz, und es kam zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei. Von 1931 bis 1934 beteiligte sich die Arbeiterklasse in Spanien an einer Reihe von Kämpfen, die brutal unterdrückt wurden. Im Oktober 1934 befanden sich sämtliche Bergbauregionen Asturiens und der Industriegürtel von Oviedo und Gijon in einer selbstmörderischen Erhebung, die von der republikanischen Regierung und ihrer Armee zerschmettert wurde. Sie endete in einer brutalen Repression. Auch in Frankreich wurde eine gewisse Kampfbereitschaft an den Tag gelegt, obwohl die Arbeiterklasse durch die „linke“ Politik der KP tief demoralisiert war, derzufolge noch 1934 die Revolution unmittelbar bevorstand und es daher notwendig war, „überall Sowjets zu bilden“. Im Sommer 1935 fanden angesichts einer Gesetzgebung, die massive Lohnkürzungen für die Arbeiter im Staatssektor verordnete, eindrucksvolle Demonstrationen und gewaltsame Konfrontationen auf den Werften von Toulon, Tarbes, Lorient und Brest statt. In Brest gab es, nachdem Soldaten einen Arbeiter mit den Gewehrkolben totgeschlagen hatten, zwischen dem 5. und 10. August gewaltsame Demonstrationen und Ausschreitungen. Diese endeten mit drei Toten und Hunderten von Verletzten; Dutzende von Arbeiter wurden ins Gefängnis gesteckt.[i] [213]
Diese Ausdrücke einer anhaltenden Militanz, die oftmals von Wut, Verzweiflung und politischer Desorientierung geprägt war, waren in Wahrheit „Ausbrüche der Verzweiflung“, die die Schwächen der Arbeiter in einer weltweiten Situation der Niederlage und Zerstreuung aufzeigten. Die Zeitschrift Bilan brachte dies im Falle Spaniens auf den Punkt: „Wenn die internationalen Kriterien etwas bedeuten, dann müssen wir sagen, dass angesichts der Tatsache einer sich ausbreitenden Konterrevolution auf der ganzen Welt die Orientierung in Spanien zwischen 1931 und 1936 nur in die gleiche Richtung zielen kann (nämlich hin zu einem konterrevolutionären Verlauf der Ereignisse), statt in die entgegen gesetzte Richtung einer revolutionären Bewegung. Die Revolution kann sich nur vollständig entwickeln, wenn sie das Resultat einer revolutionären Situation auf internationaler Ebene ist.“ (Bilan, Nr. 35, Januar 1937)
Doch um die Arbeiter jener Länder zu mobilisieren, in denen die revolutionäre Bewegung nicht zerschlagen worden war, waren die nationalen Bourgeoisien gezwungen, auf eine besondere Mystifikation zurückzugreifen. In den Ländern, in denen das Proletariat bereits in einer direkten Klassenkonfrontation niedergeschlagen worden war, war die spezifische Form der sich entwickelnden Konterrevolution die ideologische Kriegsmobilisierung für den Faschismus bzw. Nazismus oder für die stalinistische Ideologie der „Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes“. In den politischen Regimes, die „demokratisch“ geblieben waren, wurde dieselbe Mobilisierung im Namen des Antifaschismus unternommen. Die französische und spanische Bourgeoisie (und andere wie die belgische Bourgeoisie zum Beispiel) benutzten den Machtantritt der Linken, um die Klasse hinter dem Antifaschismus und der Verteidigung des „demokratischen“ Staates zu mobilisieren und die Kriegswirtschaft zu etablieren.
Die Position, die die Linke gegenüber den oben erwähnten Kämpfen einnahm, zeigt deutlich, dass die Volksfront keine Politik praktizierte, um die Dynamik der Arbeiterkämpfe zu stärken. Während der aufstandsartigen Kämpfe 1932 in Belgien weigerten sich der Parti Ouvrier Belge (Belgische Arbeiterpartei, POB) und seine Gewerkschaften, die Bewegung zu unterstützen. Dies führte dazu, dass die Wut der Arbeiter sich auch gegen die Sozialdemokratie richtete. Die Streikenden griffen das Maison du Peuple in Charleroi an und zerrissen oder verbrannten ihre POB- und Gewerkschaftsmitgliedsausweise. Ende 1933 stellte die POB den „Plan de Travail“ (Arbeitsplan) als „Volksalternative“ zur kapitalistischen Krise vor, um die Wut und Verzweiflung der Arbeiter zu kanalisieren.
Auch Spanien veranschaulicht deutlich, was das Proletariat von einer „republikanischen“ oder „linken“ Regierung zu erwarten hat. Von Anbeginn ihrer Existenz hatte die spanische Republik bewiesen, dass sie nichts von den faschistischen Regimes lernen musste, um Arbeiter zu massakrieren. Eine große Anzahl von Kämpfen in den 30er Jahren wurde von republikanischen Regierungen oder vom Partido Socialista Obrero Español (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei, PSOE) zerschlagen. Der PSOE, der sich damals in der Opposition befand, zettelte mit seinem „revolutionären“ Gerede den selbstmörderischen Aufstand im Oktober 1934 in Asturien an. Anschließend isolierte er zusammen mit seiner Gewerkschaft, der UGT, die Bewegung vollständig, indem er jegliche Ausbreitung der Bewegung vereitelte. Damals entlarvte Bilan den Charakter der „linksdemokratischen“ Regimes überaus deutlich: „In der Tat schafft der ‚Linksrutsch‘ der spanischen Republik, der in der Zeit zwischen ihrer Gründung im April 1931 und dem Dezember 1931 stattfand – die Bildung der Azaña-Caballero-Lerroux-Regierung, die Amputation ihres rechten Flügels, der von Lerroux repräsentiert wurde, im Dezember 1931 –, keine günstigen Bedingungen für die Entwicklung von proletarischen Klassenpositionen oder für die Bildung von Organen, die in der Lage sind, den revolutionären Kampf anzuführen. Es geht keinesfalls darum, dass die republikanische oder radikalsozialistische Regierung alles zum Guten der (...) kommunistischen Revolution zu tun trachtet. Es geht darum, die Bedeutung dieses Wechsels zu den Linken oder den Rechtsextremen, diesen einstimmigen Chor der Sozialisten und Gewerkschafter für die Verteidigung der Republik zu analysieren. Hat dies die Bedingungen für eine Entwicklung von Arbeitererrungenschaften und für eine revolutionäre Ausrichtung des Proletariats geschaffen? Oder war dieser Linksrutsch vom kapitalistischen Bedürfnis diktiert, die Arbeiter zu betäuben, die von der weitgreifenden revolutionären Welle mitgerissen worden waren, sicherzustellen, dass sie nicht den Weg des revolutionären Kampfes einschlagen? Der Weg, den die Bourgeoisie im Oktober 1934 einschlug, wäre 1931 zu gefährlich gewesen...“ (Bilan Nr. 12, November 1934)
Schließlich ist es besonders aufschlussreich, dass die gewaltsamen Konfrontationen in Brest und Toulon im Sommer 1935 in dem Moment ausbrachen, als die Volksfront gebildet wurde. Da sie sich spontan gegen die Losungen der politischen und gewerkschaftlichen Führer entwickelten, zögerten Letztere nicht, jene als „Provokateure“ zu verunglimpfen, die die „republikanische Ordnung“ störten: „... weder die Volksfront noch die Kommunisten, die in der vordersten Reihe stehen, zerschlagen Fensterscheiben, plündern Cafés oder zerreißen die Nationalflagge“ (Humanité-Leitartikel, 7. August 1935).
So beruhten, wie Bilan in puncto Spanien seit 1933 aufzeigte, die Politik der Volksfront und der linken Regierungen in keiner Weise auf einer dynamischen Verstärkung des proletarischen Kampfes. Im Gegenteil, sie entwickelten sich gegen ihn, sie kollidierten bewusst mit jenen noch auf einem Klassenterrain befindlichen Arbeiterbewegungen, um diese letzten Ausbrüche des Widerstandes gegen die „totale Auflösung des Proletariats im Kapitalismus“ (Bilan Nr. 22, August – September 1935) zu ersticken: „In Frankreich wird die Volksfront, getreu ihrer verräterischen Tradition, nicht nachlassen, zur Ermordung jener aufzurufen, die sich weigern, sich der ‚französischen Entwaffnung‘ zu beugen, und die sich, wie in Brest und Toulon, weiterhin in Streiks für ihre eigenen Forderungen, in Klassenschlachten gegen den Kapitalismus und außerhalb des Zugriffs der Klauen der Volksfront engagieren.“ (Bilan Nr. 26, Dezember – Januar 1936)
Der Antifaschismus fesselt die Arbeiter an die Verteidigung des bürgerlichen Staates
Hat die Volksfront nicht wenigstens „die Kräfte des Volkes gegen den Aufstieg des Faschismus vereint“? Als Hitler Anfang 1933 in Deutschland an die Macht kam, nutzte die Linke den Erfolg der rechtsextremistischen und faschistischen Fraktionen in den „demokratischen“ Ländern, um zu zeigen, dass es notwendig sei, die Demokratie mit einer breiten antifaschistischen Front zu verteidigen. Diese Strategie wurde erstmals Anfang 1934 in Frankreich praktiziert und durch ein gigantisches Manöver in Gang gesetzt. Den Vorwand hierfür lieferte die gewaltsame Protestdemonstration am 6. Februar 1934 gegen die Auswirkungen der Krise und gegen die korrupten Regierungen der Dritten Republik. Neben Militanten der KP wurden auch Gruppen von Rechtsradikalen (Croix de Feu, Camelots du Roi) in diese Demonstration eingeschleust. Einige Tage später, nach einem Strategiewechsel seitens Stalin und der Dritten Internationale, änderte die KP ihre Haltung abrupt. Erstere hatten beschlossen, die Taktik der Klassenkonfrontation durch eine Politik der Annäherung an die sozialistischen Parteien zu ersetzen. Von diesem Augenblick an wurde der 6. Februar als eine „faschistische Offensive“ und als „versuchter Staatsstreich“ in Frankreich dargestellt.
Die Ausschreitungen am 6. Februar versetzten die Linke in die Lage, die Bedrohung durch den Faschismus zu übertreiben und eine breite Kampagne zu organisieren, um die Arbeiter im Namen der Verteidigung der „Demokratie“ zu mobilisieren. Der Generalstreik, zu dem sowohl die KP als auch die SFIO[ii] [213] für den 12. Februar aufgerufen hatte, krönte den Antifaschismus mit der Parole „Einheit! Einheit gegen den Faschismus!“ Die französische KP machte sich die neue Ausrichtung rasch zu eigen, und auf der nationalen Konferenz in Ivry im Juni 1934 war der einzige Punkt auf der Tagesordnung „die Organisation der Einheitsfront des antifaschistischen Kampfes“.[iii] [213] Diese Perspektive mündete schnell in der Unterzeichnung eines bilateralen Abkommens zwischen der KP und der SFIO im Juli 1934.
Auf diese Weise wurde der Antifaschismus zu dem Mittel schlechthin, um alle bürgerlichen Kräfte, die „in die Freiheit verliebt“ waren, hinter der Flagge der Volksfront zu sammeln. Er ermöglichte es auch, die Interessen des Proletariats an jene des nationalen Kapitals zu binden, indem er ein „Bündnis der Arbeiterklasse mit den Arbeitern der Mittelschichten“ bildete, um Frankreich die „Schande und die Krankheiten einer faschistischen Diktatur“ zu ersparen, wie Thorez es formulierte. Des weiteren verbreitete die französische KP die Leier von den „200 Familien, die Frankreich ausplündern und die nationalen Interessen ausverkaufen“. So leide jeder, mit Ausnahme dieser „Kapitalisten“, an der Krise und sei in Solidarität mit allen anderen verbunden. Auf diese Weise wurden die Arbeiterklasse und ihre Klasseninteressen im Volk und in der Nation im Kampf gegen „eine Handvoll von Parasiten“ ertränkt.
Andererseits wurde Tag für Tag der Faschismus hysterisch als einziges kriegstreiberisches Element angeprangert. Die Volksfront mobilisierte die Arbeiterklasse für die Verteidigung des Vaterlandes gegen die faschistischen Invasoren, und das deutsche Volk wurde mit dem Nazismus identifiziert. In ihren Parolen rief die französische KP jedermann dazu auf, nur „französische Waren zu kaufen“, und glorifizierte die nationale Versöhnung. So drängte die Linke mit den Mitteln des abscheulichsten Nationalismus, des schlimmsten Ausdrucks von Chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit das Proletariat hinter das Staatsschiff.
Der Höhepunkt dieser intensiven Kampagne waren ein Wahlbündnis und die offizielle Bildung der Volksfront am 14. Juli 1935. Zu diesem Anlass wurden die Arbeiter dazu gebracht, unter den gemeinsamen Porträts von Marx und Robespierre die französische Nationalhymne zu singen und zu skandieren: „Lang lebe die französische Sowjetrepublik!“ Indem alle Handlungen auf die Entfaltung einer Wahlkampagne für die „Volksfront für Frieden und Arbeit“ konzentriert wurden, lenkte die Linke die Kämpfe vom Klassenterrain auf das Terrain der bürgerlichen parlamentarischen Demokratie, ertränkte das Proletariat in der formlosen Masse des „französischen Volkes“ und leitete seinen Kampf um in die Verteidigung der nationalen Interessen. „Dies war ein Resultat der neuen Positionen vom 14. Juli, die die logische Konsequenz aus der Politik des Antifaschismus waren. Die Republik war kein Kapitalismus, sie war das Reich der Freiheit, der Demokratie, die, wie wir wissen, die Plattform des Antifaschismus ist. Die Arbeiter schworen feierlich, diese Republik gegen innere wie äußere Unruhestifter zu verteidigen, während Stalin sie aufforderte, der Bewaffnung des französischen Imperialismus im Namen der Verteidigung der UdSSR zuzustimmen.“ (Bilan Nr. 22, August – September 1935)
Dieselbe Strategie zur Mobilisierung der Arbeiterklasse auf dem Terrain der Wahlen und für die Verteidigung der Demokratie wurde auch in vielen anderen Ländern praktiziert. Sie integrierte die Arbeiter in die Allgemeinheit der Volksschichten und mobilisierte sie für die Verteidigung der nationalen Interessen. In Belgien wurden bei der Mobilisierung der Arbeiter hinter die Kampagne für den „Plan de Travail“ Mittel der psychologischen Propaganda benutzt, die der nazistischen oder faschistischen Propaganda in nichts nachstanden. Am Ende trat der POB 1935 in die Regierung ein. Der antifaschistische Rausch, der insbesondere von der Linken des POB entfacht wurde, erreichte 1937 seinen Höhepunkt mit der Allianz zwischen Degrelle, dem Führer der faschistischen Königspartei, und dem Premierminister Van Zeeland, der die Unterstützung aller „demokratischen“ Kräfte einschließlich der belgischen KP genoss. Im gleichen Jahr bekräftigte Spaak, einer der Führer des linken Flügels des POB, den „nationalen Charakter“ des Programms der belgischen Sozialisten. Er schlug außerdem vor, dass die Partei zu einer Volkspartei werden solle, da sie die allgemeinen Interessen und nicht die Interessen einer einzigen Klasse vertrete!
Jedoch war Spanien das Land, in dem das französische Beispiel die Politik der Linken am nachhaltigsten inspirierte. Auch nach dem Massaker in Asturien konzentrierte der PSOE seine Politik auf die Propaganda für den Antifaschismus, für die „vereinigte Front aller Demokraten“, und rief zu einem Volksfrontprogramm gegen die faschistische Gefahr auf. Im Januar 1935 unterzeichnete er ein „Volksfrontbündnis“ mit der Gewerkschaft UGT, den republikanischen Parteien und der spanischen KP, mit kritischer Unterstützung der CNT[iv] [213] und des POUM .[v] [213] Diese „Volksfront“ rief offen zu einer Ersetzung des Arbeiterkampfes durch den Kampf auf bürgerlichem Terrain auf, gegen die faschistischen Fraktionen der Bourgeoisie und zugunsten ihres „antifaschistischen“ und „demokratischen“ Flügels. Der Kampf gegen den Kapitalismus wurde zugunsten eines illusorischen „Reformprogramms“ und einer „demokratischen Revolution“ des Systems aufgegeben. Mittels der Mystifikation der falschen antifaschistischen und demokratischen Front mobilisierte die Linke das Proletariat auf dem Terrain der Wahlen und errang darüber hinaus im Februar 1936 einen Wahltriumph: „Diese (die republikanisch-sozialistische Koalition 1931-33) war eine aufschlussreiche Demonstration, wie man die Demokratie als Manövriermasse für die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Regimes einsetzt (...) auch 1936 ergab sich auf dieselbe Weise die Möglichkeit, das spanische Proletariat nicht hinter seinen Klasseninteressen aufzustellen, sondern hinter der Verteidigung der ‚Republik‘, des ‚Sozialismus‘ und des ‚Fortschritts‘ gegen Monarchismus, Klerikalfaschismus und Reaktion. Dies zeigt die tiefe Verwirrung der Arbeiter in Spanien, wo das Proletariat erst kürzlich seine Kampfbereitschaft und seinen Opfergeist bewiesen hatte.“ (Bilan Nr. 28, Februar – März 1936)
In der Tat gelang es der antifaschistischen Politik der Linken und der Bildung der „Volksfronten“, die Arbeiter zu atomisieren, innerhalb der Bevölkerung zu verwässern, sie für die demokratische Umwandlung des Kapitalismus zu mobilisieren, ja sie mit chauvinistischem und nationalistischem Gift zu durchtränken. Bilans Einschätzung erwies sich als richtig, als am 14. Juli 1935 die Volksfront offiziell verkündet wurde: „Eindrucksvolle Massendemonstrationen signalisieren die Auflösung des französischen Proletariats in das kapitalistische Regime. Trotz der Tatsache, dass Abertausende von Arbeitern durch die Straßen von Paris marschieren, gibt es keinen Arbeiterkampf für die eigenen Ziele mehr, genauso wenig wie in Deutschland. In diesem Zusammenhang markiert der 14. Juli einen entscheidenden Moment im Prozess der Desintegration des Proletariats und des Wiederaufbaus der heiligen Einheit der kapitalistischen Nation (...) Die Arbeiter trugen geduldig die Nationalfahne, sangen die Nationalhymne und applaudierten gar Daladier, Cot und anderen kapitalistischen Ministern, die zusammen mit Blum und Cachin[vi] [213] feierlich geschworen hatten, ‚den Arbeitern Brot, den Jungen Arbeit und der Welt Frieden zu geben‘. Was bedeutete: Bleikugeln, Kasernen und imperialistischer Krieg für jedermann.“ (Bilan Nr. 21, Juli – August 1935)
Die ökonomischen Maßnahmen der Volksfront: Der Staat im Dienste der Arbeiter?
Aber hat die Linke die Schrecken der freien Konkurrenz des „Monopol“-Kapitalismus nicht zumindest gelindert durch ihre Maßnahmen zur Stärkung der staatlichen Kontrolle über die Wirtschaft? Hat sie somit nicht die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterklasse verteidigt? Es ist einmal mehr notwendig, die von der Linken gerühmten Maßnahmen in den allgemeinen Rahmen der Situation des Kapitalismus zu stellen.
Zu Beginn der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts herrschte totale Unordnung in der kapitalistischen Produktion. Die weltweite Krise warf Millionen von Proletariern auf die Strasse. Die ökonomische Krise, hervorgerufen durch die Dekadenz des kapitalistischen Systems, manifestierte sich in der großen Depression der 30er Jahre (Börsenkrach 1929, rekordhohe Inflationsraten, Rückgang in Wachstum und industrieller Produktion, dramatische Beschleunigung der Arbeitslosigkeit). Dies drängte die siegreiche Bourgeoisie unerbittlich zum imperialistischen Krieg um die Neuaufteilung des übersättigten Weltmarktes. „Exportiere oder stirb“ wurde der Slogan jeder nationalen Bourgeoisie. Die nationalsozialistischen Führer drückten dies klar aus.
Auf dem Weg zum Krieg, die Entwicklung der Kriegswirtschaft
Nach dem Ersten Weltkrieg fand sich Deutschland durch den Versailler Vertrag seiner wenigen Kolonien beraubt und von Kriegsschulden und Reparationszahlungen niedergedrückt. Es war eingezäunt im Zentrum Europas und von diesem Zeitpunkt an wuchs dort das Problem heran, welches die Politik aller europäischen Länder für die nächsten zwei Jahrzehnte bestimmen sollte. Im Zuge des Wiederaufbaus seiner Wirtschaft war Deutschland gezwungen, neue Absatzmöglichkeiten für seine Güter zu finden, wobei seine Expansion nur im Rahmen Europas stattfinden konnte. Die Ereignisse beschleunigten sich, als Hitler 1933 an die Macht kam. Die ökonomischen Bedürfnisse, die Deutschland in den Krieg drängten fanden ihren Ausdruck in der nationalsozialistischen Ideologie: Die Ablehnung des Versailler Vertrages, die Forderung nach „Lebensraum“, der nur in Europa sein konnte.
Dies überzeugte gewisse Teile der französischen Bourgeoisie, dass der Krieg unvermeidlich war und dass Sowjetrussland ein guter Alliierter sei, die pangermanischen Aspirationen abzuwehren. Dies umso mehr, als die Situation auf internationaler Ebene immer klarer wurde: Deutschland verließ den Völkerbund und die UdSSR trat ihm bei. Ehemals hatte diese die deutsche Karte gegen die Kontinentalblockade der westlichen Demokratien ausgespielt. Aber dann wurde die Beziehung Deutschlands zu den USA besser, als diese vermehrt in die deutsche Wirtschaft investierten, die dank dem Dawes-Plan[vii] [213] wieder in Fahrt kam, und so den ökonomischen Wiederaufbau einer westlichen „Bastion“ gegen den Kommunismus förderten. An diesem Punkt orientierte das stalinistische Russland seine Außenpolitik neu in Richtung eines Bruches dieser Allianz. In der Tat glaubten wichtige Teile der Bourgeoisie in den westlichen Ländern bis zu einem späten Zeitpunkt, dass sich der Krieg mit Deutschland mit Hilfe von wenigen Konzessionen und vor allem, indem man Deutschlands notwendige Expansion in den Osten lenkte, verhindern ließe. München 1938 brachte dieses kontinuierliche Unverständnis der Situation und des kommenden Krieges zum Ausdruck.
Die Reise des französischen Außenministers Laval nach Moskau unterstrich 1935 mit der französisch-russischen Annäherung dramatisch diese Aufstellung der imperialistischen Bauern auf dem europäischen Schachbrett. Stalins Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages implizierte die Anerkennung der französischen Verteidigungspolitik und ermutigte die französische KP, für die Militärkredite zu stimmen. Wenige Monate später, im August 1935, zog der VII. Kongress der Komintern für Russland die politischen Konsequenzen einer möglichen Allianz mit den westlichen Ländern zwecks Konfrontation des deutschen Imperialismus. Dimitrow benannte den neuen Feind, den es zu bekämpfen galt: Faschismus. Die Sozialisten, welche bis anhin heftig kritisiert wurden, wurden zu einer demokratischen Kraft (unter anderen) mit welcher man sich, wenn es galt, den faschistischen Feind zu besiegen, verbünden musste. Die stalinistischen Parteien in anderen Ländern folgten der 180-Grad-Drehung des großen Bruders, der KPdSU, und wurden so die feurigsten Verteidiger der imperialistischen Interessen des so genannten „Sozialistischen Vaterlandes“.
Kurz gesagt fühlten alle industrialisierten Länder einen großen Drang, ihre Kriegsökonomie zu entwickeln; nicht nur die Rüstungsproduktion, sondern auch die ganze Infrastruktur, welche für diese Produktion nötig war. Alle Großmächte, sowohl die „demokratischen“ wie die „faschistischen“, entwickelten eine ähnliche Politik der großen öffentlichen Werke unter Staatskontrolle und einer Rüstungsindustrie, welche gänzlich auf die Vorbereitung eines zweiten Weltkrieges ausgerichtet war. Darum herum organisierte sich die Wirtschaft, sie erzwang eine Reorganisation der Arbeit, von welcher der „Taylorismus“ der vorzüglichste Sprössling war.
Die Linke und die Maßnahmen zur staatlichen Kontrolle
Eine der Hauptcharakteristiken „linker“ Wirtschaftspolitik war die Stärkung staatlicher Maßnahmen mit dem Zweck, die krisengeschüttelte Wirtschaft zu unterstützen, und die staatliche Kontrolle über verschiedene Sektoren der Wirtschaft. Dies rechtfertigte Maßnahmen „einer ‚kontrollierten Wirtschaft’, eines ‚Staatssozialismus’, der die Bedingungen reifen lässt, welche es den ‚Sozialisten’ erlauben sollen, ‚friedlich’ und stufenweise die Mühlen des Staates zu erobern“ (Bilan Nr. 3, Januar 1934). Solche Maßnahmen wurden allgemein von der ganzen europäischen Sozialdemokratie gepriesen. Sie wurden in das Wirtschaftsprogramm der Volksfront in Frankreich aufgenommen, bekannt als Jouhaux-Plan. In Spanien beinhaltete das Programm der Volksfront eine breite Politik von Agrarkrediten, einen Plan für weitläufige öffentliche Investitionen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie eine Arbeitsgesetzgebung, welche zum Beispiel einen Minimallohn festsetzte. Wir können deren eigentliche Bedeutung erkennen, indem wir eines ihrer Vorbilder untersuchen, den „New Deal“, welcher in den USA unter Roosevelt nach der Krise von 1929 eingeführt wurde. Ebenfalls analysiert werden sollte die best entwickelte theoretische Konkretisierung dieses „Staatssozialismus“, der „Plan de Travail“ des belgischen Sozialisten Henri De Man.
Der „New Deal“, in Kraft gesetzt in den USA ab 1932, war ein Plan des wirtschaftlichen Wiederaufbaus und des „sozialen Friedens“. Die Intervention von Seiten der Regierung zielte ab auf die Wiederherstellung des Gleichgewichts des Bankensystems, die Wiederbelebung des Finanzmarktes, die Umsetzung bedeutender öffentlicher Investitionen (Dammbauten durch die Behörden des Tennessee Valleys gehen auf diese Zeit zurück) und bestimmter sozialer Programme (Pensionssystem, Arbeitslosenversicherung, usw.). Die Rolle der neuen Bundesagentur, der „National Recovery Administration“ (NRA, etwa „Nationale Wiederaufschwungsverwaltung“), bestand darin, Preise und Löhne in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Gewerkschaften zu stabilisieren. Sie schuf die „Public Works Administration“ (PWA, Verwaltung öffentlicher Bauten) zur Förderung einer Politik großer öffentlicher Investitionen.
Hat die Regierung von Roosevelt, ohne es zu wissen, den Arbeiterparteien den Weg bereitet, die wichtigsten Hebel der staatlichen Macht zu erobern? Für Bilan war das Gegenteil wahr: „Die Intensität der Wirtschaftskrise akkumulierte zusammen mit der Arbeitslosigkeit und dem Elend von Millionen die Gefahr eines ernsthaften sozialen Konflikts, welche der amerikanische Kapitalismus mit allen möglichen Mitteln entschärfen oder ersticken musste“ (Bilan Nr. 3, Januar 1934). So gesehen waren diese Maßnahmen alles andere als förderlich für das Wohl der Arbeiter, die Maßnahmen für den „sozialen Frieden“ waren direkte Angriffe auf die Klassenautonomie des Proletariats. „Roosevelt hatte nicht vor, die Arbeiterklasse in die Klassenopposition zu führen, sondern dieselbe innerhalb des kapitalistischen Regimes und unter der Kontrolle des kapitalistischen Staates aufzulösen. So konnten soziale Konflikte nicht mehr aus dem realen (Klassen-)Kampf zwischen den Arbeitern und den Unternehmern heraus entstehen, sondern wurden auf den Gegensatz zwischen Arbeiterklasse und NRA, einem staatskapitalistischen Organ begrenzt. So mussten die Arbeiter jegliche Initiative in diesem Kampf aufgeben und ihr Schicksal dem Gegner überlassen“ (ebenda).
Einer der Hauptarchitekten dieser Maßnahmen der Staatskontrolle und geistiger Vater einer Mehrzahl derselben war Henri De Man. Er war der Kopf des Institutes der POB-Kader sowie Vizepräsident und führende Figur der Partei ab 1933. Seine Maßnahmen wurden sowohl von der Volksfront als auch von faschistischen Regimes (Mussolini war einer seiner großen Bewunderer) in die Praxis umgesetzt. Für De Man, der detaillierte Studien über industrielle und soziale Entwicklung in den USA und in Deutschland durchgeführt hatte, mussten „alte Dogmas“ überwunden werden. Für ihn war die Grundlage des Klassenkampfes das Gefühl einer sozialen Minderwertigkeit der Arbeiter. So sollte der Sozialismus weniger auf die Befriedigung der materiellen Bedürfnisse einer Klasse (der Arbeiter), sondern vor allem auf universelle geistige Werte wie Gerechtigkeit, Respekt der menschlichen Persönlichkeit und die Sorge um das „Allgemeinwohl“ ausgerichtet werden. So wurden die unvermeidlichen und unversöhnlichen Gegensätze zwischen der Arbeiterklasse und den Kapitalisten beseitigt. Nicht nur musste die Revolution abgelehnt werden, sondern auch der „alte Reformismus“, welcher in Perioden der Krise nicht anwendbar war. Es mache keinen Sinn, ein immer größeres Stück eines konstant schwindenden Kuchens zu verlangen. Ein neuer und größerer Kuchen musste gebacken werden. Das war das Ziel seiner so genannten „konstruktiven Revolution“. Innerhalb dieses Rahmens entwickelte er 1933 für den „Weihnachts“-Kongress des POB seinen „Plan de Travail“, welcher „strukturelle Reformen“ des Kapitalismus anstrebte:
- Verstaatlichung der Banken, welche weiter existieren, jedoch einen Teil ihrer Aktien einer staatliche Kreditinstitution verkaufen und die Richtlinien des wirtschaftlichen Plans befolgen sollten;
- die gleiche Kreditinstitution sollte Anteile großer Monopole in einigen zentralen Industriesektoren (zum Beispiel dem Energiesektor) kaufen, so dass diese zu gemischten Unternehmen unter der gemeinsamen Kontrolle der Kapitalisten und des Staates würden;
- Neben diesen „assoziierten“ Unternehmen sollte ein freier kapitalistischer Sektor weiter existieren, der vom Staat gefördert und unterstützt würde;
- die Gewerkschaften sollten mit Hilfe einer „Arbeiterkontrolle“ direkt in die Koordination dieser gemischten Ökonomie eingebunden werden – eine Richtlinie, die De Man auf der der Grundlage von Erfahrungen in großen US-amerikanischen Fabriken verteidigte.
Wie führten diese von De Man angepriesenen „Strukturreformen“ zur Verteidigung des Klassenkampfes der Arbeiter? Für Bilan wollte De Man „zeigen, dass sich der Kampf der Arbeiter natürlich begrenzen musste auf nationale Ziele in Form und Inhalt und dass Sozialisierung fortschreitende Verstaatlichung der kapitalistischen oder gemischten Wirtschaft bedeutete. Unter dem Deckmantel der „unmittelbaren Aktion“ predigte De Man eine nationale Anpassung der Arbeiter an die „einzigartige und unteilbare Nation“ und stellte dies dar als die äußerste Zuflucht der von der kapitalistischen Reaktion gehemmten Arbeiter.“ Schließlich „zielen die strukturellen Reformen von H. De Man darauf ab, den realen Kampf der Arbeiter – und das ist deren einziges Ziel - in den Bereich des Irrealen zu verbannen. Sie schließen jeglichen Kampf für die Verteidigung unmittelbarer oder historischer Interessen des Proletariats im Namen einer strukturellen Reform aus, welche, was ihre Konzeption und Mittel betrifft, der Bourgeoisie nur helfen konnte, ihren Klassenstaat zu stärken, indem die Arbeiterklasse auf ihre Ohmacht reduziert wurde.“ (Bilan Nr. 4, Februar 1934).
Aber Bilan ging noch weiter und setzte den „Plan de Travail“ in den Kontext der Rolle, welche die Linke im damaligen historischen Rahmen spielte. „Der Aufstieg des Faschismus in Deutschland beendete eine bestimmende Periode von Arbeiterkämpfen. (...) Die Sozialdemokratie, welche ein wesentliches Element in diesen Niederlagen war, war auch ein Element in der organischen Reformation des Lebens des Kapitalismus. (...) Sie benutzte eine neue Sprache, um mit ihren Aufgaben fortzufahren. Sie lehnte verbal den Internationalismus ab, da dieser nicht länger notwendig war und ging über zu einer offenen ideologischen Vorbereitung der Arbeiter zur Verteidigung „ihrer Nation“. (...) Hier findet sich der wahre Ursprung von De Mans Plan. Dieser ist ein konkreter Versuch, mit Hilfe einer adäquaten Mobilisation, die Niederlage des revolutionären Internationalismus genau so zu sanktionieren wie die ideologische Vorbereitung einer Integration des Proletariats in den Kampf des Kapitalismus Richtung Krieg. Deswegen spielt ihr nationaler Sozialismus dieselbe Rolle wie der National-Sozialismus der Faschisten.“ (Bilan Nr. 4, Februar 1934).
Die Analyse des New Deals und von De Mans Plan zeigt gut, dass diese Maßnahmen in keiner Weise in Richtung einer Stärkung des proletarischen Kampfes gegen den Kapitalismus gingen. Im Gegenteil, sie zielten darauf ab, das Proletariat in die Ohnmacht zu treiben, es den Bedürfnissen der nationalen Verteidigung zu unterwerfen. Wie Bilan sagte, kann De Mans Plan auf keine Weise unterschieden werden von den Programmen der Staatskontrolle der faschistischen und Naziregimes oder von denen der stalinistischen Fünfjahrespläne, welche von 1928 an in den UdSSR durchgesetzt wurden und anfangs die Demokraten in den USA inspirierten.
Solche Maßnahmen wurden allgemein verbreitet, weil sie den Bedürfnissen eines dekadenten Kapitalismus entsprachen. In dieser Periode war die allgemeine Tendenz zum Staatskapitalismus eine der dominanten Charakteristiken des sozialen Lebens. „Da in dieser Epoche kein nationales Kapital in der Lage ist, sich uneingeschränkt zu entwickeln, und jedes von ihnen mit einer unbarmherzigen imperialistischen Konkurrenz konfrontiert ist, wird jedes Nationalkapital gezwungen, sich so effektiv wie möglich zu organisieren, um sich nach außen, gegen seine Rivalen, ökonomisch und militärisch bestmöglich zu wappnen und um im Innern der wachsenden Zuspitzung der gesellschaftlichen Widersprüche Herr zu werden. Die einzige Kraft in der Gesellschaft, die diese Aufgaben durchführen kann, ist der Staat.
Nur der Staat kann:
- die Volkswirtschaft global und zentral kontrollieren und die innere Konkurrenz reduzieren, welche die Wirtschaft schwächt. Dabei lautet seine oberste Maxime, die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Wirtschaft zu stärken, um der Konkurrenz auf dem Weltmarkt vereint zu begegnen;
- die militärischen Vorkehrungen treffen (Aufbau von militärischen Streitkräften), welche für die Verteidigung der Interessen des nationalen Kapitals in Anbetracht der Verschärfung der internationalen Gegensätze notwendig sind;
- schließlich dank eines ständig verstärkten Unterdrückungsapparates und seiner Bürokratie den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft stärken, welcher durch den sich beschleunigenden Verfall ihrer ökonomischen Grundlagen bedroht ist. (...)“ (Plattform der IKS).
In Tat und Wahrheit waren alle diese Programme der Reorganisation nationaler Produktion unter Staatskontrolle gänzlich auf den ökonomischen Krieg und die Vorbereitung eines neuen weltweiten Schlachtens (Kriegswirtschaft) ausgerichtet. Sie entsprachen genauestens den Bedürfnissen der Bourgeoisie, innerhalb des Kapitalismus in seiner dekadenten Periode zu überleben.
Der Sieg der Volksfront: Die „soziale Revolution“ auf dem Vormarsch?
Aber wurden diese pessimistischen Analysen nicht hinweggefegt von den massiven Streiks im Mai und Juni 1936 in Frankreich, von den sozialen Maßnahmen, welche die Volksfrontregierung ergriff, und von der „spanischen Revolution“, welche im Juli 1936 begann? Bestätigen diese Ereignisse nicht im Gegenteil, dass der Ansatz der „antifaschistischen“ oder „Volksfront“ korrekt war? Waren diese nicht sogar ein konkreter Ausdruck der „sozialen Revolution“ in Aktion? Untersuchen wir das Wesen dieser Ereignisse.
Mai bis Juni 1936 in Frankreich: Die Arbeiter mobilisierten hinter dem demokratischen Staat
Die große Streikwelle, welche unmittelbar auf den Antritt der Volksfrontregierung nach ihrem Wahlsieg am 5. Mai 1936 folgte, sollte die Grenzen der Arbeiterbewegung aufzeigen. Diese Grenzen waren abgesteckt durch die Niederlage der revolutionären Welle und das Gewicht der Konterrevolution.
Die „Errungenschaften“ von 1936
Am 7. Mai brach eine Streikwelle in der Flugzeugindustrie aus, gefolgt von der Bau- und der Automobilindustrie. Begleitet wurde sie von spontanen Fabrikbesetzungen. Trotz ihrer kämpferischen Natur waren diese Auseinandersetzungen ein Zeichen der beschränkten Fähigkeit der Arbeiter, den Kampf auf ihrem eigenen Klassenterrain auszufechten. In den ersten Tagen der Bewegung war die Linke erfolgreich darin, die Ablenkung der Kampfbereitschaft der Arbeiter auf das Terrain der nationalen Interessen als „Sieg der Arbeiter“ darzustellen. Es stimmt zwar, dass zu dieser Zeit die ersten Fabrikbesetzungen überhaupt in Frankreich stattfanden, aber es war auch das erste Mal, dass man Arbeiter gleichzeitig die Marseillaise und die Internationale singen hörte oder sie sowohl hinter der roten Fahne als auch der nationalen „Trikolore“ marschieren sah. Der Kontrollapparat der KP und die Gewerkschaften blieben Herren der Situation und konnten die Arbeiter erfolgreich in ihren Fabriken eingeschlossen halten, zu der besänftigenden Musik des Akkordeons. Währenddessen wurde an der Spitze über ihr Schicksal entschieden, in den Verhandlungen, welche zum Matignon-Abkommen führen sollten. Einheit bestand zwar, aber diejenige des bourgeoisen Kontrollapparates über die Arbeiterklasse, und nicht die Einheit der Arbeiterklasse. Als sich eine kleine Menge Widerspenstiger weigerte zu verstehen, dass es nach der Unterzeichnung des Abkommens Zeit war, wieder an die Arbeit zu gehen, erklärte ihnen die Humanité, dass es „notwendig war, zu wissen, wie man einen Streik stoppt... es sogar notwendig war zu wissen, wie man einen Kompromiss eingeht“ (Maurice Thorez, Rede im Juni 1936) und dass „wir unsere radikalen Freunde nicht erschrecken dürfen“.
Während des Riom-Prozesses, den das Vichy-Regime führte, um die Verantwortlichen für die „moralische Dekadenz Frankreichs“ zu bestrafen, erklärte Léon Blum persönlich, wie die Fabrikbesetzungen in die nationale Mobilisierung hinein passten: „Die Arbeiter waren da als Wächter, Aufseher und in einem gewissen Sinne auch als Mitbesitzer. Und vom speziellen Gesichtspunkt aus, der Sie interessiert, führt die Feststellung, dass es gegenüber dem nationalen Kulturgut eine Gemeinschaft von Rechten und Pflichten gibt, nicht zur Sicherung und Vorbereitung seiner gemeinsamen und einhelligen Verteidigung? (...) auf diese Weise schafft man Schritt für Schritt für die Arbeiter ein gemeinsames Eigentum im Vaterland; auf diese Weise lehrt man sie das Vaterland zu verteidigen.“
Die Linke kriegte was sie wollte: Sie brachte die Kampfbereitschaft der Arbeiter auf den unfruchtbaren Boden des Nationalismus, des nationalen Interesses. „Die Bourgeoisie ist gezwungen, sich an die Volksfront zu wenden, um den unvermeidlichen Ausbruch des Klassenkampfes zu ihrem Wohl zu kanalisieren, speziell da die Volksfront als Ausfluss der Arbeiterklasse erscheint und nicht als die kapitalistische Macht, welche das Proletariat auflöste, um es für den Krieg zu mobilisieren“ (Bilan Nr. 32, Juni-Juli 1936). Um jeglichem Arbeiterwiderstand ein Ende zu setzen, benutzten die Stalinisten ihre Knüppel gegen jene, welche „sich selbst zu kurzsichtigen Aktionen provozieren ließen“ (M. Thorez, 8. Juni 1936), und die Volksfront holte 1937 die Polizei herbei, um die Arbeiter in Clichy niederzuschießen. Indem sie die letzten Reste an aufsässigen Arbeitern zusammenschlug oder tötete, zwang die Bourgeoisie das ganze französische Proletariat in die Verteidigung der Nation.
Im Wesentlichen gab es im Programm der Volksfront nichts, um was sich die Bourgeoisie hätte Sorgen machen müssen. Am 16. Mai versicherte Daladier, der Präsident der Radikalen Partei: „Kein Artikel des Volksfrontprogramms enthält irgendetwas, was die legitimen Interessen irgendeines Bürgers beeinträchtigen, Investoren beunruhigen oder die gesunde Kraft der französischen Arbeit schädigen könnte. Es gibt keinen Zweifel, dass es viele derjenigen, die es so leidenschaftlich bekämpfen, noch nicht einmal gelesen haben“ (L’Oeuvre, 16. Mai 1936). Nichtsdestotrotz musste die Linke, um ihre antifaschistische Ideologie zu verbreiten und in ihrer Rolle als Verteidiger des Vaterlandes und des kapitalistischen Staates glaubwürdig zu bleiben, ein paar Krümel verteilen. Die Matignon-Abkommen und der Pseudoerfolg von 1936 machten es möglich, die Linke an der Macht als „großen Sieg der Arbeiter“ darzustellen und deren Vertrauen in die Volksfront und in ihre Verteidigung des bürgerlichen Staates sogar in Kriegszeiten zu gewinnen.
Dieses berühmt berüchtigte Matignon-Abkommen, unterzeichnet am 7. Juni 1936, von der CGT gefeiert als ein „Sieg über die Armut“ und bis heute dargestellt als ein Vorbild für „soziale Reformen“, war somit der Köder, mit Hilfe dessen den Arbeitern die Volksfront verkauft wurde. Was hat es konkret gebracht? Unter dem Anschein von „Konzessionen“ an die Arbeiterklasse, wie zum Beispiel Lohnerhöhungen, der 40-Stundenwoche und von bezahlten Ferien, sicherte die Bourgeoisie vor allem die Produktion unter der Führung eines „unparteiischen“ Staates, wie der CGT-Führer Léon Juhaux aufzeigte: „(...) der Beginn einer neuen Ära (...), der Ära direkter Beziehungen zwischen den beiden großen organisierten wirtschaftlichen Kräften des Landes (...). Entscheidungen wurden gänzlich unabhängig getroffen, unter der Schirmherrschaft der Regierung, welche nötigenfalls die Rolle eines Schiedsrichters übernahm, was ihrer Rolle als Repräsentant des allgemeinen Interesses entspricht“ (Radioansprache des 8. Juni 1936). Das Ziel war, die Arbeiter dazu zu bringen, beispiellose Produktionsbeschleunigungen durch Einführung neuer Methoden der Arbeitsorganisation zu akzeptieren, welche das Ziel hatten, die stündliche Produktivität speziell in der Rüstungsindustrie zu verzehnfachen. Dies bedeutete die Verallgemeinerung des Taylorismus, der Fließbandproduktion und die Diktatur der Stoppuhr in den Fabriken.
Es war Léon Blum persönlich, der den „sozialen“ Schleier lüftete, welcher die Gesetze von 1936 verdeckte, und zwar in seiner Rede vor dem Riom-Prozess 1942, welcher die Schuld an der Niederlage gegen die Nazis der Volksfront und der 40-Stundenwoche in die Schuhe schieben wollte: „Was liegt hinter der Stundenproduktivität? (...) Sie hängt ab von der guten Koordination und Anpassung der Bewegungen des Arbeiters an die Maschine; sie hängt ebenso vom moralischen und physischen Zustand des Arbeiters ab.
Es gibt in Amerika eine ganze Denkschule, die Schule von Taylor und den Bedeau-Ingenieuren, welche man auf Inspektion am Fabrikband sehen kann. Diese unternahmen gründliche Studien der materiellen Organisationsmethoden, welche die Stundenproduktion einer Maschine maximieren, was genau ihre Absicht war. Aber es gibt auch die Gilbreth-Schule, welche Daten zur physischen Verfassung der Arbeiter untersuchte, damit diese Steigerung erreicht werden kann. Der Hauptpunkt ist, die Erschöpfung des Arbeiters zu beschränken (...) Glauben sie nicht, dass all unsere soziale Gesetzgebung darauf hinauslief, diese moralische und physische Verfassung zu verbessern: Der kürzere Arbeitstag, mehr Muße, bezahlte Ferien, das Gefühl, eine gewisse Würde und Gleichheit erobert zu haben - all dies sollten Elemente sein, um die Stundenproduktivität, die der Arbeiter aus der Maschine herausholen konnte, zu erhöhen.“
Aus diesen Gründen und auf diese Weise waren die „sozialen“ Maßnahmen der Volksfrontregierung notwendig, um das Proletariat in die neuen Produktionsmethoden einzubinden, welche auf eine schnelle Wiederbewaffnung der Nation abzielten, bevor der Krieg ausbrach. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass bezahlte Ferien in der einen oder anderen Form in allen kriegswilligen entwickelten Ländern gleichzeitig garantiert wurden und so ihren Arbeitern derselbe Produktionsrhythmus aufgezwungen wurde.
Im Juni 1936 brach in Belgien unter dem Eindruck der Bewegung in Frankreich ein Dockarbeiterstreik aus. Nachdem die Gewerkschaften zuerst versucht hatten, ihn zu stoppen, anerkannten sie schließlich die Bewegung und richteten sie auf Forderungen aus, die denen der französischen Volksfront glichen: Lohnerhöhungen, die 40- Stundenwoche und eine Woche bezahlten Urlaubs. Am 15. Juni breitete sich die Bewegung aus auf Borinage und die Regionen von Liège und Limburg: Im ganzen Land standen 350'000 Arbeiter im Streik. Das Hauptresultat der Bewegung war die Verbesserung sozialer Konsultation durch die Einsetzung der nationalen Arbeitskonferenz, in der sich Bosse und Gewerkschaften auf den nationalen Plan zur Optimierung der Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Industrie einigten.
Sobald einmal die Streiks beendet und ein bleibender Zuwachs der Stundenproduktivität erreicht waren, hatte die Volksfrontregierung freie Hand, wieder zurück zu nehmen, was sie gewährt hatte. Die Lohnerhöhungen wurden innerhalb von Monaten von der Inflation weggefressen (die Nahrungsmittelpreise stiegen zwischen 1936 und 1938 um 54%), die 40-Stundenwoche wurde ein Jahr später von Blum selbst in Frage gestellt und dann komplett vergessen, sobald Daladiers radikale Regierung 1938 die ganze wirtschaftliche Maschinerie in Vorbereitung des Krieges beschleunigte: Abschaffung der Extrazahlungen für die ersten 250 Überstunden sowie der Arbeitsverträge, welche Akkordarbeit verboten, und Bestrafung all jener im Namen der nationalen Verteidigung, welche Überstunden ablehnten. „Fabriken, welche für die nationale Verteidigung arbeiteten, wurden ohne weiteres von der Auflage der 40-Stundenwoche befreit. In den meisten anderen Dingen erhielt ich 1938 von den Arbeiterorganisationen die Zustimmung für eine 45-Stundenwoche in Fabriken, welche direkt oder indirekt für die nationale Verteidigung arbeiteten“ (Blum während des Riom-Prozesses). Schlussendlich erhielten die Bosse mit Unterstützung der Regierung Blum und der Zustimmung der Gewerkschaften ihre bezahlten Ferien zurück. Weihnachten und Neujahr wurden in die bezahlte Ferienzeit integriert. Dem folgte die Abschaffung von allen existierenden öffentlichen Feiertage: das Ganze summierte sich auf 80 Stunden Extraarbeit auf, welche genau den von der Volksfront gewährten zwei Wochen bezahlter Ferien entsprachen.
Was die Anerkennung der Gewerkschaftsdelegierten und der Tarifverträge betrifft, symbolisierte dies nichts mehr als die Stärkung des gewerkschaftlichen Zugriffs auf die Arbeiter durch die Verstärkung ihrer Präsenz in den Fabriken. Léon Juhaux, Sozialist und Gewerkschaftsführer, erklärte diesen Zweck mit folgenden Worten: „Die Arbeiterorganisationen (d.h. die Gewerkschaften) wollen sozialen Frieden. Zum einen, um die Volksfrontregierung nicht in Verlegenheit zu bringen, und zum andern, um die Wiederaufrüstung nicht zu behindern.“ Wenn die Bourgeoisie den Krieg vorbereitet, muss der Staat die ganze Gesellschaft kontrollieren, um all ihre Energie auf dieses blutige Ziel zu konzentrieren. Und in den Fabriken sind es die Gewerkschaften, welche es dem Staat erlauben, die Arbeitskraft zu überwachen.
Wenn es einen Sieg gab, dann war es der Unheil verkündende Sieg des Kapitals, welches seine einzige „Lösung“ der Krise vorbereitet: den imperialistischen Krieg.
Vorbereitung auf den Krieg
In Frankreich wurde die Verteidigung der imperialistischen Interessen der französischen Bourgeoisie seit dem Beginn der Volksfront mit ihrer Parole „Frieden, Brot, Freiheit“ und über den Antifaschismus und den Pazifismus hinaus mit den demokratischen Illusionen vermischt. Auf diesem Hintergrund nützte die „Linke“ geschickt die Kriegsvorbereitung, die in internationalem Maßstab stattfand, aus, um zu zeigen, dass die „faschistische Gefahr vor den Türen des Landes“ stehe, indem sie zum Beispiel eine Kampagne über den italienischen Angriff auf Äthiopien vom Zaun riss. Noch offensichtlicher teilten sich die SFIO und die KP die Arbeit hinsichtlich des spanischen Bürgerkrieges: Während die SFIO die Intervention in Spanien im Namen des „Pazifismus“ ablehnte, propagierte die KP genau diese Intervention im Namen des „antifaschistischen Kampfes“.
Wenn somit das französische Kapital der Volksfrontregierung dankbar sein muss, so ist es insbesondere dafür, die Aufgabe der Kriegsvorbereitung übernommen zu haben. Sie hat dies auf dreierlei Arten bewerkstelligt:
- Zuerst einmal konnte die Linke die riesigen Arbeitermassen, die sich im Streik befanden, als Druckmittel gegen die rückständigsten Kräfte der Bourgeoisie benützen, indem sie ihnen die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des nationalen Kapitals angesichts der Krise aufzwang und dies gleichzeitig als einen Sieg der Arbeiterklasse verkaufte.
- Weiter setzte die Volksfront ein Rüstungsprogramm um, das die Verstaatlichung der Kriegsindustrie beinhaltete und über das Blum später während des Riom-Prozesses zu Protokoll geben sollte: „Ich habe ein großes Steuerpaket unterbreitet (…), das darauf abzielte, alle Kräfte der Nation auf die Rüstung zu konzentrieren, und das diese intensiven Rüstungsanstrengungen zur Bedingung selbst, zum eigentlichen Element eines endgültigen industriellen und wirtschaftlichen Aufschwungs machte. Es ließ die liberale Wirtschaftspolitik hinter sich und stellte sich auf die Ebene einer Kriegswirtschaft.“
Tatsächlich war sich die Linke des kommenden Krieges bewusst; allen voran sie drängte auf ein französisch-russisches Bündnis, sie griff die Münchener Tendenzen innerhalb der französischen Bourgeoisie aufs Schärfste an. Die „Lösungen“, die sie angesichts der Krise durchsetzt, waren nicht anders als diejenigen im faschistischen Deutschland, in den USA mit ihrem New Deal oder im stalinistischen Russland: Entwicklung des unproduktiven Sektors der Waffenindustrie. Welches auch immer die Maske war, hinter der sich das nationale Kapital versteckte, waren die ergriffenen wirtschaftlichen Maßnahmen die gleichen. Wie Bilan feststellte: „Es ist kein Zufall, dass die großen Streiks in der Metallindustrie ausbrachen und da in den Flugzeugfabriken begannen (…) es sind diese Sektoren, die heute aufgrund der im ganzen Land befolgten Rüstungspolitik voll ausgelastet sind. Dies spüren die Arbeiter und sie mussten ihre Bewegung auslösen, um den brutalen Rhythmus des Fliessbandes zu bremsen (…)“.
- Schließlich und vor allem führte die Volksfront das Proletariat auf das schlimmste Terrain, nämlich auf dasjenige seiner Niederlage und Vernichtung: des Nationalismus.
Mittels der vaterländischen Hysterie, die die Linke in der Form des Antifaschismus lostrat, wurde das Proletariat dazu gebracht, eine Fraktion der Bourgeoisie gegen die andere zu verteidigen, die demokratische gegen die faschistische, einen Staat gegen einen anderen, Frankreich gegen Deutschland. Die KPF verkündete: „Die Stunde der Umsetzung der allgemeinen Volksbewaffnung hat geschlagen, der Umsetzung der radikalsten Reformen, die eine Verzehnfachung der Kraft der militärischen und technischen Mittel des Landes erlauben werden. Die Armee des Volkes, die Armee der in Reih und Glied stehenden Arbeiter und Bauern, die wohl ausgebildet, wohl geführt werden durch der Republik treue Offiziere“. Im Namen dieses „Ideals“ feierten die „Kommunisten“ Jeanne d’Arc, „die große Befreierin Frankreichs“, rief die KP zur Bildung einer Französischen Front auf und übernahm die Losung, die noch ein paar Jahre zuvor diejenige der extremen Rechten gewesen war: „Frankreich den Franzosen!“ Unter dem Vorwand, die durch den Faschismus bedrohten demokratischen Freiheiten zu verteidigen, brachten sie die Proletarier dazu, die für die Gesundheit des französischen Kapitals nötigen Opfer zu erbringen und schließlich das eigene Leben im Gemetzel des Zweiten Weltkrieges zu opfern.
Für diese Henkersaufgabe fand die Volksfront effiziente Verbündete bei ihren Kritikern auf der Linken: der Sozialistischen Arbeiter- und Bauernpartei (PSOP) von Marceau Pivert, Trotzkisten und Anarchisten. Diese spielten die Rolle der Einpeitscher gegenüber den kämpferischsten Teilen der Arbeiterklasse und warfen sich in die Pose der „Radikaleren“, doch waren sie nur „radikaler“ in der Verblendung der Arbeiter. Die Sozialistischen Jugendorganisationen der Seine, wo die Trotzkisten eines Craipeau oder Roux Entrismus betrieben, waren die ersten, die auf antifaschistische Milizen setzten und sie organisierten, die Freunde Piverts, die dem PSOP beitraten, kritisierten am lautesten die „Feigheit“ von München. Alle waren sie einmütig in der Verteidigung der spanischen Republik, Seite an Seite mit den Antifaschisten, und alle sollten später am interimperialistischen Blutbad als Teil der Résistance teilnehmen. Alle leisteten ihren Beitrag zum Schutze des nationalen Kapitals, sie machten sich verdient um das Vaterland!
Spanien, Juli 1936: das Proletariat zur Schlachtbank geschickt
Mit der Bildung der Volksfront (Frente Popular) und ihrem Sieg in den Wahlen vom Februar 1936 brachte die Bourgeoisie das Gift der "demokratischen Revolution" in die Arbeiterklasse und es gelang ihr so, die Arbeiterklasse an die Verteidigung des "demokratischen" bürgerlichen Staates zu binden. Als unmittelbar nach den Wahlen eine neue Streikwelle ausbrach, bremsten und sabotierten sie die Linken und die Anarchisten, weil sie angeblich „Wasser auf die Mühlen der Unternehmer und der Rechten“ war. Diese Politik fand während des militärischen Putsches vom 18. Juli 1936 einen konkreten und tragischen Ausdruck. Die Arbeiter reagierten auf den Staatsstreich sofort mit Streiks, der Besetzung von Kasernen und der Entwaffnung der Soldaten, und zwar gegen die Anweisungen der Regierung, die zur Ruhe aufrief. Dort wo die Aufrufe der Regierungen befolgt wurden ("die Regierung befiehlt, die Volksfront gehorcht"), übernahm das Militär das Kommando, worauf eine blutige Unterdrückung folgte.
"Der bewaffnete Kampf an der imperialistischen Front ist das Grab des Proletariats" (Bilan Nr. 34)
Doch die Illusion der "spanischen Revolution" wurde verstärkt durch das vermeintliche „Verschwinden“ des republikanischen Kapitalistenstaates und die Nichtexistenz der Bourgeoisie, wo sich alle hinter einer „Pseudoarbeiterregierung“ und hinter „noch linkeren“ Organisationen wie dem „Zentralkomitee der Antifaschistischen Milizen“ oder dem „Zentralrat der Wirtschaft“ versteckten, welche die Illusion einer Doppelmacht aufrechterhielten. Im Namen dieses „revolutionären Wechsels“, der so leicht errungen war, verlangte und erhielt die Bourgeoisie von den Arbeitern den Burgfrieden mit dem alleinigen Ziel, Franco zu schlagen. Aber „die Alternative ist nicht diejenigen zwischen Azaña und Franco, sondern zwischen Bourgeoisie und Proletariat; ob der eine oder der andere der beiden Partner geschlagen wird, der wirkliche Verlierer ist in jedem Fall das Proletariat, das den Preis eines Sieges entweder von Azaña oder von Franco bezahlt“ (Bilan n°33, Juli-August 1936).
Sehr schnell lenkte die republikanische Regierung der Volksfront mit Hilfe der CNT (3) und des POUM (4) die Reaktion der Arbeiter auf den franquistischen Staatsstreich um auf den Weg eines antifaschistischen Kampfes. Sie manövrierte, damit der soziale, wirtschaftliche und politische Kampf gegen die gesamten Kräfte der Bourgeoisie einer militärischen Konfrontation in den Schützengräben Platz machte, die nur gegen Franco gerichtet war. Und die Bewaffnung der Arbeiter fand nur statt, damit sie an die militärische Front des „Bürgerkrieges“ ins Gemetzel geschickt werden konnten, weit weg von ihrem Klassenterrain. „Man könnte annehmen, dass die Bewaffnung der Arbeiter vom politischen Gesichtspunkt her an sich eine gute Sache ist und dass die Arbeiter, wenn sie einmal bewaffnet sind, ihre verräterischen Führer in die Wüste schicken und den Kampf auf eine höhere Stufe bringen könnten. Nichts dergleichen ist passiert. Der Volksfront ist es gelungen, die Arbeiter mit der Bourgeoisie zu verbinden, denn sie kämpfen nun unter der Führung und für den Sieg einer der bürgerlichen Fraktionen; somit berauben sich die Arbeiter der Möglichkeit, auf der Grundlage von Klassenpositionen zu wachsen“ (Bilan Nr. 33, Juli-August 1936).
Außerdem war es nicht ein „Bürgerkrieg“, sondern schnell ein ganz normaler Konflikt zwischen Imperialisten und damit eine Hauptprobe für den Zweiten Weltkrieg. Während die Demokratien und Russland sich auf die Seite der Republikaner schlugen, unterstützten Italien und Deutschland die Falangisten. „Anstelle von Klassengrenzen, die allein die Regimente Francos hätten auflösen und den durch die Rechte terrorisierten Bauern Vertrauen geben können, sind andere Grenzen gezogen worden, die wesentlich kapitalistischen, und der Burgfrieden wurde ausgerufen für das imperialistische Gemetzel, Region gegen Region, Stadt gegen Stadt in Spanien, und durch die Ausweitung Staaten gegen Staaten in den beiden Blöcken, in dem demokratischen und dem faschistischen. Dass der Weltkrieg noch nicht begonnen hat, heißt nicht, dass die Mobilisierung des spanischen und internationalen Proletariats für das gegenseitige Abschlachten unter den imperialistischen Fahnen des Faschismus und des Antifaschismus nicht bereits abgeschlossen wäre.“ (Bilan n°34, August-September 1936).
Die Fata Morgana einer „gesellschaftlichen Revolution“
Doch der Krieg in Spanien hat noch einen weiteren Mythos hervorgebracht. Indem die Volksfront den Klassenkampf des Proletariats gegen den Kapitalismus durch den Krieg zwischen „Demokratie“ und „Faschismus“ ersetzte, entstellte sie das Wesen der Revolution: Seine zentrale Zielsetzung ist nun nicht mehr die Zerstörung des bürgerlichen Staates und die Ergreifung der politischen Macht durch das Proletariat, sondern die Maßnahmen der angeblichen Sozialisierung und der Arbeiterselbstverwaltung in den Fabriken. Es sind vor allem die Anarchisten und bestimmten Tendenzen, die sich als rätistisch verstehen, welche diesen Mythos besonders pflegen und so weit gehen zu behaupten, dass in diesem republikanischen, antifaschistischen und stalinistischen Spanien die Eroberung sozialistischer Positionen weiter gegangen sei als das, was die Oktoberrevolution in Russland zustande gebracht habe.
Ohne diese Frage hier aufzurollen, muss doch gesagt werden, dass diese Maßnahmen, selbst wenn sie radikaler gewesen wären, als sie es wirklich waren, nichts an dem grundlegend konterrevolutionären Wesen des Prozesses in Spanien geändert hätten. Für die Bourgeoisie wie für das Proletariat kann der zentrale Punkt der Revolution nichts anders als die Zerstörung oder die Bewahrung des kapitalistischen Staates sein.
Es ist nicht so, dass sich der Kapitalismus bloß vorübergehend mit der Selbstverwaltung oder angeblichen Sozialisierungen (der Schaffung von Kooperativen/Genossenschaften) in der Landwirtschaft abfände, während er nur darauf wartete, sie bei der nächst besten Gelegenheit wieder rückgängig zu machen; vielmehr kann er sie durchaus zur Verschleierung und Ablenkung der proletarischen Energien einführen, damit diese sich in illusorischen Siegen verflüchtigen und das Proletariat von seinem zentralen Ziel abgebracht wird, das mit der Revolution unauflöslich verbunden ist: das der Zerstörung der kapitalistischen Herrschaft, des Staates.
Das Loblied auf die so genannten sozialen Maßnahmen als höchsten Punkt der Revolution ist nichts als Verbalradikalismus, der das Proletariat abbringen soll von seinem revolutionären Kampf gegen den Staat die Mobilisierung als Kanonenfutter im Dienste der Bourgeoisie versteckt. Nachdem das Proletariat sein Klassenterrain verlassen hatte, wurde es in die antifaschistischen Milizen der Anarchisten oder der POUM eingepackt und als Kanonenfutter ins Massaker an der Front geschickt; damit einher ging eine gnadenlose Überausbeutung in immer mehr Opfer im Namen der Produktion für den „Befreiungskrieg“, der antifaschistischen Kriegswirtschaft: Lohnsenkungen, Inflation, Rationierungen, Militarisierung der Arbeit, Verlängerung des Arbeitstages. Und als sich im Mai 1937 das Proletariat in Barcelona verzweifelt erhob, unterdrückten die Volksfront und die Generalitat von Barcelona, an der die Anarchisten aktiv teil hatten, offen den Aufstand, metzelten die Arbeiterklasse dieser Stadt nieder, während die Franquisten ihre Feindseligkeiten einstellten, um die linken Henker ihre Bluttat vollenden zu lassen.
Von den Sozialdemokraten bis zu den Linksextremen sind sich alle einig darüber (und dazu gehören selbst gewisse Fraktionen der bürgerlichen Rechten), dass die Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die Linke 1936 in Frankreich und Spanien (aber auch, obwohl zweifellos in weniger spektakulärem Maßstab, in anderen Ländern wie Schweden und Belgien) ein großer Sieg der Arbeiterklasse und ein Zeichen seiner Kampfbereitschaft und Stärke während der dreißiger Jahre gewesen sei. Gegenüber diesen ideologischen Verdrehungen müssen die Revolutionäre heute wie ihre Vorgänger von der Zeitschrift Bilan klar und deutlich den benebelnden Charakter der Volksfronten und ihrer so genannten "Sozialrevolutionen" aufzeigen. Der Einzug der Linken in die Regierung brachte damals vielmehr die Tiefe der Niederlage des Weltproletariats zum Ausdruck und ermöglichte der Bourgeoisie, die Arbeiterklasse in Frankreich und Spanien auf den imperialistischen Krieg auszurichten, den die gesamte Bourgeoisie vorbereitete, indem sie die Arbeiter massenhaft in die antifaschistische Ideologie einlullte.
„(…) Und ich dachte vor allem, dass es ein großartiges Ergebnis und ein großartiges Verdienst war, diese Massen und diese Arbeiterelite zur Liebe und zum Pflichtgefühl gegenüber dem Vaterland geführt zu haben“ (Erklärung von Blum im Riom-Prozess).
1936 ist für die Arbeiterklasse eine der finstersten Zeiten der Konterrevolution, als ihr die schlimmsten Niederlagen als Siege verkauft wurden; als die Bourgeoisie dem Proletariat, das nach der Niederlage der 1917 begonnenen revolutionären Welle noch ohnmächtig darniederlag, fast ohne Opposition ihre „Lösung“ der Krise - den Krieg aufzwingen konnte.
Jos
[i] [213] s. B. Kermoal, "Colère ouvrière à la veille du Front populaire", Le Monde diplomatique, Juni 2006, S. 28.
[ii] [213] Abkürzung für: Section Française de l’Internationale Ouvrière, Französische Sektion der Arbeiterinternationale, gemeint der II. Internationalen, die das Proletariat 1914 verriet.
[iii] [213] Die Zitate betreffend die Volksfronten stammen normalerweise aus: L. Bodin und J. Touchard, Front populaire 1936, Paris: Armand Colin, 1985.
[iv] [213] Confederación Nacional de Trabajo, anarcho-syndikalistische Zentrale.
[v] [213] Partido Obrero de Unificación Marxista, eine kleine, auf Katalonien konzentrierte Partei, die die „radikale“ extreme Linke der Sozialdemokratie darstellte. Sie war Teil des „Londoner Büros“, das international die linken sozialistischen Strömungen (die deutsche SAPD, den französischen PSOP, die britische Independent Labour Party etc.) zusammenfasste.
[vi] [213] Edouard Daladier: Führer der Radikalen Partei, ab 1924 immer wieder Minister (insbesondere zuständig für die Kolonien bzw. die Verteidigung), Regierungschef in den Jahren 1933, 1934 und 1938. In dieser Funktion unterschrieb er am 30. September 1938 das Münchner Abkommen. Pierre Cot: Er begann seine politische Laufbahn als Radikaler und beendete sie als Weggefährte der KPF. Er wurde 1933 von Daladier zum Luftfahrtminister ernannt. Léon Blum: Historischer Führer der SFIO (der sozialistischen Partei) nach der Spaltung am Kongress von Tours 1920, wo die Kommunistische Partei gegründet wurde. Marcel Cachin: Sagenumwobene Figur der KPF, Direktor der Humanité von 1918-1958. Sein Leistungsausweis spricht für sich: Während des Ersten Weltkrieges gehörte er zu den unnachgiebigen Vaterlandsverteidigern, so dass er von der französischen Regierung zu Mussolini geschickt wurde, der damals noch Sozialist war, um diesem das nötige Geld zuzustecken, das er für die Gründung der Zeitung Il popolo d’Italia brauchte, um damit Propaganda für den Kriegseintritt Italien zu treiben. 1917 wurde er nach der Februarrevolution nach Russland geschickt, um die Provisorische Regierung davon zu überzeugen, den Krieg fortzusetzen. Er rühmte sich später, dass er 1918 vor Freude geweint habe, als nach dem Sieg Frankreichs über Deutschland in Strassburg wieder die französische Fahne im Wind geflattert habe. 1920 trat er der KPF bei, wo er zusammen mit Frossard den rechten Flügel der Partei repräsentierte. Während seines ganzen Lebens zeichnete er sich durch Strebertum und Unterwürfigkeit aus, was es ihm erlaubte, alle Kursänderungen der KPF spielend mitzumachen.
[vii] [213] Dieser Plan wurde auf Vorschlag des amerikanischen Bankiers Charles Dawes im August 1924 durch die Londoner Konferenz angenommen, wo sich die Siegermächte und Deutschland versammelt hatten. Dieser Plan sah vor, Deutschland von den „Reparationszahlungen“, die es den Siegern (insbesondere Frankreich) leisten musste, zu entlasten, was ihm eine Wiederankurbelung seiner Wirtschaft und den Amerikanern Investitionen erlauben sollte.
Historische Ereignisse:
- Spanien 1936 [214]
Die Dekadenztheorie im Zentrum des historischen Materialismus (Teil 4)
- 3807 Aufrufe
Von Marx zur Kommunistischen Linken (Teil II)
Im ersten Artikel dieser Serie, den wir in der Internationalen Revue Nr. 32 veröffentlicht hatten, sahen wir, dass die Dekadenztheorie im eigentlichen Zentrum des historischen Materialismus, in Marxens und Engels‘ Analyse der Evolution der Produktionsweisen steht. Des Weiteren finden wir denselben Begriff im Mittelpunkt programmatischer Texte von Arbeiterorganisationen. Darüber hinaus beließen es diese Organisationen nicht dabei, diesen Grundstein des Marxismus einfach nur zu übernehmen, sondern entwickelten diese Analyse und/oder ihre politischen Implikationen weiter. Wir beabsichtigen hier, kurz die politischen Ausdrücke der Arbeiterbewegung Revue passieren zu lassen. In diesem Teil werden wir mit der Bewegung zu Lebzeiten von Marx, mit der Zweiten Internationale, der marxistischen Linken, die ihr entstammte, und mit der Kommunistischen Internationale zurzeit ihrer Gründung beginnen. Im nächsten Teil, der in einer späteren Ausgabe erscheinen wird, werden wir detaillierter den analytischen Rahmen für die politischen Positionen untersuchen, die von der Dritten Internationale und schließlich von den linken Fraktionen entwickelt wurden, die zu Beginn ihrer Degeneration auftauchten und von denen wir unsere politischen und organisatorischen Ursprünge beziehen.
Die Arbeiterbewegung zurzeit von Marx
Marx und Engels drückten stets sehr deutlich die Ansicht aus, dass die Perspektive einer kommunistischen Revolution von der materiellen, historischen und globalen Entwicklung des Kapitalismus abhängt. Die Auffassung, dass eine Produktionsweise nicht ihr Leben aushaucht, bevor die Produktionsverhältnisse, auf denen sie beruht, zu einem Hindernis für die Weiterentwicklung der Produktivkräfte geworden sind, war die Grundlage der gesamten politischen Aktivitäten von Marx und Engels sowie für die Erarbeitung eines jeden politischen Programms des Proletariats. Obgleich es zwei Momente gab, in denen Marx und Engels vermeinten, den Beginn der Dekadenz des Kapitalismus festgestellt zu haben[i] [215], korrigierten sie diese Einschätzung schnell und erkannten, dass der Kapitalismus immer noch ein progressives System war. Ihre Ansicht – bereits im Kommunistischen Manifest umrissen und seitdem in all ihren Werken vertieft -, dass, wenn das Proletariat in dieser Periode an die Macht käme, es seine hauptsächliche Aufgabe sein müsste, den Kapitalismus auf fortschrittlichste Art und Weise weiterzuentwickeln, statt ihn einfach zu zerstören, war ein Ausdruck dieser Analyse. Daher basierte die Praxis der Marxisten in der Zweiten Internationale völlig zu Recht auf der Erkenntnis, dass, solange der Kapitalismus eine fortschrittliche Rolle spielte, es notwendig war für die Arbeiterbewegung, bürgerliche Bewegungen zu unterstützen, die dabei helfen sollten, den historischen Boden für den Sozialismus zu bereiten. Wie das Kommunistische Manifest es nennt: „Wir sahen oben schon, dass der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist. Das Proletariat wird seine politische Herrschaft dazu benutzen, der Bourgeoisie nach und nach alles Kapital zu entreißen, alle Produktionsinstrumente in den Händen des Staats, d.h. des als herrschende Klasse organisierten Proletariats, zu zentralisieren und die Masse der Produktionskräfte möglichst rasch zu vermehren.“ Die Kommunisten „kämpfen für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse, aber sie vertreten in der gegenwärtigen Bewegung zugleich die Zukunft der Bewegung. In Frankreich schließen sich die Kommunisten an die sozialistisch-demokratische Partei an gegen die konservative und radikale Bourgeoisie, ohne darum das Recht aufzugeben, sich kritisch zu den aus der revolutionären Überlieferung herrührenden Phrasen und Illusionen zu verhalten. In der Schweiz unterstützen sie die Radikalen, ohne zu verkennen, dass diese Partei aus widerstrebenden Elementen besteht, teils aus demokratischen Sozialisten im französischen Sinn, teils aus radikalen Bourgeois. Unter den Polen unterstützen die Kommunisten die Partei, welche eine agrarische Revolution zur Bedingung der nationalen Befreiung macht, dieselbe Partei, welche die Krakauer Insurrektion von 1846 ins Leben rief. In Deutschland kämpft die Kommunistische Partei, sobald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und die Kleinbürgerei.“[ii] [215]
Parallel dazu war es für die Arbeiter notwendig, den Kampf um Reformen fortzusetzen, solange der Kapitalismus sie ermöglichte, und in diesem Kampf sollten die Kommunisten „für die Erreichung der unmittelbar vorliegenden Zwecke und Interessen der Arbeiterklasse“ (Manifest) kämpfen. Diese materialistischen Positionen wurden auch gegen die ahistorischen Rufe der Anarchisten nach sofortiger Abschaffung des Kapitalismus und gegen ihre totale Opposition gegenüber jedweder Reform vertreten.[iii] [215]
Die Zweite Internationale:Erbe von Marx und Engels
Die Zweite Internationale machte sich diese Anpassung der Arbeiterpolitik an die historische Periode noch ausdrücklicher zu Eigen, indem sie zusammen mit einem Minimalprogramm (Anerkennung der Gewerkschaften, Arbeitszeitverkürzung, etc.) auch ein Maximalprogramm, den Sozialismus, verabschiedete, das in Kraft treten sollte, sobald die unvermeidliche historische Krise des Kapitalismus in Erscheinung trat. Dies wird deutlich im Erfurter Programm, das den Sieg des Marxismus innerhalb der Sozialdemokratie konkretisierte: „So verwandelt das Privateigenthum an den Produktionsmitteln (…) für die ganze Gesellschaft sein ursprüngliches Wesen in sein Gegentheil. Aus einer Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung wird es zu einer Ursache der gesellschaftlichen Versumpfung, des gesellschaftlichen Bankerotts. (…) Sein Untergang ist gewiss. Es fragt sich nur: Soll es die Gesellschaft mit sich in den Abgrund reißen oder soll diese sich der verderblichen Bürde entledigen, um frei und neugestärkt den Weg weiter wandeln zu können, den die Gesetze der Entwicklung ihr vorschreiben? (…) Die Produktivkräfte, die sich im Schooße der kapitalistischen Gesellschaft entwickelt haben, sind unvereinbar geworden mit der Eigenthumsordnung, auf der dieselbe beruht. Diese Eigenthumsordnung aufrecht erhalten wollen, heißt jeden weiteren gesellschaftlichen Fortschritt unmöglich machen, heißt die Gesellschaft zum Stillstand, zur Verwesung verurtheilen (…) Der Untergang dieses Privateigenthums ist nur noch eine Frage der Zeit. Er kommt sicher, wenn auch Niemand mit Bestimmtheit sagen kann, wann und in welcher Weise er eintreten wird. (…) Ein Beharren in der kapitalistischen Zivilisation ist unmöglich; es heißt entweder vorwärts zum Sozialismus oder rückwärts in die Barbarei. (…) die Geschichte der Menschheit (wird) nicht durch die Ideen der Menschen, sondern durch die ökonomische Entwicklung bestimmt (…), welche unwiderstehlich fortschreitet, nach bestimmten Gesetzen, nicht nach den Wünschen und Launen der Menschen“ (aus: Das Erfurter Programm, In seinem grundsätzlichen Teil erläutert von Karl Kautsky, Stuttgart 1892, korrigiert und unterstützt von Engels.[iv] [215]
Doch für die Mehrheit der offiziellen Führung der Zweiten Internationale wurde das Minimalprogramm immer mehr zum einzig gültigen Programm der Sozialdemokratie: „Das Endziel ist nichts, die Bewegung ist alles“, wie Bernstein es formulierte. Der Sozialismus und die proletarische Revolution wurden auf Plattitüden und Moralpredigten anlässlich von 1.-Mai-Kundgebungen reduziert, während die Energie der offiziellen Bewegung immer mehr darauf gerichtet wurde, der Sozialdemokratie einen Platz innerhalb des kapitalistischen Systems zu verschaffen, zu welchem Preis auch immer. So war es unvermeidlich, dass der opportunistische Flügel der Sozialdemokratie die eigentliche Idee von der Notwendigkeit der Zerstörung des Kapitalismus abzulehnen und die Idee von einer langsamen, allmählichen Umwandlung des Kapitalismus in den Sozialismus zu vertreten begann.
Die marxistische Linke in der Zweiten Internationalen
In Reaktion auf die Ausbreitung des Opportunismus in der Zweiten Internationale tauchten in einer Reihe von Ländern linke Fraktionen auf. Sie sollten die Basis für die Bildung kommunistischer Parteien sein, die als Folge auf den Verrat am proletarischen Internationalismus durch die Sozialdemokratie bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs ins Leben traten. Diese Fraktionen nahmen unüberhörbar und entschlossen die Fackel des Marxismus und das Erbe der Zweiten Internationale auf; wobei sie gezwungen waren, dieses Vermächtnis im Angesicht neuer Herausforderungen weiterzuentwickeln, die durch die Eröffnung einer neuen Epoche des Kapitalismus, der Dekadenzperiode, entstanden waren.
Diese Strömungen erschienen zu einem Zeitpunkt, als der Kapitalismus durch die letzte Phase seines Aufstiegs ging, als die imperialistische Expansion es ermöglichte, sich eine Ahnung von den kommenden Konfrontationen zwischen den Großmächten auf Weltebene zu verschaffen, und als die Arbeiterklasse immer öfter ihr Haupt erhob (die Entwicklung von politischen Generalstreiks und vor allem der Massenstreiks in etlichen Ländern). Gegen den Opportunismus von Bernstein und Co. verteidigte der linke Flügel der Sozialdemokratie – die Bolschewiki, die holländischen Tribunisten, Rosa Luxemburg und andere Revolutionäre – all die Implikationen des Marxismus: das Verständnis der Dynamik am Ende der aufsteigenden Phase des Kapitalismus und des unvermeidlichen Bankrotts des Systems[v] [215], die Gründe der opportunistischen Abweichungen[vi] [215] und die Bekräftigung der Notwendigkeit einer gewaltsamen und endgültigen Zerstörung des Kapitalismus.[vii] [215] Unglücklicherweise wurde all diese theoretische Arbeit der linken Fraktionen nicht auf internationaler Ebene ausgeführt. All diese Fraktionen arbeiteten isoliert voneinander und mit einem unterschiedlich ausgeprägten Verständnis der gewaltigen gesellschaftlichen Konvulsionen im ersten Teil des 20. Jahrhunderts, verkörpert durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und der aufständischen Bewegungen auf internationaler Ebene. Wir maßen uns hier nicht an, all die Beiträge der linken Fraktionen zu diesen Fragen darzustellen oder zu analysieren; wir wollen uns vielmehr auf einige wenige Schlüsselpositionen der beiden Organisationen beschränken, die das Rückgrat der neuen Internationale bildeten – die Bolschewiki und die deutsche Kommunistische Partei mit ihren hervorragendsten Repräsentanten, Lenin und Rosa Luxemburg.
Auch wenn Lenin nicht die Begriffe „Aufstieg“ und „Dekadenz“ benutzte (jedoch Ausdrücke wie „die Epoche des fortschrittlichen Kapitalismus“, „einst ein Faktor des Fortschritts“, „die Epoche der fortschrittlichen Bourgeoisie“, um die Aufstiegsperiode des Kapitalismus zu charakterisieren, und: „die Epoche der reaktionären Bourgeoisie“, „der Kapitalismus ist reaktionär geworden“, „sterbender Kapitalismus“, „die Epoche eines Kapitalismus, der seinen Zenit überschritten hat“, um die Dekadenzperiode des Kapitalismus zu charakterisieren), machte er ausgiebig Gebrauch von diesem Konzept und seinen wesentlichen Auswirkungen, besonders in seiner Analyse des Charakters des Ersten Weltkriegs. So war Lenin im Gegensatz zu den Sozialchauvinisten, die, indem sie sich die Analysen von Marx in der aufsteigenden Epoche des Kapitalismus zunutze machten, damit fortfuhren, zur Unterstützung bestimmter bürgerlicher Fraktionen und ihrer nationalen Befreiungskämpfe aufzurufen, in der Lage, im Ersten Weltkrieg den Ausdruck eines Systems zu sehen, das seine historische Funktion erschöpft hat, und die Notwendigkeit zu erklären, es durch eine weltweite Revolution zu überwinden. Daher seine Charakterisierung des imperialistischen Krieges als total reaktionär und seine Betonung der Notwendigkeit, ihm den proletarischen Internationalismus und die Revolution entgegenzusetzen:
„Aus einem Befreier der Nationen, der er in der Zeit des Ringens mit dem Feudalismus war, ist der Kapitalismus in der imperialistischen Epoche zum grössten Unterdrücker der Nationen geworden. Früher fortschrittlich, ist der Kapitalismus jetzt reaktionär geworden, er hat die Produktivkräfte so weit entwickelt, dass der Menschheit entweder den Übergang zum Sozialismus oder aber ein jahre-, ja sogar jahrzehntelanger bewaffneter Kampf der „Groß“mächte um die künstliche Aufrechterhaltung des Kapitalismus mittels der Kolonien, Monopole, Privilegien und jeder Art von nationaler Unterdrückung bevorsteht.“ (W. I. Lenin: „Sozialismus und Krieg“, in: LW Bd. 21 S. 302)
„Die Epoche des kapitalistischen Imperialismus ist die des reifen und überreifen Kapitalismus, der vor dem Zusammenbruch steht, der reif ist, dem Sozialismus Platz zu machen. Die Epoche 1789 bis 1871 war die des fortschrittlichen Kapitalismus, als auf der Tagesordnung der Geschichte die Niederringung des Feudalismus, des Absolutismus, die Abschüttelung des fremden Joches stand.“ (W. I. Lenin: „Der Opportunismus und der Zusammenbruch der II. Internationalen“, in: LW Bd. 22 S. 108)
„Es sind eben der Parasitismus und die Fäulnis des Kapitalismus, die seinem höchsten geschichtlichen Stadium, d.h. dem Imperialismus, eigen sind (...) Der Imperialismus ist der Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats. Das hat sich seit 1917 im Weltmaßstab bestätigt“ (W. I. Lenin, „Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus“, in: LW Bd. 22 S. 191)
Die Haltung zu Krieg und Revolution war stets eine klare Trennungslinie innerhalb der Arbeiterbewegung gewesen. Lenins Fähigkeit, die historische Dynamik des Kapitalismus wahrzunehmen, das Ende der „Epoche des fortschrittlichen Kapitalismus“ zu erkennen, zu sehen, dass der „Kapitalismus reaktionär geworden ist“, versetzte ihn nicht nur in die Lage, den Ersten Weltkrieg klar zu charakterisieren, sondern auch das Wesen und die Bedeutung der Revolution in Russland zu erfassen. Als in diesem Land die revolutionäre Situation heranreifte, erlaubte es die Wahrnehmung der durch die neue Periode aufgezwungenen Aufgaben den Bolschewiki, gegen die mechanistischen und nationalistischen Auffassungen der Menschewiki anzukämpfen. Als Letztere versuchten, die Bedeutung der revolutionären Welle unter dem Vorwand herunterzuspielen, dass Russland viel zu unterentwickelt für den Sozialismus sei, beharrten die Bolschewiki darauf, dass der weltweite Charakter des imperialistischen Krieges enthüllt hatte, dass der Weltkapitalismus einen Punkt der Reife erreicht hat, wo die sozialistische Revolution zu einer Notwendigkeit geworden ist. Somit kämpften sie für die Machtergreifung durch die Arbeiterklasse in Russland, die sie als den Auftakt zur proletarischen Weltrevolution betrachteten.
Zu den ersten und klarsten Ausdrücken dieser Verteidigung des Marxismus gehörte die Broschüre Sozialreform oder Revolution, die 1899 von Rosa Luxemburg verfasst wurde. Auch wenn sie anerkannte, dass der Kapitalismus noch immer durch „die plötzliche Erweiterung des Gebiets der kapitalistischen Wirtschaft“ (d.h. den Imperialismus) expandierte, bestand Luxemburg darauf, dass der Kapitalismus sich unabwendbar auf seine „Senilitätskrise“ hinzubewegt, die die revolutionäre Machtergreifung durch das Proletariat notwendig macht. Darüber hinaus erkannte Luxemburg mit großem politischen Scharfsinn die neuen Erfordernisse, die sich durch den Wandel in der historischen Periode den Kämpfen und den politischen Positionen des Proletariats stellten, insbesondere bezüglich der Gewerkschaftsfrage, der parlamentarischen Taktik, der nationalen Frage und der neuen Methoden des Kampfes, die durch den Massenstreik in den Mittelpunkt rückten.[viii] [215]
Über die Gewerkschaften: „Hat die Entwicklung der Industrie ihren Höhepunkt erreicht und beginnt für das Kapital auf dem Weltmarkt der ‚absteigende Ast‘, dann wird der gewerkschaftliche Kampf doppelt schwierig (...) Der bezeichnete Gang der Dinge ist es, dessen andere Seite und Korrelat der Aufschwung des politischen und sozialen Klassenkampfes sein muss.“ (Sozialreform oder Revolution?, „Einführung des Sozialismus durch soziale Reformen“)
Über den Parlamentarismus: „Entweder Nationalversammlung oder die ganze Macht den Arbeiter- und Soldatenräten, entweder Verzicht auf den Sozialismus oder schärfster Klassenkampf im vollen Rüstzeug des Proletariats gegen die Bourgeoisie: Das ist das Dilemma. Ein idyllischer Plan dies: auf parlamentarischem Wege, durch einfachen Mehrheitsbeschluss den Sozialismus zu verwirklichen! (...) Auch der Parlamentarismus war eine Arena des Klassenkampfes für das Proletariat, solange der ruhige Alltag der bürgerlichen Gesellschaft dauerte: Er war die Tribüne, von der aus die Massen um die Fahne des Sozialismus gesammelt, für den Kampf geschult werden konnten. Heute stehen wir mitten in der proletarischen Revolution, und es gilt heute, an den Baum der kapitalistischen Ausbeutung selbst die Axt zu legen. Der bürgerliche Parlamentarismus hat, wie die bürgerliche Klassenherrschaft, deren vornehmstes politisches Ziel er ist, sein Daseinsrecht verwirkt. Jetzt tritt der Klassenkampf in seiner unverhüllten, nackten Gestalt in die Schranken. Kapital und Arbeit haben sich nichts mehr zu sagen, sie haben einander nur mit eiserner Umarmung zu packen und im Endkampf zu entscheiden, wer zu Boden geworfen wird.“ (Nationalversammlung oder Räteregierung?)
Über die nationale Frage: „5. Der Weltkrieg dient weder der nationalen Verteidigung noch wirtschaftlichen oder politischen Interessen irgendwelcher Volksmassen, er ist lediglich eine Ausgeburt imperialistischer Rivalitäten zwischen den kapitalistischen Klassen verschiedener Länder um die Weltherrschaft und das Monopol in der Aussaugung und Auspowerung der letzten Reste der noch nicht vom Kapital beherrschten Welt. In der Ära dieses entfesselten Imperialismus kann es keine nationalen Kriege mehr geben. Die nationalen Interessen dienen nur als Düpierungsmittel, um die arbeitenden Volksmassen ihrem Todfeind, dem Imperialismus, dienstbar zu machen.“ (Entwurf zu den Junius-Thesen, in: Luxemburg-Werke Bd. 4 S. 44)
Die Dekadenz des Kapitalismus im Zentrum der Analysen der Kommunistischen Internationalen
Von den revolutionären Bewegungen, die dem Ersten Weltkrieg ein Ende bereitet hatten, ins Leben gerufen, wurde die Kommunistische Internationale (KI) auf der Grundlage der Erkenntnis gegründet, dass die fortschrittliche Rolle der Bourgeoisie beendet war, wie der linke Flügel der Zweiten Internationale vorhergesagt hatte. Konfrontiert mit der Aufgabe, den Wendepunkt zu begreifen, der im Ausbruch des Weltkriegs und in den aufständischen Bewegungen auf internationaler Ebene zum Ausdruck kam, erblickten die KI und die Gruppen, aus denen sie zusammengesetzt war, in der Dekadenz mehr oder weniger den Schlüssel zu ihrem Verständnis der neuen Epoche. So wird in der Richtlinien der Kommunistischen Internationale gesagt: „Eine neue Epoche ist geboren! Die Epoche der Auflösung des Kapitalismus, seines inneren Zersetzung, die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats.“ (in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd. 1 S. 40). Dieser analytische Rahmen findet sich mehr oder weniger in allen Grundsatzerklärungen der KI[ix] [215], wie in den „Thesen zum Parlamentarismus“, die auf ihrem Zweiten Kongress verabschiedet wurden: „Der theoretische klare Kommunismus muss dagegen den Charakter der gegenwärtigen Epoche richtig einschätzen (Höhepunkt des Kapitalismus; imperialistische Selbstverneinung und Selbstvernichtung, ununterbrochenes Anwachsen des Bürgerkrieges usw.).“ (in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd. 1 S. 178)
Dieser analytische Rahmen erschien mit noch größerer Klarheit im „Bericht über die internationale Lage“, der von Trotzki verfasst und vom Dritten Kongress angenommen wurde: „Zyklische Schwankungen – sagten wir in unserem Bericht an den 3. Kongress der KI - begleiten die kapitalistische Gesellschaft in ihrer Jugend, in ihrem Erwachsensein und in ihrem Zerfall, so wie die Herzschläge den Menschen selbst auf seinem Totenbett begleiten“ (aus: Die Flut steigt, Jan. 1922, eigene Übersetzung). Was auch in den Diskussionen rund um diesen Bericht bestätigt wurde: „Wir sahen gestern im Detail, wie Genosse Trotzki – und ich denke, alle, die hier sind, stimmen mit ihm überein – auf der einen Seite das Verhältnis zwischen kurzen Krisen und kurzen Perioden zeitweiliger zyklischer Krisen und auf der anderen Seite das Problem der Krise und des Niedergangs des Kapitalismus auf der Ebene der großen historischen Epochen aufzeigt. Wir stimmen alle darin überein, dass die große aufsteigende Kurve nun unwiderstehlich in die andere Richtung gehen wird und dass in dieser Kurve weiterhin Schwankungen, ein Auf und Ab stattfinden werden.“ (Authier D., Dauve G., Ni parlement ni syndicats... les conseils ouvriers!, Edition „Les nuits rouges“ 2003, eigene Übersetzung).[x] [215] Schließlich wird dieser Rahmen noch ausdrücklicher in den „Thesen über die Taktik der Komintern“ bestätigt:
„2. Die Niedergangsperiode des Kapitalismus. Nach Abschätzung der ökonomischen Weltlage konnte der 3. Kongress mit vollkommener Bestimmtheit konstatieren, dass der Kapitalismus nach Erfüllung seiner Mission, die Entwicklung der Produktion zu fördern, in unversöhnlichen Widerspruch zu den Bedürfnissen nicht nur der gegenwärtigen historischen Entwicklung, sondern auch der elementarsten menschlichen Existenzbedingungen geraten ist. Im letzten imperialistischen Kriege spiegelte sich dieser fundamentale Widerspruch wider, der durch den Krieg noch verschärft wurde und der die Produktions- und Zirkulationsverhältnisse den schwersten Erschütterungen aussetzte. Der überlebte Kapitalismus ist in das Stadium getreten, in dem die Zerstörungsarbeit seiner zügellosen Kräfte die schöpferischen, wirtschaftlichen Errungenschaften, die das Proletariat noch in den Fesseln kapitalistischer Knechtschaft geschaffen hat, lähmt und vernichtet.“ (in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd. 2, 4. Weltkongress, S. 6)
Die Analyse der politischen Bedeutung des I. Weltkriegs
Der Ausbruch des imperialistischen Krieges 1914 markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte sowohl der Bourgeoisie als auch der Arbeiterbewegung. Das Problem der „Senilitätskrise“ des Systems war nicht mehr Gegenstand einer rein theoretischen Debatte zwischen den verschiedenen Fraktionen der Arbeiterbewegung. Die Erkenntnis, dass der Krieg eine neue Periode des Kapitalismus als historisches System eröffnet hatte, erforderte auch eine Änderung in der politischen Praxis, die die Klassengrenzen neu justierte: auf der einen Seite die Opportunisten, die sich selbst deutlich als Agenten des Kapitalismus gezeigt haben, indem sie die Revolution zugunsten der nationalen Verteidigung in einem imperialistischen Krieg „vertagten“; und auf der anderen Seite die Bolschewiki um Lenin, die Gruppe Internationale, die Bremer Linksradikalen, die holländischen Tribunisten, etc., die sich in Zimmerwald und Kienthal versammelten und bekräftigten, dass der Krieg die Ära der „Kriege und Revolutionen“ eröffnet hat und dass die einzige Alternative zur kapitalistischen Barbarei die revolutionäre Erhebung des Proletariats gegen den imperialistischen Krieg war. Unter allen Revolutionären, die an diesen Konferenzen teilnahmen, waren die Bolschewiki am klarsten in der Kriegsfrage, und diese Klarheit resultierte direkt aus der Auffassung, dass der Kapitalismus in seine Dekadenzphase getreten ist, da die „Epoche der fortschrittlichen Bourgeoisie“ abgelöst wurde durch die „Epoche der reaktionären Bourgeoisie“, wie in folgender Passage von Lenin unmissverständlich klargemacht wurde: „Die russischen Sozialchauvinisten (an ihrer Spitze Plechanow) berufen sich auf die Taktik von Marx im Kriege von 1870; die deutschen Sozialchauvinisten (vom Schlage der Lensch, David und Co.) berufen sich auf die Erklärungen von Engels im Jahre 1891, in denen er von der Pflicht der deutschen Sozialisten spricht, im Falle eines gleichzeitigen Krieges gegen Russland und Frankreich das Vaterland zu verteidigen. (…) All diese Berufungen sind eine empörende Verfälschung der Auffassungen von Marx und Engels zugunsten der Bourgeoisie und der Opportunisten (…) Wer sich jetzt auf Marx´ Stellungnahme zu den Kriegen in der Epoche der fortschrittlichen Bourgeoisie beruft und Marx´ Worte ´Die Arbeiter haben kein Vaterland´ vergisst – dies Worte, die sich gerade auf die Epoche der reaktionären, überlebten Bourgeoisie beziehen, auf die Epoche der sozialen Revolution –, der fälscht Marx schamlos und ersetzt die sozialistische Auffassung durch die bürgerliche.“ (W. I. Lenin: Sozialismus und Krieg, in LW Bd. 21 S. 309 f.)
Diese politische Analyse der historischen Bedeutung des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs bestimmte die Stellung, die von der gesamten revolutionären Bewegung eingenommen wurde, von der marxistischen Fraktion innerhalb der Zweiten Internationale[xi] [215] über die Kommunistische Internationale bis hin zu den Gruppen der Kommunistischen Linken. Exakt dies hatte Engels Ende des 19. Jahrhunderts vorhergesehen. „Friedrich Engels sagt einmal: Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein ‚Rückfall in die Barbarei‘ auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof; oder Sieg des Sozialismus, d.h. der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder – Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats. Die Zukunft der Kultur und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert mit männlichem Entschluss in die Waagschale wirft.“ (R. Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, in: Werke Bd. 4 S. 62)
Es war auch dieses Verständnis, das die revolutionären Kräfte bei der Gründung der Kommunistischen Internationale antrieb. So stellte Letztere unmissverständlich fest: „Die III. Kommunistische Internationale bildete sich beim Ausbruch des imperialistische Krieges 1914-1918, in welchem die imperialistische Bourgeoisie der verschiedenen Länder 20 Millionen Menschen opferte. `Gedenke des imperialistischen Krieges!` das ist das erste, womit sich die Kommunistischen Internationale an jeden Werktätigen wendet, wo er auch leben mag, in welcher Sprache er auch sprechen mag. Gedenke dessen, dass dank des Bestehens der kapitalistischen Ordnung ein kleines Häufchen von Imperialisten die Gelegenheit hatte, im Verlauf von vier langen Jahren die Arbeiter der verschiedenen Länder zu zwingen, einander den Hals abzuschneiden! Gedenke dessen, dass der Krieg der Bourgeoisie über Europa und die ganze Welt die fürchterlichste Hungersnot und das entsetzlichste Elend heraufbeschwor! Gedenke dessen, dass ohne den Sturz des Kapitalismus die Wiederholung von derartigen Raubkriegen nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist. (...) Die Kommunistische Internationale hält die Diktatur des Proletariats für das einzige Mittel, welches die Möglichkeit gibt, die Menschheit von den Greueln des Kapitalismus zu befreien.“ (in: Manifeste, Leitsätze, Thesen und Resolutionen, Bd. 1 S. 142)
Ja, mehr denn je müssen wir uns an die Analysen „erinnern“, die von unseren illustren Vorgängern angefertigt wurden. Wir müssen all dies umso nachdrücklicher bekräftigen, wenn parasitäre Grüppchen versuchen, sie als „bürgerlichen Moralismus und Humanismus“ abzutun, indem sie den imperialistischen Krieg und den Genozid bagatellisieren. Unter dem Vorwand einer Kritik an der Dekadenztheorie greifen solche Gruppen in Wahrheit die fundamentalsten Errungenschaften der Arbeiterbewegung an: „Um zum Beispiel zu demonstrieren, dass sich die kapitalistische Produktionsweise in der Dekadenz befindet, bekräftigt Sander, dass ihr Kennzeichen der Völkermord ist und dass mehr als drei Viertel aller Kriegstoten in den letzten 500 Jahren auf das 20. Jahrhundert fielen. Diese Art von Argumentation kommt auch im Denken des Tausendjährigen Reiches vor. Für die Zeugen Jehovas war der Erste Weltkrieg wegen seiner Erhabenheit und Intensität ein Wendepunkt in der Geschichte. Ihnen zufolge war die Zahl der Toten während des Ersten Weltkriegs ‚siebenmal höher als alle 901 vorhergehenden Kriege in den 2400 Jahren vor 1914‘. Gemäß einem polemischen Werk von Ruth Leger Sivard, das 1996 veröffentlicht wurde, hinterließ das Jahrhundert rund 110 Millionen Tote in 250 Kriegen. Wenn wir diese Zahl bis zum Ende des Jahrhunderts hochrechnen, werden es 120 Millionen sein, sechsmal mehr als im 19. Jahrhundert. Wenn wir diese Zahl zum Bevölkerungswachstum ins Verhältnis setzen, sind es nur noch zweimal soviel (...) Selbst dann bleiben die Auswirkungen der Kriege zweitrangig gegenüber jenen von Fliegen und Mücken (...) Nicht indem man sich hinter Konzepte schart, die zum bürgerlichen Gesetz gehören (wie der Völkermord), gestaltet von der demokratischen Ideologie und den Menschenrechten im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, werden wir den Materialismus nach vorn bringen; schon gar nicht werden wir unser Verständnis über die Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise vergrößern.“ (Robin Goodfellow, „Comrade, one more effort to no longer be revolutionary“, eigene Übersetzung)
Die Verheerungen des imperialistischen Krieges als etwas darzustellen, das „zweitrangig gegenüber den Auswirkungen von Fliegen und Mücken“ ist, heißt auf die Millionen von Proletariern, die auf den Schlachtfeldern niedergemetzelt wurden, und auf die Tausenden von Revolutionären zu spucken, die ihr Leben geopfert haben, um dem mörderischen Arm der Bourgeoisie Einhalt zu gebieten und den Ausbruch der revolutionären Bewegungen zu forcieren. Es ist eine skandalöse Beleidigung von Generationen von Kommunisten, die mit aller Macht darum kämpften, die imperialistischen Kriege anzuprangern. Der Vergleich der Analysen, die uns von Marx, Engels und all unseren Vorgängern aus der Kommunistischen Internationale und der Kommunistischen Linken hinterlassen wurden, mit den Zeugen Jehovas und mit dem bürgerlichen Moralismus ist wirklich irrsinnig. Angesichts solcher Verunglimpfungen stimmen wir mit Rosa Luxemburg überein, die argumentierte, dass die Empörung des Proletariats eine revolutionäre Kraft ist!
Für diese parasitären Elemente sind die gesamte Dritte Internationale, Lenin, Trotzki, Bordiga einem beklagenswerten Irrtum aufgesessen und haben dummerweise den Ersten Weltkrieg, den die KI-Plattform das „größte aller Verbrechen“ nannte, mit etwas verwechselt, dessen Auswirkungen „zweitrangig gegenüber denen von Fliegen und Mücken“ waren. All die Revolutionäre, die annahmen, dass der imperialistische Krieg die gigantischste Katastrophe für das Proletariat ist – „Die Katastrophe des imperialistischen Krieges hat alle Eroberungen des gewerkschaftlichen und parlamentarischen Kampfes weggefegt“ (Manifest der Komintern) –, hätten den größten aller Fehler begangen: Sie haben den Ersten Weltkrieg als Eröffnung der Niedergangsepoche des Kapitalismus theoretisiert. Sie haben tollkühn behauptet, dass „der Kapitalismus nach Erfüllung seiner Mission, die Entwicklung der Produktion zu fördern, in unversöhnlichen Widerspruch zu den Bedürfnissen nicht nur der gegenwärtigen historischen Entwicklung, sondern auch der elementarsten menschlichen Existenzbedingungen geraten ist. Im letzten imperialistischen Kriege spiegelte sich dieser fundamentale Widerspruch wider, der durch den Krieg noch verschärft wurde und der die Produktions- und Zirkulationsverhältnisse den schwersten Erschütterungen aussetzte.“ (Thesen über die Taktik der Komintern, 4. Weltkongress, a.a.O.)
Die hochnäsige Geringschätzung der Errungenschaften der Arbeiterbewegung, die mit dem Blut unserer Klassenbrüder erkauft wurden, durch diese Parasiten wird nur von der Geringschätzung, die die Bourgeoisie gegenüber dem Elend der Arbeiter zeigt, und vom seelenlosen Zynismus erreicht, den diese Klasse an den Tag legt, wenn sie ihre brutalen Statistiken benutzt, um die „Errungenschaften“ des Kapitalismus aufzuzeigen. In Anlehnung an den berühmten Satz von Marx gegenüber Proudhon über das Elend könnte man sagen, dass diese Parasiten in den Zahlen nichts als Zahlen, und nicht die darin enthaltene gesellschaftliche und revolutionäre Bedeutung sehen.[xii] [215] Alle Revolutionäre jener Periode hatten den qualitativen Unterschied begriffen, die ganze gesellschaftliche und politische Bedeutung dieses Massenuntergangs der „Kerntruppen des internationalen Proletariats“: „Aber das heutige Wüten der imperialistischen Bestialität in den Fluren Europas hat noch eine Wirkung, für welche die ‚Kulturwelt‘ (und die heutigen Parasiten) kein entsetztes Auge, kein schmerzzuckendes Herz hat: Das ist der Massenuntergang des europäischen Proletariats. Nie hat ein Krieg in diesem Maße ganze Volksschichten ausgerottet (...) Es sind die besten, intelligentesten, geschultesten Kräfte des internationalen Sozialismus, die Träger der heiligsten Traditionen und des kühnsten Heldentums, der modernen Arbeiterbewegung, die Vordertruppen des gesamten Weltproletariats: die Arbeiter Englands, Frankreichs, Belgiens, Deutschlands, Russlands, die jetzt zuhauf niedergeknebelt, niedergemetzelt werden (...) Hier enthüllt der Kapitalismus seinen Totenschädel, hier verrät er, dass sein historisches Daseinsrecht verwirkt, seine weitere Herrschaft mit dem Fortschritt der Menschheit nicht mehr vereinbar ist.“ (R. Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, in Werke Bd. 4, S. 162 f.)[xiii] [215]
C. Mcl.
[i] [215] Für weitere Details siehe den ersten Artikel dieser Serie in Internationale Revue Nr. 32.
[ii] [215] Leider wurde diese Sichtweise, die Marx sehr richtig in dieser Epoche zum Ausdruck gebracht hatte, in der Epoche der Dekadenz als reaktionäre Konfusion benutzt, indem die Maßnahmen, die im Kommunistischen Manifest befürwortet worden waren, weiterhin gepredigt wurden, so als seien sie in der gegenwärtigen Periode noch geeignet.
[iii] [215] Diese scheinbar ultrarevolutionären Positionen waren in Wahrheit der Ausdruck eines kleinbürgerlichen Wunsches nach Abschaffung des Kapitalismus und der Lohnarbeit, nicht indem man sich in Richtung ihrer historischen Überwindung bewegt, sondern indem man sich in eine Welt unabhängiger Kleinproduzenten zurückzieht.
[iv] [215] Der erste Artikel in dieser Reihe hat bereits mit Hilfe einer Reihe von Zitaten aus ihrem gesamten Werk deutlich gemacht, dass das Konzept der Dekadenz wie auch der Begriff selbst ihren Ursprung in den Schriften von Marx und Engels haben und den Mittelpunkt des historischen Materialismus, des Verständnisses der Aufeinanderfolge von Produktionsweisen bildeten. Dies weist eindeutig die verrückte Behauptung der akademischen Zeitschrift Aufheben zurück, dass „die Theorie des kapitalistischen Niedergangs erstmals in der Zweiten Internationale auftauchte“ (s. die Serie „Über die Dekadenz: Theorie des Niedergangs oder Niedergang der Theorie“ in Aufheben Nr. 2, 3 und 4, eigene Übersetzung). Doch auch die Erkenntnis, dass die Dekadenztheorie in der Tat ein Kernbereich im marxistischen Programm der Zweiten Internationale war, überführt allein die absurden Behauptungen der Lüge, die der Chor der parasitären Gruppen anstimmt. So tauchte für die IFIKS diese Theorie zuerst Ende des 19. Jahrhunderts auf. „Wir haben den Ursprung des Begriffs der Dekadenz in den Debatten rund um den Imperialismus und der historischen Alternative zwischen Krieg und Revolution gezeigt, die am Ende des 19. Jahrhunderts angesichts der tiefen Umwälzungen, durch die der Kapitalismus ging, stattfand.“ Für die RIMC (Revue Internationale du Mouvement Communiste) wurde er laut ihrem Artikel „Die Dialektik der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse in der kommunistischen Theorie“ nach dem Ersten Weltkrieg in die Welt gesetzt: „Ziel dieses Werks ist es, eine globale und definitive Kritik an dem Konzept der ‚Dekadenz‘ zu üben, das die kommunistische Theorie vergiftet hat und eine der Hauptabweichungen war, die in der Nachkriegszeit in die Welt gesetzt wurde und aufgrund ihres total ideologischen Charakters jeglicher wissenschaftlichen Arbeit zur Restaurierung der kommunistischen Theorie im Weg stand.“ Und für Internationalist Perspective („Auf zu einer neuen Theorie der Dekadenz des Kapitalismus“) war es schließlich Trotzki, der das Konzept erfand: „Das Konzept der Dekadenz des Kapitalismus entstand in der Dritten Internationale und wurde insbesondere von Trotzki entwickelt.“ Das einzige, was diese Gruppen gemeinsam haben, ist die Kritik an unserer Organisation und insbesondere an unserer Dekadenztheorie. Doch in Wahrheit weiß keine von ihnen wirklich, worüber sie spricht.
[v] [215] Was zum Beispiel von Lenin in Der Imperialismus, die höchste Stufe des Kapitalismus oder von Rosa Luxemburg in Die Akkumulation des Kapitals getan wurde.
[vi] [215] Was wiederum von Luxemburg in Sozialreform oder Revolution und später von Lenin in Die proletarische Revolution und der Renegat Kautsky getan wurde.
[vii] [215] Auch hier waren Lenin und Luxemburg tätig, in Staat und Revolution und Was will der Spartakusbund?
[viii] [215] siehe ihr Buch Der Massenstreik, die Partei und die Gewerkschaften.
[ix] [215] Wir werden diese Idee im dritten Teil dieses Artikels noch anschaulicher machen.
[x] [215] Diese Passage ist ein Ausdruck aus einer Intervention von Alexander Schwab, einem KAPD-Delegierten auf dem 3. Kongress der KI, in der Diskussion über Trotzkis Bericht über die weltwirtschaftliche Lage („Thesen zur Weltlage und zu den Aufgaben der Kommunistischen Internationalen“). Sie gewährt einen guten Einblick in den Tenor, die Richtung und vor allem den konzeptionellen Rahmen dieses Berichts und der Diskussionen in der KI rund um den Begriff des Aufstiegs und Niedergangs des Kapitalismus auf der Ebene der „großen historischen Epochen“.
[xi] [215] „Eines ist sicher: Der Weltkrieg ist eine Weltwende. Es ist ein törichter Wahn, sich die Dinge so vorzustellen, dass wir den Krieg nur zu überdauern brauchen, wie der Hase unter dem Strauch das Ende des Gewitters abwartet, um nachher munter wieder in den alten Trott zu verfallen. Der Weltkrieg hat die Bedingungen unseres Kampfes verändert und uns selbst am meisten.“ (R. Luxemburg, Die Krise der Sozialdemokratie, in Werke Bd. 4 S. 56)
[xii] [215] Selbst auf der Zahlenebene sind unsere Zensoren immer noch gezwungen, gemäß ihren weisen Kalkulationen anzuerkennen, dass in der Dekadenz doppelt so viele Menschen starben wie in der Epoche des Aufstiegs.
[xiii] [215] Wenn wir uns überhaupt mit solchen Beleidigungen auseinandersetzen, dann nicht nur, um sie zu stigmatisieren und die theoretischen Errungenschaften aller Generationen von Proletariern und Revolutionären zu verteidigen, sondern auch um das kleine Milieu der Parasiten deutlich zu brandmarken, das diese Art von Prosa kultiviert und verbreitet. Wir haben es hier mit einem von vielen Beispielen ihres vollkommen parasitären Charakters zu tun: Ihre Rolle ist es, die Errungenschaften der Kommunistischen Linken zu zerstören, das proletarische Milieu kaputt zu machen und insbesondere die IKS zu diskreditieren.
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken (1976 – 1980)
- 2901 Aufrufe
Lehren aus einer Erfahrung für das proletarische Milieu
Vor 25 Jahren endete der Zyklus der internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken in Chaos und Durcheinander, die auf Initiative der Internationalistischen Kommunistische Partei (PC Int. Battaglia Communista) hin einige Jahre zuvor stattgefunden hatten, in Folge eines von Battaglia Communista und der Communist Workers' Organisation gestellten Antrages über die Parteifrage. Dieser Antrag hatte das Ziel, die IKS wegen ihrer angeblichen "spontaneistischen" Haltung zur Organisationsfrage auszuschließen. Diese Konferenzen sind von der IKS als einen positiven Schritt begrüßt worden, um aus der Zersplitterung und den Missverständnissen unter den Gruppen herauszukommen, die das internationale proletarische Milieu geplagt hatten. Sie stellen jetzt noch eine wertvolle Erfahrung dar, aus welcher die heute entstehende neue Generation von Revolutionären viele Lehren ziehen kann. Es ist wichtig für diese neue Generation, sich die Debatten, die an den Konferenzen und um diese stattfanden, wieder anzueignen. Dennoch können wir die negativen Auswirkungen der Art und Weise, wie sie endeten, nicht ignorieren. Ein kurzer Blick auf den jämmerlichen Zustand des politischen proletarischen Milieus heute zeigt, dass wir immer noch unter den Folgen des Scheiterns des Versuchs leiden, einen organisierten Rahmen für eine brüderliche Debatte und eine politische Klärung unter den Gruppen zu schaffen, die der Tradition der Kommunistischen Linken angehören.
Angesichts des Techtelmechtels des IBRP mit dem parasitären, selbsternannten Grüppchen "Interne Fraktion der IKS" (FICCI) und dem Abenteurer, der sich hinter dem "Circulo de Comunistas Internacionalistas" in Argentinien verbirgt, sind die Beziehungen zwischen dem IBPR und der IKS noch nie so schlecht gewesen wie heute. Entweder begnügen sich die Gruppen bordigistischer Tradition im sektiererischen Alleinsein des Elfenbeinturms, in dem sie Ende der 70er Jahre vor den Konferenzen Schutz gesucht haben, oder sie haben sich – so z.B. Le Prolétaire - wie das IBRP für die Verführungsspielchen und Schmeicheleien der FICCI empfänglich gezeigt. Jedenfalls haben sich die Bordigisten von der traumatischen Krise des Jahres 1981, aus der sie in Bezug auf ihre wichtigsten Schwächen nur wenig Lehren gezogen haben, noch nicht erholt. Was die letzten Erben der deutsch/holländischen Linken angeht, so sind sie inzwischen praktisch verschwunden. So steht es heute mit den Gruppen der Kommunistischen Linken - und dies gerade jetzt, wo eine neue Generation von Leuten auf der Suche nach einer richtungweisenden Antwort auf ihre Fragen sich der organisierten kommunistischen Bewegung nähert, und das auch zu einem Zeitpunkt, an dem historisch so viel auf dem Spiel steht wie nie zuvor.
Als Battaglia den Beschluss fasste, die Teilnahme der IKS an den Konferenzen zu sabotieren, behauptete sie "die Verantwortung, die man von einer seriösen Führungskraft zu erwarten berechtigt ist", übernommen zu haben (Antwort auf die Adresse der IKS an das Proletarische Milieu 1983). Indem wir auf die Geschichte dieser Konferenzen zurückkommen, wollen wir unter anderem die Verantwortung aufzeigen, die diese Gruppe für die Desorganisierung der Kommunistischen Linken trägt.
Wir werden kein ausführliches Protokoll der Diskussionen, die in und um die Konferenzen stattgefunden haben, liefern. Die Leser können verschiedene Publikationen nachschlagen, die die Texte und Protokolle dieser Konferenzen beinhalten, obwohl diese nur noch selten zu finden sind (in diesem Sinne sind alle Hilfsangebote, diese Publikation online zur Verfügung zu stellen, willkommen). Der Zweck dieses Artikels ist vielmehr, die wesentlichen Themen zusammenzufassen, die in diesen Konferenzen behandelt wurden, und vor allem die wichtigsten Gründe ihres Scheiterns zu untersuchen.
Der Kontext der internationalen Konferenzen: das Ende einer langen Zeit der Zersplitterung
Die Zersplitterung der Kräfte der Kommunistischen Linken war 1976 keine neue Erscheinung. Die Kommunistische Linke hat ihren Ursprung in den linken Fraktionen der Zweiten Internationale, die den Kampf gegen den Opportunismus ab dem Ende des 19. Jahrhunderts geführt haben. Schon dieser Kampf war zersplittert geführt worden.
Als z.B. Lenin den Kampf gegen den menschewistischen Opportunismus in der russischen Partei aufnahm, war die erste Reaktion Rosa Luxemburgs, sich auf die Seite der Menschewiki zu stellen. Als Luxemburg die wirkliche Bedeutung der Kapitulation Kautskys begriff, brauchte Lenin länger, um zu realisieren, dass sie recht hatte. Das alles kam daher, dass die Parteien der Zweiten Internationale auf einer nationalen Grundlage entstanden waren und fast alle ihre Arbeit auf nationaler Arbeit führten; die Internationale war eher ein Zusammenschluss nationaler Parteien als eine vereinigte Weltpartei. Auch wenn die Kommunistische Internationale (KI) sich verpflichtete, diese nationalen Besonderheiten zu überwinden, behielten diese ein sehr großes Gewicht. Es gibt keinen Zweifel, dass die linken kommunistischen Fraktionen, die gegen die Degenerierung der KI Anfang der 20er Jahre zu reagieren begannen, von dem Gewicht der Vergangenheit auch beeinträchtigt waren; die Linke antwortete abermals alles andere als einheitlich auf das Anwachsen des Opportunismus innerhalb der proletarischen Internationale. Der gefährlichste und schädlichste Ausdruck dieser Zerstreuung war der Graben, der die Deutsche und die Italienische Linke fast von Anfang an ab den 20er Jahren voneinander trennte. Bordiga neigte dazu, die Bedeutung, die die deutsche Linke der entscheidenden Rolle der Arbeiterräte beimaß, der "Verherrlichung der Fabrikräte" durch Gramsci gleichzusetzen; die deutsche Linke wiederum vermochte nicht wirklich in der italienischen "leninistischen" Linken einen möglichen Verbündeten gegen die Degenerierung der KI zu erkennen.
Die Konterrevolution, die die Arbeiterbewegung Ende der 20er Jahre mit voller Wucht traf, hat zur weiteren Zersplitterung der Linken beigetragen, obwohl die Italienische Fraktion diese Tendenz mit aller Kraft bekämpfte, indem sie eine Diskussion und eine internationale Zusammenarbeit auf der Basis von Prinzipien zu etablieren versuchte. So veröffentlichte sie in ihrer Presse die Debatten mit den holländischen Internationalisten, den Dissidenten-Gruppen der Linksopposition und anderen. Die geistige Offenheit, die bei Bilan (Presseorgan der Italienischen Fraktion) vorhanden war – neben anderen allgemeineren programmatischen Vorstößen der Fraktion – wurde durch die opportunistische Gründung der Internationalistischen Kommunistischen Partei am Ende der Krieges weggefegt. Dem nationalen Kleingeist zu einem guten Stück unterworfen, beeilte sich die Mehrheit der Italienischen Fraktion, die Bildung einer neuen Partei (nur in Italien!) zu begrüßen, worauf die Fraktion sich auflöste und ihre Mitglieder einzeln der Partei beitraten. Der voreilige Zusammenschluss verschiedener, sehr heterogener Kräfte hat nicht zu der Verfestigung der Einheit der Strömung der italienischen Linken geführt, sondern hat neue Spaltungen verursacht. Dies schon 1945 mit der französischen Fraktion, deren Mehrheit sich gegen die Auflösung der Italienischen Fraktion ausgesprochen hatte und die opportunistischen Grundlagen der neuen Partei kritisierte. Die Französische Fraktion wurde ohne Rücksicht aus der internationalen Organisation des PCI (der Internationalen Kommunistischen Linken) ausgeschlossen und gründete dann die Kommunistische Linke Frankreichs. 1952 erlitt die Partei selbst eine große Spaltung zwischen ihren zwei Hauptflügeln – den "Damenisten" um Battaglia Communista und den "Bordigisten" um Programma Communista; diese entwickelten insbesondere eine theoretische Rechtfertigung des strengsten Sektierertums, indem sie sich für die einzige proletarische Partei des Planeten hielten (was andere Spaltungen sowie die Koexistenz verschiedener "einzig wahrer" Internationaler Kommunistischer Partei in den 70er Jahren nicht verhinderte).
Dieses Sektierertum war ohne Zweifel ein Tribut an die Konterrevolution. Einerseits war es der Ausdruck des Versuchs, in einer feindlichen Umwelt die Prinzipien zu bewahren, indem eine Mauer "invarianter" (unveränderlicher) Formeln um schwer errungene Grundsätze errichtet wurde. Andererseits war es Ausdruck der zunehmenden Absonderung der Revolutionäre von der gesamten Arbeiterklasse und ihres Zirkelgeistes. Ihre Neigung, in der eigenen Welt kleiner Gruppen zu leben, konnte den Zirkelgeist und – wie bei Sekten – die Diskrepanz zu den wirklichen Bedürfnissen der proletarischen Bewegung nur begünstigen.
Nach 40 Jahren Konterrevolution – am tiefsten Punkt der Schwäche des internationalen revolutionären Milieus - begann sich das soziale Klima zu verändern. Das Proletariat erschien wieder auf der historischen Bühne mit den Streiks im Mai 68. Diese Bewegung besaß eine unermesslich tiefe politische Dimension, denn sie stellte die Frage nach der Errichtung einer neuen Gesellschaft und hatte eine Vielzahl von Gruppen entstehen lassen, deren Suche nach revolutionärer Kohärenz sie naturgemäß zu einer Wiederaneignung der Traditionen der Kommunistischen Linken führte. Unter den ersten, die die Veränderung der Lage erkannten, befanden sich die Genossen der alten Kommunistischen Linken Frankreichs, die mit einigen jungen Interessierten eine politische Aktivität in Venezuela wiederaufgenommen und 1964 die Gruppe Internacionalismo gegründet hatten. Nach den Ereignissen vom Mai 1968 reisten Genossen von Internacionalismo nach Europa, um in das neue, von dieser starken Bewegung erzeugte proletarische Milieu zu intervenieren. Diese Genossen ermunterten insbesondere die alten Gruppen der Italienischen Linken, die den Vorteil hatten, über eine Presse und eine strukturierte Organisationsform zu verfügen, dazu, durch die Einberufung einer internationalen Konferenz als Zentrum der Debatte und des Kontaktes für die neuen suchenden Elemente zu fungieren. Sie bekamen eine eisige Antwort, denn die zwei Flügel der Italienischen Linken sahen im Mai 68 (und sogar im Heißen Herbst in Italien) nicht viel mehr als eine Welle studentischer Aufruhr.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, die italienischen Gruppen von ihrer Verantwortung zu überzeugen (vgl. den Brief der IKS an Battaglia in der Broschüre Dritte Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken, Mai 1980, Protokoll), konzentrierten die Genossen von Internacionalismo und der neu gegründeten Gruppe Révolution Internationale ihre Bemühungen auf die Umgruppierung der neuen Elemente, die dank des Wiedererstarkens des Proletariats auf der sozialen Bühne politisiert wurden. 1968 kamen zwei Gruppen in Frankreich - Cahiers du Communisme de Conseils und die Rätistische Organisation von Clermont-Ferrand – mit der Gruppe Révolution Internationale zusammen und gründeten die Zeitung RI "neue Serie", die mit Internacionalismo und Internationalism (USA) eine internationale Tendenz bildeten. 1972 schlug Internationalism die Bildung eines internationalen Korrespondenznetzes vor. Erneut hielten sich die italienischen Gruppen von dieser Entwicklung fern. Diese führte zu positiven Ergebnissen – insbesondere zu einer Reihe von Konferenzen 1973-74, an der Révolution Internationale sowie einige neue Gruppen aus England teilnahmen. Eine von ihnen – World Revolution – schloss sich der internationalen Tendenz an, die 1975 zur Bildung der IKS führen sollte (damals aus 6 Gruppen bestehend: Révolution Internationale in Frankreich ; Internationalism USA ; World Revolution England ; Internacionalismo Venezuela ; Accion Proletaria Spanien und Rivoluzione Internazionale Italien).
Erste Konferenz: Mailand 1977
Der Zyklus internationaler Konferenzen wurde 1976 eröffnet, als Battaglia Communista endlich ihre Isolation in Italien beendete und einigen Gruppen der Welt ein internationales Treffen vorschlug.
Die Gruppen waren die folgenden:
Frankreich: Révolution Internationale, Pour une Intervention Communiste, Union Ouvrière, Combat Communiste;
England: Communist Workers’ Organisation, World Revolution;
Spanien: Fomento Obrero Revolucionario (FOR);
USA: Revolutionary Workers' Group;
Japan: Japan Revolutionary Communist League, Revolutionary Marxist Fraction (Kahumaru-Ha) ;
Schweden: Forbundet Arbetarmakt (Workers' Power League);
Portugal: Combate.
Das Vorwort zur Broschüre „Texte und Protokolle der von der Internationalistischen Kommunistischen Partei (Battaglia Communista) organisierten internationalen Konferenz“ bemerkt: „Durch die Auflösung von Union Ouvrière und der RWG und den Abbruch der Kontakte mit Combat Communiste, dessen politische Prinzipien sich mit den Themen der Konferenz als unvereinbar herausstellten, fand sehr schnell eine „natürliche Auslese“ statt. Die Kontakte mit der portugiesischen Gruppe wurden nach einer Zusammenkunft zwischen ihren Vertretern und einem Gesandten der PCInt in Lissabon im Übrigen unterbrochen, als die Entfernung dieser Gruppe von den Grundauffassungen der kommunistischen Bewegung festgestellt wurde. Die japanische Organisation hat nie geantwortet, was vermuten lässt, dass sie die „Adresse“ der PCInt nicht bekommen haben.“
Die schwedische Gruppe zeigte Interesse, konnte aber nicht teilnehmen.
Es war ein wichtiger Schritt, den Battaglia da tat – die Anerkennung der überaus großen Wichtigkeit nicht von internationalen Verbindungen (wie jede linke Gruppe es auch befürwortet), sondern der internationalistischen Aufgabe, die Spaltungen in der weltweiten revolutionären Bewegung zu überwinden und auf eine Zentralisierung und letztendlich Umgruppierung hinzuarbeiten. Die IKS hat die Initiative von Battaglia Communista als einen Schlag gegen Sektierertum und Zersplitterung wärmstens begrüßt. Ihr Beschluss an dieser Initiative teilzunehmen hatte zudem eine heilsame Wirkung auf ihr eigenes politisches Leben, denn keine Gruppe ist gänzlich vor der schädlichen Neigung gefeit, sich als die „einzige und alleinige“ revolutionäre Gruppe zu betrachten. In Folge von Fragestellungen, die innerhalb der IKS über das proletarische Wesen der aus der Italienischen Linken stammenden Gruppen entstanden waren, entwickelte sich eine Diskussion über die Kriterien zur Beurteilung der Klassenzugehörigkeit politischer Organisationen. Eine Resolution über die proletarischen politischen Gruppen wurde infolgedessen beim Internationalen Kongress der IKS 1977 verabschiedet.
Gewichtige Schwächen gab es dennoch im Vorschlag Battaglias und bei der dann stattfindenden Konferenz in Mailand im April/Mai 1977. Erstens fehlten in dem Vorschlag von Battaglia klare Kriterien für die Teilnahme. Mit etwas zeitlichem Abstand betrachtet war der ursprünglich angegebene Grund für den Aufruf zur Konferenz vollkommen richtig: die Annahme des „Eurokommunismus“ durch die wichtigsten westeuropäischen Kommunistischen Parteien. Die Schlussfolgerungen einer Diskussion über das, was Battaglia die „Sozialdemokratisierung“ der KP’s nannte, waren nicht klar. Noch wichtiger war aber die Tatsache, dass der Aufruf die wesentlichen Klassenpositionen, die gewährleisten, dass jede Zusammenkunft proletarischer Gruppen den linken Flügel des Kapitals ausschließt, keineswegs definierte. Die Verschwommenheit in dieser Frage war nicht neu für Battaglia, die in der Vergangenheit bereits zu einer internationalen Konferenz mit der Teilnahme der Trotzkisten von Lutte Ouvrière aufgerufen hatte. Diesmal beinhaltete die Liste der eingeladenen Gruppen auch radikale Linke wie die japanische Gruppe oder Combat Communiste. Die IKS betonte also die Notwendigkeit, dass die Konferenz ein Minimum an grundsätzlichen Prinzipien annimmt, die sowohl die Linkskapitalisten ausschließt, als auch diejenigen, die – auch wenn sie eine gewisse Anzahl an Klassengrundsätzen verteidigen – die Idee einer Klassenpartei ablehnen. Das Ziel der Konferenz wurde also begriffen als Teil eines langfristigen Prozesses hin zu der Bildung einer neuen weltweiten Partei.
Ebenfalls wandte sich die Konferenz direkt gegen das Sektierertum, das die Bewegung beherrschte. Battaglia schien sich z.B. als alleinige Vertreterin der „Italienischen Linken“ zu betrachten und hatte demnach keine einzige andere bordigistische Gruppe zur Konferenz eingeladen. Diese Vorgehensweise spiegelte sich auch darin wider, dass der Aufruf nicht an die IKS gerichtet war (die schon eine Sektion in Italien hatte), sondern nur an einige territoriale Sektionen der IKS. Dann gab es die plötzliche Bekanntgabe der Gruppe Pour une Intervention Communiste, nicht teilzunehmen, obwohl sie anfänglich dazu bereit gewesen war. In einem Schreiben vom 25.04.1977 behauptet sie, diese Zusammenkunft würde zu keinem Dialog führen. Letztendlich zeigte sich in der Konferenz etwas, das sich später zu einem massiven Problem entwickeln sollte: die Unfähigkeit der Konferenzen, irgendeine gemeinsame Stellungnahme zu verabschieden. Am Ende des Treffens schlug die IKS ein kurzes Statement vor, das die Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten, die sich in der Diskussion herausgestellt hatten, klarstellen sollte. Das war für Battaglia schon zu viel. Obwohl diese Gruppe für die Konferenz großartige Ziele hatte: „die Grundzüge einer Plattform grundsätzlicher Prinzipien, um eine gemeinsame Arbeit beginnen zu können; ein internationales Koordinationsbüro“ (dritter Rundbrief des PCInt., Februar 1977), wurde schon vor den allerersten Schritten in diese Richtung die Initiative Battaglias gebremst bei dem Gedanken daran, mit der IKS die noch so bescheidene Zusammenfassung der Übereinstimmungen und Unterschiede zu unterschreiben. Die einzigen Gruppen, die in der Lage waren, an der Konferenz teilzunehmen, waren in der Tat Battaglia und die IKS. Die Communist Workers' Organisation war einverstanden zu kommen, konnte aber aus praktischen Gründen doch nicht teilnehmen – dies war dennoch ein großer Schritt, da sie bislang jeglichen Kontakt mit der IKS, die sie wegen ihrer Analyse des Niedergangs der Russischen Revolution als „konterrevolutionär“ bezeichnete, abgebrochen hatte. Auch die um Munis in Spanien und Frankreich gegründete Gruppe FOR konnte nicht teilnehmen. Die Diskussion hatte trotz allem viele Punkte behandelt und eine Reihe von entscheidenden Fragen erörtert, die in der von der IKS vorgeschlagenen gemeinsamen Stellungnahme zusammengefasst sind. Die Diskussion hatte folgendes hervorgehoben:
Einverständnis über die Tatsache, dass der Kapitalismus in seine Dekadenzphase eingetreten ist, obwohl Differenzen in den Analysen der Ursachen dieser Dekadenz bestehen: die IKS verteidigte die These Rosa Luxemburgs, wonach der Hauptwiderspruch des Kapitalismus in seiner Niedergangsphase die Frage der Realisierung des Mehrwerts ist, während für Battaglia dieser Faktor gegenüber der Senkung der Profitrate zweitrangig ist.
Einverständnis über den Beginn einer neuen Phase akuter ökonomischer Krise.
Kein Einverständnis über die Bedeutung der Klassenbewegung am Ende der 60er Jahre und am Anfang der 70er. Für die IKS war dies das Zeichen des Endes der Konterrevolution, während für Battaglia die Konterrevolution noch andauerte.
Einverständnis über die konterrevolutionäre Rolle der Sozialistischen und Kommunistischen Parteien. Die IKS kritisierte dabei Battaglia, dass sie diese Organisationen lediglich als „opportunistisch“ oder „reformistisch“ bezeichnete, denn solche Attribute können nur für proletarische Organisationen, die von der bürgerlichen Ideologie beeinflusst werden, angewendet werden.
Einverständnis über das Wesen der Gewerkschaften als Organisationen der Bourgeoisie, aber kein Einverständnis über die Intervention ihnen gegenüber. Battaglia verteidigte noch die Notwendigkeit einer Arbeit innerhalb der Gewerkschaften – einschließlich der Möglichkeit, in basisgewerkschaftlichen Fabrikkomitees gewählt zu werden. Gleichzeitig verteidigte Battaglia die Notwendigkeit, ihre eigenen „Fabrikgruppen“ zu bilden, die sie „kommunistische Fabrikgruppen“ oder „kommunistische Gewerkschaftskomitees“ nannte.
Diese Frage der Fabrikgruppen war auch ein Hauptelement der Diskussionen, da Battaglia sie als „einen Keilriemen zwischen Klasse und Partei“ betrachtete, während die IKS die Existenz solcher „Keilriemen“ in der Phase der kapitalistischen Dekadenz leugnete, da die Arbeiterklasse keine dauerhaften Massenorganisationen mehr entstehen lassen kann, um die Gewerkschaften zu ersetzen.
Diese Diskussion hing mit erheblichen Differenzen über die Frage der Partei und des Klassenbewusstseins zusammen: Battaglia vertrat die Auffassung Lenins, wonach die Partei das Bewusstsein „von außen“ zu den Arbeitern bringt. Diese Frage sollte bei der nächsten Konferenz wiederaufgenommen werden. Diese Fragen sind Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten zwischen der IKS und Battaglia (und dem IBRP) seit den Konferenzen (als schwerwiegend kommt hinzu, dass sich das IBRP vom Dekadenzbegriff abgewandt hat – siehe unsere kürzlich veröffentlichten Artikel in der Internationalen Revue). Dieser Widerstreit war dennoch keineswegs der Ausdruck sinnloser Auseinandersetzungen. Battaglia hat sich tatsächlich bezüglich der Gewerkschaftsfrage weiter entwickelt und fügt sogar ihren Fabrikgruppen den Begriff „gewerkschaftlich“ nicht mehr hinzu. Auch zeigten während der Mailänder Konferenz einige der Antworten der IKS auf Battaglia zur Frage des Klassenbewusstseins einen starken „Anti-Leninismus“, den die IKS in den darauf folgenden Jahren in den eigenen Reihen bekämpfen sollte – insbesondere ab 1984 in der Debatte mit denjenigen, die später die FECCI („Externe Fraktion der IKS“) gegründet haben. Kurzum, die Diskussion führte zu Klärungen auf beiden Seiten und war für das gesamte politische Milieu äußerst interessant. Die Konferenz zog eine positive Bilanz ihrer Arbeit, denn es herrschte Übereinstimmung über die Weiterführung dieses Diskussionsprozesses.
Zweite Konferenz: Paris, November 1978
Die Tatsache, dass die nächste Konferenz gegenüber der ersten einen wichtigen Schritt vorwärts bedeuten sollte, zeigte die Richtigkeit dieser Schlussfolgerungen. Die nächste Konferenz war viel besser organisiert, die politischen Teilnahmekriterien waren klarer und mehr Organisationen waren anwesend. Zahlreiche Diskussionsbeiträge sowie die Protokolle wurden veröffentlicht (Siehe Band I und II der Broschüre „Zweite Konferenz der Gruppen der Kommunistischen Linken“, auf Französisch noch erhältlich).
Diesmal beteiligten sich viele: Battaglia, die IKS, die CWO, der Nucleo Communista Internazionalista (NCI aus Italien), For Kommunismen (Schweden) und das FOR. Drei andere Gruppen waren interessiert, konnten aber nicht teilnehmen: Arbetarmakt (Schweden), Il Leninista aus Italien und die Organisation Communiste Révolutionnaire Internationaliste aus Algerien.
Die Themen der Zusammenkunft waren eine Fortsetzung der Diskussionen auf der ersten Konferenz – die Krise und die ökonomischen Ursachen der kapitalistischen Dekadenz, die Rolle der Partei. Es gab auch eine Diskussion über die nationalen Befreiungskämpfe – Stein des Anstoßes für die meisten Gruppen bordigistischer Tradition. Diese Debatten lieferten einen wichtigen Beitrag im allgemeinen Klärungsprozess. Erstens ermöglichten sie einigen der bei der Konferenz anwesenden Gruppen zu erkennen, dass ausreichend gemeinsame Positionen vorhanden waren, um in einen Prozess der Umgruppierung einzutreten, der den allgemeinen Rahmen der Konferenzen nicht in Frage stellen würde. Dies war der Fall für die IKS und die schwedische Gruppe For Kommunismen. Hinzu kam, dass diese Debatten einen unschätzbaren Bezugspunkt für das gesamte politische Milieu darstellten – einschließlich für die Einzelnen, die keiner bestimmten Gruppe angehörten, aber eine revolutionäre Kohärenz suchten.
Diesmal stellte sich aber das Problem des Sektierertums besonders deutlich.
Die bordigistischen Gruppen waren zur Zweiten Konferenz eingeladen, aber ihre Antwort war ein typischer Ausdruck ihrer Ablehnung der wirklichen Bewegung, ihrer zutiefst sektiererischen Haltung. Die Internationale Kommunistische Partei (IKP) „Florenz“ (die sich 1972 von der bordigistischen Gruppe Programma gespalten hatte und Il Partito Communista veröffentlicht) antwortete, sie möchte mit „Missionaren der Vereinigung“ nichts zu tun haben. Wie wir aber in unserer Antwort „Die Zweite Internationale Konferenz“ (International Review Nr. 16, frz./engl./span. Ausgabe) betonen, war die Vereinigung mit Sicherheit nicht die unmittelbare Absicht: „Die Stunde der Vereinigung der verschiedenen heute bestehenden kommunistischen Gruppen in eine einzige Partei hat noch nicht geschlagen.“
Der gleiche Artikel widmet sich auch der Antwort von Programma: „Nicht viel anders in der Argumentation ist die Antwort der zweiten IKP – Programma. Wichtigster Unterschied ist ihre Vulgarität. Der Titel der Artikels „der Kampf zwischen Fottenti und Fottuti“ (wörtlich: zwischen Fickenden und Gefickten) zeigt schon, auf welches wahrhaftig für andere schwer erreichbare „Niveau“ Programma sich stellt. Muss man annehmen, dass Programma so sehr von stalinistischen Umgangsweisen geprägt ist, dass sie die Gegenüberstellung von Positionen unter Revolutionären nur in Begriffen von „Vergewaltigern und Vergewaltigten“ auffasst? Für Programma ist keine Diskussion möglich unter Gruppen, die sich auf den Kommunismus berufen und dem kommunistischen Lager tatsächlich angehören – vor allem nicht unter diesen Gruppen. Man kann gegebenenfalls mit Trotzkisten und anderen Linken in einem Möchtegern-Soldatenkomitee marschieren oder mit ihnen oder ihresgleichen gemeinsame Flugblätter für die „Verteidigung der Gastarbeiter“ unterschreiben, aber niemals zieht man die Möglichkeit der Diskussion unter kommunistischen Gruppen, nicht einmal unter den vielen bordigistischen Gruppen in Betracht. Da kann es sich nur um einen Machtkampf handeln: wenn man sie nicht zerstören kann, dann zumindest ihre Existenz ignorieren! Vergewaltigung oder Ohnmacht ist die einzige Alternative, die Programma für die kommunistische Bewegung und die Beziehungen unter den Gruppen sieht. Da sie keine andere Auffassung vertritt, glaubt sie sie überall zu erkennen und schreibt sie gern den anderen zu. Eine Internationale Konferenz kommunistischer Gruppen kann in ihren Augen nichts anderes sein und kein anderes Ziel haben, als Mitglieder der anderen Gruppe abzuwerben. Programma hat aus Furcht ohnmächtig zu sein nicht teilgenommen, obwohl der Wunsch zu „vergewaltigen“ sicherlich vorhanden war... Für Programma kann man nur mit sich selber diskutieren. Aus Angst, in einer Auseinandersetzung mit anderen kommunistischen Gruppen den Kürzeren zu ziehen, flüchtet sich Programma lieber in die „Masturbation“. Das ist die Männlichkeit einer Sekte und ihr einziges Mittel der Befriedigung.“
Die IKP hatte auch noch ein anderes Argument hervorgehoben: Die IKS sei parteifeindlich. Andere verweigerten ihre Teilnahme, weil sie gegen die Partei waren – Spartacusbond (Niederlande) und die PIC, die – wie der Artikel es zeigt – die Gesellschaft des sozialdemokratischen linken Flügels der der „Bordigo-Leninisten“ bei Weitem bevorzugte. Und:
„Die Konferenz erlebte durch die Haltung der Gruppe FOR eine Überraschung. Diese hatte ihr volles Einverständnis zur ersten Konferenz in Mailand und zur zweiten gegeben, mit Diskussionstexten beigetragen, zog sich aber bei der Eröffnung der Konferenz mit dem Argument zurück, sie sei mit dem ersten Punkt auf der Tagesordnung – der Entwicklung der Krise und ihrer Perspektiven - nicht einverstanden. Das FOR entwickelte die These, dass sich der Kapitalismus in keiner ökonomischen Krise befand. Die jetzige Krise sei nur eine konjunkturelle, wie der Kapitalismus sie im Laufe ihrer Geschichte immer wieder erlebt und überwunden habe. Sie eröffne demnach keine neue Perspektive, und schon gar nicht eine Wiederaufnahme der proletarischen Kämpfe, sondern eher das Gegenteil. Das FOR stellte die These einer von der ökonomischen Situation völlig unabhängigen „Zivilisationskrise“ auf. Man findet in dieser These den Beigeschmack des Modernismus als Erbe des Situationismus wieder. Wir werden hier keine Debatte eröffnen, um zu beweisen, dass es für die Marxisten absurd erscheint, von Dekadenz und Zusammenbruch einer historischen Gesellschaft zu sprechen, indem man sich ausschließlich auf infrastrukturelle und kulturelle Phänomene beruft, ohne sich auf die ökonomische Struktur zu beziehen, und gleichzeitig behauptet, diese Struktur – Grundlage jeder Gesellschaftsform – werde immer stärker und blühe förmlich auf. Diese Gedankengänge ähneln mehr den Hirngespinsten eines Marcuse als Marxens Denken. Auf diese Weise gründet das FOR die revolutionäre Tätigkeit weniger auf einen objektiven ökonomischen Determinismus als vielmehr auf den subjektiven Voluntarismus, der alle Protestler kennzeichnet. Wir sollten der Frage aber nachgehen, ob diese Verirrungen die wirkliche Ursache dafür sind, dass das FOR die Konferenz verlassen hat? Bei weitem nicht. In der Ablehnung der Teilnahme an der Konferenz und an der Debatte drückt sich vor allem der Cliquengeist des Jeder-für-sich aus, der die sich auf den Linkskommunismus berufenden Gruppen noch so stark prägt“.[i] [216]
Es war in der Tat relativ eindeutig, dass das Sektierertum ein Problem als solches darstellte. Dennoch lehnte die Konferenz den Vorschlag der IKS ab, eine gemeinsame Stellungnahme zur Verurteilung solcher Verhaltensweisen zu verabschieden (obwohl der Nucleo dies unterstützt hätte): nicht die Haltung der Gruppen sei das Problem, sondern ihre politischen Divergenzen. Dies stimmte für Gruppen wie den Spartacusbond oder die PIC, die aufgrund ihrer Ablehnung der Klassenpartei die Kriterien der Konferenz nicht annehmen konnten. Falsch ist aber die Idee, dass die politische Aktivität einzig und allein aus der Verteidigung oder Ablehnung politischer Positionen besteht. Die Haltung, der Werdegang, das Verhalten und die organisatorische Praxis der politischen Gruppen und ihrer Mitglieder sind ebenso maßgeblich, und die sektiererische Haltung fällt selbstverständlich unter diese Kategorie.
Wir haben vom IBRP angesichts verschiedener Krisen innerhalb der IKS die gleiche Antwort bekommen. Für sie ist der Versuch, interne Krisen als Ausdruck des Zirkelgeistes, des Klanverhaltens oder des Parasitismus zu verstehen, nichts als eine Vermeidung „politischer“ Debatten, gar eine bewusste Verschleierung. Mit dieser Auffassung kann man alle organisatorischen Probleme der IKS mit ihrer irrtümlichen Analyse der internationalen Situation oder der historischen Periode erklären; der tägliche Einfluss der bürgerlichen Gewohnheiten und Ideologie innerhalb der proletarischen Organisationen ist einfach ohne Belang. Der eindeutigste Beweis, dass die IBRP dafür absichtlich blind ist, ist ihre bedauernswerte Reaktion auf die letzten Angriffe der parasitären FICCI und des Abenteurers, der hinter dem „Circulo“ in Argentinien steckt, gegen die IKS. Unfähig, die wirklichen Beweggründe dieser Gruppen zu sehen, die nichts mit der Klärung politischer Differenzen zu tun haben, wurde das IBRP zum unmittelbaren Komplizen ihrer zerstörerischen Machenschaften.[ii] [216] Die Fragen des Verhaltens sind keine falschen Fragen für das proletarische politische Leben. Vielmehr sind sie eine Prinzipienfrage – die Frage eines Prinzips, das mit einem lebenswichtigen Anliegen jeder Organisationsform der Arbeiterklasse einhergeht: die Anerkennung eines gemeinsamen Interesses, das den Interessen der Bourgeoisie entgegengesetzt ist. Kurzum, die Notwendigkeit der Solidarität – keine proletarische Organisation kann diese elementare Notwendigkeit ignorieren, ohne dafür zu büßen. Dies gilt auch für das Sektierertum, das auch die solidarischen Bande unter den Organisationen der Arbeiterklasse abschwächt. Die Weigerung der Zweiten Konferenz, das Sektierertum zu verurteilen, hat der Grundlage dieser Reihe von Konferenzen selbst – die dringende Notwendigkeit, über den Tellerrand zu gucken und die wirkliche Einheit der revolutionären Bewegung voranzutreiben – einen Schlag versetzt. Mit ihrer Ablehnung jeglicher gemeinsamen Stellungnahme, fiel sie umso mehr in die Falle des Sektierertums.
Die Definition von Marx lautete: „Die Sekte sucht ihre raison d'être und ihren point d'honneur [Daseinsberechtigung und Ehre] nicht in dem, was sie mit der Klassenbewegung gemein hat, sondern in dem besonderen Schibboleth, das sie von ihr unterscheidet." (Marx an Schweitzer 13/10/1868, Briefwechsel...). Sie beschreibt genau die Haltung der großen Mehrheit der Gruppen, die an den internationalen Konferenzen teilgenommen haben.
Dritte Konferenz, Paris Mai 1980
Obwohl wir in Bezug auf die Arbeit der Zweiten Konferenz optimistisch blieben, da sie einen bedeutsamen Fortschritt gegenüber der ersten bedeutete, waren Anzeichen von Gefahr doch erkennbar. Sie bestätigten sich bei der Dritten Konferenz. Die teilnehmenden Gruppen waren: die IKS, Battaglia, die CWO, l’Eveil Internationaliste, die Nuclei Leninisti Internazionalisti (entstanden aus der Fusion zwischen dem Nucleo und Il Leninista), die Organisation communiste révolutionnaire d’Algérie (war selbst nicht anwesend, sondern wurde vertreten) und die Groupe communiste internationaliste als „Beobachter“.[iii] [216]
Die wichtigsten Fragen auf der Tagesordnung waren erneut die Krise und ihre Perspektiven sowie die Aufgaben der Revolutionäre heute. Die von der IKS gezogene Bilanz: „Einige allgemeinen Bemerkungen zu den Beiträgen für die dritte internationale Konferenz“ (erschienen in der Broschüre Die Dritte Konferenz) stellte einige wichtige Übereinstimmungspunkte als Grundlage der Konferenz heraus:
Der Kapitalismus steht vor einer sich vertiefenden Krise, die das System zu einem dritten Weltkrieg führt;
Dieser Krieg wird imperialistisch sein und die Revolutionäre müssen beide Lager verurteilen;
Die Kommunisten müssen als Ziel haben, zu der revolutionären Aktion ihrer Klasse beizutragen, die allein der Entwicklung zum Krieg entgegentreten kann;
Die Arbeiterklasse muss sich vom Einfluss der angeblichen „Arbeiterparteien“ und Gewerkschaften befreien, und auf dieser Ebene ist die Aktivität der Revolutionäre unerlässlich.
Der Texte vermerkt auch, dass bedeutende Differenzen über den historischen Kurs insbesondere mit Battaglia bestehen: Sie behauptete, es könne gleichzeitig einen Kurs zum Krieg und einen Kurs zur Revolution geben und es sei nicht die Aufgabe der Revolutionäre zu entscheiden, welcher sich durchsetzen würde. Die IKS wiederum stützte sich auf die Methode der Italienischen Fraktion in den 30er Jahren und unterstrich die Tatsache, dass ein Kurs zum Krieg nur auf der Grundlage einer Schwächung und Niederlage der Arbeiterklasse entstehen kann und dass die Klasse, wenn sie sich in einer Dynamik zur revolutionären Konfrontation mit dem Kapitalismus befindet, für einen Krieg nicht angeworben werden kann. Sie fügte hinzu, es sei für die Revolutionäre von herausragender Bedeutung, die möglichst klarste Position zu der vorherrschenden Tendenz zu haben, da die Form und der Inhalt ihrer Tätigkeit auf einer Analyse über den historischen Kurses gründet.
Die Frage der Fabrikgruppen war wieder ein Reibungspunkt für die anwesenden Gruppen. Während Battaglia sie als ein Mittel zur Entwicklung einer reellen und konkreten Einflussnahme innerhalb der Klasse präsentierte, stellte diese Auffassung für die IKS eher die Sehnsucht dar nach der längst verflossenen Zeit der permanenten Organisationen der Arbeiterklasse (z.B. der Gewerkschaften). Der Gedanke, die kleinen revolutionären Gruppen von heute könnten ein solches Netz, einen „Keilriemen zwischen der Partei und der Klasse“ schaffen, zeugte von einem gewissen Größenwahn bezüglich der tatsächlichen Möglichkeiten revolutionärer Tätigkeit zu dieser Zeit.
Die Diskrepanz zwischen dieser Auffassung und einem wirklichen Verständnis der reellen Bewegung konnte eine bedenkliche Unterschätzung der tatsächlichen Arbeit der Revolutionäre zur Folge haben und verhindern, dass eine Intervention in den Organisationsformen, die anfänglich in den Kämpfen des Proletariats 1978-80 entstanden waren, als notwendig erachtet wurde: nicht nur in den Vollversammlungen und Streikkomitees (die zwar am spektakulärsten in Polen auftraten, aber auch schon im Streik der Hafenarbeiter von Rotterdam zu finden waren), sondern auch in den Gruppen und Zirkeln, die kämpferische Minderheiten während oder am Ende der Streiks ins Leben riefen. In dieser Frage war die Auffassung der IKS der der NLI und deren Kritik des „Fabrikgruppen“-Schemas Battaglias ähnlich. Jegliche Möglichkeit, die Diskussion zu dieser Frage oder anderen zu führen, wurde aber durch den endgültigen Sieg des Sektierertums in den Konferenzen restlos vernichtet. Zuerst wurde der Vorschlag der IKS abgelehnt, eine gemeinsame Erklärung angesichts der Kriegsdrohung zu verfassen, die in Folge des Einmarsches Russlands in Afghanistan zu dieser Zeit besondere Brisanz besaß:
„Die IKS forderte die Konferenz auf, zu dieser Frage Stellung zu nehmen, und schlug eine Resolution vor, um gemeinsam die Haltung der Revolutionäre gegenüber dem Krieg zu bekräftigen. Der PCInt und dann die CWO und l’Eveil Internationaliste lehnten ab. Die Konferenz blieb stumm. Aufgrund der Kriterien für die Teilnahme an der Konferenz teilten alle anwesenden Gruppen zweifellos die gleiche grundlegende Position über die Haltung, die das Proletariat im Falle der Gefahr eines weltweiten Konfliktes einzunehmen hat. „Wir unterschreiben nicht mit irgendjemand, das wäre opportunistisch“, sagen uns die Befürworter des Schweigens. Wir antworten: Opportunismus bedeutet, Prinzipien bei der erstbesten Gelegenheit zu verraten. Wir schlugen nicht vor, ein Prinzip zu verraten, sondern es so kraftvoll wie möglich zu bekräftigen. Das internationalistische Prinzip ist eins der höchsten und wichtigsten für den proletarischen Kampf. Unabhängig davon, welche Differenzen zwischen den internationalistischen Gruppen ansonsten bestehen, gibt es nur wenige politische Organisationen auf der Welt, die dieses Prinzip konsequent verteidigen. Die Konferenz musste zum Krieg Stellung beziehen und dies so laut wie möglich. Der Inhalt dieser glänzenden „nicht opportunistischen“ Schlussfolgerung lautet: Da die revolutionären Organisationen nicht in allen Fragen eine Einigung erreicht haben, dürfen sie nicht zu den Fragen sprechen, über die sie seit langem einverstanden sind. Die Besonderheiten jeder Gruppen sind wichtiger als das Gemeinsame. Genau das ist Sektierertum. Das Schweigen der drei Konferenzen ist der klarste Ausdruck der Machtlosigkeit, zu der das Sektierertum führt.“ (International Review Nr. 22 „Das Sektierertum – Erbe der Konterrevolution“).
Das Problem ist nicht verschwunden: 1999 und 2003 trat es bei dem Vorschlag der IKS, gemeinsame Erklärungen zu den Kriegen in Jugoslawien und Irak zu verfassen, wieder auf.
Ferner wurde die Debatte plötzlich unterbrochen, als am Ende der Versammlung Battaglia und die CWO ein neues Kriterium hervorholten, das die IKS wegen ihrer Position zur Ablehnung der Machtergreifung durch die Partei in einer revolutionären Phase herausdrängen sollte. Dieses neue Kriterium lautete: „Die proletarische Partei ist zur politischen Führung der revolutionären Klassenbewegung und der revolutionären Macht selbst notwendig.“ Dies bedeutete, die Debatte zu schließen, bevor sie überhaupt anfangen konnte. Für Battaglia war es das Zeichen eines Ausleseprozesses, das die „Spontaneisten“ aus den Reihen der Konferenz aussondern sollte, damit nur diejenigen bleiben, die ernsthaft an der Bildung einer revolutionären Partei interessiert sind. Tatsächlich waren aber alle anwesenden Gruppen de facto an der langfristigen Bildung der Partei beteiligt. Nur die Diskussion in Verbindung mit der wirklichen Praxis der Revolutionäre konnte die wichtigsten Differenzen zur Struktur und Funktion der Partei beseitigen.
Das Kriterium von Battaglia und der CWO zeigt, dass diese Gruppen selbst zu keiner klaren Position zur Rolle der Partei gelangt waren. Zur Zeit der Konferenz und trotz der großen Phrasen über die Partei als „Kapitän der Klasse“ betonte Battaglia die Notwendigkeit für diese, sich vom Staat zu unterscheiden. Dabei verwarf sie eindeutig die „offener“ bordigistische Auffassung, die die Diktatur der Partei vertritt. Bei der Zweiten Konferenz hatte die CWO vor allem gegen die Kritik der IKS an den „substitutionistischen“ Fehlern der Bolschewiki polemisiert und entschieden behauptet, dass die Partei die Macht ergreife, wenngleich das „durch“ die Räte erfolgen soll. Diese beiden Gruppen konnten also schwer verkünden, die Debatte sei „beendet“. Der Grund, weshalb Battaglia (die die Konferenzen ohne Kriterien begonnen hatte und jetzt fanatisch besonders „selektive“ Kriterien hervorholte) dieses Kriterium in den Vordergrund stellte, war keineswegs der Wille zur Klärung, sondern vielmehr der sektiererische Drang, die IKS als die zu vernichtende Rivalin loszuwerden, um sich als der einzige internationale Pol der Umgruppierung hervorzutun. Diese Politik wurde in den 80er und 90er Jahren immer mehr zur Theorie und Praxis des IBRP. Sie führte zu der Aufgabe des Konzeptes eines proletarischen Lagers und zu der Selbsternennung als die einzige Kraft, die die Errichtung der Weltpartei vorantreiben könne. Wichtig ist auch zu verstehen, dass die andere Seite des Sektierertums der Opportunismus, der Schacher mit Prinzipien ist. Das hat die Methode gezeigt, mit welcher Battaglia dieses neue Kriterium aus dem Hut gezaubert und zur Abstimmung gebracht hat (nach Verhandlungen mit der CWO hinter den Kulissen): genau zu dem Zeitpunkt, als die einzige Gruppe, die ebenso dagegen war (die NCI), die Konferenz schon verlassen hatte (solche Manöver gehören zur Methode der bürgerlichen Parlamente und haben definitiv nichts in einer Versammlung kommunistischer Gruppen zu suchen).
Der Brief der IKS an Battaglia nach der Konferenz (in der Broschüre Die Dritte Konferenz veröffentlicht) zeigt gegenüber solchen Methoden, was eine verantwortliche Haltung gewesen wäre: „Wenn Ihr tatsächlich dachtet, es sei an der Zeit, ein zusätzliches, viel selektiveres Kriterium für die Einladung zu zukünftigen Konferenzen einzufügen, wäre die einzige ernsthafte, verantwortungsvolle Haltung gewesen, die mit dem Bestreben nach der notwendigen brüderlichen Klärung und Diskussion unter revolutionäre Gruppen zu vereinbaren ist, die Konferenz aufzufordern, diese Frage explizit auf die Tagesordnung zu stellen und entsprechende Diskussionstexte vorzubereiten. Dennoch habt Ihr zu keinem Zeitpunkt während der Vorbereitung auf die Dritte Konferenz diese Frage ausdrücklich angesprochen. Erst nach Verhandlungen mit der CWO hinter den Kulissen habt Ihr am Ende der Konferenz Eure kleine Bombe platzen lassen.
Wie soll man Eure Kehrtwendung und die vorsätzliche Verheimlichung Eurer wirklichen Absichten verstehen? Wir können schwer etwas anderes darin erkennen als den Willen die Grundsatzdebatte zu vermeiden, die der Einführung eines zusätzlichen Kriteriums zur Frage der Partei eventuell einen Sinn verliehen hätte. Obwohl wir der Meinung waren, eine „Selektion“ sei auch nach einer solchen Diskussion sehr verfrüht, schlugen wir, gerade um diese Grundsatzdebatte zu führen, für die Tagesordnung der nächsten Konferenz folgende Frage vor: „die Frage der Partei – ihre Natur, Funktion und das Verhältnis zwischen Partei und Klasse ausgehend von der historischen Darstellung dieser Frage in der Arbeiterbewegung und der historischen Beweisführung dieser Konzepte“ (von der IKS vorgeschlagener Resolutionsentwurf). Genau dieser Diskussion wolltet Ihr aus dem Weg gehen (stört sie Euch so sehr?). Dies wurde sehr deutlich, als Ihr Euch am Ende der Konferenz geweigert habt, eine Erklärung zu Eurem Vorschlag für ein Kriterium zu liefern: „die proletarische Partei als notwendiges Organ der politischen Führung der revolutionären Klassenbewegung und der revolutionären Macht selbst.“ Allen Teilnehmern war klar, dass Eure einzige Absicht nicht die Klärung der Debatte war, sondern die Konferenzen sollten sich der Elemente – unter anderen der IKS - „entledigen“ , die Ihr als „spontaneistisch“ bezeichnet hattet.
Eine solche Vorgehensweise verrät die größte Geringschätzung gegenüber den teilnehmenden Gruppen – sowohl den anwesenden als noch vielmehr denjenigen, die aus materiellen Gründen nicht hatten kommen können, und darüber hinaus des gesamten revolutionären Milieus, für welches die Konferenzen eine Referenz waren; sie scheint auch darauf hinzudeuten, dass Battaglia Communista die Konferenzen als IHR Ding betrachtete, das sie nach Gutdünken aufbauen oder zerstören kann.
Nein Genossen! Die Konferenzen waren nicht Battaglias Eigentum, nicht einmal dasjenige der sie organisierenden Gruppen. Sie gehören dem Proletariat, sind eine Etappe auf seinem mühsamen Weg zur Bewusstwerdung und zur Revolution. Keine Gruppe hat das Recht auf ihr Bestehen oder ihre Auflösung, weder aufgrund einer Laune noch wegen der ängstlichen Weigerung, über die Probleme, mit denen die Klasse konfrontiert ist, vertieft zu diskutieren.“
Der Opportunismus, der sich in der Vorgehensweise von Battaglia und der CWO gezeigt hatte, wurde in der vierten Konferenz in London 1982 voll bestätigt. Es wurde ein Flop in puncto Organisation: viel weniger Teilnehmer als bei den vorigen Konferenzen, keine veröffentlichten Texte oder Protokolle, keine Fortsetzung. Außerdem ein gefährliches Aufweichen der Prinzipien, denn die einzige anwesende Gruppe waren die Unterstützer der Einheit Kommunistischer Militanter (SUCM) – eine radikale stalinistische Gruppe in direkter Verbindung mit dem kurdischen Nationalismus, die sich jetzt Kommunistische Partei der Arbeiter Irans nennt (auch bekannt unter dem Namen „Hekhmatisten“). Die sektiererische „Strenge“ gegenüber der IKS und dem proletarischen Milieu ging mit einer sehr nachgiebigen Haltung gegenüber der Konterrevolution einher. Wie wir es in dem Artikel „Polemik mit dem IBRP: eine opportunistische Umgruppierungspolitik führt lediglich zu Fehlgeburtent“ (Internationale Revue Nr. 36) zeigten, sollte das IBRP unverhohlen diese opportunistische Auffassung der Umgruppierung noch öfters vertreten.
Die Jahre der Wahrheit für die Revolutionäre
Die 70er Jahre waren für die revolutionäre Bewegung, die noch die Früchte des ersten Ansturms von Arbeiterkämpfen am Ende der 60er Jahre erntete, Wachstumsjahre. Seit Anfang der 80er Jahre war aber das politische Umfeld erheblich düsterer. Der Einmarsch Russlands in Afghanistan und die aggressive Antwort der USA darauf machten eine Zuspitzung der interimperialistischen Konflikte deutlich; die damit verbundene Gefahr eines Weltkrieges nahm Form an. Die Bourgeoisie verkündete immer weniger eine strahlende Zukunft und immer mehr den Realismus, dessen Symbol die Politik der „Eisernen Lady“ in Großbritannien wurde.
Zu Anfang des Jahrzehnts erkannte die IKS, dass die Jahre der Illusionen vorbei waren und die Jahre der Wahrheit begannen. Mit der dramatischen Vertiefung der Krise und der Beschleunigung der Kriegsvorbereitungen konfrontiert, vertraten wir die Ansicht, dass die Arbeiterklasse ihre Kämpfe auf ein höheres Niveau stellen müsse und dass das kommende Jahrzehnt für das weitere Schicksal des Kapitalismus entscheidend sein könne. Das Proletariat war gezwungen, den Klassenkampf auf eine höhere Stufe zu stellen. Im August 1980 kam in Polen der klassische Massenstreik hervor, der die Fähigkeit der Arbeiterklasse, sich auf der Ebene eines ganzen Landes zu organisieren, erneut aufzeigte. Obwohl diese Bewegung isoliert blieb und letztendlich brutal niedergeschlagen wurde, zeigte die in Belgien 1983 begonnene Kampfeswelle, dass die Arbeiter der westeuropäischen Schlüsselländer bereit waren, auf die durch die Krise bedingten vermehrten Angriffe auf ihre Lebensbedingungen zu antworten. Die Revolutionäre hatten zahlreiche und wichtige Gelegenheiten, in der darauf folgenden Bewegung zu intervenieren, dennoch war es keine „einfache“ Zeit für die Mitgliedschaft in einer kommunistischen Organisation. Der Ernst der Lage forderte zu viel von denjenigen, die zu einem langfristigen Engagement für die Sache des Kommunismus nicht bereit waren oder die sich mit vielen von den „happy days“ der 60er Jahre geerbten kleinbürgerlichen Illusionen in der Bewegung verirrt hatten. Hinzu kommt, dass die damaligen Kämpfe, so wichtig sie waren, es nicht schafften, ein ausreichendes Niveau von Politisierung zu erreichen. Der Kampf der englischen Bergarbeiter, des Schulpersonals in Italien, der Eisenbahner in Frankreich, der Generalstreik in Dänemark ... – all diese Kämpfe und andere mehr waren Ausdruck des offenen Misstrauens einer nicht besiegten Klasse, die den Weg der Bourgeoisie zum Weltkrieg versperrte. Sie waren aber nicht in der Lage, die Perspektive einer neuen Gesellschaft aufzuzeigen und haben das Potential des Proletariats als revolutionäre Klasse der Zukunft nicht deutlich herausgestellt. Sie haben auf Grund dessen keine neue Generation von proletarischen Gruppen und Militanten hervorgebracht.
Das globale Ergebnis dieses Kräfteverhältnisses zwischen den Klassen war das, was wir die Phase des kapitalistischen Zerfalls genannt haben, in welcher keine der beiden historischen Klassen ihre eigene Perspektive durchzusetzen vermag: weltweiten imperialistischen Krieg oder proletarische Revolution. Die „Jahre der Wahrheit“ sollten die ganze Schwäche des proletarischen Milieus gnadenlos offenbaren. Die IKP (Programma) wurde Anfang der 80er Jahre von einer verheerende Krise infolge eines Geburtsgebrechens ihres programmatischen Gerüstes geschüttelt – insbesondere die Frage der nationalen Befreiungskämpfe führte zu einem Eindringen linker und nationalistischer Elemente in ihre Reihen. Die Krise der IKS von 1981 (die in die Abspaltung der „Chénier“-Tendenz mündete) war weitestgehend der Preis, den die IKS für ihr schwaches Verständnis organisatorischer Fragen zu zahlen hatte. Der Bruch mit der „Externen Fraktion der IKS“ (FECCI) zeigte außerdem, dass unsere Organisation die Überreste rätistischer Auffassungen ihrer Anfangsjahre noch nicht überwunden hatte. 1985 bildete sich das IBRP aufgrund einer Verbindung zwischen Battaglia und der CWO. Die IKS bezeichnete diesen Zusammenschluss als „opportunistischen Bluff“. Die darauf folgende Unfähigkeit des IBRPs, eine wirklich zentralisierte internationale Organisation aufzubauen, hat dies bestätigt.
All diese Schwierigkeiten wären gewiss nicht aufgetreten, wenn die Konferenzen nicht Anfang des Jahrzehnts sabotiert worden wären. Aber das Fehlen von Konferenzen bedeutete einmal mehr, dass das proletarische Milieu ungeordnet ihnen entgegentreten musste. Bezeichnenderweise sind die Konferenzen am Vorabend des Massenstreiks in Polen gescheitert; damit wurde die Unfähigkeit des proletarischen Milieus deutlich, nicht nur zur Frage des Krieges, sondern auch angesichts eines derart offenen und anregenden Ausdrucks der proletarischen Alternative mit einer einzigen Stimme zu sprechen.
Die Schwierigkeiten, mit denen das heutige politische proletarische Milieu konfrontiert ist, sind keineswegs das Produkt des Scheiterns der internationalen Konferenzen. Wie wir gesehen haben, liegen die Wurzeln viel tiefer und breiter. Aber der Mangel an einem organisierten Rahmen der politischen Debatte und Zusammenarbeit hat zu ihrer Verstärkung beigetragen.
Die Entstehung einer neuen Generation von proletarischen Gruppen und Elementen wird sicherlich in Zukunft das Bedürfnis nach einem organisierten Rahmen hervorbringen. Eine der ersten Initiative des NCI in Argentinien war ein Vorschlag in dieser Richtung. Fast die gesamten Gruppen des proletarischen Milieus haben abschlägig reagiert. Solche Vorschläge werden aber wieder gemacht werden, auch wenn die Mehrheit der „etablierten“ Gruppen immer weniger in der Lage ist, einen einigermaßen positiven Beitrag zur Entwicklung der Bewegung zu liefern. Wenn diese Vorschläge fruchten, wird man sich die Lehren aus den Konferenzen 1976-1980 aneignen müssen.
In Ihrem Schreiben an Battaglia in der Broschüre „Die Dritte Konferenz“ zieht die IKS die wichtigsten Lehren:
„Wichtigkeit dieser Konferenzen für das revolutionäre Milieu und die gesamte Klasse,
Notwendigkeit von Kriterien,
Notwendigkeit, Stellung zu beziehen,
Ablehnung von überstürztem Verhalten,
Notwendigkeit der tiefstmöglichen Diskussion über die entscheidenden Fragen, mit denen das Proletariat konfrontiert ist.“
Wenn sich die neue Generation diese Lehren zu Eigen macht, dann wird der erste Zyklus internationaler Konferenzen in seiner Aufgabe nicht gänzlich gescheitert sein.
Amos
Kurze Notizen zu den genannten Gruppen
Einige der erwähnten Gruppen sind später verschwunden.
Spartacusbond
Eine der letzten Gruppen der Kommunistischen Holländischen Linken, die aber in den 70er Jahren nur noch ein Schatten des Rätekommunismus der 30er Jahre und des Spartacusbond der Nachkriegszeit war, der die Notwendigkeit einer proletarischen Partei anerkannt hatte.
Forbundet Arbetarmkt
Schwedische Gruppe mit einer seltsamen Mischung aus Rätekommunismus und linker Ideologie.
Sie bezeichnete die UdSSR als „staatsbürokratische Produktionsweise“, unterstützte die nationalen Befreiungskämpfe und die Arbeit in den Gewerkschaften. Erheblich Differenzen waren vorhanden und einige der Mitglieder verließen sie Ende der 70er Jahre und schlossen sich der IKS an.
Pour une Intervention communiste
Ende 1973 aus der IKS ausgetreten, weil diese angeblich nicht ausreichend intervenieren würde (für die PIC war Intervention gleichbedeutend mit: Unmengen an Flugblättern produzieren). Die Gruppe orientierte sich relativ schnell hin zu halb-rätistischen Positionen und verschwand.
Nucleo Comunista Internazionalista
Aus der IKP (Programma) in Italien Ende der 70er Jahre entstanden, hatte diese Gruppe anfänglich eine viel offenere Haltung gegenüber der Tradition von Bilan und dem bestehenden proletarischen Milieu, wie man in ihren Interventionen während der Konferenz feststellen kann. Zur Zeit der Dritten Konferenz fusionierte sie mit Il Leninista und gründete die Nuclei Leninisti Internazionalisti. Später entstand die Organizzazione Comunista Internazionalista, die sich aber zu den Linken entwickelte. Die ursprüngliche Schwäche der NCI zur nationalen Frage bildete einen fruchtbaren Boden und verfestigte sich: die OCI unterstützte offen Serbien im Krieg 1999 und den Irak in beiden Golfkriegen.
Formento Obrero Revolucionario
Von Grandizo Munis in den 50er Jahren gegründet. Munis hatte mit dem Trotzkismus in der Frage der Verteidigung der UdSSR gebrochen und sich zu den Positionen der kommunistischen Linken hin entwickelt. Die Unklarheiten dieser Gruppe über die Krise und der Tod des charismatischen Munis haben der Gruppe den Gnadenstoß gegeben, sie verschwand Mitte der 90er Jahre.
L’Eveil Internationaliste
Entstand Ende der 70er Jahre infolge eines Bruchs mit dem Maoismus. Hat bei der Dritten Konferenz alle anderen Gruppen über ihre Unzulänglichkeiten in Theorie und Intervention belehrt und ist kurz darauf spurlos verschwunden.
Organisation communiste révolutionnaire internationaliste d’Algérie
Auch
bekannt unter dem Namen TIL (nach ihrer Zeitschrift Travailleurs Immigrés
en Lutte), unterstützte sie die Konferenzen, konnte aber aus
Sicherheitsgründen angeblich nicht teilnehmen. Tatsächlich war dies Teil eines
größeren Problems: die Konfrontation mit dem revolutionären Milieu zu
vermeiden. Sie überlebte noch bis in die 80er Jahre.
[i] [216] Das FOR scheint einen nachträglichen Sieg bei der Konferenz errungen zu haben. Es gibt nämlich eine frappierende Ähnlichkeit zwischen seiner Idee, die kapitalistische Gesellschaft, aber nicht die kapitalistische Wirtschaft sei dekadent und der neuen Entdeckung des IBRP, die zwischen der kapitalistischen (nicht dekadenten) Produktionsweise und dem gesellschaftlichen (dekadenten) Überbau unterscheidet. Siehe insbesondere den Text von Battaglia: Dekadenz und Zerfall, Produkte der Konfusion sowie unsere Antwort auf unserer französischsprachigen Webseite.
[ii] [216] siehe den „Offenen Brief an die Genossen des IBRP“ auf unserer Webseite.
[iii] [216] Die Haltung der GCI bei der Konferenz zeigte, wie wir es in der International Review Nr. 22 gezeigt haben, dass diese Gruppe keinen Platz in einer Zusammenkunft von Revolutionären hatte. Obwohl die IKS zur Zeit der Konferenzen ihre Auffassung des politischen Parasitentums noch nicht entwickelt hatte, konnte man bei der GCI alle Charakteristiken dessen finden. Sie war nur zur Konferenz gekommen, um sie als „Betrug“ zu denunzieren, betonte, sie sei nur als Beobachterin gekommen, habe jederzeit das Recht, das Wort zu allen Fragen zu ergreifen, und verursachte fast eine Schlägerei. Kurzum, diese Gruppe existiert, um das proletarische Milieu zu sabotieren. Bei der Konferenz schwenkte sie große Reden über den revolutionären Defätismus und den Internationalismus in Aktion und nicht in Worten. Wie viel wert diese Phrasen waren, kann man an den Lobliedern, die die GCI später über die nationalistischen Gangs in Peru und El Salvador gesungen hat, und an ihrer aktuellen Auffassung über einen proletarischen Kern des „Widerstandes“ im Irak messen.
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Krieg im Libanon, im Mittleren Osten, im Irak
- 3057 Aufrufe
Es gibt eine Alternative gegenüber der kapitalistischen Barbarei
Gegenüber dem Krieg, der im Nahen und Mittleren Osten ständig wütet, und neulich wieder gegenüber dem Konflikt zwischen Israel und Libanon, vertreten die Revolutionäre eine klare Position. Deshalb unterstützen wir voll und ganz die wenigen internationalistischen und revolutionären Stimmen, die in dieser Region zu vernehmen waren, wie die der Gruppe Enternasyonalist Komunist Sol der Türkei. In ihrer Stellungnahme zur Lage im Libanon und Palästina, die wir in den verschiedenen Organen unserer territorialen Presse veröffentlicht haben, verwirft diese Gruppe entschlossen jede Unterstützung der aufeinander prallenden rivalisierenden bürgerlichen Cliquen und Fraktionen, deren direkte Opfer Millionen Proletarier sind, ob sie nun palästinensischen, jüdischen, schiitischen, sunnitischen, kurdischen, drusischen oder anderen Ursprungs sind. Diese Gruppe hat zu Recht hervorgehoben: „Der Imperialismus ist die natürliche Politik eines jeden Nationalstaates und einer jeden Organisation, die wie ein Nationalstaat funktioniert“. Sie hat ebenso die folgende Tatsache angeprangert: “In der Türkei als auch in der übrigen Welt gewährte eine große Mehrheit der Linksextremisten der PLO und der Hamas völlige Unterstützung. Im letzten Konflikt sagten sie einstimmig: „Wir alle sind Hisbollah“. Der Logik „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ folgend, umarten sie innig diese gewalttätige Organisation, die ihre Arbeiterklasse in einen katastrophalen nationalistischen Krieg stieß. Die Unterstützung, die die Linksextremisten dem Nationalismus gewährten, zeigt uns, warum Linksextremisten nicht viel anderes sagen als Parteien wie die MHP (Partei der nationalistischen Bewegung – die faschistischen Grauen Wölfe)… Sowohl der Krieg zwischen der Hisbollah und Israel als auch der Krieg in Palästina ist ein imperialistischer Konflikt, und alle Seiten benutzen den Nationalismus, um die Arbeiter ihrer Territorien auf ihre Seite zu ziehen. Je mehr die Arbeiter vom Nationalismus aufgesaugt werden, desto mehr werden sie die Fähigkeit verlieren, als Klasse zu handeln. Daher dürfen Israel, die Hisbollah, die PLO oder die Hamas unter keinen Umständen unterstützt werden.“ (siehe Weltrevolution Nr. 138). Dies belegt, dass die proletarische Perspektive immer noch vorhanden ist und sich nicht nur durch die Entwicklung der Kämpfe der Arbeiterklasse überall auf der Welt äußert (in Europa, USA, Lateinamerika, Indien oder Bangladesh), sondern auch durch das Auftauchen von kleinen Gruppen und politisierten Leuten in verschiedenen Ländern, die bestrebt sind, internationalistische Positionen zu verteidigen, welche das herausragende Merkmal proletarischer Politik sind.
Der Krieg im Libanon vom letzten Sommer war eine neue Etappe zu einem weiteren Blutvergießen im ganzen Nahen und Mittleren Osten. Die Welt versinkt in einem immer weniger kontrollierbaren Chaos, einem Krieg, zu dem alle imperialistischen Mächte der angeblichen ‚internationalen Weltgemeinschaft’ beigetragen haben, von den größten bis zu den kleinsten Staaten. 7000 Luftangriffe allein auf libanesisches Territorium, abgesehen von den unzähligen Raketenangriffen auf Nordisrael, mehr als 1200 Tote im Libanon und Israel (darunter mehr als 300 Kinder unter 12 Jahren), mehr als 5000 Verletzte, eine Million Zivilisten, die vor den Bomben und Kämpfen flüchten mussten. Andere, die zu arm sind zu fliehen, suchen irgendwo total verängstigt Schutz. Ganze Stadtviertel und Dörfer in Schutt und Asche gelegt, überfüllte Krankenhäuser: Dies ist die Bilanz eines Monats Krieg im Libanon und in Israel nach der Tsahal-Offensive, die dazu dienen sollte, den wachsenden Einfluss der Hisbollah einzudämmen, und eine Reaktion auf eine der zahlreichen tödlichen Angriffe der islamistischen Milizen über die israelisch-libanesische Grenze hinweg war. Man schätzt den wirtschaftlichen Schaden auf mehr als 6 Milliarden Euro, zusätzlich zu den militärischen Kosten des Krieges.
Der israelische Staat hat mit einer unglaublichen Brutalität, Wildheit und Besessenheit eine Politik der verbrannten Erde gegenüber der Zivilbevölkerung in den Dörfern des Südlibanons praktiziert. Die Menschen wurden aus ihren Wohngebieten vertrieben, man überließ sie dem Hunger, ohne Wasser, den schlimmsten Epidemien ausgesetzt. 90 Brücken und zahlreiche Verkehrswege wurden systematisch zerstört (Straßen, Autobahnen…), drei Elektrizitätswerke und Tausende von Wohnungen vernichtet, durch die pausenlosen Bombardierungen wurde eine Umweltkatastrophe ausgelöst. Die israelische Regierung und ihre Armee erklärten unaufhörlich, man wolle die ‚Zivilisten verschonen’. Massaker wie das in Kanaa wurden als ‚bedauerliche Unfälle’ dargestellt (wie die berühmten ‚Kollateralschäden’ im Golfkrieg und auf dem Balkan). Aber unter der Zivilbevölkerung gab es die meisten Opfer – 90% der Getöteten waren Zivilisten!
Alle sind Kriegstreiber
Auch wenn die Hisbollah nur über begrenzte und damit weniger spektakuläre Mittel verfügt, hat sie genau die gleiche mörderische und blutrünstige Politik der ziellosen Beschießungen betrieben. Ihre Raketen trafen vor allem die Zivilbevölkerung und die im Norden Israels gelegenen Städte (75% der Getöteten gehörten gar der arabischen Bevölkerung an, die angeblich geschützt werden sollte).
Wie festgefahren die Lage im Nahen Osten war, konnte man schon deutlich anhand des Eintritts der Hamas in die Regierung der palästinensischen Gebiete (dort hat die Unnachgiebigkeit der israelischen Regierung dazu beigetragen, den Großteil der palästinensischen Bevölkerung zu ‚radikalisieren’) und den offenen Riss zwischen den Fraktionen der palästinensischen Bourgeoisie sehen, hauptsächlich zwischen Fatah und Hamas. Jegliche Verhandlungslösung galt als ausgeschlossen. Gegenüber dieser Sackgasse reagierte Israel so, wie heute alle Staaten reagieren: mit der Flucht nach vorne. Um seine Autorität wieder zu behaupten, hat sich Israel umgewandt mit dem Ziel, den wachsenden Einfluss der Hisbollah im Südlibanon einzudämmen, die vom Iran Hilfe, Geld und Waffen erhalten. Israel begründete sein Vorgehen mit dem Vorwand der Befreiung zweier, von der Hisbollah verschleppter israelischer Soldaten, die aber vier Monate nach ihrer Verschleppung noch immer Gefangene der schiitischen Milizen sind. Der andere Rechtfertigungsgrund war die ‚Neutralisierung’ und Entwaffnung der Hisbollah, deren Angriffe und Eindringen vom Südlibanon aus auf israelisches Gebiet als eine ständige Bedrohung für die Sicherheit des israelischen Staates angesehen werden.
Schließlich erwies sich die militärische Operation als ein großer Misserfolg, der den Mythos der Unbesiegbarkeit und Unverletzbarkeit der israelischen Armee plötzlich auffliegen ließ. Zivilisten und Militärs innerhalb der israelischen Bourgeoisie schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu für den schlecht vorbereiteten Krieg. Im Gegenzug geht die Hisbollah verstärkt aus dem Konflikt hervor und verfügt in den Augen der arabischen Bevölkerung aufgrund ihres Widerstandes gegen Israel über eine neue Legitimität. Anfangs war die Hisbollah wie auch Hamas nur eine der zahlreichen islamischen Milizen, die sich gegen den israelischen Staat gebildet hatten. Sie entstand 1982 während der israelischen Offensive im Südlibanon. Aufgrund des starken Gewichtes der Schiiten konnte sie dank der umfangreichen finanziellen Hilfe des Ayatollahregimes und der iranischen Mullahs gedeihen. Syrien hat die Hisbollah ebenfalls durch seine umfangreiche logistische Unterstützung benutzt. Damit konnte die Hisbollah für Syrien als Stützpunkt dienen, nachdem sich Syrien 2005 aus dem Libanon zurückziehen musste. Diese Mörderbande konnte gleichzeitig geduldig ein ganzes Netz von Rekrutierungsoffizieren errichten, wobei diese medizinische, sanitäre und soziale Hilfe anboten, die aus Geldmitteln der iranischen Öleinkünfte finanziert wurden. Diese Gelder ermöglichen nun gar die Ersetzung der durch den Bomben- oder Raketenbeschuss zerstörten Häuser, damit die Stimmung der Bevölkerung für die Hisbollah mobilisiert werden kann. In Berichten über diese „Schattenarmee“ konnte man sehen, dass ihr viele männliche Jugendliche im Alter von 10–15 Jahren angehören, die bei ihren blutigen Abrechnungen jeweils als Kanonenfutter verwendet werden.
Syrien und Iran bilden gegenwärtig den homogensten Block um Hamas und Hisbollah. Insbesondere der Iran zeigt offen seine Bestrebungen, die führende imperialistische Macht in der Region zu werden. Wenn der Iran in den Besitz von Atomwaffen käme, würde er in der Tat eine solche Rolle erfüllen können. Dies ist genau eine der Hauptsorgen der USA, denn seit ihrer Gründung im Jahre 1979 hat die ‚islamische Republik’ eine ständige Feindseiligkeit gegenüber den USA an den Tag gelegt.
Die USA haben für die Auslösung der israelischen Offensive gegen den Libanon grünes Licht gegeben. Nachdem sie bis zum Hals in den Krieg im Irak und im Afghanistan verwickelt sind, und nach dem Scheitern ihres „Friedensplans“ zur Regelung des Palästinenserkonfliktes müssen die USA das Scheitern ihrer Strategie feststellen, die darauf abzielte, eine „Pax Americana“ im Nahen und Mittleren Osten zu errichten. Insbesondere hat die US-Präsenz im Irak seit drei Jahren zu einem blutigen Chaos, einem schrecklichen regelrechten Bürgerkrieg zwischen verschiedenen rivalisierenden Fraktionen und zu tagtäglichen Attentaten geführt, die die Bevölkerung wahllos treffen und jeden Tag zwischen 80-100 Toten hinterlassen.
Auf diesem Hintergrund stand es außer Frage, dass die USA selbst intervenieren, obwohl es ihr erklärtes Ziel ist, sich die Staaten vorzuknüpfen, die als „terroristisch“ und als Verkörperung der „Achse des Bösen“ dargestellt werden wie Syrien und vor allem der Iran, der die Hisbollah unterstützt. Die israelische Offensive sollte den beiden Staaten als eine Warnung dienen; sie zeigte die völlige Interessensidentität zwischen dem Weißen Haus und der israelischen Bourgeoisie. Deshalb stellt das Scheitern Israels ebenso ein Zurückweichen der USA und die fortgesetzte Schwächung der US-Führungsrolle dar.
Der Zynismus und die Heuchelei aller Großmächte
Der Gipfel des Zynismus und der Heuchelei wurde von der UNO erreicht, als diese während der ein Monate dauernden Kriegshandlungen im Libanon unaufhörlich ihren „Friedenswillen“ verkündete und gleichzeitig ihre „Machtlosigkeit“ zur Schau stellte.[i] [217] Dies ist total verlogen. Diese Verbrecherbande (wie Lenin die Vorläuferorganisation der UNO, den Völkerbund, nannte) ist ein Ort, wo sich die gefährlichsten Krokodile der Erde bekämpfen. Die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder sind die größten Räuber der Erde:
- Die USA, deren Vorherrschaft auf der militärischen Armada des stärksten Staates der Welt fußt, und deren Verbrechen seit der 1990 erfolgten Verkündung einer „Ära des Friedens und des Wohlstands“ durch Bush Senior (die beiden Golfkriege, die Intervention auf dem Balkan, die Besetzung des Iraks, der Krieg im Afghanistan…) für sich selbst sprechen.
- Russland, das für die schrecklichsten Grausamkeiten in seinen beiden Kriegen in Tschetschenien verantwortlich ist, weil es den Zusammenbruch der UdSSR nicht verkraftet hat und nach Rache dürstet, zeigt heute seine neuen imperialistischen Ambitionen, nachdem es von der Schwäche der USA profitiert hat. Deshalb spielt es die Karte der Unterstützung des Irans und etwas diskreter der Hisbollah.
- China, das von seinem wachsenden wirtschaftlichen Einfluss profitiert, träumt davon, Zugang zu neuen Einflusszonen außerhalb Südostasiens zu bekommen. Es hat insbesondere den Iran umworben, der ein privilegierter Wirtschaftspartner ist, welcher ihm Öl zu besonders günstigen Beziehungen verkauft. Russland und China haben die jüngsten UN-Resolutionen zu sabotieren versucht.
- Bislang hat Großbritannien die großen Strafaktionen seitens der USA für die Verteidigung seiner eigenen Interessen mitgetragen. Es will so sein altes Einflussgebiet wieder zurückgewinnen, über das es seinerzeit in Gestalt der alten Protektorate in dieser Region verfügte (insbesondere Iran und Irak).
- Die französische Bourgeoisie zeigt weiterhin eine Nostalgie für eine Zeit, zu der sie die Einflussgebiete im Nahen und Mittleren Osten mit Großbritannien teilen konnte. Deshalb unterstützte sie die US-Pläne gegenüber Libanon anlässlich der berühmten UN-Resolution 1201 und willigte gar dem Plan des Einsatzes von UNIFIL-Truppen zu. Deshalb hat sie auch der Entsendung von zunächst 400, mittlerweile 2000 Soldaten in den Südlibanon im Rahmen der UNIFIL zugestimmt.
Andere Mächte sind ebenfalls auf den Plan getreten wie Italien, das als Belohnung für die Entsendung des größten Kontingentes an UN-Truppen nach Februar 2007 das Oberkommando über die UNIFIL im Libanon übernehmen wird. Einige Monate nach dem Rückzug der italienischen Truppen aus dem Irak tritt Prodi, der zuvor das Engagement der Berlusconi-Mannschaft im Irak kritisiert hatte, in dessen Fußstapfen im Libanon und beweist damit die Ambitionen Italiens, am Tisch der Großen mit sitzen zu wollen, auch wenn es dabei wieder Federn lassen muss. Das verdeutlicht wieder einmal, dass alle imperialistischen Mächte Kriegstreiber sind.
Der Nahe und Mittlere Osten liefert uns heute eine gebündelte Illustration des irrationalen Charakters des Krieges, wo jeder Imperialismus sich immer stärker engagiert, um seine eigenen Interessen zu vertreten, was zur Folge hat, dass dadurch Konfliktfelder immer größer und blutiger werden, weil immer mehr Staaten daran beteiligt sind.
Die Ausdehnung der blutigen Konfliktherde auf der ganzen Welt zeigt somit den unausweichlich barbarisch-kriegerischen Charakter des Kapitalismus. Krieg und Militarismus sind zur ständigen Überlebensform des im Zerfall begriffenen dekadenten Kapitalismus geworden. Es handelt sich um einen Hauptwesenszug der tragischen Sackgasse eines Systems, das der Menschheit nichts anderes anzubieten hat als Tod und Elend.
Die amerikanische Bourgeoisie in der Sackgasse
Der Polizist, der angeblich den Schutz der „Weltordnung“ sicherstellen soll, ist heute selber ein aktiver Faktor bei der Zunahme der Unordnung.
Wie ist es möglich, dass die stärkste Armee der Welt, mit den modernsten Technologien und den mächtigsten Geheimdiensten ausgerüstet, mit hoch komplexen Waffen, die ein Tausende Kilometer weit entferntes Ziel präzise treffen können, sich plötzlich in einer Fallgrube gefangen vorfindet? Wie kommt es, dass die USA, das mächtigste Land der Welt, von einem Halbidioten regiert werden, der seinerseits von einer Bande von Aktivisten umgeben ist, die nicht gerade dem Bild entsprechen, das man sich von einer verantwortungsvollen „großen Demokratie“ der Bourgeoisie traditionellerweise macht? Bush Junior, der vom Schriftsteller Norman Mailer als „schlimmster Präsident der Vereinigten Staaten: ignorant, arrogant und vollkommen blöd“ bezeichnet wird, hat sich mit einer Mannschaft von „klugen Köpfen“ umgeben, die ihm die Politik diktieren: von Vizepräsident Dick Cheney über den Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und seinen Guru-Manager Karl Rove bis zum „Theoretiker“ Paul Wolfowitz. Dieser hat sich seit Beginn der 1990er Jahre als konsequentester Verfechter einer „Doktrin“ hervorgetan, die klar behauptet, dass „die wesentliche politische und militärische Mission von Amerika nach dem Kalten Krieg darin besteht, zu verhindern, dass irgendeine rivalisierende Supermacht in Westeuropa, in Asien oder in den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion entstehen kann“. Diese „Doktrin“ wurde im März 1992 publik, als die amerikanische Bourgeoisie sich nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der Wiedervereinigung Deutschlands noch Illusionen über den Erfolg ihrer Strategie machte. Mit diesem Ziel erklärten jene Leute vor ein paar Jahren, dass „es ein neues Pearl Harbor bräuchte“, um die Nation wachzurütteln, der ganzen Welt die demokratischen Werte Amerikas zu vermitteln und die imperialistischen Rivalitäten zu überwinden. Dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass der japanische Angriff auf den Stützpunkt der amerikanischen Seestreitkräfte im Dezember 1941, der 4500 Tote und Verletzte auf amerikanischer Seite forderte, den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten an der Seite der Alliierten erlaubte, da in der öffentlichen Meinung, die sich bis zu diesem Zeitpunkt gegen eine Beteiligung am Krieg wandte, ein Stimmungsumschwung stattfand, während die höchsten politischen Gremien in den USA über den Angriffsplan auf dem Laufenden waren und nicht intervenierten. Seit Cheney und seinesgleichen dank dem Sieg von Bush Junior im Jahr 2000 an die Macht gekommen sind, haben sie genau die vorgesehene Politik umgesetzt: Die Angriffe vom 11. September haben ihnen als „neues Pearl Harbor“ gedient, und im Namen ihres Kreuzzuges gegen den Terrorismus haben sie die Invasionen zuerst in Afghanistan und dann im Irak wie auch die äußerst kostspieligen neuen Rüstungsprogramme gerechtfertigt, ohne dass wir dabei die beispiellose Intensivierung der polizeilichen Kontrolle über die Bevölkerung vergessen dürfen. Dass sich die USA solche Führer geben, die mit dem Schicksal des Planeten wie Zauberlehrlinge spielen, gehorcht der gleichen Logik des dekadenten, krisengeschüttelten Kapitalismus, die seinerzeit einen Hitler in Deutschland an die Macht brachte. Es ist nicht dieses oder jenes Individuum an der Spitze eines Staates, das den Kapitalismus in diese oder jene Richtung sich entwickeln lässt; vielmehr ist es dieses auseinander brechende System, das diesem oder jenem Repräsentanten dieser Entwicklung, wenn er sie in Gang bringen kann, erlaubt, an die Macht zu gelangen. Das bringt die historische Sackgasse, in welche der Kapitalismus die Menschheit hineinzieht, klar zum Ausdruck.
Die Bilanz dieser Politik ist erschütternd: 3000 Soldaten, die seit Beginn des Krieges vor drei Jahren im Irak gestorben sind (unter ihnen mehr als 2800 von den amerikanischen Truppen), 655’000 Iraker sind zwischen März 2003 und Juli 2006 umgekommen, während die mörderischen Attentate und die Konfrontationen zwischen schiitischen und sunnitischen Fraktionen ständig weiter eskalieren. 160'000 Soldaten der Besatzungsmächte stehen auf irakischem Boden unter dem Oberkommando der USA, und sie sind unfähig „ihren Auftrag zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu erfüllen“ in einem Land, das am Rande des Zusammenbruchs und des Bürgerkriegs steht. Im Norden versuchen die schiitischen Milizen ihre Regeln durchzusetzen und führen immer mehr Machtdemonstrationen durch, im Süden rufen aktivistische Sunniten, die stolz auf ihre Verbindungen zu den Taliban und Al Kaida sind, eine „islamische Republik“ aus, während im Zentrum des Landes, in der Gegend um Bagdad, die Bevölkerung plündernden Banden und Autobomben ausgesetzt ist und jeder Patrouillengang von amerikanischen Truppen in einem Hinterhalt enden kann.
Die Kriege im Irak und in Afghanistan verschlingen darüber hinaus Unsummen von Geld, was das Budgetdefizit der USA noch mehr vergrößert und sie in eine gewaltige Verschuldung treibt. Die Situation in Afghanistan ist nicht minder katastrophal. Die unendliche Jagd nach Al Kaida und die Anwesenheit einer Besatzungsmacht auch hier, geben den Taliban neuen Kredit, die 2002 von der Macht vertrieben worden sind, die aber vom Iran und diskreter von China mit Waffen ausgerüstet werden und ihre Hinterhalte und Anschläge wieder verstärken. Die „terroristischen Dämonen“, d.h. Bin Laden und das Taliban-Regime, sind aber alle beide „Geschöpfe“ der USA im seinerzeitigen Kampf gegen die UdSSR, zur Zeit der imperialistischen Blöcke nach der Invasion der russischen Truppen in Afghanistan. Bin Laden ist ein ehemaliger Spion, den die CIA 1979 rekrutierte und der, nachdem er in Istanbul als Finanzintermediär bei einem Waffenhandel von Saudiarabien und den USA mit Bestimmungsort afghanische Guerilla „ganz natürlich“ von Anbeginn der russischen Intervention an zum Vermittler der Amerikaner bei der Verteilung der finanziellen Hilfe an den afghanischen Widerstand wurde. Die Taliban wurden von den USA bewaffnet und finanziert, und ihr Aufstieg an die Macht stand unter dem vollen Segen von Uncle Sam.
Längst ist unbestritten, dass der grosse Kreuzzug gegen den Terrorismus keineswegs zu dessen Ausmerzung führte, sondern vielmehr in eine Vervielfachung von terroristischen Angriffen und Selbstmordanschlägen mündete, deren einziges Ziel darin besteht, möglichst viele Opfer zu verursachen. Heute muss das Weiße Haus ohnmächtig erdulden, dass ihm das iranische Regime auf der Nase herumtanzt. Was wiederum die Flügel von Mächten im vierten oder fünften Rang wachsen lässt wie von Nordkorea, das sich am 8. Oktober einen Atomwaffentest erlauben konnte und damit zum 8. Land wurde, das Atomwaffen besitzt. Diese gewaltige Herausforderung stellt das Gleichgewicht in ganz Südostasien in Frage und ermutigt neue Anwärter in ihren Plänen, sich auch nuklear zu rüsten. Sie rechtfertigt damit auch die erneute Militarisierung und Wiederaufrüstung Japans und dessen Marschrichtung hin zur Produktion von Atomwaffen, um damit dem unmittelbaren Nachbarn die Stirn bieten zu können. Diese Gefahr besteht durchaus und sie veranschaulicht den „Dominoeffekt“ bei dieser Flucht nach vorn in den Militarismus und das „Jeder-für-sich“.
Dabei ist auch die absolut chaotische Lage zu erwähnen, die im Nahen Osten und insbesondere im Gazastreifen herrscht. Nach dem Wahlsieg der Hamas Ende Januar wurde die direkte ausländische Hilfe eingestellt, und die israelische Regierung verhängte ein Steuer- und Zollembargo über die palästinensische Behörde. 165'000 Beamte sind schon während sieben Monaten nicht mehr entlöhnt worden, doch ihre Wut und diejenige der ganzen Bevölkerung, von der 70% unter der Armutsgrenze leben (bei einer Arbeitslosenrate von 44%), wird leicht in den Straßenkämpfen aufgefangen, in denen sich seit dem 1. Oktober von neuem die Milizen der Hamas und der Fatah gegenüber stehen. Die Versuche, eine Regierung der nationalen Einheit auf die Beine zu stellen, scheitern einer nach dem anderen. Auch nachdem sich die israelische Armee aus dem Südlibanon zurückgezogen hatte, verstärkte sie die Kontrolle an der Grenze zwischen Ägypten und Gazastreifen und nahm die Beschießung der Stadt Rafah mit Raketen unter dem Vorwand wieder auf, Hamasaktivisten zu verfolgen. Für diejenigen, die noch eine Arbeit haben, gibt es unaufhörlich Kontrollen. Die Bevölkerung lebt in einem ständigen Klima des Terrors und der Unsicherheit. Seit dem 25. Juni wurden in den Territorien 300 Tote gezählt.
Das Fiasko der amerikanischen Politik ist offensichtlich. Deshalb wird die Bush-Administration auch immer mehr in Frage gestellt, und zwar selbst von Leuten aus dem eigenen, republikanischen Lager. Die Gedenkfeiern zum fünften Jahrestag des 11. September waren Anlass für eine geballte Ladung von bissiger Kritik an Bush, die durch die Medien ausgebreitet wurde. Vor fünf Jahren setzte sich die IKS dem Vorwurf aus, sie habe eine machiavellistische Sichtweise der Geschichte, als sie die Hypothese aufstellte und untermauerte, dass das Weiße Haus die Ausführung der Anschläge in Kenntnis der Dinge zuließ, um die sich in Vorbereitung befindenden militärischen Abenteuer zu rechtfertigen.[ii] [217] Heute stellen unglaublich zahlreiche Bücher, Dokumentarfilme, Artikel im Internet nicht nur die offizielle Version über den 11. September in Frage, sondern ein großer Teil dieser Stellungnahmen vertritt wesentlich härtere Theorien und klagt die Bush-Regierung des Komplotts und der konzertierten Manipulation an. In der Bevölkerung selber geht nach den jüngsten Meinungsumfragen mehr als ein Drittel der Amerikaner und fasst die Hälfte der New Yorker Bevölkerung davon aus, dass eine Manipulation hinter den Anschlägen stand, dass der 11. September ein „inside job“ (eine innere Angelegenheit) war.
Während 60% der amerikanischen Bevölkerung den Krieg im Irak für eine „schlimme Sache“ halten, glaubt ein Großteil von ihnen nicht mehr an die These über das Atomwaffenprogramm und ebenso wenig an die Verbindungen zwischen Saddam und Al Kaida, sondern geht davon aus, dass es sich dabei um Vorwände für den Einmarsch im Irak gehandelt hat. Etwa ein halbes Dutzend von kürzlich erschienen Büchern (darunter dasjenige des Starjournalisten Bob Woodward, der den Watergate-Skandal zur Zeit von Nixon aufdeckte) legen unwiderlegbares Material vor, um die „Staatslüge“ zu entlarven und den Rückzug der Truppen aus dem Irak zu fordern. Das bedeutet keineswegs, dass der militaristischen Politik der USA die letzte Stunde geschlagen hätte, doch ist die Regierung gezwungen, dieser Stimmung Rechnung zu tragen und ihre eigenen Widersprüche offen zu legen, um zu versuchen sich anzupassen.
Der angebliche letzte „Schnitzer“ von Bush, der darin bestand, die Parallele zum Vietnamkrieg zuzugeben, fiel zusammen mit anderen „Lecks“ - welche durch die von James Baker persönlich gewährten Interviews medial begleitet wurden. Der Plan des ehemaligen Stabchefs der Ära Reagan und dann Staatssekretärs unter Vater Bush sieht eine Eröffnung des Dialogs mit Syrien und dem Iran und insbesondere den teilweisen Truppenrückzug aus dem Irak vor. Dieser Versuch eines begrenzten Zurückweichens unterstreicht das Ausmaß der Schwächung der amerikanischen Bourgeoisie, für die der sofortige und vollständige Rückzug aus dem Irak die am lautesten schallende Ohrfeige ihrer Geschichte und deshalb untolerierbar wäre. Die Parallele mit dem Vietnamkrieg ist genauer betrachtet eine trügerische Unterschätzung der Lage. Seinerzeit erlaubte der Rückzug der Truppen aus Vietnam eine strategische Neuorientierung, die für die Bündnisse der USA vorteilhaft war und es erlaubte, China aus dem Lager der damaligen UdSSR in ihr eigenes herüberzuziehen. Heute wäre der Rückzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak eine schlichte Kapitulation ohne jeden Ausgleich und würde zu einer völligen Diskreditierung der amerikanischen Macht führen. Ein solcher Rückzug würde gleichzeitig den Zusammenbruch des Iraks nach sich ziehen und damit das Chaos in der ganzen Region beträchtlich vergrößern. Diese Widersprüche sind ein schreiender Ausdruck der Krise, der Schwächung der amerikanischen Vormachtstellung und des fortschreitenden „Jeder-für-sich“, das wiederum das sich zuspitzende Chaos in den internationalen Beziehungen belegt. Und eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im Kongress anlässlich der nächsten Zwischenwahlen, ja selbst die allfällige Wahl eines demokratischen Präsidenten in zwei Jahren würde keine andere Perspektive bieten als die Flucht nach vorn in weitere militärische Abenteuer. Die Bande von Besessenen, die in Washington regiert, hat zwar ein Ausmaß an Inkompetenz unter Beweis gestellt, das durch die amerikanische Verwaltung nur selten erreicht wird. Doch wie auch immer die Ablösungsmannschaft zusammengesetzt sein wird – sie wird die die Matrix nicht ändern können: Angesichts eines kapitalistischen Systems, das in seiner Todeskrise versinkt, ist die herrschende Klasse unfähig, eine andere Antwort anzubieten als die Flucht nach vorn in die Kriegsbarbarei. Auch und gerade die ranghöchste Bourgeoisie der Welt wird sich so an ihre Rolle klammern müssen.
Der Klassenkampf ist die einzige Alternative zur kapitalistischen Barbarei
In den USA ist der zentnerschwere Chauvinismus, der unmittelbar nach dem 11. September überall verbreitet wurde, aufgrund der Erfahrung mit dem doppelten Fiasko des Kampfes gegen den Terrorismus und des Kontrollverlustes im Irakkrieg weitgehend verschwunden. Die Rekrutierungskampagnen der Armee bekunden Mühe bei der Suche nach Kandidaten, die bereit wären, sich im Irak die Haut durchlöchern zu lassen, während die Truppen immer mehr demoralisiert sind. Trotz den sich stellenden Risiken gibt es immer mehr Soldaten, die desertieren. Es sind mehr als 1000 Deserteure gezählt worden, die nach Kanada geflohen sind.
Diese Lage ist aber nicht nur ein Ausdruck der Sackgasse der Bourgeoisie, sondern sie kündigt eine Alternative an. Das immer unerträglichere Gewicht des Krieges und der Barbarei in der Gesellschaft ist eine unabdingbare Dimension im Bewusstwerdungsprozess der Proletarier, wenn es darum geht, den Bankrott des kapitalistischen Systems zu begreifen. Die einzige Antwort der Arbeiterklasse auf den imperialistischen Krieg, die einzige Solidarität, die sie ihren Klassenbrüdern und –schwestern angesichts der schlimmsten Massaker anbieten kann, ist die eigene Mobilisierung auf ihrem Klassenterrain gegen die Ausbeuter. Das bedeutet, zu kämpfen und ihre Kämpfe auf dem gesellschaftlichen Terrain gegen die nationale Bourgeoisie weiter zu treiben. Und dies hat die Arbeiterklasse bereits zu tun begonnen, z.B. im Solidaritätsstreik, den die Flughafenangestellten in Heathrow im August 2005 trotz aller antiterroristischer Kampagnen nach den Anschlägen von London zusammen mit den beim Catering-Unternehmen Gate Gourmet entlassenen pakistanischen Arbeitern führten. Ebenso tat sie es mit der Mobilisierung der zukünftigen Proletarier in Frankreich gegen den Erstanstellungsvertrag (CPE) oder der Metallarbeiter in Vigo in Spanien. Auch die 18'000 Mechaniker von Boeing in den USA zeigten im September 2005 den Weg, als sie sich gegen Rentenkürzungen wehrten und sich gleichzeitig weigerten, eine Diskriminierung der jungen gegenüber den älteren Arbeitern hinzunehmen. Dasselbe gilt für die Angestellten der U-Bahn und des öffentlichen Verkehrs in New York, die kurz vor Weihnachten 2005 in den Streik traten. Konfrontiert mit einem Angriff auf die Renten, der eigentlich vordergründig nur die in Zukunft anzustellenden Arbeiter betroffen hätte, stellten sie ein wachsendes Bewusstsein darüber unter Beweis, dass der Kampf für die Zukunft unserer Kinder Teil unseres Kampfes überhaupt ist. Diese Kämpfe sind noch schwach, und der Weg hin zu entscheidenden Konfrontationen zwischen Bourgeoisie und Proletariat ist noch lang und schwierig, aber sie legen Zeugnis über die Wiederaufnahme des Klassenkampfes in weltweitem Maßstab ab. Sie stellen den einzigen möglichen Hoffnungsschimmer für eine andere Zukunft dar, für eine Alternative der Menschheit zur kapitalistischen Barbarei.
W, 21. Oktober 2006
[i] [217] Diesen Zynismus und diese Heuchelei konnte man deutlich vor Ort anhand einer Kriegsepisode der letzten Kriegstage erkennen. Ein Flüchtlingstreck eines Teils der Bevölkerung eines libanesischen Dorfes, in dem sich viele Frauen und Kinder befanden, welcher aus dem Kampfgebiet fliehen wollte, war wegen einer technischen Panne liegen geblieben und wurde von der israelischen Armee beschossen. Die Flüchtlinge wollten in einem nahe gelegen UN-Kontrollpunkt Unterschlupf suchen. Man antworte ihnen, es sei unmöglich sie unterzubringen, weil man kein Mandat dafür habe. Die meisten Flüchtlinge (58) starben unter israelischem Beschuss und vor den passiven Augen der UNIFIL-Kräfte (so die Zeugenaussage einer Mutter im Fernsehen, deren Familie lebend durchkommen konnte).
[ii] [217] s. unseren Artikel „Pearl Harbor 1941, Twin Towers 2001 – Der Machiavellismus der herrschenden Klasse“, in: Internationale Revu Nr. 29.
Geographisch:
- Naher Osten [77]
Theoretische Fragen:
- Krieg [27]
Vor 100 Jahren: Die russische Revolution von 1905 (Teil 3)
- 5074 Aufrufe
Debatte in der revolutionären Avantgarde über die Folgen von 1905
Die ersten Artikel dieser Reihe warfen einen Blick zurück, um zu überprüfen, was diese Veränderung bedeutete, stellten Form und Inhalt von 1905 dem Vergangenen gegenüber und untersuchten, inwiefern sie der neuen Periode in der Dekadenz des Kapitalismus entsprachen. Wir zeigten auf, dass die Gewerkschaften von den Sowjets als jene organisatorische Form verdrängt wurden, die am besten zum Zweck und Charakter des Kampfes passt, welchen die Arbeiterklasse heute führt. Wir haben gezeigt, dass es falsch war, die Sowjets als ein Produkt der angeblichen Rückständigkeit Russlands zu betrachten, und haben das Augenmerk auf die Tatsache geworfen, dass die Bildung der Sowjets im Gegenteil Ausdruck eines fortgeschrittenen Bewusstseinstandes der Arbeiterklasse war. In dieser neuen Periode hörten die Gewerkschaften auf, ein Mittel zur Durchsetzung der Interessen der Arbeiterklasse zu sein, und verwandelten sich in ein Hindernis gegen die Weiterentwicklung des Kampfes und in eine Falle für die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse sowie ihrer entschlossensten Elemente. Die Entwicklung von Gewerkschaften in Russland 1905 und auch 1917 spiegelte die revolutionäre Leidenschaft der Arbeiterklasse, welche jedes Mittel zu nutzen versuchte, um ihren Kampf voran zu bringen, aber auch einen faktischen Mangel an Erfahrungen mit den Gewerkschaften wider. Es waren die Sowjets, die den Kampf anführten und ihm einen revolutionären Charakter verliehen; die Gewerkschaften trotteten nur hinterher.
Die Entstehung der Sowjets war untrennbar mit dem Massenstreik verbunden, der als Kampfmethode gegen den Kapitalismus auftauchte, als Teilreformen und Linderungen nicht mehr zu erlangen waren. Wie die Sowjets entsprang er einem Bedürfnis der gesamten Klasse und brachte dieselbe nicht nur zusammen, sondern förderte auch ihr Klassenbewusstsein. Dadurch stieß er mit den Beschränkungen der Gewerkschaften und Teilen der revolutionären Bewegung zusammen, die in einer solchen Bewegung nur ein anarchistisches Spektrum erblickten. Es blieb der Linken der Arbeiterklasse, mit Rosa Luxemburg und Anton Pannekoek an der Spitze, überlassen, den Massenstreik nicht als bloße Taktik der Führung, sondern als eine elementare, revolutionäre und erneuernde Kraft zu verteidigen, die inmitten der Arbeiterklasse entstanden war und fähig ist, ihre Kampfbereitschaft und ihr Bewusstsein auf eine neue und höhere Ebene zu stellen.
1905 zeigte auf, dass der Kampf um Reformen vom Kampf für die Revolution verdrängt worden war.
Wir haben ebenfalls darauf hingewiesen, dass diese Veränderungen nichts spezifisch Russisches waren, sondern die gesamte Arbeiterklasse betrafen, als der Kapitalismus in seine dekadente Phase eintrat. Die Arbeiterklasse, die sich als eine internationale Klasse konsolidiert hatte und für ihre Interessen zu kämpfen bereit war, sah sich von nun an mit der Notwendigkeit konfrontiert, den Kapitalismus zu überwinden und die Produktionsverhältnisse umzuwandeln, statt für Verbesserungen in ihnen zu kämpfen. Überall auf der Welt fand in den Jahrzehnten vor dem I. Weltkrieg eine Eskalation und Intensivierung von Streiks statt, die die alten Organisationsweisen und die alten Ziele des Kampfes in Frage zu stellen begannen und die von Zeit zu Zeit in einem offenen Konflikt mit dem Staat aufflammten. Kurzum: Nach 1905 wurde der Kampf der Arbeiterklasse zum Kampf für den Kommunismus.
Die wahre Bedeutung von 1905 ist also, dass dieses Ereignis zukunftsweisend war und den Weg für sämtliche Streiks ebnete, die im dekadenten Kapitalismus stattfanden, das heißt für alle Kämpfe der letzten hundert Jahre und für jene von morgen.
1905 öffnete das Tor zur Zukunft
Die Rolle, die 1905 bei der Wegbereitung der Zukunft spielte, konnte man mit großer Klarheit 1917 sehen, als die Sowjets die Hauptwaffe der Revolution waren. Sie waren die Form, die Letztere annahm. Die Sowjetmacht stand gegen die bürgerliche Macht der Provisorischen Regierung, wie Trotzki beredt in seinem Werk Die Geschichte der Russischen Revolution schilderte: „Wie war die reale Konstitution des Landes nach der Aufrichtung der neuen Macht?Die monarchistische Reaktion verkroch sich in die Löcher. Sobald nur die ersten Wasser der Sintflut zurückwichen, gruppierten sich die Besitzenden aller Arten und Richtungen um das Banner der Kadettenpartei, die mit einem Male die einzige nichtsozialistische Partei und gleichzeitig die äußerste Rechte in der offenen Arena geworden war. (...) Die Massen ergossen sich in die Sowjets wie in ein Triumphtor der Revolution. Alles, was außerhalb der Sowjets blieb, fiel von der Revolution gleichsam ab und schien einer anderen Welt zugehörig (...) Den Sowjets wandten sich alle Aktiven aus den Massen zu, und während der Revolution siegte mehr denn je die Aktivität; da nun die Massenaktivität von Tag zu Tag wuchs, so erweiterte sich die Basis der Sowjets ununterbrochen. Dies war auch die einzige reale Basis der Revolution.“[i] [218]
Die Sowjets – und nur die Sowjets – haben eine Organisationsform, die sowohl für die Mittel als auch den Zweck des Kampfes für den Kommunismus geeignet ist. Jedoch war dies zu damaliger Zeit alles andere als klar, insbesondere für die Revolutionäre in Russland. Dies wurde in der Diskussion über die Gewerkschaftsfrage auf dem Ersten Kongress der Dritten Internationale offensichtlich, wie wir im Artikel „Von Marx zur Kommunistischen Linken, Teil 3“ in der Internationalen Revue Nr. 123 (engl., franz. und span. Ausgabe)[ii] [219] gezeigt haben. Delegierte vieler europäischer Länder prangerten in der Diskussion unmissverständlich die konterrevolutionäre Rolle an, die die Gewerkschaften mittlerweile spielten. Im Gegensatz dazu argumentierte Sinowjew, der den Bericht über Russland verfasste: „Die zweite Organisationsform der Arbeiter in Russland sind die Gewerkschaften. Sie entwickelten sich hier anders als in Deutschland: Sie spielten eine wichtige revolutionäre Rolle in den Jahren 1904-05 und marschieren heute Seite an Seite mit uns in den Kampf für den Sozialismus (...) Eine große Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder unterstützt unsere Parteiposition, und sämtliche Entscheidungen der Gewerkschaften werden im Geiste jener Positionen getroffen“. Dies bestätigt keineswegs, dass die Gewerkschaften in Russland irgendwelche besonderen Tugenden besaßen, sondern bezog sich auf gewisse Besonderheiten der russischen Situation. Wie der Artikel sagt, wurden die Gewerkschaften von der Welle der Sowjets mitgerissen. Während der revolutionären Phase war ihre Rolle als Instrument des kapitalistischen Staates gegen die Arbeiterklasse weniger offensichtlich als sonst.
Auch wenn die Revolution von 1917 erst durch 1905 ermöglicht wurde, konnte die Revolution von 1905 selbst nicht zu einer weltweiten kommunistischen Revolution führen. Dies hätte erst 1917 geschehen können, wenn es der Revolution gelungen wäre, sich überall auf der Welt auszubreiten und zu triumphieren. Dennoch zogen die isolierten Gruppen von Revolutionären, die die Zerschlagung der revolutionären Welle von 1917-23 überlebt und bestrebt waren, die revolutionäre Bewegung neu zu errichten, viele Lehren aus ihr. Hierin bestand insbesondere die Rolle der Kommunistischen Linken. Die Richtigkeit dieser Lehren ist immer wieder auch von den Erfahrungen der Arbeiterklasse in ihrem täglichen Kampf und in ihren größeren Anstrengungen, wie Polen Anfang 1980, bewiesen worden. Bereits unmittelbar nach 1905 wurde begonnen, die Lehren aus dieser Revolution zu ziehen, und genau dieser Arbeit wollen wir uns nun zuwenden.
Die Lehren ziehen: Eine Frage der Methode
In diesem letzten Teil unserer Artikelreihe über 1905 werden wir schauen, wie die revolutionäre Bewegung sowohl bezüglich der Weiterentwicklung ihrer Positionen als auch bezüglich ihrer Methoden antwortete. Dies ist kein unwichtiger Punkt, wenn man berücksichtigt, dass eine Änderung in der tatsächlichen Lage auch andere Mittel erfordert, um mit dieser Situation richtig umzugehen.
Was an der theoretischen Auseinandersetzung und Debatte nach 1905 auffällt, ist ihr kollektiver und internationaler Charakter, auch wenn die Teilnehmer sich nicht immer völlig klar darüber waren.
Während Marx nach der Pariser Kommune von 1870 in der Lage gewesen war, ihre Bedeutung für den Generalrat der Internationalen Arbeiterassoziation (die Erste Internationale) in einer einzigen Broschüre zusammenzufassen, war dies nach 1905 aufgrund der Komplexität der gestellten Frage nicht möglich.
Insbesondere hatten es die Revolutionäre jener Zeit mit einem unerhörten historischen Epochenwechsel zu tun, mit Veränderungen, die viele Annahmen und Errungenschaften der Arbeiterbewegung über den Haufen warfen, wie die Rolle der Gewerkschaften und die Form des Klassenkampfes. Die Leistung der Linken der Arbeiterbewegung bestand nicht nur darin, diese Herausforderungen anzunehmen, sondern auch darin, zu solch tiefer Einsicht in so viele Fragen zu gelangen und solch ein großartiges Vermächtnis an theoretischen Mühen zu hinterlassen, und vor allem in ihrem bemerkenswerten Können bei der Anwendung der marxistischen Methode. Diese Leistung überwiegt bei weitem die Lücken und Schwächen in ihren Bemühungen. Etwas anderes, ja Perfektion zu erwarten ist nicht nur einfach naiv, sondern offenbart auch eine Unfähigkeit, den wahren Charakter des Marxismus und des gesamten Kampfes der Arbeiterklasse zu begreifen. Das wäre so, als erwarte man von der Arbeiterklasse, jeden Streik zu gewinnen, jedes Manöver der Bourgeoisie zu durchschauen und letztendlich imstande zu sein, die kommunistische Revolution aus dem Stand zu machen.
Der manchmal bruchstückhafte Charakter der Debatte und ihrer Beiträge war nicht eine Schwäche, sondern eine unvermeidliche Konsequenz aus der Entwicklung, die in Gestalt der theoretischen Auseinandersetzung als Pendant zur Entwicklung des „praktischen“ Kampfes stattgefunden hat. In der Tat kann man soweit gehen zu sagen, dass das Pendant zum Massenstreik der massenhafte theoretische Kampf ist. Natürlich umfasst Letzterer nicht so große Zahlen wie Ersterer, aber er drückt den gleichen kollektiven Geist aus und erfordert die gleichen Qualitäten der Solidarität, Bescheidenheit und Selbstaufopferung. Vor allem aber erfordert er ein aktives Engagement, wie unsere Genossen von Internationalisme vor fast 60 Jahren betonten: „Entgegen der Idee, dass Militante nur auf der Grundlage von Gewissheiten handeln können (...) bestehen wir darauf, dass es keine Gewissheiten gibt, sondern lediglich ein kontinuierlicher Prozess des Hinwegschreitens über alte Wahrheiten. Allein eine Aktivität, die auf den jüngsten Entwicklungen basiert, auf Fundamenten, die kontinuierlich angereichert werden, ist wirklich revolutionär. Im Gegensatz dazu ist eine Handlungsweise, die auf den Wahrheiten von Gestern beruht, welche bereits ihre Gültigkeit verloren haben, steril, schädlich und reaktionär. Man mag versucht sein, die Mitglieder mit absoluten Gewissheiten und Wahrheiten abzuspeisen, doch nur relative Wahrheiten, die eine Antithese, Zweifel enthalten, können eine revolutionäre Synthese bewirken.“[iii] [220] Dies ist es, was die Linke der Arbeiterbewegung – Lenin, Luxemburg, Pannekoek, etc. – vom Zentrum trennte, das von Kautsky und der offen revisionistischen, von Bernstein angeführten Rechten verkörpert wurde. Der Graben zwischen den Zentristen und der Linken wurde in der Debatte über den Massenstreik deutlich, als Kautsky sich unfähig zeigte, die grundlegenden Veränderungen im Klassenkampf zu erkennen, die von Rosa Luxemburg analysiert worden waren. Außerstande, über die Sichtweise der Vergangenheit hinauszugehen, in der der Massenstreik allein ein vom Zentralkomitee benutztes Werkzeug war, konnte Kautsky Luxemburgs Argumenten nichts abgewinnen und versuchte gar in der zweiten Stufe der Diskussionen, ihre Veröffentlichung zu blockieren.[iv] [221]
Die Debatten nach 1905
Es ist möglich, einige der Schlüsselaussagen aus den Dokumenten und der Debatte, die nach 1905 aufkamen, zu identifizieren:
- Neben den praktischen Lehren von 1905 teilten sie das Merkmal, eher Ansätze denn fertige Produkte zu sein.
- Es wurde keine einzige Arbeit produziert, die eine allgemeine Analyse bewerkstelligte.
- Kein Einzelner widmete sich allen Aspekten des Themas.
- Vieles aus der Diskussion stammte aus vergangenen Diskussionen, wie die Frage des Massenstreiks, der Rolle der revolutionären Organisation und der Arbeiterklasse in der demokratischen Revolution.
Dies spiegelte die Realität eines Epochenwechsels wider, in der es sowohl Abgrenzungen als auch den Versuch gibt, jene Abgrenzungen zu verstehen und zu meistern. In einer Periode immenser Veränderungen sind viele desorientiert. Einige verwerfen die gesamte Vergangenheit, andere hängen an dem, was sie kennen, und versuchen, die Veränderungen zu ignorieren, während wiederum andere die Veränderungen erkennen und bemüht sind, sich ihnen anzupassen, ohne jenes aus der Vergangenheit, was auch weiterhin gültig bleibt, aufzugeben. Diese unterschiedlichen Antworten existierten innerhalb der Arbeiterbewegung und bestimmten die Spaltungen, die sich zwischen den Rechten, dem Zentrum und den Linken entwickelten. Darüber hinaus verlief diese Debatte im Wesentlichen zwischen diesen Tendenzen und nicht zwischen Individuen. Wirkliche Bemühungen, die neue Situation zu verstehen, kamen nur von der Linken. Die Rechte dagegen wandte sich sowohl von den Schlussfolgerungen als auch von der marxistischen Methode ab. Auch die Zentristen kehrten ihr in wachsendem Maße zugunsten einer sterilen, konservativen Orthodoxie, die am deutlichsten von Karl Kautsky verkörpert wurde, den Rücken zu.
Die wesentliche Leistung der Linken bestand in der Erkenntnis, dass die Gesellschaft eine neue Periode betreten hat, und in ihrem Streben nach Verständnis. Dabei vertrat die Linke die marxistische Methode und somit das wahre Vermächtnis von Marx. In Lenins, Luxemburgs und Trotzkis Werken gibt es genug Hinweise darauf, dass die objektiven Bedingungen sie vorwärts getrieben haben. Alle drei entwarfen wichtige Analysen:
- Lenin über die zentrale Rolle der Organisation und auch über das Verhältnis zwischen Strategie und Taktik;
- Trotzki über die große historische Dynamik, die ihn zu einer klaren Sichtweise der Rolle der Sowjets führte; darüber hinaus kam er der Erkenntnis der Eröffnung einer Periode der proletarischen Revolution am nächsten;
- Luxemburg über die Dynamik innerhalb der Klasse, die ihren Ausdruck im Massenstreik findet.
Die theoretischen Bemühungen der Arbeiterklasse waren nicht auf diese drei beschränkt, sondern umfasste auch viele andere linke Strömungen, die entstanden waren, wo immer es eine politische, organisierte Arbeiterbewegung gab. Lenin und Luxemburg sahen sich zu dem Versuch veranlasst, sich über die Veränderungen in den Strukturen des Kapitalismus klar zu werden, auch wenn dies nicht der Zweck ihrer Untersuchung war.
In Anbetracht der Tatsache, dass das Vermächtnis von 1905 das Werk der gesamten Linken der Arbeiterbewegung war, wollen wir, statt uns der Reihe nach mit allen Individuen zu beschäftigen, einen Blick auf ihre Bemühungen werfen, die wichtigen Fragen des Ziels, der Methode und der Form der Arbeiterkämpfe in der neuen Periode zu verstehen.
Das Ziel: die proletarische Revolution
Niemand erklärte es ausdrücklich, aber alle ahnten es: Alle erkannten, dass die proletarische Revolution nicht mehr in ferner Zukunft lag, nicht mehr ein bloßes Ideal war, sondern zu einer unübersehbaren Realität geworden war. Lenin, Trotzki und Luxemburg erklärten zwar formal die bürgerliche Revolution zum Ziel, doch ihre Analysen des Charakters dieser bürgerlichen Revolution und der Rolle der Arbeiterklasse stellten indirekt ihre eigene Annahme in Frage. Sie alle betonten, dass das Proletariat dabei die Hauptkraft sein wird, und erkannten, wenn auch in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlichem Umfang, dass dies die Situation fundamental verändert. Es war also die Methode, die sie gegen jene vereinte, die lediglich die alten Schemata anwendeten.
1906 veröffentlichte Trotzki die Schrift Ergebnisse und Perspektiven, in der er die Idee einer permanenten Revolution (oder der „ununterbrochenen Revolution“, wie sie damals noch genannt wurde) vorstellte. Darin befasste er sich mit den „Voraussetzungen der Revolution“ und vertrat die Ansicht, dass sie alle erfüllt seien.
Die erste Voraussetzung ist „produktionstechnisch“, d.h. sie betrifft den Entwicklungsgrad der Produktionsmittel. Er argumentierte, dass sie erfüllt gewesen sei: „Seit die gesellschaftliche Arbeitsteilung zur Arbeitsteilung in der Manufaktur führte und besonders, seit die Manufaktur von der Fabrik mit maschineller Produktion abgelöst wurde“.[v] [222] Er geht so weit zu behaupten, dass „ausreichende technische Voraussetzungen für die kollektivistische Produktion in diesem oder jenem Umfang schon seit 100 bis 200 Jahren gegeben sind“. Jedoch fügte er hinzu: „Aber die technischen Vorzüge des Sozialismus genügen allein keineswegs, um ihn zu verwirklichen (…) Weil es zu dieser Zeit keine soziale Kraft gab, die bereit und fähig gewesen wäre (ihn) zu realisieren“.
Dies führt zur zweiten Voraussetzung, zur „sozialökonomischen“, mit anderen Worten: zur Entwicklung des Proletariats. Hier stellt Trotzki die Frage: „(…) wie groß muß die relative, zahlenmäßige Stärke des Proletariats sein? Muß es die Hälfte, zwei Drittel oder neun Zehntel der Bevölkerung ausmachen?“, um aber sogleich einen solchen „Schematismus“ zu verwerfen und festzuhalten: „Die Bedeutung des Proletariats beruht ganz und gar auf seiner Rolle in der Großproduktion.“ Für Trotzki zählt allein die qualitative Rolle, die das Proletariat spielt, und nicht so sehr die quantitative Bedeutung. Dies hat zwei wichtige Folgen. Erstens, dass es für das Proletariat nicht notwendig ist, die Mehrheit der Bevölkerung zu bilden, um den Sozialismus einzuführen. Zweitens (und noch spezifischer), dass das Proletariat wegen der Konzentration und der Größe der Industrie ein weitaus größeres Gewicht in Russland besaß, als dies in Ländern wie Großbritannien und Deutschland der Fall war, wo der Anteil des Proletariats an der Gesamtbevölkerung ähnlich hoch war. Nach der Betrachtung der Rolle des Proletariats in anderen großen Ländern zieht Trotzki den Schluss: „Aus all dem können wir zu dem Schluss kommen, dass die ökonomische Evolution – das Wachstum der Industrie, das Wachstum der Großbetriebe. das Wachstum der Städte, das Wachstum des Proletariats im allgemeinen und des Industrieproletariats im besonderen – bereits den Schauplatz bereitet hat, nicht nur für den Kampf des Proletariats um die politische Macht, sondern auch für ihre Eroberung.“
Die dritte Voraussetzung ist die „Diktatur des Proletariats“, mit der Trotzki im Wesentlichen die Entwicklung des Klassenbewusstseins zu meinen scheint: „Es ist (…) notwendig, dass sich diese Klasse ihres objektiven Interesses bewusst ist. Es ist notwendig, dass sie versteht, daß es für sie keinen anderen Ausweg als den Sozialismus gibt; es ist notwendig, dass sie sich zu einer Armee vereint, die stark genug ist, um die Staatsgewalt in offenem Kampf zu erobern.“ Er stellt nicht ausdrücklich fest, ob dies bereits der Fall ist, aber lehnt die Idee vieler „sozialistischer Ideologen“ ab, die besagt: „Das Proletariat und „die Menschheit“ überhaupt müßten vor allem ihre alte egoistische Natur ablegen, im gesellschaftlichen Leben sollten die Impulse des Altruismus vorherrschen usw.“ Diese Erkenntnis über das dynamische Verhältnis zwischen Revolution und Bewusstsein ist eine der wichtigsten Einblicke in die ganze Frage, wie sich eine Revolution entwickelt. Beim Anblick der besonderen Lage in Russland behauptet Trotzki, dass 1905 direkt die Frage der Revolution gestellt habe: „(…) das russische Proletariat (zeigte) eine Kraft, die in diesem ungeheuren Ausmaß von den russischen Sozialdemokraten selbst in ihrer optimistischsten Stimmung nicht erwartet worden war. Der Verlauf der russischen Revolution war in seinen Grundzügen entschieden. Was vor zwei oder drei Jahren eine Möglichkeit war oder schien, ist zur unmittelbaren Wahrscheinlichkeit geworden, und alles spricht dafür, dass diese Wahrscheinlichkeit bereit ist, zur Notwendigkeit zu werden.“ [vi] [223]
Bereits in Ergebnisse und Perspektiven argumentierte Trotzki, dass eine historische Weiterentwicklung das Übergehen der revolutionären Rolle von der Bourgeoisie auf das Proletariat bedeute. Er behauptete, dass die Revolution von 1905 und die Bildung des Petersburger Sowjets dies bestätigten. Dies bedeutete, dass bürgerliche Revolutionen so, wie sie einst betrachtet worden waren, nicht mehr möglich sind. Trotzki lehnte besonders die Idee ab, dass das Proletariat erst eine Revolution ausführt und anschließend die Macht der Bourgeoisie überreicht: „Wenn man sich die Sache so vorstellt, dass die Sozialdemokratie in eine provisorische Regierung eintritt, sie während einer Periode revolutionär-demokratischer Reformen anführt, auch noch ihre radikalsten Maßnahmen verteidigt und sich hierbei auf das Organisierte Proletariat stützt, dass die Sozialdemokratie dann, nachdem das demokratische Programm erfüllt ist, aus dem von ihr gebauten Haus auszieht und den bürgerlichen Parteien den Weg freigibt, selbst in die Opposition geht und damit eine Epoche parlamentarischer Politik eröffnet: sich dies vorzustellen, hieße, die Idee einer Arbeiterregierung kompromittieren. Nicht deshalb, weil es, „prinzipiell“ unzulässig wäre – eine so abstrakte Fragestellung entbehrt jeden Inhalts –, sondern weil es völlig irreal, weil es ein Utopismus übelster Sorte, weil es eine Art von revolutionär-philisterhaftem Utopismus ist.“[vii] [224] Wenn das Proletariat die Mehrheit in der Regierung hält, ist es nicht mehr seine Aufgabe, das Minimalprogramm der Reformen zu verwirklichen, sondern das Maximalprogramm der sozialen Revolution. Dies ist keine Frage des Wollens, sondern der Dynamik der Situation. Trotzki veranschaulichte dies am Beispiel des Achtstundentages. Auch wenn diese Maßnahme „nicht im mindesten den kapitalistischen Verhältnissen widerspricht“, würde seine Einführung dennoch auf den „auf den organisierten und hartnäckigen Widerstand der Kapitalisten stoßen“, der in Aussperrungen und Betriebsschließungen enden würde. Eine bürgerliche Regierung, die damit konfrontiert wäre, würde klein beigeben und die Arbeiter unterdrücken, doch „für eine Arbeiterregierung gibt es nur einen Ausweg: die Enteignung der geschlossenen Fabriken und Betriebe und die Organisation ihrer Produktion auf der Grundlage gesellschaftlicher Rechnungsführung“. Kurz, laut Trotzki „wird die russische Revolution die Bedingungen schaffen, unter denen die Macht in die Hände des Proletariats übergehen kann (und im Falle des Sieges der Revolution muss sie dies tun), bevor die Politiker des bürgerlichen Liberalismus Gelegenheit erhalten ihr staatsmännisches Genie voll zu entfalten“.[viii] [225]
Wie Trotzki stellt auch Lenin die Revolution in den Kontext der internationalen Entwicklung der objektiven Bedingungen: „(…) wir (dürften) einen vollen Sieg der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, d.h. die revolutionäre demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft nicht fürchten (...), denn ein solcher Sieg werde uns die Möglichkeit geben, Europa zur Erhebung zu bringen, und das sozialistische Proletariat Europas werde uns, nachdem es das Joch der Bourgeoisie abgeschüttelt habe, seinerseits helfen, die sozialistische Umwälzung zu vollbringen (...) Der ‚Wperjod‘[ix] [226] zeigte dem revolutionären Proletariat Russlands eine aktive Aufgabe: im Kampf für die Demokratie siegen und diesen Sieg ausnutzen, um die Revolution nach Europa hinüberzutragen.“[x] [227]
Dies ist nur ein Auszug aus einer langen, polemischen Gegenüberstellung der bolschewistischen und menschewistischen Positionen in der Frage der Revolution von 1905, die von beiden als bürgerlich-demokratisch betrachtet wurde. Die Erstgenannten riefen (nimmt man das folgende Zitat aus der Kongressresolution) das Proletariat dazu auf, die Führung zu übernehmen, während die Letztgenannten (nimmt man die Resolution der Konferenz[xi] [228] dazu neigten, die Initiative der Bourgeoisie zu überlassen: „Die Konferenzresolution spricht von der Liquidierung der alten Ordnung im Prozess des beiderseitigen Kampfes zwischen den Elementen der Gesellschaft. Die Parteitagsresolution sagt, dass wir, die Partei des Proletariats, diese Liquidierung vornehmen müssen, dass eine wirkliche Liquidierung nur durch die Errichtung der demokratischen Republik erfolgen kann, dass wir diese Republik erkämpfen müssen, dass wir für sie und für die volle Freiheit nicht nur gegen die Selbstherrschaft, sondern auch gegen die Bourgeoisie kämpfen werden, sobald sie versuchen wird (und sie wird es unbedingt versuchen), uns unsere Errungenschaften zu entreißen. Die Parteitagsresolution ruft eine bestimmte Klasse zum Kampf auf für ein genau bestimmtes nächstes Ziel. Die Konferenzresolution stellt Betrachtungen an über den beiderseitigen Kampf verschiedener Kräfte. Die eine Resolution spiegelt die Mentalität des aktiven Kampfes, die andere die des passiven Zuschauers wider (...)“[xii] [229] Die Betonung der Notwendigkeit für das Proletariat, die führende Rolle zu übernehmen, wird immer und immer wieder von Lenin gegen die Menschewiki zitiert, die er mit Parteirechte meint: „Unser rechter Flügel glaubt nicht an einen vollen Sieg der gegenwärtigen, d.h. der bürgerlich-demokratischen Revolution in Russland, er fürchtet diesen Sieg und stellt die Losung dieses Sieges nicht entschieden und eindeutig vor dem Volke auf. Er irrt ständig zu dem grundfalschen und den Marxismus verflachenden Gedanken ab, dass nur die Bourgeoisie die bürgerliche Revolution selbständig ‚machen’ könne oder dass nur die Bourgeoisie berufen sei, die bürgerliche Revolution zu führen. Die Rolle des Proletariats als des Vorkämpfers für einen vollen und entscheidenden Sieg der bürgerlichen Revolution ist dem rechten Flügel der Sozialdemokratie nicht klar.“[xiii] [230] „In Russland werden der Sozialdemokratie von den gegenwärtigen Verhältnissen solch große Aufgaben auferlegt, wie sie vor keiner einzigen der westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien stehen. Wir sind von der sozialistischen Umwälzung unvergleichlich weiter entfernt als die westlichen Genossen, aber wir stehen vor der bürgerlich-demokratischen Bauernrevolution, in welcher dem Proletariat die Rolle des Führers zufallen wird.“[xiv] [231] Diese Zitate zeigen den dynamischen Charakter der bolschewistischen Position, so dass die Bolschewiki, auch wenn sie nicht erkannten, dass sich die Bedingungen für die proletarische Revolution allgemein entwickelt hatten, dennoch in der Lage waren, die zentrale Rolle, die das Proletariat spielte, zu begreifen und dies deutlich in den Begriffen eines Machtkampfes auszudrücken. Obwohl Lenin ausdrücklich feststellt, dass 1905 eine bürgerliche Revolution gewesen sei[xv] [232], öffnete die von ihm entwickelte Analyse über die besondere Rolle des Proletariats das Tor zur scheinbaren Kehrtwende im April 1917 und zum Aufruf zu einer proletarischen Revolution: „Die Eigenart der gegenwärtigen Lage in Russland besteht im Übergang von der ersten Etappe der Revolution, die infolge des ungenügend entwickelten Klassenbewusstseins und der ungenügenden Organisiertheit des Proletariats der Bourgeoisie die Macht gab, zur zweiten Etappe der Revolution, die die Macht in die Hände des Proletariats und der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muss.“[xvi] [233] Die Frage der unmittelbaren Taktik, die so viel Platz in Lenins Schriften einnimmt und die zu scheinbaren Positionswechseln führt (wie in der Frage der Wahlen zur Duma), rührt aus der ständigen Sorge her, das allgemeine Verständnis der Situation auf die tatsächlichen Aktivitäten der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Organisation zu beziehen, statt in zeitlosen Schemata gefangen zu bleiben.
Luxemburgs Position zur Revolution von 1905 erkennt ebenfalls an, dass diese die Frage der proletarischen Revolution gestellt hat, auch hier trotz der formalen Annahme, dass deren Aufgabe die bürgerliche Revolution sei. Dies ergibt sich aus ihrer Analyse des Massenstreiks als eines Ausdrucks der Revolution: „Der Massenstreik ist bloß die Form des revolutionären Kampfes (...) Der Massenstreik, wie ihn uns die russische Revolution zeigt, ist nicht ein pfiffiges Mittel, ausgeklügelt zum Zwecke einer kräftigeren Wirkung des proletarischen Kampfes, sondern er ist die Bewegungsweise der proletarischen Masse, die Erscheinungsform des proletarischen Kampfes in der Revolution.“ [xvii] [234] Auch sie unterstreicht die zentrale Rolle, die das Proletariat gespielt hatte: „… am 22. Januar … hat zum erstenmal das russische Proletariat als Klasse die politische Bühne betreten, zum erstenmal ist endlich auf dem Kampfplatz diejenige Macht erschienen, die allein geschichtlich berufen und imstande ist, den Zarismus in den Staub zu werfen und in Russland wie überall das Banner der Zivilisation aufzupflanzen. (…) die Macht und die Zukunft der revolutionären Bewegung liegt einzig und allein im klassenbewussten russischen Proletariat“ .[xviii] [235]
Luxemburg äußert sich sehr ausdrücklich über die sich ändernde historische Periode, als sie die Französische, Deutsche und Russische Revolution miteinander vergleicht: „... die heutige russische Revolution steht auf einem Punkt des geschichtlichen Weges, der bereits über den Berg, über den Höhepunkt der kapitalistischen Gesellschaft hinweggeschritten ist, wo die bürgerliche Revolution nicht mehr durch den Gegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat erstickt werden kann, sondern umgekehrt zu einer neuen, langen Periode gewaltigster sozialer Kämpfe entfaltet wird, in denen die Begleichung der alten Rechnung mit dem Absolutismus als eine Kleinigkeit erscheint gegen die vielen neuen Rechnungen, die die Revolution selbst aufmacht. Die heutige Revolution realisiert somit in der besonderen Angelegenheit des absolutistischen Russlands zugleich die allgemeinen Resultate der internationalen kapitalistischen Entwicklung und erscheint weniger ein letzter Nachläufer der alten bürgerlichen als ein Vorläufer der neuen Serie der proletarischen Revolutionen des Westens. Das zurückgebliebenste Land weist, gerade weil es sich mit seiner bürgerlichen Revolution so unverzeihlich verspätet hat, Wege und Methoden des weiteren Klassenkampfes dem Proletariat Deutschlands und der vorgeschrittensten kapitalistischen Länder.“[xix] [236] Später scheint sie sogar zu argumentieren, dass die Aufgabe, der sich das deutsche Proletariat gegenübersieht, die proletarische Revolution sei: „... kann es sich bei einer Periode offener politischer Volkskämpfe in Deutschland als letztes geschichtlich notwendiges Ziel nur noch um die Diktatur des Proletariats handeln.“[xx] [237]
Die Methode: der Massenstreik
Luxemburgs größter Beitrag zur von 1905 angeregten Diskussion ist ihre Publikation Der Massenstreik, die politische Partei und die Gewerkschaften, die sie im August 1906 verfasst hatte[xxi] [238] und in der sie den Charakter sowie die Merkmale des Streiks analysierte. Nach einem Rückblick auf die traditionelle marxistische Position zum Massenstreik, der Kritik an den anarchistischen und revisionistischen Positionen und einem Blick auf die aktuelle Entwicklung des Streiks in Russland fasste Luxemburg die Hauptaspekte des Massenstreiks zusammen.
Erstens und im Gegensatz zu dem, was sich Anarchisten und viele in der sozialdemokratischen Partei darunter vorstellten, ist der Massenstreik nicht ein „Akt, eine Einzelhandlung“, sondern „vielmehr die Bezeichnung, der Sammelbegriff einer ganzen jahrelangen, vielleicht jahrzehntelangen Periode des Klassenkampfes“.[xxii] [239] Dies führt zu einer Unterscheidung zwischen Massenstreiks als „politische Demonstrationsstreiks“ und als „Kampfstreiks“. Erstere sind eine Taktik, die von der Partei gehandhabt wird, und weisen „das größte Maß von Parteidisziplin, bewusster Leitung und politischen Gedanken auf (...), (müssten) also nach dem Schema als die höchste und reifste Form des Massenstreiks erscheinen“.[xxiii] [240] In Wahrheit jedoch gehören sie zu den Anfängen der Bewegung und werden „mit der Entwicklung der ernsten revolutionären Kämpfe“[xxiv] [241] immer unwichtiger. Sie räumen das Feld zugunsten der elementareren Kräfte des kämpferischen Massenstreiks.
Zweitens überwindet diese Form des Massenstreiks die willkürliche Spaltung zwischen den ökonomischen und den politischen Kämpfen: „Jeder neuer Anlauf und neue Sieg des politischen Kampfes verwandelt sich in einen mächtigen Anstoß für den wirtschaftlichen Kampf, indem er zugleich seine äußeren Möglichkeiten erweitert und den inneren Antrieb der Arbeiter, ihre Lage zu bessern, ihre Kampflust erhöht. Nach jeder schäumenden Welle der politischen Aktion bleibt ein befruchtender Niederschlag zurück, aus dem sofort tausendfältige Halme des ökonomischen Kampfes emporschießen. Und umgekehrt. Der unaufhörliche ökonomische Kriegszustand der Arbeiter mit dem Kapital hält die Kampfenergie in allen politischen Pausen wach, er bildet sozusagen das ständige frische Reservoir der proletarischen Klassenkraft, aus dem der politische Kampf immer von neuem seine Macht hervorholt ...“[xxv] [242] Die Einheit zwischen ökonomischen und politischen Kämpfen ist „eben der Massenstreik“.[xxvi] [243]
Drittens ist „der Massenstreik von der Revolution unzertrennlich“. Jedoch lehnt Luxemburg das in der Arbeiterbewegung weit verbreitete Schema ab, nach dem der Massenstreik nur in einer blutigen Konfrontation mit dem Staat enden könne, die durch das Gewaltmonopol des Letztgenannten unvermeidlich zu einem massenhaften Blutvergießen führen müsse. Dies war die Grundlage, auf der der Massenstreik als nutzlose Geste bekämpft wurde. Im Gegensatz dazu entstand er, auch wenn die Russische Revolution sicherlich einen Zusammenstoß mit dem Staat und Blutvergießen beinhaltete, aus den objektiven Bedingungen des Klassenkampfes; er entstand aus dem In-die-Bewegung-Setzen von immer größeren Massen der Arbeiterklasse. Kurz: „... produziert nicht der Massenstreik die Revolution, sondern die Revolution produziert den Massenstreik“.[xxvii] [244]
Viertens kann, wie der vorherige Punkt besagt, ein wirklicher Massenstreik nicht dekretiert oder im Voraus geplant werden. Dies veranlasst Luxemburg dazu, das Element der Spontaneität zu betonen und die Idee zurückzuweisen, dass dies eine Folge der angeblichen Rückständigkeit Russlands sei: „Die Revolution ist, auch wenn in ihr das Proletariat mit der Sozialdemokratie an der Spitze die führende Rolle spielt, nicht ein Manöver des Proletariats im freien Felde, sondern sie ist ein Kampf mitten im unaufhörlichen Krachen, Zerbröckeln, Verschieben aller sozialen Fundamente. Kurz, in den Massenstreiks in Russland spielt das Element des Spontanen eine so vorherrschende Rolle, nicht weil das russische Proletariat ‚ungeschult‘ ist, sondern weil sich Revolutionen nicht schulmeistern lassen.“[xxviii] [245] Auch lässt sie sich nicht dazu verleiten, die Bedeutung der Organisation zu verneinen: „Der Entschluss und Beschluss der Arbeiterschaft spielt auch dabei eine Rolle, und zwar kommt die Initiative sowie die weitere Leitung natürlich dem organisierten und aufgeklärtesten sozialdemokratischen Kern des Proletariats zu.“[xxix] [246]
Luxemburgs Analyse unterscheidet sich deshalb so stark von jenen der Anarchisten und der orthodoxen Marxisten, weil sie innerhalb eines anderen Zusammenhangs angesiedelt ist: in jenem der Revolution. Auf den ersten Seiten von Massenstreik macht sie klar, dass ihre Schlussfolgerungen, die scheinbar jenen von Marx und Engels widersprechen, nur das Ergebnis der Anwendung ihrer Methode auf eine neue Situation sind: „... es sind dieselben Gedankengänge, dieselbe Methode, die der Marx-Engelschen Taktik, die auch der bisherigen Praxis der deutschen Sozialdemokratie zugrunde lagen, welche jetzt in der russischen Revolution ganz neue Momente und neue Bedingungen des Klassenkampfes erzeugten ...“[xxx] [247]
Kurz und gut, Luxemburg präsentiert eine Analyse der revolutionären Dynamik - mit der Arbeiterklasse an der Spitze -, die aus den sich ändernden objektiven Bedingungen entsteht. Dies führt sie richtigerweise dazu, die Spontaneität des Massenstreiks zu betonen, aber auch zur Erkenntnis, dass diese Spontaneität faktisch das Produkt der Erfahrung der Arbeiterklasse ist. Dies unterscheidet sie von solchen Leuten wie Kautsky, der, auch wenn er damals bei der Unterstützung des Massenstreiks gesehen wurde, der orthodoxen Sichtweise verbunden blieb und unfähig war, die fundamentalen Veränderungen zu begreifen, die die Russische Revolution von 1905 verkörperte.
1910 entwickelte sich eine zweite Phase der Debatte über den Massenstreik[xxxi] [248], die zum endgültigen Bruch zwischen Luxemburg und Kautsky führte. In dieser Debatte spielte Pannekoek eine wichtige Rolle und vertrat nicht nur Positionen, die denen Luxemburgs nahe standen, sondern entwickelte sie auch weiter. Er beginnt, indem er ausdrücklich die Frage des Massenstreiks mit den Lehren von 1905 verknüpft: „Das russische Proletariat … hat die Deutschen im Gebrauch einer neuen Waffe unterwiesen, des Generalstreiks“; „Die russische Revolution schaffte die Voraussetzungen für eine revolutionäre Bewegung in Deutschland“.[xxxii] [249] In seiner Auffassung über den Charakter des Massenstreiks folgt er Luxemburg, indem er ihn als einen Prozess betrachtet und Kautskys Auffassung über ihn als einen „einmaligen Akt“ kritisiert. Er argumentiert, dass der Massenstreik eine Fortsetzung des Tageskampfes bilde, und richtet eine Verbindung zwischen den aktuellen Aktionsformen, die eher klein sind, und jenen Aktionen her, die zur Eroberung der Macht führen. Er setzt die Massenaktion in Beziehung zur Entwicklung des Kapitalismus: „... unter dem Einfluss der modernen Formen des Kapitalismus haben sich in der Arbeiterbewegung neue Aktionsformen ausgebildet, die Massenaktionen (...) Als sie sich aber zu einer machtvollen Praxis entwickelten, stellten sie neue Probleme; die Frage der sozialen Revolution – bisher ein Endziel in ungreifbarer Ferne – erhob sich als eine beginnende Gegenwartsfrage vor den Augen des kämpferischen Proletariats.“[xxxiii] [250] Er fährt fort, indem er die dynamischen, entwicklungsfähigen Aspekte des Massenstreiks verteidigt: „Deshalb weisen wir noch einmal darauf hin, dass im Fortschreiten dieser Aktionen, bei denen die tiefsten Interessen und Leidenschaften der Massen zum Durchbruch kommen, nicht die Angehörigkeit zur Organisation, nicht eine traditionelle Ideologie, sondern immer mehr der reale Klassencharakter den Ausschlag gibt.“[xxxiv] [251] Er zieht den Schluss, dass der wesentliche Unterschied zwischen seiner Position und jener von Kautsky in der Frage der Revolution besteht, und zeigt damit, wohin Kautskys Zentrismus führt: „Über diese Revolution sind nun unsere Meinungen auseinander gekommen. Für Kautsky bilden sie einen Akt in der Zukunft, eine politische Katastrophe, und haben wir uns bis dahin nur auf jene große Entscheidungsschlacht vorzubereiten, indem wir unsere Macht zusammenbringen, unsere Truppen sammeln und sie einüben. Für uns ist sie ein Prozess der Revolution – in dessen erste Anfänge wir schon hineinwachsen -, weil die Massen erst gesammelt, eingeübt und zu einer zur Eroberung der Herrschaft fähigen Organisation gemacht werden können durch den Kampf um die Herrschaft selbst. Diese Verschiedenheit der Auffassung ergibt eine durchaus verschiedene Bewertung der Gegenwartsaktionen; und es ist klar, dass die revisionistische Ablehnung jeder revolutionären Aktion und ihre Hinausschiebung in unbestimmte Ferne bei Kautsky sie in mancher Gegenwartsfrage einander nahe bringen müssen, in der sie zusammen uns gegenüberstehen.“[xxxv] [252]
Die Form: die Sowjets
Trotzki schildert die Sowjets in seinem Buch 1905 als sehr mächtig, wie wir in früheren Artikeln dieser Reihe sahen. Am Ende des Buches fasst er in einer Passage, die in dieser Serie bereits teilweise zitiert wurde, die Bedeutung des Sowjets während der Revolution zusammen:
„Bereits vor der Einsetzung des Rates finden wir in den Kreisen des industriellen Proletariats zahlreiche revolutionäre Organisationen, deren Leitung hauptsächlich von der Sozialdemokratie besorgt wurde. Aber das waren Organisationen im Proletariat; ihr unmittelbares Ziel war - der Kampf um den Einfluss auf die Massen. Der Rat aber schwang sich mit einem Schlage zur Organisation des Proletariats auf, sein Ziel war – der Kampf um die revolutionäre Macht. Indem der Delegiertenrat zum Brennpunkt der revolutionären Kräfte des Landes wurde, löste er sich dennoch nicht in dem Chaos der Revolution auf, er war und blieb der organisierte Ausdruck des Klassenwillens des Proletariats. In seinem Kampfe um die Macht bediente er sich der Methoden, die sich aus dem Charakter des Proletariats als einer Klasse naturgemäß ergeben: aus seiner Rolle in der Produktion, seiner Zahl, seiner sozialen Gleichartigkeit. Noch mehr: den Kampf um die Macht an der Spitze aller revolutionären Kräfte verband er mit der allseitigen Leitung der Klassenselbsttätigkeit der Arbeitermassen – er förderte nicht nur die Organisation der Gewerkschaften, er griff sogar in die Konflikte einzelner Arbeiter mit ihren Arbeitgebern (...) Das Hauptkampfmittel des Rates war der politische Massenstreik. Die revolutionäre Wirkung eines solchen Streiks besteht darin, dass sie über den Kopf des Kapitals hinweg die staatliche Gewalt desorganisiert. Je größer und allgemeiner die von ihm herbeigeführte Anarchie wird, um so näher ist der Sieg. Aber nur in einem Falle: wenn diese Anarchie nicht mit anarchistischen Mitteln herbeigeführt wird. Die Klasse, die auf dem Wege der einmaligen Arbeitseinstellung den Produktionsapparat und zu gleicher Zeit den zentralisierten Apparat der Staatsgewalt lahm legt, indem sie die einzelnen Teile des Landes von einander isoliert und eine allgemeine Unsicherheit erzeugt, muss selbst genügend organisiert sein, wenn sie nicht als erstes Opfer der von ihr geschaffenen Anarchie fallen will. Je mehr der Streik die bestehende Staatsorganisation paralysiert, um so mehr muss die Organisation des Streiks selbst die Ausübung der Staatsfunktionen auf sich nehmen. Die Bedingungen des allgemeinen Streiks als eines proletarischen Kampfmittels waren zugleich die Bedingungen des gewaltigen Einflusses des Arbeiterdelegiertenrates.“[xxxvi] [253]
Nach der Niederlage der Revolution schaute er nach vorn, auf die Rolle, die der Rat in Zukunft spielen würde: „Das städtische Russland bildete eine zu schmale Basis für den Kampf. Der Sowjet wollte den Kampf auf Landesebene führen, er selbst blieb jedoch vor allem eine Petersburger Angelegenheit … Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass sich bei der nächsten Revolutionswelle solche Arbeiterräte im ganzen Land bilden werden. Ein allrussischer Arbeitersowjet, der von einem Landeskongress organisiert wird, übernimmt dann die Führung … Die Geschichte wiederholt sich nicht. Der neue Sowjet wird die Erfahrung der fünfzig Tage nicht noch einmal durchmachen müssen. Aber er wird aus diesen fünfzig Tagen sein ganzes Aktionsprogramm herleiten können …: die revolutionäre Kooperation mit der Armee, der Bauernschaft und den unteren Schichten der Mittelklassen; die Beseitigung des Absolutismus; die Zerschlagung des absolutistischen Militärapparats; die partielle Auflösung und partielle Reorganisation der Armee; die Abschaffung der Polizei und des bürokratischen Apparats; den Achtstundentag; die Bewaffnung des Volkes, vor allem der Arbeiter; die Umwandlung des Sowjets in Organe einer revolutionären, städtischen Selbstverwaltung; die Bildung von Bauernsowjets, die an Ort und Stelle die Agrarrevolution überwachen; Wahlen zur konstituierenden Versammlung … Es ist leichter, einen solchen Plan zu formulieren als ihn auszuführen. Aber wenn der Revolution der Sieg bestimmt ist, dann muss das Proletariat diese Rolle übernehmen. Es wird eine revolutionäre Leistung vollbringen, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat.“[xxxvii] [254]
In Ergebnisse und Perspektiven unterstreicht Trotzki, dass die Sowjets eine Kreation der Arbeiterklasse waren, die der revolutionären Periode entsprach: „Das waren keine genau vorbereiteten Verschwörerorganisationen, die in einem Moment der Erregung die Macht über die proletarische Masse ergriffen hatten. Nein, das waren Organe, die von dieser Masse selbst planmäßig zur Koordinierung ihres revolutionären Kampfes geschaffen wurden. Und diese, von der Masse gewählten und der Masse verantwortlichen Sowjets, diese unbedingt demokratischen Einrichtungen, führen eine äußerst entscheidende Klassenpolitik im Geiste des revolutionären Sozialismus.“[xxxviii] [255]
Lenins Haltung gegenüber den Sowjets von 1905 ist bereits in der Internationalen Revue Nr. 123 (engl., franz. und span. Ausgabe) kurz erwähnt worden, in der wir aus einem unveröffentlichten Brief zitierten, worin er die Opposition einiger Bolschewiki gegenüber den Sowjets ablehnte, für „sowohl den Sowjet der Arbeiterdeputierten als auch die Partei“[xxxix] [256] stritt sowie das Argument ablehnte, dass der Sowjet irgendeiner Partei angeschlossen sein müsse. Nach der Revolution verteidigte Lenin beharrlich die Rolle der Sowjets bei der Organisierung und Vereinigung der Klasse. Noch vor dem Vereinigungskongress von 1906[xl] [257] entwarf er eine Resolution über die Sowjets der Arbeiterdeputierten, in der sie als ein Kennzeichen des revolutionären Kampfes anerkannt wurden und nicht als einmaliges Phänomen von 1905: „Sowjets der Arbeiterdeputierten (entstehen) auf dem Boden der politischen Massenstreiks als parteilose Organisationen der breiten Arbeitermassen (…); (sie sind) Keimformen der revolutionären Staatsmacht“[xli] [258] Die Resolution legte ferner die Haltung der Bolschewiki gegenüber den Sowjets dar und schloss, dass die Revolutionäre an ihnen teilnehmen und die Arbeiterklasse so wie auch Bauern, Soldaten und Seeleute dazu veranlassen sollten, sich ebenfalls an ihnen zu beteiligen. Doch warnte die Resolution davor, dass die Ausweitung der Aktivitäten und des Einflusses des Sowjets in sich zusammenbrechen würde, es sei denn, sie würde von einer Armee gestützt: „daher muss die Bewaffnung des Volkes und die Verstärkung der militärischen Organisation des Proletariats als eine Hauptaufgabe dieser Einrichtungen in jeder revolutionären Situation betrachtet werden“.[xlii] [259] In anderen Texten verteidigt Lenin die Rolle der Sowjets als Organe des allgemeinen revolutionären Kampfes, wobei er allerdings sagt, dass sie allein nicht ausreichten, um eine bewaffnete Erhebung zu organisieren. 1917 erkannte er, dass die Ereignisse über die bürgerliche Revolution hinaus auf die proletarische Revolution zusteuerten und dass in ihrem Zentrum die Sowjets stünden: „Keine parlamentarische Republik – von den Sowjets der Arbeiterdeputierten zu dieser zurückzukehren wäre ein Schritt rückwärts -, sondern eine Republik der Sowjets der Arbeiter-, Landarbeiter- und Bauerndeputierten im ganzen Lande, von unten bis oben.“[xliii] [260] Nun analysierte er in Worten, die denen Trotzkis auffallend ähnlich waren, den Charakter der Doppelmacht, die in Russland existierte: „Diese Doppelherrschaft kommt zum Ausdruck im Bestehen zweier Regierungen: der eigentlichen, wirklichen Hauptregierung, der Regierung der Bourgeoisie, der ‚Provisorischen Regierung’ Lwow und Co., die über alle Machtorgane verfügt, und der zusätzlichen, ‚kontrollierenden’ Nebenregierung in Gestalt des Petrograder Sowjets der Arbeiter- und Soldatendeputierten, die über keine Organe der Staatsmacht verfügt, sich aber unmittelbar auf die anerkannt absolute Mehrheit des Volkes, auf die bewaffneten Arbeiter und Soldaten stützt.“[xliv] [261]
Von 1905 zur kommunistischen Revolution
Die Streitfragen, die die Revolution von 1905 provozierte, haben alle folgenden revolutionären Praktiken und Debatten geprägt. In diesem Sinn ziehen wir den Schluss, dass 1905 nicht einfach eine Generalprobe für 1917 war, wie gemeinhin gesagt wird, sondern der erste Akt in einem Drama, das noch nicht sein Finale erreicht hatte. Die Fragen von Theorie und Praxis, die wir in dieser Serie öfters erwähnt haben, wurden kontinuierlich weiterentwickelt. Eine Konstante bestand darin, dass es immer die Linke der Arbeiterbewegung war, die diese Arbeit leistete. Während der revolutionären Welle schlossen sich viele andere Lenin, Luxemburg, Trotzki und Pannekoek an. Im Gefolge ihrer Niederlage, als die Konterrevolution im Allgemeinen und der Stalinismus im Besonderen triumphierten, wurden ihre Reihen drastisch ausgedünnt. Der Stalinismus war die Negation der vielgestaltigen proletarischen Formen von 1905: Arbeiter wurden im Namen des „Arbeiterstaates“ abgeschlachtet, die Sowjets wurden zugunsten einer zentralen Bürokratie erstickt, und der Begriff der proletarischen Revolution wurde zu einer ideologischen Waffe der Außenpolitik des stalinistischen Staates pervertiert.
Jedoch widerstanden überall auf der Welt Minderheiten der Konterrevolution. Die entschlossensten und gründlichsten unter ihnen waren jene Organisationen, die wir als der Kommunistischen Linken angehörig betrachten und die das Thema zahlreicher Studien der IKS gewesen sind.[xlv] [262] Die Fragen des Ziels, der Methode und der Form der Revolution standen im Mittelpunkt ihrer Arbeit, und dank ihren Bemühungen und ihrer Selbstaufopferung sind viele der Lehren von 1905 vertieft und geklärt worden.
Was die zentrale Frage der proletarischen Revolution selbst angeht, so bestand der größte Schritt vorwärts in der Erkenntnis, dass die materiellen Bedingungen für die kommunistische Weltrevolution seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts existierten. Dies wurde auf dem ersten Kongress der Dritten Internationale vertreten und von der Italienischen Kommunistischen Linken mit der Erarbeitung der Theorie der kapitalistischen Dekadenz weiterentwickelt. Sie machte deutlich, dass die Ära der bürgerlichen Revolutionen zu Ende war und dass die Diskussion in Russland über die Rolle des Proletariats nicht faktisch eine Widerspiegelung der Verspätung der bürgerlichen Revolution in diesem Land war, sondern ein Indikator dafür, dass die ganze Welt in eine neue Periode eingetreten war, in der die Aufgabe die weltweite kommunistische Revolution war und bleibt. Diese Klärung schuf den einzigen Rahmen, innerhalb dessen alle anderen Fragen verstanden werden konnten.
Die Anerkennung der unersetzlichen Rolle des Massenstreiks bedeutete ein Wiederaufgreifen der fundamentalen marxistischen Position, dass die Revolution durch eine Klassenschlacht zwischen Proletariat und Bourgeoisie erfolgt. Der parlamentarische Weg war niemals eine Option; genauso wenig würde der Kommunismus das Resultat einer Anhäufung von Reformen durch die Teilkämpfe sein. Die Massenaktion stellt Klasse gegen Klasse. Sie ist auch das Mittel, womit das Proletariat sein Bewusstsein und seine praktische Erfahrung entwickelt. Wie Pannekoek und Luxemburg erkannten, zog sie in immer höherem Tempo Arbeiter an, bildete sie und trainierte sie für den Kampf. Sie ist eine ungleichförmige Bewegung, die aus der Arbeiterklasse entsteht und innerhalb derer die revolutionären Minderheiten eine dynamische Rolle spielen. Ihre Wirklichkeit bestätigt den grundlegenden marxistischen Standpunkt über die Wechselbeziehung zwischen Bewusstsein und Aktion.
Die Diskussion über die Rolle der Sowjets bzw. die Arbeiterräte führte zur Klarheit über die Rolle der Gewerkschaften, über das Verhältnis zwischen revolutionärer Organisation und den Räten und über die ganze Frage der Übergangsperiode vom Kapitalismus zum Kommunismus.
North, 2.2.06
[i] [263] siehe L. Trotzki, 1905, Kap. 10, Die neue Macht.
[ii] [264] Diese Artikel ist Teil der Serie Die Dekadenztheorie im Zentrum des historischen Materialismus und wird voraussichtlich in der Internationalen Revue Nr. 39 auf Deutsch erscheinen.
[iii] [265] Gegen die Auffassung vom ‚genialen Chef‘, Internationale Revue Nr. 33 (engl., franz. und span. Ausgabe).
[iv] [266] s. R. Luxemburg, Die Theorie und die Praxis,https://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1910/theoprax/index.htm [267].
[v] [268] s. L. Trotzki, Ergebnisse und Perspektiven, Kap. 7, Die Voraussetzungen des Sozialismus, http://www.marxists.org/ [269]
deutsch/archiv/trotzki/1906/erg-pers/index.htm
[vi] [270] a.a.O., Kap. 8, Die Arbeiterregierung in Russland und der Sozialismus.
[vii] [271] a.a.O., Kap. 6, Das proletarische Regime.
[viii] [272] a.a.O., Kap. 4, Revolution und Proletariat.
[ix] [273] Wperjod (Vorwärts) wurde von den Bolschewiki gegründet, nachdem die Menschewiki 1903 im Anschluss an den Zweiten Kongress der russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei die Kontrolle über die Iskra (Der Funke) übernommen hatten.
[x] [274] s. W. I. Lenin, Ges. Werke, Band 9, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, Kap. 10, Die ‚revolutionären Kommunen‘ und die revolutionär-demokratische Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft.
[xi] [275] Im April 1905 beriefen die Bolschewiki den Dritten Kongress der RSDAP ein. Die Menschewiki verweigerten ihre Teilnahme und hielten ihre eigene Konferenz ab.
[xii] [276] s. W. I. Lenin, Ges. Werke Bd. 9, Zwei Taktiken der Sozialdemokratie in der demokratischen Revolution, Kap. 4, Die Liquidierung der monarchischen Staatsordnung und die Republik.
[xiii] [277] s. W. I. Lenin, Ges. Werke, Bd. 10, Bericht über den Vereinigungsparteitag der SDAPR, Kap. VIII, Die Ergebnisse des Parteitags.
[xiv] [278] s. W. I. Lenin, Ges. Werke, Bd. 10 S. 428, Der Wahlsieg der Sozialdemokratie in Tiflis, 1906.
[xv] [279] „Der Grad der ökonomischen Entwicklung Russlands (die objektive Bedingung) und der Grad des Klassenbewusstseins und der Organisiertheit der breiten Massen des Proletariats (die subjektive Bedingung, die mit der objektiven unlöslich verbunden ist) machen eine sofortige vollständige Befreiung der Arbeiterklasse unmöglich. Nur ganz unwissende Leute können den bürgerlichen Charakter der vor sich gehenden demokratischen Umwälzung ignorieren ...“ (aus: Zwei Taktiken der Sozialdemokratie ..., Kap. 2, „Was sagt die Resolution des III. Parteitags der SDAPR über die provisorische revolutionäre Regierung?“
[xvi] [280] s. W. I. Lenin, Ges. Werke Bd. 24 S. 4, Über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution (Die Aprilthesen)
[xvii] [281] ) s. R. Luxemburg, Der Massenstreik, die Partei und die Gewerkschaften, Kap. IV
[xviii] [282] s. R. Luxemburg, Die Revolution in Russland, Gesammelte Werke Bd. 1 /2 S. 492 ff.
[xix] [283] s. R. Luxemburg, Der Massenstreik, die Partei und die Gewerkschaften, Kap. VII.
[xx] [284] Ebenda.
[xxi] [285] Es wurde geschrieben, als Luxemburg nach ihrer Entlassung aus polnischer Haft in Finnland war, wo sie sich an der revolutionären Bewegung beteiligt hatte. Es ist möglicherweise aufschlussreich, dass sie viel Zeit in Finnland mit führenden Bolschewiki, einschließlich Lenin, verbrachte.
[xxii] [286] s. R. Luxemburg, Der Massenstreik, die Partei und die Gewerkschaften, Kap. IV.
[xxiii] [287] Ebenda.
[xxiv] [288] Ebenda.
[xxv] [289] Ebenda.
[xxvi] [290] Ebenda.
[xxvii] [291] Ebenda.
[xxviii] [292] Ebenda
[xxix] [293] Ebenda.
[xxx] [294] s.o.; Kap. I.
[xxxi] [295] Siehe unser Buch The Dutch and the German Communist Left für eine breitere Diskussion darüber.
[xxxii] [296] Prussia in Revolt, in: Internationalist Socialist Review“, Band 10, Nr. 11, Mai 1910, www.marxists.org/archive/pannekoe/1910/prussia.htm [297]
[xxxiii] [298] s. A. Pannekoek, Marxistische Theorie und revolutionäre Taktik, in: Die Neue Zeit, XXXI, Nr. 1, 1912, www.marxists.org/archive/pannekoe/1912/tactics.htm [299]
[xxxiv] [300] Ebenda.
[xxxv] [301] Ebenda.
[xxxvi] [302] s. L. Trotzki, 1905, Kap. 22, „Die Bilanz der Revolution“, www.marxists.org/archive/trotsky/1907/1905/ch22.htm [303].
[xxxvii] [304] Aus einem Beitrag zur Geschichte des Sowjets, zitiert nach Isaac Deutscher, Trotzki – Der bewaffnete Prophet 1879–1921, Kap. VI, Die ‚Permanente Revolution’
[xxxviii] [305] Trotzki, Ergebnisse und Perspektiven; Kapitel 3 1789 – 1848 – 1905.
[xxxix] [306] s. W. I. Lenin, Ges. Werke, Bd. 10, Unsere Aufgaben und der Sowjet der Arbeiterdeputierten.
[xl] [307] Der Einheitskongress der SDAPR wurde im April 1906 abgehalten und führte zur Wiedervereinigung der Bolschewiki mit den Menschewiki, was eine Folge der Dynamik der Revolution war.
[xli] [308] s. W. I. Lenin, Ges. Werke Bd. 10 S. 148 f., Taktische Plattform zum Vereinigungsparteitag der SDAPR
[xlii] [309] Ebenda. Es gab keine Diskussion über die Sowjets auf dem Kongress, der von den Menschewiki dominiert war.
[xliii] [310] s. W. I. Lenin, Ges. Werke Bd. 24, Über die Aufgaben des Proletariats in der gegenwärtigen Revolution (Aprilthesen).
[xliv] [311] s. W. I. Lenin, Ges. Werke Bd. 24 S. 45, Über die Aufgaben des Proletariats in unserer Revolution, Die eigenartige Doppelherrschaft und ihre klassenmäßige Bedeutung.
[xlv] [312] siehe unsere Bücher The Italian Left 1926-45, The Dutch and German Communist Left, The Russian Communist Left und The British Communist Left (sie sind auch in anderen Sprachen erschienen, auszugsweise auch auf Deutsch).
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Internationale Revue - 2007
- 4058 Aufrufe
Internationale Revue 39
- 2990 Aufrufe
Brief von Marx an Arnold Ruge, September 1843
- 9174 Aufrufe
M. an R.
Kreuznach, im September
1843
Es freut mich, dass Sie
entschlossen sind und von den Rückblicken auf das Vergangene Ihre Gedanken zu
einem neuen Unternehmen vorwärts wenden. Also in Paris, der alten Hochschule
der Philosophie, absit omen! (möge es nichts Schlimmes bedeuten!)
und der neuen Hauptstadt der neuen Welt. Was notwendig ist, das fügt sich. Ich
zweifle daher nicht, dass sich alle Hindernisse, deren Gewicht ich nicht verkenne,
beseitigen lassen.
Das Unternehmen mag
aber zustande kommen oder nicht; jedenfalls werde ich Ende dieses Monats in
Paris sein, da die hiesige Luft leibeigen macht und ich in Deutschland durchaus
keinen Spielraum für eine freie Tätigkeit sehe.
In Deutschland wird
alles gewaltsam unterdrückt, eine wahre Anarchie des Geistes, das Regiment der
Dummheit selbst ist hereingebrochen, und Zürich gehorcht den Befehlen aus
Berlin; es wird daher immer klarer, dass ein neuer Sammelpunkt für die wirklich
denkenden und unabhängigen Köpfe gesucht werden muss. Ich bin überzeugt, durch
unsern Plan würde einem wirklichen Bedürfnis entsprochen werden, und die
wirklichen Bedürfnisse müssen sich doch auch wirklich erfüllen lassen. Ich
zweifle also nicht an dem Unternehmen, sobald damit ernst gemacht wird.
Größer noch als die
äussern Hindernisse scheinen beinahe die inneren Schwierigkeiten zu sein. Denn
wenn auch kein Zweifel über das „Woher", so herrscht desto mehr Konfusion über
das „Wohin". Nicht nur, dass eine allgemeine Anarchie unter den Reformern
ausgebrochen ist, so wird jeder sich selbst gestehen müssen, das er keine
exakte Anschauung von dem hat, was werden soll. Indessen ist das gerade wieder
der Vorzug der neuen Richtung, dass wir nicht dogmatisch die Welt antizipieren,
sondern erst aus der Kritik der alten Welt die neue finden wollen. Bisher
hatten die Philosophen die Auflösung aller Rätsel in ihrem Pulte liegen, und
die dumme exoterische Welt hatte nur das Maul aufzusperren, damit ihr die
gebratenen Tauben der absoluten Wissenschaft in den Mund flogen. Die
Philosophie hat sich verweltlicht, und der schlagendste Beweis dafür ist, dass
das philosophische Bewusstsein selbst in die Qual des Kampfes nicht nur
äußerlich, sondern auch innerlich hineingezogen ist. Ist die Konstruktion der
Zukunft und das Fertigwerden für alle Zeiten nicht unsere Sache, so ist desto
gewisser, was wir gegenwärtig zu vollbringen haben, ich meine die rücksichtslose
Kritik alles Bestehenden, rücksichtslos sowohl in dem Sinne, dass die
Kritik sich nicht vor ihren Resultaten fürchtet und ebensowenig vor dem Konflikte
mit den vorhandenen Mächten.
Ich bin daher nicht
dafür, dass wir eine dogmatische Fahne aufpflanzen, im Gegenteil. Wir müssen
den Dogmatikern nachzuhelfen suchen, dass sie ihre Sätze sich klarmachen. So
ist namentlich der Kommunismus eine dogmatische Abstraktion, wobei ich
aber nicht irgendeinen eingebildeten und möglichen, sondern den wirklich
existierenden Kommunismus, wie ihn Cabet, Dézamy, Weitling etc. lehren, im Sinn
habe. Dieser Kommunismus ist selbst nur eine aparte, von seinem Gegensatz, dem
Privatwesen, infizierte Erscheinung des humanistischen Prinzips. Aufhebung des
Privateigentums und Kommunismus sind daher keineswegs identisch, und der
Kommunismus hat andre sozialistische Lehren, wie die von Fourier, Proudhon
etc., nicht zufällig, sondern notwendig sich gegenüber entstehn sehn, weil er
selbst nur eine besondre, einseitige Verwirklichung des sozialistischen
Prinzips ist.
Und das ganze
sozialistische Prinzip ist wieder nur die eine Seite, welche die Realität
des wahren menschlichen Wesens betrifft. Wir haben uns ebensowohl um die andre
Seite, um die theoretische Existenz des Menschen zu kümmern, also Religion,
Wissenschaft etc. zum Gegenstande unserer Kritik zu machen. Außerdem wollen wir
auf unsere Zeitgenossen wirken, und zwar auf unsre deutschen Zeitgenossen. Es
fragt sich, wie ist das anzustellen? Zweierlei Fakta lassen sich nicht
ableugnen. Einmal die Religion, dann die Politik sind Gegenstände, welche das
Hauptinteresse des jetzigen Deutschlands bilden. An diese, wie sie auch sind,
ist anzuknüpfen, nicht irgendein System wie etwa die „Voyage en Icarie"
ihnen fertig entgegenzusetzen.
Die Vernunft hat immer
existiert, nur nicht immer in der vernünftigen Form. Der Kritiker kann also an
jede Form des theoretischen und praktischen Bewusstseins anknüpfen und aus den eigenen
Formen der existierenden Wirklichkeit die wahre Wirklichkeit als ihr Sollen
und ihren Endzweck entwickeln. Was nun das wirkliche Leben betrifft, so enthält
grade der politische Staat, auch wo er von den sozialistischen
Forderungen noch nicht bewussterweise erfüllt ist, in allen seinen modernen
Formen die Forderungen der Vernunft. Und er bleibt dabei nicht stehn. Er
unterstellt überall die Vernunft als realisiert. Er gerät aber ebenso überall
in den Widerspruch seiner ideellen Bestimmung mit seinen realen Voraussetzungen.
Aus diesem Konflikt des
politischen Staates mit sich selbst lässt sich daher überall die soziale
Wahrheit entwickeln. Wie die Religion das Inhaltsverzeichnis von den theoretischen
Kämpfen der Menschheit, so ist es der politische Staat von ihren
praktischen. Der politische Staat drückt also innerhalb seiner Form sub
specie rei publicael (als einer besonderen Staatsform) alle sozialen
Kämpfe, Bedürfnisse, Wahrheiten aus. Es ist also durchaus nicht unter der hauteur
des principes (dem Niveau der Prinzipien), die speziellste
politische Frage - etwa den Unterschied von ständischem und repräsentativem
System - zum Gegenstand der Kritik zu machen. Denn diese Frage drückt nur auf politische
Weise den Unterschied von der Herrschaft des Menschen und der Herrschaft des
Privateigentums aus. Der Kritiker kann also nicht nur, er muss in diese
politischen Fragen (die nach der Ansicht der krassen Sozialisten unter aller
Würde sind) eingehn. Indem er den Vorzug des repräsentativen Systems vor dem
ständischen entwickelt, interessiert er praktisch eine große
Partei. Indem er das repräsentative System aus seiner politischen Form zu der
allgemeinen Form erhebt und die wahre Bedeutung, die ihm zugrunde liegt,
geltend macht, zwingt er zugleich diese Partei, über sich selbst hinauszugehn,
denn ihr Sieg ist zugleich ihr Verlust.
Es hindert uns also
nichts, unsre Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahme in der
Politik, also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit ihnen zu
identifizieren. Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen
Prinzip entgegen: Hier ist die Wahrheit, hier kniee nieder! Wir entwickeln der
Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht: Lass ab
von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug; wir wollen dir die wahre Parole des
Kampfes zuschrein. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft, und das
Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch
nicht will.
Die Reform des Bewusstseins
besteht nur darin, dass man die Welt ihr Bewusstsein innewerden lässt,
dass man sie aus dem Traum über sich selbst aufweckt, dass man ihre eignen
Aktionen ihr erklärt. Unser ganzer Zweck kann in nichts anderem bestehn,
wie dies auch bei Feuerbachs Kritik der Religion der Fall ist, als dass die
religiösen und politischen Fragen in die selbstbewusste menschliche Form
gebracht werden.
Unser Wahlspruch muss
also sein: Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch Analysierung
des mystischen, sich selbst unklaren Bewusstsein, trete es nun religiös oder
politisch auf. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von
einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie
wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen großen
Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung
der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich zeigen, dass die
Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte
Arbeit zustande bringt.
Wir können also die
Tendenz unsers Blattes in ein Wort fassen: Selbstverständigung (kritische
Philosophie) der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche. Dies ist eine Arbeit für
die Welt und für uns. Sie kann nur das Werk vereinter Kräfte sein. Es handelt
sich um eine Beichte, um weiter nichts. Um sich ihre Sünden vergeben zu
lassen, braucht die Menschheit sie nur für das zu erklären, was sie sind.
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Der Kommunismus: Der Beginn der wirklichen Geschichte der Menschheit [Serie III - Teil 1]
- 8955 Aufrufe
Der Kommunismus ist die einzige Zukunft
Mit diesem Artikel beginnen wir den dritten Band unserer Kommunismus-Reihe, die vor fast 15 Jahren begonnen wurde. Der zweite Band dieser Reihe (in Internationale Revue Nr. 111, engl., franz. und span. Ausgabe) schloss mit dem Ende einer Periode - der Erschöpfung der internationalen revolutionären Welle, die den Kapitalismus bis in seine Grundfeste erschüttert hatte - und, noch spezifischer, mit einer kühnen Beschreibung der kommunistischen Kultur der Zukunft, die 1924 von Trotzki in seinem Werk Literatur und Revolution umrissen worden war.
Für die proletarische Bewegung war die Klärung ihrer allgemeinen Ziele ein konstantes Element ihres Kampfes gewesen. Diese Artikelreihe hat versucht, ihren eigenen Teil zu diesem Kampf beizutragen, nicht nur indem sie die Geschichte dieser Bewegung nochmals schilderte – auch wenn dies wichtig genug ist angesichts der fürchterlichen Verzerrungen der tatsächlichen Geschichte des Proletariats durch die herrschende Ideologie -, sondern auch indem sie danach strebte, neue oder lange vernachlässigte Gebiete zu erforschen und ein tieferes Verständnis des gesamten kommunistischen Projekts zu entwickeln. In den nächsten Artikeln werden wir daher an den chronologischen Faden der bisherigen Reihe anknüpfen, insbesondere indem wir die Beiträge zu den Problemen der Übergangsperiode untersuchen, die von den linkskommunistischen Fraktionen in der Epoche der Konterrevolution geleistet wurden, welche der historischen Niederlage der Arbeiterklasse gefolgt war. Doch statt die neuen theoretischen Entwicklungen in der Arbeiterbewegung in Fragen des Kommunismus und der Übergangsperiode im Licht der ersten Machtergreifung durch das revolutionäre Proletariat nur zu porträtieren, denken wir, dass es sowohl nützlich als auch notwendig ist, die Ziele und die Methodik dieser Reihe zu klären, indem wir noch einmal zu den Anfängen zurückkehren: Einerseits werden wir zum Beginn dieser Artikelreihen und zum Anfang des Marxismus selbst zurückkehren. Andererseits werden wir die Hauptargumente rekapitulieren, die in den ersten beiden Bänden dieser Reihe entwickelt worden waren, um einen Bericht über die Untersuchungen und Klärungen des Inhalts der kommunistischen Gesellschaft zu erstellen, der die Entwicklung der historischen Erfahrungen des Proletariats begleitet hat. Dies wird schließlich einen stabileren Ausgangspunkt ermöglichen, um die Fragen zu betrachten, welche von den Revolutionären der 1930er und 1940er Jahre gestellt worden waren, und um auch weiterhin das Problem der proletarischen Revolution in unseren Zeiten zu berücksichtigen.
In dieser Ausgabe der Internationalen Revue wollen wir daher detailliert einen zukunftsweisenden Text des jungen Karl Marx untersuchen: den Brief an Arnold Ruge[1] [313] aus dem September 1843, ein Text, der sehr häufig zitiert worden war, aber kaum umfassend analysiert wurde. Es gibt mehr als einen Grund, um auf den Brief an Ruge zurückzukommen. Für Marx und den Marxismus ist es nicht schlicht eine Frage des Kampfes für eine neue Wirtschaftsform anstelle des Kapitalismus, sobald dieser seine historischen Grenzen erreicht hat. Es ist nicht einfach eine Frage des Kampfes für die Emanzipation der Arbeiterklasse. Wie Engels später sagte, geht es darum, es der menschlichen Spezies zu ermöglichen, vom „Reich der Notwendigkeit zum Reich der Freiheit“ überzugehen, von ihrer „Vorgeschichte“ zu ihrer wahren Geschichte. Es geht darum, all das Potenzial zu befreien, das die Menschheit in sich trägt und das in Hunderttausenden von Jahren des Mangels und besonders in den Jahrtausenden der Klassenherrschaft unterdrückt worden war. Der Brief an Ruge weist uns einen Weg aus dieser Problematik, indem er darauf pocht, dass wir kurz vor einer allgemeinen Wiedererweckung der Menschheit stehen. Und wir können sogar noch weiter gehen: Wie Marx in den Ökonomischen und Philosophischen Manuskripten argumentierte, findet das Wiedererwachen des Menschen zur gleichen Zeit statt wie das Wiedererwachen der Natur. Wie der Mensch durch das Proletariat sich seiner selbst bewusst wird, so wird sich die Natur durch den Menschen ihrer selbst bewusst. Zweifellos handelt es sich hier um Fragen, die uns tief in die Erforschung des Menschen führen. Dabei sind die Umrisse ihrer Lösung nicht eine Erfindung eines brillanten Individuums Marx, sondern die theoretische Synthese der realen Möglichkeiten, die sich in der Geschichte eröffnet haben.
Der Brief an Ruge ist eine sehr gute Illustration des Prozesses, durch den sich Marx vom Milieu der Philosophie zur kommunistischen Bewegung entwickelte. Wir haben uns mit dieser Frage bereits im zweiten Artikel der Reihe befasst („Wie das Proletariat Marx für den Kommunismus gewonnen hat“, in unserem Buch Kommunismus: Kein schönes Ideal, sondern eine materielle Notwendigkeit) wo wir zeigen, dass Marx‘ politischer Werdegang in sich selbst eine Veranschaulichung der Tatsache war, die auch im Kommunistischen Manifest geäußert wurde: dass die Ansichten der Kommunisten nicht die Erfindungen individueller Ideologen sind, sondern der theoretische Ausdruck einer lebenden Bewegung, der Bewegung des Proletariats. Wir zeigten insbesondere, wie Marx‘ Einführung in die Arbeiterassoziationen von Paris 1844 einen entscheidenden Anteil daran hatte, ihn für eine kommunistische Bewegung zu gewinnen, die Marx vorausging und unabhängig von ihm entstand. Das Studium von Ruges Brief und anderer Arbeiten durch Marx vor seiner Ankunft in Paris macht deutlich, dass dies keine plötzliche „Konvertierung“ war, sondern der Höhepunkt eines Prozesses, der bereits zuvor im Gange gewesen war. Doch dies ändert nichts an der grundlegenden These. Marx war kein reservierter Philosoph, der aus der sicheren Entfernung seines Elfenbeinturms die Rezeptbücher für die Zukunft ausbrütete. Er bewegte sich zum Kommunismus unter der magnetischen Anziehungskraft einer revolutionären Klasse, die schließlich in der Lage war, sich all seine unbestreitbaren Talente anzueignen und in den Kampf für eine neue Welt einzubeziehen. Und der Brief an Ruge beginnt bereits, wie wir sehen werden, diese biographische Realität in einer kohärenten, theoretischen Herangehensweise gegenüber der Frage des Bewusstseins zu artikulieren.
Von der Kritik der Entfremdung zum historischen Materialismus
Im September 1843 verbrachte Marx mehrere Wochen „Urlaub“ in Kreuznach, zum Teil dank der Aktionen der allgegenwärtigen preußischen Zensur, die Marx der Verantwortung für die Herausgabe der Rheinischen Zeitung enthoben hatte. Die Zeitung wurde nach der Veröffentlichung einer Reihe von „subversiven“ Stücken, einschließlich der Artikel von Marx über die Leiden der Weinbauern der Mosel, geschlossen. Marx nutzte die Freiheit, die ihm so gewährt wurde, um nachzudenken und zu schreiben. Er machte eine eminent wichtige Entwicklungsphase durch, eine Phase des Übergangs von einem radikal-demokratischen Standpunkt zu einer ausdrücklich kommunistischen Position, die er im darauf folgenden Jahr in Paris vertreten sollte.
Es wurde viel geschrieben über „den jungen Marx“, insbesondere über die Arbeiten in den Jahren 1843-44. Einige der wichtigsten Werke dieser Periode blieben noch lange nach dem Tode von Marx unbekannt; insbesondere die Ökonomischen und Philosophischen Manuskripte, die er 1844 in Paris verfasst hatte, wurden erst 1932 veröffentlicht.
Infolgedessen war in einer sehr bedeutsamen Entwicklungsphase der Arbeiterbewegung - nämlich in der gesamten Periode der Zweiten Internationale und während der Bildung der Dritten - den Marxisten viel von den Frühwerken und Ideen von Marx unbekannt geblieben. Einige von den kühnsten Entdeckungen, die in den Ökonomischen und Philosophischen Manuskripten enthalten sind – Schlüsselelemente, die sowohl das Konzept der Entfremdung als auch den Inhalt der menschlichen Erfahrungen in einer Gesellschaft betreffen, in der die Entfremdung überwunden ist -, konnten nicht direkt in die Entwicklung des marxistischen Denkens in dieser gesamten Periode integriert werden.
Dies hatte eine Reihe von ideologischen Interpretationen und Abstufungen zur Folge, die sich im Allgemeinen zwischen zwei Polen ansiedelten. Der eine Pol wurde vom Sprecher der senilsten Form des stalinistischen Intellektualismus personifiziert – Louis Althusser, für den die frühen Werke von Marx in die Kategorie des sentimentalen Humanismus und des jugendlichen Übermuts gehören, die später wohlweislich vom Wissenschaftler Marx abgelegt worden seien, der die zentrale Bedeutung der objektiven Gesetze der Ökonomie betont habe. Objektive Gesetze, die - wenn man vom erhabenen Kauderwelsch der Althusser’schen Theorie zur verständlicheren Anwendung in der Welt der Politik gelangt - glücklicherweise nicht auf ein Ende der Entfremdung weist, sondern auf ein viel erstrebenswerteres staatskapitalistisches Programm der stalinistischen Bürokratie. Der andere Pol ist das Spiegelbild des Hardcore-Stalinisten: Es ist die Ideologie einer Kongregation von Katholiken, Existenzialisten und anderen Philosophen, die zwar ebenfalls eine Kontinuität zwischen den Spätwerken von Marx und den Fünfjahresplänen in der UdSSR ausfindig machen wollen, die uns aber zuflüstern, dass es einen anderen Marx gibt, einen jungen, romantischen und idealistischen Marx, der uns eine Alternative zur geistigen Verarmung anbietet, die den materialistischen Westen plagt. Zwischen diesen beiden Polen gibt es allerlei Arten von Theoretiker – einige von ihnen der Frankfurter Schule[2] [313] oder dem Werk von Lucio Colletti[3] [313] zugetan, andere von Teilaspekten des Linkskommunismus beeinflusst (wie die Publikation Aufheben in Großbritannien) -, die die Tatsache, dass die Zweite Internationale in Angelegenheiten der Philosophie mehr Engels als dem frühen Marx vertraut hatte, dazu benutzt haben, um einen Keil nicht so sehr zwischen den beiden Marx‘, sondern zwischen Marx und Engels bzw. zwischen Marx und der Zweiten und Dritten Internationale zu treiben. In jedem Fall werden die Schurken in diesem Stück als Verfechter einer mechanischen, positivistischen Verzerrung des Denkens von Marx gesehen.
Diese Vorgehensweisen enthalten sicherlich Bruchstücke der Wahrheit in ihren Rezepten. Es ist richtig, dass insbesondere die Periode der Zweiten Internationale eine Arbeiterbewegung erblickte, die immer verwundbarer gegenüber der Penetration der herrschenden Ideologie wurde, was nicht weniger der Fall war auf der Ebene der allgemeinen Theorie (z.B. die Philosophie, die Frage des historischen Fortschritts, die Ursprünge des Klassenbewusstseins) oder auf der Ebene der politischen Praxis (z.B. die Frage des Parlaments, des Minimal- und Maximalprogramms, etc.). Es ist ebenfalls zutreffend, dass das Unwissen über das Frühwerk von Marx die Verwundbarkeit noch verstärkte, manchmal im Zusammenhang mit den weitreichendsten Problemen. Engels seinerseits leugnete nie, dass Marx der größere Denker war, und es gibt Momente in Engels‘ theoretischem Werk, in denen eine volle Assimilierung einiger der Fragen, die in Marx‘ Frühwerk am hartnäckigsten gestellt wurden, in der Tat seine Beiträge auf eine höhere Ebene gehoben hätte. Doch was all den auseinanderstrebenden Vorgehensweisen mangelt, das ist der Sinn für die Kontinuität im Denken von Marx und für die Kontinuität der revolutionären Strömung, die trotz aller Schwächen und Defizite die marxistische Methode angenommen hat, um in der Sache des Kommunismus voranzukommen. In früheren Artikeln dieser Reihe haben wir gegen die Idee argumentiert, dass es eine unüberbrückbare Kluft zwischen der Zweiten Internationale und dem authentischen Marxismus gibt, sowohl vorher als auch nachher (siehe Internationale Revue Nr. 84, engl., franz. und span. Ausgabe). Wir haben ebenfalls auf die Versuche geantwortet, Marx auf der philosophischen Ebene gegen Engels auszuspielen (siehe den Artikel „Die Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse“ in Internationale Revue Nr. 85, engl., franz. und span. Ausgabe, der die von Schmidt und Colletti vertretene Idee ablehnt, dass es bei Marx kein Konzept der Dialektik der Natur gegeben habe). Und wir haben wie Bordiga auf die faktische Kontinuität zwischen dem Marx von 1844 und der Ökonomischen und Philosophischen Manuskripte sowie dem reifen Marx des Kapital bestanden, der seinen früheren Visionen keinesfalls den Rücken kehrte, sondern danach strebte, ihnen ein solideres Fundament und eine wissenschaftlichere Basis zu verschaffen, vor allem durch die Entwicklung der Theorie des historischen Materialismus und durch eine umfassendere Untersuchung der kapitalistischen Nationalökonomie (siehe Internationale Revue Nr. 75, engl., franz. und span. Ausgabe, „Das Kapital und die Prinzipien des Kommunismus“).
Ein Blick auf die unmittelbar „vor-kommunistische“ Phase von Marx, auf den Marx von 1843, unterstützt voll und ganz diese Vorgehensweise gegenüber dem Problem. In der vorhergehenden Periode wurde Marx in wachsendem Maße mit kommunistischen Ideen konfrontiert. Beispielsweise hatte er, als er als Mitherausgeber an der Rheinischen Zeitung beteiligt war, die Treffen eines Diskussionszirkels in den Kölner Büros der Zeitung besucht, der von Moses Hess[4] [313] angeregt wurde, der seine Unterstützung für den Kommunismus bereits erklärt hatte. Sicherlich verpflichtete sich Marx nicht leichtfertig einer Sache. So wie er lange darüber nachdachte, ob er Anhänger Hegels werden sollte, so verweigerte er jegliche oberflächliche Übernahme kommunistischer Theorien, da er wusste, dass viele der existierenden Formen des Kommunismus krude und unterentwickelt waren – dogmatische Abstraktionen, wie er sie in seinem Brief vom September 1843 an Ruge beschrieb. In einem früheren Brief an Ruge (November 1842) schrieb er: „Ich erklärte, dass ich das Einschmuggeln kommunistischer und sozialistischer Dogmen, also einer neuen Weltanschauung, in beiläufigen Theaterkritiken ect. für unpassend, ja für unsittlich halte und eine ganz andere und gründlicher Besprechung des Kommunismus, wenn er einmal besprochen werden sollte, verlange.“ (MEW, Bd. 27, S. 412).
Die Überwindung der Trennung zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft
Schon eine flüchtige Untersuchung der Texte, die Marx in dieser Phase geschrieben hatte, zeigt, dass sein Übergang zum Kommunismus bereits voll im Gange war. Der Haupttext, an dem er während seines Aufenthaltes in Kreuznach arbeitete, war die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Dies ist ein langer und unvollständiger Text, der schwierig zu lesen ist, der aber Marx‘ Ringen mit Feuerbachs Kritik an Hegel aufzeigt. Marx war besonders beeinflusst von Feuerbachs richtiger Umkehrung der idealistischen Spekulationen Hegels, die betont, dass das Denken vom Sein kommt und nicht umgekehrt. Diese Methode durchdringt die Kritik des Staates, der von Hegel als Inkarnation des Denkens statt als die Widerspiegelung der eher erdverbundenen Realitäten des menschlichen Lebens angesehen wurde. Somit waren die Grundlagen gelegt für eine fundamentale Kritik des Staates als solchen. Aus dem Blickwinkel der 1843 verfassten Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie wurde der Staat – auch der moderne repräsentative Staat – schon als ein Ausdruck der Entfremdung der gesellschaftlichen Kräfte des Menschen aufgefasst. Und obwohl Marx noch immer auf das Kommen des allgemeinen Wahlrechts und einer demokratischen Republik setzte, schaute er von Anfang an über das Ideal eines liberalen politischen Regimes hinaus. Denn in den zugegebenermaßen hybriden Formulierungen in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie argumentiert Marx, dass das allgemeine Wahlrecht und – mehr noch - eine radikale Demokratie Vorboten der Überwindung sowohl des Staates als auch der Zivilgesellschaft, d.h. der bürgerlichen Gesellschaft seien: „Im politisch abstrakten Staat ist die Reform des Wahlrechts eine Auflösung des Staates, und gleichfalls die Auflösung der sozialen Gesellschaft.“.
Hier zeigt sich in Embryonalform bereits ein Ziel, das die marxistische Bewegung in ihrer ganzen Geschichte animiert hat: das Absterben des Staates.
In seinem Essay Über die jüdische Frage, gegen Ende 1843 geschrieben, schaut Marx erneut über den Kampf für die Abschaffung feudaler Barrieren hinaus – in diesem Fall die Beschränkungen der Bürgerrechte für Juden, deren Außerkraftsetzung er als einen Schritt vorwärts befürwortete, im Gegensatz zu den Sophismen von Bruno Bauer. Marx zeigt die inhärenten Grenzen des eigentlichen Begriffs der Bürgerrechte, die lediglich das Recht der atomisierten Bürger in einer Gesellschaft konkurrierender Egos bedeuten. Für Marx sollte die politische Emanzipation – mit anderen Worten, die Ziele der bürgerlichen Revolution, die es im rückständigen Deutschland noch zu erreichen galt – nicht mit einer echten gesellschaftlichen Emanzipation verwechselt werden, bei der die Menschheit nicht nur von der Herrschaft fremder politischer Mächte befreit wird, sondern auch von der Tyrannei des Kaufens und Verkaufens. Dies schloss die Überwindung der Trennung zwischen dem Individuum und der Gemeinschaft mit ein. Das Wort Kommunismus wird nicht benutzt, aber die Implikationen sind bereits vorhanden (siehe „Marx und die Judenfrage“ in Internationale Revue Nr. 32, deutsche Ausgabe).
Schließlich sind in der kürzeren, aber weitaus fokussierteren Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (Ende 1843 oder Anfang 1844 verfasst) die Errungenschaften von Marx enorm, und es bedarf eines eigenen Artikels, um sie zu zusammenzufassen. So kurz wie möglich zusammengefasst, umfassen sie zweierlei: Erstens stellt Marx seine berühmte Kritik der Religion vor, die bereits die rationalistische Kritik der bürgerlichen Aufklärung übertraf, indem er erkannte, dass die Macht der Religion aus der Existenz einer Gesellschaftsordnung herrührt, die menschliche Bedürfnisse leugnen muss; zweitens identifiziert er das Proletariat als den Urheber der sozialen Revolution: „In der Bildung einer Klasse mit radikalen Ketten, einer Klasse der bürgerlichen Gesellschaft, welche keine Klasse der bürgerlichen Gesellschaft ist, eines Standes, welcher die Auflösung aller Stände ist, (…) einer Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch die völlige Wiedergewinnung des Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als ein besonderer Stand ist das Proletariat.“ (MEW, Bd. 1, S. 390).
Die Emanzipation des Proletariats ist nicht zu trennen von der allgemeinen menschlichen Emanzipation: Die Arbeiterklasse kann nicht bloß sich selbst von der Ausbeutung befreien, kann nicht als herrschende Klasse ewig fortbestehen, sondern muss als Fahnenträger aller Unterdrückten agieren; es kann sich selbst und die Menschheit auch nicht vom Kapitalismus allein befreien, sondern muss das albtraumartige Gewicht aller bisher existierenden Formen der Ausbeutung und Unterdrückung abschütteln.
Das Proletariat: Urheber des revolutionären Wechsels
Wir sollten auch hinzufügen, dass die beiden letzten Texte, zusammen mit einer Sammlung von Briefen von Marx an Ruge, in einer einzigen Ausgabe der Deutsch-Französischen Jahrbücher im Februar 1844 veröffentlicht wurden. Diese Zeitschrift war die Frucht der Zusammenarbeit von Marx mit Ruge, Engels und anderen[5] [313]. Marx hatte grosse Erwartungen in dieses Unternehmen, von dem er hoffte, dass es Ruges verbotene Deutsche Jahrbücher ersetzen und einen großen Schritt nach vorn machen könnte, indem es feste Verbindungen zwischen französischen und deutschen revolutionären Ideen knüpft, obgleich letztendlich keiner seiner in Aussicht gestellten französischen Mitstreiter diese Ansprüche teilte. Alle Beiträge kamen von deutscher Seite. Es ist äußerst interessant, dass im August-September 1843 Marx einen kurzen Programmentwurf für die Publikation schrieb: „Die Artikel unserer Schrift sollen von Deutschen und Franzosen gemeinsam geschrieben werden und folgendes behandeln:
1. Menschen und Systeme, welche einen nützlichen oder gefährlichen Einfluss errungen haben, und politisch aktuelle Fragen, ob sie nun die Verfassungen, die politische Ökonomie oder die öffentlichen Institutionen und die Moral betreffen.
2. Wir sollten Besprechungen der Presse vorsehen, die eine strenge Kritik der oft in Publikationen vorhandenen Unterwürfigkeit und Niederträchtigkeit darstellen, und helfen, die Aufmerksamkeit auf andere zu lenken, welche im Namen der Menschlichkeit und Freiheit stehen.
3. Wir sollten einen Überblick über die Literatur und die Publikationen des alten Regimes in Deutschland geben, welches niedergeht und sich selber zerstört. Und schlussendlich einen Überblick über die Bücher der zwei Nationen, welche den Beginn und die Fortführung der neuen Ära darstellen, in die wir eintreten.“ (eigene Übersetzung).
Aus diesem Dokument können wir zwei Dinge entnehmen. Erstens, dass selbst auf dieser Stufe Marx‘ Streben ein militantes war: Einen Programmentwurf für eine Publikation zu entwerfen ist, auch wenn nur kurz und allgemein, ein Zeichen dafür, dass die Publikation Ausdruck einer organisierten Tat war. Diese Dimension im Leben von Marx – der Gedanke, sein Leben einer Sache und der Notwendigkeit zu widmen, eine Organisation von Revolutionären aufzubauen – bleibt ein fundamentales Merkmal des proletarischen Einflusses auf Marx, den „Mensch und Kämpfer“, um den Titel der Biographie von Nikolaevski aus dem Jahr 1936 zu benutzen.
Zweitens: wenn Marx über die „neue Ära“ spricht, so müssen wir uns vergegenwärtigen, dass, während in Deutschland und im größten Teil Europas die neue Ära den Sturz des Feudalismus und den Triumph der demokratischen Bourgeoisie bedeutete, es auch eine mächtige Tendenz in Marx‘ und Engels‘ anfänglichem Bekenntnis zum Kommunismus gab, die bürgerliche mit der proletarischen Revolution zu verschmelzen und zu meinen, dass ziemlich schnell eine nach der anderen folgen werde. Dies wird deutlich aus Marx‘ Identifizierung des Proletariats als Urheber des revolutionären Wechsels selbst im rückständigen Deutschland, und es wird noch deutlicher im Anspruch, der vom Kommunistischen Manifest und in seiner Theorie der permanenten Revolution, die er im Anschluss an die Aufstände von 1848 erarbeitet hatte, erhoben wurde. Bezogen auf das Denken von Marx 1843 und 1844, müssen wir folgern, dass bei der Vorwegnahme einer „neuen Ära“ der Blick von Marx weniger auf die Übergangskämpfe für eine bürgerliche Republik gerichtet war, sondern weitaus mehr auf die nachfolgende Auseinandersetzung für eine wahrhaft menschliche Gesellschaft, die frei von kapitalistischem Egoismus und Ausbeutung ist. Was Marx sein ganzes Leben hindurch antrieb, war vor allem dieses Gespür für die Möglichkeit solch einer Gesellschaft. Später erkannte er immer deutlicher, dass der direkte Kampf für solch eine Welt noch nicht auf der Tagesordnung der Geschichte stand, dass die Menschheit noch die Kavallerie des Kapitalismus vorbeiziehen lassen musste, damit die materiellen Grundlagen für die neue Gesellschaft gelegt werden; doch diese ursprüngliche Inspiration hat ihn niemals verlassen.
Der Marxismus ist kein geschlossenes System
Es ist daher unsinnig, eine strikte Unterscheidung zwischen dem jungen und dem alten Marx zu machen. Die Texte von 1843-44 waren allesamt wichtige Schritte in Richtung einer voll entwickelten kommunistischen Weltanschauung, noch bevor er bewusst oder ausdrücklich sich selbst als Kommunist definierte. Darüber hinaus ist das Tempo der Entwicklung von Marx äußerst bemerkenswert. Nach dem Verfassen der oben erwähnten Texte zog er nach Paris. Im Sommer 1844 stellte Marx, offensichtlich beeinflusst von seiner direkten Einbeziehung in die kommunistischen Arbeiterassoziationen dieser Stadt, die Ökonomischen und Philosophischen Manuskripte fertig, in denen er sich für den Kommunismus ausspricht. Ende August traf er Engels, der in der Lage war, zu einem weitaus direkteren Verständnis der Funktionsweise des Kapitalismus beizutragen. Ihre Zusammenarbeit wirkte sich auf das Werk von Marx noch dynamisierender aus, und ab 1845 war er durch seine Thesen zu Feuerbach und die Deutsche Ideologie in der Lage, die Grundlagen der materialistischen Theorie der Geschichte zu präsentieren. Und da der Marxismus, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, kein geschlossenes System ist, sollte sich dieser Prozess der Evolution und Selbstentwicklung bis zum Ende des Lebens von Marx fortsetzen (siehe zum Beispiel den Artikel aus dieser Reihe über den „späten Marx“ in Internationale Revue, Nr. 81, engl., franz. und span. Ausgabe, der erzählt, wie Marx sich selbst Russisch beigebracht hat, um sich mit der russischen Frage zu befassen, und Antworten produziert hat, die einige seiner engen Anhänger durcheinandergebracht haben).
Der September-Brief an Ruge, den wir unten in Gänze abdrucken, muss im Zusammenhang mit dem oben Genannten verstanden werden. Es ist kein Zufall, dass die gesamte Sammlung der Briefe in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern veröffentlicht wurde; diese Briefe wurden selbst damals selbstverständlich als Beiträge zur Erarbeitung eines neuen Programms oder zumindest einer neuen politischen Methode betrachtet. Und der letzte Brief ist der „programmatischste“ von allen. Durch die Chronologie der Briefe können wir Marx‘ Entscheidung nachvollziehen, Deutschland zu verlassen, wo seine Aussichten noch prekärer geworden waren aufgrund einer Kombination von familiären Unstimmigkeiten und Schikanierungen durch die Behörden. Im September-Brief räumt Marx ein, dass er es immer schwieriger fand, in Deutschland zu atmen, und dass er sich entschlossen habe, nach Frankreich zu gehen – das Land der Revolutionen, wo sich sozialistisches und kommunistisches Gedankengut überschäumend und in mannigfaltigen Richtungen entwickelte. Ruge, der ehemalige Herausgeber der unterdrückten Deutschen Jahrbücher, war ein williger Helfer bei der Umsetzung des Plans, die Deutsch-Französischen Jahrbücher zu etablieren. Doch ihre Wege sollten sich trennen, als Marx einen ausdrücklich kommunistischen Standpunkt einnahm, und Ruge gegenüber Marx seine Entmutigung infolge der Erfahrungen mit der deutschen Zensur und mit der philisterhaften Atmosphäre in Deutschland eingestand. So war Marx‘ vorletzter Brief an Ruge (im Mai 1843 in Köln verfasst) zu einem gewissen Teil dem Zweck gewidmet, Ruges Stimmung aufzuhellen, und gibt uns einen guten Einblick in die optimistische Geistesverfassung von Marx in jener Zeit: „Von unserer Seite muss die alte Welt vollkommen ans Tageslicht gezogen und die neue positiv ausgebildet werden. Je länger die Ereignisse der denkenden Menschheit Zeit lassen, sich zu besinnen, um so vollendeter wird das Produkt in die Welt treten, welches die Gegenwart in ihrem Schosse trägt.“ (MEW, Bd. 1, S. 343).
Der Kampf gegen den Dogmatismus
Zu der Zeit, als Marx den September-Brief schrieb, hatte sich Ruges Depression gebessert. Marx wollte unbedingt das politische Vorgehen skizzieren, das in ihrem angestrebten Unternehmen herrschen sollte. So war er sorgsam darauf bedacht, jegliches dogmatische und sektiererische Vorgehen zu vermeiden. Es muss daran erinnert werden, dass dies der Gipfelpunkt des utopischen Sozialismus aller Arten war, von denen fast alle auf abstrakten Spekulationen darüber beruhten, wie eine neue und gerechtere Gesellschaft funktionieren kann, und wenig oder keine Verbindung zu den realen, bodenständigen Kämpfen hatten, die sich rings um sie herum ereigneten. In vielen Fällen offenbarten die Utopisten eine überhebliche Verachtung sowohl gegenüber den Forderungen der demokratischen Opposition gegen den Feudalismus als auch gegenüber den unmittelbaren ökonomischen Forderungen der frisch aus der Taufe gehobenen Arbeiterklasse. Und selten warteten sie mit einem besseren Plan für die Institutionalisierung der neuen gesellschaftlichen Ordnung auf, als die Bettelschale an reiche bürgerliche Philantropen zu übergeben. Daher tat Marx viele Abarten des zeitgenössischen Sozialismus als Formen des Dogmatismus ab, die die Welt mit fertigen Schemata konfrontierten und den praktischen politischen Kampf als ihrer Aufmerksamkeit nicht wert betrachteten. Gleichzeitig macht Marx klar, dass er sich der verschiedenen Richtungen innerhalb der kommunistischen Bewegung wohl bewusst war und dass einige von ihnen – er erwähnt Proudhon und Fourier[6] [313] – lohnenswerter für Untersuchungen sind als andere. Doch der Schlüssel ist seine Überzeugung, dass eine neue Welt nicht vom Himmel fällt, sondern dass Resultat von Kämpfen in der realen Welt sein muss. Daher die berühmten Zeilen: „Es hindert uns also nichts, unsre Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahmen in der Politik, also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit ihnen zu identifizieren. Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die Wahrheit, hier kniee nieder! Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht: Lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug; wir wollen dir die wahre Parole des Kampfs zuschrein. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft, und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch nicht will.“ (MEW, Bd. 1, S. 345).
Im Kern ist dies, wie Lukacs in seinem 1920er Essay Klassenbewusstsein unterstreicht, bereits eine materialistische Analyse: Es geht nicht darum, einem unbewussten Ding Bewusstsein beizubringen – die Essenz des Idealismus -, sondern darum, einen Prozess bewusst zu machen, der sich bereits in eine bestimmte Richtung bewegt; einen Prozess, der von materiellen Notwendigkeiten angetrieben wird, was auch die Notwendigkeit umfasst, sich seiner selbst bewusst zu werden.
Es trifft sicherlich zu, dass Marx noch immer größtenteils über den Kampf für die politische Emanzipation spricht – zur Vervollständigung der bürgerlichen Revolution vor allem in Deutschland. Die Betonung der Kritik an der Religion, der Intervention in zeitgenössischen politischen Fragen (wie die Unterschiede zwischen dem Ständestaat und der repräsentativen Regierung), aber auch der Möglichkeit, dass diese Aktivitäten „das Interesse einer großen Partei gewinnen“ werden – d.h. Einfluss auf die liberale Bourgeoisie - bestätigt dies. Doch wir sollten nicht vergessen, dass Marx kurz davor stand, das Proletariat als Urheber des gesellschaftlichen Wandels anzukündigen, eine Schlussfolgerung, die bald darauf sowohl auf das feudale Deutschland als auch auf die höher entwickelten kapitalistischen Länder angewandt werden sollte. Daher kann die Methode gleichermaßen – ja, sogar noch spezifischer – auf den proletarischen Kampf für Sofortforderungen angewendet werden, ob wirtschaftlich oder politisch. Dies ist in der Tat eine profunde Antizipation des Kampfes gegen die sektiererische Vorgehensweise, die später für Bakunin typisch war. Doch es ist auch mit den Formulierungen in Die Deutsche Ideologie verknüpft, die den Kommunismus als „die reelle Bewegung, welche die bestehenden Verhältnisse überwindet“, die das revolutionäre Bewusstsein in der Existenz einer revolutionären Klasse lokalisiert und das kommunistische Bewusstsein ausdrücklich als eine historische Auswirkung der ausgebeuteten Klasse definiert. Die Kontinuität mit den Thesen über Feuerbach – das Verständnis, dass die Erzieher auch erzogen werden müssen – ist gleichermaßen evident. Zusammen sind diese Arbeiten eine Warnung gegen all die modernen Erlöser des Proletariats, gegen all jene, die das sozialistische Bewusstsein als etwas betrachten, das den niederen Arbeitern von irgendeiner höheren Instanz beigebracht werden muss.
<<>>Der Kommunismus in Kontinuität mit der Geschichte der Menschheit>
Die abschließenden Paragraphen des Briefes fassen das Vorgehen von Marx bei der politischen Intervention zusammen, aber sie nehmen uns auch mit in tieferes Wasser: „Unser Wahlspruch muss also sein: Reform des Bewusstseins nicht durch Dogmen, sondern durch die Analysierung des mythischen, sich selbst unklaren Bewusstseins, trete es nun religiös oder politisch auf. Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen. Es wird sich zeigen, dass es sich nicht um einen grossen Gedankenstrich zwischen Vergangenheit und Zukunft handelt, sondern um die Vollziehung der Gedanken der Vergangenheit. Es wird sich endlich zeigen, dass die Menschheit keine neue Arbeit beginnt, sondern mit Bewusstsein ihre alte Arbeit zustande bringt.
Wir können also die Tendenz unseres Blattes in ein Wort fassen: Selbstverständigung (kritische Philosophie) der Zeit über ihre Kämpfe und Wünsche. Dies ist eine Arbeit für die Welt und für uns. Sie kann nur das Werk vereinter Kräfte sein. Es handelt sich um eine Beichte, um weiter nichts. Um sich ihre Sünden vergeben zu lassen, braucht die Menschheit sie nur für das zu erklären, was sie sind.“ (MEW, Bd. 1, S. 346)
In George Elliots großartigem Roman über das Gesellschaftsleben in England Mitte des 19. Jahrhunderts, Middlemarch, gibt es eine Figur, die sich Casaubon nennt, ein staubtrockener Gelehrter und ein Mann der Kirche mit unabhängigen Mitteln, der sein Leben dem Verfassen eines monumentalen und möglichst definitiven Werkes widmet, das den Titel Der Schlüssel zu allen Mythologien tragen soll. Dieses Werk wird niemals vollendet, und dies ist ein symbolischer Ausdruck für die Trennung dieser Figur vom realen menschlichen Leben und seinen Leidenschaften. Doch wir können dies auch als eine Gleichnis über das bürgerliche Gelehrtentum im Allgemeinen nehmen. In ihrer Aufstiegsperiode entwickelte die Bourgeoisie ein Gespür für universelle Fragen und für die Suche nach universellen Antworten. Doch diese Suche wurde in ihrer dekadenten Phase immer mehr aufgegeben, denn das Stellen solcher Fragen führt zur unbequemen Konsequenz ihres Dahinscheidens als Klasse. Casaubons Scheitern nimmt somit die intellektuelle Sackgasse des bürgerlichen Denkens vorweg. Marx dagegen bietet uns in einigen kurzen Bemerkungen den Ansatz einer Vorgehensweise an, die uns einen Zugang zu sämtlichen Mythologien anbietet. So wie Marx im September-Brief sagt, dass die Religion das „Inhaltsverzeichnis von den theoretischen Kämpfen der Menschheit ist.“, so ist die Mythologie das Register der Psyche der Menschheit seit ihren Anfängen, sowohl in ihren Grenzen als auch in ihrem Streben. Das Studium der Mythologie verschafft uns einen Einblick in die Bedürfnisse, die diesem Streben Vorschub leisten.
David McLellan, vielleicht einer der besten Marx-Biographen seit Mehring, kommentiert, dass „der Begriff der Erlösung durch eine ‚Reform des Bewusstseins‘ natürlich sehr idealistisch war. Doch dies war nur zu typisch für die deutsche Philosophie jener Zeit“ (Karl Marx, His Life and Thought, 1973, S. 77; eigene Übersetzung). Dies ist sicherlich ein zu statischer Blick auf die Formulierungen von Marx. Wenn wir die Tatsache berücksichtigen, dass Marx diese „Reform des Bewusstseins“ bereits als das Produkt der realen Kämpfe betrachtete, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Marx bereits im Begriff war, das Proletariat als Träger dieses „reformierten“ Bewusstseins zu betrachten, dann ist es offensichtlich, dass Marx bereits die Dogmen der zeitgenössischen deutschen Philosophie hinter sich gelassen hat. Wie Lukacs später in den Essays, die in Geschichte und Klassenbewusstsein enthalten sind, klarstellte, hat das Proletariat als erste Klasse, die sowohl ausgebeutet als auch revolutionär ist, kein Bedürfnis nach ideologischen Mystifikationen. Sein Klassenbewusstsein ist daher erstmals ein klares Bewusstsein, das einen fundamentalen Bruch mit allen Formen der Ideologie markiert[7] [313]. Der Begriff eines Bewusstseins, das so klar über sich ist, ist eng mit Marx‘ Annäherung gegenüber dem Proletariat verknüpft. Und es war dieselbe Bewegung, die Marx und Engels in die Lage versetzte, eine materialistische Geschichtstheorie zu erarbeiten, die anerkennt, dass der Kommunismus nicht mehr nur eine „schöne Idee“ ist, weil der Kapitalismus die materiellen Voraussetzungen für eine Gesellschaft des Überflusses gelegt hat. Die Fundamente dieses Verständnisses sollten nur zwei Jahre später in Die deutsche Ideologie vorgestellt werden.
<<>>Das Proletariat sieht sich selbst als Verteidiger all dessen, was menschlich ist>
Es könnte auch der Vorwurf erhoben werden, dass die Formulierungen von Marx im September-Brief noch im Rahmen des Humanismus, einer alle Klassen umfassenden Sichtweise der Menschheit gefangen waren. Doch wie wir gezeigt haben, ist es augenscheinlich, dass keines der humanitären Überbleibsel ihn daran hinderte, einen Klassenstandpunkt einzunehmen, da Marx bereits zur proletarischen Bewegung tendierte. Abgesehen davon, ist es nicht nur zulässig, sondern auch notwendig, von der Menschheit, von der Spezies als eine Realität und nicht als eine Abstraktion zu sprechen, wenn wir die wahren Dimensionen des kommunistischen Projektes begreifen wollen. Denn auch wenn das Proletariat die kommunistische Klasse par excellence ist, so beginnt das Proletariat dennoch keine „neue Arbeit“. Die Ökonomischen und Philosophischen Manuskripte sollten, wie wir gesehen haben, klar machen, dass der Kommunismus auf der Wiederentdeckung des gesamten Reichtums der menschlichen Vergangenheit beruhen muss. Aus dem gleichen Grund lesen wir darin: „Die ganze Bewegung der Geschichte ist daher, wie sein wirklicher Zeugungsakt – der Geburtsakt seines empirischen Daseins – so auch für sein denkendes Bewusstsein die begriffne und gewusste Bewegung seines Werdens, (…)“ (MEW, Bd. 40, S. 536). Der Kommunismus ist daher das Werk der Geschichte, und der Kommunismus des Proletariats ist die Klärung und Synthese aller früheren Kämpfe gegen Elend und Ausbeutung. Daher nannte Marx unter anderen auch Spartakus als eine der historischen Figuren, die er am meisten bewunderte. Indem er noch weiter zurückschaut, wird der künftige Kommunismus auf einer höheren Stufe die Einheit der Stammesgemeinschaften wieder entdecken, in der die Menschheit den größten Teil ihrer Existenz verbrachte, vor dem Aufkommen der Klassenteilungen und der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen.
Das Proletariat sieht sich selbst als Verteidiger all dessen, was menschlich ist. Auch wenn es heftig die Unmenschlichkeit der Ausbeutung anprangert, predigt es nicht eine Haltung des Hasses, nicht einmal gegenüber dem einzelnen Ausbeuter. Auch betrachtet es andere unterdrückte Klassen und gesellschaftliche Schichten, vergangene oder gegenwärtige, nicht mit Geringschätzung oder Überheblichkeit. Die falsche Ansicht, dass der Kommunismus die Vernichtung aller Kultur bedeute, da diese bis jetzt den Ausbeutern gehörte, wurde in den Ökonomischen und Philosophischen Manuskripten als „kruder Kommunismus“ zusammengestaucht. Es ist eine negative Tradition, die die Arbeiterbewegung seit jeher plagte, zum Beispiel in gewissen Formen des Anarchismus, welche sich an der Plünderung und Zerstörung der kulturellen Symbole der Vergangenheit ergötzten. Und als die Dekadenz des Kapitalismus sich mit der stalinistischen Konterrevolution verband, hat sie besonders abscheuliche Charaktere ausgebrütet, wie die maoistischen Kampagnen gegen „die vier Alten“[8] [313] während der so genannten Kulturrevolution. Doch simplifizierende und destruktive Verhaltensweisen gegenüber der vergangenen Kultur manifestierten sich auch während der heroischen Tage der Russischen Revolution, als besonders Repressionsorgane wie die Tscheka oftmals ein schroffes und rachsüchtiges Verhalten gegenüber „Nicht-Proletariern“ an den Tag legten, was gelegentlich betrachtet wurde, als sei es eine nahezu natürliche Eigenschaft des „reinen“ Proletariers. Die marxistische Anerkennung der historischen Rolle der Arbeiterklasse hat nichts gemein mit dieser Art von „Arbeitertümelei“, mit der permanenten Huldigung des Proletariats und auch nichts mit dem Philistertum, das die gesamte Kultur der alten Welt ablehnt (siehe insbesondere den Artikel in dieser Reihe über Trotzki und die proletarische Kultur in Internationale Revue, Nr. 30, deutsche Ausgabe). Der Kommunismus der Zukunft wird das Beste aus den kulturellen und moralischen Bestrebungen der menschlichen Spezies in sich einverleiben.
Amos
[1] [313] Arnold Ruge (1802-1880) war ein junger Linkshegelianer, der mit Marx in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern zusammenarbeitete, ehe er die Beziehungen zu ihm abbrach. 1866 wurde er Anhänger Bismarcks.
[2] [313] Die Frankfurter Schule wurde 1923 gegründet. Ihr anfänglicher Zweck war das Studium gesellschaftlicher Phänomene. Nach dem Krieg war sie weniger ein Institut für gesellschaftliche Untersuchungen sondern mehr eine intellektuelle Strömung (Marcuse, Adorno, Horkheimer, Pollock, Grossman, etc.), die behauptete, von Marx beeinflusst zu sein.
[3] [313] Lucio Colletti (1924-2001) war ein italienischer Philosoph, der Marx eher für einen Nachfolger Kants denn Hegels hielt. Autor zahlreicher Werke einschließlich Marxismus und Hegel und die Einleitung zu Marx‘ frühen Schriften. Nachdem er eine gewisse Zeitlang Mitglied der italienischen KP gewesen war, bewegte er sich auf die Sozialdemokratie zu und beendete seine politische Karriere schließlich als Mitglied in Berlusconis Regierung.
[4] [313] Moses Hess (1812-1875) war Junghegelianer, Mitbegründer und Mitarbeiter von Marx in der Rheinischen Zeitung. Ein Gründer des „wirklichen Sozialismus“ in den 1840er Jahren.
[5] [313] So wie auch die Texte von Marx die bereits erwähnt wurden, enthalten die Deutsch-Französischen Jahrbücher den Brief von Marx an den Herausgeber der Allgemeinen Zeitung (Augsburg), zwei Artikel von Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie und eine Revue von Thomas Carlyle Vergangenheit und Gegenwart. Marx hat im Oktober 1843 auch an Feuerbach geschrieben, in der Hoffnung, dass Feuerbach mitarbeiten würde, doch anscheinend war Feuerbach noch nicht bereit, vom Gebiet der Theorie auf das Feld der politischen Tat überzuwechseln.
[6] [313] Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865): französischer Drucker, Journalist und Mitglied der Nationalversammlung im Jahr 1848. Marx kritisierte seine ökonomischen Theorien in Das Elend der Philosophie. Charles Fourier (1772-1837): französischer utopischer Sozialist, der einen beträchtlichen Einfluss auf die spätere Entwicklung des sozialistischen Denkens ausgeübt hat.
[7] [313] Es ist möglicherweise kein Zufall, dass mit diesen Essays Lukacs auch einer der ersten war – obgleich er damals nichts von den Ökonomischen und Philosophischen Manuskripten wusste -, der zum Problem der Entfremdung zurückkehrte, dem er sich via dem Konzept der Konkretisierung näherte.
[8] [313] Die „vier Alten“ standen für die „alten Ideen, Kulturen, Sitten und Gebräuche“ und waren Zielscheibe der angeblichen „Kulturrevolution“.
Theorie und Praxis:
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Die Theorie der Dekadenz im Zentrum des historischen Materialismus
- 3482 Aufrufe
Von Marx zur Kommunistischen Linken: Die Positionen der 3. Internationale
Im ersten Artikel dieser Serie, der in der Internationalen Revue Nr. 34 veröffentlicht wurde, zeigten wir, dass die Dekadenztheorie sich im eigentlichen Zentrum des historischen Materialismus bei der Analyse der Evolution der Produktionsweisen durch Marx und Engels befindet. Sie steht an zentraler Stelle in den programmatischen Texten der Organisationen der Arbeiterbewegung. Im zweiten Artikel, der in der Internationalen Revue Nr. 35 erschien, sahen wir, wie die Organisationen der Arbeiterbewegung, beginnend mit der Zeit von Marx und Engels über die Zweite Internationale und ihre marxistische Linke bis hin zur Kommunistischen Internationale, diese Analyse zum Grundstein ihres Verständnisses der Evolution des Kapitalismus machten und sich so in die Lage versetzten, die Prioritäten für die Periode zu bestimmen. Tatsächlich stellten Marx und Engels stets sehr deutlich fest, dass die Perspektive der kommunistischen Revolution von der objektiven, historischen und globalen Entwicklung des Kapitalismus abhängt. Besonders die Dritte Internationale machte diese Analyse zum allgemeinen Rahmen ihres Verständnisses der neuen Epoche, die mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges eingeleitet wurde. Alle politischen Strömungen, die die Dritte Internationale bildeten, erkannten, dass der erste globale Krieg den Beginn der dekadenten Phase des Kapitalismus markierte. Wir setzen hier nun unseren historischen Überblick über die wichtigsten Ausdrücke der Arbeiterbewegung fort, indem wir die spezifischen politischen Positionen der Kommunistischen Internationale in der Frage des Parlamentarismus und der Gewerkschaften, für die der Eintritt des Systems in seine Niedergangsphase wichtige Auswirkungen hatte, näher untersuchen.
Der Erste Kongress der Kommunistischen Internationale wurde vom 2. – 6. März 1919 abgehalten, auf dem Höhepunkt der internationalen revolutionären Welle, die über die großen Arbeiterkonzentrationen in Europa dahinfegte. Die junge Sowjetrepublik in Russland war kaum zwei Jahre an der Macht. Im September 1918 fand ein wichtiger Aufstand in Bulgarien statt. Deutschland befand sich auf dem Höhepunkt der gesellschaftlichen Gärung, überall wurden Arbeiterräte gebildet, und zwischen November 1918 und Februar 1919 fand in Berlin eine große Erhebung statt. In Bayern wurde im November 1918 sogar eine Räterepublik gegründet; tragischerweise sollte sie nur bis zum Februar 1919 überleben. In Ungarn brach eine sozialistische Revolution aus und widerstand sechs Monate lang, von März bis August 1919, erfolgreich den Anschlägen der konterrevolutionären Kräfte. Infolge der Kriegsgräuel und der Probleme nach Kriegsende erschütterten wichtige gesellschaftliche Bewegungen auch alle anderen Länder Europas.
Zur gleichen Zeit befanden sich die revolutionären Kräfte aufgrund des Verrats der Sozialdemokratie, die beim Ausbruch des Krieges im August 1914 auf die Seite der herrschenden Klasse gewechselt war, im Prozess der Reorganisierung. Neue Formationen, die aus dem schwierigen Reifungsprozess entstanden, strebten danach, die Prinzipien und die größten Errungenschaften der alten Parteien zu sichern. Die Konferenzen von Zimmerwald (September 1915) und Kienthal (April 1916) haben mit der Regruppierung aller Gegner des imperialistischen Krieges nachdrücklich zu dieser Reifung beigetragen und ermöglicht, dass das Fundament einer neuen Internationale gelegt wurde.
Im letzten Artikel sahen wir, wie infolge des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs diese neue Internationale den Eintritt des Kapitalismus in eine neue historische Epoche zum Rahmen ihres Verständnisses der unmittelbaren Aufgaben machte. Wir wollen nun untersuchen, wie dieser Rahmen direkt oder indirekt bei der Erarbeitung der programmatischen Positionen berücksichtigt wurde. Wir werden ebenfalls zeigen, dass die Schnelligkeit der Ereignisse und die komplizierten Bedingungen seinerzeit den Revolutionären nicht erlaubte, alle politischen Implikationen aus dem Eintritt des Kapitalismus in seine dekadente Phase in Bezug auf den Inhalt und die Form des Kampfes der Arbeiterklasse zu erkennen.
Die Gewerkschaftsfrage
Als der Erste Kongress der Dritten Internationale im März 1919 abgehalten wurde, war die erste Frage, der sich die entstehenden kommunistischen Organisationen gegenüberstanden, jene nach dem Inhalt, der Form und der Perspektiven der revolutionären Bewegung, die sich fast überall in Europa entwickelte. In dem Maße, wie die unmittelbaren Aufgaben nicht mehr die Erlangung fortschrittlicher Reformen im Rahmen eines sich im Aufstieg befindlichen Kapitalismus waren, sondern die Eroberung der Macht angesichts einer Produktionsweise, die zur Jahrhundertwende, mit dem Ausbruch des Weltkrieges[1] [315], ihren historischen Bankrott offenbart hatte, korrespondierte auch die Form, die der Klassenkampf annahm, mit seinem neuen Inhalt und Ziel. Die Organisierung in Gewerkschaften - im Wesentlichen ökonomische Organe, die eine Minderheit der Arbeiterklasse um sich scharten – war den Zielen der Bewegung in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus angepasst, aber sie entsprach nicht der Machtergreifung. Daher schuf die Arbeiterklasse, beginnend mit den Massenstreiks in Russland 1905[2] [315], die Sowjets (Arbeiterräte), die Organe verkörpern, welche alle Arbeiter im Kampf um sich sammeln, deren Inhalt sowohl ökonomischer als auch politischer Natur ist[3] [315], und deren fundamentales Ziel darin besteht, die Machtergreifung vorzubereiten. „Nur muss eine praktische Form gefunden werden, die das Proletariat in den Stand setzt, seine Herrschaft zu verwirklichen. Diese Form ist das Sowjetsystem mit der Diktatur des Proletariats. Diktatur des Proletariats! Das war bisher Latein für die Massen. Mit der Ausbreitung des Sowjetsystems in der ganzen Welt ist dieses Latein in alle Sprachen übersetzt worden: die praktische Form der Diktatur ist durch die Arbeitermassen gefunden. Sie ist den grossen Arbeitermassen verständlich geworden durch die Sowjetmacht in Russland, durch die Spartakisten in Deutschland und ähnliche Bewegungen in anderen Ländern (…).“ („Rede Lenins zur Eröffnung des Ersten Kongresses der Kommunistischen Internationale“)
Basierend auf der Erfahrung der Russischen Revolution und dem breiten Auftreten der Arbeiterräte in allen Aufständen in Europa, war sich die Kommunistische Internationale auf ihrem Ersten Kongress sehr wohl bewusst, dass große Arbeiterkämpfe nicht mehr im gewerkschaftlichen Rahmen stattfinden werden, sondern im Rahmen der neuen Einheitsorgane, der Arbeiterräte: „Der Sieg kann nur dann als gesichert gelten, wenn nicht nur die städtischen Arbeiter, sondern auch die ländlichen Proletarier organisiert sind, und zwar organisiert nicht wie früher in Gewerkschaften und Genossenschaften, sondern in Sowjets.“ („Thesen und Referat Lenins über bürgerliche Demokratie und Diktatur des Proletariates“, Erster Kongress der Komintern). Außerdem bestand die Hauptlehre, die der Erste Kongress der Dritten Internationale gezogen hatte, in Lenins Worten darin: „Aber ich glaube, dass wir nach fast zwei Jahren Revolution die Frage nicht so stellen dürfen, sondern direkte Vorschläge machen müssen, denn die Ausbreitung des Rätesystems ist für uns, besonders für die meisten westeuropäischen Länder, die wichtigste Aufgabe. (…) Ich habe einen praktischen Vorschlag zu machen, der dahin geht, eine Resolution anzunehmen, in der speziell drei Punkte angenommen werden. Erstens: Eine der wichtigsten Aufgaben für die Genossen der westeuropäischen Länder besteht darin, die Massen über die Bedeutung, die Wichtigkeit und die Notwendigkeit des Rätesystems aufzuklären. (…) Drittens müssen wir sagen, dass die Eroberung einer kommunistischen Mehrheit in den Räten die Hauptaufgabe in allen Ländern ist, in denen die Sowjetmacht noch nicht gesiegt hat.“ (ebenda).
Die Arbeiterklasse schuf nicht nur neue Kampforgane – die Arbeiterräte -, die den neuen Zielen und dem neuen Inhalt des Kampfes in der Dekadenz des Kapitalismus angepasst waren. Darüber hinaus machte der Erste Kongress den Revolutionären klar, dass das Proletariat sich auch den Gewerkschaften stellen musste, die mit Sack und Pack ins Lager der Bourgeoisie übergegangen waren, wie aus den Berichten der Delegierten der verschiedenen Ländern ersichtlich wird. So sagte Albert, ein Delegierter aus Deutschland, in seinem Bericht über die Lage in Deutschland: „Für uns ist von Bedeutung, dass durch diese Betriebsräte die bisher in Deutschland so sehr einflussreichen Gewerkschaften an die Wand gedrückt worden sind, die Gewerkschaften, die mit den Gelben eins waren, die den Arbeitern verboten hatten zu streiken, die gegen jede offene Bewegung der Arbeiter waren, die den Arbeitern überall in den Rücken gefallen sind. Diese Gewerkschaften sind seit dem 9. November vollständig ausgeschaltet. Alle Lohnbewegungen seit dem 9. November wurden ohne, ja gegen die Gewerkschaften geführt, die selbst keine einzige Lohnforderung der Arbeiter durchgedrückt hatten.“ („Protokolle des Ersten Kongresses der Kommunistischen Internationale“). Dasselbe gilt auch für Plattens Bericht aus der Schweiz: „Die gewerkschaftliche Bewegung in der Schweiz hat dieselben Krankheiten aufzuweisen wie die deutsche. (…) Die Arbeiter in der Schweiz haben frühzeitig erkannt, dass sie ihre materielle Lage nur verbessern können, wenn sie über die Statuten der Gewerkschaften hinaus einfach zum Kampf schreiten, nicht unter der Führung des alten Gewerkschaftsbundes, sondern unter selbst gewählter Leitung. Es kam zur Gründung eines Arbeiterkongresses und eines Arbeiterrats (…) Der Arbeiterkongress kam zustande trotz des Widerstandes des Gewerkschaftsbundes (…)“ (ebenda). Diese Realität einer oft gewaltsamen Konfrontation zwischen der in Räten organisierten Arbeiterbewegung und den Gewerkschaften, die zur letzten Verteidigungslinie des Kapitalismus geworden waren, ist eine Erfahrung, die sich mehr oder weniger deutlich durch die Berichte aller Delegierten zieht.[4] [315]
Die Realität der mächtigen konterrevolutionären Rolle der Gewerkschaften war neu für die bolschewistische Partei: In seinem Bericht über Russland konnte Sinowjew noch immer sagen: „Die Gewerkschaften haben bei uns eine andere Entwicklung durchgemacht als in Deutschland. Sie haben während der Jahre 1904-1905 eine grosse revolutionäre Rolle gespielt, und sie gehen parallel mit unserem Kampf für den Sozialismus. (…) Die grösste Mehrheit der Mitglieder vertritt den Standpunkt unserer Partei, und alle Beschlüsse werden nur im Geiste unserer Partei gefasst.“ Auch sagte Bucharin, Mitverfasser und Co-Rapporteur der Plattform, die verabschiedet wurde: „Genossen! Meine Aufgabe besteht darin, die von uns vorgelegten Richtlinien zu analysieren. (…) Wenn wir für die Russen schreiben würden, so hätten wir die Rolle der Gewerkschaften in dem revolutionären Umwandlungsprozess beschrieben. Aber nach der Erfahrung der deutschen Kommunisten ist dies unmöglich, denn die dortigen Genossen erzählen uns, dass die Stellung der dortigen Gewerkschaften der unseren völlig entgegengesetzt ist. Bei uns spielen die Gewerkschaften im Prozess der positiven Arbeit die Hauptrolle; die Sowjetmacht stütz sich gerade auf sie, in Deutschland ist es umgekehrt.“ (ebenda).
Dies ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass die Gewerkschaften bis 1905 nicht wirklich in Russland in Erscheinung traten, dass sie erst durch die Sowjets angespornt wurden. Als die Bewegung nach dem Scheitern der Revolution abebbte, neigten die Gewerkschaften ebenfalls dazu, zu verschwinden. Die relative Schwäche des zaristischen Staates ließ es im Gegensatz zu den westlichen Ländern nicht zu, dass die Gewerkschaften in den Staat integriert werden konnten. In den meisten entwickelten, westlichen Ländern wie Deutschland, England oder Frankreich hatten sich die Gewerkschaften durch ihre Beteiligung in verschiedensten Organismen und Schlichtungskommissionen immer mehr in die Verwaltung der Gesellschaft eingegliedert. Der Ausbruch des Krieges beschleunigte diese Tendenz und die Gewerkschaften mussten ihr Lager definitiv wählen. Dies machten sie in den angeführten Ländern, indem sie die Arbeiterklasse verrieten, einschliesslich der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CGT in Frankreich[5] [315]. In Russland wurden die Gewerkschaften durch den Klassenkampf, ausgelöst durch die Privatisierungen und die Schrecken des Krieges, aktiviert. Ihre Rolle beschränkte sich jedoch mehr auf Anhängsel der Sowjets, wie schon 1905. Es muss jedoch festgehalten werden, dass trotz ihrer geringeren Integration in den Staat einige Gewerkschaften in Russland zur Zeit der revolutionären Periode von 1917 eine reaktionäre Rolle spielten, so die Eisenbahnergewerkschaft.
Diese unterschiedlichen Erfahrungen in der Arbeiterschaft sollten mit der nachlassenden Dynamik der revolutionären Welle und mit der Isolierung Russlands (zu diesem Zeitpunkt behauptete noch niemand, dass die bolschewistische Partei die Speerspitze der Konterrevolution sei) die Fähigkeit der Internationale beeinträchtigen, alle Lehren und Erfahrungen des Proletariats weltweit zu ziehen und zu vereinheitlichen. Die Stärke der revolutionären Bewegung, die zur Zeit des Ersten Kongresses beträchtlich war, wie auch die Übereinstimmung der Erfahrungen aller Delegierten aus den höchst entwickelten kapitalistischen Ländern in der Gewerkschaftsfrage ließ diese Frage offen. Genosse Albert zog somit für das Präsidium und als Co-Rapporteur in der Gewerkschaftsfrage folgende Schlussfolgerung: „Ich komme gleich auf eine sehr wichtige Frage, die in den Richtlinien nicht behandelt ist, das ist die gewerkschaftliche Bewegung. Wir haben uns lange mit dieser Frage beschäftigt. Wir haben die Vertreter der einzelnen Länder über die gewerkschaftliche Bewegung ausgefragt und müssen feststellen, dass es heute unmöglich ist, zu dieser Frage in den Richtlinien international Stellung zu nehmen, da die Stellung des Proletariat in den einzelnen Ländern völlig verschieden ist. (…) Das alles sind Verhältnisse, die in den einzelnen Ländern verschieden sind, so dass es uns unmöglich erscheint, den Arbeitern klare internationale Richtlinien zu geben. Weil dies nicht möglich ist, können wir diese Frage heute nicht entscheiden, wir müssen es den einzelnen Landesorganisationen überlassen, zu ihr Stellung zu nehmen.“ (ebenda). Auf die Idee der Revolutionierung der Gewerkschaften, die von Reinstein, einem ehemaligen Mitglied der amerikanischen sozialistischen Arbeiterpartei, der als Delegierter der Vereinigten Staaten anerkannt wurde[6] [315], vorgebracht wurde, entgegnete Albert, Delegierter der Kommunistischen Partei Deutschlands: „Man könnte leicht sagen: ihr müsst sie revolutionieren, an Stelle der gelben Führer revolutionäre setzen. Aber das lässt sich nicht so ohne weiteres machen, weil die ganzen Organisationsformen der Gewerkschaften dem alten Staat angepasst sind, weil das Rätesystem auf der Grundlage der Fachverbände nicht durchführbar ist.“ (ebenda).
Das Kriegsende, eine gewisse „Sieges-Euphorie“ in den Siegerländern und die Fähigkeit der Bourgeoisie, mit der unerschütterlichen Unterstützung durch die sozialdemokratischen Parteien und Gewerkschaften eine heftige Repression gegen gesellschaftliche Bewegungen zu entfesseln und gleichzeitig wichtige wirtschaftliche und politische Zugeständnisse gegenüber der Arbeiterklasse (wie das allgemeine Wahlrecht und den Achtstundentag) zu machen, ermöglichten es Stück für Stück, die sozioökonomische Lage in allen Ländern zu stabilisieren. Dies verursachte einen fortschreitenden Verfall in der Intensität der revolutionären Welle, die gerade wegen der Kriegsgräuel und deren Folgen entstanden war. Die Erschöpfung des revolutionären Elans und der Beginn einer Verbesserung der wirtschaftlichen Lage lastete schwer auf der Fähigkeit der revolutionären Bewegung, die Lehren aus all den Kampferfahrungen auf internationaler Ebene zu ziehen und ihr Verständnis aller Folgen des historischen Wandels für die Formen und den Inhalt des proletarischen Kampfes zu vereinheitlichen. Mit der Isolierung der Russischen Revolution wurde die Kommunistische Internationale immer stärker von den Positionen der bolschewistischen Partei dominiert. Diese wurde unter dem fürchterlichen Druck der Ereignisse in wachsendem Maße dazu gezwungen, Zugeständnisse zu machen, um zu versuchen, Zeit zu gewinnen und aus dem Schraubstock auszubrechen, in dem sie gezwängt worden war. Drei wichtige Ereignisse in dieser Rückentwicklung fanden zwischen dem Ersten und Zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale (Juli 1920) statt. Kurz vor ihrem Zweiten Kongress 1920 schuf die KI eine Rote Gewerkschaftsinternationale, die in Konkurrenz zur Internationale der „gelben“ Gewerkschaften in Amsterdam (die mit den verräterischen sozialdemokratischen Parteien verknüpft waren) stand. Im April 1920 löste die Exekutivkommission der KI ihr Amsterdamer Büro für Westeuropa auf, das die radikalen Positionen der westeuropäischen Parteien gegen einige der Orientierungen der KI, insbesondere in der Frage der Gewerkschaften und des Parlamentarismus, artikuliert hatte. Und schließlich verfasste Lenin im April - Mai 1920 eines seiner schwächsten Werke: Der Linksradikalismus, eine Kinderkrankheit des Kommunismus, in dem er in ungerechtfertigter Weise all jene kritisierte, die er „Linksradikale“ nannte und die genau jene Ausdrücke der Linken waren, welche die Erfahrungen der geballtesten und fortgeschrittensten Bastionen des europäischen Proletariats zum Ausdruck brachten[7] [315]. Statt die Diskussion, die Konfrontation und Vereinheitlichung der unterschiedlichen Erfahrungen des internationalen Kampfes des Proletariats weiterzuverfolgen, öffnete dieser Wechsel in der Perspektive und Stellung die Tür zum Rückzug zu den alten Positionen der radikalen Sozialdemokraten[8] [315].
Trotz des immer ungünstigeren Verlaufs der Ereignisse bewies die Kommunistische Internationale in ihren Leitsätzen zur Gewerkschaftsfrage, die auf dem Zweiten Kongress angenommen wurden, dass sie ihre Fähigkeit zur theoretischen Klärung noch nicht ganz verloren hatte. Dank der Auseinandersetzung mit den Erfahrungen aus dem Kampf in allen Ländern und einer Annäherung an die Lehren aus der konterrevolutionären Rolle der Gewerkschaften, gelangte sie zur Überzeugung, dass Letztere, trotz der entgegen gesetzten Erfahrungen in Russland, während des Ersten Weltkriegs auf die Seite der Bourgeoisie übergewechselt waren. „Aus denselben Gründen, denen zufolge die internationale Sozialdemokratie sich mit geringen Ausnahmen nicht als Werkzeug des revolutionären Kampfes des Proletariats zum Sturz des Kapitalismus, sondern als eine Organisation erwies, die das Proletariat im Interesse der Bourgeoisie von der Revolution zurückhält, erwiesen sich die Gewerkschaften während des Krieges in den meisten Fällen als Teil des Kriegsapparates der Bourgeoise und halfen dieser, aus der Arbeiterklasse möglichst viel Schweiss auszupressen, zwecks möglichst energischer Kriegsführung für die Interessen des kapitalistischen Gewinns.“ („Leitsätze über die Gewerkschaftsbewegung, Betriebsräte und die Kommunistische Internationale“). Im Gegensatz zu ihren eigenen Erfahrungen in Russland akzeptierten die Bolschewiki auch, dass von nun an die Gewerkschaften im Wesentlichen eine negative Rolle spielten und eine mächtige Bremse gegen die Entwicklung des Klassenkampfes bildeten, da sie genauso wie die Sozialdemokratie vom Reformismus kontaminiert waren.
Jedoch führte der fürchterliche Druck der Ereignisse – das Umschlagen der revolutionären Welle, die sozioökonomische Stabilisierung des Kapitalismus und die Isolation der Russischen Revolution – die Komintern dazu, unter Federführung der Bolschewiki an den alten radikalen sozialdemokratischen Positionen festzuhalten, statt die politische Vertiefung zu vervollständigen, die notwendig war, um den Wandel in der Dynamik, im Inhalt und in der Form des Klassenkampfes in der dekadenten Phase des Kapitalismus zu verstehen. So wundert es nicht, dass die programmatischen Leitsätze, die gegen den Widerstand vieler kommunistischer Organisationen und nicht zuletzt der Repräsentanten der fortgeschrittensten Fraktionen des westeuropäischen Proletariats vom Zweiten Kongress der Komintern verabschiedet wurden, einen Rückschritt darstellen. Ohne jegliche Argumente und in völligem Widerspruch zur allgemeinen Orientierung, die auf dem Ersten Kongress entwickelt worden war, aber auch zur konkreten Realität des Kampfes vertraten die Bolschewiki die Idee: „Die Gewerkschaften, die während es Krieges zu Organen für die Beeinflussung der Arbeitermassen im Interesse der Bourgeoisie geworden waren, werden jetzt zu Organen der Zerstörung des Kapitalismus“ (ebenda). Diese Behauptung wurde zwar sofort stark modifiziert[9] [315], doch die Tür war nun offen für alle möglichen taktischen Mittel, um die Gewerkschaften „wiederzuerobern“, sie „in die Enge zu treiben“ und die Taktik der Einheitsfront zu entwickeln, etc. – alles unter dem Vorwand, dass die Kommunisten noch immer eine Minderheit seien, dass die Situation immer ungünstiger werde, dass es notwendig sei, „mit den Massen zu gehen“, etc.
Die Entwicklung in der Gewerkschaftsfrage, die wir oben kurz umrissen haben, ähnelte in vielen Details dem Werdegang der anderen politischen Positionen der Kommunistischen Internationale. Nachdem sie wichtige Fortschritte und eine theoretische Klärung erzielt hatte, entwickelte sie sich mit dem Rückgang der internationalen revolutionären Welle zurück. Es ist nicht an uns, den Richter der Geschichte zu spielen und Zensuren zu verteilen, sondern einen Prozess zu verstehen, an dem alle mit ihren Stärken und Schwächen teilhatten. Angesichts einer wachsenden Isolation und des Drucks durch den Rückzug sozialer Bewegungen versuchte jede Partei, Verhaltensweisen und Positionen anzunehmen, die von den spezifischen Erfahrungen der Arbeiterklasse in den einzelnen Ländern bestimmt wurden. Der vorherrschende Einfluss der Bolschewiki in der Kommunistischen Internationale, einst ein aktiver Faktor bei ihrer Gründung, war allmählich in eine Behinderung des Klärungsprozesses umgeschlagen, indem ihre Positionen im Wesentlichen aus der Erfahrung der Russischen Revolution allein abgeleitet wurden[10] [315].
Die Frage des Parlamentarismus
Die Position zur Parlamentspolitik entwickelte sich wie auch jene zur Gewerkschaftsfrage von einem Bestreben zur Klärung, einschließlich der Leitsätze über den Parlamentarismus, die auf dem Zweiten Kongress der Komintern angenommen wurden, hin zu einer zweiten Periode. Diese zeichnete sich durch die Leitsätze aus, diese Thesen wieder zurückzunehmen[11] [315]. Doch mehr noch als die Gewerkschaftsfrage, auf die wir uns in diesem Artikel konzentriert haben, wurde die Parlamentarismusfrage im Rahmen der Entwicklung des Kapitalismus von seiner aufsteigenden zu seiner dekadenten Phase betrachtet. So können wir in den Leitsätzen des Zweiten Kongresses lesen: „Der Kommunismus muss von einer klaren theoretischen Einschätzung des Charakters der gegenwärtigen Epoche ausgehen (Höhepunkt des Kapitalismus; seine imperialistische Selbstverneinung und Selbstvernichtung; ununterbrochenes Anwachsen des Bürgerkrieges usw.) (…) Die Stellung der III. Internationale zum Parlamentarismus wird nicht durch eine neue Doktrin, sondern durch die Änderungen der Rolle des Parlamentarismus selbst bestimmt. In der vergangenen Epoche hat das Parlament als Instrument des sich entwickelnden Kapitalismus in gewissem Sinne eine historisch fortschrittliche Arbeit geleistet. Aber unter den gegenwärtigen Verhältnissen, unter dem zügellosen Imperialismus, ist das Parlament zu einem Werkzeug der Lüge, des Betrugs, der Gewalttat und des entnervten Geschwätzes geworden. Angesichts der imperialistischen Verheerungen, Plünderungen, Gewalttaten, Räubereien und Zerstörungen verlieren die jeder Planmässigkeit und Festigkeit baren parlamentarischen Reformen für die werktätigen Massen jede praktische Bedeutung. (…) Gegenwärtig kann das Parlament für die Kommunisten auf keinen Fall ein Schauplatz des Kampfes um Reformen, um Verbesserung der Lage der Arbeiter sein, wie das in gewissen Augenblicken der vergangenen Periode der Fall war. Der Schwerpunkt des politischen Lebens hat sich vollkommen aus dem Parlament verschoben, und zwar endgültig. (…) Dabei muss man stets die relative Unwichtigkeit dieser Frage im Auge behalten. Da der Schwerpunkt in dem ausserparlamentarischen Kampf um die Staatsmacht liegt, so versteht es sich von selbst, dass die Frage der proletarischen Diktatur und des Kampfes der Massen für diese Diktatur mit der Teilfrage der Ausnutzung des Parlamentarismus nicht gleichzusetzen ist.“ („Leitsätze über die kommunistischen Parteien und den Parlamentarismus“). Leider standen diese Leitsätze nicht in einem Zusammenhang mit ihren eigenen theoretischen Untermauerungen. Trotz dieser klaren Stellungnahmen hatte die Kommunistische Internationale insofern nicht alle Auswirkungen mit einbezog, als sie von allen Kommunistischen Parteien verlangte, weiterhin „revolutionäre“ Propaganda auf der parlamentarischen Tribüne und in den Wahlen zu betreiben.
Die nationale Frage
Das Manifest, das vom Ersten Kongress der Kommunistischen Internationale verabschiedet wurde, war besonders in der nationalen Frage sehr weitsichtig, als es angesichts der neuen Periode, die vom Ersten Weltkrieg eingeleitet wurde, verkündete: „Der nationale Staat, der der kapitalistischen Entwicklung einen mächtigen Impuls gegeben hat, ist für die Fortentwicklung der Produktivkräfte zu eng geworden.“ Die Folge: „Um so unhaltbarer wurde die Lage der unter den Grossmächten Europas und anderer Weltteile verstreuten kleinen Staaten.“ Bis zu dem Punkt, wo die kleinen Staaten sich selbst genötigt sehen, ihre eigene imperialistische Politik zu entwickeln. „Diese Kleinstaaten, die zu verschiedenen Zeiten als Bruchstücke von grossen Staaten, als Scheidemünze zu Bezahlung verschiedener Dienstleistungen, als strategische Puffer entstanden sind, haben ihre Dynastien, ihre herrschenden Banden, ihre imperialistischen Ansprüche, ihre diplomatischen Machenschaften. (…) Gleichzeitig ist die Zahl der Kleinstaaten gestiegen: aus dem Bestand der österreichisch-ungarischen Monarchie, aus den Teilen des Zarenreichs sondern sich neue Staatswesen ab, die, kaum in die Welt gesetzt, sich gegenseitig wegen der staatlichen Grenzen an die Kehle springen.“ Unter Berücksichtigung dieser Schwächen im Rahmen eines Systems, das für die Expansion der Produktivkräfte zu klein geworden ist, wird die nationale Unabhängigkeit als „illusorisch“ beschrieben. Den kleinen Nationen bleibe keine andere Wahl, als das Spiel der Großmächte mitzuspielen und sich so teuer wie möglich in den interimperialistischen Beziehungen zu verkaufen. „Ihre illusorische Unabhängigkeit hatte bis zum Kriege dieselben Stützen wie das europäische Gleichgewicht: den ununterbrochenen Gegensatz zwischen den beiden imperialistischen Lagern. Der Krieg hat dieses Gleichgewicht zerstört. Indem der Krieg anfänglich Deutschland ein gewaltiges Übergewicht verlieh, zwang er die Kleinstaaten, Heil und Rettung in der Grossmut des deutschen Militarismus zu suchen. Nachdem Deutschland geschlagen wurde, wandte sich die Bourgeoisie der Kleinstaaten gemeinsam mit ihren patriotischen „Sozialisten“ dem siegreichen Imperialismus der Verbündeten zu und begann in den heuchlerischen Punkten des Wilsonschen Programms Sicherungen für ihr weiteres selbständiges Fortbestehen zu suchen. (…) Unterdessen bereiteten die alliierten Imperialisten solche Kombinationen von neuen und alten Staaten vor, um sie durch die Haftpflicht des gegenseitigen Hasses und allgemeiner Ohnmacht zu binden.“ („Manifest an das Proletariat der ganzen Welt“, Erster Kongress der Kommunistischen Internationale).
Diese Klarheit wurde unglücklicherweise seit dem Zweiten Kongress, mit der Annahme der „Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage“, Zug um Zug preisgegeben, als nicht mehr davon ausgegangen wurde, dass alle Nationen, ob groß oder klein, gezwungen waren, eine imperialistische Politik zu praktizieren und sich selbst an die Strategie der Großmächte zu binden. Tatsächlich wurden die Nationen in zwei Gruppen aufgeteilt: „(…) genaue Trennung der unterdrückten, abhängigen, nicht gleichberechtigten Nationen von den unterdrückenden, ausbeutenden, vollberechtigten Nationen (…)“ („Leitsätze über die Nationalitäten- und Kolonialfrage“) Was beinhaltete: „Jede Partei die der III. Internationale anzugehören wünscht, ist verpflichtet (…) jede Freiheitsbewegung in den Kolonien nicht nur mit Worten, sondern auch durch Taten zu unterstützen (…) Parteimitglieder, die die von der Kommunistischen Internationale aufgestellten Verpflichtungen und Leitsätze grundsätzlich ablehnen, müssen aus der Partei ausgeschlossen werden.“ („Leitsätze über die Bedingungen der Aufnahme in die Kommunistische Internationale“). Darüber hinaus – und im Gegensatz zu dem, was richtigerweise im „Manifest“ des Ersten Kongresses festgestellt wurde – wurde der Nationalstaat nicht mehr betrachtet als „zu eng geworden für die Fortentwicklung der Produktivkräfte“, denn „die Fremdherrschaft hemmt beständig die Entwicklung des sozialen Lebens; daher muss der erste Schritt der Revolution die Beseitigung dieser Fremdherrschaft sein.“ („Ergänzungsthesen über die Nationalitäten- und Kolonialfrage“, Punkt 6). Hier können wir sehen, dass durch den Verzicht auf eine Vertiefung der Konsequenzen aus der Analyse über den Eintritt des kapitalistischen Systems in die Dekadenz die Kommunistische Internationale schnell auf das dünne Eis des Opportunismus geriet.
Schlussfolgerungen
Wir erheben nicht den Anspruch, dass die Kommunistische Internationale ein vollständiges Verständnis der Dekadenz der kapitalistischen Produktionsweise hätte haben müssen. Wie wir im nächsten Artikel sehen werden, waren sich die Dritte Internationale und ihre Parteien sicherlich mehr oder weniger bewusst darüber, dass eine neue Epoche angebrochen war, dass der Kapitalismus ausgedient hatte, dass die unmittelbare Aufgabe darin bestand, nicht mehr Reformen, sondern die Macht zu erringen, und dass die Klasse, die den Kapitalismus verkörpert, die Bourgeoisie, reaktionär geworden ist, zumindest in den zentralen Ländern. Es war eine der Schwächen der Komintern, dass sie nicht imstande war, alle Lehren aus der neuen Epoche zu ziehen, die durch den Ersten Weltkrieg eingeleitet worden war, Lehren über den Inhalt und die Form des proletarischen Kampfes. Weit entfernt davon, ausschließlich auf die Komintern und ihre Parteien beschränkt gewesen zu sein, war diese Schwäche vielmehr die Frucht allgemeiner Schwierigkeiten, die die Arbeiterbewegung als solche hatte: die tiefe Spaltung der Revolutionäre zum Zeitpunkt des Verrats durch die Sozialdemokratie und die Notwendigkeit ihres Wiederaufbaus unter den schwierigen Umständen des Krieges und der unmittelbaren Nachkriegsperiode; die Spaltung zwischen Sieger- und Verliererländern, die keine günstigen Bedingungen für die Generalisierung der revolutionären Bewegung schuf; der rapide Rückgang der Bewegungen und Kämpfe, als die einzelnen Länder wieder soweit waren, die wirtschaftliche und soziale Lage nach dem Krieg zu stabilisieren, etc. Diese Schwäche konnte nur wachsen, und es fiel den linken Fraktionen zu, die sich von der Komintern trennten, die Arbeit fortzusetzen, die es noch zu machen galt.
C. Mcl.
[1] [315] „Die 2. Internationale hat ihren Teil an nützlicher Vorarbeit geleistet, um die proletarischen Massen zunächst während der langen „friedlichen“ Periode härtester kapitalistischer Sklaverei und raschesten kapitalistischen Fortschritts im letzten Drittel des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts zu organisieren. Der 3. Internationale steht die Aufgabe bevor die Kräfte des Proletariats zum revolutionären Ansturm gegen die kapitalistischen Regierungen zu organisieren, zum Bürgerkrieg gegen die Bourgeoisie aller Länder, für die proletarische Macht, für den Sieg des Sozialismus!“ (Lenin, „Lage und Aufgaben der Sozialistischen Internationale“, Werke, Band, 21)
[2] [315] siehe die dreiteilige Artikelserie „Die Revolution von 1905 in Russland“, Internationale Revue Nr. 36-38
[3] [315] „Der wirtschaftliche Kampf des Proletariats verwandelt sich in der Epoche des Zerfalls des Kapitalismus viel schneller in einen politischen Kampf, als dies im Zeitalter der friedlichen Entwicklung des Kapitalismus geschehen konnte. Jeder grosse wirtschaftliche Zusammenstoss kann die Arbeiter unmittelbar vor die Frage der Revolution stellen.“ („Leitsätze über die Gewerkschaftsbewegung, die Betriebsräte und die Kommunistische Internationale“, 2. Kongress der Komintern) „Lohnkämpfe der Arbeiter bringen – auch wenn sie erfolgreich sind – nicht die erhoffte Hebung der Lebenslage, da der sprungweise sich erhöhende Kaufpreis aller Bedarfsgüter jeden Erfolg illusorisch macht. Die Lebenslage der Arbeiter kann nur dann gehoben werden, wenn nicht die Bourgeoise, sondern das Proletariat selbst die Produktion beherrscht. Die gewaltigen Lohnkämpfe der Arbeiter in allen Ländern, in denen deutlich die verzweifelte Lage zum Ausdruck kommt, machen durch ihre elementare Wucht und Tendenz der Verallgemeinerung die Fortführung der kapitalistischen Produktionsweise unmöglich.“ („Richtlinien der Kommunistischen Internationale“, 1. Kongress der Komintern)
[4] [315] Auch der Bericht von Feinberg über England unterstreicht: „Die Gewerkschaften gaben die Errungenschaften, die sie in langjährigem Kampf erobert hatten, auf, und das Zentralkomitee der Gewerkschaften schloss den Burgfrieden mit der Bourgeoisie. Aber das Leben, die Verstärkung der Ausbeutung, die Erhöhung der Lebensmittelpreise zwangen die Arbeiter, sich gegen die Kapitalisten, die den Burgfrieden zu ihren Ausbeutungszwecken ausnützen, zu wehren. Sie sahen sich gezwungen, erhöhte Arbeitslöhne zu verlangen und diese Forderungen durch Streik zu unterstützen. Das Zentralkomitee der Gewerkschaften und die früheren Führer der Bewegung hatten der Regierung versprochen, die Arbeiter im Zaum zu halten, und deshalb versuchten sie die Bewegung zurückzuhalten und desavouierten die Streiks. Dennoch fanden die Streiks „unoffiziell“ statt.“ („Protokoll des Ersten Kongresses der Kommunistischen Internationale“). Der Bericht von Reinstein über die USA hob hervor: „Nur muss man hier betonen, dass die amerikanische kapitalistische Klasse praktisch und schlau genug war, einen praktischen und tatkräftigen Blitzableiter für sich zu schaffen, und dieser bestand in der Entwicklung einer antisozialistischen grossen gewerkschaftlichen Organisation unter der Führung von Gompers. (…) Gompers ist aber eher ein amerikanischer Subatow (…) (Subatow war der Organisator der „gelben“ Gewerkschaften für die zaristische Polizei). Kuusinen, der Delegierte für Finnland, ging in der Diskussion über die „Richtlinien der Kommunistischen Internationale“ in dieselbe Richtung: „Es gibt eine Anmerkung zu machen bezüglich des Abschnitts „Demokratie und Diktatur“, bei dem es um die revolutionären Gewerkschaften und Genossenschaften geht. In Finnland haben wir weder revolutionäre Gewerkschaften als auch keine revolutionären Genossenschaften und wir zweifeln auch daran, dass es solche jemals in unserem Land geben wird. Die Struktur dieser Gewerkschaften und Genossenschaften überzeugt uns, dass nach der Revolution die neue soziale Ordnung besser aufgebaut werden kann ohne diese Organisationen.“
[5] [315] Dies war auch der Grund, weshalb die CGT in Spanien 1914 nicht sofort ins Lager der Bourgeoisie überwechselte, was sie später dann tat. Da Spanien nicht am Ersten Weltkrieg teilnahm, wurde sie nicht auf die Feuerprobe gestellt zwischen den Lagern des Proletariates und der Bourgeoise zu wählen.
[6] [315] Dieser Delegierte schlug einen Anhang in diesem Sinne zur den „Richtlinien“ vor, der vom Kongress abgelehnt wurde.
[7] [315] Lenin ging soweit, dass er schrieb: „Aus all dem ergibt sich die Notwendigkeit, die absolute Notwendigkeit für die kommunistische Partei, die Vorhut des Proletariats, zu lavieren, Absprachen zu machen, Kompromisse zu schliessen, mit den verschiedenen Gruppen von Arbeitern, mit den verschiedenen Parteien der Arbeiter und denen anderer Unterdrückter.“
[8] [315] „ (…) so kann die zweite Aufgabe, die nun zur nächsten wird und die in der Fähigkeit besteht, die Massen heranzuführen an die neuen Positionen, die den Sieg der Vorhut in der Revolution zu sichern vermag – so kann diese nächste Aufgabe nicht erfüllt werden, ohne dass man mit dem linken Doktrinarismus aufräumt, ohne dass man seine Fehler völlig überwindet und sich von ihnen frei macht.“
[9] [315] Die „Leitsätze“ merkten an: „Diese Änderung des Charakters der Gewerkschaften wird von der alten Gewerkschaftsbürokratie und durch die alten Organisationsformen der Gewerkschaften auf jede Weise behindert.“
[10] [315] „Der 2. Kongress der Kommunistischen Internationale erkennt als unrichtig die Ansichten über die Beziehungen der Partei zu Klasse und Masse, über die Unverbindlichkeit der Teilnahme der kommunistischen Parteien an den bürgerlichen Parlamenten und reaktionärsten Gewerkschaften an, die in besonderen Beschlüssen des 2. Kongresses eingehend widerlegt sind und am vollständigsten durch die „Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands“ (KAPD) verteidigt werden, sowie teilweise von der „Kommunistischen Partei der Schweiz“, dem Organ des Osteuropäischen Sekretariats der Kommunistischen Internationale „Der Kommunismus“ in Wien, und einigen holländischen Genossen, ferner von einigen kommunistischen Organisationen in England, z.B. der „Sozialistischen Arbeiterföderation“ u. a., sowie von den „Industriearbeitern der Welt“ (IWW) in Amerika und von den Shop Stewards Committees in England usw. („Leitsätze über die Grundaufgaben der Kommunistischen Internationale“, Punkt 18)
[11] [315] Nachdem wir in der Gewerkschaftsfrage ins Detail gegangen sind, können wir dies im Rahmen dieses Artikels über die Dekadenz nicht auch noch in der Frage des Parlamentarismus machen. Wir verweisen französischsprachige Leser auf unsere Artikelsammlung „Mobilisation électorale – demobilisation de la classe ouvrière“, die zwei Untersuchungen über diese Frage wieder veröffentlichten, die in Révolution Internationale Nr. 2, Februar 1973, unter dem Titel „Les Barricades de la bourgeoisie“ und in Révolution Internationale Nr. 10, Juli 1974, unter dem Titel „Les élections contre la classe ouvrière“ erschienen. Der letztgenannte Artikel erschien auf Englisch in World Revolution Nr. 2, November 1974, unter dem Titel „Elections: the discreet charm of the bourgeoisie“.
Erbe der kommunistischen Linke:
Internationale Revue 39 - Editorial
- 2586 Aufrufe
Imperialistisches Chaos, Ökokatastrophe: Der Kapitalismus in der Sackgasse
Vor mehr als hundert Jahren sagte Engels voraus, dass die kapitalistische Gesellschaft, sich selber überlassen, die Menschheit in die Barbarei stürzen würde. Und tatsächlich, in den letzten hundert Jahren haben imperialistische Kriege nicht aufgehört, auf immer abstoßendere Weise diese Voraussage zu bestätigen. Heute hat die kapitalistische Welt eine neue Türe zur Apokalypse geöffnet, zu der von Menschenhand geschaffenen ökologischen Katastrophe, welche in wenigen Generationen den Planeten Erde zu einem unwirtlichen Ort wie den Planeten Mars machen könnte. Obwohl sich die Verteidiger der kapitalistischen Ordnung dieser Perspektive bewusst sind, können sie rein gar nichts dagegen tun, denn es ist ihre eigene Produktionsweise, welche die imperialistischen Kriege wie auch die ökologische Katastrophen hervorruft.
Imperialistischer Krieg = Barbarei
Das blutige Fiasko des Irakfeldzuges der 2003 von den USA angeführten Koalition stellt ein schicksalhaftes Moment in der Entwicklung der imperialistischen Kriege auf dem Weg der Zerstörung der Gesellschaft selber dar. Vier Jahre nach der Invasion ist der Irak weit davon entfernt, „befreit“ zu sein, und hat sich in das verwandelt, was die bürgerliche Presse vorsichtig als einen „gescheiterten Staat“ definiert; dieses Land, dessen Bevölkerung die Massaker von 1991 über sich ergehen lassen musste, danach während eines Jahrzehnts durch die Wirtschaftssanktionen1[1] [316] ausgeblutet wurde und nun täglich durch Selbstmordattentate, Pogromen der verschiedenen „Aufständischen“, von den Todesschwadronen des Innenministeriums oder durch willkürliche Hinrichtungen durch die Besatzungstruppen aufgerieben wird. Die Situation im Irak ist nichts anderes als das Epizentrum eines Prozesses des Zerfalls und des militärische Chaos, welches sich über Palästina, Somalia, den Sudan, den Libanon und Afghanistan ausbreitet und immer neue Regionen zu befallen droht. Die kapitalistischen Metropolen sind nicht davon ausgenommen, wie die Anschläge in New York, Madrid oder London im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts zeigen. Weit davon entfernt, eine neue Ordnung im Nahen und Mittleren Osten aufzubauen, hat die amerikanische Militärmacht das Chaos nur vergrößert.
In diesem Sinn gibt es nichts Neues an diesem Massaker. Der Erste Weltkrieg von 1914 bis 1918 war ein erster Schritt zu einer barbarischen „Zukunft“. Das Gemetzel von Millionen junger Arbeiter, welche die jeweiligen imperialistischen Herrscher in die Schützengräben geschickt hatten, wurde abgelöst durch die Pandemie der „spanischen Grippe“, welche weitere Millionen von Opfern forderte. Die mächtigsten europäischen Nationen befanden sich am Ende des Krieges ökonomisch am Boden. Nach der Niederlage der Oktoberrevolution von 1917 und der verschiedenen Arbeiterrevolutionen, die im Laufe der 20er Jahren unter diesem Einfluss ausbrachen, war der Weg zu einem noch katastrophaleren Krieg geebnet, zum Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945. Hier wurde die wehrlose Zivilbevölkerung das Hauptziel eines systematischen Massakers durch die Luftstreitkräfte; ein Völkermord im Herzen der europäischen Zivilisation forderte Millionen von Menschenleben.
Während des Kalten Krieges von 1947 bis 1989 gab es eine ganze Reihe von zerstörerischen Kriegen, in Korea, Vietnam, Kambodscha und quer durch ganz Afrika, während der Antagonismus zwischen den USA und der UdSSR die Welt dauernd mit der weltweiten nuklearen Apokalypse bedrohte.
Was heute am imperialistischen Krieg neu ist, ist nicht das absolute Ausmaß der Zerstörung, obwohl die Zerstörungskraft mindestens der USA sehr viel größer ist als je zuvor, denn die jüngeren militärischen Konflikte haben noch nicht die wesentlichen Bevölkerungskonzentrationen im Herzen des Kapitalismus in den Abgrund geführt, wie dies während des Ersten und Zweiten Weltkriegs der Fall war. 1918 verglich Rosa Luxemburg die Barbarei des Ersten Weltkrieges mit dem Niedergang des Alten Roms und der düsteren Zeit, die darauf folgte. Heute scheint selbst dieser dramatische Vergleich unangemessen, wenn man den grenzenlosen Schrecken beschreiben will, den uns der Kapitalismus bietet. Trotz der Brutalität und dem Chaos der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts gab es dabei immer noch eine Perspektive - wenn auch eine illusorische - eines Wiederaufbaus einer gesellschaftlichen Ordnung im Interesse der herrschenden imperialistischen Mächte. Die Spannungsfelder unserer Zeit bieten hingegen keine andere Perspektive als diejenige des immer tieferen Versinkens im gesellschaftlichen Auseinanderdriften auf allen Ebenen, im Zerfall jeglicher sozialen Ordnung, in einem endlosen Chaos.
Die Sackgasse des US-amerikanischen Imperialismus ist diejenige des Kapitalismus
Ein ganz großer Teil der US-amerikanischen Bourgeoisie ist gezwungen worden zu anerkennen, dass die Strategie des Unilateralismus bei ihren weltweiten Hegemonialansprüchen sowohl auf der diplomatischen als auch auf der militärischen und der ideologischen Ebene gescheitert ist. Der Bericht der Irak-Studiengruppe (Irak Study Group, ISG), der dem amerikanischen Kongress vorgelegt worden ist, verheimlicht diese offensichtliche Tatsache nicht. Statt das Ansehen der USA zu stärken, hat die Besetzung des Iraks ihr Prestige in praktisch allen Bereichen geschwächt. Aber welche Alternative schlagen die härtesten Kritiker der Bush-Administration innerhalb der herrschenden Klasse der USA vor? Der Rückzug der Truppen ist nicht möglich, ohne die amerikanische Hegemonie weiter zu schwächen und das Chaos zu beschleunigen. Eine Teilung des Iraks in ethnische Zonen hätte den gleichen Effekt. Einige schlagen eine Politik der Eindämmung vor wie während der Zeit des Kalten Krieges, aber es ist klar, dass man nicht zur Politik der zwei imperialistischen Blöcke zurückkehren kann. Außerdem ist das Versagen der US-Truppen im Irak viel schlimmer als dasjenige in Vietnam, denn im Gegensatz zu Vietnam geht es für die USA im Irak darum, die ganze restliche Welt in die Schranken zu weisen, und nicht mehr bloß den seinerzeit rivalisierenden Block der UdSSR.
Trotz der harschen Kritik der ISG und der durch die demokratische Partei errungenen Kontrolle über den Kongress wurde Bush ermächtigt, die Zahl der Soldaten im Irak um 20´000 zu erhöhen. Gleichzeitig begann eine Politik der militärischen und diplomatischen Drohung gegenüber dem Iran. Welches die alternativen Strategien der herrschenden Klasse der USA auch immer sind, wird sie früher oder später gezwungen sein, einen weiteren blutigen Beweis für ihren Status als Supermacht zu liefern mit noch widerwärtigeren Konsequenzen für die Menschen der ganzen Welt, was einmal mehr die Ausbreitung der Barbarei beschleunigen wird.
Das ist weder das Resultat der Inkompetenz noch der Arroganz der republikanischen Administration unter Bush und der Neokonservativen, wie dies die Bourgeoisien der anderen imperialistischen Mächte unaufhörlich wiederholen. Sich auf die UNO und den Multilateralismus abzustützen, ist keine wirkliche Friedensoption, entgegen den Empfehlungen dieser Bourgeoisien und der Pazifisten jeder Couleur. Seit 1989 hat Washington sehr gut verstanden, dass die UNO eine Tribüne geworden ist, auf der die Rivalen der USA die amerikanischen Pläne durchkreuzen können: ein Ort, wo ihre weniger mächtigen Rivalen die amerikanische Politik verzögern und verwässern oder gar mit einem Veto verhindern können, um der Schwächung ihrer eigenen Position entgegen zu wirken. Indem Frankreich, Deutschland und die anderen die USA als die einzigen Verantwortlichen für Chaos und Krieg darstellen, offenbaren sie lediglich, dass sie selber ihren vollen Anteil an der zerstörerischen Logik des Kapitalismus haben: einer Logik, nach der jeder für sich selber spielt und sich gegen alle anderen durchsetzen muss.
Es überrascht nicht, dass die regelmäßigen Antikriegsdemonstrationen in großen Städten der wichtigen Metropolen im allgemeinen laut die kleinen imperialistischen Mächte des Nahen und Mittleren Ostens unterstützen, wie beispielsweise die Aufständischen im Irak oder die Hisbollah im Libanon, welche die USA bekämpfen. Das zeigt, dass dem Imperialismus eine Logik innewohnt, der sich keine Nation entziehen kann, und dass der Krieg nicht nur das Resultat der Aggressionen der Großmächte ist.
Andere verkünden dauernd wider besseres Wissen, dass das Abenteuer der USA im Irak ein „Krieg ums Öl“ sei. Dabei werden die Gefahren ihrer grundlegenden geostrategischen Ziele völlig außer acht gelassen. Dies ist eine grobe Unterschätzung der aktuellen Lage. Die Situation, in der sich die USA im Irak befinden, ist nur der Ausdruck der weltweiten Sackgasse, in der die ganze kapitalistische Gesellschaft steckt. George Bush senior proklamierte seinerzeit, dass mit dem Wegfall des Ostblocks eine Zeit des Friedens und der Stabilität begonnen habe, eine „neue Weltordnung“. Schon schnell sollte die Realität diese Vorhersage Lügen strafen, zunächst mit dem ersten Irakkrieg, dann mit dem barbarischen Konflikt in Jugoslawien, einem Krieg im Herzen Europas. Die 90er Jahre waren keineswegs Jahre der Ordnung, sondern des zunehmenden militärischen Chaos. Ironischerweise ist George Bush junior die Rolle zugefallen, einen weiteren entscheidenden Schritt hin zu diesem unumkehrbaren Chaos zu tun.
Die Zerstörung der Biosphäre
Gleichzeitig zur Verschärfung seines imperialistischen Kurses hin zu einer immer sichtbareren Barbarei, verstärkt der zerfallende Kapitalismus seine Attacke gegen die Biosphäre in einem solchen Ausmaß, dass ein künstlicher klimatischer Holocaust die Zivilisation und die Menschen zu zerstören droht. Laut den Erkenntnissen, zu denen die Umweltwissenschaftler im Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderung (IPCC) gekommen sind, wird bestätigt, dass die Theorie über die Klimaerwärmung durch hohe Kohlendioxid-Werte in der Atmosphäre, verursacht durch die massenhafte Verbrennung fossiler Brennstoffe, nicht nur eine simple Hypothese, sondern „Wahrscheinlichkeit“ sei. Das Kohlendioxid in der Atmosphäre hält die von der Erdoberfläche und der Umgebungsluft abgestrahlte Sonnenwärme zurück und führt zu einem „Treibhauseffekt“. Dieser Prozess hat um 1750 begonnen, zur Zeit der kapitalistischen industriellen Revolution, und seither haben die Kohlendioxid-Emissionen und die Erderwärmung stetig zugenommen. Seit 1950 hat sich dies ständig beschleunigt, und während des letzten Jahrzehnts wurden jedes Jahr neue Temperaturrekorde gemessen. Die Konsequenzen dieser Erderwärmung haben bereits alarmierende Ausmaße angenommen: Die Klimaveränderung führt zu wiederkehrenden Dürren und riesigen Überschwemmungen, zu tödlichen Hitzewellen in Nordeuropa und Klimabedingungen mit einer großen Zerstörungskraft. Sie führt zur Verschärfung der Hungersnöte und der Krankheiten in der Dritten Welt und selbst zum Ruin von Städten wie New Orleans nach dem Hurrikan Katrina.
Sicher, man darf nicht den Kapitalismus anklagen, damit begonnen zu haben, fossile Brennstoffe zu verbrennen, oder mit der Umwelt in gefährlicher und zerstörerischer Weise umzugehen. Dies war schon zu Beginn der menschlichen Zivilisation der Fall:
„Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten nicht, dass sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen. Die Italiener der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirges so sorgsam gehegten Tannenwälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, dass sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem Gebiet die Wurzeln abgruben; sie ahnten noch weniger, dass sie dadurch ihren Bergquellen für den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen, damit diese zur Regenzeit um so wütender Flutströme über die Ebene ergießen könnten. Die Verbreiter der Kartoffel in Europa wussten nicht, dass sie mit den mehligen Knollen zugleich die Skrofelkrankheit verbreiteten. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht – sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und dass unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können.“ (Friedrich Engels, Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen in Dialektik der Natur)
Doch der Kapitalismus ist verantwortlich für die enorme Zunahme dieser Umweltzerstörung. Dies nicht wegen der Industrialisierung an sich, sondern wegen seiner Jagd nach einem maximalen Profit und seiner Blindheit gegenüber den ökologischen und menschlichen Bedürfnissen, außer wenn sie zufällig mit dem Ziel der Anhäufung von Reichtum zusammenfallen. Die kapitalistische Produktionsweise hat aber noch andere Charakteristiken, welche zur ungebremsten Zerstörung der Umwelt führen. Die gnadenlose Konkurrenz unter den Kapitalisten, vor allem unter den verschiedenen Nationalstaaten, verhindert schlussendlich jegliche Kooperation auf Weltebene. Und verbunden mit dieser Charakteristik die Tendenz des Kapitalismus zur Überproduktion, in seiner unersättlichen Suche nach Profit.
Im dekadenten Kapitalismus, in seiner Periode der permanenten Krise, wird diese Tendenz zur Überproduktion chronisch. Dies ist seit Ende des Zweiten Weltkrieges besonders deutlich geworden, da die Erweiterung der kapitalistischen Wirtschaft auf einer künstlichen Basis vorangetrieben wird, vor allem durch die Politik der Finanzierung über Defizite und die enorme Zunahme der Verschuldung in der Wirtschaft. All dies hat nicht zur Befriedigung der Bedürfnisse der Masse der arbeitenden Bevölkerung geführt, welche weiterhin im Morast der Armut steckt, sondern zu einer enormen Vergeudung, zu Bergen von unverkauften Gütern; zur Verschleuderung von Millionen Tonnen von Lebensmitteln; wegen fehlender Planung der Produktion zu immensen Mengen von überschüssigen Gütern; vom Auto bis zum Computer zu Produkten, die schnell wieder auf den Müll geworfen werden; zu einer gigantischen Masse von identischen Produkten aus der Produktion der verschiedenen Konkurrenten für denselben Markt.
Während der Rhythmus der technologischen Entwicklung und Spezialisierung in der Dekadenz des Kapitalismus zunimmt, werden die daraus resultierenden Innovationen vor allem durch den militärischen Sektor angeregt, dies im Gegensatz zur Zeit des aufsteigenden Kapitalismus. Auf der Ebene der Infrastruktur: Gebäude, sanitäre Einrichtungen, Energieproduktion, Transportwesen, sind wir aber keineswegs Zeugen von revolutionären Entwicklungen, welche mit dem Beginn der kapitalistischen Produktionsweise vergleichbar wären. In der Phase des Zerfalls des Kapitalismus, der letzten Phase der Dekadenz, herrscht eine andere Tendenz vor: das Herunterschrauben der Kosten für die Aufrechterhaltung selbst der alten Infrastruktur, in der Hoffnung auf kurzfristige Profite. Man kann eine Karikatur dieses Prozesses in der Entwicklung der Produktion in China und Indien beobachten, wo die industrielle Infrastruktur größtenteils fehlt. Anstatt dem Kapitalismus einen neuen Lebenselan einzuhauchen, führt diese Entwicklung zu grausamsten Verschmutzungen: zur Zerstörung der Flüsse, enormen Smog-Decken, die ganze Länder überdecken, usw.
Dieser lange Prozess des Niedergangs und Zerfalls der kapitalistischen Produktionsweise liefert eine Erklärung, weshalb es eine dermaßen dramatische Zunahme der Kohlendioxid-Verschmutzung und der Erwärmung des Planeten in den letzten Jahrzehnten gibt. Er lässt auch begreifen, weshalb gegenüber einer solchen wirtschaftlichen und klimatischen Entwicklung der Kapitalismus und seine „Machthaber“ unfähig sind, die katastrophalen Auswirkungen der Erderwärmung zu bekämpfen.
Die apokalyptischen Szenarien, welche zur Zerstörung der Menschheit führen können, werden in einem gewissen Sinne durch die Sprecher und Medien der Regierungen aller kapitalistischer Länder anerkannt und öffentlich dargestellt. Die Tatsache, dass sie zahllose Heilmittel anpreisen, um diese Auswirkungen zu vermeiden, heißt noch lange nicht, dass nur ein Einziger von ihnen eine realistische Alternative gegenüber der barbarischen Perspektive anzubieten hätte. Ganz im Gegenteil. Angesichts des ökologischen Desasters ist der Kapitalismus, gleich wie gegenüber der imperialistischen Barbarei, absolut hilflos.
„Viel Wind“ um die Klimaerwärmung
Die Regierungen der ganzen Welt finanzieren seit 1990 über die Vereinten Nationen großzügig die Forschung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung, und ihre Medien haben die kürzlich gezogenen, schrecklichen Schlussfolgerungen breit gewalzt.
Die wichtigsten politischen Parteien der Bourgeoisie aller Länder stellen sich alle als Variationen von Ökologen dar. Aber wenn man genauer hinschaut, verschleiert die „grüne“ Politik dieser Parteien, wie radikal sie auch erscheinen mögen, vorsätzlich den Ernst des Problems, denn die einzige Erfolg versprechende Lösung würde gerade das System in Frage stellen, dessen Lob sie singen. Der gemeinsame Nenner all dieser „grünen“ Kampagnen besteht darin, die Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins in einer Bevölkerung zu verhindern, die zu Recht über die klimatische Erwärmung entsetzt ist. Die ständig wiederholte ökologische Botschaft der Regierungen lautet, dass „den Planeten zu retten die Verantwortung jedes und jeder Einzelnen“ sei, während die überwiegende Mehrheit keinerlei wirtschaftliche oder politische Macht hat und von jeder Kontrolle über die Produktion und den Konsum ausgeschlossen ist. Und die Bourgeoisie, die diese Entscheidungsmacht hat, beabsichtigt in keiner Weise, ihre Profite den allgemeinen ökologischen und menschlichen Bedürfnissen zu opfern.
Al Gore, der im Jahre 2000 beinahe demokratischer Präsident der Vereinigten Staaten geworden wäre, stellte sich mit seinem Film „Eine unbequeme Wahrheit“ an die Spitze einer internationalen Kampagne gegen den Kohlendioxidausstoß. Der Film gewann in Hollywood einen Oscar für die lebendige Art und Weise, mit der er die Gefahr des globalen Temperaturanstiegs, des Schmelzens der Polarkappen, des Anstiegs der Meere und aller Zerstörungen behandelt, die sich daraus ergeben. Aber der Film ist auch eine Wahlplattform für Al Gore selbst. Er ist nicht der einzige alte Politiker, der auf die Idee kommt, die gerechtfertigte Angst der Bevölkerung vor der ökologischen Katastrophe für die Jagd aufs Präsidentenamt auszunutzen, die das demokratische Spiel der großen kapitalistischen Länder ausmacht. In Frankreich haben alle Präsidentschaftskandidaten den „ökologischen Pakt“ des Journalisten Nicolas Hulot unterzeichnet. In Großbritannien rivalisieren die politischen Hauptparteien darum, wer der „grünste“ sei. Der von Gordon Brown und seiner New Labour in Auftrag gegebene Stern-Bericht hat mehrere Regierungsinitiativen nach sich gezogen, die die CO2-Emissionen reduzieren sollen. David Cameron, Chef der konservativen Opposition, geht mit dem Fahrrad zum Parlament (während seine Entourage im Mercedes folgt).
Es reicht, die Ergebnisse der früheren Regierungsstrategien anzuschauen, die angeblich den Zweck hatten, den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren, um die Unfähigkeit der Staaten festzustellen, den Beweis irgendeiner Wirksamkeit ihrer Politik zu erbringen. Statt die Emission von Gasen mit Treibhauseffekt bis ins Jahr 2000 auf dem Stand von 1990 zu stabilisieren, wie sich die Unterzeichner des Kyoto-Protokolls im Jahre 1997 bescheiden verpflichteten, gab es in Tat und Wahrheit bis Ende des Jahrhunderts in den wichtigsten Industrieländern eine Erhöhung des Ausstoßes um 10,1%, und die Voraussage lautet, dass diese Umweltverschmutzung bis ins Jahr 2010 noch um 25,3% steigen wird! (Deutsche Umwelthilfe)
Es genügt auch, die grobe Fahrlässigkeit der kapitalistischen Staaten bei den Unglücken festzustellen, die sich bereits wegen der Klimaänderung ereignet haben, um sich ein Urteil über die Aufrichtigkeit der zahllosen Erklärungen guter Absichten zu machen.
Es gibt natürlich diejenigen, die erkennen, dass das Interesse an der Profitmaximierung einen mächtigen Faktor darstellt, welcher der wirksamen Begrenzung der Umweltverschmutzung entgegenwirkt; sie glauben, dass man das Problem lösen könne, indem man die liberale Politik durch Lösungen ersetze, die der Staat organisiere. Aber er ist insbesondere auf internationaler Ebene klar, dass die kapitalistischen Staaten, selbst wenn sie innenpolitisch etwas umsetzen würden, unfähig sind, untereinander in dieser Frage zusammenzuarbeiten, denn jeder müsste wirtschaftliche Opfer bringen. Kapitalismus heißt Konkurrenz, und er ist heute mehr denn je durch das Jeder-für-sich beherrscht.
Die kapitalistische Welt ist unfähig, sich für ein gemeinsames Vorhaben zusammenzuschließen, das so massiv und kostspielig wäre wie eine vollständige Umstrukturierung der Industrie und des Verkehrs, die nötig wäre, um eine drastische Reduzierung der Erzeugung von Energie zu erreichen, die Kohlenstoff verbrennt. Vielmehr besteht das Hauptanliegen aller kapitalistischen Nationen darin zu versuchen, dieses Problem zu benutzen, um ihren eigenen widerwärtigen Ehrgeiz zu befriedigen. Wie auf der imperialistischen und militärischen Ebene ist der Kapitalismus auch auf der ökologischen Ebene von unüberwindbaren nationalen Grenzen durchzogen und kann deshalb nicht einmal auf die dringendsten Bedürfnisse der Menschheit eingehen.
Für das Proletariat ist noch nicht alles verloren – wir haben immer noch eine Welt zu gewinnen
Aber es wäre falsch, einfach zu resignieren und zu meinen, der Untergang in der Barbarei sei aufgrund der mächtigen Tendenzen – des Imperialismus und der ökologischen Zerstörung - unvermeidlich. Angesichts der Selbstgefälligkeit aller halben Maßnahmen, die der Kapitalismus uns vorschlägt, um den Frieden und die Harmonie mit der Natur herzustellen, ist der Fatalismus eine gleichermaßen falsche Einstellung wie der naive Glauben an die Wirksamkeit kosmetischer Mittel.
Während der Kapitalismus alles dem Kampf um den Profit und der Konkurrenz opfert, hat er gleichzeitig die Elemente geschaffen, die seine Überwindung als Ausbeutungsweise erlauben. Er hat die technologischen und kulturellen Mittel entwickelt, die für ein weltweites Produktionssystem nötig sind, das als Gesamtheit und nach einem Plan funktioniert und in Einklang mit den Bedürfnissen der Menschheit und der Natur steht. Er hat eine Klasse hervorgebracht, das Proletariat, die aus nationalen Vorurteilen oder Konkurrenzdenken allgemein keinen Vorteil schöpft und jedes Interesse an der Entwicklung der internationalen Solidarität hat. Die Arbeiterklasse hat kein Interesse an der gierigen Jagd nach Profit. Mit anderen Worten hat der Kapitalismus die Grundlagen für eine höhere Gesellschaftsordnung, für seine Überwindung durch den Sozialismus gelegt. Der Kapitalismus hat die Mittel entwickelt, die menschliche Gesellschaft zu zerstören, aber er hat auch ihren eigenen Totengräber, die Arbeiterklasse, geschaffen, die diese menschliche Gesellschaft erhalten und sie einen entscheidenden Schritt in ihrer Entfaltung weiter bringen kann.
Der Kapitalismus hat die Schaffung einer Wissenschaftskultur erlaubt, die fähig ist, unsichtbare Gase wie Kohlendioxid zu erkennen und seine Konzentration sowohl in der Atmosphäre von heute als auch in jener von vor 10’000 Jahren zu messen. Die Wissenschaftler können die spezifischen Isotope von Kohlendioxid erfassen, die durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern produziert wurden. Die wissenschaftliche Gemeinschaft war fähig, die Hypothese des „Treibhauseffektes“ zu prüfen und zu bestätigen. Jedoch sind die Zeiten längst vorbei, zu denen der Kapitalismus als Gesellschaftssystem fähig war, die wissenschaftliche Methode und ihre Ergebnisse im Interesse des Fortschritts der Menschheit zu nutzen. Der größte Teil der Forschungsarbeiten und der wissenschaftlichen Entdeckungen von heute wird der Zerstörung gewidmet, der Entwicklung immer raffinierterer Methoden der Massentötung. Nur eine neue Gesellschaftsordnung, eine kommunistische Gesellschaft, kann die Wissenschaft in den Dienst der Menschheit stellen.
Trotz der hundert letzten Jahre des Niedergangs und der Fäulnis des Kapitalismus und der ernsthaften Niederlagen, welche die Arbeiterklasse eingesteckt hat, ist die notwendige Grundlage für eine neue Gesellschaft immer noch vorhanden.
Dass das Proletariat nach 1968 weltweit wieder auf der Bühne erschienen ist, belegt diese Ausgangslage. Die Entwicklung seines Klassenkampfes gegen den konstanten Druck auf den Lebensstandard der Proletarier während der Jahrzehnte, die auf 1968 gefolgt sind, hat den barbarischen Ausgang verhindert, der durch den Kalten Krieg vorgezeichnet war: den vernichtende Zusammenstoß zwischen den imperialistischen Blöcken. Seit 1989 jedoch und dem Verschwinden der Blöcke hat die defensive Haltung der Arbeiterklasse nicht ausgereicht, eine Abfolge entsetzlicher lokaler Kriege zu verhindern, die drohen, sich außerhalb jeder Kontrolle zu beschleunigen und immer mehr Regionen des Planeten in Mitleidenschaft zu ziehen. In dieser kapitalistischen Zerfallsperiode läuft dem Proletariat die Zeit davon, und dies umso mehr als noch eine drohende ökologische Katastrophe in die historische Gleichung aufgenommen werden muss.
Aber es ist noch nicht so weit, dass wir sagen müssten, der Niedergang und der Zerfall des Kapitalismus hätten einen Punkt erreicht, wo es kein Zurück mehr gibt - einen Punkt, von dem an seine Barbarei nicht mehr aufzuhalten wäre.
Seit 2003 beginnt die Arbeiterklasse, den Kampf mit einer neu gewonnenen Kraft wieder aufzunehmen, nachdem der Zusammenbruch des Ostblocks für eine gewisse Zeit den 1968 begonnenen Aufbruch gestoppt hat.
Unter diesen Bedingungen der Entwicklung des Vertrauens in der Klasse können die wachsenden Gefahren, die der imperialistische Krieg und die ökologische Katastrophe darstellen, statt Ohnmachts- und Fatalismusgefühle hervorzurufen auch zu einem vertieften politischen Nachdenken und zu einem stärkeren Bewusstsein darüber führen, was weltweit auf dem Spiel steht, zu einem Bewusstsein über die Notwendigkeit der revolutionären Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft. Es ist die Verantwortung der Revolutionäre, aktiv an dieser Bewusstseinsbildung teilzunehmen.
Como, 3/04/2007
[1] [317] Die Kindersterblichkeit im Irak ist zwischen 1990 und 2005 von 40 auf 102 Promille angestiegen, The Times, 26. März 2007.
Theoretische Fragen:
- Umwelt [53]
Interne Debatte der IKS: Marxismus und Ethik (Teil I/a)
- 3190 Aufrufe
Warum ein Text über Ethik heute?
Mehr als zwei Jahre lang dauerte die Debatte in der IKS über die Frage der Moral und der proletarischen Ethik. Diese Debatte fand auf der Grundlage eines Orientierungstextes statt, dessen Inhalt wir hier in großen Auszügen veröffentlichen wollen. Wenn wir eine solche theoretische Debatte eröffneten, so taten wir dies, weil unsere Organisation zurzeit ihrer Krise 2001 intern mit einem besonders zerstörerischen Verhalten konfrontiert war, das jener Klasse völlig fremd ist, die den Kommunismus errichten soll. Dieses Verhalten hat sich in brutalen Methoden kristallisiert, die von einigen Elementen angewendet wurden, welche der „internen Fraktion“ der IKS (IFIKS) zum Leben verholfen hatten[1]: Diebstahl, Erpressung, Lügen, Verleumdungskampagnen, Spitzeltum, Rufmord und Todesdrohungen gegen unsere Genossen. Die Notwendigkeit, die Organisation in der Frage der proletarischen Moral zu wappnen – eine Frage, die die Arbeiterbewegung seit ihren Ursprüngen beschäftigt hat –, entspringt also einem konkreten Problem, das auch das politische Milieu des Proletariats gefährdet. Wir haben stets bekräftigt (besonders in unseren Statuten), dass die Frage des militanten Verhaltens eine ganz und gar politische Frage ist. Doch bis jetzt war die IKS nicht in der Lage gewesen, tiefer über diese Frage nachzudenken und sie mit der Frage der proletarischen Ethik und Moral zu verknüpfen. Um die ursprünglichen Absichten und Merkmale der Ethik der Arbeiterklasse zu begreifen, hat sich die IKS auf die Entwicklung der Moral in der Geschichte der Menschheit berufen und sich die theoretischen Errungenschaften des Marxismus angeeignet, die von den Fortschritten der menschlichen Zivilisation insbesondere auf dem Gebiet der Wissenschaften und der Philosophie gestützt wurden. Dieser Orientierungstext verfolgt nicht das Ziel, ein endgültiges theoretisches Elaborat zu liefern, sondern mehrere Denkanstöße zu verfolgen, um der Organisation die Vertiefung einer Reihe von fundamentalen Fragen zu ermöglichen (Ursprung und Charakter der Moral in der menschlichen Geschichte, der Unterschied zwischen bürgerlicher Moral und proletarischer Moral, der Verfall der Werte und der Ethik des Kapitalismus in der Epoche seines Zerfalls, etc.). Angesichts der Tatsache, dass diese interne Debatte noch nicht beendet ist, werden wir hier nur Auszüge des Orientierungstextes veröffentlichen, die uns am verständlichsten für den Leser erscheinen. Weil es sich hier um einen internen Text handelt, erscheinen die Ideen äußerst kondensiert und beziehen sich auf komplexe theoretische Konzepte; wir sind uns im Klaren, dass gewisse Passagen sich als schwierig erweisen könnten. Dennoch sind gewisse Aspekte unserer Debatte soweit herangereift, dass wir es für nützlich erachten, Auszüge aus diesem Orientierungstext nach außen zu tragen, damit die Arbeiterklasse und das politische Milieu des Proletariats sich am von der IKS angestoßenen Denkprozess beteiligen können.
Von Anfang an spielte die Frage des politischen Verhaltens und somit der proletarischen Moral eine zentrale Rolle im Leben der IKS. Unsere Auffassung zu dieser Frage findet ihren lebendigen Ausdruck in unseren Statuten (1982 verabschiedet).[2]
Wir haben stets darauf bestanden, dass die Statuten nicht eine Kollektion von Regeln sind, die festlegen, was erlaubt ist und was nicht, sondern eine Orientierung für unser Verhalten und unsere Haltung, die ein in sich zusammenhängendes Ganzes von moralischen Werten (besonders bezüglich des Verhältnisses unter den Mitgliedern und gegenüber der Organisation) zusammenfasst. Daher verlangen wir von jedem, der Mitglied der Organisation werden will, eine tiefgehende Übereinstimmung mit diesen Werten.
Doch die Statuten als integraler Bestandteil unserer Plattform regeln nicht allein, wer unter welchen Umständen Mitglied der IKS werden kann. Sie bedingen auch den Rahmen und den Geist des militanten Lebens der Organisation und jedes ihrer Mitglieder.
Die Bedeutung, die die IKS stets diesen Verhaltensprinzipien zugemessen hat, wird von der Tatsache veranschaulicht, dass sie nie zögerte, diese Prinzipien zu verteidigen, selbst wenn sie dabei eine Organisationskrise riskierte. Indem sie so verfährt, stellt sich die IKS bewusst und unerschütterlich in die Tradition des Kampfes von Marx und Engels in der Ersten Internationale, des Bolschewismus und der Italienischen Fraktion des Kommunistischen Linken. Indem sie so verfuhr, war sie in der Lage, eine Reihe von Krisen zu überstehen und fundamentale Verhaltensprinzipien der Klasse aufrechtzuerhalten.
Jedoch wurde das Konzept der proletarischen Moral mehr implizit denn explizit hochgehalten, es wurde eher in empirischer Manier als theoretisch verallgemeinert in die Praxis umgesetzt. Angesichts massiver Vorbehalte der neuen Generation von Revolutionären nach 1968 gegenüber jeglichen Moralkonzepten, welche im Allgemeinen als notwendigerweise reaktionär betrachtet wurden, hielt es die Organisation für wichtiger, die Verhaltensweisen der Arbeiterklasse zu berücksichtigen, statt diese sehr allgemeine Debatte zu einer Zeit zu eröffnen, die noch nicht reif genug dafür war.
Fragen der Moral waren nicht das einzige Gebiet, wo die IKS auf diese Weise verfuhr. In den frühen Tagen der Organisation existierten ähnliche Vorbehalte gegenüber der Notwendigkeit der Zentralisierung oder der Intervention der Revolutionäre, der führenden Rolle der Organisation bei der Entwicklung von Klassenbewusstsein, der Notwendigkeit des Kampfes gegen die demokratische Ideologie oder der Anerkennung der Aktualität der Auseinandersetzung mit dem Opportunismus und Zentrismus.
Und in der Tat zeigte der Verlauf unserer wichtigsten Debatten, dass die Organisation stets in der Lage war, nicht nur ihr theoretisches Niveau anzuheben, sondern auch jene Fragen zu klären, die zu Beginn unklar geblieben waren. Gerade in den Organisationsfragen ist es der IKS immer wieder gelungen, auf Herausforderungen zu reagieren, indem sie ihr theoretisches Verständnis der gestellten Fragen vertiefte und erweiterte.
Die IKS hat bereits ihre jüngste Krise so wie auch die ihr zugrundeliegende Tendenz des Verlustes der Errungenschaften der Arbeiterbewegung als Manifestationen des Eintritts des Kapitalismus in eine neue und letzte Phase, die seines Zerfalls, analysiert. Die Klärung einer solch wichtigen Frage ist eine Notwendigkeit der historischen Periode als solche und betrifft die gesamte Arbeiterklasse.
„... die Sittlichkeit ist ein Erfolg der geschichtlichen Entwicklung, ein Kulturprodukt. Sie beruht auf dem sozialen Triebe des Menschengeschlechts, auf der materiellen Notwendigkeit des gesellschaftlichen Lebens. Weil die Tendenz der Sozialdemokratie vornehmlich auf ein soziales, auf ein gesellschaftliches Leben in höherem Grade gerichtet ist, darum kann sie nicht anders, als ganz wahrhaftig eine moralische Tendenz sein.“ [3]
Der Zerfall des Kapitalismus untergräbt das Vertrauen in das Proletariat und in die Menschheit
Aufgrund der Unfähigkeit der beiden Hauptgesellschaftsklassen, Bourgeoisie und Proletariat, ihre Lösung der Krise durchzusetzen, hat der Kapitalismus seine ultimative Phase des Zerfalls betreten, die sich durch die allmähliche Auflösung nicht nur der gesellschaftlichen Werte, sondern auch der Gesellschaft selbst auszeichnet.
Heute, angesichts des „Jeder-für-sich“ des kapitalistischen Zerfalls und der Aushöhlung aller moralischen Werte, wird es für revolutionäre Organisationen – und, allgemeiner noch, für die aufkommende neue Generation von Militanten – unmöglich sein, sich zu behaupten, ohne sich Klarheit über moralische und ethische Themen verschafft zu haben. Nicht nur die bewusste Entwicklung der Arbeiterkämpfe, sondern auch eine spezifische theoretische Auseinandersetzung mit diesen Fragen und die Wiederaneignung des Werkes der marxistischen Bewegung sind zu einer Überlebensfrage geworden. Dieser Kampf ist unverzichtbar nicht nur für den proletarischen Widerstand gegen den Zerfall und die aus diesem resultierende amoralische Haltung, sondern auch, um das proletarische Vertrauen in eine Zukunft der Menschheit mithilfe des eigenen historischen Projekts wiederzugewinnen.
Die besondere Form, die die Konterrevolution in der UdSSR annahm – der Stalinismus, der sich selbst als Vollendung statt als Totengräber der Oktoberrevolution darstellte –, hatte bereits das Vertrauen in das Proletariat und in seine kommunistische Alternative erschüttert. Nach dem Ende der Konterrevolution 1968 hat der Zusammenbruch der stalinistischen Regimes 1989 – die historische Epoche des Zerfalls einleitend – noch einmal das Vertrauen des Proletariats in sich selbst als Vermittler der Befreiung der gesamten Menschheit erschüttert.
Die Schwächung des Selbstvertrauens, der Klassenidentität und der Vision einer proletarischen Alternative zum Kapitalismus haben mit den ersten Schockwellen des Zerfalls die Bedingungen verändert, unter denen sich die Frage der Ethik stellt. In der Tat haben die Rückschläge der Arbeiterklasse ihr Vertrauen nicht nur in eine kommunistische Perspektive, sondern auch in die Gesellschaft insgesamt beschädigt.
Die Behauptung, dass der grundsätzlich „schlechte“ Charakter der Menschen die Probleme der zeitgenössischen Gesellschaft bedingt, erntete bei klassenbewussten Arbeitern in der Epoche des kapitalistischen Aufstiegs und noch mehr in der ersten revolutionären Welle nur Hohn und Spott. Dagegen scheint heute die Behauptung von der Unmöglichkeit fundamentaler gesellschaftlicher Verbesserungen und der Entwicklung höherer Formen der menschlichen Solidarität zu einer gegebenen Tatsache der historischen Lage geworden zu sein. Heutzutage suchen die tiefen Zweifel an den moralischen Qualitäten unserer Spezies nicht nur die herrschende Klassen und die Zwischenschichten heim, sondern bedrohen auch das Proletariat einschließlich seiner revolutionären Minderheiten. Dieser Mangel an Vertrauen in die Möglichkeit eines kollektiveren und verantwortlicheren Umgangs mit der menschlichen Gemeinschaft ist nicht nur das Resultat der Propaganda der herrschenden Klasse. Die historische Entwicklung selbst hat zu diesem Verlust an Vertrauen in die Zukunft der Menschheit geführt.
Wir leben in einer Zeit, die gekennzeichnet ist von:
– einem extremen Pessimismus gegenüber der „menschlichen Natur“;
– Skeptizismus und gar Zynismus gegenüber der Notwendigkeit oder gar der Möglichkeit von moralischen Werten;
– einer Unterschätzung oder gar Leugnung der Wichtigkeit ethischer Fragen.
Die öffentliche Meinung glaubt das Urteil des englischen Philosophen Thomas Hobbes (1588–1679) bestätigen zu können, dass der Mensch unter seinesgleichen wie ein Wolf unter Wölfen ist. Der Mensch wird im Grunde als destruktiv, räuberisch, egoistisch, heillos irrational und in seinem Sozialverhalten als unter vielen Tierarten stehend betrachtet. Der kleinbürgerliche Umweltschutz zum Beispiel betrachtet die kulturelle Entwicklung als einen „Fehler“ oder als „Sackgasse“. Die Menschheit selbst wird als Krebsgeschwür der Geschichte gesehen, an dem die Natur „Rache“ nehmen wird – ja, sogar soll.
Natürlich hat der kapitalistische Zerfall diese Probleme nicht geschaffen, aber er hat die bereits herrschenden Probleme unerträglich verschärft.
In den letzten Jahrhunderten hat die Verallgemeinerung der kapitalistischen Warenwirtschaft die Bande der Solidarität als Gesellschaftsgrundlage fortschreitend aufgelöst, so dass selbst die Erinnerung an sie aus dem kollektiven Bewusstsein zu verschwinden droht.
Die Niedergangsphase von Gesellschaftsformationen war stets von der Auflösung etablierter moralischer Werte und – solange sich eine historische Alternative noch nicht durchzusetzen begann – von einem Vertrauensverlust in die Zukunft geprägt.
Doch die Barbarei und Unmenschlichkeit der kapitalistischen Dekadenz ist einmalig. Es ist nicht leicht, nach Auschwitz und Hiroshima und angesichts permanenter, allgemeiner Zerstörung das Vertrauen in die Möglichkeit eines moralischen Fortschritts aufrecht zu halten.
Der Kapitalismus hat auch das frühere, rudimentäre Gleichgewicht zwischen dem Menschen und dem Rest der Natur zerstört und somit die langfristigen Grundlagen der Gesellschaft untergraben.
Zu diesen Merkmalen der historischen Entwicklung des Kapitalismus müssen wir noch die sich häufenden Auswirkungen eines allgemeineren Phänomens beim Aufstieg der Menschheit im Rahmen von Klassengesellschaften hinzufügen. Dies ist die Ungleichmäßigkeit bei der Entwicklung der verschiedenen Kapazitäten der Menschheit; im Besonderen die Kluft zwischen der moralischen und der gesellschaftlichen sowie technologischen Entwicklung.
„Die Naturwissenschaften werden richtigerweise als das Gebiet betrachtet, auf dem das menschliche Denken seine logischen Formen in einer kontinuierlichen Serie von Triumphen am mächtigsten entwickelt hat (...) Umgekehrt steht als Gegenbeweis auf der anderen Seite das große Gebiet der menschlichen Handlungsweisen und Beziehungen, in denen der Gebrauch von Werkzeugen keine unmittelbare Rolle spielt und die nur undeutlich und als zutiefst unbekannte und unsichtbare Phänomene wirken. Dort sind Gedanke und Tat meistens von Leidenschaft und Trieben bestimmt, von Willkür und Verschwendung, von Tradition und Glaube; dort führt keine methodische Logik zu der Gewissheit von Wissen (...) Der Gegensatz, der hier zwischen der Perfektion einerseits und der Unvollkommenheit andererseits auftritt, bedeutet, dass der Mensch die Naturkräfte beherrscht oder dabei ist, dies mit noch größeren Maßnahmen zu erreichen, jedoch nicht in der Lage ist, die Kräfte des Willens und der Leidenschaften, die in ihm sind, zu kontrollieren. Wo er auf der Stelle tritt, vielleicht sogar zurückgefallen ist, das ist der offensichtliche Mangel an Kontrolle über seine eigene ‚Natur‘ (Tilney). Daher hinkt offensichtlich die Gesellschaft so weit hinter den Wissenschaften hinterher. Der Mensch hat das Potenzial, die Natur zu beherrschen. Doch er besitzt keine Herrschaft über seine eigene Natur.“ [4]
Warum die Idee von der „proletarischen Moral“ nach 1968 so verdächtig erschien
Nach 1968 war die Elementarkraft des Arbeiterkampfes ein mächtiges Gegengewicht zum wachsenden Skeptizismus der kapitalistischen Gesellschaft. Gleichzeitig führte eine unzureichende Assimilierung des Marxismus zu der allgemeinen Behauptung innerhalb der neuen Generation von Revolutionären, dass es innerhalb der sozialistischen Gesellschaft keinen Platz für Moral oder ethische Fragen gibt.
Diese Haltung war an erster Stelle das Produkt des Bruchs in der organischen Kontinuität, der von der Konterrevolution verursacht wurde, welche der revolutionären Welle von 1917–23 gefolgt war. Bis dahin wurden die ethischen Werte der Arbeiterbewegung stets von einer Generation zur nächsten weitergereicht. Die Assimilierung dieser Werte war also von der Tatsache begünstigt, dass sie Teil einer lebendigen, kollektiven, organisierten Praxis war. Die Konterrevolution löschte zu einem großen Teil die Kenntnis von diesen Errungenschaften aus, so wie sie die revolutionären Minderheiten fast vollständig eliminierte, die diese verkörperten.
Darüber hinaus pervertierte der Stalinismus als politisches Produkt der Konterrevolution in Reinkultur diese Lehren, indem er das Vokabular der Arbeiterbewegung beibehielt und gleichzeitig den Auffassungen eine neue, bürgerliche Bedeutung verlieh. So wie er den Begriff Kommunismus diskreditierte, indem er diesen Titel der staatskapitalistischen Konterrevolution in den UdSSR verlieh, so erklärte er die Besetzung der Tschechoslowakei 1968 zu einem Ausdruck des „proletarischen Internationalismus“, so stellte er die schändliche Praxis der Einschüchterung, Denunzierung und Terrorisierung von Proletariern – die staatliche „Ethik“ des dekadenten kapitalistischen Totalitarismus – als das A und O der „proletarischen Moral“ dar.
Dies verstärkte umgekehrt den Eindruck, dass Moral an sich eine reaktionäre, der herrschenden, ausbeutenden Klasse innewohnende Angelegenheit ist. Und natürlich ist es richtig, dass in der gesamten Geschichte der Klassengesellschaften die herrschende Moral stets die Moral der herrschenden Klasse gewesen war. Dies ist insoweit richtig, als die Moral und der Staat, aber auch Moral und Religion stets synonym in der öffentlichen Meinung waren. Die moralischen Gefühle der Gesellschaft im Ganzen sind stets von den Ausbeutern, durch Staat und Religion, benutzt worden, um den herrschenden Zustand heilig zu sprechen und für ewig zu erklären. Und in der Realität bestand die Hauptrolle, die die Moral in dieser Geschichtsepoche gespielt hat, faktisch darin, den Status quo zu erhalten, die ausgebeuteten Klassen dazu zu bringen, sich in ihrer Unterdrückung zu ergeben.
Die Attitüde des Moralisierens, mit der die herrschende Klasse stets danach getrachtet hat, den Widerstand der arbeitenden Klassen durch die Einflößung eines Schuldbewusstseins zu brechen, ist eine der großen Geißeln der Menschheit. Sie ist auch eine der subtilsten und effektivsten Waffen zur Absicherung der Klassenherrschaft.
Der Marxismus hat immer die Moral der herrschenden Klassen bekämpft, so wie er das philisterhafte Moralisieren des Kleinbürgertums bekämpft hat. Entgegen der Heuchelei der Moralapostel des Kapitalismus hat der Marxismus immer und besonders darauf bestanden, dass die Kritik der politischen Ökonomie auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, nicht auf einem ethischen Urteil beruhen müsse.
Ungeachtet all dessen ist seine Pervertierung durch die Hände des Stalinismus kein Grund, das Konzept der proletarischen Moral beiseitezulegen, so wie sie denn auch keine Rechtfertigung dafür ist, dem Konzept des Kommunismus den Rücken zuzukehren. Der Marxismus hat gezeigt, dass die moralische Geschichte der Menschheit nicht nur die Geschichte der Moral der herrschenden Klasse ist. Er hat vorgeführt, dass ausgebeutete Klassen eigene ethische Werte besitzen und dass diese Werte eine revolutionäre Rolle im Fortschreiten der Menschheit spielten. Er hat bewiesen, dass Moral weder mit der Funktion der Ausbeutung noch mit dem Staat oder mit der Religion identisch ist und dass die Zukunft – wenn es denn eine Zukunft geben sollte – einer Moral jenseits von Ausbeutung, Staat und Religion gehört.
„... Menschen (werden) sich nach und nach gewöhnen (...), die elementaren, von alters her bekannten und seit Jahrtausenden in allen Vorschriften gepredigten Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens einzuhalten, sie ohne Gewalt, ohne Zwang, ohne Unterordnung, ohne den besonderen Zwangsapparat, der sich Staat nennt, einzuhalten“[5].
Der Marxismus hat enthüllt, dass das Proletariat genau dazu berufen ist, die Moral und somit die Menschheit von der Geißel des Schuldbewusstseins und dem Durst nach Rache und Bestrafung zu befreien zu helfen.
Darüber hinaus war der Marxismus durch die Verbannung des kleinbürgerlichen Moralisierens aus der Kritik der politischen Ökonomie in der Lage, die Rolle der moralischen Faktoren im proletarischen Klassenkampf wissenschaftlich aufzuzeigen. So deckte er beispielsweise auf, dass die Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft – im Gegensatz zu jeder anderen Ware – ein moralisches Element enthält: den Mut, die Entschlossenheit, Solidarität und Selbstachtung der Arbeiter.
Der Widerstand gegen das Konzept der proletarischen Moral drückt auch das Gewicht der kleinbürgerlichen und demokratischen Ideologie aus – die Abscheu vor Verhaltensregeln, vor jederlei Prinzip, vor so vielen Fesseln der individuellen „Freiheit“. Diese Schwäche betonte die Unreife dieser Generation gerade in den Fragen des menschlichen und organisatorischen Verhaltens und ihr Scheitern, von neuem eine starke Tradition der proletarischen Solidarität zu entwickeln.
Das Wesen der Moral
Die Moral ist ein unverzichtbarer Verhaltensführer in der Welt der menschlichen Kultur. Sie identifiziert die Prinzipien und Regeln, die das Zusammenleben der Gesellschaftsmitglieder moderieren. Solidarität, Sensibilität, Großzügigkeit, Unterstützung der Bedürftigen, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Höflichkeit, Bescheidenheit, Solidarität zwischen den Generationen – all dies sind Schätze, die zum Erbe der Menschheit gehören. Sie sind Qualitäten, ohne die eine Gesellschaft unmöglich ist. Daher haben die Menschen stets Werte anerkannt, so wie umgekehrt Gleichgültigkeit gegenüber den anderen, Brutalität, Gier, Neid, Arroganz und Eitelkeit, Unehrlichkeit und Untreue stets Ablehnung und Abscheu provoziert haben.
Als solche erfüllt die Moral die Funktion, im Interesse der Aufrechterhaltung der Gemeinschaft die sozialen gegenüber den antisozialen Impulsen zu begünstigen. Sie kanalisiert die psychische Energie im Interesse der Gesamtheit. Die Art und Weise, wie diese Energie kanalisiert wird, variiert entsprechend der Produktionsweise, der gesellschaftlichen Konstellationen, etc. Die Tatsache der Einspannung dieser Kräfte ist so alt wie die Gesellschaft selbst.
Innerhalb der Gesellschaft kristallisieren sich infolge einer ständigen Wiederholung von charakteristischen Situationen auf der Grundlage der lebendigen Erfahrung Verhaltensnormen und -maßstäbe, die der gegebenen Lebensweise entsprechen. Dieser Prozess ist Teil dessen, was Marx im Kapital die relative Emanzipation von Willkür und bloßem Schicksal durch die Etablierung einer Ordnung nannte.
Die Moral hat einen imperativen Charakter. Sie ist eine Aneignung der sozialen Welt durch eine Einteilung in „gut“ und „böse“, in akzeptabel und nicht-akzeptabel. Diese Form, sich der Realität anzunähern, instrumentalisiert bestimmte psychische Mechanismen, wie das Gewissen und das Verantwortungsgefühl. Diese Mechanismen beeinflussen Entscheidungen und allgemeines Verhalten, ja bestimmen sie häufig. Die moralischen Forderungen enthalten eine Kenntnisnahme der Gesellschaft – eine Kenntnis, die auf emotionaler Ebene absorbiert und assimiliert worden war. Wie alle Mittel der Aneignung und Umwandlung der Realität hat sie einen kollektiven Charakter. Via Einbildung, Intuition und Beurteilung erlaubt sie dem Subjekt, die geistige und emotionale Welt anderer Menschen zu betreten. Sie ist also eine Quelle menschlicher Solidarität und ein Mittel gegenseitiger spiritueller Bereicherung und Entwicklung. Sie kann sich nicht ohne soziale Interaktion entfalten, ohne die Weiterreichung der Errungenschaften und Erfahrungen unter den Mitgliedern der Gesellschaft, von der Gesellschaft zum Einzelnen und von einer Generation zur nächsten.
Eine Besonderheit der Moral besteht darin, dass sie die Realität an dem misst, wie sie sein sollte. Ihr Vorgehen ist eher teleologisch denn kausal. Der Zusammenstoß zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, ist kennzeichnend für die moralische Handlungsweise und macht sie zu einem aktiven und wichtigen Faktor.
Der Marxismus hat nie die Notwendigkeit oder die Bedeutung des Beitrags nicht-theoretischer und nicht-wissenschaftlicher Faktoren beim Aufstieg der Menschheit geleugnet. Im Gegenteil, er hat immer ihre Notwendigkeit und gar ihre relative Unabhängigkeit begriffen. Daher war er in der Lage, ihre gegenseitigen Verbindungen in der Geschichte zu untersuchen und ihre gegenseitige Ergänzung zu erkennen.
In Urgesellschaften, aber auch unter dem Klassenrecht entwickelt sich die Moral auf spontane Weise. Verhaltensweisen und ihre Einschätzung existierten schon lange vor der Entwicklung der Fähigkeit, moralische Werte zu kodifizieren oder über sie nachzudenken. Jede Gesellschaft, jede Klasse oder gesellschaftliche Gruppe (selbst jeder Beruf, wie Engels betonte) und jedes Individuum besitzt ein eigenes Verhaltensmuster. Wie Hegel anmerkte, ist eine Reihe von Handlungen durch ein Subjekt das Subjekt selbst.
Die Moral ist mehr als eine Summe von Verhaltensregeln und Gebräuchen. Sie ist ein wesentlicher Teil der Färbung der menschlichen Beziehungen in einer gegebenen Gesellschaft. Sie reflektiert, wie die Menschen sich selbst sehen und wie sie zu einem Verständnis untereinander gelangen, und ist gleichzeitig treibender Faktor in diesem Prozess.
Moralische Einschätzungen sind nicht nur als Antwort auf tägliche Probleme notwendig, sondern auch als Bestandteil einer planvollen Handlungsweise, die sich bewusst auf ein Ziel richtet. Sie leiten nicht nur individuelle Entscheidungen, sondern auch die Orientierung eines ganzen Lebens oder einer ganzen historischen Epoche.
Obgleich das Intuitive, das Instinktive und das Unbewusste wesentliche Aspekte in der moralischen Welt sind, wächst mit dem Aufstieg der Menschheit auch die Rolle des Bewusstseins in dieser Sphäre. Moralische Fragen berührten die eigentlichen Tiefen der menschlichen Existenz. Eine moralische Ausrichtung ist das Produkt von gesellschaftlichen Bedürfnissen, aber auch der Denkweise einer gegebenen Gesellschaft oder Gruppe. Sie erfordert eine Beurteilung des Wertes des menschlichen Lebens, des Verhältnisses des Individuums zur Gesellschaft, eine Definition des eigenen Platzes in der Welt, der eigenen Verantwortlichkeiten und Ideale. Doch hier findet die Beurteilung nicht so sehr in wechselseitiger Weise statt, sondern in der Form von Verhaltensfragen. Die ethische Ausrichtung leistet somit ihren spezifischen – praktischen, einschätzbaren, imperativen – Beitrag, dem menschlichen Leben eine Bedeutung zu verleihen. Die Ausbreitung des Universums ist ein Prozess, der sich fern und unabhängig von jeglichen Zielen und objektiven „Bedeutungen“ abspielt. Doch die Menschheit ist jener Teil der Natur, der sich selbst Ziele setzt und für ihre Verwirklichung kämpft.
In seinem Werk Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates legt Engels die Wurzeln der Moral in den sozioökonomischen Verhältnissen und den Klasseninteressen bloß. Doch er weist auch auf ihre regulierende Rolle nicht nur bei der Reproduktion der existierenden gesellschaftlichen Strukturen, sondern auch beim Aufkommen neuer Verhältnisse hin. Die Moral kann den historischen Fortschritt entweder behindern oder beschleunigen. Sie reflektiert häufig früher als die Philosophie oder die Wissenschaft verborgene Veränderungen unter der Oberfläche der Gesellschaft.
Der Klassencharakter einer gegebenen Moral sollte uns nicht blind gegenüber der Tatsache machen, dass jedes Moralsystem allgemeine menschliche Elemente enthält, die zum Schutz der Gesellschaft auf einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung beitragen. Wie Engels im Antidühring hervorhebt, enthält die proletarische Moral weitaus mehr Elemente der allgemeinen menschlichen Werte, da sie die Zukunft gegen die Moral der Bourgeoisie repräsentiert. Engels beharrt auf der Existenz eines moralischen Fortschritts in der Geschichte. Durch die Bemühungen, Generation für Generation die menschliche Existenz besser zu meistern, und durch die Kämpfe der historischen Klassen ist der Reichtum der moralischen Erfahrungen der Gesellschaft stetig angewachsen. Obwohl der ethische Fortschritt des Menschen alles andere als linear verläuft, kann er an der Notwendigkeit und Möglichkeit abgelesen werden, immer komplexere menschliche Probleme zu lösen. Dies enthüllt das Potenzial für eine wachsende Bereicherung der inneren und gesellschaftlichen Welt der Persönlichkeit, die, wie Trotzki betonte, einer der wichtigsten Maßstäbe für den Fortschritt ist.
Ein anderes fundamentales Kennzeichen auf dem moralischen Gebiet ist, dass ihre Existenz, auch wenn sie das Bedürfnis der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit ausdrückt, nicht vom eigentlichen persönlichen und intimen Leben des Individuums, von der inneren Welt des Gewissens und der Persönlichkeit zu trennen ist. Jedes Vorgehen, das den subjektiven Faktor unterschätzt, bleibt notgedrungen abstrakt und passiv. Es ist die intime und tiefe Identifizierung der Persönlichkeit mit moralischen Werten, die nebst anderen den Menschen vom Tier unterscheidet und ihm eine gesellschaftliche, wandlungsfähige Macht verleiht. Hier wird das, was gesellschaftlich notwendig ist, zur inneren Stimme des Gewissens und verbindet die Gefühle mit dem Strom des gesellschaftlichen Fortschritts. Seine moralische Reifung rüstet das Subjekt gegen Vorurteile und Fanatismus, steigert seine Fähigkeiten, bewusst und kreativ gegenüber ethischen Konflikten zu reagieren und moralische Verantwortung zu übernehmen.
Es ist ebenfalls notwendig zu unterstreichen, dass, obwohl die Moral ihre biologische Grundlage in den sozialen Instinkten hat, ihre Entwicklung nicht von der menschlichen Kultur zu trennen ist. Der Aufstieg der Menschheit hängt nicht nur von der Entwicklung des Denkens ab, sondern auch von der Erziehung und der Veredelung der Gefühle. Tolstoi hatte also Recht, als er die Rolle der Kunst beim menschlichen Fortschritt im breitesten Sinne in eine Reihe mit den Wissenschaften stellte.
„So wie dank der menschlichen Fähigkeit, durch Worte ausgedrückte Gedanken zu verstehen, jeder Mensch all das erfahren kann, was auf dem Gebiet des Denkens die gesamte Menschheit für ihn geleistet hat (...) ganz genauso wird ihm dank der menschlichen Fähigkeit, vermittels der Kunst mit den Gefühlen anderer Menschen angesteckt zu werden, auf dem Gebiet des Gefühls all das zugänglich, was die Menschheit vor ihm erlebt hat, werden ihm die Gefühle zugänglich, die seine Zeitgenossen empfinden, die andere Menschen vor Jahrtausenden empfunden haben, und wird es ihm möglich, seine eigenen Gefühle anderen mitzuteilen. Besäßen die Menschen nicht die Fähigkeit, alle durch Worte übermittelten Gedanken aufzunehmen, die von früher lebenden Menschen gedacht worden sind, und anderen ihre eigenen Gedanken mitzuteilen, die Menschen glichen wilden Tieren oder einem Kaspar Hauser. Gäbe es nicht die andere menschliche Fähigkeit, sich mit der Kunst anstecken zu lassen, die Menschen wären gewiss in noch größerem Maße Wilde und vor allem noch weit mehr voneinander geschieden und einander feindlich.“ [6]
[1] Um eine Ahnung von dem Verhalten der IFIKS-Elemente zu bekommen, siehe unsere Artikel „Morddrohungen gegen IKS-Mitglieder“, „Informanten aus den öffentlichen Veranstaltungen der IKS verbannt“, „Die Polizeimethoden der IFIKS“ (Révolution Internationale Nr. 354, 338 und 330) sowie „Außerordentliche Konferenz der IKS: Der Kampf für die Verteidigung organisatorischer Prinzipien“ in International Review Nr. 110 (franz., engl. und span. Ausgabe) und „Bilanz des 16. Kongresses der IKS: Sich auf den Klassenkampf und das Auftauchen neuer kommunistischer Kräfte vorbereiten“ in Internationale Revue Nr. 36 (deutschsprachige Ausgabe).
[2] Diese Sichtweise wird in dem Text „Die Frage des organisatorischen Funktionierens in der IKS“ entwickelt, der in der Internationalen Revue Nr. 30 veröffentlicht wurde.
[3] Josef Dietzgen: Die Religion der Sozialdemokratie – Kanzelreden, 1870.
[4] Anton Pannekoek, Anthropogenesis: A study of the origin of man, 1953, S. 101, 103 (eigene Übersetzung aus dem Englischen).
[5] Lenin, Staat und Revolution, 1917.
[6] Tolstoi, Was ist Kunst?, 1897, Kap. 5. In einem Artikel, der über dieses Essay in der Neuen Zeit veröffentlicht wurde, erklärte Rosa Luxemburg, dass Tolstoi bei der Formulierung dieses Standpunktes sich viel mehr als Sozialist und historischer Materialist erwiesen habe als das meiste, was in der Parteipresse darüber erschienen sei.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [50]
Erbe der kommunistischen Linke:
Interne Debatte der IKS: Marxismus und Ethik (Teil I/b)
- 3410 Aufrufe
Die Ethik vor dem Marxismus
Die Ethik ist das theoretische Verständnis der Moral, mit dem Ziel, ihre Rolle besser zu begreifen und ihre Inhalte und Aktionsfelder zu verbessern und zu systematisieren. Auch wenn sie eine theoretische Disziplin ist, ist ihr Ziel stets ein praktisches gewesen. Eine Ethik, die nicht dazu beiträgt, das Verhalten im wirklichen Leben zu verbessern, ist per se wertlos. Die Ethik ist erschienen und hat sich entwickelt als eine Art philosophische Wissenschaft, und zwar nicht nur aus historischen Gründen, sondern weil die Moral kein präzises Objekt ist, sondern ein Verhältnis, das die Gesamtheit des menschlichen Lebens und Bewusstseins durchdringt. Die Ethik hat die größten Geister der Menschheit beschäftigt; sie wurde von den klassischen griechischen Philosophen bis hin zu Spinoza und Kant stets als eine wichtige Frage angesehen.
Ungeachtet der Vielheit der verschiedenen Vorgehensweisen und der gegebenen Antworten ist ein gemeinsames Ziel, das sämtliche Spielarten der Ethik auszeichnet, die Beantwortung der Frage: Wie kann man ein Maximum an Glück für die größtmögliche Zahl von Menschen erreichen? Die Ethik war immer eine Waffe für den Kampf, insbesondere für den Klassenkampf gewesen.
Die Konfrontation mit Krankheit und Tod, mit dem Interessenkonflikt oder mit der Enttäuschung und dem emotionalen Leiden war oft eine mächtige Stimulans gewesen, um Ethik zu studieren. Doch während die Moral, so rudimentär sie in ihren Manifestationen ist, eine uralte Bedingung der menschlichen Existenz ist, ist die Ethik ein weitaus jüngeres Phänomen. Das Bedürfnis, seinem eigenen Verhalten und seinem eigenen Leben bewusst eine Richtung zu geben, ist das Produkt der immer komplexeren Natur des gesellschaftlichen Lebens. In der Urgesellschaft wurde der Aktivitätssinn ihrer Mitglieder direkt von der bittersten Armut, der Trägheit und Gleichförmigkeit des Lebens diktiert. Individuelle Freiheit existierte noch nicht. Vor dem Hintergrund des wachsenden Widerspruchs zwischen dem öffentlichen und privaten Leben, zwischen Individualisierung und den Bedürfnissen der Gesellschaft begann ein theoretischer Denkprozess über das Verhalten und seine Prinzipien. Dieses Nachdenken ist nicht zu trennen vom Auftreten einer kritischen Haltung gegenüber der Gesellschaft und vom Willen, sie auf planvolle Weise zu ändern. Somit wird, wie im antiken Griechenland, das Aufkommen einer solchen Haltung – wie jene der Philosophie im Allgemeinen –, während das Auseinanderbrechen der Urgesellschaft in Klassen die Vorbedingung für sie ist, insbesondere von der Entwicklung der Warenproduktion stimuliert.
Nicht nur das Erscheinen der Ethik, sondern auch ihre Evolution hängt wesentlich vom Fortschritt im Materiellen, insbesondere von der ökonomischen Grundlage der Gesellschaft ab. Mit der Klassengesellschaft änderten sich moralische Forderungen und Sitten notgedrungen, da jede Gesellschaftsformation von einer Moral abhängt, die ihren Bedürfnissen entspricht. Dies führte umgekehrt die Ethik zur Konfrontation mit neuen Fragen, neuen Widersprüchen, die die treibenden Kräfte hinter diesem Prozess sind. Wenn die herrschende Moral in Widerspruch zur historischen Weiterentwicklung tritt, wird sie zur Quelle der fürchterlichsten Leiden, die in wachsendem Maße physischer und psychischer Gewalt zu ihrer eigenen Stärkung bedarf und zu allgemeiner Desorientierung, wuchernder Heuchelei, aber auch zur Selbstgeißelung führt. Solche Phasen sind eine besondere Herausforderung für die Ethik, denn diese hat das Potenzial, neue Prinzipien zu formulieren, die erst in einer künftigen Zeit greifen und die Massen orientieren werden.
Trotz dieser Abhängigkeit ist die Entwicklung der Ethik jedoch alles andere als eine passive, mechanische Reflexion der ökonomischen Lage. Sie besitzt eine eigene innere Dynamik. Dies wird bereits von der Entwicklung des Materialismus der alten Griechen illustriert, der Beiträge zur Ethik leistete, die noch heute zum unschätzbaren theoretischen Erbe der Menschheit gehören. Dies schließt die Identifizierung des Strebens nach Glück als eine Hauptsorge der Ethik mit ein. Es beinhaltet die Erkenntnis, dass hinter dem Ruf nach einer Moral der „Mäßigung“ die „entmystifizierte“ materielle Tatsache steht, dass dieses Glück von der Erlangung einer Harmonie innerhalb des individuellen oder sozialen Organismus und von einem dynamischen Gleichgewicht innerhalb der Gesamtheit der verschiedenen menschlichen Bedürfnisse und ihrer Befriedigung abhängt. Bereits Heraklit machte die zentrale Frage der Ethik aus: das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen dem, was das Individuum tatsächlich tut, und dem, was es im allgemeinen Interesse tun sollte. Doch diese „Naturphilosophie“ war nicht in der Lage, eine materialistische Erklärung für die Ursprünge der Moral und insbesondere des Gewissens zu geben. Darüber hinaus hinderte die einseitige Betonung der Kausalität, zum Schaden der „teleologischen“ Seite der menschlichen Existenz (planvolle Aktivitäten für ein bewusstes Ziel), sie daran, befriedigende Antworten auf einige der größten Probleme der Ethik zu geben.
Daher ebnete nicht nur die objektive gesellschaftliche Entwicklung, sondern auch dieser Mangel an Lösungen für die gestellten theoretischen Fragen den Weg zum philosophischen Idealismus. Das Interesse des Idealismus und mit ihm das neue religiöse Credo des Monotheismus galt nicht mehr der Erklärung der Natur, sondern der Erforschung des ethischen, spirituellen Lebens. Dies kulminierte in der Aufteilung der Persönlichkeit in einen himmlischen (moralischen) und einen materiellen (körperlichen) Teil: halb Engel, halb Tier. Eine Sichtweise, die perfekt der Konsolidierung der Macht der herrschenden Klasse des Adels entsprach.
Der Triumph des ethischen Idealismus wurde erst durch den revolutionären Materialismus der aufsteigenden Bourgeoisie ernsthaft herausgefordert. Der neue Materialismus postulierte, dass die natürlichen Impulse des Menschen den Keim all dessen enthalten, was gut ist, und machte die alte Ordnung und den Zustand der Gesellschaft zur Quelle allen Übels. Aus dieser Denkschule entstammten nicht nur die theoretischen Waffen der bürgerlichen Revolution, sondern auch der utopische Sozialismus (Fourier vom französischen Materialismus, Owen von Benthams System der „Nützlichkeit“).
Doch auch dieser Materialismus war unfähig zu erklären, woher die Moral stammt. Die Moral kann nicht „natürlich“ erklärt werden, weil die menschliche Natur bereits die Moral in sich trägt. Auch kann diese revolutionäre Theorie nicht ihren eigenen Ursprung erklären. Wenn der Mensch im Moment seiner Geburt nichts als ein unbeschriebenes Blatt Papier, eine Tabula rasa, ist, wie dieser Materialismus behauptet, und allein von der herrschenden sozialen Ordnung geformt wird – woher kommen dann die revolutionären Ideen und wo liegt der Ursprung der moralischen Entrüstung, diese unerlässliche Voraussetzung für eine neue und bessere Gesellschaft? Sein wertvollster Beitrag besteht darin, dass er dem Pessimismus des Idealismus – der die Möglichkeit eines historischen ethischen Fortschritts leugnet und durch die Aufstellung unerfüllbarer moralischer Forderungen demoralisiert – den Krieg erklärt hat. Doch trotz seines scheinbar grenzenlosen Optimismus lieferte dieser allzu mechanische und metaphysische Materialismus nur eine dürftige Grundlage für ein wirkliches Vertrauen in die Menschheit. Letztendlich erscheint in dieser Weltsicht der „Aufklärer“ selbst als einzige Quelle der ethischen Vervollkommnung der Gesellschaft.
Die Tatsache, dass der bürgerliche Materialismus in seinen Bemühungen scheiterte, die Ursprünge der Moralität allein auf der Basis der Erfahrung zu erklären (und nicht nur der Rückständigkeit von Deutschland oder der Provinzialität von Königsberg), steuerte zu Kants Rückfall in den ethischen Idealismus bei der Erklärung des Phänomens des Gewissens bei. Indem er das „moralische Gesetz in uns“ zu einem „Ding an sich“ machte, das a priori existiere, außerhalb von Zeit und Raum, erklärte Kant faktisch, dass wir nicht die Ursprünge der Moral kennen können.
Und in der Tat war es, trotz aller unschätzbarer Beiträge, die die Menschheit geleistet hat und die sozusagen die Teile eines noch nicht zusammengesetzten Puzzles bildeten, erst das Proletariat, das mit Hilfe der marxistischen Theorie in der Lage war, eine befriedigende und kohärente Antwort auf diese Frage zu geben.
Der Marxismus und die Ursprünge der Moral
Für den Marxismus liegt der Ursprung der Moral im durch und durch gesellschaftlichen, kollektiven Wesen der menschlichen Gattung. Diese Moral ist das Ergebnis nicht nur von zutiefst sozialen Trieben, sondern der Abhängigkeit der Art von geplanter gemeinschaftlicher Arbeit und vom immer komplexer werdenden Produktionsapparat, den diese Arbeit erfordert. Die Grundlage und der Kern der Moral ist die Einsicht in die Notwendigkeit der Solidarität als Antwort auf das Ungenügen des Individuums, auf die Abhängigkeit von der Gesellschaft. Diese Solidarität ist der gemeinsame Nenner von allem, was im Laufe der Geschichte der Moral an Positivem und Dauerhaftem hervorgebracht wurde. Insofern ist sie sowohl Maßstab des moralischen Fortschritts als auch Ausdruck der Kontinuität dieser Geschichte – trotz aller Unterbrüche und Rückschläge.
Diese Geschichte ist geprägt von der Erkenntnis, dass die Überlebenschancen umso größer sind, je mehr die Gesellschaft oder gesellschaftliche Klasse eine Einheit bildet, je stärker ihr Zusammenhalt ist, je größer die Harmonie zwischen ihren verschiedenen Teilen. Aber es geht nicht allein um die Überlebensfrage. Tiefere Formen der Kollektivität sind die Voraussetzung für die Entfaltung der Persönlichkeit und die volle Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Gesellschaft und ihrer Mitglieder. Nur durch die Beziehung zu anderen kann der Mensch seine eigene Menschlichkeit entdecken. Die praktische Verfolgung des gemeinsamen Interesses ist das Mittel, mit dem die Mitglieder der Gesellschaft die Moral veredeln. Das reichste Leben ist dasjenige, das am stärksten in der Gesellschaft verwurzelt ist, mit den meisten Verknüpfungen zum Leben anderer.
Der Grund, weshalb nur das Proletariat die Frage des Ursprungs und des Wesens der Moral beantworten konnte, liegt darin, dass die Perspektive einer Weltgemeinschaft, einer kommunistischen Gesellschaft den Schlüssel für das Verständnis der Geschichte der Moral darstellt. Das Proletariat ist die erste Klasse in der Geschichte, die kein Sonderinteresse zu verteidigen hat und die durch eine wirkliche Vergesellschaftung der Produktion vereinigt ist – die Grundlage einer qualitativ höheren Ebene der menschlichen Solidarität.
Die materialistische Ethik des Marxismus erlaubt es dank ihrer Fähigkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse (namentlich diejenigen von Darwin, dem Marx Das Kapital gewidmet hat) zu integrieren, zu verstehen, dass der Mensch als Produkt der Evolution in Tat und Wahrheit nicht als tabula rasa, als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommt. Er bringt eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Bedürfnissen „in die Welt“, die Ergebnis seines tierischen Ursprungs sind (beispielsweise das Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Zuneigung, ohne die das Neugeborene sich nicht entwickeln, ja nicht einmal überleben kann).
Aber der Fortschritt der Wissenschaft hat auch offen gelegt, dass der Mensch darüber hinaus eine Kämpfernatur hat. Diese hat es ihm ermöglicht aufzubrechen, um die Welt zu erobern, die Naturkräfte zu beherrschen, sie zu gebrauchen, um das gesellschaftliche Leben auf dem ganzen Planeten zu entfalten. Die Geschichte zeigt auch, dass der Mensch in aller Regel vor Schwierigkeiten nicht zurückschreckt. Der Kampf der Menschheit stützt sich auf eine Reihe von Trieben, die sie aus dem Tierreich geerbt hat: diejenigen der Selbsterhaltung, der sexuellen Fortpflanzung, des Schutzes der Nachkommen usw. Im Rahmen der Gesellschaft konnten sich diese Arterhaltungstriebe nur dadurch entwickeln, dass der Mensch seine Gefühle mit den Artgenossen teilte. Es stimmt zwar, dass diese Qualitäten das Ergebnis der Sozialisierung sind; aber ebenso erlauben diese Qualitäten umgekehrt erst ein Leben in der Gesellschaft. Die Geschichte der Menschheit hat auch gezeigt, dass der Mensch ein Potential an Aggressivität mobilisieren kann und muss, ohne das er sich nicht gegen eine feindliche Umwelt verteidigen und behaupten kann.
Doch die Grundlage der Kampfbereitschaft der menschlichen Gattung geht noch viel mehr in die Tiefe, sie wurzelt vor allem in der Kultur. Die Menschheit ist der einzige Teil der Natur, der sich durch den Prozess der Arbeit ständig selbst verwandelt. Das bedeutet, dass das Bewusstsein zum wichtigsten Mittel ihres Überlebenskampfes geworden ist. Jedes Mal, wenn der Mensch ein neues Ziel erreicht hat, hat er seine Umwelt verändert und sich neue, höhere Ziele gesteckt. Dies wiederum hat eine Weiterentwicklung seines gesellschaftlichen Wesens bedingt.
Die wissenschaftliche Methode des Marxismus hat die biologischen, „natürlichen“ Ursprünge der Moral und des gesellschaftlichen Fortschritts aufgedeckt. Weil er die Bewegungsgesetze der menschlichen Geschichte entdeckte und den metaphysischen Standpunkt überwand, löste der Marxismus die Fragen, die der alte, bürgerliche Materialismus nicht beantworten konnte. Damit bewies er die Relativität, aber auch den relativen Wert der verschiedenen moralischen Systeme der Geschichte. Er legte ihre Abhängigkeit von der Entwicklung der Produktivkräfte und – ab einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt – dem Klassenkampf offen. Dadurch legte er das theoretische Fundament für eine praktische Überwindung dessen, was eine der größten Geißeln der Menschheit bis heute gewesen ist: die fanatische, dogmatische Tyrannei jedes moralischen Systems.
Indem der Marxismus aufzeigte, dass die Geschichte eine Bedeutung hat und ein kohärentes Ganzes bildet, überwand er den falschen Gegensatz zwischen dem moralischem Pessimismus des Idealismus und dem hohlen Optimismus des bürgerlichen Materialismus. Durch den Nachweis eines moralischen Fortschritts in der Geschichte der Menschheit, erweiterte er die Grundlage für das Vertrauen des Proletariats in die Zukunft.
Trotz der erhabenen Schlichtheit der gemeinschaftlichen Grundsätze des Urkommunismus waren seine Tugenden an die blinde Unterwerfung unter Rituale und Aberglauben gebunden, sie waren nie das Ergebnis einer bewussten Wahl. Typisch war die örtliche Gebundenheit der moralischen Grundsätze: Der Fremde verkörperte Böses. Erst mit dem Aufkommen der Klassengesellschaft (in Europa zur Zeit der Blüte der Sklavenhaltergesellschaften) konnten menschliche Wesen einen moralischen Wert unabhängig von Blutsbanden besitzen. Diese Errungenschaft war das Produkt von Kultur und der Revolte von Sklaven und anderer unterdrückter Schichten. Es ist wichtig festzuhalten, dass die Kämpfe der ausgebeuteten Klassen, selbst wenn sie keine revolutionäre Perspektive hatten, das moralische Erbe der Menschheit durch die Kultivierung eines rebellischen Geistes und einer Empörung, durch die Erringung eines Respekts vor der menschlichen Arbeit sowie die Idee der Würde eines jeden menschlichen Wesens bereicherten. Der moralische Reichtum einer Gesellschaft ist nie bloß das Ergebnis der unmittelbaren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Konstellation, sondern eine Zusammenfassung von Errungenschaften der Geschichte. Wir sollten dabei auch nicht vergessen, dass die Individualisierung nicht allein die Einsamkeit hervorbrachte, sondern auch zur Entdeckung und Untersuchung der tiefsten Schichten unserer Seele und zur Grundlegung für die Übernahme individueller Verantwortung führte. So wie die Erfahrung und das Leiden eines langen und schwierigen Lebens zur Reifung derjenigen beiträgt, die sich dadurch nicht brechen lassen, wird die Hölle der Klassengesellschaft zum Wachstum der moralischen Erhabenheit der Menschheit beitragen – unter der Bedingung, dass diese Gesellschaft überwunden werden kann.
Es sollte weiter hinzugefügt werden, dass der historische Materialismus den alten Gegensatz zwischen Trieb und Bewusstsein, und zwischen Kausalität und Teleologie, der den Fortschritt der Moral behinderte, auflöste. Die objektiven Gesetzmäßigkeiten der geschichtlichen Entwicklung sind ihrerseits Ausdrücke der menschlichen Tätigkeit. Sie erscheinen nur deshalb als äußerliche Kräfte, weil die Ziele, die sich die Menschen setzen, von den Umständen abhängen, die die Vergangenheit der Gegenwart vermacht hat. Wenn man diesen Prozess aber als dynamischen begreift, als Bewegung von der Vergangenheit in die Zukunft, ist die Menschheit sowohl das Ergebnis als auch die Ursache der Veränderung. In diesem Sinn sind auch die Moral und die Ethik sowohl das Produkt als auch aktive Faktoren der Geschichte.
Indem der Marxismus das wahre Wesen der Moral aufdeckt, ist er auch in der Lage, ihre Richtung zu beeinflussen und sie als Waffe des proletarischen Klassenkampfes zu schärfen.
Der Kampf gegen die bürgerliche Moral
Die proletarische Moral entwickelt sich im Kampf gegen die herrschenden Werte, nicht in der Isolierung von ihnen. Die wachsende Unerträglichkeit der herrschenden Werte wird zu einer der Hauptantriebskräfte bei der Entwicklung einer konträren, revolutionären Moral und ihrer Fähigkeit, die Massen zu ergreifen.
Der Kern der Moral der bürgerlichen Gesellschaft ist in der Verallgemeinerung der Warenproduktion enthalten. Diese bestimmt ihren wesentlich demokratischen Charakter, der eine höchst fortschrittliche Rolle bei der Auflösung des Feudalismus spielte, der jedoch mit dem Niedergang des kapitalistischen Systems in wachsendem Maße seine irrationale Seite enthüllt.
Der Kapitalismus ordnet die gesamte Gesellschaft, einschließlich der Arbeitskraft selbst, der Quantifizierung des Tauschwerts unter. Der Wert der Menschen und ihrer produktiven Aktivitäten liegt nicht mehr in ihren konkreten menschlichen Qualitäten und ihrem einzigartigen Beitrag zur Kollektivität, sondern kann nur noch quantitativ, im Vergleich zu anderen und einem abstrakten Durchschnitt ermessen werden – was sie mit der Gesellschaft als unabhängige, blinde Kraft konfrontiert. Indem also der Mensch als Konkurrent gegen den Mitmenschen ausgespielt wird und gezwungen ist, sich ständig an anderen zu messen, höhlt der Kapitalismus die menschliche Solidarität als Grundlage der Gesellschaft aus. Indem er von den realen Qualitäten der lebenden Menschen, einschließlich ihrer moralischen Qualitäten, abstrahiert, unterminiert er die eigentliche Grundlage der Moral. Indem er die Frage: „Was kann ich zur Gemeinschaft beitragen?“ durch die Frage: „Was ist mein eigener Wert innerhalb der Gemeinschaft?“ (Reichtum, Macht, Prestige) ersetzt, stellt er die Möglichkeit einer Gemeinschaft schlechthin in Frage.
Die bürgerliche Gesellschaft neigt dazu, die moralischen Errungenschaften auszuhöhlen, die die Menschheit in Jahrtausenden angehäuft hat, von den simplen Traditionen der Gastfreundschaft und des Respekts gegenüber den anderen im täglichen Leben bis hin zum elementaren Reflex, jenen zu helfen, die in Not sind.
Mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Schlussphase, den Zerfall, neigt diese ihm innewohnende Tendenz dazu, vorherrschend zu werden. Der irrationale Charakter dieser Tendenz – langfristig unvereinbar mit dem Schutz der Gesellschaft – enthüllt sich in der Notwendigkeit selbst für die Bourgeoisie, im Interesse einer profitablen Produktion wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen und Strategien gegen das „Mobbing“ auszuhecken, Pädagogen einzustellen, die Schulkindern beibringen, wie man mit Konflikten umgeht und wie man die Qualität der immer selteneren Fähigkeit, in einer Gruppe zu arbeiten, erlernt, die wichtigste Qualifikation, die viele Betriebe von den neuen Beschäftigten verlangen.
Eine Besonderheit des Kapitalismus ist die Ausbeutung auf der Grundlage der „Freiheit“ und juristischen „Gleichheit“ der Ausgebeuteten. Daher der im Prinzip heuchlerische Charakter seiner Moral. Doch diese Besonderheit verändert auch die Rolle, die die Gewalt in der Gesellschaft spielt.
Im Gegensatz zu dem, was seine Apologeten behaupten, übt der Kapitalismus nicht weniger, sondern eine weitaus rohere Gewalt als jede andere Ausbeutungsweise aus. Doch weil die Verstärkung des Ausbeutungsprozesses selbst nun auf einem wirtschaftlichen Verhältnis statt auf physischem Zwang beruht, gibt es einen qualitativen Sprung in der Anwendung indirekter, moralischer, psychischer Gewalt. Verleumdungen, Anschläge auf die Persönlichkeit, die Suche nach Sündenböcken, die gesellschaftliche Isolation anderer, die systematische Degradierung der menschlichen Würde und des Selbstvertrauens sind zu täglichen Instrumenten der sozialen Kontrolle und des Konkurrenzkampfes geworden. Mehr noch: sie sind zu Manifestationen der demokratischen Freiheit, des moralischen Ideals der bürgerlichen Gesellschaft geworden. Und je mehr die Bourgeoisie sich auf diese indirekte Gewalt und auf den Einfluss ihrer Moral gegen das Proletariat verlässt, desto stärker ist ihre Position.
Die Moral des Proletariats
Der Kampf des Proletariats für den Kommunismus bildet mit Abstand den höchsten Punkt in der moralischen Entwicklung der Gesellschaft bis heute. Er beinhaltet, dass die Arbeiterklasse die gesammelten Kulturgüter geerbt und sie auf einem qualitativ höheren Niveau weiterentwickelt hat, sie auf diese Weise vor der Liquidierung durch den kapitalistischen Zerfall bewahrend. Eines der Hauptziele der kommunistischen Revolution ist der Sieg der sozialen Gefühle und Qualitäten über die anti-sozialen Impulse. Wie Engels im Antidühring argumentiert, wird eine wirklich menschliche Moral fern jeder Klassenwidersprüche erst in einer Gesellschaft möglich sein, in der nicht nur der Klassengegensatz selbst, sondern auch die Erinnerung an ihn praktisch aus dem täglichen Leben verschwunden ist.
Das Proletariat absorbiert antike Gemeinschaftsregeln wie auch die Errungenschaften der jüngeren und komplizierteren Ausdrücke der Moralkultur in seine eigene Bewegung. Dies beinhaltet auch solch elementare Regeln wie das Verbot des Diebstahls, das für die Arbeiterbewegung nicht nur eine goldene Regel der Solidarität und des gegenseitigen Vertrauens ist, sondern auch eine unersetzliche Barriere gegen fremde moralische Einflüsse der Bourgeoisie und des Lumpenproletariats.
Die Arbeiterbewegung lebt auch von der Entfaltung des sozialen Lebens, der Sorge um das Leben der anderen, des Schutzes der ganz Jungen, der ganz Alten und der Bedürftigen. Auch wenn sich die Liebe zur Menschheit nicht nur auf das Proletariat beschränkt, wie Lenin sagt, ist diese Wiederaneignung durch die Arbeiterklasse notgedrungen kritisch und strebt die Überwindung der Rohheit, Kleinlichkeit und der Provinzialität der nicht-proletarischen ausgebeuteten Klassen und Schichten an.
Das Auftreten der Arbeiterklasse als Träger des moralischen Fortschritts ist eine perfekte Veranschaulichung der dialektischen Natur der gesellschaftlichen Entwicklung. Durch die radikale Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln und ihre radikale Unterordnung unter die Marktgesetze schuf der Kapitalismus zum ersten Mal in der Geschichte eine Gesellschaftsklasse, die radikal von ihrer eigenen Menschlichkeit entfremdet war. Die Genese der modernen Klasse von Lohnarbeitern ist somit eine Geschichte der Auflösung sozialer Gemeinschaften und ihrer Errungenschaften – der Entwurzelung, Vagabundierung und Kriminalisierung von Millionen von Männern, Frauen und Kindern. Abseits der Sphäre der Gesellschaft waren sie einem unbeschreiblichen Prozess der Brutalisierung und moralischer Degradierung ausgesetzt. Anfangs waren die Arbeiterbezirke in den industrialisierten Regionen Brutstätten der Ignoranz, des Verbrechens, der Prostitution, des Alkoholismus, der Gleichgültigkeit und Hoffnungslosigkeit.
Doch schon in seiner Untersuchung der Arbeiterklasse in England konnte Engels feststellen, dass die klassenbewussten unter den Proletariern die liebenswürdigsten, edelsten und menschlichsten Seiten der Gesellschaft bildeten. Und später, bei der Bilanzierung der Pariser Kommune, setzte Marx das Heldentum, den Geist der Selbstaufopferung und Leidenschaft des kämpfenden, arbeitenden und denkenden Paris für die herkulische Aufgabe dem parasitären, skeptischen und egoistischen Paris der Bourgeoisie entgegen.
Diese Verwandlung des Proletariats, einst eine Klasse ohne eigene Menschlichkeit, ist der Ausdruck seines spezifischen Klassencharakters. Der Kapitalismus hat erstmals in der Geschichte einer Klasse zum Leben verholfen, die nur durch die Entfaltung der Solidarität ihre Menschlichkeit bekräftigen und ihre Identität sowie ihre Klasseninteressen ausdrücken kann. Wie niemals zuvor ist die Solidarität zur Waffe des Klassenkampfes und zum spezifischen Mittel geworden, durch das die Aneignung, die Verteidigung und die höhere Entwicklung der menschlichen Kultur und Moral durch eine ausgebeutete Klasse möglich werden. Wie Marx 1872 erklärte: „Bürger, denken wir an jenes Grundprinzip der Internationale: die Solidarität. Nur wenn wir dieses lebenspendende Prinzip unter sämtlichen Arbeitern aller Länder auf sichere Grundlagen gestellt haben, werden wir das große Endziel erreichen, das wir uns gesteckt haben. Die Umwälzung muss solidarisch sein, das lehrt uns das große Beispiel der Pariser Kommune ...“[1] [318]
Diese Solidarität ist das Resultat des Klassenkampfes. Ohne die ständige Auseinandersetzung zwischen Fabrikbesitzern und Arbeitern, sagt Marx, „würde die Arbeiterklasse Großbritanniens und ganz Europas eine niedergedrückte, charakterschwache, verbrauchte, unterwürfige Masse sein, deren Emanzipation aus eigner Kraft sich als ebenso unmöglich erweisen würde wie die der Sklaven des antiken Griechenlands und Roms“[2] [318].
Und Marx fügte hinzu: „Um den Wert von Streiks und Koalitionen richtig zu würdigen, dürfen wir uns nicht durch die scheinbare Bedeutungslosigkeit ihrer ökonomischen Resultate täuschen lassen, sondern müssen vor allen Dingen ihre moralischen und politischen Auswirkungen im Auge behalten.“
Diese Solidarität geht Hand in Hand mit der moralischen Empörung der Arbeiter über ihre eigene Erniedrigung. Diese Empörung ist eine Voraussetzung nicht nur für den Kampf und Selbstrespekt der Arbeiter, sondern auch für das Aufblühen ihres Klassenbewusstseins. Nachdem er die Fabrikarbeit als ein Mittel zur Verdummung der Arbeiter definiert hat, kommt Engels zu dem Schluss: „... wenn dennoch die Fabrikarbeiter nicht nur ihren Verstand gerettet, sondern auch mehr als andere ausgebildet und geschärft haben, so war dies wieder nur durch die Empörung gegen ihr Schicksal und gegen die Bourgeoisie möglich.“ [3] [318]
Die Befreiung der Arbeiter aus dem paternalistischen Gefängnis des Feudalismus versetzte sie in die Lage, die politische, globale Dimension dieser „moralischen Resultate“ zu entwickeln und so sich ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft als Ganzes zu Herzen zu nehmen. In seinem Buch über die Arbeiterklasse in England ruft Engels in Erinnerung, wie in Frankreich die Politik und in Großbritannien die Ökonomie sie aus ihrer „Gleichgültigkeit gegenüber den allgemeinen Interessen der Menschheit“ befreite, eine Gleichgültigkeit, die sie „geistig-tot“ machte.
Für die Arbeiterklasse ist die Solidarität nicht eine Waffe unter vielen anderen, die angewendet wird, wenn sie benötigt wird. Sie ist die Essenz des Kampfes und der täglichen Existenz der Klasse. Daher sind die Organisation und die Zentralisierung ihres Kampfes der lebendige Ausdruck dieser Solidarität.
Der moralische Aufstieg der Arbeiterbewegung ist nicht von der Formulierung ihres historischen Ziels zu trennen. Im Verlaufe seiner Untersuchung der utopischen Sozialisten erkannte Marx den ethischen Einfluss von kommunistischen Ideen, durch welche „unser Bewusstsein geschmiedet wird“. Und in ihrem Werk „Sozialismus und die Kirchen“ rief Rosa Luxemburg in Erinnerung, dass die Verbrechensraten in den Industriebezirken von Warschau drastisch zurückgegangen waren, sobald aus Arbeitern Sozialisten geworden waren.
Kennzeichnend für den moralischen Fortschritt ist die Erweiterung des Wirkungskreises der sozialen Tugenden und Antriebe, bis die Gesamtheit der Menschheit erfasst ist. Der bei weitem höchste Ausdruck der menschlichen Solidarität, des ethischen Fortschritts der Gesellschaft bis heute ist der proletarische Internationalismus. Dieses Prinzip ist ein unerlässliches Mittel zur Befreiung der Arbeiterklasse und bereitet die Grundlage für die künftige menschliche Gemeinschaft. Die Zentralität dieses Prinzips und die Tatsache, dass nur die Arbeiterklasse es verteidigen kann, unterstreicht die Bedeutung der moralischen Autonomie des Proletariats gegenüber allen anderen Klassen und Schichten der Gesellschaft. Es ist unerlässlich für klassenbewusste Arbeiter, sich selbst größtenteils vom Denken und Fühlen der Bevölkerung zu befreien, um ihre eigene Moral jener der Bourgeoisie entgegenzusetzen.
Ihre Stellung im Herzen des proletarischen Kampfes lässt ein neues Verständnis der Bedeutung der Solidarität in der menschlichen Gesellschaft zu.
Sie ist ein unverzichtbares Mittel, um das Ziel des Kommunismus zu erreichen, aber auch das Wesen selbst dieses Ziels. Ebenso besteht das Ziel der Arbeiterbewegung bei der Bekämpfung des Kapitalismus nicht nur darin, Ausbeutung und materiellen Eigennutz, sondern auch Einsamkeit und soziale Gleichgültigkeit zu überwinden.
Revolutionen beinhalten stets die moralische Erneuerung der Gesellschaft. Sie können nicht stattfinden und erfolgreich sein, es sei denn, die Massen waren bereits zuvor von neuen Werten und Ideen erfasst, die ihren Kampfgeist, ihren Mut und ihre Entschlossenheit galvanisieren. Die Überlegenheit der moralischen Werte des Proletariats bildet eines der prinzipiellen Elemente ihrer Fähigkeit, andere nicht ausbeutende Schichten hinter sich zu ziehen. Obgleich es unmöglich ist, eine kommunistische Moral innerhalb der Klassengesellschaft zu etablieren, deuten die Prinzipien der Arbeiterklasse die Zukunft an und helfen ihr, den Weg zu ebnen. Durch den Kampf selbst bringt die Klasse ihr Verhalten und ihre Werte allmählich mit ihren eigenen Bedürfnissen und Zielen in Einklang und erlangt so eine neue menschliche Würde.
Das Ziel des Proletariats ist nicht ein ethisches Ideal, sondern die Befreiung der bereits existierenden Elemente der neuen Gesellschaft. Es hat kein Bedürfnis nach moralischen Illusionen und verabscheut Heuchelei. Sein Interesse ist es, die Moral von allen Illusionen und Vorurteilen zu entkleiden. Als erste Klasse in der Gesellschaft mit einem wissenschaftlichen Verständnis der Gesellschaft erreicht es eine neue Qualität in dem anderen Hauptanliegen der traditionellen Moral – in der Wahrhaftigkeit. Wie die Solidarität nimmt die Aufrichtigkeit eine neue und tiefere Bedeutung an. Angesichts des Kapitalismus, der ohne Lug und Trug nicht leben kann und der die gesellschaftliche Realität verzerrt – indem er das Verhältnis zwischen den Menschen zu einem Verhältnis zwischen Objekten macht –, besteht das Ziel des Proletariats darin, die Wahrheit als unverzichtbares Mittel seiner eigenen Befreiung zu enthüllen. Daher hat der Marxismus nie versucht, die Bedeutung der Hindernisse auf dem Weg zum Sieg herunterzuspielen oder vor der Möglichkeit einer Niederlage zurückzuschrecken. Der härteste Test der Aufrichtigkeit ist es, sich selbst gegenüber wahrhaftig zu sein. Dies betrifft Klassen genauso wie Individuen. Natürlich kann dieses Streben nach einem Verständnis der eigenen Realität schmerzvoll sein und sollte nicht in einem absoluten Sinn verstanden werden. Doch die Ideologie und die Selbsttäuschung widersprechen direkt den Interessen der Arbeiterklasse.
In der Tat ist der Marxismus Erbe der besten wissenschaftlichen Ethik der Menschheit, indem er die Suche nach der Wahrheit in den Mittelpunkt seiner Beschäftigung rückt. Für das Proletariat ist der Kampf um Klarheit von höchstem Wert. Die Haltung, Debatten zu vermeiden und zu sabotieren, ist das Gegenstück davon, da eine solche Vorgehensweise stets die Tür für das Eindringen fremder Ideologien und Verhaltensweisen weit öffnet.
Neben der Absorbierung der ethischen Errungenschaften und ihrer Weiterentwicklung auf einer höheren Ebene konfrontiert der Kampf für den Kommunismus die Arbeiterklasse mit neuen Fragen und neuen Dimensionen ethischen Handelns. Zum Beispiel stellt der Kampf um die Macht direkt die Frage des Verhältnisses zwischen den Interessen des Proletariats und jenen der Menschheit insgesamt, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Geschichte zwar einander entsprechen, aber nicht identisch sind. Angesichts einer Wahl zwischen Sozialismus und Barbarei muss die Arbeiterklasse bewusst Verantwortung für das Überleben der Menschheit in ihrer Gesamtheit übernehmen. Im September–Oktober 1917, im Angesicht eines heranreifenden Aufstandes und der Gefahr, dass das Scheitern der Revolution bei ihrer Ausbreitung zu furchtbaren Leiden für das russische und das Weltproletariat führen würde, beharrte Lenin darauf, dass dies riskiert werden müsse, weil ansonsten das Schicksal der Zivilisation selbst auf dem Spiel stünde. Ebenso wird die Wirtschaftspolitik der Umwandlung nach der Machtergreifung die Klasse mit der Notwendigkeit konfrontieren, bewusst ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Natur zu entwickeln, das nicht mehr ein Verhältnis eines „Siegers auf erobertem Gebiet“ (Antidühring) sein kann.
IKS
[1] [318] Marx: „Rede über den Haager Kongress“, 1872, MEW, Bd. 18, S. 161.
[2] [318] Marx: „Die russische Politik gegenüber der Türkei – Die Arbeiterbewegung in England“, 1853, MEW, Bd. 9, S. 171.
[3] [318] Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 1845. Kapitel „Die einzelnen Arbeitszweige. Die Fabrikarbeiter im engeren Sinne (Sklaverei. Fabrikregeln)“.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [50]
Erbe der kommunistischen Linke:
Ungarn 1956: Ein proletarischer Aufstand gegen den Stalinismus
- 3329 Aufrufe
In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 1956 begannen die Arbeiter in Budapest, fast unmittelbar gefolgt vom Rest der ungarischen Arbeiter, einen bewaffneten Aufstand, der das gesamte Land ergriff. Sie waren geknechtet durch die schreckliche Ausbeutung und den Terror, den das stalinistische Regime seit 1948 ausübte. Innerhalb von 24 Stunden breitete sich ein Streik auf die wichtigsten Industriestädte aus, die Arbeiterklasse bildete Räte und übernahm die Kontrolle des Aufstandes.
Es war eine Revolte des ungarischen Proletariates gegen den Kapitalismus in seiner stalinistischen Form, welcher bleischwer auf der Arbeiterklasse der Länder Osteuropas lastete. Diese Tatsache hat die herrschende Klasse in den letzten 50 Jahren zu verheimlichen versucht oder noch häufiger verdreht und verfälscht. In den zensurierten und verfälschten Geschichtsschreibungen wird die entscheidende Rolle der Arbeiterklasse auf ein Minimum reduziert. Zu den Arbeiterräten werden meist nur Lippenbekenntnisse gemacht, die sich auf Anekdoten reduzieren, oder sie werden als ein Mischmasch von Komitees und nationalen oder regionalen Räten dargestellt, von denen Einer nationalistischer als der Andere gewesen sein soll. Meist aber werden sie gänzlich übergangen.
Schon 1956 kursierten im Osten wie im Westen die plumpsten Lügen. Laut dem Kreml und den europäischen stalinistischen KPs waren die Ereignisse in Ungarn ein „faschistischer Aufstand“, manipuliert durch die „westlichen Imperialisten“. Für die Stalinisten gab es zu dieser Zeit zwei Ziele. Sie wollten die Zerschlagung des ungarischen Proletariates durch russische Panzer rechtfertigen. Gleichzeitig wollten sie gegenüber den Arbeitern im Westen die Illusion aufrechterhalten, dass der Ostblock „sozialistisch“ sei und vermeiden, dass diese den proletarischen Charakter des Kampfes der ungarischen Arbeiterklasse erkennen würden.
So wurde der Aufstand in Ungarn auf der einen Seite als ein „Werk von faschistischen Banden im Dienste der USA“ angeprangert, während auf der anderen Seite die Bourgeoisie der westlichen Staaten ihn als einen „Triumph der Demokratie“, einen Kampf für „Freiheit“ und „nationale Unabhängigkeit“ hochleben ließen. Diese beiden Lügen gehen Hand in Hand, da sie das Ziel haben, der Arbeiterklasse ihre eigene Geschichte und ihren revolutionären Charakter zu verbergen. Nachdem die Verbrechen des Stalinismus ans Licht gekommen waren und der Ostblock zusammengebrochen war, wurde die Version eines patriotischen Kampfes, in welchem sich alle sozialen Klassen in einem „Volksaufstand“ für den „Sieg der Demokratie“ finden, zum Haupttenor der Propaganda der Bourgeoisie.
Mit den Erinnerungszeremonien, welche die herrschende Klasse alle zehn Jahre abhält, führt sie ein Werk fort, welches sie schon damals begonnen hat. Ihr Hauptziel ist, die Arbeiterklasse am Verständnis zu hindern, dass der ungarische Aufstand ihre revolutionäre Natur zum Ausdruck brachte, ihre Fähigkeit zeigte, den bürgerlichen Staat herauszufordern und sich in Arbeiterräten zu organisieren. Dieses Zeichen der revolutionären Natur der Arbeiterklasse war umso bedeutsamer, da es sich 1956 in einer Zeit der schwersten Konterrevolution manifestierte. Damals war das Proletariat weltweit enorm geschwächt, niedergeschlagen durch den Zweiten Weltkrieg, aufgesplittert und kontrolliert durch die Gewerkschaften und deren Helfer, die politische Polizei. Aufgrund der Schwierigkeiten dieser Periode konnte der Aufstand von 1956 auch nicht zu einem bewussten Versuch des Proletariats heranreifen, die politische Macht zu übernehmen und eine neue Gesellschaft aufzubauen.
Die grenzenlose Ausbeutung unter dem Stalinismus
Wie üblich sieht die Realität anders aus, als sie von der Bourgeoisie dargestellt wird.
Der Aufstand in Ungarn war allem voran eine proletarische Antwort auf die wilde Ausbeutung, die in den Ländern ausgeübt wurde, welche nach dem Zweiten Weltkrieg unter russische Herrschaft gefallen waren.
Nach den Schrecken des Krieges, den Schlägen des faschistischen Regimes unter General Horth[1] [319] und der anschließenden Übergangsregierung (1944-48), waren die Gewalttaten der Stalinisten für die Arbeiterklasse in Ungarn ein weiterer Abstieg in die Hölle.
Am Ende des Krieges hatte der russische „Befreier“ in den Gebieten Osteuropas, welche durch ihn von der Naziherrschaft „befreit“ worden waren, das Ziel, sich fest zu installieren und so sein Reich bis zu den Toren Österreichs auszudehnen. Die Rote Armee, gefolgt von der russischen politischen Polizei NKVD, kontrollierte das gesamte Gebiet vom Baltikum bis zum Balkan. In der ganzen Region waren Plünderungen, Diebeszüge und Deportationen in Arbeitslager ein Markenzeichen der russischen Besatzung und gaben einen Vorgeschmack auf die stalinistischen Regime, die bald darauf eingesetzt wurden. In Ungarn wurde ab 1948, als der politische Apparat unter die vollständige Kontrolle der Kommunistischen Partei gebracht war, die Stalinisierung des Landes Realität. Mátyás Rákosi[2] [319], bekannt als der gelehrigste Schüler Stalins, umgeben von seiner Bande von Mördern und Folterknechten (wie z.B. dem finsteren Gerö[3] [319]) war die Personifizierung des Stalinismus in Ungarn. Er stützte sich, nach alt bekanntem Rezept, vornehmlich auf politischen Terror und grenzenlose Ausbeutung der Arbeiterklasse.
Als Sieger- und Besatzungsmacht in Osteuropa forderte die Sowjetunion von den besiegten Ländern und im Besonderen von denen, welche wie Ungarn mit den Achsenmächten zusammengespannt hatten, hohe Reparationsleistungen. In Wirklichkeit war dies lediglich ein Vorwand, um sich den Produktionsapparat der Länder, die nun zu ihren Satelliten geworden waren, anzueignen und sie dazu zu zwingen, mit allen Mitteln für die ökonomischen und imperialistischen Interessen der UdSSR zu arbeiten. Ein wahrhaftes Blutsaugersystem wurde 1945/46 installiert, so zum Beispiel mit der Demontage ganzer Fabriken und deren Abtransport auf russischen Boden - Arbeiter inbegriffen!
Mit derselben Absicht wurde 1949 der COMECON gegründet. Dies war ein Markt für „privilegierten Handel“, in welchem die Privilegien nur in eine Richtung galten. Der russische Staat konnte damit seine Produkte zu einem viel höheren Wert abstoßen als auf dem Weltmarkt. Umgekehrt erhielt Russland von seinen Satelliten Produkte zu lächerlich tiefen Preisen.
Die gesamte ungarische Wirtschaft hatte sich dem Diktat und den Produktionsplänen des russischen Hauptquartiers zu beugen. Dies zeigte sich sehr deutlich 1950-53 zur Zeit des Koreakrieges, als die UdSSR Ungarn dazu zwang, die Mehrzahl der Fabriken auf Waffenproduktion umzustellen. Ab diesem Zeitpunkt wurde Ungarn zum Haupt-Waffenlieferanten für die UdSSR.
Um die wirtschaftlichen und imperialistischen russischen Forderungen erfüllen zu können, musste der ungarische Produktionsapparat auf vollen Touren und unter größtem Druck laufen. Die Fünfjahrespläne, im Besonderen derjenige von 1950, sahen ein nie da gewesenes Produktions- und Produktivitätswachstum vor. Wunder fallen nicht vom Himmel, und so litt vor allem die Arbeiterklasse unter einer grenzenlosen Ausbeutung durch die galoppierende Industrialisierung. Die gesamte Energie musste zur Erfüllung des Planes von 1950-54 geopfert werden, mit dem Schwerpunkt des Aufbaus der Schwerindustrie und der Waffenproduktion. Letztere wurde zu Ende des Plans verfünffacht. Alles wurde unternommen, um das ungarischen Proletariat auszupressen. Der Akkordlohn wurde eingeführt, begleitet von ständig erhöhten Produktionsquoten. Die rumänische KP sagte mit einer gehörigen Portion Zynismus, dass „der Akkordlohn ein revolutionäres System ist, welches die Faulheit beseitigt, (…) jeder hat die Möglichkeit härter zu arbeiten (…)“. Das System „eliminierte“ jeden, der diese „Möglichkeit“ ausschlug. Die Arbeiter konnten wählen zwischen dem Hungertod und dem Dahinvegetieren am Arbeitplatz für einen erbärmlichen Lohn.
Wie der sagenhafte Sisyphus, der von Hades dazu verdammt wurde, einen Fels den Berghang hoch zu rollen, wurden die ungarischen Sisyphuse zu unhaltbaren und pausenlosen Arbeitsrhythmen verdammt.
In den meisten Betrieben stellte die Leitung jeweils Ende Monat fest, dass sie dem unmenschlichen Plan hinterherhinkte. Es wurde der Befehl zur „großen Anstrengung“ herausgegeben, eine Vervielfachung der Arbeitgeschwindigkeit im Sinne der „Stourmovtchina“[4] [319], oft schon an den russischen Arbeitern erprobt. Diese „Stourmovtchina“ fand nicht nur Ende Monat statt, sondern auch am Ende der Woche. Die Überstunden nahmen dramatisch zu und damit auch die Arbeitunfälle. Menschen und Maschinen wurden bis an ihre äußersten Grenzen getrieben.
Und als Krone des Ganzen war es für die Arbeiter nicht unüblich, bei Arbeitsantritt als Überraschung einen „Versprechensbrief“ vorzufinden, geschrieben und unterzeichnet in ihrem Namen von - den Gewerkschaften. Schon erschöpft, fanden sie nun ein „Versprechen“ vor, erneut die Produktion zu erhöhen, alles zu Ehren dieser oder jener Jubiläen und Gedenktage. Jede nur erdenkliche Möglichkeit wurde ausgeschöpft, um diese Art von „freiwilligen“ Arbeitstagen zu erzwingen, welche natürlich unbezahlt waren. Zwischen März 1950 und Februar 1951 gab es 11 solche Tage: „Befreiungstag“, 1. Mai, Korea-Woche, Rákosis Geburtstag und andere Ereignisse, die Grund waren für unbezahlte Überzeit.
Während der Periode des ersten Fünfjahresplanes wurde die Produktion verdoppelt und die Produktivität stieg um 63%. Die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse verschlechterten sich drastisch. Innerhalb von 5 Jahren, von 1949 bis 1954, wurden die Nettolöhne um 20% reduziert, und im Jahr 1956 lebten nur 15% der Familien über dem von den regimeeigenen Experten definierten Existenzminimum!
Der Stachanovismus wurde in Ungarn augenscheinlich nicht auf einer freiwilligen Basis der Liebe zum „Sozialistischen Vaterland“ eingeführt. Die herrschende Klasse führte ihn mittels Terror ein, mit gewalttätigen Repressalien und schweren Sanktionen, wenn die Produktionsnormen (welche laufend in die Höhe geschraubt wurden) nicht erfüllt waren.
Der stalinistische Terror erfasste die Fabriken gänzlich. Am 9. Januar 1950 verabschiedete die Regierung ein Gesetz, das den Arbeitern untersagte, den Arbeitsplatz ohne Erlaubnis zu verlassen. Eine strenge Disziplin wurde eingeführt und „Verstöße“ mit strengen Bußen bestraft.
Dieser alltägliche Terror erforderte einen allgegenwärtigen Polizeiapparat. Die Polizei und die Gewerkschaften mussten überall sein, was zu fast lächerlichen Situationen führte. Die MOFAR-Fabrik in Magyarovar, die sich zwischen 1950 und 1956 auf das Dreifache vergrößerte, hatte, um die Kontrolle über die Arbeiter aufrecht zu erhalten, nicht drei- sondern zehnmal soviel Überwachungspersonal anzuheuern: Gewerkschaftsfunktionäre, Parteimitglieder und Fabrikpolizei.
Die Gewerkschaftsstatuten, die das Regime 1950 erließ, sind unmissverständlich: „(…) Organisierung und Ausdehnung des sozialistischen Wettbewerbs unter den Arbeitern, Kampf für eine bessere Organisierung der Arbeit, für die Festigung der Disziplin (…) und die Erhöhung der Produktivität“.
Doch leider waren Bußen und Einschüchterungen nicht die einzigen Maßnahmen gegen die „Widerspenstigen“.
Am 6 Dezember 1948 schimpfte Istvan Kossa, der Industrieminister, anlässlich eines Besuches der Stadt Debrecen über die „(…) Arbeiter die eine terroristische Haltung gegenüber den Managern der verstaatlichten Industrie haben (…)“. Mit anderen Worten, über die, welche sich nicht „frohlockend“ den Stachanov-Normen beugten oder ganz einfach nicht die verlangten Produktionsnormen erfüllen konnten. Seither wurden Arbeiter, die ihre Arbeit nicht genug zu „lieben“ schienen, systematisch als „Agenten des westlichen Kapitalismus“, „Faschisten“ oder „Säufer“ denunziert.
Kossa fügte hinzu, wenn sie ihre Haltung nicht änderten, helfe ihnen wohl nur eine Zeit Zwangsarbeit. Dies waren nicht leere Worte, wie unter anderem der Fall eines Arbeiters der Eisenbahnwagenfabrik in Györ zeigte. Er wurde des „Lohnbetrugs“ angeklagt und zur Internierung in einem Arbeitslager verurteilt. Die Äußerung von Sandor Kopacsi, Internierungsbeamter im Jahr 1949 und Polizeipräfekt von Budapest 1956, ist ebenfalls aufschlussreich: „In den Lagern waren Arbeiter, verarmte Bauern und Leute aus Klassen, die dem Regime feindlich gesinnt waren. Die Arbeit (des Direktors) war einfach: er musste die vorgesehene Internierungsdauer verlängern, meist um sechs Monate. (…) Sechs Monate Untersuchung und sechs Monate Verlängerung. Gewiss, es war nicht dasselbe wie die „zehn Jahre“ oder „fünfzehn Jahre“ Verlängerung in den sibirischen Einöden (…) Dennoch gingen diese Verurteilten nach der Internierung nicht zurück ins Privatleben, es waren Internierungen mit dem System der Verlängerungen um sechs Monate und weitere sechs Monate – genauso wenig wie diejenigen, welche fünfzehn oder fünfundzwanzig Jahre im Norden Sibiriens verbrachten.“ [5] [319] 1955 stieg die Zahl der Gefangenen drastisch an und die Mehrzahl waren so genannte „widerspenstige“ Arbeiter.
Unter dem Rákosi-Regime verschwanden Zehntausende spurlos. Sie waren verhaftet und interniert worden. Damals sprach man von einem „Hausglocken-Unglück“ welches Ungarn heimsuchte. Wenn die Hausglocke am Morgen läutete, wusste man nie, ob es der Milchmann oder ein Agent der politischen Polizei AVH war.
Der proletarische Aufstand vom Oktober 1956
Dennoch hatten das Terrorregime, die Präsenz der Roten Armee und die Folterer der AVH nicht den gewünschten Erfolg. Der Unmut innerhalb der Arbeiterklasse wurde ab 1948 immer spürbarer. Die Wut der Arbeiterklasse war nahe daran, sich auf der Strasse zu entladen. Es erwachte ein unbezähmbares Gefühl, sich dem hierarchischen Apparat der sowjetischen Bürokratie entgegenzusetzen, der alle Entscheide fällte, von den Produktionsnormen bis zur Auswahl der Vorarbeiter und Überwacher, welche mit der Umsetzung der Pläne in Produktionsziffern beauftragt waren.
Die ausgelaugte Arbeiterklasse war am Ende ihrer Kräfte. Die Bedingungen der Ausbeutung waren nicht länger zu ertragen und ein Aufstand bahnte sich an.
Die Situation, welche die UdSSR in Ungarn geschaffen hatte, war auch in den anderen stalinistischen Ländern des Ostblocks nicht anders. Aus diesem Grunde herrschte eine permanente Unzufriedenheit der Arbeiterklasse. Zu Beginn des Jahres 1953 waren die Arbeiter im tschechischen Pilsen mit dem stalinistischen Staatsapparat in Konflikt geraten, weil sie sich weigerten, die berühmt-berüchtigte Stücklohnproduktion zu akzeptieren. Einige Wochen später, am 17. Juni 1953, brach ein großer Streik unter den Bauarbeitern in Ostberlin aus, weil die Arbeitsnormen um 10% gestiegen und die Löhne um 30% gesenkt worden waren. Die Arbeiter demonstrierten auf der Stalin-Allee mit dem Ruf „Nieder mit der Tyrannei der Normen“, „Wir sind Arbeiter, keine Sklaven“. Streikkomitees zur Ausweitung des Kampfes entstanden spontan und sie begaben sich in die anderen Stadtteile, um die Arbeiter von Westberlin zur Teilnahme am Streik aufzurufen. Da die berühmte Berliner Mauer damals noch nicht stand, beeilten sich die westlichen Alliierten, ihre Sektoren abzuriegeln. Die in der DDR stationierten russischen Panzer erwürgten diesen Streik. So machte die herrschende Klasse im Westen und Osten in abgekarteter Manier gemeinsame Sache, um den Widerstand der Arbeiter zu erdrücken. Zur selben Zeit brachen in sieben polnischen Städten Demonstrationen und Arbeiteraufstände aus. Das Kriegsrecht wurde über Warschau, Krakau und Schlesien verhängt – und auch dort wurden die russischen Panzer zur Niederschlagung der Arbeiterklasse auf den Plan gerufen. Auch Ungarn geriet in Bewegung. Streiks brachen zuerst im großen Eisen- und Stahlproduktionsbezirk Cespel in Budapest aus, danach griffen sie auf andere Industriestädte wie Odz und Diösgyör über.
Der Sturm der Revolte gegen den Stalinismus, der über Osteuropa hinwegfegte, fand seinen Höhepunkt im Aufstand vom Oktober 1956 in Ungarn.
Das Klima in Ungarn verunsicherte den Kreml offenbar aufs Höchste. In der Absicht, der angeheizten Situation den Dampf abzulassen, entschied Moskau, den Mann, der den Terror des Regimes personifizierte, zeitweilig von der Regierung abzusetzen. Mátyás Rákosi wurde in Juni 1953 seines Postens als Premierminister enthoben. 1955 kam er wieder an die Macht zurück, wurde aber im Juli 1956 erneut abgesetzt. Doch all dies konnte die Situation nicht beschwichtigen, denn die angestaute Wut war zu groß und die Lebensbedingungen verbesserten sich nicht. Das Pulverfass stand kurz vor der Explosion.
In dieser Situation kurz vor dem Aufstand, die das Regime ins Wanken brachte, verstand die nationalistische Fraktion der ungarischen Bourgeoisie, dass sie einen Trumpf in der Hand hatte, um ihre Position als Untertan Russlands abzuwerfen oder zumindest die Leine zu verlängern, um einen größeren Spielraum zu haben. Die schnell vorangetriebene Sowjetisierung des ungarischen Staates, die totale und ungeteilte Machtkontrolle durch die Männer des Kremls und ihre Panzer der Roten Armee, die Industrie, die vollständig in den Dienst der imperialistischen Bedürfnisse der UdSSR gestellt worden war – all dies war der nationalen Bourgeoisie zuviel. Sie wartete nur auf einen Moment, um ihren Besatzer abschütteln zu können. Sogar unter den ungarischen Stalinisten herrschten starke Tendenzen zur nationalen Unabhängigkeit - die „nationalen Kommunisten“, welche zu einem „ungarischen Weg zum Sozialismus“ aufriefen, so wie er von vielen Intellektuellen vorgeschlagen wurde. Sie machten Imre Nagy[6] [319] zu ihrem „Helden“ des Oktoberaufstandes. Auch die ungarische Armee konnte nicht gänzlich sowjetisiert werden, ohne Konzessionen an den Nationalismus der alten Offiziere zu machen. In deren Augen entsprach die Allianz mit der UdSSR nicht den nationalen Interessen, welche sich traditionell am Westen orientierten. Als der Oktoberaufstand ausbrach, erblickte die Armee die Möglichkeit, sich von den stalinistischen Fesseln zu befreien. Dies ist der Grund, weshalb sie sich auch teilweise an den Straßenkämpfen beteiligte. Der patriotische Widerstand fand seine Personifizierung in der Figur des Generals Pal Maleter und die Truppen der Kilian-Kaserne in Budapest. Diese Teile der Bourgeoisie und des Kleinbürgertums vergifteten die Atmosphäre des Arbeiteraufstandes mit ihrer nationalistischen Propaganda. Es ist kein Zufall, wenn bis heute die herrschende Klasse versucht, Nagy und Maleter zu Mythen der Ereignisse von 1956 zu erheben. Durch die Darstellung dieser bürgerlichen Galionsfiguren soll die Lüge bekräftigt werden, es habe sich um eine „Revolution für Demokratie und nationale Befreiung“ gehandelt.
Nach der Absetzung von Rákosi im Juli 1956 wurde das Klima stark bestimmt von Elementen des Kleinbürgertums, den nationalistischen Intellektuellen der Schriftstellergewerkschaft und den Studenten des Petöfi-Zirkels. Am 23. Oktober organisierte Letzterer eine friedliche Demonstration in Budapest, an der viele Arbeiter teilnahmen. Bei der Statue von General Bem angelangt, verlas die Schriftstellergewerkschaft eine Resolution, welche den Anspruch auf Unabhängigkeit des „ungarischen Volkes“ ausdrückte.
Für die Bourgeoisie ist dies der Charakter des ungarischen Aufstandes – ein Haufen von Studenten und Intellektuellen, welche für die nationale Unabhängigkeit von der Moskauer Fessel kämpften. In den letzten fünfzig Jahren hat die herrschende Klasse einen Schleier über den Hauptakteur des Aufstandes, die Arbeiterklasse, gelegt. Ebenso über die Gründe, die hinter dem Aufstand lagen, welcher weit entfernt von einem nationalen Widerstand oder der Liebe zum Vaterland ein Versuch der Arbeiterklasse war, sich den schrecklichen Lebensbedingungen zu widersetzen.
Die Arbeiter strömten aus den Fabriken und die Masse der Arbeiterklasse in Budapest schloss sich der Demonstration an. Als die Versammlung offiziell beendet war, gingen die Arbeiter nicht nach Hause, im Gegenteil. Sie begaben sich in die Straße des Parlaments und begannen dort, die Statue Stalins niederzureißen und mit Hämmern zu zerstören. Danach begab sich die Menschenmasse zum Radiogebäude, um gegen die Erklärung des Premierministers Gerö zu protestieren, der die Demonstranten beschuldigte, nichts anders als „eine Bande von nationalistischen Abenteurern zu sein, welche die Macht der Arbeiterklasse brechen wolle“. Als dann die politische Polizei AVH das Feuer auf die Menge eröffnete, schlug der Protest in einen bewaffneten Aufstand um. Die nationalistischen Intellektuellen, welchen zur Demonstration aufgerufen hatten, wurde nun selbst von den Ereignissen überrascht und, wie der Sekretär des Petöfi-Zirkels, Balazs Nagy, selber zugab, wollten sie „die Bewegung lieber bremsen als vorwärts treiben“.
Innerhalb von 24 Stunden schlossen sich dem Generalstreik vier Millionen Arbeiter an, und er breitete sich auf ganz Ungarn aus. In den großen Industriezentren entstanden spontan Arbeiterräte. Damit versuchte die Arbeiterklasse, den Aufstand zu organisieren und zu kontrollieren.
Die Arbeiter bildeten zweifellos das Rückgrat der Bewegung und demonstrierten dies mit ihrer ungebrochenen Kampfbereitschaft und ihrem Willen. Sie bewaffneten sich und bildeten überall Barrikaden. In den Straßen der Hauptstadt kämpften sie mit unterlegener Bewaffnung gegen die AVH und die russischen Panzer. Die AVH war jedoch sehr bald durch die Ereignisse überrumpelt. Eine neue Regierung, gebildet und angeführt durch den „progressiven“ Imre Nagy, rief ohne zu zögern nach der Intervention der russischen Armee, um die neue Regierung vor der Wut der Arbeiter zu schützen. Nagy forderte unaufhörlich die Widerherstellung der Ordnung und die „Kapitulation der Aufständischen“. Später verkündete dieser Meister der Demokratie, dass die Intervention der russischen Streitkräfte „im Interesse der sozialistischen Disziplin notwendig gewesen sei“.
Die Panzer brachen am 24. Oktober um etwa 2 Uhr Nachts in Budapest ein und trafen auf die ersten Barrikaden in den Arbeiterbezirken der Stadt. Die Csepel-Fabrik mit ihren Tausenden von Metallarbeitern leistete den härtesten Widerstand – mit altmodischen Feuerwaffen und Molotow-Cocktails gegen Divisionen von bewaffneten russischen Fahrzeugen.
Nagy, der legitime Kandidat aller nationalistischen Bestrebungen, war unfähig, die Ruhe wieder herzustellen. Es gelang ihm nie, das Vertrauen der Arbeiter zu gewinnen und sie zur Abgabe der Waffen zu bewegen, weil die Arbeiter im Gegensatz zu den Intellektuellen und einem Teil der ungarischen Armee nicht für „die nationale Befreiung“ kämpften; obwohl sie durch die herrschende Propaganda und die patriotischen Gesänge auch angesteckt werden mochten, lehnten sie sich im Grunde gegen den Terror und die Ausbeutung auf.
Am 4. November, im selben Zeitpunkt, als Moskau Nagy durch Janos Kadar ersetzte, drangen 6000 sowjetische Tanks in die Hauptstadt ein und eröffneten eine zweite Runde, um den Aufstand endgültig niederzuschlagen. Aus diesem Grund ging die ganze Gewalt des Angriffs auf die Arbeitervororte nieder: auf das rote Csepel, Ujpest, Köbanya, Dunapentele. Trotz einer 100-fachen Überlegenheit des Feindes an Menschen und Waffen schlugen sich die Arbeiter weiter und wehrten sich wie Löwen. „In Csepel sind die Arbeiter zum Kampf entschlossen. Am 7. November wird das Gebiet durch Artillerie beschossen und von Flugzeugen bombardiert. Am nächsten Tag kommt ein sowjetischer Abgesandter, um zu versuchen, die Arbeiter zur Kapitulation zu bewegen. Sie lehnen ab, und der Kampf dauert an. Am folgenden Tag erlässt ein weiterer Offizier eine letzte Aufforderung: Wenn sie die Waffen nicht abgäben, werde das Viertel ausgelöscht. Einmal mehr lehnten die Aufständischen ab, sich zu ergeben. Der Artilleriebeschuss wurde immer stärker. Die sowjetischen Streitkräfte benützten Raketenwerfer, die ernste Schäden an den Fabriken und an den benachbarten Gebäuden verursachten. Als ihnen die Munition ausging, stellten die Arbeiter den Kampf ein.“ (Budapest, der Aufstand, François Fejtö.)
Nur der Hunger und der Mangel an Munition schienen die Kämpfe und den Arbeiterwiderstand beenden zu können.
Die Arbeiterviertel blieben völlig niedergemäht zurück, und gewisse Schätzungen gehen von mehreren Zehntausenden von Toten aus. Trotz dieser Massaker dauerte der Streik während einiger weiterer Wochen an. Auch nach seinem Ende gab es immer noch sporadische Widerstandsaktionen bis in den Januar 1957.
Die wieder entstandene Organisationsform der Arbeiterräte
Der Mut, die Revolte gegen das Elend, der Überdruss über die Ausbeutungsbedingungen und den stalinistischen Terror sind die Schüsselelemente, um diesen kämpferischen Widerstand der ungarischen Arbeiter zu erklären, aber ein weiterer wichtiger Faktor ist hinzuzufügen: die Tatsache, dass diese Revolte durch Arbeiterräte organisiert wurde.
In Budapest wie in der Provinz war ein wesentliches Merkmal des Aufstandes die Bildung von Räten. Zum ersten Mal nach fast 40 Jahren fanden die ungarischen Arbeiter in ihrem Kampf gegen die stalinistische Bürokratie spontan die Form der Organisation und der proletarischen Macht wieder, die ihre Väter zum ersten Mal in Russland im Laufe der Revolution von 1905 sowie in der revolutionären Welle schufen, die im Jahre 1917 von Petrograd ausging und 1919 auch Budapest mit seiner kurzen Räterepublik erreichte. Vom 25. Oktober 1956 an wurden die Städte Dunapentele, Szolnok (wichtiger Eisenbahnknotenpunkt), Pécs (mit den Bergwerken des Südwestens), Debrecen, Szeged, Miskolc, Györ, durch Arbeiterräte geführt, die die Bewaffnung der Aufständischen und die Versorgung organisierten und die wirtschaftlichen und politischen Forderungen stellten.
Auf diesem Weg wurde der Streik in den wichtigsten industriellen Zentren Ungarns mit Geschick geführt. So grundlegende Sektoren für die Mobilität des Proletariats wie die Transporte, so lebenswichtige Bereiche wie die Krankenhäuser und die Stromerzeugung funktionierten in vielen Fällen auf Befehl der Räte weiter. Ebenso bildeten und kontrollierten die Räte beim Aufstand die Arbeitermilizen, verteilten die Waffen (unter Kontrolle der Arbeiter der Zeughäuser) und forderten die Auflösung einiger Organisationen, die vom Regime ausgingen.
Schon am 25. Oktober rief der Rat von Miskolc die Arbeiterräte aller Städte dazu auf, „ihre Anstrengungen zu koordinieren, um eine einzige und einheitliche Bewegung zu schaffen“; allerdings gestaltete sich die Umsetzung dieses Vorhabens viel langsamer und chaotischer. Nach dem 4. November gab es in Csepel einen Versuch, auf der Ebene der Distrikte die Aktivitäten der Räte zu koordinieren. Im 13. und 14. Distrikt wurde ein erster Arbeiterdistriktrat gebildet. Später, am 13. November, regte der Rat von Ujpest die Schaffung eines mächtigen Rates für die ganze Hauptstadt an; dies war die Geburt des zentralen Rates von Großbudapest. Erster, wenn auch später Schritt in Richtung einer vereinten Macht der Arbeiterklasse.
Doch für die ungarischen Arbeiter war die politische Rolle der Räte – die eigentlich den Kern dieses Organs ausmacht, das ja dazu bestimmt ist, die Macht zu ergreifen - nur ein Zufallsprodukt, eine Funktion, die die Lage mangels Alternative aufdrängte, bis die „Spezialisten“, die „Experten der Politik“ sich wieder einrichteten und die Zügel der Macht in die Hand nahmen: „Niemand schlägt vor, dass die Arbeiterräte selbst die politische Vertretung der Arbeiter sein könnten. Sicherlich... der Arbeiterrat musste bestimmte politische Funktionen ausüben, denn er widersetzte sich einem Regime, und die Arbeiter hatte keine andere Vertretung, aber aus der Sicht der Arbeiter war dies nur eine einstweilige Lösung“ (Zeugenaussage von Ferenc Töke, Vizepräsident des zentralen Rates von Großbudapest).
Die Grenzen der Bewegung und der Räte
Wir berühren hier eine der wichtigsten Grenzen des Aufstandes: das schwache Bewusstseinsniveau des ungarischen Proletariats, das ohne revolutionäre Perspektive und ohne die Unterstützung der Arbeiter aller Länder keine Wunder vollbringen konnte. In der Tat bewegten sich die Ereignisse in Ungarn gegen den Strom, in einer finsteren Zeit, nämlich derjenigen der Konterrevolution, die auf der Arbeiterklasse des Ostens wie des Westens lastete.
Es trifft zu, dass die Arbeiter die Triebkraft des Aufstandes gegen die Regierung bildeten, die durch die russischen Panzer unterstützt wurde. Doch wenn diese Bewegung ihr proletarisches Wesen im entschlossenen Widerstand gegen die Ausbeutung zum Ausdruck brachte, so wäre es umgekehrt falsch, die gigantische Kampfbereitschaft der ungarischen Arbeiter als eine Äußerung des revolutionären Bewusstseins zu sehen. Der Arbeiteraufstand von 1956 stellt unweigerlich einen Rückgang des Bewusstseinsniveaus der Proletarier im Vergleich zu demjenigen in der revolutionären Welle von 1917-1923 dar. Während die Arbeiterräte am Ende des Ersten Weltkrieges sich als politische Organe der Arbeiterklasse verstanden, Ausdruck ihrer Diktatur waren, stellten die Räte von 1956 zu keinem Zeitpunkt den Staat in Frage. Der Arbeiterrat von Miskolc verkündete zwar am 29. Oktober „die Abschaffung der AVH“ (die ohne weiteres mit dem Terror des Regimes identifiziert wurde), fügte aber gleich hinzu, dass „die Regierung sich nur auf zwei Streitkräfte stützen darf, die nationale Armee und die gewöhnlichen Polizei“. Der kapitalistische Staat wurde nicht bloß nicht in seiner Existenz bedroht, sondern seine zwei Hauptlinien der bewaffneten Verteidigung wurden bewahrt.
Demgegenüber erkannten die Räte von 1919, die das historische Ziel ihres Kampfes klar begriffen, sofort die Notwendigkeit, die Armee aufzulösen. Damals gaben die Arbeiter der Fabriken von Csepel zur gleichen Zeit, als sie die Räte bildeten, die Losungen aus:
„- Sturz der Bourgeoisie und ihrer Institutionen
- es lebe die Diktatur des Proletariats
- Mobilisierung für die Verteidigung der revolutionären Errungenschaften durch die Bewaffnung des Volkes“.
Im Jahre 1956 gingen die Räte so weit, dass sie sich selbst die Hände banden, indem sie sich als einfache Organe der wirtschaftlichen Fabrikverwaltung definierten: „Unsere Absicht bestand nicht darin, eine politische Rolle zu beanspruchen. Wir dachten im Allgemeinen, dass es in der Politik ähnlich wie in der Wirtschaft, wo die Führung den Spezialisten überlassen wird, Experten braucht, die diese Aufgabe übernehmen.“ (Ferenc Töke). Manchmal verstanden sie sich sogar als eine Art Unternehmensausschuss: „Die Fabrik gehört den Arbeitern, diese bezahlen dem Staat Steuern, die auf Grund der Produktion von Dividenden berechnet werden, die nach den Gewinnen festgelegt sind... der Arbeiterrat entscheidet im Konfliktfall über die Beschäftigung und die Entlassung der Arbeiter“ (Resolution des Rates von Großbudapest).
In dieser dunklen Periode der fünfziger Jahre war das internationale Proletariat ausgeblutet. Die Aufrufe des Rates von Budapest an „die Arbeiter der restlichen Welt“ zugunsten von „Solidaritätsstreiks“ blieben toter Buchstabe. Und ähnlich wie ihre Klassenbrüder in den anderen Ländern hatten die ungarischen Arbeiter (trotz ihres Mutes), ein sehr geschwächtes Bewusstsein. Auf diesem Hintergrund tauchten die Räte instinktiv auf, aber ihre eigentliche Bestimmung, die Machtergreifung, konnte sich nicht verwirklichen. Die Räte von 1956 waren „Form ohne Inhalt“, sie können nur als „unvollendete“ Räte oder im besten Fall als Entwurf von Räten aufgefasst werden.
Umso einfacher ist es für die ungarischen Offiziere und die Intellektuellen, die Arbeiter im Gefängnis der nationalistischen Ideen einzuschließen, und für die russischen Panzer, sie zu massakrieren.
Während die Räte von den Arbeitern selbst nicht als politische Organe aufgefasst wurden, so sahen sie Kadar, das russische Oberkommando und die großen westlichen Demokratien aufgrund ihrer Erfahrungen durchaus als höchst politische Organe an. In der Tat entsprach die Niederschlagung des ungarischen Proletariats trotz all seiner Schwächen, die mit der damaligen Periode zusammenhingen, der ständigen Furcht, welche die Bourgeoisie angesichts jedes Ausdrucks des proletarischen Kampfes packt.
Von Anfang an, als Nagy von der Entwaffnung der Arbeiterklasse sprach, dachte er natürlich an die Maschinengewehre, aber auch und besonders an die Räte. Und als Janos Kadar die Macht im November wieder herstellte, drückte er genau dasselbe Anliegen aus: die Räte müssen „wieder unter Kontrolle gebracht und von den Demagogen gesäubert werden, die da nichts zu suchen haben“.
Ebenso widmeten sich die Gewerkschaften im Solde des Regimes seit dem Auftauchen der Räte derjenigen Arbeit, die sie am besten kennen: der Sabotage. Als der Nationale Gewerkschaftsrat (NGR) “den Arbeitern und den Angestellten vorschlägt, ... mit der Wahl von Arbeiterräten in den Fabriken, den Betrieben, den Bergwerken und an allen Arbeitsorten zu beginnen...“, so geschah dies nur, um sie besser zu kontrollieren, ihre Tendenz zur Beschränkung auf wirtschaftliche Aufgaben zu verstärken, sie daran zu hindern, die Frage der Machtergreifung zu stellen, und sie in den Staatsapparat zu integrieren. „Der Rat der Arbeiter wird für seine Verwaltung vor allen Arbeitern und vor dem Staat verantwortlich sein... [die Räte] haben unmittelbar die wesentliche Aufgabe, die Wiederaufnahme der Arbeit zu gewährleisten, die Ordnung und die Disziplin wiederherzustellen und zu garantieren.“ (Erklärung des Vorsitzes des NGR am 27. Oktober).
Glücklicherweise genossen die Gewerkschaften, die unter der Herrschaft von Rákosi ernannt worden waren, nur sehr wenig Glaubwürdigkeit unter den Arbeitern, wie es diese Richtigstellung beweist, die durch den Rat von Großbudapest am 27. November verabschiedet wurde: „Die Gewerkschaften versuchen gegenwärtig, die Arbeiterräte als Ergebnis des Kampfes der Gewerkschaften darzustellen. Es ist überflüssig darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um eine haltlose Behauptung handelt. Einzig und allein die Arbeiter kämpften für die Schaffung der Arbeiterräte, und der Kampf dieser Räte wurde in vielen Fällen durch die Gewerkschaften gestört, die sich hüteten, ihnen zu helfen.“
Die Komplizenschaft der demokratischen Bourgeoisie mit der stalinistischen Repression
Am 6. Dezember begannen die Verhaftungen der Mitglieder der Räte (ein Vorspiel zu weiteren massenhafteren und blutigeren Festnahmen). Russische Truppen und die AVH umzingelten mehrere Fabriken. Auf der Insel von Csepel sammelten Hunderte von Arbeitern die wenigen Kräfte, die ihnen verblieben und lieferten der Polizei eine letzte Schlacht, um sie daran zu hindern, in die Fabriken einzudringen und Verhaftungen vorzunehmen. Am 15. Dezember wurde die Todesstrafe für die Beteiligung an Streiks durch Ausnahmegerichte in die Praxis umgesetzt, die befugt waren, die als „schuldig“ verurteilten Arbeiter auf der Stelle zu exekutieren. Girlanden von Gehängten zierten die Brücken der Donau.
Am 26. Dezember erklärte György Marosan, Sozialdemokrat und Minister von Kadar, dass die Regierung nötigenfalls 10’000 Menschen töten werde, um zu beweisen, dass sie, und nicht die Räte die wahre Ordnungsmacht ist.
Hinter der Repression durch Kadar stand die Entschlossenheit des Kremls, die Arbeiterklasse zu zermalmen. Für Moskau ging es nicht bloß darum, den nach Unabhängigkeit strebenden Satelliten die Flügel zu stutzen, sondern vor allem das Gespenst des proletarischen Selbstbewusstseins und ihres Sinnbilds, des Arbeiterrates, zu vernichten. Deshalb unterstützten die Titos, Maos und alle Stalinisten der ganzen Welt die Linie des Kremls bedingungslos.
Auch der Block der großen Demokratien stellte der Repression einen Persilschein aus. Der amerikanische Botschafter in Moskau, Charles Bohlen, erzählte in seinen Memoiren, dass er am 29. Oktober 1956 von Staatssekretär John Foster Dulles beauftragt worden war, den sowjetischen Führern Chruschtschow, Schukow und Bulganin eine dringliche Mitteilung zu übermitteln. Dulles ließ den Machthabern der UdSSR sagen, dass die Vereinigten Staaten weder Ungarn noch sonst einen Satelliten als möglichen militärischen Verbündeten betrachteten. Mit anderen Worten: „Sie sind bei sich zu Hause Herr und Meister.“
Entgegen allen Lügen, die die Bourgeoisie nicht aufgehört hat, über den Aufstand von 1956 in Ungarn zu verbreiten, war er in der Tat ein Kampf der Arbeiter gegen die kapitalistische Ausbeutung. Zwar war die Periode nicht günstig. Die Gesamtheit der Arbeiterklasse schaute nicht mehr Richtung weltweite revolutionäre Welle, wie dies noch 1917-1923 der Fall war, als im März 1919 eine leider nur kurzlebige ungarische Räterepublik das Licht der Welt erblickte. Aus diesem Grund konnten sich die ungarischen Arbeiter 1956 die Überwindung des Kapitalismus und die Übernahme der Macht gar nicht zur Aufgabe machen, was auch ihr fehlendes Verständnis für das höchst politische und subversive Wesen der Räte erklärt, die sie im Laufe ihres Kampfes schufen. Und doch ist es die wirklich revolutionäre Natur des Proletariats selbst, die soeben mutig durch die Revolte der ungarischen Arbeiter und ihre Räteorganisation erneut bestätigt wurde; die Bestätigung der historischen Rolle des Proletariats, wie es Tibor Szamuelly[7] [319] im Jahre 1919 formuliert hatte: „Unser Ziel und unsere Aufgabe ist die Zerstörung des Kapitalismus.“
Jude, 28. Juli 2006
[1] [319] Früherer Militärkommandeur Ungarns und Diktator von 1920 bis 1944.
[2] [319] Generalsekretär der Kommunistischen Partei Ungarns KPU und Premierminister nach 1952.
[3] [319] Als Führer der NKVD in Spanien organisierte Gerö im Juli 1937 die Entführung und Ermordung von Erwin Wolf, einem engen Mitarbeiter Trotzkis. Er kehrte 1945 nach Ungarn zurück, um seine Arbeit als stalinistischer Schlächter in der Rolle des Generalsekretärs der Kommunistischen Partei Ungarns weiterzuführen.
[4] [319] Ein russisches Wort, welches die Erhöhung der Arbeitkadenz bis zum Letzten beschreibt.
[5] [319] Sandor Kopasci: „Im Namen der Arbeiterklasse“
[6] [319] Am 13. Juni 1953 wurde Nagy im Zuge der Entstalinisierung anstelle von Rákosi zum Premierminister ernannt. Trotz der Propaganda für einen „nationalen und menschlichen Sozialismus“ flammte der Machtkampf innerhalb der Partei erneut auf und es war die stalinistische Gruppe um Rákosi, welche den Sieg davon trug. Nagy wurde am 14. April 1955 durch die Führung der ungarischen Kommunistischen Partei seines Amtes enthoben und einige Monate später aus der Partei ausgeschlossen.
[7] [319] Tibor Szamuelly war eine führende Figur in der ungarischen Arbeiterbewegung und ein glühender Verfechter der Gründung einer Kommunistischen Einheitspartei, die Marxisten und Anarchisten vereinen sollte und schließlich im November 1918 auch gegründet wurde. Ihr Programm beinhaltete die Diktatur des Proletariats. Er verteidigte entschlossen die Revolution in Ungarn und wurde im August 1919 von den konterrevolutionären Kräften hingerichtet.
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Internationale Revue 40
- 3072 Aufrufe
Der 17. Kongress der IKS: Eine internationale Verstärkung des proletarischen Lagers
- 3086 Aufrufe
Ende Mai hat die IKS ihren 17. Internationalen Kongress abgehalten. Da die revolutionären Organisationen nicht um ihrer selbst willen existieren, sondern ein Ausdruck des Proletariats sind und gleichzeitig als aktive Faktoren im Leben der Arbeiterklasse wirken, ist es ihre Aufgabe, an die gesamte Klasse über die Arbeit dieses besonderen Augenblickes zu berichten, den solch ein Kongress darstellt. Diesem Ziel dient dieser Artikel, welcher die Resolution über die internationale Situation ergänzt, welche auf dem Kongress angenommen wurde und in dieser Nummer der Internationalen Revue ebenfalls veröffentlicht ist.
Alle Kongresse der IKS sind natürlich wichtige Momente im Leben unserer Organisation. Dennoch muss gesagt werden, dass dieser Kongress noch bedeutender war als die vorhergegangenen, da er einen bedeutenden Schritt in der mehr als 30jährigen Geschichte der IKS darstellt.[1]
Die Anwesenheit anderer Gruppen des proletarischen Milieus
Dies wird hauptsächlich anhand der Präsenz von Delegationen dreier Gruppen des internationalen proletarischen Lagers auf unserem Kongress deutlich: OPOP[2] aus Brasilien, SPA[3] aus Südkorea, EKS[4] aus der Türkei. Eine andere Gruppe, Internasyonalismo von den Philippinen, war ebenfalls zu unserem Kongress eingeladen worden. Aber trotz ihrer Entschlossenheit, eine Delegation zu unserem Kongress zu entsenden, war es ihnen nicht möglich gewesen zu kommen. Doch hat diese Gruppe dem Kongress eine Grußbotschaft und Stellungnahmen zu den Hauptberichten übermittelt, die wir der Gruppe geschickt hatten.
Die Beteiligung mehrerer Gruppen an einem Kongress der IKS ist nichts Neues. Bereits in der Vergangenheit, in ihrer Gründungsphase, hatte die IKS Delegationen anderer Gruppen an unseren Kongressen willkommen geheißen. So beteiligten sich an unserem Gründungskongress im Januar 1975 die Revolutionary Workers Group aus den USA, Pour une Intervention Communiste aus Frankreich und Revolutionary Perspectives aus Großbritannien. Auch auf unserem 2. Kongress (1977) war eine Delegation des Partito Comunista Internazionalista (Battaglia Comunista) anwesend. Zu unserem 3. Kongress (1979) kamen Delegationen der Communist Workers Organisation (Großbritannien), des Nucleo Comunista Internazionalista und von Il Leninista (Italien) sowie ein einzelner Genosse aus Skandinavien. Später konnten wir aber diese Praxis leider aus von uns unabhängigen Gründen nicht fortsetzen: Einige Gruppen verschwanden, andere Gruppen entwickelten sich hin zu linksextremen Positionen (wie der NCI) oder schlugen einen sektiererischen Kurs ein (CWO und Battaglia Comunista). Letztere waren für die Sabotage der Internationalen Konferenzen der Gruppen der Kommunistischen Linken verantwortlich, die Ende der 1970er Jahre stattgefunden hatten[5]. So war mehr als ein Vierteljahrhundert vergangen, ehe die IKS wieder andere Gruppen auf ihrem Kongress begrüßen konnte. Als solches war also schon die Beteiligung von vier Gruppen[6] auf unserem 17. Kongress ein wichtiges Ereignis.
Die Bedeutung des 17. Kongresses
Die Bedeutung dieses Kongresses geht weit über die Tatsache hinaus, dass wir in der Lage waren, diese Praxis wieder aufzunehmen, die ein Kennzeichen der IKS seit ihren Anfängen darstellte. Noch bedeutsamer ist die Existenz und Haltung dieser Gruppen. Sie sind Teil einer historischen Entwicklung, die wir schon auf unserem letzten Kongress folgendermaßen umrissen hatten: „Das Hauptanliegen des Kongresses war sowohl die Wiederbelebung des Kampfes der Arbeiterklasse als auch die damit einhergehende Verantwortung unserer Organisation, besonders hinsichtlich der Entwicklung einer neuen Generation von suchenden Menschen, die sich in Richtung einer revolutionären politischen Perspektive bewegen." (https://en.internationalism.org/ir/122_16congres [320]).
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und der stalinistischen Regimes 1989 hat die „ohrenbetäubende Kampagne der Bourgeoisie über das ‚Scheitern des Kommunismus‘, den ‚endgültigen Sieg des liberalen und demokratischen Kapitalismus‘, das ‚Ende des Klassenkampfes‘, ja das Ende der Arbeiterklasse selbst (...) dem Proletariat auf der Ebene des Bewusstseins und der Kampfbereitschaft einen herben Rückschlag versetzt. Dieser Rückschlag war tiefgreifend und dauerte über zehn Jahre. Er hat eine ganze Generation von Arbeitern geprägt und Ratlosigkeit, ja selbst Demoralisierung ausgelöst (...) Erst im Laufe des Jahres 2003 begann sich das Proletariat vor allem durch die großen Mobilisierungen in Frankreich und Österreich gegen die Angriffe auf die Altersrenten wieder von den Rückschlägen nach 1989 zu erholen. Seither hat sich die Tendenz zur Wiederaufnahme von Klassenkämpfen und zur Entwicklung des Bewusstseins bestätigt. Arbeiterkämpfe haben in den zentralen Ländern stattgefunden, und zwar auch in den wichtigsten wie den USA (Boeing und öffentlicher Verkehr in New York 2005), Deutschland (Daimler und Opel 2004, Klinikärzte im Frühjahr 2006, Deutsche Telekom im Frühjahr 2007), Großbritannien (Londoner Flughafen im August 2005, öffentlicher Dienst im Frühjahr 2006), Frankreich (Studenten und Schüler gegen den CPE im Frühjahr 2006), aber auch in einer ganzen Reihe von peripheren Ländern wie Dubai (Bauarbeiter im Frühjahr 2006), Bangladesh (Textilarbeiter im Frühjahr 2006), Ägypten (Textil- und Transportarbeiter im Frühjahr 2007)." („Resolution über die internationale Lage", vom 17. Kongress angenommen)
„Heute geht wie 1968 (anlässlich des historischen Wiederaufflammens der Arbeiterkämpfe, die der vier Jahrzehnte währenden Konterrevolution ein Ende bereitet haben) der Anstieg der Klassenkämpfe mit einem vertieften Nachdenken einher, bei dem das Auftauchen neuer Leute, die sich den Positionen der Kommunistischen Linken zuwenden, nur die Spitze des Eisbergs darstellt." (ebenda)
Deshalb war die Präsenz mehrerer Gruppen des proletarischen Milieus auf unserem Kongress und ihre sehr offene Haltung in den Diskussionen (die sich deutlich abhebt von der sektiererischen Haltung der „alten" Gruppen der Kommunistischen Linken) keineswegs ein Zufall: Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der neuen Entwicklungsetappe im Kampf der Weltarbeiterklasse gegen den Kapitalismus.
Während der Diskussionen auf dem Kongress wurde diese Tendenz nicht zuletzt durch Schilderungen aus verschiedenen Ländern immer wieder unterstrichen - von Belgien bis Indien, von den Ländern des Zentrums bis zu den Ländern der Peripherie. Dies wird sowohl in den wieder erstarkenden Arbeiterkämpfen als auch im Denkprozess unter den Suchenden einer politischen Debatte verdeutlicht, die sich auf die Positionen der Kommunistischen Linken zu bewegen - eine Tendenz, die sich einerseits in der Integration neuer Genossen in unsere Organisation (einschließlich in Ländern, wo bis dato lange keine neuen Integrationen stattgefunden hatten), andererseits in der Bildung eines Kerns der IKS in Brasilien zeigt. Dies ist für uns ein wichtiges Ereignis, da es die Präsenz unserer Organisation im größten Land Südamerikas, mit den gewaltigsten Industriekonzentrationen dieses Teils der Erde und auch weltweit, konkretisiert. Die Entstehung des Kerns in Brasilien ist das Resultat einer engagierten punktuellen Arbeit der IKS in den letzten 15 Jahren, welche sich in letzter Zeit intensivierte. Es entstanden Kontakte mit verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen, vor allem OPOP, von der eine Delegation an unserem 17. Kongress teilnahm, aber auch mit einer Gruppe aus Sao Paulo, welche sich unter dem Einfluss linkskommunistischer Positionen gegründet hatte und mit der wir regelmäßige politische Kontakte aufgenommen haben, so zum Beispiel eine gemeinsam abgehaltene öffentlichen Diskussionsveranstaltung. Die Zusammenarbeit mit diesen Gruppen steht in keinem Widerspruch zu unserem Willen die spezifische organisatorische Präsenz der IKS in Brasilien zu verstärken. Ganz im Gegenteil wird unsere dauernde Präsenz in diesem Land auch die Zusammenarbeit unserer Organisationen verstärken, vor allem auch deshalb, weil zwischen unserem Kern und der OPOP schon eine lange gemeinsame Geschichte besteht, die von Vertrauen und Respekt geprägt ist.
Die Diskussionen auf dem Kongress
In Anbetracht der besonderen Bedingungen, unter denen der Kongress tagte, stand die Behandlung der Arbeiterkämpfe als erster Punkt auf der Tagesordnung. An zweiter Stelle untersuchten wir die nun auftauchenden neuen revolutionären Kräfte. Wir können in diesem kurzen Artikel nicht im Detail auf die stattgefundenen Diskussionen eingehen: Die ebenfalls in dieser Internationalen Revue veröffentliche Resolution zur internationalen Situation liefert eine Synthese ihrer Hauptelemente. Was wir hier allerdings betonen wollen, sind die neuen und spezifischen Merkmale der gegenwärtigen Entwicklung im Klassenkampf. Es wurde insbesondere auf Faktoren hingewiesen, die alle dazu führen werden, die Arbeiterkämpfe zu politisieren: Erstens das Ausmaß der kapitalistischen Krise, zweitens die Massivität der Angriffe gegen die Arbeiterklasse, drittens die dramatische Zuspitzung der militärischen Barbarei und viertens die wachsende Bedrohung durch die Umweltkatastrophe. Die Lage unterscheidet sich insofern ein wenig von der Situation nach dem historischen Wiedererstarken des Arbeiterkampfes nach 1968, als der Spielraum, über den der Kapitalismus damals noch verfügte, es diesem ermöglicht hatte, die Illusion aufrechtzuerhalten, dass „die Zukunft etwas Besseres bringen" werde. Heute sind solche Illusionen nicht mehr möglich: Die neuen Arbeitergenerationen, aber auch die älteren, werden sich immer bewusster, dass die Lage in der Zukunft sich nur noch verschlechtern wird. Auch wenn diese Perspektive zunächst demoralisierend und demobilisierend wirken kann, werden die immer heftiger werdenden Angriffe die Arbeiter dazu veranlassen, sich bewusst zu werden, dass die heutigen Kämpfe eine Vorbereitung sind für die viel größeren Klassenkämpfe gegen ein todgeweihtes System. Bereits jetzt machen sich die Kämpfe, die wir seit 2003 erlebt haben: „...immer mehr die Frage der Solidarität zu eigen. Dies ist eine Frage von höchster Wichtigkeit, da die Solidarität das wirksamste ‚Heilmittel‘ gegen das für den gesellschaftlichen Zerfall typische ‚Jeder-für-sich‘ darstellt und vor allem weil sie den Kern der Fähigkeit des Weltproletariats ausmacht, nicht nur die gegenwärtigen Kämpfe zu entwickeln, sondern auch den Kapitalismus zu überwinden." (ebenda)
Obgleich der Kongress sich hauptsächlich mit dem Klassenkampf befasst hat, wurden auch andere Aspekte der internationalen Situation behandelt. So ist der Kongress näher auf die Entwicklung der Wirtschaftskrise eingegangen, insbesondere auf das gegenwärtige Wachstum von „Schwellenländern" wie Indien oder China, deren Entwicklung im scheinbaren Widerspruch zu den Analysen über den endgültigen Bankrott der kapitalistischen Produktionsweise steht, wie sie von unserer Organisation und den Marxisten allgemein vertreten wird. Auf der Grundlage eines sehr detaillierten Berichtes und einer vertieften Diskussion kam der Kongress zu der Schlussfolgerung, dass die „außergewöhnlichen Wachstumsraten, die gegenwärtig Länder wie Indien und insbesondere China kennen, (...) in keinster Weise einen Beweis für einen ‚frischen Wind‘ in der Weltwirtschaft darstellen. Selbst wenn sie zu einem beträchtlichen Teil zum erhöhten Wachstum derselben im Laufe der letzten Zeit beigetragen haben. Paradoxerweise ist die Ursache für dieses außergewöhnliche Wachstum einmal mehr die Krise des Kapitalismus (...) Somit sind das ‚chinesische Wunder‘und das einiger anderer Länder der Dritten Welt alles andere als ein ‚frischer Wind‘ der kapitalistischen Wirtschaft, sondern eine weitere Manifestation des niedergehenden Kapitalismus (...) So wie das ‚Wunder‘ der zweistelligen Wachstumsraten der asiatischen ‚Tiger‘ und ‚Drachen‘ 1997 ein schmerzhaftes Ende fand, wird das heutige ‚chinesische Wunder‘, auch wenn es andere Ursachen hat und über wesentlich gewichtigere Trümpfe verfügt, früher oder später mit der harschen Realität der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise konfrontiert werden." (ebenda)
Es muss betont werden, dass der Kongress bezüglich der ökonomischen Krise die Diskussionen widerspiegelte, welche wir momentan in unserer Organisation führen: Wie analysiert man die Mechanismen, welche es dem Kapitalismus erlaubten, nach dem Zweiten Weltkrieg spektakuläre Wachstumsraten zu erzielen? Die verschiedenen Analysen, die gegenwärtig in der IKS vertreten werden (welche aber alle gemeinsam die vom IBRP und „bordigistsichen" Gruppen vertretene Idee verwerfen, dass der Krieg eine „momentane Lösung" der kapitalistischen Widersprüche darstelle), richten sich darauf aus, die aktuelle Dynamik der Wirtschaft verschiedener „neu aufgetauchter" Länder wie allen voran China zu verstehen. Weil sich der Kongress spezifisch dieses Phänomens angenommen hat, konnten sich auch die in unserer Organisation darüber existierenden Divergenzen am Kongress ausdrücken. Wie wir das immer in der Vergangenheit getan haben, werden wir in der Internationalen Revue Dokumente veröffentlichen, welche diese Debatte zusammenfassen, sobald sie einen gewissen Reifegrad erreicht hat.
Schließlich waren an unserem Kongress die Folgen der Sackgasse der kapitalistischen Gesellschaft für die Bourgeoisie und der daraus resultierende Sturz in den Zerfall Gegenstand zweier Diskussionen: Eine befasste sich mit den Konsequenzen dieser Lage in den jeweiligen Ländern, die andere mit der Entwicklung der imperialistischen Gegensätze zwischen den Staaten. Diese zwei Aspekte sind miteinender verknüpft, vor allem weil die Streitigkeiten innerhalb der nationalen Bourgeoisien auch unterschiedliche Haltungen gegenüber den imperialistischen Konflikten hervorbringen können (über die Allianzen zwischen den Staaten, die Modalitäten beim Einsatz der militärischen Mittel, usw.). Zum ersten Punkt hat der Kongress hervorgehoben, dass alle Debatten über „weniger Staat" nichts anderes sind als Maskeraden der permanenten Verstärkung des Staates in der Gesellschaft, in dem Sinne als dieses Organ die einzige Garantie dafür ist, dass die Gesellschaft nicht dem „Jeder-für-sich" unterworfen wird, welches die Zerfallsphase des Kapitalismus charakterisiert. Es wurde vor allem die stattfindende Verstärkung der polizeilichen Funktion des Staates unterstrichen, so auch in den „demokratischen" Ländern wie Großbritannien und den USA. Die Verstärkung des Polizeiapparates findet offiziell unter dem Banner der Bedrohung durch den Terrorismus statt (ein Phänomen das auch mit dem Zerfall in Verbindung steht, welches aber den stärksten Bourgeoisien selbst nicht fremd ist) und erlaubt der herrschenden Klasse, sich auf die zukünftigen Konfrontationen mit der Arbeiterklasse vorzubereiten. Zum Punkt der imperialistischen Konflikte verwies der Kongress auf das Scheitern der Politik der stärksten Bourgeoisie der Welt, nämlich der amerikanischen, vor allem bei ihrem Abenteuer im Irak. Diese Tatsache offenbart die allgemeine Sackgasse des Kapitalismus: „Tatsächlich aber war der Regierungsantritt der Bande um Cheney, Rumsfeld und Konsorten nicht einfach eine gigantische ‚Fehlkalkulation‘ der US-Bourgeoisie. Einerseits hat dies erheblich zur Verschlechterung der Situation der USA auf imperialistischer Ebene beigetragen. Andererseits ist die Einsetzung dieser Regierungsmannschaft an sich schon ein Ausdruck der wachsenden Schwierigkeiten der USA, ihre Führungsrolle durchzusetzen. Darüber hinaus ist dies ein Ausdruck des ‚Jeder-für-sich‘ in den internationalen Beziehungen, wodurch sich die Zerfallsphase auszeichnet." (ebenda)
Ganz allgemein hat der Kongress unterstrichen, dass das „militärische Chaos, das sich über die Erde ausbreitet und ganze Gebiete in ein höllisches Inferno stürzt - vor allem im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika - (...) weder der einzige Ausdruck der historischen Sackgasse des Kapitalismus noch die größte Bedrohung für die Gattung Mensch (ist). Heute wird immer deutlicher, dass die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems durch die bisherige Funktionsweise auch die Zerstörung der Umwelt, die den Aufstieg der Menschheit erst ermöglichte, mit sich bringt". (ebenda)
Aus diesem Teil der Diskussionen wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass die „von Engels Ende des 19. Jahrhunderts formulierte Alternative ‚Sozialismus oder Barbarei‘ im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer schrecklichen Realität geworden ist. Was uns das 21. Jahrhundert in Aussicht stellt, ist wahrhaft ‚Sozialismus oder Zerstörung der Menschheit‘. Und das ist die Herausforderung, vor der die einzige Klasse in der Gesellschaft steht, die den Kapitalismus überwinden kann - die Arbeiterklasse." (ebenda)
Die Verantwortung der Revolutionäre
Diese Perspektive verdeutlicht umso mehr die entscheidende Bedeutung der gegenwärtigen Kämpfe, die die Arbeiterklasse überall auf der Welt austrägt. Sie unterstreicht ebenso die grundlegende Rolle der revolutionären Organisationen, insbesondere der IKS, bei der Intervention in den Kämpfen, damit sich ein Bewusstsein darüber entwickelt, was heute weltweit auf dem Spiel steht.
In dieser Hinsicht zog der Kongress eine sehr positive Bilanz unserer Intervention in den Klassenkämpfen und gegenüber den entscheidenden Fragen, vor denen die Bewegung steht. Besonders begrüßt wurde die Fähigkeit der IKS, sich international zu mobilisieren (Artikel in unserer Presse, auf unserer Webseite, öffentliche Diskussionsveranstaltungen usw.), damit die Lehren aus einer der Hauptepisoden des Klassenkampfes gezogen werden - dem Kampf der studentischen Jugend gegen den CPE im Frühjahr 2006 in Frankreich. Wir haben dabei festgestellt, dass es damals einen spektakulären Anstieg der Zugriffe auf unsere Internetseite gab, was belegt, dass die Revolutionäre nicht nur die Verantwortung, sondern auch die Möglichkeit haben, dem Blackout entgegenzutreten, das die bürgerlichen Medien systematisch gegenüber den Arbeiterkämpfen praktizieren.
Der Kongress hat ebenfalls eine sehr positive Bilanz über unsere Arbeit gegenüber Gruppen und Einzelpersonen gezogen, welche sich für die Verteidigung oder Annäherung an linkskommunistische Positionen einsetzen. In letzter Zeit, wie schon zu Beginn dieses Artikels erwähnt, sind bemerkenswert viele neue Genossen in die IKS eingetreten, ein Resultat von all den Diskussionen, die wir mit ihnen geführt hatten (es war aber schon immer die Praxis unserer Organisation, nicht „Rekrutierungen zu jedem Preis" zu machen, wie dies bei linken Gruppen der Fall ist). Die IKS hat sich auch aktiv an verschiedenen Internet-Foren beteiligt, in denen Klassenpositionen vertreten werden können, vor allem in englischer Sprache, der wichtigsten auf Weltebene. Dies hat zahlreichen Leuten ermöglicht, unsere Positionen und Diskussionsmethoden besser kennen zu lernen und damit ein gewisses Misstrauen zu überwinden, welches von kleinsten parasitären Kapellen geschürt wird, deren Ziel nicht die Förderung des Klassenbewusstseins in der Arbeiterklasse ist, sondern die Aussaat von Misstrauen gegenüber Organisation, welche genau diese wichtige Aufgabe übernehmen. Aber der positivste Aspekt dieser Arbeit ist zweifellos die Verstärkung des Kontaktes zu anderen Organisationen, welche revolutionäre Positionen vertreten, und dies wurde durch die Präsenz von vier Gruppen auf unserem 17. Kongress konkretisiert. Dahinter stand eine große Anstrengung der IKS, vor allem durch die Entsendung von zahlreichen Delegationen in verschiedene Länder (unter anderen nach Brasilien, Südkorea, Türkei und den Philippinen).
Die zunehmende Verantwortung, die auf der IKS lastet, sei es in der Intervention in den Klassenkämpfen, sei es in den Diskussionen mit Gruppen und Einzelpersonen, welche sich auf einem Klassenterrain befinden, erfordert auch eine Verstärkung unseres Organisationsgewebes. Dies war zu Beginn des Jahres 2000 durch eine Krise ernsthaft angegriffen worden, welche unmittelbar nach unseren 14. Kongress ausgebrochen war und ein Jahr später eine außerordentliche Konferenz sowie eine vertiefte Reflexion bis zum 15. Kongress im Jahr 2003 erforderte[7]. Wie dieser Kongress feststellte und dann auch der 16. Kongress bestätigte, hat die IKS zum großen Teil ihre organisatorischen Schwächen überwunden, welche die Wurzeln dieser Krise darstellten. Eines der wichtigsten Elemente in der Fähigkeit der IKS, ihre organisatorischen Schwierigkeiten zu überwinden, liegt in der genauen und vertieften Untersuchung der Schwierigkeiten. Dazu hat sich die IKS im Laufe des Jahres 2001 eine spezielle Kommission gegeben, welche unabhängig vom Zentralorgan ist und durch den Kongress zur Ausführung dieser spezifischen Arbeit ernannt wurde. Diese Kommission hat sich in ihrem Mandat, neben den großen Forschritten, welche die Organisation als ganze machte, auch um weiter bestehende Narben der Vergangenheit in einzelnen Sektionen gekümmert. Dies alles ist ein Beweis dafür, dass der Aufbau eines soliden Organisationsgewebes nie zu Ende ist, sondern dass es einer immerwährenden Anstrengung seitens der ganzen Organisation und ihrer Mitglieder bedarf. Aufgrund dieser Notwendigkeit und der wichtigen Rolle, welche diese Kommission in den vergangenen Jahren spielte, hat der Kongress beschlossen, sie als ein permanentes Organ vorzusehen und in die Statuten der IKS aufzunehmen. Dies ist keineswegs eine „Erfindung" unserer Organisation, sondern knüpft an eine Tradition innerhalb der politischen Organisationen der Arbeiterklasse an. Selbst die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die Referenz innerhalb der 2. Internationale, verfügte über eine „Kontrollkommission" mit denselben Aufgaben.
Eines der wichtigsten Elemente, das uns erlaubte, die Krise zu überwinden und daraus gestärkt hervorzugehen, war die Fähigkeit zu einem tiefen Nachdenken über die Gründe und Auswirkungen der organisatorischen Schwächen, und dies unter Berücksichtigung der historischen und theoretischen Dimension. Ein Nachdenken, das sich im Wesentlichen um verschiedene Orientierungstexte drehte, von denen lange Auszüge in der Internationalen Revue veröffentlicht wurden[8]. Dieses Anliegen vor Augen, hat der Kongress sich ausführlich mit einem Orientierungstext zur Debattenkultur befasst, der einige Monate zuvor in der IKS zur Diskussion gestellt wurde (und nächstens in der Internationalen Revue veröffentlicht wird). Diese Frage betrifft nicht nur das interne Leben der Organisation. Die Intervention der Revolutionäre beinhaltet, dass Letztere dazu fähig sind, die angemessensten und tiefgreifendsten Analysen der Lage zu erstellen und diese Analyse so wirksam wie möglich in der Arbeiterklasse zu vertreten, um bei der Weiterentwicklung des Bewusstseins mitzuhelfen. Dies setzt voraus, dass sie diese Analysen so genau als möglich diskutieren, sie innerhalb der Arbeiterklasse als Ganzes und gegenüber interessierten Leuten vertreten, sowie auf deren Sorgen und Fragen eingehen können. In dem Masse, wie die IKS in ihren eigenen Reihen und der ganzen Klasse mit einer neuen Generation von Militanten oder nahe stehenden Menschen, welche sich für die Überwindung des Kapitalismus einsetzen, konfrontiert ist, gehört es zu ihrer Aufgabe, sich voll und ganz dafür einzusetzen, dass dieser Generation eine der wichtigsten Erfahrungen der Arbeiterbewegung, die mit der kritischen Methode des Marxismus unzertrennlich ist, näher gebracht wird: die Debattenkultur.
Die Debattenkultur
Die Einleitung und Diskussion zu dieser Frage ging davon aus, dass bei allen Abspaltungen in der Geschichte der IKS der Monolithismus eine bestimmende Rolle spielte. Wenn Divergenzen auftauchten, sagten Genossen, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten könnten, die IKS eine bürgerliche Organisation geworden sei oder sich auf dem Weg dazu befinde, auch wenn nach Ansicht der Mehrheit solche Divergenzen in einer nicht monolithischen Organisation vorhanden sein konnten. Die IKS hat von der italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken gelernt, wie auch bei der Existenz von Meinungsunterschieden bezüglich prinzipieller Fragen die genauste gemeinsame Klärung vor einer organisatorischen Spaltung kommt. In diesem Sinne waren die Abspaltungen mehrheitlich Ausdruck eines Mangels an Debattenkultur und einer monolithischen Auffassung. Doch die Probleme waren natürlich nicht gelöst durch den Austritt einzelner Genossen. Sie waren vielmehr Ausdruck einer generellen Schwierigkeit der IKS in dieser Frage, weil es in unseren Reihen Konfusionen gab, die ein Abgleiten in den Monolithismus ermöglichten und eine Tendenz zur Negierung statt Förderung der Debatte aufwiesen. Diese Probleme hielten an, doch soll man das Ausmaß dieser Probleme nicht übertreiben. Es waren Konfusionen und Ausrutscher, die punktuell stattfanden. Doch die Geschichte, diejenige der IKS sowie die der gesamten Arbeiterbewegung, hat uns gezeigt, dass aus kleinen Ausrutschern und Konfusionen große und gefährliche Abgleitungen werden können, wenn man die Wurzeln der Probleme nicht versteht.
In der Geschichte der Kommunistischen Linken gibt es Strömungen, welche den Monolithismus verteidigen und theoretisieren. Die „bordigistische" Strömung ist eine Karikatur davon. Die IKS ist im Gegensatz dazu Erbin der Tradition der Italienischen Fraktion und der Französischen Kommunistischen Linken, welche die entschlossensten Gegner des Monotlithismus waren und in einer gradlinigen Art die Debattenkultur pflegten. Die IKS wurde auf diesem Verständnis gegründet, das auch in ihren Stauten verankert ist. Aus all diesen Gründen wird klar, dass sich trotz Problemen bei der praktischen Umsetzung kein Genosse der IKS in allgemeiner Hinsicht gegen die Entfaltung einer Debattenkultur wenden würde. Dennoch ist es wichtig, das Bestehen gewisser Schwierigkeiten zu anerkennen. Eine dieser Schwächen ist der Hang, jede Diskussion als eine Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Opportunismus, zwischen Bolschewismus und Menschewismus oder gar zwischen Proletariat und Bourgeoisie zu betrachten. Eine solche Angehensweise würde nur dann Sinn machen, wenn wir die Auffassung der Invarianz des kommunistischen Programms hätten. Hier bleibt der Bordigismus wenigsten konsequent: Die Invarianz und der Monolithismus, auf die sich diese Strömung bezieht, gehen Hand in Hand. Es gilt aber zu begreifen, dass der Marxismus kein Dogma und die Wahrheit relativ ist, und diese nicht erstarrt sind, sondern einen Prozess darstellen, weil wir aufgrund der Realität, welche sich andauernd verändert, nie aufhören zu lernen. Aufgrund all dessen sind der Drang zur Vertiefung und selbst Irrtümer normale Etappen auf dem Weg zur Schärfung des Klassenbewusstseins. Entscheidend sind der kollektive Impuls und der Wille zu einer aktiven Teilnahme an der Vertiefung.
Es ist wichtig zu bemerken, dass der Hang überall und in jeder Debatte den Opportunismus (also eine Tendenz hin zu bürgerlichen Positionen) sehen zu wollen, zu einer Banalisierung der opportunistischen Gefahr führen kann. Damit stellt man jede Debatte auf dasselbe Niveau. Die Erfahrung zeigt uns, wie in den raren Diskussionen, in denen die Prinzipien in Frage gestellt wurden, oft die Schwierigkeit herrschte, dies zu sehen: Ist alles opportunistisch, so ist schlussendlich gar nichts mehr opportunistisch.
Ein anderes Resultat einer solchen Haltung, in jeder Diskussion den Opportunismus und die bürgerliche Ideologie erkennen zu wollen, ist die Hemmung der Debatte. Die Genossen haben so nicht mehr „das Recht", Unklarheiten zu haben, diese auszusprechen oder Irrtümer zu begehen, weil man sie sofort als Verräter betrachtet und sie sich selbst so vorkommen. Gewisse Debatten beinhalten tatsächlich eine Konfrontation zwischen bürgerlichen und proletarischen Positionen. Dies ist Ausdruck einer Krise und Degenerationsgefahr. Doch im Leben der Arbeiterklasse ist dies nicht die generelle Regel. Wenn man alle Debatten auf diese Ebene stellt, endet man schlussendlich in der Idee, dass die Debatte an sich Ausdruck einer Krise ist.
Ein anderes Problem, welches mehr in der Praxis als in theoretisierter Version besteht, ist das Verhalten, in einer Debatte die Anderen so schnell wie möglich von der richtigen Position überzeugen zu wollen. Diese Angehensweise führt zur Ungeduld, der Haltung, die Diskussion monopolisieren und in gewisser Weise den „Gegner ausschalten" zu wollen. Diese Haltung führt nur zu Schwierigkeiten, wirklich zu verstehen, was die Anderen sagen. Es ist sicher richtig, dass es sonst im Leben, in einer vom Individualismus und der Konkurrenz geprägten Gesellschaft, schwer ist zu lernen, den Anderen zuzuhören. Aber verschlossene Ohren führen zu einer Abwendung von der Welt, genau zum Gegenteil einer revolutionären Haltung. In diesem Sinne ist es wichtig zu verstehen, dass das Wichtigste in einer Debatte ihr Platz ist, dass sie sich entwickeln kann, dass es eine breitest mögliche Beteiligung daran gibt und eine wirkliche Klärung daraus hervorgeht. Zu guter Letzt trägt auch das kollektive Leben der Arbeiterklasse, wenn es sich entwickeln kann, zur Klärung bei. Der Wille zu einer politischen Klärung wohnt dem Proletariat in seinem Charakter inne; es ist sein Klasseninteresse. Die Arbeiterklasse braucht die Wahrheit, und nicht Verfälschungen. Deshalb, so schrieb Rosa Luxemburg, ist und bleibt die revolutionärste Tat, immer das zu sagen, was ist. Verwirrungen sind nicht die Regel oder dominierend in der IKS, doch sie existieren, können gefährlich werden und müssen überwunden werden. Besonders muss gelernt werden, die Debatten nicht zu dramatisieren. Die meisten Diskussionen in unserer Organisation sind nicht Konfrontationen zwischen bürgerlichen und proletarischen Positionen. Es sind Diskussionen, bei denen wir auf der Basis von gemeinsamen Positionen und einem gemeinsamen Ziel eine Vertiefung anstreben und Verwirrungen überwinden wollen.
Die Entwicklung einer wirklichen Debattenkultur in den revolutionären Organisationen ist eines der Hauptanzeichen ihrer Zugehörigkeit zur Arbeiterklasse, ihrer Fähigkeit, lebendig und offen zu bleiben, und auf die Bedürfnisse der Klasse reagieren zu können. Dies gilt gleichermaßen für die Arbeiterklasse insgesamt, da sie durch ihre eigenen Diskussionen, insbesondere in ihren Vollversammlungen, in der Lage ist, die Lehren aus ihren Erfahrungen zu ziehen und ihr Bewusstsein voranzutreiben. Das Sektierertum und die Verweigerung der Debatte, die heute leider das Merkmal einiger Organisationen des proletarischen Lagers sind, stellen keineswegs einen Beweis für ihre „Unnachgiebigkeit" gegenüber der bürgerlichen Ideologie oder gegenüber bestehenden Konfusionen dar. Im Gegenteil, es handelt sich dabei um einen Ausdruck ihrer Angst, ihre eigenen Positionen zu vertreten, und es ist letzten Endes der Beweis einer mangelnden Überzeugung von der Richtigkeit der eigenen Positionen.
Die Interventionen der eingeladenen Gruppen
Diese Debattenkultur hat unseren ganzen Kongress geprägt. Sie äußerte sich besonders in der Tatsache, dass die eingeladenen Gruppen ihre Erfahrungen und Überlegungen weitergaben.
Die Delegation aus Korea unterstrich dies, als einer ihrer Delegierten sagte, dass er „sehr beeindruckt sei von dem solidarischen Geist, dem kameradschaftlichen Verhältnis untereinander, was im Gegensatz zu seiner bisherigen Erfahrung steht, um was er uns beneidet".
Ein anderer Genosse dieser Delegation gab seine Überzeugung weiter, dass „die Diskussion über die Debattenkultur für die Entwicklung ihrer eigenen Aktivitäten fruchtbar und es wichtig ist, dass sich die IKS nicht als „einzige Gruppe auf der Welt" betrachtet".
Die Delegation der OPOP hat „mit größter Brüderlichkeit einen Gruß an den Kongress" vermittelt und ihre „Zufriedenheit darüber, an einem so wichtigen Ereignis teilnehmen zu können", ausgedrückt. Für die Delegation sei „dieser Kongress nicht lediglich ein wichtiges Ereignis für die IKS, sondern für die Arbeiterklasse als Ganzes. Wir lernen viel mit der IKS. Wir haben in den vergangenen drei Jahren viel gelernt durch den Kontakt, den wir hatten, und die Debatten, die wir zusammen in Brasilien geführt haben. Wir haben schon am vorangegangenen Kongress teilgenommen (derjenige der französischen Sektion der IKS im Jahr 2006) und haben dort die Gewissenhaftigkeit festgestellt, mit der die IKS die Debatte führt, ihre Offenheit für die Debatte, dass sie keine Angst vor einer Debatte hat und auch nicht davor, andere Positionen mit ihren eigenen zu konfrontieren. Ganz im Gegenteil, ihre Haltung ist es, die Debatte voranzutreiben, und wir wollen der IKS dafür danken, dass wir diese Haltung kennen gelernt haben. Wir begrüßen ebenfalls die Art, mit der die IKS die Frage der neuen Generationen angeht, heute und in der Zukunft. Wir lernen vom Erbe, auf das sich die IKS bezieht und das uns von der Arbeiterbewegung seit ihrer Existenz übertragen wird." Gleichzeitig tat die Delegation ihre Überzeugung kund, dass „auch die IKS von der OPOP gelernt habe", vor allem als eine IKS-Delegation in Brasilien an der Seite der OPOP an einer Intervention in einer Arbeitervollversammlung teilnahm, welche von den Gewerkschaften dominiert war.
Auch der Delegierte der EKS unterstrich die Wichtigkeit der Debatte bei der Entwicklung der revolutionären Positionen innerhalb der Arbeiterklasse, besonders für die neuen Generationen: „Ich möchte damit beginnen, die Wichtigkeit der Debatte für die neue Generation zu unterstreichen. Wir haben in unserer Gruppe junge Leute und wir haben uns durch die Debatte politisiert. Wir haben wirklich viel in den Debatten gelernt, vor allem in denen mit jungen Leuten, mit denen wir in Kontakt stehen (...) Ich denke, dass in der Zukunft für die junge Generation die Debatte ein wichtiger Aspekt der politischen Entwicklung sein wird. Wir haben einen Genossen getroffen, der aus einem sehr armen Arbeiterquartier von Istanbul stammt und der älter ist als wir. Er sagte uns, dass in dem Quartier, aus dem er komme, die Arbeiter immer diskutieren wollen. Aber die Linken, die in den Arbeiterquartieren politische Arbeit betreiben, versuchen immer schnell die Debatte abzuwürgen, um „praktische Sachen" zu machen, so wie man es von ihnen erwarten kann. Ich denke die proletarische Kultur, in der man jetzt hier diskutiert und die ich auf diesem Kongress erleben konnte ist eine Verneinung der linken Diskussionsmethode, welche nur ein Konkurrenzkampf darstellt. Ich möchte einige Bemerkungen machen über die Diskussionen unter den internationalistischen Gruppen. Zuerst denke ich, müssen solche Diskussionen so konstruktiv und brüderlich wie möglich sein und wir müssen immer dazu Sorge tragen, dass diese Debatten eine kollektive Anstrengung sind, um zu einer politischen Klärung unter den Revolutionären zu kommen. Dies ist keinesfalls ein Wettkampf oder etwas, das Feindschaften oder Rivalitäten hervorbringen darf. So etwas wäre die komplette Verneinung der kollektiven Anstrengung, zu neuen Schlussfolgerungen zu kommen, um sich damit der Wahrheit anzunähern. Es ist auch wichtig, dass die Debatte unter den internationalistischen Gruppen so regelmäßig wie möglich stattfindet, weil dies viel zur Klärung beiträgt für alle, die international beteiligt sind. Ich denke es ist für die Debatte auch notwendig, offen zu sein gegenüber allen interessierten proletarischen Elementen. Gleichfalls gehe ich davon aus, dass die Debatten für die interessierten revolutionären Elemente zugänglich sind. Eine Debatte begrenzt sich nicht auf diejenigen, die direkt beteiligt sind. Die Debatte selbst, das was diskutiert wird, ist eine große Hilfe für denjenigen, der es lediglich liest. Ich erinnere mich, wie ich noch vor einiger Zeit Angst vor Diskussionen hatte, aber viel lesen wollte. Debatten und ihre Resultate zu lesen hilft enorm viel und deshalb ist es sehr wichtig, die geführten Debatten den Interessierten zugänglich zu machen. Das ist ein Mittel, um sich wirkungsvoll theoretisch und politisch weiterzuentwickeln."
Diese offenherzigen Redebeiträge der Delegierten der eingeladenen Gruppen haben nichts mit Schmeichelei gegenüber der IKS zu tun. So haben die Genossen aus Südkorea auch Kritiken an der Arbeit des Kongresses formuliert, vor allem, dass nicht mehr auf die Erfahrung unserer Intervention in der Bewegung gegen den CPE in Frankreich eingegangen wurde und dass die ökonomische Analyse der Situation in China nicht stärker auf die soziale Lage und die Kämpfe der Arbeiterklasse in diesem Land einging. Alle Delegierten der IKS brachten diesen Kritiken eine große Aufmerksamkeit entgegen, weil sie unserer Organisation erlauben, auf die Sorgen und Erwartungen der anderen Gruppen des proletarischen Lagers einzugehen, und unsere Anstrengung stimulieren, eine so wichtige Situation wie diejenige in China besser zu analysieren. Die Beiträge und Analysen, welche die anderen Gruppen liefern können (vor allem auch aus Ostasien), sind sehr wichtig für unsere eigene Arbeit.
Während des Kongresses selbst, waren die Beiträge der Delegationen wichtig für unser Verständnis der internationalen Situation. Dies vor allem, weil sie uns ein genaues Bild von der Situation in den Ländern gaben, in denen sie leben. Wir können im Rahmen dieses Artikels die Beiträge der Delegationen nicht ausführlich wiedergeben, sie werden in anderen Artikeln unserer Presse Platz finden. Wir geben uns hier damit zufrieden, die wichtigsten Eckpunkte kurz zu erwähnen. Bezüglich des Klassenkampfes hat der Delegierte der EKS darauf bestanden, dass nach der Niederlage der massiven Kämpfe von 1989 heute, angesichts der dramatischen wirtschaftlichen Lage für die Arbeiter in der Türkei, eine Wiederaufnahme von Arbeiterkämpfen und eine Welle von Streiks mit Fabrikbesetzungen stattfindet. In dieser Situation begnügen sich die Gewerkschaften nicht damit, die Kämpfe so wie gewöhnlich zu sabotieren, sondern sie versuchen auch den Nationalismus unter den Arbeitern zu schüren, indem sie eine Kampagne um die „säkulare Türkei" führen. Die Delegation der OPOP hat aufgezeigt, wie durch die Verbindung zwischen den Gewerkschaften und der gegenwärtigen Regierung (Präsident Lula war der führende Gewerkschaftsboss des Landes gewesen) in Brasilien nun eine Tendenz zu Kämpfen außerhalb des Rahmens der offiziellen Gewerkschaften existiert, eine „Rebellion der Basis", so wie es in der Bewegung unter den Bankangestellten 2003 der Fall gewesen war. Die neuen ökonomischen Angriffe, welche die Regierung Lula vorbereitet, werden die Arbeiterklasse dazu stoßen, sich weiterhin zu Wehr zu setzen, auch wenn die Gewerkschaften eine „kritischere" Haltung gegenüber Lula vorspielen.
Ein anderer wichtiger Beitrag der Delegationen von OPOP und EKS auf dem Kongress betraf die imperialistische Politik Brasiliens und der Türkei. OPOP schilderte wichtige Elemente zu einem besseren Verständnis der Positionierung dieses Landes, das sich einerseits als getreuer Verbündeter der amerikanischen „Weltpolizist-Politik" gibt (vor allem durch die militärische Präsenz in Timor und Haiti, wo es das Kommando über die fremden Truppen führt) und gleichzeitig aber seine eigene Diplomatie mit bilateralen Abkommen entwickelt, vor allem mit Russland (von dem es Flugzeuge kauft) und mit Indien und China (deren Industrieprodukte eine Konkurrenz für die brasilianische Produktion sind). Brasilien entwickelt überdies eine starke regionale imperialistische Macht, bei der es seine Bedingungen gegenüber Ländern wie Bolivien oder Paraguay durchzusetzen beginnt. Der Genosse der EKS hatte einen sehr interessanten Beitrag über das Leben der türkischen Bourgeoise (so über den Konflikt zwischen dem „islamistischen" und dem „laizistischen" Sektor) und deren imperialistische Ambitionen gemacht. Wir können auch diesen Beitrag in diesem Artikel leider nicht ausführlich beschreiben. Die Hauptidee wollen wir aber weitergeben: Das Risiko, dass in einem Nachbargebiet eines der gewalttätigsten imperialistischen Konflikte, im Irak, die türkische Bourgeoise auch in eine dramatische militärische Spirale eintritt und damit die Arbeiterklasse noch mehr den Preis für die kapitalistischen Widersprüche bezahlen muss.
Die Beiträge der Delegationen der eingeladenen Gruppen haben zusammen mit denjenigen der Sektionen der IKS Wertvollstes zur Arbeit des Kongresses und seinem Nachdenken über alle Fragen beigetragen und ihm erlaubt „die internationale Situation zu synthetisieren", wie es die Delegation der SPA aus Südkorea ausdrückte. Wie schon zu Beginn dieses Artikels erwähnt: Eines der Hauptelemente für den Erfolg dieses Kongresses und den Enthusiasmus, der von allen Delegationen zum Abschluss des Kongresses zum Ausdruck gebracht wurde, bestand gerade in der Teilnahme der eingeladenen Gruppen.
Kurz hintereinander fanden zwei internationale Treffen statt: der G8-Gipfel und der Kongress der IKS. Natürlich unterscheiden sich die beiden Treffen hinsichtlich des Einflusses und der unmittelbaren Wirkung, aber es ist wichtig, den großen Gegensatz hinsichtlich des Umfeldes, der Ziele und der Funktionsweise zu unterstreichen. Das eine war ein Treffen hinter Stacheldraht, mit einem unerhörten Aufgebot an Polizei und polizeilicher Repression, bei dem die Deklarationen über die „Ernsthaftigkeit der Debatte", zum „Frieden" und zur „Zukunft der Menschheit" nur eine Verschleierung waren, um die Widersprüche zwischen den kapitalistischen Staaten zu verhüllen, neue Kriege vorzubereiten und ein System zu bewahren, das der Menschheit nichts mehr anzubieten hat. Das andere war ein Treffen von Revolutionären aus 15 Ländern, die gegen alle Verschleierungen und den schönen Schein kämpften und die sich in wahrhaft solidarischen Debatten engagierten, um zur einzigen Perspektive beizutragen, welche die Menschheit retten kann: dem vereinten und internationalen Kampf der Arbeiterklasse mit dem Ziel, den Kapitalismus zu stürzen und den Kommunismus zu etablieren.
Wir wissen dass der Weg dorthin noch lang und schwierig sein wird. Doch die IKS ist überzeugt, dass ihr 17. Kongress ein wichtiger Schritt dabei war.
IKS, Juni 2007
[1] Zur Geschichte der IKS siehe unseren Artikel 30 Jahre IKS: Von der Vergangenheit für die Zukunft lernen, Internationale Revue Nr. 37.
[2] OPOP: Oposição Operária - Arbeiteropposition. Die Gruppe besteht in mehreren Städten Brasiliens; sie wurde Anfang der 1990er Jahre gegründet. Dabei beteiligten sich insbesondere Leute, die mit der CUT (Gewerkschaftsverband) und der Arbeiterpartei (PT) Lulas (gegenwärtig Präsident Brasiliens) gebrochen haben, um proletarische Positionen zu übernehmen - insbesondere in der Frage des Internationalismus, aber auch der Gewerkschaften (Anprangerung dieser Organe als Instrumente der herrschenden Klasse) und des Parlamentarismus (Anprangerung der „demokratischen" Maskerade). Die Gruppe interveniert aktiv in Arbeiterkämpfen (insbesondere im Bankensektor). Die IKS führt seit Jahren solidarische Diskussionen mit dieser Gruppe. Wir haben auch mehrere gemeinsame öffentliche Diskussionsveranstaltungen mit ihnen in Brasilien abgehalten (siehe dazu insbesondere „ICC Public Meetings in Brazil: A strengthening of revolutionary positions in Latin America", in: World Revolution Nr. 292, https://en.internationalism.org/wr/292_brazil_forums.html [321]). Eine Delegation von OPOP beteiligte sich bereits im Frühjahr 2006 am 17. Kongress unserer Sektion in Frankreich (siehe dazu unseren Artikel in Révolution Internationale).
[3] SPA: Socialist Political Alliance. Die Gruppe hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Positionen des Linkskommunismus in Korea bekannt zu machen (insbesondere durch Übersetzungen bestimmter Grundlagentexte des Linkskommunismus) und Diskussionen unter Gruppen und Individuen über diese Positionen in Korea anzuregen. Im Oktober 2006 organisierte die SPA eine internationale Konferenz, an der sich die IKS, die seit mehr als einem Jahr mit dieser Gruppe im Austausch steht, beteiligte (siehe unseren Artikel „Rapport über die Konferenz in Korea, Oktober 2006"in Internationale Revue Nr. 129 (engl., franz., span.). Es sollte angemerkt werden, dass die Teilnehmer dieser Konferenz, die unmittelbar nach den nordkoreanischen Nuklearversuchen stattfand, eine „Internationalistische Erklärung aus Korea angesichts der Kriegsgefahr" verabschiedete (siehe Weltrevolution Nr. 139)
[4] EKS: Enternasyonalist Komünist Sol (Internationale Kommunistische Linke), eine Gruppe, die jüngst in der Türkei gegründet wurde und sich entschlossen auf linkskommunistische Positionen stützt. Wir haben mehrere ihrer Stellungnahmen auf unserer Website veröffentlicht: https://en.internationalism.org/wr/295_eks_basicpositions [322], https://en.internationalism.org/node/1772 [323].
[5] Das hatte 1999 die IKS jedoch nicht daran gehindert, das Internationale Büro für die Revolutionäre Partei (IBRP) zu ihrem 13. Kongress einzuladen. Wir meinten, dass die Tragweite der imperialistischen Spannungen mitten in Europa (damals wurde Serbien von NATO-Flugzeugen bombardiert) es verlangte, dass die revolutionären Gruppen ihre Streitigkeiten beiseite schieben, um an einem Ort zusammenzukommen, damit man gemeinsam die Folgen dieses Konfliktes untersucht und ggf. eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Leider hatte das IBRP diese Einladung ausgeschlagen.
[6] Da Internasyonalismo politisch präsent war, auch wenn ihre Delegation nicht physisch anwesend sein konnte.
[7] siehe Ausserordentliche Konferenz der IKS: Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien, in: Internationale Revue Nr. 30 und 15. Kongress der IKS: Die Organisation gegenüber den Herausforderungen der Zeit verstärken, in: International Review Nr.114 (engl., franz., span. Ausgabe).
[8] Siehe das Vertrauen und die Solidarität im Kampf des Proletariats, in: Internationale Revue Nr. 31 und 32, sowie Marxismus und Ethik, in Internationale Revue Nr. 39 und 40.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [50]
Erbe der kommunistischen Linke:
Der Kommunismus: Der Beginn der wirklichen Geschichte der Menschheit (II)
- 2884 Aufrufe
Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee, sondern auch eine materielle Notwendigkeit
Der Artikel in dieser Ausgabe kehrt zum Werk des jungen Marx 1843 zurück, um die Ursprünge seiner Methoden zur Erarbeitung des kommunistischen Programms zu untersuchen. Wir hoffen, dass diese Zusammenfassung älterer Artikel die Leser dazu animieren wird, zu den Originalartikeln zurückzugehen, die wir auf Englisch in Form eines Buches veröffentlichten, aber auch online stellten. Die in Punkt 1 bis 7 zusammengefassten Artikel sind in voller Länge in Deutsch als Broschüre und Online auf unserer Web-Site erhältlich. Bisher hat es nur wenig Reaktionen aus dem politischen proletarischen Milieu zu den Artikeln gegeben. Dennoch bieten wir sie all jenen als eine Quelle der Untersuchung und Reflexion an, die danach streben, die wahre Bedeutung und den wirklichen Inhalt der kommunistischen Revolution zu klären.
Der erste Band konzentriert sich - mit Ausnahme des ersten Artikels, der das kommunistische Gedankengut vor dem Erscheinen des Kapitalismus betrachtet und mit den frühesten Formen des proletarischen Kommunismus schließt - im Wesentlichen auf die Evolution des kommunistischen Programms in der Epoche des im Aufstieg befindlichen Kapitalismus, als die kommunistische Revolution noch nicht auf der Tagesordnung der Geschichte stand. Der Titel des Bandes ist eine polemische Entgegnung auf all jene, die zwar anerkannt haben, dass der so genannte Kommunismus der stalinistischen Regimes nicht gerade dem entspricht, was Marx und andere im Kopf hatten, die aber pro-kommunistische Argumente mit der Äußerung abtun, dass der Kommunismus in der Theorie zwar eine schöne Idee sein mag, aber niemals in der realen Welt funktionieren könne. Im Gegensatz dazu sind Marxisten der Ansicht, dass der Kommunismus nicht in dem Sinne eine schöne Idee ist, dass er von guten Geistern oder von einzelnen Genies erfunden wurde. Der Kommunismus ist fraglos eine Theorie oder - besser - eine Bewegung, die die theoretische Dimension mit beinhaltet. Dennoch rührt die kommunistische Theorie aus der realen Praxis einer revolutionären gesellschaftlichen Kraft her. Und zentraler Bestandteil dieser Theorie ist es, dass der Kommunismus als Gesellschaftsform an dem Punkt zu einer Notwendigkeit wird, wo der Kapitalismus nicht mehr funktioniert, wo er in wachsendem Maße in Widerspruch zu den menschlichen Bedürfnissen gerät. Doch lange bevor dieser Punkt erreicht war, waren das Proletariat und seine politischen Minderheiten nicht nur dazu gezwungen gewesen, die allgemeingültigen, historischen Ziele ihrer Bewegung in großen Zügen zu skizzieren, sondern sahen sich auch dazu veranlasst, das kommunistische Programm im Lichte der Erfahrungen zu erarbeiten, die durch die praktischen Kämpfe der Arbeiterklasse gemacht wurden.
1. „Vom primitiven Kommunismus zum utopischen Sozialismus" (International Review, Nr. 69)
Ein flüchtiger Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieser Internationalen Revue (engl., franz. und span. Ausgabe), die im ersten Quartal 1992 herauskam, erinnert uns an den historischen Kontext, in dem diese Reihe begann. Der Leitartikel konzentriert sich auf die Explosion der UdSSR und auf die Massaker in Jugoslawien; ein anderer Text trägt den Titel: „Bemerkungen zum Imperialismus und Zerfall: hin zum größten Chaos in der Geschichte". Kurz, die IKS hatte erkannt, dass der Zusammenbruch des Ostblocks endgültig eine neue Phase im Leben (oder Tod) des dekadenten Kapitalismus eröffnet hatte, die Zerfallsphase - eine Phase, die neue Gefahren und Prüfungen für die Arbeiterklasse und somit für ihre revolutionären Minderheiten mit sich brachte. Gleichzeitig erlaubte der spektakuläre Niedergang der stalinistischen Regimes den Herrschenden, eine massive Propagandakampagne auszulösen, in der Absicht, die Arbeiterklasse, deren Kämpfe sie die letzten beiden Jahrzehnte geplagt hatten, abzustumpfen und zu demoralisieren. Ausgehend von der völlig falschen Annahme, dass Stalinismus = Kommunismus sei, wurde uns mit arroganter Selbstverständlichkeit erklärt, dass wir Zeuge des Endes des Kommunismus, des endgültigen Bankrotts des Marxismus, des Verschwindens der Arbeiterklasse, ja des Endes der Geschichte seien... Die Kommunismus-Reihen waren daher anfangs als eine Antwort auf diese bösartigen Kampagnen gedacht und konzentrierten sich auf den fundamentalen Unterschied zwischen dem Stalinismus und der authentischen Vision des Kommunismus in der gesamten Geschichte der Arbeiterbewegung. Sie wurden als kurze Artikelreihen von fünf oder sechs Artikeln ins Auge gefasst. Doch schon die ersten Artikel zeigten, dass eine gründlichere Vorgehensweise erforderlich war, und zwar aus zwei Gründen. Erstens war die Aufgabe, die Ziele des Kommunismus zu klären, von Beginn an ein ständiges Anliegen der revolutionären marxistischen Bewegung gewesen; diese Aufgabe bleibt auch heute gültig und ist nicht abhängig von den Erfordernissen unmittelbar historischer Ereignisse, seien sie noch so epochal wie der Zusammenbruch des Ostblocks. Zweitens ist die Geschichte des Kommunismus an sich nicht nur die Geschichte des Marxismus oder der Arbeiterbewegung, sondern auch die Geschichte der Menschheit.
In besagtem Artikel in der Internationalen Revue, Nr. 39, widmeten wir unsere besondere Aufmerksamkeit einem Satz, der im Brief von Marx an Ruge 1843 stand: „Es wird sich dann zeigen, dass die Welt längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur das Bewusstsein besitzen muss, um sie wirklich zu besitzen." Der erste Artikel versucht also, die kommunistischen Träume der Menschheit zusammenzufassen. Diese Träume wurden in theoretischer Form zunächst in den antiken Gesellschaften entwickelt; doch wir mussten noch weiter zurückgehen, weil diese frühen Spekulationen in gewissem Maße auf einer realen Erinnerung an den realen, wenn auch beschränkten Kommunismus in den primitiven Stammesgesellschaften beruhten.
Die Entdeckung, dass menschliche Wesen Zigtausende von Jahren in einer Gesellschaft ohne Klassen und Staat gelebt hatten, sollte sich als mächtige Waffe in den Händen der Arbeiterbewegung erweisen, denn sie schuf ein Gegengewicht zu all den Behauptungen, dass die Liebe zum Privateigentum und die Notwendigkeit einer hierarchischen Vorherrschaft ein dem menschlichen Wesen innewohnendes Bedürfnis seien. Gleichzeitig besaß die Vorgehensweise der kommunistischen Vordenker ein stark rückwärts gewandtes, mythisches Element, das sich im Nachtrauern einer unwiederbringlich verloren gegangenen Gemeinschaft äußerte. Dies war zum Beispiel im „Urkommunismus" der frühen Christen oder in den von Spartacus angeführten Sklavenaufständen der Fall, die von der Suche nach dem verlorenen Goldenen Zeitalter angetrieben wurden. Es traf auch in einem großen Umfang auf die kommunistischen Predigten von John Ball während des englischen Bauernaufstandes zu, wenngleich es hier schon klar war, dass das einzige Heilmittel gegen die gesellschaftliche Ungerechtigkeit das Gemeineigentum des Landes und der Produktionsinstrumente war.
Die kommunistischen Ideen, die im aufkeimenden Kapitalismus aufkamen, waren schon eher in der Lage, einen vorwärts gewandten Standpunkt zu entwickeln, der sich sukzessive von dieser Fixierung auf eine mythische Vergangenheit freimachte. Von der annabaptistischen Bewegung, die von Münzer im 16. Jahrhundert in Deutschland angeführt wurde, über Winstanley und die Diggers im englischen Bürgerkrieg bis hin zu Babeuf und der „Verschwörung der Gleichen" in der Französischen Revolution gab es eine Bewegung weg von der religiös-apokalyptischen Sichtweise des Kommunismus und hin zu einer wachsenden Betonung der Fähigkeit der Menschheit, sich selbst von einer ausbeuterischen Gesellschaftsordnung zu befreien. Dies wiederum spiegelte den historischen Fortschritt wider, der vom Kapitalismus ermöglicht wurde, insbesondere die Entwicklung einer wissenschaftlichen Weltanschauung und das allmähliche Auftauchen des Proletariats als eine besondere Klasse in der neuen Gesellschaftsordnung. Diese Entwicklung erreichte mit dem Erscheinen der utopischen Sozialisten wie Robert Owen, Saint-Simon und Fourier ihren Höhepunkt, die eine durchdringende Kritik an den Schrecken des Industriekapitalismus übten und die Möglichkeiten, darüber hinauszugehen, bereits als gegeben ansahen, ohne allerdings in der Lage zu sein, die reale Gesellschaftskraft zu erkennen, die im Stande ist, eine menschlichere Gesellschaft herbeizuführen - das moderne Proletariat.
2. „Wie das Proletariat Marx für den Kommunismus gewonnen hatte" (International Review, Nr. 69)
Der Kommunismus war also im Gegensatz zur vulgären Interpretation keine Bewegung, die von Marx „erfunden" wurde. Wie der erste Artikel zeigte, geht der Kommunismus dem Proletariat und der proletarische Kommunismus Marx voraus. Doch so wie der Kommunismus des Proletariats einen qualitativen Sprung über alle vorherigen Formen des Kommunismus hinaus repräsentierte, so verkörperte der „wissenschaftliche" Kommunismus, der von Marx und anderen entwickelt wurde, die nacheinander seine Methoden aufgriffen, einen qualitativen Fortschritt gegenüber den Hoffnungen und Spekulationen der Utopisten.
Dieser Artikel folgt den Spuren, auf denen sich Marx, ausgehend von der kritischen Hegelianischen Philosophie und der radikalen Demokratie, in Richtung Kommunismus begeben hatte. Wie wir in der Internationalen Revue Nr. 39, betonten, handelte es sich hier um eine sehr schnelle, aber keinesfalls willkürliche Entwicklung: Marx beharrte auf eine gründliche Untersuchung aller existierenden kommunistischen Strömungen, die in Deutschland und Frankreich zu blühen begonnen hatten, besonders in Paris, wohin Marx 1844 gezogen und wo er mit Gruppen kommunistischer Arbeiter in Kontakt gekommen war. Diese Gruppen laborierten notgedrungen an einer Fülle von Konfusionen und Ideologien, die sie von den Revolutionen der Vergangenheit geerbt hatten. Doch zusammen mit den ersten embryonalen Anzeichen eines allgemeineren Klassenkampfes der Arbeiter reichten diese Manifestationen einer zutiefst historischen Bewegung aus, um Marx davon zu überzeugen, dass das Proletariat die gesellschaftliche Kraft ist, welche nicht nur, was einmalig ist, in der Lage ist, eine kommunistische Gesellschaftsordnung zu etablieren, sondern auch durch ihre eigentliche Natur gezwungen ist, so zu handeln. So wurde Marx vom Proletariat für den Kommunismus gewonnen und brachte die theoretischen Waffen mit, die er von der Bourgeoisie erhalten hatte.
Von Anfang an (besonders in Die deutsche Ideologie, die sich gegen die idealistische Philosophie richtete, die das Bewusstsein als etwas betrachtete, was außerhalb der ungehobelten materiellen Wirklichkeit steht) bestand Marx darauf, dass das kommunistische Bewusstsein aus dem Proletariat kommt und dass die kommunistische Avantgarde ein Produkt dieses Prozesses ist, nicht sein Schöpfer, auch wenn sie produziert wurde, um ein aktiver Faktor in eben diesem Bewusstseinsprozess zu werden. Dies allein war bereits eine Widerlegung der These, die ein halbes Jahrhundert später von Kautsky aufgegriffen wurde, derzufolge es die sozialistische Intelligenzia sei, die das kommunistische Bewusstsein „von außen" in die Arbeiterklasse injiziere.
3. „Die Entfremdung der Arbeit ist eine Voraussetzung
für ihre Emanzipation" (International Review,
Nr. 70)
Nachdem er diesen fundamentalen Wechsel zum Standpunkt des Proletariats vollzogen hatte, begann Marx die Vision eines gewaltigen Projektes der menschlichen Emanzipation zu entwickeln, die die Existenz der revolutionären proletarischen Bewegung nun von einem schönen, aber unerreichbaren Traum in ein realisierbares gesellschaftliches Ziel umwandeln sollte. Die Ökonomischen und Philosophischen Manuskripte (ÖPM) von 1844 enthalten einige von Marx‘ kühnsten Einsichten über den Charakter des menschlichen Handelns in einer wirklich freien Gesellschaft. Es ist argumentiert worden, dass diese Notizbücher „vor-marxistisch" seien, da sie sich noch mit im Grunde philosophischen Konzepten wie die Entfremdung befassten, die ein Schlüsselbegriff in Hegels philosophischem System war. Und es trifft zu, dass das Konzept der Entfremdung des Menschen, der von seinen realen Kräften ferngehalten wird, nicht nur bei Hegel, sondern mehr oder weniger die ganze Geschichte hindurch existiert hatte, selbst in den frühesten Formen der Mythologie. Auch ist es natürlich richtig, dass es noch viele andere fundamentale Entwicklungen im Denken von Marx in den folgenden Jahrzehnten geben sollte. Dennoch herrscht grundsätzlich eine Kontinuität zwischen den Schriften des frühen Marx und jenen des späten Marx, der große „wissenschaftliche" Werke wie das Kapital produzierte. Als Marx die Entfremdung in den ÖPM analysierte, hatte er sie bereits aus den Wolken der Mythologie und Philosophie auf die konkrete Ebene des realen gesellschaftlichen Lebens des Menschen und seiner produktiven Tätigkeiten heruntergeholt; überdies gründeten sich seine anregenden Bilder, die er von der kommunistischen Menschheit zeichnete, auf reale menschliche Fähigkeiten. Spätere Werke wie die Grundrisse gingen vom gleichen Ausgangspunkt aus.
In den ÖPM schuf Marx die Bühne, um diese befreite Menschheit zu schildern, indem er eingehend die Natur des Problems analysiert, dem sich die Spezies gegenübersieht - ihrer Entfremdung in der kapitalistischen Gesellschaft.
Marx identifiziert vier Facetten der Entfremdung, alle verwurzelt im fundamentalen Arbeitsprozess:
- die Entfremdung des Menschen von seinem eigenen Produkt, so dass die Schöpfungen der Menschen zu Kräften werden, die ihn beherrschen: Die Maschine, die vom Arbeiter gebaut und in Bewegung gesetzt wird, kettet den Arbeiter an ihren höllischen Rhythmus; der gesellschaftliche Reichtum, der vom Arbeiter geschaffen wurde, wie das Kapital, wird zu einer unpersönlichen Macht, die das gesamte Gesellschaftsleben tyrannisiert;
- die Entfremdung von seiner produktiven Tätigkeit, so dass die Arbeit jeden Anschein eines schöpferischen Vergnügens verliert und zu einer Qual für den Arbeiter wird;
- die Entfremdung gegenüber anderen Menschen: Die entfremdete Arbeit basiert auf der Ausbeutung der einen Klasse durch eine andere, und diese fundamentale Teilung zieht viele andere nach sich, insbesondere unter der Herrschaft einer universellen Warenproduktion, in der die Gesellschaft zu einem Krieg des Jeder-gegen-jeden tendiert;
- die Entfremdung des Menschen von seiner eigenen spezifischen Natur, die eine soziale und schöpferische ist und in beispielloser Weise durch die bürgerlichen Produktionsverhältnisse entleert worden ist.
Doch in der marxistischen Analyse der Entfremdung steckt kein Nachtrauern früherer, weniger deutlicher Formen der Entfremdung und auch kein Anlass zur Verzweiflung: Denn obwohl die ausbeutende Klasse ebenfalls entfremdet ist, wird erst mit dem Proletariat die Entfremdung zur subjektiven Grundlage eines revolutionären Angriffs gegen die kapitalistische Gesellschaft.
4. „Der Kommunismus: Der wahre Beginn der menschlichen Gesellschaft" (International Review, Nr. 71)
Die Schriften des frühen Marx, die diese Krankheit analysierten, zeigten auch, wie das Wohlergehen der Spezies aussehen könnte. Entgegen dem Begriff der „Egalisierung" nach unten weist Marx darauf hin, dass der Kommunismus einen riesigen Fortschritt für die Menschheit darstellt, die Lösung von Konflikten, die sie nicht nur in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern die gesamte Geschichte hindurch geplagt hatten - „die Auflösung des Rätsels der Geschichte". Der Mensch im Kommunismus wird nicht reduziert, sondern erhöht werden; doch er wird sich innerhalb der Möglichkeiten seiner eigenen Natur erheben. Marx unterstreicht die vielfältigen Dimensionen im gesellschaftlichen Handeln des Menschen, wenn einmal die Ketten des Kapitals abgeschüttelt sind:
- Wenn die Arbeitsteilung und vor allem die Produktion unter der Herrschaft des Geldes und Kapitals die Menschheit in eine Unendlichkeit von miteinander wetteifernden Atomen teilt, so stellt der Kommunismus die gesellschaftliche Natur des Menschen wieder her, so dass ein Teil der eigentlichen Befriedigung der Arbeit das Verständnis ist, dass sie für die Bedürfnisse anderer unternommen wird.
- Desgleichen muss die Arbeitsteilung in einzelne Individuen unterbunden werden, so dass die Produzenten nicht wie angewachsen an eine einzige Form der Tätigkeit, ob geistig oder manuell, gebunden sind: Der Produzent wird zu einem Allround-Individuum, dessen Arbeit geistige, physische, künstlerische und intellektuelle Tätigkeiten miteinander kombiniert.
- Befreit von der Not und der Knute der Zwangsarbeit, öffnet sich der Weg zu einer neuen und erhellenden Erfahrung der Welt, zu einer „Emanzipation aller Sinne"; desgleichen erlebt der Mensch sich selbst nicht mehr als ein atomisiertes Ego, das im „Gegensatz" zur Natur steht, sondern erfährt ein neues Bewusstsein von seiner Einheit mit der Natur.
5. „1848: Der Kommunismus als politisches Programm" (International Review, Nr. 72)
Diese frühen Schriften enthalten bereits ein Verständnis für die Zentralität der Produktionsverhältnisse bei der Bestimmung menschlicher Handlungen, doch war dies noch nicht zu einer kohärenten und dynamischen Darstellung der historischen Evolution ausgereift. Dies sollte bald darauf der Fall sein, in Werken wie Die deutsche Ideologie, wo Marx erstmals die Methode skizzierte, die später als historischer Materialismus bekannt wurde. Gleichzeitig war das Bekenntnis zum Kommunismus und zur proletarischen Revolution nicht „bloß" theoretischer Art; es beinhaltete notwendigerweise ein militantes, politisches Bekenntnis. Dies spiegelte den eigentlichen Charakter des Proletariats als eigentumslose Klasse wider, die innerhalb der alten Gesellschaft nicht zu wirtschaftlicher Stärke gelangen kann, sondern sich nur im Gegensatz zu ihr behaupten kann. Somit konnte der kommunistischen Transformation nur eine politische Revolution vorausgehen, die Machtergreifung durch die Arbeiterklasse. Und um sich darauf vorzubereiten, musste das Proletariat seine eigene politische Partei schaffen.
Es gibt viele heute, die ihre Anhängerschaft zu den Ideen von Marx bekunden, die aber, traumatisiert durch die Erfahrungen aus dem Stalinismus, keine Notwendigkeit erblicken, auf kollektive, organisierte Weise zu handeln. Dies ist sowohl dem Marxismus als auch dem Dasein des Proletariats wesensfremd, das als kollektive Klasse keine anderen Mittel für seine Sache besitzt als die Bildung von kollektiven Assoziationen; und es ist unvorstellbar, dass die höchstentwickelten Schichten der Klasse, die Kommunisten, irgendwie außerhalb dieses tiefen Bedürfnisses stünden.
Von Anfang an war Marx ein Vorkämpfer der Arbeiterklasse. Sein Ziel war es, an der Bildung einer kommunistischen Organisation mitzuwirken. Daher die Intervention von Marx und Engels in jener Gruppe, die zum Bund der Kommunisten werden sollte und 1847, auf dem eigentlichen Höhepunkt der Welle von revolutionären Erhebungen, als das Proletariat zum ersten Mal als eine separate politische Kraft auftrat, das Kommunistische Manifest veröffentlichte.
Das Manifest beginnt damit, indem sie die neue Theorie kurz umreißt, und zählt kurz die Chronik des Aufstiegs und Falls der verschiedenen Formen der Klassenausbeutung auf, die dem Erscheinen des modernen Kapitalismus vorausgegangen waren. Der Text macht keinen Hehl aus seiner Anerkennung der revolutionären Rolle der Bourgeoisie, diente diese doch der globalen Ausweitung der kapitalistischen Produktionsweise; gleichzeitig weist er mit der Identifizierung der Widersprüche des Systems, insbesondere der ihm innewohnenden Tendenz zur Überproduktionskrise, darauf hin, dass auch der Kapitalismus, wie das Römische Reich oder der Feudalismus vor ihm, nicht für immer währen wird, sondern durch eine höhere Form des gesellschaftlichen Lebens ersetzt wird.
Das Manifest bekräftigt diese Möglichkeit, indem es auf einen zweiten fundamentalen Widerspruch im System hinweist - auf den Klassenwiderspruch zwischen der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse. Die historische Entwicklung spaltet die kapitalistische Gesellschaft in zwei sich bekriegende Lager, deren Kampf entweder zur Gründung einer höheren Gesellschaftsform führt oder zum „gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen".
Tatsächlich sind dies Indikatoren, die bereits die Zukunft des Kapitalismus anzeigen: eine Epoche, in der der Kapitalismus nicht mehr dem menschlichen Fortschritt dient, sondern zu einer Fessel der Produktivkräfte wird. Das Manifest ist allerdings nicht konsequent in diesem Punkt: Es sieht zwar noch immer die Möglichkeit eines Fortschritts unter der Bourgeoisie, besonders bei der Überwindung der Überreste des Feudalismus; doch an anderer Stelle nimmt es an, dass das System bereits in den Niedergang umgekippt sei und dass die proletarische Revolution bevorstehe. Nichtsdestotrotz bleibt das Manifest ein Werk wirklich gesellschaftlicher „Prophezeiungen": Nur einige Monate nach seiner Veröffentlichung bewies das Proletariat in der Praxis, dass es die neue revolutionäre Kraft in der bürgerlichen Gesellschaft ist. Dies war der Beweis für die Solidität der historischen Methode, die das Manifest verkörpert.
Das Manifest war der erste richtige Ausdruck eines neuen politischen Programms und wies auf die Schritte hin, die das Proletariat unternehmen musste, um die neue Gesellschaft einzuleiten:
- die Eroberung der politischen Macht. Der Klassenkampf wird als mehr oder weniger verhüllter Bürgerkrieg beschrieben; die Revolution wird als gewaltsamer Sturz der Bourgeoisie ins Auge gefasst. Damals gab es die Idee, dass die Klassengewalt des Proletariats auf die Eroberung des bestehenden Staatsapparates abzielt; und es wurde sogar von einer friedlichen Eroberung der Macht durch „die Erkämpfung der Demokratie" gesprochen. Diese Vorgehensweise gegenüber dem bürgerlichen Staat wurde jedoch im Lichte weiterer Erfahrungen gründlich revidiert;
- die Eroberung der Macht durch das Proletariat muss auf internationaler Ebene stattfinden. Dies ist der Text, in dem Marx und Engels den unsterblichen Ruf erhoben: „Die Arbeiter haben kein Vaterland" und darauf beharrten, dass die „vereinigte Aktion, wenigstens der zivilisierten Länder (...) eine der ersten Bedingungen seiner (des Proletariats, Red.) Befreiung" ist;
- das langfristige Ziel ist die Ersetzung eines auf Klassenteilung beruhenden Systems durch eine „Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Vorbedingung für die freie Entwicklung aller ist". Diese Gesellschaft bedarf keines weiteren Staates mehr und wird die abstumpfende Arbeitsteilung und die Trennung zwischen Stadt und Land überwinden.
Das Manifest bildet sich nicht ein, dass eine solche Gesellschaft über Nacht erbaut werden kann; es berücksichtigt eine mehr oder weniger lange Übergangsperiode. Viele der unmittelbaren Maßnahmen, die vom Manifest als Verkörperung „despotischer Eingriffe in das Eigentumsrecht und in die bürgerlichen Produktionsverhältnisse" vorgestellt werden - wie die Verstaatlichung der Banken und die Durchsetzung einer starken Progressivsteuer - sind mittlerweile völlig vereinbar mit dem Kapitalismus, besonders mit dem Kapitalismus in seiner Niedergangsepoche, die sich durch eine totalitäre Vorherrschaft des Staates auszeichnet. Auch hier hat die revolutionäre Erfahrung der Arbeiterklasse mittlerweile einen viel größeren Grad an Klarheit über den ökonomischen Inhalt der proletarischen Revolution gezeitigt. Doch das Manifest bekräftigt völlig richtig das allgemeine Prinzip, dass das Proletariat nur durch die Zentralisierung der Produktivkräfte unter seiner Kontrolle zum Kommunismus gelangen kann.
6. „Die Revolution von 1848: Die kommunistische Perspektive tritt zutage" (International Review, Nr. 73)
Die realen Erfahrungen aus der Revolution von 1848 machten die Dinge klarer. In der Erkenntnis, dass eine breite soziale Erhebung bevorstand, antizipierte das Manifest bereits ihren hybriden Charakter zwischen der großen bürgerlichen Revolution von 1789 und der zukünftigen kommunistischen Revolution, indem es eine Reihe von taktischen Maßnahmen vorschlug, die dazu bestimmt waren, der Bourgeoisie und dem radikalen Kleinbürgertum in ihrem Kampf gegen den Feudalismus beizustehen und gleichzeitig den Boden für eine proletarische Revolution zu bereiten, die es unmittelbar nach dem Sieg der Bourgeoisie folgen sah.
In der Tat stand diese Perspektive nicht außerhalb der Ereignisse. Das politische Auftreten des Proletariats in den Straßen von Paris - parallel dazu in England der Aufstieg der ersten wirklichen Arbeiterpartei, der Chartisten - verbreitete Angst und Schrecken in der Bourgeoisie. Letztere realisierten, dass solch eine aufsteigende Kraft nicht leicht kontrolliert werden kann, wenn sie erst einmal gegen die feudalen Mächte losgelassen worden war. So sah sich die Bourgeoisie dazu gedrängt, Kompromisse mit dem Ancien Regime einzugehen, besonders in Deutschland. Das Proletariat war damals politisch noch nicht reif genug, um die Richtung der Gesellschaft zu bestimmen: Die kommunistischen Bestrebungen der Pariser ProletarierInnen waren eher unbewusst als beabsichtigt. Und in vielen anderen Ländern befand sich das Proletariat noch im Stadium der Herausschälung aus den sich auflösenden früheren Ausbeutungsformen.
Die Bewegungen von 1848 waren eine Feuertaufe des erst kurz zuvor gebildeten Bundes der Kommunisten. Indem er versuchte, die im Manifest befürworteten Taktiken auszuführen, widersetzte sich der Bund dem oberflächlichen Revolutionismus jener, die behaupteten, dass die proletarische Diktatur eine unmittelbare Möglichkeit sei, oder die sich in militärischen Träumereien der Befreiung Deutschlands durch das französische Bajonett verloren. Der Bund dagegen versuchte, das taktische Bündnis mit den Radikaldemokraten in Deutschland in die Tat umzusetzen. Jedoch ging er dabei zu weit; der Bund löste sich in den Demokratischen Vereinigungen auf, die von den radikalbürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien aufgestellt worden waren.
Im Lichte dieser Irrtümer und als Resultat des Denkprozesses hinsichtlich der schlimmen Repression gegen die Pariser Arbeiter und des Verrates der deutschen Bourgeoisie an ihrer eigenen Revolution zog der Bund der Kommunisten, besonders im Text von Marx über die „Klassenkämpfe in Frankreich", einige wichtige Lehren:
- die Notwendigkeit einer proletarischen Autonomie. Die Niedertracht der Bourgeoisie war zu erwarten und war beabsichtigt. Letztere würde unvermeidlich entweder einen Kompromiss mit der Reaktion eingehen oder, falls siegreich, sich gegen die Arbeiter wenden. Somit war es wichtig für die Arbeiter, ihre eigene Organisation im Verlauf der bürgerlichen Revolution zu erhalten. Dies betraf sowohl die kommunistische Avantgarde als auch die allgemeineren Organisationen der Klasse („Vereine, Komitees, etc.");
- diese Organe müssen bewaffnet werden und sogar darauf vorbereitet sein, eine Arbeiterregierung zu bilden. Darüber hinaus begann Marx zu dämmern, dass solch eine neue Macht erst durch die „Zerschmetterung" des bereits existierenden Staatsapparates entstehen kann - eine Lehre, die von den Erfahrungen der Pariser Kommune 1871 voll und ganz bestätigt wurde.
Was die Perspektive anging, so blieb es bei einer „permanenten Revolution": ein unmittelbarer Übergang von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution. Allerdings waren diese Lehren eher für die Epoche der proletarischen Revolution relevant, wie die Ereignisse in Russland 1917 zeigen sollten. Und innerhalb des Bundes der Kommunisten selbst gab es in der Tat hitzige Debatten über die Aussichten für die Arbeiterklasse nach den Niederlagen von 1848. Eine immediatistische Tendenz, die von Willich und Schapper angeführt wurde, nahm an, dass die Niederlage nur geringe Konsequenzen hatte und dass der Bund sich auf neue revolutionäre Abenteuer vorbereiten solle. Doch die Tendenz um Marx dachte tiefer über die Ereignisse nach. Sie begriff nicht nur, dass die Revolution nicht wie Phönix aus der Asche der Niederlage entstehen kann, sondern auch, dass der Kapitalismus selbst noch nicht reif war für die proletarische Revolution, die nur aus einer neuen kapitalistischen Krise kommen kann. Daher hatten es die Revolutionäre mit der Aufgabe zu tun, die Lehren aus der Vergangenheit zu bewahren und eine ernsthafte Untersuchung über das kapitalistische System anzustellen, um sein tatsächliches Schicksal zu verstehen. Diese Differenzen mündeten in der Auflösung des Bundes und für Marx in eine Periode profunder theoretischer Arbeit, die seinem Meisterstück, das Kapital, zum Leben verhalf.
7. „Das Studium des Kapitals und die kommunistischen
Grundlagen"
Teil 1: „Der geschichtliche Hintergrund" (International Review, Nr. 75)
Der Schlüssel, um die Tür zur Zukunft des Kapitalismus aufzuschließen, lag auf dem Gebiet der politischen Ökonomie. Zu ihren revolutionärsten Zeiten haben die Nationalökonomen der Bourgeoisie, insbesondere Adam Smith, einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Charakters der kapitalistischen Gesellschaft geliefert, insbesondere zur Entwicklung der Theorie des Arbeitswertes, der die bürgerlichen „Wirtschaftsexperten" heute, in der Niedergangsepoche des Kapitalismus, den Rücken zugekehrt haben. Doch auch damals waren die besten bürgerlichen Ökonomen nicht in der Lage, diese ersten Einblicke bis zu ihrer letzten Konsequenz weiterzuentwickeln, da ihre Klassenvorurteile im Weg standen. Die tatsächliche innere Funktionsweise des Kapitals konnte sich nur vom Standpunkt des Proletariats aus erschließen, das scharfsinnige Schlussfolgerungen ziehen konnte, die für die Bourgeoisie und ihren Apologeten ungenießbar waren: Der Kapitalismus ist nicht nur eine Gesellschaft, die auf Klassenausbeutung fußt, er ist auch die letzte Form der Klassenausbeutung in der menschlichen Geschichte und hat sowohl die Möglichkeit als auch die Notwendigkeit für seine Verdrängung durch eine klassenlose kommunistische Gesellschaft geschaffen.
Doch bei der Untersuchung des Charakters und Schicksals des Kapitals blieb Marx nicht an den Grenzen der kapitalistischen Epoche stehen. Im Gegenteil, der Kapitalismus konnte nur vor dem Hintergrund der gesamten menschlichen Geschichte richtig verstanden werden. So kehren das Kapital und sein „Entwurf", die Grundrisse, mit Hilfe einer fortgeschritteneren historischen Methode zu den anthropologischen und philosophischen Anliegen zurück, die die ÖPM angeregt hatten:
- die Bestätigung der Existenz einer menschlichen Natur: Der Mensch ist ist kein unbeschriebenes Blatt Papier, in jeder ökonomischen Formation aufs Neue geboren; stattdessen entwickelt der Mensch sein Wesen durch sein eigenes Handeln in der Geschichte weiter;
- die Bestätigung des Konzeptes der Entfremdung, die auch in ihrer geschichtlichen Entwicklung gesehen wird: Die kapitalistische Lohnarbeit verkörpert die fortgeschrittenste Form der Entfremdung der Arbeit und ist gleichzeitig die Voraussetzung für ihre Emanzipation. Daher die Ablehnung einer rein linearen Sichtweise der Geschichte als reibungsloser Fortschritt und stattdessen die Befürwortung einer dialektischen Methode, die den historischen Fortschritt als etwas betrachtet, das durch einen widersprüchlichen Prozess geht, der auch Phasen der Regression und des Niedergangs beinhaltet.
In diesem Rahmen betrachtet, bewirkt die Dynamik der Geschichte eine wachsende Auflösung der ursprünglichen gesellschaftlichen Bande des Menschen durch die Verallgemeinerung der Warenverhältnisse: Der primitive Kommunismus und der Kapitalismus stehen an den antithetischen Enden dieses historischen Prozesses und ebnen den Weg für die kommunistische Synthese. Innerhalb dieses breiten Rahmens ist die Bewegung der Geschichte synonym für den Aufstieg und Niedergang unterschiedlicher antagonistischer Gesellschaftsformationen. Das Konzept des Aufstiegs und der Dekadenz von aufeinander folgenden Produktionsweisen ist vom historischen Materialismus nicht zu trennen; und im Gegensatz zu manch kruden Fehlkonzeptionen beinhaltet die Dekadenz eines Gesellschaftssystems überhaupt nicht einen völligen Stopp im Wachstum.
Teil 2: „Die Abschaffung des Warenfetischismus" (International Review, Nr. 76)
Bei all seiner Gründlichkeit und Komplexität ist das Kapital im Wesentlichen ein polemisches Werk. Es ist eine Tirade gegen die „wissenschaftlichen" Apologeten des Kapitalismus und somit „das sicherste Geschoß, das den Bürgern (Großgrundbesitzer eingeschlossen) noch an den Kopf geschleudert worden ist", um die Worte von Marx zu gebrauchen.
Ausgangspunkt von Das Kapital ist die Enträtselung der Mystifikation der Ware. Der Kapitalismus ist ein System der universellen Warenproduktion: Alles ist käuflich. Die Herrschaft der Ware zieht einen Schleier über die wahre Funktionsweise des Systems. Es war somit notwendig, das Geheimnis des Mehrwerts zu enthüllen, um zu demonstrieren, dass alle kapitalistische Produktion ohne Ausnahme auf der Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft basiert und somit die wahre Quelle aller Ungerechtigkeit und Barbarei im Leben des Kapitalismus ist.
Gleichzeitig heißt das Geheimnis des Mehrwerts zu begreifen, zu demonstrieren, dass der Kapitalismus mit tiefen Widersprüchen belastet ist, die unvermeidlich zu seinem Niedergang und schließlichem Ableben führt. Diese Widersprüche sind im eigentlichen Charakter der Lohnarbeit eingeflochten:
- die Krise der Überproduktion. Die Mehrheit der Bevölkerung im Kapitalismus ist durch den eigentlichen Charakter der Mehrarbeit Überproduzent und Unterkonsument in einem. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, alle Werte, die er produziert, innerhalb des geschlossenen Kreislaufes seiner Produktionsverhältnisse zu realisieren;
- der tendenzielle Fall der Profitrate. Nur die menschliche Arbeitskraft kann neue Werte schaffen, und dennoch zwingt die nie nachlassende Konkurrenz den Kapitalismus dazu, den Anteil menschlicher Arbeit im Verhältnis zur toten Arbeit der Maschinen zu reduzieren.
In der aufsteigenden Epoche, in der Marx gelebt hatte, konnte der Kapitalismus seine inneren Widersprüche immer wieder aufschieben, indem er immer weiter in die unermesslichen vor-kapitalistischen Regionen, die ihn umgaben, expandierte. Das Kapital begriff bereits die Realität dieses Prozesses und seiner Grenzen, doch es musste ein unvollständiges Werk bleiben, nicht nur wegen der persönlichen Einschränkungen, denen sich Marx gegenübersah, sondern auch, weil nur die reale Entwicklung des Kapitalismus den tatsächlichen Prozess klären konnte, durch den das kapitalistische System in die Epoche seines Niedergangs eintrat. Das Verständnis der Phase des Imperialismus, der kapitalistischen Dekadenz, konnte daher erst von den Nachfolgern Marx‘ - insbesondere von Rosa Luxemburg - entwickelt werden.
Die Widersprüche des Kapitalismus weisen auch auf ihre wahre Lösung hin - den Kommunismus. Eine Gesellschaft, die durch das Gesetz der Marktverhältnisse dem Chaos entgegen treibt, kann nur von einer Gesellschaft ersetzt werden, die die Lohnarbeit und die Produktion für den Austausch abschafft, einer Gesellschaft von „frei assoziierten Produzenten", in der die Beziehungen zwischen den Menschen nicht mehr obskur, sondern einfach und klar sind. Aus diesem Grund ist das Kapital auch eine Beschreibung des Kommunismus; größtenteils im negativen Sinn, aber auch im direkteren und positiven Sinn einer Skizzierung, wie eine Gesellschaft von frei assoziierten Produzenten funktionieren könnte. Und darüber hinaus kehren das Kapital und die Grundrisse zur inspirierten Vision der ÖPM zurück, indem sie versuchen, das Reich der Freiheit zu beschreiben - um uns einen Einblick in das freie, kreative Handeln zu verschaffen, das die Essenz der kommunistischen Produktion ist.
8. „1871: die erste proletarische Revolution" (International Review, Nr. 77)
1864 fand die Periode des Rückzugs der Arbeiterklasse ein Ende. Die Arbeiter Europas und Amerikas organisierten sich in Gewerkschaften, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu verteidigen. Es wurde zunehmend von der Streikwaffe Gebrauch gemacht; und die Arbeiter mobilisierten sich auch auf dem politischen Terrain, um fortschrittliche Anliegen wie den Krieg gegen die Sklaverei in den USA zu unterstützen. Diese Unruhe in der Klasse verhalf der Internationalen Arbeiterassoziation zu ihrer Existenz, wobei die Fraktion rund um Marx eine aktive Rolle bei ihrer Bildung spielte. Marx und Engels erkannten die Internationale als authentischen Ausdruck der Arbeiterklasse an, auch wenn sie sich aus vielen diversen und oft konfusen Strömungen zusammensetzte. Die marxistische Fraktion in der Internationale setzte sich dabei in vielen kritischen Debatten mit diesen Strömungen auseinander, insbesondere:
- über das Prinzip der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse gegen wohlmeinende bürgerliche Reformer, die die Klasse von oben befreien wollten, und über das Prinzip der Klassenautonomie gegenüber bürgerlichen Nationalisten wie Mazzini;
- über die Verteidigung einer proletarischen Politik und zentralisierten Organisation gegen die antipolitische Attitüde und die föderalistischen Vorurteile der Anarchisten.
Die Debatte über die Notwendigkeit für das Proletariat, die politische Dimension seines Kampfes anzuerkennen, war in einem gewissen Sinn eine Debatte darüber, ob man auf dem Gebiet der bürgerlichen Politik, des Parlaments und der Wahlen agieren soll oder nicht, und somit über die historische Perspektive der Revolution: Für die Marxisten war der Kampf um Reformen noch auf der Tagesordnung, da das kapitalistische System noch nicht in seine „Epoche der sozialen Revolution" eingetreten war. Doch 1871 tat die reale Klassenbewegung einen historischen Schritt nach vorn: die erste politische Machtergreifung durch die Arbeiterklasse, die Pariser Kommune. Auch wenn Marx den „frühreifen" Charakter dieser Erhebung erkannte, war sie ein enorm wichtiger Vorläufer, der in der Frage des Verhältnisses zwischen Proletariat und bürgerlichem Staat neue Klarheit schuf. Während im Kommunistischen Manifest die Perspektive in der Übernahme des existierenden Staates bestand, bewies die Pariser Kommune, dass dieser Teil des Programms nun obsolet war und dass das Proletariat nur durch die gewaltsame Zerstörung des kapitalistischen Staates an die Macht gelangen konnte. Weit davon entfernt, die marxistische Methode zu falsifizieren, war dies eine eindrucksvolle Bestätigung Letzterer.
Diese Klärung kam nicht aus heiterem Himmel: Die marxistische Kritik am Staat geht zurück auf Marx‘ Schriften von 1843; das Manifest erblickte im Kommunismus eine staatenlose Gesellschaft; und in den Lehren des Bundes der Kommunisten aus den Erfahrungen von 1848 wurde bereits die Notwendigkeit einer autonomen proletarischen Organisation betont, ja wurde vom Zerschlagen des bürokratischen Apparates gesprochen. Doch nach der Kommune konnte dies nun in einer höheren Synthese eingegliedert werden.
Der heroische Kampf der Kommunarden machte deutlich, was die Arbeiterrevolution bedeutete:
- die Auflösung des stehenden Heeres und seine Ersetzung durch die Bewaffnung des Proletariats;
- die Ersetzung der privilegierten Bürokratie durch öffentliche Angestellte, die mit einem durchschnittlichen Arbeiterlohn bezahlt werden; die Ersetzung aller parlamentarischen oder semiparlamentarischen Körperschaften durch Organe der Arbeiterklasse, die die Legislative und Exekutive miteinander verbinden; und am wichtigsten von allen das Prinzip der Wahl und jederzeitigen Abwählbarkeit aller verantwortlichen Positionen der neuen Macht.
Diese neue Macht schuf den organisierten Rahmen:
- für das Bemühen, die anderen nicht-ausbeutenden Klassen hinter das Proletariat zu ziehen;
- für den Beginn der ökonomischen und sozialen Umwandlung, der den Weg zum Kommunismus anzeigte, auch wenn Letzterer in dieser Epoche und in solch einem begrenzten geographischen Kontext noch nicht verwirklicht werden konnte.
Die Kommune war also bereits ein „Halbstaat", der historisch dazu bestimmt ist, den Weg zur staatenlosen Gesellschaft freizugeben. Doch schon damals waren Marx und Engels in der Lage, einen Blick auf die „negative" Seite des Kommune-Staates zu werfen: Marx betonte, dass die Kommune nur einen organisierten Rahmen schaffen konnte, aber nicht in sich selbst die Bewegung für die soziale Emanzipation des Proletariats war; Engels beharrte darauf, dass dieser Staat ein „notwendiges Übel" blieb. Spätere Erfahrungen - die Russische Revolution von 1917-27 - sollten den Scharfsinn der beiden beweisen und enthüllen, wie wichtig es für das Proletariat war, seine eigenen autonomen Klassenorgane zu schmieden, um den Staat zu kontrollieren - Organe wie die Arbeiterräte, die unter den semi-handwerklichen Proletariern von 1871 noch nicht vorstellbar waren.
Schließlich zeigte die Kommune an, dass die Zeit der Nationalkriege in Europa vorüber war: Angesichts des Gespenstes der proletarischen Revolution vereinigten die Bourgeoisien von Frankreich und Preußen ihre Kräfte, um ihren Hauptfeind niederzuschlagen. Für das Proletariat Europas war die nationale Verteidigung zu einer Maske geworden, hinter der sich Klasseninteressen verbargen, die sich ihren eigenen gegenüber völlig feindlich verhielten.
9. „Kommunismus gegen ‚Staatssozialismus‘"(International Review, Nr.78)
Mit der brutalen Niederschlagung der Kommune sah sich die Arbeiterbewegung einer neuerlichen Periode des Rückzugs gegenüber. Die Internationale sollte dies nicht lange überleben. Für die marxistische Strömung war dies erneut eine Zeit der intensiven politischen Auseinandersetzung mit Kräften, die zwar innerhalb der Bewegung agierten, aber mehr oder weniger den Einfluss und die Weltanschauung anderer Klassen zum Ausdruck brachten. Es war eine Auseinandersetzung einerseits mit den explizit bürgerlichen Einflüssen des Reformismus und des „Staatssozialismus" und andererseits mit den kleinbürgerlichen und deklassierten Ideologien des Anarchismus.
Die Identifikation des Staatskapitalismus mit dem Sozialismus lag der großen Lüge des 20. Jahrhunderts zugrunde, dass Stalinismus gleich Kommunismus ist, so wie auch den etwas milderen „sozialdemokratischen" Versionen des gleichen Schwindels. Einer der Gründe, warum diese Lüge solch ein großes Gewicht besitzt, besteht darin, dass sie sich aus einst ehrlichen Konfusionen innerhalb der Arbeiterbewegung speist. In der aufsteigenden Periode, als sich der Kapitalismus größtenteils im Gewand der Privatkapitalisten manifestierte, konnte man leicht behaupten, dass die Zentralisierung des Kapitals, die vom Staat repräsentiert wird, einen Schlag gegen das Kapital darstelle (wie wir zum Beispiel im Kommunistischen Manifest sahen). Nichtsdestotrotz schufen marxistische Theoretiker bereits die Grundlage für eine Kritik an dieser Behauptung, indem sie demonstrierten, dass das Kapital kein rechtliches, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis ist, so dass es wenig Unterschied macht, ob der Mehrwert von einem individuellen oder von einem kollektiven Kapitalisten extrahiert wird. Darüber hinaus hatte Engels, als der Staat Ende des 19. Jahrhunderts immer energischer in die Wirtschaft zu intervenieren begann, diese bisher unausgesprochene Kritik bereits ausdrücklich artikuliert.
In der Periode nach der Auflösung der Internationale rückte die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Deutschland in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die rückständigen politischen Bedingungen, die hier noch immer herrschten, wurden auch von der Rückständigkeit der Strömung um Lassalle reflektiert, die sich durch eine abergläubische Verehrung des Staates und insbesondere des halbfeudalen Bismarck'schen Staates auszeichnete. Und selbst die von Bebel und Liebknecht angeführte marxistische Fraktion war nicht völlig frei von solchen Vorurteilen. Der Kompromiss zwischen diesen beiden Gruppen verhalf der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zum Leben. Das Programm der neuen Partei (1875) sah sich einer vernichtenden Kritik durch Marx (in seiner Kritik am Gothaer Programm) ausgesetzt, die die marxistische Vorgehensweise gegenüber dem Problem der Revolution und des Kommunismus, wie es damals existierte, zusammenfasste. So:
- warnte Marx gegen die Tendenz des Gothaer Programms, unmittelbare Reformen mit dem langfristigen Ziel des Kommunismus zu verwechseln, sowie vor dem Vertrauen der deutschen Partei in den Ausbeuterstaat, der angeblich nicht nur die Ausgebeuteten beschützte, sondern auch die Gesellschaft zum Sozialismus mitnehmen sollte;
- beharrten die Marxisten - für die die Bezeichnung „Sozialdemokratie" ein völlig unzureichender Begriff war - entgegen der Tendenz, die Sozialdemokratie zu einer Mehrklassenpartei der demokratischen Reform zu machen, auf den Klassencharakter der Partei als ein gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft unversöhnliches Element;
- bestanden die Marxisten entgegen substitutionistischen Ideen der Partei als eine gebildete bürgerliche Elite, die den unbedarften Arbeitern Heilung verschafft, darauf, dass Elemente aus anderen Klassen sich nur dann der proletarischen Bewegung anschließen konnten, wenn sie ihre bürgerlichen Vorurteile ablegten;
- bestanden die Marxisten entgegen den Illusionen über den Begriff eines „Volksstaates", der stückweise Reformen bringen könne, die möglicherweise zum Sozialismus führten, darauf, dass der Kommunismus eine radikale gesellschaftliche Umwälzung bedeutete und dass er erst nach einer Periode der proletarischen Diktatur, die das ultimative Verschwinden jeglicher staatlichen Form anstrebt, eingeleitet werden könne. Das Prinzip der proletarischen Diktatur wurde durch die Praxis der Pariser Kommune vollkommen bestätigt;
- bestand Marx entgegen der Forderung des Gothaer Programms nach „gerechter Verteilung" des gesellschaftlichen Produkts darauf, dass der Schlüssel jeder Bewegung zum Kommunismus die Abschaffung des Tausches und des Wertgesetzes sei;
- sprach Marx über eine Bewegung von der niederen zur höheren Stufe des Kommunismus, während das Gothaer Programm Sozialismus mit Staatseigentum verwechselte. In der ersten Stufe sei die Gesellschaft noch vom Mangel und durch das Gepräge der alten Gesellschaft gezeichnet. Die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse müssen mit Maßnahmen bekämpft werden, die die Rückkehr des Strebens nach Wertanhäufung verhindern. Solch eine Übergangsmaßnahme war das System der Arbeitsgutscheine, in denen Marx einen Schritt zur Abschaffung des Lohnsystems sah, auch wenn dies noch von „bürgerlichem Recht" eingeschränkt war.
10. „Anarchismus oder Kommunismus" (International Review, Nr. 79)
Der Kampf gegen die offen bürgerlichen Einflüsse des „Staatssozialismus" ging mit dem Kampf gegen die Überbleibsel der im Anarchismus verkörperten kleinbürgerlichen Ideologie einher. Dies war keine neue Auseinandersetzung: In Werken wie Das Elend der Philosophie hatte sich der Marxismus bereits gegen die proudhonistische Nostalgie für eine Gesellschaft von unabhängigen Produzenten, vermittelt durch den „gerechten Austausch", ausgesprochen. Ab den 1860er Jahren schien sich der Anarchismus weiterentwickelt zu haben, betrachtete sich doch zumindest Bakunins Strömung nun als kollektivistisch, ja kommunistisch. Doch in Wahrheit war auch der Bakunismus in seinem Kern der Arbeiterbewegung nicht weniger fremd als die proudhonistische Ideologie, abgesehen vom Nachteil, dass Ersterer nicht mehr als Ausdruck der Unreife der Arbeiterbewegung betrachtet werden kann, sondern sich von Anfang an gegen den fundamentalen Fortschritt richtete, der von der marxistischen Weltanschauung verkörpert wurde.
Der Konflikt zwischen Marxismus und Bakunismus, zwischen dem proletarischen und dem kleinbürgerlichen Standpunkt wurde auf mehreren Ebenen ausgefochten:
- die Frage der Organisation: Bakunins Beitrag zum Leben der Internationale bestand darin, als Verteidiger der Freiheit und lokalen Autonomie gegen übertrieben zentralistische Tendenzen, die sich im Zentralrat der Internationale ausdrückten, zu posieren. Doch die Zentralisierung ist ein organischer Ausdruck des Bedürfnisses des Proletariats nach Einheit, wohingegen die Bakunisten den Zentralrat auf einen bloßen Briefkasten stutzen wollten, um die Fähigkeit der Internationale, mit einer Stimme gegen den Klassenfeind zu sprechen, zu liquidieren. Dieses Projekt konnte nur Unordnung in den Reihen der proletarischen Bewegung stiften. Gleichzeitig waren seine Reden über Freiheit und Autonomie reine Heuchelei, da das ganze Ziel des Bakunismus darin bestand, die Internationale via eines äußerst „autoritären" Geheimordens zu infiltrieren, der auf dem freimaurerischen Modell basierte, mit „Bürger B" - Bakunin - an seiner Spitze. Der Kampf für organisatorische Prinzipien des Proletariats - der auf Transparenz und klaren Richtlinien für die Verantwortlichkeiten fußt - gegen die kleinbürgerlichen Intrigen des Bakunin-Clans war die Schlüsselfrage auf dem Kongress der Internationale 1872;
- die historische Methode: Während die marxistische Strömung für die Methode des historischen Materialismus stand, für das Verständnis, dass das Handeln der Arbeiterbewegung im Verhältnis zu den objektiven historischen Bedingungen, mit denen sie konfrontiert ist, definiert werden muss, lehnte Bakunin dieses Vorgehen ab und befürwortete den Gedanken einer ewig gültigen Freiheit und Gerechtigkeit, wobei er argumentierte, dass die Revolution jederzeit möglich sei;
- das Subjekt der Revolution: Während der Marxismus erkannt hatte, dass die Klasse, die einzig und allein dazu bestimmt ist, die Revolution anzuführen - das moderne Proletariat -, sich noch im Formierungsprozess befand, standen die Bakunisten, für die die Revolution ein Großbrand war, der gleichermaßen von Bauern, Halbproletariern und Banditen-Rebellen wie von Arbeitern entfacht werden konnte, dem gleichgültig gegenüber;
- der politische Charakter des Klassenkampfes: Da für die Marxisten die kommunistische Revolution noch nicht auf der Tagesordnung der Geschichte stand, war es für die Arbeiterklasse notwendig, sich selbst als politische Kraft innerhalb der Grenzen der bürgerlichen Gesellschaft zu konsolidieren, was bedeutete, sich selbst in Gewerkschaften und ähnlichen Verteidigungsorganen zu organisieren und auf dem bürgerlichen politischen Terrain des Parlaments zu intervenieren, um die eigenen Interessen auf legale Weise durchzusetzen. Die Bakunisten jedoch lehnten jegliche parlamentarische Tätigkeit prinzipiell und - oberflächlich zumindest - überhaupt jeglichen Kampf ab, der nicht der Abschaffung des Kapitalismus galt; ferner erforderte - nach ihnen - der Sturz des Kapitalismus nicht die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse, sondern die unmittelbare „Auflösung" jeglicher Staatsform. Die Marxisten dagegen zogen die wirklichen Lehren aus der Kommune: dass die Arbeiterrevolution in der Tat die Ergreifung der politischen Macht bedeutet, dass aber diese Macht neuartig ist - eine Macht, mit der das gesamte Proletariat, besser als jede privilegierte Elite, direkt die Verwaltung des politischen und wirtschaftlichen Lebens ausüben kann. Und in der Praxis erwiesen sich die ultrarevolutionären Sprüche der Anarchisten als dünnes Furnier über ihrer opportunistischen Rolle als Wurmfortsatz der Bourgeoisie, wie sich in Spanien zeigte, wo sie sich an den lokalen Behörden beteiligten, die sich keineswegs vom kapitalistischen Staat getrennt hatten;
- die Frage der künftigen Gesellschaft: Der wahre Charakter des Anarchismus als Widerspiegelung der konservativen Weltanschauung kleinbürgerlicher Schichten, die von der Kapitalkonzentration ruiniert worden waren, war nirgendwo deutlicher als in ihrer Vision einer künftigen Gesellschaft. Dies trifft auf die „kollektivistischen" Bakunisten nicht weniger zu als auf Proudhon: Besonders Guillaumes Text „Über den Aufbau der neuen Gesellschaft" betont, dass die vielen Produzenten-Assoziationen und Kommunen, die nach der Revolution ins Leben gerufen werden, mit den guten Diensten einer „Tauschbank" verknüpft werden sollten, die das Geschäft des Kaufs und Verkaufs für die Gesellschaft organisiert. Im Gegensatz dazu beharrten die Marxisten darauf, dass in einer wirklich „kollektivistischen" Gesellschaft die Produzenten nicht ihre Produkte austauschen, da diese bereits Produkt und „Eigentum" der Gesamtheit der Gesellschaft sind. Die Fortführung der Warenverhältnisse kann nur eine Reflexion auf die Existenz von Privateigentum sein und dient als Humus für das Wachsen neuer Formen des Kapitalismus.
11. „Der späte Marx: vergangener und zukünftiger Kommunismus" (International Review, Nr. 81)
Während seiner letzten Lebensjahre widmete Marx einen Gutteil seiner intellektuellen Energie dem Studium archaischer Gesellschaften. Die Veröffentlichung von Morgans Ancient Society und Fragen, die ihm von der russischen Arbeiterbewegung über die Perspektive einer Revolution in Russland gestellt wurden, veranlassten ihn zu einem intensiven Studium, das uns zwar sehr unvollständige, aber äußerst wichtige Ethnologische Notizbücher hinterlassen hat. Diese Studien regten auch Engels‘ großes anthropologisches Werk Über die Ursprünge der Familie, des Privateigentums und des Staates an.
Morgans Werk über die nordamerikanischen Indianer war für Marx und Engels eine klare Bestätigung ihrer Thesen über den primitiven Kommunismus: Entgegen der konventionellen bürgerlichen Vorstellung, dass Privateigentum, gesellschaftliche Hierarchie und geschlechtliche Ungleichheit der menschlichen Natur immanent sind, enthüllte Morgans Untersuchung: Je älter die Gesellschaftsformation, desto mehr Gemeineigentum, desto kollektiver der Entscheidungsprozess, desto mehr fußte das Verhältnis zwischen Mann und Frau auf gegenseitigem Respekt. Dies bedeutete eine ungeheure Unterstützung für das kommunistische Argument gegen die Mythen der Bourgeoisie. Gleichzeitig befand sich das Hauptobjekt von Morgans Untersuchungen - die Gesellschaft der Irokesen - bereits im Übergang von der früheren Form der „Wildheit" zur Stufe der Zivilisation oder Klassengesellschaft; und die Formen des Erbrechts, die im Clan bzw. im Gens-System eingepflanzt waren, stellten schon die Keime des Privateigentums dar, der den Humus für die Entstehung der Klassen und des Staates bilden sowie für die „historische Niederlage des weiblichen Geschlechts" sorgen sollte.
Marx‘ Annäherung an die primitive Gesellschaft basierte auf seiner materialistischen Methode, die die historische Entwicklung von Gesellschaften als in letzter Instanz durch die Änderungen in ihrer ökonomischen Produktionsweisen bestimmt sieht. Diese Änderungen brachten das Ableben der primitiven Gemeinde mit sich und ebneten den Weg für das Erscheinen entwickelterer Gesellschaftsformationen. Doch diese Sichtweise des historischen Fortschreitens war dem kruden bürgerlichen Evolutionismus radikal entgegengesetzt, der einen rein linearen Aufstieg aus der Dunkelheit ans Licht sah, welcher in der blendenden Pracht der bürgerlichen Zivilisation kulminierte. Marx‘ Sichtweise war vollkommen dialektisch: Weit davon entfernt, die primitive kommunistische Gesellschaft als halb-menschlich abzutun, drücken die Notizbücher einen tiefen Respekt für die menschlichen Qualitäten der Stammesgemeinschaft aus: ihre Fähigkeit zur Selbstregierung, die unvorstellbare Kraft ihrer künstlerischen Kreationen, ihre Geschlechtergleichheit. Die einschränkenden Begleiterscheinungen der primitiven Gesellschaft - insbesondere die Restriktionen für das Individuum und die Separierung der Menschheit in getrennte Stammeseinheiten - wurden vom historischen Fortschritt überwunden. Doch die positive Seite dieser Gesellschaften wird in der kommunistischen Zukunft auf einer höheren Ebene wiederhergestellt werden müssen.
Im Gegensatz zu jenen, die einen Keil zwischen Marx und Engels zu treiben versuchten, indem sie Letzteren beschuldigten, ein gewöhnlicher „Evolutionist" zu sein, wurde diese dialektische Sichtweise der Geschichte von Engels geteilt, was deutlich in Der Ursprung der Familie... demonstriert wird.
Das Problem der primitiven und vor-kapitalistischen Gesellschaften war nicht einfach eine Frage der Vergangenheit. Die 1870er und 1880er Jahre waren eine Zeit, in der sich der Kapitalismus, nachdem er die Aufgaben der bürgerlichen Revolution im alten Europa erfüllt hatte, auf die imperialistische Phase zubewegte, in der die verbliebenen nicht-kapitalistischen Gebiete des Globus‘ aufgeteilt wurden. Die proletarische Bewegung musste also eine klare Position zur Kolonialfrage beziehen, nicht zuletzt weil es in ihren Reihen Strömungen gab, die den Begriff des „sozialistischen Kolonialismus" vertraten, eine frühe Form des Chauvinismus, dessen ganze Gefahr sich 1914 entblößte.
Die Unterstützung der fortschrittlichen Mission des Imperialismus stand für die Revolutionäre außer Frage. Doch da weite Teile des Planeten noch von vor-kapitalistischen Produktionsformen beherrscht wurden, war es notwendig, eine kommunistische Perspektive für diese Regionen zu erarbeiten. Dies wurde in der russischen Frage konkretisiert: Die Begründer des Kommunismus in Russland schrieben an Marx, um ihn über seine Haltung gegenüber dem archaischen Kommunismus, der agrarischen Mir, zu befragen, die im zaristischen Russland überlebt hatte. Könnte diese Formation als Grundlage für eine kommunistische Entwicklung in Russland dienen? Und - im Gegensatz zu den Erwartungen einiger seiner „marxistischen" Anhänger in Russland, die sich über den Inhalt der Antwort von Marx ausschwiegen - zog Marx den Schluss, dass es keine unvermeidliche Stufe der „bürgerlichen Revolution" in Russland geben muss und dass die Agrargemeinde durchaus als Grundlage für eine kommunistische Umwandlung dienen kann. Doch es gab einen wichtigen Vorbehalt: Dies kann nur geschehen, wenn die russische Revolution gegen den Zarismus das Signal zu einer proletarischen Revolution im Westen ist.
Diese ganze Episode zeigt, dass die Methode von Marx keineswegs beschränkt oder orthodox war. Im Gegenteil, er lehnte die groben Schemata der historischen Entwicklung ab, die einige Marxisten aus seinen Prämissen zogen, und prüfte sowie revidierte, sofern notwendig, stets seine Schlussfolgerungen. Doch sie offenbart auch seine prophetische Gabe: Auch wenn die kapitalistische Entwicklung in Russland die Mir im Wesentlichen unterminierte, sollte Marx‘ Ablehnung einer Stufentheorie der Revolution in Russland einen Nachhall in Trotzkis Theorie der permanenten Revolution und in Lenins Aprilthesen finden, die Marx in der Erkenntnis folgten, dass das Schicksal einer revolutionären Umwälzung in Russland unmittelbar mit der proletarischen Revolution in Westeuropa verknüpft war.
12. „1883-1895: Die Sozialdemokratie treibt die Sache des Kommunismus voran" (International Review, Nr. 84)
Das Aufkommen „sozialdemokratischer" Parteien in Europa war ein wichtiger Ausdruck der Wiederbelebung des Proletariats nach der niederschmetternden Niederlage der Kommune. Trotz ihrer Irritation über den Begriff „Sozialdemokratie" unterstützten Marx und Engels enthusiastisch die Bildung dieser Parteien, die einen Fortschritt gegenüber der Internationale in zwei Punkten markierten: Erstens verkörperten sie eine klarere Unterscheidung zwischen den allgemeinen Einheitsorganen der Klasse (damals besonders die Gewerkschaften) und der politischen Organisation, die die fortgeschrittensten Elemente der Klasse um sich scharte. Und zweitens konstituierten sie sich auf der Grundlage des Marxismus.
Zweifellos gab es von Anbeginn ernsthafte Schwächen in den programmatischen Grundlagen dieser Parteien. Auch die marxistische Führung in ihnen war häufig von all dem ideologischen Ballast erdrückt; und mit dem Wachsen ihres Einflusses wurden sie zu einem Anziehungspunkt für alle Arten bürgerlicher Reformisten, die sich feindlich gegenüber dem Marxismus verhielten. Die Periode der kapitalistischen Expansion Ende des 19. Jahrhunderts schuf die Bedingungen für die Zunahme eines immer offeneren Opportunismus innerhalb dieser Parteien, für einen Prozess der inneren Degenerierung, der im großen Verrat von 1914 kulminierte.
Dies hatte viele pseudoradikale politische Strömungen, die gewöhnlich behaupteten, kommunistisch zu sein, aber tief vom Anarchismus beeinflusst waren, dazu verleitet, die ganze Erfahrung der Sozialdemokratie en bloc abzulehnen, sie als eine Widerspiegelung und Adaption der bürgerlichen Gesellschaft abzutun. Doch damit wurde die tatsächliche Kontinuität der proletarischen Bewegung und die Art und Weise, in der sie zu einem Verständnis für ihr historisches Ziel gelangt, völlig verleugnet. Die besten Elemente der kommunistischen Bewegung im 20. Jahrhundert - von Lenin bis Luxemburg, von Bordiga bis Pannekoek - gingen durch die Schule der Sozialdemokratie und hätten ohne sie nicht existiert. Es ist kein Zufall, dass die ahistorische Methode, die zur pauschalen Verurteilung der Sozialdemokratie führte, immer häufiger damit schloss, Engels, ja den Marxismus selbst in den Mülleimer der Geschichte zu werfen, und somit die anarchistischen Wurzeln ihrer Denkweise enthüllte.
Entgegen der Versuche, Engels von Marx zu trennen und ihn als gewöhnlichen Reformisten darzustellen, ist es evident, dass Engels‘ Polemik gegen die realen bürgerlichen Einflüsse, die auf die Sozialdemokratie wirkten, - insbesondere sein Anti-Dühring - eine fulminante Verteidigung kommunistischer Prinzipien darstellte:
- die Bestätigung der unlösbaren Widersprüche des Kapitalismus, die in der eigentlichen Natur der Produktion und der Realisierung des Mehrwerts liegen;
- die Kritik an der Staatsintervention, die als eine Assoziation der Produzenten dargestellt wird, die sich der Lohnarbeit und Warenproduktion entledigt hat;
- die wiederholte Feststellung, dass das höchste Ziel des Kommunismus die Überwindung der Entfremdung und der wahre Beginn der menschlichen Geschichte ist.
Auch war Engels kein einsamer Rufer in den sozialdemokratischen Parteien. Ein kurzes Studium des Werkes von August Bebel und William Morris bestätigt dies: Die Befürwortung der Idee, dass der Kapitalismus überwunden werden müsse, weil seine Widersprüche in wachsende Katastrophen für die Menschheit mündeten; die Ablehnung der Identifizierung des Staatseigentums mit dem Sozialismus; die Notwendigkeit für die revolutionäre Arbeiterklasse, eine neue Form der Macht zu etablieren, wie sie von der Pariser Kommune vorgezeichnet wurde; die Erkenntnis, dass der Sozialismus die Abschaffung von Handel und Geld beinhaltet; das Verständnis, dass der Sozialismus nicht in einem Land errichtet werden kann, sondern die vereinte Aktion des Weltproletariats erfordert; die internationalistische Kritik am kapitalistischen Kolonialismus und die Ablehnung des nationalen Chauvinismus vor allem im Zusammenhang mit den zunehmenden Rivalitäten zwischen den imperialistischen Großmächten - diese Positionen waren den sozialdemokratischen Parteien nicht fremd, sondern drückten ihren fundamental proletarischen Kern aus.
13. „Die Umwandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse: Wie die Revolutionäre am Ende des 19. Jahrhunderts die Frage betrachtete" (International Review, Nr. 85)
Nur wenn man sich des Mythos‘ entledigt, dass die Sozialdemokratie vor 1914 einen bürgerlichen Charakter besessen habe, kann man eine seriöse Untersuchung über die Stärken und die Grenzen der Art und Weise anstellen, in der sich die Revolutionäre die Umwandlung des Gesellschaftslebens und die Eliminierung einiger der drückendsten Probleme der Menschheit vorstellen konnten.
Eine wichtige Frage, die sich dem kommunistischen Denken im 19. Jahrhundert stellte, war die „Frauenfrage". Schon in den Manuskripten von 1844 hatte Marx argumentiert, dass das Verhältnis zwischen Mann und Frau in jeder Gesellschaft ein Schlüssel zum Verständnis war, wie nah oder wie weit die betreffende Gesellschaft von der Verwirklichung des Menschen entfernt war. Die Werke von Engels, Über die Ursprünge der Familie, des Privateigentums und des Staates an, und von Bebel, Die Frau und der Sozialismus, bezeugten die historische Weiterentwicklung der Frauenunterdrückung, die mit der Abschaffung des primitiven Kommunismus und dem Auftreten des Privateigentums einen großen Schritt tat, jedoch auch in den entwickeltsten Formen der kapitalistischen Zivilisation ungelöst blieb. Diese historische Annäherung ist per Definition eine Kritik an der feministischen Ideologie, die dazu neigt, die Unterdrückung der Frauen zu einem angeborenen, biologischen Element des Mannes und somit zu einem ewigen Attribut der menschlichen Bedingungen zu machen. Auch wenn der Feminismus sich hinter einer scheinbar radikalen Kritik am Sozialismus versteckte, dem sie eine rein ökonomische Transformation vorhält, offenbarte er seine im Wesentlichen konservative Herangehensweise. Der Kommunismus ist keineswegs eine rein ökonomische Umwandlung. Denn so wie er beginnt, nämlich mit dem politischen Sturz des bürgerlichen Staates, so erfordert sein äußerstes Ziel - die tief greifende Umwandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse - die Eliminierung eben jener ökonomischen Kräfte, die sich hinter dem Konflikt zwischen Mann und Frau sowie hinter der Umwandlung der Sexualität in eine Ware verbergen.
So wie der Feminismus den Marxismus fälschlicherweise beschuldigt, „nicht weit genug zu gehen", so behaupten die Umweltaktivisten - indem sie die Lüge wiederholen, dass Marxismus gleich Stalinismus ist - , dass der Marxismus nur eine weitere „produktivistische" Ideologie sei, die für die Vergewaltigung der natürlichen Umwelt im 20. Jahrhundert mit verantwortlich sei. Dieser Vorwurf wurde auch auf einer etwas philosophischeren Ebene geäußert, besonders gegen die Sozialdemokratie des 19. Jahrhunderts, deren Methodik oft mit einer rein mechanistischen Art des Materialismus identifiziert wurde, mit einem unkritischen „Wissenschaftskult", der dazu neige, den Menschen von der natürlichen Welt zu abstrahieren, so wie er vom Kapital behandelt wird: als ein totes Ding, das gekauft, verkauft und ausgebeutet werden kann. Auch hier befindet sich Engels oft unter den als schuldig Ausgemachten. Doch auch wenn es zutrifft, dass diese mechanistischen Tendenzen innerhalb der sozialdemokratischen Parteien existierten und gar überhand nahmen, als sich der Degenerationsprozess beschleunigte, so ist es genauso richtig, dass ihre besten Elemente stets ein ganz anderes Vorgehen vertraten. Und auch hier gibt es eine vollkommene Kontinuität zwischen Marx und Engels, nämlich in der Erkenntnis, dass die Menschheit Teil der Natur ist und dass der Kommunismus nach Jahrtausenden der Entfremdung eine echte Aussöhnung zwischen Mensch und Natur bringen wird.
Diese Vision beschränkte sich nicht auf eine unerreichbar ferne Zukunft; in den Werken von Marx, Engels, Bebel und anderen gründete sie sich auf ein konkretes Programm, das das Proletariat in Gang setzen müsse, sobald es an die Macht gelangt sei. Dieses Programm wurde in der Formulierung zusammengefasst: „Abschaffung der Trennung zwischen Stadt und Land". Der Stalinismus an der Macht interpretierte diese Phrase auf seine Weise - mit der Rechtfertigung der Vergiftung des Landes und des Aufbaus von öden Baracken, in denen die ArbeiterInnen hausen sollten. Doch für die wirklichen Marxisten des 19. Jahrhunderts bedeutete die Phrase „Abschaffung der Trennung zwischen Stadt und Land" nicht eine besessene Urbanisierung des Globus, sondern die Eliminierung der überquellenden Städte und die harmonische Verteilung der Menschheit auf dem ganzen Planeten. Dieses Projekt ist in der heutigen Welt der unermesslichen Megacitys und der zügellosen Vergiftung der Umwelt mehr denn je relevant.
14. „Die Umwandlung der Arbeit nach den Vorstellungen der Revolutionäre des späten 19. Jahrhunderts" (International Review, Nr. 86)
Als Künstler, der sich mit Haut und Haaren der sozialistischen Bewegung angeschlossen hatte, befand sich William Morris an der richtigen Stelle, um über die Umwandlung der Arbeit in einer kommunistischen Gesellschaft zu schreiben, da er sowohl den Seelen zerstörenden Charakter der Arbeit im Kapitalismus als auch die radikalen Möglichkeiten kannte, entfremdete Arbeit durch eine wahrhaft schöpferische Tätigkeit zu ersetzen. In seinem visionären Roman Kunde aus dem Nirgendwo wird schlicht festgestellt, dass „Glück ohne glückliches Tageswerk unmöglich" ist. Dies stimmt perfekt mit der marxistischen Konzeption, die Arbeit ins Zentrum des menschlichen Leben zu rücken, überein: Der Mensch hat sich selbst durch Arbeit geschaffen, aber er hat sich unter Bedingungen geschaffen, die seine Entfremdung erzeugten. Aus diesem Grund kann die Überwindung der Entfremdung nicht ohne eine gründliche Umwandlung der Arbeit erreicht werden.
Der Kommunismus ist im Gegensatz zu einigen, die in seinem Namen sprechen, nicht „gegen die Arbeit". Selbst im Kapitalismus drückt die Ideologie der „Arbeitsverweigerung" eine rein individuelle Revolte marginaler Klassen oder Schichten aus. Und eine der ersten Maßnahmen der proletarischen Macht wird es sein, eine allgemeine Arbeitspflicht durchzusetzen. In seinen Frühphasen enthält der revolutionäre Prozess unvermeidlich ein Element der Einschränkung, da es unmöglich ist, den Mangel ohne eine mehr oder weniger lange Übergangsperiode abzuschaffen, die sicherlich beträchtliche materielle Opfer beinhaltet, besonders in der Anfangsphase des Bürgerkriegs gegen die alte herrschende Klasse. Doch das Fortschreiten zum Kommunismus kann an dem Grad gemessen werden, mit dem die Arbeit aufhört, eine Form des Opfers zu sein, und zu einem positiven Vergnügen wird. In seinem Essay Nützliche Arbeit versus unnützliche Arbeit identifiziert Morris drei wesentliche Aspekte der Arbeit:
- dass die Arbeit von der „Hoffnung auf Erholung" beseelt ist: Die Reduzierung des Arbeitstages muss ein unmittelbares Mittel der siegreichen Revolution sein, andernfalls wird es für die Mehrheit der Arbeiterklasse unmöglich sein, eine aktive Rolle im revolutionären Prozess zu spielen. Der Kapitalismus hat bereits die Bedingungen für diese Maßnahme geschaffen, indem er die Technologie entwickelte, die - wenn sie einmal vom Profitstreben befreit ist - sehr gut dazu benutzt werden kann, die Menge an repetitiven und unangenehmen Aufgaben, die im Arbeitsprozess involviert sind, zu reduzieren. Gleichzeitig könnte die riesige Masse an menschlicher Arbeitskraft, die in der kapitalistischen Produktion überflüssig zu werden droht - in Gestalt massiver Arbeitslosigkeit oder in Form von Arbeit, die keinem nützlichen Zweck dient (Bürokratie, Rüstungsproduktion, etc.) -, für nützlichere Produktion oder Dienste eingesetzt werden. Auch dies würde helfen, den Arbeitstag für alle zu reduzieren. Diese Beobachtungen wurden bereits von Engels, Bebel und Morris gemacht, und sie treffen in der dekadenten Epoche des Kapitalismus mehr denn je zu;
- dass es eine „Hoffnung auf Ergebnisse" gibt: Mit anderen Worten, die Arbeiter sollten ein Interesse daran haben, was produziert wird, sei es, weil dies wichtig für die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse ist oder schlicht wegen der eigentlichen Schönheit des Produktes. Schon zu Lebzeiten von Morris besaß der Kapitalismus eine große Gabe darin, schäbige und nutzlose Produkte herzustellen, doch die Massenproduktion von Trödel und Hässlichem im dekadenten Kapitalismus würde wahrscheinlich seine schlimmsten Albträume übertreffen;
- dass es eine „Hoffnung auf Vergnügen an der Arbeit selbst" gibt. Morris und Bebel bestehen darauf, dass die Arbeit in angenehmen Umständen ausgeführt werden soll. Im Kapitalismus ist die Fabrik ein Modell für die Hölle auf Erden; die kommunistische Produktion wird den assoziierten Charakter der Fabrikarbeit erhalten, jedoch in einer ganz unterschiedlichen Umgebung. Gleichzeitig muss die kapitalistische Arbeitsteilung - die so viele ProletarierInnen dazu verdammt, stumpfsinnige, repetitive Arbeiten zu verrichten - überwunden werden, so dass jeder Produzent eine Balance zwischen körperlicher und geistiger Arbeit erreicht und imstande ist, sich selbst einer Vielfalt von Aufgaben zu widmen und eine Vielzahl an Fertigkeiten zu entwickeln, um eben diese Aufgaben auszuführen. Darüber hinaus wird die Arbeit der Zukunft vom frenetischen Tempo befreit sein, das die Jagd nach den Profiten erfordert, und den menschlichen Bedürfnissen und Wünschen angepasst sein.
Fourier mit seiner bemerkenswerten Vorstellungskraft hat im Zusammenhang mit seinen „Phalansterien" von einer Arbeit gesprochen, die auf „leidenschaftlicher Anziehung" basierte. Er ging davon aus, dass die tägliche Arbeit gleichsam zum Spiel wird. Marx, der Fourier sehr bewunderte, argumentierte, dass wirklich schöpferische Arbeit auch eine „verdammt ernste Angelegenheit" sei oder, wie er es in den Grundrissen nannte: „Ein Mensch kann nicht wieder zum Kind werden, ohne kindlich zu werden". Jedoch fährt er fort: „Aber findet er nicht Freude an der Naivität des Kindes und muss er sich nicht anstrengen um auf einem höheren Niveau zur Wahrheit zu gelangen?" (eigene Übersetzung). Die kommunistische Tätigkeit wird den alten Gegensatz zwischen Arbeit und Spiel überwunden haben.
Diese Skizzen der kommunistischen Zukunft waren nicht utopisch, da der Marxismus bereits demonstriert hatte, dass der Kapitalismus die materiellen Bedingungen dafür geschaffen hatte, damit die tägliche Arbeit endlich dergestalt umgewandelt wird. Der Marxismus hat zudem die gesellschaftliche Kraft identifiziert, die dazu gezwungen wird, diese Umwandlung vorzunehmen, eben weil sie das letzte Opfer der Entfremdung der Arbeit ist.
15. „1895-1905: Parlamentarische Illusionen verbergen die Perspektive der Revolution" (International Review, Nr. 88)
Die Diktatur des Proletariats war seit Anfang an ein fundamentales Konzept des Marxismus gewesen. Frühere Artikel zeigten, dass sie nie eine statische Idee war, sondern weiterentwickelt wurde und im Lichte des proletarischen Kampfes immer konkreter wurde. Desgleichen war die Verteidigung der proletarischen Diktatur gegen die vielen Formen des Opportunismus stets ein konstantes Element im Werdegang des Marxismus gewesen. So war Marx 1875, als er seine Argumente auf die Erfahrungen der Pariser Kommune stützte, in der Lage, eine vernichtende Kritik am Lassalleanischen Begriff des „Volksstaates" zu üben, der im Gothaer Programm der neuen Sozialdemokratischen Partei in Deutschland Eingang gefunden hatte.
Gleichzeitig beinhaltet dies, da die Perspektive der proletarischen Macht aus dem erbarmungslosen Kampf gegen die vorherrschende Ideologie geboren wird, auch einen Kampf gegen die Auswirkungen, den diese Ideologie selbst auf die scharfsinnigsten Fraktionen der Arbeiterbewegung hatte. Selbst nach der Erfahrung der Pariser Kommune hielt Marx zum Beispiel in einer Rede vor dem Haager Kongress von 1872 daran fest, dass in zumindest einigen Ländern das Proletariat friedlich, mittels des demokratischen Apparates des existierenden Staates, zur Macht gelangen könne.
In den 1880er Jahren wurde die deutsche Partei - die führende Partei in der internationalen Bewegung - vom Bismarck-Regime für außergesetzlich erklärt, was ihre revolutionäre Integrität zu bewahren half. Selbst da, wo Zugeständnisse gegenüber der bürgerlichen Demokratie fortbestanden, war es die vorherrschende Ansicht, dass die proletarische Revolution notwendigerweise den erzwungenen Sturz der Bourgeoisie erfordert. Und die fundamentale Lehre aus der Kommune - dass der herrschende Staat nicht erobert werden kann, sondern in Stücke zerschlagen werden muss - war keineswegs vergessen worden.
In der sich anschließenden Periode jedoch schuf die Legalisierung der Partei, der Zustrom von kleinbürgerlichen Elementen und vor allem die spektakuläre Expansion des Kapitalismus sowie der daraus folgende Zugewinn an realen Reformen für die Arbeiterklasse den Boden für das Wachstum eines deutlicher prononcierten Reformismus innerhalb der Partei. Der Aufstieg einer „staatssozialistischen" Tendenz um Vollmar und insbesondere die revisionistischen Theorien von Eduard Bernstein strebten danach, die sozialistische Bewegung davon zu überzeugen, ihre Ansprüche zugunsten einer gewaltsamen Revolution aufzugeben und sich offen zur Partei der demokratischen Reform zu erklären.
In einer proletarischen Partei trifft eine solch offenkundige Penetration bürgerlicher Einflüsse unvermeidlich auf den erbitterten Widerstand jener, die das proletarische Herz der Organisation repräsentieren. In der deutschen Partei trat den opportunistischen Tendenzen am famosesten Rosa Luxemburg mit ihrer Schrift Sozialreform oder Revolution entgegen, doch der Aufstieg linker Faktionen war ein internationales Phänomen.
Zunächst schienen die Schlachten, die von Luxemburg, Lenin und anderen angeführt wurden, erfolgreich zu sein. Die Revisionisten wurden nicht nur von der Roten Rosa, sondern auch vom „Papst" des Marxismus, Karl Kautsky, verdammt.
Nichtsdestotrotz erwiesen sich die Siege der Linken als zerbrechlicher, als sie zunächst erschienen. Die Ideologie der Demokratie drang langsam in die gesamte Bewegung ein; selbst Engels blieb nicht davon ausgenommen. In seiner 1895er Einführung zu Die Klassenkämpfe in Frankreich von Marx wies Engels richtigerweise darauf hin, dass eine simple Flucht auf die Barrikaden und in den Straßenkampf nicht mehr ausreichte, um das alte Regime ins Wanken zu bringen, und dass das Proletariat das Kräftegleichgewicht massiv zu seinem Gunsten beeinflussen müsse, ehe es zum Angriff bläst. Dieser Text wurde von der Führung der deutschen Partei so verzerrt, dass es den Anschein hatte, als sei Engels gegen jegliche proletarische Gewalt. Doch die Opportunisten waren, wie Luxemburg später hervorhob, nur deswegen dazu in der Lage gewesen, weil es in der Tat Schwächen in Engels‘ Argumentation gab: Die Schaffung einer politischen Kraft des Proletariats wurde mehr oder weniger mit dem allmählichen Wachstum der sozialdemokratischen Parteien und ihres Einflusses auf der parlamentarischen Bühne identifiziert.
Dieser Fokus auf den parlamentarischen Gradualismus wurde besonders von Kautsky theoretisiert, der unbestritten gegen die offenen Revisionisten opponierte, aber in wachsendem Maße für ein konservatives „Zentrum" stand, das eine Scheineinheit der Partei höher bewertete als die programmatische Klarheit. In solch folgenreichen Werken wie Die soziale Revolution setzte Kautsky die proletarische Machtergreifung mit der Erringung der parlamentarischen Mehrheit gleich, auch wenn er klar machte, dass auch in solch einer Lage die Arbeiterklasse dazu bereit sein müsse, den Widerstand der Konterrevolution zu unterdrücken. Diese politische Strategie ging auch mit einem ökonomischen „Realismus" einher, der den wahren Inhalt des sozialistischen Programms - die Abschaffung der Lohnarbeit und der Warenproduktion - aus den Augen verlor und stattdessen den Sozialismus als staatliche Regulierung des Wirtschaftslebens betrachtete.
Der Artikel in der nächsten Ausgabe der Internationalen Revue wird die zweite Artikelserie zusammenfassen, die die Zeit zwischen 1905 und dem Ende der ersten großen internationalen revolutionären Welle umfasst. Zunächst wird er aufzeigen, wie die Frage von Form und Inhalt der Revolution durch eine scharfe Debatte über die neuen Formen des Klassenkampfes geklärt wurde, die zu entstehen begannen, als sich der Kapitalismus dem Scheitelpunkt zwischen seiner aufsteigenden und seiner dekadenten Epoche näherte.
CDW, 11. Dezember 2005
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Erbe der kommunistischen Linke:
Editorial: Finanzkrise: Von der Liquiditätskrise zur Liquidierung des Kapitalismus
- 3789 Aufrufe
Der Sommer 2007 war ein erneutes Beispiel dafür, wie der Kapitalismus in immer schneller wiederkehrende Krisen stürzt: die imperialistische Barbarei mit den andauernden Blutbädern unter Zivilisten im Irak; die Verwüstungen aufgrund der Klimaerwärmung, welche ihre Ursachen in der unaufhörlichen Jagd nach Profit hat; und eine erneute ökonomische Krise, welche eine noch stärkere Verarmung der Weltbevölkerung ankündigt. Auf der anderen Seite entwickelt die Arbeiterklasse, welche als einzige Klasse fähig ist, die Menschheit zu retten, ein immer größeres Misstrauen gegenüber dem Kapitalismus. Wir wollen hier aber auf die ökonomische Krise eingehen, die dramatischen Ereignisse im Immobiliensektor in den USA, welche die ganze internationale Finanzwelt und Ökonomie erschüttert hat.
Die Blase platzt
Die Krise wurde ausgelöst durch den Fall der Immobilienpreise in den USA, begleitet von einem Rückgang in der Bauindustrie und der Unfähigkeit zahlreicher Schuldner, die gestiegenen Zinsen zu bezahlen und Kredite abzustottern, welche heutzutage unter dem Namen „Subprime" oder Risikoanleihen bekannt sind. Von diesem Epizentrum aus haben sich die Erschütterungen auf das weltweite Finanzsystem ausgeweitet. Im August waren ganze Investmentfonds und Handelsbanken, welche Milliarden von Dollars in dieses riskante Geschäft gesteckt hatten, zusammengebrochen oder mussten gestützt werden. Selbst zwei „Hedge Funds" der amerikanischen Bear Sterns Bank verschwanden und mit ihnen eine Milliarde Dollar von Investoren. Die deutsche Bank ADF musste ebenfalls gerettet werden und die französische BNP Paribas wurde brutal erschüttert. Die Aktivitäten der Immobilienanleihen-Institute und anderer Banken waren stark gesunken, was zu einem Schwindel erregenden Sturz an allen großen Börsenplätzen führte und Milliarden von Dollar „akkumulierter Arbeit" zerstörte. Um dem Vertrauensverlust und dem Widerstand der Banken, neue Kredite zu gewähren, entgegenzusteuern, intervenierten die Zentralbanken - die amerikanische Notenbank FED und die Europäische Zentralbank EZB - und stellten neue Milliardenbeträge zu günstigeren Zinsen zur Verfügung. Dieses Geld war natürlich nicht für die hunderttausende von Leuten bestimmt, welche durch das „Subprime"-Fiasko das Dach über dem Kopf verloren hatten. Auch nicht für die Tausenden von Arbeitern, welche durch die Krise im Bausektor in die Arbeitslosigkeit geworfen wurden. Nein, sie waren für den Kreditmarkt selber bestimmt! Die Finanzinstitute welche enorme Mengen von Geldern verschwendet hatten wurden wieder aufgemöbelt, damit sie ihr Spekulantentum fortsetzen können. Doch all das löste die Krise natürlich nicht. In England führte es zur Farce.
Im September hatte die britische Staatsbank andere Zentralbanken kritisiert, weil sie riskanten und unvorsichtigen Investoren, welche die Krise beschleunigten, unter die Arme gegriffen hatten. Sie schlug eine andere Politik vor, die Schwarze Schafe bestraft und das Ausbrechen derselben Spekulationsprobleme verhindert soll. Doch schon am nächsten Tag machte Mervyn King, der Präsident der britischen Zentralbank, eine Kehrtwende. Die Bank musste den fünftgrößten Immobilienkreditgeber Englands, die Northern Rock Bank, retten. Deren „Unternehmensstrategie" bestand darin, auf dem Kreditmarkt mehr Geld auszuleihen, als den Leuten zur Verfügung zu stellen, welche Wohnungen zu höheren Zinsen kauften. Als die Kreditmärkte zusammenbrachen, ereilte die Northern Rock dasselbe Schicksal.
Auch noch nach der Nachricht von der Unterstützung der Bank bildeten sich enorme Schlangen vor deren Filialen: die Sparkontoinhaber wollten ihr Geld abheben, und in 3 Tagen wurden 2 Milliarden Pfund Sterling abgehoben. Dies war der erste Ansturm dieser Art vor einer englischen Bank seit 140 Jahren (1866). Um einem Ansteckungsrisiko vorzubeugen, musste die Regierung erneut intervenieren und eine hundertprozentige Garantie gegenüber den Kunden von Northern Rock und den Sparern anderer bedrohter Banken gewähren[1]. Am Ende war die „alte Dame der Threadneedle Street" - die Englische Zentralbank - gezwungen, in derselben Art und Weise wie andere Zentralbanken, welche sie zuvor kritisiert hatte, ungeheure Mengen von Geld ins zerbrechliche Bankensystem zu schleudern. Mit dem Resultat, dass die Glaubwürdigkeit der Leitung des Londoner Finanzzentrums, welches heute einen Viertel der britischen Wirtschaft ausmacht, ruiniert ist.
Der nächste Akt des ganzen Dramas, das zur Zeit der Redaktion dieses Artikels anhält, betrifft die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Wirtschaft im Allgemeinen. Die erste Zinssenkung der FED seit fünf Jahren, die eine größere Erhältlichkeit von Krediten zum Ziel hat, ist bisher kein Erfolg. Sie konnte den fortschreitenden Zusammenbruch des Immobilienmarktes in den USA nicht aufhalten und bietet auch für all die 40 anderen Länder, in denen das Platzen der Spekulationsblase droht, keine Perspektive. Es konnten damit auch nicht erschwerte Bedingungen für Kredite verhindert werden und damit Auswirkungen auf Investitionen und die Verschuldung der Haushalte im Allgemeinen. Ganz im Gegenteil führte es zu einem raschen Fall des Dollars, welcher verglichen mit anderen Devisen an einen Tiefpunkt gelangt ist, seit Nixon den Dollar 1971 entwertete. Gleichzeitig verzeichnen nun der Euro und Rohstoffe wie Öl oder Gold einen Rekordstand.
All dies sind Anzeichen eines Einbruchs der Weltwirtschaft, einer offenen Rezession und Inflation in der nächsten Zeit.
Oder anders ausgedrückt: Die Wachstumsperiode der letzten sechs Jahre, basierend auf Hypotheken, Konsum und der gewaltigen auswärtigen Verschuldung des US-amerikanischen Staatsbudgets ist zu Ende.
So präsentiert sich die gegenwärtige wirtschaftliche Lage. Die Frage lautet nun: Befindet sich die sich abzeichnende und von allen erwartete Rezession lediglich im Rahmen des unvermeidlichen Auf und Ab einer gesunden kapitalistischen Wirtschaft, oder ist sie Zeichen einer Zersetzung, einer internen Panne des Kapitalismus, welche sich durch immer heftiger werdende Erschütterungen ausdrückt?
Um auf diese Frage eine Antwort geben zu können, ist es zuerst notwendig, die Auffassung zu beleuchten, nach der das Anwachsen der Spekulation und die daraus entspringende Kreditkrise lediglich eine Abweichung eines ansonsten gesunden Systems seien und durch die Kontrolle des Staates oder eine bessere Regulation im Griff behalten werden könnten. Oder mit anderen Worten: Ist die gegenwärtige Krise das Produkt von unverantwortungsvollen Spekulanten?
Die Rolle des Kredits im Kapitalismus
Die Entwicklung des Bankensystems, der Börse und anderer Kreditmechanismen ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung des Kapitalismus seit dem 18. Jahrhundert. Sie waren notwendig zur Anhäufung und Zentralisierung von Geldern und ermöglichten für eine breite industrielle Expansion die notwendigen Investitionen, welche selbst der reichste Einzelkapitalist nicht aufbringen konnte. Die Vorstellung vom Industrieunternehmer, der Kapital anhäuft, indem er sein eigenes Geld einsetzt oder riskiert, ist eine Fiktion. Die Bourgeoisie benötigt den Zugriff auf Kapital, das bereits auf den Kreditmärkten konzentriert ist. Auf den Finanzmärkten pokern die Vertreter der herrschenden Klasse nicht mit ihrem individuellen Eigentum, sondern mit bereits angehäuftem, sozialem Reichtum in Geldform.
Der Kredit spielte im Vergleich zu früheren Epochen eine wichtige Rolle in der Steigerung der Produktivkräfte und in der Bildung eines Weltmarktes.
Auf der anderen Seite war aufgrund der dem Kapitalismus innewohnenden Tendenzen der Kredit auch ein gewaltiger Faktor bei der Überproduktion und der Überschätzung der Möglichkeiten des Marktes, Produkte aufzunehmen, und wurde somit zu einem Katalysator der Spekulationsblase mit ihrer Konsequenz der Krise und Austrocknung des Kredits. Gleichzeitig mit der Verursachung sozialer Katastrophen haben die Börsen und das Bankensystem die ganzen individuellen Sittenlosigkeiten wie Habgier und Doppelzüngigkeit gefördert, welche bezeichnend sind für eine ausbeutende Klasse, die von der Arbeit anderer lebt: Vermögensdelikte, fiktive Zahlungen, skandalöse Sonderleistungen, goldene Fallschirme (Abgangsentschädigungen von CEOs), Hinterziehung, oder schlicht und einfach Diebstahl, usw.
Die Spekulation, die riskanten Schulden, die Schwindeleien, die Börsenkrisen und das Verschwinden unglaublicher Mengen von Mehrwert sind ein fester Bestandteil der Anarchie der kapitalistischen Produktion.
Die Spekulation ist in Wirklichkeit eine Folge und nicht eine Ursache der kapitalistischen Krisen. Wenn es heute so scheint, als dominierten die spekulativen Finanzaktivitäten die gesamte Wirtschaft, dann lediglich deshalb, weil die kapitalistische Überproduktion seit mehr als 40 Jahren eine stetig tiefer werdende Krise verursacht, in der der Weltmarkt vollkommen mit Produkten übersättigt ist und die Investition in die Produktion immer weniger lukrativ wird. Das Finanzkapital hat keine andere Wahl, als zu spekulieren - das ist die heutige „Kasinoökonomie"[2].
Ein Kapitalismus ohne finanzielle Exzesse ist unvorstellbar. Sie sind ein typischer Teil der kapitalistischen Tendenz, so zu produzieren als hätte der Markt keine Schranken, und der Unfähigkeit selbst eines Allan Greenspan, des ehemaligen Präsidenten der FED, zu erkennen, dass „der Markt überschätzt wird".
Der kürzliche Zusammenbruch des Immobilenmarktes in den USA und anderen Ländern ist eine Illustration des wahren Verhältnisses zwischen der Überproduktion und dem Kreditzwang.
Der Immobiliensektor zeigt den Anachronismus der kapitalistischen Produktion auf
Die Krise im Immobilienmarkt erinnert an die Beschreibung der kapitalistischen Krise wie sie schon Marx im Kommunistischen Manifest 1848 formuliert hatte: „In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie der Überproduktion. (...) Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt."
So ist Obdachlosigkeit heutzutage nicht Resultat eines Mangels an Wohnungen oder Häusern, sondern paradoxerweise eines Überflusses, und es gibt eine regelrechte Überfülle an leeren Wohnungen und Häusern. Die Bauindustrie hat grenzenlos gearbeitet in den letzten fünf Jahren. Doch gleichzeitig ist die Kaufkraft der amerikanischen Arbeiter zurückgegangen, weil der amerikanische Kapitalismus seinen Profit erhöhen wollte. Es ist ein Graben entstanden zwischen den neu auf den Markt geworfenen Häusern und der Fähigkeit der Leute, welche diese wirklich benötigen, sie sich auch zu leisten. Die riskanten Darlehen - sprich „Subprimes" - hatten den Zweck, neue Käufer zu finden, welche sich dies aber gar nicht leisten konnten. Eine Quadratur des Zirkels! Schlussendlich brach der Markt zusammen. Heute werden immer mehr Hauseigentümer aus ihren vier Wänden herausgeschmissen, weil sie die steigenden Zinsen nicht mehr bezahlen können, und der Immobilienmarkt wird dadurch noch mehr gesättigt. In den USA wird erwartet, dass 3 Millionen Leute ihr Haus verlieren werden, weil sie ihre „Subprime"-Anleihen nicht zurück bezahlen können. Auch in anderen Ländern, in denen die Immobilienblase geplatzt oder auf gutem Weg dazu ist, zeichnet sich eine ähnliche Tragödie ab. Die gesteigerte Bautätigkeit und Hypothekengewährung in den letzten 10 Jahren, weit davon entfernt, die Obdachlosigkeit zu reduzieren, hat ein angenehmes Wohnen für einen großen Teil der Bevölkerung unerschwinglich gemacht und Hauseigentümer in eine prekäre Lage gebracht[3].
Was die Führer des kapitalistischen Systems - die „Hedge-Fund"-Manager, die Finanzminister, die Leiter der Zentralbanken, usw. - kümmert, ist nicht die menschliche Tragödie, welche durch das „Subprime"-Debakel ausgelöst wurde, nicht die Hoffnungen auf ein besseres Leben (oder nur dann, wenn es zu einer Infragestellung des Kapitalismus führt), sondern die Unfähigkeit der Konsumenten, die Wucherzinse für ihre Kredite zu bezahlen.
Das „Suprime"-Debakel zeigt deutlich die Krise des Kapitalismus auf, seine in der Jagd nach Profit begründete Tendenz zu einer Überproduktion, gemessen an der Kaufkraft der Märkte. Es zeigt seine Unfähigkeit auf, trotz der immensen materiellen, technologischen und menschlichen Ressourcen, die elementaren Bedürfnisse der Menschheit zu befriedigen[4].
Auch wenn das kapitalistische System im Lichte der heutigen Krise noch so absurd, verschwenderisch und anachronistisch erscheint, versucht die herrschende Klasse sich und die ganze Bevölkerung zu beruhigen und behauptet, es sei alles niemals so schlimm wie die Krise von 1929.
Die heutige Lage: dasselbe Problem wie 1929
Der Krach der Wall Street im Jahre 1929 und die Große Depression ängstigen die Bourgeoisie nach wie vor, wie die Medienberichterstattung über die neuen Ereignisse beweist. Mit Leitartikeln, Hintergrundberichten und historischen Analogien wird versucht, uns zu überzeugen, dass die derzeitige Bankenkrise nicht zur selben Katastrophe führen werde, dass 1929 ein einmaliges Ereignis gewesen sei, das sich nur deshalb in eine Katastrophe verwandelt habe, weil falsche Entscheide gefällt worden seien.
Die „Experten" der Bourgeoisie schüren die Illusion, nach der die derzeitige Finanzkrise eine Art Wiederholung der Krachs des 19. Jahrhunderts sei, die in zeitlicher und räumlicher Ausdehnung vergleichsweise begrenzt waren. In Wirklichkeit hat die derzeitige Lage aber mehr gemeinsam mit 1929 als mit jener früheren Phase des kapitalistischen Aufstiegs; sie weist Eigenschaften auf, die typisch sind für die verhängnisvollen wirtschaftlichen und finanziellen Krisen der Niedergangsphase, die mit dem Ersten Weltkrieg begonnen hat, einer Phase der Erschütterung der kapitalistischen Produktionsweise, eines Zeitalters der Kriege und der Revolutionen.
Die wirtschaftlichen Krisen des kapitalistischen Aufstiegs und die spekulativen Aktivitäten, die sie oft begleiteten oder ihr vorausgingen, stellten den Puls eines gesunden Systems dar und ebneten den Weg für eine neue kapitalistische Expansion durch ganze Kontinente, für wichtige technologischen Fortschritte, die Eroberung kolonialer Märkte, die Umwandlung der Handwerker und Bauern in Armeen von Lohnarbeitern usw.
Der Börsenkrach in New York im Jahre 1929, der die erste große Krise des dekadenten Kapitalismus einläutete, stellte alle Spekulationskrisen des 19. Jahrhunderts in den Schatten. Während der „verrückten 20er Jahre" hatten sich die Aktienwerte an der Börse von New York, der wichtigsten der Welt, verfünffacht. Der weltweite Kapitalismus hatte die Katastrophe des Ersten Weltkrieges nicht überwunden, und im Land, das das reichste der Welt geworden war, suchte die Bourgeoisie einen Ausweg in der Börsenspekulation.
Doch der „Schwarze Donnerstag", der 24. Oktober 1929, war der brutale Absturz. Die Panikverkäufe setzten sich am „Schwarzen Dienstag" der folgenden Woche fort. Und die Börse befand sich bis zum Jahre 1932 auf dem absteigenden Ast; mittlerweile hatten die Titel 89% von ihrem maximalen Wert von 1929 verloren. Sie sanken auf Niveaus, die seit dem 19. Jahrhundert nie mehr gesehen worden waren. Der Höchststand der Aktienwerte von 1929 wurde erst wieder im Jahre 1954 erreicht!
In dieser Zeit brach auch das amerikanische Bankensystem, das Geld für den Kauf von Titeln ausgeliehen hatte, zusammen. Diese Katastrophe kündigte die große Depression der Dreißiger Jahre an, die bisher tiefste Krise des Kapitalismus. Das amerikanische BIP wurde halbiert. 13 Millionen Arbeiter verloren praktisch ohne jede Absicherung die Arbeit. Ein Drittel der Bevölkerung sank in die bitterste Armut ab. Die Auswirkungen davon waren auf dem ganzen Planeten zu spüren.
Aber es folgte kein wirtschaftlicher Wiederaufschwung wie jeweils nach den Krisen des 19. Jahrhunderts. Die Produktion nahm erst wieder einen Anlauf, nachdem sie auf die Rüstungsproduktion ausgerichtet worden war zur Vorbereitung des Blutbads zur Neuaufteilung des Weltmarktes, des Zweiten Weltkrieges; mit anderen Worten, nachdem die Arbeitslosen in Kanonenfutter verwandelt worden waren.
Die Rezession der Dreißiger Jahre schien die Folge von 1929 zu sein, aber in Wirklichkeit beschleunigte der Krach der Wall Street nur die chronische Überproduktionskrise des Kapitalismus in seiner Niedergangsphase, die der gemeinsame Wesenszug der Krise der Dreißiger Jahre und jener von heute ist, die im Jahre 1968 begonnen hat.
Die Bourgeoisie der 50er und 60er Jahre verkündete zur Genüge, dass sie das Problem der Krisen gelöst und dank den Gegenmitteln der staatlichen Eingriffe in die nationale und internationale Wirtschaft, der Defizitfinanzierung und der progressiven Besteuerung auf ein geschichtliches Kuriosum reduziert habe. Zu ihrer Bestürzung trat die weltweite Überproduktionskrise im Jahre 1968 doch wieder auf.
Seit 40 Jahren torkelt diese Krise von einer Rezession in die andere; von einer offenen Rezession in die nächste, die noch ernsthafter ist; von einer Fata Morgana in die folgende. Die Krise seit 1968 hat nicht die schroffe Form des Krachs von 1929 angenommen.
Im Jahre 1929 ergriffen die bürgerlichen Finanzexperten Maßnahmen, die die finanzielle Krise nicht eindämmen konnten. Diese Maßnahmen waren keine Fehler, sondern Methoden, die bei den früheren Einbrüchen des Systems funktioniert hatten, wie bei jenem von 1907 und der Panik, die er verursacht hatte; aber sie waren in der neuen Phase nicht mehr ausreichend. Der Staat lehnte es ab zu intervenieren. Die Zinssätze stiegen, man ließ die Währungsreserven zurückgehen, die Kredithindernisse sich verstärken und das Vertrauen ins Banken- und Kreditsystem sich in Luft auflösen. Die Smoot-Hawley-Zollgesetze stellten Schranken gegen Einfuhren auf, was den weltweiten Handel weiter verlangsamte und folglich die Rezession nur noch vertiefte.
In den 40 letzten Jahren hat die Bourgeoisie es verstanden, das staatliche Instrumentarium zu benützen, um die Zinssätze zu reduzieren, flüssige Mittel ins Bankensystem einzuspritzen und damit den Finanzkrisen entgegenzutreten. Sie war fähig, die Krise zu begleiten, aber zum Preis einer Überladung des kapitalistischen Systems mit Schuldenbergen. Der Niedergang war gradueller als in den Dreißiger Jahren; aber die Linderungsmittel wirken je länger je weniger, und das finanzielle System wird immer zerbrechlicher.
Das phänomenale Anwachsen der Schulden in der weltweiten Wirtschaft während des letzten Jahrzehnts wird auf dem Kreditmarkt durch das außergewöhnliche Wachstum der heute berühmt berüchtigten Hedge Funds veranschaulicht. Das geschätzte Kapital dieser Fonds ist von 491 Milliarden Dollar im Jahre 2000 auf 1745 Milliarden im 2007 angeschwollen[5]. Ihre komplizierten Finanztransaktionen, die mehrheitlich geheim und nicht reglementiert ablaufen, benutzen Schulden als eine handelbare Sicherheit auf der Jagd nach dem kurzfristigen Gewinn. Hedge Funds werden als dafür verantwortlich erachtet, dass sich faule Schulden im ganzen Finanzsystem verbreitet haben, womit sich die derzeitige Finanzkrise beschleunigt und ausgedehnt hat.
Der Keynesianismus, das System der Finanzierung mittels staatlicher Defizite mit dem Zweck, die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten, hat sich mit der galoppierenden Inflation der Siebziger Jahre und der Rezessionen von 1975 und 1981 in Luft aufgelöst. Die Reaganomics und der Thatcherismus - Methoden, mit denen die Profite durch Reduzierung des sozialen Lohns sowie Senkung der Steuern erhöht und die nicht rentablen Unternehmen dem Konkurs überlassen wurden, was eine Massenarbeitslosigkeit verursachte - sind seit dem Börsenkrach von 1987, dem Skandal um Savings and Loans (Kreditgesellschaft für den Sozialwohnungsbau) und der Rezession von 1991 passé. Den asiatischen Drachen ging im Jahre 1997 die Luft aus, und sie hinterließen gewaltige Schulden. Die Internet-Revolution, die „New Economy", hat sich als nicht nachhaltig erwiesen, und der Aktienboom erlitt im Jahre 1999 ebenfalls Schiffbruch. Der Immobilienboom, das gewaltige Aufblähen des Konsumkredites in den letzten fünf Jahren, die gigantische Auslandverschuldung der Vereinigten Staaten zur Herstellung einer Nachfrage für die weltweite Wirtschaft und die „wunderbare" Expansion der chinesischen Wirtschaft - all das wird auch in Frage gestellt.
Man kann nicht genau vorhersagen, wie die Weltwirtschaft ihren Niedergang fortsetzen wird, doch unausweichlich wird es zu immer größeren Störungen und einer immer härteren Sparpolitik kommen.
Der Kapitalismus hat die Vorbedingungen für den Sozialismus geschaffen
Im Dritten Band des Kapital argumentiert Karl Marx, dass das durch den Kapitalismus entwickelte Kreditsystem in embryonaler Form eine neue Produktionsweise innerhalb der alten hervorgebracht hat. Indem der Reichtum ausgeweitet und vergesellschaftet, aus den Händen der individuellen Mitglieder der Bourgeoisie genommen wurde, bereitete der Kapitalismus den Weg für eine Gesellschaft, in der die Produktion zentralisiert und von den Produzenten selbst kontrolliert und wo das bürgerliche Eigentum als ein historischer Anachronismus abgeschafft werden könnte: „Das Kreditwesen beschleunigt daher die materielle Entwicklung der Produktivkräfte und die Herstellung des Weltmarkts, die als materielle Grundlagen der neuen Produktionsform bis auf einen gewissen Höhegrad herzustellen, die historische Aufgabe der kapitalistischen Produktionsweise ist. Gleichzeitig beschleunigt der Kredit die gewaltsamen Ausbrüche dieses Widerspruchs, die Krisen, und damit die Elemente der Auflösung der alten Produktionsweise."[6]
Seit nunmehr einem Jahrhundert sind die Voraussetzungen reif für die Abschaffung der bürgerlichen Herrschaft und der kapitalistischen Ausbeutung. Da es bis jetzt keine radikale Antwort des Proletariats gibt, die dazu führen könnte, den Kapitalismus weltweit zu überwinden, spitzen sich die Widersprüche dieses kranken Systems, insbesondere die Wirtschaftskrise, immer mehr zu. Wenn heute der Kredit immer noch eine Rolle bei der Entwicklung dieser Widersprüche spielt, so geht es dabei nicht mehr um die Eroberung des Weltmarktes, denn der Kapitalismus hat schon seit langem die Herrschaft seiner Produktionsverhältnisse auf den ganzen Planeten ausgedehnt. Die massive Verschuldung aller Staaten hat es aber dem Kapitalismus tatsächlich erlaubt, einen brutalen Absturz der Wirtschaft zu vermeiden, was aber nicht umsonst geschah. So war die verrückte Flucht nach vorn in den allgemeinen und massiven Einsatz des Kredits anfänglich während Jahrzehnten ein Faktor der Abdämpfung des unüberbrückbaren Widerspruchs zwischen der Entwicklung der Produktivkräfte und den hinfällig gewordenen kapitalistischen Produktionsverhältnissen, doch werden „die gewaltsamen Ausbrüche dieses Widerspruchs" brutal beschleunigt, so dass das gesellschaftliche Gebilde wie noch nie erschüttert wird. Doch werden solche Erschütterungen allein noch keine Bedrohung für die Spaltung der Gesellschaft in Klassen darstellen. Sie werden es erst, sobald sie dazu beitragen, das Proletariat in Bewegung zu setzen.
Die Revolutionäre haben immer hervorgehoben, dass die Krise den Prozess der Bewusstwerdung darüber, in welcher Sackgasse die derzeitige Welt steckt, beschleunigen wird. Sie wird langfristig immer mehr Teile der Arbeiterklasse in Kämpfe stoßen, die es ihr erlauben, Erfahrungen zu sammeln. Die Herausforderung dieser künftigen Erfahrungen ist die Fähigkeit der Arbeiterklasse, sich gegenüber allen Kräften der Bourgeoisie zu verteidigen und zu behaupten, Vertrauen in ihre eigenen Kräfte zu gewinnen und sich je länger je mehr das Bewusstsein anzueignen, dass sie die einzige Kraft der Gesellschaft darstellt, die fähig ist, den Kapitalismus zu beseitigen.
Como, 29/10/2007
[1] In der britischen Wirtschaftszeitschrift The Economist wurde diese Garantie als ein Bluff betitelt.
[2] „Und es gibt keine Weisheiten von ‚Globalisierungsgegnern‘ und anderen Gegnern der ‚Verfinanzung‘ der Wirtschaft, die daran auch nur das Geringste ändern könnten. Diese politischen Strömungen möchten einen ‚sauberen‘, ‚gerechten‘ Kapitalismus, der insbesondere die Spekulation unterbindet. In Tat und Wahrheit ist Letztere keineswegs Auswuchs eines ‚schlechten‘ Kapitalismus, der seine Verantwortung dafür ‚vergessen‘ habe, in wirklich produktive Sektoren zu investieren. Wie Marx schon im 19. Jahrhundert festgestellt hat, ist die Spekulation eine Folge der Tatsache, dass die Kapitalbesitzer angesichts des Mangels an zahlungskräftigen Absatzmärkten für ihre produktiven Investitionen es vorziehen, ihr Kapital zwecks Gewinnmaximierung kurzfristig in eine gigantische Lotterie zu stecken, eine Lotterie, die heute den Kapitalismus in ein weltumspannendes Kasino verwandelt hat. Der Wunsch, dass der Kapitalismus heutzutage auf die Spekulation verzichtet, ist so realistisch wie der Wunsch, dass aus Tigern Vegetarier werden." (Resolution zur internationalen Lage, 17. Kongress der IKS, siehe in dieser Nummer)
[3] Benjamin Bernanke, der Präsident der FED sprach von Hypothekarschuldnern als „Delinquenten". Mit anderen Worten: „Kriminelle gegen den Reichtum". Die „Kriminellen" wurden gebüßt - durch die Erhöhung der Zinsen!
[4] Wir können hier nicht auf die Frage der Obdachlosigkeit auf der Welt eingehen. Laut der UNO-Kommission für Menschenrechte leben 1 Milliarde Menschen ohne angemessene und 100 Millionen ganz ohne Unterkunft.
[5] www.mcclatchydc.com [324]
[6] 27. Kapitel, Die Rolle des Kredits in der kapitalistischen Produktion.
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Interne Debatte der IKS: Marxismus und Ethik (Teil II)
- 5919 Aufrufe
„Wir haben stets darauf bestanden, dass die Statuten nicht eine Kollektion von Regeln sind, die festlegen, was erlaubt ist und was nicht, sondern eine Orientierung für unser Verhalten und unsere Haltung, die eine in sich zusammenhängende Sammlung von moralischen Werten (besonders bezüglich des Verhältnisses unter den Mitgliedern und gegenüber der Organisation) zusammenfasst. Daher verlangen wir von jedem, der Mitglied der Organisation werden will, eine tiefgehende Übereinstimmung mit diesen Werten.
Doch die Statuten als integraler Bestandteil unserer Plattform regeln nicht allein, wer unter welchen Umständen Mitglied der IKS werden kann. Sie bedingen auch den Rahmen und den Geist des militanten Lebens der Organisation und jedes ihrer Mitglieder.
Die Bedeutung, die die IKS stets diesen Verhaltensprinzipien zugemessen hat, wird von der Tatsache veranschaulicht, dass sie nie zögerte, diese Prinzipien zu verteidigen, selbst wenn sie dabei eine Organisationskrise riskierte. Indem sie so verfährt, stellt sich die IKS bewusst und unerschütterlich in die Tradition des Kampfes von Marx und Engels in der Ersten Internationale, des Bolschewismus und der Italienischen Fraktion des Kommunistischen Linken. Indem sie so verfuhr, war sie in der Lage gewesen, eine Reihe von Krisen zu überstehen und fundamentale Verhaltensprinzipien der Klasse aufrechtzuerhalten.
Jedoch wurde das Konzept der proletarischen Moral mehr implizit denn explizit hochgehalten, wurde es eher in empirischer Manier als theoretisch verallgemeinert in die Praxis umgesetzt. Angesichts massiver Vorbehalte der neuen Generation von Revolutionären nach 1968 gegenüber jeglichen Moralkonzepten, welche im Allgemeinen als notwendigerweise reaktionär betrachtet wurden, hielt es die Organisation für wichtiger, die Verhaltensweisen der Arbeiterklasse zu berücksichtigen, statt diese sehr allgemeine Debatte zu einer Zeit zu eröffnen, die noch nicht reif genug dafür war.
Fragen der Moral waren nicht das einzige Gebiet, wo die IKS auf diese Weise verfuhr. In den frühen Tagen der Organisation existierten ähnliche Vorbehalte gegenüber der Notwendigkeit der Zentralisierung oder der Intervention der Revolutionäre, der führenden Rolle der Organisation bei der Entwicklung von Klassenbewusstsein, der Notwendigkeit des Kampfes gegen den Demokratismus oder der Anerkennung der Aktualität der Auseinandersetzung mit dem Opportunismus und Zentrismus."
Dieser erste Artikel mit Auszügen des Textes behandelte folgende Themen:
- das Problem des Zerfalls und des Vertrauensverlustes im Proletariat und in der Menschheit insgesamt;
- die Ursachen für die Vorbehalte unter den Revolutionären gegenüber dem Konzept der proletarischen Moral nach 1968;
- die Natur der Moral;
- die Ethik, das heißt, die vor-marxistische Theorie der Moralität;
- der Marxismus und die Ursprünge der Moral;
- der Kampf des Proletariats gegen die bürgerliche Moral;
- die proletarische Moral.
In dieser Ausgabe werden wir mit der Veröffentlichung von Auszügen fortfahren und an den Kampf erinnern, der vom Marxismus gegen verschiedene Formen und Manifestationen der bürgerlichen Moral geführt wurde. Ferner werden wir auf die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung des Proletariats mit den Auswirkungen des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft besonders auf seine Perspektive hinweisen, nämlich die Wiederaneignung eines sehr wesentlichen Elements seines Kampfes und seiner historischen Perspektive - die Solidarität.
Der marxistische Kampf gegen den ethischen Idealismus
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts behauptete die Bernsteinsche Strömung in der Zweiten Internationale, dass der Anspruch des Marxismus, eine wissenschaftliche Vorgehensweise zu sein, die Rolle der Ethik im Klassenkampf ausschließe. Davon ausgehend, dass sich wissenschaftliche und ethische Vorgehensweise gegenseitig negieren, befürwortete diese Strömung den Verzicht auf Erstere zugunsten Letzterer. Sie schlug die „Vervollständigung" des Marxismus durch die Ethik von Kant vor. Hinter ihrer Praxis, die Gier des einzelnen Kapitalisten zu verdammen, steckte die Entschlossenheit des bürgerlichen Reformismus, die fundamentale Unvereinbarkeit von Kapitalismus und Kommunismus zu begraben.Doch weit entfernt davon, die Ethik auszuschließen, führte die wissenschaftliche Vorgehensweise des Marxismus erstmals eine wirklich wissenschaftliche Dimension im gesellschaftlichen Denken und damit in die Moral ein. Der Marxismus entwirrte das Puzzle der Geschichte, weil er verstand, dass das wichtigste gesellschaftliche Verhältnis das zwischen der lebendigen Arbeitskraft und den toten Produktionsmitteln ist. Der Kapitalismus öffnete den Weg zu dieser Erkenntnis, so wie er den Weg zum Kommunismus ebnete, indem er die Ausbeutungsmechanismen entpersonalisierte.
In Wahrheit stellte der Ruf nach einer Rückkehr zur Ethik von Kant einen theoretischen Rückfall weit hinter den bürgerlichen Materialismus dar, der bereits die sozialen Ursprünge von „gut und böse" begriffen hatte. Seither hat jeder Fortschritt im gesellschaftlichen Wissen dieses Verständnis bekräftigt und vertieft. Dies trifft nicht nur auf den Fortschritt in der Wissenschaft zu, wie im Falle der Psychoanalyse, sondern auch auf die Künste. Wie Rosa Luxemburg schrieb: „Wie für Hamlet durch das Verbrechen seiner Mutter alle Bande der Menschheit aufgelöst, die Welt aus den Fugen ist, so für Dostojewski angesichts der Tatsache, dass ein Mensch einen Menschen ermorden kann. Er findet keine Ruhe, er fühlt die Verantwortung, die auf ihm wie auf jeden von uns für dies Entsetzliche lastet. Er muss sich die Psyche des Mörders klarmachen, seinen Leiden, seinen Qualen bis in die verborgenste Falte seines Herzens nachspüren. Er hat diese Foltern alle durchkostet und ist geblendet durch die furchtbare Erkenntnis: Der Mörder ist selbst das unglücklichste Opfer der Gesellschaft (...) Die Romane Dostojewskis sind die furchtbarste Anklage gegen die bürgerliche Gesellschaft, der er ins Gesicht schleudert: Der wahre Mörder, der Mörder der Menschenseelen bist du!"[1]
Diesen Standpunkt vertrat auch die junge proletarische Diktatur in Russland. Sie rief die Strafgerichte dazu auf, „vollkommen frei (zu sein) vom Geist der Revanche. Sie können nicht Rache an Leuten nehmen, nur weil sie in der bürgerlichen Gesellschaft gelebt haben."[2]
Nicht zuletzt dieses Verständnis, dass wir alle Opfer unserer Umstände sind, macht die marxistische Ethik zum fortgeschrittensten Ausdruck des moralischen Fortschritts bis heute. Diese Vorgehensweise schafft nicht die Moral ab, wie die Bourgeoisie behauptet, oder beseitigt die individuelle Verantwortung, wie es der kleinbürgerliche Individualismus gerne hätte. Stattdessen stellt sie einen gewaltigen Fortschritt darin dar, die Moral auf Verständnis statt auf Schuld - jenes Schuldgefühl, das den moralischen Fortschritt behindert, indem es die innere Persönlichkeit vom Mitmenschen abschneidet - zu stützen. Sie ersetzt den Hass von Menschen - diese Hauptquelle von anti-sozialen Trieben - durch die Empörung und die Revolte gegen gesellschaftliche Verhältnisse und Verhaltensweisen.
Die reformistische Kant-Nostalgie war in Wirklichkeit der Ausdruck einer Erosion des Kampfwillens. Die idealistische Interpretation der Moral versöhnte sich auf emotionaler Ebene mit der herrschenden Klasse, indem sie die Rolle der Moral bei der Umwandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse leugnete. Doch das höchste Ideal der Menschheit, der innere Frieden und Einklang mit der umgebenden gesellschaftlichen und natürlichen Welt, kann nur durch einen beständigen Kampf erreicht werden. Die erste Bedingung des menschlichen Glücks ist die Kenntnis darüber, was notwendig ist, ist das freiwillige Dienen für eine große Sache.
Kant verstand den widersprüchlichen Charakter der bürgerlichen Moral weitaus besser als die bürgerlichen Utilitaristen wie Bentham.[3] Insbesondere begriff er, dass ungezügelter Individualismus selbst in der positiven Form des Strebens nach persönlichem Glück zur Auflösung der Gesellschaft führen kann. Die Tatsache, dass es innerhalb des Kapitalismus nicht nur Gewinner im Konkurrenzkampf geben kann, bewirkt unvermeidlich die Trennung zwischen Pflicht und Neigung. Kants Beharren auf den Vorrang der Pflicht korrespondiert mit der Auffassung, dass das höchste Gut der bürgerlichen Gesellschaft nicht das Individuum, sondern der Staat und besonders die Nation ist. In der bürgerlichen Moralität besitzt der Patriotismus einen viel höheren Stellenwert als die Menschenliebe. In der Tat lauerte hinter dem Mangel an Empörung innerhalb der Arbeiterbewegung über den Reformismus bereits die Erosion des proletarischen Internationalismus.
Für Kant ist eine moralische Handlung, die vom Pflichtgefühl motiviert wird, von größerem ethischem Wert als jene, die mit Begeisterung, Leidenschaft und Freude ausgeübt wird. Hier ist der ethische Wert mit dem Verzicht, mit der Idealisierung der Selbstaufopferung durch die nationalistische und staatliche Ideologie aufs Engste verknüpft. Das Proletariat lehnt diesen unmenschlichen Opferkult um seiner selbst willen, den die Bourgeoisie von der Religion geerbt hat, rigoros ab. Auch wenn der Kampfwille notgedrungen die Leidensbereitschaft mit einschließt, hat die Arbeiterbewegung niemals aus solch einem notwendigen Übel eine moralische Qualität gemacht. Tatsächlich haben schon vor dem Marxismus die besten Beiträge zur Ethik stets die pathologischen und unmoralischen Konsequenzen solch einer Vorgehensweise unterstrichen. Denn im Gegensatz zu dem, was die bürgerliche Ethik glaubt, heiligt die Selbstaufopferung nicht jedes unwerte Ziel.
Wie Franz Mehring betonte, repräsentierte selbst Schopenhauer, der seine Ethik auf das Mitgefühl statt auf die Pflicht stützte, im Verhältnis zu Kant einen Fortschritt.[4]
Die bürgerliche Moral, unfähig, sich die Überwindung des Gegensatzes zwischen Individuum und Gesellschaft, zwischen Egoismus und Altruismus auch nur vorzustellen, bezieht Stellung zugunsten des einen gegen den anderen oder sucht nach einem Kompromiss zwischen beiden. Sie ist nicht in der Lage zu begreifen, dass das Individuum selbst einen sozialen Charakter besitzt. Entgegen der idealistischen Moral vertritt der Marxismus den moralischen Idealismus der Freuden spendenden Aktivität als einen der wichtigsten Aktivposten in der Erhebung gegen die niedergehende Klasse.
Eine andere Attraktion der Kantschen Ethik bestand für den Opportunismus darin, dass ihre Formulierung des „kategorischen Imperativs" eine Art Kodex in Aussicht stellte, mit dem sämtliche moralischen Konflikte automatisch gelöst werden können. Nach Kant ist die Gewissheit, dass man im Recht ist, ein Merkmal der moralischen Handlungsweise (...) Auch hier drückt sich der Wille aus, den Kampf zu umgehen.
Der dialektische Charakter der Moral, der die Tugend und Untugend im konkreten Leben nicht immer leicht unterscheidbar macht, wird verleugnet. Wie Josef Dietzgen betonte, kann die Vernunft den Verlauf einer Handlung nicht im Voraus bestimmen, da jedes Individuum und jede Situation einmalig und unvorhersehbar sind. Es müssen komplexe moralische Probleme studiert werden, um zu einem Verständnis und zu einer kreativen Lösung zu gelangen. Dies kann gelegentlich eine besondere Untersuchung oder die Etablierung eines spezifischen Organs erforderlich machen, wie die Arbeiterbewegung lange Zeit verstanden hat.[5]
In Wahrheit sind moralische Konflikte ein unvermeidlicher Bestandteil des Lebens - nicht nur innerhalb der Klassengesellschaft. Beispielsweise können verschiedene ethische Prinzipien (...) oder verschiedene Ebenen der Sozialisation des Menschen (die Verantwortung gegenüber der Klasse, der Familie, dem persönlichen Gleichgewicht, etc.) miteinander in Konflikt treten. Dies erfordert die Bereitschaft, mit der momentanen Ungewissheit zu leben, um eine wirkliche Prüfung zu erlauben und der Versuchung zu widerstehen, das eigene Gewissen zum Schweigen zu bringen; es erfordert die Fähigkeit, seine eigenen Vorurteile zu hinterfragen, vor allem aber eine rigorose, kollektive Methode der Klärung.
Im Kampf gegen den Neo-Kantianismus zeigte Kautsky, wie der Beitrag Darwins über den biologischen, animalischen Ursprung des Gewissens das stärkste Bollwerk der idealistischen Moral zerschlug. Diese unsichtbare Kraft, diese kaum hörbare Stimme, die nur in den Tiefen der Persönlichkeit vernehmbar ist, war stets der Kern der ethischen Kontroverse gewesen. Die idealistische Moral war im Recht, wenn sie darauf bestand, dass das Gewissen nicht durch die Angst vor der öffentlichen Meinung oder vor Sanktionen durch die Mehrheit erklärt werden kann. Im Gegenteil, das Gewissen kann uns zwingen, uns der öffentlichen Meinung und Repression zu widersetzen oder unser Handeln zu bedauern, obwohl es auf allgemeine Zustimmung stößt. „Daher seine geheimnisvolle Natur, diese Stimme in uns, die mit keinem äusserlichen Anstoss, keinem sichtbaren Interesse zusammenhängt; dieser Dämon oder Gott, den seit Sokrates und Plato bis Kant jene Ethiker in sich empfanden, die es ablehnten, die Ethik aus der Selbstliebe oder der Luft abzuleiten. Sicher ein geheimnisvoller Drang, aber nicht geheimnisvoller als die Geschlechtsliebe, die Mutterlieb, der Selbsterhaltungstrieb, das Wesen des Organismus überhaupt und so viele andere Dingen, die nur der Welt der ´Erscheinungen´ angehören und die niemand als Produkt einer übersinnlichen Welt ansehen wird. Weil das Sittengesetz ein tierischer Trieb ist, der den Trieben der Selbsterhaltung und Fortpflanzung ebenbürtig, deshalb seine Kraft, deshalb sein Drängen, dem wir ohne zu überlegen gehorchen, deshalb unsere rasche Entscheidung in einzelnen Fällen...".[6]
Diese Schlussfolgerungen sind seitdem von der Wissenschaft bestätigt worden, zum Beispiel durch Freud, der darauf bestand, dass die entwickeltsten und sozialisiertesten Tiere grundsätzlich einen ähnlichen psychischen Apparat wie der Mensch besitzen und an vergleichbaren Neurosen leiden. Doch Freud hat nicht nur unser Verständnis in diesen Fragen vertieft. Wegen der Vorgehensweise der Psychoanalyse, die nicht nur untersucht, sondern auch eingreift, therapiert, teilt sie mit dem Marxismus das Anliegen einer fortschreitenden Entwicklung des moralischen Apparates des Menschen.
Freud unterschied zwischen den Trieben („Es"), dem „Ego", das ihn die Umwelt kennen lernen lässt und die Existenz sichert (eine Art Realitätsprinzip), und dem „Über-Ich", das das Gewissen enthält und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft gewährt. Obwohl Freud manchmal polemisch behauptete, das das Gewissen „nichts anderes als gesellschaftliche Furcht" sei, macht seine ganze Auffassung, wie Kinder die Moral der Gesellschaft verinnerlichen, deutlich, dass dieser Prozess von der emotionalen Liebe zu den Eltern und deren Akzeptanz als nachahmenswerte Beispiele abhängt.[7] (...)
Freud untersuchte auch die Interaktion zwischen bewussten und unbewussten Faktoren des Gewissens selbst. Das Über-Ich entwickelt die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Das Ego kann und muss seinerseits in der Lage sein, über die Reflexionen des Über-Ichs nachzudenken. Erst durch diese „Doppelreflexion" wird der Verlauf einer Handlung zu einem bewussten Akt des Menschen.
Dies entspricht der marxistischen Sichtweise, dass der moralische Apparat des Menschen auf sozialen Triebkräften beruht, dass er aus unbewussten, halbbewussten und bewussten Komponenten besteht, dass mit dem Fortschreiten der Menschheit die Rolle der bewussten Faktoren wächst, bis mit dem revolutionären Proletariat die Ethik, auf einer wissenschaftlichen Methode basierend, immer mehr zur Richtschnur des moralischen Verhaltens wird, und dass im Gewissen selbst der moralische Fortschritt untrennbar mit der Stärkung des Bewusstseins zu Lasten der Schuldgefühle verknüpft ist.[8] Der Mensch kann in wachsendem Maße Verantwortung übernehmen, und dass nicht nur gegenüber seinem Gewissen, sondern auch hinsichtlich der Inhalte seiner eigenen moralischen Werte und Überzeugungen.
Der marxistische Kampf gegen den ethischen Utilitarismus
Trotz seiner Schwächen repräsentierte der bürgerliche Materialismus, besonders in seiner utilitaristischen Form - mit dem Konzept, dass die Moral Ausdruck realer, objektiver Interessen ist - , einen enormen Fortschritt in der ethischen Theorie. Er ebnete den Weg für ein historisches Verständnis der moralischen Entwicklung. Indem er den relativen Übergangscharakter aller moralischen Systeme enthüllte, versetzte er der religiösen und idealistischen Vision eines ewigen, unveränderlichen, vermeintlich Gott gegebenen Kodex‘ einen schweren Schlag.
Wie wir gesehen haben, zog die Arbeiterklasse bereits sehr früh ihre eigenen, sozialistischen Schlüsse aus dieser Vorgehensweise. Obgleich frühe sozialistische Theoretiker wie Robert Owen oder William Thompson weit über die Philosophie eines Jeremy Bentham - den sie als Ausgangspunkt benutzten - hinausgingen, übte die utilitaristische Vorgehensweise selbst nach dem Erscheinen des Marxismus einen starken Einfluss innerhalb der Arbeiterbewegung aus. Die Frühsozialisten revolutionierten Benthams Theorie, indem sie seine Hauptvoraussetzungen auf gesellschaftliche Klassen statt auf Individuen anwandten und so den Weg zum Verständnis des gesellschaftlichen Klassencharakters der Geschichte der Moral öffneten. Und die Erkenntnis, dass Sklavenhalter nicht denselben Wertekatalog haben wie Kaufleute oder dass Wüstennomaden dieselbe Moral haben wie Bergschäfer, ist bereits nachdrücklich von der im Kielwasser der kolonialen Expansion entstandenen Anthropologie bestätigt worden. Der Marxismus hat von diesen vorbereitenden Arbeiten profitiert, so wie er auch von den Studien Morgans oder Maurers, die die „Genealogie der Moral" ins Licht gerückt haben, profitiert hat.[9] Doch trotz des Fortschritts, den er verkörperte, ließ dieser Utilitarismus auch in seiner proletarischen Form eine Reihe von Fragen ungelöst.
Erstens: Wenn die Moral nichts anderes ist als die Kodifizierung der materiellen Interessen, wird die Moral selbst überflüssig und verschwindet als gesellschaftlicher Faktor. Der britische Radikalmaterialist Mandeville hatte bereits in diesem Zusammenhang behauptet, dass die Moral nichts als Heuchelei sei, die dazu diene, die eigentlich Interessen der herrschenden Klassen zu verbergen. Später sollte Nietzsche etwas unterschiedliche Schlussfolgerungen aus derselben Prämisse ziehen: dass die Moral das Mittel der schwachen Masse sei, um die Herrschaft der Eliten zu verhindern, so dass die Befreiung Letzterer das Eingeständnis erfordere, dass für sie alles erlaubt sei. Doch wie Mehring betonte, ist die angebliche Abschaffung der Moral in Nietzsches „Jenseits von Gut und Böse" nichts anderes als die Etablierung einer neuen Moral - eine Moral des reaktionären Kapitalismus in seinem Hass auf das sozialistische Proletariat, eine Moral, die sich von den Fesseln des kleinbürgerlichen Anstandes und der großbürgerlichen Respektabilität befreit.[10] Insbesondere beinhaltet die Identität von Interesse und Moral, dass, wie die Jesuiten bereits behauptet hatten, der Zweck die Mittel heiligt.[11]
Zweitens: Indem die gesellschaftlichen Klassen als „kollektive Individuelle" postuliert werden, die lediglich ihre eigenen Interessen verfolgen, erscheint die Geschichte als bedeutungsloses Hauen und Stechen, als eine Angelegenheit, die vielleicht für die verwickelten Klassen wichtig ist, aber nicht für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. Diese Sichtweise stellt einen Rückschritt gegenüber Hegel dar, der (wenn auch in einer mystifizierten Form) nicht nur die Relativität aller Moral bereits verstanden hatte, sondern auch den progressiven Charakter emporstrebender ethischer Systeme, die gegen die bestehende Moral verstießen. (In diesem Sinn erklärte Hegel: „Man kann der Meinung sein etwas Grossartiges zu sagen wenn man behauptet: Der Mensch ist von Natur aus gut. Doch man vergisst, dass man etwas viel Grösseres sagt mit der Aussage: Der Mensch ist von Natur aus schlecht."[12]
Drittens: Die utilitaristische Herangehensweise führt zu einem sterilen Rationalismus, der die sozialen Gefühle aus dem ethischen Leben tilgt.
Die negativen Konsequenzen dieser bürgerlichen, utilitaristischen Überbleibsel wurden in dem Moment sichtbar, als mit der Ersten Internationale die Arbeiterbewegung begann, die Sektenphase zu überwinden. Die Untersuchung des Komplotts der Allianz gegen die Internationale - insbesondere die Kommentare von Marx und Engels über Bakunins „Revolutionskatechismus" - enthüllen, dass die „alleszerstörenden Anarchisten (...) die Anarchie in die Moral ein (führen), indem sie die Unsittlichkeit der Bourgeoisie aufs äußerste übertreiben". Der Bericht, der vom Haager Kongress 1872 in Auftrag gegeben wurde, zählt die einzelnen Elemente aus Bakunins Anschauung auf: Der Revolutionär hat keine persönlichen Interessen, Angelegenheiten, Gefühle oder Neigungen; er hat nicht nur mit der bürgerlichen Ordnung gebrochen, sondern auch mit der Moral und den Sitten der gesamten zivilisierten Welt; er sieht in allem, was den Triumph der Revolution fördert, eine Tugend und in allem, was sie behindert, eine Laster; er ist stets bereit, alles zu opfern, einschließlich seinen eigenen Willen und seine Persönlichkeit; er unterdrückt alle Gefühle der Freundschaft, Liebe oder Dankbarkeit; er zögert niemals, Menschen, falls nötig, zu liquidieren; er kennt keinen anderen Wertekanon als den Maßstab der Nützlichkeit.
Tief empört über dieses Vorgehen, nannten Marx und Engels dies die Moral der Gosse, des Lumpenproletariats. Genauso grotesk wie infam und autoritärer als der primitivste Kommunismus, wird die Revolution bei Bakunin „zu einer Reihe von erst einzelnen individuellen, dann Massenmorden; die einzige Verhaltensregel ist die gesteigerte Jesuitenmoral...".[13]
Wie wir wissen, hat die Arbeiterbewegung in ihrer Gesamtheit die Lehren aus dem Kampf gegen den Bakunismus nicht allzu tief assimiliert. In seinem „Historischen Materialismus" präsentierte Bucharin die ethischen Normen als bloßes Regelwerk. Die Taktik ersetzte die Moral. Noch konfuser war die Haltung von Lukacs gegenüber der Revolution. Nachdem er ursprünglich das Proletariat als die Verwirklichung des moralischen Idealismus von Kant und Fichte dargestellt hatte, wandte Lukacs sich dem Utilitarismus zu. In „Was bedeutet revolutionäres Handeln?" (1919) erklärte er: „Die Herrschaft der Gesamtheit über die Teile bedeutet (...) die entschlossene, zu allem bereite Selbstaufopferung (...) Derjenige ist ein Revolutionär (...), der zu allem bereit ist, wenn es um die Verwirklichung dieser Interessen geht."
Doch die Stärkung der utilitaristischen Moral nach 1917 in der UdSSR war vor allem eine Widerspiegelung der Bedürfnisse des Übergangsstaates. In seiner „Moral und Klassennormen" präsentierte Preobraschenski die revolutionäre Organisation als eine Art moderne Klosterordnung. Er wollte sogar den Geschlechtsverkehr den Prinzipien einer erbhygienischen Selektion unterordnen, und zwar in einer Welt, in welcher der Unterschied zwischen Individuum und Gesellschaft abgeschafft worden sei und Emotionen den Befunden der Naturwissenschaften unterworfen seien. Selbst Trotzki war nicht frei von diesem Einfluss, vertrat er doch in „Ihre Moral und unsere" faktisch den Standpunkt, dass der Zweck die Mittel heiligt.
Es ist sicherlich richtig, dass jede Gesellschaftsklasse dazu neigt, das „Gute" und „Sittliche" in ihrem Interesse zu interpretieren. Nichtsdestotrotz sind Interessen und Moral nicht identisch. Der Einfluss der Klassen auf gesellschaftliche Werte ist äußerst vielgestaltig und verkörpert die Stellung einer gegebenen Klasse im Produktionsprozess und im Klassenkampf, ihre Traditionen, Ziele und Zukunftserwartungen, ihren Anteil an der Kultur. All dies manifestiert sich in der Form der Lebensweise, der Emotionen, der Intuitionen und Bestrebungen.
Im Gegensatz zur utilitaristischen Vermengung von Interessen und Moral (oder „Pflicht", wie er hier formuliert) unterscheidet Dietzgen zwischen beiden. „Das Interesse ist mehr das konkrete, gegenwärtige, handgreifliche Heil; die Pflicht dagegen das erweiterte, auch auf die Zukunft bedachte, allgemeine Heil (...) verlangt die Pflicht dagegen, dass wir nicht nur einen Teil, auch das Ganze, nicht nur gegenwärtige, nächste, auch das entfernte, künftige, nicht nur das leibliche, auch das geistige Wohl im Auge halten. Die Pflicht kümmert sich auch um das Herz, um die sozialen Bedürfnisse, die Zukunft, das Seelenheil, kurz um die Interessen im Großen und Ganzen und schärft uns ein, dem Überflüssigen zu entsagen, um das Notwendige zu erlangen und zu erhalten."[14]
In Reaktion auf die idealistische Befürwortung einer unveränderlichen Moral geht der soziale Utilitarismus ins andere Extrem, indem er so einseitig auf ihren Übergangscharakter beharrt, dass er die Existenz gemeinsamer Werte, die die Gesellschaft zusammenhalten, und den ethischen Fortschritt aus den Augen verliert. Die Kontinuität des Gemeinschaftsgefühls ist jedoch keine metaphysische Fiktion.
Dieser „übertriebene Idealismus" sieht die einzelnen Klassen und ihren Kampf, aber „nicht den totalen gesellschaftlichen Prozess, die Verbindung zwischen den verschiedenen Episoden, versagt also darin, die unterschiedlichen Stufen der moralischen Entwicklung als Teile eines in Wechselbeziehungen stehenden Prozesses zu unterscheiden. Er besitzt keinen allgemeinen Standard, um die verschiedenen Regeln zu würdigen, ist unfähig, über die unmittelbaren und temporären Erscheinungen hinauszugehen. Er setzt die verschiedenen Erscheinungsformen nicht durch die Mittel des dialektischen Denkens zu einer Einheit zusammen."[15]
Bezüglich des Verhältnisses zwischen Zweck und Mittel lautet die korrekte Formulierung nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt, sondern dass der Zweck die Mittel beeinflusst und die Mittel ihrerseits den Zweck beeinflussen. Beide Seiten des Gegensatzes bestimmen sich wechselseitig und bedingen einander. Mehr noch, sowohl der Zweck als auch die Mittel sind Glieder in einer historischen Kette, wo jeder Zweck umgekehrt ein Mittel ist, um ein weiterreichendes Ziel anzustreben. Daher muss eine methodische und ethische Rigorosität Anwendung finden, die den ganzen Prozess erfasst; eine Methode, die sich auch auf die Vergangenheit und Zukunft und nicht nur auf das Unmittelbare bezieht. Mittel, die nicht einem gegebenen Zweck entsprechen, dienen lediglich dazu, ihn zu deformieren und von ihm abzulenken. Das Proletariat kann zum Beispiel die Bourgeoisie nicht besiegen, indem es ihre Waffen benutzt. Die Moral des Proletariats richtet sich sowohl nach der gesellschaftlichen Realität als auch nach sozialen Emotionen. Daher lehnt es sowohl das dogmatischen Ausschließen von Gewalt als auch das Konzept der moralischen Gleichgültigkeit gegenüber den angewandten Mitteln ab.
In seinem falschen Verständnis der Verknüpfung von Mittel und Zweck meint Preobraschenski auch, dass das Schicksal der einzelnen Teile - und insbesondere der Individuen - unwichtig sei und bedenkenlos dem Interesse des Ganzen geopfert werden könne. Dies war jedoch nicht die Haltung von Marx, der erkannte, dass die Pariser Kommune zu früh kam, und sich dennoch aus Solidarität mit ihr verbündete, und auch nicht die Haltung von Eugen Levine aus der noch jungen KPD, der der dahinscheidenden Münchener Räteregierung beitrat - deren Ausrufung sich die KPD noch widersetzt hatte - , um ihre Verteidigung zu organisieren und so die Zahl der proletarischen Opfer zu minimieren. Das einseitige Kriterium des Klassennutzens dagegen lässt faktisch Spielraum für eine sehr bedingte Klassensolidarität.
Wie Rosa Luxemburg in ihrer Polemik gegen Bernstein betonte, besteht der prinzipielle Widerspruch im Herzen der proletarischen Bewegung darin, dass der tägliche Kampf innerhalb des Kapitalismus stattfindet, während das Ziel außerhalb desselben liegt und einen fundamentalen Bruch mit jenem System darstellt. Infolgedessen ist der Gebrauch von Gewalt und Täuschung gegen den Klassenfeind notwendig und das Auftreten von Klassenhass und anti-sozialen Aggressionen kaum zu vermeiden. Doch das Proletariat ist moralisch nicht gleichgültig gegenüber solchen Manifestationen. Auch wenn es selbst Gewalt anwendet, darf es niemals vergessen, dass - wie Pannekoek sagte - sein Ziel darin besteht, die Köpfe aufzuklären, und nicht darin, sie zu zerschmettern. Und wie Bilan[16] aus den russischen Erfahrungen schloss, sollte, wo immer es geht, der Gebrauch von Gewalt gegen andere nicht-ausbeutende Schichten vermieden werden und muss gänzlich und prinzipiell aus den Reihen der Arbeiterklasse ausgeschlossen werden. Selbst unter den Begleitumständen des Bürgerkriegs gegen den Klassenfeind muss sie von der Notwendigkeit überzeugt sein, dem Aufkommen anti-sozialer Gefühle wie Rache, Grausamkeit, Zerstörungswut entgegenzuwirken, da diese zur Brutalisierung führen und das Bewusstsein trüben. Solche Gefühle signalisieren das Eindringen fremder Klasseneinflüsse. Es kam nicht von ungefähr, dass Lenin nach der Oktoberrevolution erkannte, dass die Hebung des kulturellen Bildungsgrades der Massen die - nach der Ausdehnung der Weltrevolution - höchste Priorität haben sollte. Wir sollten uns auch vergegenwärtigen, dass es die Erkenntnis von der Grausamkeit und moralischen Indifferenz Stalins war, die Lenin (in seinem Testament) befähigte, die von ihm ausgehende Gefahr zu erkennen.
Die Mittel, die vom Proletariat angewendet werden, müssen soweit wie möglich sowohl mit seinen Zielen als auch mit den sozialen Emotionen korrespondieren, die seinem Klassencharakter entsprechen. Es war nicht zuletzt im Namen dieser Gefühle, dass das Programm der KPD vom 14. Dezember 1918 zwar resolut die Notwendigkeit der Klassengewalt vertrat, aber gleichzeitig den Gebrauch von Terror ablehnte.
„Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors, sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft, weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschung sie blutig zu rächen hätte."[17]
Im Gegensatz dazu ist die Eliminierung der emotionalen Seite der Moral durch ein mechanistisches, utilitaristisches Vorgehen typisch bürgerlich. Gemäß diesem Vorgehen ist der Gebrauch von Lügen und Irreführungen moralisch höher zu bewerten, sofern diese der Erlangung eines gegebenen Zieles dienen. Doch die Lügen, die von den Bolschewiki in Umlauf gesetzt wurden, um die Repression von Kronstadt zu rechtfertigen, erodierten nicht nur das Vertrauen der Klasse in die Partei, sondern untergruben auch die Überzeugung der Bolschewiki selbst. Die Sichtweise, dass der Zweck die Mittel heiligt, leugnet praktisch die ethische Überlegenheit der proletarischen Revolution über die Bourgeoisie. Sie vergisst: Je mehr die Belange einer Klasse mit dem Wohl der gesamten Menschheit verknüpft sind, desto mehr kann diese Klasse auf ihre moralische Stärke bauen.
Das in der Welt des Business geläufige Motto, dass nur der Erfolg zählt, findet keine Anwendung auf die Arbeiterklasse. Das Proletariat ist die erste revolutionäre Klasse, deren endgültiger Sieg von einer Reihe von Niederlagen vorbereitet wird. Die unschätzbaren Lektionen, aber auch das moralische Beispiel der großen Revolutionäre und der großen Arbeiterkämpfe sind die Vorbedingungen für den künftigen Sieg.
Der Kampf gegen die Auswirkungen des kapitalistischen Zerfalls
In der gegenwärtigen historischen Periode ist die Bedeutung ethischer Fragen größer denn je. Die deutliche Tendenz zur Auflösung der soziale Bande und des Denkens in Zusammenhängen hat notgedrungen besonders negative Auswirkungen auf die Moral. Darüber hinaus ist die ethische Desorientierung innerhalb der Gesellschaft eine zentrale Komponente des Problems im Zentrum des Zerfalls der sozialen Bande. Die Blockade, die aus der Antwort der Bourgeoisie auf die Krise des Kapitalismus und der Antwort des Proletariats, zwischen Weltkrieg und Weltrevolution resultiert, ist direkt mit dem Bereich der gesellschaftlichen Ethik verknüpft. Die Überwindung der Konterrevolution durch eine neue und ungeschlagene Generation des Proletariats nach 1968 drückte nicht zuletzt die historische Diskreditierung des Nationalismus aus, vor allem in jenen Ländern, wo sich die stärksten Sektoren der Arbeiterklasse befanden. Doch andererseits sind die massiven Arbeiterkämpfe nach 1968 nicht von einer dementsprechenden Entwicklung der politischen und theoretischen Dimension des proletarischen Kampfes begleitet worden, insbesondere der ausdrücklichen und bewussten Bejahung des Prinzips des proletarischen Internationalismus. Als Folge ist keine der beiden Hauptklassen der zeitgenössischen Gesellschaft im Moment in der Lage, ihr eigenes Klassenideal einer sozialen Gemeinschaft durchzusetzen.
Im Allgemeinen ist die herrschende Moral in der Gesellschaft die Moral der herrschenden Klasse. Genau aus diesem Grunde muss jede dominante Moral, um den Interessen der herrschenden Klasse zu dienen, gleichzeitig Elemente von allgemeinem moralischen Interesse enthalten, die die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit zusammenhalten. Eines dieser Elemente ist die Entwicklung einer Perspektive oder eines Ideals der sozialen Gemeinschaft. Solch ein Ideal ist ein unerlässlicher Faktor bei der Zügelung anti-sozialer Triebkräfte.
Wie wir gesehen haben, ist der Nationalismus das spezifische Ideal der bürgerlichen Gesellschaft. Dies entspricht der Tatsache, dass der Nationalstaat die höchste Einheit ist, die der Kapitalismus erreichen kann. Als der Kapitalismus in seine dekadente Phase trat, hörte jedoch der Nationalstaat definitiv auf, ein Vehikel des Fortschritts in der Geschichte zu sein, und wurde faktisch zum Hauptinstrument der gesellschaftlichen Barbarei. Schon lange bevor dies eintrat, war der Totengräber des Kapitalismus, die Arbeiterklasse - eben weil sie die Trägerin eines höheren, internationalistischen Ideals ist - , in der Lage gewesen, den betrügerischen Charakter der nationalen Gemeinschaft bloßzustellen. Obgleich die Arbeiter 1914 zunächst diese Lehre vergessen hatten, sollte der Erste Weltkrieg letztendlich die Haupttendenz nicht nur in der bürgerlichen Moral, sondern in der Moral aller ausbeutenden Klassen enthüllen. Diese besteht in der Mobilisierung der mutigsten und selbstlosesten sozialen Instinkte der ausgebeuteten, arbeitenden Klassen zu Gunsten der engstirnigsten und schmutzigsten Anliegen.
Doch ungeachtet ihres betrügerischen und immer barbarischeren Charakters ist die Nation das einzige Ideal, welches die Bourgeoisie vorbringen kann, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Dieses Ideal allein entspricht der heutigen Realität der staatlichen Strukturen in der bürgerlichen Gesellschaft. Daher sind all die anderen Ideale, die heute vorhanden sind - die Familie, die Lokalität, die religiöse, kulturelle oder ethnische Gemeinschaft, die Lifestyle-Szene oder die Gang - im Allgemeinen Ausdrücke des sich auflösenden Gesellschaftslebens, der Verfaulung der Klassengesellschaft.
Aber dies trifft genauso auf jene moralischen Anliegen zu, die sich an die gesamte Gesellschaft zu richten versuchen, dies jedoch auf der Grundlage des Interklassismus, der Klassen übergreifenden Aktion tun: der Humanitarismus, die Ökologie, „eine andere Globalisierung". Indem sie die Verbesserung des Individuums auf der Basis einer erneuerten Gesellschaft postulieren, bilden sie demokratistische Ausdrücke derselben individualistischen Fragmentierung der Gesellschaft. Überflüssig zu sagen, dass diese Ideologien ganz hervorragend der herrschenden Klasse in ihrem Bemühen passen, die Entwicklung einer proletarischen, internationalistischen Klassenalternative zum Kapitalismus abzublocken.
Innerhalb der Gesellschaft des Zerfalls können wir gewisse Züge mit direkten Auswirkungen auf die gesellschaftlichen Werte identifizieren.
Erstens: Der Mangel an Perspektiven tendiert dazu, den Fokus des menschlichen Verhaltens auf die Gegenwart und die Vergangenheit zu richten. Wie wir gesehen haben, ist ein zentraler Bestandteil im rationalen Kern der Moral die Verteidigung der langfristigen Interessen gegen das Gewicht des Unmittelbaren. Die Abwesenheit einer langfristigen Perspektive begünstigt somit die Entsolidarisierung zwischen den Individuen und Gruppen der zeitgenössischen Gesellschaft, aber auch und besonders zwischen den Generationen. Sie mündet in der Neigung zur Pogrommentalität, d.h. zum zerstörerischen Hass gegen einen Sündenbock, der für das Verschwinden einer idealisierten, besseren Vergangenheit verantwortlich gemacht wird. Auf der Bühne der Weltpolitik können wir diese Tendenz in der Entwicklung des Antisemitismus, der antiwestlichen Haltung oder des Anti-Islamismus, in der Vervielfachung „ethnischer Säuberungen", im Aufstieg des politischen Populismus gegen Immigranten und in der Ghettomentalität unter den Immigranten selbst beobachten. Diese Mentalität neigt dazu, das gesellschaftliche Leben insgesamt zu durchdringen, wie die Entwicklung des Mobbings als allgemeines Phänomen veranschaulicht.
Zweitens: Die Entwicklung der gesellschaftlichen Ängste neigt zur Lähmung sowohl der sozialen Instinkte als auch des kohärenten Denkens - die grundlegenden Prinzipien der menschlichen Solidarität und vor allem der Klassensolidarität heute. Diese Ängste sind das Resultat der gesellschaftlichen Atomisierung, die jedem Individuum das Gefühl verleiht, es sei allein mit seinen Problemen. Diese Einsamkeit färbt auf die Art und Weise ab, wie der Rest der Gesellschaft gesehen wird und macht die Reaktion anderer menschlicher Wesen immer unkalkulierbarer, gefährlicher und feindlicher. Diese Ängste - die in allen irrationalen Denkrichtungen aufblühen, die sich der Vergangenheit und der Leere zuwenden - sollten daher von jenen Ängsten unterschieden werden, die aus der wachsenden gesellschaftlichen Unsicherheit resultieren, welche von der Wirtschaftskrise ausgelöst wurde, und die zu einem mächtigen Impuls für eine Gegenreaktion wie die Klassensolidarität werden können.
Drittens: Der Mangel an Perspektiven und die Auflösung der sozialen Bande machen für zahllose Menschen das Leben sinnentleert. Diese nihilistische Atmosphäre ist prinzipiell für die Gesellschaft unerträglich, da sie der bewussten und sozialen Essenz der Menschheit widerspricht. Sie führte somit zu einer Reihe von eng miteinander verknüpften Phänomenen, von denen die wichtigsten die Entwicklung einer neuen Religiosität und einer Todessehnsucht sind.
In Gesellschaften, die hauptsächlich auf Naturalwirtschaft beruhen, ist die Religion vor allem Ausdruck der Rückständigkeit, der Ignoranz und der Angst vor den Kräften der Natur. Im Kapitalismus nährt sich die Religion hauptsächlich aus der gesellschaftlichen Entfremdung - aus der Angst vor den gesellschaftlichen Kräften, die unerklärlich und unkontrollierbar geworden sind. In der Epoche des kapitalistischen Zerfalls ist es vor allen Dingen der allgegenwärtige Nihilismus, der religiöse Sehnsüchte antreibt. Während die traditionelle Religion, so reaktionär ihre Rolle zumeist gewesen ist, immer noch Bestandteil einer kommunitarischen Weltsicht war und die modernisierte Religion der Bourgeoisie die Adoption dieser traditionellen Weltsicht in die Perspektiven der kapitalistischen Gesellschaft darstellte, speist sich der Mystizismus des kapitalistischen Zerfalls aus dem Nihilismus. Ob in der Form der reinen Zersplitterung esoterischer Seelenwanderer, des berüchtigten „Sich-selbst-Findens" außerhalb jeglichen gesellschaftlichen Zusammenhangs oder in der Form der Festungsmentalität von Sekten und des religiösen Fundamentalismus, die die Auslöschung der Persönlichkeit und die Liquidierung der individuellen Verantwortung anbieten - all diese Tendenz sind, auch wenn sie behaupten, Antworten zu geben, in Wahrheit nichts anderes als extreme Ausdrücke dieses Nihilismus.
Darüber hinaus erwecken dieser Mangel an Perspektiven und die Auflösung der sozialen Bande den Anschein, als raube die biologische Tatsache des Todes dem individuellen Leben jegliche Bedeutung. Die daraus resultierende Morbidität (von der der Mystizismus heute zu einem beträchtlichen Umfang profitiert) drückt sowohl die unverhältnismäßig große Angst vor dem Tod als auch eine pathologische Sehnsucht nach ihm aus. Erstere konkretisiert sich zum Beispiel in der „hedonistischen" Mentalität der „Spaßgesellschaft" (deren Motto lauten könnte: „Esst, trinkt und seid fröhlich, denn morgen sterben wir"); Letztere endet mittels Kulten wie den Satanismus in Weltsekten und in der stetig wachsenden Verherrlichung der Gewalt, der Zerstörung und des Märtyrertums (wie im Falle der Selbstmordattentäter).
Der Marxismus hat sich als revolutionäre, materialistische Weltanschauung des Proletariats stets durch seine tiefe Zuwendung zur Welt und seine leidenschaftliche Bejahung des Wertes des menschlichen Lebens ausgezeichnet. Gleichzeitig hat sein dialektischer Standpunkt Leben und Tod, Sein und Nicht-Sein als Teil einer unzertrennlichen Einheit verstanden. Weder hat er den Tod ignoriert, noch hat er dessen Rolle im Leben überbewertet. Die Menschheit ist Teil der Natur. Als solches sind das blühende Leben, aber auch Krankheit, Siechtum und Tod genauso Bestandteile ihrer Existenz wie die aufgehende Sonne oder der Fall der Blätter im Herbst. Doch der Mensch ist ein Produkt nicht nur der Natur, sondern auch der Gesellschaft. Als Erbe der Errungenschaften der menschlichen Kultur und als Träger ihrer Zukunft ist das revolutionäre Proletariat selbst mit den gesellschaftlichen Quellen einer wirklichen Stärke verbunden, deren Wurzeln die Klarheit des Gedankens sowie Brüderlichkeit, Geduld und Humor, Freude und Zuneigung, die reale Sicherheit eines gut begründeten Vertrauens sind.
Die Solidarität und die Perspektive des Kommunismus heute
Für die Arbeiterklasse ist die Ethik nicht etwas Abstraktes, das außerhalb ihres Kampfes steht. Die Solidarität, das Fundament ihrer Klassenmoral, ist gleichzeitig die erste Vorbedingung ihrer Fähigkeit, sich selbst im Kampf als Klasse zu bestätigen.
Heute sieht sich das Proletariat der Aufgabe gegenüber, seine Klassenidentität zurückzuerobern, die nach 1989 einen Rückschlag erlitten hatte. Diese Aufgabe ist nicht zu trennen vom Kampf um die Wiederaneignung seiner Traditionen der Solidarität.
Die Solidarität ist nicht nur eine zentrale Komponente des Tageskampfes der Arbeiterklasse, sondern trägt auch den Keim der künftigen Gesellschaft in sich. Diese beiden Aspekte, die sich auf Vergangenheit und Zukunft beziehen, beeinflussen sich wechselseitig. Die Wiederentdeckung der Klassensolidarität in den Arbeiterkämpfen ist ein wesentlicher Aspekt der gegenwärtigen Dynamik des Klassenkampfes und öffnet den Weg zu einer neuen revolutionären Perspektive. Und solch eine Perspektive wird, wenn sie sich auftut, umgekehrt zu einem mächtigen Faktor bei der Wiederverstärkung der Solidarität in den unmittelbaren Kämpfen des Proletariats sein.
Diese Perspektive ist also entscheidend angesichts der Probleme, mit denen die Dekadenz und der Zerfall des Kapitalismus die Arbeiterklasse konfrontiert. Zum Beispiel die Frage der Immigration: Im emporstrebenden Kapitalismus war die Position der Arbeiterbewegung, insbesondere der Linken, gleichbedeutend mit der Verteidigung der offenen Grenzen und der Bewegungsfreiheit der Arbeit. Dies war Teil des Minimalprogramms der Arbeiterklasse. Heute ist die Wahl zwischen offenen und geschlossenen Grenzen eine falsche Alternative, da nur die Abschaffung aller Grenzen diese Frage lösen kann. Unter den Bedingungen des Zerfalls neigt das Thema der Migration dazu, die Klassensolidarität auszuhöhlen und die Arbeiter gar mit der Pogrommentalität zu infizieren. Angesichts dieser Situation ist die Perspektive einer weltweiten Gemeinschaft, die auf Solidarität fußt, der wirksamste Faktor bei der Verteidigung des proletarischen Internationalismus.
Unter der Voraussetzung, dass die Arbeiterklasse nach einer langen Periode wachsender Kämpfe und politischer Denkprozesse ihre Klassenidentität wiedererlangen kann, kann die Anerkennung der tatsächlichen Unterminierung der sozialen Emotionen, Beziehungen und Verhaltensweisen durch den heutigen Kapitalismus zu einem Faktor werden, der das Proletariat dazu drängt, seine eigenen Klassenwerte zu entwickeln und bewusst zu formulieren. Die Empörung der Arbeiterklasse über das Verhalten, das vom zerfallenden Kapitalismus provoziert wird, und das Bewusstsein darüber, dass allein der proletarische Kampf eine Alternative bilden kann, sind von zentraler Bedeutung für das Proletariat, um seine revolutionäre Perspektive neu zu bekräftigen.
Die revolutionäre Organisation hat eine unverzichtbare Rolle in diesem Prozess zu spielen, nicht nur durch die Propagierung dieser Klassenprinzipien, sondern auch und vor allem dadurch, dass sie selbst ein lebendiges Beispiel für ihre Praktizierung und Verteidigung gibt.
Abgesehen davon ist die Verteidigung der proletarischen Moral ein unverzichtbares Instrument im Kampf gegen den Opportunismus und somit bei der Verteidigung des Programms der Arbeiterklasse. Entschlossener denn je müssen sich die Revolutionäre durch einen kompromisslosen Kampf gegen fremdes Klassenverhalten in die Tradition des Marxismus stellen.
„Der Bolschewismus hat den Typ des wahren Revolutionärs geschaffen, der den historischen, mit der bestehenden Gesellschaft nicht zu versöhnenden Zielen die Bedingungen seines persönlichen Daseins, seine Ideen, seine sittlichen Kriterien unterwirft. Die nötige Distanz zur bürger-lichen Ideologie wurde in der Partei durch die wachsame Unver-söhnlichkeit, deren Inspirator Lenin war, aufrechterhalten. Er wurde nicht müde, mit der Lanzette zu arbeiten, um jene Bindun-gen zu zerschneiden, die die kleinbürgerliche Umgebung zwi-schen Partei und offizieller öffentlicher Meinung schuf. Gleich-zeitig lehrte Lenin die Partei, sich eine eigene öffentliche Meinung zu formen, die sich auf Gedanken und Gefühle der emporsteigen-den Klasse stützt. So schuf sich die bolschewistische Partei durch Auslese und Erziehung in ständigem Kampfe nicht nur ihr poli-tisches, sondern auch ihr moralisches, von der bürgerlichen öffent-lichen Meinung unabhängiges und dieser unversöhnlich entgegen-gesetztes Milieu. Nur dies allein hat den Bolschewiki ermöglicht, die Schwankungen in den eigenen Reihen zu überwinden und durch die Tat jene kühne Entschlossenheit zu entwickeln, ohne die der Oktobersieg nicht möglich gewesen wäre."[18]
[1] R. Luxemburg, Einleitung zu W. Korolenko - Die Geschichte meines Zeitgenossen, geschrieben im Strafgefängnis Breslau im Juli 1918.
[2] Bucharin und Preobraschenski, Das ABC des Kommunismus. Kommentare zum Programm des 8. Parteikongresses, 1919. Kapitel IX Proletarische Justiz, §74: Proletarische Strafmethoden.
[3] Jeremy Bentham (1748-1832) war ein britischer Philosoph, Jurist und Reformer. Er war ein Freund von Adam Smith und Jean-Baptiste Say, zwei der wichtigsten Ökonomen der Bourgeoisie zu einer Zeit, als Letztere noch eine revolutionäre Klasse war. Er beeinflusste „klassische" Philosophen wie John Stuart Mill, John Austin, Herbert Spencer, Henry Sidgwick und James Mill. Er unterstützte die Französische Revolution von 1789 und unterbreitete zahlreiche Vorschläge bezüglich der Etablierung der Rechtssprechung, der Judikative, von Gefängnissen, der politischen Organisationen des Staates und bezüglich der Kolonialpolitik („Emanzipiert eure Kolonien"). Die junge französische Republik ernannte ihn am 23. August 1792 zum Ehrenbürger. Sein Einfluss machte sich im Code civile (auch bekannt als „Code Napoleon", der noch heute die zivile Rechtssprechung in Frankreich beherrscht) bemerkbar. Der Gedanke von Bentham ging von folgendem Prinzip aus: Individuen können sich ihre Interessen nur im Verhältnis zu Strafe und Belohnung vorstellen. Sie versuchen, ihr Glück zu maximieren, was sich in einem Mehr an Belohnungen als an Strafe ausdrückt. Jedes Individuum muss gemäß einer hedonistischen Logik verfahren. Jede Handlung hat eine Zeitlang positive und negative Auswirkungen mit unterschiedlicher Intensität; also muss das Individuum jene Handlung begehen, die ihm die meiste Freude einbringt. Er gab dieser Doktrin 1781 den Namen Utilitarismus.
Bentham stellte eine Methode, „Die Kalkulation des Glücks und der Strafe", vor, die beabsichtigte, die Quantität an Freude und Strafe wissenschaftlich zu bestimmen, die durch unsere vielfältigen Handlungen geprägt sind. Es gibt sieben Kriterien:
- Dauer: eine lange und andauernde Freude ist nützlicher als eine vorübergehende Freude.
- Intensität: eine intensive Freude ist nützlicher als eine schwache Freude.
- Gewissheit: eine Freude ist nützlicher, wenn man sicher ist, dass sie wahr wird.
- Nähe: eine unmittelbare Freude ist nützlicher als eine Freude, die sich erst langfristig äußert.
- Ausdehnung: eine Freude, die mehrmals genossen wird, ist nützlicher als eine einzelne Freude.
- Fruchtbarkeit: eine Freude, die zu weiteren Freuden führt, ist nützlicher als eine einfache Freude.
- Reinheit: eine Freude, die nicht zu Leiden führt, ist nützlicher als eine Freude, die ein Risiko birgt.
- Theoretisch wird die moralischste Handlung jene sein, die die größte Zahl der Kriterien erfüllt.
[4] FranzMehring: Zurück zu Schopenhauer!, in: Neue Zeit, 1908/09.
[5] So hatten die meisten politischen Organisationen des Proletariats neben Organen der Zentralisierung, die sich mit den „laufenden Angelegenheiten" befassen, Organe wie die Kontrollkommission, die sich aus erfahrenen Mitgliedern zusammensetzten, welchen das größte Vertrauen entgegengebracht wurde und besonders mit heiklen Fragen beauftragt wurden, die sensible Aspekte des Verhaltens der Militanten innerhalb wie außerhalb der Organisation berührten.
[6] Karl Kautsky, Ethik und materialistische Geschichtsauffassung., Kapitel Die sozialen Triebe.
[7] Bestätigt von der Beobachtung von Anna Freud, dass aus dem KZ befreite Waisen, während sie eine Art von rudimentärer egalitärer Solidarität unter ihresgleichen etablierten, kulturelle und moralische Standards gegenüber der Gesamtgesellschaft nur akzeptierten, wenn sie in kleineren „Familien"-Einheiten gruppiert waren, die jeweils von einer erwachsenen Respektsperson geleitet wurden, denen gegenüber die Kinder Zuneigung und Bewunderung entwickeln konnten.
[8] Kautskys Buch über die Ethik ist die erste verständliche marxistische Studie dieser Frage und auch sein Hauptbeitrag zur sozialistischen Theorie. Jedoch überschätzt er die Bedeutung des Beitrags von Darwin. Als Folge davon unterschätzt er die spezifisch menschlichen Faktoren der Kultur und des Bewusstseins, indem er zu einer statischen Sichtweise neigt, in der unterschiedliche Gesellschaftsformationen eigentlich unveränderliche soziale Impulse mehr oder weniger begünstigen oder behindern.
[9] Siehe zum Beispiel Paul Lafargue, Vom Ursprung der Ideen, 1885, wieder veröffentlicht in: Neue Zeit, 1899/1900.
[10] Franz Mehring: Über die Philosophie des Kapitalismus, 1891. Wir sollten hinzufügen, dass Nietzsche der Theoretiker der deklassierten Abenteurer und ihres Verhaltens ist.
[11] Die Vorhut der Konterrevolution gegen den Protestantismus, die Jesuiten, zeichnete sich durch die Aneignung der Methoden der Bourgeoisie bei ihrer Verteidigung gegen die Feudalkirche aus. Sie drückte daher schon sehr früh die Niederträchtigkeit der bürgerlichen Moral aus, lange bevor die bürgerliche Klasse in ihrer Gesamtheit (die damals noch eine revolutionäre Rolle spielte) die hässlichsten Seiten ihrer Klassenherrschaft enthüllte. Siehe zum Beispiel F. Mehring, Deutsche Geschichte vom Ausgange des Mittelalters, 1910.
[12] Eine Bemerkung am Rande: Die vielleicht geeignetste Antwort auf die uralte Frage, ob die Menschheit gut oder böse ist, kann vielleicht gegeben werden, indem man aus Die heilige Familie von Marx und Engels zitiert, wo sie im Kapitel über Fleur de Marie aus dem Roman von Eugene Sue, Das Geheimnis von Paris schreiben: „Die Menschheit ist nicht gut oder böse, sie ist menschlich".
[13] Ein Komplott gegen die Internationale Arbeiterassoziation - Bericht über das Treiben Bakunins, 1873, Kapitel VIII: Die Allianz in Russland, MEW Bd. 18, S. 407.
[14] J. Dietzgen: Das Wesen der Kopfarbeit, 1869
[15] Henriette Roland-Holst: Communisme en moraal, 1925. Kapitel V Der ‚Sinn des Lebens‘ und die Aufgabe des Proletariats (eigene Übersetzung). Trotz einiger wesentlicher Schwächen enthält dieses Buch vor allem eine exzellente Kritik an der utilitaristischen Moral.
[16] Französischsprachige Zeitschrift der Linken Fraktion der Italienischen Kommunistischen Partei (später die italienische Fraktion der Internationalen Kommunistischen Linken).
[17] Was will der Spartakusbund?, in: Ges. Werke Bd. 4, S. 440 ff. Hier und in anderen Schriften von Rosa Luxemburg finden wir ein tiefes Verständnis der Klassenpsychologie des Proletariats. (Eine leicht veränderte englische Übersetzung dieser Passage kann man in Selected Political Writings of Rosa Luxemburg, Monthly Review Press, 1971, lesen).
[18] Leo Trotzki, Geschichte der Russischen Revolution, Kapitel: Lenin ruft zum Aufstand (Ausgabe: Fischer-Taschenbuch Bd. 2.2. S. 831)
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [50]
Erbe der kommunistischen Linke:
Resolution zur internationalen Lage 2007
- 2851 Aufrufe
Dekadenz und Zerfall des Kapitalismus
1 Einer der wichtigsten Faktoren, die das derzeitige Leben der kapitalistischen Gesellschaft prägen, ist ihr Eintritt in die Zerfallsphase. Die IKS hat bereits seit dem Ende der achtziger Jahre auf die Ursachen und Wesenszüge dieser Zersetzungsphase der Gesellschaft hingewiesen. Sie hat insbesondere die folgenden Tatsachen hervorgehoben:
a) Die Phase des Zerfalls des Kapitalismus ist ein wesentlicher Bestandteil der Dekadenzperiode dieses Systems, die mit dem Ersten Weltkrieg eröffnet wurde (wie dies die große Mehrheit der Revolutionäre zu jenem Zeitpunkt erkannt hatte). In diesem Zusammenhang behält sie die Haupteigenschaften bei, die der Dekadenz des Kapitalismus eigen sind, wobei aber neue, bislang unbekannte Merkmale im gesellschaftlichen Leben hinzukommen.
b) Sie stellt die letzte Phase dieses Niedergangs dar, in der sich nicht nur die verhängnisvollsten Erscheinungen der vorhergehenden Phasen häufen, sondern das gesamte gesellschaftliche Gebäude am lebendigen Leib verfault.
c) Praktisch alle Aspekte der menschlichen Gesellschaft sind durch den Zerfall betroffen, auch und besonders jene, die für ihr Schicksal entscheidend sind, wie die imperialistischen Konflikte und der Klassenkampf. In diesem Sinn und vor dem Hintergrund der Zerfallsphase mit all ihren Begleiterscheinungen ist die gegenwärtige internationale Lage unter ihren hauptsächlichen Gesichtspunkten zu untersuchen, nämlich unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Krise des kapitalistischen Systems, der Konflikte innerhalb der herrschenden Klasse insbesondere auf der imperialistischen Bühne und schließlich unter dem Gesichtspunkt des Kampfes zwischen den zwei wesentlichen Gesellschaftsklassen, der Bourgeoisie und dem Proletariat.
2 Paradoxerweise ist die wirtschaftliche Lage des Kapitalismus am geringfügigsten vom Zerfall beeinträchtigt. Dies verhält sich hauptsächlich deshalb so, weil es gerade diese wirtschaftliche Lage ist, die in letzter Instanz die anderen Aspekte des Lebens dieses Systems bestimmt, einschließlich jener, die sich aus dem Zerfall ergeben. Ähnlich wie schon die Produktionsweisen, die dem Kapitalismus vorausgegangen waren, ist auch die kapitalistische Produktionsweise nach der Epoche ihres Aufstiegs, die Ende des 19. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht hatte, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Epoche ihres Niedergangs eingetreten. Die eigentlichen Ursachen dieser Dekadenz sind, wie auch bei den früheren Wirtschaftsordnungen, die wachsenden Spannungen zwischen den sich entwickelnden Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen. Was konkret den Kapitalismus angeht, dessen Entwicklung durch die Eroberung außerkapitalistischer Märkte bedingt ist, so war der Erste Weltkrieg das erste bedeutende Anzeichen seiner Dekadenz. Als die koloniale und wirtschaftliche Eroberung der Welt durch die kapitalistischen Metropolen abgeschlossen war, waren diese dazu gedrängt, sich um die bereits verteilten Märkte zu streiten. In der Folge trat der Kapitalismus in eine neue Periode seiner Geschichte ein, die 1919 von der Kommunistischen Internationale als Ära der Kriege und der Revolutionen bezeichnet wurde. Das Scheitern der revolutionären Welle, die aus dem Ersten Weltkrieg entstanden war, ebnete so den Weg zu wachsenden Erschütterungen der kapitalistischen Gesellschaft: die große Rezession der dreißiger Jahre und ihre Folge, der Zweite Weltkrieg, der noch viel mörderischer und barbarischer war als der Erste Weltkrieg. Die darauffolgende Phase, von einigen bürgerlichen „Experten" als die „glorreichen Dreißig" bezeichnet, ließ die Illusion aufkommenen, dass der Kapitalismus seine zerstörerischen Widersprüche überwunden habe, eine Illusion, der selbst Strömungen erlegen waren, die sich auf die kommunistische Revolution beriefen. Ende der 1960er Jahre folgte auf diese „Wohlstandsära", die sowohl auf zufälligen Umständen als auch auf spezifischen Gegenmaßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der wirtschaftlichen Krise beruhte, erneut die offene Krise der kapitalistischen Produktionsweise, die sich Mitte der 70er Jahre noch verschärfte. Diese offene Krise des Kapitalismus deutete wieder auf die Alternative, die schon von der Kommunistischen Internationale angekündigt worden war: Weltkrieg oder Entwicklung der Arbeiterkämpfe mit der Perspektive der Überwindung des Kapitalismus. Der Weltkrieg ist im Gegensatz zu dem, was bestimmte Gruppen der Kommunistischen Linken denken, keineswegs eine „Lösung" der Krise, die es dem Kapitalismus erlauben würde, „sich zu regenerieren" und dynamisch einen neuen Zyklus zu beginnen. Die Sackgasse, in der sich dieses System befindet, die Zuspitzung der Spannungen zwischen den nationalen Sektoren des Kapitalismus führt auf der militärischen Ebene unweigerlich in die Flucht nach vorn, an deren Ende der Weltkrieg steht. Tatsächlich haben sich infolge der wachsenden wirtschaftlichen Zwänge des Kapitalismus die imperialistischen Spannungen ab den 1970er Jahren zugespitzt. Aber sie konnten nicht in dem Weltkrieg münden, da sich die Arbeiterklasse 1968 von ihrer historischen Niederlage wieder erholt hatte und sich gegen die ersten krisenbedingten Angriffe zur Wehr setzte. Trotz ihrer Fähigkeit, die einzig mögliche Perspektive (sofern man hier von „Perspektive" sprechen kann) der Bourgeoisie zu vereiteln, und trotz einer seit Jahrzehnten ungekannten Kampfbereitschaft, konnte aber auch die Arbeiterklasse ihre eigene Perspektive, die kommunistische Revolution, nicht in Angriff nehmen. Genau diese Konstellation, in der keine der beiden entscheidenden Klassen der Gesellschaft ihre Perspektive durchsetzen kann, in der sich die herrschende Klasse darauf beschränken muss, tagtäglich und sukzessiv das Versinken ihrer Wirtschaft in einer unüberwindbaren Krise zu „verwalten", ist die Ursache für den Eintritt des Kapitalismus in seine Zerfallsphase.
3 Eines der deutlichsten Anzeichen der fehlenden historischen Perspektive ist die Entwicklung des „Jeder-für-sich", das alle Ebenen der Gesellschaft, vom Individuum bis zu den Staaten, betrifft. Doch wäre es falsch zu meinen, dass es seit dem Beginn der Zerfallsphase im wirtschaftlichen Leben des Kapitalismus eine prinzipielle Änderung gegeben habe. Denn das „Jeder-für-sich", die Konkurrenz aller gegen alle gehört seit eh und je zum Wesen der kapitalistischen Produktionsweise. Mit Eintritt in seine Dekadenzphase konnte der Kapitalismus diese Eigenschaften nur durch eine massive Intervention des Staates in die Wirtschaft bändigen; solche Staatsinterventionen begannen im Ersten Weltkrieg und wurden in den 1930er Jahren insbesondere mit den faschistischen und keynesianischen Programmen reaktiviert. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde dieser Staatsinterventionismus durch die Etablierung von internationalen Organisationen wie den IWF, die Weltbank und die OECD ergänzt, denen später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft folgte (die Vorläuferin der heutigen Europäischen Union). Zweck dieser Institutionen war es, zu verhindern, dass die wirtschaftlichen Widersprüche in einer allgemeinen Auflösung münden, wie dies nach dem „Schwarzen Donnerstag" von 1929 der Fall gewesen war. Trotz aller Reden über den „Triumph des Liberalismus" und das „Gesetz des freien Marktes" verzichten die Staaten heute weder auf Interventionen in die Wirtschaft noch auf Strukturen, die die Aufgabe haben, die internationalen Beziehungen wenigstens ansatzweise zu regulieren. Im Gegenteil: in der Zwischenzeit sind weitere Institutionen geschaffen worden, wie beispielsweise die Welthandelsorganisation. Doch weder jene Programme noch diese Organisationen haben es erlaubt, die Krise des Kapitalismus zu überwinden, auch wenn sie das Tempo derselben beträchtlich gebremst hatten. Trotz ihrer Reden über die „historischen" Wachstumsraten der Weltwirtschaft und die außergewöhnlichen Leistungssteigerungen der beiden asiatischen Riesen, Indien und insbesondere China, ist es der Bourgeoisie nicht gelungen, mit der Krise fertig zu werden.
Wirtschaftskrise: Kopf voran in die Verschuldung
4 Die Gründe für die Wachstumsraten im weltweiten Bruttosozialprodukt im Laufe der letzten Jahre, welche die Bourgeois und ihre intellektuellen Lakaien in Euphorie versetzen, sind grundsätzlich nicht neu. Es sind dieselben wie jene, die verhindert haben, dass die Sättigung der Märkte, die den Ausbruch der Krise Ende der 1960er Jahre bewirkte, die weltweite Wirtschaft vollständig erdrosselt hatte; sie lassen sich unter dem Begriff der wachsenden Verschuldung subsummieren. Gegenwärtig stellt die gewaltige Verschuldung der amerikanischen Wirtschaft - sowohl in ihrem Staatsbudget als auch in ihrer Handelsbilanz - die wichtigste „Lokomotive" für den weltweiten Wachstum dar. Effektiv handelt es sich dabei um eine Flucht nach vorn, die weit entfernt davon ist, die Widersprüche des Kapitalismus zu lösen und uns nur eine noch schmerzhaftere Zukunft beschert, mit einer brutalen Verlangsamung des Wachstums, wie dies seit mehr als dreißig Jahren immer wieder der Fall gewesen war. Schon jetzt lösen die Gewitterwolken, die sich im Immobiliensektor in den Vereinigten Staaten - einer wichtigen Triebkraft der nationalen Ökonomie - mit der Gefahr von katastrophalen Bankenpleiten zusammenbrauen, große Sorgen in den maßgeblichen Wirtschaftskreisen aus. Diese Sorgen werden verstärkt durch die Aussicht auf andere Pleiten, die von „Hedgefonds" (spekulative Fonds) ausgehen, wie das Beispiel von Amaranth im Oktober 2006 veranschaulicht hat. Die Bedrohungslage ist um so ernsthafter, als diese Gebilde, deren Zweck darin besteht, kurzfristig große Profite zu machen, indem mit den Kursänderungen bei den Währungen oder den Rohstoffen spekuliert wird, keineswegs Heckenschützen des internationalen Finanzsystems sind. Vielmehr platzieren die „seriösesten" Finanzinstitute einen Teil ihrer Guthaben in diesen „Hedgefonds". So sind die in diesen Fonds investierten Summen derart gewaltig, dass sie dem jährlichen Bruttoinlandsprodukt eines Landes wie Frankreich gleichkommen, wobei sie wiederum einem noch sehr viel beträchtlicheren Kapitalverkehr als „Transmissionsriemen" dienen (etwa 700.000 Milliarden Dollar im Jahr 2002, das heißt 20 Mal mehr als die Transaktionen von Gütern und Dienstleistungen, also der „realen" Produkte). Und es gibt keine Weisheiten von „Globalisierungsgegnern" und anderen Gegnern der „Verfinanzung" der Wirtschaft, die daran auch nur das Geringste ändern könnten. Diese politischen Strömungen möchten einen „sauberen", „gerechten" Kapitalismus, der insbesondere die Spekulation unterbindet. In Tat und Wahrheit ist Letztere keineswegs Auswuchs eines „schlechten" Kapitalismus, der seine Verantwortung dafür „vergessen" habe, in wirklich produktive Sektoren zu investieren. Wie Marx schon im 19. Jahrhundert festgestellt hat, ist die Spekulation eine Folge der Tatsache, dass die Kapitalbesitzer angesichts des Mangels an zahlungskräftigen Absatzmärkten für ihre produktiven Investitionen es vorziehen, ihr Kapital zwecks Gewinnmaximierung kurzfristig in eine gigantische Lotterie zu stecken, eine Lotterie, die heute den Kapitalismus in ein weltumspannendes Kasino verwandelt hat. Der Wunsch, dass der Kapitalismus heutzutage auf die Spekulation verzichtet, ist so realistisch wie der Wunsch, dass aus Tigern Vegetarier werden.
5 Die außergewöhnlichen Wachstumsraten, die gegenwärtig Länder wie Indien und insbesondere China erleben, stellen in keiner Weise einen Beweis für einen „frischen Wind" in der Weltwirtschaft dar, selbst wenn sie im Laufe der letzten Zeit beträchtlich zum erhöhten Wachstum derselben beigetragen haben. Die Grundlage dieses außergewöhnlichen Wachstums in beiden Ländern wiederum ist paradoxerweise die Krise des Kapitalismus. In der Tat resultiert die wesentliche Dynamik dieses Wachstums aus zwei Faktoren: den Ausfuhren und den Investitionen von Kapital, das aus den höchstentwickelten Ländern stammt. Wenn der Handel dieser Länder sich immer mehr auf Güter verlagert, die in China statt in den „alten" Industrieländern hergestellt werden, so geschieht dies, weil sie zu sehr viel niedrigeren Preisen verkauft werden können, was immer mehr zum obersten Gebot wird, je gesättigter die Märkte sind und je schärfer die Handelskonkurrenz wird. Gleichzeitig erlaubt dieser Prozess dem Kapital, die Kosten der Arbeitskraft in den Industrieländern zu vermindern. Der gleichen Logik gehorcht auch das Phänomen der „Auslagerung", des Transfers der Industrieproduktion der großen Unternehmen in Länder der Dritten Welt, wo die Arbeitskräfte unvergleichlich billiger sind als in den höchstentwickelten Ländern. Es ist übrigens festzustellen, dass die chinesische Wirtschaft einerseits von diesen „Auslagerungen" auf ihr eigenes Territorium profitiert, andererseits aber selbst dazu tendiert, genauso gegenüber Ländern zu verfahren, wo die Löhne noch niedriger sind.
6 Das „zweistellige Wachstum" Chinas (insbesondere seiner Industrie) findet vor dem Hintergrund einer hemmungslosen Ausbeutung der Arbeiterklasse dieses Landes statt, die oft Lebensbedingungen kennt, die mit jenen der englischen Arbeiterklasse in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergleichbar sind - Arbeitsbedingungen, die von Engels 1844 in seinem bemerkenswerten Werk Die Lage der arbeitenden Klasse in England angeprangert wurden. Für sich genommen sind diese Bedingungen kein Kennzeichen des Bankrotts des Kapitalismus, denn dieses System hat sich einst mithilfe einer ebenso barbarischen Ausbeutung des Proletariats aufgemacht, die Welt zu erobern. Und doch gibt es grundlegende Unterschiede zwischen dem Wirtschaftswachstum und den Bedingungen der Arbeiterklasse in den ersten kapitalistischen Ländern des 19. Jahrhunderts einerseits und denjenigen im heutigen China andererseits:
- in den Erstgenannten hat die Erhöhung der Zahl der Industriearbeiter in dem einen Land nicht mit einer Verminderung in dem anderen korrespondiert; vielmehr haben sich die Industriesektoren in Ländern wie England, Frankreich, Deutschland oder den Vereinigten Staaten parallel entwickelt. Gleichzeitig haben sich die Lebensbedingungen des Proletariats insbesondere dank seines Widerstandes während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stetig verbessert;
- was das heutige China betrifft, so wächst die Industrie dieses Landes (wie die anderer Länder der Dritten Welt) auf Kosten zahlreicher Industriesektoren, die in den alten kapitalistischen Ländern verschwinden; gleichzeitig sind die „Auslagerungen" Waffen eines allgemeinen Angriffs auf die Arbeiterklasse dieser Länder, eines Angriffs, der begonnen hat, lange bevor die „Auslagerungen" zur gängigen Praxis geworden sind. Doch die Auslagerungen von Produktionsstätten erlaubt es der Bourgeoisie, den Angriff in puncto Arbeitslosigkeit, berufliche Dequalifizierung, Verelendung und Senkung des Lebensstandards zu intensivieren.
Somit ist das „chinesische Wunder" und anderer Länder der Dritten Welt weit entfernt davon, einen „frischen Wind" für die kapitalistische Wirtschaft darzustellen. Es ist nichts anderes als eine Variante des niedergehenden Kapitalismus. Darüber hinaus stellt die extreme Exportabhängigkeit der chinesischen Wirtschaft einen empfindlichen Punkt im Falle eines Nachfragerückgangs dar, eines Rückgangs, der unweigerlich kommen wird, insbesondere wenn die amerikanische Wirtschaft gezwungen wird, etwas Ordnung in die schwindelerregende Schuldenwirtschaft zu bringen, die es ihr momentan erlaubt, die Rolle der „Lokomotive" der weltweiten Nachfrage zu spielen. So wie das „Wunder" der asiatischen „Tiger" und „Drachen", die durch zweistellige Wachstumsraten geglänzt hatten, 1997 ein schmerzhaftes Ende fand, wird das heutige „chinesische Wunder", auch wenn es andere Ursachen hat und über wesentlich ernsthaftere Trümpfe verfügt, früher oder später unweigerlich in der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise landen.
Die Zuspitzung der imperialistischen Spannungen und des Chaos
7 In keinem Land dieser Erde kann die Wirtschaft den Zwangsläufigkeiten der Dekadenz entgehen. Und das mit gutem Grund, denn die Dekadenz geht vor allem von der ökonomischen Frage aus. Dennoch äußern sich heute die deutlichsten Zeichen des Zerfalls nicht auf der ökonomischen Ebene. Vielmehr zeigen sie sich im politischen Bereich der kapitalistischen Gesellschaft, in den Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Sektoren der herrschenden Klasse und insbesondere in den imperialistischen Auseinandersetzungen. So trat das erste bedeutende Anzeichen für den Eintritt des Kapitalismus in die Zerfallsphase auf der Ebene der imperialistischen Konflikte auf: des Zusammenbruchs des imperialistischen Ostblocks Ende der 1980er Jahre, der sehr schnell auch die Auflösung des westlichen Blocks nach sich zog. Es sind heute also vor allem die politischen, diplomatischen und militärischen Beziehungen zwischen den verschiedenen Staaten, in denen sich das „Jeder-für-sich", das Hauptmerkmal der Zerfallsphase, äußert. Das Blocksystem im Kalten Krieg beinhaltete zwar die Gefahr eines dritten Weltkrieges (der allerdings nicht ausbrach, weil seit Ende der 1960er Jahre die internationale Arbeiterklasse im Weg stand); gleichzeitig ermöglichte jedoch die Existenz der Blöcke, dass die imperialistischen Spannungen gewissermaßen in „geordnete Bahnen" gelenkt wurden, vor allem durch die Kontrolle, die in beiden Lagern durch die jeweils führende Macht ausgeübt wurde. Seit 1989 ist die Situation eine völlig andere. Zwar hat sich die akute Gefahr eines Weltkrieges vermindert, doch gleichzeitig fand eine wahre Entfesselung imperialistischer Rivalitäten und lokaler Kriege unter direkter Beteiligung der größeren Mächte statt, allen voran der USA. Das weltweite Chaos, das seit dem Ende des Kalten Krieges um sich griff, zwang die USA, ihre Rolle als „Weltpolizist", die sie seit Jahrzehnten spielt, noch zu verstärken. Jedoch führt dies keineswegs zu einer Stabilisierung der Welt; den USA geht es nur noch darum, krampfhaft ihre führende Rolle aufrechtzuerhalten. Eine Führungsrolle, die vor allem durch die ehemaligen Verbündeten permanent in Frage gestellt wird, da die Grundvoraussetzung der ehemaligen Blöcke, die Bedrohung durch den anderen Block, nicht mehr existiert. In Ermangelung der „sowjetischen Gefahr" bleibt das einzige Mittel für die USA zur Durchsetzung ihrer Disziplin das Ausspielen ihrer größten Stärke - der absoluten militärischen Überlegenheit. Dadurch wird die Politik der USA selbst zu einem der stärksten Zerrüttungsfaktoren der Welt. Seit Beginn der 1990er Jahre häufen sich die Beispiele dafür: Der erste Golfkrieg 1991 hatte zum Ziel, die sich auflösenden Verbindungen zwischen den Ländern des ehemaligen Westblocks wieder fester zu schnüren (es ging nicht, wie vorgetäuscht, um die „Verteidigung des verletzten Völkerrechts" und gegen die Besetzung Kuwaits durch den Irak). Kurz darauf zerrissen die Bande unter den Ländern des ehemaligen westlichen Blocks gänzlich: Deutschland schürte das Feuer in Jugoslawien, indem es Slowenien und Kroatien ermunterte, ihre Unabhängigkeit zu erklären. Frankreich und Großbritannien bildeten erneut, wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine „Große Allianz", indem sie gemeinsam die imperialistischen Interessen Serbiens unterstützten, und die USA spielten sich als die Beschützer der Muslime Bosniens auf.
8 Die Niederlage der US-Bourgeoisie während der 1990er Jahre in den verschiedenen Militäroperationen, mit denen sie ihre Führungsrolle verankern wollte, hat sie dazu gezwungen, einen neuen „Feind" der „freien Welt" und der Demokratie zu suchen, mit dem sie die Großmächte, vor allem aber ihre ehemaligen Verbündeten, hinter sich scharen konnte: Sie fand ihn im islamistischen Terrorismus. Die Attentate des 11. September 2001, die in den Augen eines Drittels der amerikanischen Bevölkerung und der Hälfte der Einwohner von New York vom amerikanischen Staat wahrscheinlich so gewollt oder sogar vorbereitet wurden, dienten als Anlass für den neuen Kreuzzug. Fünf Jahre später ist das Ergebnis dieser Politik offenkundig. Wenn die Attentate des 11. September es den USA noch erlaubt hatten, Länder wie Frankreich und Deutschland in ihre Intervention in Afghanistan einzubinden, so hatte es nicht mehr dazu gereicht, diese in das Abenteuer im Irak 2003 zu zwingen. Im Gegenteil hatten diese beiden Länder zusammen mit Russland ein kurzfristiges Bündnis gegen die Intervention im Irak geschmiedet. Auch jene „Verbündete", die anfangs der „Koalition" angehörten, die im Irak intervenierte, wie Spanien und Italien, haben mittlerweile das sinkende Schiff verlassen. Die US-Bourgeoisie hat keines ihrer zu Beginn groß angekündigten Ziele erreicht: weder die Zerstörung von „Massenvernichtungswaffen" im Irak noch die Errichtung einer friedlichen „Demokratie" in diesem Land oder die Stabilisierung und Rückkehr des Friedens in der gesamten Region unter der Ägide der USA, die Zurückdrängung des Terrorismus oder die Akzeptanz der militärischen Interventionen ihres Regimes in der US-Bevölkerung.
Das Geheimnis der „Massenvernichtungswaffen" hatte sich schnell gelüftet: Es wurde klar, dass die einzigen im Irak vorhandenen Massenvernichtungswaffen von der „Koalition" selbst mitgebracht worden waren. Dies enthüllte die Lügen, mit denen die Bush-Administration ihre Intervention in dieses Land rechtfertigen wollte. Bezüglich der Zurückdrängung des Terrorismus gilt festzustellen, dass die Invasion im Irak ihm keineswegs die Flügel gestutzt hat, sondern im Gegenteil zu dessen Verstärkung beigetragen hat, sei es im Irak selbst oder in anderen Teilen der Welt so wie auch in den Metropolen des Kapitalismus, wie aus den Anschlägen im März 2004 in Madrid und im Juli 2005 in London ersichtlich wird.
Aus der geplanten Errichtung einer friedlichen „Demokratie" im Irak ist lediglich die Installation einer Marionetten-Regierung geworden, die ohne die massive Unterstützung der US-Truppen nicht die geringste Kontrolle über das Land ausüben könnte. Eine „Kontrolle", die sich ohnehin nur auf einige „Sicherheitszonen" beschränkt und den Rest des Landes der gegenseitigen Massakrierung der schiitischen und sunnitischen Bevölkerungsteile sowie den Terroranschlägen überlassen hat, die seit der Entmachtung Saddam Husseins Tausende von Menschenleben gefordert haben.
Stabilität und Frieden im Mittleren und Nahen Osten waren noch nie so weit entfernt wie heute. Im 50-jährigen Konflikt zwischen Israel und Palästina hat es in den vergangenen Jahren eine neuerliche Zuspitzung der Situation als Ganzes sowie der Zusammenstöße unter den Palästinensern zwischen Fatah und Hamas gegeben; auch der ohnerhin schon beträchtliche Gesichtsverlust der israelischen Regierung wird immer dramatischer. Zweifellos ist der Autoritätsverlust des amerikanischen Riesen in der Region infolge seiner bitteren Niederlage im Irak eng mit dem Chaos und dem Scheitern des „Friedensprozesses", dem er Paten stand, verknüpft.
Dieser Autoritätsverlust ist auch Grund für die vermehrten Schwierigkeiten der NATO-Truppen in Afghanistan und für en Kontrollverlust der Regierung Karzai gegenüber den Taliban.
Überdies ist die zunehmende Dreistigkeit, die der Iran bei der Vorbereitung seiner Atomwaffenproduktion an den Tag legt, eine direkte Konsequenz aus dem Versinken der USA im irakischen Sumpf, was Letzteren weitere militärische Interventionen verunmöglicht.
Und schlussendlich haben sich die Anstrengungen der US-Bourgeoisie, das „Vietnam-Syndrom" endlich zu überwinden, also den Widerstand innerhalb der heimischen Bevölkerung gegen die Entsendung von Soldaten auf das Schlachtfeld aufzuheben, gerade in ihr Gegenteil verkehrt. Nachdem die Emotionen, die durch die Attentate des 11. September geschürt wurden, zunächst die nationalistischen Aufwallungen, den Willen zur „nationalen Einheit" und die Entschlossenheit, sich am „Kampf gegen den Terrorismus" zu beteiligen, gestärkt hatten, sind mittlerweile die Zweifel am Krieg und an der Entsendung von amerikanischen Truppen wieder erheblich gewachsen.
Heute steckt die US-Bourgeoisie im Irak in einer regelrechten Sackgasse. Einerseits haben die USA nicht die militärischen, wirtschaftlichen und politischen Mittel, um in diesem Land irgendeine „Ordnung" wiederherzustellen. Andererseits können die USA es sich nicht erlauben, sich aus dem Irak zurückzuziehen, die Niederlage ihrer Politik offen einzugestehen und den Irak einer totalen Zerstückelung sowie die gesamte Region einer wachsenden Destabilisierung zu überlassen.
9 Die Regierungsbilanz von Bush junior ist sicher eine der katastrophalsten in der Geschichte der USA. Die Beförderung der so genannten „Neokonservativen" an die Staatsspitze 2001 war ein regelrechtes Desaster für die US-Bourgeoisie. Weshalb hat die führende Bourgeoisie der Welt diese Bande von Abenteurern und Stümpern dazu berufen, ihre Interessen zu vertreten? Was war der Grund für die Blindheit der herrschenden Klasse des stärksten kapitalistischen Landes der Welt? Tatsächlich war die Beauftragung der Bande um Cheney, Rumsfeld und Konsorten mit den Regierungsgeschäften keineswegs eine ebenso simple wie gigantische „Fehlbesetzung" durch die US-Bourgeoisie. Wenn sich die Lage der USA auf dem imperialistischen Terrain noch sichtbarer verschlechtert hat, so ist dies vor allem Ausdruck der Sackgasse, in der sich dieses Land schon zuvor durch den zunehmenden Verlust ihrer Führungsrolle befand, und des allgemein herrschenden „Jeder-für-sich" in den internationalen Beziehungen, das die Zerfallsphase kennzeichnet.
Dies beweist die Tatsache, dass die erfahrenste und intelligenteste Bourgeoise der Welt, die herrschende Klasse Großbritanniens, sich in das Irak-Abenteuer ziehen ließ. Ein anderes Beispiel für den Hang zu Unheil bringenden imperialistischen Schritten von Seiten der „fähigsten" Bourgeoisien - jener, die bisher meisterlich ihre militärische Stärke ausspielen konnten - ist, eine Nummer kleiner, das katastrophale militärische Abenteuer Israels im Libanon im Jahr 2006. Eine Offensive, die grünes Licht aus Washington erhalten hatte und die Hisbollah schwächen sollte, aber im Gegenteil eine Stärkung dieser Gruppierung zur Folge hatte.
Die zunehmende Zerstörung der Umwelt
10 Das militärische Chaos, das sich über die Erde ausbreitet und ganze Gebiete in einen Abgrund der Verwüstung stürzt - vor allem im Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika - ist keineswegs der einzige Ausdruck der historischen Sackgasse, in der sich der Kapitalismus befindet, und letztlich auch nicht die größte Bedrohung für die Gattung Mensch. Heute wird immer deutlicher, dass die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems und seiner Funktionsweise auch die Zerstörung der Umwelt, die die Entwicklung der Menschheit erst ermöglichte, mit sich bringt. Der anhaltende Ausstoß von Treibhausgasen im heutigen Ausmaß und die Erwärmung des Planeten werden nie dagewesene klimatische Katastrophen auslösen (Orkane, Verwüstungen, Überschwemmungen, usw.), die mit schrecklichen menschlichen Leiden (Hunger, Vertreibung von Millionen von Menschen, Überbevölkerung in den bisher am meisten verschonten Regionen, usw.) einhergehen. Angesichts der unübersehbaren Anzeichen der Umweltzerstörung können die Regierungen und die führenden Teile der Bourgeoisie die Dramatik der Lage und die sich abzeichnenden Katastrophen nicht länger vor der Bevölkerung verheimlichen. Darum präsentieren sich die Bourgeoisien und fast alle bürgerlichen Parteien der Industrieländer im grünen Gewand und versprechen, Maßnahmen zu ergreifen, um die aufkommenden Katastrophen von der Menschheit abzuwenden. Doch mit dem Problem der Umweltzerstörung verhält es sich ähnlich wie mit den Kriegen: Alle Teile der herrschenden Klasse sind gegen den Krieg, und dennoch ist diese Klasse seit dem Eintritt des Kapitalismus in die Dekadenz unfähig, einen Frieden zu garantieren. Hier handelt es sich keinesfalls um eine Frage des guten oder schlechten Willens (auch wenn in den Fraktionen, die den Krieg am eifrigsten anfeuern, die schmutzigsten Interessen zu finden sind). Selbst die „pazifistischsten" Führer der herrschenden Klasse können der objektiven Logik nicht entfliehen, die ihren „humanistischen" Anwandlungen und der „Vernunft" keinen Raum lässt. Im gleichen Maße ist der von den Spitzen der herrschenden Klasse plakativ zur Schau gestellte „gute Wille", die Umwelt zu schützen, angesichts der Zwänge der kapitalistischen Wirtschaft wirkungslos. Meist handelt es sich eh nur um Lippenbekenntnisse, mit denen möglichst viele Wählerstimmen erschlichen werden sollen. Sich dem Problem des Ausstoßes von Treibhausgasen ernsthaft zu stellen würde beträchtliche Veränderungen in der Industrie, der Energieproduktion, dem Transportwesen und den Wohnverhältnissen erfordern und massive Investitionen in diese Sektoren nach sich ziehen. Es würde überdies die gewichtigen ökonomischen Interessen der großen Masse der Unternehmer, aber auch des Staates selbst in Frage stellen. Konkret: Jeder Staat, der die notwendigen Maßnahmen ergreifen würde, um einen wirkungsvollen Beitrag zur Lösung des Problems beizusteuern, fände sich sofort und massiv in seiner Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt eingeschränkt. Die Staaten verhalten sich bezüglich der Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung so wie die Fabrikanten gegenüber den Lohnerhöhungen der Arbeiter: Sie sind alle dafür... solange die anderen davon betroffen sind. So lange die kapitalistische Produktionsweise besteht, ist die Menschheit dazu verdammt, unter einer immer dickeren Rußschicht zu leiden, die dieses System in seiner Agonie über den Erdball zieht, ein Phänomen, das das System selbst zu bedrohen beginnt.
Wie die IKS schon vor mehr als 15 Jahren hervorgehoben hat, bedeutet der zerfallende Kapitalismus eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit. Die von Engels Ende des 19. Jahrhunderts formulierte Alternative „Sozialismus oder Barbarei" ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer schrecklichen Realität geworden. Was uns das 21. Jahrhundert in Aussicht stellt, ist in der Tat „Sozialismus oder Zerstörung der Menschheit". Und das ist die Herausforderung, vor der die einzige Klasse in der Gesellschaft steht, die den Kapitalismus überwinden kann, die Arbeiterklasse.
Die Perspektive des Klassenkampfes und die Entwicklung des Klassenbewusstseins
11 Mit dieser Aufgabe ist die Arbeiterklasse konfrontiert, seit sie 1968 wieder auf die historische Bühne getreten war und damit der schlimmsten Konterrevolution in ihrer Geschichte ein Ende bereitet hatte. Ihr Wiederauftreten verhinderte, dass der Kapitalismus seine Lösung für die offene Wirtschaftskrise, den Weltkrieg, durchsetzen konnte. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten fanden Kämpfe der Arbeiterklasse mit all ihren Höhen und Tiefen, Fortschritten und Rückschlägen statt; Kämpfe, die es der Arbeiterklasse erlaubten, Erfahrungen zu sammeln, vor allem über die Rolle der Gewerkschaften als Saboteure des Klassenkampfes. Doch gleichzeitig wurde die Arbeiterklasse zunehmend dem Gewicht des Zerfalls ausgesetzt, was vor allem erklärt, dass die Ablehnung der klassischen Gewerkschaften vom Rückzug in den Korporatismus begeleitet war, eine Folge des Jeder-gegen-Jeden, das selbst im Klassenkampf seinen Ausdruck findet. Es war tatsächlich der Zerfall des Kapitalismus, der durch seine spektakulärste Äußerung, den Zusammenbruch des Ostblocks und der stalinistischen Regimes 1989, dieser ersten Reihe von Arbeiterkämpfen ein Ende bereitet hatte. Die ohrenbetäubende Kampagne der Bourgeoisie über das „Ende des Kommunismus", den „endgültigen Sieg des liberalen und demokratischen Kapitalismus" und das „Ende des Klassenkampfes", ja der Arbeiterklasse selbst haben dem Proletariat auf der Ebene des Bewusstseins und der Kampfbereitschaft einen herben Rückschlag versetzt. Dieser Rückschlag war nachhaltig und dauerte über zehn Jahre. Er hat eine ganze Generation von Arbeitern geprägt und Ratlosigkeit, ja selbst Demoralisierung ausgelöst. Diese Ratlosigkeit machte sich aber nicht lediglich aufgrund der Ereignisse Ende der 1980er Jahre breit, sondern auch angesichts ihrer Folgeerscheinungen wie den ersten Golfkrieg 1991 und den Krieg in Ex-Jugoslawien. Diese Ereignisse widerlegten zwar klar und deutlich die euphorischen Erklärungen von US-Präsident Bush senior nach dem Ende des Kalten Krieges, dass nun eine „Ära des Friedens und Wachstums" angebrochen sei, doch bewirkten sie angesichts der allgemeinen Ratlosigkeit in der Klasse keine Weiterentwicklung des Bewusstseins. Im Gegenteil hatten diese Ereignisse ein tiefes Gefühl der Machtlosigkeit in der Arbeiterklasse hinterlassen, was das Selbstvertrauen und die Kampfbereitschaft weiter sinken ließ.
Doch auch in den 90er Jahren hatte die Arbeiterklasse den Kampf nicht völlig aufgegeben. Die anhaltenden Angriffe des kapitalistischen Systems zwangen sie zur Gegenwehr. Doch diese Kämpfe wiesen nicht die Dimension, das Bewusstsein und die Fähigkeit auf, den Gewerkschaften so entgegenzutreten, wie dies noch in der vorangegangenen Periode der Fall gewesen war. Erst im Laufe des Jahres 2003 begann sich das Proletariat vor allem in Gestalt der großen Mobilisierungen in Frankreich und Österreich gegen die Angriffe auf die Altersrenten wieder von den Rückschlägen nach 1889 zu erholen. Seither hat sich die Tendenz zur Wiederaufnahme des Klassenkampfes und zur Weiterentwicklung des Bewusstseins bestätigt. Überall in den zentralen Ländern haben Arbeiterkämpfe stattgefunden, auch in den wichtigsten wie in den USA (Boeing und öffentlicher Verkehr in New York 2005), in Deutschland (Daimler und Opel 2004, Spitalärzte im Frühling 2006, Deutsche Telekom im Frühling 2007), Großbritannien (Londoner Flughafen im August 2005, öffentlicher Dienst im Frühling 2006), Frankreich (Studenten und Schüler gegen den CPE im Frühling 2006), aber auch in einer eine ganze Reihe von peripheren Ländern wie Dubai (Bauarbeiter im Frühling 2006), Bangladesh (Textilarbeiter im Frühling 2006), Ägypten (Textil- und Transportarbeiter im Frühling 2007).
12 Engels schrieb einst, dass die Arbeiterklasse ihren Kampf auf drei Ebenen führt: auf der ökonomischen, der politischen und der theoretischen Ebene. Erst wenn wir die Welle von Kämpfen nach 1968 und jene seit 2003 auf diesen Ebenen vergleichen, können wir die Perspektive der gegenwärtigen Phase ausmachen.
Die Kämpfe nach 1968 hatten eine große politische Bedeutung: Sie stellten das Ende der Periode der Konterrevolution dar. Sie riefen auch einen theoretischen Denkprozess hervor, der das Wiederauftauchen von linkskommunistischen Strömungen begünstigte, von denen die Gründung der IKS 1975 der wichtigste Ausdruck war. Die Arbeiterkämpfe vom Mai 1968 in Frankreich und der „Heiße Herbst" 1969 in Italien ließen angesichts ihrer politischen Forderungen vermuten, dass eine Politisierung der Arbeiterklasse auf internationaler Ebene bevorsteht. Doch diese Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Identität, die sich innerhalb der Klasse durch diese Kämpfe entwickelte, war vielmehr von ökonomischen Kategorien geprägt und weniger eine Identifizierung mit ihrer politischen Kraft innerhalb der Gesellschaft. Die Tatsache, dass diese Kämpfe die herrschende Klasse daran hinderten, den Weg zu einem dritten Weltkrieg einzuschlagen, wurde von der Arbeiterklasse (inklusive der Mehrheit der revolutionären Gruppierungen) nicht wahrgenommen. Der Massenstreik in Polen 1980 hatte, auch wenn er einen (seit dem Ende der revolutionären Welle nach dem Ersten Weltkrieg) neuen Höhepunkt in puncto Organisationskraft der Arbeiterklasse darstellte, eine entscheidende Schwäche: Die einzige „Politisierung", die stattfand, war die Annäherung an bürgerlich-demokratische Ideen und an den Nationalismus.
Die IKS hatte schon damals folgende Feststellungen gemacht:
- das langsame Tempo der Wirtschaftskrise machte es im Gegensatz zum imperialistischen Krieg, aus dem die erste globale revolutionäre Welle hervorgegangen war, möglich, den Niedergang des Systems zu verschleiern, was Illusionen über die Fähigkeit des Kapitalismus schürte, der Arbeiterklasse ein gutes Leben zu sichern;
- es existierte aufgrund der traumatischen Erfahrung mit dem Stalinismus ein Misstrauen gegenüber den revolutionären politischen Organisationen (unter den Arbeitern in den Ländern des Ostblocks hatte dies gar große Illusionen über die „Vorteile" der traditionellen bürgerlichen Demokratie hervorgerufen);
- der organische Bruch hatte die revolutionären Organisationen von ihrer Klasse abgeschnitten.
13 Die Situation, in der sich heute die neue Welle von Klassenkämpfen entfaltet, ist eine völlig andere:
- nahezu vierzig Jahre der offenen Krise und Angriffe gegen die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und vor allem die wachsende Arbeitslosigkeit und Prekarisierung haben die Illusionen weggefegt, „dass es uns morgen besser gehen wird": Die alten und auch die jungen Generationen werden sich immer bewusster, dass es ihnen morgen noch schlechter ergehen wird als heute;
- das Andauern der immer barbarischeren kriegerischen Auseinandersetzungen sowie die Bedrohung durch die Umweltzerstörung erzeugen eine (wenn auch noch konfuse) Ahnung, dass sich diese Gesellschaft grundsätzlich ändern muss. Das Auftauchen der Antiglobalisierungs-Bewegung mit ihrer Parole: „Eine andere Welt ist möglich" stellt dabei ein Gegengift dar, das von der bürgerlichen Gesellschaft verbreitet wird, um diese Ahnungen auf falsche Bahnen zu lenken;
- das Trauma, das durch den Stalinismus und die nach seinem Zerfall vor fast zwanzig Jahren ausgelösten Kampagnen verursacht wurde, klingt langsam ab. Die Arbeiter der neuen Generation, die heute ins aktive Leben treten und sich damit auch potenziell am Klassenkampf beteiligen, befanden sich zur Zeit der schlimmsten Kampagnen über den so genannten „Tod des Kommunismus" noch im Kindesalter.
Diese Bedingungen bewirken eine Reihe von Unterschieden zwischen der heutigen Welle von Kämpfen und jener, die 1989 endete.
Auch wenn sie eine Reaktion auf ökonomische Angriffe sind, die ungleich heftiger und allgemeiner sind als jene, die das spektakuläre und massive Auftauchen der ersten Welle verursacht hatten, so haben die aktuellen Kämpfe in den zentralen Ländern des Kapitalismus noch nicht denselben massiven Charakter. Dies vor allem aus zwei Gründen:
- das historische Wiederauftauftauchen der Arbeiterklasse Ende der 1960er Jahre hatte die herrschende Klasse überrascht. Heute dagegen ist dies nicht mehr der Fall. Die Bourgeoisie unternimmt alles Mögliche, um der Arbeiterklasse zuvorzukommen und die Ausdehnung der Kämpfe vor allem durch ein systematisches mediales Ausblenden zu verhindern;
- der Einsatz von Streiks ist heute viel heikler, weil das Gewicht der Arbeitslosigkeit als Druckmittel gegen die Arbeiterklasse wirkt und Letztere sich auch bewusst ist, dass der Spielraum der Bourgeoisie zur Erfüllung von Forderungen immer kleiner wird.
Dieser letzte Aspekt ist jedoch nicht nur ein Faktor, der die Arbeiter vor massiven Kämpfen zurückschrecken lässt. Er erfordert auch ein tiefes Bewusstsein über das endgültige Scheitern des Kapitalismus, das eine Bedingung dafür ist, dass sich ein Bewusstsein über die Notwendigkeit der Überwindung dieses Systems bildet. In einer gewissen Weise sind die Hemmungen der Arbeiterklasse, sich in den Kampf zu stürzen, durch das schiere Ausmaß der Aufgaben bedingt, mit denen die kämpfende Klasse konfrontiert wird, nämlich mit nichts Geringerem als die proletarische Revolution.
Auch wenn die ökonomischen Kämpfe der Klasse momentan weniger heftig sind als die Kämpfe nach 1968, enthalten sie eine gewichtigere politische Dimension. Bereits jetzt machen sich die Kämpfe, die wir seit 2003 erleben, mehr und mehr die Frage der Solidarität zu eigen, eine Frage von höchster Wichtigkeit, da sie das wirksamste „Gegengift" zum für den gesellschaftlichen Zerfall typischen „Jeder-für-sich" darstellt und vor allem weil sie in ihrem Kern die Fähigkeit des Weltproletariates ausmacht, nicht nur die gegenwärtigen Kämpfe zu entfalten, sondern auch den Kapitalismus zu überwinden:
- der spontane Streik der Daimler-Arbeiter in Bremen gegen die Angriffe auf die Belegschaft ihres Betriebes in Stuttgart;
- der Solidaritätsstreik der GepäckarbeiterInnen in einem Londoner Flughafen gegen die Entlassungen von Angestellten eines Catering-Unternehmens, und dies trotz der Illegalität des Streiks;
- der Streik der Transportangestellten in New York aus Solidarität mit der jungen Generation, die die Direktion unter schlechteren Konditionen einstellen wollte.
14 Die Frage der Solidarität stand auch im Zentrum der Bewegung gegen das CPE-Gesetz in Frankreich im Frühjahr 2006, die sich - unter hauptsächlicher Beteili-
gung von StudentInnen und OberschülerInnen - voll und ganz auf dem Terrain der Arbeiterklasse befand:
- aktive Solidarität der Studierenden besser gestellter Universitäten mit den StudentInnen anderer Universitäten;
- Solidarität gegenüber den Kindern der Arbeiterklasse in den Vorstädten, deren Revolten im Herbst 2005 die miserablen Lebensbedingungen und die fehlenden Perspektiven, die ihnen der Kapitalismus bietet, ans Licht gebracht hatten;
- Solidarität unter den verschiedenen Generationen: zwischen jenen, die vor der Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitsbedingungen stehen, und jenen, die sich bereits in einem Lohnarbeitsverhältnis befinden; zwischen jenen, die nun in den Klassenkampf eintreten, und jenen, die bereits einschlägige Erfahrungen gesammelt haben.
15
Diese Bewegung war auch beispielhaft für die Fähigkeit der Klasse, ihre Kämpfe selbst in die Hand zu nehmen, mit Vollversammlungen und ihnen gegenüber verantwortlichen Streikkomitees (dies haben wir auch während des Streiks in den Metallbetrieben im spanischen Vigo Frühjahr 2006 gesehen, wo tägliche Vollversammlungen aller beteiligten Belegschaften auf der Straße abgehalten wurden). Die extreme Schwäche der Gewerkschaften im studentischen Milieu hatte dies ermöglicht; die Gewerkschaften konnten ihre traditionelle Rolle als Saboteure des Klassenkampfes nicht ausüben, eine Rolle, die sie bis zur Revolution verkörpern werden. Ein Beispiel für die arbeiterfeindliche Rolle der Gewerkschaften ist die Tatsache, dass die jüngsten Kämpfe oft in Ländern stattfanden, in denen die Gewerkschaften noch sehr schwach vertreten sind (wie in Bangladesh) oder direkt als Organe des Staates auftreten (wie in Ägypten).
16 Die Bewegung gegen das CPE-Gesetz, die in jenem Land stattfand, in dem auch die erste und spektakulärste Manifestation des historischen Wiedererwachens der Arbeiterklasse stattgefunden hatte, der Generalstreik in Frankreich 1968, deutet noch auf andere Unterschiede zwischen der heutigen Welle von Klassenkämpfen und der vorangegangenen hin:
- 1968 waren die Studentenbewegung und die Kämpfe der Arbeiterklasse, auch wenn sie sich zeitlich überschnitten und eine gegenseitige Sympathie vorhanden war, Ausdruck von zwei verschiedenen Realitäten zurzeit des Eintritts des Kapitalismus in seine offene Krise: einerseits eine Revolte des intellektuellen Kleinbürgertums in Gestalt der Studenten gegen die Degradierung ihres Status‘ innerhalb der Gesellschaft, andererseits ein ökonomischer Kampf der Arbeiterklasse gegen die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen. Die Bewegung der StudentInnen im Jahr 2006 war eine Bewegung der Arbeiterklasse und zeigte klar auf, dass die Veränderungen in der Arbeitswelt in den entwickeltsten Ländern (Vergrößerung des tertiären Sektors auf Kosten des industriellen Sektors) die Fähigkeit der Arbeiterklasse, Klassenkämpfe zu führen, nicht in Frage stellen;
- in der Bewegung von 1968 wurde die Frage der Revolution tagtäglich diskutiert. Doch dieses Interesse ging hauptsächlich von den StudentInnen aus, von denen sich die große Mehrheit bürgerlichen Ideologien hingab: dem Castrismus aus Kuba oder dem Maoismus aus China. In der Bewegung von 2006 wurde die Frage der Revolution viel weniger diskutiert, dafür herrschte aber ein viel klareres Bewusstsein darüber, dass nur die Mobilisierung und Einheit der gesamten Arbeiterklasse ein wirkungsvolles Mittel sind, um den Angriffen der Bourgeoise entgegenzutreten.
17 Diese letzte Frage führt uns zum dritten Aspekt des Klassenkampfes, den Engels formuliert hatte: zum theoretischen Kampf, zur Entwicklung des Bewusstseins innerhalb der Arbeiterklasse über die grundsätzlichen Perspektiven ihres Kampfes und zum Auftauchen von Elementen und Organisationen, die ein Produkt dieser Anstrengungen sind. Wie 1968 geht heute die Zunahme der Arbeiterkämpfe mit einem vertieften Nachdenken einher. Dabei stellt das Auftauchen neuer Leute, die sich den Positionen der Kommunistischen Linken zuwenden, lediglich die Spitze des Eisbergs dar. Jedoch bestehen auch hier erhebliche Unterschiede zwischen dem heutigen Denkprozess und den Reflexionen nach 1968. Damals setzte das Nachdenken aufgrund massiver und spektakulärer Kämpfe ein, wohingegen der heutige Denkprozess nicht darauf wartet, bis die Arbeiterklasse Kämpfe derselben Dimension entfacht. Dies ist ein Resultat der unterschiedlichen Bedingungen, mit denen das Proletariat heute - im Gegensatz zu denen Ende der 1960er Jahre - konfrontiert ist: Ein Charakteristikum der Kampfwelle, die 1968 begann, bestand darin, dass sie aufgrund ihrer Ausbreitung das Potenzial einer proletarischen Revolution erahnen ließ. Ein Potenzial, das infolge der schlimmen Konterrevolution und der Illusionen, die das „Wachstum" des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg produziert hatte, aus den Köpfen verschwunden war. Heute ist es nicht die Möglichkeit einer Revolution, die den Denkprozess nährt, sondern - angesichts der katastrophalen Perspektive des Kapitalismus - ihre Notwendigkeit. Aus diesem Grund vollzieht sich alles langsamer und weniger sichtbar als in den 1970er Jahren. Der ganze Prozess ist jedoch viel nachhaltiger und nicht so abhängig von Schwankungen im Kampf der Arbeiterklasse.
Der Enthusiasmus für die Revolution, der sich 1968 und in den darauffolgenden Jahren ausgedrückt hatte, trieb die Mehrheit der Menschen, die an eine Revolution glaubten, in die Arme linksextremistischer Gruppen. Nur eine kleine Minderheit, die den radikalen kleinbürgerlichen Ideologien und der Momentbezogenheit der Studentenbewegung weniger stark ausgesetzt war, konnte sich den Positionen des Linkskommunismus annähern und seinen Organisationen beitreten. Die Schwierigkeiten, auf welche die Arbeiterklasse angesichts diverser Gegenoffensiven der herrschenden Klasse gestoßen war, und der gesellschaftliche Kontext, der noch Illusionen in die Überlebensfähigkeit des Kapitalismus erlaubte, ließen reformistische Ideologien wiederaufleben, die vor allem die „extremen" Gruppen links des offiziellen, diskreditierten Stalinismus förderten. Heute, nach dem Zusammenbruch des Stalinismus, nehmen die linken Gruppen seinen frei gewordenen Platz ein. Die „Etablierung" dieser Gruppierungen im politischen Spiel der Bourgeoisie löst eine Gegenreaktion ihrer ehrlichsten Anhänger aus, die auf der Suche nach Klassenpositionen sind. Aus diesem Grund drückt sich das Nachdenken in der Arbeiterklasse nicht nur durch das Auftauchen junger Leute aus, die sich dem Linkskommunismus zuwenden, sondern auch durch Ältere, die bereits Erfahrungen in Organisationen der bürgerlichen Linken gesammelt haben. Dies ist ein sehr positives Phänomen, das uns verspricht, dass die revolutionären Kräfte, die unvermeidlich aus den Kämpfen der Arbeiterklasse auftauchen, nicht mehr so einfach sterilisiert und eingebunden werden können, wie dies im Laufe der 1970er Jahre noch der Fall gewesen war, und dass sie sich vermehrt den Positionen und Organisationen der Kommunistischen Linken anschließen.
Die Verantwortung der revolutionären Organisationen, und vor allem der IKS, besteht darin, aktiver Teil in diesem Denkprozess innerhalb der Klasse zu sein. Dies nicht nur durch aktive Interventionen in den sich entwickelnden Klassenkämpfen, sondern auch durch die Stimulierung der Gruppen und Einzelpersonen, die sich diesem Kampf anschließen wollen.
IKS
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf [325]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Internationale Revue - 2008
- 3576 Aufrufe
Internationale Revue 41
- 3434 Aufrufe
Editorial - USA: Die Lokomotive der Weltwirtschaft ... fährt auf den Abgrund zu
- 3337 Aufrufe
Es sind wahrlich harte Zeiten für die Weltwirtschaft seit der anhaltenden Immobilienkrise, die während des letzten Jahres in den USA ausbrach. Die Situation war seit dem Beginn der offenen Krise des Kapitalismus Ende der 1960er Jahre noch nie so heikel wie heute, auch wenn die herrschende Klasse all ihre Mittel einsetzt, um die Auswirkungen einzudämmen:
- Die Immobilienkrise in den USA hat sich in eine weltweite Finanzkrise ausgeweitet, begeleitet durch den schallenden Lärm über die Zahlungsunfähigkeit der amerikanischen und europäischen Banken.[i] Diejenigen Bankinstitute, welche nicht scheiterten, schafften es nur mit Hilfe von Rettungsszenarien durch den Staat. Und es gibt grosse Ängste, dass viele Banken, die aus verschiedenen Gründen kurz vor dem Abgrund standen, in einer potentiellen Krisensituation stecken, was wiederum die Gefahr eines noch größeren Finanzkrachs birgt.
- Die Zeichen stehen deutlich auf einer Verlangsamung der ökonomischen Aktivitäten, wenn man die Rezession, in einigen Ländern, darunter den USA, betrachtet. Die herrschende Klasse hat die verschiedenen Rezessionen mit denen sie seit den 1970er Jahren konfrontiert war, mit einer verstärkten Verschuldung überwunden. Der Aufwand war jedes Mal größer, der Effekt jedes Mal geringer. Wird sie ein erneutes Mal die kommende Rezession austricksen können, wenn dazu lediglich das Mittel einer enormen Erhöhung der weltweiten Verschuldung existiert und damit das Risiko eines Zusammenbruchs des internationalen Kreditsystems?
- Das Sinken der Börsenkurse mit gelegentlich brutalen Einbrüchen erschüttert das Vertrauen in die Grundlage der Börsenspekulation, deren Erfolge es zeitweise erlaubt haben, die Probleme der realen Ökonomie zu verschleiern. Diese Erfolge haben stark zur Erhöhung der Profitrate vieler Unternehmen seit Mitte der 1980er Jahre beigetragen und sie bilden die Basis eines verankerten Mythos, der aber heute in Frage gestellt wird, dass unabhänging von allen unvorhergesehenen Risiken die Börsenkurse nichts anderes als steigen würden.
- Die Militärausgaben, das sieht man deutlich in den USA, bilden eine immer unüberwindbarere Bürde für die Wirtschaft. Sie können nicht einfach willentlich zurückgeschraubt werden. Sie sind die Konsequenz des immer größeren Gewichtes, welches der Militarismus in der Gesellschaft einnimmt. Denn durch die immer unlösbarer werdenden ökonomischen Probleme ist jede Nation gezwungen, die Flucht nach vorne in den Krieg zu ergreifen.
- Die erneute Inflation ist für die Bourgeoisie in zweifacher Weise ein Schreckgespenst. Einerseits ist sie eine Bremse für den Warenhandel, weil sie immer schwerer vorhersehbare Schwankungen des Warenhandels mit sich bringt. Auf der anderen Seite, weil sie noch mehr als die Antwort der Arbeiterklasse auf die Angriffe durch Arbeitslosigkeit, den Verteidigungskampf der Arbeiterklasse um eine Erhöhung der Löhne gegen die Erhöhung der Preise und damit eine Generalisierung der Arbeiterkämpfe über die Sektoren hinweg hervorruft. Die Instrumente, über welche die Bourgeoise heute noch verfügt, um der Inflation entgegenzuwirken, die harte Sparpolitik und die Ausgabenreduktion des Staates, werden konsequent eingesetzt, doch sie verschärfen lediglich den Kurs in Richtung Rezession.
Die heutige Situation ist nicht einfach eine Wiederholung all der Auswirkungen der Krise seit Ende der 1960er Jahre. Sie ist eine Konzentration der Krise in einer viel geballteren und explosiveren Form und führt zu einer ökonomischen Katastrophe neuer Schärfe, die das System in Frage stellt. In den vergangenen Jahrzehnten war es oft die Aufgabe der mächtigsten Wirtschaftsmacht der Welt, die Lokomotive zu spielen und Rezessionen zu vermeiden oder zu überwinden. Heute aber ist der Effekt, den die USA auf die gesamte Welt hat, ein umgekehrter: hin zur Rezession und auf den Abgrund zu.
Die Verschärfung der Wirtschaftskrise in den USA
George Bush ist gewiss der größte Optimist in den USA und vielleicht ist er mit diesem Optimismus alleine, wenn man die wirtschaftliche Situation des Landes betrachtet. Am 28. Februar, in Gewissheit des Risikos einer Verlangsamung der Wirtschaft, erklärte der Präsident: „Ich denke nicht, dass wir einer Rezession entgegen gehen (...). Ich glaube, dass die Grundlagen unserer Wirtschaft in guter Gesundheit sind (...), dass das Wachstum anhält und auch noch in einer robusteren Art anhalten wird als heute. Wir haben immer noch einen starken Dollar auf unserer Seite."[ii] Zwei Wochen später, am 14. März in einer Sitzung von Ökonomen in New York, wiederholte der Präsident seinen optimistischen Standpunkt und sprach sein Vertrauen in die „schlagfertige" Kapazität der US-Wirtschaft aus. Dies am selben Tag, als die US-Staatsbank und die JP Morgan Bank sich zusammenrauften, um einen Rettungsplan für die Bear Stearns Bank, eine große Börsenanlage-Bank an der Wall Street, auf die Beine zu stellen, die durch einen massiven Anlagenrückzug von Seiten ihrer Klienten betroffen war. Ein Szenario, das an die große Depression von 1929 erinnert. Am selben Tag spielte sich zudem folgendes ab: Der Preis für ein Fass Öl erreichte eine Rekordhöhe von 111 Dollar, und dies trotz höherem Angebot als herrschender Nachfrage; die Regierung kündigte eine Intensivierung der Immobilienpfändungen um 60% für den Februar an; der Stand des Dollars gegenüber dem Euro erreichte ein Rekordtief. Auch die realitätsferne Negierung der Wirklichkeit des Herrn Bush lässt nicht übersehen, wie die angebliche Prosperität durch den Immobilienboom und die Immobilienblase der letzten Jahre den Weg in eine ökonomische Katastrophe eröffnet hat. Im wirtschaftlich mächtigsten Land der Welt, sowie auf internationaler Ebene, ist die Wirtschaftskrise wieder in den Brennpunkt gerückt.
Die Immobilienkrise: Symptom eines Systems in permanenter Krise
Seit Beginn des Jahres 2007, als die ersten Anzeichen für ein Ende des Immobilienbooms manifest werden, diskutiert die Clique der bürgerlichen Ökonomen über die Möglichkeit einer Rezession in den USA. Seit Anfang 2008 tauchen immer mehr „pessimistische" Wirtschaftsprognosen auf, die schon von einer Rezession seit Dezember 2007 ausgehen, gegenüber den „Optimisten", welche auf ein Wunder warten. Zwischen den beiden Lagern befinden sich jene, die sich nicht auf die Äste hinauslassen und behaupten, dass sich „die Wirtschaft sowohl in die eine als auch in die andere Richtung entwickeln" könne. Doch die Situation hat sich in den vergangenen Monaten dermaßen schnell zugespitzt (außer vielleicht für Herrn Bush), dass es kaum mehr Platz gibt für Optimismus oder „Zentrismus". Heute sind sie sich einig darüber, dass die schönen Zeiten vorüber sind. Mit anderen Worten: Die US-Ökonomie befindet sich heute in einer Rezession, oder zumindest an deren Beginn.
Dass die Bourgeoisie die Schwierigkeiten des US-amerikanischen Kapitalismus anerkennt, ändert aber kaum etwas an ihrem Verständnis über die wirkliche Lage des gesamten Systems. Die gebräuchliche Beschreibung einer Rezession von Seiten der herrschenden Klasse ist folgende: ein negatives Wirtschaftswachstum während zwei aufeinander folgenden Quartalen. Das National Bureau of Economic Research verwendet eine andere Definition, welche einen Hauch brauchbarer ist. Es definiert die Rezession als einen bedeutsamen und anhaltenden Niedergang aller wirtschaftlichen Aktivitäten, sichtbar an den Einkünften, dem Beschäftigungsgrad, dem Warenverkauf und der industriellen Produktion. Auf der Basis dieser Definition kann die herrschende Klasse eine Rezession nur erkennen, wenn sie schon eine gewisse Zeit andauert, und oft erst dann, wenn das Schlimmste schon vorbei ist. Nach gewissen Aussagen müsse man dann noch einige Monate warten, bis man, diesen Kriterien folgend, wisse, ob bereits eine Rezession herrsche oder ob sie erst beginne.
All die Prognosen, welche die Wirtschaftsseiten der Zeitungen füllen, sind sehr trügerisch. Sie tragen nur dazu bei, den katastrophalen Zustand des amerikanischen Kapitalismus zu verschleiern, der sich in den kommenden Monaten nur verschlechtern kann und dann wohl als das offizielle Datum des Eintritts der Wirtschaft in die Rezession dargestellt werden wird.
Es ist wichtig zu sehen, dass die gegenwärtige Krise keinesfalls eine ansonsten „gute Gesundheit" der US-amerikanischen Wirtschaft widerspiegelt, die gerade eine schlechte Phase in einem ansonst normalen Zyklus von Expansion und Rezession durchmacht. Was wir heute erleben, sind Erschütterungen eines Systems, das sich in einer permanenten Krise befindet und das ab und zu durch trügerische Heilmittel kurze Momente der Erholung erlebt, die dann den nächsten Absturz noch schlimmer machen.
Das ist die Geschichte des amerikanischen Kapitalismus - und des Kapitalismus insgesamt - seit dem Ende der 1960er Jahre und der Rückkehr der offenen Wirtschaftskrise. Während vier Jahrzehnten, durch Phasen des Aufschwungs und der offiziell anerkannten Rezession hat die gesamte Wirtschaft den Schein, dass sie funktioniere, nur dank staatskapitalistischer Maßnahmen auf den Ebenen der Geld- und der Steuerpolitik aufrecht erhalten können, die die Regierungen gezwungen sind zu ergreifen, um die Auswirkungen der Krise zu bekämpfen. Aber die Lage ist nicht statisch geblieben. Während all diesen Jahren der Krise und der Staatsinterventionen zu deren Management hat die Wirtschaft so viele Widersprüche angehäuft, dass heute eine reale Gefahr einer wirtschaftlichen Katastrophe besteht, wie sie in der Geschichte des Kapitalismus noch nie zu sehen war.
Nach dem Zerplatzen der Internet- und Technologieblase 2000-2001 hat sich die Bourgeoisie in eine neue Blase geflüchtet, diejenige des Immobilienmarktes. Obwohl die Spitzenbereiche des industriellen Sektors, wie die Autoindustrie oder die Flugzeugherstellung, weiterhin Pleiten erlebten, schaffte der Immobilienboom der letzten fünf Jahre die Illusion einer expandierenden Ökonomie. Doch dieser Boom hat sich nun in einen Krach verwandelt, der das ganze Gebäude des kapitalistischen Systems erschüttert und der in der Zukunft Auswirkungen haben wird, die noch niemand voraussehen kann.
Nach den jüngsten Daten sind sämtliche Transaktionen im privaten Immobilienbereich ins Trudeln geraten. Die Erstellung von Neubauten ist schon um rund 40% zusammengebrochen im Vergleich zum Kulminationspunkt im Jahr 2006, und die Verkäufe sind noch schneller abgesackt, was einen Preiseinbruch nach sich gezogen hat. Der Preis der Häuser ist im ganzen Land um 13% gesunken seit dem Höhepunkt 2006, und es wird erwartet, dass er um weitere 15 bis 20% fallen wird, bis er die Talsohle erreicht hat. Der Immobilienboom hinterlässt eine gewaltige Anzahl von leerstehenden Wohnungen, die nicht verkauft worden sind - ungefähr 2,1 Millionen, also etwa 2,6% der Gesamtzahl im ganzen Land. Im letzten Jahr waren die Zwangsversteigerungen im Großen und Ganzen auf die Subprime-Hypothekarkredite beschränkt, die Leuten gewährt worden waren, denen im Grunde genommen die Mittel fehlten, um sie zurück zu bezahlen. Etwa ein Viertel dieser Darlehen befanden sich im letzten November im Zahlungsstopp. Die Zahlungsunfähigkeit beginnt jetzt aber zunehmend auch diejenigen zu ergreifen, deren finanzielle Lage noch relativ gut ist. Im November befinden sich 6,6% der Schuldner im Zahlungsverzug, wenn nicht sogar im Verfahren der Zwangsversteigerung. Ein schlechtes Vorzeichen ist, dass der Höhepunkt der Immobilienzwangsversteigerungen stattfindet, noch bevor die Zinssätze auf den Hypothekarkrediten erhöht werden. Mit dem Zusammenbruch der Immobilienpreise, der mit der Krise einhergeht, erlaubt der Wert der Häuser vieler Leute nicht mehr die Rückzahlung ihrer Hypothekarschulden, so dasss ihnen der Verkauf des Hauses nicht nur keinen Gewinn einbrächte, sondern ihnen sogar noch eine Schuld aufbürdete. Das führt zu einer Situation, in welcher es finanziell gesehen klüger ist, seine Verpflichtungen loszuwerden, indem man Privatkonkurs erklärt.
Das Platzen der Immobilienblase zieht den Finanzsektor in Mitleidenschaft. Bis jetzt hat die Immobilienkrise bei den größten Finanzinstituten Verluste von mehr als 170 Milliarden Dollar verursacht. Milliarden von Dollar an Börsenwerten sind vernichtet, die Wall Street erschüttert worden. Unter den Großen, die 2007 mindestens ein Drittel ihres Wertes verloren haben, kann man Fannie Mae, Freddie Mac, Bear Stearns, Moody's und Citigroup nennen.[iii] MBIA, eine Gesellschaft, die sich auf die Garantie der finanziellen Gesundheit anderer Gesellschaften spezialisiert hat, hat fast drei Viertel ihres Wertes verloren! Verschiedene Firmen, die im Bereich der Hypothekarkredite tätig und an der Börse besonders hoch kotiert gewesen sind, sind bankrott gegangen.
Und dies ist erst der Anfang. Mit der zu erwartenden Zunahme der Zwangsversteigerungen in den nächsten Monaten werden die Banken weitere Verluste einstecken müssen, und die plötzliche Knappheit an Krediten (der credit crunch) wird sich weiter zuspitzen, was auch die anderen Bereiche der Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen wird.
Von der Immobilienkrise zur Kreditkrise
Außerdem stellt die Finanzkrise, die mit den Hypothekarkrediten zusammenhängt, nur die Spitze des Eisbergs dar. Die unvorsichtigen Kreditpraktiken, die den Immobilienmarkt beherrscht haben, gelten auch in den Bereichen der Kreditkarten und des Autokredits, in denen sich die Probleme ebenfalls ausbreiten. Und genau diese Bereiche stellen den Kern der gegenwärtigen „Gesundheit" des Kapitalismus dar. Sein kleines, ja nicht zu verratendes Geheimnis ist die Perversion des Kreditmechanismus mit dem Zweck, dem Mangel an zahlungsfähigen Märkten zu begegnen, auf denen er seine Waren verkaufen muss. Der Kredit ist wesentlich das Mittel geworden, die Wirtschaft künstlich aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass das System unter dem Gewicht seiner historischen Krise zusammenbricht. Ein Mittel, das bereits seine Grenzen und Risiken offenbart hat: Schon in den 80er Jahren folgte die Finanzkrise der Pleite der Staaten in Lateinamerika, die mit gewaltigen Darlehen eingedeckt worden waren, die sie nie und nimmer zurückzahlen konnten; der Zusammenbruch der asiatischen Tiger und Drachen in den Jahren 1997 und 1998 stellte eine Wiederholung der Geschichte dar. In der Tat war die Immobilienblase selbst eine Reaktion auf das Platzen der Internetblase und ein Versuch, diesen Schlamassel zu überwinden.
Die derzeitige Finanzkrise hat ganz andere Ausmaße, die sich aus der schleichenden Spekulation ergeben, welche die Immobilienblase begleitet hat. Es handelt sich dabei nicht um eine nebensächliche Spekulation eines Investors, der ein Haus kauft, um es bei steigenden Preisen gleich wieder mit Gewinn weiter zu verkaufen. Das ist eine Lappalie. Was ins Gewicht fällt, ist vielmehr die Spekulation im großen Stil, die alle Finanzinstitute durch Verbriefung[iv] und Verkauf von Hypothekarforderungen an den Börsen betreiben. Die Mechanismen dieser Abläufe werden nicht genau durchschaut, sie ähneln in vielerlei Hinsicht dem Ponzi-Trick.[v] Was diese gewaltige Spekulation aufzeigt, ist das Ausmaß, in dem die Wirtschaft eine „Kasino-Wirtschaft" geworden ist, in der das Kapital nicht mehr in der realen Produktion investiert, sondern für Wetten eingesetzt wird.
Die derzeitige Krise enthüllt den Betrug des Liberalismus und die Wirklichkeit des Staatskapitalismus
Die amerikanische Bourgeoisie stellt sich gerne als ideologischen Weltmeister des Liberalismus dar. Diese Haltung ist ihrerseits höchst ideologisch. Die Wirtschaft ist durch und durch geprägt von der staatlichen Intervention. Darum geht es in der gegenwärtigen „Debatte" der Bourgeoisie über die Art und Weise, wie die in Bedrängnis geratene Wirtschaft zu verwalten sei. Grundsätzlich wird nichts Neues vorgeschlagen. Dieselben alten währungs- und steuerpolitischen Maßnahmen werden angewandt in der Hoffnung, die Wirtschaft damit zu stimulieren.
Was gegenwärtig gemacht wird, um die Krise abzufedern, läuft auf die altbekannte Methode hinaus - die alten Programme des schnellen Geldes und einfachen Kredits werden lanciert, um der Wirtschaft wieder etwas Boden unter den Füssen zu verschaffen. Die amerikanische Antwort auf den credit crunch (Kreditklemme) lautet: noch mehr Kredit! Die amerikanische Notenbank hat nun seit September 2007 fünfmal den Zinssatz gesenkt und scheint bereit, dies ein weiteres Mal an der für März vorgesehenen Sitzung zu tun. Da die Notenbank weiß, dass dieses Heilmittel nichts ausrichtet, hat sie ihre Intervention auf den Kapitalmärkten erhöht und den an flüssigen Mitteln notleidenden Finanzinstituten billiges Geld angeboten - 200 Milliarden Dollar zusätzlich zu den im letzten Dezember schon angebotenen Milliarden.
Das Weiße Haus und der Kongress haben ihrerseits auch schnell Ankurbelungsmaßnahmen (unter der Bezeichnung „economic stimulus package") vorgeschlagen, die im Wesentlichen auf Steuerreduktionen für Familien und -nachlasse für Unternehmen hinauslaufen und ein Gesetz beinhalten, das die Epidemie der ausbleibenden Schuldentilgung bei Hypotheken eindämmen und den ausgebluteten Immobilienmarkt wiederbeleben soll. Doch angesichts des Ausmaßes der Immobilien- und Finanzkrise wird die Lösung einer massiven staatlichen Sanierung des ganzen Immobiliendebakels immer ernsthafter in Betracht gezogen. Die ungeheuren Kosten einer solchen Maßnahme würden die Summen, die der Staat 1990 zur Rettung der Saving and Loans Industry (Sparkassensystem) zur Verfügung stellte - 124,6 Milliarden Dollar -, als lächerlich erscheinen lassen.
Wie groß die Anstrengungen des Staates, die Krise zu verwalten, schließlich sein werden, bleibt abzuwarten. Offensichtlich ist, dass der Spielraum der Bourgeoisie für ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen je länger je enger wird. Nach Jahrzehnten des Krisenmanagements führt die amerikanische Bourgeoisie eine sehr kranke Wirtschaft. Der gewaltige staatliche und private Schuldenberg, das Bundeshaushaltsdefizit, die Zerbrechlichkeit des Finanzsystems und das enorme Außenhandelsdefizit - all das treibt die Schwierigkeiten der Bourgeoisie, dem Zusammenbruch des Systems zu begegnen, auf die Spitze. In der Tat haben die herkömmlichen Mittel der Regierung, um der Wirtschaft ein wenig neues Leben einzuhauchen, bis jetzt nichts gefruchtet. Im Gegenteil scheinen sie die Krankheit zu verschlimmern, die sie angeblich heilen sollen. Trotz den Anstrengungen der Notenbank, die Kreditvergabe zu entkrampfen, den Finanzsektor zu stabilisieren und den Immobilienmarkt wieder zu beleben, sind Kredite schwierig zu erhalten und teuer. Die Wall Street befindet sich pausenlos auf einer Achterbahn mit gewaltigen Ausschlägen und einer vorherrschenden Tendenz nach unten.
Außerdem trägt die Notenbank-Politik des billigen Geldes zum Wertverlust des Dollars bei, der alle Wochen neue Negativrekorde gegenüber dem Euro und anderen Währungen aufstellt und die Preise der Waren wie des Erdöls steigen lässt. Die Erhöhung der Preise für Energie, Nahrungsmittel und andere Waren, während sich gleichzeitig die Wirtschaft verlangsamt, treibt die Angst bei den „Experten" vor einer „Stagflationsphase" der amerikanischen Wirtschaft an. Die derzeitige Inflation schränkt bereits den Konsum der Bevölkerung ein, die versucht, mit Einkommen zu leben, die nicht steigen und die Arbeiterklasse und andere Sektoren der Bevölkerung zwingen, den Gurt enger zu schnallen.
Die Angriffe gegen die Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten
Die Nachricht des amerikanischen Arbeitsdepartements vom 7. März, dass 63.000 Arbeitsplätze im Land im Laufe des Monats Februar verloren gingen, alarmierte den Bourgeois. Natürlich nicht deshalb, weil er sich über das Schicksal der entlassenen Arbeiter Sorgen macht, sondern weil dieser starke Abbau die schlimmsten Albträume der Wirtschaftsexperten von der Vertiefung der Krise bestätigt. Es war der zweite Beschäftigungsrückgang in Folge und der dritte im Privatsektor. Wie eine Art schlechter Witz auf Kosten der Arbeitslosen mutet an, dass die Quote der Gesamtarbeitslosigkeit von 4,9 auf 4,8% zurückging. Wie war dies möglich? Es geschah aufgrund eines statistischen Tricks, den die Bourgeoisie benützte, um die Zahl der Arbeitslosen zu tief zu veranschlagen. Für die amerikanische Regierung bist du nur dann ein Arbeitsloser, wenn du keine Arbeit hast und während dem vergangenen Monat aktiv einen Arbeitsplatz gesucht hast und bereit bist, im Zeitpunkt der Umfrage zu arbeiten. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen unterschätzen denn auch erheblich die Beschäftigungskrise. Sie ignorieren die Millionen amerikanischer Arbeiter, die „entmutigt" sind, nachdem sie ihre Arbeit verloren und die Hoffnung aufgegeben haben, eine neue zu finden; die folglich in den letzten 30 Tagen vor der Umfrage keine neue Stelle gesucht haben; oder die zwar arbeiten wollen, aber zu entmutigt sind, es zu versuchen, da die Anstellung zu erdrückend ist; oder die schlicht nicht für die Hälfte des früheren Lohnes arbeiten wollen; oder (auch dies Millionen) die ganztags arbeiten wollen, aber nur Teilzeitarbeitsstellen finden. Wenn man all diese Arbeiter in die Arbeitslosenstatistiken aufnehmen würde, wäre die Quote deutlich höher. Um die Arbeitslosenziffern noch weiter nach unten zu frisieren, wird seit dem geschickten Trick der Statistiker Ronald Reagans das Militärpersonal in den Vereinigten Staaten zur Arbeitskraft des Landes gerechnet (zuvor ist die Arbeitslosigkeit nur ins Verhältnis zur zivilen Arbeitskraft gestellt worden). Diese Manipulation lässt die Zahl der „Beschäftigten" um etwa zwei Millionen ansteigen.
Der derzeitige Zustand der amerikanischen Wirtschaft lässt Katastrophales für die Ökonomie auf Weltebene befürchten. Die wichtigste Volkswirtschaft der Welt wird auch ihre Mitstreiter hinunter ziehen. Es gibt keine wirtschaftliche Lokomotive, die den Taucher der USA wettmachen und die Weltwirtschaft auf Kurs halten könnte. Der Rückgang des Kredits wird den Welthandel untergraben, der Zusammenbruch des Dollars wird die Importe der USA einschränken, was wiederum die wirtschaftliche Lage der anderen Länder verschlimmern wird. Die Angriffe auf die Lebensbedingungen des Proletariats werden überall brutaler. Wenn es in diesem düsteren Panorama einen Lichtblick gibt, so ist es die durch diese Lage vorangetriebene Rückkehr des Proletariats auf den Boden des Klassenkampfs gegen den Kapitalismus; die Arbeiterklasse wird gezwungen, sich gegen die verheerenden Auswirkungen der kapitalistischen Krise zu Wehr zu setzen.
Die Perspektive der Beschleunigung und Vertiefung der Krise des Kapitalismus geht einher mit der Aussicht auf eine Entwicklung des Klassenkampfs, der seinerseits über die Schritte, die das Proletariat seit der historischen Wiederaufnahme der Klassenkämpfe Ende der 1960er Jahre getan hat, hinausgehen muss.
ES/JG, 14. März 2008
[i] Siehe dazu unseren Artikel in der Internationalen Revue Nr. 40 „Finanzkrise: Von der Liquiditätskrise zur Liquidierung des Kapitalismus!"
[ii] Ein schlecht platzierter Optimismus scheint das Markenzeichen amerikanischer Präsidenten zu sein. Auch Richard Nixon erklärte 1969, zwei Jahre bevor die Krise die USA zwang die Bindung an den Dollar und das gesamte System von Bretton Woods aufzulösen, folgendes: „Wir haben endlich gelernt eine moderne Wirtschaft zu entwickeln die ein kontinuierliches Wachstum erlaubt". Einer seiner Vorgänger, Calvin Coolidge, hatte vor dem amerikanischen Kongress am 4. Dezember 1928 (also kurz vor der Krise von 1929) erklärt: „Kein je versammelter US-Kongress der den Stand der Nation betrachtetet konnte je eine komfortablere Situation wie die heutige feststellen...(Das Land) kann die Gegenwart mit Befriedigung betrachten und der Zukunft mit Optimismus entgegensehen."
[iii] Dieser Artikel ist unmittelbar vor der Ankündigung geschrieben worden, dass Bear Stearns - die fünftgrößte Handelsbank der USA - an JP Morgan Chase zu 2 Dollar pro Aktie verkauft wird, was bedeutet, dass die Bank 98% ihres einstigen Wertes verloren hat.
[iv] Verbriefung bedeutet die Verwandlung von Forderungen (zukünftigen Zahlungen) oder Eigentumsrechten in handelbare Wertpapiere.
[v] Im englischen Sprachraum wird mit „Ponzi Scheme" (Ponzi-Trick) ein Schneeballsystem bezeichnet. Charles Ponzi war ein Immobilienbetrüger in Kalifornien. Ein Schneeballsystem ist ein Geschäftsmodell, bei dem ständig mehr Leute mitmachen müssen, damit es funktioniert. Gewinne für die Teilnehmer entstehen dadurch, dass neue Teilnehmer einsteigen und Geld investieren.
Geographisch:
- Vereinigte Staaten [326]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Mai 68 und die revolutionäre Perspektive Die weltweite Studentenbewegung in den 1960er Jahren
- 5170 Aufrufe
Im Januar 1969 erklärte der Präsident
der USA, Richard Nixon, bei seiner Amtsübernahme: „Wir haben endlich gelernt,
eine Wirtschaft so zu gestalten, dass ihr ständiges Wachstum sichergestellt
ist.“ Rückblickend können wir sehen, in welchem Maße dieser Optimismus durch
die Wirklichkeit brutal widerlegt wurde. Schon zu Beginn seiner zweiten
Amtszeit, vier Jahre später, schlitterten die USA in die schlimmste Rezession
seit dem 2. Weltkrieg. Dieser folgten viele andere, die alle jeweils
verheerender waren als die vorhergehenden. Aber was weltfremden Optimismus
angeht, so war Nixon ein Jahr zuvor von
einem viel erfahreneren Staatschef übertroffen worden – dem General de Gaulle,
seit 1958 Präsident der französischen Republik und Führer des „freien
Frankreich“ während des 2. Weltkriegs. Hatte der große Führer in seiner
Neujahresansprache nicht erklärt: „Ich begrüße das Jahr 1968 mit großer Ruhe
und Frieden“. In seinem Falle vergingen keine vier Monate, bevor der Optimismus
verflogen war. Vier Monate reichten, bis die Ruhe des Generals der größten
Verwirrung wich. De Gaulle musste nicht nur einer gewalttätigen und massiven
Studentenrevolte entgegentreten, sondern auch dem größten Streik in der
Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung. 1968 war also nicht nur kein
Jahr der Ruhe und des Friedens für Frankreich, sondern es war und bleibt bis
heute das Jahr mit den größten Erschütterungen seit dem 2. Weltkrieg. Aber nicht
nur in Frankreich kam es in jenem Jahr zu großen Erschütterungen. Zwei Autoren,
denen man keinen Vorwurf der Beschränkung des Blickes auf Frankreich machen
kann, der Engländer David Caute und der Amerikaner Mark Kulansky, machen dazu
eindeutige Aussagen: „1968 war das turbulenteste Jahr seit dem
Ende des 2. Weltkriegs. Reihenweise kam es zu Aufständen in Amerika und
Westeuropa, bis hin zur Tschechoslowakei. Durch sie wurde die
Weltnachkriegsordnung in Frage gestellt.“[i] „Zuvor hatte es kein Jahr wie 1968 gegeben. Und
wahrscheinlich wird es ein Jahr mit solchen Ereignissen nicht mehr geben. Zu
einer Zeit, als die Nationen und Kulturen noch gespalten und sehr
unterschiedlich waren, (…) tauchte ein rebellischer Geist spontan auf der
ganzen Welt auf. Zuvor hatte es schon andere Revolutionsjahre gegeben: 1848 zum
Beispiel; aber im Gegensatz zu 1968 waren die Ereignisse auf Europa beschränkt
geblieben…“[ii] Während
gegenwärtig 40 Jahre nach diesem „heißen Jahr“ in mehreren Ländern eine
wahre Flut von Berichten in der Presse und im Fernsehen zu diesem Thema
präsentiert wurde, müssen die Revolutionäre auf die wichtigsten Ereignisse von
1968 zurückkommen, nicht so sehr um diese hier detailliert und erschöpfend
wieder aufzurollen, sondern um die wirkliche Bedeutung dieser Ereignisse
herauszuarbeiten[iii]. Insbesondere müssen sie gegenüber einer heute sehr weit
verbreiteten Idee Stellung beziehen, die auch auf der Umschlagseite des Buches
von Kurlansky aufgegriffen wird: „Sowohl Historiker als auch
Politikwissenschaftler – die Experten der Sozialwissenschaften auf der ganzen
Welt sind sich darin einig, dass man zwischen einem Vor-1968 und einem
Nach-1968 unterscheiden kann.“ Um es gleich vorweg zu sagen, wir teilen diese
Einschätzung, aber sicher nicht aus den gleichen Gründen, wie man sie immer
wieder hört: Weil es zu einer „sexuellen Befreiung“, der „Frauenbefreiung“, der
Infragestellung familiärer autoritärer Strukturen, der „Demokratisierung“
bestimmter Institutionen (wie der Universität), der Entwicklung neuer
Kunstformen usw. gekommen sei. Deshalb wollen wir in diesem Artikel die
wirklichen Umwälzungen aufzeigen, die aus der Sicht der IKS im Jahre 1968
stattfanden.
Neben einer ganzen Reihe von als solchen schon wichtigen Ereignissen (wie z.B. die Tet-Offensive der Vietcong im Februar, welche zwar schlussendlich von der US-Armee abgewehrt wurde, dennoch deutlich machte, dass die USA den Krieg in Vietnam niemals gewinnen könnten oder auch der Einmarsch sowjetischer Panzer in der Tschechoslowakei im August 1968) war das Jahr 1968 – wie Caute und Kurlansky hervorheben – durch diesen „Geist der Rebellion, welcher auf der ganzen Welt zu spüren war, geprägt“. Bei dieser Infragestellung der bestehenden Ordnung muss man zwischen zwei Komponenten unterscheiden, die sowohl unterschiedliche Ausmaße als auch unterschiedliche Bedeutungen annahmen.
Es handelte sich einerseits um die Studentenrevolte, die fast alle Länder des westlichen Blocks erfasste, und die sich in einem gewissen Maße gar bis in die damaligen Ostblockstaaten ausbreitete. Die andere Komponente war der massive Kampf der Arbeiterklasse, der sich im Jahre 1968 im Wesentlichen nur in einem Land, Frankreich, entwickelte.
In diesem ersten Artikel werden wir ausschließlich diese erste Komponente untersuchen, nicht weil sie die wichtigste wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Sie entfaltete sich lediglich vor den Arbeiterkämpfen. Der Kampf der Arbeiter sollte eine besondere historische Bedeutung erlangen, die weit über die Bedeutung der Studenten-revolten hinausging.
Die Studentenbewegung – weltweit
Im mächtigsten Land der Erde, den USA, entfalteten sich damals ab 1964 die massivste und radikalste Bewegung jener Zeit. Insbesondere an der Universität Berkeley, im Norden Kaliforniens, breiteten sich die Studentenproteste zum ersten Mal in größerem Umfang aus. Die von den Studenten erhobene Hauptforderung war die der „free speech movement“ (Bewegung für Redefreiheit) zugunsten der freien politischen Äußerung in den Universitäten.
Gegenüber den gut ausgerüsteten Anwerbern der US-Armee wollten die protestierenden Studenten Propaganda gegen den Vietnamkrieg und gegen die Rassentrennung betreiben (all dies spielte sich ein Jahr nach dem „Marsch für die Bürgerrechte“ am 28.8.1963 in Washington ab, auf dem Martin Luther King seine berühmte Rede „I have a dream“ hielt). Anfänglich reagierten die Behörden sehr repressiv, insbesondere durch den Einsatz von Polizeikräften gegen die „Sit-ins“, die friedliche Besetzung der Uniräume, wobei 800 Studenten verhaftet wurden. Anfang 1965 gestattete die Universitätsleitung politische Aktivitäten an der Uni, die damit zu einem Hauptzentrum des Studentenprotestes in den USA wurden. Gleichzeitig wurde damals Ronald Reagan 1965 unerwartet zum Gouverneur von Kalifornien mit der Parole gewählt „Räumen wir mit der Unordnung in Berkeley auf“. Die Bewegung erlebte einen mächtigen Auftrieb und radikalisierte sich in den darauf folgenden Jahren durch die Proteste gegen die Rassentrennung, für die Verteidigung der Frauenrechte und vor allem gegen den Vietnamkrieg. Während gleichzeitig viele junge Amerikaner, vor allem Studenten, scharenweise ins Ausland flüchteten, um einer Einberufung nach Vietnam zu entgehen, wurden die meisten Universitäten des Landes zum Schauplatz von Antikriegsbewegungen, während gleichzeitig die gewaltsamen Aufstände in den schwarzen Ghettos der Großstädte aufflammten (der Anteil junger Schwarzer, die in den Vietnamkrieg geschickt wurden, lag viel höher als der nationale Durchschnitt der nach Vietnam-Einberufenen).
Diese Protestbewegungen wurden oft
grausam unterdrückt. So wurden Ende 1967 952 Studenten zu langjährigen
Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie sich geweigert hatten, der Einberufung
nach Vietnam Folge zu leisten. Am 8. Februar 1968 wurden 3 Studenten während
einer Demonstration für die Bürgerrechte in Süd Carolina getötet. 1968
breiteten sich die Bewegungen am stärksten aus. Im März besetzten schwarze
Studenten in der Universität Howard in Washington vier Tage lang das
Uni-Gelände. Vom 23. bis 30. April 1968 wurde die Columbia-Universität von New
York aus Protest gegen die Zusammenarbeit mit dem Pentagon und aus Solidarität
mit den Bewohnern des schwarzen Ghettos von Harlem besetzt. Die Unzufriedenheit
und Radikalisierung nahmen weiter durch die Ermordung Martin Luther Kings am
4. April weiter zu, die zahlreiche gewalttätige Zusammenstöße in den schwarzen
Ghettos des Landes auslösten. Die Besetzung der Columbia-Universität war einer
der Höhepunke der Studentenproteste in den USA, was wiederum neue Zusammenstöße
hervorrief.
Im Mai traten die Studenten von 12 Universitäten in den Streik, um gegen den Rassismus und den Vietnamkrieg zu protestieren. Im Sommer geriet Kalifornien in den Sog der Bewegung. Zwei Nächte lang kam es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Studenten in der Universität Berkeley, wonach der Gouverneur Kaliforniens, Ronald Reagan, den Notstand ausrief und ein Ausgehverbot verhängte. Diese neue Welle von Zusammenstößen erreichte ihren Höhepunkt nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem 22. und 30. August in Chicago, als es während der Konferenz der Demokratischen Partei zu großen gewaltsamen Auseinandersetzungen kam.
Die Revolten der amerikanischen Studenten breiteten sich in der gleichen Zeit auf viele andere Länder aus.
Auf dem amerikanischen Kontinent selbst traten die Studenten in Brasilien und in Mexiko am aktivsten auf den Plan.
Immer wieder kam es 1967 in Brasilien zu Kundgebungen gegen die brasilianischen und amerikanischen Regierungen. Am 28. März griff die Polizei gegen Studenten ein und tötete einen von ihnen, Luis Edson; mehrere wurden schwer verletzt, von denen wiederum einer einige Tage später verstarb. Das Begräbnis von Luis Edson am 29. März schlug in eine gewaltige Demonstration um. Von der Universität Rio de Janeiro, welche in einen unbefristeten Streik trat, dehnte sich die Bewegung über die Universitäten in Sao Paulo aus, wo Barrikaden errichtet wurden. Am 30. und 31. Märzen fanden erneut Kundgebungen im ganzen Land statt. Am 4. April wurden in Rio ca. 600 Menschen verhaftet. Trotz einer heftigen Repression und massenhafter Verhaftungen fanden fast täglich Demonstrationen bis Oktober 1968 statt.
Einige Monate später wurde Mexiko erfasst. Ende Juli brach in Mexiko Stadt eine Studentenrevolte aus. Als Reaktion setzte die Polizei Panzer ein. Der Polizeichef der Hauptstadt rechtfertige die Repression folgendermaßen : Man muss einer „subversiven Bewegung“ entgegentreten, welche „am Vorabend der 19. Olympischen Spiele dazu neigt, eine Atmosphäre der Feindschaft gegenüber unserer Regierung zu erzeugen.“ Die Repression ging weiter und wurde sogar noch verschärft. Am 18. September wurde das Universitätsgelände von der Polizei besetzt. Am 21. September verhaftete die Polizei im Verlaufe von neuen Zusammenstößen in der Hauptstadt 736 Personen. Am 30. September wurde die Universität Veracruz besetzt. Am 2. Oktober schließlich ließ die Regierung auf eine Studentendemonstration mit ca. 10.000 Teilnehmern auf dem Platz der Drei Kulturen in Mexiko schießen; dabei kamen paramilitärische Kräfte ohne Uniform zum Einsatz. Bei dieser Niederschlagung, die als „das Massaker von Tlatelolco“ in Erinnerung blieb, wurden mindestens 200 Teilnehmer getötet, mehr als 500 schwer verletzt und über 2000 verhaftet. Dem Präsidenten Díaz Ordaz gelang es somit, die am 12. Oktober begonnenen Olympischen Spiele „in Ruhe“ durchzuführen. Nach der „Zwangspause“ der Olympischen Spiele setzten die Studenten ihre Bewegung jedoch noch einige Monate lang fort.
Aber nicht allein der amerikanische Kontinent wurde von dieser Welle von Studentenrevolten ergriffen. Tatsächlich waren alle Kontinente betroffen.
So kam es in Asien in Japan zu besonders spektakulären Bewegungen. Seit 1963 fanden gewalttätige Demonstrationen gegen die USA und den Vietnamkrieg statt, die hauptsächlich von den Zengakuren (Nationaler Verband der autonomen Komitees der japanischen Studenten) getragen wurden. Am Ende des Frühjahrs 1968 erreichten die Studentenproteste die Schulen und Universitäten. Ein Schlachtruf lautete: „Wandeln wir den Kanda [Universitätsviertel von Tokio] in ein Quartier Latin um.“ Nachdem sich der Bewegung Arbeiter angeschlossen hatten, erreichte diese im Oktober 1968 ihren Höhepunkt. Am 9. Oktober prallten in Tokio, Osaka und Kyoto Polizisten und Studenten aufeinander – 80 Menschen wurden verletzt, 188 verhaftet. Das Antiaufstandsgesetz wurde verabschiedet – dagegen protestierten ca. 800.000 Menschen auf der Straße. Als Reaktion auf das Eingreifen der Polizei in der Tokioter Uni gegen die Besetzung derselben traten am 25. Oktober 6000 Studenten in den Ausstand. Mitte Januar 1969 fiel dann allerdings die Tokioter Uni, die letzte Bastion der Studentenbewegung.
In Afrika ragten insbesondere zwei Länder heraus: Senegal und Tunesien.
Im Senegal prangerten die Studenten den Rechtsdrall der Regierung und den neokolonialen Einfluss Frankreichs an und forderten die Umstrukturierung der Universitäten. Am 29. Mai 1968 wurde der Generalstreik der Studenten und Arbeiter von Léopold Sédar Senghor, Mitglied der ‚Sozialistischen Internationale’ mit Hilfe der Armee niedergeschlagen. Bei der Repression wurde in der Uni Dakar ein Mensch getötet und 20 verletzt. Und am 12. Juni wurde erneut bei einer Studenten- und Schülerdemo in den Vororten von Dakar ein Mensch getötet.
In Tunesien fing die Bewegung 1967 an. Am 5. Juni wurde bei einer Demonstration gegen die USA und Großbritannien, welche beschuldigt wurden, Israel gegen die arabischen Staaten zu unterstützen, das Amerikanische Kulturzentrum verwüstet und die britische Botschaft angegriffen. Ein Student, Mohamed Ben Jennet, wurde verhaftet und zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Am 17. November protestierten Studenten zahlreich gegen den Vietnamkrieg. Vom 15.–19. März 1968 traten die Studenten in den Streik und forderten die Freilassung Mohamed Ben Jennets. Schließlich wurde die Bewegung durch eine Reihe von Verhaftungen niedergeschlagen.
... Europa ...
Aber in Europa entfaltete sich die reifste und spektakulärste Bewegung.
In Großbritannien fing es schon Ende 1966 in der sehr respektablen „London School of Economics“ an zu brodeln, die eine Hochburg der bürgerlichen Wirtschaftsschulen ist, als die Studenten gegen die Nominierung einer Persönlichkeit zum Präsidenten ihrer Schule protestierten, die für ihre Beziehungen zum rassistischen Regime des damaligen Rhodesiens und Südafrikas bekannt war. Später wurde die LSE immer wieder von Protestbewegungen heimgesucht. So gab es beispielsweise im März 1967 ein sit-in von fünf Tagen gegen Disziplinarmaßnahmen, in deren Anschluss, dem amerikanischen Vorbild folgend, eine „Freie Universität“ gebildet wurde. Im Dezember fanden in der Regent Street Polytechnic und im Holborn College of Law and Commerce Sit-ins statt, welche eine Studentenvertretung in der College Leitung forderten. Im Mai wurde die Universität Essex, das Hornsey College of Art in Hull, Bristol und Keele besetzt ; diesen folgten andere Bewegungen in Croydon, Birmingham, Liverpool, Guildford und im Royal College of Arts.
Die spektakulärsten Demonstrationen (an denen sich viele Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund und unterschiedlichen Auffassungen beteiligten) waren die gegen den Vietnamkrieg: Im März und Oktober 1967, im März und Oktober 1968 (letztere war die zahlenmäßig größte); alle führten zu gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei. Dabei gab es jeweils Hunderte von Verletzten und Verhaftungen vor der US-Botschaft am Grosvenor Square.
In Belgien zogen die Studenten von April 1968 an mehrfach auf die Straße, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren und Verbesserungen des Bildungswesens zu fordern. Am 22. Mai wurde die Freie Universität Brüssel besetzt und zur für das „Volk offenen Universität“ erklärt. Das Gelände wurde Ende Juni wieder geräumt, nachdem der Akademische Rat der Uni auf einige ihrer Forderungen eingegangen war.
In Italien wurden ab 1967 immer mehr Universitäten besetzt, auch gab es regelmäßig Zusammenstöße zwischen Polizei und Studenten. Die Universität Rom wurde im Februar 1968 besetzt. Die Polizei räumte das Gelände; daraufhin zogen die Studenten zu den Gebäuden der Architektur in der Villa Borghese. Schließlich kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen, die unter dem Namen “Schlacht von Valle Grulia” bekannt wurden. Gleichzeitig protestierten spontan Beschäftigte der Industriebranchen, in denen die Gewerkschaften schwach waren (in dem Marzotto-Werk in Venezien). Darauf hin proklamierten die Gewerkschaften einen eintägigen Generalstreik in der Industrie, an dem sich viele Beschäftigte beteiligten. Schließlich bedeuteten die Wahlen im Mai das Ende der Bewegung, die schon ab dem Frühjahr abflachte.
Im Spanien Francos entfaltete sich ab 1966 eine Welle von Arbeiterstreiks und Universitätsbesetzungen. 1967 schwoll die Bewegung weiter stark an; sie setzte sich bis ins Jahr 1968 fort. Studenten und Arbeiter zeigten sich jeweils solidarisch, wie z.B. am 27. Januar 1967, als 100.000 Demonstranten gegen die brutale Repression gegen die Teilnehmer an einer Demonstration in Madrid protestierten, bei denen die Studenten, die sich ins Gebäude der Wirtschaftswissenschaften zurückgezogen hatten, sich mit der Polizei sechs Stunden lang Auseinandersetzungen lieferten. Die Behörden setzten alle Mittel gegen die Protestierer ein. Die Presse wurde kontrolliert, die Mitglieder der Bewegung und im Untergrund tätige Gewerkschafter wurden verhaftet. Am 28. Januar 1968 errichtete die Regierung in jeder Uni eine “Universitätspolizei”. Diese konnte jedoch die Studentenbewegung nicht an der Fortsetzung ihres Widerstandes gegen den Vietnamkrieg und das Franco-Regime hindern. Darauf hin wurde die Universität von Madrid im März geschlossen.
Von allen Ländern Europas war die Studentenbewegung in Deutschland am stärksten.
In Deutschland entstand Ende 1966 eine „Außerparlamentarische Opposition“, insbesondere als Reaktion auf die Beteiligung der Sozialdemokratie an der Regierung. Die APO stützte sich insbesondere auf studentische Vollversammlungen, in denen man in hitzigen Debatten über Mittel und Wege des Protestes stritt. An vielen Universitäten bildeten sich – dem US-Vorbild folgend – Diskussionsgruppen, als Gegenpol zur „etablierten“, bürgerlichen wurde die „kritische Universität“ gegründet. In dieser Phase wurde eine alte Tradition der Debatte, der Diskussionen in öffentlichen Vollversammlungen zum Teil wiederbelebt. Auch wenn sich viele durch den Drang zum spektakulären Handeln angezogen fühlten, blühte wieder das Interesse an Theorie, an der Geschichte revolutionärer Bewegungen auf und der Mut an den Gedanken der Überwindung des Kapitalismus auf. Bei vielen keimte Hoffnung auf andere Gesellschaft auf. Die Protestbewegung in Deutschland galt international als am „theo-retischsten, am meisten in den Diskussionen in die Tiefe gehend, am politischsten“.
Parallel zu diesen Diskussionen fanden zahlreiche Protestkundgebungen statt. Der Vietnamkrieg war sicherlich die Haupttriebkraft in einem Land, dessen Regierung die US-Militärmacht voll unterstützte, welches aber auch vom 2. Weltkrieg nachhaltig geprägt worden war. Am 17./18. Februar 1968 wurde in West-Berlin ein Internationaler Vietnam-Kongress mit anschließender Demonstration von 12.000 Teilnehmern abgehalten. Aber die seit 1965 einsetzenden Demonstrationen prangerten ebenso den Aufbau der Notstandsgesetze an, welche den Staat mit umfassenden Rechten der Militarisierung im Inneren und verschärfter Repression ausstatten sollten. Die 1966 in die Große Koalition eingetretene SPD bestand auf diesem Vorhaben in Fortsetzung ihrer alter Tradition von 1918–1919, als sie die blutige Niederschlagung des deutschen Proletariats angeführt hatte. Am 2. Juni 1967 wurde eine Demonstration gegen den Besuch des Schahs von Persien in Berlin mit der größten Brutalität vom „demokratischen“ deutschen Staat, welcher beste Beziehungen mit diesem blutrünstigen Diktator unterhielt, angegriffen. Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen wurde dabei von einem Zivilpolizisten der Student Benno Ohnesorg hinterrücks erschossen (der Polizist wurde nachher freigesprochen). Nach diesem Mord wurde die Stimmung gegen die Protestierenden weiter aufgeheizt, insbesondere gegen ihre Führer. Die Bild-Zeitung forderte: „Stoppt den Terror der Jungroten jetzt!“ Bei einer vom Berliner Senat organisierten „Pro-Amerika-Demonstration“ am 21. Februar 1968 trugen Teilnehmer Plakate mit der Aufschrift „Volksfeind Nr. 1: Rudi Dutschke“, die prominenteste Führerpersönlichkeit der Protestbewegung. Bei dieser Kundgebung wurde ein Passant mit Dutschke verwechselt, Demonstrationsteilnehmer drohten diesen totzuschlagen. Eine Woche nach der Ermordung von Martin Luther King in den USA erreichte schließlich in Deutschland am „Gründonnerstag“ 11. April die Hetzkampagne ihren Höhepunkt nach dem Attentat auf Rudi Dutschke in Berlin durch einen jungen Attentäter, der durch die Springer-Presse aufgestachelt worden war. Die darauf folgenden Osterunruhen richteten sich hauptsächlich gegen die Springer-Presse. Mehrere Wochen lang spielte die Studentenbewegung in Deutschland den Bezugspunkt für die meisten Länder Europas, bevor sich dann die Blicke auf Frankreich richteten.
… und in Frankreich
Die Hauptepisode der
Studentenrevolten in Frankreich begann am 22. März 1968 in Nanterre in einem
westlichen Vorort von
Paris.
Als solche waren die Ereignisse jenes Tages nichts Besonderes. Um gegen die Verhaftung eines linksextremen Studenten der Universität Nanterre zu protestieren, der unter dem Verdacht stand, an einem Attentat gegen ein Büro von American Express in Paris zu einem Zeitpunkt beteiligt gewesen zu sein, als in Paris viele gewalttätige Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg stattfanden, hielten 300 seiner Kommilitonen ein Treffen in einem Hörsaal ab. 142 von ihnen beschlossen die nächtliche Besetzung des Gebäudes des Akademischen Rates der Universität. Die Studenten der Uni Nanterre hatten nicht zum ersten Mal ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht. So war es kurz zuvor schon zu einem Konflikt zwischen Studenten und Polizisten wegen des Zugangs zu einem Studentinnenheim gekommen, dessen Zugang den männlichen Studenten verboten war. Am 16. März 1967 hatte eine Versammlung von 500 Studenten, ARCUN, die Abschaffung der Hausordnung beschlossen, die unter anderem besagte, dass die Studentinnen (auch die Volljährigen, was damals erst mit 21 Jahren der Fall war) weiterhin als Minderjährige anzusehen seien. Daraufhin hatte die Polizei am 21. März 1967 auf das Verlangen der Uni-Verwaltung hin das Studentinnenwohnheim umzingelt, um dort 150 Studenten festzunehmen, die sich in deren Gebäude befanden und sich in der obersten Etage verbarrikadiert hatten. Aber am nächsten Tag waren die Polizisten selbst von mehreren Tausend Studenten umzingelt worden. Diese hatten daraufhin den Befehl erhalten, die verbarrikadierten Studenten ohne irgendeine Belästigung abziehen zu lassen. Aber sowohl dieser Vorfall als auch andere Demonstrationen der Studenten, in denen sie ihre Wut abließen, insbesondere gegen den im Herbst 1967 verkündeten „Fouchet-Plan“ der Universitätsreform, blieben ohne Folgen. Nach dem 22. März 1968 verlief aber alles anders. Innerhalb weniger Wochen sollte eine Reihe von Ereignissen nicht nur zur größten Studentenmobilisierung seit dem Krieg führen, sondern auch zum größten Streik in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung.
Bevor sie das Gebäude verließen, beschlossen die 142 Besetzer des Akademischen Rates der Uni die Bildung einer Bewegung des 22. März (M22), um so die Agitation aufrechtzuerhalten und sie voranzutreiben. Es handelte sich um eine informelle Bewegung, der zu Beginn die Trotzkisten der Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) und die Anarchisten (zu ihnen gehörte unter anderem Daniel Cohn-Bendit) angehörten; Ende April traten ihnen die Maoisten der Union der marxistisch-leninistischen kommunistischen Jugend (UCJML) bei. Insgesamt beteiligten sich in den darauf folgenden Wochen ca. 1200 Studenten daran. An den Wänden der Universität tauchten mehr und mehr Plakate und Graffitis auf: “Professoren, Ihr seid alt und Eure Kultur ebenso.”; “Lasst uns leben!”, “Nehmt Eure Wünsche für Wirklichkeit!” Die M22 kündigte für den 29. März einen Tag der “kritischen Universität” an und trat damit in die Fußstapfen der deutschen Studenten. Der Universitätsrektor beschloss die Schließung der Universität bis zum 1. April, aber die Agitation flammte sofort wieder nach der Öffnung der Universität auf. Vor 1000 Studenten erklärte Cohn-Bendit: “Wir wollen nicht die zukünftigen Manager der kapitalistischen Ausbeutung sein.” Die meisten Lehrenden reagierten ziemlich konservativ: Am 22. April verlangten 18 von ihnen, darunter “linke Dozenten”, “Maßnahmen und Mittel, damit die Agitatoren entlarvt und bestraft” werden. Der Rektor beschloss eine Reihe von Repressionsmaßnahmen, insbesondere gestattete er der Polizei freien Zugang und Bewegungsfreiheit auf dem Unigelände. Gleichzeitig hetzte die Presse gegen die “Wütenden”, die “Sekten” und “Anarchisten”. Die “Kommunistische” Partei Frankreichs hieb in die gleiche Kerbe: Am 26. April kam Pierre Juquin, Mitglied des Zentralkomitees, zu einem Treffen in Nanterre: “Die Störenfriede, die wohlbetuchte Muttersöhnchen sind, hindern die Arbeiterkinder daran, ihre Prüfungen abzulegen.” Er konnte seine Rede nicht zu Ende bringen, sondern musste stattdessen die Flucht antreten. In der Humanité vom 3. Mai, hetzte dann Georges Marchais, die Nummer 2 der PCF, wiederum: “Diese falschen Revolutionäre müssen energisch entlarvt werden, denn objektiv dienen sie den Interessen der Macht der Gaullisten und der großen kapitalistischen Monopole.”
Auf dem Unigelände in Nanterre kam es immer häufiger zu Schlägereien zwischen linksextremen Studenten und Faschisten aus der Gruppe Occident, die aus Paris angereist waren, um “Bolschewiki zu verprügeln”. In Anbetracht dieser Lage beschloss der Rektor am 2. Mai die Universität erneut zu schließen, die danach von der Polizei abgeriegelt wurde. Die Studenten von Nanterre beschlossen am darauf folgenden Tag eine Versammlung im Hof der Universität Sorbonne abzuhalten, um gegen die Schließung der Universität und gegen die disziplinarischen Maßnahmen gegen 8 Mitglieder der M22, darunter Cohn-Bendit, durch den Akademischen Rat zu protestieren.
An dem Treffen nahmen nur 300 Leute
teil. Die meisten Studenten bereiteten aktiv ihre Jahresabschlussprüfungen vor.
Aber die Regierung, die die Agitation endgültig auslöschen wollte, wollte zu
einem großen Schlag ausholen, als sie die Besetzung des Quartier Latin
(Univiertel in Paris) und die Umzingelung der Sorbonne durch die Polizei
anordnete. Die Polizei drang zum ersten Mal seit Jahrhunderten in die
Universität Sorbonne ein. Den Studenten, die sich in die Sorbonne zurückgezogen
hatten, wurde freies Geleit zugesagt. Doch während die Studentinnen unbehelligt
abziehen konnten, wurden die Studenten systematisch in Polizeiwagen
verfrachtet, sobald sie das Unigelände verlassen hatten. In Windeseile
versammelten sich Hunderte von Studenten auf dem Platz der Sorbonne und
beschimpften die Polizisten. Die Polizei schoss mit Tränengas auf die
Studenten. Die Studenten wurden gewaltsam vom Platz vertrieben, aber im
Gegenzug fingen immer mehr Studenten an, die Polizisten und ihre Fahrzeuge
einzukreisen. Die Zusammenstöße dauerten an jenem Abend vier Stunden: 72 Polizisten wurden verletzt,
400 Demonstranten verhaftet. In den darauf folgenden Tagen riegelte die Polizei
das Gelände der Sorbonne vollständig ab. Gleichzeitig wurden vier Studenten zu
Gefängnisstrafen verurteilt. Diese Politik der “entschlossenen Hand” bewirkte
jedoch das Gegenteil dessen, was die Regierung von ihr erhoffte: Anstatt die
Agitation zu beenden, wurde diese
noch massiver. Ab Montag, dem 6. Mai kam es immer wieder zu Zusammenstößen mit
den um die Sorbonne zusammengezogenen Polizeikräften und den zahlenmäßig immer
größer werdenden Demonstrationen, zu denen von der M22, UNFEF (Studentische
Gewerkschaft) und Snesup (Gewerkschaft des Uni-Lehrkörpers) aufgerufen wurde.
Bis zu 45.000 Studenten beteiligten sich an ihnen mit dem Schlachtruf “Die
Sorbonne gehört in die Hände der Studenten”, “Bullen raus aus dem Quartier
Latin”, und vor allem “Befreit unsere Genossen”. Den Studenten schlossen sich
immer mehr Schüler, Lehrer, Arbeiter und Arbeitslose an. Am 7. Mai
überschritten die Demonstrationszüge überraschenderweise die Seine und zogen
die Champs-Elysées entlang und drangen bis in die Nähe des Präsidentenpalastes
vor. Die Internationale wurde unter dem Triumphbogen angestimmt, dort wo man
meistens die Marseillaise hört oder Totengeläut. Die Demonstrationen griffen auch
auf einige Provinzstädte über. Die Regierung wollte einen Beweis für ihren
guten Willen zeigen und öffnete die Universität von Nanterre am 10. Mai. Am
Abend des gleichen Tages strömten Zehntausende von Demonstranten im Quartier
Latin zusammen und fanden sich den Polizeikräften gegenüber, die die Sorbonne
abgeriegelt hatten. Um 21 Uhr fingen einigen Demonstranten an, Barrikaden zu
errichten (insgesamt wurden ca. 60 errichtet). Um Mitternacht wurde eine
Delegation von drei Studenten (unter ihnen Cohn-Bendit) vom Rektor der Akademie
von Paris empfangen. Der Rektor stimmte der Wiedereröffnung der Sorbonne zu,
konnte aber keine Versprechungen hinsichtlich der Freilassung der am 3. Mai
verhafteten Studenten machen. Um zwei Uhr morgens starteten die CRS (Bürgerkriegspolizei)
den Sturm auf die Barrikaden, nachdem sie zuvor viele Tränengasgeschosse auf
sie gefeuert hatten. Die Zusammenstöße verliefen sehr gewalttätig; Hunderte von
Menschen wurden auf beiden Seiten verletzt. Mehr als 500 Demonstranten wurden
verhaftet. Im Quartier Latin bekundeten viele Anwohner ihre Sympathie mit den
Demonstranten; sie ließen sie in ihre Wohnungen rein oder spritzten Wasser auf
die Straße, um sie vor dem Tränengas und den anderen Geschossen der Polizei zu
schützen. All diese Ereignisse, insbesondere die Berichte über die Brutalität
der Repressionskräfte, wurden im Radio permanent von Hunderttausenden Menschen
verfolgt. Um sechs Uhr morgens ‚herrschte Ordnung’ im Quartier Latin, das wie
von einem Tornado durchpflügt schien.
Am 11. Mai war die Empörung in Paris und in ganz Frankreich riesengroß. Die Menschen strömten überall zu spontanen Demonstrationszügen zusammen. Diesen schlossen sich nicht nur Studenten sondern Hunderttausende anderer Demonstranten mit unterschiedlichster Herkunft an, insbesondere junge Arbeiter oder Eltern von Studenten. In der Provinz wurden viele Universitäten besetzt; überall auf den Straßen, auf den Plätzen fing man an zu diskutieren und verurteilte die Haltung der Repressionskräfte.
In Anbetracht dieser Entwicklung kündigte der Premierminister Georges Pompidou abends an, dass vom 13. Mai an die Polizeikräfte aus dem Quartier Latin abzuziehen, die Sorbonne wieder zu öffnen und die verhafteten Studenten freizulassen sind.
Am gleichen Tag riefen die Gewerkschaftszentralen, die CGT eingeschlossen (die bis dahin die ‚linksextremen’ Studenten angeprangert hatten), sowie einige Polizeigewerkschaften zum Streik und Demonstrationen für den 13. Mai auf, um gegen die Repression und die Regierungspolitik zu protestieren.
Am 13. Mai fanden in allen Städten des Landes die größten Demonstrationen seit dem 2. Weltkrieg statt. Die Arbeiterklasse beteiligte sich massiv an der Seite der Studenten. Einer der am meisten verbreiteten Schlachtrufe lautete “10 Jahre, das reicht” (man bezog sich auf den 13. Mai 1958, als De Gaulle wieder die Macht übernommen hatte). Am Ende der Demonstrationen wurden fast alle Universitäten nicht nur von den Studenten besetzt, sondern auch von vielen jungen Arbeitern. Überall ergriff man das Wort. Die Diskussionen begrenzten sich nicht nur auf die universitären Fragen oder die Repression. Man fing an, alle möglichen gesellschaftlichen Fragen aufzugreifen: die Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung, die Zukunft der Gesellschaft.
Am 14. Mai gingen die Diskussionen in vielen Betrieben weiter. Nach den gewaltigen Demonstrationen am Vorabend, die den ganzen Enthusiasmus und ein Gefühl der Stärke zum Vorschein gebracht hatten, war es schwierig die Arbeit wieder aufzunehmen, so als ob nichts passiert wäre. In Nantes traten die Beschäftigen von Sud-Aviation in einen spontanen Streik und beschlossen die Besetzung des Werkes. Vor allem die jüngeren Beschäftigten trieben die Bewegung voran. Die Arbeiterklasse war auf den Plan getreten.
Die Bedeutung der Studentenbewegung der 1960er Jahre
Ein Merkmal dieser ganzen Bewegung
war natürlich vor allem die Ablehnung des Vietnamkrieges. Aber während man
eigentlich hätte erwarten können, dass
die stalinistischen Parteien, die mit dem Regime in Hanoi und Moskau
verbunden waren, wie zuvor bei den Antikriegsbewegungen während des
Koreakrieges zu Beginn der 1950er Jahre, die Führung dieser Bewegung übernehmen würden, geschah dies nicht. Im
Gegenteil; diese Parteien verfügten praktisch über keinen Einfluss, und sehr
oft standen sie im völligen Gegensatz zu den Bewegungen.[iv] Dies war eines der Merkmale der Studentenbewegung Ende
der 1960er Jahre; es zeigte die tiefgreifende Bedeutung auf, die ihr zukommen
sollte. Diese Bedeutung werden wir jetzt aufzuzeigen versuchen. Dazu müssen wir
natürlich unbedingt die damaligen Themen der studentischen Mobilisierung in
Erinnerung rufen.
Die Themen der Studentenrevolte in den 1960er Jahren in den USA ...
Wenn der Widerstand gegen den Vietnamkrieg der USA der wichtigste und weitest verbreitete Mobilisierungsfaktor in allen Ländern der westlichen Welt war, ist es sicherlich kein Zufall, dass die Studentenrevolten im mächtigsten Land der Erde einsetzten. Die Jugend in den USA wurde direkt und unmittelbar mit der Frage des Krieges konfrontiert, da in ihren Reihen junge Männer rekrutiert wurden, die zur Verteidigung „der freien Welt“ in den Krieg geschickt wurden. Zehntausende amerikanische Jugendliche haben für die Politik ihrer Regierung ihr Leben gelassen; Hunderttausende sind verletzt und verstümmelt aus Vietnam zurückgekehrt, Millionen bleiben ihr Leben lang geprägt durch das, was sie in diesem Land erlebt haben. Abgesehen von dem Horror, den sie vor Ort durchgemacht haben, wurden viele mit der Frage konfrontiert: Was machen wir eigentlich in Vietnam? Den offiziellen Erklärungen zufolge waren sie dorthin geschickt worden, um die ‚Demokratie’, ‚die freie Welt’ und die ‚Zivilisation’ zu verteidigen. Aber was sie vor Ort erlebten, widersprach völlig den offiziellen Rechtfertigungen: Das Regime, das sie angeblich verteidigen sollten, die Regierung in Saigon, war weder ‚demokratisch’ noch ‚zivilisiert’. Sie war eine Militärdiktatur und extrem korrupt. Vor Ort fiel es den Soldaten sehr schwer nachzuvollziehen, dass sie die ‚Zivilisation’ verteidigten, wenn von ihnen verlangt wurde, dass sie sich selbst wie Barbaren verhalten sollten, die unbewaffnete arme Bauern, Frauen, Kinder und Alte terrorisieren und umbringen sollten. Aber nicht nur die Soldaten vor Ort waren von den Schrecken des Krieges angeekelt, sondern dies traf auch auf wachsende Teile der US-Jugend insgesamt zu. Junge Männer fürchteten nicht nur in den Krieg geschickt zu werden, und junge Frauen fürchteten nicht nur den Verlust ihrer Freunde, sondern man erfuhr auch immer mehr von den rückkehrenden „Veteranen“, oder ganz einfach durch das Fernsehen von der Barbarei, die dort herrschte.[v] Der schreiende Widerspruch zwischen den offiziellen Reden der US-Regierung von der ‚Verteidigung der Zivilisation und der Demokratie’, auf die sich die US-Regierung berief und ihr tatsächliches Handeln in Vietnam war einer der wichtigsten Faktoren, der zur Revolte gegen die Autoritäten und die traditionellen Werte der US-Bourgeoisie führte.[vi] Diese Revolte hatte in einer ersten Phase die Hippie-Bewegung mit hervor gebracht, eine gewaltlose und pazifistische Bewegung, die sich auf ‚Flower power“ (Macht der Blumen) berief, und von der ein Slogan lautete: „Make Love, not War“ (Macht Liebe, nicht Krieg). Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass die erste größere Studentenmobilisierung an der Universität Berkeley entstand, d.h. in einem Vorort von San Francisco, das damals das Mekka der Hippies war.
Die Themen und vor allem die Mittel dieser Mobilisierungen ähnelten noch dieser Hippie-Bewegung: „Sit-in“; eine gewaltlose Methode, um die „Free Speech“ (Redefreiheit) für politische Propaganda an den Universitäten zu fordern, insbesondere auch um die ‚Bürgerrechte’ der Schwarzen zu unterstützen und die Rekrutierungskampagnen der Armee, die in den Universitäten stattfanden, anzuprangern. Jedoch stellte wie in anderen Ländern später auch, insbesondere 1968 in Frankreich, die Repression in Berkeley einen wichtigen Faktor der ‚Radikalisierung’ der Bewegung dar. Von 1967 an, nach der Gründung der Youth International Party (Internationalen Partei der Jugend) durch Abbie Hoffman und Jerry Rubin, der eine kurze Zeit bei der Bewegung der Gewaltlosen mitgewirkt hatte, gab sich die Bewegung der Revolte eine ‚revolutionäre’ Perspektive gegen den Kapitalismus. Die neuen ‚Helden’ der Bewegung waren nicht mehr Bob Dylan oder Joan Baez, sondern Leute wie Che Guevara (den Rubin 1964 in La Havanna getroffen hatte). Die Ideologie dieser Bewegung war unglaublich konfus. Es gab anarchistische Bestandteile (wie den Freiheitskult, insbesondere die sexuelle Freiheit oder Freiheit des Drogenkonsums), aber auch stalinistische Bestandteile (Kuba und Albanien wurden als Beispiele gepriesen). Die Aktionen ähnelten sehr denen der Anarchisten – wie Lächerlichmachen und Provokationen. So bestand eine der ersten spektakulären Aktionen des Tandems Hoffman-Rubin darin, Bündel Falschgeld in der New Yorker Börse zu verteilen, woraufhin sich die dort Anwesenden wie wild auf sie stürzten, um welche zu ergattern. Und während des Kongresses der Demokratischen Partei im Sommer 1968 schlugen sie als Präsidentenkandidaten das Schwein Pegasus vor[vii], während sie gleichzeitig bewaffnete Auseinandersetzungen mit der Polizei vorbereiteten. Zusammenfassend kann man zu den Hauptmerkmalen der Proteste, welche sich in den 1960er Jahren in den USA ausbreiteten, sagen, dass sie sich sowohl gegen den Vietnamkrieg als auch gegen die Rassendiskriminierung, gegen die ungleiche Behandlung der Geschlechter und gegen die traditionelle Moral und die Werte Amerikas wandten. Wie die meisten der Beteiligten feststellten (als sie sich wie revoltierende Bürgerkinder verhielten), waren diese Bewegungen keineswegs Regungen der Arbeiterklasse. Es ist sicherlich kein Zufall, dass einer ihrer ‚Theoretiker’, der Philosophieprofessor Herbert Marcuse, meinte, die Arbeiterklasse sei ‚integriert’ worden, und dass die revolutionären Kräfte gegen den Kapitalismus unter anderen Gesellschaftsschichten zu finden seien, so beispielsweise die Schwarzen, die Opfer der Rassendiskriminierung waren, die Bauern der Dritten Welt oder revoltierende Intellektuelle.
… und in den anderen Ländern
In den meisten anderen Ländern des Westens ähnelten die Studentenbewegungen der 1960er Jahre stark denen der USA: Verwerfung der US-Intervention in Vietnam, Revolte gegen die Autoritäten, insbesondere die akademischen Autoritäten, gegen die Autorität im Allgemeinen, gegen die traditionelle Moral, insbesondere gegen die Sexualmoral. Dies ist einer der Gründe, weshalb die stalinistischen Parteien, die ein Symbol des Autoritären waren, keinen Widerhall unter den Revoltierenden finden konnten, obgleich sie die US-Intervention in Vietnam heftig an den Pranger stellten. Dabei wurden die von den USA bekämpften militärischen Kräfte in Vietnam, welche als ‚anti-kapitalistisch’ auftraten, total vom sowjetischen Block unterstützt. Es stimmt, dass der Ruf der UdSSR sehr stark unter der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 1956 gelitten hatte, und dass das Bild des alten Apparatschiks Breschnew keine großen Träume aufkommen ließ. Die Revoltierenden der 1960 Jahre hingen lieber Poster von Ho Chi Minh (ein alter Apparatschik, der aber eher vorzeigbar war und als ‚heldenhafter’ erschien) und am liebsten noch das romantische Photo von Che Guevara auf (ein anderes Mitglied einer stalinistischen Partei, aber halt ‚exotischer’) oder von Angela Davis (sie war auch Mitglied der stalinistischen Partei der USA, aber sie hatte den doppelten Vorteil eine Schwarze und Frau zu sein, und zudem noch genau wie Che Guevara ‚gut’ auszusehen).
Diese Komponente, sowohl gegen den Vietnamkrieg gerichtet zu sein und als ‚libertär’ zu erscheinen, tauchte ebenfalls in Deutschland auf. Die berühmteste Figur der Bewegung, Rudi Dutschke, stammte aus der ehemaligen DDR, wo er sich als junger Mann schon gegen die Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes geäußert hatte. Seine ideologischen Bezugspunkte waren der ‚junge Marx’ sowie die Frankfurter Schule (der Marcuse angehörte), und auch die Situationistische Internationale (auf die sich die Gruppe „Subversive Aktion“, deren Berliner Sektion er 1962 gründete, berief).[viii]
Während der Diskussionen, die sich von 1965 an in den deutschen Universitäten entfalteten, stieß die Suche nach einem “wahren anti-autoritären Marxismus” auf einen großen Erfolg. Damals wurden viele Texte der Rätebewegung wieder aufgelegt.
Die Themen und Forderungen der Studentenbewegung, die sich 1968 in Frankreich entfaltete hat, waren im Wesentlichen die gleichen. Im Laufe der Entwicklung wurde der Widerstand gegen den Vietnamkrieg durch eine Reihe von Slogans in den Hintergrund gedrängt, die situationistisch oder anarchistisch inspiriert waren (oder gar surrealistisch), und die man immer häufiger auf den Mauern lesen konnte („Die Mauern haben das Wort“). Die anarchistische Ausrichtung wurde insbesondere in folgenden Slogans deutlich:
„Die Leidenschaft der Zerstörung ist eine schöpferische Freude.“ (Bakunin)
„ Es ist verboten zu verbieten.“
„Freiheit ist das Verbrechen, das alle Verbrechen beinhaltet.“
„Wahlen sind Fallen für Dumme.“
„Frech und unverschämt zu sein, ist die neue revolutionäre Waffe.“
Diese wurden durch jene Forderungen ergänzt, die zur „sexuellen Revolution“ aufriefen:
„Liebt euch aufeinander liegend!“
„Knöpft euer Gehirn so oft auf wie euren Hosenschlitz!“
„Je mehr ich Liebe mache, desto mehr habe ich Lust die Revolution zu machen. Je mehr ich die Revolution mache, desto mehr habe ich Lust Liebe zu machen.“
Der Einfluss des Situationismus spiegelte sich in Folgendem wider:
„Nieder mit der Konsumgesellschaft!“
„Nieder mit der Warengesellschaft des Spektakels!“
„Schaffen wir die Entfremdung ab!“
„Arbeitet nie!“
„Seine Wünsche für die Wirklichkeit nehmen, denn ich glaube an die Wirklichkeit meiner Wünsche.“
„Wir wollen keine Welt, in der die Sicherheit nicht zu verhungern eingetauscht wird mit dem Risiko vor Langeweile zu sterben.“
„Langeweile ist konterrevolutionär.“
„Wir wollen leben ohne Stillstand und uns grenzenlos amüsieren.“
„Seien wir realistisch, verlangen wir das Unrealistische!“
Übrigens tauchte auch die Generationenfrage (die in den USA und in Deutschland sehr präsent war) in verschiedenen Slogans (oft auf sehr schändliche Weise) auf:
„Lauf Genosse, die alte Welt liegt hinter dir!“
„Die Jungen machen Liebe, die Alten machen obszöne Gesten.“
Im Frankreich des Mai 68, wo Barrikaden errichtet wurden, hörte man auch Slogans wie:
„Die Barrikaden versperren die Straßen, aber öffnen den Weg.“
„Der Abschluss allen Denkens ist der Pflasterstein in deiner Fresse, CRS [Bürgerkriegs-polizei].”
„Unter dem Pflasterstein liegt der Strand.“
Die größte Verwirrung, die in dieser Zeit vorzufinden war, kommt durch die beiden folgenden Slogans zum Ausdruck:
„Es gibt kein revolutionäres Denken. Es gibt nur revolutionäre Handlungen.“
„Ich habe etwas zu sagen, aber ich weiß nicht was.“
Das Klassenwesen der Studentenbewegung der 1960er Jahre
Diese Slogans wie die meisten, die in den anderen Ländern zirkulierten, zeigen deutlich, dass die Studentenbewegung der 1960er Jahre keineswegs das Wesen der Arbeiterklasse widerspiegelte, auch wenn es in verschiedenen Ländern (wie natürlich in Frankreich, und auch in Italien, Spanien oder im Senegal) den Willen gab, eine Brücke zu den Arbeiterkämpfen zu schlagen. Diese Herangehensweise spiegelte übrigens eine gewisse Überheblichkeit gegenüber der Arbeiterklasse wider, die mit einer gewissen Faszination für den Arbeiter als Blaumann durchmischt war, welcher der Held von schlecht verdauten Texten der Klassiker des Marxismus war. Im Kern war die Studentenbewegung der 1960er Jahre kleinbürgerlicher Natur. Einer der klarsten Aspekte neben ihrem anarchisierenden Erscheinungsbild war der Wille „das Leben sofort umzuwälzen“. Die Ungeduld und das “alles sofort” waren die Merkmale einer gesellschaftlichen Schicht wie des Kleinbürgertums, die in der Geschichte keine Zukunft haben.
Der ‚revolutionäre’ Radikalismus der Führung dieser Bewegung, sowie die Gewaltverherrlichung, die von einigen Teilen der Bewegung betrieben wurde, spiegelt ebenfalls ihr kleinbürgerliches Wesen wider. Die ‚revolutionären’ Anliegen der Studenten von 1968 waren zweifelsohne aufrichtig, aber sie waren stark geprägt von einer Sicht der Welt aus einer Dritten-Welt-Perspektive (Guevarismus und Maoismus) sowie vom Antifaschismus. Die Bewegung hatte eine romantische Sichtweise der Revolution, ohne auch nur die geringste Vorstellung von der wirklichen Entwicklung der Bewegung der Arbeiterklasse zu haben, die zur Revolution führt. Die Studenten in Frankreich, die sich für „revolutionär“ hielten, glaubten, dass die Bewegung des Mai 68 schon die Revolution war, und die Barrikaden, die Tag für Tag errichtete wurden, wurden als die Erben der Barrikaden von 1848 und der Kommune von 1871 dargestellt.
Eines der Merkmale der
Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre war der „Generationenkonflikt“, der
sehr große Graben zwischen der neuen Generation und der ihrer Eltern, denen
verschiedene Vorwürfe gemacht wurden. Insbesondere die Tatsache, dass
diese hart hatte schuften müssen, um Armut und auch Hunger zu überwinden, die
durch den 2. Weltkrieg entstanden waren. Man warf ihr vor, dass sie sich nur um
ihr materielles Wohlergehen kümmerte. Deshalb feierten die Fantastereien über
die „Konsumgesellschaft“ und Slogans wie „Arbeitet nie!“ solche Erfolge. Als
Nachfolger einer Generation, die von der Konterrevolution voll getroffen worden
war, warf die Jugend der 1960er Jahre der älteren Generation vor, sich den
Ansprüchen des Kapitalismus unterworfen und angepasst zu haben. Im Gegenzug
verstanden viele Eltern nicht und hatten Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass
ihre Kinder Verachtung für die Opfer zeigten, die sie hatten erbringen müssen,
um ihren Kindern bessere wirtschaftliche Verhältnisse zu ermöglichen, als sie
sie selbst erlebt hatten.
Aber dennoch gab es einen wirklichen
ökonomischen Bestimmungsgrund für die Studentenrevolte der 1960er Jahre. Damals
gab es keine größere Bedrohung durch Arbeitslosigkeit oder durch prekäre
Arbeitsbedingungen nach dem Studium, wenn man die Lage mit der heute
vergleicht. Die Hauptsorge der studentischen Jugend war damals, dass sie nicht
mehr den gleichen sozialen Aufstieg würde machen können wie die vorhergehende
Akademikergeneration. Die Generation von 1968 war die erste Generation, die mit
einer gewissen Brutalität mit dem Phänomen der „Proletarisierung der
Führungskräfte“ konfrontiert wurde, welches von den Soziologen der damaligen
Zeit eingehend untersucht wurde. Dieses Phänomen hatte sich seit einigen Jahren
ausgebreitet, noch bevor die Krise offen in Erscheinung trat, sobald die
Studentenzahl beträchtlich zugenommen hatte (so war zum Beispiel die Zahl der
Studenten in Deutschland von 330.000 auf
1.1 Millionen zwischen 1964–1974 gestiegen). Diese Zunahme entsprach den
Bedürfnissen der Wirtschaft aber auch dem Willen und der Möglichkeit der
Generation ihrer Eltern, ihren Kindern eine bessere wirtschaftliche und soziale
Lage als ihre eigene angedeihen zu
lassen.
Unter anderem hatte diese massenhafte Zunahme der Studenten die wachsende Malaise hervorgerufen, die auf den Fortbestand von Strukturen und Praktiken an den Universitäten zurückzuführen war, welche aus einer Zeit stammten, in der nur eine Elite die Uni besuchen konnte, und in der stark autoritäre Strukturen vorherrschten.
Während die Studentenbewegung, welche 1964 einsetzte, sich in einer Zeit des „Wohlstandes“ des Kapitalismus entfaltete, sah die Lage 1967 schon anders aus, als die wirtschaftliche Situation sich schon sehr stark verschlechtert hatte – wodurch die studentische Malaise vergrößert wurde. Dies war einer der Gründe, weshalb die Bewegung 1968 ihren Höhepunkt erlebte. Und dies erklärt auch, warum im Mai 1968 die Arbeiterklasse auf den Plan trat und die Bewegung anführte. Darauf werden wir in einem nächsten Artikel eingehen.
Fabienne[i] David Caute, 1968 dans le monde, Paris, Laffont, 1988, übersetzt aus Sixty-Eight: The Year of the Barricades, London, Hamilton 1988. Es erschien in den USA ebenso unter dem Titel „The Year of the Barricades – A Journey through 1968, New Yorker: Harper & Row, 1988.
[ii] Mark Kurlansky, 1968: l‘année qui ébranla le monde. Paris: Presses De La Cite, 2005 ; übersetzt aus 1968: The Year That Rocked the World. New York: Ballan-tine Books, 2004.
[iii] Einige unserer territorialen Publikationen haben schon oder werden noch Artikel über die Ereignisse in den jeweiligen Ländern veröffentlichen.
[iv] Studentenbewegungen griffen 1968 auch auf stalinistische Regime über. In der Tschechoslowakei waren sie Teil des „Prager Frühlings“, welcher von einem Teil der stalinistischen Partei propagiert wurde. Sie können nicht als eine Bewegung angesehen werden, die das Regime infragestellten. In Polen nahm die Bewegung einen anderen Charakter an. Am 8. März wurden Studentenproteste gegen das Verbot einer als Russland-feindlichen angesehenen Aufführung von der Polizei unterdrückt. Im März stieg die Spannung weiter an. Immer mehr Universitäten wurden von den Studenten besetzt, immer mehr wurde demonstriert. Unter der Führung des Innenministers, General Moczar, Anführer der „Partisanenströmung“ in der stalinistischen Partei, wurden sie brutal unterdrückt, während gleichzeitig die Juden in der Partei auf-grund von „Zionismusvorwürfen“ herausgeschmissen wurden.
[v] Während des Vietnamkrieges waren die US-Medien den Militärbehörden nicht unterworfen. Diesen „Fehler“ beging die US-Regierung während der Auslösung des Irakkrieges 1991 und 2003 nicht mehr.
[vi] Solch ein Phänomen wiederholte sich nicht mehr nach dem 2. Weltkrieg. Die US-Soldaten hatten ebenfalls eine Hölle er-lebt, insbesondere jene, die 1944 in der Normandie gelandet waren, aber fast alle Soldaten und die Bevölkerung insgesamt waren angesichts der Barbarei des Nazi-Regimes bereit, diese Opfer zu bringen
[vii] Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die französischen Anarchisten einen Esel für die Parlamentswahlen nominiert.
[viii] Für eine zusammenfassende Darstellung der politischen Positionen des Situationismus siehe unseren Artikel: „Guy Debord – Der zweite Tod der Situa-tionistischen Internationale“ in Revue Internationale, Nr. 80.
Theoretische Fragen:
- Historischer Kurs [32]
Vor 60 Jahren: Eine Konferenz revolutionärer Internationalisten
- 3413 Aufrufe
Die IKS hielt 2007 ihren 17. Kongress
ab. Zum ersten Mal seit 1979 konnte dieser Kongress wieder Delegationen anderer
internationalistischer Gruppen willkommen heißen, welche buchstäblich aus
verschiedensten Ecken der Welt (von Brasilien bis Südkorea) angereist waren.
Wie wir im Artikel über die Arbeit des Kongresses[i] festgehalten haben, ist diese Praxis keine Erfindung der
IKS. Wir tun damit nichts anderes, als die Haltung wieder aufzunehmen, welche
wir bereits bei unserer Gründung 1975 hatten und die wir von der
Kommunistischen Linken und besonders von der Französischen Kommunistischen
Linken (Gauche Communiste de France, GCF), geerbt haben. Dies zeigt der Artikel
auf, den wir hier wiederveröffentlichen und der ursprünglich in
INTERNATIONALISME, Nr. 23, anlässlich einer Konferenz von Internationalisten im
Mai 1947 – also genau 60 Jahre vor unserem
17. Kongress – publiziert wurde.[ii]
Die Konferenz von 1947 wurde vom holländischen Communistenbond Spartacus, einer „rätekommunistischen“ Gruppe, ins Leben gerufen. Diese Gruppe hatte den Krieg von 1939-45 trotz all der brutalen Repressalien, die sie wegen ihrer Beteiligung an Arbeiterkämpfen unter dem Besatzungsregime erdulden musste, überlebt.[iii] Die Konferenz wurde in einem für die wenigen Revolutionäre, welche an den proletarischen internationalistischen Prinzipien festhielten und den Kampf für die bürgerliche Demokratie oder das „sozialistische Vaterland“ Stalins zurückwiesen, außerordentlich düsteren Moment der Geschichte abgehalten. 1943 hatte eine Streikwelle in Norditalien Anlass zur Hoffnung gegeben, dass der Zweite Weltkrieg auf dieselbe Weise wie der Erste enden wird: mit einem Aufstand, der diesmal nicht nur den Krieg beenden, sondern auch den Weg zu einer neuen proletarischen Revolution eröffnen sollte, die den Horror des Kapitalismus für immer beseitigt. Doch die herrschende Klasse hatte ihre Lehren aus 1917 gezogen, und der Zweite Weltkrieg endete mit einer systematischen Zerschlagung der Arbeiterklasse, bevor sie sich erheben konnte. In Italien wurden die ArbeiterInnen in ihren Quartieren von der deutschen Besatzungsmacht blutig unterdrückt, der Aufstand in Warschau durch deutsche Truppen unter den „wohlwollenden“ Blicken des sowjetischen Gegners[iv] niedergeschlagen und die deutschen Arbeiterbezirke unter einem Bombenhagel amerikanischer und britischer Flugzeuge begraben. Dies sind nur einige Beispiele. Die GCF realisierte, dass in dieser Zeit der Weg zur Revolution nicht unmittelbar offen stand, und schrieb im Rahmen der Vorbereitungen der Konferenz an den Communistenbond Spartacus:
„Es war in einem gewissen Sinne logisch, dass die Abscheulichkeiten des Krieges die Augen öffnen und neue Revolutionäre hervorbringen würden. Ein Resultat war hier und dort das Entstehen von kleinen Gruppen, welche trotz ihren unvermeidbaren Konfusionen und ihrer politischen Unreife eine ernste Anstrengung unternahmen, die revolutionäre Bewegung der Arbeiterklasse wieder auf die Beine zu stellen.
Der Zweite Weltkrieg endete nicht wie der Erste in einer Welle von revolutionären Klassenkämpfen. Ganz im Gegenteil. Nach einigen schwachen Anstrengungen erlitt das Proletariat eine schwere Niederlage, welche einen weltweiten reaktionären Kurs eröffnete. Unter solchen Bedingungen bestand die Gefahr, dass die schwachen Gruppen, welche gegen Kriegsende entstanden waren, weggespült wurden oder zerbrachen. Mit der Schwächung einiger dieser Gruppen und mit dem Verschwinden anderer, wie die ‚Communistes Révolutionnaires‘ in Frankreich, haben wir diesen Prozess schon erlebt“.[v]
Die GCF hatte keine Illusionen über die Möglichkeiten dieser Konferenz: „In einer Zeit wie der unsrigen, in einer Zeit der Reaktion und des Rückschritts steht es nicht an, neue Parteien oder gar eine neue Internationale zu gründen – so wie es die Trotzkisten und Konsorten machen –, denn die Hochstapelei solch künstlicher Konstruktionen hat immer nur dazu geführt, noch größere Verwirrung in der Arbeiterklasse zu stiften“.[vi] Die GCF betrachtete die Konferenz deshalb aber keinesfalls als eine Zeitverschwendung. Ganz im Gegenteil stellte sie einen lebenswichtigen Schritt dar, um das Überleben der internationalistischen Gruppen zu sichern: „Keine Gruppe besitzt die ‚absolute und ewige Wahrheit‘ und keine Gruppe wird allein fähig sein, dem schrecklichen historischen Kurs von heute zu widerstehen. Das Leben der Gruppen und ihre ideologische Entwicklung hängen direkt von den Beziehungen ab, die sie untereinander aufbauen können, vom Austausch der Standpunkte, von der Konfrontation der Ideen und der Debatte, die sie international entwickeln können.
Diese Aufgabe scheint uns von größter Wichtigkeit für die Genossen in der heutigen Zeit zu sein, und aus diesem Grund haben wir uns dafür ausgesprochen. Wir werden alles daran setzen, den Kontakt aufrechtzuerhalten, weitere Treffen zu organisieren und die Korrespondenz zu erweitern“.[vii]
Der historische Kontext
Die Konferenz war vor allem von Bedeutung, weil sie nach sechs schrecklichen Jahren des Krieges, der Repression und Isolation das erste internationale Treffen unter Revolutionären darstellte. Doch der historische Kontext – die Periode von „Reaktion und Rückschritt“ – war stärker als die Initiative von 1947. Das Resultat der Konferenz fiel denn auch sehr mager aus. Im Oktober 1947 schrieb die GCF dem Communistenbond und bat ihn um die Organisierung einer zweiten Konferenz, die mit einem Diskussionsbulletin vorbereitet werden sollte. Doch von Letzterem wurde lediglich eine Nummer erstellt, und die zweite Konferenz fand nie statt. In den folgenden Jahren zerfielen die meisten teilnehmenden Gruppen. Auch die GCF, welche auf einige isolierte Genossen zusammenschrumpfte, die ihren Kontakt so gut wie möglich brieflich aufrechterhielten.[viii]
Heute ist der historische Kontext ein
ganz anderer. Nach Jahren der Konterrevolution bewies die Welle von Streiks,
die den Ereignissen von 1968 in Frankreich folgte, dass die revolutionäre
Klasse wieder auf die Bühne der Geschichte zurückgekehrt war. Doch
diese Kämpfe konnten der Stärke der kapitalistischen Angriffe während den
1980er Jahren nicht trotzen und endeten abrupt mit dem Zusammenbruch des
Ostblocks 1989. Es folgte darauf die schwierige Periode der 1990er Jahre,
gekennzeichnet durch Entmutigung und Verwirrung innerhalb der Arbeiterklasse und
ihren revolutionären Minderheiten. Doch mit dem neuen Jahrtausend kam wieder
Bewegung auf. Einerseits entwickelte sich in den letzten Jahren ein Kampf der
Arbeiterklasse um die Stärkung des Solidaritätsprinzips. Gleichzeitig bewies
die Anwesenheit der zum 17. Kongress der IKS eingeladenen Gruppen die
Entwicklung eines weltweiten politischen Nachdenkens unter den kleinen
Minderheiten, die internationalistische Positionen aufrechterhalten und Kontakt
untereinander herzustellen versuchen.
In dieser Situation ist die Erfahrung von 1947 wichtig und aktuell. Wie eine Saat, die über den Winter unter der Erde verborgen bleibt, stellt sie ein Potenzial für die Internationalisten von heute dar. In dieser kurzen Einführung wollen wir die wichtigsten Lehren der Konferenz von 1947 und der Beteiligung der GCF daran beleuchten.
Die Notwendigkeit politischer Kriterien für die Beteiligung an der Konferenz
Seit dem Verrat der sozialistischen Parteien und Gewerkschaften 1914 und noch mehr seit den 1930er Jahren, als die kommunistischen Parteien - gefolgt von den Trotzkisten in den 1940er Jahren - denselben Weg einschlugen, gab es ein Haufen Gruppen und Parteien, welche behaupteten, der Arbeiterklasse anzugehören, deren wirklicher Existenzgrund aber kein anderer als die Unterstützung der Herrschaft der kapitalistischen Klasse und ihres Staates war. Aus diesem Grund schrieb die GCF 1947: „Es geht nicht um Diskussionen im Allgemeinen, sondern um ein Treffen, das die Diskussion zwischen revolutionären proletarischen Gruppen ermöglicht. Dies bedingt notwendigerweise eine Unterscheidung auf der Basis politischer ideologischer Kriterien. Um jegliche Unklarheiten und Schwankungen zu vermeiden, ist es notwendig, diese Kriterien so klar wie möglich zu formulieren“.[ix]Die GCF formulierte vier Kriterien:
1. den Ausschluss der Trotzkisten aufgrund ihrer Unterstützung des russischen Staates und ihrer Beteiligung am imperialistischen Krieg von 1939-45 auf der Seite der demokratischen und stalinistischen imperialistischen Länder;
2. den Ausschluss derjenigen
Anarchisten (in diesem Fall der französischen
anarchistischen Föderation), welche sich an der Volksfront, der
kapitalistischen spanischen Regierung von 1936–38 und unter der Fahne des
Antifaschismus von 1939-45 an der Résistance beteiligt hatten;
3. den Ausschluss aller Gruppen, die, aus welchem Grund auch immer, am Zweiten Weltkrieg teilgenommen hatten;
4. die Anerkennung der Notwendigkeit, „den bürgerlichen Staat mit Gewalt zu zerschlagen“, und damit auch die Anerkennung der historischen Bedeutung der Oktoberrevolution von 1917.
Nach der Konferenz wurden die Kriterien von der GCF in ihrem Brief vom Oktober 1947 auf zwei reduziert:
1. „Entschlossenheit für den Kampf für die proletarische Revolution durch die gewaltsame Zerstörung des bürgerlichen Staates und den Aufbau des Sozialismus“;
2. „die Ablehnung jeglicher Akzeptanz gegenüber der Beteiligung am Zweiten imperialistischen Weltkrieg und all den ideologischen Korruptionen, die damit einher gehen, wie die Ideologien des Faschismus und Antifaschismus und ihre nationalen Versatzstücke (die französische Résistance, die nationale und koloniale Befreiung) und ihre politischen Seiten (die Verteidigung der UdSSR, der Demokratien oder des europäischen Nationalsozialismus)“.
Wie wir sehen, sind diese Kriterien auf die Frage des Krieges und der Revolution ausgerichtet, und sie bleiben unseres Erachtens bis heute gültig.[x] Was sich verändert hat, ist der historische Kontext, in dem sie sich heute stellen. Für die Generationen, die heute politisch aktiv werden, sind der Zweite Weltkrieg und die Russische Revolution längst vergangene Ereignisse, die man lediglich aus Geschichtsbüchern kennt. Aber sie bleiben dennoch bedeutend für die revolutionäre Perspektive der Arbeiterklasse und für das Engagement für die Sache des Proletariats. Denn die heutigen Generationen sind durch die notwendige Denunzierung all der Kriege, die den Planeten zerstören (Irak, Israel-Palästina, Tschetschenien, Atomversuche in Nordkorea, usw.), wieder direkt mit der Frage des Krieges konfrontiert.
Die Frage der Revolution stellt sich heute mehr durch die notwendige Entlarvung der himmelschreienden Verfälschungen à la Chavéz als durch einen direkten Bezug zur Russischen Revolution von 1917.
Es existiert heute keine Gefahr einer faschistischen Mobilisierung der Arbeitermassen in einen imperialistischen Krieg, auch wenn es Länder gibt (vor allem im ehemaligen Ostblock), die unter faschistischen Banden leiden, welche, mehr oder weniger durch den Staat gesteuert, die Bevölkerung terrorisieren und für die Revolutionäre ein Problem darstellen. Als Resultat ist auch der Antifaschismus unter den heutigen Bedingungen kein Hauptelement zur ideologischen Kontrolle der Arbeiterklasse, wie dies während des Krieges von 1939–45 der Fall war, als der Antifaschismus als Mittel zur Mobilisierung der Arbeiter hinter den demokratischen Staat diente. Doch auch heute wird er eingesetzt, um die Arbeiter von der Verteidigung ihrer eigenen Klasseninteressen abzubringen.
Die Haltung gegenüber dem Anarchismus
Eine wichtige Diskussion vor und während der Konferenz war die Haltung, die es gegenüber dem Anarchismus einzunehmen galt. Für die GCF war klar: „Wie die Trotzkisten oder jede andere Bewegung, welche mit dem Argument, ein Land (wie Russland) oder eine bürgerliche Herrschaftsform gegenüber der anderen (die Verteidigung der Republik und Demokratie gegen den Faschismus) verteidigen zu müssen, am imperialistischen Krieg teilgenommen haben (oder nehmen), findet die anarchistische Bewegung keinen Platz in dieser Konferenz revolutionärer Gruppen“. Der Ausschluss der Anarchisten war keinesfalls davon bestimmt, dass sie Anarchisten waren, sondern durch ihre Haltung gegenüber dem imperialistischen Krieg. Diese Unterscheidung ist sehr wichtig und wird verdeutlicht durch die Tatsache, dass die Konferenz von einem Anarchisten präsidiert wurde (wie wir in einer „Korrektur“ des Berichts in INTERNATIONALISME, Nr. 24 nachlesen können).
Die Heterogenität der anarchistischen Bewegung ist heute derart groß, dass diese Frage nicht mehr in einer derart einfachen Weise beantwortet werden kann. Unter der Bezeichnung „Anarchisten“ finden wir heute Gruppen, die sich von den Trotzkisten lediglich in der „Parteifrage“ unterscheiden, aber in allen anderen Fragen (bis hin zur Forderung nach einem „palästinensischen Staat“!) die trotzkistischen Positionen unterstützen. Andererseits gibt es wirklich internationalistische Gruppen, mit denen Kommunisten nicht nur eine gute politische Debatte führen, sondern auch gemeinsame Aktivitäten auf der Basis des Internationalismus unternehmen können.[xi] Unserer Ansicht nach gibt es heute absolut keinen Grund, Debatten mit Gruppen oder Individuen abzulehnen, nur weil sie sich als „Anarchisten“ bezeichnen.
Einige andere Punkte
Wir wollen zum Schluss drei andere wichtige Punkte der Konferenz unterstreichen:
– Der erste ist das Vermeiden jeglicher grandioser und leerer Erklärungen: Die Konferenz blieb bezüglich ihrer Wichtigkeit und ihrer Möglichkeiten auf dem Boden. Das bedeutet nicht, dass die GCF damals die Formulierung gemeinsamer Positionen für unmöglich gehalten hätte - ganz im Gegenteil. Doch nach sechs Jahren Krieg konnte die Konferenz nicht mehr sein als eine erste Kontaktaufnahme, bei der unvermeidlich „die Diskussionen nicht genügend vorangekommen waren, um irgendwelche wohlklingenden Resolutionen zu verabschieden“. Heute müssen Revolutionäre sich ihrer enormen Verantwortung bewusst sein, aber gleichzeitig realistisch bleiben bezüglich ihrer Möglichkeiten und Kräfte, mit denen sie ihre Arbeit leisten können.
– Der zweite Punkt ist die Wichtigkeit der Gewerkschaftsfrage. Unserer Ansicht nach ist die Gewerkschaftsfrage seit langem geklärt. Doch dies war nicht vollumfänglich der Fall für die GCF, welche sich 1947 gerade erst die Positionen der Deutsch-Holländischen Linkskommunisten in dieser Frage angeeignet hatte. 1947, genau wie auch heute, lag hinter der Gewerkschaftsfrage das Problem der Kampfmethode. Die Kampfmethode und die Haltung gegenüber den Gewerkschaften ist eine brennende Frage für die Arbeiterklasse und die Revolutionäre auf der ganzen Welt.[xii]
– Drittens wollen wir den Abschnitt wiederholen, den wir zu Beginn des Artikels zitiert haben: „Keine Gruppe besitzt die ‚absolute und ewige Wahrheit‘ (…) Das Leben der Gruppen und ihre ideologische Entwicklung hängen direkt von den Beziehungen ab, die sie untereinander aufbauen können, vom Austausch der Standpunkte, von der Konfrontation der Ideen und der Debatte, die sie international entwickeln können“. Dies ist für uns ein Leitfaden für die kommenden Jahre und ein Grund, weshalb der 17. Kongress der IKS der Frage der Debattenkultur einen derart großen Platz einräumte.[xiii]
IKS, 6. Januar 2008
(Anmerkung: Im nachfolgend abgedruckten Text sind die Fußnoten a und b am Ende des Dokumentes aus dem Original von 1947. Die Fußnoten 1 und 2 am Seitenende haben wir jetzt angefügt, um zwei historische Aspekte kurz zu
[i] Siehe Internationale Revue Nr. 40
[ii] Die in diesem Artikel zitierten Texte sind vollumfänglich in unserer auf Französisch publizierten Broschüre La Gauche Communiste de France zu finden.
[iii] Siehe unser Buch Die Deutsch-Holländische Linke, vor allem das vorletzte Kapitel. Der Communistenbond Spartacus hatte seine Wurzeln in der Marx-Lenin-Luxemburg Front, welche mit aller Kraft an den Streiks der holländischen Arbeiter von 1941 teilnahm, die sich gegen die Deportation von Juden durch die deutsche Besatzungsmacht richteten. Sie verteilten während des Krieges selbst in deutschen Kasernen Flugblätter mit dem Aufruf zur Verbrüderung.
[iv] Es war ein Entscheid Churchills, „die Italiener in ihrem Saft schmoren zu lassen“. Stalin stoppte den Vormarsch der Roten Armee vor den Toren Warschaus, am anderen Ufer der Weichsel, bis das Gemetzel durch die deutschen Truppen abgeschlossen war.
[v] Publiziert in INTERNATIONALISME Nr. 23. Die Hervorhebung ist aus dem Originaltext. Die Communistes Révolutionnaires entstammten der RKD, einer Gruppen österreichischer Trotzkisten, welche nach Frankreich geflüchtet waren. Sie waren die einzige Delegation am Kongress von Périgny, die sich der Gründung der 4. Internationale widersetzte und sie als „Abenteurertum“ bezeichnete.
[vi] ebenda
[vii] ebenda
[viii] Es ist hier nicht der Platz , um die Nachkriegsgeschichte des Communistenbond Spartacus niederzuschreiben. Siehe dazu unser Buch Die Deutsch-Holländische Linke. Hier nur einige Meilensteine: Bald nach der Konferenz von 1947 übernahm der Communistenbond deutlich „rätistische“ Orientierungen in der Organisationsfrage, in der Art der früheren GIC (Groepen van Internationale Communisten). 1964 spaltete sich die Gruppe, und es entstanden der Spartacusbond und Daad en Gedachte (Tat und Gedanke), die vorwiegend von Cajo Brendel angeregt wurde. Der Spartacusbond schlug nach 1968 einen aktivistischen Kurs ein und verschwand 1980. Daad en Gedachte folgte der Logik des Rätismus, um schlussendlich 1989 aufgrund eines Mangels an Beiträgen für ihre Zeitschrift zu verschwinden.
[ix] ebenda
[x] Dies war auch 1976 unsere Haltung, als die Gruppe Battaglia Communista einen Aufruf zu einer Konferenz linkskommunistischer Gruppen machte, aber keinerlei Kriterien für die Teilnahme vorschlug. Wir begrüßten den Aufruf, insistierten aber gleichzeitig: „Damit dieser Vorstoß ein Erfolg wird, damit er wirklich zu einer Annäherung unter den Revolutionären beiträgt, ist es notwendig klare politische Kriterien aufzustellen, die als Basis und Rahmen dienen, damit die Diskussion und die Gegenüberstellung von Ideen fruchtbar und konstruktiv wird“. (siehe Internationale Revue Nr. 40 (engl., franz., span.): „Die Gründung des IBRP, ein opportunistischer Bluff“.
[xi] Die IKS führte verschiedene Debatten und unternahm auch gemeinsame Aktivitäten mit der in Moskau ansässigen KRAS-AIT.
[xii] Siehe auf unserer Website den Artikel zu den Kämpfen in der MEPZA auf den Philippinen.
[xiii] Siehe unsere Artikel über den 17. Kongress der IKS (Internationale Revue Nr. 40) und über die Debattenkultur (in dieser Ausgabe).
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [42]
Dokument von 1947: Eine internationale Konferenz revolutionärer Gruppen
- 3216 Aufrufe
Am 25. und 26. Mai hat eine internationale Konferenz für den Kontakt unter den revolutionären Gruppen stattgefunden. Die Konferenz wurde nicht nur aus Sicherheitsgründen nicht groß im Voraus angekündigt, wie wir das von stalinistischer und sozialistischer Seite gewohnt sind. Die Teilnehmer der Konferenz sind sich vollumfänglich der schrecklichen konterrevolutionären Periode, die zurzeit das Proletariat heimsucht, sowie der eigenen Isolation bewusst –unvermeidlich in einer Zeit der sozialen Reaktion. Sie geben sich auch nicht den spektakulären Bluffs hin, die so ganz nach dem Geschmack – nach dem schlechten Geschmack – all der trotzkistischen Gruppen sind.
Diese Konferenz versuchte nicht, sich unmittelbare, konkrete Ziele zu setzen, die in der gegenwärtigen Zeit nicht realistisch sind. Auch versuchte sie nicht, irgendwelche willkürlichen Strukturen im Gewande einer Internationale zu schaffen oder flammende Aufrufe an die Arbeiterklasse zu verfassen. Das einzige Ziel war die Wiederaufnahme des Kontaktes unter den verstreuten revolutionären Gruppen und die Konfrontation ihrer Ansichten über die heutige Situation und die Perspektive des Kampfes der Arbeiterklasse.
Durch die Initiative zu dieser Konferenz hat der Communistenbond Spartacus aus Holland (besser bekannt unter dem Namen RätekommunistenA) die unselige Isolation durchbrochen, in der die Mehrheit der revolutionären Gruppen lebt, und die Klärung einiger gewisser Fragen ermöglicht.
Die Teilnehmer
Folgende Gruppen waren auf der Konferenz vertreten und haben an der Debatte teilgenommen:
– Holland: der Communistenbond Spartacus;
– Belgien: die Gruppen aus Brüssel und Gent, die sich auf den Communistenbond Spartacus beziehen;
– Frankreich: die Gauche Communiste de France und die Gruppe Prolétaire;
– Schweiz: die Gruppe Klassenkampf.[i]
Darüber hinaus nahmen Genossen etlicher revolutionärer Gruppierung entweder persönlich oder durch schriftliche Interventionen an den Debatten der Konferenz teil.
Es gilt auch einen langen Brief zu erwähnen, den die Sozialistische Partei Großbritanniens an die Konferenz adressierte, in dem sie ausführlich ihre spezifischen politischen Positionen formulierte.
Auch die FFGC[ii] sandte einen kurzen Brief, in welchem sie der Konferenz „erfolgreiche Arbeit“ wünschte, aber schrieb, dass sie wegen Zeitmangel und dringender Aufgaben nicht an der Konferenz teilnehmen könne.B
Die Arbeit der Konferenz
Folgende Tagesordnung wurde als Diskussionsrahmen für die Konferenz angenommen:
1. die gegenwärtige Periode;
2. die neuen Kampfformen der Arbeiterklasse (von den alten zu den neuen Kampfformen);
3. Aufgaben und Organisation der revolutionären Avantgarde;
4. Staat – Diktatur des Proletariates – Arbeiterdemokratie;
5. konkrete Fragen und Schlussfolgerungen (Übereinkunft über die internationale Solidarität, Kontakte, internationaler Informationsaustausch usw.).
Diese erste Konferenz war nicht gut genug vorbereitet. Es stand ihr zuwenig Zeit zur Verfügung, und die Tagesordnung erwies sich als viel zu ambitiös, um vollständig absolviert zu werden. Lediglich auf die ersten drei Punkte der Tagesordnung konnte genügend eingegangen werden. Jeder dieser Punkte löste interessante Diskussionen aus.
Natürlich wäre es übertrieben gewesen, zu erwarten, dass dieser Meinungsaustausch Einmütigkeit erzielt. Die Teilnehmer dieser Konferenz hegten keinesfalls solche Ansprüche. Dennoch kann man feststellen, dass die leidenschaftlichen Debatten eine größere Übereinstimmung als erwartet zeitigten.
Beim ersten Punkt der Tagesordnung, der allgemeinen Analyse der gegenwärtigen Epoche des Kapitalismus, hat die Mehrheit der Beiträge die Theorien von James Burnham über die unmittelbare Möglichkeit einer Revolution und die Notwendigkeit, sie anzuführen, abgelehnt. Ebenfalls wurde die Idee zurückgewiesen, nach der die kapitalistische Gesellschaft aufgrund einer möglichen Weiterentwicklung der Produktion fortdauern könne. Die gegenwärtige Periode wurde als die Periode des dekadenten Kapitalismus und der permanenten Krise bezeichnet, die ihren kulturellen und politischen Ausdruck im Staatskapitalismus findet.
Die Frage, ob die Gewerkschaften und die Beteiligung am Parlamentarismus in der heutigen Zeit für die Arbeiterklasse als Organisationsform und Aktionsfeld noch von Nutzen ist, hat eine lebendige und interessante Diskussion ausgelöst. Es ist bedauernswert, dass die Tendenzen, welche diese Formen des Klassenkampfes noch immer befürworten und deren überholten und antiproletarischen Charakter übersehen, nicht an der Konferenz teilnahmen, um ihre Position darzulegen. Dies gilt vor allem für den PCInt in Italien. Die Belgische Fraktion und die Autonome Föderation von Turin waren anwesend, doch ihre Überzeugung gegenüber diesen Positionen, die sie noch kürzlich verteidigt hatten, war dermaßen ins Schwanken geraten, dass sie es vorzogen, sich auf der Konferenz nicht dazu zu äußern.
Die Debatte drehte sich daher nicht um eine mögliche Verteidigung der Gewerkschaften und des Parlamentarismus als Formen des proletarischen Kampfes, sondern diskutierte ausschließlich die historischen Gründe, die Erklärung, warum es unmöglich ist, solche Formen des Kampfes in der gegenwärtigen Zeit weiterhin zu benutzen. In der Frage der Gewerkschaften wurde die Diskussion erweitert; sie drehte sich nicht ausschließlich um die Frage der Organisationsform als solche, die lediglich ein zweitrangiger Aspekt ist. Die Diskussion untersuchte vielmehr die Ziele, die den Kampf zu korporatistischen und ökonomischen Teilforderungen führen, welche im heutigen dekadenten Kapitalismus nicht mehr verwirklicht werden können; noch weniger können sie als Grundlage für eine Mobilisierung der Klasse dienen.
Die Frage der Fabrikkomitees oder Fabrikräte als neue Einheitsorganisation der Arbeiterklasse enthüllt nur ihre volle Bedeutung, wenn sie eng und untrennbar mit den Zielen verknüpft wird, vor denen das Proletariat heute steht. Das Ziel sind nicht ökonomische Reformen im Rahmen des kapitalistischen Regimes, sondern ist eine soziale Umwälzung des kapitalistischen Systems.
Der dritte Punkt der Tagesordnung – Aufgaben und Organisation der revolutionären Avantgarde – griff die Fragen auf, ob eine politische Klassenpartei notwendig ist oder nicht, welche Rolle dieser Partei im Emanzipationskampf der Arbeiterklasse spielt und wie das Verhältnis zwischen der Partei und der Klasse aussieht. Leider konnten diese Fragen nicht so ausführlich besprochen werden, wie wir es uns wünschten.
Die kurze Diskussion darüber erlaubte es den verschiedenen Tendenzen lediglich, ihre Positionen über diese Fragen grob darzulegen. Alle fühlten, dass damit eine entscheidende Frage angeschnitten wurde für eine eventuelle Annäherung unter den verschiedenen revolutionären Gruppen sowie auch für die Zukunft und den Erfolg des Proletariats in seinem Kampf für die Überwindung des Kapitalismus und den Aufbau des Sozialismus. Diese grundlegenden Fragen konnten nur gestreift werden und erfordern weitere Diskussionen zur Vertiefung und Präzisierung. Doch es ist wichtig festzustellen, dass, auch wenn es auf dieser Konferenz Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Rolle einer Organisation von bewussten kommunistischen Militanten gab, die Rätekommunisten und auch die anderen Teilnehmer die Notwendigkeit einer solchen Organisation – ob sie nun Partei genannt wird oder nicht – nicht ablehnten, damit der Sozialismus am Ende triumphiert. Diese Übereinstimmung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Wir hatten auf der Konferenz nicht genügend Zeit, um auf die anderen Punkte der Tagesordnung einzugehen. Gegen Ende fand eine sehr wichtige Diskussion über den Charakter und die Funktion der anarchistischen Bewegung statt. In der Diskussion über die Gruppen, die zu den nächsten Konferenzen eingeladen werden sollten, wurde die – trotz ihrer revolutionären Phraseologie – sozial-patriotische Rolle der anarchistischen Bewegung im Krieg von 1939-45 zur Sprache gebracht. Es wurde festgestellt, dass ihre Beteiligung am Partisanenkampf für die „nationale Befreiung und Demokratie“ in Frankreich, Italien und noch heute in Spanien ein logisches Resultat ihrer Beteiligung an der bürgerlichen „republikanischen und antifaschistischen“ Regierung Spaniens und am imperialistischen Krieg von 1936-38 in Spanien ist.
Unserer Auffassung, dass die anarchistische Bewegung wie die Trotzkisten oder alle anderen Tendenzen, die sich am imperialistischen Krieg beteiligten und noch beteiligen – sei es im Namen der Verteidigung eines Landes (Verteidigung Russlands) oder sei es im Namen der Verteidigung einer bürgerlichen Herrschaftsform gegen eine andere (Verteidigung der Republik und der Demokratie gegen den Faschismus) -, keinen Platz auf einer Konferenz revolutionärer Gruppen hat, wurde von den meisten Teilnehmern zugestimmt. Lediglich der Vertreter der Gruppe Prolétaire sprach sich für die Einladung gewisser nicht-orthodoxer Tendenzen aus dem anarchistischen und trotzkistischen Lager aus.
Schlussfolgerung
Wie schon gesagt, wurde die Konferenz beendet, ohne die Tagesordnung vollständig diskutiert zu haben, ohne praktische Beschlüsse und ohne die Annahme irgendwelcher Resolutionen. Es konnte auch nicht anders sein. Dies nicht so sehr, um die, wie einige Genossen es ausdrückten, religiöse Zeremonie am Ende einer jeden Konferenz zu vermeiden, die in einer Schlussabstimmung über Resolutionen besteht, die nicht viel bedeuten. Unserer Auffassung nach lag dies eher daran, dass die Diskussionen nicht genügend entwickelt waren, um die Abstimmung über eine Resolution zu ermöglichen.
Die Skeptiker und jene, die es nicht gut mit uns meinen, mögen denken: „Also war diese Konferenz nichts anderes als ein Treffen, auf dem dieselben alten Diskussionen wieder aufgegriffen wurden, und daher kaum der Rede wert“. Nichts könnte falscher sein. Wir denken dagegen, dass die Konferenz in der Tat von Interesse war und dass ihre Bedeutung sich künftig im Verhältnis zwischen den verschiedenen revolutionären Gruppen zeigen wird. Denken wir daran, dass diese Gruppen, die letzten 20 Jahre in der Isolation verbracht hatten und auf sich selbst gestellt gewesen waren. Dies hat bei allen eine Art Bunkermentalität oder Sektierertum hervorgerufen. Die vielen Jahre der Isolation haben das Denken, die Auffassungen und die Ausdrucksweise dieser Gruppen derart geprägt, dass sie für die anderen Gruppen oft unverständlich sind. Es besteht unbestritten die Notwendigkeit, sich mit den Ideen und Argumenten der anderen Gruppen auseinanderzusetzen und die eigenen Ansichten der Kritik der Anderen auszusetzen. All das ist Bedingung für das Weiterleben von revolutionären Ideen und gegen den Dogmatismus und macht diese Konferenz so bedeutend.
Der erste Schritt, der wenn auch kein spektakulärer, so doch ein schwieriger war, ist gemacht. Alle Teilnehmer der Konferenz, einschließlich der Belgischen Fraktion, welche erst nach langem Zögern und mit Skepsis teilnahm, haben ihre Zufriedenheit ausgesprochen und waren über die brüderliche Atmosphäre und die Ernsthaftigkeit der Diskussion erfreut. Alle haben gesagt, dass sie eine weitere Konferenz einberufen wollen, die breiter und besser vorbereitet sein soll, und dass sie die begonnene Arbeit der Klärung und Gegenüberstellung von Ideen weiterzuführen beabsichtigen.
Das positive Ergebnis weckt die Hoffnung, den eingeschlagenen Weg fortzuführen, und wird den revolutionären Militanten und Gruppen helfen, die gegenwärtige Situation der Zersplitterung zu überwinden und die Arbeit für die Emanzipation unserer Klasse wirkungsvoller zu gestalten. Dies ist die Klasse, welche vor der Aufgabe steht, die gesamte Menschheit vor der schrecklichen und blutigen Zerstörung durch den dekadenten Kapitalismus zu bewahren.
MarcoA In der Zeitschrift Le Libertaire vom 29. Mai findet man einen Artikel über diese Konferenz, der ein Phantasiegebilde ist. Der Autor, der mit AP unterschreibt und sich als Spezialist für die Geschichte der kommunistischen Arbeiterbewegung bezeichnet, nimmt die „Freiheit“ im Umgang mit der Geschichte etwas zu wörtlich. Er beschreibt die Konferenz – an der er gar nicht teilnahm und von der er auch gar nichts weiß – als eine Konferenz von Rätekommunisten. In Wirklichkeit nahmen Letztere, obwohl sie zur Konferenz aufgerufen hatten, mit demselben Status daran teil wie alle anderen. AP nimmt die „Freiheit“ aber nicht nur bezüglich der Vergangenheit, sondern auch bezüglich der Zukunft auf die leichte Schulter. In der Manier jener Journalisten, die die Exekution Görings schon im Voraus in Details beschrieben hatten, ohne auf die Idee zu kommen, dass dieser die Unverschämtheit besitzen könnte, im letzten Moment Selbstmord zu begehen, hat der Historiker AP in Le Libertaire die Beteiligung anarchistischer Gruppen an der Konferenz angekündigt, obwohl dem gar nicht so war. Es stimmt, dass Le Libertaire tatsächlich eingeladen war, doch sie schlugen diese Einladung unserer Ansicht nach zu Recht aus. Die Beteiligung von Anarchisten an der republikanischen Regierung und am imperialistischen Krieg in Spanien 1936-38, die Weiterführung ihrer Kollaborationspolitik mit allen spanischen politischen Formationen in der Emigration unter der Fahne des Antifaschismus und des Kampfes gegen Franco, die ideologische und aktive Beteiligung von Anarchisten in der „Résistance“ gegen die „fremde“ Besatzungsmacht haben aus ihnen eine Strömung gemacht, die dem revolutionären Kampf der Arbeiterklasse absolut fremd ist. Die anarchistische Bewegung hatte aus diesem Grund keinen Platz in dieser Konferenz, und es war ein Fehler, sie überhaupt einzuladen.
[i] Eine „Korrektur“, die in INTERNATIONAL-ISME Nr. 24, veröffentlicht wurde, geht auf die Teilnahme der „Autonomen Sektion von Turin“ des PCInt (Partito Comunista Internazionalista, nicht die stalinistische PCI!) ein. Die Sektion verfasste diese Korrektur, um den im Rapport entstandenen Eindruck bezüglich einiger ihrer Positionen richtigzustellen: Die Sektion „erklärte sich autonom eben wegen ihrer Meinungsverschiedenheiten über die Frage des Parlamentarismus und die Schlüsselfrage der Einheit der revolutionären Kräfte“
[ii] Die FFGC, die sogenannte „Französische Fraktion der Kommunistischen Linken“, hatte mit der GCF auf einer unklaren politischen Basis gebrochen, welche mehr mit persönlichen Unstimmigkeiten und Ressentiments zu tun hatte als mit wirklichen Differenzen. Siehe dazu unsere Broschüre La Gauche Communiste de France.
B Die „dringenden Arbeiten“ der FFGC drücken gut aus, wie ernst sie den Kontakt mit anderen revolutionären Gruppen nimmt. Worunter leidet die FFGC tatsächlich? An einem „Zeitmangel“ oder an einem Mangel an Interesse und Verständnis für die Wichtigkeit des Kontaktes und der Diskussionen unter revolutionären Gruppen? Oder macht ihnen etwa die Konfrontation ihrer Positionen mit denen anderer Gruppen wegen ihres Mangels an politischer Orientierung Angst (mal für, mal gegen die Beteiligung an den Wahlen; mal für, mal gegen die Arbeit in den Gewerkschaften, mal für, mal gegen die Beteiligung an antifaschistischen Komitees usw.)?
Politische Strömungen und Verweise:
- Kommunistische Linke [41]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Die Debattenkultur: Eine Waffe des Klassenkampfes
- 3255 Aufrufe
Die „Debattenkultur“ ist weder für die Arbeiterbewegung noch für die IKS eine neue Frage. Dennoch hat der Verlauf der Geschichte unsere Organisation – seit Anfang des neuen Jahrtausends – gezwungen, zu dieser Frage zurückzukehren und sie noch gründlicher zu untersuchen. Es gab zwei wichtige Entwicklungen, die uns veranlasst haben, dies zu tun: erstens das Auftreten einer neuen Generation von Revolutionären und zweitens die interne Krise, die wir zu Beginn dieses Jahrhunderts erlitten hatten.
Der politische Dialog und die neue Generation
Es war in der ersten Linie der Kontakt mit einer neuen Generation von Revolutionären, der die IKS dazu veranlasste, ihre Offenheit nach außen und ihre Fähigkeit zum politischen Dialog bewusster zu pflegen.
Jede Generation bildet ein Glied in der Kette der Menschheitsgeschichte. Jede von ihnen wird mit drei fundamentalen Aufgaben konfrontiert: damit, das kollektive Erbe von der vorherigen Generation zu übernehmen; dieses Erbe auf der Grundlage ihrer eigenen Erfahrung zu bereichern und es schließlich weiterzureichen, so dass die nächste Generation mehr erreichen kann, als eigentlich in ihrem Vermögen steht.
Diese Aufgaben sind alles andere als leicht und stellen eine besondere Herausforderung dar. Dies trifft auch auf die Arbeiterbewegung zu. Die ältere Generation hat ihre Erfahrungen anzubieten. Doch sie trägt auch an den Wunden und Traumata ihrer Kämpfe, musste lernen, Niederlagen, Enttäuschungen und der Tatsache ins Gesicht zu schauen, dass die Erringung von dauernden Errungenschaften des kollektiven Kampfes oftmals mehr als eine Lebensspanne erfordert.[i] Es benötigt die Energie und den Elan der folgenden Generation, aber auch ihre neuen Fragen und ihre Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu betrachten.
Doch so sehr sich die Generationen gegenseitig benötigen, ist ihre Fähigkeit, die nötige Einheit zu schmieden, nicht automatisch gegeben. Je mehr sich die Gesellschaft von der Naturalwirtschaft entfernte, je unablässiger und schneller der Kapitalismus die Produktivkräfte und die gesamte Gesellschaft „revolutioniert“, desto mehr unterscheiden sich die Erfahrungen der einen Generation von der nächsten. Der Kapitalismus, das Konkurrenzsystem schlechthin, spielt die Generationen im Kampf einer gegen alle gegenseitig aus.
Dies im Hinterkopf begann unsere Organisation, sich auf die Aufgabe einzustellen, diese Verbindung zu knüpfen. Doch mehr noch als diese Vorbereitung war es die aktuelle Erfahrung, auf diese neue Generation zu stoßen, die der Frage der Debattenkultur eine - in unseren Augen - zusätzliche Bedeutung verlieh. Wir trafen auf eine Generation, die dieser Frage eine weitaus größere Bedeutung beimisst als die 68er Generation. Das erste wichtige Anzeichen für diesen Wandel in der Arbeiterklasse insgesamt war die Massenbewegung der Studenten und Schüler im Frühjahr 2006 in Frankreich gegen die „Prekarisierung“ der Beschäftigung. Hier fiel die Betonung der freiesten und breitesten Debatte insbesondere in den allgemeinen Versammlungen besonders stark ins Auge. Im Gegensatz dazu war die Studentenbewegung, die sich in den späten 60er Jahren entwickelt hatte, häufig von ihrer Unfähigkeit zum politischen Dialog gekennzeichnet. Dieser Unterschied ist in erster Linie ein Ausdruck der Tatsache, dass das Studentenmilieu heute weitaus stärker proletarisiert ist, als dies vor vierzig Jahren der Fall gewesen war. Die intensive, breite Debatte war stets ein wichtiger Eckpfeiler proletarischer Massenbewegungen gewesen und charakterisierte auch die Arbeiterversammlungen 1968 in Frankreich oder 1969 in Italien. Doch 2006 gab es eine Offenheit der kämpfenden Jugend gegenüber den älteren Generationen, eine Neugier, um von ihren Erfahrungen zu lernen. Dies unterschied sich deutlich vom Verhalten der Studentenbewegung in Deutschland Ende der 60er Jahre (was vielleicht die Stimmung zu jener Zeit am meisten karikierte). Einer ihrer Slogans war: alle über 30 ab ins Konzentrationslager! Hand in Hand mit dieser Ansicht ging die Praxis einher, jeden Anderen niederzubrüllen, „rivalisierende“ Treffen gewaltsam zu sprengen etc. Hier liegt auf psychologischer Ebene eine der Wurzeln für die Entwicklung des Terrorismus als eine Protestform nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien. Der Bruch in der Kontinuität zwischen den Generationen der Arbeiterklasse war eine der Wurzeln dieses Problems, sind doch die Beziehungen zwischen den Generationen seit altersher ein bevorzugter Bereich, um eine Dialogbereitschaft zu schaffen. Die Militanten von 1968 unterstellten der Generation ihrer Eltern, sich an den Kapitalismus „verkauft“ zu haben, oder betrachteten sie (wie in Deutschland oder Italien) als eine Generation von Faschisten und Kriegsverbrechern. Für die ArbeiterInnen, die die schreckliche Ausbeutung der Nachkriegsphase nach 1945 in der Hoffnung ertragen hatten, dass es ihren Kinder einst besser ergehen würde als ihnen, war es eine bittere Enttäuschung zu hören, wie ihre Kinder sie beschuldigten, „Parasiten“ zu sein, die von der „Ausbeutung der Dritten Welt“ lebten. Jedoch gibt es auch keinen Zweifel, dass die Elterngeneration jener Zeit weitestgehend die Dialogbereitschaft verloren hatte oder zumindest nicht gelernt hatte. Diese Generation trug durch den II. Weltkrieg und den Kalten Krieg, durch die faschistische, stalinistische und sozialdemokratische Konterrevolution schlimme Narben davon.
Im Gegensatz dazu kündigte sich 2006 in Frankreich etwas Neues und außerordentlich Fruchtbares an.[ii] Bereits einige Jahre zuvor hatte sich das Anliegen der neuen Generation in Gestalt der revolutionären Minderheiten der Arbeiterklasse angekündigt. Diese Minderheiten waren von dem Moment an, wo sie die Ebene des politischen Lebens betraten, mit ihrer eigenen Kritik am Sektierertum und an der Verweigerung der Debatte gewappnet. Eine der ersten Forderungen, die sie erhoben, war, dass die Debatte nicht als ein Luxus betrachtet werden dürfe, sondern als eine dringende Notwendigkeit; dass jene, die sich an ihr beteiligen, den Anderen ernstnehmen und lernen sollten, sich einander zuzuhören; dass Argumente die Waffen dieser Auseinandersetzung sind, und nicht die brutale Gewalt oder der Appell an moralische bzw. theoretische „Autoritäten“. In Bezug auf das internationalistische proletarische Lager kritisierten diese Genossen im All-gemeinen (und völlig richtig) den Mangel an solidarischer Debatte zwischen den existierenden Gruppen. Sie verwarfen ohne Umschweife den Gedanken, dass der Marxismus ein Dogma sei, welches die neue Generation unkritisch adoptieren müsse.[iii]
Was uns anging, so waren wir von der Reaktion dieser neuen Generation gegenüber der IKS überrascht. Die neuen Genossen, die auf unseren öffentlichen Treffen erschienen, die Kontakte überall auf der Welt, die mit uns zu korrespondieren begannen, die verschiedenen politischen Gruppierungen und Zirkel, mit denen wir debattierten – sie alle sagten uns wiederholt, dass sie den proletarischen Charakter der IKS nicht nur wegen unserer programmatischen Positionen, sondern auch wegen unserer Haltung – insbesondere die Art, wie wir debattierten – anerkannten.
Woher kommt dieses tiefe Anliegen der neuen Generation in dieser Frage? Wir denken, es resultiert aus dem Ausmaß der historischen Krise des Kapitalismus, die heute weitaus schwerwiegender und gefährlicher ist als nach 1968. Dies erfordert die radikalste Kritik am Kapitalismus, die bis in die tiefsten Wurzeln der Probleme reichen muss. Eine der ruinösesten Auswirkungen des bürgerlichen Individualismus ist die Art und Weise, wie er die Fähigkeit zerstört, zu diskutieren und insbesondere einander zuzuhören und voneinander zu lernen. Der Dialog wird von der Rhetorik ersetzt; Sieger ist jener, der den meisten Krach macht (wie in bürgerlichen Wahlen). Die Debattenkultur ist dank der menschlichen Sprache der Hauptweg, das Bewusstsein als erstrangige Waffe für jene Klasse zu entwickeln, die die Zukunft der Menschheit in sich trägt. Für das Proletariat ist sie das einzige Mittel zur Überwindung seiner Isolation und Ungeduld und dafür, in Richtung einer Vereinigung seiner Kämpfe zu gehen.
Ein anderer Aspekt dieses Anliegens heute ist der Kampf, um den Albtraum des Stalinismus zu überwinden. Viele der Mitstreiter, die heute internationalistischen Positionen zustreben, kommen direkt aus dem linksextremistischen Milieu und sind von Letzterem beeinflusst. Dieses Milieu stellt eine Karikatur der dekadenten bürgerlichen Ideologie und Haltung in einem sozialistischen Gewand dar. Diese Militanten wurden politisch dazu gebracht zu glauben, dass der Austausch von Argumenten mit dem „bürgerlichen Liberalismus“ identisch sei, dass ein „guter Kommunist“ jemand sei, der seinen Mund hält sowie seinen Kopf und seine Gefühle ausschaltet. Die Genossen, die heute entschlossen sind, diese Auswirkungen dieses todgeweihten Produkts der Konterrevolution abzuschütteln, verstehen in wachsendem Maße, dass dies die Ablehnung nicht nur ihrer Positionen, sondern auch ihrer Mentalität erfordert. Indem sie so verfahren, tragen sie zur Re-Etablierung einer Tradition der Arbeiterbewegung bei, die vom Aussterben bedroht war, als die Konterrevolution einen Bruch in ihrer organischen Kontinuität verursachte.[iv]
Organisationskrisen und die Tendenz zum Monolithismus
Der zweite bedeutende Impuls für die IKS, zur Frage der Diskussionskultur zurückzukommen, war unsere eigene interne Krise zu Beginn des neuen Jahrtausends, die von einem bösartigen Verhalten gekennzeichnet war, wie wir es in unseren Reihen noch nie erlebt hatten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte musste die IKS nicht einen, sondern mehrere ihrer Mitglieder ausschließen.5[v] Am Anfang dieser Krise standen Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten in der Frage der Zentralisierung in unserer französischen Sektion. Eigentlich gibt es keinen Grund, warum Divergenzen dieser Art die Ursache einer Organisationskrise sein sollen. Und sie waren auch nicht die Ursache. Was die Krise verursachte, war die Weigerung, zu diskutieren, und besonders der Versuch, zu isolieren und zu verunglimpfen; d.h. jene persönlich anzugreifen, mit denen man nicht übereinstimmte.
Im Anschluss an diese Krise verpflichtete sich die Organisation, bis an die tiefsten Wurzeln der Krisen und Abspaltungen in unserer Geschichte zu gehen. Wir haben bereits Beiträge zu einigen dieser Aspekte veröffentlicht.[vi] Eine der Schlussfolgerungen, zu denen wir gelangten, war, dass in all den Abspaltungen, die wir erlitten, die Tendenz zum Monolithismus eine wichtige Rolle spielte. Sobald Divergenzen auftraten, begannen gewisse Mitglieder zu behaupten, dass sie nicht länger mit den anderen zusammenarbeiten könnten, dass die IKS zu einer stalinistischen Organisation geworden sei oder sich im Prozess der Degenerierung befinde. Diese Krisen brachen anlässlich von Divergenzen aus, die in einer nichtmonolithischen Organisation größtenteils problemlos eingedämmt und in jedem Fall diskutiert und geklärt worden wären, ehe auch nur der Gedanke an eine Trennung aufgekommen wäre.
Das wiederholte Auftreten von monolithischen Herangehensweisen ist durchaus überraschend in einer Organisation, die sich gerade auf die Traditionen der Italienischen Fraktion beruft, welche stets den Standpunkt vertrat, dass, wann immer es Divergenzen über fundamentale Prinzipien gibt, gründliche und kollektive Klärung jeder organisatorischen Trennung vorausgehen müsse.
Die IKS ist die einzige Strömung der Kommunistischen Linken heute, die sich ausdrücklich in die organisatorische Tradition der Italienischen Fraktion (Bilan) und der Französischen Kommunistischen Linken (GCF) stellt. Im Gegensatz zu den Gruppen, die aus dem PCInt stammen, welcher Ende des II. Weltkrieges in Italien gegründet worden war, erkannte die Italienische Fraktion den überaus proletarischen Charakter der anderen internationalen Strömungen der Kommunistischen Linken an, die in Reaktion auf die stalinistische Konterrevolution entstanden waren, insbesondere die Deutsche und die Holländische Linke. Weit davon entfernt, diese Strömungen als „anarchospontaneistisch“ oder „syndikalistisch“ abzutun, lernte sie von ihnen, was zu lernen war. Tatsächlich betraf ihre Hauptkritik an dem, was später zur „rätekommunistischen“ Strömung wurde, deren Sektierertum, das sich durch ihre Ablehnung der Beiträge der Zweiten Internationale und insbesondere des Bolschewismus ausgedrückt hat.[vii] Auf diese Weise hielt die Italienische Fraktion selbst in der fürchterlichen Konterrevolution das marxistische Verständnis aufrecht, dass sich Klassenbewusstsein kollektiv entwickelt und dass keine Partei oder Tradition ein Monopol darauf erheben kann. Daraus folgerte sie, dass das Bewusstsein nicht ohne solidarische, öffentliche, internationale Debatte entwickelt werden kann.[viii] Doch dieses fundamentale Verständnis, obgleich Teil des grundlegenden Erbes der IKS, ist nicht leicht in die Praxis umzusetzen. Die Debattenkultur kann nur gegen den Strom der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt werden. Da die spontane Tendenz innerhalb des Kapitalismus nicht die Klärung von Ideen ist, sondern die Gewalt, Manipulation und das Erringen von Mehrheiten (am beispielhaftesten im Wahlzirkus der bürgerlichen Demokratie), enthält die Infiltration dieses Einflusses in proletarischen Organisationen die Keime der Krise und Degeneration. Die Geschichte der bolschewistischen Partei veranschaulicht dies perfekt. So lange wie die Partei die Speerspitze der Revolution war, war die lebendigste, oft kontroverse Debatte eines ihrer Hauptmerkmale. Im Gegensatz dazu war die Verbannung realer Fraktionen (nach dem Massaker von Kronstadt von 1921) ein unübersehbares Anzeichen und aktiver Faktor ihrer Degenerierung. Desgleichen kann die Praxis der „friedlichen Koexistenz“ (d.h. die Nicht-Debatte) von einander widersprechenden Positionen, die bereits den Gründungsprozess des Partio Comunista Internazionalista auszeichnete, oder die Theoretisierung der Tugenden des Monolithismus durch Bordiga und seine Anhänger nur im Zusammenhang mit der historischen Niederlage in der Mitte des 20. Jahrhunderts verstanden werden.
Wenn revolutionäre Organisationen ihre fundamentale Rolle bei der Entwicklung und Ausbreitung von Klassenbewusstsein erfüllen wollen, ist die Kultivierung einer kollektiven, internationalen, solidarischen und öffentlichen Diskussion absolut notwendig. Es ist wahr, dass dies einen hohen Grad an politischer Reife (und auch allgemeiner, an menschlicher Reife) erfordert. Die Geschichte der IKS ist eine Illustrierung der Tatsache, dass dies nicht über Nacht erreicht werden kann, sondern das Produkt einer historischen Entwicklung ist. Heute hat die neue Generation eine wichtige Rolle in diesem Reifungsprozess zu spielen.
Die Debattenkultur in der Geschichte
Die Fähigkeit, zu debattieren, war ein Hauptkennzeichen in der Arbeiterbewegung gewesen. Doch die Debattenkultur war keine Erfindung der Arbeiterbewegung. Wie in anderen wichtigen Bereichen war auch hier der Kampf für den Sozialismus in der Lage, die großen Errungenschaften der Menschheit zu assimilieren, indem er sie auf seine eigenen Bedürfnisse anwendete. Dadurch wandelte er diese Qualitäten um und hob sie auf eine höhere Ebene.
Grundsätzlich ist die Debattenkultur ein Ausdruck des eminent sozialen Charakters der Menschheit. Sie ist insbesondere eine Auswirkung des spezifisch menschlichen Gebrauchs der Sprache. Der Gebrauch der Sprache als ein Mittel zum Informationsaustausch ist etwas, was die Menschheit mit vielen Tieren teilt. Was die Menschheit jedoch vom Rest der Natur unterscheidet, ist die Fähigkeit, Argumentationen (die mit der Entwicklung der Logik und der Wissenschaften verknüpft sind) zu pflegen, auszutauschen und die anderen kennenzulernen (die Kultivierung des Mitgefühls, das unter anderem mit der Entwicklung der Kunst verknüpft ist).
Folglich ist diese Qualität nicht neu. In der Tat ging sie der Klassengesellschaft voraus und spielte mit Sicherheit eine tragende Rolle beim Aufstieg der Menschheit. Engels beispielsweise nahm auf die Rolle der allgemeinen Versammlungen der Griechen in der homerischen Epoche, der frühen deutschen Stämme oder der Irokesen in Nordamerika Bezug und pries besonders die Debattenkultur Letztgenannter.[ix] Leider sind wir, trotz des Pionierwerks solcher Menschen wie Lewis Henry Morgan im 19. Jahrhundert und seiner Nachfolger, nur unzureichend über die frühen und mit ziemlicher Sicherheit entscheidenden Entwicklungen auf diesem Gebiet informiert.
Doch was wir wissen, ist, dass die Philosophie und die Anfänge des wissenschaftlichen Denkens in der Geschichte zu blühen begannen, als die Mythologie und der naive Realismus – dieses antike, widersprüchliche und doch unzertrennliche Paar – in Frage gestellt wurden. Beide sind Gefangene der Unfähigkeit, die un-mittelbaren Erfahrungen besser zu verstehen. Die Gedanken, die sich der frühe Mensch über seine praktische Erfahrung machte, waren religiöser Natur. „Seit der frühen Zeit, wo die Menschen, noch in gänzlicher Unwissenheit über ihren eigenen Körperbau und angeregt durch Traumerscheinungen, auf die Vorstellung kamen, ihr Denken und Empfinden sei nicht eine Tätigkeit ihres Körpers, sondern einer besonderen, in diesem Körper wohnenden und ihn mit beim Tode verlassenden Seele – seit dieser Zeit mussten sie über das Verhältnis dieser Seele zur äußern Welt sich Gedanken machen. Wenn sie im Tod sich vom Körper trennte, fortlebte, so lag kein Anlass vor, ihr noch einen besondren Tod anzudichten; so entstand die Vorstellung von ihrer Unsterblichkeit, die auf jener Entwicklungsstufe keineswegs als ein Trost erscheint, sondern als ein Schicksal, wogegen man nicht ankann, und oft genug, wie bei den Griechen, als ein positives Unglück.“ (Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, MEW 21, S. 274)
Die ersten Schritte in der langsamen Entwicklung der Kultur und der Produktivkräfte fanden im Rahmen des naiven Realismus statt. Das magische Denken hatte, auch wenn es bis zu einem gewissen Grad psychologische Weisheiten enthielt, vor allem die Aufgabe, das Un-erklärliche zu erklären, um so die Furcht zu begrenzen. Beides, Mythologie und naiver Realismus, leistete wichtige Beiträge zum Fortschritt der Menschheit. Die Behauptung, dass der reale Realismus eine besondere Affinität zur materialistischen Philosophie habe oder dass Letzterer sich direkt aus ihm entwickelt habe, entbehren jedoch jeglicher Grundlage.
„Es ist ein alter Satz der in das Volksbewusstsein übergegangenen Dialektik, dass die Extreme sich berühren. Wir werden uns demnach schwerlich irren, wenn wir die äußersten Grade der Phantasterei, Leichtgläubigkeit und Aberglauben suchen nicht etwa bei derjenigen naturwissenschaftlichen Richtung, die, wie die deutsche Naturphilosophie, die objektive Welt in den Rahmen ihres subjektiven Denkens einzuzwängen suchte, sondern vielmehr bei der entgegengesetzten Richtung, die, auf die bloße Erfahrung pochend, das Denken mit souveräner Verachtung behandelt und es wirklich in der Gedankenlosigkeit auch am weitesten gebracht hat. Diese Schule herrscht in England.“ (Engels: Dialektik der Natur, MEW 20, S. 337)
Die Religion entstand, wie Engels aufzeigt, nicht nur aus einer magischen Weltanschauung, sondern auch aus dem naiven Realismus. Ihren ersten, oft kühnen Verallgemeinerungen über die Welt war notwendigerweise ein autoritativer Charakter verliehen.
Die ersten Bauerngemeinden begriffen beispielsweise schnell ihre Abhängigkeit vom Regen, doch waren sie noch weit entfernt davon, die Bedingungen zu begreifen, von denen der Regen abhängt. Die Erfindung eines Regengottes ist ein schöpferischer, sich selbst versichernder Akt, der den Eindruck erweckt, dass es möglich ist, den Verlauf der Natur durch Zuwendungen und Hingabe zu beeinflussen. Der Homo sapiens ist eine Spezies, die sich auf die Entwicklung des Bewusstseins zur Absicherung ihres Überlebens verlässt. Als solche ist sie mit einem bis dahin nie gekannten Problem konfrontiert: mit der oft lähmenden Furcht vor dem Unbekannten. Die Erklärungen des Unbekannten müssen also über alle Zweifel erhaben sein. Aus diesen Bedürfnissen heraus entstanden als ihr höchstentwickelter Ausdruck die Religionen der Offenbarung. Die ganze emotionale Grundlage dieser Weltsicht ist der Glaube, nicht das Wissen.
Der naive Realismus ist nichts anderes als die andere Seite derselben Münze, einer Art elementare geistige „Arbeitsteilung“. Was auch immer wir nicht in einem unmittelbaren, praktischen Sinne erklären können, betritt die Welt der Magie. Mehr noch, das praktische Verständnis ist selbst in einer religiösen Vision eingebettet, ursprünglich in jener des Animismus. Hier wird die ganze Welt zum Fetisch. Selbst die Prozesse, die das menschliche Wesen bewusst produzieren und reproduzieren kann, finden allem Anschein nach unter Zuhilfenahme personalisierter Kräfte statt, die unabhängig von unserem Willen existieren.
Es ist klar, dass es in dieser Welt wenig Platz für die Debatte im modernen Sinne des Begriffes gab. Ungefähr vor zweieinhalb Tausend Jahren begann sich eine neue Qualität stärker Geltung zu verschaffen, die das Zwillingspaar von Religion und „gesundem Menschenverstand“ direkt konfrontierte. Sie entwickelte sich aus den alten traditionellen Denkmustern in dem Sinne, dass sich Letztere in ihr Gegenteil verkehrten. So wandelte sich das frühe dialektische Denken, das der Klassengesellschaft vorausging – ausgedrückt z.B. in China durch die Idee der Polarität zwischen Yin und Yang, zwischen dem männlichen und weiblichen Prinzip -, in ein kritisches Denken um, das auf den wesentlichen Komponenten der Wissenschaft, der Philosophie und des Materialismus beruhte. Doch wäre all dies undenkbar gewesen ohne das, was wir Debattenkultur nennen.
Was verhalf dieser neuen Vorgehensweise zu ihrem Aufstieg? Ganz allgemein gesprochen, war es die Vergrößerung der Welt der gesellschaftlichen Beziehungen und des sozialen Wissens. Wie Engels zu sagen beliebte, ist der gesunde Menschenverstand ein starker und gesunder Bursche, solange er sich zuhause in seinen vier Wänden aufhält, doch erlebt er alle Arten von Unfällen, sobald er sich in die große, weite Welt hinauswagt. Doch auch die Grenzen der Religion bei der Eindämmung der Furcht wurden enthüllt. In der Tat hatte sie die Furcht nicht genommen, sondern bloß nach außen verlagert. Durch diesen Mechanismus hatte die Menschheit versucht, mit einem Schrecken fertig zu werden, der sie andernfalls zu einer Zeit, als sie noch keine anderen Selbstverteidigungsmittel hatte, zerschmettert hätte. Doch dadurch machte sie ihre eigene Furcht zu einer weiteren Kraft, die über sie herrschte.
Zu „erklären“, was noch unerklärlich ist, bedeutet, auf ihre wirkliche Untersuchung zu verzichten. So kommt es zum Kampf zwischen Religion und Wissenschaft, zwischen Glauben und Wissen oder, wie Spinoza es formulierte, zwischen Unterwerfung und Untersuchung. Die griechische Philosophie entstand ursprünglich in Opposition zur Religion. Schon Thales, der erste uns bekannte Philosoph, brach aus der mystischen Weltsicht aus. Anaximander, der ihm folgte, forderte, dass die Natur aus sich selbst erklärt werden müsse.
Doch das griechische Denken war auch eine Kriegserklärung an den naiven Realismus. Heraklitus erklärte, dass das Wesen der Dinge nicht auf ihrer Stirn geschrieben steht. „Die Natur liebt es sich zu verbergen“, erklärte er. Oder wie Marx sagte: „Und alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen.“ (Marx: Kapital, Bd. 1, S. 825)
Die neue Herangehensweise forderte neben dem Glauben auch das Vorurteil und die Tradition heraus, die das Credo des Alltagslebens ist (in der deutschen Sprache haben Glaube und Aberglaube eine gemeinsame Wurzel). Dagegen standen Theorie und Dialektik. „Man mag noch so viel Geringschätzung hegen für alles theoretische Denken, so kann man doch nicht zwei Naturtatsachen in Zusammenhang brin-gen oder ihren bestehenden Zusammenhang einsehen ohne theoretisches Denken.“ (Engels: Dialektik der Natur, MEW 20, S. 346)
Der wachsende gesellschaftliche Umgang war natürlich mit der Entwicklung der Produktivkräfte verknüpft. So erschienen zusammen mit den Problemen – die Ungenügendheit der herrschenden Denkweise – auch die Mittel zu ihrer Lösung. In erster Linie ein gesteigertes Selbstvertrauen insbesondere in die Kraft des menschlichen Gedankens. Die Wissenschaft kann nur entstehen, wenn es eine Fähigkeit und Bereitschaft gibt, die Existenz von Zweifeln und Unsicherheiten zu akzeptieren. Im Gegen-satz zur Autorität der Religion und der Tradition ist die Wahrheit der Wissenschaft nicht absolut, sondern relativ. So ergibt sich nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit des Meinungsaustausches.
Es liegt auf der Hand, dass das Bekenntnis zur Herrschaft des Wissens nur gemacht werden kann, wo die Produktivkräfte (im breitesten kulturellen Sinne) einen bestimmten Reifegrad erreicht haben. Es ist unvorstellbar ohne eine entsprechende Entwicklung der Künste, der Bildung, der Literatur, der Naturbeobachtung, der Sprache. Und es geht auf einer bestimmten Stufe in der Geschichte Hand in Hand mit dem Aufkommen einer Klassengesellschaft und einer herrschenden Schicht, die von der Bürde der materiellen Produktion befreit ist. Doch diese Entwicklungen verhalfen der neuen, un-abhängigen Herangehensweise nicht automatisch zu ihrem Aufstieg. Weder die Ägypter noch die Babylonier, trotz ihrer wissenschaftlichen Fortschritte, noch die Phönizier, die als erste ein modernes Alphabet entwickelten, gingen so weit in diese Richtung wie die Griechen.
In Griechenland war es die Entwicklung der Sklaverei, die das Auftauchen einer Klasse von freien Bürgern neben den Priestern ermöglichte. Diese lieferte die materielle Grundlage für die Untergrabung der Religion. (Wir können so die Formulierung von Engels im AntiDühring besser verstehen: ohne die Sklaverei in der Antike kein moderner Sozialismus.) In Indien, wo ungefähr zur gleichen Zeit eine Entwicklung von Philosophie, Materialismus (die so genannte Lokayata) und des Studiums der Natur stattfand, fiel dies mit der Bildung und Stärkung eines Kriegsadels zusammen, der sich der Brahmanischen Theokratie widersetzte, eines Adels, der teilweise auf landwirtschaftlicher Sklaverei basierte. Wie in Griechenland, wo der Kampf von Heraklitus gegen Religion, Unmoral und die Verurteilung körperlicher Freuden sich direkt gegen die Vorurteile sowohl der herrschenden Tyrannen als auch der unterdrückten Bevölkerung richtete, ging die neue militante Vorgehensweise in Indien von der Aristokratie aus. Buddhismus und Jainismus, die ungefähr zur selben Zeit erschienen, waren weitaus tiefer in der geplagten Bevölkerung verankert, aber sie blieben im religiösen Rahmen – mit ihrer Auffassung von der Re-Inkarnation der Seele, die typisch für eine Kastengesellschaft war, der sie sich widersetzten (auch in Ägypten zu finden).
Im Gegensatz dazu wurde dies in China, wo es eine Entwicklung der Wissenschaft und einer Art von rudimentärem Materialismus (zum Beispiel in der Logik von Mo’-Ti‘) gab, durch das Fehlen einer Kaste von herrschenden Priestern, gegen die man aufbegehren konnte, eingeschränkt. Das Land wurde von einer Militärbürokratie beherrscht, die im Kampf gegen die benachbarten „Barbaren“ gebildet worden war.[x]
In Griechenland gab es einen zusätzlichen und in vielerlei Hinsicht entscheidenden Faktor, der auch in Indien eine wichtige Rolle spielte: eine fortgeschrittene Entwicklung der Warenproduktion. Die griechische Philosophie nahm ihren Anfang nicht im griechischen Kernland, sondern in den Hafenkolonien in Kleinasien. Warenproduktion beinhaltet nicht nur den Austausch von Gütern, sondern auch den der Erfahrung, der sich aus ihrer Produktion ergibt. Sie beschleunigte die Geschichte; sie begünstigte die höheren Ausdrücke des dialektischen Denkens. Sie ermöglichte einen Grad der Individualisierung, ohne den ein Gedankenaustausch auf solch hohem Niveau schwierig gewesen wäre. Und sie begann der Isolation ein Ende zu bereiten, in der die soziale Evolution zuvor stattgefunden hatte. Die ökonomische Grundeinheit aller Bauerngesellschaften, die auf der Naturalwirtschaft beruhten, ist das Dorf oder allenfalls die regionale Autarkie. Doch die ersten ausbeutenden Gesellschaften, die auf einer größeren Kooperation, oft im Interesse der künstlichen Bewässerung, basierten, waren noch immer agrarwirtschaftlich in ihrem Kern. Im Gegensatz dazu öffnete der Handel und die Seefahrt der griechischen Gesellschaft die Welt. Sie reproduzierte, aber auf einem höheren Niveau, die Haltung der Eroberung und Entdeckung der Welt, die nomadische Gesellschaften auszeichnet. Die Geschichte zeigt, dass von einer bestimmten Stufe ihrer Entwicklung an das Auftauchen des Phänomens der öffentlichen Debatte untrennbar mit einer internationalen Entwicklung (selbst wenn sie sich auf ein Gebiet konzentrierte) verbunden war und in einem gewissen Sinne „inter-nationalistisch“ in ihrem Wesen war. Diogenes und die Zyniker waren gegen die Unterscheidung zwischen Hellenen und Barbaren und erklärten sich selbst zu Weltbürger. Democritus wurde vor Gericht gestellt, weil er angeblich eine Erbschaft verschwendet hatte, die er nutzte, um seine Bildungsreisen nach Ägypten, Babylonien, Persien und Indien zu finanzieren. Er verteidigte sich selbst und las aus Auszügen seiner Schriften, Früchte seiner Reisen, vor – und wurde freigesprochen.
Die Debatte entstand als Antwort auf eine praktische Notwendigkeit. In Griechenland entwickelte sie sich durch den Vergleich verschiedener Wissensquellen. Verschiedene Denkweisen, Untersuchungsmethoden und deren Ergebnisse, Produktionsmethoden, Sitten und Traditionen wurden miteinander verglichen. Sie waren dazu geschaffen, einander zu widersprechen, zu bestätigen oder zu ergänzen. Sie traten gegeneinander in den Kampf oder unterstützten einander oder beides. Absolute Wahrheiten relativierten sich durch den Vergleich.
Diese Debatten waren öffentlich. Sie fanden in den Häfen, auf den Marktplätzen (den Foren), in Schulen und Akademien statt. In schriftlicher Form füllten sie die Bibliotheken und verbreiteten sich überall in der bekannten Welt.
Socrates – jener Philosoph, der seine Zeit auf dem Marktplatz verbrachte – verkörperte die Essenz dieser Entwicklung. Seine Hauptbeschäftigung – zu einem wahrhaftigen Wissen über die Moral zu gelangen – ist bereits eine Attacke gegen Religion und Vorurteil, die behaupten, dass diese Fragen bereits beantwortet seien. Er erklärte, dass das Wissen die Hauptbedingung für die richtige Ethik und die Ignoranz ihr Hauptfeind sei. So ist es die Erlangung von Bewusstsein und nicht die Bestrafung, die den moralischen Fortschritt ermöglicht, da die meisten Menschen nicht lange gegen die Stimme ihres eigenen Gewissens ankämpfen könnten.
Doch Sokrates ging noch weiter und legte das theoretische Fundament aller Wissenschaft und aller kollektiven Klärung: die Erkenntnis, dass der Ausgangspunkt des Wissens das Beiseiteschieben von Vorurteilen ist. Dies machte den Weg frei für das Wesentliche: Suche (Untersuchung). Er war ein erbitterter Gegner vorgefasster Schlussfolgerungen, unkritischer selbstbefriedigender Auffassungen, der Arroganz und der Prahlerei. Woran er glaubte, war die „Bescheidenheit des Nicht-Wissens“ und die Leidenschaft, die aus einem wahrhaftigen Wissen herrühren, das auf tiefer Einsicht und Überzeugung beruht. Dies ist der Ausgangspunkt der Sokrates-Monologe. Wahrheit ist das Resultat einer kollektiven Suche, die aus dem Dialog aller Schüler besteht, wo jedermann Lehrer und Schüler zur gleichen Zeit ist. Der Philosoph ist nicht mehr ein Prophet, der Offenbarungen verkündet, sondern zusammen mit anderen ein Wahrheitssuchender. Dies bringt ein neues Führungskonzept mit sich: am entschlossensten auf eine Klärung drängen, ohne jemals das endgültige Ziel aus den Augen zu verlieren. Die Parallele zur Definition der Rolle der Kommunisten im Klassenkampf im Kommunistischen Manifest ist auffällig.
Sokrates verstand es meisterhaft, Diskussionen anzuregen und zu lenken. Er hob die öffentliche Debatte in die Sphären einer Kunst bzw. Wissenschaft. Sein Schüler, Plato, entwickelte den Dialog in einem Umfang weiter, wie er seither kaum mehr erreicht worden war.
In der Einleitung zur Dialektik der Natur spricht Engels von drei großen geschichtlichen Perioden der Naturwissenschaft bis dato, den „genialen naturwissenschaftlichen Intuitionen“ der antiken Griechen und den „höchst bedeutenden, aber sporadischen Entdeckungen“ der Araber als Vorläufer der modernen Wissenschaft, die mit der Renaissance begann. Was an der „arabisch-muslimischen Kulturepoche“ auffällt, war die bemerkenswerte Fähigkeit, eine Synthese der Errungenschaften der verschiedenen antiken Kulturen zu machen und sie zu absorbieren, sowie ihre Offenheit gegenüber der Diskussion. August Bebel zitierte einen Augenzeugen der Kultur des öffentlichen Streits in Bagdad. „Stellt Euch vor, bei der ersten Versammlung waren nicht bloß Mohammedaner von allen Sekten anwesend, Orthodoxe und Heterodoxe, sondern auch Feueranbeter (Parsen), Materialisten, Atheisten, Juden und Christen, kurzum Ungläubige jeder Art. Jede dieser Sekten hatte ihren Sprecher, der ihre Ansichten verteidigen musste. Trat einer dieser Parteihäuptlinge in den Saal, so erhoben sich alle ehrerbietig und niemand setzte sich, ehe er Platz genommen hatte. Als der Saal nahezu angefüllt war, nahm einer der Ungläubigen das Wort und sprach: ‚Wir haben uns versammelt, um zu disputieren; Ihr kennt die Vorbedingungen; Ihr Mohammedaner dürft uns nicht mit Beweisgründen bekämpfen, die aus Eurer Schrift geschöpft sind, oder auf die Reden Eures Propheten sich stützen; denn wir glauben weder an dieses Buch noch an Euren Propheten. Jeder der Anwesenden darf sich nur auf Gründe berufen, die aus der menschlichen Vernunft entnommen sind’. Diese Worte wurden allgemein bejubelt.“ (Bebel: Die Mohammedanisch-Arabische Kulturperiode, Stuttgart 1889, S. 143f)
Bebel erklärt: „Der Unterschied zwischen Mohammedanismus und Christentum war der: Die Araber sammelten bei ihren Eroberungen sorgfältig alle Werke, die ihnen zum Studium und zur Belehrung über die besiegten Völker und Länder dienen und Nutzen stiften konnten; die Christen zerstörten bei der Ausbreitung ihrer Lehre alle dergleichen Kulturdenkmäler als Werke des Satans und heidnische Gräuel, die ein guter Christ so rasch als möglich vernichten müsse.“ (ebendort, S. 137) „Die mohammedanisch-arabische Kulturperiode ist das Verbindungsglied zwischen der untergegangenen griechisch-römischen und der alten Kultur überhaupt und der seit dem Renaissancezeitalter aufgeblühten europäischen Kultur. Die letztere hätte ohne dieses Bindeglied schwerlich so bald ihre heutige Höhe erreicht. Das Christentum stand dieser ganzen Kultur-Entwicklung feindlich gegenüber.“ (ebendort, S. 169)
Einer der Gründe für den blinden Fanatismus und das Sektierertum des Christentums wurde bereits von Heinrich Heine ausgemacht und später von der Arbeiterbewegung bestätigt: Je mehr Opfer und Verzicht eine Kultur erfordert, desto unerträglicher wird allein der Gedanke, dass ihre Prinzipien in Frage gestellt werden.
Was die Renaissance und Reformation anbetrifft, die er „die größte progressive Umwälzung, die die Menschheit bis dahin erlebt hatte“ nannte, betonte Engels nicht nur die Rolle der Entwicklung des Denkens, sondern auch die der Gefühle, der Personalität, des menschlichen Potenzials und der Kampfbereitschaft. Es war „eine Zeit, die Riesen brauchte und Riesen zeugte, Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charakter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit. [...] Die Heroen jener Zeit waren eben noch nicht unter die Teilung der Arbeit geknechtet, deren beschränkende, einseitig machende Wirkungen wir so oft bei ihren Nachfolgern spüren. Was ihnen aber besonders eigen, das ist, dass sie fast alle mitten in der Zeitbewegung, im praktischen Kampf leben und weben, Partei ergreifen, mitkämpfen, der mit Wort und Schrift, der mit dem Degen, manche mit beiden.“ (Engels: Dialektik der Natur, MEW 20, S. 312)
Die Debatte und die Arbeiterbewegung
Die drei „heroischen“ Zeitalter des menschlichen Geistes Revue passieren lassend, die laut Engels die Entwicklung der modernen Wissenschaft vorbereiteten, ist es bemerkenswert, wie begrenzt sie zeitlich und räumlich waren. Angefangen damit, dass sie erst sehr spät in der Geschichte der gesamten Menschheit auftauchten. Selbst wenn wir die indischen und chinesischen Kapitel miteinbeziehen, waren diese Phasen geographisch beschränkt. Sie dauerten auch nicht lange (die Renaissance in Italien oder die Reformation in Deutschland nur ein paar Jahrzehnte). Und der Teil der oh-nehin äußerst minoritären ausbeutenden Klassen, der aktiv involviert war, war winzig.
In diesem Zusammenhang scheinen zwei Dinge doch überraschend zu sein. Erstens, dass diese Momente des Aufschwungs der Wissenschaft und der öffentlichen Debatte überhaupt stattfanden und dass ihre Auswirkung so wichtig und nachhaltig war – trotz aller Brüche und Sackgassen. Zweitens das Ausmaß, in welchem das Proletariat – trotz des Bruchs in der organischen Kontinuität seiner Bewegung Mitte des 20. Jahrhunderts, trotz der Unmöglichkeit permanenter Massenorganisationen in der kapitalistischen Dekadenz – in der Lage war, den Rahmen einer organisierten Debatte zu erhalten und gelegentlich beträchtlich zu vergrößern. Die Arbeiterbewegung hat diese Tradition, trotz Unterbrechungen, zwei Jahrhunderte lang am Leben gehalten. Und es hat Momente gegeben – wie während der revolutionären Bewegungen in Frankreich, Deutschland oder Russland –, in denen dieser Prozess Millionen von Menschen umfasste. Hier wurde Quantität zu einer neuen Qualität.
Diese Qualität ist jedoch nicht nur das Produkt der Tatsache, dass das Proletariat zumindest in den industrialisierten Ländern die Mehrheit der Bevölkerung stellt. Wir haben bereits gesehen, wie die moderne Wissenschaft und Theorie nach ihrem ruhmreichen Beginn in der Renaissance von der bürgerlichen Arbeitsteilung in ihrer Weiterentwicklung beeinträchtig und behindert wurden. Kern dieses Problems ist die Trennung der Wissenschaft von den Produzenten, und das in einem Ausmaß, wie es in der arabischen Epoche der Renaissance noch nicht möglich gewesen wäre. Dieser Bruch „vollendet sich in der großen Industrie, welche die Wissenschaft als selbständige Produktionspotenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals presst.“ (Marx: Kapital, Bd. 1, S. 382)
Die Schlussfolgerung aus diesem Prozess beschrieb Marx im ersten Entwurf seiner Antwort an Vera Sassulitsch: „Diese Gesellschaft führt Krieg gegen Wissenschaft, Volksmassen und gegen die Produktivkräfte, die sie hervorbringt.“ (eigene Übersetzung)
Der Kapitalismus ist das erste Wirtschaftssystem, das ohne die systematische Anwendung der Wissenschaft in der Produktion nicht existieren kann. Es muss die Bildung des Proletariats begrenzen, um seine Klassenherrschaft aufrechtzuerhalten. Es muss die Bildung des Proletariats vorwärtsdrängen, um seine wirtschaftliche Stellung zu behaupten. Heute wird die Bourgeoisie immer mehr zu einer unkultivierten und primitiven Klasse, während Wissenschaft und Kultur sich entweder in den Händen von Proletariern oder in denen bezahlter Repräsentanten der Bourgeoisie befinden, deren ökonomische und soziale Lage zunehmend jener der Arbeiterklasse ähnelt.
Die Abschaffung der Klassen „hat also zur Voraussetzung einen Höhegrad der Entwicklung der Produktion, auf dem Aneignung der Produktionsmittel und Produkte, und damit der politischen Herrschaft, des Monopols der Bildung und der geistigen Leitung durch eine besondre Gesellschaftsklasse nicht nur überflüssig, sondern auch ökonomisch, politisch und intellektuell ein Hindernis der Entwicklung geworden ist. Dieser Punkt ist jetzt erreicht.“ (Engels: Anti-Dühring, MEW 20, S. 263)
Das Proletariat ist der Erbe der wissenschaftlichen Traditionen der Menschheit. Mehr als in der Vergangenheit wird künftig jeder proletarische Kampf notwendigerweise zu einem nie gekannten Aufblühen der öffentlichen Debatte und zum Startschuss im Streben nach Wiederherstellung der Einheit von Wissenschaft und Arbeit, der Erlangung eines globalen Verständnisses, das den Anforderungen des heutigen Zeitalters eher genügt.
Die Fähigkeit des Proletariats, neue Höhen zu erklimmen, wurde bereits mit der Entwicklung des Marxismus bewiesen, der ersten wissen-schaftlichen Annäherung in Fragen der menschlichen Gesellschaft und ihrer Geschichte. Allein das Proletariat war im Stande, die größte Errungenschaft des bürgerlichen philosophischen Denkens zu assimilieren – die Philosophie von Hegel. Die beiden Formen der Dialektik, die der Antike bekannt waren, waren die Dialektik des Wandels (Heraclitus) und die Dialektik der Interaktion (Plato, Aristoteles). Hegel kombinierte lediglich diese beiden Formen und schuf so die Grundlage für eine wirklich historische Dialektik.
Hegel fügte dem ganzen Konzept der Debatte eine neue Dimension hinzu, indem er, viel weitgehender als jeder andere vor ihm, die rigide metaphysische Gegenüberstellung von Falsch und Richtig attackierte. In der Einleitung zu seiner Phänomenologie des Geistes zeigte er auf, wie die unterschiedlichen und widersprüchlichen Phasen eines Entwicklungsprozesses – wie die Geschichte der Philosophie – eine organische Einheit bilden, gleich der Blüte und der Frucht. Hegel erklärte, dass das Unvermögen, dies anzuerkennen, mit der Tendenz verknüpft war, sich auf den Gegensatz zu konzentrieren und die Entwicklung aus den Augen zu verlieren. Indem er diese Dialektik auf ihre Füße stellte, war der Marxismus in der Lage, die fortschrittlichste Seite von Hegel aufzunehmen, nämlich das Verständnis eines zukunftsorientierten Prozesses.
Das Proletariat ist die erste Klasse, die gleichzeitig revolutionär und ausgebeutet ist. Im Gegensatz zu früheren revolutionären Klassen, die ausbeuterisch waren, beschränkt sich seine Suche nicht auf irgendwelche Interessen des Selbst-Schutzes als Klasse. Im Gegensatz zu früheren ausgebeuteten Klassen, die nur überleben konnten, indem sie sich mit (insbesondere religiösen) Illusionen trösteten, erfordert sein Klasseninteresse den Verlust der Illusionen. Das Proletariat als solches ist die erste Klasse, deren natürliche Neigung, sobald sie nachdenkt, sich organisiert und auf dem eigenen Terrain kämpft, in Richtung Klärung geht.
Dieses einmalige Wesen wurde vom Bordigismus übersehen, als er sein Konzept der Invarianz (Unveränderlichkeit) erfand. Sein Ausgangspunkt ist korrekt: das Bedürfnis, den Grundprinzipien des Marxismus angesichts der bürgerlichen Ideologie treu zu bleiben. Doch die Schlussfolgerung, dass es notwendig sei, die Diskussion einzuschränken oder gar abzuschaffen, um Klassenpositionen aufrechtzuhalten, ist ein Produkt der Konterrevolution. Die Bourgeoisie hat viel besser begriffen, dass es, um die Arbeiterklasse auf das Terrain des Kapitals zu ziehen, vor allem notwendig ist, ihre Debatten zu unterdrücken und zu ersticken. Anfangs hat sie dies vor allem mit grausamer Repression versucht; später hat sie noch wirksamere Waffen, wie die Demokratie und die Sabotagearbeit der bürgerlichen Linken, entwickelt. Auch der Opportunismus hat dies schon lange begriffen. Da sein wesentlicher Charakterzug seine Inkohärenz ist, muss er sich verstecken, vor der offenen Debatte fliehen. Der Kampf gegen den Opportunismus und die Notwendigkeit einer Diskussionskultur sind nicht nur nicht widersprüchlich; das eine ist auch undenkbar ohne das andere.
Solch eine Kultur schließt überhaupt nicht harte Zusammenstöße von politischen Positionen aus – im Gegenteil. Doch dies bedeutet nicht, dass die politische Diskussion notwendigerweise traumatisierend ist und zu Spaltungen führt. Das erbaulichste Beispiel für die „Kunst“ oder „Wissenschaft“ der Debatte in der Geschichte ist jenes der bolschewistischen Partei zwischen Februar und Oktober 1917. Selbst unter dem Druck massiver Eingriffe durch fremde Ideologien waren diese Diskussionen leidenschaftlich, aber äußerst brüderlich und anregend für alle Beteiligten. Vor allem er-möglichten sie, was Trotzki die „Wiederbewaffnung“ der Partei nannte, die Re-Justierung ihrer Politik auf die veränderten Erfordernisse des revolutionären Prozesses, eine der Vorbedingungen für den Sieg.
Der „bolschewistische Dialog“ erfordert das Verständnis, dass nicht alle Debatten dieselbe Bedeutung haben. Die Polemik von Marx gegen Proudhon war vernichtend, weil es ihre Aufgabe war, in den Mülleimer der Geschichte zu schmeißen, was zu einer Fessel der gesamten Arbeiterbewegung geworden ist. Im Gegensatz dazu verlor der junge Marx, auch wenn er sich in titanischen Auseinandersetzungen mit Hegel und gegen den utopischen Sozialismus engagierte, nie seinen enormen Respekt vor Hegel, Fourier, Saint-Simon oder Owen, denen er half, für immer in unser gemeinsames Erbe einzugehen. Und Engels sollte später schreiben, dass es ohne Hegel kein Marxismus gegeben hätte und ohne die Utopisten keinen wissenschaftlichen Sozialismus, wie wir ihn kennen.
Die schwersten Krisen in den Arbeiterorganisationen, einschließlich der IKS, wurden zum größten Teil nicht durch die Existenz von Divergenzen schlechthin, wie fundamental auch immer, verursacht, sondern durch die Umgehung, ja offene Sabotage des Klärungsprozesses. Der Opportunismus nutzt jedes mögliche Mittel für diesen Zweck. Diese beinhalten nicht nur das Runterspielen wichtiger Divergenzen, sondern gleichermaßen die Übertreibung zweitrangiger Divergenzen oder die Erfindung von nicht-existenten Divergenzen. Sie beinhalten auch die Personalisierung und sogar die Verunglimpfung.
Das auf dem Rücken der Arbeiterbewegung lastende tote Gewicht des üblichen „gesunden Menschenverstandes“ einerseits, das unkritische, fast religiöse Festhalten an Gebräuche und Traditionen andererseits wurde von Lenin zu dem verbunden, was er den Zirkelgeist nannte. Er hatte völlig recht hinsichtlich der Unterwerfung des Prozesses des Organisationsaufbaus und ihres politischen Lebens unter der „Spontaneität“ des gesunden Menschenverstandes und der Konsequenzen. „Warum aber, wird der Leser fragen, führt die spontane Bewegung, die Bewegung in der Richtung des geringsten Widerstands gerade zur Herrschaft der bürgerlichen Ideologie? Aus dem einfachen Grunde, weil die bürgerliche Ideologie ihrer Herkunft nach viel älter ist als die sozialistische, weil sie vielseitiger entwickelt ist, weil sie über unvergleichlich mehr Mittel der Verbreitung verfügt.“ (Lenin: Was tun, LW, Bd. 5, S. 397)
Kennzeichnend für die Zirkelmentalität ist die Personalisierung der Diskussion, die Reaktion auf politische Argumente, indem darauf geschaut wird, wer was sagt, und nicht, was gesagt wird. Überflüssig zu sagen, dass diese Personalisierung ein enormes Hindernis auf dem Weg zu einer fruchtbaren, kollektiven Diskussion ist.
Bereits der Sokrates-Dialog verstand, dass die Entwicklung der Debatte nicht nur eine Frage des Denkvermögens ist; sie ist darüber hinaus eine ethische Frage. Heute dient das Streben nach Klärung den Interessen des Proletariats, während die Sabotage der Klärung sie bedroht. In diesem Sinn konnte die Arbeiterklasse das Motto des deutschen Aufklärers Lessing übernehmen, der sagte, dass es eine Sache gab, die er noch mehr als die Wahrheit liebte – die Suche nach der Wahrheit.
Der Kampf gegen Sektierertum und Ungeduld
Die eindruckvollsten Beispiele einer Debattenkultur als ein wichtiges Mittel der proletarischen Massenbewegungen verschaffte uns die Russische Revolution.[xi] Die Klassenpartei war, weit entfernt davon, sich ihr zu widersetzen, die Avantgarde dieser Dynamik. Die Diskussionen innerhalb der Partei in Russland 1917 betrafen Fragen wie die des Klassencharakters der Revolution, gingen darum, ob man die Fortsetzung des imperialistischen Krieges unterstützen sollte oder nicht, wann und wie man die Macht ergreifen sollte. Noch war durchgehend die Einheit der Partei gewahrt, trotz politischer Krisen, in denen das Schicksal der Weltrevolution und damit jenes der Menschheit auf dem Spiel stand.
Und doch lehrt uns die Geschichte des proletarischen Klassenkampfes und insbesondere die Geschichte der organisierten Arbeiterbewegung, dass solch eine Ebene der Debattenkultur nicht immer erreicht wurde. Wir haben bereits das wiederholte Eindringen von monolithischen Herangehensweisen in die IKS erwähnt. Es ist nicht überraschend, dass diese Störungen häufig zu Abspaltungen von der Organisation führten. Im Rahmen des Monolithismus kann es bei Divergenzen keine andere Lösung geben als die Trennung. Jedoch wird das Problem nicht durch die Abspaltung jener Elemente gelöst, die diese Vorgehensweise in karikaturhafter Weise verkörpern. Die Tatsache, dass solche nicht-proletarischen Vorgehensweisen immer wiederkehren, weist auf die Existenz weitaus größerer Schwächen in dieser Frage innerhalb der Organisation hin. Diese bestehen in häufig kleinen, kaum wahrnehmbaren Verwirrungen und Fehlauffassungen im täglichen Leben und in Diskussionen, die jedoch unter bestimmten Umständen den Weg für ernstere Schwierigkeiten ebnen können. Eine von ihnen ist die Tendenz, jede Debatte in den Rahmen einer Auseinandersetzung zwischen Marxismus und Opportunismus, des direkten Kampfes gegen die bürgerliche Ideologie zu stellen. Eine der Konsequenzen daraus ist, die Debatte zu hemmen, indem den Genossen das Gefühl vermittelt wird, dass sie nicht mehr das Recht haben, falsch zu liegen oder Konfusionen zum Ausdruck zu bringen. Eine andere Konsequenz ist die „Banalisierung“ des Opportunismus. Wenn wir ihn überall wittern (und bei der leisesten Meinungsverschiedenheit „Feuer“ rufen), werden wir ihn wahrscheinlich nicht erkennen, wenn er wirklich auftritt. Ein anderes Problem ist die Ungeduld in den Debatten, die in der Unfähigkeit mündet, den anderen Argumenten zuzuhören, und in der Neigung, die „Gegner“ zu zermalmen, die anderen „mit allen Mitteln“ zu überzeugen.1[xii]
Was all diese Vorgehensweisen gemeinsam haben, ist das Gewicht der kleinbürgerlichen Ungeduld, der Mangel an Vertrauen in der lebendigen Praxis der kollektiven Klärung im Proletariat. Sie drücken Schwierigkeiten aus, zu akzeptieren, dass Diskussion und Klärung ein Prozess ist. Wie alle fundamentalen Prozesse im gesellschaftlichen Leben hat er einen inneren Rhythmus und ein eigenes Bewegungsgesetz. Seine Entfaltung entspricht der Bewegung weg von der Konfusion hin zu mehr Klarheit und enthält Fehler und falsche Wendungen sowie deren Korrektur. Solche Prozesse erfordern Zeit, wenn sie wirklich gründlich sein sollen. Sie können beschleunigt, aber nicht verkürzt werden. Je breiter die Teilnahme in diesem Prozess ist, je mehr die Beteiligung seitens der gesamten Klasse ermutigt und begrüßt wird, desto reichhaltiger wird sie werden.
In ihrer Polemik gegen Bernstein[xiii] wies Rosa Luxemburg auf den fundamentalen Widerspruch des Arbeiterkampfes hin, der einerseits eine Bewegung innerhalb des Kapitalismus ist, andererseits aber ein Ziel anstrebt, das außerhalb des Letzteren ist. Aus diesem widersprüchlichen Charakter ergeben sich zwei große Gefahren für diese Bewegung. Die erste ist der Opportunismus, d.h. die Offenheit gegenüber dem fatalen Einfluss des Klassenfeindes. Das Motto dieser Verirrung vom Weg des Klassenkampfes heißt: „Die Bewegung ist alles, das Endziel nichts.“ Die zweite Gefahr ist das Sektierertum, d.h. der Mangel an Offenheit gegenüber dem Einfluss des Lebens der eigenen Klasse, das Proletariat. Das Motto dieser Verirrung ist: „Das Ziel ist alles, aber die Bewegung ist nichts.“
Im Kielwasser der fürchterlichen Konterrevolution, die der Niederlage der Weltrevolution am Ende des I. Weltkrieges folgte, wurde innerhalb dessen, was vom revolutionären Lager übrig geblieben war, die fatale Fehlkonzeption entwickelt, dass es möglich sei, den Opportunismus mit den Mitteln des Sektierertums zu bekämpfen. Diese Vorgehensweise, die lediglich zur Sterilität und Fossilierung führt, übersieht, dass Opportunismus und Sektierertum zwei Seiten derselben Münze sind, da beide Ziel und Bewegung voneinander trennen. Ohne die vollständige Teilnahme revolutionärer Minderheiten am realen Leben und an der Bewegung ihrer Klasse kann das Ziel des Kommunismus nicht erreicht werden[i] Selbst solch reife und theoretisch klare junge Revolutionäre wie Marx und Engels glaubten – zurzeit der Erschütterungen von 1848 –, dass die Verwirklichung des Kommunismus mehr oder minder auf der unmittelbaren Tagesordnung stünde.
[ii] Siehe unsere Thesen über die Studentenbewegung in Frankreich.
[iii] Im proletarischen Lager wurde dieser Begriff vom „Bordigismus“ theoretisiert.
[iv] Die Biographien und Erinnerungen vergangener Revolutionäre sind voller Beispiele für ihre Fähigkeit, zu diskutieren und besonders zuzuhören. Lenin war in diesem Zusammenhang geradezu legendär, aber er war nicht der einzige. Nur ein Beispiel sind die Memoiren von Fritz Sternberg über seine „Konversationen mit Trotzki“ (1963 verfasst): „In seinen Konversationen mit mir war Trotzki ausgesprochen höflich. Er unterbrach mich praktisch nie, und wenn, dann um mich nach der Erläuterung eines Wortes oder Gedankens zu bitten.“
[v] Dazu die Artikel „Ausserordentliche Konferenz der IKS:
Der Kampf für die Verteidigung der organisatorischen Prinzipien“, in der Internationalen Revue
Nr. 30 und „Der 15. Kongress der IKS: „Die Verstärkung der
Organisation angesichts der Herausforderungen der heutigen Zeit“, in Internationale Revue
Nr. 114 (engl., franz., span.).
[vi] Siehe dazu „Vertrauen und Solidarität im Kampf der Arbeiterklasse“ in Internationale Revue Nr. 31 und 32 und „Marxismus und Ethik“ in Internationale Revue Nr. 39 und 40.
[vii] Man schlage nach in unseren Büchern über die Italienische und Holländische Kommunistische Linke.
[viii] Die GCF sollte später, nach der Auflösung der Italienischen Fraktion, dieses Verständnis aufrechterhalten. Siehe zum Beispiel ihre Kritik an dem Konzept des „brillanten Führers“ die in der Internationalen Revue Nr. 33 (engl., franz., span.) wieder veröffentlicht wurde, und an der Idee, dass Disziplin bedeutet, dass Mitglieder der Organisation blosse Befehlsempfänger sind, die nicht die politischen Orientierungen der Organisation zu diskutieren haben, wieder veröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 34 (engl., franz., span.)
[ix] Engels, Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates
[x] Über die Entwicklung in Asien um 500 v.Chr. siehe die Vorlesungen von August Thalheimer, die er an der Sun-Yat-Sen-Universität von Moskau 1927 abgehalten hatte: Einführungen in den Dialektischen Materialismus: www.marxists.org/archive/thalheimer/works/diamant/index.htm [328].
[xi] Siehe zum Beispiel Trotzki, Geschichte der Russischen Revolution, oder John Reed, Zehn Tage, die die Welt erschütterten diese Fragen weiter.
[xii] Der Bericht über die Arbeit des 17. Kongresses der IKS in der Internationalen Revue Nr. 40 entwickelt diese Fragen weiter.
[xiii] Rosa Luxemburg, Sozial-Reform oder Revolution?
Theoretische Fragen:
- Kultur [107]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Der Kommunismus ist keine schöne Idee, sondern eine materielle Notwendigkeit
- 6577 Aufrufe
Wir haben zuvor eine Zusammenfassung des ersten Bandes unserer Artikelreihe zum Kommunismus veröffentlicht, in der wir die Entwicklung des kommunistischen Programms in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus anhand der Werke von Marx und Engels thematisierten. Der zweite Band dieser Reihe befasst sich eingehender mit den weiteren Präzisierungen dieses Programms, die sich aus den praktischen Erfahrungen und theoretischen Überlegungen der Arbeiterbewegung während der revolutionären Welle von Kämpfen ergaben, die die kapitalistische Welt nach 1917 erschüttert hatten. Wir teilen die Zusammenfassung dieses Bandes in zwei Teile auf: Der hier folgende Teil untersucht die heroische Phase der revolutionären Welle, als die Aussicht auf die Weltrevolution noch real und das kommunistische Programm sehr konkret war; der zweite Teil wird sich mit dem Zurückfluten der revolutionären Welle und mit den Bemühungen der revolutionären Minderheiten befassen, das unaufhaltsame Vorwärtsdrängen der Konterrevolution zu begreifen.
1. 1905: Der Massenstreik öffnete die Tür zur proletarischen Revolution (International Review Nr. 90)
Wir wollen im zweiten Band der Kommunismus-Reihe aufzeigen, wie das kommunistische Programm durch die direkte Erfahrung der proletarischen Revolution weiterentwickelt wurde. Hintergrund ist die neue Epoche von Kriegen und Revolutionen, die endgültig durch den ersten imperialistischen Weltkrieg und insbesondere durch das Aufkommen und anschließende Abflauen der ersten Welle großer revolutionärer Kämpfe der internationalen Arbeiterklasse zwischen 1917 und Ende der 1920er Jahre eingeleitet worden war. Deshalb haben wir den übergeordneten Titel dieses Bandes etwas geändert: Der Kommunismus hieß nicht mehr nur vorherzusagen, was notwendig wird, sobald der Kapitalismus keine fortschrittliche Rolle mehr spielt. Der Kommunismus stand nunmehr aufgrund der neuen Bedingungen – der Niedergang des Kapitalismus – auf der Tagesordnung. Dies bedeutete, dass der Kapitalismus nicht mehr nur zu einem Hindernis für jeglichen weiteren Fortschritt, sondern auch zu einer Bedrohung für das eigentliche Überleben der Menschheit geworden war.
Dieser Band beginnt jedoch mit den Ereignissen von 1905, mit einer Zeit des Übergangs, als die neuen Bedingungen erst in groben Zügen erkennbar waren und sich noch nicht endgültig durchgesetzt hatten – einer Zeit voller Unklarheiten. Häufig spiegelte sich dies in unklaren Perspektiven wider, die die Revolutionäre selbst entwickelt hatten. Doch der plötzliche Ausbruch von Massenstreiks und Aufständen in Russland 1905 gab der Diskussion, die bereits in der marxistischen Bewegung angestoßen worden war, eine andere Wendung. Dieses Ereignis griff Fragen auf, die für die angesprochenen Themen dieser Serie besonders wichtig sind: Auf welche Weise wird die Arbeiterklasse in der Stunde der Revolution die Macht übernehmen? Das war der eigentliche Hintergrund der Debatte über den Massenstreik, die insbesondere in der deutschen Sozialdemokratie aufgekommen war.
Diese Auseinandersetzung fand im Wesentlichen auf drei Ebenen statt: Auf der einen Seite führte die revolutionäre Linke um Luxemburg und Pannekoek diese Auseinandersetzung zunächst gegen die offen revisionistischen Thesen von Bernstein und anderen, die ausdrücklich jeglichen Bezug zur revolutionären Überwindung des Kapitalismus fallenlassen wollten, sowie gegen die Gewerkschaftsbürokratie, die sich keinen Arbeiterkampf vorstellen konnte, der nicht von ihr selbst strikt kontrolliert wurde. Dieser Teil wollte jeglichen Generalstreik hinsichtlich seiner Forderungen und Dauer stark einschränken. Und auch hier meinte das „orthodoxe“ Zentrum der Partei, welches die Idee eines Massenstreiks zwar formal unterstützte, dass der Massenstreik nur eine begrenzt gültige Taktik sei, die sich einer im Wesentlichen parlamentarischen Strategie unterzuordnen habe. Im Gegensatz dazu betrachtete die Linke den Massenstreik als ein Zeichen dafür, dass der Kapitalismus den Endpunkt seines aufsteigenden Astes erreicht habe; der Massenstreik sei ein Vorläufer der Revolution. Luxemburgs und Pannekoeks Analyse, die von allen konservativen Kräften in der Partei als „anarchistisch“ abgelehnt wurde, war in Wirklichkeit keine Neuauflage der alten anarchistischen Abstraktion des Generalstreiks in neuem Gewand, sondern ein Versuch, die tatsächlichen Charakteristiken der Massenbewegung in der neuen Zeit zu begreifen:
– ihre Tendenz, spontan von „unten“ auszubrechen, oft von Partikularforderungen oder Forderungen begleitet, die nur vorübergehender Natur waren. Doch diese Spontaneität stand keinesfalls im Gegensatz zur Organisation; im Gegenteil, in der neuen Periode wurde die Organisierung des Kampfes durch den Kampf selbst hervorgebracht und konnte infolgedessen auf ein höheres Niveau gelangen;
– die Tendenz zur schnellen, geographischen Ausdehnung auf immer größere Teile der Arbeiterklasse, die dabei auf dem Streben nach Solidarität fußte;
– die Wechselbeziehung zwischen der ökonomischen und politischen Dimension des Kampfes, bis hin zur Stufe des bewaffneten Aufstandes;
– die Bedeutung der Partei in diesem Prozess, die nicht abnahm, sondern im Gegenteil noch größer wurde. Ihre Aufgabe bestand nicht länger darin, den Kampf technisch vorzubereiten, sondern in der politischen Führung des Kampfes.
Während Luxemburg diese drei allgemeinen Charakteristiken des Massenstreiks erkannte, trugen die Revolutionäre in Russland wesentlich zum Verständnis der neuen Kampforganisation, der Sowjets, bei. Trotzki und Lenin begriffen sehr schnell die Bedeutung der Sowjets als ein Instrument zur Organisierung des Massenstreiks, als eine flexible Form, die es den Massen ermöglichte, zu debattieren, zu entscheiden und ihr Klassenbewusstsein zu entwickeln, und als das Organ des proletarischen Aufstandes und der politischen Macht. Entgegen jenen „Super-Leninisten“ in der bolschewistischen Partei, deren erste Reaktion gegenüber den Sowjets darin bestand, diese dazu aufzurufen, in der Partei aufzugehen, betonte Lenin, dass die Partei als Organisation der revolutionären Avantgarde und die Sowjets als Einheitsorganisation der gesamten Klasse keine Rivalen waren, sondern sich perfekt ergänzten. Somit verdeutlichte er, dass die bolschewistische Parteiauffassung faktisch einen Bruch mit den alten sozialdemokratischen Auffassungen über die Massenpartei darstellte, dass sie ein organisches Produkt aus der neuen Epoche revolutionärer Kämpfe war. Die Ereignisse von 1905 lösten auch heftige Debatten über die Perspektiven der Revolution in Russland aus. Die Debatte drehte sich dabei um drei Punkte:
– Die Menschewiki warfen ein, dass Russland dazu verurteilt sei, die Phase der bürgerlichen Revolution zu durchlaufen, und dass aus diesem Grund die Hauptaufgabe der Arbeiterbewegung in der Unterstützung der liberalen Bourgeoisie in deren Kampf gegen die zaristische Autokratie liege. Der revolutionsfeindliche Inhalt dieser Theorie kam 1917 deutlich zum Vorschein.
– Lenin und die Bolschewiki begriffen, dass die liberale Bourgeoisie in Russland zu schwach war, um den Kampf gegen den Zarismus anzuführen. Die Aufgaben der bürgerlichen Revolution sollten durch eine „demokratische Revolution“ durchgeführt werden, die durch einen Volksaufstand ausgelöst werde, in der die Arbeiterklasse die führende Rolle spiele.
– Trotzki, der sich auf die 1848er Auffassung von Marx über die „permanente Revolution“ stützte, ging vornehmlich von einem internationalen Standpunkt aus. Er meinte, dass die Revolution in Russland notwendigerweise die Arbeiterklasse dazu antreiben werde, die Macht zu ergreifen, und dass die Bewegung schnell in eine sozialistische Phase übergehen könne, indem sie sich mit der Revolution in Westeuropa verbünde. Diese Herangehensweise stellte eine Verbindung zwischen den Schriften Marx’ über Russland und der konkreten Erfahrung aus der Revolution von 1917 dar und wurde größtenteils auch von Lenin 1917 übernommen, als er die Auffassung über die „demokratische Diktatur“ über Bord warf, die ihn in einen Gegensatz zur „orthodoxen“ Auffassung der Bolschewiki brachte.
In der Zwischenzeit verlieh die Niederlage von 1905 den Argumenten Kautskys und Anderer in der deutschen Sozialdemokratie Auftrieb, die behaupteten, dass der Massenstreik nur als eine defensive Taktik aufgefasst werden solle und dass die beste Strategie für die Arbeiterklasse in der allmählichen, im Wesentlichen legalistischen „Ermattungsstrategie“ bestehe, wobei Parlament und Wahlen als Hauptinstrumente für die Machtübernahme durch das Proletariat betrachtet wurden. Die Antwort der Linken fasste Pannekoek zusammen, der erwiderte, dass das Proletariat neue Kampforgane entwickelt habe, die der neuen Epoche im Leben des Kapitals entsprachen. Er wandte sich gegen den Begriff „Ermattungsstrategie“ und hob hervor, dass gemäß dem Marxismus die Revolution nicht darauf abziele, den Staat zu erobern, sondern darauf, ihn zu zerstören und ihn durch neue politische Machtorgane zu ersetzen.
2. Lenins Staat und Revolution: eine bemerkenswerte Bestätigung des Marxismus (International Review Nr. 91)
Aus der Sicht der Philosophen des bürgerlichen Empirismus ist der Marxismus nie mehr als eine Pseudowissenschaft gewesen, da er keine Möglichkeit für die Verifizierung bzw. Widerlegung seiner Hypothesen biete. Tatsächlich kann der Anspruch des Marxismus, wissenschaftliche Methoden zu benutzen, nicht unter Laborbedingungen bestätigt bzw. widerlegt werden. Dies kann nur im – wenn man so will –historischen Labor der Gesellschaft überprüft werden. Dabei erwiesen sich die katastrophalen Ereignisse des Jahres 1914 als überzeugender Beweis für die Richtigkeit der grundsätzlichen Perspektive, die sowohl im Kommunistischen Manifest von 1848 – in dem von der allgemeinen Alternative zwischen dem Sozialismus und der Barbarei die Rede ist – als auch in Engels’ erstaunlich genauer Vorhersage eines zerstörerischen Krieges in Europa, die er 1887 machte, aufgezeigt wurde. Das revolutionäre Beben von 1917-1919 bestätigte die andere Seite der Prognose – die Fähigkeit der Arbeiterklasse, gegenüber der Barbarei des niedergehenden Kapitalismus eine Alternative bieten zu können.
Diese Bewegungen warfen das Problem der Diktatur des Proletariats auf eine sehr praktische Art auf. Aus der Sicht der Arbeiterbewegung kann es jedoch keine strikte Trennung zwischen Theorie und Praxis geben. Lenins Werk Staat und Revolution, das er während des entscheidenden Zeitraums zwischen Februar und Oktober 1917 in Russland verfasst hatte, entsprach dem Bedürfnis des Proletariats, ein klares theoretisches Verständnis seiner praktischen Bewegung zu entwickeln. Dies war besonders deshalb wichtig, weil der Opportunismus in den Parteien der II. Internationale noch sehr stark verbreitet war und das Konzept der proletarischen Diktatur vernebelt hatte, das immer mehr durch die Theoretisierung eines schrittweisen, parlamentarischen Weges zur Arbeitermacht ersetzt worden war. Gegen diese reformistischen Verzerrungen – aber auch gegen die von den Anarchisten verbreiteten falschen Antworten – schickte sich Lenin an, die grundlegenden Lehren des Marxismus in der Frage des Staates und der Übergangsperiode zum Kommunismus wiederherzustellen.
Lenins erste Aufgabe bestand deshalb darin, die Auffassung vom Staat als einem neutralen Instrument entgegenzutreten, das je nach Charakter seiner Führung entweder positiv oder negativ eingesetzt werden könne. Es war ungeheuer wichtig, die marxistische Sicht zu bestätigen, derzufolge der Staat nur das Instrument für die Unterdrückung einer Klasse durch eine andere sein kann. Diese Tatsache wurde durch die weit verbreiteten Argumente Kautskys und anderer Verfechter dieser Strömung, aber auch konkret von den Menschewiki und deren Verbündeten in Russland vertreten, die von „revolutionärer Demokratie“ schwadronierten und diese als ein Feigenblatt für die kapitalistische Provisorische Regierung benutzten, die nach dem Februaraufstand an die Macht gekommen war.
Da es sich bei ihm um ein Organ handelt, das auf die Bedürfnisse der Klassenherrschaft der Bourgeoisie zugeschnitten ist, konnte der bestehende bürgerliche Staat nicht im Interesse des Proletariats umgewandelt werden. So knüpfte Lenin an die historische Entwicklung der marxistischen Auffassung vom Kommunistischen Manifest bis zu seinen Lebzeiten an. Er zeigte dabei auf, wie die jeweiligen Erfahrungen des Arbeiterkampfes – die Revolutionen von 1848 und vor allem die Pariser Kommune von 1871 – die Notwendigkeit herausgestellt hatten, dass die Arbeiterklasse den bestehenden Staat zerstören und ihn durch eine neue Art von politischer Macht ersetzen musste. Diese neue Macht müsse sich auf eine Reihe fundamentaler Maßnahmen stützen, die die politische Autorität der Arbeiterklasse über alle Institutionen der Übergangsperiode aufrechterhalten müsse: die Auflösung des stehenden Heeres, die Wahl und jederzeitige Abwählbarkeit aller Beamten, deren Bezahlung dem Durchschnittslohn eines Arbeiters entsprechen sollte, die Zusammenlegung von Exekutive und Legislative in einem einzigen Organ.
Dies waren die Prinzipien der neuen Sowjetmacht, die Lenin gegenüber dem bürgerlichen Regime der Provisorischen Regierung verfocht. Die Notwendigkeit, im September/Oktober 1917 von der Theorie zur Praxis überzugehen, hinderte Lenin daran, der Frage nachzugehen, inwiefern die Sowjets eine höhere Form der proletarischen Diktatur darstellten als die Pariser Kommune. Aber Staat und Revolution kommt das große Verdienst zu, gewisse Unklarheiten in den Schriften von Marx und Engels aus der Welt geräumt zu haben, denn diese hatten darüber spekuliert, ob die Arbeiterklasse in einigen der demokratischeren Länder wie Großbritannien, Holland oder den USA friedlich an die Macht kommen könne. Lenin unterstrich, dass im Zeitalter des Imperialismus, in dem der militaristische Staat sich überall den Mantel einer „unparteiischen Macht“ zulegte, es keine Ausnahmen mehr geben könne. In den“demokratischen“ Ländern wie in den eher autoritären Regimes war das proletarische Programm dasselbe: Zerstörung des bestehenden Staatsapparates und die Gründung eines „Kommunestaates“.
Im Gegensatz zum Anarchismus erkannte Staat und Revolution ebenfalls, dass der Staat als solcher nicht über Nacht abgeschafft werden kann. Auch nach dem Sturz des bürgerlichen Staates werden weiterhin Klassen existieren, so wie auch der materielle Mangel vorerst noch fortbesteht. Diese objektiven Bedingungen machen einen Halbstaat in der Übergangsperiode erforderlich. Doch Lenin hob hervor, dass das Ziel des Proletariats nicht darin besteht, diesen Staat ständig zu verstärken, sondern darin, für die schrittweise Schwächung seiner Rolle im Gesellschaftsleben zu sorgen, um schließlich ganz auf ihn verzichten zu können. Dies erforderte die ständige Beteiligung der Arbeitermassen am politischen Leben und ihre wachsame Kontrolle über alle Staatsfunktionen. Gleichzeitig machte dies eine ökonomische Umwälzung in Richtung Kommunismus nötig. Gegenüber dieser Frage griff Lenin die Hinweise von Marx in dessen Kritik des Gothaer Programms auf, in der Letzterer ein System der Arbeitszeitgutscheine als eine vorübergehende Alternative gegenüber der Lohnarbeit propagiert hatte. Lenin verfasste diese Schrift am Vorabend einer gigantischen revolutionären Erfahrung. Er konnte eigentlich nur die allgemeinen Parameter des Problems der Übergangsperiode aufzeigen. Staat und Revolution beinhaltet deshalb unvermeidlich Lücken und Unzulänglichkeiten, die während der darauf folgenden Jahre der Siege und Niederlagen geklärt werden sollten:
– In seiner Schilderung der zum Kommunismus hinführenden ökonomischen Maßnahmen herrscht eine große Verwirrung über die Möglichkeit für die Arbeiterklasse, den Wirtschaftsapparat des Kapitals einfach zu übernehmen, sobald dieser staatliche Formen angenommen hatte. Dieses unzureichende Verständnis der Gefahren, die vom Staatskapitalismus ausgingen, wurde durch die irreführende Vorstellung vom „Sozialismus“ als Zwischenstufe der Produktion zwischen Kapitalismus und Kommunismus verstärkt. Gleichzeitig berücksichtigte er nicht ausreichend die Tatsache, dass der Übergang zum Kommunismus nur international in Angriff genommen werden kann.
– Das Buch äußert sich wenig zum Verhältnis zwischen der Partei und dem neuen Staatsapparat; damit lässt es Raum für Konfusionen über den Parlamentarismus und dafür, dass die Partei die Macht ergreifen und sich mit dem Staat verschmelzen könne.
– Es gibt eine Tendenz, das Ausmaß des Staatsapparates zu unterschätzen und ihn im Wesentlichen auf eine “bewaffnete Körperschaft” zu reduzieren, statt Engels’ Erkenntnis aufzugreifen, in der dieser vom Staat als einem Ausdruck der Klassengesellschaft sprach, der neben seiner Funktion als klassisches Unterdrückungsorgan die Aufgabe hatte, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Diese Aufgabe spiegelte damit das konservative Wesen des Staates, auch des Halbstaates in der Übergangsperiode, wider. Die Erfahrungen in Russland sollten Engels’ Aussage bekräftigen, denn es wurde deutlich, dass die Gefahren, die von diesem neuen Staat ausgingen, ihn zu einem Hort der Bürokratisierung und einer eventuellen bürgerlichen Konterrevolution machten.
Trotzdem bietet Staat und Revolution eine Reihe von Erkenntnissen über die negative Rolle des Staates. Die Schrift erkannte, dass der neue Staat mit materiellem Mangel konfrontiert sein wird und dass bei der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums somit „bürgerliches Recht“ zum Tragen kommen wird. Lenin sprach hinsichtlich dieses neuen Staates gar von einem „bürgerlichen Staat ohne Bourgeoisie“, was sicherlich eine zugespitzte Formulierung war, die zwar etwas ungenau war, aber dennoch eine gewisse Einsicht in die potenziellen Gefahren, die von dem Übergangsstaat ausgehen, erahnen ließ.
3. 1918: Das Programm der Kommunistischen Partei Deutschlands
(International Review Nr. 93)
Der Ausbruch der Revolution in Deutschland 1918 bestätigte die Perspektive, von der die Bolschewiki im Oktoberaufstand geleitet worden waren: die Perspektive der Weltrevolution. In Anbetracht der historischen Traditionen der Arbeiterklasse in Deutschland und dem Platz Deutschlands im Zentrum des Weltkapitalismus stellte die Revolution in Deutschland den Schlüssel für den gesamten weltrevolutionären Prozess dar. Sie spielte eine zentrale Rolle bei der Beendigung des Weltkrieges und bedeutete große Hoffnung für die belagerte proletarische Macht in Russland. Ebenso besiegelte ihre endgültige Niederlage in den darauf folgenden Jahren das Schicksal der Revolution in Russland, das einer schrecklichen inneren Konterrevolution zum Opfer fiel. Während der Sieg der Revolution die Tür zu einer neuen und höheren Stufe in der menschlichen Gesellschaft hätte aufstoßen können, löste ihre Niederlage ein Jahrhundert der Barbarei aus, wie sie die Menschheit noch nie zuvor erlebt hatte.
Im Dezember 1918 – einen Monat nach dem Aufstand im November und zwei Wochen vor der tragischen Niederlage des Berliner Aufstandes, in dem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ihr Leben verloren hatten, hielt die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ihren Gründungskongress ab. Das neue Parteiprogramm (Was will der Spartakusbund?) wurde von Rosa Luxemburg selbst vorgestellt, die das Programm in seinen historischen Kontext einordnete. Auch wenn es durch das Kommunistische Manifest von 1848 inspiriert worden war, musste das neue Programm sich auf sehr unterschiedliche Traditionen stützen; das Gleiche galt für das Erfurter Programm der deutschen Sozialdemokratie. Dieses hatte noch zwischen Minimal– und Maximalforderungen unterschieden, was zu einer Zeit, als die proletarische Revolution noch nicht unmittelbar auf der Tagesordnung gestanden hatte, adäquat gewesen war. Der Weltkrieg hatte jedoch eine neue Epoche in der Menschheitsgeschichte eingeläutet – die Epoche des Niedergangs des Kapitalismus, die Epoche der proletarischen Revolution. Damit musste das neue Programm dem direkten Kampf für die proletarische Diktatur und dem Aufbau des Sozialismus Rechnung tragen. So verlangte es nicht nur einen Bruch mit dem formellen Programm der Sozialdemokratie, sondern auch mit den reformistischen Illusionen, die die Partei Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachhaltig infiziert hatten – und mit den Illusionen über eine allmähliche Machteroberung mittels des Parlaments, von denen auch so klare und scharfsinnige Revolutionäre wie Engels beeinflusst worden waren.
Doch die Behauptung, dass die proletarische Revolution auf der Tagesordnung der Geschichte stand, beinhaltete nicht, dass das Proletariat unmittelbar dazu in der Lage war, diese durchzuführen. So hatte die Novemberrevolution in der Tat gezeigt, dass die Arbeiterklasse in Deutschland noch lange Zeit brauchen würde, um den Ballast der Vergangenheit abzuwerfen, wie der immer noch starke Einfluss der sozialdemokratischen Verräter in den Arbeiterräten bewies. Luxemburg bestand darauf, dass die Arbeiterklasse in Deutschland sich selbst durch eine Reihe von Kämpfen erziehen müsse, die sowohl ökonomischer und politischer Art seien und auf der Ebene der Verteidigung und Offensive stattfinden müssten und die ihr schließlich das für die Leitung der Gesellschaft notwendige Vertrauen und Bewusstsein geben werden. Es war eine der großen Tragödien der Revolution in Deutschland, dass es der Bourgeoisie gelang, das Proletariat in einen vorzeitigen Aufstand zu locken, der diesen Prozess vereitelte und ihn seiner weitsichtigsten und klarsten Führer beraubte.
Das Dokument der KPD umriss eingangs die allgemeinen Ziele und Prinzipien. Es erkannte unverblümt die Notwendigkeit der gewaltsamen Unterdrückung der bürgerlichen Macht an, während gleichzeitig die Idee abgelehnt wurde, dass die proletarische Gewalt eine neue Form des Terrors sei. Es unterstrich, dass der Sozialismus einen qualitativen Schritt vorwärts in der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bedeutet und nicht durch eine Reihe von oben aufgezwungener Maßnahmen dekretiert werden kann. Stattdessen könne er nur das Ergebnis des kreativen und kollektiven Werkes von unzähligen Millionen von Arbeitern sein. Gleichzeitig war dieses Dokument ein wirkliches Programm, da es eine Reihe von praktischen Schritten vorschlug, die darauf abzielen, die Herrschaft der Arbeiterklasse zu errichten und erste Schritte zur Vergesellschaftung der Produktion zu ergreifen wie zum Beispiel:
– Entwaffnung der Polizei und Offiziere, Beschlagnahme aller Waffen– und Munitionsbestände durch die Arbeiterräte, Bildung von Arbeitermilizen;
– Aufhebung der Kommandogewalt der Armee und die Ausbreitung der Soldatenräte;
– Bildung von Revolutionstribunalen;
– Einberufung eines zentralen Kongresses der Arbeiter- und Soldatenräte, die überall durch lokale Arbeiter- und Soldatenräte gewählt werden, und die gleichzeitige Auflösung aller alten Parlamente und Gemeinderäte;
– Begrenzung des Arbeitstages auf maximal sechs Stunden;
– Konfiszierung aller Lebensmittel, um die Bevölkerung zu ernähren und mit Wohnraum sowie Kleidung zu versorgen;
– Enteignung von Grund und Boden, Banken, Bergwerken und der Großbetriebe in Industrie und Handel;
– Etablierung von Betriebsräten, um die Hauptaufgabe der Verwaltung von Fabriken und anderen Arbeitsplätzen zu übernehmen.
Die Mehrzahl der im KPD-Programm angekündigten Maßnahmen bleibt auch heute gültig, obgleich das Programm als ein Dokument, das zu Beginn der ungeheuer wichtigen revolutionären Erfahrungen verfasst wurde, nicht in allen Fragen klar sein konnte. So war die Rede von Nationalisierungen der Wirtschaft als ein Schritt zum Sozialismus: Damals konnte man nicht wissen, wie schnell sich das Kapital damit arrangieren konnte. Während jegliche Form des Putschismus abgelehnt wurde, beharrte es darauf, dass die Partei selbst die politische Macht ergreifen müsse. Seine Aussagen zu den internationalen Aufgaben der Revolution sind sehr vage. Doch dies waren Schwächen, die überwunden hätten werden können, falls die Revolution in Deutschland nicht im Keim erstickt worden wäre.
4. Die Plattform der Kommunistischen Internationale (International Review Nr. 94)
Die Plattform der Kommunistischen Internationale wurde anlässlich des Ersten Kongresses der Komintern 1919 verfasst. Dies geschah nur wenige Monate nach dem tragischen Ausgang des Berliner Aufstandes. Doch noch hatte die internationale revolutionäre Welle ihren Zenit nicht überschritten. Zum Zeitpunkt des Ersten Kongresses der Komintern traf die Nachricht von der Ausrufung einer neuen Sowjetrepublik in Ungarn ein. Die Klarheit der politischen Positionen, die auf dem Ersten Kongress verabschiedet wurden, spiegelte die vorwärts strebende Bewegung der Klasse wider, so wie das spätere Abgleiten der Komintern in den Opportunismus direkt mit der abflauenden Bewegung verbunden war.
Bucharin leitete die Kongress-Diskussionen über den Entwurf einer Plattform ein. Seine Bemerkungen wurden auch durch die beträchtlichen Fortschritte auf theoretischer Ebene bestärkt, die die Revolutionäre damals erzielt hatten. Bucharin bestand darauf, dass der Ausgangspunkt für die Plattform die Anerkennung des Bankrotts des kapitalistischen Systems auf globaler Ebene war. Von Anfang an begriff die Komintern, dass die „Globalisierung“ des Kapitals schon eine vollendete Tatsache war, ja dass sie in der Tat ein grundlegender Faktor beim Niedergang und Zusammenbruch des Systems war.
Bucharins Rede brachte auch ein weiteres Merkmal des Kongresses zum Ausdruck: seine offene Haltung gegenüber den neuen Entwicklungen, die den Beginn der durch den Krieg eingeläuteten Epoche anzeigten. Er erkannte an, dass zumindest in Deutschland die bestehenden Gewerkschaften keine positive Rolle mehr spielten und durch neue Klassenorgane ersetzt werden mussten, die die Massenbewegung hervorgebracht hatte, insbesondere die Fabrikkomitees. Dies hob sich deutlich von späteren Kongressen ab, als die Arbeit in den offiziellen Gewerkschaften als für alle Parteien der Internationale verbindlich erklärt wurde. Doch dies deckte sich mit den Erkenntnissen der Plattform in der Frage des Staatskapitalismus, da Bucharin an anderer Stelle argumentierte, dass die Integration der Gewerkschaften in das kapitalistische System gerade eine Funktion des Staatskapitalismus sei. Die Plattform selbst bot einen kurzen Überblick über den neuen Zeitraum und die Aufgaben des Proletariats. Sie versuchte nicht ein detailliertes Maßnahmenprogramm für die proletarische Revolution zu erstellen. Sie unterstrich erneut sehr klar, dass mit dem Weltkrieg „eine neue Epoche geboren (ist) – die Epoche der Auflösung des Kapitalismus, seiner inneren Zersetzung, die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats“ (Richtlinien der Kommunistischen Internationale)
Sie bestand darauf, dass die Machtergreifung durch das Proletariat die einzige Alternative zur kapitalistischen Barbarei ist, und rief zur revolutionären Zerstörung aller Institutionen des bürgerlichen Staates (Parlament, Polizei, Gerichte usw.) und zu ihrer Ersetzung durch proletarische Machtorgane auf, die sich auf die bewaffneten Arbeiterräte stützen. Sie entblößte die Leere der bürgerlichen Demokratie und erklärte, dass allein das Rätesystem die Massen in die Lage versetzt, eine reale Macht auszuüben. Sie stellte des Weiteren grobe Richtlinien für die Enteignung der Bourgeoisie und für die Vergesellschaftung der Produktion auf. Dazu gehörte die unmittelbare Vergesellschaftung der Hauptzentren der kapitalistischen Industrie und Landwirtschaft, die schrittweise Integration von kleinen, unabhängigen Produzenten in den vergesellschafteten Bereich und radikale Maßnahmen mit dem Ziel der Ersetzung des Marktes durch eine gleichmäßige Verteilung der Produkte.
Im Interesse eines siegreichen Kampfes bestand die Plattform auf der Notwendigkeit eines vollständigen politischen Bruchs sowohl mit der rechten Sozialdemokratie, die „ausgesprochene politische Lakaien des Kapitals und Henker der kommunistischen Revolution“ waren, als auch mit dem Zentrum um Kautsky. Diese Position, die im totalen Gegensatz zur Politik der zwei Jahre später verabschiedeten Einheitsfront steht, hatte nichts mit Sektierertum zu tun, da sie von einem Aufruf zur Einheit mit den echten proletarischen Kräften, wie Teilen der anarcho-syndikalistischen Bewegung, flankiert wurde. Angesichts der Einheitsfront der kapitalistischen Konterrevolution, die sich bereits für den Tod von Luxemburg und Liebknecht verantwortlich zeichnete, rief die Plattform zur Verbreitung des Massenkampfes in allen Ländern auf, was zu einer direkten Konfrontation mit dem bürgerlichen Staat führen werde.
5. 1919: Das Programm der Diktatur des Proletariats (International Review Nr. 95)
Die Existenz einer Reihe von verschiedenen nationalen Parteiprogrammen neben der Plattform der Kommunistischen Internationale wies auf den Fortbestand eines gewissen Föderalismus auch in der neuen Internationale hin, die danach strebte, die nationale Autonomie zu überwinden, die zum Niedergang der alten beigetragen hatte. Aber das Programm der russischen Partei, das für deren 9. Kongress 1919 verfasst wurde, ist von besonderem Interesse. Während das Programm der KP das Ergebnis einer Partei war, die vor der Aufgabe stand, die Arbeiter in eine Revolution zu führen, war das neue Programm der bolschewistischen Partei die Manifestierung der Ziele und Methoden der ersten Sowjetmacht, einer wirklichen Diktatur des Proletariats. Konkret wurde es also von einer Reihe von Dekreten begleitet, die die Politik der Sowjetrepublik in bestimmten Fragen widerspiegelten, obgleich, wie Trotzki eingestand, viele Dekrete eher propagandistischer Natur waren, als eine praktische Politik darstellten. Wie die Plattform der Komintern unterstrich auch das Programm von Anfang an den Beginn der neuen Epoche des niedergehenden Kapitalismus und die Notwendigkeit der proletarischen Weltrevolution. Ebenso wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, einen vollständigen und tief greifenden Bruch mit den offiziellen sozialdemokratischen Parteien zu vollziehen. Das Programm war in folgende Teile aufgeteilt:
Allgemeine Politik: Die Überlegenheit des Sowjetsystems gegenüber der bürgerlichen Demokratie zeigte sich anhand ihrer Fähigkeit, die überwältigende Mehrheit der Ausgebeuteten und Unterdrückten an dem Betrieb des Staates zu beteiligen. Das Programm hob hervor, dass die Arbeiterräte durch ihre Organisierung auf der Grundlage des Arbeitsplatzes statt des Wohnortes ein direkter Ausdruck des Proletariats als Klasse sind. Da die Arbeiterklasse den revolutionären Prozess anführen muss, spiegelt sich dies in dem größeren Gewicht der städtischen Räte im Verhältnis zu den Räten auf dem Land wider. Doch wurde nicht die Idee vertreten, dass anstelle der Sowjets die Partei die Macht ausüben soll. Das übergeordnete Anliegen des Programms, das in der Zeit der Entbehrungen des Bürgerkrieges geschrieben wurde, bestand darin, Mittel und Wege zu finden, um dem wachsenden Einfluss der Bürokratie im neuen Staatsapparat entgegenzutreten, indem eine größere Zahl Arbeiter an der Leitung der Staatsgeschäfte beteiligt wird. In Anbetracht der schrecklichen Bedingungen, denen das Proletariat gegenüberstand, erwiesen sich diese jedoch als unzureichend. Die militanten Arbeiter neigten dazu, sich in Staatsbürokraten zu verwandeln, statt der Bürokratie den Willen der kämpfenden Arbeiterklasse aufzuzwingen. Dennoch reflektierte dieser Teil bereits früh ein Bewusstsein über die Gefahren, die aus dem Staatsapparat hervorgehen.
Nationalitätenfrage: Von einem richtigen Standpunkt ausgehend – nämlich der Notwendigkeit, nationale Grenzen innerhalb des Proletariats und der unterdrückten Massen zu überwinden und einen gemeinsamen Kampf gegen das Kapital zu entwickeln –, offenbarte das Programm hier einige seiner schwächsten Seiten, als es den Begriff der nationalen Selbstbestimmung übernahm. Im Grunde lief dieser Begriff nur auf die Selbstbestimmung der Bourgeoisie hinaus. In der Epoche des Imperialismus kann dies nur bedeuten, die Dominierung nationaler Einheiten von einem nationalistischen Herrscher auf einen anderen zu verlagern. Rosa Luxemburg und andere hoben die schrecklichen Folgen dieser Politik hervor, als sie aufzeigten, dass alle Nationen, denen die Bolschewiki die „Unabhängigkeit“ gewährten, tatsächlich zu Stützpfeilern der imperialistischen Intervention gegen die Sowjetmacht wurden.
Militärfragen: Nachdem das Programm die Notwendigkeit einer Roten Armee zur Verteidigung des neuen Sowjetregimes in Zeiten des Bürgerkrieges anerkannte, schlug das Programm eine Reihe von Maßnahmen vor, die sicherstellen sollten, dass die neue Armee tatsächlich eine Waffe des Proletariats blieb: Ihre Truppen sollten aus dem Proletariat und dem Halbproletariat hervorgehen. Ihre Ausbildungsmethoden sollten sich auf sozialistische Prinzipien stützen. Politische Kommissare, die aus den Reihen bewährter Kommunisten ernannt werden sollten, sollten mit früheren zaristischen Militärs zusammenarbeiten und sicherstellen, dass diese sich ganz der Sache der Sowjetmacht widmeten. Gleichzeitig sollten immer mehr Offiziere von klassenbewussten Arbeitern gestellt werden. Doch die Praxis, die Offiziere zu wählen – eine Forderung der ersten Soldatenräte -, wurde nicht zu einem Prinzip erhoben. Auf dem 9. Kongress entwickelte sich eine von der Gruppe Demokratischer Zentralisten angestoßene Debatte über die Notwendigkeit, die Prinzipien der Kommune auch in der Armee aufrechtzuerhalten und sich der Tendenzen in der Armee zu widersetzen, immer wieder in die alten hierarchischen Methoden oder Organisationsformen zurückzufallen. Eine weitere Schwäche, vielleicht die größte, bestand darin, dass der Aufbau der Roten Armee mit der Auflösung der Roten Garden einherging. Damit verloren die Arbeiterräte ihre besonderen bewaffneten Kräfte zugunsten eines sehr statisch handelnden Organs, das sich viel weniger auf die Bedürfnisse des Klassenkampfes einstellen konnte.
Proletarische Justiz: Die bürgerlichen Gerichte wurden durch die Volksgerichte ersetzt, deren Richter von der Arbeiterklasse gewählt wurden. Die Todesstrafe sollte abgeschafft, das Strafsystem von jedem Revanchismus befreit werden. Aber unter den brutalen Bedingungen des Bürgerkriegs wurde die Todesstrafe bald wieder eingeführt. Und die revolutionären Tribunale, die errichtet wurden, um mit Notlagen umzugehen, missbrauchten oft ihre Macht; ganz zu schweigen von den Aktivitäten der Sonderkommissionen gegen die Konterrevolution, der Tscheka, die immer mehr der Kontrolle der Sowjets entglitt.
Erziehung: In Anbetracht des enormen Gewichts der Rückständigkeit Russlands ging es bei den Erziehungsreformen, die vom Sowjetstaat eingeleitet wurden, schlicht und einfach darum, die Bildungspolitik Russlands auf das Niveau der fortgeschrittenen Erziehungsmethoden anzuheben, die bereits in den bürgerlichen Demokratien praktiziert wurden (wie freie Schulbildung für Kinder beider Geschlechter bis zum Alter von 17 Jahren). Gleichzeitig ging es bei den langfristigen Zielen darum, die Schule von einem Organ bürgerlicher Indoktrination zu einem Instrument der kommunistischen Umwandlung der Welt zu machen. Dies erforderte die Überwindung von Methoden, die auf Zwang und Hierarchie gebaut waren, die Abschaffung der strikten Trennung zwischen Hand– und Kopfarbeit und im Allgemeinen die Erziehung einer neuen Generation in einer Welt, in der Lernen und Arbeiten ein Vergnügen statt eine Mühsal ist.
Religion: Während man an der Notwendigkeit einer intelligenten und einfühlsamen Propaganda durch die Sowjetmacht festhielt, die darauf abzielte, die archaischen religiösen Vorurteile der Massen zu bekämpfen, wurden alle Bemühungen energisch zurückgewiesen, die Religion mit Gewalt zu unterdrücken, denn dies führte, wie die Erfahrung des Stalinismus später lehren sollte, nur zu einem Anwachsen des religiösen Einflusses.
Wirtschaftsfragen: Obgleich davon ausgegangen wurde, dass der Kommunismus nur auf weltweiter Ebene errichtet werden kann, enthielt das Programm einen allgemeinen Rahmen für eine proletarische Wirtschaftspolitik in jenen Gebieten, die unter der Kontrolle des Proletariats standen: Enteignung der alten herrschenden Klasse, Zentralisierung der Produktivkräfte unter der Kontrolle der Sowjets, Mobilisierung aller verfügbaren Arbeitskräfte, Praktizierung einer neuen Arbeitsdisziplin, die sich auf die Prinzipien der Klassensolidarität stützte, schrittweise Eingliederung der unabhängigen Produzenten in die kollektive Produktion. Das Programm erkannte auch die Notwendigkeit an, dass die Arbeiterklasse kollektiv die Verwaltung des Produktionsprozesses betreibt. Die Instrumente zur Ausführung dieser Aufgabe waren jedoch nicht die Arbeiterräte und die Fabrikkomitees (die nicht einmal in dem Programm erwähnt wurden), sondern die Gewerkschaften, die aufgrund ihres Wesens dazu neigten, der Arbeiterklasse die kollektive Kontrolle über die Produktion zu entwinden und sie in die Hände des Staates zu legen. Am meisten ausschlaggebend war, dass die schrecklichen, durch den Krieg geschaffenen Bedingungen eine Zersplitterung der proletarischen Massen in den Städten und ihre Herabstufung bewirkten. Dies machte es für die Arbeiterklasse immer schwieriger, nicht nur die Fabriken, sondern auch den Staat zu kontrollieren.
Landwirtschaft: Hier gelangte man zur Erkenntnis, dass eine auf Bauern gestützte Produktion nicht über Nacht kollektiviert werden könne, sondern einen mehr oder weniger langen Zeitraum der Integration in den vergesellschafteten Sektor erfordere. In der Zwischenzeit müsse die Sowjetmacht den Klassenkampf auf dem Land entfachen, indem die armen Bauern und die Landarbeiter die größte Unterstützung erhielten.
Güterverteilung: Die Sowjetmacht stellte sich selbst die grandiose Aufgabe, den Warenhandel durch eine sinnvolle Güterverteilung zu ersetzen, die sich an den Bedürfnissen der Menschen ausrichtet und durch ein Netzwerk von Konsumentenkommunen ersetzt wird. In der Tat brach das alte Währungssystem in der Zeit des Bürgerkrieges mehr oder weniger zusammen und wurde durch ein System der Konfiszierungen und Rationierungen ersetzt. Jedoch dies war auf einen direkten Mangel zurückzuführen und bedeutete nicht wirklich die Etablierung kommunistischer Gesellschaftsverhältnisse, obgleich diese oft als solche theoretisiert wurden. Eine reale Etablierung von Kommunen kann sich nur auf die Fähigkeit stützen, Überschüsse zu produzieren, was jedoch in einer isolierten proletarischen Bastion unmöglich ist.
Finanzen: Diese zu optimistische Einschätzung des Kriegskommunismus spiegelte sich auch in anderen Bereichen wider, insbesondere in der Idee, dass man allein durch den Zusammenschluss aller bestehenden Banken zu einer einzigen Staatsbank einen Schritt zur Auflösung der Banken als solche machen könne. Doch das Geldsystem, das während der Zeit des Bürgerkriegs nur „abgetaucht“ war, erlebte in Russland bald eine Wiederauferstehung: Geld in der einen oder anderen Form sowie Mittel zu dessen Aufbewahrung werden solange bestehen, wie es Tauschbeziehungen gibt, und können erst durch die Errichtung einer vereinten Weltgemeinschaft überwunden werden.
Wohnungsfrage und öffentliche Gesundheit: Die proletarische Macht entfaltete eine Vielzahl von Initiativen, um die Obdachlosigkeit und Überbelegung von Wohnung zu reduzieren, insbesondere durch die Enteignung bürgerlicher Wohnungen. Doch ihre weiterreichenden Bestrebungen, eine neue städtische Umgebung zu schaffen, wurden durch die ungünstigen Bedingungen nach dem Aufstand vereitelt. Das Gleiche trifft auf viele andere Maßnahmen zu, die die Sowjetmacht dekretiert hatte: Verkürzung des Arbeitstages, Unterstützungszahlungen für Behinderte und Arbeitslose, drastische Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Das unmittelbare Ziel bestand darin, Russland auf den gleichen Standard zu heben, wie er in höher entwickelten bürgerlichen Staaten erreicht worden war. Aber auch hier wurde die neue Macht an der Einführung wirklicher Verbesserungen durch das Abführen gewaltiger Ressourcen an den Kriegsapparat gehindert.
6. 1920: Bucharin und die Übergangsperiode
(International Review Nr. 96)
Bucharin verfasste neben dem Programm der russischen Partei einen theoretischen Text über die Probleme der Übergangsperiode. Obgleich in vielerlei Hinsicht mit großen Fehlern behaftet, stellen einige Teile einen ernsthaften Beitrag zur marxistischen Theorie dar. Eine Untersuchung seiner Schwächen ermöglicht, die Probleme zu beleuchten, die er zu stellen versuchte. Bucharin hatte während des I. Weltkriegs der theoretischen Avantgarde der bolschewistischen Partei angehört. Sein Buch Imperialismus und Weltwirtschaft war zur gleichen Zeit wie Rosa Luxemburgs Untersuchung der neuen Epoche des kapitalistischen Niedergangs – Die Akkumulation des Kapitals – veröffentlicht worden. In seinem Buch zeigte Bucharin als einer der ersten auf, dass diese Phase eine neue Stufe in der Organisierung des Kapitals eröffnet hatte – die Stufe des Staatskapitalismus, die er hauptsächlich mit dem globalen militärischen Kampf zwischen imperialistischen Nationalstaaten verband. In seinem Artikel Hin zu einer Theorie des imperialistischen Staates vertrat Bucharin eine sehr fortschrittliche Position zur nationalen Frage (seine Position ähnelte der Position Rosa Luxemburgs über die Unmöglichkeit der nationalen Befreiung im Zeitalter des Imperialismus) und zur Frage des Staates. Er gelangte rascher als Lenin zur Position, die dieser in Staat und Revolution vertrat – die Notwendigkeit der Zerstörung des bürgerlichen Staatsapparates.
Diese Auffassungen wurden in seinem 1920 verfassten Buch Ökonomik der Transformationsperiode weiterentwickelt. In diesem Text bekräftigte Bucharin die marxistische Auffassung über die unvermeidliche Katastrophe sowie das gewaltsame Ende der Klassenherrschaft und somit über die notwendige proletarische Revolution als der einzigen Grundlage für den Aufbau einer neuen und höheren Produktionsweise. Gleichzeitig befasste er sich eingehender mit den Eigenschaften dieser neuen Phase der kapitalistischen Dekadenz. Er hatte eine Vorahnung von der wachsenden Tendenz des senilen Kapitalismus zur Verschwendung und Zerstörung der akkumulierten Produktivkräfte, unabhängig von dem damit verbundenen möglichen quantitativen „Wachstum“. Er zeigte ebenso auf, wie unter den Bedingungen des Staatskapitalismus die alten Arbeiterparteien und die Gewerkschaften „in den Staat integriert“ wurden, d.h. wie sie in einem unglaublich aufgeblähten kapitalistischen Staatsapparat absorbiert wurden.
In seinen groben Umrissen ist die Darstellung Bucharins der kommunistischen Alternative gegenüber diesem niedergehenden kapitalistischen System ziemlich eindeutig: eine weltweite Revolution, die sich auf die Eigenaktivität der Arbeiterklasse und ihrer neuen Kampforgane stützt – die Sowjets. Eine solche Revolution zielt darauf ab, die ganze Menschheit in eine vereinte Weltgemeinschaft zusammenzuführen, die die blinden Gesetze der Produktion in der Warenwirtschaft durch die bewusste Regelung des gesellschaftlichen Lebens ersetzt.
Doch die Mittel und Ziele der proletarischen Revolution müssen konkretisiert werden. Dies kann nur das Ergebnis einer lebendigen Erfahrung und des Nachdenkens sowie der Auswertung dieser Erfahrung sein. Hier liegt die Schwäche des Buches. Obgleich Bucharin 1918 der linkskommunistischen Tendenz in der bolschewistischen Partei angehörte, beschränkte sich diese Ausrichtung vor allem auf die Frage des Brest-Litowsker Waffenstillstandes. Im Gegensatz zu anderen Linkskommunisten wie etwa Ossinksi war er weitaus weniger im Stande, eine kritische Sichtweise über die Hauptanzeichen der Bürokratisierung des Sowjetstaates zu entwickeln. Im Gegenteil, sein Buch neigte eher dazu, als eine Rechtfertigung für den Status quo während des Bürgerkriegs zu dienen, da er vor allem eine theoretische Rechtfertigung für die Maßnahmen des Kriegskommunismus als Ausdruck eines echten Prozesses kommunistischer Umwälzung lieferte.
So bedeutete aus der Sicht Bucharins das (scheinbare) Verschwinden des Geldes und der Löhne während des Bürgerkrieges – was ein direktes Ergebnis des Zusammenbruchs der kapitalistischen Wirtschaft war – die Überwindung der Ausbeutung und der Einzug einer Form des Kommunismus. Ähnlich machte er aus der bitteren Notwendigkeit des Mehrfrontenkrieges der Roten Armee, der der proletarischen Revolution in Russland aufgezwungen wurde, nicht nur eine Regel für die Phase der revolutionären Kämpfe, sondern gar ein Modell für die Ausdehnung der Revolution, die sich nunmehr in eine monumentale Schlacht zwischen kapitalistischen und proletarischen Ländern verwandelt habe. In dieser Hinsicht stand Bucharin mit seinem Standpunkt viel weiter rechts als Lenin, der niemals vergaß, dass die Ausdehnung der Revolution vor allem eine politische Aufgabe und nicht hauptsächlich eine militärische war.
Ironischerweise zeigte sich Bucharin, nachdem er eindeutig den Staatskapitalismus als die universelle Form der kapitalistischen Organisierung im Zeitalter des kapitalistischen Niedergangs identifiziert hat, blind gegenüber der Gefahr des Staatskapitalismus nach der proletarischen Revolution. Unter dem „proletarischen Staat“, unter dem System der „proletarischen Verstaatlichungen“ werde die Ausbeutung unmöglich werden. Der Umstand, dass der neue Staat der organische Ausdruck der historischen Interessen des Proletariats sei, sei für das Proletariat insofern vorteilhaft, als sämtliche Klassenorgane der Arbeiter im Staatsapparat verschmolzen und die ausgeprägtesten hierarchischen Praktiken bei der Verwaltung des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens wiederherstellt seien. Ihm fehlte jegliches Problembewusstsein, dass der Übergangsstaat, der ein Ausdruck der Notwendigkeit ist, eine nur vorübergehende Gesellschaftsformation zusammenzuhalten, eine konservative Rolle spielt und sich gar von den Interessen des Proletariats lösen könnte.
In der Zeit nach 1921 wandelte Bucharin sich schnell von einem Linken zu einem Anhänger eines rechten Kurses. Doch in Wirklichkeit gab es eine Kontinuität in dieser Entwicklung: die Neigung, sich dem Status quo anzupassen. Da sein Buch Die Ökonomik der Transformationsperiode ein Versuch war, zu erklären, dass das strenge Regime des Kriegskommunismus bereits das Ziel des Kampfes der Arbeiterklasse sei, bedeutete es einige Jahre später keinen großen Kurswechsel, als er erklärte, dass die Neue Ökonomische Politik NEP – die den Kräften des Marktes freien Lauf ließ, der in der vorhergehenden Phase lediglich in den Hintergrund getreten war – bereits die Vorstufe zum Sozialismus sei. Bucharin wurde mehr noch als Stalin zum Theoretiker des „Sozialismus in einem Land“. Dies kommt schon in der absurden Behauptung zum Ausdruck, dass die isolierte russische Bastion der Jahre 1918-20, in der das Proletariat durch den Bürgerkrieg dezimiert worden war und in der es sich der wachsenden neuen Bürokratie unterwerfen musste, bereits eine kommunistische Gesellschaft darstelle.
7. 1920: Das Programm der KAPD (International Review Nr. 97)
Die Isolierung der Revolution in Russland sollte sich negativ auf die politischen Positionen der neu gegründeten Kommunistischen Internationale auswirken, die ihre Klarheit, die sie auf ihrem Gründungskongress zum Ausdruck gebracht hatte, allmählich verlor, was insbesondere gegenüber den sozialdemokratischen Parteien deutlich wurde. Nachdem diese zuvor noch als Parteien der Bourgeoisie gebrandmarkt worden waren, begann die Komintern die Taktik der „Einheitsfront“ mit eben diesen Parteien zu praktizieren. Zum Teil manifestierte sich dies in dem Versuch, mehr Unterstützung für die isoliert gebliebene russische Bastion zu gewinnen. Es waren die linkskommunistischen Strömungen in einer Reihe von Ländern, insbesondere in Italien und Deutschland, die sich dem Aufkommen des Opportunismus in der Komintern vehement entgegenstellten. Einer der ersten Ausdrücke des wachsenden Opportunismus in der Komintern war Lenins Schrift Der „linke Radikalismus“ – Die Kinderkrankheit im Kommunismus. Seit seiner Veröffentlichung lieferte der Text die Grundlage für viele Verfälschungen und Verzerrungen über die Kommunistische Linke. Insbesondere zeigte sich dies im Falle der deutschen Linken um die KAPD, die 1920 aus der KPD ausgeschlossen wurde. Der KAPD wurde vorgeworfen, einer „sektiererischen“ Politik anheim zu fallen, weil sie die wirklichen Arbeitergewerkschaften willkürlich durch „revolutionäre Unionen“ ersetzen wollte. Ihr wurden vor allem anarchistische Tendenzen in der Frage des Parlamentarismus und der Rolle der Partei vorgeworfen.
In Wirklichkeit war die KAPD, die das Ergebnis eines tragischen und verfrühten Bruchs in der deutschen Partei war, nie eine homogene Organisation. Ihr gehörte eine Reihe von Mitgliedern an, die tatsächlich vom Anarchismus beeinflusst worden waren. Und als die revolutionäre Welle zurückgewichen war, sollte dieser Einfluss mit zum Auftauchen rätekommunistischer Ideen beitragen, die die Bewegung der Kommunisten in Deutschland stark prägten. Aber ein kurzer Blick auf ihr Programm zeigt, dass die KAPD in ihren besten Zeiten den damaligen Höhepunkt der marxistischen Klarheit verkörperte:
– Im Gegensatz zum Anarchismus ging ihr Programm von den objektiven, historischen Bedingungen des Weltkapitalismus aus: von der neuen, durch den Weltkrieg eröffneten Epoche der kapitalistischen Dekadenz. Es beharrte auf der Alternative zwischen Sozialismus und Barbarei.
– Im Gegensatz zum Anarchismus unterstützte das Programm vorbehaltlos seine Solidarität mit der Russischen Revolution und bekräftigte die Notwendigkeit ihrer weltweiten Ausdehnung. Dabei wurde Deutschland ausdrücklich als Schlüsselelement für diese Perspektive hervorgehoben.
– Die Ablehnung des Parlamentarismus und der Gewerkschaften durch die KAPD stützte sich nicht auf irgendeinen zeitlosen Moralismus oder auf eine Besessenheit für Organisationsformen, sondern auf ein Verständnis der neuen Bedingungen, die die Epoche der proletarischen Revolution mit sich gebracht hatte, in der Parlamentarismus und Gewerkschaften nunmehr nur den Interessen des Klassenfeindes dienten.
– Dasselbe trifft auf die Befürwortung der Fabrikorganisationen und der Arbeiterräte durch die KAPD zu. Diese waren keine willkürlichen, von einer Handvoll Revolutionäre ausgedachten Formen, sondern konkrete organisatorische Erfahrungen aus der realen Klassenbewegung in der neuen Epoche. Auch wenn es noch keine vollständige Klarheit über das Wesen der Fabrikorganisationen geben konnte (die die KAPD immer noch als eine Art ständiger Vorläufer der Räte betrachtete, die sich auf ein politisches Minimalprogramm stützten), waren sie alles andere als ein künstliches Produkt der damaligen Zeit, sondern ein Zusammenschluss der kämpferischsten Arbeiter in Deutschland.
– Weit davon entfernt, parteifeindlich zu sein, bekräftigte das Programm (das durch die Thesen zur Rolle der Partei in der Revolution untermauert wurde) deutlich die unabdingbare Rolle der Partei als ein Kern der kommunistischen Kompromisslosigkeit und Klarheit gegenüber der allgemeinen Klassenbewegung.
– Ebenso verteidigte das Programm ohne Zögern die marxistische Auffassung über die Diktatur des Proletariats.
Hinsichtlich der praktischen Maßnahmen befand sich das Programm der KAPD in direkter Kontinuität mit dem Programm der KPD, insbesondere in seinem Aufruf zur Auflösung aller parlamentarischen und Gemeindeorgane und zu ihrer Ersetzung durch ein zentralisiertes System der Arbeiterräte. Das Programm der KAPD von 1920 war dagegen in den Fragen der internationalen Aufgaben der Revolution klarer. Es rief zum Beispiel zum unmittelbaren Zusammenschluss mit anderen Sowjetrepubliken auf. Des Weiteren befasste es sich näher mit dem ökonomischen Inhalt der Revolution. Es betonte die Notwendigkeit unmittelbarer Schritte zur Ausrichtung der Produktion auf die Bedürfnisse (auch wenn wir der Behauptung des Programms widersprechen, dass allein die Bildung eines „sozialistischen Wirtschaftsblocks“ mit Russland einen bedeutenden Schritt zum Kommunismus bewirken könne). Schließlich warf das Programm einige „neue“ Themen auf, die im Programm der KPD von 1918/1919 nicht behandelt worden waren, wie das proletarische Vorgehen gegenüber der Kunst, Wissenschaft, Erziehung und Jugend. Dies zeigt, dass die KAPD weit davon entfernt war, eine Strömung zu sein, die die Arbeiterklasse mystifizierte. Sie befasste sich im Gegenteil mit all den Fragen, die durch die kommunistische Umwälzung der Gesellschaft aufgeworfen wurden.
Theoretische Fragen:
- Kommunismus [39]
Internationale Revue 42
- 3405 Aufrufe
Dekadenz des Kapitalismus (1)
- 3521 Aufrufe
Die Revolution ist seit einem Jahrhundert notwendig und möglich
1915, als die abscheuliche Realität des europäischen Krieges immer offensichtlicher wurde, schrieb Rosa Luxemburg „Die Krise der Sozialdemokratie“, einen Text, besser bekannt als Junius-Broschüre, abgeleitet von dem Pseudonym, unter welchem Luxemburg ihn publizierte. Das Pamphlet wurde im Gefängnis geschrieben und illegal durch die Gruppe Die Internationale verteilt, welche sich sofort nach Ausbruch des Krieges formierte. Es war eine flammende Anklage gegen die Positionen, welche sich die Führung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zueigen machte. An dem Tag, an dem die Feindseligkeiten begannen, am 4. August 1914, verriet die SPD ihre internationalistischen Prinzipien und stellte sich auf die Seite des der Vaterlandsverteidiger, indem sie zur Einstellung des Klassenkampfes und zur Partizipation im Krieg aufforderte. Das war ein fataler Rückschlag für die internationale sozialistische Bewegung, war die SPD doch der Stolz der ganzen Zweiten Internationale. Anstatt als Fanal der internationalen Arbeitersolidarität zu fungieren, wurde ihre Kapitulation vor der Kriegstreiberei als Rechtfertigung für ähnlich verräterische Aktionen in anderen Ländern benutzt. Das Resultat war der schändliche Kollaps der Internationalen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Der Erste Weltkrieg: Ein Wendepunkt der Geschichte
Die SPD formierte sich in den 1870ern als eine marxistische Partei und symbolisierte damit den wachsenden Einfluss des „wissenschaftlichen Sozialismus“ innerhalb der Arbeiterbewegung. An der Oberfläche blieb die SPD von 1914 dem marxistischen Credo treu, sogar als sie dessen Geist mit Füssen trat. Hatte nicht schon Marx seiner Tage vor der Gefahr des zaristischen Absolutismus, des Hauptpfeilers der Reaktion in Europa, gewarnt? Wurde nicht die Erste Internationale an einer Versammlung zur Unterstützung des Kampfes für die Unabhängigkeit Polens vom zaristischen Joch gegründet? Hatte nicht Engels, obwohl er vor der Gefahr eines Krieges in Europa warnte, dennoch die Ansicht vertreten, dass die deutschen Sozialisten eine „revolutionär defensive“ Position einnehmen sollten im Falle einer franko-russischen Aggression gegen Deutschland? Und nun rief die SPD auf zur nationalen Einheit um jeden Preis angesichts der Hauptbedrohung durch die Macht des zaristischen Despotismus, dessen Sieg, wie sie meinte, all die politischen und ökonomischen Errungenschaften rückgängig machen würde, welche die Arbeiterklasse durch Jahre geduldigen und zähen Kampfes erreicht hatte. Die SPD präsentierte sich also als legitimen Erben von Marx und Engels und deren resoluten Verteidigung all dessen, was progressiv war in der Europäischen Zivilisation.
Aber mit den Worten Lenins, eines anderen Revolutionärs, der nicht zögerte, den Verrat der „Sozialchauvinisten“ zu denunzieren: „Wer sich jetzt auf Marx’ Stellungnahme zu den Kriegen in der Epoche der fortschrittlichen Bourgeoisie beruft und Marx Worte „Die Arbeiter haben kein Vaterland“ vergisst – diese Worte die sich gerade auf die Epoche der reaktionären, überlebten Bourgeoise beziehen, auf die Epoche der sozialistischen Revolution – der fälscht Marx schamlos und ersetzt die sozialistische Auffassung durch die bürgerliche“<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]-->. Luxemburg argumentierte exakt gleich. Der Krieg war nicht von derselben Art Krieg wie ihn Europa in der Mitte des letzten Jahrhunderts erlebt hatte. Jene Kriege waren kurz, begrenzt im Raum und in ihren Zielen und wurden meist zwischen professionellen Armeen ausgefochten; und, was wichtiger ist, der europäische Kontinent erlebte seit dem Ende der napoleonischen Kriege 1815 eine noch nie dagewesene Ära des Friedens, der ökonomischen Expansion und eines stetigen Anstiegs des Lebensstandards. Hinzu kommt, dass jene Kriege, fern davon, ihre Antagonisten zu ruinieren, öfter dazu dienten, den Prozess der kapitalistischen Expansion zu beschleunigen, indem sie feudale Hindernisse der nationalen Einheit wegfegten und neuen Nationalstaaten erlaubten, sich als Rahmen geeignet für die Entwicklung des Kapitalismus zu konstituieren (die französischen Revolutionskriege und die Kriege zur Vereinigung Italiens sind klare Beispiele).
Solche Kriege – nationale Kriege, welche immer noch eine progressive Rolle für das Kapital selbst spielen konnten – gehörten der Vergangenheit an. Mit seiner mörderischen Zerstörungswut – 10 Millionen Menschen verschwanden auf den Schlachtfeldern Europas, beinahe alle von ihnen innerhalb eines blutigen und unnützen Patts; gleichzeitig starben Millionen von Zivilisten, vor allem als Resultat der Misere und des Hungers, welche der Krieg mit sich brachte. Mit dieser globalen Zerstörungswut als der eines Krieges zwischen weltumspannenden Imperien, und ebenso mit seinen praktisch unbegrenzten Zielen von Eroberung und totaler Niederlage des Feindes; mit seinem Charakter eines „totalen“ Krieges, welcher nicht nur Millionen von wehrpflichtigen Proletariern für die Front mobilisierte, sondern auch noch den Schweiß und das Blut von Millionen Arbeitern im Hinterland forderte, war dies ein Krieg neuen Typs, der die Vorhersagen der herrschenden Klasse zum Schweigen brachte, dass „alles an Weihnachten vorbei sei“. Das monströse Blutbad des Krieges wurde natürlich beträchtlich durch die hoch entwickelten technologischen Mittel der Kriegsparteien intensiviert, und die Tatsache, dass Letztere die Strategien und Taktiken klassischer Kriegsschulen längst überholt hatten, erhöhte die Abschlachtung noch weiter. Aber die Barbarei des Krieges widerspiegelte etwas viel tiefer Liegendes als die technologische Entwicklung des bürgerlichen Systems. Sie war ein Ausdruck einer Produktionsweise, welche in eine fundamentale historische Krise eintrat und damit die obsolete Natur der kapitalistischen sozialen Beziehungen enthüllte und die Menschheit vor die Alternative stellte: sozialistische Revolution oder Rückfall in die Barbarei. Daher eine der meist zitierten Passagen der Junius-Broschüre:
„Friedrich Engels sagte einmal: ‚Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma: entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei.‘ Was bedeutet ein ‚Rückfall in die Barbarei‘ auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges, und endgültig, wenn die nun begonnene -Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof. Oder Sieg des Sozialismus, das heißt der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder-Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats. Die Zukunft der Kultur und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert mit männlichem Entschluss in die Waagschale wirft.
In diesem Kriege hat der Imperialismus gesiegt. Sein blutiges Schwert des Völkermordes hat mit brutalem Übergewicht die Waagschale in den Abgrund des Jammers und der Schmach hinab gezogen. Der ganze Jammer und die ganze Schmach können nur dadurch aufgewogen werden, dass wir aus dem Kriege und im Kriege lernen, wie das Proletariat sich aus der Rolle eines Knechts in den Händen der herrschenden Klassen zum Herrn des eigenen Schicksals aufrafft.“
Diese epochale Wendung machte Marx’ Argumente für die Unterstützung nationaler Unabhängigkeit obsolet (welche er für die fortgeschrittenen europäischen Länder bereits nach der Pariser Kommune zu toten Buchstaben erklärte). Es konnte nicht mehr die Rede davon sein, sich die fortgeschrittenste Nation auszusuchen in diesem Konflikt, weil -nationale Konflikte selbst jegliche progressive Funktion verloren hatten und zu blossen Instrumenten imperialistischer Eroberung und des kapitalistischen Dranges zur Katastrophe wurden:
„Das nationale Programm hatte nur als -ideologischer Ausdruck der aufstrebenden, nach der Macht im Staate zielenden Bourgeoisie eine geschichtliche Rolle gespielt, bis sich die bürgerliche Klassenherrschaft in den Großstaaten Mitteleuropas schlecht und recht zurechtgesetzt, sich in ihnen die nötigen Werkzeuge und Bedingungen geschaffen hat.
Seitdem hat der Imperialismus das alte bürgerlich-demokratische Programm vollends zu Grabe getragen, indem er die Expansion über nationale Grenzen hinaus und ohne jede Rücksicht auf nationale Zusammenhänge zum Programm der Bourgeoisie aller Länder erhoben hat. Die nationale Phrase freilich ist geblieben. Ihr realer Inhalt, ihre Funktion ist aber in ihr Gegenteil verkehrt; sie fungiert nur noch als notdürftiger Deckmantel imperialistischer Bestrebungen und als Kampfschrei imperialistischer Rivalitäten, als einziges und letztes ideologisches Mittel, womit die Volksmassen für ihre Rolle des Kanonenfutters in den imperialistischen Kriegen eingefangen werden können.“
Nicht nur änderte sich die „nationale Taktik“ – auch alles andere wurde gründlich verändert durch den Krieg. Es gab kein Zurück mehr in die Epoche, wo die Sozialdemokratie geduldig und systematisch für seine Etablierung kämpfte, genauso wie das Proletariat in seiner Gesammtheit, das sich als organisierte Kraft innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft etabliert hatte.
„Eins ist sicher: der Weltkrieg ist eine Weltwende. Es ist ein törichter Wahn, sich die Dinge so vorzustellen, dass wir den Krieg nur zu überdauern brauchen, wie der Hase unter dem Strauch das Ende des Gewitters abwartet, um nachher munter wieder in alten Trott zu verfallen. Der Weltkrieg hat die Bedingungen unseres Kampfes verändert und uns selbst am meisten. Nicht als ob die Grundgesetze der kapitalistischen Entwicklung, der Krieg zwischen Kapital und Arbeit auf Tod und Leben eine Abweichung oder eine Milderung erfahren sollten. Schon jetzt, mitten im Kriege, fallen die Masken, und es grinsen uns die alten bekannten Züge an. Aber das Tempo der Entwicklung hat durch den Ausbruch des imperialistischen Vulkans einen gewaltigen Ruck erhalten, die Heftigkeit der Auseinandersetzungen im Schosse der Gesellschaft, die Grösse der Aufgaben, die vor dem sozialistischen Proletariat in unmittelbarer Nähe ragen – sie lassen alles bisherige in der Geschichte der Arbeiterbewegung als sanftes Idyll erscheinen.“ (Kapitel „Sozialismus oder Barbarei“)
Diese Aufgaben waren enorm, da sie mehr als nur die kurzsichtige Verteidigung gegen die Ausbeutung verlangten, sondern zu einem offensiven, revolutionären Kampf riefen, um die Ausbeutung ein für alle Mal zu beseitigen, um „im sozialen Leben des Menschen einen bewussten Gedanken zu etablieren, einen bestimmten Plan, den freien Willen der Menschheit“. Rosa Luxemburgs Bestehen auf der Eröffnung einer radikal neuen Epoche im Kampf der Arbeiterklasse wurde bald zu einer allseits anerkannten Richtlinie der internationalen revolutionären Bewegung, welche wieder auferstand von den Ruinen der So-
zialdemokratie und welche 1919 die Weltpartei der proletarischen Revolution gründete – die Kommunistische Internationale. An ihrem ersten Kongress in Moskau proklamierte die Komintern: „Eine neue Epoche ist geboren! Die Epoche des Zerfalls des Kapitalismus, seines inneren Kollapses. Die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats.“ Und sie ging genauso mit Luxemburg darin einig, dass wenn die proletarische Revolution – welche zu diesem Zeitpunkt ihren globalen Höhepunkt erreichte im Gefolge des Oktoberaufstandes in Russland und der revolutionären Welle, welche durch Deutschland, Ungarn und viele andere Länder rollte – den Kapitalismus nicht würde besiegen können, würde die Menschheit in einen weiteren Krieg gestürzt, in eine eigentliche Epoche nicht endenden Krieges, die die ganze Zukunft der menschlichen Kultur in Frage stellen würde.
Beinahe 100 Jahre später ist der Kapitalismus immer noch hier und ist, gemäß der offiziellen Propaganda, die einzig mögliche Form sozialer Organisation. Was wurde aus Luxemburgs Dilemma zwischen Sozialismus und Barbarei? Gemäß dem ideologischen Mainstream wurde der Sozialismus im
20. Jahrhundert ausprobiert und scheiterte. Die großen Hoffnungen, welche die Russische Revolution 1917 weckte, wurden zerschmettert im Stalinismus und zusammen mit dessen Opfern nach dem Kollaps des Ostblocks Ende der 1980er Jahre zu Grabe getragen. Nicht nur stellte sich der Sozialismus bestenfalls als Utopie und schlechtestenfalls als Alptraum dar. Sogar der Kampf der Arbeiterklasse, welcher für Marxisten dessen Grundlage war, verschwand in einem formlosen Nebel einer „neuen“ Form des Kapitalismus, gestützt nicht von einer ausgebeuteten Klasse von Produzenten, sondern von einer unendlichen Masse von Konsumenten und einer Ökonomie, welche oft eher virtuell denn materiell ist.
Das will man uns glauben machen. Ohne Zweifel wäre Luxemburg, könnte sie von den Toten wieder auferstehen, ziemlich überrascht, dass die kapitalistische Zivilisation den Planeten immer noch beherrscht. In einem weiteren Artikel werden wir die Mittel untersuchen, mit welchen sich das System trotz der Schwierigkeiten, mit welchen es im letzten Jahrhundert konfrontiert wurde, am Leben bleiben konnte. Aber wenn wir die verzerrende Brille der dominanten Ideologie wegwerfen und mit einem Minimum an Seriosität den Kurs betrachten, den das letzte Jahrhundert genommen hat, dann werden wir sehen, dass sich die Prognose Rosa Luxemburgs und der Mehrheit der damaligen revolutionären Sozialisten als richtig heraus stellte. Diese Epoche war – ohne den Sieg der proletarischen Revolution – bereits die barbarischste in der menschlichen Geschichte und birgt die Drohung eines noch tieferen Abstiegs in die Barbarei in sich, dessen letzte Konsequenz nicht nur der „Kollaps der Zivilisation“ sein könnte, sondern die Ausrottung menschlichen Lebens auf dem Planeten überhaupt.
Die Epoche der Kriege und Revolutionen
1915 war nur eine Minderheit der Sozialisten klar gegen den Krieg. Trotzki scherzte, dass die Internationalisten, welche sich in jenem Jahr in Zimmerwald trafen, alle in ein Taxi passen würden. Aber Zimmerwald selbst war ein Zeichen, dass sich etwas regte in der internationalen Arbeiterklasse. Die Unzufriedenheit mit dem Krieg, sowohl an, als auch hinter der Front, wurde immer offensichtlicher. Beweise dafür waren Streiks in Deutschland und England sowie die Arbeiterdemonstrationen in Deutschland zur Feier der Freilassung Karl Liebknechts, Luxemburgs Genosse, dessen Name zum Synonym für den Slogan „Der Hauptfeind steht im eigenen Land“ geworden war. Im Februar 1917 brach die Revolution aus in Russland und brachte die Herrschaft der Zaren an ihr Ende. Aber fern davon, ein russisches 1789, eine verspätete bürgerliche Revolution zu sein, machte der Februar nur den Weg für den Oktober frei: Die Machtübernahme der in Sowjets organisierten Arbeiterklasse und verkündete den ersten Schritt in Richtung Weltrevolution, welche nicht nur den Krieg sondern den Kapitalismus selbst beenden würde.
Die Russische Revolution steht oder fällt mit der Weltrevolution, wie Lenin und die Bolschewiki immer wieder unterstrichen. Und zuerst schien es, als würde ihr Ruf zu den Waffen beantwortet: Meutereien in der französischen Armee 1917 und die Revolution in Deutschland 1918 zwingen die bürgerlichen Regierungen der Welt zu einem hastigen Frieden um das Ausbreiten des bolschewistischen Geistes zu verhindern; Sowjetrepubliken entstehen 1919 in Bayern und Ungarn; Generalstreiks brechen aus in Seattle und Winnipeg; Panzer fahren auf als Antwort auf die Arbeiterunruhen in Clyde im selben Jahr; 1920 werden Fabriken besetzt in Italien. Das war eine offensichtliche Bestätigung der Ansicht der Komintern, dass die neue Ära eine Ära der Kriege und Revolutionen sein würde. Indem der Kapitalismus die Menschheit auf den Pfad von Zerstörung und Militarismus brachte, beförderte er auch die Notwendigkeit der proletarischen Revolution.
Aber das Bewusstsein der dynamischsten und weitsichtigsten Elemente der Arbeiterklasse, der Kommunisten, fällt selten zusammen mit dem Bewusststeinsniveau der Klasse als Ganzes. Die Mehrheit der Klasse verstand noch nicht, dass es kein zurück gab in die alte Ära der friedlichen, schrittweisen Reformen. Sie wollten zuallererst das Ende des Krieges und obwohl sie die Bourgeoisie dazu zwingen mussten, profitierte diese trotzdem von dem Gedanken, dass es möglich sei zum „Status quo ante bellum“ zurück zu kehren, wenn auch mit einigen als Errungenschaften der Arbeiter präsentierten Änderungen: In England kamen „homes fit for heroes“, das Frauenwahlrecht und die vierte Klausel im Labour-Programm, welche die Nationalisierung der Kommandohöhen der Wirtschaft versprach. In Deutschland, wo die Revolution bereits Form angenommen hatte, waren die Versprechungen radikaler. Ausdrücke wie Sozialisation und Arbeiterräte kamen ins Spiel, zusammen mit der Abdankung des Kaisers und der Gründung der Republik auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts.
Es waren fast ausschließlich die Sozialdemokraten, die deutsche „Arbeiterpartei“, diese vertrauenswürdigen Spezialisten des Reformismus, welche diese Illusionen an die Arbeiter verkauften. Illusionen, welche es ihnen ermöglichten zu behaupten, sie seien auf der Seite der Revolution, während sie Hand in Hand mit proto-faschistischen Banden die wahren Arbeiterrevolutionäre von Berlin und München massakrierten, inklusive Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Zur selben Zeit unterstützten die Sozialdemokraten die wirtschaftliche Strangulation und die militärische Offensive gegen die Sowjetmacht in Russland mit der trügerischen Rechtfertigung, dass die Bolschewiki den natürlichen Lauf der Geschichte untergruben, indem sie in einem rückständigen Land mit nur einer Minderheit von Arbeitern eine Revolution erzwungen hätten und so gegen die heiligen Prinzipien der Demokratie verstießen.
Zusammengefasst wurde die revolutionäre Welle mit einem Mix aus List und brutaler Repression in einer Serie separater Niederlagen zurück geschlagen. Abgeschnitten vom Sauerstoff der Weltrevolution, begann die Revolution in Russland zu ersticken und sich selbst aufzufressen. Die Vorgänge in Kronstadt, wo unzufriedene Arbeiter und Matrosen Neuwahlen für die Sowjets forderten und von der bolschewistischen Regierung zusammengeschossen wurden, stehen als Symbol für diese Wende. Der „Gewinner“ dieses Prozesses innerer Degeneration war Stalin und sein erstes Opfer die bolschewistische Partei selbst, endgültig und unwiderruflich transformiert in ein Instrument einer neuen Staats-Bourgeoisie, welche jegliche interna-tionalistischen Ambitionen zu Gunsten der betrügerischen Vorstellung eines „Sozialismus in einem Land“ aufgegeben hatte.
So überlebte der Kapitalismus also den Schock der revolutionären Welle, trotz der Nachbeben wie des Generalstreiks in England 1926 oder des Arbeiteraufstandes 1927 in Shanghai. Er gedachte fest, zur Normalität zurück zu kehren. Während des Krieges wurden die Prinzipien von Profit und Verlust temporär (und teilweise) ausgesetzt, als die ganze Produktion in die Kriegsmaschinerie gesteckt wurde und der Zentralstaat die Kontrolle über ganze Sektoren der Wirtschaft übernahm. In einem Report zuhanden des dritten Kongresses der Kommunistischen Internationale beschrieb Trotzki, wie der Krieg eine neue Funktionsweise für das kapitalistische System initiierte, welches hauptsächlich auf staatlicher Regulierung der Wirtschaft und der Generierung ganzer Berge von Schulden, von fiktivem Kapital, basierte: „Kapitalismus als ökonomisches System ist, das wissen sie, voller Widersprüche. Während der Kriegsjahre erreichten diese Widersprüche monströse Ausmaße. Um die für den Krieg nötigen Ressourcen zu bekommen, griff der Staat primär zu zwei Maßnahmen: Erstens, die Ausgabe von Papiergeld; Zweitens, das Ingangbringen von Anleihen. So trat eine immer größer werdende Anzahl so genannter „Wertpapiere“ (Sicherheiten) in die Zirkulation, während der Staat die realen Materialwerte aus dem Land schuf, um sie im Krieg zu zerstören. Umso größer die durch den Krieg verschlungenen Summen, desto größer der Umfang des Pseudo-Reichtums, der im Land akkumulierten fiktiven Werte. Staatsanleihen wuchsen ins Unermessliche. Oberflächlich konnte es scheinen, als sei das Land extrem reich geworden, aber in Wirklichkeit wurde der Boden unter der Wirtschaft weggezogen, wurde die Wirtschaft durchgeschüttelt und an den Rand des Kollapses gebracht. Staatsschulden kletterten auf ungefähr 1’000 Milliarden, die zu den ca. 62 Prozent, der nationalen Ressourcen, der kriegsführenden Ländern, hizukommen. Vor dem Krieg umfasste die weltweite Summe des Papier –und Kreditgeldes ungefähr 28 Milliarden Goldmark, heute zwischen 220 und 280 Milliarden, d.h. das Zehnfache. Und das noch ohne Russland, da wir nur über die kapitalistische Welt reden. All das gilt primär, wenn nicht ausschließlich, für die europäischen Länder, hauptsächlich Kontinentaleuropa und teilweise Zentraleuropa. Allgemein betrachtet hüllt sich Europa, ärmer und ärmer werdend – wie es bis zu diesem Tag geschieht –, in immer dickere Schichten von Papierwerten, oder anders gesagt, von fiktivem Kapital. Dieses fiktive Kapital – Papierwährung, Schatzbriefe, Kriegsanleihen, Bankanleihen und so weiter – repräsentierte entweder das Andenken toten Kapitals oder die Erwartung noch zu kommenden Kapitals. Aber zur gegenwärtigen Zeit entspricht es in keiner Weise real existierendem Kapital. Wie auch immer, es funktioniert als Geld und als Kapital und dies tendiert dazu, ein völlig verzerrtes Bild der Gesellschaft und der modernen Wirtschaft als Ganzes zu geben. Je ärmer diese Wirtschaft wird, umso reicher scheint das Bild im Spiegel dieses fiktiven Kapitals. Gleichzeitig bedeutet die Bildung dieses fiktiven Kapitals, wie wir sehen werden, dass die Klassen unterschiedlich in der Verteilung des graduell zusammengeschnürten Nationaleinkommens –und Vermögens Anteil nehmen. Das Nationaleinkommen wurde, genau wie das Nationalvermögen aber weniger stark, zusammengeschnürt. Die Erklärung dafür ist denkbar einfach: Die Kerze der kapitalistischen Wirtschaft wurde von beiden Seiten her abgebrannt.“
Solche Methoden waren ein Zeichen dafür, dass der Kapitalismus nur noch funktionieren konnte, indem er seiner eigenen Gesetze spottete. Die neuen Methoden wurden „Kriegssozialismus“ genannt, waren aber tatsächlich ein Instrument um den Kapitalismus am Leben zu erhalten in einer Ära, in welcher dieser bereits obsolet geworden war. Und somit waren diese Methoden eine verzweifelte Verteidigung gegen den Sozialismus, gegen den Aufstieg einer höheren sozialen Produktionsweise. Aber obwohl der „Kriegssozialismus“ als für den Sieg notwendig erachtet wurde, wurde er gleich danach umgehend demontiert.
Die Nachkriegsperiode bestätigte eine andere fundamental neue Charakteristik des imperialistischen Krieges. Während die Kriege des 19. Jahrhunderts ökonomisch normalerweise „Sinn machten“, also in einem Entwicklungsschub der Gewinnerseite resultierten, führten die gigantischen Materialkosten des Weltkrieges zu einer Schrumpfung, wenn nicht sogar zum totalen Ruin, der Wirtschaft sowohl des Gewinners als auch des Unterlegenen. Eine unstete Periode des Wiederaufbaus begann im kriegsversehrten Europa der frühen 20er Jahre, aber die Wirtschaft der alten Welt blieb träge: die spektakulären Wachstumsraten, welche die ersten kapitalistischen Länder vor dem Weltkrieg erreicht hatten, wurden nicht mehr erreicht. Arbeitslosigkeit wurde zu einem fixen Bestandteil der Wirtschaft in Ländern wie England, während die deutsche Wirtschaft, blankgescheuert von verwerflichen Reparationszahlungen, alle bisherigen Inflationsrekorde brach und nur noch durch Kredite flott gehalten wurde.
Die wichtigste Ausnahme war Amerika, welches während des Krieges prosperierte indem es, wie Trotzki es im selben Bericht nannte, den Quartiermeister Europas spielte. Es war nun definitiv die grösste Wirtschaftsmacht der Welt und profitierte genau davon, dass seine Rivalen von den gigantischen Kriegskosten, den sozialen Unruhen nach dem Krieg und dem effektiven Verschwinden des russischen Marktes zu Boden gedrückt wurden. Für Amerika war es das Zeitalter des Jazz, die goldenen Zwanziger: die Bilder der „Flapper“ und des in Henry Fords Fabriken massenproduzierten Modells T spiegelten die Realität der schwindelerregenden Wachstumsraten wider. Nachdem es das Ende der internen Expansion erreicht und von der Stagnation der alten europäischen Mächte profitiert hatte, überfielen amerikanisches Kapital und amerikanische Waren den Globus, überschwemmten sowohl Europa als auch die unterentwickelten und oft noch vorkapitalistischen Regionen. Vom Netto-Schuldner des 19. Jahrhunderts wurden die USA zum weltgrößten Kreditgeber – es waren hauptsächlich amerikanische Kredite, welche Deutschland auf den Beinen hielten in den 1920ern. Obwohl die US-Landwirtschaft zum großen Teil hinter dem Boom zurück blieb, gab es ein wahrnehmbares Wachstum der Konsumkraft der urbanen und proletarischen Bevölkerung. All das war offensichtlich der Beweis, dass man zum laissez-faire-Kapitalismus zurückkehren konnte, der im 19. Jahrhundert eine solch außergewöhnliche Expansion mit sich gebracht hatte. Die beruhigende Theorie von Calvin Coolidge hatte triumphiert. Und so wandte sich der Präsident im Dezember 1928 an den Kongress:
„Kein jemals zur Evaluation des „State of the Union“ zusammen gekommener Kongress der Vereinigten Staaten traf eine gefälligere Aussicht als jene, welche sich zur Zeit bietet. In der Innenpolitik herrscht Ruhe und Zufriedenheit, harmonische Beziehungen zwischen Management und Lohnempfängern, Freiheit von industriellem Hader und die höchstem Wachstumsraten seit Jahren. In der Außenpolitik herrscht Frieden, guter Wille zu gegenseitigem Verständnis und das Wissen, dass die kurz zuvor noch riesig erscheinenden Probleme zu einer echten Freundschaft führen. Der große Reichtum, der von unseren Unternehmungen und Industrie kreiert und von unserer Wirtschaft bewahrt wurde, fand die weiteste Verteilung unter unserem Volk und geht hinaus in einem stetigen Strom, um der Wohltätigkeit und der Wirtschaft der Welt zu dienen. Die Existenzgrundlagen gingen über den Standard der Notwendigkeit hinaus in die Sphäre des Luxus. Wachsende Produktion wird konsumiert von einer erhöhten Nachfrage im Innern und einem expandierenden Handel im Äußern. Das Land kann der Gegenwart mit Zufriedenheit und der Zukunft mit Optimismus entgegen schauen.“
Die berühmten letzten Worte! 1929 dann der Crash. Das fieberhafte Wachstum der US-Wirtschaft erreichte die Grenzen des Marktes und manche von jenen, welche an das unbegrenzte Wachstum, an ewige kapitalistische Märkte glaubten und all ihre Ersparnisse auf der Basis dieser Mythologie investierten, sprangen nun von Wolkenkratzern. Darüber hinaus war dies keine Krise wie diejenigen des 19. Jahrhunderts mit ihrer Regelmäßigkeit, dass es möglich wurde, von „Zehnjahreszyklen“ zu reden. In jener Zeit wurden nach einer kurzen Baisse neue Märkte auf der ganzen Welt gefunden und neue noch stärkere Wachstumsphasen setzten ein. Außerdem waren die Krisen der 1870er Jahre bis 1914, einer Zeit charakterisiert von beschleunigten imperialistischen Kämpfen zur Eroberung der noch verbleibenden nicht-kapitalistischen Regionen, bei weitem weniger gewaltig, obwohl sie das Zentrum des Systems betrafen, als diejenigen Krisen, welche den Kapitalismus in seiner Jugend trafen. Und das trotz des Geredes um die „große Depression“ der 1870er und 1890er Jahre, welche in gewissem Ausmaß das Ende der britischen Vorherrschaft über die Weltwirtschaft widerspiegelte.
Auf keinen Fall aber ist ein Vergleich möglich zwischen den ökonomischen Problemen des 19. Jahrhunderts und der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre. Es war ein qualitativ neues Level: die Bedingungen der kapitalistischen Akkumulation änderten sich fundamental. Es war eine weltweite Depression. Von ihrem Ausgangspunkt, den USA, traf sie das fast vollständig von Amerika abhängige Deutschland und das restliche Europa. Die Krise war ebenso zerstörerisch in den Kolonien oder semi-abhängigen Regionen, welche von ihren imperialistischen „Besitzern“ genötigt waren die Produkte zu produzieren, welche in den Metropolen nachgefragt wurden. Der plötzliche Sturz der Weltmarktpreise ruinierte die Mehrheit dieser Regionen.
Als Maßstab für das Ausmaß der Krise kann die Tatsache genommen werden, dass die Weltproduktion während des Ersten Weltkrieges um 10% sank, als Resultat der Krise jedoch um nicht weniger als 36.2%<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->. In den USA, welche stark vom Krieg profitiert hatten, fiel die industrielle Produktion um 53.8%. Schätzungen zur Arbeitslosigkeit variieren, aber nach Sternbergs Quellen waren es 40 Millionen in den wichtigen kapitalistischen Ländern. Der Rückgang des Welthandels war ähnlich katastrophal, er sank auf einen Drittel des vor-1929-Levels. Aber der hauptsächliche Unterschied zwischen der Weltwirtschaftskrise und den Krisen des 19. Jahrhunderts war, dass es keinen Automatismus mehr gab, der zu einem neuen Expansionszyklus in bisher nicht-kapitalistische Regionen des Globus geführt hätte. Die Bourgeoisie begriff bald, dass die „unsichtbare Hand“ des Marktes die Wirtschaft sobald nicht mehr heilen würde. Also musste sie den naiven Liberalismus eines Coolidge oder Hoover über Bord werfen und erkennen, dass der Staat fortan despotisch in die Wirtschaft würde eingreifen müssen, um das kapitalistische System zu bewahren. Diese Erkenntnis wurde hauptsächlich von Keynes in die Form einer Theorie gegossen. Keynes verstand, dass der Staat serbelnde Industrien aufpeppen musste und einen künstlichen Markt kreieren sollte, um die Unfähigkeit des Systems, sich neue Märkte zu erschliessen, zu kompensieren: das war die Bedeutung der massiven „öffentlichen Arbeiten“ von Roosevelts New Deal, der Unterstützung der neuen CIO Gewerkschaften zur Vereinfachung der Ankurbelung der Konsumnachfrage und so weiter. In Frankreich nahm die neue Politik die Form der Volksfront an. In Deutschland und Italien stand der Faschismus genauso für diese neu Politik wie in Russland der Stalinismus. Die zugrunde liegende Bedeutung war dieselbe. Die neue Epoche des Kapitalismus war die Epoche des Staatskapitalismus.
Aber Staatskapitalismus existiert in keinem Land isoliert vom Rest. Im Gegenteil ist er definiert durch die Notwendigkeit die nationale Wirtschaft in Konkurrenz mit anderen Nationen zu zentralisieren und zu verteidigen. In den 30ern hatte dies einen ökonomischen Aspekt – Protektionismus wurde als Mittel gesehen, die eigenen Märkte und Industrien gegen den Übergriff von Industrien und Märkten anderer Länder zu beschützen. Aber es hatte einen noch signifikanteren militärischen Aspekt, da die ökonomische Konkurrenz das Abgleiten in einen weiteren Weltkrieg beschleunigte. Staatskapitalismus ist in seiner Essenz eine Kriegsökonomie. Der Faschismus, welcher laut mit den Vorteilen des Krieges prahlte, war der offensichtlichste Ausdruck dieser Tendenz. Unter dem Hitlerregime reagierte das deutsche Kapital auf seine schwere wirtschaftliche Situation mit dem Einstieg in eine wahnsinnige Wiederaufrüstung. Dies hatte den „Vorteil“, die Arbeitslosigkeit rapide zu senken. Aber das war nicht das Ziel der Kriegsökonomie selbst; viel mehr war es ihr Ziel, sich auf eine neue gewalttätige Aufteilung der Märkte vorzubereiten. In ähnlicher Weise bereitete sich das stalinistische System in Russland mit seiner rücksichtslosen Unterordnung des proletarischen Lebensstandards unter die Produktion der Schwerindustrie darauf vor, eine militärische Macht zu werden, mit der man rechnen musste. Zusammen mit Nazideutschland und dem militaristischen Japan (welches schon mitten in einer militärischen Kampagne zur Eroberung der Mandschurei 1931 und des Restes von China 1937 stand) war der „Erfolg“ dieser Regime, der ökonomischen Krise zu entkommen, direkt verbunden mit ihrem Willen, alle Produktion den Bedürfnissen des Krieges zu unterordnen. Die Entwicklung einer Kriegswirtschaft war aber auch der wahre Hintergrund der massiven öffentlichen Programme in den Ländern des „New Deals“ und der Einheitsfront. Diese waren einfach um einiges langsamer darin, ihre Fabriken auf die massive Produktion von Waffen und Kriegsmaterial auszurichten.
Victor Serge beschrieb die Zeit der 30er Jahre einmal als „Mitternacht des Jahrhunderts“. Nicht weniger als der Erste Weltkrieg bewies die Krise von 1929 die Senilität der kapitalistischen Produktionsweise. Hier hatte man in einem viel größeren Ausmaß als im
19. Jahrhundert eine „Epidemie, welche in allen vorangegangenen Epochen absurd erschienen wäre – die Epidemie der Überproduktion“<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->. Millionen hungerten und wurden in eine erzwungene Untätigkeit geworfen. Nicht weil die Fabriken und Felder zu wenig produzierten, sondern weil „zu viel“ produzierten als dass es der Markt noch hätte absorbieren können. Es war eine weitere Bestätigung der Notwendigkeit der sozialistischen Revolution.
Aber der erste Versuch des Proletariats, die historische Notwendigkeit herbeizuführen, war in den späten 20ern definitiv besiegt und überall triumphierte die Konterrevolution. Diese erreichte die schrecklichste Ausprägung genau in den Ländern, in welchen die Revolution am weitesten gekommen war. In Russland nahm sie die Form der Arbeitslager und Massenexekutionen an; die Deportation ganzer Volksgruppen, vorsätzliches zu Tode Hungern von Millionen von Bauern; Stachanovsche Super-Ausbeutung in den Fabriken. Auf dem kulturellen Level nahm die Konterrevolution die Form der Zurückweisung all der sozialen und künstlerischen Experimente der frühen Revolutionsjahre und der Rückkehr zu höchst philisterhaften bürgerlichen Gewohnheiten und offiziell verfügtem realsozialistischem „Geschmack“ an.
In Deutschland und Italien war das Proletariat näher an der Revolution als in allen anderen europäischen Ländern. Die Konsequenz seiner Niederlage war die Errichtung brutalster Polizeiregime. Der Faschismus war eine weitgreifende Bürokratie von Informanten, eine barbarische Verfolgung von Dissidenten sowie sozialen und ethnischen Minderheiten. Darunter am prominentesten und hässlichsten vertreten, ist die Verfolgung der Juden in Deutschland. Das Naziregime zertrampelte Jahrhunderte von Kultur und wälzte sich in okkulten und pseudo-wissenschaftlichen Theorien über die zivilisierende Mission der arischen Rasse, verbrannte Bücher mit undeutschen Inhalten und verherrlichte die Tugenden von Blut, Boden und Eroberung. Trotzki sah die Zerstörung der Kultur in Deutschland als äußerst beredten Beweis für die Dekadenz der bürgerlichen Kultur an:
„Der Faschismus entdeckte den Bodensatz der Gesellschaft für die Politik. Nicht nur in den Bauernhäusern, sondern auch in den Wolkenkratzern der Städte lebt neben dem zwanzigsten Jahrhundert heute noch das zehnte oder zwölfte. Hunderte Millionen Menschen benutzen den elektrischen Strom, ohne aufzuhören, an die magische Kraft von Gesten und Beschwörungen zu glauben. Der römische Papst predigt durchs Radio vom Wunder der Verwandlung des Wassers in Wein. Kinostars laufen zur Wahrsagerin. Flugzeugführer, die wunderbare, vom Genie des Menschen erschaffene Mechanismen lenken, tragen unter dem Sweater Amulette. Was für unerschöpfliche Vorräte an Finsternis, Unwissenheit, Wildheit! Die Verzweiflung hat sie auf die Beine gebracht, der Faschismus wies ihnen die Richtung. All das, was bei ungehinderter Entwicklung der Gesellschaft vom nationalen Organismus als Kulturexkrement ausgeschieden werden mußte, kommt jetzt durch den Schlund hoch; die kapitalistische Zivilisation erbricht die unverdaute Barbarei. Das ist die Physiologie des Nationalsozialismus.“<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->
Aber genau weil der Faschismus der konzentrierte Ausdruck des Zerfalls des Kapitalismus war, war es ein purer Mythos zu denken, dass man den Faschismus bekämpfen könne, ohne den Kapitalismus anzugreifen, wie dies verschiedene „Anti-Faschisten“ dachten. Das zeigte sich sehr klar in Spanien 1936: Die Arbeiter von Barcelona antworteten auf den Staatsstreich des rechten Generals Franco mit ihren eigenen Methoden des Klassenkampfes – Generalstreik, Verbrüderung mit den Truppen, Bewaffnung der Arbeiter – und lähmten die faschistische Offensive innerhalb von Tagen. In dem Moment, in welchem sie ihren Kampf der demokratischen Bourgeoisie, der Volksfront, übergaben, waren sie verloren, wurden in einen zwischen-imperialistischen Wettbewerb gezwungen, welcher die Probe für ein noch größeres Massaker werden sollte. Wie die Italienische Linke nüchtern konstatierte, war der Krieg in Spanien eine schreckliche Bestätigung ihrer Prognose, dass das Weltproletariat besiegt war; und da das Proletariat das einzige Hindernis für den Kapitalismus auf seinem Weg in den Krieg war, standen die Tore nun weit offen für einen weiteren Weltkrieg.
Eine neue Stufe der Barbarei
Das Bild Guernica von Pablo Picasso ist berechtigterweise bekannt als bahnbrechende Darstellung des modernen Krieges. Die blinde Bombardierung der Bevölkerung dieser spanischen Stadt durch deutsche Flugzeuge die Francos Armee unterstützen war ein grosser Schock, denn es war ein relativ neues Phänomen. Die Bombardierung von zivilen Zielen aus der Luft war im Ersten Weltkrieg beschränkt und militärisch ineffektiv gewesen. Die grosse Mehrzahl der Gefallenen waren in diesem Krieg Soldaten auf den Schlachtfeldern. Der Zweite Weltkrieg zeigte, dass der niedergehende Kapitalismus seine Fähigkeit zur Barbarei steigerte, denn nun war die grosse Mehrheit der Gefallenen Zivilpersonen: „Die geschätzte Zahl der im Zweiten Weltkrieg umgekommenen Personen, unabhängig vom Kriegslager, belief sich auf etwa 72 Millionen. Die Anzahl Zivilpersonen betrug davon rund 42 Millionen, eingeschlossen der 20 Millionen durch Hunger und durch den Krieg hervorgerufene Krankheiten Umgekommene. Die militärischen Verluste beliefen sich auf rund 25 Millionen und ca. 5 Millionen Kriegsgefangene“<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]-->.
Der schrecklichste und konzentrierteste Ausdruck dieses Horrors war die industriell vollführte Ermordung von Millionen von Juden und anderen Minoritäten durch das Nazi-Regime. Sie wurden in Gruppen in den Ghettos und Wäldern Osteuropas erschossen, geknüppelt und zu Tode geschuftet als Sklavenarbeiter und zu Hundertausenden in den Lagern von Auschwitz, Bergen-Belsen und Treblinka vergast. Der Tod von Zivilpersonen durch die Bombardierung der Städte durch beide Kriegslager war nun Beweis, dass die systematische Ermordung von Unschuldigen die allgemeine Zukunft des Krieges darstellte. Auf dieser Ebene überrundeten die Demokratien die Abscheulichkeiten der faschistischen Staaten mit ihren Flächen- und Feuerbombardierungen deutscher und japanischer Städte und sie machten den deutschen „Blitzkrieg“ im Gegensatz dazu fast zu einem Amateurakt. Der symbolische Höhepunkt dieser neuen Methode der Massenschlächterei war die atomare Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki, doch was die Zahl der Opfer angeht waren die „konventionellen“ Bombardierungen von Tokio, Hamburg und Dresden noch tödlicher.
Der Einsatz von Atomwaffen durch die USA eröffnete auf zweierlei Weise eine neue Ära. Erstens bestätigte es, dass der Kapitalismus ein System des permanenten Krieges war. Auch wenn die Atombomben den endgültigen Kollaps der Achsenmächte noch besiegelten, so eröffneten sie gleichzeitig eine neue Kriegsfront. Das wirkliche Ziel von Hiroshima war nicht Japan, das schon in den Knien war und einen Friedensvertrag ersuchte, sondern die UdSSR. Es war eine Warnung an Russland seine imperialistischen Ambitionen im Fernen Osten und in Europa zu mässigen. Denn, „die amerikanische Staatsspitze erarbeitete einen Plan, nach dem die 20 grössten sowjetischen Städte in den ersten 10 Wochen nach dem Krieg mit Atombomben zerstört werden konnten“<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->. Oder in anderen Worten ausgedrückt, die Atombomben wurden zu Ende des Zweiten Weltkrieges nur deshalb eingesetzt um die Frontlinien für einen dritten zu diktieren. Es füllte die Warnung Rosa Luxemburgs über die „letzten Konsequenzen“ des Zeitalters des unbegrenzten Krieges mit einer neuen und beängstigenden Realität. Die Atombomben demonstrierten die Fähigkeit des kapitalistischen Systems das Leben auf diesem Planeten auszulöschen.
Die Jahre zwischen 1914 und 1945, die Hobsbawm als das „Zeitalter der Katastrophe“ beschrieb, waren eine klare Bestätigung der Diagnose, dass der Kapitalismus ein dekadentes soziales System geworden war, so wie das alte Rom oder der Feudalismus. Die Revolutionäre welche die Verfolgungen und Demoralisierungen der 30er und 40er Jahre überlebt hatten und vor und während des Krieges für internationalistische Prinzipien gegen beide Kriegslager eintraten, waren nur eine Handvoll. Doch für die meisten von ihnen war es ein absolutes Prinzip. Zwei Weltkriege, die unmittelbare Gefahr eines dritten, sowie eine Erfahrung einer ökonomischen Krise von unglaublichem Ausmass schienen es für sie für immer bestätigt zu haben.
In den folgenden Jahrzehnten kamen aber dennoch Zweifel auf. Das Weiterbestehen des Kapitalismus beutete jetzt, dass die Menschheit unter einer permanenten Zerstörung leben musste. Die darauf folgenden 40 Jahre waren geprägt durch einen nie endenden Konflikt und eine Feindschaft zwischen den beiden neuen imperialistischen Blöcken, auch wenn sie nicht direkt einen dritten Weltkrieg entfachten. Eine ganze Serie von Stellvertreterkriegen im Mittleren- und Fernen Osten und in Afrika brach aus, und sie brachten die Welt verschiedentlich an den Rand einer Katastrophe, besonders während der kubanischen Raketenkrise 1962. Nach offiziellen Schätzungen starben in all diesen Kriegen mehr als 20 Millionen Menschen, oft werden auch mehr angegeben.
Diese Kriege spielten sich in den unterentwickelten Teilen der Erde ab und in den Nachkriegszeiten litt die Bevölkerung unter massiver Armut und Unterernährung. In den mächtigsten westlichen kapitalistischen Ländern fand ein spektakulärer Boom statt, den die bürgerlichen Experten rückblickend „Die Jahre des Wirtschaftswunders“ nannten. Die Wachstumsraten erreichten oder übertrafen oft sogar diejenigen des 19. Jahrhunderts, die Löhne stiegen, Sozialeinrichtungen und Krankenversorgung wurden unter der Ägide des Wohlfahrtsstaates eingeführt… 1960 gab in England Premierminister Harold Macmillan der Arbeiterklasse bekannt, dass „sie es noch nie so gut gehabt habe“. Die Soziologen entwickelten neue Theorien über den Eintritt des Kapitalismus in die „Konsumgesellschaft“ in der die Arbeiterklasse „verbürgerlicht“ sei durch eine niemals endende Wohlstandsflut von Fernsehern, Waschmaschinen, Autos und Ferienangeboten. Für viele, eingeschlossen einige aus dem Lager der revolutionären Bewegung, schien diese Periode zu bestätigen, dass die Auffassung eines Eintritts des Kapitalismus in seine Dekadenz nicht mehr gültig sei und es schien als Beweis eines fast unlimitierten Wachstums des Kapitalismus. „Radikale“ Theoretiker wie Marcuse begannen sich anderswo als bei der Arbeiterklasse nach einem revolutionären Subjekt umzusehen – bei den Bauern der Dritten Welt oder den rebellierenden Studenten der kapitalistischen Grossstädte.
Eine Gesellschaft im Zerfall
Wir werden noch auf eine genauere Erklärung dieses Nachkriegsbooms zurückkommen, indem wir die Mittel des dekadenten Kapitalismus untersuchen, die er zur Besänftigung der unmittelbaren Konsequenzen seiner Widersprüche ergreift. Wie auch immer, diejenigen die meinten, dass der Kapitalismus seine Widersprüche abschaffen kann, wurden Ende der 1960er Jahre als oberflächliche Empiriker entlarvt, denn damals tauchten die ersten klaren Symptome einer neuen ökonomischen Krise in den westlichen Ländern auf. Mitte der 1970er Jahre wurde die Geschichte handfest: Die Inflation begann die meisten Ökonomien zu bedrängen und führte zu einer Abkehr von den keynesianistischen Methoden des direkten Einsatzes der Staatsmacht zur Steuerung der Wirtschaft, wie es in den vorangegangenen Jahrzehnten gut gewirkt hatte. Die 80er Jahre waren die Jahre des Thatcher- und Reaganismus, die grundsätzlich beinhalteten, dass die Krise sich selber überlassen wurde und die schwächsten Unternehmen verschwinden mussten. Die Inflation wurde durch die Rezession kuriert. Seither erlebten wir verschiedene Mini-Booms und Mini-Rezessionen und die Ideologie des Thatcherismus lebt in der Form des Neo-Liberalismus und der Privatisierungen weiter. Doch hinter all den Sprüchen über ein Zurück zu den ökonomischen Werten des freien Unternehmertums der Zeit von Königin Victoria bleibt die Rolle des Staates so bestimmend wie immer. Er manipuliert das wirtschaftliche Wachstum mit allen möglichen finanziellen Manövern die auf einem anwachsenden Berg von Schulden beruhen. Dies wird vor allem in den USA ersichtlich, deren weltweite Macht vom Wechsel von einem Geber- zu einem Schuldnerstaat begleitet wurde und das heute unter Rund 36’000 Milliarden Dollar Schulden leidet<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->. „Dieser Schuldenberg stellt nicht nur in Japan, sondern auch in den anderen entwickelten Ländern ein potenziell destabilisierendes Pulverfass dar. Eine grobe Schätzung der weltweiten Verschuldung der Gesamtheit aller Wirtschaftsakteure (Staaten, Unternehmen, Haushalte, Banken) schwankt zwischen 200 und 300% des Weltsozialprodukts. Das bedeutet konkret zweierlei Dinge: Einerseits hat das System ein monetäres Äquivalent im Umfang des zwei- bis dreifachen Wertes der gesamten globalen Produktion vorgeschossen, um der drückenden Überproduktion entgegenzutreten; anderseits müsste man zwei bis drei Jahre gratis arbeiten, um diese Schulden zu begleichen. Eine solch massive Verschuldung können die entwickelten Ökonomien heute noch ertragen, die „aufstrebenden“ Länder hingegen drohen eines nach dem anderen daran zu ersticken. Diese auf Weltebene phänomenale Verschuldung ist historisch beispiellos und drückt gleichzeitig sowohl die Tiefe der Ausweglosigkeit aus, in der sich der Kapitalismus befindet, als auch seine Fähigkeit zur Manipulation des Wertgesetzes, um die Zahlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.“<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->
Während uns die Bourgeoisie glauben machen will, wir sollten doch Vertrauen haben in ihre Bluffs wie die „Computer-Ökonomie“ oder andere „technologische Revolutionen“, erzeugt die Abhängigkeit der Weltwirtschaft von den Schulden unterirdische Probleme welche in der Zukunft unweigerlich gewaltige Eruptionen hervorbringen werden. Wir haben das immer wieder gesehen. Die 1997 in die Knie gegangenen asiatischen „Tiger- und Drachenstaaten“ waren wohl das deutlichste Beispiel. Doch heute wird wiederum behauptet, dass die spektakulären Wachstumszahlen Chinas und Indiens den Weg in die Zukunft bedeuten würden. Doch im selben Atemzug kommt schon die Angst über ein eventuelles Scheitern zum Vorschein. Chinas Wachstum basiert vor allem auf billigen Exporten in den Westen und die Konsumfähigkeit des Westens basiert auf einer massiven Verschuldung… Was also geschieht wenn die Schulden zurückgefordert werden? Hinter dem durch Schulden ermöglichten Wachstum der letzten zwei Jahrzehnte ist die Empfindlichkeit der ganzen Geschichte an einigen seiner negativen Aspekte offen zu erkennen: die Desindustrialisierung ganzer Gebiete der westlichen Ökonomien, die eine Reihe von unproduktiven und oft prekären Arbeitsplätzen hervorbringt, welche immer mehr mit den parasitären Gebieten der Wirtschaft verhängt sind; die zunehmende Armutsschere nicht nur zwischen den zentralen kapitalistischen Ländern und den ärmsten Region, sondern auch innerhalb der entwickeltsten Ökonomien; die Unfähigkeit die permanente Massenarbeitslosigkeit zu beheben, welche mit statistischen Tricks verschleiert wird (Umschulungsprogramme die nirgendwohin führen oder die andauernde Neudefinition von Arbeitslosigkeit, usw.).
Auf der ökonomischen Ebene hat der Kapitalismus also keineswegs seine Tendenz hin zur Katastrophe überwunden. Dasselbe gilt für die imperialistischen Konflikte. Als der Ostblock zu Ende der 1980er Jahre kollabierte, das dramatische Ende von vier Jahrzehnten „Kalter Krieg“, kündigte der damalige US-Präsident Bush Senior großartig den Beginn einer neuen Weltordnung des Friedens und des Wachstums an. Doch weil der dekadente Kapitalismus permanenter Krieg bedeutet, können imperialistische Konflikte ihr Gesicht ändern, doch sie können nicht verschwinden. Wir sahen dies 1945 und ebenfalls 1991. Anstelle relativ „disziplinierter“ Konflikte zwischen zwei Blöcken existieren heute die zunehmend chaotischen Kriege des „Jeder gegen Jeden“. Die einzig übrig gebliebene Supermacht USA ist mehr und mehr gezwungen sich in militärische Wagnisse zu stürzen, um ihre schwindende Autorität zu sichern. Doch immer wenn die USA die Karte der militärischen Überlegenheit auszuspielen versucht, führt dies zu einer Verstärkung des Widerstandes dagegen. Dies war der Fall nach dem ersten Golfkrieg 1991. Auch wenn die ehemaligen Alliierten Deutschland und Frankreich gezwungen waren für eine beschränkte Zeit den Feldzug gegen Saddam Hussein zu unterstützen, so wurde es innert weniger Jahre offensichtlich, wie die alte Blockdisziplin für immer zerfiel. In den Kriegen auf dem Balkan führten zuerst Deutschland (mit seiner Unterstützung für Kroatien und Slowenien) und dann Frankreich (durch seine permanente Unterstützung für Serbien, während die USA begann Bosnien den Rücken zu stärken) einen Stellvertreterkrieg gegen die USA. Selbst England, der „Handlanger“ der USA, befand sich auf der anderen Seite, indem es Serbien so lange unterstützte, bis es am Ende die amerikanischen Bombardierungen Serbiens nicht mehr verhindern konnte. Der gegenwärtige „Krieg gegen den Terrorismus“ – ausgelöst durch die Zerstörung der Twin Towers durch ein Selbstmordkommando am 11. September 2001 (welches eventuell sogar durch den amerikanischen Staat manipuliert wurde), ein weiteres Zeugnis der heutigen Barbarei – hat diese Differenzen noch vertieft. Frankreich, Deutschland und Russland formierten eine Koalition gegen die Eröffnung des Krieges im Irak. Und die Konsequenzen der Invasion von 2003 sind schlimmer als je gedacht. Weit davon entfernt die Kontrolle der USA im Mittleren Osten zu festigen und damit die „allgegenwärtige Dominanz“, von der die Neo-Konservativen und die Bush-Administration träumten, hat die Invasion die gesamte Region in ein Chaos gestürzt und auch eine zunehmende Instabilität in Israel/Palästina, Libanon, Iran, Türkei, Afghanistan und Pakistan mit sich gebracht. In der Zwischenzeit wurde das imperialistische Gleichgewicht durch das Auftauchen von Indien und Pakistan als Atommächte verändert. Und auch der Iran, der durch den Zerfall seines großen Rivalen Irak seine imperialistischen Ambitionen verstärkt sieht, wird diesen Schritt eventuell bald machen. Das imperialistische Gleichgewicht wurde auch aus den alten Fugen gebracht durch das erneute rivalisierende Auftreten Russlands gegenüber seinen westlichen Konkurrenten, durch Chinas wachsendes Gewicht weltweit, durch die Vermehrung der so genannten „Schurkenstaaten“ im Mittleren- und Fernen-Osten und in Afrika und die Ausbreitung des Terrorismus im Namen des Islams (der oft im Dienste großer imperialistischer Staaten steht, aber auch als unberechenbarer Faktor für sich selber agiert). Die Welt ist seit dem Ende des Kalten Krieges nur zunehmend gefährlicher geworden.
Während des gesamten 20. Jahrhunderts war man sich schon der Gefahr der ökonomischen Krisen und der imperialistischen Kriege für die Menschheit bewusst. Doch in den letzten Jahrzehnten wurde eine dritte Dimension des kapitalistischen Desasters augenscheinlich: die ökologische Zerstörung. Die kapitalistische Produktionsweise, gekennzeichnet durch die irrwitzige Konkurrenz um die letzten Marktanteile, dehnte sich in jede Ecke des Planeten aus, um alle Ressourcen auszuplündern, koste es was es wolle. Das gepriesene „Wachstum“ ist mehr und mehr wie ein Krebsgeschwür, das an der Welt haftet. In den letzten zwei Jahrzehnten rückte dieses Problem zunehmend in das öffentliche Bewusstsein, denn was wir heute sehen ist das Resultat eines schon lange andauernden Prozesses und das ökologische Problem steigert sich heute auf eine höhere Stufe. Die Verschmutzung der Luft, der Flüsse und der Meere durch industrielle Emissionen und den Warentransport, die Zerstörung der Regenwälder und anderer Naturgebiete, die Ausrottung unzähliger Tierarten, sind heute alarmierend. Sie kommen zusammen mit dem Klimawandel, der zunehmende Überschwemmungen ganzer Gebiete der Menschheit erzeugt und Dürren, Hunger und Seuchen auslöst. Der Klimawandel selber kann eine Spirale von Katastrophen auslösen, wie es unter anderem der gerühmte Physiker Stephen Hawking beschrieb. In einem ABC-News Interview erklärte er im August 2006: „Es besteht die Gefahr einer Rückkoppelung der globalen Erwärmung, wenn dies nicht bereits schon der Fall ist. Das Abschmelzen des arktischen und antarktischen Eises reduziert den Anteil der Sonnenenergie welche in die Atmosphäre zurückgestrahlt wird, und dies erhöht erneut die Temperatur. Der Klimawandel kann den Amazonas und andere Regenwälder zerstören und damit einen der einzigen Wege eliminieren auf dem CO2 aus der Atmosphäre absorbiert wird. Der Anstieg der Meerestemperatur kann die Freisetzung großer Mengen von Methan bewirken, welche in Form von Hydraten auf dem Meeresboden gebunden sind. Diese Phänomene verstärken den Treibhauseffekt und damit die globale Erwärmung. Wir müssen die globale Erwärmung sofort stoppen, falls dies überhaupt noch möglich ist.“
Die Dynamiken des ökonomischen, militärischen und ökologischen Kollapses sind nicht getrennt – sie haben einen engen Zusammenhang. Kapitalistische Länder, die mit dem wirtschaftlichen Ruin und ökologischen Katastrophen konfrontiert sind, werden ihren Absturz nicht friedlich hinnehmen, sondern nach militärischen Lösungen auf Kosten der Nachbarn suchen.
Es stellt sich für uns heute mehr denn je die Alternative „Sozialismus oder Barbarei“. Und wenn nach den Worten Rosa Luxemburgs der Erste Weltkrieg schon die Barbarei war, so besteht heute die Gefahr, dass die Menschheit und im speziellen ihre einzige Kraft, die sie retten kann, das Proletariat, in den weltweiten Strudel der Barbarei gerissen wird bevor es seine Lösung durchsetzen kann.
Das ökologische Desaster zeigt dies deutlich auf. Der Kampf der Arbeiterklasse kann darauf kaum einen Einfluss haben, bevor das Proletariat die Macht ergriffen hat und in der Lage ist die Produktion und den Verbrauch auf Weltebene anders zu organisieren. Je länger eine Revolution hinausgezögert wird, desto größer ist die Gefahr, dass die Zerstörung der Umwelt die Grundlagen für eine kommunistische Umwälzung zunichte macht. Dasselbe gilt für die sozialen Auswirkungen der heutigen Phase der Dekadenz. In den Städten gibt es eine wachsende Tendenz hin zum Verlust der Klassenidentität als Arbeiterklasse. Die junge Generation ist mit dem Problem, Opfer der Gangmentalität zu werden konfrontiert, mit irrationalen Ideologien und nihilistischer Hoffnungslosigkeit. Und auch hier besteht die Gefahr, dass es für die Arbeiterklasse einmal zu spät sein kann, sich als revolutionäre soziale Kraft zu formieren.
Die Arbeiterklasse darf ihr wirkliches Potential nie vergessen. Die herrschende Klasse war sich darüber immer sehr bewusst. In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg wartete die Bourgeoisie ängstlich auf die Antwort der Sozialdemokratie, denn sie wusste genau, dass sie ohne deren aktive Unterstützung die Arbeiter nicht in den Krieg mobilisieren konnte. Diese ideologische Niederlage, welche von Rosa Luxemburg angeprangert wurde, war die unabdingbare Bedingung zur Auslösung des Krieges. Erst das erneute Erwachen der Arbeiterklasse ab 1916 beendete den Krieg schließlich wieder. Umgekehrt war es die Niederlage und die Demoralisierung nach dem Zurückfluten der weltrevolutionären Welle, welche den Weg hin zum Zweiten Weltkrieg ebnete und es bedurfte einer langen Periode der Repression und ideologischen Vergiftung, bis sich die Arbeiterklasse in die zweite weltweite Schlächterei treiben ließ. Die herrschende Klasse war sich damals auch der Notwendigkeit von Präventivschlägen gegen die Gefahr einer Wiederholung der Revolution von 1917 und einer Kriegsbeendigung durch das Proletariat bestens bewusst. Dieses „Klassenbewusstsein“ der Bourgeoisie wurde vor allem durch den sog. „Größten aller Briten“, Winston Churchill, repräsentiert, welcher gut aus seiner Erfahrung bei der Zerschlagung der Gefahr des Bolschewismus von 1917-1920 gelernt hatte. Nach den Massenstreiks der Arbeiter in Norditalien 1943 war es Churchill, der die Leitlinie formulierte „die Italiener in ihrem eigenen Saft schmoren zu lassen“. Dazu wurde das Vorrücken der Alliierten von Süd- nach Norditalien verzögert, um den Nazis die Niederschlagung der italienischen Arbeiter zu erlauben. Churchill verstand auch am besten die Absicht der grauenvollen Bombardierungen Deutschlands in der letzten Phase des Krieges: es ging darum, jegliche Gefahr einer Revolution im Keim zu ersticken, dort wo die Bourgeoisie am meisten Angst davor hatte.
Die weltweite Niederlage und die Konterevolution dauerten vier Jahrzehnte an. Doch bedeutete es nicht das Ende des Klassenkampfes, wie gewisse Leute zu behaupten begannen. Mit dem erneuten Ausbruch der Krise zu Ende der 1960er Jahre begann auch eine neue Generation von Arbeitern für ihre Interessen zu kämpfen. Die „Ereignisse“ des Mai 68, offiziell als „Studentenrevolte“ bekannt, brachten den französischen Staat nur deshalb ins Zittern, weil die Revolte in den Universitäten durch den größten Massenstreik begleitet wurde, den die Geschichte bis dahin gesehen hatte. In den darauf folgenden Jahren erlebten Italien, Argentinien, Polen, Spanien, England und viele andere Länder große Mobilisierungen der Arbeiterklasse, welche oft die „offiziellen Vertreter der Arbeit“, die Gewerkschaften und linken Parteien, im Regen stehen ließen. „Wilde“ Streiks wurden zur Tagesordnung gegen die „disziplinierten“ Mobilisierungen der Gewerkschaften. Arbeiter begannen neue Formen des Kampfes zu entwickeln um dem erstickenden Schema der Gewerkschaften zu entfliehen: Vollversammlungen, selbst gewählte Streikkomitees und die Entsendung von großen Delegationen in andere Betriebe. In den mächtigen Streiks von 1980 in Polen verwendeten die Arbeiter diese Mittel, um ihren Kampf über das ganze Land hinweg zu koordinieren.
Was die unmittelbaren Forderungen angeht, endeten die Kämpfe in den Jahren zwischen 1968 und 1989 oft in Niederlagen. Doch ohne Zweifel, wenn sie nicht stattgefunden hätten, wäre der herrschenden Klasse noch viel mehr Spielraum für Angriffe auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse offen geblieben, dies besonders in den am höchsten entwickelten Ländern. Der Widerstand der Arbeiterklasse, alle Auswirkungen der kapitalistischen Krise ausbaden zu müssen, bedeutete aber auch eine Ablehnung gegen die Mobilisierung in einen neuen Krieg. Denn das Wiederauftauchen der Krise bedeutete ab den 70er Jahren, und noch mehr in den 80er Jahren, eine deutliche Verschärfung der imperialistischen Spannungen zwischen den beiden Blöcken. Der imperialistische Krieg ist untrennbar von der ökonomischen Krise des Systems, auch wenn der Krieg keine „Lösung“ für die Krise bringt, sondern nur einen noch größeren Ruin. Doch um einen Krieg direkt gegen die Hauptgegner führen zu können, braucht die herrschende Klasse einen Verbündeten in Form eines ideologisch unterworfenen Proletariates, und dies hatte sie damals nicht. Dies zeigte sich am deutlichsten im damaligen Ostblock: Die russische Bourgeoisie, am heftigsten zur Suche nach einer militärischen Lösung ihres ökonomischen Kollapses und der zunehmenden militärischen Umzingelung gedrängt, musste einsehen, dass sie ihre Arbeiterklasse nicht als Kanonenfutter in einen Krieg gegen den Westen führen konnte. Die Massenstreiks in Polen 1980 waren ein klares Signal dafür. Es war diese Sackgasse, welche 1989-91 zum Zusammenbruch des Ostblocks führte.
Das Proletariat selber war aber auch nicht in der Lage seine eigene Lösung gegenüber all den Widersprüchen des Kapitalismus durchzusetzen: Die Perspektive einer neuen Gesellschaft. Gewiss, der Mai 68 brachte diese Frage massiv aufs Tapet und erzeugte eine neue Generation von Revolutionären. Diese blieben aber eine verschwindend kleine Minderheit. Angesichts der Zuspitzung der ökonomischen Krise blieben die meisten Kämpfe der 1970er und 80er Jahre aber auf einem Niveau der Defensive und auf der Ebene der wirtschaftlichen Forderungen stehen. Zugleich hatten Jahrzehnte von Enttäuschungen über die „traditionellen“ linken Parteien in den Reihen der Arbeiterklasse ein tiefes Misstrauen gegenüber jeglicher „Politik“ erzeugt.
Damit entstand eine Art Blockade im Klassenkampf: Die Bourgeoisie hat der Menschheit keine Perspektive mehr anzubieten und das Proletariat hat seine eigene Zukunft noch nicht wieder entdeckt. Doch die Krise des Systems steht nicht still und das Resultat dieser Blockade ist ein Zerfall der Gesellschaft auf allen Ebenen. Auf der imperialistischen Ebene äußerte sich dies Ende der 1980er Jahre in der Auflösung der zwei Blöcke und damit rückte die Gefahr eines Weltkriegs zwischen großen Blöcken für unbestimmte Zeit in den Hintergrund. Wie wir aber sehen, setzt dies das Proletariat und die gesamte Menschheit einer neuen Gefahr aus, einer schleichenden Barbarei, die in vielen Belangen heimtückischer ist.
Die Menschheit befindet sich an einem Scheidepunkt. Die Jahre und Jahrzehnte vor uns können die wegweisendsten der Geschichte sein. Sie werden darüber entscheiden, ob die menschliche Gesellschaft in einen unaufhaltbaren Rückschritt oder gar einen Untergang eintritt, oder ob sie den Schritt auf eine neue Stufe der Entwicklung schafft, in der die Menschheit wenigstens in der Lage ist, die eigenen sozialen Kräfte zu kontrollieren. Wo sie fähig wird eine Welt zu schaffen, welche in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Menschheit steht.
Es ist unsere Überzeugung als Kommunisten, dass es für die zweite Alternative noch nicht zu spät ist und dass die Arbeiterklasse trotz all der materiellen und ideologischen Angriffe, unter denen sie in den letzten Jahrzehnten gelitten hat noch fähig ist zu widerstehen. Sie ist die einzige Klasse, welche dem Abgleiten in den Abgrund entgegentreten kann. Seit 2003 gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung von Arbeiterkämpfen auf der ganzen Welt. Gleichzeitig erleben wir das Auftauchen einer neuen Generation von Gruppen und Einzelpersonen, welche das heutige System grundlegend in Frage stellen und gewissenhaft nach einem fundamentalen sozialen Wechsel streben. Mit anderen Worten: wir sehen greifbare Anzeichen einer Reifung des Klassenbewusstseins.
Gerrard
<!--[endif]-->[1]<!--[endif]--> Lenin: Sozialismus und Krieg, Kapitel 1, „Falsche Berufungen auf Marx und Engels“, 1915.
Der Kommunismus: Der Beginn der wirklichen Geschichte der Menschheit
- 2971 Aufrufe
Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee, sondern er steht auf der Tagesordnung der Geschichte
Der folgende Artikel ist der 3. Teil der Zusammenfassung unserer bisher in der International Review erschienen Artikelserie zum Thema Kommunismus. Die ersten beiden Teile erschienen auf unserer Webseite und in der Internationalen Revue Nr. 40 + 41 auf Deutsch.
Im zweiten Teil unserer Zusammenfassung untersuchten wir, wie das kommunistische Programm durch die großen Fortschritte bereichert wurde, die die Arbeiterbewegung während der Welle revolutionärer Kämpfe gemacht hatte, welche durch den I. Weltkrieg hervorgerufen worden war. In diesem dritten Teil werden wir untersuchen, wie die Revolutionäre sich darum bemühten, den Rückfluss und die Niederlage der revolutionären Welle zu begreifen. Wir werden dabei aufzeigen, dass diese Phase auch eine Quelle unschätzbar wichtiger Lehren für die zukünftigen Revolutionen darstellt.
1. 1918: Die Revolution kritisiert ihre Fehler(International Review Nr. 99)
Da die Russische Revolution, wie Rosa Luxemburg sagte, „die allererste Erfahrung der Diktatur des Proletariats in der Geschichte der Welt ist“, muss folglich jeder Versuch, den Weg zu einer künftigen Revolution zu bahnen, auf die Lehren zurückgreifen, die aus dieser Erfahrung hervorgingen. Eingedenk der Tatsache, dass die proletarische Bewegung nur Schaden erleiden kann, wenn sie versucht, vor der Wirklichkeit zu fliehen, gingen die Bemühungen, diese Lehren zu begreifen, auf die ersten Tage der Revolution selbst zurück, auch wenn es mehrere Jahre schmerzhafter Erfahrungen und ebenso quälender Überlegungen brauchte, um das Erbe der Russischen Revolution umfassend zu begreifen.
Die Vorlage zur Analyse der Fehler der Revolution wurde von Rosa Luxemburg in ihrer Broschüre „Zur Russischen Revolution“ geliefert, die sie 1918 im Gefängnis niederschrieb. Luxemburgs Ausgangspunkt war die grundsätzliche Solidarität mit der Sowjetmacht und der bolschewistischen Partei. Sie erkannte, dass die Schwierigkeiten, vor denen beide standen, zuallererst das Ergebnis der Isolation der russischen Bastion waren und dass sie nur überwunden werden konnten, wenn das Weltproletariat – insbesondere das deutsche Proletariat – seine Verantwortung übernahm und das Urteil der Geschichte über den Kapitalismus vollstreckte.
Innerhalb dieses Rahmens kritisierte Luxemburg die Bolschewiki in drei Bereichen:
– in der Landfrage: Auch wenn sie anerkannte, dass die bolschewistische Parole: „Das Land den Bauern“ taktisch notwendig war, um die Bauernmassen für die Sache der Revolution zu gewinnen, war Luxemburg der Auffassung, dass die Bolschewiki ihre eigenen Schwierigkeiten noch vergrößerten, als sie die Aufteilung des Landes in Parzellen formalisierten. Aber auch wenn Luxemburg richtig vorhersah, dass dieser Prozess schlussendlich eine konservative Schicht von kleinen Landbesitzern hervorbringen würde, war ebenso klar, dass die Kollektivierung des Bodens als solche keine Garantie für eine Bewegung hin zum Sozialismus war, solange die Revolution isoliert blieb.
– in der nationalen Frage: Luxemburgs Kritik an der Parole der nationalen Selbstbestimmung (die von Pjatakow und anderen innerhalb der bolschewistischen Partei vertreten wurde) wurde durch die späteren Erfahrungen vollauf bestätigt. In Wirklichkeit kann „nationale“ Selbstbestimmung nur „Selbstbestimmung“ für die Bourgeoisie bedeuten. Doch in der Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution entschieden sich all die Länder (d.h. die Bourgeoisien), die von der Sowjetmacht in die „nationale Unabhängigkeit“ entlassen worden waren, dafür, sich den großen imperialistischen Mächten und deren Kampf gegen die Russische Revolution anzuschließen. Das Proletariat konnte die nationalen Befindlichkeiten der Arbeiter der „unterdrückten“ Nationen nicht ignorieren; doch diese hätten für die revolutionäre Sache nur gewonnen werden können, wenn man an ihre Klassenbedürfnisse und nicht an ihre nationalistischen Illusionen appelliert hätte.
– in der Frage der „Demokratie“ und „Diktatur“: In Luxemburgs Auffassungen zu diesen Fragen gibt es zutiefst widersprüchliche Aussagen. Auf der einen Seite meinte sie, dass sich die Abschaffung der Konstituierenden Versammlung durch die Bolschewiki negativ auf das Leben der Revolution auswirken werde. Damit legte sie eine seltsame Nostalgie für überholte Formen der bürgerlichen Demokratie an den Tag. Auf der anderen Seite rief das Spartakusprogramm, das kurze Zeit später verfasst wurde, zur Ersetzung der alten parlamentarischen Versammlungen durch Kongresse der Arbeiterräte auf, was darauf hinweist, dass sich Rosa Luxemburgs Auffassungen zu dieser Frage schnell weiterentwickelt hatten. Doch Luxemburgs Kritik an der Tendenz der Bolschewiki, die Redefreiheit in der Arbeiterbewegung einzuschränken, war sehr wohl begründet. Diese gegen andere Gruppen der Arbeiterklasse und gegen andere Parteien getroffenen Maßnahmen sowie die Umwandlung der Sowjets in ausführende Organe des von der bolschewistischen Partei angeführten Staates erwiesen sich in der Tat als negativ für das Überleben und die Integrität der proletarischen Diktatur.
In Russland selbst kam es bereits 1918 zu ersten Reaktionen gegen die Gefahr der Kursabweichung der Partei. Ihr Zentrum (zumindest unter den Strömungen des revolutionären Marxismus) war die linkskommunistische Tendenz in der bolschewistischen Partei. Diese Tendenz war hauptsächlich wegen ihres Widerstandes gegen den Brest–Litowsker Vertrag bekannt geworden, von dem sie fürchtete, dass er nicht nur zur Aufgabe von Teilen des Landes, sondern auch zur Aufgabe der Prinzipien selbst führen würde. Doch auf der Ebene der Prinzipien ist ein Vergleich zwischen Brest–Litowsk und dem vier Jahre später abgeschlossenen Rapallo–Vertrag unzulässig. Ersterer wurde in aller Offenheit verhandelt; es gab keinen Versuch der Verschleierung der brutalen Folgen des Vertrages. Letzterer dagegen wurde geheim ausgehandelt und führte de facto zu einem Bündnis zwischen dem deutschen Imperialismus und dem sowjetischen Staat. Zudem fußte, wie Bilan später unterstrich, die Position, die von Bucharin und anderen Linkskommunisten zugunsten eines „revolutionären“ Krieges vertreten wurde, auf einer ernsthaften Konfusion: auf der Vorstellung, dass die Revolution hauptsächlich durch militärische Mittel in der einen oder anderen Form ausgedehnt werden könne, während sie in Wirklichkeit die Arbeiter der ganzen Welt nur durch den Einsatz von im Wesentlichen politischen Mitteln (wie die Bildung der Kommunistischen Internationale 1919) für sich gewinnen kann.
Nützlicher für das Verständnis der Lehren aus der Revolution waren die ersten Debatten zwischen Lenin und der Linken über den Staatskapitalismus. Lenin trat dafür ein, die deutschen Waffenstillstandsbedingungen zu akzeptieren, um so der Sowjetmacht die dringend benötigte „Atempause“ zu verschaffen, in der sie ein Mindestmaß an gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Leben wieder aufbauen sollte.
Die Divergenzen kreisten um zwei Fragen:
– um die Frage der in diesem Prozess verwendeten Mittel: Lenin, dessen besonderes Anliegen der Kampf um Produktivität und Effizienz gegen das erdrückende Gewicht der russischen Rückständigkeit war, plädierte für strenge Maßnahmen wie die Übernahme des Taylor–Systems und die Ein–Mann–Führung der Betriebe, während die Linke darauf beharrte, dass solche Methoden für die Selbsterziehung und die Selbstaktivierung des Proletariats schädlich seien. Ähnliche Debatten entbrannten in der Frage, in welchem Maße die Prinzipien der Kommune auf die Rote Armee angewandt werden sollen.
– um die Gefahr des Staatskapitalismus: Aus Lenins Sicht war der Staatskapitalismus ein Schritt vorwärts, weil die russische Wirtschaft zuvor fragmentiert gewesen und in einem halb–mittelalterlichen Zustand verharrt geblieben sei. Dies stand in Einklang mit der Auffassung, dass der große Schub staatskapitalistischer Entwicklung in den entwickelten Ländern nach dem 1. Weltkrieg in einem gewissen Sinne eine Vorbereitung für die sozialistische Umwälzung sei. Die Linken wiederum neigten dazu, die dem Staatskapitalismus innewohnende Bedrohung für die Arbeitermacht zu sehen, und warnten vor der Gefahr, dass die Partei durch den Prozess bürokratischer Staatskontrolle vereinnahmt und sich letztendlich gegen die Interessen des Proletariats wenden werde.
Die Kritik der Linken am Staatskapitalismus steckte sicherlich erst in ihren Anfängen und enthielt viele Konfusionen. Sie neigte dazu, die Hauptgefahr im Kleinbürgertum zu lokalisieren; und sie war sich auch im Unklaren darüber, dass die Staatsbürokratie selbst die Rolle einer neuen Bourgeoisie spielen könnte. Auch hegten die Linken Illusionen über die Möglichkeit einer echten sozialistischen Umwälzung innerhalb russischer Grenzen. Doch Lenin irrte, als er im Staatskapitalismus etwas anderes als die Negation des Kommunismus erblickte. Auch mit ihrer Warnung vor der Entwicklung in Russland sollten die Linken Recht behalten; ihre Vorhersagen sollten sich als geradezu prophetisch erweisen.
2. 1921 – Das Proletariat und der Übergangsstaat (International Review, Nr. 100)
Trotz der großen Differenzen innerhalb der bolschewistischen Partei wegen des Kurses der Revolution und insbesondere wegen der Richtung, den der sowjetische Staat einschlug, bewirkte die Notwendigkeit der Einheit in Anbetracht der unmittelbaren Bedrohung durch die Konterrevolution, dass diese Differenzen in gewisser Weise eingedämmt wurden. Das Gleiche kann man hinsichtlich der Spannungen in der russischen Gesellschaft insgesamt sagen: Trotz der schrecklichen Bedingungen für die Arbeiter und Bauern während der Bürgerkriegszeit wurde der wachsende Konflikt zwischen den materiellen Interessen und den politischen und ökonomischen Forderungen des neuen Staatsapparates durch den Kampf gegen die weiße Konterrevolution unter Kontrolle gehalten. Doch mit dem Sieg im Bürgerkrieg war der Deckel entfernt worden. Und mit der zunehmenden Isolation der Revolution infolge einer Reihe von entscheidenden Niederlagen des Proletariats in Europa trat der Konflikt erneut als zentraler Widerspruch des „Übergangsregimes“ hervor.
Innerhalb der Partei kam das grundlegende Problem, vor dem die Revolution stand, durch die Debatte über die Gewerkschaftsfrage ans Tageslicht, die auf dem 10. Parteikongress im März 1921 stattfand. Diese Debatte drehte sich hauptsächlich um drei verschiedene Positionen, obgleich es zwischen ihnen und um sie selbst herum viele unterschiedliche Schattierungen gab:
– die Position Trotzkis: Nachdem er die Rote Armee trotz oft überwältigender Schwierigkeiten zum Sieg gegen die Weißen Armeen geführt hatte, war Trotzki zu einem glühenden Verfechter militärischer Methoden geworden. Er wollte sie in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens angewandt sehen, insbesondere im Arbeitsleben. Da der Staat, der diese Methoden anwende, ein „Arbeiterstaat“ sei, meinte er, könne es keine Interessenkonflikte zwischen der Arbeiterklasse und den Forderungen des Staates geben. Er ging sogar so weit, die Zwangsarbeit als historisch fortschrittliche Möglichkeit zu theoretisieren. In diesem Zusammenhang empfahl er, dass die Gewerkschaften offen als Organe der Arbeitsdisziplin zugunsten des Arbeiterstaates handeln sollten. Gleichzeitig begann Trotzki, eine ausdrückliche theoretische Rechtfertigung des Begriffs der Diktatur der Kommunistischen Partei und des Roten Terrors zu entwickeln.
– die Position der Arbeiteropposition um Kollontai, Schljapnikow und andere: Aus der Sicht Kollontais hatte der Sowjetstaat einen heterogenen Charakter, und er war höchst zugänglich für den Einfluss nicht–proletarischer Kräfte wie Bürokraten und Bauern. Für die schöpferische Arbeit, die bei dem Aufbau der russischen Wirtschaft zu leisten sei, sei es deshalb nötig, dass diese von spezifischen Organen der Arbeiter geleitet würden, wofür aus der Sicht der Arbeiteropposition die Industriegewerkschaften in Frage kamen. Ihr zufolge konnte die Arbeiterklasse mit Hilfe der Industriegewerkschaften die Kontrolle der Produktion aufrechterhalten und entscheidende Schritte zum Kommunismus einleiten. Diese Strömung brachte eine proletarische Reaktion gegenüber der wachsenden Bürokratisierung des Sowjetstaates zum Ausdruck, aber sie litt auch an einer ernsthaften Schwäche. Ihre Befürwortung der Industriegewerkschaften als der beste Ausdruck der Interessen der Arbeiterklasse bedeutete einen Rückschritt im Verständnis der Rolle der Arbeiterräte, die in der neuen revolutionären Epoche als das Instrument des Proletariats zur Leitung nicht nur des wirtschaftlichen, sondern auch des politischen Lebens entstanden waren. Und gleichzeitig kam mit den Illusionen der Opposition über die Möglichkeit der Errichtung neuer kommunistischer Verhältnisse in Russland eine erhebliche Unterschätzung der negativen Auswirkungen der Isolation der Revolution zum Ausdruck. 1921 war die Isolation fast total.
– die Position Lenins: Lenin wehrte sich vehement gegen die Exzesse Trotzkis in dieser Debatte. Er wandte sich gegen den Sophismus, demzufolge es auf unmittelbarer Ebene keinen Interessenkonflikt zwischen Staat und Arbeiterklasse geben könne, da es sich bei diesem Staat um einen Arbeiterstaat handle. Zwar behauptete Lenin einst, dass der Staat faktisch ein „Arbeiter– und Bauernstaat“ sei, aber er räumte auch ein, dass es sich dabei um einen bürokratisch sehr deformierten Staat handle. In solch einer Lage müsse die Arbeiterklasse immer noch ihre materiellen Interessen verteidigen können, wenn notwendig, auch gegen den Staat. Die Gewerkschaften sollten deshalb nicht nur als Organe der Arbeitsdisziplin, sondern auch als Organe der proletarischen Selbstverteidigung betrachtet werden. Gleichzeitig verwarf Lenin die Position der Arbeiteropposition als eine Konzession gegenüber dem Anarcho–Syndikalismus.
Rückblickend können wir sagen, dass die Grundlagen dieser Debatte mit großen Schwächen behaftet waren. Zunächst war es kein Zufall, dass die Gewerkschaften so widerstandslos bereit waren, zu Organen der Arbeitsdisziplin im Interesse des Staates zu werden. Diese Richtung wurde durch die neuen Bedingungen der kapitalistischen Dekadenz aufgezwungen. Nicht die Gewerkschaften, sondern die Organe, mit denen die Klasse auf diese neue Zeit reagiert hatte – Fabrikkomitees, Räte usw. –, hatten zur Aufgabe, die Autonomie der Arbeiterklasse zu verteidigen. Gleichzeitig waren all die Strömungen, die sich an dieser Debatte beteiligten, mehr oder weniger der Idee verbunden, dass die Diktatur des Proletariats durch die Kommunistische Partei ausgeübt werden sollte.
Doch die Debatte zeigte bei aller Konfusion den Versuch zu begreifen, was geschieht, wenn die Staatsmacht, die von der Revolution geschaffen wurde, anfängt, der Kontrolle des Proletariats zu entgleiten und sich gegen die Interessen des Proletariats zu richten. Dieses Problem sollte noch dramatischer durch den Kronstädter Aufstand illustriert werden, der während des 10. Kongresses der Partei nach einer Reihe von Arbeiterkämpfen in Petrograd ausbrach.
Die Führung der Bolschewiki prangerte die Rebellion anfangs als eine reine Verschwörung der Weißen Garden an. Später legte sie die Betonung auf ihren kleinbürgerlichen Charakter, aber die Niederschlagung der Revolte wurde mit dem Argument gerechtfertigt, dass sie sowohl geographisch wie auch politisch der Konterrevolution den Weg bereitet habe. Und dennoch war Lenin gezwungen einzugestehen, dass die Revolte eine Warnung vor einer weiteren Fortsetzung der Zwangsarbeitsmethoden der kriegskommunistischen Phase bedeutete und eine Art „Normalisierung“ der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse anmahnte. Doch hinsichtlich der Auffassung, dass die Verteidigung der proletarischen Macht in Russland die ausschließliche Rolle der bolschewistischen Partei sei, gab es keinen Kompromiss. Diese Auffassung wurde von vielen russischen Linkskommunisten geteilt. Auf dem 10. Kongress zählten Mitglieder der oppositionellen Gruppen zu den ersten Freiwilligen für den Angriff auf die Kronstädter Garnison. Sogar die KAPD in Deutschland leugnete, dass sie die Rebellen unterstützte. Auch Viktor Serge verteidigte schweren Herzens die Niederschlagung der Revolte als das geringere der beiden Übel, da die Alternative der Sturz der Bolschewiki und der Aufstieg einer neuen weißen Tyrannei sei.
Dennoch gab es innerhalb des revolutionären Lagers diesbezüglich auch Meinungsverschiedenheiten. Da gab es natürlich die Anarchisten, die schon viele richtige Kritiken an den Exzessen der Tscheka und der Unterdrückung der Organisationen der Arbeiterklasse geübt hatten. Doch der Anarchismus bietet wenige nützliche Lehren aus dieser Erfahrung, da aus seiner Sicht die Reaktion der Bolschewiki auf die Revolte von Anfang an dem Wesen einer jeden marxistischen Partei entsprach.
In Kronstadt selbst schlossen sich jedoch auch viele Bolschewiki auf der Grundlage der ursprünglichen Ideale des Oktober 1917 dem Aufstand an: für die Sowjetmacht und die Weltrevolution. Der Linkskommunist Mjasnikow verweigerte die Unterstützung derjenigen, die sich am Angriff auf die Garnison beteiligt hatten. Er ahnte die katastrophalen Ergebnisse, die die Niederschlagung der Arbeiterrevolte durch den „Arbeiterstaat“ verursachen würde. Damals war dies noch eine Ahnung. Erst in den 1930er Jahren, als die Italienischen Linkskommunisten sich mit der Frage befassten, konnten mit größter Klarheit die Lehren daraus gezogen werden. Die Italienische Linke, die die Revolte als ohne Zweifel proletarisch bezeichnete, meinte, dass die Ausübung von Gewalt innerhalb der Arbeiterklasse aus Prinzip abgelehnt werden müsse; dass die Arbeiterklasse über Mittel zu ihrer eigenen Verteidigung gegen den Übergangsstaat verfügen müsse, der aufgrund seines Wesens Gefahr laufe, ein Anziehungspunkt für die Kräfte der Konterrevolution zu werden, und dass die Kommunistische Partei sich nicht mit dem Staatsapparat vermischen dürfe, sondern ihre Unabhängigkeit ihm gegenüber bewahren müsse. Die Italienische Linke stellte die Prinzipien über den Schein der Zweckmäßigkeit. Deshalb war sie auch der Auffassung, dass es besser gewesen wäre, Kronstadt zu verlieren, als die Macht zu behalten, da dadurch die grundlegenden Ziele der Revolution untergraben worden seien.
1921 stand die Partei vor einem historischen Dilemma: die Macht zu behalten und zu einem Träger der Konterrevolution zu werden oder in die Opposition zu gehen und in den Reihen der Arbeiterklasse tätig zu werden. Indes war die Verschmelzung zwischen Partei und Staat schon zu weit fortgeschritten, als dass die Partei in ihrer Gesamtheit den letztgenannten Weg hätte einschlagen können. Daher stand konkret die Arbeit einer linken Fraktion an, die innerhalb und außerhalb der Partei tätig werden musste, um sich der zunehmenden Degeneration zu widersetzen. Das Fraktionsverbot innerhalb der Partei nach dem 10. Kongress bedeutete, dass diese Aufgabe zunehmend außerhalb der Partei und schließlich gegen die bestehende Partei angegangen werden musste.
3. 1922–23: Die kommunistischen Fraktionen gegen die ansteigende Konterrevolution (International Review Nr. 101)
Die Konzessionen an die Bauernschaft – für Lenin waren sie eine unumgängliche Notwendigkeit, die durch den Kronstädter Aufstand um so dringender geworden waren – fanden ihren Ausdruck in der Neuen Ökonomischen Politik. Diese wurde als ein zeitweiliger Rückzug angesehen, der es der vom Krieg zerrissenen proletarischen Macht erlauben werde, ihre in Schutt und Asche liegende Wirtschaft wieder aufzubauen, um sich so als Bastion der Weltrevolution am Leben zu halten. In der Praxis jedoch führte der Versuch, die Isolation des Sowjetstaates zu durchbrechen, zu grundlegenden Konzessionen in Grundsatzfragen, nicht nur bezüglich des Handels mit kapitalistischen Mächten (was als solches kein Bruch der Prinzipien war), sondern auch bezüglich geheimer militärischer Bündnisse, wie der Rapallo–Vertrag mit Deutschland. Und neben diesen militärischen Bündnissen entstanden unnatürliche politische Allianzen mit Kräften der Sozialdemokratie, die zuvor als der linke Flügel der Bourgeoisie entlarvt worden waren. Dies war die Politik der „Einheitsfront“, die vom 3. Kongress der Komintern verabschiedet worden war.
Lenin hatte bereits 1918 behauptet, dass der Staatskapitalismus für ein rückständiges Land wie Russland einen Schritt vorwärts bedeute; 1922 behauptete er ferner, dass der Staatskapitalismus dem Proletariat nützen könne, solange er von einem „proletarischen Staat“ geleitet werde. Gleichzeitig jedoch musste er einräumen, dass der Staat – weit entfernt davon der Staat zu sein, den man in der Revolution geerbt hatte – dabei war, alles zu lenken, aber nicht in die Richtung, die man sich erhoffte, sonern hin zur Restaurierung der Bourgeoisie.
Lenin erkannte schnell, dass die Kommunistische Partei selbst zutiefst von diesem Prozess der Regression erfasst worden war. Zunächst führte er das Problem hauptsächlich auf die unteren Schichten von kulturlosen Bürokraten zurück, die begonnen hatten, massenhaft in die Partei einzudringen. Aber in seinen letzten Lebensjahren wurde ihm auf schmerzhafte Weise klar, dass der Fäulnisprozess bis in die höchsten Ebenen der Partei vorgedrungen war. Wie Trotzki hervorhob, konzentrierte sich Lenins letzter Kampf hauptsächlich auf Stalin und den aufkommenden Stalinismus. Im Gefängnis des Staates eingesperrt, war Lenin jedoch unfähig, mehr als nur administrative Maßnahmen zur Eindämmung der aufkommenden Bürokratie vorzuschlagen. Hätte er länger gelebt, wäre er sicher dazu gedrängt worden, eine oppositionellere Haltung einzunehmen; so aber musste der Kampf gegen die aufsteigende Konterrevolution jetzt von anderen übernommen werden.
1923 brach die erste Wirtschaftskrise in der Phase der NEP aus. Für die Arbeiterklasse hieß dies Lohnkürzungen und Stellenstreichungen sowie eine Welle von spontanen Streiks. Innerhalb der Partei rief sie Konflikte und Debatten hervor; auch brachte sie neue Oppositionsgruppen hervor. Ihr erster expliziter Ausdruck war die Plattform der 46, der auch Prominente wie Trotzki (er wurde damals schon zunehmend von dem herrschenden Triumvirat Stalin, Kamenew und Sinowjew kritisiert) und Mitglieder der Gruppe Demokratischer Zentralismus angehörten. Die Plattform kritisierte die Bereitschaft, die NEP als adäquaten Weg zum Sozialismus zu betrachten; sie forderte mehr statt weniger zentrale Planung. Wichtiger noch – sie warnte vor der zunehmenden Erdrosselung des Parteilebens.
Gleichzeitig distanzierte sich die Plattform von den radikaleren oppositionellen Gruppen, die damals entstanden waren. Die wichtigste unter ihnen war die Arbeitergruppe Mjasnikows, die an den Streiks in den Industriezentren beteiligt war. Obwohl sie als eine verständliche, aber „morbide“ Reaktion gegen die aufkommende Bürokratie angesehen wurde, war das Manifest der Arbeitergruppe in Wirklichkeit ein Ausdruck der Ernsthaftigkeit der russischen Kommunistischen Linken:
– Die Schwierigkeiten des Sowjetregimes erklärten sie mit der Isolation und der fehlgeschlagenen Ausdehnung der Revolution.
– Ihre Kritik an der opportunistischen Politik der Einheitsfront war hellsichtig; sie bekräftigte ihre ursprüngliche Analyse, dass die sozialdemokratischen Parteien Verteidiger des Kapitalismus seien.
– Sie warnten vor den Gefahren des Aufkommens einer neuen kapitalistischen Oligarchie und riefen zur Erneuerung der Sowjets und der Fabrikkomitees auf.
– Gleichzeitig waren sie äußerst vorsichtig bei der Einschätzung der Charakteristiken des Sowjetregimes und der bolschewistischen Partei. Im Gegensatz zu Bogdanows Gruppe Arbeiterwahrheit wollten sie nichts mit der Idee zu tun haben, dass die Revolution oder die bolschewistische Partei von Anfang an bürgerlich gewesen sei. Sie begriffen ihre Rolle im Wesentlichen als die einer linken Fraktion, die innerhalb und außerhalb der Partei für ihre Wiederaufrichtung kämpfte.
Die Linkskommunisten waren deshalb die theoretische Avantgarde im Kampf gegen die Konterrevolution in Russland. Die Tatsache, dass Trotzki 1923 eine offen oppositionelle Haltung eingenommen hatte, war in Anbetracht seines Rufs als Führer des Oktoberaufstandes von großer Bedeutung. Jedoch zeichnete sich im Vergleich zu den kompromisslosen Positionen der Arbeitergruppe Trotzkis Opposition gegen den Stalinismus durch eine zögerliche und zentristische Herangehensweise aus:
– Trotzki verpasste eine Reihe von Gelegenheiten, einen offenen Kampf gegen den Stalinismus zu führen; insbesondere zögerte er, Lenins „Testament“ zu benutzen, um Stalin anzuprangern und ihn aus der Parteiführung zu drängen.
– Er neigte dazu, während vieler Debatten innerhalb des bolschewistischen Zentralorgans zu schweigen.
Diese Schwächen sind vor allem auf Charakterfragen zurückzuführen. Trotzki war kein durchtriebener Intrigant wie Stalin, er besaß keine umfassenden persönlichen Ambitionen. Aber es gab noch tiefer liegende, politische Gründe für Trotzkis Unfähigkeit, seine Kritik so weit wie die radikalen Schlussfolgerungen der Kommunistischen Linken zu entwickeln.
– Trotzki hatte nie verstanden, dass Stalin und seine Fraktion keine verirrte, fehlgeleitete zentristische Tendenz innerhalb der Arbeiterbewegung darstellten, sondern die Speerspitze einer bürgerlichen Konterrevolution.
– Trotzkis eigener Werdegang als eine Person im Mittelpunkt des Sowjetregimes erschwerte es ihm, sich von dem Prozess des Niedergangs zu lösen. Ein tief in der Partei verwurzelter „Parteipatriotismus“ erschwerte es zudem Trotzki und anderen Oppositionellen anzuerkennen, dass die Partei sich irren kann.
4. 1924–28: Der Triumph des stalinistischen Staatskapitalismus (International Review Nr. 102)
1927 hatte Trotzki akzeptiert, dass die Gefahr einer bürgerlichen Restaurierung in Russland bestand – eine Art schleichende Konterrevolution ohne den formellen Sturz des bolschewistischen Regimes. Aber er unterschätzte sehr stark, bis zu welchem Punkt dieser Prozess schon gereift war, ja dass er nahezu abgeschlossen war.
– Es war für ihn sehr schwer zu begreifen, dass er selbst in großem Maße am Niedergangsprozess beteiligt war (durch die Politik der Militarisierung der Arbeit, der Niederschlagung Kronstadts usw.).
– Während er begriff, dass die Probleme, vor denen die Sowjetunion stand, ein Ergebnis der Isolierung und des Rückzugs der internationalen Revolution waren, verstand Trotzki nicht das Ausmaß der Niederlage, die die Arbeiterklasse im Begriff war zu erleiden. Vor allem aber erkannte er nicht, dass die Sowjetunion schon dabei war, sich in das imperialistische Weltsystem einzugliedern.
– Trotzki glaubte, dass der russische „Thermidor“ durch einen Sieg jener Kräfte erfolgen würde, die auf eine Rückkehr des Privateigentums (NEP–Leute, Kulaken, die Rechte um Bucharin) drängten. Der Stalinismus wurde als eine Art Zentrismus, nicht als eine Speerspitze der staatskapitalistischen Konterrevolution definiert.
Die ökonomischen Theorien der linken Opposition um Trotzki erschwerten die Erkenntnis, dass der „Sowjetstaat“ selbst zum direkten Träger der Konterrevolution geworden war, ohne dass es eine Rückkehr zum klassischen Privateigentum gegeben hatte. Die Bedeutung der Erklärung Stalins vom „Sozialismus in einem Land“ wurde sehr spät und nie vollständig begriffen. Durch den Tod Lenins und die offensichtliche Stagnation der Weltrevolution mutiger geworden, vollzog Stalin mit dieser Erklärung einen offenen Bruch mit dem Internationalismus und verpflichtete sich, Russland zu einer imperialistischen Weltmacht aufzubauen. Dies stand im völligen Gegensatz zum Bolschewismus des Jahres 1917, der betont hatte, dass der Sozialismus nur das Ergebnis einer erfolgreichen Weltrevolution sein kann. Aber je mehr die Bolschewiki an der Verwaltung des Staates und der Wirtschaft in Russland beteiligt und durch sie absorbiert wurden, um so mehr neigten sie dazu, die Verwirklichung des Sozialismus auch in einem isolierten und rückständigen Land zu theoretisieren. So wurde die Debatte über die NEP beispielsweise aus diesem Blickwinkel betrachtet: Die Rechte argumentierte, dass der Sozialismus durch das Wirken der Marktkräfte eingeführt werden könne, wohingegen die Linke die Rolle der Planwirtschaft und der Schwerindustrie betonte. Preobrashenski, der Haupttheoretiker der linken Opposition in ökonomischen Fragen, sprach von der Überwindung des kapitalistischen Wertgesetzes durch ein Monopol im Außenhandel und der Akkumulation im staatlichen Sektor. Man nannte dies gar „primitive sozialistische Akkumulation“.
Die Theorie der primitiven sozialistischen Akkumulation verwechselte fälschlicherweise das Wachstum der Industrie mit den Interessen der Arbeiterklasse und des Sozialismus. In Wirklichkeit war ein Industriewachstum in Russland nur durch die wachsende Ausbeutung der Arbeiterklasse möglich. Kurzum, primitive sozialistische Akkumulation konnte nur heißen: Akkumulation von Kapital. Deshalb warnte die Italienische Linke zum Beispiel vor jeder Tendenz, industrielles Wachstum oder die Verstaatlichung von Industrien als eine fortschrittliche, zum Sozialismus weisende Maßnahme zu betrachten.
Nach dem Auseinanderbrechen des herrschenden Triumvirates wurde der Kampf gegen die Theorie des „Sozialismus in einem Lande“ von der Gruppe um Sinowjew aufgenommen. Dies führte zur Bildung der Vereinigten Opposition 1926, die anfangs auch die Demokratischen Zentralisten umfasste. Obwohl man sich formell dem Verbot der Bildung von Fraktionen unterwarf, war die neue Opposition zunehmend gezwungen, ihre Kritik am Regime auf die unteren Ränge der Partei und sogar direkt auf die Arbeiter auszudehnen. Dabei stieß sie auf Drohungen, Beleidigungen, erfundene Beschuldigungen, Repression und Ausschluss. Dennoch war sie noch immer nicht in der Lage, das Wesen dessen, wogegen sie kämpfte, zu begreifen. Stalin machte sich ihren Wunsch nach Versöhnung innerhalb der Partei zunutze, indem er sie zwang, auf jede so genannte Fraktionsaktivität zu verzichten. Die Gruppe um Sinowjew und einige Anhänger Trotzkis kapitulierten sofort. Und als Stalin 1928 seine „Linkswende“ und eine zügige Industrialisierungspolitik verkündete, nahmen viele Trotzkisten, Preobrashenksi eingeschlossen, an, dass Stalin doch noch ihre Positionen übernommen habe.
Gleichzeitig jedoch gerieten jene Mitglieder der Opposition unter den wachsenden Einfluss der Linkskommunisten, denen es besser gelungen war zu begreifen, dass die Konterrevolution schon eingetreten war. Die Demokratischen Zentralisten zum Beispiel, die zwar noch Hoffnungen auf eine radikale Reform des Sowjetregimes hegten, waren sich weitaus klarer darüber, dass die verstaatliche Industrie nicht mit dem Sozialismus gleichzusetzen war, dass die Verschmelzung zwischen Staat und Partei zur Liquidierung der Partei führte und dass die Außenpolitik des Sowjetregimes sich zunehmend gegen die internationalen Interessen des Proletariats richtete. Nach dem massenhaften Ausschluss der Opposition 1927 entwickelten die Linkskommunisten mehr und mehr die Auffassung, dass Regime und Partei nicht mehr reformierbar waren. Die Reste der Mjasnikow–Gruppe spielten eine Schlüsselrolle bei der nun einsetzenden Radikalisierung. Doch im Verlauf der nächsten Jahre sollten die lebhaften Debatten über das Wesen des Regimes vor allem in Stalins Gefängnissen geführt werden.
5. Die Lösung des russischen Rätsels: 1926–36 (International Review Nr. 105)
In Anbetracht des Ausmaßes der Niederlage verlagerte sich jetzt der Schwerpunkt der Bemühungen, das Wesen des stalinistischen Regimes zu begreifen, nach Westeuropa. In dem Maße, wie die Kommunistischen Parteien „bolschewisiert“, d.h. in leicht beeinflussbare Instrumente der russischen Außenpolitik verwandelt wurden, entstand in ihren Reihen eine Vielzahl von Oppositionsgruppen, die sich jedoch schnell von der Partei abspalteten oder ausgeschlossen wurden.
In Deutschland umfassten diese Gruppen manchmal Tausende von Mitgliedern, wenngleich ihre Mitgliederzahlen schnell schrumpften. Die KAPD existierte noch und intervenierte gegenüber diesen Gruppen. Eine der bekanntesten war die Gruppe um Karl Korsch; die Korrespondenz zwischen ihm und Bordiga in Italien verdeutlicht viele der Probleme, vor denen die Revolutionäre damals standen.
Eines der Merkmale der Deutschen Linken – ein Faktor, der zu ihrem organisatorischen Zerfall mit beitrug – war die Tendenz, voreilige Schlüsse über das Wesen des neuen Systems in Russland zu ziehen. Während sie dessen kapitalistisches Wesen erkannten, waren sie oft nicht in der Lage, die Hauptfrage zu beantworten: Wie kann sich eine proletarische Macht in ihr Gegenteil verkehren? Oft bestand ihre Antwort in der Leugnung, dass diese jemals proletarisch gewesen war. Man behauptete, dass die Oktoberrevolution nichts anderes als eine bürgerliche Revolution und die Bolschewiki nichts als eine Partei der Intelligentsia gewesen seien.
Bordigas Antwort verkörperte die eher geduldigere Methode der Italienischen Linken. Sie war gegen den überstürzten Versuch des Aufbaus einer Organisation ohne eine gesunde programmatische Grundlage. Bordiga unterstützte die Notwendigkeit einer umfassenden und tief greifenden Diskussion der Lage, die viele neue Fragen aufgeworfen hatte. Dies war die einzige Grundlage einer substanziellen Umgruppierung. Gleichzeitig weigerte er sich, den proletarischen Charakter der Oktoberrevolution in Frage zu stellen. Statt dessen betonte er, dass die Frage, vor der die revolutionäre Bewegung stünde, laute: Wie konnte eine isolierte, auf ein Land beschränkte proletarische Macht in einen solchen Prozess der inneren Degeneration geraten?
Mit dem Sieg des Nationalsozialismus in Deutschland verlagerte sich erneut der geographische Schwerpunkt der Diskussionen – dieses Mal nach Frankreich, wo eine Reihe von Oppositionsgruppen 1933 eine Konferenz in Paris abhielt, um über das Wesen des Regimes in Russland zu diskutieren. Es beteiligten sich auch die „offiziellen“ Anhänger Trotzkis, doch die meisten Gruppen standen eher links, wie auch die Exilgruppe der Italienischen Linken. In der Konferenz tauchten viele Theorien über den Charakter des Regimes auf, von denen viele sich stark widersprachen: dass es sich um einen Klassensystem neuen Typs handelte, welches man nicht mehr unterstützen dürfe; dass es sich um ein Klassensystem neuen Typs handelte, welches man dennoch weiter unterstützen müsse; dass es ein proletarisches Regime geblieben sei, welches man aber nicht mehr verteidigen dürfe… All dies spiegelte die großen Schwierigkeiten der Revolutionäre wider zu begreifen, in welche Richtung sich die Sowjetunion entwickelte und was dies bedeutete. Aber es zeigte auch, dass die „orthodoxe“ trotzkistische Position – wonach die UdSSR trotz ihrer Entartung ein Arbeiterstaat bleibe und gegen den Imperialismus verteidigt werden müsse – von verschiedenen Seiten angegriffen wurde.
Größtenteils aufgrund dieses Drucks seitens der Linken schrieb Trotzki 1936 seine berühmte Analyse der russischen Revolution: „Die verratene Revolution“.
Dieses Buch belegt, dass Trotzki, obwohl er zunehmend dem Opportunismus anheim fiel, ein Marxist geblieben war. So zertrümmerte er schlagfertig die Behauptung des Stalinismus, die UdSSR sei ein Paradies für die Arbeiter. Sich auf die Aussage Lenins stützend, dass der Übergangsstaat „ein bürgerlicher Staat ohne Bourgeoisie“ ist, lieferte er wichtige Erkenntnisse über das Wesen dieses Staates und seine von ihm für das Proletariat ausgehende Gefahr. Trotzki kam damals sogar zur Schlussfolgerung, dass die alte bolschewistische Partei tot sei und die Bürokratie nicht mehr reformiert werden könne, sondern mit Gewalt gestürzt werden müsse. Doch das Buch hat eine fundamentale Schwäche – es wendet sich ausdrücklich gegen die Auffassung, dass die UdSSR eine Form des Staatskapitalismus war. Trotzki verteidigte hartnäckig die These, dass die staatlichen Eigentumsformen ein Beleg für den proletarischen Charakter des russischen Staates seien. Während er theoretisch eingestand, dass es in der kapitalistischen Niedergangsphase eine Tendenz zum Staatskapitalismus gibt, lehnte er die Idee ab, dass die stalinistische Bürokratie eine neue herrschende Klasse sei, denn sie besitze keine Aktien und könne ihr Eigentum nicht weiter vererben. Damit reduzierte er das Kapitwal auf eine juristische Form, anstatt es als ein im Wesentlichen unpersönliches gesellschaftliches Verhältnis zu betrachten.
Und was die Idee angeht, dass die UdSSR immer noch ein Arbeiterstaat sei, obgleich er selbst eingestehen musste, dass die Arbeiterklasse als solche von der politischen Macht völlig ausgeschlossen war, so brachte dies ein mangelndes, oberflächliches Verständnis des Wesens der proletarischen Revolution zum Vorschein. Die proletarische Revolution ist die erste Revolution in der Geschichte, die das Werk einer eigentumslosen Klasse ist; eine Klasse, die nicht über ihre eigenen Wirtschaftsformen verfügt und die ihre Befreiung nur erreichen kann, wenn sie in der Lage ist, ihre politische Macht als einen Hebel zu benutzen, um die „spontanen“ Gesetze der Wirtschaft unter die bewusste Kontrolle der Menschen zu bringen.
Vor allem aber zwang Trotzkis Charakterisierung der UdSSR seine Bewegung dazu, in der ganzen Welt den Stalinismus radikal zu verteidigen. Dies ging deutlich aus Trotzkis Argument hervor, wonach das schnelle Industriewachstum unter Stalin – das sich auf eine schreckliche Ausbeutung der Arbeiterklasse stützte und Teil der Vorbereitungen der Kriegswirtschaft im Hinblick auf eine neue imperialistische Aufteilung der Welt war – ein Beweis für die Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus sei. Es wurde auch offenkundig angesichts Trotzkis entschlossener Unterstützung der russischen Außenpolitik und der kompromisslosen Verteidigung der Sowjetunion gegen imperialistische Angriffe zu einer Zeit, als der russische Staat selbst zu einem aktiven Mitspieler auf der imperialistischen Weltbühne geworden war. Diese Analyse barg den Keim für den Verrat der Trotzkisten am Internationalismus im II. Weltkrieg in sich.
Trotzkis Buch gab der Idee Auftrieb, dass die Frage der Sowjetunion noch nicht endgültig geklärt sei und dass dies nur entscheidende historische Ereignisse wie ein Weltkrieg regeln könnten. In seinen letzten Schriften, in denen er sich möglicherweise der Risse in seiner Theorie des „Arbeiterstaates“ bewusst wurde, aber noch zögerte anzuerkennen, dass die UdSSR ein kapitalistisches Gebilde war, begann er darüber zu spekulieren, dass, wenn der Stalinismus eine neue Form der Klassenherrschaft darstellte, die weder kapitalistisch noch sozialistisch wäre, der Marxismus seine Glaubwürdigkeit verloren hätte. Trotzki selbst wurde ermordet, bevor er sich dazu äußern konnte, ob der Krieg in der Tat das „russische Rätsel“ gelöst hatte. Doch nur diejenigen unter seinen Gefolgsleuten, welche dem Weg folgten, den die Kommunistische Linke eingeschlagen hatte, und die Analyse des Staatskapitalismus übernahmen (wie Stinas in Griechenland, Munis in Spanien und Trotzkis Frau Natalia), blieben dem proletarischen Internationalismus während und nach dem II. Weltkrieg treu.
6. Das russische Rätsel und die Italienische Kommunistische Linke 1933–46 (International Review Nr. 106)
Die Kommunistische Linke fand ihren klarsten Ausdruck unter jenen Teilen des Weltproletariats, die den Kapitalismus in der revolutionären Welle am stärksten herausgefordert hatten. Neben Russland waren dies das deutsche und italienische Proletariat; folglich waren die Deutsche und Italienische Kommunistische Linke die theoretische Avantgarde der internationalen Kommunistischen Linken.
Als es darum ging, das Wesen des Regimes zu begreifen, das auf den Trümmern der Niederlage in Russland entstanden war, bewies die Deutsche Linke mit ihrer Fähigkeit, Schlussfolgerungen zu ziehen, eine gewisse Frühreife. Sie erkannte nicht nur, dass das stalinistische System eine Spielart des Staatskapitalismus war; sie entwickelte auch wichtige Einsichten in den Staatskapitalismus als eine universelle Tendenz des krisengeschüttelten Kapitalismus. Dennoch waren diese Erkenntnisse zu oft mit der Neigung verbunden, die Solidarität mit der Oktoberrevolution aufzukündigen und den Bolschewismus als Speerspitze einer bürgerlichen Revolution zu bezeichnen. In dieser Auffassung spiegelte sich die Überstürzung wider, in der die Deutsche Linke die Notwendigkeit einer proletarischen Partei aufgab und die Rolle der revolutionären Organisation unterschätzte.
Die Italienische Linke dagegen brauchte lange, um das Wesen der UdSSR klar zu begreifen, aber sie ging an die Frage mit größerer Vorsicht und Stringenz heran. Ihre grundlegenden Prämissen waren:
– Sie hielt an der Überzeugung fest, dass der Rote Oktober eine proletarische Revolution gewesen war.
– Da der Weltkapitalismus ein im Niedergang befindliches System war, stand die bürgerliche Revolution nirgendwo mehr auf der Tagesordnung.
– Vor allem durfte es keinen Kompromiss beim proletarischen Internationalismus geben, der eine totale Ablehnung der Auffassung vom „Sozialismus in einem Lande“ bedeutete.
Trotz dieser soliden Grundlagen war die Auffassung der Italienischen Linken über das Wesen der UdSSR in den 1930er Jahren sehr widersprüchlich. Oberflächlich betrachtet, teilten sie mit Trotzki die Auffassung, dass die UdSSR ein proletarischer Staat sei, da er staatliche Eigentumsformen aufrecht halte. Die stalinistische Bürokratie wurde eher als eine parasitäre Kaste denn als eine eigenständige Ausbeuterklasse bezeichnet.
Aber der tief verwurzelte Internationalismus der Italienischen Linken zog eine scharfe Trennungslinie zu den Trotzkisten, deren Position, die Verteidigung des degenerierten Arbeiterstaates, sie in die Fänge des imperialistischen Krieges trieb, in ihre Teilnahme an ihm. Die theoretische Zeitschrift der Italienischen Linken, Bilan, erschien ab 1933. Nach anfänglichem Zögern überzeugten die Ereignisse jener Zeit (Hitlers Machtergreifung, die Unterstützung der französischen Wiederbewaffnung, Russlands Beitritt zum Völkerbund, der Krieg in Spanien) Bilan, dass, auch wenn die UdSSR proletarisch blieb, sie dennoch nun eine konterrevolutionäre Rolle auf der ganzen Welt spielte. Deshalb verlangten die internationalen Interessen der Arbeiterklasse, dass die Revolutionäre ihre Solidarität mit diesem Staat verweigerten.
Diese Analyse war mit Bilan’s Erkenntnis verbunden, dass das Proletariat eine historische Niederlage erlitten hatte und die Welt sich auf einen neuen imperialistischen Krieg hinbewegte. Bilan sagte mit bestechender Genauigkeit voraus, dass die UdSSR sich letztendlich mit dem einen oder anderen in der Bildung befindlichen Block verbünden werde. Damit lehnte sie die Auffassung Trotzkis ab, derzufolge die UdSSR grundsätzlich feindlich gegenüber dem Weltkapital eingestellt sei und die imperialistischen Mächte zum Zusammenschluss gegen sie gezwungen seien.
Im Gegenteil, Bilan meinte, dass trotz des Überlebens der “kollektivierten” Eigentumsformen die Arbeiterklasse in der UdSSR einer rücksichtslosen kapitalistischen Ausbeutung unterworfen sei. Die beschleunigte Industrialisierung, die als “Aufbau des Sozialismus” tituliert wurde, bedeutete nichts anderes als den Aufbau einer Kriegswirtschaft, welche es der UdSSR ermöglichen sollte, sich an der nächsten imperialistischen Aufteilung der Beute zu beteiligen. Deshalb lehnte Bilan Trotzkis Lobpreisungen der Industrialisierung in der UdSSR ab.
Bilan war sich des Weiteren bewusst darüber, dass es auch in den westlichen Ländern eine wachsende Tendenz zum Staatskapitalismus gab, ob er nun in Gestalt des Faschismus oder des demokratischen “New Deal” auftrat. Dennoch zögerte Bilan, den letzten Schritt zu machen – anzuerkennen, dass die stalinistische Bürokratie tatsächlich eine Staatsbourgeoisie war. Statt sie als Verkörperung einer neuen kapitalistischen Klasse zu betrachten, sah man sie als “Vertreter des Weltkapitals”.
Nachdem die Auffassung vom “proletarischen Staat” mit den Ereignissen in der realen Welt immer mehr in Konflikt geraten war, begann eine Minderheit von Genossen in der Fraktion die ganze Theorie in Frage zu stellen. Und es war kein Zufall, dass diese Minderheit am besten dafür gerüstet war, die anfängliche Verwirrung zu überstehen, die der Kriegsausbruch in der Fraktion ausgelöst hatte. Diese war zuvor durch die revisionistische Theorie der “Kriegswirtschaft” in eine Sackgasse geführt worden – eine Theorie, derzufolge kein Weltkrieg stattfinden werde.
Es war immer als selbstverständlich angesehen worden, dass die russische Frage so oder so durch den Ausbruch des Krieges gelöst werden würde. Und für die klarsten Teile der Italienischen Linken lieferte die Beteiligung der UdSSR am imperialistischen Räuberkrieg den letzten Beweis. Die kohärentesten Argumente für die Position, dass die UdSSR imperialistisch und kapitalistisch sei, wurden von jenen Genossen entwickelt, die die Arbeit Bilan‘s in der Französischen Fraktion der Kommunistischen Linken und, nach dem Krieg, in der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs) fortsetzten. Durch die Integration der wertvollsten Erkenntnisse der Deutschen Linken – ohne dabei rätekommunistischen Verleumdungen der Oktoberrevolution auf dem Leim zu gehen – zeigte diese Strömung auf, warum der Kapitalismus in seiner Niedergangsphase hauptsächlich die Form des Staatskapitalismus annahm. Was Russland anbetraf, so wurden die letzten Reste einer “juristischen” Definition des Kapitalismus über Bord geworfen. Es wurde die grundlegende marxistische Auffassung bekräftigt, dass das Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis ist, das von einem zentralisierten Staat genauso wie von einer Gruppe von Privatkapitalisten ausgeübt werden kann. Und es wurde die notwendige Schlussfolgerung bezüglich der proletarischen Herangehensweise gegenüber der Übergangsperiode gezogen. Die Fortentwicklung zum Kommunismus kann nicht daran gemessen werden, in welchem Maße der staatliche Bereich wächst – denn damit ist die große Gefahr einer Rückkehr des Kapitalismus verbunden –, sondern in der Tendenz, dass lebendige Arbeit tote Arbeit beherrscht und dass die Produktion für den Mehrwert durch eine Produktion ersetzt wird, die auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse abzielt.
7. Die Debatte über die „proletarische Kultur“ im revolutionären Russland (International Review, Nr. 109)
Entgegen der zunehmend oberflächlichen Herangehensweise an das Problem der Kultur im bürgerlichen Denken, die dazu neigt, die Kultur auf die unmittelbarsten Ausdrücke bestimmter Länder bzw. ethnischer Gruppen oder gar auf den Status vorübergehender gesellschaftlicher Verhaltensweisen zu reduzieren, stellt der Marxismus die Frage in ihrem umfassendsten und tiefsten historischen Zusammenhang: die grundlegenden Charakteristiken der Menschheit und ihrer Entstehung aus der Natur im Rahmen der großen Zyklen aufeinander folgender Produktionsformen, die die Geschichte der Menschheit kennzeichnen.
Die proletarische Revolution in Russland, die so viele reichhaltige Lehren hinsichtlich der politischen und ökonomischen Ziele der Arbeiterklasse enthält, war auch auf dem Gebiet der Kunst und Kultur von einer kurzen, aber mächtigen Explosion der Kreativität geprägt – in der Malerei, Bildhauerei, Architektur, Musik und Literatur, in der praktischen Organisierung des Alltagslebens auf gemeinschaftlicher Grundlage, in den Humanwissenschaften wie die Psychologie und so weiter. Gleichzeitig wurde die allgemeine Frage des Übergangs der Menschheit von der bürgerlichen Kultur zu einer höheren, kommunistischen Kultur aufgeworfen.
Eine der Hauptdiskussionen unter den russischen Revolutionären kreiste um die Frage, ob dieser Übergang zur Entwicklung einer spezifischen proletarischen Kultur führen werde. Da auch frühere Kulturen aufs Engste mit den Ansichten der herrschenden Klasse verbunden waren, schienen manche zu meinen, dass die Arbeiterklasse, sobald sie zur herrschenden Klasse geworden ist, ihre eigene Kultur schaffen werde, die im Gegensatz zur Kultur der alten, ausbeutenden Klasse stehen werde. Dies war jedenfalls die Meinung der “Proletkult”–Bewegung, die in den ersten Jahren nach der Revolution über eine große Anhängerschaft verfügte.
In einer dem „Proletkult“–Kongress von 1920 vorgelegten Resolution schien selbst Lenin diese Idee einer besonderen proletarischen Kultur zu akzeptieren. Gleichzeitig kritisierte er gewisse Aspekte der „Proletkult“–Bewegung: ihre philisterhafte „Arbeitertümelei“, die dazu führte, die Arbeiterklasse in ihrem Ist–Zustand zu idealisieren, statt ihren Soll–Zustand anzustreben, und ihr Hang zur bilderstürmerischen Ablehnung der früheren kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Lenin misstraute der Gruppe „Proletkult“ auch wegen ihrer Tendenz, als eine eigenständige Partei mit eigenem Organisationsapparat und eigenem Programm aufzutreten. So empfahl Lenin in seiner Resolution, dass die Orientierung der Kulturarbeit im Sowjetregime unter der direkten Leitung des Staates stehen sollte. Doch im Grunde lag Lenins Hauptinteresse in Kulturfragen woanders. Aus seiner Sicht hatte die Kulturfrage weniger mit der grandiosen Fragestellung zu tun, ob es eine neue proletarische Kultur in Sowjetrussland geben kann, als vielmehr mit dem Problem, die gewaltige kulturelle Rückständigkeit der russischen Massen zu überwinden, unter denen mittelalterliche Sichtweisen und der Aberglaube noch ein großes Gewicht hatten. Lenin war sich des niedrigen kulturellen Entwicklungsstandes der Massen bewusst; er wusste, dass dies ein Nährboden für die Ausbreitung der Geißel der Bürokratie im Sowjetstaat werden kann. Die Anhebung des kulturellen Niveaus der Massen war für Lenin ein Mittel zur Bekämpfung dieser Geißel und zur Verstärkung der Fähigkeit der Massen, die politische Macht in den Händen zu behalten.
Trotzki dagegen entwickelte eine tiefergehende Kritik der „Proletkult“–Bewegung. Aus seiner Sicht, die er in einem Kapitel seines Buches „Literatur und Revolution“ darstellte, war der Begriff proletarische Kultur als solcher schon eine unzutreffende Bezeichnung. Als ausbeutende Klasse, die ihre ökonomische Macht über eine ganze Zeit lang innerhalb des Rahmens des alten Feudalsystems aufbauen konnte, konnte die Bourgeoisie auch eine eigene, spezifische Kultur entfalten. Dies trifft auf das Proletariat nicht zu, das als eine ausgebeutete Klasse nicht über die materiellen Grundlagen für die Entwicklung einer eigenen Kultur innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft verfügt. Es stimmt, dass das Proletariat während der Übergangsperiode zum Kommunismus zur herrschenden Klasse werden muss, doch handelt es sich dabei lediglich um eine vorübergehende politische Diktatur, deren Endziel nicht darin besteht, die Existenz des Proletariat als solches unbegrenzt aufrechtzuerhalten, sondern darin, das Proletariat in der neuen menschlichen Gemeinschaft aufzulösen. Die Kultur dieser neuen Gemeinschaft wird die erste wirklich menschliche Kultur sein, die alle früheren kulturellen Fortschritte, die die Gattung Mensch erzielt hat, integrieren wird.
Trotzki verfasste sein Buch „Literatur und Revolution“ im Jahr 1924. Es war ein wichtiges Werkzeug in Trotzkis Kampf gegen den emporkommenden Stalinismus. Nachdem „Proletkult“ durch die Befürwortung der Eigeninitiative der Arbeiter anfangs ein wichtiges Sammelbecken für die linken Gruppen gewesen war, die sich gegen das Aufblähen der sowjetischen Bürokratie stellten, neigten seine Nachfolger später dazu, sich mit der Ideologie des „Sozialismus in einem Land“ zu identifizieren. Aus ihrer Sicht schien dies in Einklang mit der Auffassung zu stehen, dass eine „neue“ Kultur in der Sowjetunion bereits im Aufbau war. Trotzkis Schriften zur Kultur zeigten auf, dass solche Ansprüche haltlos waren. Er wandte sich auch heftig gegen die Verwandlung der Kunst in eine Staatspropaganda. Stattdessen propagierte er eine „anarchistische“ Politik auf dem Gebiet der Kultur, die von niemand verordnet werden dürfe, weder von der Partei noch vom Staat.
8. Trotzki und die Kultur des Kommunismus (International Review Nr. 111)
Trotzki entwickelt seine Auffassung über die kommunistische Kultur der Zukunft im letzten Kapitel seines Buchs „Literatur und Revolution“. Er wiederholt zunächst seine Ablehnung des Begriffs „proletarische Kultur“ als Bezeichnung des Verhältnisses zwischen Kunst und Arbeiterklasse in der Übergangsperiode. Stattdessen schlägt er eine Unterscheidung zwischen revolutionärer und sozialistischer Kunst vor. Die erste hebt sich vor allem durch ihren Gegensatz zur bestehenden Gesellschaft hervor. Trotzki meinte gar, dass sie tendenziell von einem „gewissen gesellschaftlichen Hass“ geprägt sein wird. Er warf auch die Frage auf, welche Kunst–“Schule“ einer revolutionären Periode am offensten gegenüber eingestellt sein wird. Er benutzte den Begriff „Realismus“ zur Beschreibung dieses Phänomens. Aber dies hieß in seiner Sicht nicht die geisttötende Unterwerfung der Kunst unter die Staatspropaganda, die von der stalinistischen Schule des „sozialistischen Realismus“ betrieben wurde. Ebenso wenig bedeutete dies, dass Trotzki blind gegenüber der Möglichkeit einer Eingliederung der Errungenschaften von Kunstformen war, die nicht direkt mit der revolutionären Bewegung verbunden waren oder sich gar durch eine verzweifelte Flucht vor der Realität auszeichneten.
Sozialistische Kunst würde Trotzki zufolge von höheren und positiveren Emotionen durchdrungen sein, die in einer Gesellschaft aufblühen werden, die sich auf Solidarität stützt. Gleichzeitig verwarf Trotzki die Idee, dass in einer Gesellschaft, die Klassenspaltungen und andere Quellen von Unterdrückung und Angst überwunden hat, die Kunst steril werden könnte. Im Gegenteil, sie werde dazu neigen, alle Aspekte des Alltaglebens mit einer schöpferischen und harmonischen Energie zu durchdringen. Und da Menschen in einer kommunistischen Gesellschaft immer noch mit den grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens – vor allem Liebe und Tod – konfrontiert sein werden, wird es immer noch Raum für die tragischen Dimensionen der Kunst geben. Hier stimmte Trotzki völlig überein mit der Herangehensweise von Marx an die Frage der Kunst in den Grundrissen, in denen er erklärte, warum die Kunst früherer menschlicher Epochen nicht ihren Charme für uns verlieren werde. Denn die Kunst könne nicht auf die politischen Aspekte des menschlichen Lebens reduziert werden und auch nicht auf die gesellschaftlichen Verhältnisse einer spezifischen Epoche in der Geschichte, sondern spiegele die grundlegenden Bedürfnisse und Bestrebungen des menschlichen Wesens wider.
Und die Kunst der Zukunft werde auch nicht monolithisch sein. Im Gegenteil, Trotzki fasste sogar die Möglichkeit einer Bildung von “Parteien” ins Auge, die für oder gegen besondere Herangehensweisen in der Kunst oder bei Projekten plädierten, mit anderen Worten: eine lebendige und fortdauernde Debatte unter frei assoziierten gesellschaftlichen Produzenten.
In der zukünftigen Gesellschaft werde die Kunst in der Herstellung von Gütern, im Städtebau und in der Landschaftsgestaltung integriert sein. Weil sie nicht mehr der Bereich von Spezialisten sind wird, wird die Kunst, wie Bordiga es nannte, ein “Plan zum Leben für die menschliche Gattung” werden; sie wird die Fähigkeiten der Menschen ausdrücken, eine Welt zu errichten, die “im Einklang steht mit den Gesetzen der Schönheit”, wie Marx schrieb.
Bei der Landschaftsgestaltung werden die Menschen in Zukunft nicht versuchen, eine längst verloren gegangene ländliche Idylle wiederherzustellen. Die kommunistische Zukunft wird sich auf die fortschrittlichsten Entdeckungen der Wissenschaft und der Technologie stützen. Deshalb wird die Stadt und nicht so sehr das Dorf die Kerneinheit der Zukunft bilden. Doch Trotzki lehnte nicht die Befürwortung einer neuen Harmonie zwischen Stadt und Land und damit eines Endes der gewaltigen, überbevölkerten Megastädte ab, die zu solch einer zerstörerischen Wirklichkeit im dekadenten Kapitalismus geworden sind. Das wird durch Trotzkis Idee deutlich, dass z.B. Tiger und Dschungel von den künftigen Generationen geschützt und in Frieden gelassen werden.
Schließlich wagte Trotzki das Bild der Menschen in einer späteren, weit entfernten kommunistischen Gesellschaft zu umreißen. Diese Menschen werden nicht mehr beherrscht werden durch blinde Natur– und gesellschaftliche Kräfte. Da die Menschheit nicht mehr durch die Todesangst beherrscht wird, wird sie den Instinkten des Lebens freie Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Die Männer und Frauen der Zukunft werden mit Anmut und Präzision vorgehen, sie werden die Gesetze der Schönheit bei der “Arbeit, beim Gehen und im Spiel” befolgen. Der Durchschnittsmensch wird sich auf das “Niveau eines Aristoteles, Goethe oder Marx erheben”. Darüber hinaus werde die Menschheit bei der Erkundung und Beherrschung der Tiefen des Unbewussten nicht nur wirklich menschlich werden, sondern sie werde in einem gewissen Sinne auch zu einer neuen Gattung übergehen:
“Der Mensch wird sich zum Ziel setzen, seiner eigenen Gefühle Herr zu werden, seine Instinkte auf die Höhe des Bewusstseins zu heben, sie durchsichtig zu machen, mit seinem Willen bis in die letzten Tiefen seines Unbewussten vorzudringen und sich auf eine Stufe zu erheben – einen höheren gesellschaftlich–biologischen Typus, und wenn man will – den Übermenschen zu schaffen”.
Dies ist sicherlich einer der kühnsten Versuche seitens eines kommunistischen Revolutionärs, die mögliche Zukunft der Menschen zu beschreiben. Da er sich dabei fest auf das wirkliche Potenzial der Menschheit und auf die proletarische Weltrevolution als ihre unabdingbare Vorbedingung stützte, kann seine Auffassung nicht als ein Rückgriff auf den utopischen Sozialismus verworfen werden. Gleichzeitig gelang es ihm, die inspiriertesten Spekulationen der alten Utopisten auf eine solidere Grundlage zu stellen. Dies ist der Kommunismus als ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten.
Editorial: Die einzige Alternative; der Kampf der Arbeiterklasse zur Überwindung des Kapitalismus
- 2803 Aufrufe
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Wieder einmal war der Sommer von der Barbarei des Krieges gekennzeichnet. Zur selben Zeit als alle Nationen ihre Medaillen an den Olympischen Spielen zählten, häuften sich terroristische Attentate im Nahen Osten, Afghanistan, Libanon, Algerien, der Türkei und in Indien. In weniger als zwei Monaten ereigneten sich 16 Attentate in einem zunehmenden makabren Rhythmus und sie forderten unter der Bevölkerung Dutzende von Toten, währen sich der Krieg in Afghanistan und dem Irak verschärfte. In Georgien spielte sich jedoch die dramatischste Zuspitzung der kriegerischen Barbarei ab.
Einmal mehr haben im Kaukasus die Waffen gesprochen und es ist Blut geflossen. Während sich Bush und Putin gemeinsam an der olympischen Eröffnungszeremonie, dem Symbol des Friedens und der Völkerverständigung, grossartig gaben, hatten der georgische Präsident und Schützling des Weissen Hauses Saakaschwili und die russische herrschende Klasse ihre Soldaten aufeinander gehetzt und gegenseitig Massaker an der Zivilbevölkerung befohlen. Wie immer ist die lokale Bevölkerung (seien es Russen, Osseten, Abchasen oder Georgier) die Geisel der verschiedenen nationalen herrschenden Klassen. Auf beiden Seiten haben sich dieselben Horrorszenen abgespielt. In ganz Georgien ist die Zahl der in Lumpen lebenden Flüchtlinge in einer Woche um 115‘000 angestiegen. Und wie in jedem Krieg beschuldigt die eine Seite die andere der Verantwortung für den Ausbruch der Feindseligkeiten.
Doch die Verantwortung für diesen neuen Krieg und die Massaker beschränkt sich nicht nur auf die direkten Kriegstreiber vor Ort. Andere Staaten, die heute heuchlerisch die Rolle des Bedauerns über die Situation in Georgien spielen, haben ihre Finger gleichfalls im Blut getränkt und Grausamkeiten verübt. Seien es die USA im Irak, Frankreich mit dem Genozid 1994 in Ruanda oder Deutschland, das die Abspaltung von Slowenien und Kroatien vorangetrieben und damit 1992 wesentlich zur Auslösung des schrecklichen Krieges in Ex-Jugoslawien beigetragen hatte. Wenn heute die USA im Namen der „humanitären Hilfe“ Kriegsschiffe vor die Küsten des Kaukasus sendet, dann geschieht das nicht aus Sorge um die Menschen, sondern lediglich um dort ihre eigenen Interessen als imperialistischer Geier zu verteidigen.
Bewegen wir uns auf einen dritten Weltkrieg zu?
Was den Konflikt im Kaukasus kennzeichnet, ist die Zuspitzung der militärischen Spannungen unter den Grossmächten. Die beiden ehemaligen Blockführer, Russland und die USA stehen sich heute wieder in gefährlicher Art und Weise Kopf an Kopf gegenüber: die US-Zerstörer die angeblich zur „Lebensmittelversorgung“ Georgiens eingesetzt wurden, versuchen der russischen Seebasis im abchasischen Gudauta und dem von russischen Panzern besetzten Hafen von Poti entgegen zu wirken. Dieses Kopf an Kopf ist sehr besorgniserregend und man darf sich berechtigterweise verschiedene Fragen stellen: Was sind die Gründe dieses Krieges? Wird er in einen dritten Weltkrieg münden?
Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 war der Kaukasus immer eine Region von wichtiger geostrategischer Bedeutung für die Grossmächte. Der Konflikt schwelte schon seit langem. Der georgische Präsident, eine Schützling Washingtons, erbte einen Staat, der bei seiner Gründung 1991 vollständig von den USA unterstützt wurde, um für die „neue Weltordnung“ von Bush Senior einen Stützpunkt zu haben. Wenn nun Putin Saakaschwili eine Falle gestellt hat, in die dieser auch getappt ist, so hatte dies zum Ziel, Russlands Autorität in Kaukasus wieder herzustellen. Es war eine Antwort auf die Einkreisung Russlands seit 1991 durch die NATO-Staaten. Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 wurde Russland immer mehr isoliert, vor allem seit seine ehemaligen Vasallenstaaten (wie Polen) in die NATO eingetreten sind. Doch diese Isolation ist für Moskau nicht mehr akzeptierbar geworden, seit die Ukraine und Georgien ebenfalls ihren Beitritt in die NATO gestellt haben. Russland konnte vor allem auch die geplanten Antiraketen-Stützpunkte in Polen und Tschechien nicht mehr tolerieren. Die russische herrschende Klasse wusste genau, dass hinter diesem Projekt der NATO, das offiziell gegen den Iran gerichtet ist, eine Strategie gegen sie selber steckt. So ist die russische Offensive gegenüber Georgien in Wahrheit ein Versuch Moskaus, die Einkreisung zu durchbrechen. Russland profitierte nun von der schwierigen Situation der USA (dessen militärische Kräfte im Morast im Irak und Afghanistan stecken), die Hände für eine militärische Konteroffensive im Kaukasus gebunden zu haben. Dies lange Zeit nachdem es mit grösstem Aufwand seine Autorität in den grausamen Kriegen in Tschetschenien wiederherzustellen versucht hatte.
Trotz der Zuspitzung der militärischen Spannungen zwischen Russland und den USA, steht ein dritter Weltkrieg heute nicht auf der Tagesordnung. Heute gibt es nicht zwei formierte imperialistische Blöcke und keine stabilen militärischen Allianzen, wie dies in den zwei Weltkriegen des Zwanzigsten Jahrhunderts und während des Kalten Krieges der Fall gewesen war. Auch die erneute Feindschaft zwischen den USA und Russland bedeutet keinesfalls den Eintritt in einen neuen Kalten Krieg. Die Geschichte wiederholt sich nicht zweimal auf dieselbe Weise. Im Gegensatz zur den imperialistischen Spannungen zwischen den Grossmächten während des Kalten Krieges ist das heutige Kopf an Kopf zwischen Russland und den USA von einer Tendenz des „Jeder gegen Jeden“ geprägt, vom Verschwinden von Allianzen, das generell den Zerfall des Kapitalismus kennzeichnet.
Der „Waffenstillstand“ in Georgien bestätigt den Triumph der Herren des Kremls und die militärische Überlegenheit Russlands auf der militärischen Ebene. Es ist de facto eine erniedrigende Kapitulation Georgiens zu den Bedingungen Moskaus. Es ist ebenfalls für die USA, den „Onkel“ Georgiens, ein herber Rückschlag. Während Georgien für seine Allianz mit den USA einen grossen Tribut bezahlt hat (die Entsendung von 2000 Soldaten in den Irak und nach Afghanistan), konnten die USA als Gegenleistung lediglich eine moralische Unterstützung liefern, indem sie das Vorgehen Russlands verbal verurteilten, ohne jedoch nur den kleinen Finger dagegen rühren zu können.
Doch der gewichtigste Aspekt dieser Schwächung der amerikanischen Vormachtstellung liegt in der Tatsache, dass das Weisse Haus gezwungen war einen „europäischen Waffenstillstandsplan“ zu akzeptieren. Und noch schlimmer: ein Plan der von Moskau diktiert war. Während die USA ihre Machtlosigkeit zeigen musste, demonstrierte Europa in diesem Konflikt das heute erreichte Niveau des „Jeder gegen Jeden“. Da den USA die Hände gebunden waren, trat die europäische Diplomatie mit ihrem selbsternannten Chef dem französischen Präsidenten Sarkozy in Aktion, der wieder einmal mehr nur sich selber auf die Bühne bringen wollte – weit ab von jeglicher Weitsicht und als „Meister“ der schnellen Aktionen. Europa hat sich erneut als ein Korb von Krabben entblösst, in dem die gegensätzlichsten Interessen zwischen den einzelnen Staaten zum Vorschein kommen. Es gibt keinerlei Einheit in Europas Reihen. Einerseits mit Polen und den baltischen Staaten, die eifrige Verteidiger Georgiens spielen (weil sie ein halbes Jahrhundert lang unter der Bevormundung durch Russland litten und deshalb alle imperialistischen Bemühungen dieses Landes unterstützen) und andererseits Deutschland, das unter den resolutesten Gegnern der Integration Georgiens und der Ukraine in die NATO war, dies um den Einfluss der USA in der Region zurückzudrängen.
Der wichtigste Grund weshalb die grossen Staaten heute keinen dritten Weltkrieg entfesseln können liegt aber im Kräfteverhältnis zwischen den zwei wichtigsten sozialen Klassen der Gesellschaft: dem Proletariat und der Bourgeoisie. Im Gegensatz zu der Zeit vor den zwei Weltkriegen ist die Arbeiterklasse in den mächtigsten Ländern des Kapitalismus, in den USA und Europa, heute nicht bereit, sich widerstandslos als Kanonenfutter gebrauchen zu lassen und ihr Leben dem Kapital zu opfern. Mit der Rückkehr der offenen, permanenten Krise des Kapitalismus Ende der 1960er Jahre und dem historischen Wiedererwachen des Klassenkampfes der Arbeiterklasse eröffnete sich ein neuer Kurs hin zu Klassenkonfrontationen. In den bestimmenden kapitalistischen Ländern, vor allem in Europa und Nordamerika, kann die herrschende Klasse nicht mehr Millionen von Arbeitern hinter die nationalen Fahnen mobilisieren. Doch auch wenn heute die Bedingungen für einen dritten Weltkrieg nicht gegeben sind, so gilt es keinesfalls die Dramatik der heutigen historischen Situation zu unterschätzen. Der Krieg in Georgien brachte nicht nur das Risiko einer Entfesselung und Destabilisierung auf regionaler Ebene mit sich. Er hatte auch auf weltweiter Ebene Konsequenzen bezüglich des Kräfteverhältnisses der imperialistischen Staaten für die Zukunft. Das „Friedensabkommen“ ist nur Sand in die Augen. Es enthält in der Realität nur die Bestandteile einer neuen gefährlichen kriegerschen Eskalation, welche einen permanenten Brandherd vom Kaukasus bis hin zum Nahen Osten zu eröffnen droht.
Mit dem Erdöl und Gas des Kaspischen Meeres und von den Ländern Zentralasien, die sich meist nach der Türkei ausrichten, sind die Interessen der Türkei und des Irans in dieser Region zwar stark präsent. Doch zugleich hat die ganze Welt ihre Finger im Spiel. Ein Ziel der USA und der Länder Westeuropas Georgiens Unabhängigkeit von Moskau zu unterstützen, ist die Unterbindung von Russlands Liefermonopol des Öls vom Kaspischen Meer Richtung Westen durch die BTC-Pipeline (von Baku in Asarbeidschan, über Tiflis nach Ceyhan in der Türkei). Es sind aber vor allem bedeutende strategische Interessen welche in dieser Region eine Rolle spielen. Die grossen imperialistischen Mächte können die Leute im Kaukasus leicht als Kanonenfutter missbrauchen, weil diese Region ein verworrenes Mosaik verschiedenster ethnischer Gruppen ist. In dieser verworrenen Situation fällt es leicht, das Feuer des Krieges und des Nationalismus zu entfachen. Andererseits wiegt die dominierende Vergangenheit Russlands sehr schwer und führt zur Entstehung neuer und heftigerer imperialistischer Rivalitäten. Die Mobilisierung der baltischen Staaten und der Ukraine, als Atommacht und wesentlich grösseres Kaliber als Georgien, ist Besorgnis erregend.
Auch wenn die Perspektive nicht die eines dritten Weltkrieges ist, so stellt das „Jeder gegen Jeden“ einen genauso schrecklichen Irrsinn des Kapitalismus dar: dieses todkranke System ist in seiner Zerfallsphase, fähig die Menschheit durch ein blutiges Chaos zu zerstören.
Welche Alternative zum Niedergang des Kapitalismus?
Angesichts des kriegerischen Chaos heisst die historische Alternative mehr denn je „Sozialismus oder Barbarei“, also „proletarische Weltrevolution oder Zerstörung der Menschheit“. Im Kapitalismus ist Frieden unmöglich, denn der Kapitalismus trägt den Krieg in sich. Die alleinige Perspektive für die Zukunft der Menschheit ist der Kampf der Arbeiterklasse für die Überwindung des Kapitalismus.
Doch diese Perspektive kann sich nur verwirklichen, wenn die Arbeiterklasse es verweigert, sich als Kanonenfutter für die Interessen ihrer Ausbeuter missbrauchen zu lassen und wenn sie jeglichen Nationalismus vehement von sich weist. Die Arbeiterklasse muss sich in der täglichen Realität das alte Leitwort der Arbeiterbewegung „Die Arbeiterklasse hat kein Vaterland, Proletarier aller Länder vereinigt euch!“ zu Herzen nehmen. Angesichts der Massaker an der Bevölkerung und dem Ausbruch immer neuer Kriege darf die Arbeiterklasse nicht passiv bleiben. Sie muss die Solidarität mit ihrer Klasse in den unter dem Krieg leidenden Ländern zeigen, indem sie als erster Schritt jegliche Unterstützung für die eine oder andere kriegführende Seite klar zurückweist. Dazu ist es wichtig, ihre eigenen Klassenkämpfe zu entwickeln, solidarisch und vereint gegen die Ausbeuter in allen Ländern. Dies ist das einzige Mittel um wirklich gegen den Kapitalismus zu kämpfen, um seine Überwindung vorzubereiten und damit eine Gesellschaft aufzubauen ohne Grenzen und Kriege. Diese Perspektive der Überwindung des Kapitalismus ist keine Utopie, denn der Kapitalismus zeigt uns heute überall, dass er ein niedergehendes System ist.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks haben uns Bush Senior und die gesamte westliche „demokratische“ Bourgeoisie eine „neue Weltordnung“ versprochen (eingesetzt unter den Fittichen der USA), welche eine Ära der „Prosperität und des Friedens“ eröffne. Die herrschende Klasse hatte weltweit eine riesige Kampagne über die angebliche „Niederlage des Kommunismus“ entfesselt um damit der Arbeiterklasse glauben zu machen, die einzige Perspektive liege im Kapitalismus der freien Marktwirtschaft. Heute ist es immer ersichtlicher, dass der Kapitalismus am Ende ist und allen voran ist die grösste Weltmacht die Lokomotive des Konkurses der ganzen kapitalistischen Weltwirtschaft geworden (siehe dazu das Editorial in unserer Internationalen Revue Nr. 41). Dieser Konkurs drückt sich Tag für Tag in der Verschlechterung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse aus, und dies nicht lediglich in den „armen“, sondern genauso in den „reichen“ Ländern. In den USA zum Beispiel ist die Arbeitslosigkeit permanent am steigen und 6% der Bevölkerung ist ohne Arbeit. Seit dem Beginn der „subprime-Krise“ wurden 2 Millionen Arbeiterfamilien aus ihren Häusern geworfen, da sie ihre Immobilien-Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Und bis Jahresbeginn 2009 stehen eine Million Leute vor der Gefahr, ebenfalls auf die Strasse gestellt zu werden. In den ärmsten Ländern steht es noch dramatischer. Mit der Erhöhung der Preise für Grundnahrungsmittel werden die untersten Schichten immer mehr mit dem Horror des Hungers konfrontiert. Kein Wunder, dass dieses Jahr in Mexiko, Bangladesh, Haiti, Ägypten und den Philippinen Hungerrevolten ausgebrochen sind.
Angesichts all der unübersehbaren Tatsachen versuchen die Wortführer der herrschenden Klasse die Dinge zu verschleiern. In den Buchläden erscheinen immer mehr Schriften mit alarmierenden Titeln. Und vor allem die Erklärungen der Verantwortlichen der grossen Finanzinstitute können heute nichts mehr anderes als heuchlerisch ihre Besorgnis zur Schau stellen: „Wir sind mit noch niemals erlebt schwierigen ökonomischen Bedingungen und einer problematischen Geldpolitik konfrontiert“ (so der Präsident der amerikanischen FED am 22. August), „Für die Wirtschaft ist die Krise wie ein herannahender Tsunami“ (Jacques Attali, Ökonom und Politiker in Le Monde am 8. August), „Die heutige Konjunktur ist die schwierigste seit Jahrzehnten“ (schreibt HSCB, die grösste Bank der Welt am 5. August in Libération“).
Die Perspektive der Entfaltung des Kampfes der Arbeiterklasse
Der Zusammenbruch der stalinistischen Regime 1989 hat keinesfalls das Ende des Kommunismus bedeutet, sondern ganz im Gegenteil die Notwendigkeit des Kommunismus. Denn der Zusammenbruch des Staatskapitalismus in der UdSSR war in Wirklichkeit die spektakulärste Erscheinung des historischen Scheiterns des Weltkapitalismus. Es war das erste grosse Erschütterungszeichen der Sackgasse des kapitalistischen Systems. Heute trifft die zweite grosse Erschütterung mit voller Wucht den grössten aller „demokratischen“ Staaten, die USA. Mit der Beschleunigung der Wirtschaftskrise und der kriegerischen Konflikte erleben wir heute eine Beschleunigung der Geschichte.
Doch diese Beschleunigung findet ihren Ausdruck auch auf der Ebene der Arbeiterkämpfe, auch wenn diese viel unspektakulärer sind. Mit einer fotografischen Sichtweise kann man schnell meinen, dass sich nichts bewegt und die Arbeiter keinen Finger rühren. Die Arbeiterkämpfe scheinen durch einen solchen Blickwinkel der Dramatik der Situation nicht gerecht zu werden und man bekommt schnell eine pessimistische Sichtweise. Doch sichtbar ist eben oft nur die Spitze des Eisbergs. In der Realität, und dies haben wir in unserer Presse immer wieder unterstrichen, ist der Kampf der Arbeiterklasse seit 2003 in eine neue Dynamik eingetreten.<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Diese Kämpfe, welche sich an allen Ecken der Welt ereignet haben, zeichneten sich vor allem durch ein Wiedererlangen der aktiven Solidarität und das Eintreten einer neuen Generation in den proletarischen Klassenkampf aus (dies haben wir vor allem bei den Kämpfen der Studenten in Frankreich im Jahr 2006 erlebt).
Diese Dynamik zeigt, wie die internationale Arbeiterklasse den Weg ihrer historischen Perspektive wieder aufzunehmen beginnt, ein Weg der durch die riesige Kampagne über den „Tod des Kommunismus“ nach dem Zusammenbruch des Ostblocks enorm erschwert wurde. Heute können die Beschleunigung der Krise und die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse nur zur Entfachung ihrer Kämpfe drängen, zur Wiederbelebung ihrer Solidarität und zur Vereinigung auf der ganzen Welt. Vor allem die Inflation, welche den Kapitalismus erneut heimsucht, und die Preiserhöhungen die begleitet werden von einer Senkung der Löhne und Renten, tragen zu einer Zusammenführung der Arbeiterkämpfe bei.
Doch es gibt zwei Aspekte welche vorrangig das Bewusstsein der Arbeiterklasse über die Sackgasse dieses Systems und die Notwendigkeit des Kommunismus vorwärts treiben. Der erste Aspekt ist der Hunger und die Generalisierung der Lebensmittelknappheit, welche die Unfähigkeit des Kapitalismus zur Ernährung der Menschheit aufzeigen und die Notwendigkeit einer anderen Produktionsweise verdeutlichen. Der zweite Aspekt ist die Absurdität des Krieges, der tödliche Irrsinn des Kapitalismus, welcher in permanenten Massakern immer mehr Leute umbringt. Der Krieg löst zwar unmittelbar eine grosse Angst aus und die herrschende Klasse versucht die Arbeiterklasse mit allen Mitteln zu lähmen, ihr ein Gefühl der Machtlosigkeit zu geben und sie glauben zu machen, der Krieg sei ein Schicksal gegen das man nichts machen kann. Doch gleichzeitig schüren die Schweinereien all der grossen Mächte in den Kriegsgebieten (vor allem im Irak und Afghanistan) immer mehr ein Misstrauen innerhalb der Arbeiterklasse. Angesichts des Versinkens der USA im Morast des Iraks, entwickelt sich in der Bevölkerung der USA ein immer stärkeres Gefühl gegen den Krieg. Dieses Anti-Kriegs-Gefühl hat man auch in der „öffentlichen Stimmung“ und in Umfragen gesehen, nachdem die französische Bourgeoisie am 18. August 10 Soldaten in Afghanistan geopfert hatte.
Doch es existiert heute ein Nachdenken in der Arbeiterklasse, welches über dieses Misstrauen in der Bevölkerung hinausgeht. Das deutlichste Anzeichen dieses Nachdenkens ist das Auftauchen eines neuen proletarischen politischen Milieus rund um die Verteidigung internationalistischer Positionen gegen den Krieg (dies vor allem in Südkorea, den Philippinen, der Türkei, Russland und Lateinamerika)<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->. Der Krieg ist nicht etwa ein Schicksal, dem die Menschheit machtlos gegenübersteht. Der Kapitalismus ist auch kein ewiges System. Er trägt in sich auch nicht nur den Krieg, sondern auch die Bedingungen zu seiner eigenen Überwindung, den Keim einer neuen Gesellschaft ohne Grenzen und ohne Krieg.
Durch die Formierung einer weltweiten Arbeiterklasse hat der Kapitalismus seinen eigenen Totengräber geschaffen. Die ausgebeutete Klasse hat im Gegensatz zur Bourgeoisie in ihren Reihen keine gegensätzlichen Interessen zu verteidigen. Sie ist die alleinige Kraft in der Gesellschaft welche die Menschheit vereinigen kann, indem sie eine Welt auf der Basis von Solidarität und der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse schafft. Der Weg ist noch lange bis die Arbeiterklasse ihren Kampf den Notwendigkeiten der heutigen Situation anpassen kann. Doch im Rahmen der Beschleunigung der weltweiten ökonomischen Krise zeigen die Dynamik der gegenwärtigen Kämpfe und der Eintritt einer neuen Generation in den Klassenkampf, dass das Proletariat auf dem richtigen Weg ist. Heute sind die revolutionären Internationalisten noch eine kleine Minderheit. Aber sie zeigen die Fähigkeit eine Debatte zu führen und damit an vielen Orten präsent zu sein. Ihr klares Auftreten gegen die kriegerische Barbarei erlaubt auch eine Umformierung ihrer Kräfte und trägt zum Bewusstsein der gesamten Arbeiterklasse bei, dass der Kapitalismus dringend überwunden werden muss.
SW 12. September. 2008
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Siehe dazu unseren Artikel „17. Kongress der IKS, Resolution zur internationalen Lage“, Internationale Revue Nr. 40, und verschiedene Artikel in Weltrevolution Nr. 148.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Zusätzlich zu unserer “Resolution zur internationalen Lage”, die wir in der vorhergehenden Fussnote erwähnt haben, empfehlen wir dazu: “Bilanz des
17. Kongresses: Eine internationale Verstärkung des proletarischen Lagers”, ebenfalls in Internationale Revue, Nr. 40.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [51]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Interne Debatte der IKS: Die Gründe für das „Wirtschaftswunder“nach dem Zweiten Weltkrieg
- 4217 Aufrufe
Auch wenn die Realität und die Entwicklung der Krise seit dem Ende des „Wirtschaftswunders“ deutlich gezeigt haben, dass diese Periode eine Ausnahmesituation im dekadenten Kapitalismus war, so ist die Wichtigkeit der aufgetauchten Fragen keinesfalls zu unterschätzen. Diese Fragen führen uns zurück zum Kern der marxistischen Analyse und lassen uns auch den historisch begrenzten Charakter der kapitalistischen Produktionsweise verstehen. Der Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz und die Unüberwindbarkeit der heutigen Krise sind eine der objektiven Grundlagen für die revolutionäre Perspektive der Arbeiterklasse.
Der Hintergrund der Debatte: gewisse Widersprüche in unseren Analysen
Die erneute kritische Lektüre unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->, hat innerhalb unserer Organisation ein Nachdenken und eine Debatte mit verschiedenen Positionen ausgelöst. Fragen bezüglich der Auswirkungen des Krieges in der Dekadenz des Kapitalismus hat sich die Arbeiterbewegung – vor allem die Kommunistische Linke – in der Vergangenheit schon gestellt. Die Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus entwickelt die Idee, dass die Kriegszerstörungen im dekadenten Kapitalismus, vornehmlich die Weltkriege, einen Absatzmarkt für die kapitalistische Produktion erzeugen – den Wiederaufbau: „Aber gleichzeitig sind mit der erhöhten Nachfrage nach neuen Märkten die äusseren Märkte stark zurückgegangen. Deshalb musste der Kapitalismus auf Hilfsmittel wie Zerstörungen und die Produktion von Zerstörungsmitteln zurückgreifen, um die größten Verluste oder die Abnahme an „Lebensraum“ auszugleichen zu versuchen.“ (Kapitel: „Das Wachstum seit dem Zweiten Weltkrieg“, Seite 21, deutsche Ausgabe).
„In der massiven Zerstörung im Hinblick auf den Wiederaufbau entdeckte der Kapitalismus einen gefährlichen und vorübergehenden, aber wirkungsvollen Ausweg für seine neuen Absatzprobleme.
Die Zerstörungen des Ersten Weltkrieges haben nicht ausgereicht (…) Von 1929 an befand sich der Kapitalismus erneut in einer Krise.
Es sieht so aus, als ob diese Lehre gut verstanden worden sei: die Zerstörungen, welche durch den Zweiten Weltkrieg angerichtet wurden, waren grösser sowohl in ihrer Intensität, als auch in ihrer Ausdehnung (…) Russland, Deutschland, Japan, Grossbritannien, Frankreich und Belgien litten gewaltig unter den Auswirkungen des Krieges, der zum ersten Mal das Ziel verfolgte, das bestehende industrielle Potential systematisch zu zerstören. Der „Wohlstand“ Europas und Japans nach dem Kriege schien schon kurz nach dem Kriege systematisch mit eingeplant gewesen zu sein (Marshallplan–Hilfe, usw.) (Kapitel: „Der Zyklus Krieg–Wiederaufbau“, Seite 22)
Eine solche Idee findet sich auch in verschiedenen Texten der Organisation (vor allem in der Internationalen Revue), sowie bei unseren Vorgängern von Bilan, die in einem Artikel mit dem Titel „Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus“ schrieben: „Das folgende Massaker bildete ein beträchtliches Ventil für die kapitalistische Produktion und eröffnete „großartige“ Perspektiven. (…) Während der Krieg das große Ventil für die kapitalistische Produktion ist, ist es in „Friedenszeiten“ der Militarismus (d.h. alle Aktivitäten die mit der Vorbereitung auf den Krieg zu tun haben), der den Mehrwert fundamentaler Bereiche der vom Finanzkapital kontrollierten Produktion realisiert.“ (Bilan, Nr. 11, 1934 – wiederveröffentlicht in der Internationalen Revue Nr. 28, deutsch, Seiten 19 und 21).
In anderen Texten der IKS jedoch, die sowohl vor als auch nach der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus erschienen, wird eine andere Analyse über die Rolle des Krieges in der Dekadenz entwickelt. Sie stützt sich auf den „Rapport der Konferenz der Französischen Kommunistischen Linken vom Juli 1945“, für die der Krieg: „Ein unabdingbares Mittel des Kapitalismus war, welches ihm Entwicklungsmöglichkeiten eröffnete, in einer Epoche als diese Möglichkeiten auch vorhanden waren, aber nur mit gewalttätigen Methoden eröffnet werden konnten. Der Niedergang der kapitalistischen Welt aber, der historisch alle Möglichkeiten zu einer Entwicklung beendet hat, findet im modernen Krieg, im imperialistischen Krieg, den Ausdruck dieses Niedergangs. Es besteht keine weitere Möglichkeit zur Entwicklung der Produktion. Die Produktivkräfte werden auf dem Scheiterhaufen landen und es werden in einem immer schnelleren Rhythmus Ruinen über Ruinen hinterlassen.“ (Hervorhebung durch uns).
Der Bericht über den Historischen Kurs vom 3. Kongress der IKS<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> bezieht sich ausdrücklich auf diese Passage im Text der Französischen Kommunistischen Linken, sowie auch der Artikel „Krieg, Militarismus und imperialistische Blöcke in der Dekadenz des Kapitalismus“, den wir 1988 veröffentlichten.<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> Dort steht: „Was all diese Kriege auszeichnet, wie die zwei Weltkriege, ist, dass sie anders als diejenigen im vorangegangenen Jahrhundert keinen Fortschritt in der Entwicklung der Produktivkräfte ermöglichten. Sie hatten lediglich massive Zerstörungen und die Ausblutung der Länder in denen sie stattfanden zur Folge (ganz abgesehen von den schrecklichen Massakern).“
Der Rahmen der Debatte
All diese Fragen sind wichtig, weil die darauf gegebenen Antworten die theoretische Grundlage für die generelle politische Orientierung einer revolutionären Organisation ausmachen. Sie unterscheiden sich in ihrer Natur aber deutlich von Fragen, die eine Klassengrenze zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie darstellen, wie der Internationalismus, die arbeiterfeindliche Rolle der Gewerkschaften, die Beteiligung am parlamentarischen Zirkus, usw. Oder anders ausgedrückt: die verschiedenen Positionen sind vollumfänglich in Einklang mit der Plattform der IKS.
Wenn gewisse Ideen aus der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus kritisiert oder gar in Frage gestellt werden, so geschieht dies mit derselben Methode und im gleichen allgemeinen Rahmen der schon zur Zeit der Niederschrift dieser Broschüre vorhanden war und sich seither vertiefte.<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> Wir wollen das Wichtigste in Erinnerung rufen:
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
1. Die Anerkennung des Eintritts des Kapitalismus in seine dekadente Phase durch das Ausbrechen des Ersten Weltkrieges und die Anerkennung des unüberwindbaren Charakters der Widersprüche dieses Systems. Es handelt sich hier um ein Verständnis über die Ausdrücke und politischen Konsequenzen eines Wechsels in der historischen Periode, welche die Arbeiterbewegung damals mit den Worten „Das Zeitalter der Kriege und Revolutionen“ bezeichnete.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
2. Wenn wir die Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise über eine gewisse Periode betrachten, so müssen wir nicht mit einer Studie der einzelnen Sektoren (Nationen, Unternehmen, usw.) des Kapitalismus beginnen, sondern den Kapitalismus als ein weltweites Ganzes betrachten. Denn nur dies erlaubt ein Verständnis der verschiedenen Teile. Dies war auch die Methode von Marx als er die Reproduktion des Kapitals untersuchte und er festhielt: „Um den Gegenstand der Untersuchung in seiner Reinheit, frei von störenden Nebenumständen aufzufassen, müssen wir hier die gesamte Handelswelt als eine Nation ansehen und voraussetzen, dass die kapitalistische Produktion sich überall festgesetzt und sich aller Industriezweige bemächtigt hat.“ (Das Kapital, Band 1, Kapitel 22: „Verwandlung von Mehrwert in Kapital“, Ges. Werke, S. 607).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
3. „Im Gegenteil zu dem, was die Verehrer des Kapitals suggerieren, schafft die kapitalistische Produktion jedoch nicht automatisch und wunschgemäß die für ihr Wachstum notwendigen Märkte. Der Kapitalismus entwickelte sich zunächst in einer nichtkapitalistischen Welt, worin er die für seine Entfaltung notwendigen Märkte fand. Nachdem er aber seine Produktionsverhältnisse auf die ganze Erde ausgedehnt und in einem einzigen Weltmarkt vereinigt hatte, erreichte der Kapitalismus Anfang des 20. Jahrhunderts die Schwelle zur Sättigung derselben Märkte, die im 19. Jahrhundert noch seine ungeheure Ausdehnung ermöglicht hatten. Darüber hinaus wurde durch die wachsende Schwierigkeit des Kapitals, Märkte zu finden, wo sein Mehrwert realisiert werden kann, der Druck auf die Profitrate verstärkt und ihr tendenzieller Fall bewirkt. Dieser Druck wird durch den ständigen Anstieg des konstanten, „toten“ Kapitals (Produktionsmittel) zu Lasten des variablen, lebendigen Kapitals, die menschliche Arbeitskraft, ausgedrückt. Anfangs nur als Tendenz wirkend, wird der Fall der Profitrate schließlich immer spürbarer und zu einer zusätzlichen Bremse für den Akkumulationsprozess des Kapitals, also für die Funktionsweise des gesamten Systems.“ (Plattform der IKS Punkt 3: „Die Dekadenz des Kapitalismus“, Seite 3 der deutschen Ausgabe)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
4. Es war die Aufgabe von Rosa Luxemburg, auf der Grundlage der Arbeiten von Marx und der Kritik einer gewissen Unvollständigkeit dieser Arbeiten die These aufzustellen, dass zentral für die Bereicherung des Kapitalismus als Ganzes der Verkauf von eigens produzierten Waren auf außerkapitalistischen Märkten ist; das heißt, in Ökonomien, welche zwar Warenhandel betrieben, aber noch nicht in die kapitalistische Produktionsweise integriert waren: „In Wirklichkeit sind die realen Bedingungen bei der Akkumulation des Gesamtkapitals ganz andere als bei dem Einzelkapital und als bei der einfachen Reproduktion. Das Problem beruht auf folgendem: Wie gestaltet sich die gesellschaftliche Reproduktion unter der Bedingung, dass ein wachsender Teil des Mehrwerts nicht von den Kapitalisten konsumiert, sondern zur Erweiterung der Produktion verwendet wird? Das Draufgehen des gesellschaftlichen Produkts, abgesehen von dem Ersatz des konstanten Kapitals, in der Konsumtion der Arbeiter und Kapitalisten ist hier von vornherein ausgeschlossen, und dieser Umstand ist das wesentlichste Moment des Problems. Damit ist aber auch ausgeschlossen, dass die Arbeiter und die Kapitalisten selbst das Gesamtprodukt realisieren können. Sie können stets nur das variable Kapital, den verbrauchten Teil des konstanten Kapitals und den konsumierten Teil des Mehrwerts selbst realisieren, auf diese Weise aber nur die Bedingungen für die Erneuerung der Produktion in früherem Umfang sichern. Der zu kapitalisierende Teil des Mehrwerts hingegen kann unmöglich von den Arbeitern und Kapitalisten selbst realisiert werden. Die Realisierung des Mehrwerts zu Zwecken der Akkumulation ist also in einer Gesellschaft, die nur aus Arbeitern und Kapitalisten besteht, eine unlösbare Aufgabe.“ (Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Kapitel 26: „Die Reproduktion des Kapitals und ihr Milieu“, Ges. Werke, Bd. 5, S. 299).
Die IKS hat diese Analyse im Allgemeinen übernommen, was aber nicht heißt, dass innerhalb unserer Organisation nicht Positionen existieren können, welche die ökonomische Auffassung von Luxemburg kritisieren. Das werden wir im Speziellen noch bei einer der hier präsentierten Positionen sehen. Luxemburgs Analyse wurde zu ihrer Zeit nicht nur von den Reformisten bekämpft, welche nicht wahrhaben wollten, dass der Kapitalismus einer Katastrophe entgegen ging, sondern auch aus dem revolutionären Lager und dabei von nicht geringeren als Lenin und Pannekoek. Sie gingen zwar ebenfalls davon aus, dass der Kapitalismus eine historisch überlebte Produktionsweise geworden war, doch waren ihre Begründungen anders als die von Rosa Luxemburg.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
5. Das Phänomen des Imperialismus rührt exakt von der Notwendigkeit der entwickelten Länder her, außerkapitalistische Märkte zu erobern: „Der Imperialismus ist der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nichtkapitalistischen Weltmilieus.“ (Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Kapitel 31: „Schutzzoll und Akkumulation“, Ges. Werke Bd. 5 S. 391)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
6. Der historisch begrenzte Charakter der außerkapitalistischen Märkte bildet die ökonomische Grundlage für die Dekadenz des Kapitalismus. Der Erste Weltkrieg war Ausdruck eines solchen Widerspruchs. Die Aufteilung der Welt unter den Großmächten war abgeschlossen und diejenigen, welche mit ihrem Besitz an Kolonien am schlechtesten dastanden, hatten keine andere Wahl, als eine Neuaufteilung mit militärischen Mitteln zu suchen. Der Eintritt des Kapitalismus in seine niedergehende Phase war Beweis für die Unlösbarkeit der Widersprüche dieses Systems.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
7. Die Einführung von staatskapitalistischen Maßnahmen in der Dekadenz des Kapitalismus ist für die Bourgeoisie Hilfsmittelmittel, um die Krise zu bremsen und ihre schlimmsten Auswirkungen abzuschwächen. Sie versuchen damit zu verhindern, dass sich die Krise erneut in einer dermaßen brutalen Form zeigt wie dies 1929 der Fall gewesen war.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
8. In der Periode der Dekadenz ist der Kredit ein wesentliches Mittel, mit dem die herrschende Klasse versucht, dem Mangel an außerkapitalistischen Märkten entgegen zu wirken. Die Anhäufung von je länger je weniger kontrollierbaren Schulden, die wachsende Zahlungsunfähigkeit der verschiedenen kapitalistischen Sektoren und die sich steigernde Instabilität der Weltwirtschaft zeigen aber klar die Grenzen des Kredits.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
9. Ein typischer Ausdruck der Dekadenz des Kapitalismus auf ökonomischer Ebene sind die wachsenden unproduktiven Ausgaben. Sie zeigen, wie die unüberwindbaren Widersprüche dieses Systems die Entwicklung der Produktivkräfte hemmt: die Militärausgaben (Waffen und Militäreinsätze) angesichts der weltweit sich verschärfenden imperialistischen Spannungen; die Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Ausrüstung der Repressionsapparate, um letzten Endes gegen den Kampf der Arbeiterklasse vorzugehen; die Werbung, als Waffe des ökonomischen Wettkampfes auf dem übersättigten Markt; usw. Vom ökonomischen Standpunkt aus gesehen bilden solche Ausgaben einen totalen Verlust für das Kapital.
Die Positionen in der gegenwärtigen Debatte
Innerhalb der IKS existiert eine Position, die zwar mit unserer Plattform einverstanden ist, aber verschiedene Aspekte des Beitrags von Rosa Luxemburg zu den Gründen der ökonomischen Krise zurückweist.<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Für diese Position liegen die Gründe der Krise in einem anderen Widerspruch, der von Marx hervorgehoben wurde: dem tendenziellen Fall der Profitrate. Während sie Konzepte zurückweist (die vor allem von den Bordigisten und Rätisten vertreten werden) die davon ausgehen, dass der Kapitalismus automatisch und für alle Ewigkeit die Ausdehnung seiner eigenen Märkte aufrechterhalten kann, solange nur die Profitrate genug hoch ist, hebt sie hervor, dass der Grundwiderspruch des Kapitalismus nicht in den Grenzen der Märkte liegt (also der Form in der sich die Krise manifestiert), sondern in der Barriere zur Ausdehnung der Produktion.
Das Wesentliche zur Debatte über diese Position haben wir schon in Polemiken mit anderen Organisationen beschrieben (auch wenn es Unterschiede dabei gibt), in denen die Sättigung der Märkte und der Fall der Profitrate beleuchtet werden.<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> Dennoch, und das werden wir später noch sehen, existiert eine gewisse Übereinstimmung dieser Auffassung mit einer Position in der gegenwärtigen Debatte, die sich „Keynesianisch–Fordistischer Staatskapitalismus“ nennt und ebenfalls in diesem Text vorgestellt wird. Diese zwei Positionen gehen davon aus, dass es einen internen Markt innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse gab, welcher ein Faktor der Prosperität des so genannten „Wirtschaftswunders“ war. Sie analysieren das Ende dieser Periode als Produkt des „tendenziellen Falls der Profitrate“.
Die anderen Positionen in der Debatte beziehen sich auf den Rahmen der Analyse Rosa Luxemburgs über die zentrale Rolle des Mangels an außerkapitalistischen Märkten für die Krisen und die Dekadenz des Kapitalismus.
Aufgrund dieser Analyse hat ein Teil der Organisation erkannt, dass in unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus Widersprüche vorhanden sind. Die Broschüre bezieht sich auf denselben Rahmen, insofern sie die Akkumulation während des „Wirtschaftswunders“ in der Entstehung eines Wiederaufbau–Marktes sieht, der nicht außerkapitalistisch ist.
Aufgrund dieser Kritik entstand innerhalb der IKS eine Position – sie ist hier unter dem Titel „Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus“ aufgeführt –, welche Kritiken an unserer Broschüre formuliert. Vor allem kritisiert sie eine fehlende Genauigkeit und die mangelnde Beachtung des Marshall–Plans in der Erklärung des Wiederaufbaus. Zudem bezieht sie sich grundsätzlich „auf die Idee, dass die Prosperität der 50er und 60er Jahre durch die globale Situation der imperialistischen Machtverhältnisse und die Installierung einer permanenten Kriegswirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmt ist“.
Der Teil unserer Organisation, welcher die Analyse der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus über das „Wirtschaftswunder“ kritisiert, hat zwei verschiedene Interpretationen über die Prosperität dieser Periode formuliert. Die erste – hier unter dem Titel „Außerkapitalistische Märkte und Verschuldung“ präsentiert – misst den beiden Faktoren, welche die IKS in ihrer Vergangenheit schon analysiert hat, eine grössere Bedeutung zu.<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> Laut dieser Position „sind diese zwei Faktoren ausreichend, um sich die Prosperität des Wirtschaftswunders zu erklären“.
Die zweite Position – unter dem Titel „Keynesianisch–Fordistischer Staatskapitalismus“ präsentiert – „geht vom selben Punkt aus, der in der Broschüre über die Dekadenz entwickelt ist: die relative Sättigung der Märk-te 1914, verglichen mit dem Bedürfnis nach Akkumulation auf Weltebene. Sie entwickelt die Idee, dass nach 1945 das System mit der Einführung einer Variante des Staatskapitalismus antwortete, basierend auf einer Dreiteilung (Keynesianismus) der enorm gesteigerten Produktivität (Fordismus) in Profit, Staatsabgaben und Reallöhne“.
Das Ziel dieses ersten Artikels zur Debatte über die „30 glorreichen Jahre“ ist die nun erfolgte kurze Vorstellung dieser Positionen und im nachfolgenden Rest des Textes je eine zusammengefasste Präsentation der drei Positionen. Dies um die Debatte anzuregen<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->. Wir werden später ausführlichere Beiträge zu den verschiedenen Positionen publizieren oder auch andere, die im Laufe der Debatte auftauchen.
1. Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus
Der Ausgangspunkt dieser Position ist schon 1945 von der Französischen Kommunistischen Linken entwickelt worden. Sie hielt fest, dass seit 1914 die außerkapitalistischen Märkte, welche das notwendige Ausdehnungsgebiet des Kapitalismus während seiner aufsteigenden Periode dargestellt hatten, nicht mehr ausreich-ten: „Die jetzige Periode ist die der Dekadenz des Kapitalismus. Was bedeutet dies? Die herrschende Klasse lebte vor dem ersten imperialistischen Krieg mit einer ständigen Ausdehnung der Produktion, und sie konnte auch nicht anders. Nun ist sie am Punkt ihrer Geschichte angekommen, an dem sie diese Ausdehnung nicht mehr in derselben Weise fortführen kann. (…) Heute ist die Bourgeoisie in allen Teilen – abgesehen von unbrauchbaren entfernten Gebieten, von zu vernachlässigenden Übrigbleibseln der nichtkapitalistischen Welt, die ungenügend sind, um die weltweite Produktion aufzunehmen – Herrin dieser Welt, doch hat sie keine außerkapitalistische Länder mehr vor sich, die für ihr System neue Märkte darstellen könnten: Und damit beginnt auch ihre Dekadenz.“<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->
Die Geschichte der Weltwirtschaft seit 1914 ist der Versuch der herrschenden Klasse in den verschiedenen Ländern, dieses grundsätzliche Problem zu überwinden: wie den durch die kapitalistische Ökonomie produzierten Mehrwert akkumulieren, in einer Welt, die schon unter den großen imperialistischen Mächten aufgeteilt ist und in welcher der Markt die Gesamtheit des Mehrwertes nicht mehr aufnehmen kann? Und seit die imperialistischen Mächte nur noch auf Kosten ihrer Rivalen expandieren können, müssen sie sich nach der Beendigung eines Krieges schon wieder auf den nächsten vorbereiten. Die Kriegswirtschaft wird zum Überlebensprinzip der kapitalistischen Gesellschaft. „Die Kriegsproduktion hat nicht das Ziel, ein ökonomisches Problem zu lösen. Sie ist im Wesentlichen Ergebnis der Notwendigkeit des kapitalistischen Staates, sich einerseits gegen die enteigneten Klassen zu verteidigen und durch Gewalt deren Ausbeutung aufrecht zu erhalten und andererseits mit Gewalt ihre wirtschaftliche Position zu stärken und sie auf Kosten der anderen imperialistischen Staaten zu erweitern (…) Die Kriegsproduktion wird auch bestimmend für die industrielle Produktion und hauptsächliches ökonomisches Betätigungsfeld der Gesellschaft“ (Internationalisme: „Bericht über die internationale Lage“, Juli 1945).
Die Wiederaufbauperiode – das so genannte „Wirtschaftswunder“ – ist ein Teil dieser Geschichte.
Drei ökonomische Charakteristiken der Welt nach 1945 sollen hier hervorgehoben werden:
– Erstens: Es gab eine gewaltige wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft der USA, wie sie in der Geschichte des Kapitalismus noch nie vorgekommen war. Die USA stellten selbst die Hälfte der weltweiten Produktion und besaßen fast 80% der globalen Goldreserven. Sie waren der einzige kriegführende Staat, dessen Produktionsapparat unbeschädigt aus dem Krieg hervorkam. Ihr Bruttosozialprodukt verdoppelte sich zwischen 1940 und 1945. Sie absorbierten das gesamte, vom britischen Empire während all der Jahre der Kolonialherrschaft akkumulierte Kapital und dazu noch einen Teil desjenigen des französischen Kolonialreichs.
– Zweitens: In den Reihen der herrschenden Klasse der westlichen Länder existierte ein klares Bewusstsein darüber, dass der Lebensstandard der Arbeiterklasse notwendigerweise zu heben ist, um soziale Unruhen zu vermeiden, welche von den Stalinisten und dem gegnerischen russischen Block ausgenützt werden könnten. Die Kriegswirtschaft beinhaltete einen neuen Aspekt, dessen sich unsere Vorgänger der Französischen Kommunistischen Linken damals nicht vollständig bewusst waren: die verschiedenen sozialen Einrichtungen (Gesundheitswesen, Arbeitslosenversicherungen, Pensionen, usw.), welche die herrschende Klasse – vor allem die des westlichen Blocks – zu Beginn des Wiederaufbaus in den 1940er Jahren eingerichtet hatten.
– Drittens: Der Staatskapitalismus, der vor dem Zweiten Weltkrieg eine Tendenz hin zur Autarkie der verschiedenen nationalen Ökonomien eingenommen hatte, war jetzt in die Struktur von imperialistischen Blöcken integriert, welche die wirtschaftlichen Beziehungen unter den Staaten bestimmte (Bretton Woods für den amerikanischen Block, COMECON für den russischen Block).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Während des Wiederaufbaus erfuhr der Staatskapitalismus eine qualitative Entwicklung: Der Anteil des Staates in der nationalen Ökonomie wurde dominierend.<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> Selbst heute, nach 30 Jahren des so genannten „Liberalismus“ bilden die Staatsausgaben einen Anteil zwischen 30–60% des Bruttoinlandproduktes der Industrieländer.
Dieses neue Gewicht des Staates war ein Übergang von Quantität in Qualität. Der Staat war nicht mehr nur „ausführendes Organ“ der herrschende Klasse, er war auch der größte Arbeitgeber und stellte den größten Markt. In den USA zum Beispiel wurde das Pentagon der größte Arbeitgeber des Landes (mit 3 bis 4 Millionen zivilen und militärischen Beschäftigten). Dadurch spielte er eine gewichtige Rolle in der Wirtschaft und ermöglichte es, die bestehenden Märkte noch besser auszuschöpfen.
Die Inkraftsetzung des Bretton–Woods–Abkommens ermöglichte auch die Einführung eines verfeinerten und weniger anfälligen Kreditsystems im Vergleich zur Vergangenheit: Das Konsumkreditwesen wurde ausgebaut, und die ökonomischen Institutionen, die vom amerikanischen Block gegründet wurden (IWF, Weltbank, GATT) ermöglichten die Verhinderung von Finanz– und Bankenkrisen.
Die enorme wirtschaftliche Überlegenheit der USA erlaubte es der amerikanischen Bourgeoisie, schrankenlos Geld auszugeben, um ihre militärische Überlegenheit gegenüber dem russischen Block zu sichern: Sie unterstützten zwei blutige und kostspielige Kriege (Korea und Vietnam), Projekte à la Marshall–Plan und fremde Investitionen für den Wiederaufbau der ruinierten europäischen Wirtschaft Europas und Asiens (vor allem in Korea und Japan). Doch diese enorme Anstrengung – nicht durch die „klassische“ Funktionsweise des Kapitalismus bestimmt, sondern durch die imperialistische Konfrontation, welche die Dekadenz dieses Systems kennzeichnet – endete im Ruin der amerikanischen Wirtschaft. 1958 befand sich der amerikanische Staatshaushalt bereits in einem Defizit, und 1970 besaßen die USA nur noch 16% der weltweiten Goldreserven. Das Bretton–Woods–System erlitt Schiffbruch, und die Welt stürzte in eine Krise, von der sie sich bis heute nicht erholt hat.
2. Außerkapitalistische Märkte und Verschuldung
Weit davon entfernt, die Produktivkräfte in einer vergleichbaren Art und Weise zu steigern, wie dies in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus der Fall gewesen war, charakterisierte sich das „Wirtschaftswunder“ durch eine enorme Verschwendung von Mehrwert. Dies war ein Zeichen für die Fesselung der Entwicklung der Produktivkräfte, welche die Dekadenz des Kapitalismus kennzeichnet.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Der Wiederaufbau nach dem Ersten Weltkrieg eröffnete eine Phase der Prosperität, die aber nur einige Jahre anhielt. Während dieser Zeit bildeten Verkäufe auf außerkapitalistischen Märkten die notwendige Grundlage für die Akkumulation, so wie es schon vor Ausbruch des Konfliktes der Fall gewesen war. Auch wenn die Welt damals schon unter den größten Industriestaaten aufgeteilt war, so war sie noch weit davon entfernt, von der kapitalistischen Produktionsweise gänzlich beherrscht zu werden. Trotzdem war die Aufnahmefähigkeit der außerkapitalistischen Märkte ungenügend, gemessen an der Menge der in den industrialisierten Ländern hergestellten Waren. Der Aufschwung brach deshalb durch der Krise von 1929 schnell an der Überproduktion zusammen.
Ganz anders dagegen war die Periode des auf den Zweiten Weltkrieg folgenden Wiederaufbaus, der die besten wirtschaftlichen Kennzahlen der aufsteigenden Phase des Kapitalismus in den Schatten stellte. Während mehr als zwei Jahrzehnten entwickelte sich ein anhaltendes Wachstum aufgrund der größten Produktivitätssteigerungen in der Geschichte des Kapitalismus. Dies war vor allem der Perfektionierung der Fließbandproduktion (Fordismus), der Automatisierung der Produktion und ihrer größtmöglichen Ausweitung geschuldet.
Doch genügt es nicht, nur Waren zu produzieren, man muss sie auch auf dem Markt verkaufen können. Der Erlös aus dem Verkauf von Waren, die im Kapitalismus produziert werden, dient der notwendigen Erneuerung der Produktionsmittel und dem Kauf der Arbeitskraft (Löhne der Arbeiter). Er dient also der einfachen Reproduktion des Kapitals (ohne Ausweitung der Produktionsmittel oder der Konsumtion), er muss aber auch die unproduktiven Kosten abdecken. Diese reichen von den Rüstungsausgaben bis hin zum Lebensunterhalt der Kapitalisten und beinhalten zahlreiche andere Kosten, auf die wir noch zurückkommen werden. Wenn nach all dem ein positiver Saldo übrig bleibt, kann dieser der Akkumulation des Kapitals zugeführt werden.
Bei den jährlich gemachten Verkäufen im Kapitalismus ist der Anteil, welcher der Akkumulation des Kapitals zufließt und der seine Besitzer somit bereichert, notwendigerweise beschränkt, weil er den Überschuss nach Abzug all der anderen notwendigen Ausgaben darstellt. Historisch gesehen stellt er nur einen kleinen Prozentsatz des jährlich produzierten Reichtums dar<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> und korrespondiert im Wesentlichen mit den Verkäufen auf außerkapitalistischen Märkten (interne und externe)<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]-->. Dies ist effektiv das einzige Mittel für den Kapitalismus, sich zu entwickeln (neben der Ausbeutung der außerkapitalistischen Ökonomien, ob legal oder illegal). Oder mit anderen Worten: um nicht in einer Situation zu sein, in der „die Kapitalisten ja selbst nur unter sich ihre Waren auszutauschen und aufzuessen haben“ was, wie es Marx ausdrückte, „keineswegs eine Wertsteigerung des Kapitals erlaubt“: „Wie könnte es sonst an Nachfrage für dieselben Waren fehlen, deren die Masse des Volks ermangelt, und wie wäre es möglich, diese Nachfrage im Ausland suchen zu müssen, auf fernern Märkten, um den Arbeitern zu Hause das Durchschnittsmaß der notwendigen Lebensmittel zahlen zu können? Weil nur in diesem spezifischen, kapitalistischen Zusammenhang das überschüssige Produkt eine Form erhält, worin sein Inhaber es nur dann der Konsumtion zur Verfügung stellen kann, sobald es sich für ihn in Kapital rückverwandelt. Wird endlich gesagt, dass die Kapitalisten ja selbst nur unter sich ihre Waren auszutauschen und aufzuessen haben, so wird der ganze Charakter der kapitalistischen Produktion vergessen und vergessen, dass es sich um die Verwertung des Kapitals handelt, nicht um seinen Verzehr“.<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->
Mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz wurden die außerkapitalistischen Märkte immer unzureichender, doch sie verschwanden nicht einfach und ihre Lebensfähigkeit hing, gleich wie in der aufsteigenden Phase, vom Fortschreiten der Industrialisierung ab. Die außerkapitalistischen Märkte wurden immer unfähiger, die wachsende Produktion an Gütern durch den Kapitalismus aufzunehmen. Das Resultat war eine Überproduktion und mit ihr die Vernichtung eines Teils der Produktion, außer wenn der Kapitalismus den Kredit einsetzte, um dieser Situation entgegen zu wirken. Doch je mehr sich die außerkapitalistischen Märkte verringern, desto weniger können die Kredite zurückbezahlt werden.
Das zahlungskräftige Feld für das Wachstum des fast 30 Jahre andauernden „Wirtschaftswunders“ entstand aus einer Kombination von Ausbeutung dieser immer noch existierenden außerkapitalistischen Märkte und einer Verschuldung, weil erstere nicht fähig waren, die die Gesamtheit des Angebots aufzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg (außer einmal mehr die Ausbeutung der außerkapitalistischen Reichtümer), der die Expansion des Kapitalismus in dieser Periode ermöglichte, so wie es auch in allen anderen Perioden der Fall ist. Deshalb leistete das „Wirtschafswunder“ seinen eigenen kleinen Beitrag am heutigen Schuldenberg, der niemals zurückbezahlt werden kann und wie ein Damoklesschwert über dem Kapitalismus schwebt.
Ein anderes Charakteristikum des „Wirtschaftswunders“ ist das Gewicht der unproduktiven Kosten in der Wirtschaft. Sie bilden einen bedeutenden Anteil der Staatsausgaben, die ab Ende der 1940er Jahre in den meisten industrialisierten Staaten beträchtlich anwuchsen. Dies war das geschichtliche Ergebnis der Entwicklung hin zum Staatskapitalismus und dabei vor allem des Gewichts des Militarismus in der Wirtschaft, welches nach dem Zweiten Weltkrieg sehr hoch war, und zugleich auch das Ergebnis einer keynesianischen Politik, die eine künstliche Nachfrage schaffte. Wenn eine Ware oder ein Angebot unproduktiv ist, bedeutet dies, dass deren Gebrauchswert nicht in den Produktionsprozess einfließen kann<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->, um so an der einfachen oder erweiterten Reproduktion des Kapitals teilzunehmen. Wir müssen also auch diejenigen Kosten als unproduktiv betrachten, welche im Zusammenhang mit einer Nachfrage innerhalb des Kapitalismus stehen, die aber für die einfache und erweiterte Reproduktion nicht notwendig sind. Dies war während des „Wirtschaftswunders“ im Speziellen der Fall bei den schrittweisen Lohnerhöhungen in Anpassung an die Produktivitätssteigerung der Arbeit, von der gewisse Teile der Arbeiterklasse in bestimmten Ländern „profitiert“ hatten und in denen eine keynesianische Doktrin vollzogen wurde. Die Ausbezahlung von Löhnen, welche höher sind als das strikt Notwendige zur Wiederherstellung der Arbeitskraft ist, genauso wie die miserablen Arbeitslosengelder oder die unproduktiven Ausgaben des Staates, im Grunde eine Verschwendung von Kapital, das nicht mehr an der Wertsteigerung des globalen Kapitals teilnehmen kann. Mit anderen Worten: Das Kapital welches in unproduktive Ausgaben gesteckt wird ist, wie auch immer sie aussehen, sterilisiert.
Die Bildung eines internen Marktes durch den Keynesianismus als eine unmittelbare Lösung zum Absatz der massiven industriellen Produktion hat Illusionen in eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums wie zu Zeiten des aufsteigenden Kapitalismus geweckt. Doch seit der Markt komplett abgenabelt wurde von den Bedürfnissen der Wertsteigerung des Kapitals, hatte dies die Sterilisierung eines beträchtlichen Teils des Kapitals zur Folge. So weiterzufahren war nur durch eine Verbindung von verschiedenen und sehr außergewöhnlichen Faktoren möglich, die aber nicht dauerhaft sein konnten:
– ein Produktivitätsanstieg der Arbeit, welcher bei einer gleichzeitigen Finanzierung unproduktiver Ausgaben genügend groß war, um einen Überschuss abzuwerfen für die Weiterführung der Akkumulation;
– die Existenz von zahlungskräftigen Märkten – die entweder außerkapitalistisch oder das Resultat einer Verschuldung waren – und eine Realisierung des Überschusses ermöglichten.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Eine Steigerung der Produktivität wie zu Zeiten des „Wirtschaftswunders“ ist seither nicht mehr erreicht worden. Auch wenn dies eintreffen würde, so zeigt das totale Verschwinden der außerkapitalistischen Märkte und die Tatsache, dass praktisch eine Grenze zur Wiederbelebung der Wirtschaft durch eine noch höhere weltweite Verschuldung (welche bereits gigantisch ist) erreicht ist, die Unmöglichkeit der Wiederholung einer solchen Wachstumsperiode.
Im Gegensatz zur Analyse in unserer Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus bildete der Markt des Wiederaufbaus keinen Faktor, der den Aufschwung während des „Wirtschaftswunders“ nach dem Zweiten Weltkrieg erklären könnte. Am Ende des Zweiten Weltkrieges bildete der Wiederaufbau des Produktionsapparates an sich keinen außerkapitalistischen Markt und kreierte selbst keinen Wert. Er war großteils das Resultat eines Transfers von Reichtum, der bereits in den USA akkumuliert war, in diejenigen Länder, die den Wiederaufbau brauchten. Die Finanzierung wurde durch den Marshall–Plan übernommen, und somit war es im Wesentlichen ein Geschenk aus der staatlichen Schatztruhe der USA. Ein solcher Markt des Wiederaufbaus genügt auch nicht als Erklärung für die kurze Aufschwungsphase nach dem Ersten Weltkrieg. Dies ist der Grund, weshalb das Schema „Krieg–Wiederaufbau/Prosperität“, das zwar empirisch der Realität des dekadenten Kapitalismus entspricht, kein ökonomisches Gesetz darstellt, nach dem es einen Markt des Wiederaufbaus gäbe, der den Kapitalismus bereichern könnte.
3. Keynesianisch–Fordistischer Staatskapitalismus
Unsere Analyse über die Triebkräfte hinter den Nachkriegsboom beruht auf einer Reihe von objektiven Feststellungen. Hier die Wichtigsten:
Die weltweite Pro–Kopf–Produktion verdoppelte sich während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]-->, und die industriellen Wachstumsraten stiegen kontinuierlich an, bis sie am Vorabend des Ersten Weltkrieges ihren Höhepunkt erreichten<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]-->. Zu diesem Zeitpunkt erreichten die Märkte, die dem Kapitalismus als Expansionsfeld gedient hatten, einen Grad relativer Sättigung, gemessen am weltweiten Bedürfnis zur Akkumulation. Dies war der Beginn der dekadenten Phase des Kapitalismus, welche durch zwei Weltkriege, die größte je erlebte Überproduktionskrise (1929–33) und einen massiven Einbruch im Wachstum der Produktivkräfte gekennzeichnet war (sowohl bei der industriellen Produktion als auch beim weltweiten Pro–Kopf–Produkt halbieren sich die Wachstumszahlen zwischen 1913 und 1945 fast auf die Hälfte: 2,8% bzw. 0,9% pro Jahr).
Doch dies hielt den Kapitalismus keineswegs davon ab, nach dem Zweiten Welzkrieg fast 30 Jahre lang eine Zeit des enormen Wachstums zu erleben. Das weltweite Pro–Kopf–Produkt verdreifachte sich, während sich die industrielle Produktion mehr als verdoppelte (2,9% bzw. 5,2% pro Jahr). Diese Zahlen sind nicht nur höher als die während der aufsteigenden Periode des Kapitalismus, auch die Reallöhne steigerten sich vier mal schneller (sie erhöhten sich um das Vierfache, während sie sich in der Zeit zwischen 1850 und 1913, die doppelt so lang war, nur knapp verdoppelt hatten)!
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Wie konnte ein solches „Wirtschaftswunder“ geschehen?
– nicht durch eine noch übrig gebliebene außerkapitalistische Nachfrage, da diese schon 1914 ungenügend war und sich danach noch verkleinerte<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]-->;
– nicht durch staatliche Verschuldung und defizitäre Budgets, da diese in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ stark zurückgingen<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]-->;
– nicht durch Kredite, da diese nach Rückkehr der Krise erst wirklich zum Zuge kamen und anwuchsen<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]-->;
– nicht durch die Kriegsproduktion, weil sie unproduktiv ist: die am meisten aufgerüsteten Länder waren am wenigsten leistungsfähig und umgekehrt;
– nicht durch den Marshall–Plan, da er in seiner Wirkung und Dauer begrenzt war<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]-->;
– nicht durch die Kriegszerstörungen, da diejenigen des Ersten Weltkrieges keinerlei Prosperität erzeugt hatten<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]-->;
– nicht durch ein Anwachsen des Gewichtes des Staates in der Wirtschaft, da es sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen verdoppelt hatte, aber keine solche Wirkung erzeugte<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]-->, da sein Anteil 1960 geringer war (19%) als 1937 (21%) und es große unproduktive Ausgaben beinhaltete.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Die Erklärungen für das „Wirtschaftswunder“ liegen woanders. Vor allem weil: (a) die Wirtschaft nach dem Krieg ausgeblutet war, (b) die Kaufkraft aller wirtschaftlichen Akteure auf einem Tiefststand war, (c) Letztere gewaltig verschuldet waren, (d) die enorme Macht der USA auf einer unproduktiven Kriegswirtschaft basierte, welche große Schwierigkeiten hatte, sich wieder in eine zivile Wirtschaft umzuwandeln, und (e) dieses „Wirtschaftswunder“ eintrat, obwohl große Mehrwertmassen in die unproduktiven Ausgaben flossen!
In Wirklichkeit ist dieses Wunder keines mehr, wenn wir die Analysen von Marx über die Produktivitätssteigerungen<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]--> und die Beiträge der Kommunistischen Linken zur Entwicklung des Staatskapitalismus in der Dekadenz des Kapitalismus miteinander verbinden. Diese Periode zeichnete sich im Wesentlichen durch folgendes aus:
a) Eine nie vorher in der Geschichte des Kapitalismus erlebte Produktivitätssteigerung. Eine Steigerung die sich auf die Verallgemeinerung und Entwicklung der Fließbandproduktion stützte (der Fordismus).
b) Ein kontinuierlicher Anstieg der Reallöhne, eine Vollbeschäftigung und die Einführung eines indirekten Lohnes mittels verschiedener Sozialleistungen. Überdies waren die Länder mit den größten Lohnsteigerungen auch die mit den stärksten Wachstumszahlen in der Gesamtwirtschaft, und umgekehrt.
c) Eine Übernahme der gesamten Produktion durch den Staat und starke Interventionen desselben in die Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit<!--[if !supportFootnotes]-->[25]<!--[endif]-->.
d) All diese keynesianischen Maßnahmen wurden in hohem Masse auf internationalem Niveau organisiert durch OECD, GATT, IWF, Weltbank, usw.
e) Schlussendlich war im Gegensatz zu anderen Perioden das „Wirtschaftswunder“ auf diejenigen Länder mit einer bereits entwickelten Wirtschaft konzentriert (und dies bei einem relativ geringen Austausch zwischen den Ländern der OECD und dem Rest der Welt), und es erfolgten keine bemerkenswerten Produktionsauslagerungen in Billiglohn–Länder trotz starkem Lohnanstieg und einer Vollbeschäftigung. Die „Globalisierung“ und die Produktionsauslagerungen waren Phänomene, die erst in den 1980er und vor allem dann in den 1990er Jahren stattfanden.
Durch die zwangsmäßige und proportionale Dreiteilung der Produktivitätssteigerung zwischen dem Profit, den Steuern und den Löhnen war der keynesianisch–fordistische Staatskapitalismus fähig, die Vollendung des Akkumulationszyklus’ mittels eines Angebots von Waren und Dienstleistungen zu gesenkten Kosten (Fordismus) und einer gesteigerten zahlungskräftigen Nachfrage, die ebenfalls auf dieser Produktivitätssteigerung beruhte (Keynesianismus), sicher zu stellen. So waren die Märkte garantiert; die Krise kehrte in der Form eines erneuten Falls der Profitrate zurück, der eine Folge der Erschöpfung der fordistischen Produktivitätssteigerungen war, die sich zwischen dem Ende der 1960er Jahre und 1982 um die Hälfte verringerten<!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!--[endif]-->. Dieser drastische Fall der Rentabilität des Kapitals führte zu einer Demontage der Nachkriegspolitik zugunsten eines deregulierten Staatskapitalismus zu Beginn der 1980er Jahre. Auch wenn diese Kehrtwende zu einem spektakulären Anstieg der Profitraten, als Folge der Lohnkürzungen, führte, so bedeutete die daraus resultierende Abnahme einer zahlungskräftigen Nachfrage, dass die Akkumulationsrate und das Wachstum zurückgingen<!--[if !supportFootnotes]-->[27]<!--[endif]-->. Seither ist der Kapitalismus mit einer strukturellen Schwäche bei der Produktivitätssteigerung dazu gezwungen, vor allem Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen auszuüben. Dies um noch zu einem Anstieg der Profite zu gelangen, was aber wiederum zu einem Rückgang zahlungskräftiger Märkte führt. Die Wurzeln dieser Entwicklung sind:
a) permanente Überkapazitäten und eine permanente Überproduktion;
b) ein zunehmender Rückgriff auf die Verschuldung, um der verringerten Nachfrage entgegenzuwirken;
c) Auslagerungen auf der Suche nach billigen Arbeitskräften;
d) eine Globalisierung um ein Maximum an Exporten zu erzielen;
e) eine sich ständig wiederholende finanzielle Instabilität durch spekulative Geschäfte, da Investitionen in sich ausdehnende Bereiche nicht mehr möglich sind.
Heute ist die Wachstumsrate auf das Niveau der Zeit zwischen den Weltkriegen gesunken, und eine Neuauflage der „30 glorreichen Jahre des Wirtschaftswunders“ ist unmöglich. Der Kapitalismus ist dazu verdammt, in einer zunehmenden Barbarei zu versinken.
Die Wurzeln und Auswirkungen dieser Analyse, auf die hier nicht genauer eingegangen werden kann, werden wir später darlegen. Dies erfordert eine Rückkehr zu einigen unserer Analysen, damit wir zu einem breiteren und kohärenteren Verständnis der Funktionsweise und Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise gelangen<!--[if !supportFootnotes]-->[28]<!--[endif]-->.
Eine offene Debatte für das internationalistische Milieu
Wie unsere Vorgänger von Bilan und der Französischen Kommunistischen Linken behaupten wir nicht, „die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben“<!--[if !supportFootnotes]-->[29]<!--[endif]-->. Wir sind uns bewusst, dass die Debatten, die in den Reihen unserer Organisation geführt werden, von kritischen und konstruktiven Anregungen von außen nur profitieren können. Aus diesem Grunde begrüßen wir alle an uns gerichtete Beiträge und werden sie in unsere kollektive Reflexion einbeziehen.
IKS
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Zwischen 1950 und 1973 hatte sich das weltweite pro Kopf Bruttosozialprodukt jährlich um 3% erhöht, während es zwischen 1870 und 1913 in einem Rhythmus von 1,3% gewachsen war (Angus Madison: „Die Weltwirtschaft“, OECD, 2001, S. 284).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Sie ist im Wesentlichen eine Sammlung von Artikeln, die wir im Januar 1981 veröffentlicht haben.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> Dritter Kongress der IKS, International Review Nr. 18, 1979, (engl./franz./span. Ausgabe)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> International Review Nr. 52, 1988, (engl./franz./span. Ausgabe)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> Siehe die Serie in der International Review „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen“ und dabei vor allem den Artikel in Nr. 56 (engl./franz./span. Ausgabe), sowie auch die Präsentation der Resolution über die internationale Situation vom 8. Kongress der IKS, die sich auf die Frage des Gewichts der Verschuldung auf die Weltwirtschaft konzentriert, Internationale Revue Nr. 11, (deutsch).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Diese Minderheitsposition existiert schon seit langem in unserer Organisation – die Genossen, welche sie heute vertreten, taten dies schon zum Zeitpunkt ihres Eintritts in die IKS – und hat diese Genossen auch nicht daran gehindert, an allen unseren Aktivitäten teilzunehmen, an unseren Interventionen sowie der theoretisch-politischen Debatte.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> Siehe dazu den zweiteiligen Artikel „Antwort an die CWO zum Krieg in der Dekadenz des Kapitalismus“, International Review Nr. 127 und 128 (engl./franz./span. Ausgabe).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> Die Ausbeutung der außerkapitalistischen Märkte ist schon in der Broschüre Die Dekadenz des Kapitalismus beschrieben. Sie wurde im 6. Artikel der Serie „Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen“ wieder aufgegriffen und unterstrichen (International Review Nr. 56, engl./franz./span. Ausgabe). Dort wird der Faktor der Verschuldung beschrieben, der „Wiederaufbau-Markt“ ist jedoch nicht erwähnt.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]--> Es gibt innerhalb dieser Positionen auch Nuancen, wie die Debatte bisher zeigte. Wir können aber im Rahmen dieses Artikels nicht darauf eingehen. Sie können in die zukünftigen Diskussionsbeiträge einfliessen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]--> Internationalisme, 1. Januar 1945: „Thesen über die internationale Lage“
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> Alleine in den USA waren die Ausgaben des Staates, welche 1930 noch 3% des BIP ausmachten, in den 1950 und 60er Jahren auf 20% des BIP angewachsen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> Als Beispiel: Während der Periode zwischen 1817-1913 betrugen die Verkäufe auf außerkapitalistischen Märkten im Jahresdurchschnitt 2,3% der weltweiten Produktion (errechnet aufgrund der Entwicklung der weltweiten Produktion in derselben Zeit. Quelle: https://www.theworldeconomy.org/publications/worldeconomy/frenchpdf/Madd... [331]).
Es handelt sich dabei um einen Durchschnitt, und dieser Wert ist somit geringer als in den Jahren des großen Wachstums, welches die Jahre unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg kennzeichnete.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> Es ist hier nicht von großem Belang, ob die Verkäufe schlussendlich produktiv sind oder nicht, wie dies bei der Rüstungsproduktion der Fall ist.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> Marx; „Das Kapital“ Band 3, Kapitel 15, Überfluss an Kapital bei Überfluss an Bevölkerung, MEW Bd. 25 S.267/68.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]--> Um dies zu illustrieren, genügt es, auf den Unterschied im Endgebrauch einer Waffe, eines Inserates oder eines gewerkschaftlichen Schulungskurses einerseits und andererseits eines Werkzeuges, von Lebensmitteln, Schul- und Universitätskursen, medizinischer Versorgung, usw. hinzuweisen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> Von 0,53% pro Jahr zwischen 1820-70 auf 1,3% zwischen 1870-1913 (Angus Maddison, L’économie mondiale, OECD S. 284)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[17]<!--[endif]--> Jährliche Wachstumsraten der weltweiten industriellen Produktion:
1786–1820: 2,5%
1820–1840: 2,9%
1840–1870: 3,3%
1870–1894: 3,3%
1894–1913: 4,7%
(aus W.W. Rostow, The World Economy, S. 662)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[18]<!--[endif]--> Während diese Kaufkraft zu Beginn der kapitalistischen Entwicklung wichtig war, betrug sie 1914 innerhalb der Grenzen der entwickelten Länder nur noch zwischen 5-20% 1914 und wurde 1945 mit 2-12% marginal (Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975, A Data Handbook, Vol. 2, Campus, 1987). Der Handel mit der Dritten Welt wurde um zwei Drittel reduziert durch den Rückzug Chinas, des Ostblocks, Indiens und anderer unterentwickelter Länder vom Weltmarkt. Der Handel mit dem übrig gebliebenen Drittel fiel zwischen 1952 und 1972 auf die Hälfte zurück (P. Bairoch, Le Tiers-Monde dans l’impasse, S. 391-392)!
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[19]<!--[endif]--> Zahlen siehe in International Review 114, (engl./franz./span. Ausgabe
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[20]<!--[endif]--> Zahlen siehe in Internationale Revue 37 (deutsch)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[21]<!--[endif]--> Der Marshall-Plan hatte nur eine schwache Auswirkung auf die amerikanische Wirtschaft: „Nach dem Zweiten Weltkrieg (…) belief sich die Ausfuhr 1946 auf nur 4,9% der Produktion und 1947 auf 6,6%, machte also einen viel kleineren Prozentsatz aus als in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Der Marshall-Plan hat hier keine entscheidende Veränderungen gebracht“. Fritz Sternberg, Kapitalismus und Sozialismus vor dem Weltgericht, Rohwolt, 1961, S. 398) Der Autor folgert daraus, dass der innere Handel ausschlaggebend war.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[22]<!--[endif]--> Die Fakten und Argumente dazu sind in einem Artikel in der International Review 128, (engl./franz./span. Ausgabe) zu finden. Wir werden aber darauf zurück kommen, weil laut Marx die Entwertung und Zerstörung von Kapital tatsächlich eine Regeneration des Akkumulationszykluses und die Eröffnung neuer Märkte erlaubt. Eine detaillierte Studie hat uns allerdings gezeigt, dass dieser Faktor, auch wenn er eine Rolle spielte, relativ gering war, begrenzt in der Zeit und auf Europa und Japan.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[23]<!--[endif]--> Der Anteil der totalen öffentlichen Ausgaben in den Ländern der OECD steigerte sich von 1913 bis 1937 von 9% auf 21% (International Review 114 (engl./franz./span. Ausgabe).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[24]<!--[endif]--> In der Realität ist die Produktivität nur ein anderer Ausdruck des Wertgesetzes – da sie das Umkehrte der Arbeitszeit bedeutet –, und sie ist die Grundlage der Auspressung des relativen Mehrwertes, die so charakteristisch für diese Periode war.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[25]<!--[endif]--> Der Anteil der öffentlichen Ausgaben in den Ländern der OECD verdoppelte sich zwischen 1960 und 1980 von 19% auf 45% (International Review 114, engl./franz./span. Ausgabe).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[26]<!--[endif]--> Grafiken dazu in International Review 115, 121 und 128 (engl./franz./span. Ausgabe)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[27]<!--[endif]--> Grafiken und Zahlen in der Internationalen Revue 37, sowie auch in unserer Analyse über das Wachstum in Südost-Asien: https://fr.internationalism.org/ICConline/2008/crise_economique_Asie_Sud... [332].
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[28]<!--[endif]--> Der Leser findet verschieden Zahlenangaben sowie auch theoretische Analysen in unseren Artikeln, die in der International Review 114, 115, 121, 127, 128 erschienen sind, sowie in den Analysen über das Wachstum in Südostasien auf unserer Webseite.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[29]<!--[endif]--> „Keine Gruppe besitzt die absolute und ewige Wahrheit“, wie es die Französische Kommunistische Linke ausdrückte. Siehe dazu unseren Artikel „Vor 60 Jahren: Eine Konferenz revolutionärer Internationalisten“ in Internationale Revue Nr. 41 (deutsch).
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Mai 68 und die revolutionäre Perspektive (II)
- 3459 Aufrufe
Das Ende der Konterrevolution – Das historische Wiedererstarken der Arbeiterklasse
Gegenüber all den Lügen, die heute zum Mai 68 verbreitet werden, müssen die Revolutionäre die Wahrheit wiederherstellen. Sie müssen auch die Mittel anbieten, um die Bedeutung und die Lehren dieser Ereignisse zu begreifen. Sie müssen insbesondere verhindern, dass ihre Lehren unter einem Haufen Blumen und Kränzen begraben werden.
Wir haben schon damit angefangen, indem wir bislang einen Artikel in unserer Internationalen Revue veröffent-licht haben, der auf die ersten Bestandteile der Ereignisse des Mai 68 zurückkommt – die Studentenproteste in Frankreich und auf der Welt. In diesem Artikel wollen wir auf den wesentlichsten Bestandteil der Ereignisse eingehen – die Bewegung der Arbeiterklasse. Im ersten Artikel dieser Reihe schrieben wir am Schluss zu den Ereignissen in Frankreich: „Am 14. Mai gingen die Diskussionen in vielen Betrieben weiter. Nach den gewaltigen Demonstrationen am Vorabend, die den ganzen Enthusiasmus und ein Gefühl der Stärke zum Vorschein gebracht hatten, war es schwierig die Arbeit wieder aufzunehmen, so als ob nichts passiert wäre. In Nantes traten die Beschäftigen von Sud-Aviation in einen spontanen Streik und beschlossen die Besetzung des Werkes. Vor allem die jüngeren Beschäftigten trieben die Bewegung voran. Die Arbeiterklasse war auf den Plan getreten.“ Diese Schilderung werden wir hier fortsetzen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Die Ausdehnung der Streiks
In Nantes stießen die jungen Arbeiter, die im gleichen Alter waren wie die Studenten, die Bewegung an. Ihre Argumentation war einfach aber einleuchtend: „Wenn die Studenten, die ja mit einem Streik keinen Druck ausüben können, die Kraft besaßen, die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, können die Arbeiter die Regierung auch zum Nachgeben zwingen.“ Die Studenten der Stadt wiederum erklärten sich mit den Arbeitern solidarisch; sie reihten sich in deren Streik-posten ein: Verbrüderung. Die Kampagnen der KPF<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> und der CGT<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> warnten vor den „linken Provokateuren, die im Dienste der Arbeitgeber und des Innenministers stehen“ und die Studenten unterwandert hätten; aber diese Kampagnen zeigten keine große Wirkung. Insgesamt standen am Abend des 14. Mai 3100 Arbeiter im Streik. Am 15. Mai breitete sich die Bewegung auf die Renault-Werke in Cléon in der Normandie, und auf zwei weitere Fabriken in der Region aus: totaler Streik, unbegrenzte Werksbesetzungen, rote Fahnen an den Fabriktoren. Am Ende des Tages streikten 11.000 Beschäftigte.
Am 16. Mai schlossen sich die Beschäftigten der anderen Renault-Werke an: rote Fahnen über Flins, Sandouville, Le Mans und Billancourt. An jenem Abend befanden sich 75.000 Arbeiter im Streik; aber als die Arbeiter von Renault-Billancourt in den Kampf traten, wurde ein deutliches Signal gesetzt. Es handelte sich um die größte Fabrik in Frankreich (35.000 Beschäftigte) und seit langem galt ein Sprichwort: „Wenn Renault niest, hat Frankreich Schnupfen.“
Am 17. Mai gab es 215.000 Streikende. Die Streiks erreichten nunmehr ganz Frankreich, vor allem die Provinz. Es handelte sich um eine vollkommen spontane Bewegung; die Gewerkschaften liefen ihr nur nach. Überall standen die jungen Arbeiter an ihrer Spitze. Häufig verbrüderten sich Studenten und junge Arbeiter. Junge Arbeiter zogen in die besetzten Universitäten und forderten die Studenten auf, zu ihnen in die Kantinen zum Essen zu kommen. Es gab keine genauen Forderungen. Stattdessen äußerte sich eher Unmut. Auf einer Fabrikmauer in der Normandie stand: „Wir brauchen Zeit zum Leben und mehr Würde!“ An jenem Tag rief die CGT zur „Ausdehnung des Streiks“ auf. Sie hatte Angst, von der „Basis überrollt“ und von der CFDT <!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->, welche von den ersten Tagen an viel präsenter war, verdrängt zu werden. Wie man damals sagte, war sie auf den „fahrenden Zug aufgesprungen“. Ihr Aufruf wurde erst am nächsten Tag bekannt. Am 18. Mai standen mittags eine Million Arbeiter im Streik, noch bevor der Streikaufruf der CGT bekannt wurde. Am Abend streikten zwei Millionen Beschäftigte.
Am 20. Mai streikten sechs Millionen, und am 21. Mai hatten schon 6.5 Millionen die Arbeit niedergelegt.
Am 22. Mai befanden sich acht Millionen im unbefristeten Streik. Es handelte sich um den größten Streik in der Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung. Er war sehr viel massiver als die vorher berühmt gewordenen Streiks – der ‚Generalstreik’ des Mai 1926 in Großbritannien (der eine Woche dauerte) und die Streiks im Mai-Juni 1936 in Frankreich. Alle Bereiche waren betroffen: Industrie, Transport und Verkehr, Energie, Post und Telekommunikation, Erziehungswesen, Verwaltungen (mehrere Ministerien waren vollkommen lahm gelegt), Medien (das staatliche Fernsehen streikte, die Beschäftigten prangerten vor allem die aufgezwungene Zensur an), Forschungslabore usw. Selbst die Bestattungsunternehmer streikten (Mai 68 war ein schlechter Zeitpunkt zum Sterben). Gar Berufssportler schlossen sich der Bewegung an. Die rote Fahne wehte über den Gebäuden des französischen Fußballverbandes. Die Künstler standen nicht abseits, das Filmfestival in Cannes wurde auf Veranlassung der Regisseure unterbrochen. In dieser Zeit wurden die besetzten Universitäten (wie auch andere öffentliche Gebäude wie das Odéon-Theater in Paris) zu Orten ständiger politischer Debatte. Viele Arbeiter, insbesondere die Jungen, aber nicht nur diese, beteiligten sich an diesen Diskussionen. Arbeiter baten diejenigen, die die Notwendigkeit einer Revolution vertraten, zu den Versammlungen in den besetzten Betrieben zu kommen und dort ihren Standpunkt zu vertreten. So wurde der kleine Kern von Leuten, die später die Sektion der IKS in Frankreich gründen sollte, dazu aufgefordert, in der besetzten Fabrik JOB ihre Auffassungen von den Arbeiterräten zu erklären. Und am bedeutendsten war, dass diese Einladung von Mitgliedern der …CGT und der KPF ausgesprochen wurde. Diese mussten eine Stunde lang mit den Hauptamtlichen der CGT des großen Werkes Sud-Aviation verhandeln, die gekommen waren, um die Streikposten der JOB zu ‚verstärken’, bevor sie die Zustimmung erhielten, ‚Linksradikale’ in das Werk zu lassen. Mehr als sechs Stunden lang diskutierten Arbeiter und Revolutionäre, auf Papierrollen sitzend, über die Revolution, die Geschichte der Arbeiterbewegung, die Sowjets und gar über den Verrat ... der KPF und der CGT. Viele Diskussionen fanden ebenfalls auf den Straßen und Bürgersteigen statt (im Mai 68 herrschte überall schönes Wetter). Sie entstanden spontan, jeder hatte etwas zu sagen („Man hört dem anderen zu und redet miteinander“ war einer der Slogans). Überall herrschte so etwas wie Feststimmung, außer in den ‚Reichenvierteln’, wo sich Angst und Hass ansammelten. Überall in Frankreich, in den Stadtvierteln, in einigen großen Betrieben oder in den benachbarten Bezirken tauchten „Aktionskomitees“ auf. Dort wurde darüber diskutiert, wie man kämpfen sollte, wie eine revolutionäre Perspektive aussehen könnte. Im Allgemeinen wurden diese Diskussionen von linken oder anarchistischen Gruppen angestoßen, aber dort versammelten sich viel mehr Leute als Mitglieder dieser Organisationen. Selbst bei der ORTF, den staatlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten, entstand ein Aktionskomitee, das insbesondere von Michel Drucker <!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> mit angetrieben wurde, und an dem sich der unbeschreibliche Thierry Rolland <!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> beteiligte.
Die Reaktionen der Bourgeoisie
In Anbetracht dieser Lage befand sich die herrschende Klasse in einer Phase des Umherirrens, was sich durch verwirrte und unwirksame Initiativen äußerte. So diskutierte und verwarf das Parlament, welches von der Rechten beherrscht wurde, einen Zensurantrag, der von der Linken zwei Wochen zuvor eingebracht worden war: Die offiziellen Institutionen der Republik Frankreichs schienen in einer anderen Welt zu leben. Das Gleiche traf auf die Regierung zu, die an jenem Tag beschloss, Daniel Cohn-Bendit, der nach Deutschland gereist war, die Wiedereinreise zu verbieten. Diese Entscheidung ließ die Unzufriedenheit nur noch weiter hochkochen. Am 24. Mai kam es zu mehreren Demonstrationen, insbesondere um gegen das Aufenthaltsverbot Cohn-Bendits zu protestieren: „Nieder mit den Landesgrenzen!“ „Wir sind alle deutsche Juden!“ Trotz des von der CGT gelegten Sperrrings gegen die „Abenteurer“ und „Provokateure“ (d.h. die „radikalen“ Studenten) schlossen sich viele junge Arbeiter diesen Demonstrationen an. Am Abend hielt der Präsident der Republik, General de Gaulle, eine Rede. Er schlug ein Referendum vor, damit die Franzosen sich zur „Beteiligung“ äußern (eine Art Assoziation Kapital-Arbeit). Weltfremder konnte man nicht sein. Diese Rede stieß auf taube Ohren. Sie zeigte die totale Verwirrung der Regierung und der Bourgeoisie im Allgemeinen<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->. Auf den Straßen hatten die Demonstrationen die Rede in Transistorradios verfolgt. Die Wut stieg sofort weiter an: „Wir pfeifen auf seine Rede.“ In ganz Paris und in mehreren Provinzstädten kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen; Barrikaden wurden errichtet. Zahlreiche Schaufenster wurden zerschlagen, Autos in Brand gesetzt. Dadurch richtete sich ein Teil der öffentlichen Meinung gegen die Studenten, die nunmehr als „Krawallmacher“ angesehen wurden. Es ist übrigens wahrscheinlich, dass sich unter die Demonstranten Mitglieder der gaullistischen Milizen oder Zivilpolizisten gemischt hatten, um Öl aufs Feuer zu gießen und der Bevölkerung Angst einzujagen. Es war aber auch klar, dass viele Studenten glaubten, sie würden die ‚Revolution machen’, indem sie Barrikaden errichteten oder Autos anzündeten, die als Symbol der ‚Konsumgesellschaft’ galten. Aber diese Handlungen brachten vor allem die Wut der Demonstranten, Studenten und jungen Arbeiter über die lächerlichen und provozierenden Reaktionen der Behörden gegenüber der größten Streikwelle der Geschichte zum Vorschein. Ein Ausdruck dieser Wut gegen das System: das Symbol des Kapitalismus, die Pariser Börse, wurde in Brand gesetzt. Schließlich konnte die Bourgeoisie erst am darauf folgenden Tag wirksamere Maßnahmen ergreifen. Am Samstag, den 25. Mai, wurden Verhandlungen im Arbeitsministerium (rue de Grenelle) zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern und der Regierung aufgenommen. Von Anfang an waren die Arbeitgeber bereit, mehr zuzugestehen, als was die Gewerkschaften erwartet hatten. Es war offensichtlich, dass die Bourgeoisie Angst hatte. Der Premierminister Pompidou leitete die Verhandlungen. Am Sonntagmorgen traf er den Chef der CGT, Séguy<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->, eine Stunde lang unter vier Augen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Frankreich brauchten Zeit, um ohne Zeugen die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung zu besprechen.<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> In der Nacht vom 26. zum 27. Mai wurde das „Abkommen von Grenelle“ unterzeichnet:
– Lohnerhöhung von 7% für alle ab dem 1. Juni, plus 3% zusätzlich ab dem 1. Oktober;
– Erhöhung der Mindestlöhne um 25%;
– Kürzung der „Eigenleistungen“ im Gesundheitswesen von 30% auf 25% (insbesondere die Gesundheitsausgaben, die die Sozialversicherung nicht übernahm);
– Anerkennung der Gewerkschaften in den Betrieben;
– Sowie eine Reihe von sehr vagen Versprechungen des Beginns von Verhandlungen, insbesondere über die Frage der Arbeitszeit (die damals durchschnittlich 47 Stunden pro Woche betrug). In Anbetracht der Stärke der Bewegung handelte es sich um eine wahre Provokation:
– Die 10% Lohnerhöhung sollte schnell durch die Inflation aufgefressen werden (damals gab es eine hohe Inflationsrate);
– nichts zur Frage des Lohnausgleichs für die Inflation;
– nichts Konkretes zur Verkürzung der Arbeitszeit. Man gab sich damit zufrieden, als Ziel die „schrittweise“ Rückkehr zur 40 Stundenwoche (welche schon 1936 offiziell erreicht worden war) zu proklamieren. Wäre man dem von der Regierung vorgeschlagenen Rhythmus gefolgt, hätte man das Ziel 2008 erreicht!
– Die einzigen, die etwas Wesentliches erreichten, waren die am geringsten bezahlten Arbeiter (man wollte die Arbeiterklasse spalten und sie zur Wiederaufnahme der Arbeit drängen) sowie die Gewerkschaften (welche für ihre Saboteursrolle belohnt wurden).
Am 27. Mai verwarfen die Vollversammlungen das „Abkommen von Grenelle“ einstimmig. Bei Renault Billancourt haben die Gewerkschaften eine ‚Showveranstaltung’ organisiert, über die von den Medien groß berichtet wird. Als er von den Verhandlungen zurückkam, sagte Séguy zu den Journalisten, „die Wiederaufnahme der Arbeit steht unmittelbar bevor“, und er hoffte sehr wohl, dass die Arbeiter von Billancourt ein Beispiel dafür liefern würden. Aber 10.000 Beschäftigte, die sich seit dem Morgen versammelt hatten, hatten die Fortsetzung der Streiks beschlossen, noch bevor die Gewerkschaftsführer angekommen waren. Benoît Frachon, ‘historischer’ Führer der CGT (der sich schon an den Verhandlungen von 1936 beteiligt hatte) erklärte: „Das Abkommen von Grenelle wird Millionen von Arbeitern einen Wohlstand bieten, den sie nicht erhofft hatten.“ Todesstille im Saal. André Jeanson von der CFDT freute sich über das anfängliche Votum zur Fortsetzung des Streiks und sprach von der Solidarität zwischen Arbeitern, Studenten und kämpfenden Oberschülern: stürmischer Beifall. Schließlich trug Séguy einen „objektiven Bericht“ der „Errungenschaften von Grenelle“ vor: minutenlanges Pfeifkonzert. Danach machte Séguy eine Kehrtwendung: „Wenn man nach dem hier gehörten urteilen muss, werdet ihr euch nicht über den Tisch ziehen lassen!“ Applaus, aber aus der Menge rief eine Stimme: „Er führt uns hinters Licht.“ Der beste Beweis der Verwerfung des „Abkommens von Grenelle“: die Zahl der Streikenden stieg noch am 27. Mai auf neun Millionen. Am 9. Mai fand im Sportstadion Charléty in Paris eine große Versammlung statt. Sie wurde von der Studentengewerkschaft UNEF, der CFDT (welche sich radikaler als die CGT gab) und linken Gruppen einberufen. In den Reden wurden revolutionäre Töne geschwungen. Man wollte für die wachsende Unzufriedenheit mit der CGT und der KPF ein Ventil finden. Neben den Vertretern der Extremen Linken waren auch Politiker der Sozialdemokratie wie Mendès-France anwesend (ehemaliger Regierungschef in den 1950er Jahren). Cohn-Bendit, der mit schwarz gefärbten Haaren aus Deutschland zurückgekehrt war, trat auch auf (am Vorabend war er in der Sorbonne erschienen). Der 28. Mai war der Tag der Manöver und Schachzüge der linken Parteien. Am Morgen hielt François Mitterrand, Vorsitzender der „Fédération de la gauche démocrate et socialiste“ (in der die Sozialistische Partei, die Radikale Partei und verschiedene kleine linke Gruppen vertreten waren) eine Pressekonferenz ab. Er meinte, es gebe ein Machtvakuum – deshalb kündigte er seine Kandidatur als Präsident der Republik an. Am Nachmittag schlug Waldeck-Rochet, der Führer der KPF, eine Regierung mit „kommunistischer Beteiligung“ vor. Es ging darum zu vermeiden, dass die Sozialdemokraten die Lage allein zu ihren Gunsten ausnutzten. Am 29. Mai folgte eine große Demonstration, zu welcher die CGT aufrief und in der sie eine „Volksregierung“ forderte. Die Rechten warnten sofort vor einem „kommunistischen Komplott“. An diesem Tag „tauchte“ General de Gaulle ab. Einige brachten das Gerücht in Umlauf, er trete ab; tatsächlich flog er nach Deutschland, um dort die Unterstützung des General Massus, welcher in Deutschland die französischen Besatzungstruppen befehligte, und die Loyalität der Armee sicher zu stellen.
Der 30. Mai stellte eine Art entscheidenden Tag dar bei dem Versuch der Bourgeoisie, die Lage wieder in den Griff zu kriegen. De Gaulle hielt erneut eine Rede. „Unter den gegenwärtigen Bedingungen trete ich nicht zurück (…). Ich löse heute die Nationalversammlung auf ...“ Gleichzeitig fand in Paris auf den Champs-Élysées eine gewaltige Demonstration zur Unterstützung de Gaulles statt. Aus den Reichenvierteln, den wohlhabenden Vororten und auch vom Land wurde mit Armeelastern das „Volk“ herangekarrt. Es kamen zusammen die Verängstigten und Besitzenden, die Bürgerlichen, die Vertreter der Religionsschulen für die Kinder der Reichen, die Führungsschichten, die sich ihrer „Überlegenheit“ bewusst waren, die kleinen Geschäftsinhaber, die um ihre Schaufenster fürchteten; Kriegsveteranen, die wegen der Angriffe auf die Nationalfahne erbost waren, die Geheimpolizei, die mit der Unterwelt unter einer Decke steckte, aber auch alte Algeriensiedler und die OAS<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->, junge Mitglieder der faschistoiden Gruppe Occident, die alten Nostalgiker Vichys (obwohl diese alle de Gaulle verachteten). All diese feinen Leute strömten zusammen, um ihren Hass auf die Arbeiterklasse und ihre „Ordnungsliebe“ zu bekunden. Aus der Menge, zu der auch alte Kämpfer des „freien Frankreich“ gehörten, drangen Rufe wie „Cohn-Bendit nach Dachau!“. Aber die „Partei der Ordnung“ beschränkte sich nicht auf die Demonstranten auf den Champs-Elysées. Am gleichen Tag rief die CGT zu branchenmäßigen Verhandlungen zur „Verbesserung der Errungenschaften von Grenelle“ auf. Es handelte sich um ein Mittel zur Spaltung der Bewegung, um sie so vernichten zu können.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Die Wiederaufnahme der Arbeit
An jenem Donnerstag an wurde die Arbeit wieder aufgenommen, allerdings nur langsam, denn am 6. Juni streikten immer noch
ca. 6 Millionen Beschäftigte. Die Arbeit wurde in großer Zerstreuung wieder aufgenommen.
31. Mai: Stahlindustrie Lothringens, Textilindustrie Nordfrankreichs,
4. Juni: Arsenale, Versicherungen
5. Juni: Elektrizitätswerke<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]-->, Kohlebergwerke
6. Juni: Post, Telekommunikation, Transportwesen (In Paris setzte die CGT Druckmittel zur Wiederaufnahme der Arbeit ein. In jedem Betriebswerk kündigten die Gewerkschaftsführer an, dass in den anderen Depots die Arbeit schon wieder aufgenommen worden sei, was eine Täuschung war.);
7. Juni: Grundschulen
10. Juni: das Renault-Werk in Flins wurde von der Polizei besetzt. Ein von den Polizisten verprügelter Gymnasiast fiel in die Seine und ertrank;
11. Juni: Intervention der CRS (Bürgerkriegspolizei)<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> in den Peugeot-Werken in Sochaux (zweitgrößtes Werk in Frankreich). Zwei Arbeiter wurden getötet. In ganz Frankreich kam es erneut zu gewalttätigen Demonstrationen. „Sie haben unsere Genossen getötet.“ Trotz des entschlossenen Widerstands der Arbeiter räumten die CRS das Sochaux-Werk. Aber die Arbeit wurde erst 10 Tage später wieder aufgenommen. Aus Furcht, dass die Empörung erneut zu einem Wiederaufleben der Streiks führte (immerhin standen noch drei Millionen Beschäftigte im Streik), riefen die Gewerkschaften (mit der CGT an der Spitze) und die Linksparteien (mit der KPF an der Spitze) nachdrücklich zur Wiederaufnahme der Arbeit auf, „damit die Wahlen stattfinden können und der Sieg der Arbeiterklasse vervollständigt werden kann.“ Die Tageszeitung der KPF, l’Humanité, trug die Schlagzeile: „Gestärkt durch ihren Sieg nehmen Millionen Beschäftigte die Arbeit wieder auf.“ Der systematische Streikaufruf durch die Gewerkschaften vom 20. Mai an konnte nun erklärt werden: Sie wollten die Bewegung kontrollieren, damit sie so leichter zur Wiederaufnahme der Arbeit in den weniger kämpferischen Teilen und zur Demoralisierung der anderen Bereiche drängen konnten. Waldeck-Rochet erklärte in seinen Reden während des Wahlkampfes, dass die „Kommunistische Partei eine Partei der Ordnung ist“. In der Tat konnte die bürgerliche „Ordnung“ schrittweise wiederhergestellt werden.
12. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit in den Schulen der Sekundarstufe
14. Juni: Air France und Seeschiffahrt
16. Juni : Besetzung der Sorbonne durch die Polizei
17. Juni: chaotische Wiederaufnahme der Arbeit bei Renault Billancourt
18. Juni: De Gaulle ließ die Führer der OAS freisetzen, die noch im Gefängnis saßen;
23. Juni: Erster Wahltag der Parlamentswahlen mit großen Stimmengewinnen für die Rechten;
24. Juni: Wiederaufnahme der Arbeit bei Citroën Javel, mitten in Paris (Krasucki, Nummer 2 der CGT, trat vor der Vollversammlung auf und rief zum Streikabbruch auf.)
26. Juni: Usinor Dünkirchen
30. Juni: Stichwahl mit einem historischen Sieg der Rechten. Einer der Betriebe, die als letzte die Arbeit wieder aufnahmen, waren die Radio- und Fernsehanstalten am 12. Juli. Viele Journalisten wollten nicht wieder bevormundet und zensiert werden, wie das vorher so sehr durch die Regierung geschehen ist. Nach der Wiederaufnahme der Arbeit wurden viele von ihnen entlassen. Überall wurde die Ordnung wiederhergestellt, gerade auch bei den Medien, die wichtig waren für die gezielte „Bearbeitung“ der Bevölkerung. So endete der größte Streik der Geschichte im Gegensatz zu den Behauptungen der CGT und der KPF in einer Niederlage. Eine schwere Schlappe, die durch die Rückkehr der Parteien und „Autoritäten“ bekräftigt wurde, welche während der Bewegung die ganze Wut und Verachtung auf sich gezogen hatten. Aber die Arbeiterbewegung weiß schon seit langem: „Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter“ (Kommunistisches Manifest). Aber ungeachtet ihrer unmittelbaren Niederlage haben die Arbeiter in Frankreich 1968 einen großen Sieg nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Weltproletariat errungen. Dies werden wir aufzeigen, in dem wir die tiefer liegenden Ursachen wie auch die historische und internationale Dimension dieses „schönen Mai“ in Frankreich beleuchten.
Die internationale Bedeutung des Streiks im Mai 1968
In den meisten Büchern und Fernsehsendungen, die sich in der letzten Zeit mit dem Thema Mai 1968 befassten, wird der internationale Charakter der Studentenbewegung, welche in Frankreich zu jener Zeit im Gange war, unterstrichen. Es herrscht, wie wir auch in früheren Artikeln festgestellt haben, Einverständnis darüber, dass die Studenten in Frankreich nicht die ersten waren, die massiv auf den Plan traten. Sie waren sozusagen auf den fahrenden Zug aufgesprungen, welcher in den US-amerikanischen Universitäten im Herbst 1964 in Gang gesetzt wurde. Von den USA ausgehend, hatte diese Bewegung die meisten westlichen Ländern erfasst und dabei in Deutschland 1967 seinen spektakulärsten Höhepunkt erlebt, was die Studenten in Deutschland zu einem „Bezugspunkt“ für die Studenten Europas machte. Aber die gleichen Journalisten oder „Historiker“, die vorbehaltlos das internationale Ausmaß der Studentenproteste Ende der 1960er Jahre unterstreichen, hüllen sich in allgemeines Schweigen über die Arbeiterkämpfe, die damals weltweit stattfanden. Natürlich können sie den gewaltigen Streik, der den wichtigsten Moment der Ereignisse des Jahres 1968 in Frankreich darstellt, nicht einfach ausblenden und schweigend darüber hinweggehen. Aber wenn sie sich dazu äußern, dann nur, um zu sagen, die Bewegung der Arbeiter sei eine auf Frankreich beschränkte Ausnahmeerscheinung, gewesen.
In Wirklichkeit war die Bewegung der Arbeiterklasse in Frankreich ebenso wie die der Studenten, Teil einer internationalen Bewegung, und sie kann auch nur im internationalen Kontext verstanden werden. Dies wollen wir unter anderem im folgenden Artikel aufzeigen.
Die französische „Besonderheit“
Es stimmt, dass die Lage in Frankreich im Mai 1968 eine besondere war, die in keinem anderen Land in dem Ausmaß vorzufinden war, allenfalls marginal: eine massive Bewegung der Arbeiterklasse, die sich von der Studentenbewegung ausgehend entwickelt hatte. Es ist offensichtlich, dass die Mobilisierung der Studenten, die danach einsetzende Repression – welche Erstere wiederum anfachte – sowie das Zurückweichen der Regierung nach der „Nacht der Barrikaden“ vom 10. auf den 11. Mai eine Rolle nicht nur bei der Auslösung der Arbeiterstreiks, sondern auch beim Ausmaß derselben gespielt haben. Aber wenn die Arbeiterklasse in Frankreich solch eine Bewegung ausgelöst hat, dann geschah dies nicht, weil sie „dem Beispiel der Studenten folgen“ wollte, sondern weil in ihren eigenen Reihen eine tiefe und weit verbreitete Unzufriedenheit, aber auch die politische Kraft herrschte, um solch einen Kampf aufzunehmen.
Dieser Tatbestand wird in der Regel durch die Bücher und Fernsehprogramme, welche sich mit Mai 68 befassten, nicht verheim-
licht. Es wird oft in Erinnerung gerufen, dass die Arbeiter von 1967 an wichtige Kämpfe geführt haben, die sich in vielem von der Zeit davor unterschieden. Während die kleinen, harmlosen Streiks und die gewerkschaftlichen Aktionstage keine große Begeisterung hervorriefen, flammten nunmehr sehr heftige Konflikte auf, mit einer großen Entschlossenheit der Beschäftigten, die mit einer gewaltsamen Repression durch die Arbeitgeber und die Polizei konfrontiert wurden und unter denen die Gewerkschaften mehrfach die Kontrolle verloren hatten. So kam es schon Anfang 1967 zu größeren Zusammenstößen in Bordeaux (im Flugzeugwerk Dassault), in Besançon und in der Gegend von Lyon (Streik und Besetzung in Rhodia, Streik bei Berliet mit anschließender Aussperrung der Arbeiter durch die Arbeitgeber und Besetzung des Werkes durch die Bürgerkriegspolizei CRS), in den Bergwerken Lothringens, in den Schiffswerften von Saint-Nazaire (die am
11. April durch einen Generalstreik lahmgelegt wurden).
In Caen in der Normandie fanden die wichtigsten Kämpfe der Arbeiterklasse vor dem Mai 1968 statt. Am 20. Januar 1968 hatten die Gewerkschaften von Saviem (LKW-Hersteller) zu einem anderthalbstündigen Streik aufgerufen, aber die Gewerkschaftsbasis, die diese Maßnahme als unzureichend betrachtete, trat am 23. Januar spontan in den Streik. Am übernächsten Tag, um 4.00 Uhr morgens, griff die CRS die Streikposten an und vertrieb sie, um den Managern und den Streikbrechern den Zugang zur Fabrik zu ermöglichen. Die Streikenden beschlossen, in das Stadtzentrum zu ziehen, wo sich ihnen Arbeiter anderer Betriebe anschlossen, die ebenfalls in den Streik getreten waren. Um acht Uhr morgens bewegten sich ca. 5.000 Menschen friedlich auf das Stadtzentrum zu, bis sie von der Bürgerkriegspolizei<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> brutal angegriffen wurden. So schlugen diese mit ihren Gewehrkolben auf die Demonstranten ein. Am 26. Januar bekundeten Beschäftigte aus allen Bereichen (unter ihnen Lehrer) wie auch viele Studenten ihre Solidarität. An einer Solidaritätsveranstaltung um 18 Uhr auf dem Marktplatz beteiligten sich ca. 7.000 Menschen. Am Ende der Veranstaltung griff die CRS erneut an, um den Platz zu räumen – aber sie wurde vom heftigen Widerstand der Arbeiter überrascht. Die Zusammenstöße dauerten die ganze Nacht. Über 200 Menschen wurden verletzt, Dutzende verhaftet. Sechs junge Demonstranten, alles junge Arbeiter, wurden zu Haftstrafen von 15 Tagen bis zu drei Monaten verurteilt. Aber anstatt die Kampfbereitschaft der Arbeiter zu schwächen und diese zurückzudrängen, bewirkte diese Repression nur die weitere Ausdehnung der Bewegung. Am 30. Januar zählte man ca. 15.000 Streikende in Caen. Am 2. Februar wurden die staatlichen Behörden und die Arbeitgeber zum Rückzug gezwungen. Die Strafverfolgungen gegen die Demonstranten wurden fallengelassen; die Löhne wurden um drei bis vier Prozent angehoben. Am nächsten Tag nahmen die Beschäftigten die Arbeit wieder auf, aber unter dem Druck der jungen Beschäftigten kam es mindestens noch einen Monat lang zu weiteren Arbeitsniederlegungen bei Saviem.
Doch Saint-Nazaire im April 67 und Caen im Januar 68 waren nicht die einzigen von Generalstreiks betroffenen Städte. Auch in anderen, weniger großen Städten wie Redon im März, Honfleur im April kam es zu größeren Streiks. Diese massiven Streiks aller Beschäftigten einer Stadt sollten einen Vorgeschmack von dem liefern, was im Mai im ganzen Land passieren sollte.
Deshalb kann man nicht behaupten, dass das Gewitter des Mai 68 wie ein Blitz aus heiterem Himmel erfolgt war. Die Studentenbewegung hatte etwas angezündet, das längst bereit war zu brennen.
Natürlich haben die „Spezialisten“, insbesondere die Soziologen, versucht, die Ursachen dieser „Ausnahme“ Frankreich aufzuzeigen. Sie haben vor allem auf die hohen Wachstumszahlen der Industrie in Frankreich während der 1960er Jahre verwiesen, wodurch das alte, landwirtschaftlich geprägte Land zu einem modernen und mächtigen Industriestaat wurde. Diese Tatsache erkläre das Auftreten und die Rolle einer großen Zahl von jungen Arbeitern, die in Fabriken angestellt waren, die oft erst kurz zuvor errichtet worden waren. Diese jungen Arbeiter, die häufig vom Land kamen, seien meistens nicht gewerkschaftlich organisiert gewesen; auch seien sie schlecht mit der Kasernendisziplin in den Betrieben zurechtgekommen, zudem sie trotz ihrer Berufsausbildung meist lächerlich geringe Löhne erhielten.
So lässt sich erklären, warum die jüngsten Mitglieder der Arbeiterklasse als erste den Kampf aufgenommen haben, und auch, warum die meisten wichtigen Bewegungen, die dem Mai 1968 vorhergingen, in Westfrankreich ausgelöst wurden: Diese Region wurde erst relativ spät industrialisiert. Aber die Erklärungen der Soziologen vermögen nicht zu erklären, warum nicht nur die jungen Arbeiter 1968 in Streik getreten sind, sondern die große Mehrheit der ganzen Arbeiterklasse, d.h. quer durch alle Generationen, gestreikt hat.
… und international
Hinter einer solch tiefgreifenden und weitreichenden Bewegung wie die des Mai 68 steckten notwendigerweise tiefergehende Ursachen, die weit über Frankreich hinausreichten. Die gesamte Arbeiterklasse Frankreichs ist damals faktisch in einen Generalstreik getreten, da alle Teile der Arbeiterklasse mittlerweile von der Wirtschaftskrise erfasst worden waren, die 1968 erst in ihrer Anfangsphase steckte. Diese Krise war aber keineswegs auf Frankreich beschränkt, sondern erfasste den Weltkapitalismus insgesamt. Die Auswirkungen dieser weltweiten Wirtschaftkrise in Frankreich (Anstieg der Arbeitslosigkeit, Lohnstopps, Produktivitätserhöhungen, Angriffe auf die Sozialleistungen) liefern die Haupterklärung für den Anstieg der Kampfbereitschaft in Frankreich 1967: „In allen Industriestaaten Europas und in den USA stieg die Arbeitslosigkeit an und die wirtschaftlichen Aussichten verschlechterten sich. England, das trotz einer Vielzahl von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts Ende 1967 dazu gezwungen war, das Pfund abzuwerten, löste eine Reihe von Abwertungen vieler anderer Währungen aus. Die Regierung Wilson kündigte ein außergewöhnliches Sparprogramm an: massive Kürzung der Staatsausgaben (...), Lohnstopps, Einschränkung der Binnennachfrage und der Importe, besondere Anstrengungen zur Ankurbelung der Exporte. Am 1. Januar 1968 schrie Johnson [der damalige US-Präsident] Alarm und kündigte unumgängliche harte Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen Gleichgewichts an. Im März brach die Dollarkrise aus. Die Tag für Tag pessimistischere Wirtschaftspresse erwähnte immer öfter das Gespenst der Wirtschaftskrise von 1929 […] Die ganze Bedeutung des Mai 1968 lag darin, eine der ersten und größten Reaktionen der Arbeiter gegen eine sich weltweit verschlechternde wirtschaftliche Lage gewesen zu sein“ (Révolution Internationale – alte Reihe, Nr. 2, Frühjahr 1969).
Tatsächlich haben besondere Umstände dazu geführt, dass der erste große Kampf der Arbeiterklasse gegen die Angriffe der Kapitalisten, die später an Schärfe noch zunehmen sollten, in Frankreich ausgefochten wurde. Doch sehr schnell traten auch Arbeiter anderer Länder in den Kampf. Den gleichen Ursachen folgten die gleichen Wirkungen.
Am anderen Ende der Welt, in Cordoba (Argentinien), kam es im Mai 1969 zu dem, was später als „Cordobazo“ in die Geschichte eingehen sollte. Nach einer ganzen Reihe von Arbeitermobilisierungen in vielen Städten gegen die brutalen wirtschaftlichen Sparmaßnahmen und die Repression durch das Militärregime hatten Polizei und Armee am 29. Mai die Kontrolle verloren, obwohl Letztere sogar Panzer aufgeboten hatte. Die Arbeiter hatten die zweitgrößte Stadt des Landes übernommen. Die Regierung konnte die „Ordnung“ am folgenden Tag nur dank des massiven Einsatzes des Militärs wiederherstellen.
In Italien begannen zum gleichen Zeitpunkt die größten Arbeiterkämpfe seit dem II. Weltkrieg. Bei Fiat in Turin legten mehr und mehr Arbeiter die Arbeit nieder, zunächst im größten Werk der Stadt, bei Fiat-Mirafiori, ehe die Bewegung dann die anderen Werke in Turin und Umgebung erreichte. Während eines gewerkschaftlichen Aktionstages am 3. Juli 1969 gegen die Mietpreiserhöhungen zogen demonstrierende Arbeiter, denen sich Studenten anschlossen, zum Mirafiori-Werk. Die Polizei griff daraufhin die Demonstrierenden gewalttätig an. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen hielten die ganze Nacht an und dehnten sich auf andere Stadtviertel aus.
Ab Ende August, als die Arbeiter aus ihrem Sommerurlaub zurückkehrten, kam es erneut zu Arbeitsniederlegungen – dieses Mal jedoch auch bei Pirelli (Reifenhersteller) in Mailand und in vielen anderen Betrieben.
Doch die italienische Bourgeoisie, die aus der Erfahrung des Mai 68 gelernt hatte, ließ sich im Gegensatz zu der französischen Bourgeoisie nicht überraschen. Sie versuchte mit aller Macht zu verhindern, dass die spürbare, starke gesellschaftliche Unzufriedenheit zu einem gesellschaftlichen Flächenbrand aus-
uferte. Deshalb versuchte der zu ihren Diensten stehende Gewerkschaftsapparat, die anstehenden Tarifverhandlungen, insbesondere in der Metallindustrie, in der Chemiebranche und im Baugewerbe, auszunutzen, um Spaltungsmanöver durchzuführen, mit denen die Arbeiter dazu veranlasst werden sollten, für „gute Abschlüsse“ in ihrer jeweiligen Branche zu kämpfen. Die Gewerkschaften verfeinerten die Taktik der „Schwerpunktstreiks“: An einem Tag streikten die Metaller, an einem anderen die Beschäftigten der chemischen Industrie, an einem dritten die des Baugewerbes. Man rief auch zu „Generalstreiks“ auf, aber diese sollten jeweils auf eine Provinz oder eine Stadt beschränkt bleiben. Sie richteten sich gegen die Preiserhöhungen oder Mietpreissteigerungen. In den Betrieben selbst plädierten die Gewerkschaften für rotierende Streiks; eine Abteilung nach der anderen sollte die Arbeit niederlegen. Dies geschah unter dem Vorwand, so dem Arbeitgeber den größtmöglichen Schaden zuzufügen und für die Streikenden den Schaden so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig unternahmen die Gewerkschaften alles, um die Kontrolle über eine Basis wiederherzustellen, die ihnen immer mehr entglitt. Nachdem die Arbeiter in vielen Betrieben aus Unzufriedenheit mit den traditionellen Gewerkschaftsstrukturen Vertrauensleute wählten, wurden diese postwendend als „Fabrikräte“ institutionalisiert, die die „Basisorgane“ der Einheitsgewerkschaft sein sollten, welche die drei Gewerkschaftsverbände CGIL, CISL und UIL gemeinsam gründen wollten.
Nach mehreren Monaten, während derer die Kampfbereitschaft durch eine Reihe von „Aktionstagen“ erschöpft wurde, die jeweils voneinander abgeschottet in verschiedenen Branchen und Städten stattfanden, wurden zwischen Anfang November und Ende Dezember die Tarifverträge Zug um Zug unterzeichnet. Und schließlich explodierte am 12. Dezember – wenige Tage vor dem Abschluss des Tarifvertrages in der bedeutendsten Branche, der privaten Metallindustrie, wo die Arbeiter am radikalsten gekämpft hatten – eine Bombe in einer Mailänder Bank. Dabei kamen 16 Menschen ums Leben. Das Attentat wurde Anarchisten in die Schuhe geschoben (einer von ihnen, Giuseppe Pinelli, starb in den Händen der Mailänder Polizei), aber viel später stellte sich heraus, dass das Attentat von gewissen Kreisen des Staatsapparates angezettelt worden war. Die geheimen Strukturen des bürgerlichen Staates leisteten so den Gewerkschaften Hilfestellung, um für Verwirrung in den Reihen der Arbeiter zu sorgen, während gleichzeitig ein Vorwand für die Verstärkung des Repressionsapparates gefunden worden war.
Das Proletariat Italiens war jedoch nicht das einzige, das sich im Herbst 1969 regte. In geringerem Maße traten auch die Arbeiter in Deutschland auf den Plan; im September 1969 kam es zu wilden Streiks gegen die von den Gewerkschaften unterzeichneten Tarifabschlüsse der Lohndämpfung. Diese Tarifabschlüsse wurden von den Gewerkschaften in Anbetracht der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland als „realistisch“ gelobt. Die Wirtschaft in Deutschland war trotz des Wirtschaftswunders von den zunehmenden Schwierigkeiten der Weltwirtschaft seit 1967 nicht verschont geblieben – 1967 rutschte Deutschland zum ersten Mal seit dem II. Weltkrieg in die Rezession ab.
Auch wenn dieses Wiedererwachen der Arbeiterklasse in Deutschland noch sehr verhalten war, kam diesem eine besondere Bedeutung zu. Auf der einen Seite handelt es sich um den zahlenmäßig größten und konzentriertesten Teil der Arbeiterklasse in Europa. Aber vor allem hat die Arbeiterklasse in Deutschland in der Geschichte eine herausragende Stellung innerhalb der Weltarbeiterklasse eingenommen – und diesen Platz wird sie auch in Zukunft einnehmen. In Deutschland war der Ausgang der internationalen revolutionären Welle von Kämpfen, die von Oktober 1917 in Russland an die kapitalistische Herrschaft auf der ganzen Welt bedroht hatte, infragestellt worden. Die von den Arbeitern in Deutschland erlittene Niederlage nach ihrem revolutionären Ansturm zwischen 1918–1923 hatte der schrecklichsten Konterrevolution, die die Weltarbeiterklasse jemals erlebt hatte, den Weg bereitet. Dort, wo die Revolution am weitesten gediehen war, in Deutschland und Russland, hatte die Konterrevolution die schlimmsten und barbarischsten Formen angenommen: Stalinismus und Naziherrschaft. Diese Konterrevolution hatte fast ein halbes Jahrhundert gedauert und erlebte ihren Gipfelpunkt im II. Weltkrieg, der es im Gegensatz zum I. Weltkrieg dem Proletariat nicht ermöglicht hatte, sein Haupt zu erheben, sondern seine Niederlage nur verschärft hatte, insbesondere durch die durch den Sieg der „Demokratie“ und des „Sozialismus“ entstandenen Illusionen.
Die gewaltigen Streiks des Mai 1968 in Frankreich, schließlich der „Heiße Herbst“ in Italien hatten den Beweis erbracht, dass die Weltarbeiterklasse die Zeit der Konterrevolution überwunden hatte, und dass im Gegensatz zur Krise von 1929 die nun mehr neu einsetzende Krise nicht zu einem neuen Weltkrieg führen sollte, sondern zu einer Intensivierung der Klassenkämpfe, welche die herrschende Klasse daran hinderten, ihre barbarische Lösung für die Erschütterungen ihrer Wirtschaft durchzusetzen. Die Kämpfe der Arbeiter in Deutschland im September 1969 bestätigten dies später, und in einem noch größeren Maße taten dies auch die Kämpfe der polnischen Arbeiter aus den Ostseestädten im Winter 1970–71.
Im Dezember 1970 reagierte die Arbeiterklasse in Polen spontan und massiv auf eine Erhöhung der Preise von mehr als 30%. Die Arbeiter zerstörten den Sitz der stalinistischen Partei in Gdansk, Gdynia und Elblag. Die Streikbewegung dehnte sich von der Ostseeküste auf Poznan, Katowice, Wroclaw und Krakov aus. Am 17. Dezember schickte Gomulka, der Generalsekretär der an der Macht befindlichen stalinistischen Partei, seine Panzer an die Ostküste. Mehrere Hundert Arbeiter wurden getötet. Straßenkämpfe fanden in Szczecin und Gdansk statt. Die Bewegung konnte aber nicht durch Repression unterdrückt werden. Am 21. Dezember brach eine Streikwelle in Warschau aus. Gomulka musste abtreten. Sein Nachfolger, Gierek, verhandelte sofort persönlich mit den Werftarbeitern von Szczecin. Gierek machte einige Konzessionen, aber weigerte sich die Preiserhöhungen zurückzunehmen. Am 11. Februar brach ein Massenstreik in Lodz aus. Gierek musste schließlich nachgeben: die Preiserhöhungen wurden gestrichen. Die stalinistischen Regimes waren die schlimmste Verkörperung der Konterrevolution gewesen. Im Namen des „Sozialismus“ und im „Interesses der Arbeiterklasse“ wurde die schrecklichste Terrorherrschaft gegen die Arbeiter ausgeübt. Der „heiße“ Winter der polnischen Arbeiter 1970–71 sowie auch die Streiks, die nach Bekanntwerden der Kämpfe in Polen auf der anderen Seite der Grenze ausbrachen, insbesondere in Lwow (Ukraine) und Kaliningrad bewiesen, dass selbst dort, wo die Konterrevolution in Gestalt der „sozialistischen“ Regimes immer noch das Zepter in der Hand hielt, ein Durchbruch erzielt worden war.
Wir können an dieser Stelle nicht alle Arbeiterkämpfe aufzählen, die nach 1968 stattgefunden haben und diese grundlegende Umwälzung des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden Klassen Bourgeoisie und Proletariat auf Weltebene bewirkt haben. Wir wollen stellvertretend nur zwei Beispiele erwähnen: Spanien und England.
Trotz einer wütenden Repression, die vom Franco-Regime ausgeübt wurde, hielt die Kampfbereitschaft der Arbeiter noch bis 1974 massiv an. In Pamplona, Navarra, überstieg die Zahl der Streiktage pro Arbeiter noch die der französischen Arbeiter 1968. Alle Industriegebiete (Madrid, Asturien, Baskenland) wurden erfasst. In den großen Arbeiterzusammenballungen der Vororte von Barcelona dehnten sich die Streiks am weitesten aus. Fast alle Betriebe der Region wurden bestreikt. Es kam zu exemplarischen Solidaritätsstreiks (oft begannen Streiks in einem Werk ausschließlich aus Solidarität mit den Beschäftigten anderer Betriebe).
Das Beispiel des englischen Proletariats ist ebenfalls sehr aufschlussreich, denn hier handelte es sich um das älteste Proletariat der Welt. Während der 1970er Jahre fanden dort massive Kämpfe gegen die Ausbeutung statt (1979 wurden mehr als 29 Millionen Streiktage registriert, die englischen Arbeiter standen in der Streikstatistik an zweiter Stelle hinter den französischen Arbeitern mit ihren Streiks 1968). Diese Kampfbereitschaft zwang die englische Bourgeoisie zweimal dazu, sogar ihren Premierminister auszutauschen: Im April 1976 wurde Callaghan durch Wilson ersetzt, und Anfang 1979 wurde Callaghan durch das Parlament abgesetzt.
So liegt die grundlegende historische Bedeutung des Mai 68 weder in den „französischen Besonderheiten“ noch in der Studentenrevolte, ebensowenig in der heute so viel gepriesenen ‚Revolution der Sitten?’, sondern darin, dass die Weltarbeiterklasse die Konterrevolution überwunden hatte und in einen neuen historischen Zeitraum von Zusammenstößen mit der kapitalistischen Ordnung eingetreten war. Diese neue Periode zeichnet sich ebenso dadurch aus, dass sich politisch-proletarische Strömungen, welche von der Konterrevolution praktisch eliminiert oder zum Schweigen gebracht worden waren, neu entwickelt haben, darunter die IKS. Darauf werden wir in einem weiteren Artikel eingehen.
Das internationale Wiederauftauchen revolutionärer Kräfte
Die Schäden der Konterrevolution in den Reihen der Kommunisten
Anfang des 20. Jahrhunderts führte das Proletariat während und nach dem 1. Weltkrieg gigantische Kämpfe, in denen der Kapitalismus beinahe überwunden worden wäre. 1917 wurde die bürgerliche Macht in Russland gestürzt. Zwischen 1918–1923 gab es in dem wichtigsten Land Europas, in Deutschland, mehrere Anläufe zur Überwindung des Kapitalismus. Diese revolutionäre Welle fand in allen Winkeln der Erde ihren Widerhall, d.h. überall wo es eine entwickelte Arbeiterklasse gab, von Italien bis Kanada, von Ungarn bis China.
Aber der Weltbourgeoisie gelang es, diese gigantische Bewegung der Arbeiterklasse einzudämmen, und sie blieb nicht dabei stehen. Sie brach die schrecklichste Konterrevolution in der Geschichte der Arbeiterbewegung vom Zaun. Diese Konterrevolution entwickelte sich in Gestalt einer unvorstellbaren Barbarei, deren bedeutendsten Ausdrücke der Stalinismus und Nationalsozialismus waren. Diese wüteten besonders stark dort, wo die Revolution am weitesten gegangen war, nämlich in Russland und in Deutschland.
In diesem Zusammenhang verwandelten sich die kommunistischen Parteien, welche in der revolutionären Welle von Kämpfen an der Spitze gestanden hatten, zu Parteien der Konterrevolution.
Der Verrat der kommunistischen Parteien löste in ihren Reihen die Entstehung von linkskommunistischen Fraktionen aus, welche wirklich revolutionäre Positionen weiter verteidigen wollten. Ein ähnlicher Prozess hatte schon innerhalb der sozialistischen Parteien stattgefunden, als diese 1914 aufgrund ihrer Unterstützung des imperialistischen Krieges ins bürgerliche Lager übergewechselt waren. Aber während diejenigen, welche innerhalb der sozialistischen Parteien gegen deren opportunistisches Abgleiten und deren Verrat ankämpften, an Stärke und Einfluss in der Arbeiterklasse gewannen, so dass sie nach der Russischen Revolution sogar eine neue Internationale gründen konnten, verlief die Entwicklung der linken Strömungen, die aus den kommunistischen Parteien hervorgingen, aufgrund des zunehmenden Gewichtes der Konterrevolution anders. Während sie anfänglich eine Mehrheit der Mitglieder in den Parteien in Deutschland und Italien umfassten, verloren diese Strömungen schrittweise ihren Einfluss in der Arbeiterklasse und den größten Teil ihrer Mitglieder. Oder sie gingen unter durch eine Zersplitterung in eine Reihe von kleinen Gruppen, wie in Deutschland, noch bevor das Hitler-Regime die letzten Militanten auslöschte oder sie ins Exil zwang.
Während der 1930er Jahre zählten neben der Strömung um Trotzki, welche immer mehr vom Opportunismus zerfressen wurde, die Gruppen, welche die revolutionären Positionen weiterhin entschlossen verteidigten wie die Gruppe Internationaler Kommunisten (GIK) in Holland (die sich auf den „Rätekommunismus“ berief und die Notwendigkeit einer proletarischen Partei verwarf) und die Linksfraktion der Kommunistischen Partei Italiens (welche die Zeitschrift Bilan veröffentlichte) nur einige wenige Dutzend Mitglieder. Diese konnten keinen Einfluss auf die Arbeiterkämpfe ausüben.
Im Gegensatz zum 1. Weltkrieg hat der 2. Weltkrieg keine Umkehrung des Kräfteverhältnisses zwischen Proletariat und Bourgeoisie ermöglicht. Ganz im Gegenteil. Durch die historische Erfahrung klüger geworden und dank der wertvollen Unterstützung der stalinistischen Parteien setzte die Bourgeoisie alles daran, jegliche neue Regungen der Arbeiterklasse im Keim zu ersticken. In der demokratischen Euphorie der „Befreiung“ standen die Gruppen der Kommunistischen Linken noch isolierter da als in den 1930er Jahren. In Holland löste der Communistenbond Spartacus den GIC bei der Verteidigung rätistischer Positionen ab. Diese wurden ebenfalls ab 1965 von der Gruppe Daad en Gedachte, einer Abspaltung vom Bond, vertreten. Diese beiden Gruppen veröffentlichten viele Texte, obwohl sie durch ihre rätekommunistische Position behindert waren, welche die Rolle einer Avantgardeorganisation für die Arbeiterklasse verwarf. Aber das größte Hindernis war das ideologische Gewicht der Konterrevolution. Dies traf auch auf Italien zu, wo die Bildung der Partito Comunista Internazionalista (die Battaglia Comunista und Prometeo veröffentlichte) im Jahre 1945 um Damen und Bordiga die Versprechen nicht hielt, welche ihre Mitglieder sich erhofft hatten. Während diese Organisation bei ihrer Gründung über ca. 3.000 Mitglieder verfügte, wurde sie infolge von Demoralisierung und Spaltungen – insbesondere nach der von Bordiga betriebenen Spaltung 1952, die zur Bildung der Parti Communiste International führte (sie veröffentlichte Programma Comunista), immer mehr geschwächt. Einer der Gründe für die Spaltungen und Schwächung liegt in der Aufgabe einer ganzen Reihe von Errungenschaften, die von Bilan in den 1930er Jahren erzielt worden waren.
In Frankreich verschwand 1952 die Gruppe Gauche Communiste de France (GCF), die 1945 gebildet worden war, und welche die Kontinuität mit den Positionen Bilan’s (bei gleichzeitiger Integration programmatischer Positionen der Deutsch-Holländischen Linken) darstellte und 42 Ausgaben ihrer Zeitschrift Internationalisme herausbrachte. Abgesehen von den Leuten, die der Parti Communiste International verbunden waren und Le Prolétaire veröffentlichten, vertrat eine andere Gruppe bis Anfang der 1960er Jahre Klassenpositionen in der Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (SouB). Aber diese aus dem Trotzkismus hervorgegangene Abspaltung nach dem 2. Weltkrieg gab schrittweise und ausdrücklich den Marxismus auf. Infolgedessen verschwand die Gruppe 1966.
Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre hatten mehrere Spaltungen von Socialisme ou Barbarie insbesondere gegenüber der Frage des Marxismus zur Bildung von kleinen Gruppen geführt, welche sich der rätistischen Bewegung anschlossen, insbesondere gehörte dazu ICO (Informations et Correspondances Ouvrières).
Man könnte noch andere Gruppen in anderen Ländern erwähnen, die zu dieser Zeit existierten, aber kennzeichnend für die Lage der damaligen Strömungen, die in den 1950er und Anfang der 1960er Jahren kommunistische Positionen vertreten haben, war ihre besonders schwache Mitgliederzahl. Ihre Publikationen zirkulierten eher in eingeweihten Kreisen, sie waren international isoliert. Darüber hinaus gab es theoretisch-programmatische Rückschritte, die entweder einfach zu ihrem Verschwinden oder zu einer sektenhaften Entwicklung geführt haben, wie das insbesondere bei der Parti Communiste International der Fall war, die sich als die einzige kommunistische Organisation auf der Welt betrachtete.
Das Wiedererstarken der revolutionären Positionen
Der Generalstreik 1968 in Frankreich, schließlich die verschiedenen massiven Bewegungen der Arbeiterklasse, über die wir im vorherigen Artikel berichtet haben, haben erneut die Idee der kommunistischen Revolution in zahlreichen Ländern auf die Tagesordnung gestellt. Die Lügen des Stalinismus, der sich als „kommunistisch“ und „revolutionär“ darstellte, zerbrachen überall. Daraus schlugen natürlich die Strömungen Kapital, die die UdSSR als „Mutterland des Sozialismus“ kritisierten, wie die maoistischen oder trotzkistischen Organisationen. 1968 erlebte die trotzkistische Bewegung, die sich auf ihren Kampf gegen Stalinismus berief, eine Art Neugeburt. Sie konnte damals aus dem Schatten der stalinistischen Parteien treten, der lange auf ihnen gelegen hatte. Ihr Wachstum war teilweise spektakulär, insbesondere in Frankreich, Belgien oder Großbritannien. Aber seit dem 2. Weltkrieg gehörte diese Strömung dem proletarischen Lager nicht mehr an, insbesondere weil sie „die Arbeitererrungenschaften der UdSSR“ verteidigt hatte, d.h. sie hatte das von der UdSSR beherrschte imperialistische Lager verteidigt. Nachdem die Arbeiterstreiks, die sich seit Ende der 1960er Jahre entfalteten, die arbeiterfeindliche Rolle der stalinistischen Parteien und Gewerkschaften, der wahren Rolle der Wahlen und der Demokratie als Herrschaftsinstrument der Bourgeoisie offenbart hatten, wurden viele Leute dazu bewogen, sich mit politischen Strömungen zu befassen, die in der Vergangenheit die Rolle der Gewerkschaften und des Parlamentarismus am deutlichsten entblößt hatten und den Kampf gegen den Stalinismus am klarsten verkörperten – die Kommunistische Linke.
Nach Mai 1968 wurden die Schriften Trotzkis sehr weit verbreitet, aber auch die Pannekoek’s, Gorter’s<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]-->, Rosa Luxemburgs, die als eine der Ersten kurz vor ihrer Ermordung im Januar 1919 die bolschewistischen Genossen vor gewissen Gefahren gewarnt hatten, die die Revolution in Russland bedrohten.
Neue Gruppen sind in Erscheinung getreten, die sich mit der Erfahrung der Kommunistischen Linken befassten. Diejenigen, die verstanden, dass der Trotzkismus eine Art linker Flügel des Stalinismus geworden war, wandten sich eher dem Rätismus zu als der Italienischen Linken. Dafür gab es mehrere Gründe. Die Verwerfung der stalinistischen Parteien ist oft mit der Verwerfung des Begriffs der kommunistischen Partei selbst verbunden. Dies war gewissermaßen der Preis, den die Neuen, welche sich der proletarischen Revolution zuwandten, der stalinistischen Lüge von der Kontinuität zwischen Bolschewismus und Stalinismus, zwischen Lenin und Stalin, zu zahlen hatten Diese falsche Idee wurde im Übrigen zum Teil durch die Positionen der bordigistischen Strömung mit verbreitet. Sie war die einzige Strömung, die aus der Italienischen Linken hervorgegangen war, welche sich international ein wenig ausbreiten konnte, und sich auf den „Monolithismus“ in ihren Reihen berief. Andererseits war dies eine Folge der Tatsache, dass die Strömungen, welche sich weiterhin auf diese Gruppierung beriefen, im Wesentlichen die Ereignisse des Mai 1968 nicht verstanden und sie verpasst haben, weil sie hinter ihnen nur einen Studentenprotest sahen und nicht die tiefer dahinter liegende historische Bedeutung.
Während gleichzeitig neue, vom Rätismus inspirierte Gruppen auftauchten, verbuchten die schon früher bestehenden Gruppen große Erfolge. Ihre Mitgliederzahlen nahmen spektakulär zu, während sie gleichzeitig zu einem politischen Bezugspunkt wurden. Dies traf insbesondere auf die Gruppe Informations et Correspondance Ouvrières (ICO= Arbeiterkorrespondenz und –informationen) zu, die aus einer Abspaltung von SouB 1958 hervorgegangen war, und die 1969 ein internationales Treffen in Brüssel organisierte, an der sich insbesondere Cohn-Bendit, Mattick (ein ehemaliges Mitglied der Deutschen Linken beteiligte, welcher in die USA ausgewandert war und dort verschiedene rätistische Zeitschriften veröffentlichte) und Cajo Brendel, Haupttriebkraft von Daad en Gedachte. Aber die Erfolge des „organisierten“ Rätismus waren nur von kurzer Dauer. Die Gruppe ICO löste sich 1974 auf. Die holländischen Gruppen fielen zusammen, nachdem ihre Haupttriebkräfte ihre Aktivitäten einstellten
In Großbritannien fiel die Gruppe Solidarity, die von den Positionen von Socialisme ou Barbarie inspiriert wurde, und einen ähnlichen Erfolg wie ICO hatte, nach einer Reihe von Spaltungen 1981 auseinander (obwohl ihre Londoner Sektion die Zeitschrift noch bis 1992 veröffentlichte). In Skandinavien haben die rätistischen Gruppen, die sich nach 1968 entwickelt haben, eine Konferenz im September 1977 in Oslo organisiert – aber dieser folgten keine weiteren Schritte.
Letztendlich hat sich die Strömung in den 1970er Jahren am weitesten entwickelt, die mit den Positionen von Bordiga (der im Juli 1970 starb) verbunden ist. Ihre Mitgliedschaft stieg damals insbesondere nach dem Ausbruch von Krisen bei linksextremen Gruppen (insbesondere bei maoistischen Gruppen). 1980 war die Internationale Kommunistische Partei die Organisation, welche sich auf die Kommunistische Linke berief, mit dem größten Einfluss auf internationaler Ebene. Aber diese „Öffnung“ der bordigistischen Strömung für Leute, die sehr stark von der extremen Linken geprägt waren, führte 1982 zu ihrem Zusammenbruch. Seitdem besteht sie weiter als eine Reihe von kleinen, auf sich beschränkten Sekten.
Der Anfang der IKS
Der bedeutendste langfristige Ausdruck dieses wieder erwachten Interesses an den Positionen der Kommunistischen Linken war unsere eigene Organisation<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]-->. Diese wurde im Wesentlichen vor gerade 40 Jahren gegründet, im Juli 1968 in Toulouse, als ein kleiner Kern von Leuten, der ein Jahr zuvor einen Diskussionskreis um einen Genossen R.V. gegründet hatte, eine erste Prinzipienerklärung verabschiedete. Dieser Genosse R.V. hatte seine ersten politischen Erfahrungen in der Gruppe Internacionalismo in Venezuela gesammelt. Diese Gruppe war 1964 von dem Genossen MC gegründet worden, der die Haupttriebkraft bei der Gauche Communiste de France (Kommunistische Linke Frankreichs – GCF – 1944–52) gewesen war, nachdem er zuvor von 1938 an der Italienischen Fraktion der Kommunistischen Linken angehört hatte, und der schon seit 1919 Militant gewesen war (im Alter von 12 Jahren). Zunächst war er in der Kommunistischen Partei Palästinas, dann in der Französischen Kommunistischen Partei aktiv gewesen. Während des Generalstreiks im Mai 1968 hatten Mitglieder des Diskussionszirkels mehrere Flugblätter mit dem Namen „Bewegung für den Aufbau von Arbeiterräten“ (MICO) verteilt. Sie hatten mit anderen Leuten diskutiert, bevor sie dann im Dezember 1968 die Gruppe Révolution Internationale gründeten. Diese Gruppe hatte Kontakt aufgenommen mit zwei anderen Gruppen, die der rätekommunistischen Bewegung angehörten – Rätekommunistische Organisation Clermont-Ferrand und „Rätekommunistische Hefte“, die in Marseille ansässig war. Mit diesen beiden Gruppen wurden dann weitere Diskussionen geführt.
Schließlich schlossen sich diese drei Gruppen 1972 zusammen, um die spätere Sektion der IKS in Frankreich, Révolution Internationale, zu gründen, welche dann mit der Veröffentlichung der Zeitschrift mit dem gleichen Namen (neue Serie) begann. In Fortsetzung der Politik von Internacionalismo, der GCF und Bilan’s, nahm Révolution Internationale Diskussionen mit verschiedenen Gruppen auf, die ebenfalls nach 1968 aufgetaucht waren, insbesondere in den USA (Internationalism). 1972 schickte Internationalism ein Schreiben an ca. 20 Gruppen, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, und rief zur Schaffung eines Netzes zum Austausch und der internationalen Debatte auf. Révolution Internationale reagierte darauf sehr positiv, und schlug dabei als Arbeitsperspektive die Organisierung einer internationalen Konferenz vor. Die anderen Gruppen, welche positiv reagierten, gehörten alle der rätekommunistischen Bewegung an. Die Gruppen, welche sich an die Italienische Linke anlehnten, stellten sich entweder taub oder hielten diese Initiative für verfrüht. Auf der Grundlage dieser Initiative fanden zwischen 1973 und 1974 mehrere Treffen in England und Frankreich statt, an denen sich insbesondere aus Großbritannien (World Revolution, Revolutionary Perspectives und Workers’ Voice) beteiligten, die ersten beiden Gruppen waren aus einer Abspaltung von Solidarity hervorgegangen und die letzte aus einer Abspaltung von den Trotzkisten).
Schließlich führte dieser Zyklus von Treffen im Januar 1975 zu einer Konferenz, bei der die Gruppen, welche die gleiche politische Orientierung teilten – Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Rivoluzione Internazionale (Italien) und Accion Proletaria (Spanien) beschlossen, sich zur Internationalen Kommunistischen Strömung zusammenzuschließen.
Die IKS beschloss dann die Fortsetzung der Politik der Kontaktaufnahme und Diskussionen mit anderen Gruppen der Kommunistischen Linken. So nahm die IKS an den Konferenzen in Oslo 1977 (mit Revolutionary Perspectives) teil und antwortete positiv auf die 1976 von Battaglia Comunista vorgeschlagene Initiative zur Abhaltung einer internationalen Konferenz von Gruppen der Kommunistischen Linken.
Die drei danach stattgefundenen Konferenzen – 1977 in Mailand, 1978 in Paris, 1980 in Paris – stießen auf ein wachsendes Interesse unter den Leuten, die sich auf die Kommunistische Linke beriefen, aber die Entscheidung Battaglia Comunista’s und der Communist Workers’ Organisation (die aus einem Zusammenschluss von Revolutionary Perspectives und Workers’ Voice in Großbritannien hervorgegangen war), die IKS aus dem Diskussionsprozess auszuschließen, bedeutete dann auch das Ende der Konferenzen<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]-->. Der sektiererische Rückzug (zumindest die Abgrenzung gegenüber der IKS) von Battaglia Comunista und der Communist Workers’ Organisation (die sich 1984 im Internationalen Büro für die Revolutionäre Partei – IBRP zusammenschlossen) zeigte, dass die Initialzündung durch das historische Wiederauftauchen der Arbeiterklasse im Mai 1968, die zur Bildung der Kommunistischen Linken geführt hatte, nun zu Ende gekommen war.
Aber trotz der Schwierigkeiten, auf die die Arbeiterklasse während der letzten Jahrzehnte gestoßen ist, insbesondere aufgrund der ideologischen Kampagnen über den „Tod des Kommunismus“ nach dem Zusammenbruch der stalinistischen Regime, hat es die Weltbourgeoisie nicht geschafft, der Arbeiterklasse eine entscheidende Niederlage beizufügen. Dies kommt durch die Tatsache zum Ausdruck, dass die Kommunistische Linke (die hauptsächlich durch das IBRP<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> und vor allem die IKS verkörpert wird) ihre Positionen aufrechterhalten hat und heute auf ein wachsendes Interesse bei den Leuten stößt, die infolge des langsamen Wiedererstarkens des Klassenkampfes seit 2003 nach einer revolutionären Perspektive suchen.
Fabienne 6. Juli 2008
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Kommunistische Partei Frankreichs
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> CGT= Confédération générale du Travail: Sie ist die stärkste Gewerkschaftszentrale, insbesondere im Industriebereich, im Transportwesen und unter den Beamten. Sie wird von der KPF kontrolliert.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> Confédération francaise démocratique du Travail. Dieser Gewerkschaftsverband ist christlichen Ursprungs aber Anfang der 1960er Jahre verwarf sie ihren Bezug auf das Christentum und sie wurde seitdem stark von der Sozialistischen Partei beeinflusst sowie von einer kleinen sozialistischen Partei (PSU), die seitdem eingegangen ist.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> Fernsehberichterstatter, der sehr auf „Ausgleich“ bedacht war.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> Sportkommentator mit zügellosem Chauvinismus
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Am Morgen nach der Rede weigerten sich die Beschäftigten der Kommunalbetriebe an vielen Orten, das Referendum zu organisieren. Auch wussten die Behörden nicht, wo sie die Stimmzettel drucken sollten. Die staatliche Druckerei wurde bestreikt und die nicht streikenden privaten Druckereien verweigerten die Annahme des Auftrags. Ihre Arbeitgeber wollte keine zusätzlichen Scherereien mit ihren Arbeitern haben.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> Georges Séguy war ebenso Mitglied des Politbüros der KPF.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> Man erfuhr später, dass Chirac, Staatssekretär im Sozialministerium ebenso Krasucki (auf einem Speicher) getroffen hat. Dieser war damals die Nummer 2 der CGT.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]--> Eine geheime bewaffnete Organisation: eine geheime Militär- und Partisanenorganisation, die für den Verbleib Frankreichs in Algerien kämpfen wollte. Anfang der 1960er Jahre verübte sie terroristische Attentate und sie versuchte gar de Gaulle umzubringen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[10]<!--[endif]--> Electricité de France
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[11]<!--[endif]--> CRS=Compagnies républicaines de Sécurité: nationale Polizeikräfte, spezialisiert auf die Niederschlagung von Straßendemonstrationen.
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[12]<!--[endif]--> Kräfte der Nationalgendarmerie (d.h. der Armee), die die gleiche Rolle wie die CRS haben
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[13]<!--[endif]--> Die beiden Haupttheoretiker der Holländischen Linken
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[14]<!--[endif]--> Eine umfassendere Darstellung der Geschichte der IKS findet man in „Aufbau der revolutionären Organisation: 20 Jahre IKS – Internationale Revue Nr. 16 – und „30 Jahre IKS: Von Vergangenheit für die Zukunft lernen“ – Internationale Revue Nr. 37
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[15]<!--[endif]--> Zu den Konferenzen siehe unseren Artikel: „Die internationalen Konferenzen der Kommunistischen Linken (1976-1980) – Lehren einer Erfahrung für das proletarische Milieu“ – Internationale Revue Nr.38
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
<!--[if !supportFootnotes]-->[16]<!--[endif]--> Jegliche Entwicklung des IBRPs im Vergleich zur IKS ist hauptsächlich auf ihr Sektierertum sowie seine opportunistische Umgruppierungspolitik zurückzuführen (wodurch sie oft schon auf Sand gebaut hat). Siehe dazu unseren Artikel „Eine opportunistische Politik der Umgruppierung führt lediglich zu „Fehlgeburten“, Internationale Revue Nr. 36)
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
Internationale Revue - 2009
- 3794 Aufrufe
Internationale Revue 43
- 2896 Aufrufe
Dekadenz des Kapitalismus (2)
- 3465 Aufrufe
Welche wissenschaftliche Methode benötigen wir, um die gegenwärtige gesellschaftliche Ordnung und die Bedingungen und Mittel ihrer Aufhebung zu verstehen?
Im ersten Teil dieser Serie untersuchten wir die Abfolge der Weltkriege, Revolutionen und globalen Wirtschaftskrisen, die den Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsepoche im frühen 20. Jahrhundert ankündeten und die die Menschheit vor die historische Alternative stellen: Errichtung einer höheren Produktionsweise oder Rückfall in die Barbarei. Aber das Verständnis der Ursprünge und Ursachen der Krisen, denen sich die Menschheit gegenübersieht, bedarf einer Theorie, die die gesamte Bewegung der Geschichte umfasst. Allgemeine Geschichtstheorien sind nicht mehr angesagt unter den offiziellen Historikern, die mit Fortdauer der Niedergangsepoche des Kapitalismus zunehmend in Verlegenheit gerieten, irgendeinen Über- und einen wirklichen Einblick in die Quellen der Spirale von Katastrophen anzubieten, die diese Periode gekennzeichnet haben. Große historische Visionen sind nicht mehr in Mode; sie werden abgetan als Abkömmlinge des idealistischen deutschen Philosophen Hegel oder der allzu optimistischen englischen Liberalen, die auf dem gleichen Gebiet die Idee eines stetigen Fortschritts der Geschichte aus der Dunkelheit und Tyrannei zur wunderbaren Freiheit der Bürger im modernen Verfassungsstaat entwickelten.
In der Tat ist diese Unfähigkeit, die historische Bewegung in ihrer Gesamtheit zu sehen, kennzeichnend für eine Klasse, die nicht mehr für den historischen Fortschritt steht und deren Gesellschaftssystem der Menschheit keine Zukunft mehr anbieten kann. Als die Bourgeoisie noch davon überzeugt war, dass ihre Produktionsweise im Vergleich zu früheren Gesellschaftsformen einen fundamentalen Fortschritt für die Menschheit darstellte und als sie die Zukunft mit dem wachsenden Selbstvertrauen einer im Aufstieg befindlichen Klasse betrachten konnte, da konnte sie noch einen längeren Blick zurück, aber auch nach vorn wagen. Die Schrecken in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts versetzten diesem Vertrauen den Todesstoß. Nicht nur dass symbolische Ortsnamen wie die Somme oder Passchendaele, wo Zehntausende von jungen Eingezogenen im I. Weltkrieg abgeschlachtet wurden, oder Auschwitz und Hiroshima, synonym für den Massenmord an Zivilisten durch den Staat, oder gleichermaßen symbolische Daten wie 1914, 1929 und 1939 alle früheren Behauptungen über den Fortschritt in Frage stellen; sie legen auch auf alarmierende Weise nahe, dass die gegenwärtige Gesellschaftsordnung nicht so ewig sein wird, wie es einst schien. Insgesamt ziehen es die bürgerlichen Geschichtsschreiber angesichts der Aussicht auf ihr eigenes Dahinscheiden - entweder durch den Kollaps ihrer Ordnung in eine Anarchie oder, was für die Bourgeoisie auf dasselbe hinausläuft, durch ihren Sturz durch die revolutionäre Arbeiterklasse - vor, Scheuklappen aufzusetzen und sich selbst in einem engstirnigen Kurzzeit-Empirismus zu verlieren - kurzzeitig und lokal - oder Theorien wie den Relativismus und Postmodernismus zu entwickeln, die jeglichen Begriff einer fortschrittlichen Bewegung von einer Epoche zur nächsten und jeglichen Versuch ablehnen, ein Entwicklungsmuster in der menschlichen Geschichte auszumachen. Darüber hinaus wird diese Unterdrückung des historischen Bewusstseins täglich im Bereich der Massenkultur verstärkt, intensiviert durch die verzweifelten Bedürfnisse des Marktes: Alles von Wert muss jetzt und neu sein, von nirgendwo kommend, ins Nirgendwo gehend.
Angesichts der Kleingeistigkeit eines großen Teils der etablierten Gelehrtheit ist es kein Wunder, dass so viele, die noch immer danach streben, den allgemeinen Sinn der Geschichte insgesamt zu verstehen, von den Verkäufern des Schlangengifts der Religion und des Okkultismus betört werden. Der Nazismus war eine frühe Manifestation dieses Trends - ein Kunterbunt von okkultistischen Theosophien, Pseudo-Darwinismus und rassistischen Verschwörungstheorien, die eine einfache Lösung all der Probleme der Welt anbieten und jede weitere Notwendigkeit des Denkens wirksam annullieren. Der islamische und christliche Fundamentalismus oder die zahllosen Verschwörungstheorien über die Geheimgesellschaften, die die Geschichte manipulieren, spielen heute dieselbe Rolle. Die offizielle bürgerliche Vernunft versagt nicht nur darin, auch nur eine bescheidene Antwort auf die Probleme im gesellschaftlichen Bereich anzubieten - sie hat es größtenteils aufgegeben, diese Fragen erst zu stellen, und überlässt somit der Unvernunft das Feld, die an ihren eigenen mythologischen Lösungen bastelt.
Die herrschende Weisheit ist sich in einem gewissen Sinn all dessen bewusst. Sie ist bereit, anzuerkennen, dass sie in der Tat einen Verlust ihres Selbstvertrauens erlitten hat. Statt positiv die Lobpreisungen des liberalen Kapitalismus als die feinsten Errungenschaften des menschlichen Geistes nachzubeten, neigt sie nun dazu, ihn als die beste unter den schlechten Lösungen zu porträtieren, sicherlich verunstaltet, aber allemal all den Formen des Fanatismus vorzuziehen, die allem Anschein gegen sie aufgeboten werden. Im Lager der Fanatiker äußert sich dies nicht nur im Faschismus oder im islamischen Terrorismus, sondern betrifft auch den Marxismus, der nun endgültig als ein Markenzeichen für utopischen Messianismus zurückgewiesen wird. Wie oft ist uns erzählt worden, üblicherweise von drittklassigen Denkern, die die Allüren haben, etwas Neues zu sagen: Die marxistische Geschichtsanschauung sei eine bloße Umkehrung des judäisch-christlichen Mythos von der Geschichte als eine Erlösungsgeschichte; der Urkommunismus sei der Garten Eden, der künftige Kommunismus das kommende Paradies; das Proletariat sei das auserwählte Volk oder der leidende Knecht Gottes, die Kommunisten seien die Propheten. Doch uns wird ebenfalls erzählt, dass diese religiösen Projektionen alles andere als harmlos seien: Die Realität der „marxistischen Herrschaft" habe gezeigt, wo solche Versuche, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, enden müssten - in der Tyrannei und in Arbeitslagern, in dem irrsinnigen Projekt, die unvollkommene Menschheit nach seiner Vision von Perfektion zu modellieren.
Und in der Tat wird diese Analyse vom Werdegang des Marxismus im 20. Jahrhundert allem Anschein nach bestätigt. Wer kann leugnen, dass Stalins GPU an die Heilige Inquisition erinnert oder dass Lenin, Stalin, Mao und andere Große Führer zu den neuen Göttern auserkoren wurden? Doch dieser Beweis ist zutiefst unsolide. Er beruht auf der größten Lüge des Jahrhunderts: dass Stalinismus gleich Kommunismus gewesen sei, wo er tatsächlich dessen totale Negation war. Wenn der Stalinismus in der Tat eine Form der kapitalistischen Konterrevolution war, wie wirklich revolutionäre Marxisten meinen, dann muss das Argument, dass die marxistische Theorie unvermeidlich zum Gulag führen musste, in Frage gestellt werden.
Und wir können auch so antworten, wie Engels dies in seinen Schriften über die Frühgeschichte des Christentums getan hatte, nämlich dass die Ähnlichkeiten zwischen den Ideen der modernen Arbeiterbewegung und den Worten der biblischen Propheten oder der frühen Christen nicht befremdlich sind, da auch Letztere das Streben der unterdrückten und ausgebeuteten Klassen und ihre Hoffnungen auf eine Welt, die auf menschlicher Solidarität statt auf Klassenherrschaft beruht, repräsentierten. Wegen der Einschränkungen, die von den Gesellschaftssystemen erzwungen wurden, in welchen sie auftraten, konnten diese frühen Kommunisten nicht über die religiöse oder mystische Vision einer klassenlosen Gesellschaft hinausgehen. Heute ist dies nicht mehr der Fall, weil die historische Entwicklung die kommunistische Gesellschaft zu einer rationalen Möglichkeit sowie zu einer dringenden Notwendigkeit gemacht hat. Nur indem wir den modernen Kommunismus nicht im Lichte alter Mythen betrachten, können wir die alten Mythen im Lichte des modernen Kommunismus begreifen.
Für uns ist der Marxismus, der historische Materialismus nichts, wenn nicht der theoretische Ausblick einer Klasse, die eine neue und höhere gesellschaftliche Form in sich trägt. Ihre Bemühungen, ja ihr Bedürfnis, die Geschichte der Vergangenheit und die Perspektiven für die Zukunft zu untersuchen, sind somit nicht überschattet von den Vorurteilen einer herrschenden Klasse, die letztendlich stets dazu gezwungen ist, die Realität im Interesse ihres Ausbeutungssystems zu leugnen und zu vernebeln. Die marxistische Theorie basiert auch, im Gegensatz zu den romantischen Bestrebungen früherer ausgebeuteter Klassen, auf einer wissenschaftlichen Methode. Sie mag zwar keine exakte Wissenschaft im Sinne der Naturwissenschaften sein, da sie die Menschheit und ihre höchst komplexe Geschichte nicht auf eine Reihe reproduzierbarer Laborexperimente reduzieren kann - aber diesen Gesetzmäßigkeiten ist auch die Evolutionstheorie unterworfen. Der Punkt ist, dass allein der Marxismus in der Lage ist, die wissenschaftliche Methode auf die Untersuchung der herrschenden Gesellschaftsordnung und auf die Gesellschaftsordnungen anzuwenden, die ihr vorausgingen, indem er rigoros die beste geisteswissenschaftliche Forschung nutzt, die die herrschende Klasse anbieten kann, und über sie hinausgeht sowie eine höhere Synthese skizziert.
Vorwort zur Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie
1859 schrieb Marx, der über bis beide Ohren tief n der Arbeit zum späteren Kapital steckte, eine kurze Schrift, dei eine meisterhafte Zusammenfassung seiner gesamten historischen Methode wiedergibt. Es war die Schrift, die „Zur Kritik der politischen Ökonomie" genannt wurde, ein Text, der größtenteils verdrängt und überschattet wurde vom Erscheinen des Kapitals. Nachdem er uns einen komprimierten Bericht über seine Gedankengänge von seinen ersten Wertstudien bis zu seiner damaligen Hauptbeschäftigung, der politischen Ökonomie, gegeben hat, kommt Marx zum springenden Punkt - dem „Das allgemeine Resultat...meine(r) Studien zum Leitfaden diente". Hier wird die marxistische Geschichtstheorie mit meisterhafter Präzision und Klarheit zusammengefasst. Wir beabsichtigen daher, diese Zeilen so getreu wie möglich zu studieren, um die Grundlage für ein wirkliches Verständnis der Epoche zu legen, in der wir leben.
Wir haben die wichtigste Passage aus diesem Text in einem Anhang am Schluss dieses Artikels zusammengefasst, aber hier beabsichtigen wir, jeden seiner Bestandteile im Detail zu betrachten.
Produktionsverhältnisse und Produktivkräfte
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt."
Der Marxismus wird häufig von seinen Kritikern, bürgerlich-konvertionell oder pseudoradikal, als eine mechanistische, „objektivistische" Theorie karikiert, die danach trachte, die Komplexität des historischen Prozesses auf eine Serie von ehernen Gesetzen zu reduzieren, über die die menschlichen Subjekte keine Kontrolle hätten und die sie wie ein Moloch zu einem schicksalhaften, determinierten äußersten Resultat trieben. Wenn uns nicht gar erzählt wird, dass er eine andere Form der Religion sei, dann wird zumindest gesagt, dass das marxistische Gedankengut ein typisches Produkt der unkritischen Anbetung der Wissenschaft im 19. Jahrhundert und ihrer Illusionen in den Fortschritt sei, das danach strebe, die vorhersagbaren, verifizierbaren Gesetze der natürlichen Welt - physikalisch, chemisch, biologisch - auf die im wesentlichen unvorhersehbaren Muster im gesellschaftlichen Leben anzuwenden. Marx wird schließlich als Autor einer Theorie der unvermeidlichen und linearen Evolution von einer Produktionsweise zur nächsten porträtiert, die unaufhaltsam von der primitiven Gesellschaft über die Sklaverei, den Feudalismus und Kapitalismus zum Kommunismus führe. Und dieser ganze Prozess sei umso mehr vorbestimmt, als er angeblich von einer rein technischen Entwicklung der Produktivkräfte verursacht werde.
Wie alle Karikaturen enthält auch dieses Bild ein Körnchen Wahrheit. Es ist zum Beispiel wahr, dass es in der Periode der Zweiten Internationale, als es eine wachsende Tendenz zur „Institutionalisierung" der Arbeiterparteien gegeben hatte, einen äquivalenten Prozess auf der theoretischen Ebene gab, eine Widerstandslosigkeit gegenüber den vorherrschenden Fortschrittskonzeptionen und eine gewisse Neigung, „Wissenschaft" als ein Ding an sich zu betrachten, losgetrennt von den realen Klassenverhältnissen in der Gesellschaft. Kautskys Idee vom wissenschaftlichen Sozialismus, der durch die Intervention der Intellektuellen in die proletarischen Massen injiziert werden müsse, war ein Ausdruck dieser Tendenz. Dies war umso mehr der Fall, als im 20. Jahrhundert, nachdem so vieles von dem, was einst den Marxismus ausgemacht hatte, nun zu einer offenen Rechtfertigung für die kapitalistische Ordnung geworden war, mechanistische Visionen des historischen Fortschritts nun offiziell kodifiziert wurden. Es gibt keine deutlichere Demonstration dafür als Stalins Fibel des „Marxismus-Leninismus", die Geschichte der KPdSU (Kurzfassung), wo die Theorie des Primats der Produktivkräfte als die materialistische Geschichtsauffassung schlechthin vorgestellt wird:
„Die zweite Besonderheit der Produktion besteht darin, dass ihre Veränderungen und ihre Entwicklung mit Veränderungen und Entwicklungen der Produktivkräfte und vor allem der Produktionsmittel beginnen. Die Produktivkräfte sind deshalb das dynamischste und revolutionärste Element der Produktion. Zunächst verändern sich die Produktivkräfte der Gesellschaft selber und entwickeln sich; dann verändern sich im Verhältnis zu ihnen und in Übereinstimmung mit dieser Veränderung die Produktionsverhältnisse zwischen den Menschen, die wirtschaftlichen Verhältnisse."
Diese Konzeption des Primats der Produktivkräfte fiel nahtlos mit dem fundamentalen Projekt des Stalinismus zusammen: die „Entwicklung der Produktivkräfte" der UdSSR auf Kosten des Proletariats mit dem Ziel, Russland zu einer Hauptmacht auf der Welt zu machen. Es war vollkommen im Interesse des Stalinismus, die Anhäufung von Schwerindustriebetrieben in den 1930er Jahren als Einzelschritte zum Kommunismus darzustellen und jede Untersuchung der hinter dieser „Entwicklung" befindlichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu verhindern - die brutale Ausbeutung der Klasse der LohnarbeiterInnen, mit anderen Worten: die Extraktion von Mehrwert mit dem Ziel der Akkumulation des Kapitals.
Marx hat diese ganze Herangehensweise in den ersten Zeilen des Kommunistischen Manifestes widerlegt, die den Klassenkampf als die dynamische Kraft in der historischen Evolution darstellen, mit anderen Worten: den Kampf zwischen verschiedenen Gesellschaftsklassen („Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener") um die Aneignung der Mehrarbeit. Sie wird nicht minder entschieden von den einleitenden Zeilen unseres Zitats aus dem Vorwort widerlegt: „In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein..." Es sind menschliche Wesen aus Fleisch und Blut, die „bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse" eingehen, die Geschichte machen, nicht „Produktivkräfte", nicht Maschinen, auch wenn es notwendigerweise eine enge Verknüpfung zwischen den Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften, die sich für sie „eignen", gibt. Wie Marx es in einer anderen berühmten Stelle im 18. Brumaire des Louis Bonaparte formulierte: „Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen."
Man beachte dabei: unter Bedingungen, die sie nicht selbst gewählt haben; die Menschen treten in „von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse". Bisher zumindest. Unter den Bedingungen, die in allen bis dahin existierenden Gesellschaftsformen vorgeherrscht hatten, waren die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Menschen unter sich bilden, mehr oder weniger unklar für sie, mehr oder weniger überschattet von mythologischen und ideologischen Darstellungen; aus dem gleichen Grunde tendieren mit dem Aufkommen der Klassengesellschaft die Formen des Reichtums, den die Menschen durch diese Verhältnisse erzeugen, dazu, sich ihnen zu entziehen, zu einer fremden Kraft zu werden, die über ihnen steht. In dieser Sichtweise sind die Menschen keine passiven Produkte ihrer Umwelt oder die Werkzeuge, die sie produzieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, sie sind stattdessen noch nicht Meister ihrer eigenen gesellschaftlichen Kräfte oder der Produkte ihrer eigenen Arbeit.
Gesellschaftliches Sein und gesellschaftliches Bewusstsein
„Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt (...) In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären."
Mit einem Wort, die Menschen machen Geschichte, aber noch nicht in vollem Bewusstsein dessen, was sie tun. Von nun an können wir uns, wenn wir den historischen Wandel untersuchen, nicht damit zufrieden geben, das Gedankengut und den Glauben einer Epoche zu studieren oder die Modifizierungen in den Regierungssystemen und Gesetzen zu prüfen. Um zu begreifen, wie diese Ideen und Systeme entstehen, ist es notwendig, auf die fundamentalen gesellschaftlichen Konflikte, die dahinter liegen, zurück zu gehen.
Noch einmal: diese Herangehensweise an die Geschichte missachtet nicht die aktive Rolle des Bewusstseins, des Glaubens und der legal-politischen Formationen, ihren realen Einfluss auf die Gesellschaftsverhältnisse und die Entwicklung der Produktivkräfte. Zum Beispiel war die Ideologie der Sklavenhalterklasse in der Antike eine Ideologie, die der Arbeit äußerste Geringschätzung entgegenbrachte. Diese Haltung spielte eine wichtige Rolle dabei, dass die Umsetzung der sehr beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritte, die von den griechischen Denkern erzielt wurden, in eine praktische Entwicklung der Wissenschaft, in allgemeine Werkzeuge und Techniken, verhindert wurde, was die Arbeitsproduktivität erhöht hätte. Doch die zugrundeliegende Realität hinter dieser Barriere war die sklavische Produktionsweise an sich: Es war die Existenz der Sklaverei im Zentrum der Wohlstandsmehrung der klassischen Gesellschaft, die die Quelle der Geringschätzung der Arbeit durch die Sklavenhalter und ihrer Überzeugung war, dass man, wollte man das Mehrprodukt erhöhen, sich mehr Sklaven verschaffen musste.
In späteren Schriften mussten Marx und Engels ihre theoretische Herangehensweise sowohl gegen Kritiker als auch gegen fehlgeleitete Anhänger verteidigen, die das Diktum, dass es das gesellschaftliche Sein ist, welches das gesellschaftliche Bewusstsein bestimmt, auf die einfachst mögliche Art interpretierten, indem sie beispielsweise vorgaben, dass dies bedeute, dass alle Mitglieder der Bourgeoisie unvermeidlich dazu bestimmt seien, wegen ihrer ökonomischen Gesellschaftsstellung nur in eine Richtung denken, oder, noch absurder, dass alle Mitglieder des Proletariats unweigerlich ein klares Bewusstsein über ihre Klasseninteressen hätten, weil sie der Ausbeutung unterworfen seien. Es war genau solch eine reduktionistische Haltung, die Marx dazu veranlasste zu behaupten: „Ich bin kein Marxist." Es gibt zahllose Gründe, warum in der Arbeiterklasse, so wie sie existiert in der „Normalität" des Kapitalismus, lediglich eine Minderheit ihre reale Klassensituation erkennt: nicht nur Unterschiede in den individuellen Lebensgeschichten und Psychologien, sondern auch und besonders die aktive Rolle, die von der herrschenden Ideologie gespielt wird, um zu verhindern, dass die Beherrschten ihre eigenen Klasseninteressen begreifen - eine herrschende Ideologie, die eine viel längere Geschichte und Auswirkung hat als die unmittelbare Propaganda der herrschenden Klasse, da sie in den Köpfen der Unterdrückten tief verinnerlicht ist. „Die Tradition aller toten Geschlechter lastet wie ein Alp auf dem Gehirne der Lebenden", wie Marx es gleich nach der Passage aus dem 18. Brumaire über die Menschen formulierte, die Geschichte unter Bedingungen machen, die nicht ihre Wahl sind.
In der Tat zeigt Marx‘ Vergleich zwischen der Ideologie einer Epoche und dem, was ein Individuum über sich selbst denkt, weit entfernt davon, reduktionistisch zu sein, psychologische Tiefe: Es wäre ein schlechter Psychoanalytiker, der kein Interesse daran zeigt, was ein Patient ihm über seine Gefühle und Überzeugungen mitteilt, aber es wäre ein gleichfalls schlechter Analytiker, der kurz vor der Selbstbewusstwerdung des Patienten stoppt und die Komplexität der versteckten und unbewussten Elemente in seinem psychologischen Gesamtprofil ignoriert. Dasselbe trifft auch auf die Geschichte der Ideen und auf die „politische" Geschichte zu. Sie können uns viel darüber erzählen, was in einer vergangenen Epoche geschah, doch für sich genommen, geben sie nur eine verzerrte Widerspiegelung der Realität wider. Daher Marx‘ Ablehnung aller historischen Vorgehensweisen, die an der Oberfläche der Ereignisse bleiben:
„Die ganze bisherige Geschichtsauffassung hat diese wirkliche Basis der Geschichte entweder ganz und gar unberücksichtigt gelassen oder sie nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem geschichtlichen Verlauf außer allem Zusammenhang steht. Die Geschichte muss daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab beschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion erscheint als Urgeschichtlich, während das Geschichtliche als das vom gemeinen Leben Getrennte, Extra-Überweltliche erscheint. Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte ausgeschlossen, wodurch der Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt wird. Sie hat daher in der Geschichte nur politische Haupt- und Staatsaktionen und religiöse und überhaupt theoretische Kämpfe sehen können und speziell bei jeder geschichtlichen Epoche die Illusion dieser Epoche teilen müssen. Z.B. bildet sich eine Epoche ein, durch rein ‚politische‘ oder ‚religiöse‘ Motive bestimmt zu werden, obgleich ‚Religion‘ und ‚Politik‘ nur Formen ihrer wirklichen Motive sind, so akzeptiert ihr Geschichtsschreiber diese Meinung. Die ‚Einbildung‘, die ‚Vorstellung‘ dieser bestimmten Menschen über ihre wirkliche Praxis wird in die einzig bestimmende und aktive Macht verwandelt, welche die Praxis dieser Menschen beherrscht und bestimmt. Wenn die rohe Praxis, in der die Teilung der Arbeit bei den Indern und Ägyptern vorkommt, das Kastenwesen bei diesen Völkern in ihrem Staat und ihrer Religion hervorruft, so glaubt der Historiker, das Kastenwesen sei die Macht, welche die rohe gesellschaftliche Form erzeugt habe."[1]
Epochen der sozialen Revolution
Wir kommen jetzt zur Passage aus dem Vorwort, die am deutlichsten zu einem Verständnis der gegenwärtigen historischen Phase im Leben des Kapitalismus führt: „Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein."
Auch hier zeigt Marx, dass das aktive Element im historischen Prozess die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, in die sich die Menschen begeben, um das Lebensnotwendige herzustellen. Wenn wir zurückblicken auf die Bewegung von einer Gesellschaftsformation zur nächsten, wird es offensichtlich, dass es eine ständige Dialektik zwischen Perioden, in denen diese Verhältnisse zu einer wirklichen Weiterentwicklung der Produktivkräfte verhelfen, und jenen Perioden gibt, in denen dieselben Verhältnisse zu einer Barriere gegen die Weiterentwicklung werden. Im Kommunistischen Manifest zeigten Marx und Engels auf, dass die kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die aus der zerfallenden feudalen Gesellschaft aufgetaucht waren, als eine zutiefst revolutionäre Kraft agierten, indem sie alle stagnierenden, statischen Formen des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens hinwegfegten, die ihnen im Weg standen. Die Notwendigkeit, miteinander zu konkurrieren und so billig wie möglich zu produzieren, zwang die Bourgeoisie, die Produktivkräfte ständig zu revolutionieren. Die unaufhörliche Notwendigkeit, neue Märkte für ihre Waren zu finden, zwang sie, den gesamten Erdball einzunehmen und eine Welt nach ihrem eigenen Bilde zu schaffen.
1848 waren die kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse eindeutig eine „Entwicklungsform" und hatten sich erst in einem oder zwei Ländern fest etabliert. Jedoch veranlasste die Gewaltsamkeit der Wirtschaftskrisen im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts die Autoren des Manifests anfangs zur Schlussfolgerung, dass der Kapitalismus bereits zu einer Fessel der Produktivkräfte geworden sei und die kommunistische Revolution (oder zumindest der schnelle Übergang von der bürgerlichen zur proletarischen Revolution) auf der unmittelbaren Tagesordnung stünde.
„In den Handelskrisen wird ein großer Teil nicht nur der erzeugten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmäßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt. Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehen, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Zivilisation und der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums. Die bürgerlichen Verhältnisse sind zu eng geworden, um den von ihnen erzeugten Reichtum zu fassen."[2]
Mit der Niederlage der Revolutionen von 1848 und der enormen Expansion des Weltkapitalismus, die in der folgenden Periode stattfand, sollten sie diese Ansicht revidieren, auch wenn sie noch immer ungeduldig auf die Ankunft des langersehnten Zeitalters der sozialen Revolution warteten, auf den Tag der Abrechnung mit der arroganten Herrschaft des Weltkapitals. Doch der Kern dieser Herangehensweise ist die grundlegende Methode: die Erkenntnis, dass eine Gesellschaftsordnung nicht weggefegt werden kann, ehe sie endgültig in Konflikt mit der Weiterentwicklung der Produktivkräfte getreten ist und die gesamte Gesellschaft in eine Krise gestürzt hat, die keine zeitweilige, keine Jugendkrise ist, sondern ein ganzes „Zeitalter" von Krisen, Erschütterungen, der sozialen Revolution, in einem Wort: eine Krise der Dekadenz.
1858 kehrte Marx erneut zu dieser Frage zurück: „Die eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft ist die Herstellung des Weltmarkts, wenigstens seinen Umrissen nach, und einer auf seiner Basis ruhenden Produktion. Da die Welt rund ist, scheint dies mit der Kolonisation von Kalifornien und Australien und dem Aufschluss von China und Japan zum Abschluss gebracht. Die schwierige Frage für uns ist die: auf dem Kontinent ist die Revolution imminent und wird sofort einen sozialistischen Charakter annehmen. Wird sie in diesem kleinen Winkel nicht notwendig unterdrückt werden, da auf viel größerem Terrain die Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft noch aufsteigend ist."[3]
Was an diesen Zeilen so interessant ist, das sind genau die Fragen, die sie stellen: Worin bestehen die historischen Kriterien zur Bestimmung des Wechsels zu einer Periode der Revolution im Kapitalismus? Kann es eine erfolgreiche kommunistische Revolution geben, solange der Kapitalismus noch immer ein global expandierendes System ist? Marx war voreilig, als er dachte, dass die Revolution in Europa anstünde. Tatsächlich schien er in einem Brief an Vera Sassulitsch über das russische Problem, 1881 geschrieben, auch hier seine Auffassung modifiziert zu haben, als er im zweiten Entwurf dazu meinte, dass „das kapitalistische System im Westen im Verblühen ist, und sich die Zeit nähert, da es nur noch eine „archaische" Formation sein wird"[4]. 20 Jahre nach 1858 „näherte" sich das System selbst in den fortgeschrittenen Ländern erst seinem „Verblühen". Erneut drückte dies die Schwierigkeiten aus, denen sich Marx angesichts der historischen Lage, in der er lebte, gegenübersah. Wie sich herausstellte, hatte der Kapitalismus noch eine letzte Phase realer globaler Entwicklung vor sich, die Phase des Imperialismus, die in eine Epoche der Erschütterungen auf Weltebene hineinführen sollte und der Indikator für die Tatsache war, dass das System in seiner Gesamtheit, und nicht nur ein Teil von ihm, in seine Senilitätskrise stürzte. Jedoch zeigen Marx‘ Äußerungen in diesen Briefen, wie ernst er das Problem nahm, eine revolutionäre Perspektive von der Entscheidung abhängig zu machen, ob der Kapitalismus diese Stufe erreicht hat oder nicht.
Weg mit den überholten Werkzeugen: die Notwendigkeit von Dekadenzphasen
„Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind."
In der nächsten Passage betont Marx weiterhin, wie wichtig es ist, eine Perspektive der sozialen Revolution nicht auf die rein moralische Abscheu zu basieren, die von einem Ausbeutungssystem ausgelöst wird, sondern auf dessen Unfähigkeit, die Arbeitsproduktivität und allgemein die Kapazitäten des menschlichen Wesens weiterzuentwickeln, seine materiellen Bedürfnisse zu befriedigen.
Das Argument, dass eine Gesellschaft niemals ihr Leben aushaucht, ehe sie nicht alle Entwicklungskapazitäten ausgeschöpft hat, ist benutzt worden, um gegen die Idee zu argumentieren, dass der Kapitalismus seine Dekadenzperiode erreicht hat: Der Kapitalismus sei seit 1914 deutlich gewachsen; man könne nicht sagen, dass er dekadent sei, solange nicht sämtliches Wachstum stoppe. Es ist richtig, dass ein großer Teil der Konfusionen durch Theorien wie jene von Trotzki aus dem Jahr 1930 verursacht worden war. Eingedenk dessen, dass der Kapitalismus sich in den heftigsten Kämpfen seiner bis damals größten Depression befand, schien diese Ansicht plausibel; darüber hinaus kann der Gedanke, dass die Dekadenz durch einen vollständigen Stopp in der Entwicklung der Produktivkräfte gekennzeichnet sei, ja sogar durch eine Rückbildung, in einem gewissen Sinn auf die früheren Klassengesellschaften angewendet werden, wo die Krise stets das Resultat der Unterproduktion war, eine absolute Unfähigkeit, genug zu produzieren, um den Grundbedürfnissen der Gesellschaft nachzukommen (und selbst in jenen Gesellschaften lief der Prozess des „Abstiegs" niemals ohne Phasen der scheinbaren Wiedererholung und gar eines kräftigen Wachstums ab). Doch das Grundproblem dieser Ansicht ist, dass sie die fundamentale Realität des Kapitalismus ignoriert - die Notwendigkeit des Wachstums, der Akkumulation, der erweiterten Reproduktion von Werten. Wie wir sehen werden, kann dieser Notwendigkeit in der Dekadenz des Systems dadurch nachgekommen werden, indem immer mehr an den eigentlichen Gesetzen der kapitalistischen Produktion herumgepfuscht wird. Doch wie wir ebenfalls sehen werden, wird dieser Punkt, an dem die kapitalistische Akkumulation absolut unmöglich wird, wahrscheinlich niemals erreicht werden. Wie Rosa Luxemburg in der Antikritik hervorhob, war ein solcher Punkt „eine theoretische Fiktion, gerade weil die Akkumulation des Kapitals nicht bloß ökonomischer, sondern politischer Prozess ist"[5]. Darüber hinaus hatte Marx bereits den Begriff des Wachstums als Rückgang postuliert: „Die höchste Entwicklung dieser Basis selbst (die Blüte, worin sie sich verwandelt; es ist aber doch immer diese Basis, diese Pflanze als Blüte; daher Verwelken nach der Blüte und als Folge der Blüte) ist der Punkt, worin sie selbst zu der Form ausgearbeitet ist, worin sie mit der höchsten Entwicklung der Produktivkräfte vereinbar, daher auch der reichsten Entwicklung der Individuen. Sobald dieser Punkt erreicht ist, erscheint die weitre Entwicklung als Verfall und die neue Entwicklung beginnt von einer neuen Basis."
Der Kapitalismus hat sicherlich genügend Produktivkräfte für die Entstehung einer neuen und höheren Produktionsweise entwickelt. In der Tat tritt das System in dem Augenblick in den Niedergang, wenn die materiellen Bedingungen für den Kommunismus entwickelt sind. Durch die Schaffung einer Weltwirtschaft - für den Kommunismus fundamental - erreicht der Kapitalismus auch die Grenzen seiner gesunden Entwicklung. Die Dekadenz des Kapitalismus ist also nicht an einer kompletten Aussetzung der Produktion festzumachen, sondern zeichnet sich durch eine wachsende Reihe von Erschütterungen und Katastrophen aus, die die absolute Notwendigkeit für seine Überwindung demonstrieren.
Marx‘ Hauptpunkt ist hier die Notwendigkeit einer Dekadenzperiode. Die Menschen machen keine Revolution, weil es ihnen gefällt, sondern weil sie von der Notwendigkeit gezwungen werden, von dem unerträglichen Leid, das von der Krise eines Systems hervorgerufen wird. Aus dem gleichen Grund ist die Anhänglichkeit am Status quo tief in ihrem Bewusstsein verwurzelt, und es kann nur der wachsende Konflikt zwischen jener Ideologie und der materiellen Wirklichkeit, der sie sich gegenübersehen, sein, der die Menschen dazu bringt, das herrschende System herauszufordern. Dies trifft vor allem auf die proletarische Revolution zu, die das erste Mal in der Geschichte eine bewusste Umwandlung jedes Aspektes des Gesellschaftslebens erfordert.
Die Revolutionäre werden gelegentlich beschuldigt, der Idee: „Je schlechter, desto besser" anzuhängen, der Idee, dass je mehr die Massen leiden, desto wahrscheinlicher sie revolutionär werden. Doch es gibt keine mechanische Beziehung zwischen dem Leid und dem revolutionären Bewusstsein. Das Leid enthält eine Dynamik zum Nachdenken und zur Revolte, aber es enthält auch eine Dynamik zur Abnutzung und Erschöpfung der Fähigkeit zur Revolte. Es kann außerdem leicht zur Praktizierung völlig falscher Formen der Rebellion führen, wie das gegenwärtige Wachstum des islamischen Fundamentalismus zeigt. Die Dekadenzperiode ist notwendig, um die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass sie eine neue Gesellschaft aufbauen muss, dass aber andererseits eine auf unbestimmte Zeit verlängerte Epoche der Dekadenz die eigentliche Möglichkeit der Revolution gefährden kann, indem sie die Welt in eine Spirale der Katastrophen drängt, die nur dazu dienen, die angehäuften Produktivkräfte und insbesondere die wichtigsten aller Produktivkräfte, das Proletariat, zu zerstören. Dies ist in der Tat die Gefahr, die sich in der finalen Phase der Dekadenz stellt, der Phase, die wir die Zerfallsphase nennen und die unserer Meinung nach bereits begonnen hat.
Dieses Problem einer am lebendigen Leib verfaulenden Gesellschaft ist im Kapitalismus besonders akut, weil im Gegensatz zu früheren Systemen die Reifung der materiellen Bedingungen für die neue Gesellschaft - den Kommunismus - nicht mit der Entwicklung neuer Wirtschaftsformen innerhalb der Hülle der alten Gesellschaftsordnung zusammenfällt. Im Niedergang der römischen Sklaverei war die Entwicklung feudaler Stände oftmals das Werk von Mitgliedern der alten sklavenhaltenden Klasse, die sich selbst vom Zentralstaat distanziert hatten, um den niederschmetternden Lasten ihrer Steuern zu entgehen. In der Periode der feudalen Dekadenz wuchs die neue Bourgeoisie in den Städten - die immer die kommerziellen Zentren des alten Systems gewesen waren - heran und nahm sich vor, die Fundamente einer neuen Wirtschaft zu legen, die auf den Manufakturen und dem Handel basierte. Das Aufkommen dieser neuen Formen war sowohl eine Antwort auf die Krise der alten Ordnung als auch ein Faktor, der sie mehr und mehr zu ihrem endgültigen Ableben trieb.
Mit dem Niedergang des Kapitalismus treten die Produktivkräfte, die er in Bewegung gesetzt hat, ganz sicher mit den Gesellschaftsverhältnissen, in denen sie wirken, in wachsendem Konflikt. Dies wird besonders durch den Kontrast zwischen den enormen Produktionskapazitäten des Kapitalismus und seiner Unfähigkeit, alle Waren, die sie produzieren, zu absorbieren, ausgedrückt - kurz: durch die Überproduktionskrise. Doch während diese Krise die Abschaffung der Warenverhältnisse immer dringender macht und das Wirken der Gesetze der Warenproduktion immer mehr entstellt, resultiert dies nicht in einem spontanen Auftreten kommunistischer Wirtschaftsformen. Anders als frühere revolutionäre Klassen ist die Arbeiterklasse eine eigentumslose, ausgebeutete Klasse und kann nicht ihre eigene Wirtschaftsordnung innerhalb des Rahmens der alten aufbauen. Der Kommunismus kann nur das Resultat eines allzeit bewussteren Kampfes gegen die alte Ordnung sein, der zur politischen Überwindung der Bourgeoisie als Voraussetzung für die kommunistische Transformation des wirtschaftlichen und sozialen Lebens führt. Wenn das Proletariat unfähig ist, seinen Kampf auf die notwendige Höhe des Bewusstseins und der Selbstorganisation zu heben, dann werden die Widersprüche des Kapitalismus nicht zur Ankunft einer höheren gesellschaftlichen Ordnung führen, sondern zum „gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen".
Gerrard
Zur Kritik der politischen Ökonomie, Vorwort
Im Folgenden die vollständige Stelle aus dem Vorwort:
Das allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen, meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewusst werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebenso wenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem Bewusstsein beurteilen, sondern muss vielmehr dies Bewusstsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, dass die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozess ihres Werdens begriffen sind. In großen Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervor wachsenden Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte der menschlichen Gesellschaft ab.
[1] Kommunistisches Manifest, Kapitel 1, „Bourgeois und Proletarier". In: MEW, Bd. 4, S. 462 ff.
[2] Marx an Engels, 8. Oktober 1858. In: MEW, Bd. 29, S. 359
[3] K. Marx, Brief an V. I. Sassulitsch. Zweiter Entwurf. In: MEW, Bd. 19, S. 398.
[4] R. Luxemburg, Antikritik, Gesammelte Werke Bd. 5 S. 519
[5] Grundrisse, S. 439
Aktuelles und Laufendes:
- Dekadenz [333]
- Überwindung des Kapitalismus [334]
- wissenschaftliche Methode [335]
Erbe der kommunistischen Linke:
Der G20 Gipfel in London: eine neue kapitalistische Welt ist nicht möglich
- 2851 Aufrufe
Natürlich sieht die Wirklichkeit ganz anders aus.
Der einzige Erfolg des Gipfeltreffens der G20 ist, dass es stattgefunden hat!
In den letzten Monaten hat die Wirtschaftskrise die internationalen Spannungen stark angefacht. Zunächst ist die Versuchung des Protektionismus gestiegen. Jeder Staat neigt zunehmend dazu, einen Teil seiner Wirtschaft durch Subventionen und die Gewährung von Privilegien für einheimische Unternehmen gegen die ausländische Konkurrenz zu retten. Das war zum Beispiel beim Unterstützungsplan für die französische Automobilindustrie der Fall, der von Nicolas Sarkozy beschlossen wurde und der von seinen europäischen „Freunden" scharf kritisiert wurde. Schließlich gibt es eine wachsende Tendenz, ohne gemeinsame Absprachen Ankurbelungsprogramme zu verabschieden, insbesondere um den Finanzsektor zu retten. Dabei versuchen viele Konkurrenten, die missliche Lage der USA, dem Epizentrum des Finanzbebens und Schauplatz einer schlimmen Rezession, auszunutzen, um die wirtschaftliche Führungsrolle der USA weiter zu untergraben. Dies ist jedenfalls das Anliegen hinter den Aufrufen Frankreichs, Deutschlands, Chinas, der südamerikanischen Staaten zum „Multilateralismus" ...
Der Gipfel von London war von Spannungen überschattet, die Debatten müssen in der Tat sehr erregt gewesen sein. Aber man hat den Schein bewahren können. Die Herrschenden konnten das katastrophale Bild eines chaotischen Gipfels vermeiden. Die herrschende Klasse hat nicht vergessen, in welchem Maße mangelnde internationale Abstimmung und die Tendenz des „Jeder für sich" zum Desaster von 1929 beigetragen haben. Damals wurde der Kapitalismus von der ersten großen Wirtschaftskrise im Zeitalter seines Niedergangs erfasst[4]; die herrschende Klasse wusste noch nicht, wie sie reagieren sollte. Und so reagierten die Staaten zunächst überhaupt nicht. Von 1929 bis 1933 wurde fast keine Maßnahme ergriffen, während Tausende von Banken der Reihe nach Bankrott gingen. Der Welthandel brach buchstäblich zusammen. 1933 zeichneten sich erste Reaktionen ab - der New Deal Roosevelts[5] wurde beschlossen. Dieser Ankurbelungsplan umfasste eine Politik der großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und der staatlichen Verschuldung, aber auch ein protektionistisches Gesetz, den „Buy American Act"[6]. Damals stürzten sich alle Länder in ein protektionistisches Wettrennen. Der Welthandel, der bereits sehr stark geschrumpft war, erlitt einen weiteren Schock. So hat die herrschende Klasse in den 1930er Jahren durch ihre eigenen Maßnahmen die Weltwirtschaftskrise noch verschärft.
Heute also wollen alle Teile der herrschenden Klasse eine Wiederholung dieses Teufelskreises von Krise und Protektionismus verhindern. Sie sind sich dessen bewusst, dass sie alles unternehmen müssen, um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Es war unbedingt erforderlich, dass dieser Gipfel der G20 die Einheit der Großmächte gegenüber der Krise zur Schau stellt, insbesondere um das internationale Finanzsystem zu stützen. Der IWF hat dazu gar einen besonderen Punkt in seinem „Arbeitsdokument" zur Vorbereitung des Gipfels formuliert, um gegen diese Gefahr des „Jeder für sich" zu warnen.[7] Es handelt sich um den Punkt 13: „Das Gespenst des Handels- und Finanzprotektionismus stellt eine wachsende Sorge dar": „Ungeachtet der von den G20-Ländern (im November 2008) eingegangenen Verpflichtungen, nicht auf protektionistische Maßnahmen zurückzugreifen, ist es zu besorgniserregenden Entgleisungen gekommen. Es ist schwer, zwischen dem öffentlichen Eingreifen, das darauf abzielt, die Auswirkungen der Finanzkrise auf die in Schwierigkeiten geratenen Bereiche einzudämmen, und den nicht angebrachten Subventionen für die Industrien zu unterscheiden, deren langfristige Überlebensfähigkeit infrage gestellt werden muss. Bestimmte Unterstützungsmaßnahmen für den Finanzbereich verleiten auch die Banken dazu, Kredite in ihre Länder zu lenken. Gleichzeitig gibt es wachsende Risiken, dass bestimmte Schwellenländer, die mit einem von Außen kommenden Druck auf ihre Konten konfrontiert sind, danach streben, Kapitalkontrollen aufzuerlegen." Und der IWF war nicht der einzige, der solche Warnungen äußerte: „Ich befürchte, dass eine allgemeine Rückkehr des Protektionismus wahrscheinlich ist. Denn die defizitären Länder wie die USA glauben damit ein Mittel gefunden zu haben, die Binnennachfrage und die Beschäftigung anzukurbeln. [...] Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment. Wir müssen eine Wahl treffen zwischen einer Öffnung nach Außen oder einem Rückzug auf Lösungen ‚innerhalb‘ eines Landes. Wir haben diesen zweiten Lösungsansatz in den 1930er Jahren versucht. Dieses Mal müssen wir den ersten versuchen." (Martin Wolf, vor der Kommission auswärtiger Angelegenheit des US-Senats, am 25. 6.2009)[8].
Der Gipfel hat die Botschaft vernommen: Die Führer der Welt konnten das Bild einer scheinbaren Einheit bewahren und dieses in ihrer Abschlusserklärung schriftlich festhalten: „Wir werden die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen". Die Welt atmete auf. Wie die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos" am 3. April schrieb: „Die erste Schlussfolgerung, die man nach dem gestrigen G20 von London ziehen kann, ist, dass er nicht gescheitert ist, und das ist schon viel wert. Nach den Spannungen der letzten Wochen haben die 20 größten Länder ihre Einheit gegenüber der Krise gezeigt."
Konkret haben sich die Länder verpflichtet, keine Handelsschranken zu errichten, auch nicht gegen Finanzströme. Die Welthandelsorganisation wurde beauftragt, sorgfältig darauf zu achten, dass diese Verpflichtungen eingehalten werden. Darüber hinaus wurden 250 Milliarden Dollar für die Unterstützung des Exports oder von Investitionen zugesagt, um den internationalen Handel wieder anzukurbeln. Aber vor allem haben die gestiegenen Spannungen die Atmosphäre auf diesem Gipfel nicht vergiften können, der sonst in einen offenen Faustkampf ausgeartet wäre. Der Schein bleibt also gewahrt. Dies ist der Erfolg des Gipfels der G20. Und dieser Erfolg ist sicherlich zeitlich beschränkt, denn der Stachel der Krise wird die internationalen Divergenzen und Spannungen weiter verschärfen.
Die Verschuldung von heute bereitet die Krisen von morgen vor
Seit dem Sommer 2008 und der berühmten „Subprime"-Krise verabschiedeten die Regierungen wie entfesselt ein Konjunkturprogramm nach dem anderen. Nach der ersten Ankündigung von massiven Kapitalspritzen im Milliardenumfang kam vorübergehend Optimismus auf. Doch da sich die Krise unbeirrt weiter zuspitzte, wuchs mit jedem neuen Programm auch die Skepsis. Paul Jorion, ein auf den Wirtschaftsbereich spezialisierter Soziologe (er war zudem einer der ersten, die die gegenwärtige Krise ankündigten) macht sich lustig über dieses wiederholte Scheitern: „Wir sind unbemerkt von den kleinen Anschüben des Jahres 2007 im Umfang von einigen Milliarden Euro oder Dollar zu den großen Paketen von Anfang 2008 übergegangen, dann kamen schließlich die gewaltigen Pakete von Ende 2008, die mittlerweile Hunderte von Milliarden Euro oder Dollar umfassen. 2009 ist das Jahr der ‚kolossalen‘ Anschübe, die diesmal Summen von ‚Trillionen‘ Euro oder Dollar beinhalten. Und trotz pharaonischer Ambitionen gibt es noch immer nicht das geringste Licht am Ende des Tunnels"[9].
Und was schlägt der Gipfel vor? Man überbietet sich mit einer Reihe von Maßnahmen, von denen die eine noch unwirksamer ist als die andere! Bis Ende 2010 sollen 5.000 Milliarden Dollar in die Weltwirtschaft gepumpt werden[10]. Die Bourgeoisie verfügt über keine andere „Lösung"; sie offenbart damit ihre eigene Machtlosigkeit[11]. Die internationale Presse hat sich in dieser Hinsicht nicht geirrt. „Die Krise ist noch lange nicht vorüber, man muss naiv sein zu glauben, dass die Beschlüsse des G20 alles ändern werden" (La Libre Belgique), „Sie sind zu einem Zeitpunkt gescheitert, als die Weltwirtschaft dabei war zu implodieren" (New York Times).
Die Vorhersagen der OECD, die normalweise ziemlich optimistisch sind, lassen für 2009 keinen Zweifel daran aufkommen, was auf die Menschheit in den nächsten Monaten zukommen wird. Ihnen zufolge wird die Rezession in den USA zu einer Schrumpfung des Bruttoinlandprodukts von vier Prozent, in der Euro-Zone von 4.1 Prozent und in Japan von 6.6 Prozent führen. Die Weltbank prognostizierte am 30. März für das Jahr 2009 „einen Rückgang des Welt-BIP von 1.7 Prozent, was den stärksten, je registrierten Rückgang der globalen Produktion bedeutet". Die Lage wird sich also in den nächsten Monaten noch weiter zuspitzen, wobei die Krise bereits heute verheerendere Ausmaße als 1929 angenommen hat. Die Ökonomen Barry Eichengreen und Kevin O'Rourke haben errechnet, dass der Rückgang der Weltindustrieproduktion allein in den letzten neun Monaten schon so stark war wie 1929, die Aktienwerte zweimal so schnell verfielen und auch der Welthandel schneller schrumpft[12].
All diese Zahlen entsprechen einer sehr konkreten und dramatischen Wirklichkeit für Millionen von ArbeiterInnen auf der Welt. In den USA, der größten Wirtschaftsmacht der Erde, wurden allein im März 2009 663.000 Arbeitsplätze vernichtet, womit sich die Zahl der vernichteten Arbeitsplätze innerhalb der letzten beiden Jahre auf 5.1 Millionen erhöht hat. Heute werden alle Länder von der Krise brutal erfasst. So erwartet Spanien 2009 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf über 17 Prozent.
Aber diese Politik ist heute nicht nur einfach unwirksam; sie bereitet auch noch gewaltigere Krisen in der Zukunft vor. Denn all diese Milliardenbeträge können nur dank massiver Verschuldung zur Verfügung gestellt werden. Doch eines Tages (und dieser Tag liegt nicht in der fernen Zukunft) müssen diese Schulden zurückgezahlt werden. Selbst die Bourgeois sagen: „Es liegt auf der Hand, die Folgen dieser Krise sind mit hohen Kosten verbunden. Die Menschen werden Reichtümer, Erbgüter, Einkommen, Ersparnisse, Arbeitsplätze verlieren. Es wäre demagogisch zu denken, dass irgendjemand davon verschont werden wird, alles oder einen Teil dieser Rechnung zu bezahlen" (Henri Guaino, Sonderberater des französischen Staatspräsidenten, 3.04.2009).[13] Durch die Anhäufung dieses Schuldenbergs ist letzten Endes die wirtschaftliche Zukunft des Kapitalismus mit einer gewaltigen Hypothek belastet.
Und was soll man zu all den Journalisten sagen, die sich darüber freuen, dass der IWF eine viel größere Bedeutung erlangt hat? Seine Finanzmittel sind in der Tat vom Gipfel verdreifacht worden; er verfügt nun über 750 Milliarden Dollar Mittel, hinzu kommen 250 Milliarden Dollar Sonderziehungsrechte.[14] IWF-Präsident Dominique Strauss-Kahn erklärte, dass es sich um den größten „jemals in der Geschichte beschlossenen koordinierten Ankurbelungsplan" handelt. Er wurde beauftragt, „den Schwächsten zu helfen", insbesondere den am Rande der Pleite stehenden osteuropäischen Staaten. Aber der IWF ist eine seltsame letzte Rettung. Denn diese Organisation ist zu Recht verrufen wegen der drakonischen Sparmaßnahmen, die sie in der Vergangenheit stets dann erzwungen hat, wenn ihre „Hilfe" gefordert wurde. Umstrukturierungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Abschaffung bzw. Kürzung von medizinischen Leistungen, Renten usw.- all das sind die Folgen der „Hilfe" des IWF. Diese Organisation hat - um nur ein Beispiel zu nennen - am vehementesten jene Maßnahmen vertreten, die Argentinien in den 1990er Jahren auferlegt wurden, bis dessen Wirtschaft 2001 kollabierte!
Der Gipfel der G20 hat also nicht nur den kapitalistischen Horizont nicht aufgehellt, sondern im Gegenteil bewirkt, dass noch dunklere Wolken aufziehen werden.
Der große Bluff eines moralischeren Kapitalismus
In Anbetracht der sattsam bekannten Unfähigkeit der G20, wirkliche Lösungen für die Zukunft anzubieten, fiel es den Bourgeois schwer, eine schnelle Rückkehr zum Wachstum und zu einer strahlenden Zukunft zu versprechen. Unter den Arbeitern breitet sich eine tiefe Verachtung gegen den Kapitalismus aus; immer mehr machen sich Gedanken über die Zukunft. Die herrschende Klasse ihrerseits ist eifrig darum bemüht, auf ihre Art auf diese Infragestellungen einzugehen. So hat denn auch dieser Gipfel mit großem Tamtam einen neuen Kapitalismus versprochen, der besser reguliert, moralischer, ökologischer sein werde...
Aber dieses Manöver ist so auffällig wie lächerlich. Um zu beweisen, wie ernst sie es mit einem „moralischeren" Kapitalismus meinen, haben die G20-Staaten ihren Zeigefinger gegen einige „Steuerparadiese" erhoben und mit eventuellen Sanktionen gedroht, über die man bis zum Ende des Jahres nachdenken werde (sic!), falls diese Länder keine Anstrengungen um größere „Transparenz" unternehmen. Insbesondere wurde auf vier Länder verwiesen, die nunmehr die berühmte „schwarze Liste" anführten: Costa Rica, Malaysia, die Philippinen, Uruguay. Auch anderen Ländern wurden Vorhaltungen gemacht; sie wurden auf eine „graue Liste" gesetzt. Unter anderem gehören Österreich, Belgien, Chile, Luxemburg, Singapur und die Schweiz dazu.
Die großen „Steuerparadiese" dagegen kommen allem Anschein nach ihren Pflichten nach. Die Kaiman-Inseln und ihre Hedgefonds, die von der britischen Krone abhängigen Territorien (Guernsey, Jersey, Ilse of Man), die Londoner City, die US-Bundesstaaten wie Delaware, Nevada oder Wyoming - all diese Gebiete sind offiziell weiß wie Schnee und gehören der weißen Liste an. Diese Klassifizierung der Steuerparadiese durch den Gipfel der G20 bedeutet, den Bock zum Gärtner zu machen.
Als Gipfel der Heuchelei kündigte nur wenige Tage nach dem Gipfel in London die OECD, die für diese Einstufungen verantwortlich ist, die Streichung der vier oben genannten Länder von der schwarzen Liste an, nachdem diese Anstrengungen zu mehr Transparenz angekündigt hatten!
All dies kann nicht überraschen. Wie könnte man von all diesen Verantwortlichen des Kapitalismus, die in Wirklichkeit Gangster ohne Gesetz und Glauben sind, eine „moralischere Haltung" erwarten?[15] Und wie kann ein System, das auf Ausbeutung und Profitstreben beruht, „moralischer" werden? Niemand erwartete übrigens von diesem Gipfel einen „menschlicheren Kapitalismus". Dieser existiert nicht, auch wenn die politischen Führer davon reden, wie Eltern ihren Kindern vom Weihnachtsmann erzählen. Diese Krisenzeiten enthüllen im Gegenteil noch deutlicher die unmenschliche Fratze dieses Systems. Vor fast 130 Jahren schrieb Paul Lafargue: „Die kapitalistische Moral [...] belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem feierlichen Bannfluch: Ihr Ideal besteht darin, die Bedürfnisse des Produzenten (das heißt des wirklich Produzierenden) auf das geringste Minimum zu reduzieren, seine Genüsse und Leidenschaften zu ersticken und ihn zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man ohne Rast und ohne Dank Arbeit nach Belieben herausschindet" (Paul Lafargue, Das Recht auf Faulheit, Vorwort). Wir könnten hinzufügen: Die einzig mögliche „Ruhe" ist die Arbeitslosigkeit und das Elend. Wenn die Krise zuschlägt, werden Beschäftigte entlassen und fliegen auf die Straße wie Ausschuss. Der Kapitalismus ist und bleibt stets ein brutales und barbarisches Ausbeutungssystem.
Aber das Manöver ist so offensichtlich wie entlarvend. Es zeigt, dass der Kapitalismus der Menschheit keinen Ausweg mehr anzubieten hat, außer noch mehr Verarmung und Leid. Die Aussichten auf einen „ökologischen" oder „moralischen" Kapitalismus sind genauso groß wie die Aussichten eines Alchimsten, Blei in Gold zu verwandeln.
Der Londoner Gipfel belegt jedenfalls eins: Eine andere kapitalistische Welt ist nicht möglich. Es ist wahrscheinlich, dass der Krisenverlauf Höhen und Tiefen durchschreiten wird, wobei es zeitweise auch zu einem Wachstum kommen kann. Aber im Wesentlichen wird der Kapitalismus weiter in der Krise versinken, noch mehr Armut und Kriege hervorrufen.
Von diesem System kann man nichts erwarten. Mit ihren internationalen Gipfeln und Konjunkturprogrammen stellt die herrschende Klasse keinen Teil der Lösung dar, sondern sie selbst ist das Problem. Nur die Arbeiterklasse kann die Welt umwälzen, dazu muss sie aber Vertrauen in die Gesellschaft entwickeln, die sie aufbauen muss: den Kommunismus!
Mehdi, 16.04.09
[1] Déclaration de Pascal Lamy, Erklärung des Generaldirektors der Welthandelsorganisation.
[2] Rapport intermédiaire - Zwischenbericht der OECD
[3] Der
G20 besteht aus den Mitgliedsländern des G8 (Deutschland, Frankreich, USA,
Japan, Kanada, Italien, Großbritannien, Russland), zu dem jetzt Südafrika,
Saudi-Arabien, Argentinien, Australien, Brasilien, China, Südkorea, Indien,
Indonesien, Mexiko, Türkei und schließlich die Europäische Union dazu gekommen
sind. Ein erster Gipfel hatte im November 2008 inmitten der
Finanzerschütterungen stattgefunden.
[4] Siehe unsere Artikelserie „Die Dekadenz des Kapitalismus begreifen"
[5] Weit verbreitet ist heute der Mythos, dass der New Deal von 1933 es der Weltwirtschaft ermöglicht habe, aus dem wirtschaftlichen Schlamassel herauszukommen. Daher die logische Schlussfolgerung, heute zu einem neuen „New Deal" aufzurufen. Aber in Wirklichkeit blieb die US-Wirtschaft zwischen 1933-38 besonders kraftlos. Erst der zweite New Deal, der 1938 beschlossen wurde, ermöglichte die Ankurbelung der Wirtschaft. Doch dieser zweite New Deal war nichts anderes als der Beginn der Kriegswirtschaft (die den 2. Weltkrieg vorbereitete). Es ist verständlich, dass diese Tatsache weitestgehend verschwiegen wird!
[6] Mit diesem Gesetz verpflichteten die US-Behörden zum Kauf von auf US-Märkten hergestellten Produktionsgütern.
[7] Quelle:
https://contreinfo.info/prnart.php3?id_article=2612 [336]
[8] Martin Wolf ist ein britischer Wirtschaftsjournalist. Er war assoziierter freischaffender Redakteur und Chef-Kommentator im Bereich Wirtschaftsfragen bei der Financial Times.
[9] „L'ère des ‘Kolossal' coups de pouce" (Die Ära der „kolossalen" Anschübe), veröffentlicht am 7 April 2009.
[10] Tatsächlich handelt es sich um 4.000 Milliarden Dollar, die von den USA als Rettungsmaßnahmen während der letzten Monate angekündigt wurden.
[11] In Japan wurde jüngst ein neues Konjunkturprogramm im Umfang von 15.400 Milliarden Yen (116 Milliarden Euro) beschlossen. Dies ist das vierte Programm, das innerhalb eines Jahres von Tokio beschlossen wurde!
[12] Quelle: www.voxeu.org [337]
[13] Zur Rolle der Verschuldung im Kapitalismus und zu seinen Krisen siehe den Artikel in dieser Ausgabe der Internationalen Revue Nr. 43, „Die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte des Kapitalismus".
[14] Die Sonderziehungsrechte sind ein Währungskorb, der aus Dollar, Euro, Yen und britischen Pfund-Sterling besteht.
Insbesondere China hat auf diesen Sonderziehungsrechten bestanden. In den letzten Wochen hat das Reich der Mitte mehrere offizielle Erklärungen abgegeben und zur Schaffung einer internationalen Währung aufgerufen, die den Dollar ablösen soll. Zahlreiche Ökonomen auf der Welt haben diese Forderung aufgegriffen und vor dem unaufhaltsamen Verfall der US-Währung und den wirtschaftlichen Erschütterungen gewarnt, die daraus resultieren würden.
Es stimmt, dass die Schwächung des Dollars mit jedem weiteren Versinken der US-Wirtschaft in der Rezession eine echte Bedrohung für die Weltwirtschaft darstellt. Kurz vor Ende des II. Weltkrieges als internationale Leitwährung eingeführt, fungierte der Dollar seither als ein Stützpfeiler für die kapitalistische Stabilität. Dagegen ist die Einführung einer neuen Leitwährung (ob Euro, Yen, Britisches Pfund oder die Sonderziehungsrechte des IWF) vollkommen illusorisch. Keine Macht wird die USA ersetzen können, keine wird deren Rolle als internationaler ökonomischer Stabilitätsanker übernehmen können. Die Schwächung der US-Wirtschaft und ihrer Währung bedeutet somit wachsendes monetäres Chaos.
[15] Lenin bezeichnete den Völkerbund, eine andere internationale Institution, als „Räuberbande".
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [37]
Die Welt am Rande einer Umweltkatastrophe
- 7292 Aufrufe
„In den Ländern der Dritten Welt dehnen sich die Hungersnöte aus, und sie werden auch bald aus den Ländern zu vermelden sein, die angeblich „sozialistisch" waren. Gleichzeitig vernichtet man in Westeuropa und in Nordamerika die landwirtschaftlichen Güter massenweise, und bezahlt den Bauern Gelder, damit weniger angebaut und geerntet wird. Sie werden bestraft, wenn sie mehr als die auferlegten Quoten produzieren. In Lateinamerika töten Epidemien wie die Cholera Tausende von Menschen, obgleich diese Geißel schon seit langem gebannt schien. Auch weiterhin fallen Zehntausende von Menschen binnen kürzester Zeit Überschwemmungen und Erdbeben zum Opfer, obgleich die Gesellschaft in der Lage wäre, Deiche und erdbebensichere Häuser zu bauen. Ganz zu schweigen von den Tücken oder „Fatalitäten" der Natur, wenn - wie in Tschernobyl 1986 - die Explosion eines AKW Hunderte (wenn nicht Tausende) Menschen tötet und noch viele mehr in anderen Regionen radioaktiv verstrahlt. Es ist bezeichnend, dass sich in den höchstentwickel-ten Ländern tödliche Unfälle häufen: 60 Tote in einem Pariser Bahnhof, 100 Tote bei einem Brand in der Londoner U-Bahn. Dieses System hat sich als unfähig erwiesen, der Zerstörung der Natur Einhalt zu gebieten, den sauren Regen, die Verschmutzungen jeder Art und insbeson-dere durch die Atomkraftwerke, den Treibhauseffekt, die zunehmende Verwüstung zu bekämpfen; d.h. alle Faktoren, die das Über-leben der Menschheit selbst bedrohen" (1991, Kommunistische Revolution oder Zerstörung der Menschheit" Manifest des 9. Kongresses der IKS 1991).
Die Frage der Umwelt ist schon immer von der Propaganda der Revolutionäre aufgegriffen worden, von Marx und Engels, die die unerträglichen Lebensbedingungen im London des 19. Jahrhunderts bloßlegten, bis hin zu Bordiga und seinen Schriften über die Umweltzerstörungen infolge des unverantwortlichen Handelns des Kapitalismus. Heute ist diese Frage noch zentraler, und sie verlangt verstärkte Anstrengungen seitens der revolutionären Organisationen, um aufzuzeigen, dass die historische Alternative, vor der die Menschheit steht, die Perspektive des Sozialismus gegenüber einer Barbarei ist, die sich nicht nur in den lokalen und allgemeinen Kriegen ausdrückt, sondern auch die Gefahr einer ökologischen und Umweltkatastrophe heraufbeschwört, die sich immer deutlicher abzeichnet.
Mit dieser Artikelserie, möchte die IKS die Umweltfrage aufgreifen. Dabei werden wir auf die folgenden Aspekte eingehen:
Im ersten Artikel versuchen wir eine kurze Bestandsaufnahme der heutigen Lage zu machen und aufzuzeigen, vor welchem globalen Risiko die Menschheit heute steht, indem wir insbesondere auf die destruktivsten der weltweit anzutreffenden Phänomene eingehen wie:
- die Zunahme des Treibhauseffektes;
- die Müllentsorgung;
- die grenzenlose Ausbreitung von Giftstoffen und die damit verbundenen biologischen Prozesse;
- die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder ihre Umwandlung durch Giftstoffe.
Im zweiten Artikel werden wir versuchen aufzuzeigen, dass die Umweltprobleme nicht auf die Verantwortlichkeit Einzelner zurückgeführt werden können (wenngleich es auch individuelle Verantwortung gibt), weil es der Kapitalismus an sich und seine Logik des Profitstrebens sind, die tatsächlich dafür verantwortlich zeichnen. So werden wir sehen, dass die Entwicklung der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Forschung keinem Zufall unterworfen ist, sondern den kapitalistischen Zwangsgesetzen des Höchstprofits unterliegt.
Im dritten Artikel werden wir auf die Lösungsansätze der verschiedenen Bewegungen der Grünen, Ökologen usw. eingehen, um aufzuzeigen, dass trotz ihren guten Absichten und dem guten Willen vieler ihrer Aktivisten diese Lösungsansätze nicht nur völlig wirkungslos sind, sondern die Illusionen über eine mögliche Lösung dieser Fragen innerhalb des Kapitalismus direkt verstärken, wo in Wirklichkeit die einzige Lösung in der internationalen kommunistischen Revolution besteht.
Die Vorboten der Katastrophe
Man spricht immer häufiger über die Umweltprobleme, allein schon weil in der jüngsten Zeit in verschiedenen Ländern der Welt Parteien entstanden sind, die sich den Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben haben. Ist das beruhigend? Überhaupt nicht! Wenn jetzt großes Aufheben um diese Frage gemacht wird, geht es nur darum, unsere Köpfe zu verwirren. Deshalb haben wir beschlossen, zunächst jene besonderen Phänomene zu beschreiben, die alle zusammengenommen die Gesellschaft immer mehr an den Rand einer Umweltkatastrophe drängen. Wie wir zeigen werden, ist die Lage im Gegensatz zu all den Beteuerungen in den Medien und insbesondere in den auf Hochglanzpapier gedruckten Fachzeitschriften noch viel schwerwiegender und bedrohlicher, als man sagt. Nicht dieser oder jener profitgierige und unverantwortliche Einzelkapitalist, nicht die Mafia oder Camorra ist für die Lage verantwortlich, sondern das kapitalistische System insgesamt.
Die Auswirkungen des wachsenden Treibhauseffektes
Jedermann spricht von den Auswirkungen des Treibhauseffektes, aber meist beruht dies nicht auf einer wirklichen Sachkenntnis. Es ist wichtig hervorzuheben, dass der Treibhauseffekt für das Leben auf der Erde eine durchaus positive Funktion erfüllt - zumindest für die Art Leben, die wir kennen, weil er es ermöglicht, dass auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von ungefähr 15°C herrscht (dieser Durchschnitt berücksichtigt die vier Jahreszeiten und die verschiedenen Breitengrade) statt minus 17°C, d.h. der geschätzten Temperatur, wenn es den Treibhauseffekt nicht gäbe. Man stelle sich vor, wie die Welt aussehen würde, wenn die Temperaturen ständig unter Null lägen, Seen und Flüsse vereist wären... Worauf ist dieser „Überschuss" von mehr als 32°C zurückzuführen? Auf den Treibhauseffekt. Das Sonnenlicht dringt durch die niedrigsten Schichten der Atmosphäre, ohne absorbiert zu werden (die Sonne erwärmt nicht die Luft), und liefert der Erde die Energie. Die dabei entstehende Strahlung setzt sich (wie die von jedem Himmelskörper) hauptsächlich aus Infrarotstrahlen zusammen; sie wird durch einige Bestandteile der Luft, wie Kohlenstoffanhydrid, Wasserdampf, Methan und andere zusammengesetzte Teile wie Fluorchlorkohlenwasserstoff (Abkürzung FCKW), aufgefangen und absorbiert. Die in den unteren Schichten der Atmosphäre dabei entstehende Wärme kommt wiederum der thermischen Bilanz der Erde zugute, weil sie bewirkt, dass die Durchschnittstemperaturen auf der Erde um eben jene besagten 32°C höher ausfallen. Das Problem ist also nicht der Treibhauseffekt als solcher, sondern die Tatsache, dass mit der Entwicklung der Industriegesellschaft Substanzen in die Atmosphäre gelassen wurden, die einen zusätzlichen Treibhauseffekt bewirken und die bei zunehmender Konzentration eine deutliche Erderwärmung verursachen. Bei Untersuchungen von Bohrkernen aus 65.000 Jahre altem Polareis wurde nachgewiesen, dass die gegenwärtige Konzentration von Kohlendioxid (CO2) von 380 ppm (Milligramm pro Kubikdezimeter) in der Luft die höchste je gemessene und vielleicht sogar die höchste seit den letzten 20 Millionen Jahren ist. Die im 20. Jahrhundert ermittelten Temperaturen sind die höchsten seit den vergangenen 20.000 Jahren. Die wahnwitzige Verschwendung fossiler Brennstoffe als Energiequelle und die wachsende Abholzung der Wälder auf der Erde haben seit dem Industriezeitalter das natürliche Gleichgewicht und den Kohlenstoffhaushalt der Erdatmosphäre durcheinander gebracht. Dieses Gleichgewicht ist das Ergebnis der Freisetzung von CO2 in der Atmosphäre einerseits durch die Verbrennung und den Abbau organischer Stoffen, andererseits durch die Fixierung dieses CO2 in der Atmosphäre durch die Photosynthese. Bei diesem Prozess wird das CO2 in Kohlenhydrat und damit in einen komplexen organischen Stoff umgewandelt. Die Veränderung dieses Gleichgewichts zwischen Freisetzung (Verbrennung) und Fixierung (Photosynthese) von CO2 zugunsten der Freisetzung ist der Grund für die gegenwärtige Zuspitzung des Treibhauseffektes.
Wie oben angeführt, spielt nicht nur das Kohlendioxid, sondern auch Wasserdampf und Methan eine Rolle. Der Wasserdampf ist sowohl treibender Faktor als auch Ergebnis des Treibhauseffektes, denn je stärker die Temperatur steigt, desto mehr Wasserdampf entsteht. Die Zunahme von Methan in der Atmosphäre ist wiederum auf eine ganze Reihe von natürlichen Ursachen zurückzuführen, aber sie ist auch Ergebnis der zunehmenden Verwendung dieses Gases als Brennstoff und von Lecks in auf der ganzen Welt verlegten Gaspipelines. Methan, das auch „Moorgas" genannt wird, ist ein Gas, das aus der Gärung organischer Stoffe unter Ausschluss von Sauerstoff entsteht. Die Flutung von bewaldeten Tälern für den Bau von Dämmen für hydroelektrische Kraftwerke ist eine Ursache für die Zunahme der Methankonzentration. Aber das Problem des Methans, das gegenwärtig für ein Drittel der Zunahme des Treibhauseffektes verantwortlich ist, ist sehr viel größer, als es anhand der eben erwähnten Fakten erscheint. Zunächst kann das Methan 23-mal mehr Infrarotstrahlung aufnehmen als Kohlendioxid. Und das ist beträchtlich. Schlimmer noch! All die gegenwärtigen, ohnehin schon katastrophalen Prognosen berücksichtigen nicht das mögliche Szenario infolge der Freisetzung von Methan aus den gewaltigen natürlichen Methanreserven der Erde. Diese befinden sich in abgeschlossenen Gashüllen, bei ungefähr 0° C und einem geringen Atmosphärendruck in besonderen Eisformationen (hydratisierten Gasen). Ein Liter Eiskristall kann ca. 50 Liter Methangas binden. Solche Vorkommen findet man vor allem im Meer, entlang des Kontinentalabhangs und im Innern der Permafrostzone in verschiedenen Teilen Sibiriens, Alaskas und Nordeuropas. Experten in diesem Bereich meinen dazu Folgendes: „Wenn die globale Erwärmung gewisse Grenzen überschreitet (3 - 4°C) und wenn die Temperatur der Küstengewässer und des Permafrostgebietes ansteigen würde, könnte binnen kurzer Zeit (innerhalb von einigen Jahrzehnten) eine gewaltige Emission von freigesetztem Methan durch instabil gewordene Hydrate stattfinden, was zu einer katastrophalen Zunahme des Treibhauseffektes führen würde (...) Im letzten Jahr sind die Methanemissionen auf schwedischem Boden im Norden des Polarkreises um 60 Prozent gestiegen. Der Anstieg der Temperaturen während der letzten 15 Jahre ist im Durchschnitt relativ begrenzt geblieben, aber in dem nördlichen Teil Eurasiens und Amerikas war er sehr ausgeprägt (im Sommer ist die sagenumwobene Nord-Westpassage eisfrei, was eine Durchfahrt vom Atlantik zum Pazifik mit dem Schiff ermöglicht)" [1].
Aber selbst wenn wir diese besonders ernste Warnung einmal übergehen - international anerkannte Prognosen wie die des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) der UNO und des MIT (Massachusetts Institute of Technology) in Boston haben bereits für dieses Jahrhundert eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von mindestens 0,5°C bis zu 4,5°C prognostiziert, ausgehend von der Annahme, dass sich nichts Wesentliches ändern wird. Dabei berücksichtigen solche Prognosen nicht einmal die Umwälzungen, die sich aus dem Auftauchen der beiden neuen Industriemächte China und Indien ergeben, die gefräßige Energieverbraucher sind.
Eine zusätzliche Erwärmung von wenigen Grad würde eine größere Verdampfung des Wassers der Weltmeere verursachen, doch exaktere Untersuchungen deuten darauf hin, dass es immer größere Unterschiede bei der geographischen Verteilung der Niederschlagsmengen geben wird. „Trockene Gebiete werden immer größer und noch trockener. Meeresgebiete mit Oberflächentemperaturen über 27°C, ein kritischer Wert für das Entstehen von Zyklonen, werden um 30 bis 40 Prozent weiter wachsen. Dies würde katastrophale meteorologische Folgen haben - und zu Überschwemmungen und immer neuen Zerstörungen führen. Das Schmelzen eines Großteils der antarktischen Gletscher und der Gletscher Grönlands, der Anstieg der Meereswassertemperaturen lässt den Meeresspiegel ansteigen () damit dringt Salzwasser in immer mehr fruchtbare Küstengebiete vor und überflutet sie (teilweise Bangladesh, viele Inseln in den Ozeanen)" [2].
Aus Platzgründen können wir nicht in die Details gehen, doch wollen wir an dieser Stelle wenigstens auf die katastrophalen Folgen hinweisen, die der durch den Treibhauseffekt bedingte Klimawandel auslösen wird. Um nur einige Beispiele zu nennen:
- Die meteorologischen Extreme werden sich intensivieren; fruchtbare Böden werden von immer stärkeren Regenfällen ausgewaschen, was dazu führt, dass die Erträge der Böden sinken. Auch in den gemäßigteren Klimazonen, wie zum Beispiel in Piemont (Italien), schreitet die Versteppung der Böden voran.
- Im Mittelmeer und in anderen einst mäßig warmen Meeren entstehen Bedingungen, die das Überleben von Lebewesen ermöglichen, die bislang nur in tropischen Gewässern existierten. Damit wird es zur „Einwanderung" von bislang nicht einheimischen Lebewesen kommen, was zu Störungen im ökologischen Gleichgewicht führt.
- Aufgrund der Ausbreitung von Klimabedingungen, die das Wachstum und die Verbreitung von Krankheitsträgern wie Mücken usw. begünstigen, kommt es zu einem Wiederaufleben alter, längst ausge-rotteter Krankheiten wie Malaria.
Das Problem der Produktion und der Umgang mit Abfall
Ein zweites Problem, das typisch ist für diese Phase der kapitalistischen Gesellschaft, ist die exzessive Produktion von Abfällen und die daraus resultierende Schwierigkeit ihrer Entsorgung. Wenn in der letzten Zeit Meldungen über Müllberge in den Straßen Neapels und in Kampanien in den internationalen Medien auftauchten, ist das auch darauf zurückzuführen, dass dieser Teil der Welt noch immer als ein Teil der Industrieländer und damit als ein Teil der fortgeschrittenen Länder betrachtet wird. Dass die Peripherien vieler Großstädte in der Dritten Welt zu offenen Müllhalden geworden sind, ist mittlerweile sattsam bekannt und keine Rede mehr wert.
Diese unglaubliche Anhäufung von Müll ist der Logik der Funktionsweise des Kapitalismus geschuldet. Die Menschheit hat immer Unrat produziert, doch wurde dieser in der Vergangenheit stets verwertet und neu verwendet. Erst nach dem Einzug des Kapitalismus wird der Müll aufgrund der besonderen Funktionsweise dieser Gesellschaft zu einem Problem. Deren Mechanismen stützen sich sämtlichst auf ein grundlegendes Prinzip: Jedes Produkt menschlicher Aktivität wird als Ware betrachtet, d.h. als etwas, das verkauft werden muss, um auf einem Markt, auf dem gnadenlose Konkurrenz herrscht, ein Höchstmaß an Profit zu erzielen. Dies musste eine Reihe von verheerenden Konsequenzen nach sich ziehen:
1. Warenproduktion kann aufgrund der Konkurrenz unter den Kapitalisten weder mengenmäßig noch zeitlich geplant werden. Sie unterliegt einer irrationalen Logik, die dazu führt, dass jeder einzelne Kapitalist seine Produktion ausdehnt, um mit möglichst niedrigen Kosten zu verkaufen und seinen Profit zu realisieren. Dadurch stapeln sich Berge von unverkauften Waren. Gerade diese Notwendigkeit, den Konkurrenten niederzuringen und die Preise zu senken, zwingt die Produzenten dazu, die Qualität der hergestellten Waren zu senken. Dadurch sinkt ihre Haltbarkeit drastisch. Folge: die Produkte verschleißen viel schneller und wandern früher in die Mülltonne.
2. Es gibt eine irrsinnige Produktion von Verpackungen und Aufmachung aller Art, oft unter Verwendung giftiger Substanzen, die, obwohl sie nicht abbaubar sind, einfach auf den Müll landen und letztendlich in den natürlichen Kreislauf gelangen. Diese Verpackungen, die oft keinen Nutzen haben, außer die Produkte „ansehnlicher", für den Verkauf attraktiver zu machen, sind häufig schwerer und platzraubender als der Inhalt der verkauften Ware selbst. Man geht davon aus, dass gegenwärtig ein Müllsack, bei dem keine Abfalltrennung vorgenommen wurde, bis zur Hälfte mit Verpackungsmaterial vollgestopft ist.
3. Das Abfallaufkommen wird zudem noch durch die neuen Formen des „Lifestyle" verschärft, die dem „modernen Leben" innewohnen. In einem Selbstbedienungsrestaurant auf Plastiktellern essen und Mineralwasser aus Plastikflaschen trinken ist mittlerweile zum Alltag für Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt geworden. Auch die Verwendung von Plastiktüten zum Einkauf ist eine „praktische Annehmlichkeit", die von vielen genutzt wird. All das ist umweltgefährdend - und nützt nur dem Besitzer des Schnellrestaurants, der das Reinigungspersonal einsparen kann, welches nötig ist, wenn man andere Verpackungsarten verwendet. Auch dem Betreiber des Supermarktes und gar dem Ladenbesitzer um die Ecke kommt dies zupass; der Kunde kann jederzeit spontan einkaufen und erhält für seine Waren eine Tragetüte. All das bewirkt eine ungeheure Steigerung der Produktion von Abfall und Verpackungsmüll; pro Kopf fällt fast ein Kilo Abfall und Verpackungen täglich an, d.h. insgesamt Millionen Tonnen verschiedenster Abfälle Tag für Tag.
Man geht davon aus, dass sich allein in einem Land wie Italien die Abfallmenge während der letzten 25 Jahre bei gleich bleibender Bevölkerungszahl mehr als verdoppelt hat.
Die Müllfrage ist eine der Fragen, welche die Politiker meinen lösen zu können, aber in Wirklichkeit stößt sie im Kapitalismus auf unüberwindbare Hürden. Diese Hürden sind nicht mangelnder Technologie geschuldet, sondern sind im Gegenteil das Ergebnis der Mechanismen, die diese Gesellschaft beherrschen. Denn auch der Umgang mit Müll, sei es um ihn zu entsorgen oder seinen Umfang zu reduzieren, ist den Regeln der Profitwirtschaft unterworfen. Selbst wenn Recycling und die Wiederverwendung von Material durch Mülltrennung usw. möglich sind, erfordert dies Mittel und eine gewisse politische Koordinierungsfähigkeit, welche im Allgemeinen in den schwächeren Wirtschaften fehlt. Deshalb stellt die Abfallentsorgung in den ärmeren Ländern oder dort, wo die Firmen in Anbetracht der sich beschleunigenden Krise während der letzten Jahrzehnte vor größeren Schwierigkeiten stehen, mehr als einen zusätzlichen Kostenfaktor dar.
Man mag einwenden, dass, wenn in den fortgeschrittenen Ländern die Müllentsorgung funktioniert, dies mithin bedeutet, dass es sich nur um eine Frage des guten Willens, des richtigen Bürgersinns und der rechten Betriebsleitung handelt. Das Problem sei, dass, wie in allen Bereichen der Produktion, die stärksten Länder einen Teil der Last der Abfallentsorgung auf die schwächeren Länder (oder innerhalb der stärksten Länder auf die schwächeren Regionen) abwälzen.
„Zwei amerikanische Umweltgruppen, Basel Action Network und Silicon Valley Toxics, haben neulich einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass 50 - 80 Prozent der Elektronikabfälle der westlichen US-Bundesstaaten in Containern auf Schiffe verladen werden, die Richtung Asien (vor allem Indien und China) fahren, wo die Kosten für ihre Beseitigung wesentlich niedriger sind und die Umweltschutzauflagen viel lockerer. Es handelt sich nicht um Hilfsprojekte, sondern um einen Handel mit giftigen Rückständen, die Verbraucher weggeworfen haben. Der Bericht der beiden Umweltgruppen erwähnt zum Beispiel die Müllhalde von Guiyu, auf der vor allem Bildschirme und Drucker gelagert werden. Die Arbeiter von Guiyu benutzen nur sehr primitive Werkzeuge, um daraus Teile auszubauen, die weiter verkauft werden können. Eine enorme Menge an Elektronikschrott wird nicht recycelt, sondern liegt einfach auf den Feldern, an Flussufern, in Teichen und Sümpfen, Flüssen und Bewässerungskanälen herum. Ohne irgendwelchen Schutz arbeiten dort Frauen, Männer und Kinder" [3].
„In Italien (...) schätzt man, dass die Öko-Mafia einen Umsatz von 26 Milliarden Euro pro Jahr macht, davon 15 Mrd. für den illegalen Handel und die illegale Entsorgung von Müll (Bericht über die Ecomafia 2007, Umweltliga). (...) Der Zoll hat im Jahre 2006 286 Container mit mehr als 9000 Tonnen Müll beschlagnahmt. Die legale Entsorgung eines 15-Tonnen-Containers mit gefährlichem Sondermüll kostet ungefähr 60.000 Euro. Bei einer illegalen Entsorgung in Asien werden dafür nur 5000 Euro verlangt. Die Hauptabnehmer für illegalen Müllhandel sind asiatische Entwicklungsländer. Das dorthin exportierte Material wird zunächst verarbeitet, dann wieder nach Italien und andere Länder eingeführt, dieses Mal aber als ein Produkt, das aus dem Müll gewonnen wurde und nun insbesondere Kunststoff verarbeitenden Fabriken zugeführt wird.
Im Juni 1992 hat die FAO (Food and Agricultural Organisation) angekündigt, dass die Entwicklungsländer, vor allem die afrikanischen Staaten, zu einer „Mülltonne" geworden sind, die dem Westen zur Verfügung steht. Somalia scheint heute einer der am meisten gefährdeten afrikanischen Staaten zu sein, ein wahrer Dreh- und Angelpunkt für den Mülltourismus. Im jüngsten Bericht der UNEP (United Nations Environment Programme) wird auf die ständig steigende Zahl von verschmutzten Grundwasservorkommen in Somalia hingewiesen, was unheilbare Erkrankungen verursacht. Der Hafen von Lagos, Nigeria, ist der wichtigste Umschlagplatz für den illegalen Handel von Technikschrott, der nach Afrika verschifft wird.
Jedes Jahr sammeln sich auf der Welt ca. 20 - 50 Millionen Tonnen „Elektroschrott" an. In Europa spricht man von elf Millionen Tonnen, davon landen 80 Prozent auf dem Müll. Man geht davon aus, dass es 2008 mindestens eine Milliarde Computer (einen für jeden sechsten Erdbewohner) geben wird; gegen 2015 wird es mehr als zwei Milliarden PCs geben. Diese Zahlen bergen neue große Gefahren in sich, wenn es darum gehen wird, den alten Elektroschrott zu entsorgen" [4].
Wie oben erwähnt, wird das Müllproblem aber auch auf die weniger entwickelten Regionen innerhalb eines Landes verlagert. Das trifft in Italien insbesondere auf Kampanien zu, das aufgrund seiner Müllberge, die monatelang auf den Straßen herumlagen, international von sich reden machte. Aber wenige wissen, dass Kampanien - so wie international China, Indien oder Nordafrika -, das „Auffangbecken" für reichlich Giftmüll aus den Industriegebieten des Nordens ist. Dadurch wurden fruchtbare landwirtschaftliche Böden wie die um Caserta zu den am meisten verschmutzten Böden der Erde. Trotz wiederholt eingeleiteter strafrechtlichen Verfolgungsmaßnahmen geht die Vernichtung der Böden weiter. Es sind aber nicht die Camorra, die Mafia, die Unterwelt, die diese Schäden verursachen, die Logik des Kapitalismus ist dafür verantwortlich. Während für die vorschriftsmäßige Entsorgung von Giftmüll oft mehr als 60 Cent pro Kilo veranschlagt werden müssen, kostet die illegale Entsorgung nur etwas mehr als zehn Cent. So wird jedes Jahr jede verlassene Höhle zu einer offenen Müllkippe. In einem kleinen Dorf Kampaniens, wo eine Müllverbrennungsanlage gebaut werden soll, wurde giftiges Material zur Vertuschung des Giftbestandes mit Erde vermischt und dann beim Straßenbau verwendet. Dort hat man es als untere Schicht für eine lange Straße mit gestampftem Boden benutzt. Wie Saviano in seinem Buch, das mittlerweile in Italien zu einem Kultbuch geworden ist, schrieb: „Wenn die illegalen Müllberge, die die Camorra „entsorgt" hat, auf einem Haufen zusammengetragen werden würden, würde dieser eine Höhe von 14.600 Meter auf einer Fläche von drei Hektar erreichen, das wäre höher als jeder Berg auf der Erde" [5].
Wie wir im nächsten Artikel näher ausführen werden, ist das Problem des Abfalls vor allem mit der Produktionsform verbunden, die die kapitalistische Gesellschaft auszeichnet. Abgesehen von dem Teil, der „weggeworfen" wird, sind die Probleme oft auf die Zusammensetzung und das Material zurückzuführen, die bei der Produktion verwendet werden. Die Verwendung von synthetischen Stoffen, insbesondere von Kunststoffen, die praktisch unzerstörbar sind, birgt gewaltige Probleme für die zukünftigen Generationen. Und hier geht es nicht um reiche oder arme Länder, weil Kunststoff nirgendwo auf der Welt abbaubar ist, wie der Auszug aus folgendem Artikel belegt: „Man nennt sie „Trash Vortex", die Müllinsel im Pazifischen Ozean, die einen Durchmesser von ca. 25.000 km umfasst, ca. 30 Meter tief ist und zu ca. 80 Prozent aus Plastik besteht, die restlichen 20 Prozent sind anderer Müll, der dort gelandet ist. Es ist, als ob es inmitten des Pazifiks eine gigantische Insel gäbe, die nicht aus Felsen, sondern aus Müll besteht. In den letzten Wochen hat die Dichte dieses Materials solche Werte erreicht, dass das Gesamtgewicht dieser ‘Müllinsel' ca. 3,5 Millionen Tonnen umfasst, erklärte Chris Parry von der Kalifornischen Küstenwacht in San Francisco (...) Diese unglaubliche, wenig bekannte Abfallmenge, ist seit den 1950er Jahren entstanden, aufgrund eines subtropischen Wirbels im Nordpazifik. Es handelt sich um eine langsame Strömung im Ozean, die sich im Uhrzeigersinn und spiralenförmig dreht, angetrieben von Hochdruckströmungen. (...) Der größte Teil dieses Plastiks, ca. 80 Prozent, wurde von den Kontinenten angeschwemmt. Nur der Rest stammt von Schiffen (private, Handels- oder Fischfangbooten). Jedes Jahr werden auf der Welt ca. 100 Milliarden Kilo Kunststoffe produziert, davon landet ca. 10 Prozent im Meer. 70 Prozent dieser Kunststoffe versinkt auf den Meeresboden und schädigt somit die Lebewesen am Meeresgrund. Der Rest schwimmt an der Meeresoberfläche. Der Großteil dieser Kunststoffe ist wenig biologisch abbaubar und zerfällt letztendlich in winzige Partikel, die wiederum im Magen vieler Meerestiere landen und deren Tod verursachen. Was übrig bleibt, wird erst im Laufe von mehreren hundert Jahren verfallen; solange wird es aber weiterhin großen Schaden in den Meeren anrichten" [6].
Solch eine Müllmenge auf einer Fläche, die zweimal größer ist als die USA, soll wirklich erst jetzt entdeckt worden sein? Mitnichten! Sie wurde 1997 von einem Kapitän eines Schiffs, das im Dienste der Meeresforschung steht, erstmals gesichtet. Der Kapitän befand sich auf der Rückkehr von einem Segelwettbewerb. Heute ist bekannt, dass die UNO in einem Bericht von 2006 davon ausging, „dass eine Million Meeresvögel und mehr als 100.000 Fische und Meeressäugetiere jedes Jahr aufgrund des Plastikmülls sterben und dass jede Seemeile des Ozeans mindestens ungefähr 46.000 Stücke schwimmenden Plastiks enthält[7].
Aber was wurde während der letzten zehn Jahre von jenen unternommen, die am Hebel der Macht sitzen? Absolut gar nichts! Ähnliche Verhältnisse, auch wenn sie nicht so dramatisch sind, sind auch im Mittelmeer zu beobachten, in dessen Gewässer jedes Jahr 6,5 Millionen Tonnen. Abfall geschmissen werden, von denen 80 Prozent Kunststoffe sind. Auf dem Boden des Mittelmeeres findet man stellenweise bis zu 2.000 Kunststoffpartikel pro Quadratkilometer [8].
Und dabei gäbe es Lösungen. Kunststoff, der aus mindestens 85 Prozent Maisstärke besteht, ist vollständig biologisch abbaubar. Heute schon gibt es Tüten, Stifte und andere aus diesem Material bestehende Gegenstände. Aber im Kapitalismus schlägt die Industrie ungern einen Weg ein, der nicht höchste Profite verspricht. Und da Kunststoff auf der Grundlage von Maisstärke teurer ist, will niemand diese Kosten für die teurere Herstellung des biologisch abbaubaren Materials übernehmen, ohne vom Markt verdrängt zu werden [9]. Das Problem ist, dass die Kapitalisten die Gewohnheit haben, Wirtschaftsbilanzen zu erstellen, die systematisch all das ausschließen, was nicht zahlenmäßig erfasst werden kann, weil man es weder kaufen noch verkaufen kann, auch nicht, wenn es sich um die Gesundheit der Menschen und die Umwelt handelt. Jedes Mal, wenn ein Industrieller einen Stoff herstellen lässt, der am Ende seiner Lebensdauer zu Müll wird, werden die Kosten für die Entsorgung des Mülls praktisch nie einkalkuliert; vor allem wird nie berücksichtigt, welche Kosten und Schäden daraus entstehen, dass dieses Material irgendwo auf der Erde unabgebaut liegen bleibt.
Man muss hinsichtlich des Müllproblems noch hinzufügen: Der Unterhalt von Müllhalden oder auch von Verbrennungsanlagen stellt eine Verschwendung des ganzen Energiewertes und der nützlichen Bestandteile dieses Mülls dar. Es ist beispielsweise Fakt, dass die Herstellung bzw. Verarbeitung von Kupfer und Aluminium mit Hilfe von recyceltem Material Kostenersparnisse bis zu 90 Prozent ermöglichen könnte. In den peripheren Ländern sind die Müllhalden zu einer wahren Quelle von Subsistenzmitteln für Abertausende von Menschen geworden, die, vom Land gekommen, in der Stadt keine Arbeit finden. Müllsammler suchen auf den Müllhalden nach Wiederverwertbarem.
„Richtige „Müllstädte" sind entstanden. In Afrika handelt es sich um Korogocha in Nairobi. Pater Zanotelli hat die Verhältnisse dort mehrmals beschrieben; weniger bekannt ist Kigali in Ruanda, aber die in Sambia sind auch berühmt. Dort wird 90 Prozent des Mülls nicht eingesammelt. Er verfault auf der Straße, während die Müllhalde von Olososua in Nigeria jeden Tag von mehr als 1.000 LKW angefahren wird. In Asien hat Payatas in Quezon City in der Nähe von Manila traurige Berühmtheit erlangt. Diese Slums, wo mehr als 25.000 Menschen leben, sind am Abhang eines Müllbergs entstanden. Man nennt ihn den „stinkenden Berg", wo sich Kinder und Erwachsene um das Material streiten, das sie weiterverkaufen können. Dann gibt es noch Paradise Village, das kein Touristendorf ist, sondern ein Slum, der auf einem Sumpfgebiet entstanden ist, wo es immer wieder zu Überschwemmungen und starken Monsunregenfällen kommt. Schließlich Dumpsite Catmon, die Müllhalde, auf der die Slums stehen, die Paradise Village überragen. In Peking, China, leben Tausende von Menschen auf den Müllhalden, die verbotene, weil gefährliche Stoffe recyceln, während es in Indien die meisten „Überlebenden" unter jenen gibt, die sich dank der Müllhalden „ernähren" können."[10]
Die Verbreitung der Giftstoffe
Giftstoffe sind natürliche oder synthetische Substanzen, die für den Menschen und/oder andere Lebewesen giftig sind. Neben Stoffen, die es immer schon auf unserem Planeten gegeben hat und die von der industriellen Technologie auf verschiedenste Art verwendet werden - wie zum Beispiel Schwermetalle, Asbest usw., hat die chemische Industrie Zehntausende anderer Stoffe massenweise produziert. Mangelnde Kenntnis der Gefahren einer Reihe von Stoffen und vor allem der Zynismus des Kapitalismus haben unvorstellbare Schäden angerichtet. Es sind dadurch Umweltzerstörungen ausgelöst worden, die man nur sehr schwer wieder beheben kann, wenn einst die gegenwärtig herrschende Klasse gestürzt sein wird.
Eine der größten Katastrophen der chemischen Industrie ist sicherlich die von Bophal, Indien, die am 2. und 3. Dezember 1984 in dem Werk des amerikanischen Chemie-Multis Union Carbide stattfand. Eine Giftwolke von 40 Tonnen Pestiziden tötete entweder sofort oder in den darauffolgenden Jahren mindestens 16.000 Menschen. Überlebende klagen seitdem über unheilbare körperliche Schäden. Später eingeleitete Untersuchungen haben zutage gebracht, dass im Gegensatz zu einem vergleichbaren Werk in Virginia, USA, das Werk in Bophal über keine drucktechnischen Überwachungsanlagen und Kühlsysteme verfügte. Der Kühlturm war vorübergehend außer Betrieb genommen worden; die Sicherheitssysteme entsprachen überhaupt nicht dem Ausmaß der Werksanlage. In Wirklichkeit stellte die indische Fabrik mit ihren billigen Arbeitskräften für die amerikanischen Besitzer eine sehr lukrative Einnahmequelle dar, die nur sehr geringe Investitionen in variables und fixes Kapital erforderte.
Ein anderes historisches Beispiel war schließlich der Vorfall im Atomkraftwerk von Tschernobyl 1986. „Man hat geschätzt, dass die radioaktiven Strahlen des Reaktors 4 von Tschernobyl ungefähr 200-mal höher lagen als die Explosionen der Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zusammengenommen. Auf einem Gebiet zwischen Russland, der Ukraine und Weißrussland, in dem ungefähr neun Millionen Menschen leben, hat man eine große Verseuchung festgestellt. 30 Prozent des Gebietes ist durch Cäsium 137 verseucht. In den drei Ländern mussten ca. 400.000 Menschen evakuiert werden, während weitere 270.000 Menschen in Gebieten leben, in denen der Konsum von örtlichen landwirtschaftlichen Produkten nur eingeschränkt erlaubt ist." [11]
Es gibt natürlich noch unzählige andere Umweltkatastrophen infolge schlampiger Betriebsleitung oder der vielen Meeresverschmutzungen durch Ölteppiche wie jenen, den der Öltanker Exxon Valdez am 24. März 1989 anrichtete, als bei seinem Untergang vor der Küste Alaskas mindestens 30.000 Tonnen Öl ins Meer liefen, oder auch infolge des ersten Golfkriegs, als viele Ölplattformen in Brand geschossen wurden und sich eine Ökokatastrophe in einem bislang noch nie da gewesenen Ausmaß im Persischen Golf abspielte. Schätzungen der US-amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften zufolge werden jedes Jahr durchschnittlich zwischen drei bis vier Millionen Tonnen Kohlenwasserstoffe ins Meer geleitet, Tendenz steigend - trotz der verschiedenen Schutzmaßnahmen, denn die Nachfrage nach diesen Produkten wächst.
Neben den Auswirkungen dieser Verschmutzungen, die bei hoher Dosierung größere Vergiftungen hervorrufen, gibt es einen anderen Vergiftungsmechanismus, der langsamer, diskreter wirkt - die chronische Vergiftung. Wenn eine giftige Substanz langsam und in geringen Dosen aufgenommen wird und chemisch stabil ist, kann sie sich in den Organen und den Geweben der Lebewesen absetzen und soweit anhäufen, bis tödliche Konzentrationen erreicht werden. Dies nennt man aus der Sicht der Ökotoxikologie Bioakkumulation. Ein weiterer Mechanismus betrifft giftige Substanzen, die in die Lebensmittelkette eindringen (das trophische Netz). Sie gelangen von einer niedrigen zu einer höheren Stufe der trophischen Stadien, mit jeweiliger Verdoppelung bzw. Verdreifachung der Konzentration. Um es deutlicher zu machen, nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Jahre 1953 in Minamata in Japan. In der Bucht Minamata lebten viele arme Fischer, die sich im Wesentlichen von ihrem Fischfang ernährten. In der Nähe dieser Bucht befand sich ein Industriekomplex, der Acetaldehyd verwendete, einen chemischen Stoff, eine Synthese, deren Zubereitung ein Quecksilberderivat erfordert. Die ins Meer als Abfall eingeleiteten Stoffe waren leicht mit Quecksilber vergiftet. Die Konzentration betrug jedoch nur 0.1 Mikrogramm pro Liter Meerwasser, d.h. eine Konzentration, die selbst mit den heute verfügbaren genaueren Messgeräten immer noch schwierig zu ermitteln ist. Welche Konsequenzen ergaben sich aus dieser kaum wahrnehmbaren Verschmutzung? 48 Menschen starben innerhalb weniger Tage, 156 litten unter Vergiftungen mit schwerwiegenden Folgen, und selbst die Katzen der Fischer, die sich ständig von Fischresten ernährten, wurden „irrsinnig", brachten sich schließlich selbst im Meer um, ein für ein Raubtier völlig unübliches Verhalten. Was war passiert? Das im Meerwasser vorhandene Quecksilber war durch das Phytoplankton aufgenommen und fixiert worden, war dann von diesem zum Zooplankton gewandert, schließlich zu den kleinen Mollusken (Weichtieren), und schlussendlich zu den kleineren und mittelgroßen Fischen. Der Vorgang erfasste die ganze trophische Kette. Dabei wurde der gleiche Schadstoff, der chemisch unzerstörbar ist, auf einen neuen ‚Gastgeber' übertragen, und zwar mit wachsender Konzentration, d.h. umgekehrt proportional im Verhältnis zur Größe des Jägers und der Masse der während seines Lebens aufgenommenen Nahrung. So hat man festgestellt, dass bei Fischen das Metall eine Konzentration von 50 mg/Kilo erreicht hatte, was einer 500.000-fachen Konzentration entspricht. Bei einigen Fischern mit dem „Minamata-Syndrom" wurden erhöhte Metallwerte in ihren Organen, insbesondere in ihren Haaren nachgewiesen, die mehr als ein halbes Gramm pro Kilo Körpergewicht betrugen.
Obgleich sich Anfang der 1960er Jahre die Wissenschaftler dessen bewusst waren, dass es bei giftigen Substanzen nicht ausreicht, Methoden der natürlichen Auflösung zu benutzen, da biologische Mechanismen in der Lage sind, das zu konzentrieren, was der Mensch verstreut, hat die chemische Industrie unseren Planeten weiterhin massiv verpestet - ohne dieses Mal den Vorwand auftischen zu können, von nichts gewusst zu haben. So ist es jüngst zu einem zweiten Minamata in Priolo (Sizilien) gekommen, wo auf einer Fläche von wenigen Quadratkilometern mindestens fünf Raffinerien, darunter Enichem, illegal Quecksilber aus einer Chlor- und Schwefelfabrik auf den Feldern entsorgten. Zwischen 1991 und 2001 sind ca. 1.000 Kinder mit großen geistigen Behinderungen und ernsthaften Missbildungen sowohl am Herzen als auch am Genitaltrakt geboren worden. Ganze Familien leiden unter Tumoren, und viele verzweifelte Frauen sahen sich zu Abtreibungen gezwungen, weil sie verkrüppelten Nachwuchs erwarteten. Dabei hatte der Vorfall von Minamata schon all die Risiken von Quecksilber für die menschliche Gesundheit aufgezeigt. Priolo ist also kein unvorhersehbares Ereignis, kein tragischer Fehler, sondern eine pure verbrecherische Tat, die vom italienischen Kapitalismus und noch dazu von seinem staatskapitalistischen Regime, das viele Leute als „links" vom „privaten Sektor" betrachten, verübt wurde. In Wirklichkeit hat man feststellen müssen, dass die Führung von Enichem sich schlimmer als die Ökomafia verhalten hat: Um Kosten bei der „Dekontaminierung" (man spricht von mehreren Millionen eingesparten Euros) zu sparen, wurden die mit Quecksilber verseuchten Abfälle mit anderem Schmutzwasser vermischt und im Meer entsorgt. Es wurden falsche Bescheinigungen ausgestellt, Tankwagen mit doppeltem Boden benutzt, um den Handel mit giftigen Substanzen zu verheimlichen - all das in Übereinstimmung mit den verantwortlichen Behörden. Als die Justiz sich schließlich rührte und die führenden Köpfe der Industrie verhaftete, war die Verantwortung dermaßen unleugbar, dass Enichem die Auszahlung eines Schmerzensgeldes von 11.000 Euro pro Familie beschloss, d.h. einen Betrag, den das Unternehmen auch im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung durch das Gericht hätte bezahlen müssen.
Neben den Ursachen für Umweltverschmutzungen, die auf Unfälle zurückzuführen sind, produziert die ganze Gesellschaft aufgrund ihrer Funktionsweise ständig umweltgefährdende Stoffe, die sich in der Luft, im Wasser und am Boden sammeln - und wie schon erwähnt - in der Biosphäre, einschließlich des Menschen. Der massive Einsatz von Reinigungsmitteln und anderen Produkten dieser Art hat zum Phänomen der Eutrophierung (Nährstoffanreicherung) der Flüsse, Seen und Meere geführt. In den 1990er Jahren wurden 6.000 - 11.000 Tonnen Blei, 22.000 - 28.000 Tonnen Zink, 4200 Tonnen Chrom, 4.000 Tonnen Kupfer, 1450 Tonnen Nickel, 530 Tonnen Kadmium, 1,5 Millionen Tonnen Stickstoffe und ca. 100.000 Tonnen Phosphate in die Nordsee eingeleitet. Dieser Giftmüll ist besonders gefährlich für jene Meere, die flächenmäßig groß, aber nicht sehr tief sind, wie die Nordsee, die Ostsee, die südliche Adria, das Schwarze Meer. Weil in diesen Meeren nicht soviel Tiefenwasser vorhanden und die Vermischung zwischen Süßwasser aus den Flüssen und dichterem Salzwasser schwierig ist, können die Giftstoffe sich nicht zersetzen.
Synthetische Produkte wie das berühmt-berüchtigte Pflanzenschutzmittel DDT, das seit 30 Jahren in den Industriestaaten verboten ist, oder auch PCB (chlorierte Biphenyle), die einst in der elektrischen Industrie verwendet, aber mittlerweile wegen bekannt gewordener Gefahren ebenfalls verboten wurden, besitzen alle eine unbeschreibliche chemische Haltbarkeit. Sie sind in unveränderten Zustand überall vorhanden, im Wasser, in den Böden, in den Zellen der Lebewesen. Aufgrund der Bioakkumulation sind diese Stoffe in einigen Lebewesen in gefährlichen Konzentrationen zu finden, was zu deren Tod oder zu Störungen bei der Reproduktion führt und einen Rückgang der jeweiligen Populationen bewirkt. So richtet der Müllhandel, bei dem oft Giftmüll noch irgendwo ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen zwischengelagert wird, unkalkulierbare Schäden im Ökosystem und für die ganze Bevölkerung an.
Bevor wir diesen Punkt hier abschließen - obwohl noch Hunderte von Beispielen aus der ganzen Welt geliefert werden könnten -, wollen wir noch daran erinnern, dass gerade diese Bodenverseuchung für ein neues und dramatisches Phänomen verantwortlich ist: die Entstehung von „Todeszonen" - wie zum Beispiel das Dreieck Priolo, Mellili und Augusta in Sizilien - wo der Prozentsatz von Neugeborenen mit Fehlbildungen viermal höher ist als im nationalen Durchschnitt, oder auch das andere Todesdreieck in der Nähe von Neapel zwischen Giuliano, Qualiano und Villaricca, wo die Zahl der Tumorerkrankungen weit über dem nationalen Durchschnitt liegt.
Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und/oder die Bedrohung durch die Umweltverschmutzung
Das letzte Beispiel des globalen Phänomens, das die Welt in eine Katastrophe führt, ist die Verknappung und Erschöpfung der natürlichen Ressourcen oder deren Bedrohung durch Umweltverschmutzung. Bevor wir näher auf dieses Phänomen eingehen, wollen wir darauf hinweisen, dass die Menschengattung schon früher - wenn auch in einem geringeren Maße - mit solchen Problemen zu tun hatte, Probleme, die schon damals katastrophale Konsequenzen hatten. Damals waren jedoch nur kleinere, beschränkte Regionen der Erde betroffen. Wir wollen aus dem Buch von Jared Diamond, „Kollaps" zitieren, das sich mit der Geschichte Rapa Nui's auf der Osterinsel befasst, die wegen ihrer großen Steinstatuen bekannt ist. Man weiß, dass die Insel vom holländischen Forscher Jacob Roggeveen Ostern 1772 entdeckt wurde (daher ihr Name), und es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass die Insel „von einem dichten subtropischen Wald bedeckt war, der viele große Bäume aufwies". Auch gab es dort viele Vögel und wilde Tiere. Doch bei Ankunft der Kolonisatoren verbreitete die Insel einen anderen Eindruck:
„So war es auch für Rogeveen ein Rätsel, wie die Inselbewohner ihre Statuen aufgerichtet hatten. Um noch einmal aus seinem Tagebuch zu zitieren: ‚Die steinernen Bildsäulen sorgten zuerst dafür, dass wir starr vor Erstaunen waren, denn wir konnten nicht verstehen, wie es möglich war, dass diese Menschen, die weder über dicke Holzbalken zur Herstellung irgendwelcher Maschinen noch über kräftige Seile verfügten, dennoch solche Bildsäulen aufrichten konnten, welche volle neun Meter hoch und in ihren Abmessungen sehr dick waren (...). Ursprünglich, aus größerer Entfernung, hatten wir besagte Osterinsel für sandig gehalten, und zwar aus dem Grund, dass wir das verwelkte Gras, Heu und andere versengte und verbrannte Vegetation als Sand angesehen hatten, weil ihr verwüstetes Aussehen uns keinen anderen Eindruck vermitteln konnte als den einer einzigartigen Armut und Öde. Was war aus den vielen Bäumen geworden, die früher dort gestanden haben müssen? Um die Bearbeitung, den Transport und die Errichtung der Statuen zu organisieren, bedurfte es einer komplexen, vielköpfigen Gesellschaft, die von ihrer Umwelt leben konnte". (Diamond, S. 105) [12]‘ "
„Insgesamt ergibt sich für die Osterinsel ein Bild, das im gesamten Pazifikraum einen Extremfall der Waldzerstörung darstellt und in dieser Hinsicht auch in der ganzen Welt kaum seinesgleichen hat. Der Wald verschwand vollständig, und seine Baumarten starben ausnahmslos aus." (Diamond, S. 138)
„Dies alles lässt darauf schließen, dass die Abholzung der Wälder kurz nach dem Eintreffen der ersten Menschen begann, um 1400 ihren Höhepunkt erreichte und je nach Ort zwischen dem frühen 15. und dem 17. Jahrhundert praktisch abgeschlossen war. Für die Inselbewohner ergab sich daraus die unmittelbare Folge, dass Rohstoffe und wild wachsende Nahrungsmittel fehlten, und auch die Erträge der Nutzpflanzen gingen zurück (...) Da es auch keine seetüchtigen Kanus mehr gab, verschwanden die Knochen der Delphine, die in den ersten Jahrhunderten die wichtigsten Fleischlieferanten der Inselbewohner gewesen waren, um 1500 praktisch völlig aus den Abfallhaufen; und das Gleiche galt für Thunfische und andere Fischarten aus dem offenen Meer. (...) Weiter geschädigt wurde der Boden durch Austrocknung und Auswaschung von Nährstoffen, auch sie eine Folge der Waldzerstörung, die zu einem Rückgang des Pflanzenertrages führte. Darüber hinaus standen die Blätter, Früchte und Zweige wilder Pflanzen, die den Bauern zuvor als Kompost gedient hatten, nicht mehr zur Verfügung. (...) Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Hungersnot, einem Zusammenbruch der Bevölkerung und einem Niedergang bis hin zum Kannibalismus (...) In der mündlichen Überlieferung der Inselbewohner nimmt der Kannibalismus breiten Raum ein; die schrecklichste Beschimpfung, die man einem Feind entgegenschleudern konnte, lautete: „Das Fleisch deiner Mutter hängt zwischen meinen Zähnen." (S. 138)
„Wegen ihrer isolierten Lage ist die Osterinsel das eindeutigste Beispiel für eine Gesellschaft, die sich durch übermäßige Ausbeutung ihrer eigenen Ressourcen selbst zerstört hat (...) Die Parallelen zwischen der Osterinsel und der ganzen heutigen Welt liegen beängstigend klar auf der Hand. Durch Globalisierung, internationalen Handel, Flugverkehr und Internet teilen sich heute alle Staaten der Erde die Ressourcen, und alle beeinflussen einander genau wie die zwölf Sippen auf der Osterinsel. Die Osterinsel war im Pazifik ebenso isoliert wie die Erde im Weltraum. Wenn ihre Bewohner in Schwierigkeiten gerieten, konnten sie nirgendwohin flüchten, und sie konnten niemanden um Hilfe bitten; ebenso können wir modernen Erdbewohner nirgendwo Unterschlupf finden, wenn unsere Probleme zunehmen. Aus diesen Gründen erkennen viele Menschen im Zusammenbruch der Osterinsel eine Metapher, ein schlimmstmögliches Szenario für das, was uns selbst in Zukunft vielleicht noch bevorsteht." (S. 152) [13]
Diese Beobachtungen, die alle aus dem Buch von Diamond stammen, warnen uns davor zu glauben, dass das Ökosystem der Erde grenzenlos ist, und sie zeigen, dass das, was auf der Osterinsel passierte, auch die Menschheit insgesamt treffen kann, falls diese nicht entsprechend behutsam mit den Ressourcen des Planeten umgeht.
Man ist versucht, eine Parallele zum Abholzen der Wälder zu ziehen, das seit dem Anfang der Urhorde bis heute vor sich geht und heute so systematisch weiterbetrieben wird, dass auch die letzten grünen Lungen der Erde wie der Regenwald des Amazonas zerstört werden.
Wie schon erwähnt, kennt die herrschende Klasse sehr wohl die Risiken, wie die edle Intervention eines Wissenschaftlers des 19. Jahrhunderts, Rudolf Julius Emmanuel Clausius, belegt, der sich zur Frage der Energie und der Ressourcen schon lange vor all den Sonntagsreden zum Naturschutz sehr deutlich äußerte: „In der Wirtschaft einer Nation ist ein Gesetz immer gültig: Man darf während eines gewissen Zeitraums nicht mehr konsumieren als das, was in diesem Zeitraum produziert wurde. Deshalb dürfen wir nur soviel Brennstoffe verbrauchen, wie es möglich ist, diese dank des Wachstums der Bäume wiederherzustellen." [14]
Doch wenn man die heutigen Verhältnisse betrachtet, muss man schlussfolgern, dass genau das Gegenteil passiert, was Clausius empfohlen hatte. Man schlägt direkt den gleichen fatalen Weg ein wie die Osterinsulaner.
Um dem Problem der Ressourcen adäquat entgegenzutreten, muss man auch eine andere grundlegende Variable berücksichtigen: die Schwankungen der Weltbevölkerung.
„Bis 1600 war das Wachstum der Weltbevölkerung noch sehr langsam; sie nahm lediglich zwischen zwei bis drei Prozent pro Jahrhundert zu. 16 Jahrhunderte vergingen, bevor die Einwohnerzahl von ca. 250 Millionen Menschen zur Zeit des Beginns des christlichen Zeitalters auf 500 Millionen Menschen gestiegen war. Von diesem Zeitpunkt an nahm der Zeitraum bis zur nächsten Verdoppelung der Bevölkerung ständig ab, so dass in einigen Ländern der Welt heute die so genannte ‘biologische Grenze' des Bevölkerungswachstums erreicht wird (drei bis vier Prozent). UNO-Schätzungen zufolge werden im Jahr 2025 ca. acht Milliarden Menschen leben. (...) Es gibt große Unterschiede zwischen den entwickelten Ländern, die nahezu ein Nullwachstum erreicht haben, und den Entwicklungsländern, die bis zu 90 Prozent zum gegenwärtigen demographischen Wachstum beitragen. (...) Im Jahre 2025 wird zum Beispiel Nigeria UN-Schätzungen zufolge eine größere Bevölkerungszahl als die USA haben, und in Afrika werden dreimal so viel Menschen leben wie in Europa. Überbevölkerung, verbunden mit Rückständigkeit, Analphabetentum und ein Mangel an Hygiene und Gesundheitseinrichtungen stellen sicher ein großes Problem dar, das nicht nur Afrika bedroht, sondern die ganze Welt beeinflussen wird. Insofern scheint es ein großes Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot an verfügbaren Ressourcen zu geben, das auch auf die Verwendung von ca. 80 Prozent der Energieressourcen der Welt durch die Industriestaaten zurückzuführen ist.
Die Überbevölkerung bringt einen starken Rückgang der Qualität der Lebensbedingungen mit sich, weil sie die Produktivität eines Arbeiters senkt und auch die Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Trinkwasser, Gesundheitsleistungen und Medikamenten pro Kopf einschränkt. Der starke, von Menschen gegenwärtig verursachte Druck führt zu einer Schädigung der Umwelt, die sich unvermeidbar auf die Gleichgewichte des Systems Erde auswirken wird.
Die Ungleichgewichte haben sich in den letzten Jahren verstärkt: Die Bevölkerung wächst nicht nur in einem Maße, das keineswegs homogen ist, sondern sie nimmt vor allem in den städtischen Ballungsräumen sehr stark zu." [15]
Das starke Bevölkerungswachstum verschärft das Problem der Erschöpfung der Ressourcen also noch mehr, zumal der Mangel an natürlichen Ressourcen vor allem da anzutreffen ist, wo die Bevölkerungsexplosion am stärksten ist, was für die Zukunft noch größere Probleme erahnen lässt, von denen immer mehr Menschen betroffen sein werden.
Untersuchen wir die erste Quelle der Natur, Wasser, ein auf der ganzen Welt notwendiges Gut, das heute durch das unverantwortliche Vorgehen des Kapitalismus stark bedroht ist.
Wasser ist ein Gut, das auf der Erdoberfläche in großen Mengen vorhanden ist (die Ozeane, Grundwasser und die Polkappen), aber nur ein kleiner Teil davon ist als Trinkwasser nutzbar, d.h. jener Teil, der in den Polkappen und in den wenigen noch nicht vergifteten Flüssen zur Verfügung steht. Die Entwicklung der industriellen Aktivitäten, die die Bedürfnisse der Umwelt völlig außer Acht lässt, und die völlig willkürliche Ablagerung und Entsorgung des städtischen Mülls haben einen Großteil des Grundwassers verseucht, das die natürliche Trinkwasserreserve des Gemeinwesens ist. Dies hat mit zur Verbreitung von Krebs und anderen Krankheiten in der Bevölkerung beigetragen; andererseits ist das Wasser zu einem knappen und kostbaren Gut in vielen Ländern geworden.
„Mitte des 21. Jahrhunderts werden den pessimistischen Prognosen zufolge ca. sieben Milliarden Menschen in 60 Ländern nicht mehr über ausreichend Wasser verfügen. Im besten Fall würden „nur" zwei Milliarden Menschen in 48 Ländern an Wassermangel leiden (...) Aber die besorgniserregendsten Angaben in dem Dokument der UNO ist die aufgrund der Wasserschmutzung und der schlechten Hygienebedingungen prognostizierte Zahl der Todesopfer: 2,2 Millionen pro Jahr. Darüber hinaus ist Wasser Träger zahlreicher Krankheiten, unter ihnen Malaria, wodurch jedes Jahr ca. eine Million Menschen sterben" [16]. (Das blaue Gold des dritten Jahrtausends)
Die englische Wissenschaftszeitung New Scientist schrieb in ihrer Schlussfolgerung anlässlich des Wassersymposiums im Sommer 2004 in Stockholm: „In der Vergangenheit wurden mehrere Millionen Brunnen errichtet, meistens ohne irgendwelche Kontrolle, und die Wassermengen, die durch gigantische elektrische Wasserpumpen gefördert werden, übersteigen bei weitem den Umfang der Regenwassermengen, die das Grundwasser wieder mit neuem Wasser versorgen (...) Wasser dem Erdreich zu entnehmen, ermöglicht vielen Ländern reichhaltige Reis- und Zuckerrohrernten (diese Pflanzen benötigen viel Wasser), doch lange wird der Boom nicht dauern. (...) Indien ist ein Zentrum der Revolution des Bohrens nach unterirdischem Wasser. Mithilfe von Technologien aus der Ölindustrie haben die kleinen Bauern 21 Millionen kleine Brunnen auf ihren Feldern errichtet, und jedes Jahr kommen noch mal eine Million Brunnen hinzu. (...) In den nördlichen Ebenen Chinas, wo die meisten landwirtschaftlichen Produkte geerntet werden, entnehmen die Bauern der Erde jedes Jahr 30 Kubikkilometer Wasser mehr, als durch den Regen zugeführt wird (...). In Vietnam wurde in den letzten Jahren die Zahl der Brunnen vervierfacht (...) In Punjab, wo 90 Prozent der Lebensmittel Pakistans herstammen, fangen die Grundwasserreserven langsam an auszutrocknen" [17].
Während die Lage allgemein schon schlimm genug ist, ist die Situation in den Schwellenländern Indien und China geradezu katastrophal.
„Die Dürre in der Provinz Sechuan und in Chongqing hat ca. 9,9 Milliarden Yuan Schäden verursacht. Einschränkungen beim Wasserverbrauch für mehr als zehn Millionen Menschen wurden veranlasst, während im ganzen Land ca. 18 Millionen Menschen an Wasserknappheit leiden." [18]
„China wurde von den schlimmsten Überschwemmungen in den letzten Jahren heimgesucht, mit mehr als 60 Millionen betroffenen Menschen in Zentral- und Südchina, mindestens 360 Toten und großen ökonomischen Schäden, die schon 7,4 Milliarden Yuan übersteigen. 200.000 Häuser sind zerstört oder beschädigt, 528.000 Hektar landwirtschaftlich bebaute Fläche sind zerstört und 1,8 Million überflutet. Gleichzeitig schreitet die Verwüstung schnell voran. Bislang wurde ein Fünftel des Territoriums in Mitleidenschaft gezogen. Dies hat Sandstürme hervorgerufen, von denen manche gar bis Japan ziehen (...) Während Zentral- und Südchina unter Überschwemmungen leidet, dehnt sich die Wüste im Norden weiter aus. Mittlerweile ist davon mehr als ein Fünftel des Gebietes entlang des Gelben Flusses, der Hochebene Qinghai-Tibets und eines Teils der Inneren Mongolei und Gansus betroffen. Die Bevölkerung Chinas umfasst ca. 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber sie verfügt nur über sieben Prozent der verfügbaren landwirtschaftlichen Anbaufläche.
Wang Tao, Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Lanzhu, zufolge hat die Desertifikation in China während des letzten Jahrzehnts jedes Jahr um 950 Quadratkilometer zugenommen. Alljährlich im Frühjahr wird Peking und ganz Nordchina von Sandstürmen heimgesucht, mit Auswirkungen bis nach Südkorea und in Japan" [19].
All das muss uns zum Nachdenken über die so viel gepriesene starke Leistungsfähigkeit des chinesischen Kapitalismus veranlassen. Die jüngste Entwicklung der chinesischen Wirtschaft kann dem niedergehenden Weltkapitalismus kein neues Leben einhauchen; stattdessen zeigt sie den ganzen Schrecken der Agonie dieses Systems auf: Städte im Smog (auch die jüngst stattgefundenen Olympischen Sommerspiele können nicht darüber hinwegtäuschen), austrocknende Flüsse und jedes Jahr Zehntausende Arbeiter, die bei Arbeitsunfällen in den Bergwerken oder anderswo aufgrund der furchtbaren Arbeitsbedingungen und der mangelnden Sicherheitsbestimmungen sterben.
Natürlich werden auch viele andere Ressourcen immer knapper. Aus Platzgründen können wir hier nur kurz auf zwei eingehen.
Die erste Ressource ist natürlich das Erdöl. Bekanntlich spricht man seit dem Ende der 1970er Jahre von der Erschöpfung der natürlichen Ölquellen, doch in diesem Jahr, 2008, scheint man tatsächlich den Gipfelpunkt der Förderung (er wird Hubbert-Gipfel genannt) erreicht zu haben, d.h. jenen Punkt, an dem verschiedenen geologischen Hochrechnungen zufolge die Hälfte der natürlichen Ressourcen bereits erschöpft ist. Öl stellt heute ca. 40 Prozent der Basisenergie dar und ungefähr 90 Prozent der im Verkehr eingesetzten Energie. Auch in der chemischen Industrie ist es ein wichtiger Grundstoff, insbesondere bei der Herstellung von Düngemitteln in der Landwirtschaft, Kunststoffen, Klebstoffen und Lacken, Schmier- und Reinigungsmitteln. All das ist möglich, weil das Öl bislang ein relativ billiger Stoff und scheinbar grenzenlos verfügbar war. Allein dass diese Perspektiven sich nun geändert haben, trägt schon jetzt zu Preiserhöhungen bei. Die kapitalistische Welt hört auch heute nicht auf die Empfehlung Clausius, innerhalb einer Generation nicht mehr zu verbrauchen, als die Natur in dieser Zeit liefern kann. Stattdessen hat sich die kapitalistische Welt in eine verrückte Jagd nach Energie gestürzt. Dabei sind China und Indien an die führende Stelle getreten, was den Energiekonsum betrifft. Sie verbrennen alles, was man verbrennen kann, greifen sogar auf giftige fossile Kohlenstoffe zur Energiegewinnung zurück und haben damit bislang nie da gewesene Umweltprobleme geschaffen.
Natürlich hat sich der wundersame Ausweg mittels der sog. Biokraftstoffe als Flop, weil völlig unzureichend, erwiesen. Die Herstellung von Brennstoff auf der Grundlage der alkoholischen Gärung von Maisstärke oder von Pflanzenölen reicht keineswegs aus, um die gegenwärtigen Bedürfnisse des Marktes nach Brennstoffen zu befriedigen. Im Gegenteil, auf diese Weise werden die Preise für Nahrungsmittel nur weiter in die Höhe getrieben, wodurch der Hunger unter den ärmsten Bevölkerungsteilen zunimmt. Auch hier werden kapitalistische Unternehmen wie die Nahrungsmittelhersteller begünstigt, die zu Verkäufern von Biokraftstoffen geworden sind. Aber für die einfachen Sterblichen bedeutet dies, dass große Waldgebiete abgeholzt werden, um dort Plantagen zu errichten (Millionen Hektar Wald sind geopfert worden). Die Herstellung von Biodiesel verlangt in der Tat den Einsatz von großen Flächen. Um sich eine konkretere Vorstellung davon zu machen: ein Hektar Raps, Sonnenblumen oder andere Ölpflanzen entspricht etwa 1.000 Liter Biodiesel, womit ein PKW ca. 10.000 Kilometer zurücklegen kann. Wenn man davon ausgeht, dass ein PKW durchschnittlich im Jahr ca. 10.000 Kilometer zurücklegen, verbraucht jedes Fahrzeug also Biodiesel in Höhe eines Hektars Anbaufläche. Für ein Land wie Italien, wo ca. 34 Millionen PKW angemeldet sind, würde dies bedeuten, dass man eine Anbaufläche von ca. 34 Millionen Hektar benötigen würde. Wenn man den PKW noch die ca. vier Millionen LKW hinzufügt, deren Verbrauch noch höher liegt, würde sich der Verbrauch verdoppeln, und es würde eine Anbaufläche von mindestens 70 Millionen Hektar erforderlich machen. Dies entspricht dem Doppelten der Fläche Italiens, Berge, Städte usw. eingeschlossen.
Obgleich davon kaum die Rede ist, stellt sich ein ähnliches Problem wie bei den fossilen Brennstoffen natürlich auch bei anderen Ressourcen mineralischer Art, wie beispielsweise bei den Mineralien, aus denen Metall gewonnen wird. Es trifft sicherlich zu, dass Metall nicht durch seine eigentliche Verwendung zerstört wird wie im Fall des Öls oder des Methangases, aber die Nachlässigkeit der kapitalistischen Produktion läuft darauf hinaus, dass große Mengen Metall auf Müllhalden und anderswo verrotten, so dass die Versorgung mit Metall früher oder später auch nicht mehr ausreichen wird. Die Verwendung bestimmter vielschichtiger Legierungen lässt den eventuellen Versuch der Rückgewinnung eines „reinen" Materials als schwierig erscheinen.
Das Ausmaß des Problems wurde anhand von Schätzungen deutlich, denen zufolge innerhalb weniger Jahrzehnte folgende Rohstoffe erschöpft sein werden: Uran, Platin, Gold, Silber, Kobalt, Blei, Mangan, Quecksilber, Molybdän, Nickel, Zinn, Wolfram und Zink. Dies sind für die moderne Industrie praktisch unabdingbare Stoffe, und ihr Mangel bzw. ihre Erschöpfung wird eine sehr schwere Last in der Zukunft darstellen. Aber auch andere Stoffe sind nicht unerschöpflich. Man hat errechnet, dass noch ca. 30 Milliarden Tonnen Eisen, 220 Millionen Tonnen Kupfer, 85 Millionen Tonnen Zink zur Verfügung stehen (in dem Sinne, dass es noch wirtschaftlich möglich sein wird, sie zu fördern). Um sich auszumalen, um welche Mengen es sich handelt, muss man wissen, dass, um die ärmsten Länder auf das Niveau der reichsten Länder zu bringen, man 30 Milliarden Tonnen Eisen, 500 Millionen Tonnen Kupfer, 300 Millionen Tonnen Zink benötigt, d.h. viel mehr, als der ganze Planet Erde anzubieten hat.
In Anbetracht dieser angekündigten Katastrophe muss man sich fragen, ob Fortschritt und Entwicklung notwendigerweise mit Umweltverschmutzung und Zerstörung des Ökosystems verbunden sein müssen. Man muss sich fragen, ob solche Desaster auf die unzureichende Bildung der Menschen oder auf etwas Anderes zurückzuführen sind. Das werden wir im nächsten Artikel untersuchen.
Ezechiele, August 2008
[1] G. Barone et al., Il metano e il futuro del clima, in Biologi Italiani, n° 8 de 2005. („Methan und die Zukunft des Klimas").
[2] Ebenda.
[3] G. Pellegri, Terzo mondo, nuova pattumiera creata dal buonismo tecnologico, siehe http:/www.caritas-ticino.ch/rivista/elenco%20rivista/riv_0203/08%20-%20Terzo%m... [339]
[4] Vivere di rifiuti, (Von Abfällen leben) http:/www.scuolevi-net:scuolevi/valdagno [340] /marzotto/mediateca.nsf/9bc8ecfl790d17ffc1256f6f0065149d/7f0bceed3ddef3b4c12574620055b62d/Body/M2/Vivere%20di%rifiuti.pdf ?OpenElement
[5] Roberto Saviano, Gomorra, Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra, (Reise in das Reich der Wirtschaft und in die Träume der Herrschaft der Camorra), Arnoldo Montaldi, 2006.
[6] La Republica on-line, 29/10/2007
[7] La Republica, 6/02/2008. Allein in den USA werden mehr als 100 Milliarden Plastiktüten verwendet. 1.9 Milliarden Tonnen Öl sind für deren Herstellung erforderlich, wobei die meisten von ihnen auf dem Müll landen und Jahrzehnte bis zu ihrer Zersetzung brauchen. Für die Herstellung mehrerer Dutzend Milliarden Plastiktüten müssen allein 15 Millionen Bäume gefällt werden.
[8] Siehe den Artikel „Das Mittelmeer, ein Plastikmeer" in La Republica du 19 Juli 2007.
[9] Man kann natürlich nicht ausschließen, dass der schwindelerregende Preisanstieg des Öls zwischen 2007-2008 die Verwendung dieses Rohstoffs für die Produktion von Kunststoffen infragestellt, wodurch es in absehbarer Zukunft zu einer Kehrtwende unter wachsamen Unternehmern kommen könnte, die aber nur auf die Verteidigung ihrer Interessen achten.
[10] R. Troisi : la discarica del mondo luogo di miseria e di speranza nel ventunesimo secolo. (Die Müllentsorgung der Erde - Misere und Hoffnung des 21. Jahrhunderts) - https://villadelchancho.splinder.com/tag/discariche+del+mondo [341]
[11] Siehe den Artikel: „Einige Kollateralschäden der Industrie - Chemie, und Atomkraft" Alcuni effetti collaterali dell'industria, La chimica, la diga e il nucleare.
[12] Jared Diamond, Collasso, edizione Einaudi.
[13] ebenda.
[14] R. J. E Clausius (1885), geboren 1822 in Koslin (damals Preußen, heute Polen) und 1888 gestorben in Bonn.
[15]
Vereinigung Geographielehrer Italiens - „Das Bevölkerungswachstum", La crescita
della popolazione.
https://www.aiig.it/UnProzent20quadernoProzent20perProzentl'ambiente/off... [342]
[16] G. Carchella, Acqua : l'oro blu del terzo millenario, su „Lettera 22, associazione indipendente di giornalisti". https://www.lettera22.it/showart.php?id=296&rubrica=9 [343] Wasser - Das blaue Gold des 21. Jahrhunderts in Brief 22, Unabhängige Vereinigung der Journalisten
[17] Asian Farmers sucking the continent dry, Newscientist, https://www.newscientist.com/article/dn6321-asian [344] farmers-sucking the continent-dry.html Asiatische Bauern trocknen den Kontinent aus, 28. August 2004
[18]
PB, Asianews, China: Noch 10 Millionen Menschen dursten nach Trockenheit
https://www.asianews.it/index.php?l=it&art=6977 [345]
[19] Asianews, China - eingeklemmt zwischen Überschwemmungen und dem Vormarsch der Wüsten https://www.asiannews.it/index.php?l=it&art=9807 [346]
, Asianews, La Cina stretta tra le inondazioni e il deserto che avanza, 18/08/2006
Aktuelles und Laufendes:
- Umweltkatastrophe [347]
- Treibhauseffekt [348]
- Müllprobleme [349]
- Abfallentsorgung [350]
- Abfallprobleme [351]
Theoretische Fragen:
- Umwelt [53]
Die schlimmste Wirtschaftskrise der Geschichte des Kapitalismus
- 7404 Aufrufe
Die herrschende Klasse ist in Angst und Schrecken versetzt worden. Von August bis Oktober gab es eine richtige Panik in der Weltwirtschaft. Die Aufsehen erregenden Erklärungen von Politikern und Ökonomen verdeutlichen dies: „Die Welt am Rand des Abgrunds". „Ein ökonomisches Pearl Harbour", ein „auf uns zurollender Tsunami", „ein 11. September der Finanzen".[1] Nur der Anspielung auf die Titanic fehlte noch. Die herrschende Klasse ist in Angst und Schrecken versetzt worden. Von August bis Oktober gab es eine richtige Panik in der Weltwirtschaft. Die Aufsehen erregenden Erklärungen von Politikern und Ökonomen verdeutlichen dies: „Die Welt am Rand des Abgrunds". „Ein ökonomisches Pearl Harbour", ein „auf uns zurollender Tsunami", „ein 11. September der Finanzen".[1] Nur die Anspielung auf die Titanic fehlte noch.
Es stimmt, die größten Banken der Welt gerieten eine nach der anderen in Konkurs, die Börse stürzte in den Keller. Seit Januar 2008 wurden 32.000 Milliarden Dollar verbraten, d.h. soviel wie zwei Jahre Gesamtproduktion der USA. Die Börse Islands fiel um 94%, die Moskaus um 71%.
Schließlich ist es den Herrschenden gelungen, mit Hilfe eines „Rettungsplans" und eines „Ankurbelungsplans" nach dem anderen die totale Erstarrung der Wirtschaft zu vermeiden. Heißt dies aber, das Schlimmste sei jetzt hinter uns? Sicher nicht! Die Rezession, die gerade erst angefangen hat, wird wohl die zerstörerischste sein seit der Großen Depression von 1929.
Die Ökonomen gestehen es offen sein: „die gegenwärtige Konjunktur ist seit Jahrzehnten nicht mehr so angeschlagen", meldet die HSBC, „die größte Bank der Welt" am 4. August 2008.[2] « Wir befinden uns in einem ökonomischen und politisch-monetären Umfeld, das noch nie so schwierig war », legte der Präsident der US-FED am 22.8. noch einen drauf.[3]
Die internationale Presse täuschte sich nicht, als sie die gegenwärtige Zeit mit der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre verglich, wie z.B. das Titelblatt von Time ankündigte: „The New Hard Times" (neue harte Zeiten) mit einem Photo von Arbeitern, die 1929 für eine kostenlose Suppe in einer Armenküche anstanden. Tatsächlich sieht man solche Bilder heute immer mehr. Die Wohltätigkeitsorganisationen, die Essen verteilen, sind völlig überfordert, während gleichzeitig die Warteschlagen Hunderttausender neuer Arbeitsloser vor den Arbeitsämtern jeden Tag länger werden.
Am 24. September verkündete der damalige US-Präsident George W. Bush noch : „Wir stecken mitten in einer schweren Finanzkrise (...) Unsere ganze Wirtschaft ist in Gefahr. (...) Schlüsselbereiche des Finanzsystems stehen vor der Gefahr des Zusammenbruchs. (...) Amerika könnte einer Finanzpanik verfallen, und das würde uns in ein eine furchtbare Lage treiben. Weitere Banken würden Pleite machen (...) Die Börse würde noch mehr zusammenbrechen, wodurch Ihre Anlagen noch mehr schrumpfen würden. Der Wert Ihrer Häuser würde sinken, noch mehr Zwangsversteigerungen. (...) Zahlreiche Betriebe müssten schließen, und Millionen Amerikaner würden ihre Stelle verlieren. (...) Schlussendlich würde unser Land in einer langen und schmerzhaften Rezession versinken."
Nun wird die „lange und schmerzhafte Rezession" Wirklichkeit; nicht nur « das amerikanische Volk », sondern die Arbeiter auf der ganzen Welt sind nun betroffen.
Eine brutale Rezession...
Seit der nunmehr berühmt gewordenen 'subprime' Krise vom Sommer 2007 hört man jeden Tag mehr schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft.
Allein das ‚Blutbad' im Bankensektor im Jahre 2008 war beeindruckend. Entweder wurden durch einen Konkurrenten aufgekauft oder durch eine Zentralbank gestützt oder einfach verstaatlicht: Northern Rock (die achtgrößte englische Bank), Bear Stearns (die fünfte Bank an der Wall Street), Freddie Mac und Fannie Mae (zwei Finanzinstitute zur Finanzierung von US-Hypotheken mit einem Geschäftsvolumen von ca. 850 Milliarden Dollar), Merrill Lynch (eine einstige weitere US-Großbank), HBOS (zweitgrößte Bank Schottlands), AIG (American International Group, einer der größten Versicherer der Welt) und Dexia (Finanzinstitut aus Luxemburg, Belgien und Frankreich). Des Weiteren kam es auch zu historischen und Aufsehen erregenden Pleiten. Im Juni wurde Indymac, einer der größten US-Hypothekenfinanzierer unter US-Staatsaufsicht gestellt. Dies war der größte Bankrott im US-Bankenwesen seit 24 Jahren. Aber dieser Rekord hielt nicht lange. Nur wenige Tage später musste die viertgrößte US-Bank, Lehman Brothers, Bankrott anmelden. Die Gesamtsumme ihrer Schulden betrug 613 Milliarden Dollar. Ein weiterer Rekord gebrochen. Bei dem größten Bankenbankrott bis zum damaligen Zeitpunkt war 1984 die Continental Illinois mit 40 Milliarden Dollar Pleite gegangen (d.h. eine 16 mal geringere Summe). Aber nur zwei Wochen später ein neuer Rekord. Die Washington Mutual (WaMu), die größte Sparkasse der USA, meldete ihrerseits Insolvenz an.
Nach dieser Art Infarkt des Herzens des kapitalistischen Systems, dem Bankenwesen, ist jetzt der gesamte Körper in Mitleidenschaft gezogen und geht danieder. „Die reale Wirtschaft" wird nun brutal erfasst. Dem NBER (National Bureau of Economic Research) stecken die USA seit Dezember 2007 offiziell in einer Rezession. Der am meisten anerkannte Ökonom an der Wall Street, Nouriel Roubini, geht gar davon aus, dass eine Schrumpfung der US-Wirtschaft um 5% im Jahre 2009 und erneut um 5% in 2010 wahrscheinlich sei![4] Wir können nicht wissen, ob dies tatsächlich der Fall sein wird, aber die Tatsache, dass einer der berühmtesten Ökonomen der Welt solch ein katastrophales Szenario ins Auge fassen kann, zeigt die wirkliche Besorgnis der Herrschenden. Die OECD erwartet eine Rezession für die gesamte Europäische Union in 2009. Die Deutsche Bank erwartet für Deutschland ein Schrumpfen des BIP um bis zu 4%![5] Um sich ein Bild davon zu machen, wie weitreichend solch eine Rezession sein könnte, muss man wissen, dass das schlimmste Jahr seit dem 2. Weltkrieg bislang 1975 war, als das deutsche BIP „nur" um 0.9% geschrumpft war. Kein Kontinent bleibt ausgespart. Japan steckt schon in der Rezession, und selbst in China, diesem ‚kapitalistischen Wunderland', verlangsamt sich das Wachstum brutal. Die Folge: Die Nachfrage ist dermaßen zusammengebrochen, dass alle Preise, auch die Ölpreise, sinken. Kurzum - der Weltwirtschaft geht es sehr schlecht.
... und eine seit den 1930er Jahren nicht mehr da gewesene Verarmung
Das erste Opfer dieser Krise ist natürlich die Arbeiterklasse. In den USA ist die Verschlechterung der Lebensbedingungen besonders spektakulär. Seit dem Sommer 2007 sind ca. 2.8 Mio. Arbeiter auf der Straße gelandet, weil sie nicht mehr ihre Schulden zurückzahlen können. Dem Verband der Hypothekenbanken MBA zufolge ist heute jeder Zehnte Schuldner in den USA von Zwangsräumung bedroht. Und dieser Trend erfasst nunmehr auch Europa, insbesondere Spanien und Großbritannien.
Auch die Massenentlassungen nehmen zu. In Japan hat Sony einen Plan bislang nie da gewesenen Ausmaßes verkündet: 16.000 Stellen sollen gestrichen werden, darunter 8.000 Beschäftigte der Stammbelegschaft. Dieser japanische Standartenträger hatte zuvor nie Beschäftigten der Stammbelegschaft gekündigt. In Anbetracht der Immobilienkrise leidet die Bauwirtschaft schwer. In Spanien wird bis 2010 mit einer Zunahme der Zahl der Arbeitslosen um 900.000 gerechnet. In den Banken brechen die Arbeitsplätze reihenweise weg. Citigroup, eine der größten Banken der Welt, wird ca. 50.000 Stellen streichen, nachdem die Gruppe seit Anfang 2008 schon 23.000 Stellen gestrichen hatte. 2008 sind alleine 260.000 Jobs im Bankensektor in den USA und in Großbritannien weggefallen. Dabei sollen an einer Stelle im Bankenwesen im Durchschnitt vier weitere Stellen hängen. Der Zusammenbruch der Finanzinstitutionen wird somit Arbeitslosigkeit für Hunderttausende Arbeiterfamilien mit sich bringen. Auch der Automobilsektor ist besonders hart getroffen. Um mehr als 30% sind die Autoverkäufe seit dem letzten Herbst zurückgegangen. Seit Mitte November hat z.B. Renault, der größte Autohersteller Frankreichs, seine Automobilproduktion eingestellt. Kein Auto ist mehr vom Band gelaufen; dabei betrug die Kapazitätsauslastung seit Monaten nur ca. 54%. Toyota wird ca. 3.000 Zeitarbeiter von 6.000 (d.h. 50%) in seinen japanischen Werken entlassen. Aber erneut kommen die besorgniserregendsten Zahlen aus den USA: die berühmten großen Drei aus Detroit (General Motors, Ford und Chrysler) stehen am Rande des Bankrotts. Das erste Rettungspaket des US-Staates von 15 Mrd. Dollar wird ihnen nicht dauerhaft weiterhelfen [6] (die Big Three forderten übrigens mindestens 34 Mrd. Dollar). In den nächsten Monaten ist mit großen Umstrukturierungen zu rechnen. Zwischen 2.3 und 3 Millionen Jobs stehen auf der Abschussliste. Und damit werden die entlassenen Arbeiter nicht nur ihre Arbeit verlieren, sondern auch ihre Krankenversicherung und ihre Rente!
Die unvermeidbare Konsequenz dieses massiven Arbeitsplatzverlustes ist natürlich die explosive Zunahme der Arbeitslosigkeit. In Irland, dem „Wirtschaftsmodell des letzten Jahrzehnts" hat sich die Zahl der Arbeitslosen innerhalb eines Jahres verdoppelt; dies ist der stärkste je registrierte Anstieg. In Spanien gab es Ende 2008 mehr als 3.13 Mio. Arbeitslose, d.h. ca. eine Million mehr als 2007.[7] In den USA wurden 2008 2.6 Mio. Stellen gestrichen - ein Rekord seit 1945.[8] Das Jahresende war besonders verheerend, da allein im November und Dezember mehr als 1.1 Millionen Beschäftigte ihre Stelle verloren. Wenn die Dinge so weitergehen, könnte es noch mehr als 3-4 Millionen zusätzliche Arbeitslose bis zum Sommeranfang 2009 geben.
Und diejenigen, die noch ihren Job behalten haben, werden damit konfrontiert, „viel mehr arbeiten zu müssen, um viel weniger zu verdienen".[9] So berichtete der letzte Bericht des Bureau international du Travail (BIT) in seinem « Bericht über die Löhne auf der Welt 2008/09", „Auf die 1.5 Milliarden Beschäftigten auf der Welt kommen schwierige Zeiten zu", „die Weltwirtschaftskrise wird zu schwerwiegenden und schmerzhaften Lohneinbußen führen".
Natürlich wird es infolge all dieser Angriffe zu einer enormen Zunahme der Verarmung kommen. Von Europa bis zu den USA haben alle karitativen Organisationen in den letzten Monaten mindestens 10% mehr Empfänger von Armensuppen registriert. Diese Welle von Verarmung bedeutet, dass es immer schwieriger sein wird, eine Wohnung zu finden, medizinische Versorgung zu erhalten und sich zu ernähren. Und für die Jugend von heute heißt dies auch, dass der Kapitalismus ihnen keine Zukunft mehr anzubieten hat.
Wie die Bourgeoisie diese Krise erklärt
Die wirtschaftlichen Mechanismen, welche die gegenwärtige Rezession hervorgerufen haben, sind mittlerweile gut bekannt. In Fernsehsendungen wurde immer wieder über die so genannten Hintergründe der Entwicklung berichtet. Vereinfacht gesagt, wurden die Ausgaben der „amerikanischen Haushalte" (m.a. W. die Arbeiterfamilien) künstlich durch alle möglichen Kreditformen aufrechterhalten, insbesondere durch einen Kredit mit tollem Erfolg: risikobehaftete oder „subprime" Immobilienkredite. Die Banken, Finanzinstitute, Pensionsfonds ... sie alle bewilligten Kredite ohne auf die wirkliche Zahlungsfähigkeit dieser Beschäftigten zu achten (daher ‚risikobehaftet'), da man ihnen unbedingt eine Immobilie verkaufen wollte. Im schlimmsten Fall, meinten sie, würden sie entschädigt durch den Verkauf der Häuser, welche die Schuldner ihnen bei Zahlungsunfähigkeit als Pfand hinterlassen müssten. Dies sorgte für einen Schneeballeffekt: Je mehr die Beschäftigten Schulden machten, insbesondere zum Erwerb einer Immobilie, umso mehr stieg der Wert einer Immobilie. Je teurer eine Immobilie wurde, desto mehr konnten die Beschäftigten sich verschulden. Alle Spekulanten auf der Erde haben sich an diesem Treiben beteiligt: Auch sie haben Immobilien erworben, um sie wieder teurer zu verkaufen; und vor allem haben sie sich gegenseitig diese berühmten subprimes mittels Finanztiteln verkauft (d.h. die Umwandlung von Schuldscheinen in Immobilienwerte, die auf dem Weltmarkt wie jede andere Aktie oder Obligation veräußert werden konnte). Innerhalb eines Jahrzehnts ist die Spekulationsblase enorm angewachsen. Alle Finanzinstitute der Welt haben sich an diesen Transaktionen in Milliardenumfang beteiligt. Mit anderen Worten, Haushalte, von denen man wusste, dass sie nicht zahlungsfähig waren, wurde zu Hühnern, die für die Weltwirtschaft goldene Eier legten.
Natürlich hat die ‘wirkliche Wirtschaft' diese Traumwelt auf den harten Boden der Realität zurückgeholt. Im ‚wahren Leben' mussten all diese hoch verschuldeten Beschäftigten auch die Folgen der Preisseigerungen und der Lohnstops, der Entlassungen, der Kürzungen der Arbeitslosengelder usw. erleben. Kurzum, auf der einen Seite kam es zu einer beträchtlichen Verarmung, auf der anderen Seite konnten immer weniger ihre Schulden begleichen. Die Kapitalisten haben daraufhin die zahlungsunfähigen Immobilienbesitzer vor die Tür gesetzt, aber die Zahl der so auf die Verkaufsliste gesetzten Häuser war so groß,[10] dass die Preise purzelten und ...bums... schmolz im Sommer 2007 der größte Schneeball der Welt schnell dahin. Die Banken standen vor Hunderttausenden zahlungsunfähiger Schuldner; der Wertverfall der Häuser war ungeheuerlich. Es kam zum Krach.
All das mag absurd erscheinen. Leuten Geld zu leihen, die nicht dazu in der Lage sind, zurückzuzahlen, richtet sich eigentlich gegen den kapitalistischen ‚Menschenverstand'. Und dennoch hat sich der größte Anteil des Wachstums der Weltwirtschaft während des letzten Jahrzehnts auf solch einen Schwindel gestützt. Die Frage steht im Raum, warum dies geschah? Warum solch ein Wahnsinn? Die Antwort der Journalisten, Politiker, Ökonomen ist einfach und einstimmig: „Die Spekulanten sind schuld". „Die Habsucht der Abzocker", die „unverantwortlichen Banker". Heute stimmen alle in den Chor der traditionellen Beschuldigung der Linken und der extremen Linken hinsichtlich der Auswirkungen der „Deregulierung" und des „Neoliberalismus" (eine Art grenzenloser Liberalismus), und rufen zu einer Rückkehr des Staates auf, was übrigens das wahre Wesen der „antikapitalistischen" Forderungen der Linken und extremen Linken offenbart. So forderte der französische Präsident Sarkozy „der Kapitalismus muss auf ethischen Grundlagen neu gegründet werden". Frau Merkel beschimpfte Spekulanten. Der spanische Premier Zapatero wiederum klagte die „Fundamentalisten des Marktes" an. Und Chavez, der illustre Paladin des « Sozialismus des 21. Jahrhunderts » kommentierte die in Windeseile beschlossenen Verstaatlichungen durch die Bush-Regierung: „Genosse Bush ist dabei, einige Maßnahmen zu ergreifen, die für den Genossen Lenin typisch waren".[11] Alle versichern uns, unsere Hoffnung müsse sich auf einen « anderen Kapitalismus » richten, welcher menschlicher, moralischer sein müsse und ... mehr Staat bedeute. All das sind Lügen! All das, was diese Politiker sagen, ist falsch; angefangen mit ihrer angeblichen Erklärung der Rezession.
Die gegenwärtige wirtschaftliche Katastrophe ist die Folge von 100 Jahren Dekadenz
In Wirklichkeit hat der Staat selbst als allererster diese generalisierte Verschuldung der Haushalte organisiert. Um die Wirtschaftlich künstlich zu stützen, haben die Staaten überall die Kredithähne geöffnet, indem sie die Leitzinsen der Zentralbanken senkten. Indem diese Staatsbanken Kredite zu Niedrigstzinsen, manchmal zu weniger als 1% Zinsen, anboten, wurde massenhaft Geld in Umlauf gebracht. Die weltweite Verschuldung war also das Ergebnis einer freien Entscheidung der Herrschenden und nicht das Ergebnis irgendeiner „Deregulierung". Wie kann man sonst die Erklärung von G.W. Bush nach dem 11. September 2001 verstehen, der damals zu Beginn der Rezession die Beschäftigten dazu aufrief: „Seid gute Patrioten, konsumiert, kauft!" Der amerikanische Präsident lieferte somit der ganzen Finanzwelt eine klare Botschaft: multipliziert die Verbraucherkredite, sonst wird die Wirtschaft zusammenbrechen![12]
Tatsächlich überlebt der Kapitalismus seit Jahrzehnten mit Hilfe des Kredites. Die nachfolgende Grafik (Grafik 1),[13] stellt die Entwicklung der gesamten US-Verschuldung seit 1920 dar (d.h. der Staatsverschuldung, Verschuldung der Unternehmen und Haushalte). Sie ist selbstredend. Um die Wurzel dieses Phänomens zu begreifen und über die vereinfachenden und verfälschenden des „Wahnsinns der Banker, Spekulanten und Unternehmer" zu entblößen, muss man das „große Geheimnis der modernen Gesellschaft, die Mehrwertproduktion",[14] so Marx, gelüftet werden.
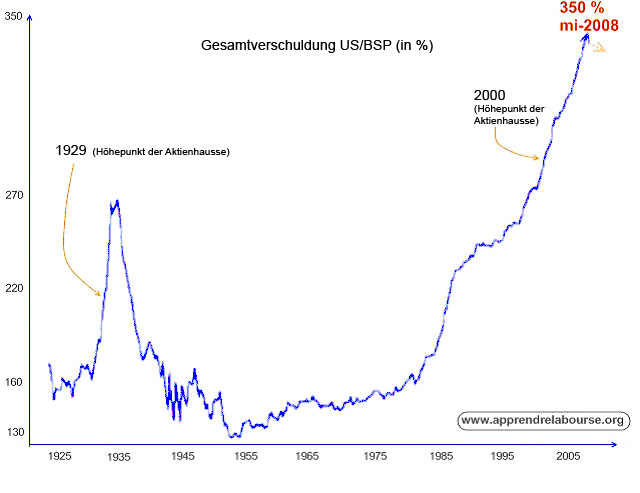 Grafik 1: Entwicklung der US-Gesamverschuldung seit 1920
Grafik 1: Entwicklung der US-Gesamverschuldung seit 1920Der Kapitalismus leidet seit seiner Entstehung an einer angeborenen Krankheit. Er bringt ständig einen Giftstoff hervor, den sein Körper nicht eliminieren kann - die „Überproduktion". Er stellt mehr Waren her als sein Markt aufnehmen kann. Warum? Nehmen wir ein theoretisches Beispiel: ein Fließbandarbeiter oder ein Beschäftigter, der mit einem Computer arbeitet, erhält am Ende des Monats einen Lohn von 800 Euro. Er hat aber nicht für den Wert von 800 Euro produziert (sein Lohn), sondern für den Wert von 1.200 Euro. Er hat unbezahlte Arbeit geleistet, mit anderen Worten einen Mehrwert geschaffen. Was macht der Kapitalist mit den 400 Euro, die er dem Arbeiter gestohlen hat (vorausgesetzt, es gelingt ihm die Waren abzusetzen)? Er steckt davon einen Teil in seine Tasche, nehmen wir an 150 Euro, und die verbleibenden 250 Euro investiert er wiederum in das Kapital seines Unternehmens, meistens indem er neue, modernere Maschinen kauft usw. Aber warum macht der Kapitalist dies? Weil er keine andere Wahl hat. Der Kapitalismus ist ein Konkurrenzsystem. Die Kapitalisten müssen die Waren billiger verkaufen als die Konkurrenten, welche die gleichen Waren anbieten. Deshalb muss der Unternehmer nicht nur seine Herstellungskosten senken, d.h. die Löhne,[15] sondern er muss auch einen wachsenden Teil der unbezahlten Arbeit dazu verwenden, prioritär in leistungsfähigere Maschinen zu investieren, um die Produktivität zu erhöhen.[16] Wenn er dies nicht tut, kann er nicht modernisieren, und früher oder später wird sein Konkurrent günstiger verkaufen und den Markt beherrschen können. Somit wird das kapitalistische System durch ein widersprüchliches Phänomen beherrscht: Indem die Arbeiter nicht für das entlohnt werden, was sie tatsächlich hergestellt haben, und indem die Unternehmer gezwungen werden, darauf zu verzichten, einen größeren Teil des so erzielten Profites zu verbrauchen, stellt das System mehr her als es absetzen kann. Niemals können Arbeiter und Kapitalisten zusammengenommen allein alle hergestellten Waren konsumieren. Wer wird aber den Warenüberschuss verbrauchen? Dazu muss das System zwangsweise neue Märkte außerhalb des Rahmens der kapitalistischen Produktionsweise finden. Diese nennt man außerkapitalistische Märkte (d.h. außerhalb des Kapitalismus, wo nicht nach kapitalistischen Prinzipien produziert wird).
Deshalb trat der Kapitalismus im 18. und 19. Jahrhundert die Eroberung der Welt an. Er musste ständig neue Märkte in Asien, Afrika, Südamerika finden, um dort seine überschüssigen Waren profitabel abzusetzen, wenn er nicht der Gefahr ausgesetzt sein wollte, gelähmt zu werden. Aber dies trat übrigens regelmäßig ein, als es ihm nicht gelang, möglichst schnell neue Märkte zu erobern. Das Kommunistische Manifest von 1848 beschrieb diesen Krisentyp sehr anschaulich und bestechend. „In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre - die Epidemie der Überproduktion. Die Gesellschaft findet sich plötzlich in einen Zustand momentaner Barbarei zurückversetzt; eine Hungersnot, ein allgemeiner Vernichtungskrieg scheinen ihr alle Lebensmittel abgeschnitten zu haben; die Industrie, der Handel scheinen vernichtet, und warum? Weil sie zuviel Zivilisation, zuviel Lebensmittel, zuviel Industrie, zuviel Handel besitzt." [Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, S. 50. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2628 (vgl. MEW Bd. 4, S. 468)]
Weil der Kapitalismus noch in seiner Wachstumsphase steckte, konnte dieser damals jedoch noch neue Territorien erobern; jede Krise mündete danach in eine neue Phase des blühenden Wachstums. „Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen...Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremdenhaß der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen, die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehn wollen; sie zwingt sie, die sogenannte Zivilisation bei sich selbsteinzuführen, d.h. Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde." [Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, S. 47. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2625 (vgl. MEW Bd. 4, S. 466)]
Aber damals schon erkannte Marx in diesen periodischen Krisen etwas mehr als nur einen einfach ewigen Zyklus, der immer wieder zu einer neuen Blütephase führen würde. Er entdeckte viel mehr die tiefgreifenden Widersprüche des Kapitalismus. „...durch die Eroberung neuer Märkte [und] Dadurch, daß sie allseitigere und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, vermindert." [Marx/Engels: Manifest der kommunistischen Partei, S. 50. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2628 (vgl. MEW Bd. 4, S. 468)] Und zu den Krisen meinte Marx in „Lohnarbeit und Kapital": „Sie werden häufiger und heftiger schon deswegen, weil in demselben Maß, worin die Produktenmasse, also das Bedürfnis nach ausgedehnten Märkten wächst, der Weltmarkt immer mehr sich zusammenzieht, immer weniger Märkte zur Exploitation übrigbleiben, da jede vorhergehende Krise einen bisher uneroberten oder vom Handel nur oberflächlich ausgebeuteten Markt dem Welthandel unterworfen hat." [Marx: Lohnarbeit und Kapital, S. 52. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 2739 (vgl. MEW Bd. 6, S. 423)]
Im 18. und 19. Jahrhundert lieferten sich die größten kapitalistischen Mächte einen wahren Wettlauf bei der Eroberung der Welt. Sie teilten schrittweise den Erdball untereinander auf und bildeten richtige Reiche. Von Zeit zu Zeit traten sie sich gegenüber und schielten gemeinsam auf dasselbe Territorium; ein kurzer Krieg wurde ausgelöst, und der Unterlegene begab sich schnell auf die Suche nach einem anderen zu erobernden Teil der Erde. Aber nachdem sich Anfang des 20. Jahrhunderts die Großmächte die Herrschaft über die Welt aufgeteilt hatten, ging es nun nicht mehr darum, in Afrika, Asien oder Amerika auf Jagd nach Kolonien zu gehen, sondern in einen unnachgiebigen Krieg zur Verteidigung ihrer Einflussgebiete einzutreten und sich mit Waffengewalt der Einflussgebiete der imperialistischen Konkurrenten zu bemächtigen. Dabei handelte sich es um einen wahren Überlebenskampf für die kapitalistischen Nationen. Sie mussten unbedingt ihre Überproduktion auf den nicht-kapitalistischen Märkten absetzen. Es war also kein Zufall, dass Deutschland, das über sehr wenig Kolonien verfügte und von der Zustimmung des britischen Reiches zum Handel auf seinen Territorien abhing (für eine nationale Bourgeoisie eine unhaltbare Situation), am aggressivsten vorging und 1914 den Ersten Weltkrieg auslöste. In diesem Krieg kamen mehr als 11 Millionen Menschen um; er rief ungeheure Leiden hervor sowie ein moralisches und psychologisches Trauma für ganze Generationen. Dieser Horror kündigte den Anbruch einer neuen Epoche an, die die barbarischste Epoche in der Geschichte wurde. Der Kapitalismus hatte seinen Höhepunkt überschritten; er trat in seine Niedergangsphase ein. Der Krach von 1929 war ein schlagender Beweis dafür.
Und dennoch, nach mehr als einhundert Jahren langsamer Agonie hält sich das System noch immer aufrecht, schwankend, angeschlagen, aber immer noch aufrecht. Wie konnte es überleben? Warum ist sein Körper noch nicht völlig durch das Gift der Überproduktion gelähmt? Hier kommt der Rückgriff auf die Verschuldung ins Spiel. Der Weltwirtschaft ist es gelungen, einen spektakulären Zusammenbruch zu vermeiden, indem immer massiver auf die Verschuldung zurückgegriffen wurde.
Wie die Grafik 1 zeigt, nahm die US-Gesamtverschuldung seit Anfang des 20. Jahrhunderts enorm zu, um förmlich in den 1920er Jahren zu explodieren. Die Haushalte, Unternehmen und Banken erstickten geradezu unter dem Gewicht der Schulden. Und der rapide Rückgang der Verschuldungskurve in den 1930er und 1940er Jahren war in Wirklichkeit irreführend. Die große Depression der 1930er Jahre stellte die erste große Wirtschaftskrise in der Dekadenz dar. Die herrschende Klasse war damals noch nicht auf solchen Schock vorbereitet. Zunächst reagierte sie nicht oder schlecht. Indem die Grenzen dicht gemacht wurden (Protektionismus), wurde die Überproduktion nur noch verschärft. Das Gift wirkte verheerend. Zwischen 1929-1933 sank die US-amerikanische Industrieproduktion um die Hälfte;[17] 13 Millionen Arbeitslose wurden registriert. Zwei Millionen Amerikaner waren obdachlos, eine gewaltige Verarmung breitete sich aus.[18] Anfangs eilte die herrschende Klasse dem Finanzsektor nicht zu Hilfe: von den 29.000 Banken, die 1921 gezählt worden waren, blieben Ende März 1933 nur 12.000 übrig. Und dieses ‚Bankengemetzel' ging noch bis 1939 weiter.[19] All diese Bankrotte bedeuteten einfach das Verschwinden eines gigantischen Schuldenberges.[20] Aber in der Grafik erscheint nicht das Wachstum der öffentlichen Verschuldung. Nach vier Jahren des Abwartens ergriff der US-amerikanische Staat schließlich Maßnahmen: Roosevelts New Deal wurde beschlossen. Aber woraus bestand dieser Plan, von dem man heute so viel spricht? Es handelt sich um eine Politik der Großprojekte, die sich auf eine massive und nie da gewesene Verschuldung des Staates stützte (1929 betrug die öffentliche Verschuldung 17 Milliarden Dollar, 1939 erreichte sie 40 Milliarden Dollar).[21]
Später hat die bürgerliche Klasse die Lehren aus diesem gescheiterten Erlebnis gezogen. Am Ende des 2. Weltkriegs schuft sie auf internationale Ebene Währungs- und Finanzinstanzen (mit Hilfe des Bretton Wood Abkommens), und vor allem erfolgte nunmehr systematisch der Rückgriff auf Kredite. Nachdem ein Tiefstand 1953-54 erreicht wurde und trotz der kurzen Beruhigung in den 1950er und 1960er Jahren,[22] nahm die US-Gesamtverschuldung langsam aber unwiderruflich von Mitte der 1950er Jahre an zu. Und als die Krise 1967 wieder ausbrach, wartete die herrschende Klasse dieses mal keine vier Jahre um zu reagieren. Sie griff sofort wieder zu Krediten. Die letzten 40 Jahre können in der Tat zusammengefasst werden als eine einzige Abfolge von Krisen und eine unglaubliche Steigerung des weltweiten Schuldenbergs. In den USA gab es offiziell in den Jahren 1969, 1973, 1980, 1981, 1990 und 2001 eine Rezession.[23] Der von der bürgerlichen Klasse in den USA eingeschlagene Weg zur Überwindung dieser Schwierigkeiten wird anhand der Grafik ersichtlich: Die Verschuldung stieg stark ab 1973 und erhöhte sich über alle Maßen in den 1990er Jahren. Die ganze bürgerliche Klasse hat überall auf der Welt so reagiert.
Aber die Verschuldung ist keine magische Lösung. Die 2. Statistik [24] zeigt, dass seit 1966 die Verschuldung immer weniger wirksam ist, um das Wachstum anzukurbeln.[25] Es handelt sich hier um einen Teufelskreis. Die Kapitalisten produzieren mehr Waren als der Markt normalerweise aufsaugen kann. Dann schafft der Kredit einen künstlichen Markt. Die Kapitalisten verkaufen somit ihre Waren und investieren ihren Profit in der Produktion .... Womit wir wieder beim Ausgangspunkt sind, denn neue Kredite werden benötigt, um die neuen Waren zu verkaufen. Nicht nur häufen sich jeweils die Schuldenberge, sondern bei jedem neuen Zyklus müssen die Schuldenberge weit höher sein, um die gleiche Wachstumsrate zu erhalten (da die Produktion erweitert werden muss). Zudem wird ein immer größerer Teil der Kredite nie dem Produktionsprozess zugeführt, sondern er verschwindet alsbald in dem Abgrund der Defizite. Überschuldete Haushalte nehmen oft neue Kredite auf, um ihre Altschulden zu begleichen. Die Staaten, Unternehmen und Banken funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Schließlich haben während der letzten 20 Jahre, als die ‚reelle Wirtschaft' ständig in der Krise steckte, große, wachsende Mengen von Geld, das in dieser Form geschaffen wurde, nur die Spekulationsblasen mit angefacht (Internet, Telekom, Immobilienblase usw.).[26] Es war in der Tat rentabler und schließlich weniger risikoreich an der Börse zu spekulieren als in die Produktion von Waren zu investieren, die auf große Absatzschwierigkeiten stoßen. Heute gibt es 50 mal mehr Geld im Umlauf an den Börsen als in der Produktion.[27]
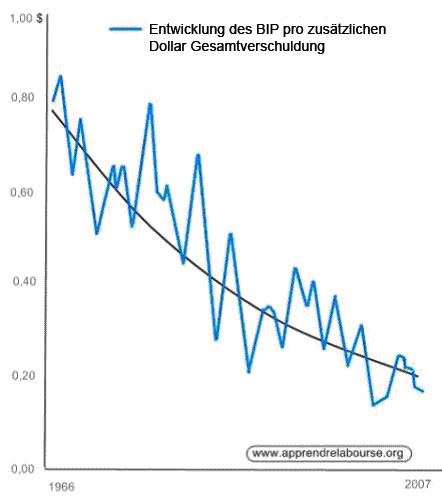 Grafik 2: Immer schwächere Wirkungen der zusätzlichen Verschuldung auf das BIP
Grafik 2: Immer schwächere Wirkungen der zusätzlichen Verschuldung auf das BIPAber diese Flucht nach vorn in die Verschuldung ist nicht nur immer weniger wirksam, sie verschärft vor allem unausweichlich und systematisch die verheerende Wirtschaftskrise. Das Kapital kann nicht endlos lange Geld aus seinem Hut zaubern. Das ABC der Wirtschaft besagt, dass jede Schuld eines Tages zurückgezahlt werden muss, weil sonst für den Gläubiger große Schwierigkeiten entstehen können, die bis hin zum Bankrott reichen. Wir kommen also gewissermaßen zum Ausgangspunkt zurück. Eigentlich hat das Kapital gegenüber seiner historischen Krise nur Zeit gewonnen. Schlimmer noch. Indem so die Auswirkungen der Krise auf morgen verschoben werden, werden dadurch nur noch heftigere wirtschaftliche Erschütterungen vorbereitet. Und genau das passiert im Kapitalismus heute!
Kann der Staat die kapitalistische Wirtschaft retten?
Wenn ein Einzelner Pleite geht, verliert er alles und fliegt auf die Straße. Ein Unternehmer muss Konkurs anmelden. Aber ein Staat? Kann ein Staat bankrott gehen? Bislang haben wir noch nie gesehen, dass ein Staat « Konkurs anmeldet ». Aber das stimmt nicht genau. Zahlungsunfähig werden, ja das kann er!
1982 mussten 14 hochverschuldete afrikanische Staaten offiziell Zahlungsunfähigkeit anmelden. In den 1990er Jahren wurden südamerikanische Staaten und Russland zahlungsunfähig. Und neulich ist Argentinien 2001 unter dem Schuldenberg zusammengebrochen. Konkret haben diese Staaten nicht zu existieren aufgehört, und die jeweilige Volkswirtschaft ist nicht zum Stillstand gekommen. Aber jedes Mal ist eine Art ökonomisches Beben eingetreten: Der Wert der Landeswährung ist gesunken, die Geldgeber (in der Regel andere Staaten) haben alles oder einen Teil ihrer Investitionen verloren, und vor allem hat der Staat seine Ausgaben drastisch gekürzt, indem ein Großteil seiner Beamten entlassen wurde und eine Zeitlang den verbliebenen Beschäftigen kein Gehalt gezahlt wurde.
Heute steht eine Vielzahl von Ländern am Rand des Abgrundes: Ecuador, Island, Ukraine, Serbien, Estland... Aber wie steht es um die Großmächte? Der Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, erklärte Ende Dezember, sein Bundesstaat müsse den „finanziellen Notstand" ausrufen. Der reichste US-Bundessstaat, der „Golden State", schickt sich an, einen großen Teil seiner 235.000 Beschäftigten (die Verbleibenden müssen ab dem 1. Februar 2009 pro Monat zwei Tage unbezahlten ‚Urlaub' nehmen) zu entlassen! Bei der Vorstellung des neuen Jahreshaushaltes warnte der ehemalige Hollywood-Star, „jeder müsse Zugeständnisse machen". Dies ist ein klares Symbol der tiefgreifenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der ersten Weltmacht. Wir sind noch weit von einer Zahlungsunfähigkeit des US-Staates entfernt, aber das Beispiel zeigt deutlich, dass die finanziellen Spielräume gegenwärtig bei allen Großmächten sehr eng geworden sind. Die weltweite Verschuldung scheint an ihre Grenzen zu stoßen (sie betrug 2007 60.000 Milliarden Dollar und ist seitdem um mehrere Tausende Milliarden Dollar weiter angewachsen). Weil sie gezwungen ist, diesen Weg weiter zu beschreiten, wird die bürgerliche Klasse nur noch weitere verheerende wirtschaftliche Erschütterungen verursachen. Die amerikanische FED hat zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahre 1913 ihre Leitzinsen für das Jahr 2009 auf 0.25% gesenkt. Der amerikanische Staat verleiht also nahezu kostenlos Geld (und dies geschieht eigentlich sogar mit Verlust, wenn man die Inflation mit berücksichtigt). Alle Ökonomen der Welt rufen nach einem „neuen New Deal". Sie träumen davon, in Obama einen neuen Roosevelt zu sehen, der dazu in der Lage wäre, die Wirtschaft wie 1933 durch einen gewaltigen Plan öffentlicher Arbeiten, die durch ... Schulden finanziert wurden, wieder anzukurbeln.[28] Aber die Herrschenden haben seit 1967 regelmäßig die Staatsverschuldung in einem noch viel größeren Umfang als zur Zeit des New Deal erhöht, bislang jedoch ohne wirklichen Erfolg. Das Problem ist, dass solch eine Politik der Flucht nach vorn den Zusammenbruch des Dollars herbeiführen kann. Immer mehr Länder zweifeln mittlerweile die Fähigkeit der USA an, ihre Schulden zurückzuzahlen und sie sind deshalb geneigt, ihre Investitionen zurückzuziehen. Das trifft z.B. auf China zu, das Ende 2008 in diplomatischer Sprache Uncle Sam drohte, die Unterstützung der US-Wirtschaft durch den Kauf von Staatsanleihen einzustellen: „Jeder Fehler hinsichtlich der Tragweite der Krise wird sowohl für die Gläubiger als auch für die Schuldner Schwierigkeiten verursachen. Der scheinbar wachsende Appetit des Landes für US-amerikanische Staatsanleihen bedeutet nicht, dass diese langfristig eine rentable Investitionen bleiben werden oder dass die amerikanische Regierung weiterhin von ausländischem Kapital abhängig sein wird." So droht also China dem amerikanischen Staat, die seit Jahren betriebene Unterstützung der US-Wirtschaft einzustellen. Wenn China seine Drohung wahr machen würde,[29] würde das daraus entstehende internationale währungspolitische Chaos apokalyptische Ausmaße annehmen und die Auswirkungen für die Arbeiterklasse wären gewaltig. Aber nicht nur das Reich der Mitte hat angefangen, Zweifel zu äußern. Am Mittwoch, den 10. Dezember 2008, hatte der US-Staat zum ersten Mal in der Geschichte große Schwierigkeiten, für eine Staatsanleihe von 28 Milliarden Dollar Käufer zu finden. Und weil bei allen Großmächten die Kassen leer sind, und sich überall die Rechnungen für die riesigen Schuldenberge anhäufen und die Wirtschaft sich in einem schlechteren Zustand befindet, musste der deutsche Staat am gleichen Tag das gleiche erleben: Auch er hatte zum ersten Mal seit den 1920er Jahren Schwierigkeiten Käufer für seine Staatsanleihen im Umfang von 7 Milliarden Euro zu finden.
Offensichtlich ist die Verschuldung, ob die der Privathaushalte, der Unternehmen oder der Staaten, nur ein ‚Schmerzmittel'. Sie kann die Krankheit des Kapitalismus - die Überproduktion - nicht heilen. Dadurch kann allerhöchstens nur vorübergehend eine Erleichterung verschafft werden, aber gleichzeitig werden dadurch nur noch größere Beben vorbereitet. Und dennoch muss die herrschende Klasse diese verzweifelte Politik fortführen, denn sie hat keine andere Wahl, wie die Erklärung Angela Merkels am 8. November 2008 auf der Internationalen Konferenz in Paris belegt: „Es gibt keine andere Möglichkeit des Kampfes gegen die Krise als die Anhäufung von Schuldenbergen", oder auch die Wortmeldung des Chefökonomen des IWF, Olivier Blanchard: „Wir stehen vor einer Krise mit einem außergewöhnlichen Ausmaß, deren Hauptcharakteristik ein Zusammenbruch der Nachfrage ist (...) Wir müssen unbedingt die private Nachfrage wieder ankurbeln, wenn wir vermeiden wollen, dass die Rezession in eine große Depression mündet. Wie? - Durch die Erhöhung der öffentlichen Ausgaben".
Aber abgesehen von den Konjunkturprogrammen kann der Staat nicht wenigsten DER Retter sein, indem er einen Großteil der Wirtschaft verstaatlicht, insbesondere die Banken und die Automobilbranche? Nein, auch das wirkt nicht! Im Gegensatz zu den traditionellen Lügen der Linken und der Extremen Linken brachten die Verstaatlichungen nie eine Verbesserung für die Arbeiterklasse. Nach dem 2. Weltkrieg diente die große Verstaatlichungswelle dazu, einen zerstörten Produktionsapparat wieder auf die Beine zu stellen, indem der Arbeitsrhythmus intensiviert wurde. Wir dürfen nicht vergessen, was damals Thorez, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Frankreichs und damals Vizepräsident der von De Gaulle geführten Regierung war, insbesondere an die Adresse der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sagte: „Wenn ein Arbeiter bei der Arbeit stirbt, müssen die Frauen ihn ersetzen", oder „Krempelt die Ärmel auf für den nationalen Wiederaufbau" oder „Streiks sind die Waffen der Trusts". Willkommen in der wunderbaren Welt der verstaatlichten Betriebe. Das verwundert alles nicht. Die revolutionären Kommunisten haben immer seit der Gründung der Pariser Kommune 1871 die arbeiterfeindliche Rolle des Staates aufgezeigt: „Der moderne Staat, was auch seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der Ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben."[Engels: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, S. 506. Digitale Bibliothek Band 11: Marx/Engels, S. 8142 (vgl. MEW Bd. 20, S. 260)] [30]
Die neue Welle von Verstaatlichungen wird also der Arbeiterklasse nichts Gutes bringen. Und sie wird es den Herrschenden auch nicht ermöglichen, ein dauerhaftes Wachstum anzustoßen. Im Gegenteil! Diese Verstaatlichungen kündigen noch gewalttätigere wirtschaftliche Stürme an. 1929 haben die pleite gegangenen US-Banken die Guthaben eines Großteils der US-Bevölkerung mit vernichtet und damit Millionen Arbeiter in die Armut gestürzt. Um die Wiederholung solch eines Debakels zu verhindern, war das Bankensystem in zwei Teile aufgeteilt worden: einerseits die Geschäftsbanken, die Unternehmen finanzieren und in allen möglichen Finanzbereichen tätig sind; anderseits Gläubigerbanken, die das Geld von den Einlegern bekommen und es für relativ sichere Anlagen benutzen. Aber von der Pleitewelle im Jahre 2008 weggespült, gibt es nun diese amerikanischen Geschäftsbanken nicht mehr. Das amerikanische Finanzsystem befindet sich jetzt wieder in dem gleichen Zustand wie vor dem 24. Oktober 1929. Beim nächsten Sturm laufen alle bislang dank der völligen oder teilweisen Verstaatlichung „geretteten" Banken ihrerseits Gefahr zu verschwinden, aber dabei werden sie die knappen Ersparnisse und die Löhne von zahlreichen Arbeiterfamilien mit zerstören. Wenn die Herrschenden heute Verstaatlichungen vornehmen, wollen sie damit nicht irgendein Konjunkturprogramm anleiern, sondern es geht darum, die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit der großen Finanzhäuser oder Industriekonzerne zu vermeiden. Es geht darum, das Schlimmste zu vermeiden.[31]
Der in den letzten vier Jahrzehnten angehäufte Schuldenberg ist zu einem wahren Mount Everest geworden, und niemand kann heute den Bergrutsch verhindern. Der Zustand der Wirtschaft ist wirklich katastrophal. Aber man darf deshalb nicht glauben, dass der Kapitalismus durch einen Schlag verschwinden wird. Die Bürgerlichen werden IHRE Welt nicht untergehen lassen ohne zu reagieren. Sie werden verzweifelt und mit allen Mitteln versuchen, die Agonie ihres Systems zu verlängern, ohne dabei auf die furchtbaren Konsequenzen, die sich dabei für die Menschheit ergeben, zu achten. Ihre wahnsinnige Flucht nach vorne in noch mehr Verschuldung wird weitergehen. Selbst wenn es in Zukunft hier und da kurze Augenblicke von Wachstum geben wird, steht fest, dass die historische Krise des Kapitalismus jetzt ihren Rhythmus geändert hat. Nach 40 Jahren langsamen Abstiegs in die Hölle, stehen wir jetzt vor gewalttätigen Erschütterungen, mit immer wieder auftretenden ökonomischen Beben, die nicht nur die Staaten der Dritten Welt sondern auch die USA, Europa, Asien erfassen werden.[32]
Die Devise der Kommunistischen Internationale 1919 « Damit die Menschheit überleben kann, muss der Kapitalismus überwunden werden/sterben » ist mehr denn je aktuell.
Mehdi, 10.01.2009
[1] Jeweils : Paul Krugman (letzter Nobelpreis für Wirtschaft), Warren Buffet (US-Investor, genannt das ‘Orakel von Omaha', so stark wird die Meinung des Milliardärs der kleinen US-Stadt in Nebraska in der Finanzwelt geachtet), Jacques Attali (Ökonom und Berater von Mitterrand und Sarkozy) und Laurence Parisot (Präsidentin des französischen Unternehmerverbandes).
[2] Libération, 4.08.08
[3] Le Monde, 22.08.08.
[4] Quelle : www.contreinfo.info [353]
[5] Les Echos, 05.12.08
[6] Dieses Geld wurde in den Kassen des Paulson Plans gefunden, welcher schon nicht für den Bankensektor ausreicht. Die herrschende Klasse in den USA muss „Paul ausziehen, um Jack anzuziehen", was ein entsprechendes Licht auf den desaströsen Zustand der Finanzen der ersten Macht der Erde wirft.
[7] Les Echos, 08.01.09
[8] nach dem Bericht, der am 9.01.09 vom US-Arbeitsministerium veröffentlicht wurde (Les Echos, 09.01.09)
[9] In Frankreich hatte Präsident Nicolas Sarkozy gar 2007 eine Kampagne 2007 mit dem Hauptslogan „Mehr arbeiten, um mehr zu verdienen" (sic !) betrieben.
[10] 2007 waren mehr als drei Millionen US-Haushalte zahlungsunfähig (in Subprime Mortgage Foreclosures by the Numbers). www.americanprogress.org/issues/2007/03/foreclosures_numbers.html [354].
[11] In diesem Fall stimmen wir mit Chavez überein. Bush ist in der Tat sein Genosse. Auch wenn sie sich bei dem Kampf zwischen zwei imperialistischen Nationen gegenüberstehen, sind sie dennoch Kampfgefährten bei der Verteidigung des Kapitalismus und der Privilegien ihrer Klasse ... die Bourgeoisie.
[12] Heute wird Alan Greenspan, der ehemalige Präsident der FED und der Orchesterchef dieser Schuldenwirtschaft wird heute von allen Ökonomen und anderen Doktoren der Ökonomie gelyncht. All diese Leute haben ein kurzes Gedächtnis, sie vergessen, dass sie ihn vor kurzem noch in den Himmel lobten. Er wurde gar als der « Finanzguru » gepriesen.
[13] Quelle : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
[14] Le Capital, Livre 1, p725, La Pléiade.
[15] oder anders gesagt das variable Kapital
[16] das fixe Kapital.
[17] A. Kaspi, Franklin Roosevelt, Paris, Fayard, 1988, p.20
[18] Diese Zahlen sind umso wichtiger, da die US-Bevölkerung damals nur 120 Mio. betrug. Quelle : Lester V. Chandler, America's Greatest Depression 1929-1941, New York, Harper and Row, 1970, p.24. et sq.
[19] Gemäß Frédéric Valloire, in Valeurs Actuelles 15.02.2008.
[20] Der Vollständigkeit halber soll ergänz werden, dass dieser Rückgang der Gesamtschuld auch durch einen komplexen ökonomischen Mechanismus erklärt wird: die Geldschöpfung. Der New Deal wurde nicht ganz durch Schulden finanziert, sondern auch durch reine Geldschöpfung. So wurde am 12. Mai 1933 der US-Präsident dazu ermächtigt, die Schulden der Zentralbank um 3 Milliarden Dollar zu erhöhen und Geldnoten im Umfang von 3 Milliarden $ ohne Gegenwert zu drucken Am 22. Oktober desselben Jahres wurde der Dollar gegenüber dem Gold um 50% abgewertet. All dies erklärt die relative Beschränkung der Verschuldungsquoten.
[21] Quelle : www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt_histo3.htm [355]
[22] Von 1950 bis 1967 durchlief der Kapitalismus eine Wachstumsphase, die « 30 glorreiche Jahre » oder « goldene Jahre » genannt wurden. Das Ziel dieses Artikels besteht nicht darin, die Ursachen dieses kurzen Zeitraums innerhalb der wirtschaftlichen Flaute des 20. Jahrhunderts zu untersuchen. In der IKS findet gegenwärtig eine Debatte statt, um besser den Hintergrund dieses kurzen Zeitraums zu begreifen. Wir haben angefangen, diese Debatte in unserer Presse zu veröffentlichen (siehe dazu « Interne Debatte der IKS : Die Ursachen der Blütephase nach dem 2. Weltkrieg", Internationale Revue Nr. 42). Wir ermuntern alle unsere Leser/Innen sich an diesen Debatten in unseren Veranstaltungen oder auch per Post oder per E-mail zu beteiligen
[23] Quelle : www.nber.org/research/business-cycle-dating [356].
[24] Quelle : eco.rue89.com/explicateur/2008/10/09/lendettement-peut-il-financer-leconomie-americaine
[25] 1996 schuft ein Dollar zusätzlicher Verschuldung 0.80 Dollar zusätzlichen Reichtum, während 2007 ein Dollar zusätzlicher Verschuldung lediglich 0.20 Dollar BIP schuf.
[26] Aktiva und Immobilien werden im BIP nicht aufgeführt.
[27] Im Gegensatz zu all dem, was uns Journalisten, Ökonomen und andere Lügenverbreiter sagen, ist dieser „spekulative Wahnsinn" doch das Ergebnis der Krise und nicht umgekehrt.
[28] Nach Beendigung dieses Artikels hat Obama seinen lang erwarteten Ankurbelungsplan vorgestellt, der selbst den Ökonomen zufolge « ziemlich enttäuschend » ist. 775 Milliarden Dollar werden locker gemacht, um den US-Haushalten 1000 Dollar zusätzliche Kaufkraft « zur Anregung des Konsums » zur Verfügung zu stellen (in diesen Genuss werden 75% der Haushalte kommen). Gleichzeitig soll ein Programm öffentlicher Ausgaben im Bereich Energie, Infrastruktur und Bildung erfolgen. Dieser Plan sollte Obama zufolge drei Millionen Arbeitsplätze « in den nächsten Jahren » schaffen. Gegenwärtig verlieren monatlich ca. 500.000 Beschäftigte ihren Job ; dieser neue New Deal (selbst wenn er die erhoffte Wirkung zeigen würde, was wenig wahrscheinlich ist) wird also bei weitem nicht reichen.
[29] Diese Bedrohung zeigt gleichzeitig die Sackgasse und die Widersprüche, in welcher die US-Wirtschaft steckt. Wenn China massiv Dollars verkaufen würde, hieße dies, sich den Ast abzusägen, auf dem es selbst sitzt, da die USA Hauptabsatzmarkt seiner Waren sind. Deshalb hat China bislang meist die US-Wirtschaft unterstützt. Aber gleichzeitig weiß China, dass dieser Ast morsch, von Würmern zerfressen ist, und es will dann nicht mehr auf dem Ast sitzen, wenn er abbricht.
[30] In « Anti-Dühring », Ed.Sociales 1963, p.318.
[31] Damit schafft er aber einen günstigeren Boden für die Entwicklung der Kämpfe. Indem der Staat wieder ihr offizieller Arbeitgeber werden wird, werden die Beschäftigten bei ihren Kämpfen alle direkt dem Staat gegenüberstehen. In den 1980er Jahren hatte die große Privatisierungswelle (z.B. unter Thatcher in England) eine zusätzliche Schwierigkeit im Klassenkampf bedeutet. Nicht nur wurden die Arbeiter durch die Gewerkschaften dazu aufgerufen, um die Betriebe des öffentlichen Dienstes zu retten, oder um anders gesagt, eher durch einen Arbeitgeber (den Staat) als durch einen anderen (privaten) ausgebeutet zu werden. So standen sie nicht mehr lediglich dem gleichen Arbeitgeber (dem Staat), sondern eine Reihe verschiedener privater Arbeitgeber gegenüber. Ihre Kämpfe wurden dadurch oft zerstreut und somit machtlos. In der Zukunft werden dagegen günstigere Bedingungen für einen einheitlichen Kampf gegen den Staat vorhanden sein.
[32] Die Wirtschaft ist sozusagen ein „besonders stark vermintes Gelände", deshalb ist es schwierig vorherzusagen, welche Mine als nächstes hochgehen wird. Aber in den Publikationen der Wirtschaftswissenschaftlicher taucht immer mehr ein Name auf, der den Experten Angst macht: die CDS. Ein CDS (credit default swap) ist eine Art Versicherung, mit Hilfe dessen ein Finanzinstitut sich gegen Zahlungsausfälle durch die Zahlung einer Prämie versichert. Der Gesamtumfang der CDS wurde für das Jahr 2008 auf 60 000 Milliarden Dollars hochgerechnet. D.h. wenn eine Krise der CDS ähnlich verlaufen würde wie die Krise der subprimes wäre dies unglaublich verheerend. Damit würden die ganzen amerikanischen Rentenfonds und damit die Renten der US-Arbeitnehmer überhaupt dahinschmelzen.
Politische Strömungen und Verweise:
- Antiglobalisierung [357]
Theoretische Fragen:
- Politische Ökonomie [45]
Griechenland: Der Aufstand der Jugend in Griechenland bestätigt die Entwicklung des Klassenkampfs
- 3964 Aufrufe
Der Ausbruch der Wut und der Revolte der jungen Arbeitergenerationen in Griechenland ist kein isoliertes oder besonderes Phänomen. Ihre Wurzeln liegen in der Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus. Der Zusammenstoß der Protestierenden mit dem gewalttätigen Unterdrückungsapparat entblößt das wahre Gesicht der bürgerlichen Herrschaft und des Staatsterrors. Es ist eine direkte Fortsetzung der Mobilisierung der Jugendlichen auf einem Klassenterrain wie in Frankreich im Zusammenhang mit dem CPE-Gesetz im Frühjahr 2006 und dem LRU 2007, als die Studenten und Gymnasiasten sich vor allem als zukünftige Beschäftigte sahen, die gegen ihre künftigen Ausbeutungsbedingungen protestierten. Alle Herrschenden der wichtigsten europäischen Länder haben dies auch so verstanden, denn sie haben ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ähnliche soziale Explosionen aus Widerstand gegen die Zuspitzung der Krise auch woanders ausbrechen. So hat bezeichnenderweise die herrschende Klasse in Frankreich einen Rückzieher gemacht, indem sie ganz überstürzt ihr Programm zur Reformierung der Gymnasien (siehe dazu den Artikel auf unserer französischsprachigen Website) vorläufig auf Eis gelegt hat. Der internationale Charakter der Proteste und die wachsende Kampfbereitschaft der Studenten und vor allem der Schüler ist schon deutlich zu spüren.
In Italien fanden am 25. Oktober und am 14. November massive Demonstrationen unter dem Motto „Wir wollen nicht für die Krise blechen" gegen die Regierungsverordnung von Gelmini statt, die zahlreiche Einschnitte im Erziehungswesen mit drastischen Konsequenzen anstrebt: So sollen zum Beispiel die Zeitverträge von 87.000 Lehrern und 45.000 anderen Beschäftigten des Erziehungswesens nicht verlängert werden. Gleichzeitig sollen umfangreiche Kürzungen in den Universitäten vorgenommen werden.
In Deutschland sind am 12. November ca. 120.000 Schüler in den meisten Großstädten des Landes auf die Straße gegangen und haben zum Teil Parolen gerufen wie „Der Kapitalismus ist die Krise" (Berlin) oder das Landesparlament in Hannover belagert.
In Spanien sind am 13. November Hunderttausende Studenten in mehr als 70 Städten auf die Straße gegangen, um gegen die neuen, europaweit gültigen Bologna-Bestimmungen der Bildungsreform und der Universitäten zu protestieren, in denen u.a. die Privatisierung der Universitäten und immer mehr Praktika in den Unternehmen vorgesehen sind.
Die Revolte der Jugend gegen die Krise und die Verschlechterung der Lebensbedingungen breitete sich auf andere Länder aus: alleine im Januar 2009 brachen Bewegungen und Konfrontationen in Vilnius (Litauen), Riga (Lettland) und Sofia (Bulgarien) aus. Sie wurden mit einer harten Polizeirepression konfrontiert. In Kegoudou, 700 Kilometer südöstlich von Dakar in Senegal, ereigneten sich im Dezember 2008 gewalttätige Konfrontationen während Demonstrationen gegen die Armut. Die Demonstranten hatten mehr Lohn bei der Arbeit in den Minen von ArcelorMittal gefordert. 2 Personen wurden dabei getötet. Schon Anfangs Mai 2008 gab es einen Aufstand von 4000 Studenten in Marrakesch (Marokko), nachdem 22 von ihnen durch das Essen in der Universitätskantine eine Vergiftung erlitten hatten. Die Bewegung wurde brutal niedergeknüppelt und es folgten Festnahmen, lange Gefängnisstrafen und Folter.
Viele von ihnen identifizieren sich mit dem Kampf der griechischen Studenten. In vielen Ländern sind zahlreiche Kundgebungen und Solidaritätsveranstaltungen gegen die Repression, unter der die griechischen Studenten leiden, organisiert worden, wobei die Polizei auch sehr oft gewaltsam dagegen vorgegangen ist.
Das Ausmaß der Mobilisierung gegen diese gleichen, staatlichen Maßnahmen überrascht keineswegs. Die europaweite Reform des Bildungswesens dient der Anpassung der jungen Arbeitergeneration an eine perspektivlose Zukunft und die Generalisierung prekärer Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitslosigkeit.
Der Widerstand und die Revolte der neuen Generationen von Schülern, die die zukünftigen Beschäftigten stellen werden, gegen die Arbeitslosigkeit und dieses ganze Ausmaß an Prekarisierung lässt überall ein Gefühl der Sympathie unter den ArbeiterInnen aufkommen, das bei allen Generationen zu spüren ist.
Gewalt durch Minderheiten oder massiver Kampf gegen die Ausbeutung und den Staatsterror?
Die in den Diensten der Lügenpropaganda des Kapitals stehenden Medien haben permanent versucht, die Wirklichkeit der Ereignisse in Griechenland seit der Ermordung des 15jährigen Alexis Andreas Grigoropoulos am 6. Dezember zu verzerren. Sie stellen die Zusammenstöße mit der Polizei entweder als das Werk einer Handvoll autonomer Anarchisten und linksextremer Studenten aus einem wohlbetuchten Milieu dar oder als das Vorgehen von Schlägern aus Randgruppen. Ständig werden in den Medien Bilder von gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei gesendet. Vor allem erscheinen Bilder von Jugendlichen, die Autos anstecken, Schaufenster von Geschäften und Banken zerschlagen, oder Bilder von Plünderungen von Geschäften.
Das ist die gleiche Fälschungsmethode, die 2006 gegen die Proteste gegen den CPE in Frankreich angewandt wurde, als die Proteste der Studenten mit den Aufständen in den Vorstädten von Paris im Herbst 2005 in den gleichen Topf geworfen wurden. Es ist das gleiche Vorgehen wie bei den Protesten gegen den LRU 2007 in Frankreich, als die Demonstranten als „Terroristen" oder „Rote Khmer" beschimpft wurden.
Aber auch wenn das Zentrum der Zusammenstöße im griechischen „Quartier Latin", in Exarchia, lag, kann man heute solche Lügen nur viel schwerer verbreiten. Wie könnten diese aufständischen Erhebungen das Werk von Randalierern oder anarchistischen Aktivisten sein, da sie sich doch lawinenartig auf alle Städte das Landes und selbst bis auf die Inseln (Chios, Samos) und bis in die großen Touristenhochburgen wie Korfu oder Kreta oder Heraklion ausgedehnt haben?
Die Gründe für die Wut
Alle Ingredienzien waren vorhanden, damit die Unzufriedenheit eines Großteils der jungen Arbeitergeneration sich ein Ventil sucht. Diese Generation hat Angst vor der Zukunft, die ihnen der Kapitalismus bietet. Griechenland verdeut-licht die Sackgasse, in welcher der Kapitalismus steckt und die auf alle Jugendlichen zukommen wird. Wenn diejenigen, die die „Generation der 600 Euro-Jobber" genannt werden
, auf dem Arbeitsmarkt auftauchen, haben sie den Eindruck, verarscht zu werden. Die meisten Studenten können ihr Studium nur finanzieren und überleben, indem sie in zwei Jobs schuften. Sie müssen kleine Jobs, meist unterbezahlte Schwarzarbeit, annehmen. Selbst in besser bezahlten Jobs wird ein Großteil des Lohns nicht versteuert, wodurch der Anspruch auf Sozialleistungen geschmälert wird. Insbesondere gelangen sie nicht in den Genuss der Sozialversicherung. Überstunden werden ebensowenig bezahlt. Oft können sie bis Mitte 30 nicht von zu Hause ausziehen, weil sie keine Miete zahlen können. 23 Prozent der Arbeitslosen in Griechenland sind Jugendliche (die Jugendarbeitslosigkeit der 15- bis 24-jährigen beträgt offiziell 25,2 Prozent). Wie eine französische Zeitung schrieb: „Diese Studenten fühlen sich durch niemanden mehr geschützt: Die Polizei schlägt auf sie ein bzw. schießt auf sie; durch das Bildungswesen stecken sie in einer Sackgasse, einen Job kriegen sie nicht, die Regierung belügt sie."[1] Die Jugendarbeitslosigkeit und ihre Schwierigkeiten in der Arbeitswelt haben somit ein Klima der allgemeinen Verunsicherung, der Wut und der Angst geschaffen. Die Weltwirtschaftskrise löst immer neue Wellen von Entlassungen aus. 2009 erwartet man allein in Griechenland den Abbau von mehr als 100.000 Arbeitsplätzen; dies allein würde fünf Prozent mehr Arbeitslose bedeuten. Gleichzeitig verdienen mehr als 40 Prozent der Beschäftigten weniger als 1100 Euro brutto im Monat. In Griechenland gibt es die meisten Niedriglöhner unter den 27 Staaten der EU: 14 Prozent.
Aber nicht nur die Jugendlichen sind auf die Straße gegangen, sondern auch die schlecht bezahlten Lehrer und viele Beschäftigte, die den gleichen Problemen, der gleichen Armut gegenüberstehen und von dem gleichen Gefühl der Revolte angetrieben werden. Die brutale Repression gegen die Bewegung, bei der der Mord an dem 15-jährigen Jugendlichen nur die dramatischste Episode war, hat dieses Gefühl der Solidarität nur noch gestärkt. Die soziale Unzufriedenheit bricht sich immer stärker Bahn. Wie ein Student berichtete, waren auch viele Eltern zutiefst schockiert über die Ereignisse: „Unsere Eltern haben festgestellt, dass ihre Kinder durch die Schüsse eines Polizisten ums Leben kommen"[2]. Sie haben den Fäulnisprozess einer Gesellschaft gerochen, in der ihre Kinder nicht den gleichen Lebensstandard erreichen werden wie sie. Auf zahlreichen Demonstrationen haben sie mit eigenen Augen das gewalttätige Vorgehen der Polizei, die brutalen Verhaftungen, den Einsatz von Schusswaffen durch die Ordnungskräfte und das harte Eingreifen der Bereitschaftspolizei (MAT) beobachten können.
Nicht nur die Besetzer der Polytechnischen Hochschule, das Zentrum der Studentenproteste, prangern den Staatsterror an. Diese Wut über die polizeiliche Repression trifft man auch auf allen Demonstrationen an, wo Parolen gerufen werden wie: „Kugeln gegen die Jugendlichen, Geld für die Banken". Noch deutlicher war ein Teilnehmer der Bewegung, der erklärte: „Wir haben keine Arbeit, kein Geld; der Staat ist wegen der Krise pleite, und die einzige Reaktion, die wir sehen, ist, dass man der Polizei noch mehr Waffen gibt"[3].
Diese Wut ist nicht neu. Schon im Juni 2006 waren die Studenten gegen die Universitätsreform auf die Straße gegangen, da die Privatisierung der Unis den weniger wohlhabenden Studenten den Zugang zur Uni verwehrte. Die Bevölkerung hat auch gegen die Schlamperei der Regierung während der Waldbrände im Sommer 2007 protestiert, als 67 Menschen zu Tode gekommen waren. Die Regierung hat bis heute noch nicht jene Menschen entschädigt, die ihre Häuser, ihr Hab und Gut verloren hatten. Aber vor allem die Beschäftigten waren massiv gegen die Regierungspläne einer „Rentenreform" auf den Plan getreten; Anfang 2008 fand zweimal innerhalb von zwei Monaten ein Generalstreik mit hoher Beteiligung statt. Damals beteiligten sich mehr als eine Millionen Menschen an den Demonstrationen gegen die Abschaffung des Vorruhestands für Schwerabeiter und die Aufkündigung der Vorruhestandsregelung für über 50-jährige Arbeiterinnen.
Angesichts der Wut der Beschäftigten sollte der Generalstreik vom 10. Dezember, der von den Gewerkschaften kontrolliert wurde, als Ablenkungsmanöver gegen die Bewegung dienen. Die Gewerkschaften forderten, mit der SP und der KP an der Spitze, den Rücktritt der gegenwärtigen Regierung und vorgezogene Neuwahlen. Allerdings konnten die Wut und die Bewegung nicht eingedämmt werden - trotz der verschiedenen Manöver der Linksparteien und der Gewerkschaften, um die Dynamik bei der Ausdehnung des Kampfes zu hemmen, und trotz all der Anstrengungen der herrschenden Klasse und ihrer Medien zur Isolierung der Jugendlichen gegenüber den anderen Generationen und der gesamten Arbeiterklasse, indem man versuchte, diese in sinnlose Zusammenstöße mit der Polizei zu treiben. Die ganze Zeit über gab es immer wieder Zusammenstöße: gewaltsames Vorgehen der Polizei mit Gummiknüppel und Tränengaseinsätzen, Verhaftungen und Verprügeln von Dutzenden von Protestierenden.
Die jungen Arbeitergenerationen bringen am klarsten das Gefühl der Desillusionierung und der Abscheu gegenüber einem total korrupten politischen Apparat zum Ausdruck. Seit dem Krieg teilen sich drei Familien die Macht und seit mehr als 30 Jahren herrschen in ständigem Wechsel die beiden Dynastien Karamanlis (auf dem rechten Flügel) und Papandreou (auf dem linken Flügel) - begleitet jeweils von großen Bestechungsaffären und Skandalen. Die Konservativen haben 2004, nach großen Skandalen der Sozialisten in den Jahren zuvor, die Macht übernommen. Viele lehnen mittlerweile den ganzen politischen und gewerkschaftlichen Apparat ab, der immer mehr an Glaubwürdigkeit verliert. „Der Geldfetisch beherrscht die Gesellschaft immer mehr. Die Jugendlichen wollen mit dieser seelenlosen und visionslosen Gesellschaft brechen."[4] Vor dem Hintergrund der Krise hat diese Generation von Arbeitern nicht nur ihr Bewusstsein über eine kapitalistische Ausbeutung weiterentwickelt, die sie an ihrem eigenen Leib spürt, sondern sie bringt auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes zum Ausdruck, indem sie spontan die Methoden der Arbeiterklasse anwendet und ihre Solidarität sucht. Anstatt der Hoffnungslosigkeit zu verfallen, gewinnt sie ihr Selbstvertrauen aus der Tatsache, dass sie die Trägerin einer neuen Zukunft ist; sie setzt sich mit aller Macht gegen den Fäulnisprozess der Gesellschaft zu Wehr, in der sie lebt. So haben die Demonstranten ihren Stolz zum Ausdruck gebracht, als sie riefen: „Wir stellen ein Bild der Zukunft gegenüber einer sehr düsteren Vergangenheit dar".
Die Lage erinnert an die Verhältnisse im Mai 1968, aber das Bewusstsein dessen, was heute auf dem Spiel steht, geht viel weiter.
Die Radikalisierung der Bewegung
Am 16. Dezember besetzten Studenten wenige Minuten lang die Studios des Regierungsenders NET und rollten vor den Kameras ein Spruchband aus: „Hört auf, fern zu sehen. Kommt alle auf die Straße!". Und sie riefen dazu auf: „Der Staat tötet. Euer Schweigen ist seine Waffe. Besetzen wir alle öffentlichen Gebäude!" Der Sitz der Bürgerkriegspolizei Athens wurde angegriffen und ein Fahrzeug dieser Polizeitruppen angezündet. Diese Aktionen wurden daraufhin sofort von der Regierung als „Versuch des Umsturzes der Demokratie" gebrandmarkt und auch von der KP Griechenlands (KKE) verurteilt.
In Thessaloniki versuchten die lokalen Strukturen der Gewerkschaften GSEE und ADEDY (die Vereinigung der Staatsangestellten) die Streikenden mit einer Versammlung vor dem Arbeitsamt festzubinden. Doch Gymnasiasten und Studenten luden die Streikenden mit Erfolg dazu ein sich ihrer Demonstration anzuschliessen: 4000 Arbeiter und Studenten formierten einen Demonstrationszug durch die Straßen den Stadt. Am 11. Dezember versuchten Mitglieder der stalinistischen Sudentenorganisation PKS Versammlungen zu blockieren, um Besetzungen zu verhindern (an der Pantheon Universität, der Schule für Philosophie der Athener Uni). Doch ihr Plan scheiterte und die Bestzungen fanden statt. Im Ayios Dimitrios Quartier wurde die Stadthalle besetzt, um eine Vollversammlung abzuhalten, an der mehr als 300 Leute aller Generationen teilnahmen.
Am 17. Dezember wurde das Gebäude der größten Gewerkschaft Griechenlands GSEE (Allgemeiner Gewerkschaftsbund Griechenlands) in Athen von Beschäftigten besetzt, die die ArbeiterInnen dazu aufriefen, an diesem Ort zusammenzukommen, um Vollversammlungen abzuhalten, die allen Beschäftigten, allen StudentInnen und den Arbeitslosen offen stehen.
Eine ähnliche Situation mit Vollversammlungen und Besetzungen, die für alle offen waren, ereignete sich an der Athener Wirtschaftsuniversität und der Polytechnischen Schule.
Wir veröffentlichen hier ihre Erklärung, um das Schweigen und Verfälschen der Medien zu brechen, welche die Ereignisse als Straßenschlachten präsentierten, die von einigen Anarchisten zur Terrorisierung der Bevölkerung verursacht worden seien. Die Erklärung zeigt im Gegenteil, wie das solidarische Gefühl der Arbeiterklasse diese Bewegung auszeichnet und somit auch die verschiedenen Generationen der Proletarier verbindet:
Wir werden entweder unsere Geschichte selber bestimmen oder dann wird sie ohne uns bestimmt.
Wir, Handarbeiter, Angestellte, Erwerbslose, Zeitarbeiter, ob hier geboren oder eingewandert - wir sind keine passiven Fernsehkonsumenten. Seit dem Mord an Alexandros Grigoropoulos Samstagnacht nehmen wir an den Demonstrationen teil, an den Zusammenstößen mit der Polizei, den Besetzungen der Innenstadt oder der Wohnviertel. Immer wieder haben wir unsere Arbeit und unsere täglichen Verpflichtungen fallen gelassen, um mit den Schülern, Studenten und den anderen kämpfenden Proletariern auf die Straße zu gehen.
Wir haben entschieden, das Gebäude der GSEE zu besetzen:
- um es in einen Ort des freien Meinungsaustausches und in einen Treffpunkt für ArbeiterInnen zu verwandeln;
- um den von den Medien verbreiteten Irrglauben, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht an den Zusammenstößen der letzten Tage beteiligt waren, dass die um sich greifende Wut die Sache von 500 „Vermummten", „Hooligans" sei, sowie andere Ammenmärchen, die verbreitet werden, zu widerlegen. Auf den Fernsehschirmen werden die ArbeiterInnen als Opfer der Unruhen dargestellt, während gleichzeitig die unzähligen Entlassungen infolge der kapitalistischen Krise in Griechenland und der restlichen Welt von den Medien und ihren Managern als „Naturereignisse" betrachtet werden;
- um die Rolle der Gewerkschaftsbürokratie bei der Untergrabung des Aufstandes - und nicht nur dort - aufzudecken. Die GSEE und der ganze seit Jahrzehnten dahintersteckende gewerkschaftliche Apparat untergraben die Kämpfe, handeln Brosamen für unsere Arbeitskraft aus und verewigen das System der Ausbeutung und der Lohnsklaverei. Das Vorgehen der GSEE am letzten Mittwoch (dem Tag des Generalstreiks) ist ziemlich erhellend: Die GSEE sagte eine vorgesehene Demonstration der streikenden ArbeiterInnen ab, stattdessen gab es eine kurze Kundgebung am Syntagma-Platz, bei der Erstere aus Furcht davor, dass sie vom Virus des Aufstandes angesteckt werden, dafür sorgte, dass die Leute in aller Eile den Platz verließen;
- um diesen Ort, der durch unsere Beiträge errichtet wurde, von dem wir aber ausgeschlossen waren, zum ersten Mal zu einem offenen Ort zu machen. Einem offenen Ort, der die gesellschaftliche Öffnung, die der Aufstand hervorgebracht hat, fortsetzt. All die vielen Jahre haben wir schicksalhaft allen möglichen Heilsverkündern geglaubt und dabei unsere Würde verloren. Als Arbeiter und Arbeiterinnen müssen wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen und Schluss damit machen, auf kluge Anführer oder „fähige" Vertreter zu hoffen. Wir müssen unsere Stimme gegen die ständigen Angriffe erheben, uns treffen, miteinander reden, zusammen entscheiden und handeln. Gegen die allgemeinen Angriffe einen langen Kampf führen. Die Entwicklung eines kollektiven Widerstandes an der Basis ist der einzige Weg dazu;
- um die Idee der Selbstorganisation und Solidarität an den Arbeitsplätzen, der Kampfkomitees und des kollektiven Handelns der Basis zu verbreiten und dadurch die Gewerkschaftsbürokratien abzuschaffen.
All die Jahre haben wir das Elend hinuntergeschluckt, die Ausnutzung der Situation der Schwächeren, die Gewalt auf der Arbeit. Wir haben uns daran gewöhnt, die Verkrüppelten und die Toten - die so genannten „Arbeitsunfälle" - einfach nur noch zu zählen. Wir haben uns daran gewöhnt, zu ignorieren, dass die Migranten, unsere Klassenbrüder- und Schwestern, getötet werden. Wir haben die Schnauze voll davon, mit der Angst um unseren Lohn und in Aussicht auf eine Rente zu leben, die sich mittlerweile wie ein in die Ferne entrückter Traum anfühlt.
So wie wir darum kämpfen, unser Leben nicht für die Bosse und die Gewerkschaftsvertreter zu vergeuden, so werden wir auch keinen der verhafteten Aufständischen allein lassen, die sich in den Händen des Staates und der Justizmaschine befinden.
Sofortige Freilassung der Festgenommenen!
Keine Strafe für die Verhafteten!
Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiterinnen!w
Generalstreik!
Die Arbeiter-Versammlung im „befreiten" Gebäude der GSEE
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 18:00 Uhr.
Die Vollversammlung der aufständischen ArbeiterInnen
Am Abend versuchten ca. 50 Gewerkschaftsbon-zen und deren Führer, die Gewerkschaftszentrale zurückzuerobern, mussten aber vor den Studenten, die schnell Verstärkung erhielten, die Flucht ergreifen. Diese Verstärkung kam vor allem von meist anarchistischen Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, die ebenfalls besetzt und in einen Ort der Versammlungen und Diskussionen umgewandelt worden war, der auch allen Beschäftigen offen stand. Man eilte den Besetzern zur Hilfe und rief: „Solidarität". Der Verband albanischer Migranten verbreitete u.a. einen Text, in dem er seine Solidarität mit der Bewegung bekundete: „Diese Tage sind auch unsere Tage"!
Bezeichnenderweise veröffentlichte eine kleine Minderheit der Besetzer des Gewerkschaftshauptsitzes folgende Erklärung:
Panagopoulos, der Generalsekretär der GSEE, hat erklärt wir seien nicht Arbeiter, denn Arbeiter seine an der Arbeit. Unter Anderem verrät dies viel über die Wirklichkeit der „Arbeit" von Panagopoulos. Seine „Arbeit" besteht darin zu garantieren, dass die Arbeiter wirklich an der Arbeit sind und alles zu tun, um sie zur Arbeit zu bewegen. Doch in den letzten zehn Tagen waren die Arbeiter nicht an der Arbeit, sie waren draussen auf der Straße. Dies ist die Realität, die kein Panagopoulos auf der ganzen Welt verschweigen kann... Wir sind Leute, die arbeiten, wir sind auch Arbeitslose (die mit dem Verlust unserer Arbeitsplätze für die Beteiligung an den Streiks, welche von der GSEE ausgerufen werden gestraft werden, währen die Vertreter der Gewerkschaften mit Beförderungen belohnt werden), wir arbeiten mit unsicheren Arbeitverträgen in einem Job nach dem anderen, wir arbeiten ohne Sicherheiten in Trainingskursen und Arbeitslosenprogrammen, um die offiziellen Arbeitslosenzahlen tief zu halten. Wir sind ein Teil dieser Welt und wir sind hier.
Wir sind aufrührerische Arbeiter. Unsere Löhne haben wir mit unserem Blut und Schweiss bezahlt, mit Gewalt am Arbeitsplatz, mit Köpfen, Knien, Händen die durch Arbeitsunfälle gebrochen wurden.
Die ganze Welt ist von uns Arbeitern gemacht worden...
Arbeiter des befreiten Gebäudes der GSEE
Immer lauter wurde zu einem unbefristeten Generalstreik aufgerufen. Die Gewerkschaften sahen sich gezwungen, am 18. Dezember zu einem dreistündigen Generalstreik im öffentlichen Dienst aufzurufen.
Am Morgen des 18. Dezember wurde ein weiterer Schüler, 16 Jahre alt, der sich an einem Sit-in in der Nähe seiner Schule in einem Athener Vorort beteiligte, von einer Kugel verletzt. Am gleichen Tag wurden mehrere Radio- und Fernsehstudios durch Demonstranten besetzt, insbesondere in Tripoli, Chania und Thessaloniki. Das Gebäude der Handelskammer in Patras wurde besetzt, wo es erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei kam. Die gigantische Demonstration in Athen wurde gewaltsam angegriffen. Dabei setzte die Aufstandsbekämpfungspolizei neue Waffen ein: lähmende Gase und ohrenbetäubende Granaten. Ein Flugblatt, das sich gegen den Staatsterror richtete, wurde von „revoltierenden Schülerinnen" unterzeichnet und in der Wirtschaftswissenschaftlichen Universität verteilt. Die Bewegung spürte ganz vage ihre eigenen geographischen Grenzen. Deshalb nahm sie mit Enthusiasmus die internationalen Solidaritätsdemonstrationen in Frankreich, Berlin, Rom, Moskau, Montreal oder in New York auf. Die Rückmeldung lautete: „Diese Unterstützung ist für uns sehr wichtig". Die Besetzer der Polytechnischen Hochschule riefen zu einem „internationalen Aktionstag gegen die staatlichen Tötungen" am 20. Dezember auf. Der einzige Weg, die Isolierung dieses proletarischen Widerstandes in Griechenland zu überwinden, besteht darin, die Solidarität und den Klassenkampf, die heute als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise immer deutlicher in Erscheinung treten, international zu entfalten.
Eine Entwicklung in die Zukunft
Am 20. Dezember kam es zu heftigen Zusammenstössen auf der Straße. Sie konzentrierten sich vor allem um die von der Polizei belagerte Polytechnische Hochschule, welche die Polizei stürmen wollte. Das besetzte Gebäude der Gewerkschaft GSEE wurde dieser am 21. Dezember in Folge eines Entscheides des Besetzungskomitees, über den in der Vollversammlung abgestimmt wurde, zurückgegeben. Das Besetzungskomitee der Athener Polytechnischen Hochschule veröffentlichte am 22. Dezember folgende Stellungnahme: „Wir sind für die Emanzipation, die menschliche Würde und die Freiheit. Es ist nicht nötig, uns mit Tränengas zu bekämpfen, wir weinen schon selber genug."
Mit viel Reife und einem Beschluss der Vollversammlung an der Ökonomischen Universität folgend, benutzten die Besetzer dieser Universität den Aufruf zu einer Demonstration am 24. Dezember gegen die polizeiliche Repression und für die Solidarität mit gefangenen Mitstreitern als günstigen Moment zur sicheren und gemeinsamen Evakuierung der Gebäudes: „Es scheint einen Konsens über die Notwendigkeit des Verlassens der Universität zu geben und die Anliegen der Revolte in der ganzen Gesellschaft zu verbreiten." Diesem Beispiel folgten Vollversammlungen an anderen besetzten Universitäten, um nicht in die Falle der Isolierung und direkten Konfrontation mit der Polizei zu geraten. Ein Blutbad und eine noch gewalttätigere Repression wurden damit verhindert. Gleichzeitig verurteilten die Vollversammlungen den Gebrauch von Handfeuerwaffen einer angeblichen Gruppe „Volksaktion" gegen ein Polizeiauto als Provokationsversuch der Polizei.
Das Besetzungskomitee der Polytechnischen Hochschule räumte die letzte Bastion in Athen symbolisch am 24. Dezember um Mitternacht. „Die Vollversammlung, und nur diese alleine, entscheidet, ob und wann wir die Universität verlassen werden (...) Der entscheidende Punkt ist, dass es die Leute sind, die das Gebäude besetzen, die über die Räumung entscheiden, und nicht die Polizei."
Zuvor hatte das Besetzungskomitee eine Erklärung veröffentlicht: „Indem wir unsere Besetzung der Polytechnischen Hochschule nach 18 Tagen beenden, senden wir allen Leuten, die an dieser Bewegung in irgendeiner Art teilgenommen haben, unsere herzlichste „Solidaritätsgrüße". Dies nicht nur in Griechenland, sondern auch in anderen Ländern Europas, Amerikas, Asiens und Australiens. Für Alle, die wir angetroffen haben und mit denen wir weitergehen werden im Kampf für die Befreiung der Gefangenen dieser Bewegung und für deren Weiterführung bis zur sozialen Befreiung der Welt."
In einigen Quartieren hatten sich Einwohner der Lautsprecheranlagen die von der Verwaltung für das Abspielen von Weihnachtsleidern installiert worden waren, bemächtigt um darüber die sofortige Freilassung der Gefangenen, die Entwaffnung der Polizei, die Auflösung der Aufstandbekämpfungs-Sondereinheiten und die Abschaffung der Antiterrorgesetze zu fordern. In Volos wurden die Sendestation des lokalen Radios und die Büros der Lokalzeitung besetzt, um darin über die Ereignisse und ihre Auswirkungen zu berichten. In Lesvos hatten Demonstranten Lautsprecher im Stadtzentrum aufgestellt und darüber Nachrichten verbreitet. In Ptolemaida und Ioannina wurde ein Weihnachtsbaum mit Fotos des ermordeten Schülers und der Demonstrationen und mit Forderungen der Bewegung dekoriert.
Das Gefühl der Solidarität drückte sich spontan und mächtig am 23. Dezember erneut aus, nachdem eine Angestellte der Reinigungsfirma Oikomet, die für die Athener Metro arbeitet, attackiert worden war. Auf ihrem Nachhauseweg von der Arbeit war ihr Essigsäure ins Gesicht geschüttet worden. Solidaritätsdemonstrationen fanden statt und das Verwaltungsgebäude der Athener Metro wurde am 27. Dezember besetzt. In Thessaloniki wurde das Hauptquartier der Gewerkschaft GSEE besetzt. Aus diesen zwei Besetzungen wurden mehrere Demonstrationen, Solidaritätskonzerte und „Gegeninformations"-Veranstaltungen organisiert (so wurden z.B. die Lautsprecher der Metro verwendet, um Erklärungen zu verlesen).
Die Vollversammlung in Athen erklärte in einem Text: „Wenn sie einen von uns angreifen, dann greifen sie uns alle an!
Heute haben wir die Büros der ISAP (Metro von Athen) besetzt, als eine erste Antwort auf die mörderische Essigsäureattacke gegen Konstantina Kuneva, als sie am 23. Dezember von der Arbeite nach Hause ging. Konstantina befindet sich auf der Intensivpflegestation des Spitals. In der vorangegangnen Woche befand sie sich in einem Streit mit der Firma, um eine volle Entlöhnung der Weihnachtstage für sich und ihre Arbeitskollegen zu erhalten und sie denunzierte dabei die illegalen Praktiken der Bosse. Zuvor wurde ihre Mutter von derselben Firma entlassen. Sie selbst wurde an einen weit weg gelegenen Arbeitsplatz versetzt. Das sind sehr verbreitete Praktiken in den Reinigungsunternehmen, die sehr prekäre Arbeitsplätze haben. Der Besitzer von Oikomet ist ein Mitglied der PASOK (der Griechischen Sozialistischen Partei). Sie beschäftigen offiziell 800 Angestellte (doch die Angestellten sagten, es sei das Doppelte, denn während der letzten 3 Jahre hatten dort mehr als 3000 Leute gearbeitet). Das illegale mafiöse Vorgehen der Bosse dieser Firma ist Alltag. So sind die Angestellten gezwungen, illegale Verträge zu unterschreiben (bei denen die Bedingungen erst nachher von den Bossen eingetragen werden) und sie haben keine Möglichkeit, dies zu widerrufen. Sie arbeiten 6 Stunden, werden aber nur für 4.5 Stunden bezahlt (Nettolohn), so dass sie niemals 30 Stunden pro Woche überschreiten (denn sonst müssten sie in einer höheren Risikoklasse eingestuft werden). Die Bosse terrorisieren sie, versetzen sie, schmeissen sie raus oder drängen sie zu Kündigungen. Der Kampf um die WÜRDE und SOLIDARITÄT ist UNSER Kampf."
Parallel dazu veröffentlichte die Vollversammlung der Besetzer der GSEE in Thessaloniki folgenden Text: „Heute haben wir den Hauptsitz der Gewerkschaften in Thessaloniki besetzt, um gegen die Unterdrückung zu protestieren, die die Form von Mord und Terrorismus gegen die Arbeiter annimmt (...) Wir rufen alle Arbeiter auf, sich diesem gemeinsamen Kampf anzuschließen (...) Die offene Versammlung derjenigen, die den Hauptsitz der Gewerkschaft besetzen, Leute von verschiedenen politischen Richtungen, Mitglieder der Gewerkschaften, Studenten, Immigranten und Freunde die vom Ausland kommen und hinter diesen gemeinsamen Forderungen stehen, haben einen Beschluss gefasst:
- Fortführung der Besetzung;
- Die Organisierung einer Vollversammlung in Solidarität mit Konstantina Kuneva;
- Das Organisieren von Aktionen, um Informationen und Aufmerksamkeit in der Stadt zu verbreiten;
- Das Durchführen eines Konzertes im Stadtzentrum, um Geld für Konstantina zu sammeln."
Diese Versammlung erklärte ebenfalls: „In den Grundsatzpapieren der Gewerkschaften werden nirgends die Ungleichheit, Armut und die hierarchischen Strukturen der Gesellschaft in Frage gestellt (...) Die Gewerkschaftsbünde und Führungen der Gewerkschaften in Griechenland sind ein fester Bestandteil des Regimes, welches an der Macht ist. Ihre Basismitglieder sollten ihnen den Rücken kehren (...) und für einen selbständigen Pol des Kampfes, den sie selber bestimmen, eintreten (...) Wenn die Arbeiter ihren Kampf in die eigenen Hände nehmen und mit der Logik brechen, sich von den Komplizen der Bosse vertreten zu lassen, dann werden sie ihr Selbstbewusstsein wieder finden und Tausende werden in den nächsten Streiks auf die Straßen strömen. Der Staat und seine Handlanger sind Mörder.
Selbstorganisierung! Kampf zur Verteidigung der sozialen Interessen! Solidarität mit den Immigranten und mit Konstantina Kuneva!"
Anfangs Januar 2009 fanden immer noch Demonstrationen im ganzen Land statt, um die Solidarität mit den Gefangenen auszudrücken. 246 Leute waren verhaftet worden und 66 wurden in Präventivhaft genommen. In Athen wurden in den ersten drei Tagen der Bewegung 50 Immigranten festgenommen, in Prozessen ohne Anwalt bis zu maximal 18 Monaten Haft verurteilt und alle mit der Ausweisung bestraft.
Am 9. Januar ereigneten sich nach einem Protestmarsch von 3000 Lehrern, Studenten und Kindern erneut Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und der Polizei. Sie trugen Slogans mit sich wie: „Geld für die Ausbildung, nicht für die Banker", „Nieder mit der Regierung der Mörder und der Armut". Polizei-Sondereinheiten versuchten, sie immer wieder zu verjagen, und machten zahlreiche Festnahmen.
In Griechenland, wie überall sonst auch, hat der kapitalistische Staat angesichts der Prekarisierung, Arbeitslosigkeit und Armut, die durch die weltweite Krise verstärkt werden, nur mehr Polizei und Repression anzubieten. Nur die internationale Entwicklung des Kampfes, die Solidarität zwischen Industriearbeitern und Büroangestellten, zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten, Schülern, Studenten, Arbeitslosen, Rentnern - über alle Generationen hinweg - kann den Weg zur Überwindung dieses Ausbeutungssystems und zu einer neuen Perspektive öffnen.
W., 18.1. 2009
[1] Marianne Nr. 608, 13. Dezember 2008 : „Grèce : les leçons d'une émeute".
[2] Libération, 12. Dezember 2008.
[3] Le Monde , 10. Dezember 2008.
[4] Marianne, s.o.
Geographisch:
- Griechenland [358]
Aktuelles und Laufendes:
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [50]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Proletarischer Kampf [79]
Interne Debatte in der IKS (II): Die Ursachen für die Aufschwungperiode nach dem Zweiten Weltkrieg
- 6282 Aufrufe
Dieser Beitrag unterstützt die in Nr. 42 vorgestellte These unter dem Titel „keynesianisch-fordistischer Staatskapitalismus" und schreibt die Schaffung einer zahlungsfähigen Nachfrage während des Nachkriegsbooms im wesentlichen den keynesianischen Mechanismen zu, die von der Bourgeoisie installiert worden waren. In den folgenden Ausgaben der Revue werden wir Artikel veröffentlichen, die andere Positionen in der Debatte vertreten und auf diese Position antworten, insbesondere bezüglich des Charakters der kapitalistischen Akkumulation und der Faktoren, die den Eintritt des Kapitalismus in seine dekadente Phase bestimmen.
Die Ursprünge, Dynamiken und Grenzen des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus
1952 beendeten unsere Vorgänger in der GCI[1] die Aktivitäten ihrer Gruppe, weil das „Verschwinden der außerkapitalistischen Märkte (...) zu einer permanenten Krise des Kapitalismus führt (...) Wir können hier die ins Auge fallende Bestätigung von Rosa Luxemburgs Theorie sehen (...) In der Tat sind die Kolonien nicht mehr ein außerkapitalistischer Markt für das koloniale Mutterland (...) Wir leben in einem Zustand des drohenden Krieges..."[2] Geschrieben am Vorabend des Nachkriegsbooms, enthüllen diese wiederholten Fehler die Notwendigkeit, über die „ins Auge fallende Bestätigung von Rosa Luxemburgs Theorie" hinauszugehen und zu einem kohärenteren Verständnis der Funktionsweise und Grenzen des Kapitalismus zurückzukehren. Dies ist das Ziel dieses Artikels.
I. Die Triebkräfte und inneren Widersprüche des Kapitalismus
1) Die Zwänge einer erweiterten Reproduktion und ihre Grenzen
Die Aneignung von Mehrarbeit ist fundamental für das Überleben des Kapitalismus.[3] Anders als die vorhergehenden Gesellschaften besitzt die kapitalistische Aneignung ihre eigene, eingebaute, permanente Dynamik in Richtung Expansion des Produktionsumfangs, die weit über die einfache Reproduktion hinausgeht. Sie erzeugt eine wachsende gesellschaftliche Nachfrage durch die Beschäftigung von neuen Arbeitern und die Investition in zusätzliche Produktions- und Konsumtionsmittel: „Diese Grenzen der Konsumtion werden erweitert durch die Anspannung des Reproduktionsprozesses selbst; einerseits vermehrt sie den Verzehr von Revenue durch Arbeiter und Kapitalisten, andrerseits ist sie identisch mit Anspannung der produktiven Konsumtion."[4] Diese Ausbreitungsdynamik nimmt die Form einer Abfolge von Zyklen an, in denen, grob gesagt alle zehn Jahre die periodische Zunahme des fixen Kapitals dazu tendiert, die Profitrate zu verringern und Krisen hervorzurufen.[5] Während dieser Krisen schaffen Bankrotte und Wertminderung des Kapitals die Bedingungen für eine Erholung, die die Märkte und das Produktionspotenzial erweitert: „Die Krisen sind immer nur momentane gewaltsame Lösungen der vorhandnen Widersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte Gleichgewicht für den Augenblick wiederherstellen (...) Die eingetretne Stockung der Produktion hätte eine spätere Erweiterung der Produktion - innerhalb der kapitalistischen Grenzen - vorbereitet. Und so würde der Zirkel von neuem durchlaufen. Ein Teil des Kapitals, das durch Funktionsstockung entwertet war, würde seinen alten Wert wiedergewinnen. Im übrigen würde mit erweiterten Produktionsbedingungen, mit einem erweitertem Markt und mit erhöhter Produktivkraft derselbe fehlerhafte Kreislauf wieder durchgemacht werden."[6] Die Graphik Nr. 1 veranschaulicht treffend all die Elemente dieses theoretischen Rahmens, der von Marx herausgearbeitet worden war: Alle zehn Zyklen der steigenden und fallenden Profitrate enden in einer Krise (Rezession):
Die kapitalistische Akkumulation in den mehr als zwei Jahrhunderten fand im Rhythmus von gut dreißig Zyklen und Krisen statt. Marx identifizierte sieben zeit seines Lebens, die Dritte Internationale sechzehn[7], und die Linke in der Internationale vervollständigte das Bild in der Zwischenkriegsphase.[8] Dies ist die immer wiederkehrende materielle Grundlage für die Zyklen der Überproduktion, deren Ursprünge wir nun untersuchen werden.[9]
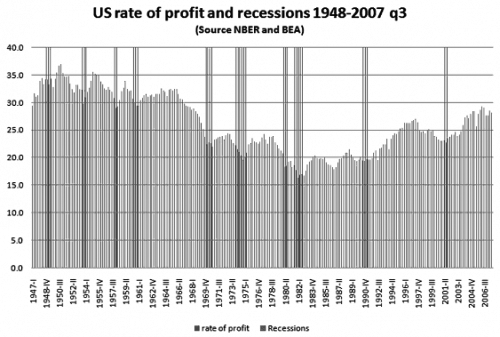
Grafik 1: Quartalsweise die Profitraten und Rezessionen in den USA von 1948 bis 2007.
2) Der Kreislauf der Akkumulation - ein Spiel in zwei Akten: die Produktion von Profit und die Realisierung von Waren
Die Abpressung eines Maximums an Mehrarbeit, kristallisiert in einer wachsenden Warenmenge, bildet das, was Marx den „ersten Akt des kapitalistischen Produktionsprozesses" nannte. Diese Waren mussten anschließend verkauft werden, um die im Mehrwert materialisierte Mehrarbeit in die Form von Geld zur Neuinvestition umzuwandeln: Dies ist der „zweite Akt des Prozesses". Jeder dieser beiden Akte enthält seine eigenen Widersprüche und Grenzen. Obwohl sie sich gegenseitig beeinflussen, wird der erste Akt vor allem durch die Profitrate angetrieben, während der zweite eine Funktion der mannigfaltigen Tendenzen ist, die den Markt begrenzen.[10] Diese beiden Einschränkungen erzeugen periodisch eine Nachfrage, die unfähig ist, die gesamte Produktion zu absorbieren: „Die Überproduktion speziell hat das allgemeine Produktionsgesetz des Kapitals zur Bedingung, zu produzieren im Maße der Produktivkräfte (d.h. der Möglichkeit, mit gegebner Masse Kapitals größtmöglichste Masse Arbeit auszubeuten) ohne Rücksicht auf die vorhandnen Schranken des Marktes oder der zahlungsfähigen Bedürfnisse...."[11]
Wo liegt der Ursprung dieser unzureichenden zahlungsfähigen Nachfrage?
In der eingeschränkten Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft, die durch die antagonistischen Verhältnisse bei der Aufteilung der Mehrarbeit (Klassenkampf) begrenzt wird: „Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde."[12]
In den Grenzen, die aus dem Akkumulationsprozess resultieren, der den Konsum reduziert, sobald die Profitrate fällt: Der im Verhältnis zum investierten Kapital unzureichende Mehrwert, der extrahiert wurde, bremst die Investitionen und die Beschäftigung neuer Arbeitskräfte: „Die Schranke der kapitalistischen Produktionsweise tritt hervor: 1. Darin, daß die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit im Fall der Profitrate ein Gesetz erzeugt, das ihrer eignen Entwicklung auf einen gewissen Punkt feindlichst gegenübertritt und daher beständig durch Krisen überwunden werden muß..."[13]
In einer unvollständigen Realisierung des Gesamtprodukts, wenn die Proportionen zwischen den Produktionssektoren nicht beachtet werden.[14]
3) Eine dreifache Schlussfolgerung über die inneren Widersprüche und die Dynamik des Kapitalismus
In seinem gesamten Werk unterstreicht Marx konstant diese zweifach geartete Ursache von Krisen, deren Bestimmungen im Grunde unabhängig sind: „Die moderne Überproduktion beruht einerseits auf der absoluten Entwicklung der Produktivkräfte und folglich der massenhaften Produktion durch Produzenten, die im Kreislauf der notwendigen Lebensmittel eingeschlossen sind, und andererseits der Begrenzung durch den Profit der Kapitalisten."[15] In der Tat: auch wenn das Niveau und der wiederkehrende Fall der Profitrate wechselseitig die Weise beeinflussen, in welcher der Mehrwert verteilt wird, besteht Marx nichtsdestotrotz darauf, dass diese beiden Grundursachen fundamental „unabhängig", „begrifflich auseinanderfallend", „nicht identisch" sind.[16] Warum das? Einfach weil die Profitproduktion und die Märkte zum größten Teil unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Daher lehnt Marx kategorisch jede Theorie ab, die die Krisen auf eine einzige Ursache zurückführt.[17] Es ist also ein theoretischer Fehler, die Entwicklung der Profitrate strikte vom Umfang des Marktes abhängig zu machen oder umgekehrt. Daraus folgt, dass diese beiden Hauptursachen je ihre eigene zeitliche Logik haben. Der erste Widerspruch (die Profitrate) hat seine Wurzeln in der Notwendigkeit, das konstante Kapital auf Kosten des variablen Kapitals zu erhöhen, und sein zeitlicher Ablauf ist somit im Wesentlichen an die Zyklen gebunden, in denen das fixe Kapital rotiert. Da der zweite Widerspruch sich um die Verteilung von Mehrarbeit dreht, wird seine Zeitebene durch das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen bestimmt, das sich über längere Perioden erstreckt.[18] Auch wenn diese beiden Zeitebenen zusammenfallen können (der Akkumulationsprozess beeinflusst das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen und umgekehrt), sind sie dennoch fundamental „unabhängig", „begrifflich auseinanderfallend", „nicht identisch", denn der Klassenkampf ist nicht strikt an die Zehnjahreszyklen gebunden, und Letztere sind nicht mit dem Kräfteverhältnis zwischen den Klassen verknüpft.
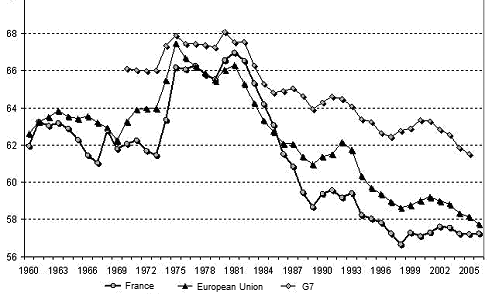
Grafik 2: Die Löhne im Verhältnis zum gesammten Vermögen in den G7, EU und Frankreich.
II. Eine empirische Bestätigung der marxistischen Theorie der Überproduktionskrisen
Die Zeit seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute ist ein gutes Beispiel, um die Marxsche Analyse der Überproduktionskrisen und ihrer drei Implikationen zu bestätigen. Insbesondere erlaubt sie uns, die Unrichtigkeit aller wKrisentheorien zu beweisen, die sich auf eine einzige Ursache berufen, ob es nun um die Theorie geht, die sich allein auf die fallende Profitrate stützt und die nicht in der Lage ist zu erklären, warum Akkumulation und Wachstum nicht wieder anspringen trotz der Tatsache, dass die Profitrate ein Vierteljahr lang gestiegen ist, oder jene Theorie, die auf der Sättigung der zahlungsfähigen Nachfrage basiert und die nicht den Anstieg der Profitrate erklären kann, da die Märkte völlig ausgezehrt sind (was sich eigentlich in einer Nullprofitrate ausdrücken müsste). All dies kann leicht aus den beiden Graphiken (Nr. 1 und Nr. 3) ersehen werden, die die Entwicklung der Profitrate zeigen.
Die Ermüdung des Nachkriegsboom und das sich verschlechternde wirtschaftliche Klima zwischen 1969-82 sind im Wesentlichen eine Folge des Rückganges der Profitrate[19], trotz der Tatsache, dass der Konsum durch die Indexierung der Löhne und durch Maßnahmen zur Stützung der Nachfrage aufrecht gehalten wurde[20]. Die Produktivitätssteigerungen sanken ab Ende der 60er Jahre[21] und halbierten die Profitrate ab 1982 (s. Graphik Nr. 3). Seither ist eine Erholung der Profitrate nur noch durch die Steigerung der Mehrwertrate (sinkende Löhne und wachsende Ausbeutung) möglich gewesen. Dies implizierte eine unvermeidliche Deregulierung der Schlüsselmechanismen, die das Wachstum in der Endnachfrage während des Nachkriegsbooms gesichert hatten (siehe unten). Dieser Prozess begann Anfang der 1980er Jahre und kann insbesondere im konstanten Fall der Löhne im Verhältnis zum gesamten hergestellten Reichtum betrachtet werden.
Überall lastete schließlich in den 70er Jahren der „Profitraten"-Widerspruch auf dem Kapitalismus, während die Endnachfrage aufrechterhalten wurde. Die Situation kehrte sich ab 1982 in ihr Gegenteil um: Die Profitrate hatte sich spektakulär erholt, aber zum Preis einer drastischen Zusammenpressung der Endnachfrage (des Marktes): im Wesentlichen der Lohnempfänger (siehe Graphik Nr. 2), aber auch (in einem geringeren Umfang) der Investitionen, da die Akkumulationsrate auf ihrem niedrigen Stand verblieben war (siehe Graphik Nr. 3).
Dadurch können wir nun verstehen, warum der wirtschaftliche Niedergang sich trotz einer wiederhergestellten Profitrate fortsetzt: Das Unvermögen von Wachstum und Akkumulation, wieder an Schwung zu gewinnen, trotz einer spektakulären Verbesserung in der Betriebsrentabilität, erklärt sich aus der Zusammenpressung der Endnachfrage (Löhne und Investitionen). Diese drastische Reduzierung der Endnachfrage führt zu einer lustlosen Investition in die erweiterte Akkumulation, zu fortgesetzter Rationalisierung durch Konzernübernahmen und -verschmelzungen, ungenutztem Kapital, das in die Finanzspekulation strömt, Verlagerung von Industrien auf der Suche nach billiger Arbeitskraft - was die allgemeine Nachfrage noch weiter drückt.
Was die Wiederherstellung der Endnachfrage angeht, so ist sie unter den gegenwärtigen Bedingungen kaum möglich, da das Wachstum der Profitrate davon abhängt, sie niedrig zu halten! Seit 1982 ist es also im Rahmen verbesserter Betriebsrentabilität die „Begrenzung der zahlungsfähigen Märkte" bzw. ihre Zeitebene, die die wesentliche Rolle bei der Erklärung der fortgesetzten Lustlosigkeit der Akkumulation und des Wachstums spielen, selbst wenn Fluktuationen in der Profitrate kurzfristig durchaus einen wichtigen Anteil bei der Auslösung von Rezessionen haben können, wie wir unschwer aus den Graphiken N. 1 und Nr. 3 ersehen können.
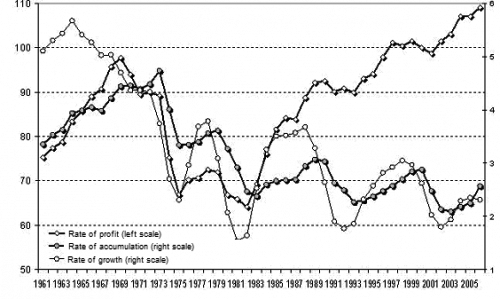
Grafik 3: Profitrate, Akkumulationsrate und ökonomisches Wachstum in den USA, Europa und Japan zwischen 1961 und 2006.
III. Der Kapitalismus und seine Umgebung
Die Dynamik des Kapitalismus zur Vergrößerung verleiht ihm notwendigerweise einen fundamental expansiven Charakter: „Der Markt muß daher beständig ausgedehnt werden, so daß seine Zusammenhänge und die sie regelnden Bedingungen immer mehr die Gestalt eines von den Produzenten unabhängigen Naturgesetzes annehmen, immer unkontrollierbarer werden. Der innere Widerspruch sucht sich auszugleichen durch Ausdehnung des äußern Feldes der Produktion. Je mehr sich aber die Produktivkraft entwickelt, um so mehr gerät sie in Widerstreit mit der engen Basis, worauf die Konsumtionsverhältnisse beruhen."[22] Als Marx all die Dynamiken und Grenzen des Kapitalismus aufzeigte, tat er dies, indem er von den Beziehungen des Kapitalismus zur äußeren (nicht-kapitalistischen) Sphäre abstrahierte. Wir müssen nun verstehen, worin die Rolle und Bedeutung Letzterer in der Entwicklung des Kapitalismus liegen. Der Kapitalismus kam zur Welt und entwickelte sich innerhalb des Rahmens feudaler, dann merkantiler gesellschaftlicher Verhältnisse, zu denen er unvermeidlicherweise wichtige Bande unterhielt, um an die Mittel seiner eigenen Akkumulation zu gelangen (Import von kostbaren Metallen, Ausplünderungen, etc.), um seine eigenen Waren abzusetzen (Direktverkauf, Atlantischer Dreieckshandel, etc.) und als Quelle der Ware Arbeitskraft.
Auch nachdem die Fundamente des Kapitalismus nach drei Jahrhunderten der ursprünglichen Akkumulation (1500-1825) gesichert waren, im Grunde in der gesamten aufsteigenden Periode, bot dieses Milieu weiterhin eine ganze Reihe von Gelegenheiten als Profitquelle, als Ventil für den Verkauf von Waren aus der Überproduktion und als zusätzliche Quelle von Arbeitskräften. All diese Gründe erklären die imperialistische Jagd nach Kolonien zwischen 1880 und 1914.[23] Jedoch bedeutet die Existenz einer externen Regulierung eines Teils der internen Widersprüche des Kapitalismus weder, dass jene für seine Entwicklung die wirksamsten gewesen wäre, noch, dass der Kapitalismus absolut außerstande wäre, interne Regulierungsmethoden zu schaffen. Es ist zuallererst die Ausweitung und Herrschaft der Lohnarbeit auf seinen eigenen Fundamenten, die es dem Kapitalismus fortschreitend ermöglichen, sein Wachstum dynamischer zu gestalten. Und auch wenn die vielfältigen Beziehungen zwischen dem Kapitalismus und der außerkapitalistischen Sphäre ihm eine ganze Reihe von Gelegenheiten verschafften, so war die Größe dieses Milieus und die allgemeine Bilanz seines Austausches mit dieser Sphäre nichtsdestotrotz eine Bremse für sein Wachstum.[24]
IV. Die historische Überlebtheit der kapitalistischen Produktionsweise und die Grundlage ihrer Aufhebung
Diese gewaltige Dynamik der internen und externen Expansion des Kapitalismus ist dennoch nicht ewig. Wie jede Produktionsweise in der Geschichte durchläuft auch der Kapitalismus eine Phase der Veraltung, in der seine gesellschaftlichen Verhältnisse die Entwicklung seiner Produktivkräfte bremsen.[25]
Wir müssen daher nach den historischen Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb der Umwandlung und Generalisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse der Lohnarbeitsproduktion suchen. Auf einer bestimmten Stufe bilden die Ausweitung der Lohnarbeit und ihre durch die Herstellung des Weltmarktes erreichte allgemeine Herrschaft den Kulminationspunkt des Kapitalismus. Statt fortzufahren, alte gesellschaftliche Verhältnisse auszurotten und die Produktivkräfte weiterzuentwickeln, neigt der nun obsolete Charakter des Lohnarbeitsverhältnisses dazu, jene einzufrieren und diese zu bremsen: Er bleibt unfähig, die ganze Menschheit in sein Verhältnis zu integrieren (große Teile werden nicht integriert), er erzeugt Krisen, Kriege und Katastrophen von immer größeren Ausmaßen, und dies bis zu dem Punkt, wo er die Menschheit mit der Auslöschung bedroht.
1) Die Überlebtheit des Kapitalismus
Die fortschreitende Verallgemeinerung der Lohnarbeit bedeutet nicht, dass sie überall Wurzeln gefasst hat, weit entfernt davon, aber sie bedeutet, dass ihre Vorherrschaft auf der Welt eine wachsende Instabilität schafft, in der sämtliche Widersprüche des Kapitalismus ihren höchsten Ausdruck finden. Der Erste Weltkrieg eröffnete dieses Zeitalter großer Krisen, deren vorherrschender Ausdruck darin besteht, dass die Krisen weltweit und in den Lohnarbeitsverhältnissen verankert sind: a) Der nationale Rahmen ist zu eng geworden, um den Ansturm der Widersprüche des Kapitalismus aufzufangen; b) die Welt bietet nicht mehr genug Gelegenheiten und Stoßdämpfer, die den Kapitalismus mit einer äußeren Regulierung seiner inneren Widersprüche versorgen; c) nachträglich betrachtet enthüllt das Scheitern der Regulierung, die während des Nachkriegsbooms eingeführt wurde, die historische Unfähigkeit des Kapitalismus, auf lange Frist seine eigenen Widersprüche in Ordnung zu bringen, die folglich mit immer barbarischerer Gewalt ausbrechen.
In dem Sinne, dass er ein Weltkonflikt war, nicht zur Eroberung neuer Einflusssphären, Investitionszonen und Märkte, sondern zur Umverteilung jener, die bereits existierten, markierte der Erste Weltkrieg den endgültigen Eintritt der kapitalistischen Produktionsweise in die Phase ihrer Überalterung. Die beiden zunehmend zerstörerischen Weltkriege, die größte je auftretende Überproduktionskrise (1929-1933), die starke Einschränkung des Wachstums der Produktivkräfte zwischen 1914 und 1945, die Unfähigkeit des Kapitalismus, einen großen Teil der Menschheit zu integrieren, die Entwicklung des Militarismus und Staatskapitalismus über den gesamten Planeten, das zunehmende Wachstum der unproduktiven Ausgaben und die historische Unfähigkeit des Kapitalismus, seine eigenen Widersprüche intern zu stabilisieren - all diese Phänomene sind materielle Ausdrücke dieser historischen Überlebtheit der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse, die auf der Lohnarbeit fußen und die der Menschheit nichts anderes anzubieten haben als eine Perspektive der wachsenden Barbarei.
2) Katastrophaler Zusammenbruch oder eine historische, materialistische und dialektische Sichtweise der Geschichte?
Die Überlebtheit des Kapitalismus impliziert nicht, dass er zu einem katastrophalen Zusammenbruch verdammt ist. Es gibt keine vordefinierten, quantitativen Grenzen innerhalb der Produktionsverhältnisse des Kapitalismus (ob es die Profitrate ist oder eine gegebene Menge an außerkapitalistischen Märkten), die den ominösen Punkt bestimmen, jenseits dessen die kapitalistische Produktion stirbt. Die Grenzen der Produktionsverhältnisse sind vor allem gesellschaftlich, das Produkt ihrer inneren Widersprüche und dem Zusammenstoss zwischen diesen nun obsoleten Verhältnissen und den Produktivkräften. Von nun an ist es das Proletariat, das den Kapitalismus abschaffen wird, der Kapitalismus wird nicht von selbst als Resultat seiner ‚objektiven‘ Grenzen sterben. Während der Überalterung des Kapitalismus wirken dieselben Tendenzen und Dynamiken, die Marx analysierte, fort, aber sie tun dies in einem völlig veränderten allgemeinen Kontext. All die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Widersprüche erscheinen unvermeidlich auf einer höheren Stufe, ob in den sozialen Kämpfen, die regelmäßig die Frage der Revolution stellen, oder in imperialistischen Konflikten, die die eigentliche Zukunft der Menschheit bedrohen. Mit anderen Worten: Die Welt hat das „Zeitalter der Kriege und Revolutionen" betreten, das von der Dritten Internationale angekündigt worden war.
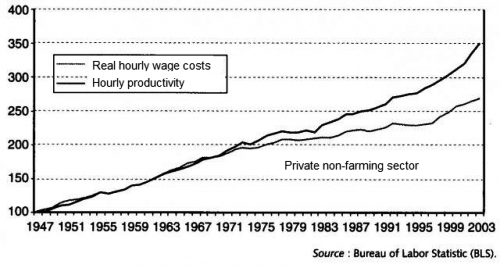
Grafik 4: Löhne und Produkitivtät in den Vereinigten Staaten.
Kommentar zu dieser Grafik: Der Anstieg der Produktivität und der Löhne stieg in gleicher Dynamik nach
dem Zweiten Weltkrieg. Nach 1980 gab es Unterschiede im Wachstum von Produktivität und dem Lohn. Seit
der Kapitalismus begann, war dieses unterschiedliche Wachstum die Regel und die Parallelität während dem
Nachkriegsboom die Ausnahme. In der Tat, diese Unterschiedlichkeit ist ein realer Ausdruck der Tendenz im
Kapitalismus, dass die Produkitivtät (obere Linie), über die Steigerung der Kaufkraft steigt (untere Linie).
V. Keynesianisch-fordistischer Staatskapitalismus: das Fundament des Nachkriegsbooms
Marxisten haben keinen Anlass, angesichts von Erholungsphasen, die in einer Überlebtheit der Produktionsweise durchaus stattfinden, irritiert zu sein: Wir können dies zum Beispiel bei der Rekonstituierung des Römischen Reiches unter Karl dem Großen sehen oder bei der Formierung der großen Monarchien während des Ancien Régime. Wenn ein Fluss mäandriert, bedeutet dies noch nicht, dass er aufwärts und weg vom Meer fließt! Dasselbe trifft auf den Nachkriegsboom zu: Die Bourgeoisie erwies sich als fähig, eine kurze Phase starken Wachstums im allgemeinen Verlauf der Überlebtheit zu kreieren.
Die Große Depression von 1929 in den Vereinigten Staaten zeigte, wie gewaltsam die Widersprüche des Kapitalismus in einer Wirtschaft ausbrechen, die von der Lohnarbeit bestimmt wird. Man mag daher erwartet haben, dass ihr immer gewaltsamere und häufigere Wirtschaftskrisen folgen werden, aber dies war nicht der Fall. Die Situation hat sich beträchtlich weiterentwickelt, sowohl im Produktionsprozess (Fordismus) als auch im Kräfteverhältnis zwischen den Klassen (und innerhalb derselben). Darüber hinaus hat die Bourgeoisie gewisse Lehren gezogen. Den Jahren der Krise und der Barbarei des Zweiten Weltkrieges folgten somit gute dreißig Jahre eines starken Wachstums, eine Vervierfachung der Reallöhne, Vollbeschäftigung, die Schaffung eines Soziallohns und die Fähigkeit des Systems, die zyklischen Krisen zwar nicht zu vermeiden, aber auf sie zu reagieren. Wie war dies alles möglich?
1) Die Fundamente des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus
Von nun an musste der Kapitalismus mangels adäquater Ventile für seine Widersprüche eine interne Lösung für seine zweifache Beschränkung auf der Ebene der Profite und der Märkte zu finden. Die hohe Profitrate wurde durch die großen Steigerungen in der Arbeitsproduktivität dank des industriellen Fordismus (Fließband kombiniert mit Schichtarbeit) ermöglicht. Und die Märkte, auf denen diese enormen Warenmengen verkauft werden sollten, wurden durch die Ausweitung der Produktion, durch Staatsinterventionen und vielfältige Systeme zur Koppelung der Reallöhne an die Produktivität garantiert. Dies ermöglichte es, die Nachfrage parallel zur Produktion zu steigern (s. Graphik Nr. 4). Durch die Stabilisierung des Lohnanteils am Gesamtvermögen war der Kapitalismus somit eine Zeitlang in der Lage die Überproduktion zu vermeiden, die „(...) grade daraus hervor[geht], dass die Masse des Volks nie mehr als die average quantity of necessaries [durchschnittliche Menge der lebenswichtigen Güter] konsumieren kann, ihre Konsumtion also nicht entsprechend wächst mit der Produktivität der Arbeit."[26]
Diese Analyse wurde von Paul Mattick und anderen Revolutionären damals übernommen, um die Nachkriegsprosperität zu analysieren: „Es ist unleugbar, dass die Löhne in der modernen Epoche gestiegen sind. Aber nur im Rahmen der Kapitalexpansion, die voraussetzt, dass das Verhältnis der Löhne zu den Profiten im Allgemeinen konstant bleibt. Die Arbeitsproduktivität sollte daher mit einer Schnelligkeit wachsen, die es ermöglichen würde, sowohl Kapital zu akkumulieren und den Lebensstandard der Arbeiter anzuheben."[27] Dies ist der wirtschaftliche Hauptmechanismus des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus. Er wird von der parallelen Entwicklung der Löhne und der Arbeitsproduktivität während dieser Periode empirisch bestätigt.
Den spontanen Dynamiken des Kapitalismus entsprechend (Konkurrenz, Lohndruck, etc.), kann ein solches System nur in der Zwangsjacke eines Staatskapitalismus lebensfähig sein, der vertraglich eine Dreiteilung der Resultate der gestiegenen Produktivität zwischen den Profiten, Löhnen und Staatseinkünften garantiert. Eine Gesellschaft, die vom Lohnarbeitsverhältnis beherrscht wird, zwingt der gesamten Politik de facto eine gesellschaftliche Dimension auf, die von der herrschenden Klasse angenommen wurde. Dies setzt die Errichtung von vielfältigen sozialen und wirtschaftlichen Kontrollen, von gesellschaftlichen Stoßdämpfern, etc. voraus. Zweck dieser beispiellosen Aufblähung des Staatskapitalismus war es, die explosiven gesellschaftlichen Widersprüche des Systems innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Ordnung aufzufangen: Vorherrschaft der Exekutive über die Legislative, bedeutsame Steigerung der Staatsinterventionen in der Wirtschaft (fast die Hälfte des BSP in den OECD-Ländern), gesellschaftliche Kontrolle der Arbeiterklasse, etc.
2) Ursprünge, Widersprüche und Grenzen des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus
Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad (Januar 1943) begannen die politischen, gewerkschaftlichen und Arbeitgeberrepräsentanten im Londoner Exil intensive Diskussionen über die Reorganisation der Gesellschaft nach dem nun unvermeidbaren Zusammenbruch der Achsenmächte. Die Erinnerung an die Jahre der Depression und die Furcht vor sozialen Bewegungen am Ende des Krieges, die aus der Krise von 1929 gezogenen Lehren, die immer breitere Akzeptanz der Notwendigkeit von Staatsinterventionen und die durch den Kalten Krieg geschaffene Bipolarität sollten die Elemente sein, die die Bourgeoisie dazu veranlassten, die Spielregeln zu modifizieren und mehr oder weniger bewusst diesen keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus auszuarbeiten, der sich als praktikabel erwies und nach und nach in allen entwickelten Ländern (OECD) eingepflanzt wurde. Die Verteilung der Produktivitätssteigerungen wurde von allen um so leichter akzeptiert, als: a) sie stark anstiegen, b) diese Neuverteilung die Steigerung der zahlungsfähigen Nachfrage parallel zur Produktion garantierte, c) sie den sozialen Frieden bot, d) der soziale Frieden umso leichter erhalten werden konnte, als das Proletariat in Wahrheit besiegt aus dem Zweiten Weltkrieg heraustrat, unter der Kontrolle von Parteien und Gewerkschaften zugunsten des Wiederaufbaus innerhalb dieses Systems, e) sie aber gleichzeitig die langfristige Rentabilität der Investitionen garantierten, f) wie auch eine hohe Profitrate.
Das System war also zeitweise imstande, die Quadratur des Kreises, die parallele Steigerung der Profitproduktion und der Märkte, zu bewerkstelligen, in einer Welt, in der die Nachfrage fortan größtenteils von jener bestimmt wurde, die aus der Lohnarbeit herrührt. Die garantierte Steigerung der Profite, der Staatsausgaben und der Anstieg der Löhne waren in der Lage, die Endnachfrage zu gewährleisten, die so entscheidend ist, wenn das Kapital seine Akkumulation fortsetzen will. Der keynesianisch-fordistische Staatskapitalismus ist die Antwort, die das System zeitweise auf die Krisen der Senilitätsphase des Kapitalismus geben konnte, die wesentlich weltweite, durch das Lohnarbeitsverhältnis bestimmte Krisen sind. Er ermöglichte momentan ein auf sich selbst beruhendes Funktionieren des Kapitalismus, ohne die Notwendigkeit, Zuflucht in Produktionsverlagerungen zu suchen, trotz hohen Löhnen und Vollbeschäftigung, während er es ihm gleichzeitig ermöglichte, seine Kolonien loszuwerden, die künftig nur einen geringen Nutzen hatten, und die innere außerkapitalistische Bauernwirtschaft zu eliminieren, deren Aktivitäten fortan subventioniert werden mussten.
Vom Ende der 1960er Jahre bis 1982 verschlechterten sich sämtliche Bedingungen, die den Erfolg dieser Maßnahmen ermöglicht hatten, beginnend mit einer fortschreitenden Verlangsamung im Produktivitätsanstieg, der überall um ein Drittel gekürzt wurde, und zogen alle anderen ökonomischen Variablen mit sich hinunter. Die innere Regulierung, die zeitweilig vom keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus entdeckt worden war, hatte also kein dauerhaftes Fundament.
Jedoch waren die Gründe, die die Schaffung dieses Systems erfordert hatten, immer noch da: Die Lohnarbeit ist in der arbeitenden Bevölkerung vorherrschend, und daher war der Kapitalismus gezwungen, ein Mittel zur Stabilisierung der Endnachfrage zu finden, um ihren Zerfall zu vermeiden, der andernfalls zu einer Depression führen würde. Da Betriebsinvestitionen durch die Nachfrage bedingt sind, war es notwendig, andere Mittel zur Aufrechterhaltung des Konsums zu finden. Die Antwort wurde unvermeidlicherweise in den Zwillingsfaktoren der abnehmenden Ersparnisse und der steigenden Schulden gefunden. Dies schuf den Anreiz zur Spekulation und zur Produktion von Finanzblasen. Die konstante Erschwerung der Ausbalancierung des Systems ist somit nicht das Resultat von Irrtümern bei der Ausübung der Wirtschaftspolitik; sie ist ein integraler Bestandteil des Modells.
3) Schlussfolgerung: und morgen?
Dieser Abstieg in die Hölle ist in der gegenwärtigen Situation umso unvermeidlicher, als die Bedingungen für eine Wiedererholung der Produktivitätssteigerungen und eine Rückkehr zu ihrer dreiseitigen Verteilung gesellschaftlich nicht mehr vorhanden sind. Es gibt nichts Greifbares in den wirtschaftlichen Bedingungen, im gegenwärtigen Kräfteverhältnis zwischen den Klassen und in der imperialistischen Konkurrenz auf der internationalen Ebene, das irgendeinen Ausweg offen lässt: Alle Bedingungen sind gegeben für einen unerbittlichen Abstieg in die Hölle. Es liegt an den Revolutionären, zum Bewusstsein der Klassenkämpfe beizutragen, die unvermeidlich aus den sich vertiefenden Widersprüchen des Kapitalismus entstehen werden.
C. Mcl
[1] Gauche Communiste de France (Französische Kommunistische Linke)
[2] Internationalisme, Nr. 46, 1952.
[3] „Sie ist ferner beschränkt durch den Akkumulationstrieb, den Trieb nach Vergrößerung des Kapitals und nach Produktion von Mehrwert auf erweiterter Stufenleiter. Dies ist das Gesetz für die kapitalistische Produktion, gegeben durch die beständigen Revolutionen in den Produktionsmethoden selbst, die damit beständig verknüpfte Entwertung von vorhandnem Kapital, den allgemeinen Konkurrenzkampf und die Notwendigkeit, die Produktion zu verbessern und ihre Stufenleiter auszudehnen, bloß als Erhaltungsmittel und bei Strafe des Untergangs." (Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 254, MEW)
[4] Marx, Das Kapital, Bd. 3, V. Abschnitt, S. 499, MEW.
[5] „In demselben Maße also, worin sich mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Wertumfang und die Lebensdauer des angewandten fixen Kapitals entwickelt, entwickelte sich das Leben der Industrie und des industriellen Kapitals in jeder besondren Anlage zu einem vieljährigen, sage im Durchschnitt zehnjährigen Zyklus (...) Durch diesen eine Reihe von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen, in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt sich eine materielle Grundlage der periodischen Krisen..." (Marx, Das Kapital, Bd. 2, II. Abschnitt, S. 185, MEW)
[6] Marx, das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 259 und 265, MEW.
[7] „Wenn wir einen aufwärts sich entwickelnden Kapitalismus betrachten, so finden wir dieselben Schwankungen, nur geht die Kurve nach oben. Wenn wir eine verfallende kapitalistische Gesellschaft beobachten, so geht die Kurve nach unten, die Entwicklung bewegt sich aber immer in diesen Schwankungen.
Aus der Tabelle der Januarnummer der „Times" ersehen wir die Epoche von 138 Jahren, von der Zeit der Kriege für die Unabhängigkeit Nordamerikas bis zum heutigen Tage. Im Laufe dieser Zeit hatten wir, wenn ich nicht irre, 16 Zyklen, das heißt 16 Krisen und 16 Hochkonjunkturen. Auf jeden Zyklus entfallen ungefähr 8 ½ Jahre, fast 9 Jahre." (Trotzki, Die wirtschaftliche Krise und die neuen Aufgaben der Kommunistischen Internationale, Protokolle der Komintern-Kongresse, 23. Juni 1921)
[8] „...Das erstrangige Ziel des Kapitalisten ist ein neuer Produktionszyklus, der ihm neuen Mehrwert einbringt (...) Die mit beinahe mathematischer Regelmäßigkeit wiederkehrenden Krisen bilden einer der spezifischen Züge der kapitalistischen Produktionsweise." (Mitchell, Bilan, Nr. 10, „Krisen und Zyklen in der Wirtschaft des niedergehenden Kapitalismus")
[9] In Graphik Nr. 1 sind die neun Rezessionen, die die zehn Zyklen interpunktieren, durch die von oben nach unten durchlaufenden Liniengruppen dargestellt: 1949, 1954, 1958, 1960, 1970-71, 1974, 1980-81, 1991, 2001.
[10] „Sobald das auspreßbare Quantum Mehrarbeit in Waren vergegenständlicht ist, ist der Mehrwert produziert. Aber mit dieser Produktion des Mehrwerts ist nur der erste Akt des kapitalistischen Produktionsprozesses, der unmittelbare Produktionsprozeß beendet. Das Kapital hat soundsoviel unbezahlte Arbeit eingesaugt. Mit dieser Entwicklung des Prozesses, der sich im Fall der Profitrate ausdrückt, schwillt die Masse des so produzierten Mehrwerts ins Ungeheure. Nun kommt der zweite Akt des Prozesses. Die gesamte Warenmasse, das Gesamtprodukt, sowohl der Teil, der das konstante und variable Kapital ersetzt, wieder den Mehrwert darstellt, muß verkauft werden. Geschieht das nicht oder nur zum Teil oder nur zu Preisen, die unter den Produktionspreisen stehn, so ist der Arbeiter zwar exploitiert, aber seine Exploitation realisiert sich nicht als solche für den Kapitalisten, kann mit gar keiner oder nur teilweiser Realisation des abgepreßten Mehrwerts, ja mit teilweisem oder ganzem Verlust seines Kapital verbunden sein." (Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 254, MEW)
[11] Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW, Bd. 26.2, XVII. Kapitel, S. 535)
[12] Marx, Das Kapital, Bd. 3, V. Abschnitt. S. 501 MEW. Diese Analyse von Marx hat selbstverständlich nichts mit der Theorie der Unterkonsumtion als Krisenursache zu tun - eine Theorie, die er tatsächlich kritisierte: „Es ist reine Tautologie zu sagen, daß die Krisen aus Mangel an zahlungsfähiger Konsumtion oder an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehn. Andere Konsumarten als zahlende kennt das kapitalistische System nicht, ausgenommen die sub forma pauperis oder die des ‚Spitzbuben‘. Daß Waren unverkäuflich sind, heißt nichts, als daß sich keine zahlungsfähigen Käufer für sie fanden, also Konsumenten (sei es nun, daß die Waren in letzter Instanz zum Behuf produktiver oder individueller Konsumtion gekauft werden). Will man aber dieser Tautologie einen Schein tiefrer Begründung dadurch geben, daß man sagt, die Arbeiterklasse erhalte einen zu geringen Teil ihres eignen Produkts, und dem Übelstand werde mithin abgeholfen, sobald sie größern Anteil davon empfängt, ihr Arbeitslohn folglich wächst, so ist nur zu vermerken, daß die Krisen jedesmal vorbereitet werden durch eine Periode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt und die Arbeiterklasse realiter größern Anteil an dem für Konsumtion bestimmten Teil des jährlichen Produkts erhält." (Marx, Das Kapital, Bd. 2, III. Abschnitt, MEW, S. 409)
[13] Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 268, MEW.
[14] Jeder dieser drei Faktoren wird von Marx in der folgenden Passage identifiziert: „Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich auseinander. Die einen sind nur beschränkt durch die Produktivkraft der Gesellschaft, die andren durch die Proportionalität der verschiednen Produktionszweige und durch die Konsumtionskraft der Gesellschaft. Diese letztre aber ist bestimmt weder durch die absolute Produktionskraft noch durch die absolute Konsumtionskraft; sondern durch Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer Distributionsverhältnisse, welche die Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein nur innerhalb mehr oder minder enge Grenzen veränderliches Minimum reduziert. Sie ist ferner beschränkt durch den Akkumulationstrieb, den Trieb nach Vergrößerung des Kapitals und nach Produktion von Mehrwert auf erweiterter Stufenleiter." (Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 254, MEW)
[15] Marx, Theorien über den Mehrwert, von uns rückübersetzt aus dem Französischen.
[16] „Da die Märkte und die Produktion unabhängige Faktoren sind, muss die Ausweitung des einen nicht unbedingt dem Wachstum des anderen entsprechen" (unsere Übersetzung aus der französischen Version der Grundrisse von Marx, La Pléiade, Economie II, S. 489). Oder noch einmal: „Die Bedingungen der unmittelbaren Exploitation und die ihrer Realisation sind nicht identisch. Sie fallen nicht nur nach Zeit und Ort, sondern auch begrifflich auseinander." (Marx, Kapital, Bd. 3)
[17] Es ist umso wichtiger, die Idee abzulehnen, dass die Überproduktionskrisen eine einzige Ursache haben, als ihre Ursachen sowohl für Marx als auch in der Realität weitaus komplexer sind: die Anarchie der Produktion, die Disproportionalität zwischen den beiden Hauptsektoren der Wirtschaft, der Gegensatz zwischen „geliehenem Kapital" und „Produktivkapital", die Trennung zwischen Kauf und Verkauf nach Schatzbildung etc. Dennoch sind die beiden Hauptursachen, die von Marx am vollständigsten analysiert worden sind, und auch die wichtigsten in der Realität die beiden, auf die wir hier stets bestanden haben: der Fall der Profitrate und die Gesetze, die die Verteilung des Mehrwerts bestimmen.
[18] Wie zum Beispiel die lange Periode der steigenden Reallöhne in der zweiten Hälfte des Aufstiegs des Kapitalismus (1870-1914), während des Nachkriegsbooms (1945-82) oder ihr relativer und gar absoluter Fall seitdem (1982-2008).
[19] Es ist selbstverständlich, dass eine Rentabilitätskrise unweigerlich zu einem endemischen Zustand der Überproduktion sowohl des Kapitals als auch der Waren führt. Jedoch tauchten diese Phänomene der Überproduktion nach der Rentabilitätskrise auf und wurden dann Gegenstand einer Auffangpolitik sowohl des Staates (Produktionsquoten, Umstrukturierungen, etc.) als auch von Privaten (Fusionen, Rationalisierung, Übernahmen, etc.).
[20] In den 1970er Jahren litt die Arbeiterklasse in der Krise im Wesentlichen unter einem Verfall der Arbeitsbedingungen, Umstrukturierungen und Entlassungen und seither unter einem spektakulären Anstieg der Arbeitslosigkeit. Jedoch führte, anders als in der Krise von 1929, diese Arbeitslosigkeit nicht zu einer Spirale der Rezession dank dem Einsatz von keynesianischen sozialen Stoßdämpfern: Arbeitslosenunterstützung, Auffangmaßnahmen, planmäßige Entlassungen, etc.
[21] Für Marx ist die Arbeitsproduktivität der wahre Schlüssel der Entfaltung des Kapitalismus, da sie nichts anderes ist als das umgekehrte Verhältnis des Wertgesetzes, mit anderen Worten: der gesellschaftlich notwendigen durchschnittlichen Arbeitszeit für die Warenproduktion. Unser Artikel über die Krise in der Internationalen Revue, Nr. 33 enthält eine Graphik, die die Arbeitsproduktivität für die G6-Staaten (USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien) von 1961 bis 2003 zeigt. Sie zeigt deutlich, dass der Fall der Arbeitsproduktivität allen anderen Variablen vorausgeht und dass sie seither auf einem tiefen Niveau geblieben ist.
[22] Marx, Das Kapital, Bd. 3, III. Abschnitt, S. 255, MEW.
[23] Jedes Akkumulationsregime, das die historische Entwicklung des Kapitalismus ausgezeichnet hat, hat spezifische Beziehungen mit seiner äußeren Sphäre erzeugt: vom Merkantilismus der Länder der Iberischen Halbinsel über den Kolonialismus des viktorianischen Britannien zum selbst-zentrierten Kapitalismus des Nachkriegsbooms - es gibt keine Uniformität in den Beziehungen zwischen dem Herzen des Kapitalismus und der Peripherie, wie Rosa Luxemburg annahm, sondern eine gemischte Abfolge von Beziehungen, die alle von diesen unterschiedlichen inneren Bedürfnissen der Kapitalakkumulation angetrieben werden.
[24] Im 19. Jahrhundert, als die Kolonialmärkte am wichtigsten waren, wuchsen ALLE NICHT-kolonialen Länder schneller als die Kolonialländer (71% schneller im Durchschnitt). Diese Beobachtung ist in der gesamten Geschichte des Kapitalismus zutreffend. Verkäufe außerhalb des reinen Kapitalismus ermöglichten es sicherlich individuellen Kapitalisten, ihre Waren zu realisieren, doch behinderten sie eine globale Akkumulation des Kapitalismus, da sie, wie die Waffen, materiellen Mitteln entsprechen, die den Kreislauf der Akkumulation verlassen.
[25] „...das Kapitalverhältnis wird zu einer Schranke für die Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit. Wenn dieser Punkt erreicht ist, tritt das Kapital, d.h. die Lohnarbeit, in dasselbe Verhältnis gegenüber der Entwicklung gesellschaftlichen Reichtums und der Produktivkräfte wie das Zunftsystem, Leibeigenschaft, Sklaverei, und es wird als Fessel abgestreift" (Marx, Grundrisse, Das Kapitel vom Kapital, Heft VII, eigene Rückübersetzung aus dem Englischen)
[26] Marx, Theorien über den Mehrwert, Sechzehntes Kapitel, S. 469, MEW Bd. 26.2
[27] Paul Mattick, Intégration capitaliste et rupture ouvrière, EDI, S. 151, unsere Übersetzung.
Aktuelles und Laufendes:
- Keynesianismus [363]
- Fordismus [364]
- Wirtschaftswunder [365]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [37]
Internationale Revue 44
- 2933 Aufrufe
18. Kongress der IKS: Auf dem Weg zur Umgruppierung der internationalistischen Kräfte
- 3078 Aufrufe
In der Aktivitätenresolution der IKS, die durch den Kongressangenommen wurde, schrieben wir:
„Die Beschleunigung der historischen Lage, wie sie in derGeschichte der Arbeiterbewegung noch nie vorgekommen ist, ist durch dasZusammentreffen der beiden folgenden Dimensionen gekennzeichnet:
- dieAusweitung der ernsthaftesten offenen Wirtschaftskrise in der Geschichte desKapitalismus, verbunden mit der Zuspitzung der imperialistischen Spannungen undseit 2003 einem langsamen, aber sich ausweitenden Voranschreiten der Reifung inder Arbeiterklasse, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite;
- unddie Entfaltung einer internationalistischen Milieus, die vor allem in denLändern der Peripherie des Kapitalismus spürbar ist.
Diese Beschleunigung erhöht noch die politische Verantwortungder IKS, stellte noch höhere Anforderungen an sie hinsichtlich dertheoretischen/politischen Analyse und der Intervention im Klassenkampf undgegenüber den Leuten, die auf der Suche sind (...)".
Die Bilanz, die wir nach dem 18. internationalen Kongressunserer Organisation ziehen können, misst sich also an ihrer Fähigkeit, dieserVerantwortung gerecht zu werden.
Für eine wirkliche und ernsthafte kommunistische Organisationist es immer heikel, lauthals zu verkünden, dass diese oder jene Aktion einErfolg gewesen sei. Dies aus verschiedenen Gründen.
Zunächst einmal deshalb, weil sich die Frage, ob eineOrganisation, die für die kommunistische Revolution kämpft, ihrer Verantwortunggewachsen ist, nicht kurzfristig beurteilen lässt, sondern nur auf lange Sicht,denn obwohl eine solche Organisation ständig in der geschichtlichen Realitätder Gegenwart verankert ist, besteht ihre Rolle meistens nicht darin, dieseunmittelbare Realität zu beeinflussen, mindestens nicht im grossen Stil,sondern die zukünftigen Ereignisse vorzubereiten.
Zweitens aber auch deshalb, weil bei den Mitgliedern einerkommunistischen Organisation immer die Gefahr besteht, die „Dinge zubeschönigen", überaus nachlässig zu sein gegenüber den Schwächen einesKollektivs, für dessen Existenz sie sich hingeben, ihre ganze Energie einsetzenund das sie dauernd gegen Angriffe verteidigen müssen, die von den offenen undversteckten Verteidigern der kapitalistischen Gesellschaft gegen es geführtwerden. Die Geschichte zeigt uns, dass es immer wieder überzeugte und dem Zieldes Kommunismus treue Militante gegeben hat, die aus „Parteipatriotismus" blindwaren, die Schwächen, das Entgleisen, ja den Verrat ihrer Organisation zuerkennen. Auch heute gibt es unter den Leuten, die eine kommunistischePerspektive verteidigen, solche, die meinen, dass ihre Gruppe, deren Mitgliederman oft an den Fingern einer Hand zählen kann, die einzige „InternationaleKommunistische Partei" sei, der sich eines Tages die proletarischen Massenanschliessen würden, solche, die keine Kritik hören und keine Debatte führenund meinen, alle anderen Gruppen des proletarischen Milieus seienFälscher.
Im Bewusstsein dieser Gefahr, sich Illusionen zu machen, undmit der nötigen Vorsicht, die sich daraus ergibt, scheuen wir uns nicht zubehaupten, dass der 18. Kongress der IKS sich auf der Höhe der Anforderungenbefand, wie sie weiter oben erwähnt worden sind, und dass er dieVoraussetzungen geschaffen hat, damit wir unsere Aktivitäten auf diesem Wegfortsetzen können.
Wir können hier nicht über alle Faktoren, die diese Behauptungstützen, Rechenschaft ablegen. Wir heben hier nur die wichtigsten hervor:
- dieTatsache, dass der Kongress mit der Ratifizierung der Integration zweier neuerterritorialer Sektionen der IKS eröffnet werden konnte, nämlich der Sektionenauf den Philippinen und in der Türkei;
- dieAnwesenheit von vier Gruppen des proletarischen Milieus;
- diePolitik der Öffnung unserer Organisation gegenüber aussen, welche namentlichdurch diese Teilnahme anderer Gruppen veranschaulicht wird;
- derWille unserer Organisation, sich mit möglichst grosser Klarheit mit denSchwierigkeiten und Schwächen zu beschäftigen, die wir überwinden müssen;
- diebrüderliche und begeisterte Stimmung, von der die Arbeiten des Kongressesgetragen waren.
DieAufnahme von zwei neuen territorialen Sektionen
Unsere Presse hat bereits darüber berichtet, dass auf denPhilippinen und in der Türkei zwei neue Sektionen der IKS entstanden sind (derKongress war zuständig dafür, die Integrationen, die das Zentralorgan unsererOrganisation im Januar 2009 beschlossen hat, zu bestätigen).[1]Wie wir bei dieser Gelegenheit festgehalten hatten: „Die Integration dieserbeiden neuen Sektionen in unsere Organisation erweitert somit beträchtlich diegeographische Ausdehnung der IKS." Wir hoben auch die beiden folgendenTatsachen bezüglich dieser Integrationen hervor:
- Sieberuhten nicht auf einer Hauruck-„Rekrutierung" (welche Mode ist bei denTrotzkisten und leider auch bei gewissen Gruppen des proletarischen Lagers),sondern waren das Ergebnis, wie dies bei der IKS üblich ist, einer Arbeit mitVertiefungsdiskussionen während mehrerer Jahre mit den Genossen von EKS in derTürkei und Internasyonalismo auf den Philippinen, eines Prozesses, über den wirin unserer Presse Zeugnis ablegten;
- sie widerlegten den Vorwurf des„Eurozentrismus", der oft gegen unsere Organisationen erhoben wird.
Die Aufnahme von zwei neuen Sektionen ist nicht etwasAlltägliches für unsere Organisation. Die letzte Integration geht ins Jahr 1995zurück, als die Schweizer Sektion aufgenommen wurde. Das heisst, dass dieAnkunft dieser beiden neuen Sektionen (die auf die Bildung eines Kerns inBrasilien 2007 folgte) von der Gesamtheit der Mitglieder als ein sehr wichtigesund positives Ereignis empfunden wurde. Sie bestätigt einerseits die Analyse,die unsere Organisation seit einigen Jahren über das neue, in der gegenwärtigenhistorischen Situation angelegte Potential zur Entwicklung desKlassenbewusstseins macht, andererseits die Gültigkeit der Politik, die wirgegenüber den Gruppen und Einzelpersonen führen, die sich den revolutionärenPositionen zuwenden. Dies gilt umso mehr, als am Kongress Delegationen von vierGruppen des internationalistischen Milieus anwesend waren.
DieAnwesenheit von internationalistischen Gruppen
In der Bilanz, die wir über denvorangegangenen Kongress der IKS zogen, unterstrichen wir, wie wichtig die(nach Jahrzehnten wieder erstmalige) Anwesenheit von vier Gruppen desinternationalistischen Milieus war, die aus Brasilien, Südkorea, denPhilippinen und der Türkei kamen. Dieses Mal waren wieder vier Gruppen diesesMilieus anwesend. Doch war dies nicht Ausdruck eines Stillstandes, denn zweider Gruppen, die am letzten Kongress als Gäste dabei waren, sind seither Sektionender IKS geworden, und wir haben das Vergnügen gehabt, zwei neue Gruppen zuempfangen: eine zweite Gruppe aus Korea und eine Gruppe aus Zentralamerika(Nicaragua und Costa Rica), die LECO (Liga por la emancipación de la claseobrera), die auch schon am „Treffen von internationalistischen Kommunisten"[2] teilgenommen hatte, das in diesem Frühjahr inLateinamerika auf Anregung der IKS und der OPOP stattgefunden hatte, derinternationalistischen Gruppe in Brasilien, mit der unsere Organisation schonseit mehreren Jahren brüderliche und sehr positive Beziehungen unterhält. DieseGruppe nahm erneut am Kongress teil. Noch weitere Gruppen, die an jenem Treffenin Lateinamerika teilgenommen hatten, waren ebenfalls zum Kongress eingeladenworden, konnten aber keine Delegation schicken, da Europa sich je länger jemehr in eine Festung gegenüber Personen verwandelt, die nicht zum sehr kleinenund geschlossenen Kreis der „reichen Länder" gehören.
Die Anwesenheit von Gruppen desinternationalistischen Milieus war ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg desKongresses und insbesondere auch für die Stimmung bei den Diskussionen. DieseGenossen gingen mit den Mitgliedern unserer Organisation sehr herzlich um,warfen Fragen auf, insbesondere zur Wirtschaftskrise und zum Klassenkampf, diefür uns und unsere internen Debatten ungewohnt waren und somit die Reflexion inder ganzen Organisation nur anregen konnten.
Schliesslich stellte die Teilnahme dieserGenossen ein zusätzliches Element bei der Politik der Öffnung dar, die sich dieIKS seit einigen Jahren als Ziel vorgenommen hat - einer Öffnung gegenüber denanderen proletarischen Gruppen, aber auch gegenüber Leuten, die sichkommunistischen Positionen annähern. Eine Öffnung auch unserer Sorgen undReflexionen, namentlich hinsichtlich der Forschung und der Entdeckungen aufwissenschaftlichem Gebiet[3], die sich konkretisiert hat in der Einladung einesMitgliedes der Wissenschaftszunft zu einer Sitzung des Kongresses.
DieEinladung eines Wissenschafters
Um auf unsere Weise das „Darwin-Jahr" zu begehen und einer inunserer Organisation stattfindenden Entwicklung des Interesses fürwissenschaftliche Fragen Rechnung zu tragen, fragten wird einen Forscher, dersich auf das Thema der Entstehung der Sprache spezialisiert hat (und Autoreinen Werks mit dem Titel Aux origines du langageist), ob er auf dem Kongress eine Einführung in seine Arbeiten mache, dienatürlich auf der Darwinschen Methode beruhen. Die neuen Ideen Jean-LouisDessalles'[4]auf dem Gebiet der Sprache, zu ihrer Rolle bei der Entwicklung dergesellschaftlichen Beziehungen und der Solidarität in der Gattung Mensch,stehen in Zusammenhang mit den Ideen und Diskussionen, die in unsererOrganisation zu Themen wie Ethik oder Debattenkultur geführt werden. Auf dieEinführung dieses Forschers folgte eine Debatte, die wir gezwungen waren,vorzeitig zu einem Ende zu bringen (da wir unter dem Druck der Tagesordnungstanden), die aber ohne weiteres noch Stunden hätte dauern können - so starkwar die Leidenschaft, in welche sich die meisten Teilnehmer und Teilnehmerinnendes Kongresses durch die aufgeworfenen Fragen versetzen liessen.
Wir möchten hier Jean-Louis Dessalles noch einmal für dieseTeilnahme danken, der - obwohl keineswegs einig mit unseren politischen Ideen -sehr herzlich und unter Hingabe eines Teils seiner Zeit dazu beigetragen hat,die Reflexion in unserer Organisation zu bereichern. Wir möchten ebenfalls diefreundliche und angenehme Art seiner Antworten hervorheben, die er auf dieFragen und Einwände der IKS-Mitglieder gab.
Die amKongress geführten Diskussionen
Die Arbeit des Kongresses drehte sich um die klassischenPunkte einer solchen Tagung:
- dieAnalyse der internationalen Lage;
- dieTätigkeiten und das Leben unserer Organisation.
Die Resolution zur internationalen Lage ist eine ArtZusammenfassung der Diskussionen am Kongress über die Einschätzung deraktuellen Weltlage. Sie kann natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen, die inden Diskussionen aufgeworfen wurden (nicht einmal all diejenigen, die in den Berichtenim Vorfeld des Kongresses auftauchten). Sie verfolgt die folgenden dreiHauptziele:
- diewirklichen Ursachen und Konsequenzen der gegenwärtigen und bisher absoluteinzigartigen Wirtschaftskrise des kapitalistischen Systems zu begreifenangesichts aller Verschleierungen, welche die Verteidiger des Systemsunablässig kolportieren;
- dieAuswirkungen der Machtergreifung in den USA durch den Demokraten Barack Obamaauf die imperialistischen Auseinandersetzungen zu verstehen, der angekündigtwurde als einer, der etwas Neues zu diesen Konflikten zu sagen habe undHoffnung auf eine Abschwächung derselben wecken soll;
- die Perspektiven für den Klassenkampfvorzuschlagen, insbesondere unter den neuen Bedingungen der brutalen Angriffe,die das Proletariat aufgrund der Gewalt der Wirtschaftskrise zu erleidenbegonnen hat.
Was den ersten Aspekt betrifft, das Verständnis derKonsequenzen der gegenwärtigen Krise des Kapitalismus, so gilt es vor allemfolgende Aspekte zu unterstreichen:
„(...) die gegenwärtige Krise (ist) die schlimmste seit dergrossen Depression, welche 1929 einsetzte. (...) So ist die Finanzkrise nicht dieWurzel der gegenwärtigen Rezession. Im Gegenteil, die Finanzkrise verdeutlichtnur die Tatsache, dass die Flucht in die Verschuldung, die die Überwindung derÜberproduktion ermöglicht hatte, nicht endlos lange fortgesetzt werden kann.(...) Auch wenn das kapitalistische System nicht wie ein Kartenhauszusammenstürzen wird (...), bleibt die Perspektive die eines immer stärkerenVersinkens in der historischen Sackgasse und der Vorbereitung von nochgrösseren Erschütterungen als jene, die wir heute erleben."
Selbstverständlich hat der Kongress nicht alle Fragenabschliessend beantworten können, die die gegenwärtige Krise des Kapitalismusaufwirft. Dies einerseits deshalb, weil jeder Tag neue Erscheinungen der Krisebringt, die die Revolutionäre zwingen, die Entwicklung der Lage ständig undaufmerksam zu verfolgen und die Diskussion auf der Grundlage der neuen Elementefortzusetzen. Andererseits aber auch deshalb, weil unsere Organisation beieiner ganzen Anzahl von Gesichtspunkten in der Analyse der Krise desKapitalismus nicht homogen ist. Dies ist unseres Erachtens keineswegs einZeichen der Schwäche der IKS. Vielmehr haben sich die auf marxistischer Grundlagegeführten Debatten über die Frage der Krisen des kapitalistischen Systems durchdie ganze Geschichte der Arbeiterbewegung hindurchgezogen. Die IKS hat auchschon damit begonnen, gewisse Aspekte ihrer internen Debatten über diese Fragezu veröffentlichen[5], dadiese Diskussionen nicht „Privateigentum" unserer Organisation sind, sondernder Arbeiterklasse insgesamt gehören. Und sie ist fest entschlossen, diesen Wegweiter zu verfolgen. So verlangt denn auch die Resolution über die Perspektiveder Aktivitäten unserer Organisation, die der Kongress verabschiedete,ausdrücklich, dass sich die Debatten bei weiteren Fragen der Analyse dergegenwärtigen Krise entwickelt, damit die IKS so gut wie möglich gewappnet ist,um klare Antworten auf die Fragen zu geben, die die Krise der Arbeiterklasseund denjenigen Leuten stellt, die entschlossen sind, sich in den Kampf für eineÜberwindung des Kapitalismus einzureihen.
Betreffend die „neue Tatsache", die durch Wahl Obamasgeschaffen wurde, nimmt die Resolution, wie folgt, Stellung:
„Somit ist die Perspektive, vor der die Welt nach der Wahl vonObama zum Präsidenten der grössten Weltmacht steht, nicht grundsätzlichverschieden von der Lage, die bis heute vorgeherrscht hat: Fortsetzung derKonfrontationen zwischen erst- und zweitrangigen Imperialisten, Fortdauer derKriegsbarbarei mit immer tragischeren Folgen für die direkt betroffeneBevölkerung (Hungersnöte, Epidemie, Flüchtlingsströme)."
Schliesslich versucht die Resolution hinsichtlich derPerspektive des Klassenkampfes die Auswirkungen der brutalen Verschlimmerungder kapitalistischen Krise einzuschätzen, wie dies auch die Genossen amKongress getan haben:
„Die gegenwärtige Zuspitzung der Krise des Kapitalismus bildetein wichtiges Element in der Entwicklung der Kämpfe der Arbeiterklasse. (...)Damit reifen die Bedingungen für eine mögliche Entfaltung der Einsicht in denReihen des Proletariates, dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Doch esgenügt nicht, wenn die Arbeiterklasse feststellt, dass der Kapitalismus ineiner Sackgasse steckt und einer anderen Gesellschaft Platz machen sollte,damit sie in die Lage versetzt wird, sich eine revolutionäre Perspektive zugeben. Es braucht auch die Überzeugung, dass eine solche Perspektive möglichist und dass die Arbeiterklasse die Kraft hat, sie umzusetzen. (...) Damit dasBewusstsein über die Möglichkeit der kommunistischen Revolution in derArbeiterklasse wirklich an Boden gewinnen kann, muss diese Vertrauen in ihreeigenen Kräfte gewinnen, und dies geschieht in massenhaften Kämpfen. Dergewaltige Angriff, der schon jetzt auf Weltebene gegen sie geführt wird, müssteeine objektive Grundlage für solche Kämpfe darstellen. Doch die wichtigsteForm, in der diese Angriffe stattfinden - Massenentlassungen -, läuft der Entwicklungsolcher Kämpfe zunächst zuwider. (...) Selbst wenn es also in der nächsten Zeitkeine bedeutende Antwort der Arbeiterklasse auf die Angriffe gibt, dürfen wirnicht denken, dass sie aufgehört habe, für die Verteidigung ihrer Interessen zukämpfen. Erst in einer zweiten Phase (...) werden sich Arbeiterkämpfe ingrösserem Ausmass entwickeln können."
DieDiskussion über die Aktivitäten und das Leben der IKS
Ein Bericht wurde vorgestellt, der dazu bestimmt war, diewichtigsten gegenwärtig vertretenen Positionen in den laufendenVertiefungsdiskussionen in der IKS zusammenzufassen. Ein wichtiger Teil dieserDiskussionen war in den vorangegangenen zwei Jahren der Wirtschaftsfragegewidmet. Auf die Divergenzen, die sich dabei entwickelten, haben wir schonweiter oben im vorliegenden Artikel hingewiesen.
Ein weiterer Teil unserer Diskussionen betraf die Frage des menschlichenWesens, der menschlichen Natur,die auch zu einer leidenschaftlichen Debatte führte, die von zahlreichen undwertvollen Beiträgen gespiesen wurde. Diese Debatte ist noch lange nichtabgeschlossen, zeigt aber eine allgemeine Übereinstimmung mit denOrientierungstexten, die wir in der InternationalenRevue veröffentlicht haben, nämlich DasVertrauen und die Solidarität im Kampf des Proletariats(Nr. 31 und 32), Marxismus und Ethik(Nr. 39 und 40) oder Die Debattenkultur: eine Waffe desKlassenkampfs (Nr. 41), wobei es noch zahlreicheFragezeichen oder Vorbehalte beim einen oder anderen Aspekt gibt. Sobald dieseMeinungsunterschiede genügend herausgearbeitet sind, um ausserhalbveröffentlicht zu werden, wird die IKS in der Tradition der Arbeiterbewegungdiesen Schritt vollziehen. Es bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass einGenosse der belgisch-holländischen Sektion kürzlich tiefe Unstimmigkeiten mitden drei zuvor zitierten Texten zum Ausdruck gebracht hat („kürzlich", bezogenauf die doch teilweise schon weit zurückliegende Erstveröffentlichung derTexte), wobei er diese als unmarxistisch betrachtet und die Organisationinzwischen verlassen hat.
Was die Diskussionen über die Aktivitäten und das Leben derIKS betrifft, zog der Kongress für die massgebende Zeit eine positive Bilanz,wenn auch Schwächen blieben, die es zu überwinden gilt:
„Die Bilanz der Aktivitäten der letzten zwei Jahre zeigt die politischeVitalität der IKS, ihre Fähigkeit, mit der geschichtlichen Situation inTuchfühlung zu sein, sich zu öffnen, eine aktive Rolle bei der Entwicklung desKlassenbewusstseins zu spielen, ihren Willen, sich für Initiativen einergemeinsamen Arbeit mit anderen revolutionären Kräften zu engagieren. (...) Aufder Ebene des internen Organisationslebens ist die Bilanz der Tätigkeiten auchpositiv trotz wirklicher Schwächen, die insbesondere auf der Ebene desOrganisationsgewebes und in geringerem Ausmass bei der Zentralisierung weiterbestehen" (Aktivitätenresolution der IKS).
Der Kongress widmete einen Teil derDiskussionen der Aufgabe, die organisatorischen Schwächen zu untersuchen, diees bei uns gibt. Diese sind nicht eine „Besonderheit" der IKS, sondern vielmehrdas Los aller Organisationen der Arbeiterbewegung, die ständig dem Gewicht derherrschenden bürgerlichen Ideologie unterworfen sind. Die wirkliche Stärkedieser Organisationen, die namentlich bei den Bolschewiki zum Ausdruck kam,bestand jeweils darin, in der Lage zu sein, die Schwächen mit möglichst grosserKlarheit anzupacken, um sie zu bekämpfen. Von diesem Geist waren die Debattenam Kongress über diese Frage beseelt.
Einer der diskutierten Punkte betraf dieSchwächen, von denen unsere Sektion in Belgien-Holland betroffen war, aus dereine kleine Zahl von Mitgliedern kürzlich austrat, und zwar in der Folge vonAnschuldigungen, die der Genosse M. erhob. Seit einiger Zeit beschuldigtedieser unsere Organisation und insbesondere die ständige Kommission ihresZentralorgans, sich von der Debattenkultur abzuwenden, über die dervorangegangene Kongress lange diskutiert[6] und die der Kongress als unabdingbar für die Fähigkeitrevolutionärer Organisationen erachtet hatte, ihre Verantwortung wahrzunehmen.Der Genosse M., der eine Minderheitsposition bei der Analyse derWirtschaftskrise vertrat, fühlte sich als Opfer einer „Ächtung" (Ostrazismus)und fand, dass seine Positionen absichtlich „diskreditiert" worden seien, damitdie IKS nicht darüber diskutieren könne. Mit diesen Anschuldigungenkonfrontiert, beschloss das Zentralorgan der IKS, dass eine besondereKommission gebildet werden sollte, deren drei Mitglieder der Genosse M. selberbestimmte und die nach monatelanger Arbeit mit Anhörungen und der Untersuchungvon Hunderten von Seiten von Dokumenten zum Schluss gelangte, dass dieAnschuldigungen nicht berechtigt waren. Der Kongress konnte nur bedauern, dassder Genosse M. und ein Teil der weiteren Genossen, die ihm folgten, nicht dieBekanntgabe der Schlussfolgerungen dieser Kommission abwarteten, bevor sieentschieden, die IKS zu verlassen.
Tatsächlich konnte der Kongress insbesondere in der Diskussionüber die internen Debatten feststellen, dass es heute in unserer Organisationeine echte Sorge für die Entfaltung ihrer Debattenkultur gibt. Und es warennicht nur die Mitglieder der IKS, die dies feststellten: Die Delegierten dereingeladenen Organisationen zogen die gleichen Schlussfolgerungen aus denArbeiten des Kongresses:
„Die Debattenkultur der IKS, der Genossen der IKS ist sehreindrücklich. Wenn ich nach Korea zurückkehre, werde ich meine Erfahrungenmeinen Genossen dort weitergeben." (eine der Gruppen aus Korea)
„Er (der Kongress) ist eine gute Gelegenheit, um meinePositionen zu klären; in vielen Diskussionen habe ich eine wirklicheDebattenkultur vorgefunden. Ich denke, dass ich viel tun muss, um dieBeziehungen zwischen (meiner Gruppe) und der IKS zu verstärken und ich habe dieAbsicht, dies zu tun. Ich hoffe, dass wir eines Tages zusammen arbeiten könnenfür eine kommunistische Gesellschaft." (die andere Gruppe aus Korea)[7]
Die IKS pflegt die Debattenkultur nicht einfach alle zweiJahre einmal aus Anlass ihres internationalen Kongresses, sie ist auchständiger Teil der Beziehung zwischen beispielsweise der Gruppe OPOP und uns,wie eine Intervention der Delegation von OPOP in der Diskussion über dieWirtschaftskrise bezeugte. Diese Beziehung sei fähig sich zu vertiefen trotzder Divergenzen in verschiedenen Fragen, wie namentlich der Analyse der Wirtschaftskrise:„Ich möchte im Namen von OPOP die Wichtigkeit dieses Kongresses unterstreichen.Für OPOP ist die IKS eine Schwesterorganisation, so wie die Partei von Leninund diejenige von Rosa Luxemburg Geschwister waren. Das heisst, dass es beiihnen, trotz Divergenzen über eine ganze Reihe von Gesichtspunkten, Meinungenund auch theoretischen Auffassungen, eine programmatische Einheit gab, was dieNotwendigkeit eines revolutionären Umsturzes der bürgerlichen Ordnung und derErrichtung einer Diktatur des Proletariats betrifft, der sofortigen Enteignungder Bourgeoisie und des Kapitals."
Die andere Schwierigkeit, die die Aktivitätenresolutionhervorhebt, betrifft die Frage der Zentralisierung. Nicht zuletzt mit derAbsicht, diese Schwierigkeiten zu überwinden, stellte der Kongress auch eineDiskussion über einen allgemeineren Text zur Zentralisierung auf dieTagesordnung. Diese Diskussion war nicht nur nützlich, um die kommunistischeAuffassung über dieses Thema bei der alten Garde aufzufrischen und zu präzisieren,sondern erwies sich auch als überaus wichtig für die neuen Genossen undGenossinnen und die neuen Sektionen, die kürzlich in die IKS aufgenommenwurden.
In der Tat war ein Wesenszug des 18. Kongresses der IKS dieTeilnahme einer beträchtlichen Anzahl „neuer Köpfe", was alle „Alten" mit einergewissen Überraschung feststellten, wobei bei den Neuen die junge Generationbesonders vertreten war.
DieBegeisterung für die Zukunft
Dass die Jugend an diesem Kongress sostark auftrat, machte einen wichtigen Teil der Dynamik und der Begeisterung inseinem Verlauf aus. Ganz anders als die bürgerlichen Medien betreibt die IKSkeinen „Kult der Jugend"; doch die Ankunft einer neuen Generation vonMitgliedern in unserer Organisation ist höchst bedeutungsvoll für die Perspektiveder proletarischen Revolution. Einerseits stellt sie - wie bei einem Eisberg -den „sichtbaren Teil" eines tiefer greifenden Prozesses der Bewusstseinsreifungin der Arbeiterklasse dar. Andererseits schafft sie die Bedingungen für dieAblösung der kommunistischen Kräfte. Wie es die Resolution über dieinternationale Lage, die auf dem Kongress verabschiedet wurde, formuliert: „DerWeg ist lang und schwierig, aber das soll die Revolutionäre nicht entmutigen,soll sie nicht in ihren Bemühungen um den proletarischen Kampf lähmen. Ganz imGegenteil!" Auch wenn die „alten" Mitglieder der IKS ihre ganze Überzeugung undihr Engagement beibehalten, so wird es doch an dieser neuen Generation liegen,einen entscheidenden Beitrag zu den zukünftigen revolutionären Kämpfen desProletariats zu leisten. Und schon heute zeugen mehrere Qualitäten der neuenGeneration, die als solche von ihren am Kongress anwesenden Vertretern aucherkannt wurden, von der Fähigkeit, diese Verantwortung zu übernehmen: derbrüderliche Geist, der Wille zum Zusammentreffen, zur gemeinsamen Offenlegungder Fallen, die uns die Bourgeoisie stellt, das Verantwortungsgefühl. Dies kamunter anderem zum Ausdruck in der Intervention des jungen Delegierten von LECOzum internationalistischen Treffen, das im letzten Frühjahr in Lateinamerikastattfand: „Die Debatte, die wir zu entwickeln beginnen, führt Gruppen undIndividuen zusammen, die auf proletarischer Grundlage eine Einheit suchen,benötigt Räume der internationalistischen Debatte und braucht diesen Kontaktmit den Delegierten der Kommunistischen Linken. Die Radikalisierung der Jugendund der Minderheiten in Lateinamerika, in Asien, werden es ermöglichen, dassdieser Bezugspol von noch mehr Gruppen erkannt wird, die sowohl an Mitgliederwie auch politisch wachsen werden. Das gibt uns die Mittel für dieIntervention, für den Kampf gegen die linksbürgerliche Ideologie, den„Sozialismus des 21. Jahrhunderts", den Sandinismus etc. Die gemeinsamePosition des Lateinamerikanischen Treffens ist schon ein proletarischesWerkzeug. Ich begrüsse die Interventionen der Genossen, die einen wirklichenInternationalismus ausdrücken, eine Sorge für diesen politischen undzahlenmässigen Fortschritt der Kommunistischen Linken auf Weltebene."
IKS 12. Juli 2009
[1] Vgl. Ein Willkommensgruss an die neuenSektionen der IKS in der Türkei und den Philippinen inWeltrevolution Nr. 153 und aufder Webseite.
[2] Vgl. zu diesem Treffen unseren Artikel Stellungnahmeeines Treffens kommunistischer Internationalisten in Lateinamerika in Weltrevolution Nr. 154 und auf unserer Webseite.
[3] Wie dies schon in verschiedenen Artikeln zum Ausdruck gekommen ist,die wir neulich zu Darwin und zum Darwinismus veröffentlicht haben.
[4] Wer sich ein Bild über diese Reflexionen machen will, kann dieWebseite Jean-Louis Dessalles' besuchen: https://perso.telecom-paristech.fr/~jld [366]
[5] Vgl. insbesondere in dieser Revue den Artikel Interne Debatte in derIKS (III): Die Ursachen für dieAufschwungperiode nach dem Zweiten Weltkrieg.
[6] Vgl. dazu Der 17. Kongress der IKS: Eineinternationale Verstärkung des proletarischen Lagersin Internationale Revue Nr. 40 und unseren Orientierungstext DieDebattenkultur: Eine Waffe des Klassenkampfes in InternationaleRevue Nr. 41.
[7] Dieser Eindruck über die Qualität der am Kongress gepflegtenDebattenkultur wurde auch durch den von uns eingeladenen Wissenschafterhervorgehoben. Er schickte uns die folgende Nachricht: „Danke noch für dieausgezeichnete Interaktion, die ich mit der Marx-Gemeinde haben konnte. Ich habewirklich einen sehr guten Augenblick erlebt."
Politische Strömungen und Verweise:
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [106]
Dekadenz des Kapitalismus (II)
- 3516 Aufrufe
Welche wissenschaftlicheMethode benötigen wir, um die gegenwärtige gesellschaftliche Ordnung und dieBedingungen und Mittel ihrer Aufhebung zu verstehen?
Aufstieg und Fall früherer Produktionsweisen
In diesem Artikel setzen wir die in der letztenAusgabe der Internationalen Revue(Nr. 43) begonnene Untersuchung derwissenschaftlichen und historischen Methode fort, die Marx, Engels und ihreNachfolger entwickelten.
„In breiten Umrissen können asiatische,antike, feudale und modern bürgerliche Produktionsweisen als progressiveEpochen der ökonomischen Gesellschaftsformation bezeichnet werden.“[1]
Die Interpretation dieser kurzen Passage,die im Grunde die gesamte geschriebene Geschichte der Menschheit überspannt,würde Bücher füllen. Für unsere Zwecke reicht es aus, auf zwei Aspekte zublicken: die allgemeine Frage des historischen Fortschritts und dieCharakteristiken des Aufstiegs und der Dekadenz von gesellschaftlichenFormationen vor dem Kapitalismus.
Gibtes Fortschritt?
Wir haben angemerkt[2],dass eine der Auswirkungen der Katastrophen des 20. Jahrhunderts eineallgemeine Skepsis gegenüber der Fortschrittsidee ist, einem Begriff, der im19. Jahrhundert weitaus selbstverständlicher war. Diese Skepsis hat einige„radikale“ Seelen zum Schluss verleitet, dass die marxistische Vision deshistorischen Fortschritts an sich nur eine dieser Ideologien des 19.Jahrhunderts sei, die als Vorwand für die kapitalistische Ausbeutung gedienthätten. Auch wenn sie sich dabei oftmals als etwas Neues präsentieren, wärmendiese Kritiker lediglich die abgedroschenen Argumente Bakunins und derAnarchisten auf, die postulierten, dass die Revolution zu jeder Zeit möglichsei, und die die Marxisten beschuldigten, ganz gewöhnliche Reformisten zu sein,weil jene argumentierten, dass die Epoche der Revolution noch nicht angebrochensei, was für die Arbeiterklasse bedeutete, sich langfristig zur Verteidigungihrer Lebensbedingungen innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung zuorganisieren. Die Anti-Progressiven beginnen gelegentlich mit einer„marxistischen“ Kritik an der Auffassung, dass der Kapitalismus heute dekadentist, indem sie behaupten, dass sich im Leben des Kapitals seit den Tagen, alsMarx darüber schrieb, wenig geändert habe, ausser vielleicht auf der reinquantitativen Ebene – grössere Ökonomie, grössere Krisen, grössere Kriege. Dochdie konsequenteren unter ihnen entledigen sich schnell der ganzen Last deshistorischen Materialismus und bestehen darauf, dass der Kommunismus auch inallen früheren Epochen der Geschichte hätte entstehen können. In der Tat sinddie Konsequentesten unter ihnen jene „Ursprünglichen“, die argumentieren, dasses seit dem Aufkommen der Zivilisation und faktisch seit der Entdeckung derLandwirtschaft, die jene ermöglicht hatte, überhaupt keinen Fortschritt in derGeschichte gegeben habe: Alles, was folgte, wird als Fehlentwicklungbetrachtet; sie gehen davon aus, dass die glücklichste Epoche im menschlichenLeben die Stufe der Jäger und Sammler gewesen sei. Solche Strömungen könnenlogischerweise nur sehnsüchtig dem endgültigen Zusammenbruch der Zivilisationund der Auslöschung eines grossen Teils der Menschheit entgegenfiebern, so dasseine Rückkehr zum Jagen und Sammeln für die wenigen Überlebenden einst wiederpraktikabel werden könnte.
Marx dagegen rückte keinen Millimeter vonder Idee ab, dass nur der Kapitalismus den Weg für die Überwindung dergesellschaftlichen Antagonismen und für die Schaffung einer Gesellschaft ebnenkönne, die es der Menschheit ermöglicht, sich in ihrer ganzen Fülle zuentwickeln. Wie er im Vorwort fortfährt: „Die bürgerlichenProduktionsverhältnisse sind die letzte antagonistische Form desgesellschaftlichen Produktionsprozesses, antagonistisch nicht im Sinn vonindividuellem Antagonismus, sondern eines aus den gesellschaftlichenLebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden Antagonismus, aber die imSchoss der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden Produktivkräfteschaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses Antagonismus.“
Der Kapitalismus schuf erstmals dieVorbedingungen für eine kommunistische Weltgesellschaft: durch die Vereinigungdes gesamten Globus in sein Produktionssystem; durch die Revolutionierung derProduktionsmittel bis zu dem Punkt, wo letztlich eine Gesellschaft desÜberflusses möglich ist; dadurch, dass eine Klasse in die Welt gesetzt wurde,deren eigene Emanzipation allein durch die Emanzipation der gesamten Menschheitgeschehen kann – das Proletariat, die erste ausgebeutete Klasse in der Geschichte,die in sich die Saat einer neuen Gesellschaft trägt. Für Marx war es undenkbar,dass die Menschheit diese Stufe in der Geschichte einfach überspringen könnteund eine dauerhafte, globale kommunistische Gesellschaft in den Epochen desDespotismus, der Sklaverei oder der Leibeigenschaft in die Welt hätte setzenkönnen.
Doch der Kapitalismus erschien nicht ausdem Nichts: Die Produktionsweisen vor dem Kapitalismus hatten umgekehrt den Wegfür ihn geebnet, und in diesem Sinn hatte die gesamte Entwicklung dieserantagonistischen, d.h. in Klassen geteilten Gesellschaftssysteme einefortschrittliche Bewegung in der menschlichen Geschichte repräsentiert, diezuletzt in die materielle Möglichkeit einer klassenlosen Weltgemeinschaft mündet. Es gibt also keine Grundlage,um das Erbe von Marx für sich zu beanspruchen und gleichzeitig denFortschrittsbegriff als bürgerlich abzulehnen.
Tatsächlich gibt es eine bürgerlicheVersion des Fortschritts und, im Gegensatz dazu, eine marxistische.
Während die Bourgeoisie dazu neigte, diegesamte Geschichte als etwas zu betrachten, das unaufhaltsam zum Triumph desdemokratischen Kapitalismus führt, als einen nach oben gerichteten, linearenFortschritt, bei dem alle vorherigen Gesellschaften in allen Belangen dergegenwärtigen Ordnung der Dinge unterlegen waren, geht der Marxismus vomdialektischen Charakter der historischen Bewegung aus. In der Tat bedeutet dereigentliche Begriff des Aufstiegs und Niedergangs von Produktionsweisen, dasses neben Fortschritten auch Rückschläge im historischen Prozess gibt. ImAnti-Dühring lenkt Engels, als er auf Fourier und seine Antizipation deshistorischen Materialismus zu sprechen kommt, die Aufmerksamkeit auf dieVerknüpfung zwischen der dialektischen Sichtweise der Geschichte und dem Begriffdes Aufstiegs und Niedergangs: „Am grossartigsten aber erscheint Fourier inseiner Auffassung der Geschichte der Gesellschaft (…) Fourier, wie man sieht,handhabt die Dialektik mit derselben Meisterschaft wie sein Zeitgenosse Hegel.Mit gleicher Dialektik hebt er hervor, gegenüber dem Gerede von derunbegrenzten menschlichen Vervollkommnungsfähigkeit, dass jede geschichtlichePhase ihren aufsteigenden, aber auch ihren absteigenden Ast hat, und wendetdiese Anschauungsweise auch auf die Zukunft der gesamten Menschheit an.“[3]
Was Engels hier sagt, ist, dass demProzess der historischen Evolution nichts Automatisches anhaftet. Wie derProzess der natürlichen Evolution ist die „menschlicheVervollkommnungsfähigkeit“ nicht im Voraus programmiert. Wie wir sehen werden,kann es, analog zu den Dinosauriern, tatsächlich gesellschaftliche Sackgassengeben – Gesellschaften, die nicht nur niedergehen, sondern vollkommenverschwinden und nichts Neues aus ihrer Mitte in die Welt setzen.
Darüber hinaus hat der Fortschritt, wenner denn stattfindet, einen zutiefst widersprüchlichen Charakter. DieVernichtung der handwerklichen Produktion, in welcher der Produzent noch in derLage war, sowohl im Produktionsprozess als auch durch das EndproduktBefriedigung zu erlangen, und ihre Ersetzung durch das Fabriksystem mit seinergeisttötenden Routine ist ein klarer Fall dafür. Doch Engels erklärt diesüberzeugend, wenn er den Übergang vom Urkommunismus zur Klassengesellschaftbeschreibt. In Ursprung der Familie, desPrivateigentums und des Staates kommt Engels, nachdemer sowohl die immensen Stärken als auch die ihm innewohnenden Einschränkungendes Stammeslebens aufgezeigt hat, zu folgenden Schlussfolgerungen darüber, wieman die Ankunft der Zivilisation betrachten sollte:
„Die Macht der naturwüchsigen Gemeinwesenmusste gebrochen werden – sie wurde gebrochen. Aber sie wurde gebrochen durchEinflüsse, die uns von vornherein als eine Degradation erscheinen, als einSündenfall von der einfachen sittlichen Höhe der alten Gentilgesellschaft. Essind die niedrigsten Interessen – gemeine Habgier, brutale Genusssucht,schmutziger Geiz, eigensüchtiger Raub am Gemeinbesitz –, die die neuezivilisierte, die Klassengesellschaft einweihen; es sind die schmählichstenMittel – Diebstahl, Vergewaltigung, Hinterlist, Verrat, die die alteGentilgesellschaft unterhöhlen und zu Fall bringen. Und die neue Gesellschaftselbst, während der ganzen dritthalbtausend Jahre ihres Bestehns, ist nie etwasandres gewesen als die Entwicklung der kleinen Minderzahl auf Kosten derausgebeuteten und unterdrückten grossen Mehrzahl, und sie ist dies jetzt mehrals je zuvor.“ (MEW, Bd. 21, S. 97)
Diese dialektische Betrachtungsweiserichtet sich auch auf die künftige kommunistische Gesellschaft, die in Marx‘schöner Passage in Ökonomische und Philosophische Manuskripte 1844 als „alswirkliche Aneignung des menschlichenWesens durch und für den Menschen; darum als vollständige, bewusst undinnerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordne Rückkehr desMenschen für sich als eines gesellschaftlichen,d.h. menschlichen Menschen“ beschrieben wird. Auf dieselbe Weise wird derkünftige Kommunismus als Wiedergeburt des Kommunismus der Vergangenheit aufhöherer Ebene betrachtet. So beschliesst Engels sein Buch über die Ursprüngedes Staates mit einem eloquenten Satz des Anthropologen Lewis Morgan, der einenKommunismus vorwegnimmt, der „eine Wiederbelebung – aber in höherer Form – derFreiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit der alten Gentes“ sein wird.[4]
Doch angesichts all dieserQualifizierungen wird aus dem Vorwort ersichtlich, dass derFortschrittsbegriff, der Begriff der „fortschrittlichen Epochen“ für dasmarxistische Denken fundamental ist. In der grandiosen Vision des Marxismus,die mit dem Auftreten der Menschheit beginnt und den Bogen spannt vomErscheinen der Klassengesellschaft, über die Entwicklung des Kapitalismus biszum grossen Sprung ins Reich der Freiheit, das in der Zukunft auf uns wartet,ist „die Welt nicht als ein Komplex von fertigen Dingen zu fassen (…), sondernals ein Komplex von Prozessen, worin die scheinbar stabilen Dinge nicht minderwie ihre Gedankenabbilder in unserm Kopf, die Begriffe, eine ununterbrocheneVeränderung des Werdens und Vergehens durchmachen, in der bei aller scheinbarenZufälligkeit und trotz aller momentanen Rückläufigkeit schliesslich einefortschreitende Entwicklung sich durchsetzt“[5]Aus der damaligen Distanz betrachtet, wird ersichtlich, dass es einen realenEntwicklungsprozess gibt: auf der Ebene der Fähigkeit der Menschheit, auf dieNatur durch die Entwicklung von immer raffinierteren Werkzeugen einzuwirken;auf der Ebene des subjektiven Verständnisses des Menschen von sich selbst undder Welt um ihn herum und somit auf der Ebene der Fähigkeit des Menschen, seineschlummernden Kräfte freizulassen und ein Leben in Übereinstimmung mit seinentiefsten Bedürfnissen zu führen.
Die Aufeinanderfolge der Produktionsweisen
VomUrkommunismus zur Klassengesellschaft
Als Marx einen „breiten Umriss“ derprinzipiellen Produktionsweisen schuf, die sich gegenseitig beerbten, solltedies keinesfalls erschöpfend sein. So erwähnte er lediglich „antagonistische“Gesellschaftsformen, d.h. die Hauptformen der Klassengesellschaft, und äussertesich nicht über die vielfältigen Formen nicht-ausbeutender Gesellschaften, dieihnen vorausgingen. Das Studium der vorkapitalistischen Gesellschaftsformenbefand sich zu Marx´ Tagen noch in den Kinderschuhen, so dass es schlicht undeinfach unmöglich war, eine umfassende Liste aller bisher existierenden Gesellschaftenzu erstellen. In der Tat bleibt diese Aufgabe selbst beim gegenwärtigen Standder historischen Kenntnisse äusserst schwer zu vervollständigen. In der langenPeriode zwischen der Auflösung der ursprünglichen urkommunistischengesellschaftlichen Verhältnisse, die ihre klarste Form unter den nomadischenJägern des Paläolithikums fand, und den vollständig ausgebildetenKlassengesellschaften, die den Anfang der historischen Zivilisationen bildeten,gab es zahllose vermittelnde Übergangsformen wie auch Formen, die schlicht ineiner historischen Sackgasse endeten und über die unsere Kenntnisse sehrbeschränkt bleiben.[6]
Die Nicht-Einbeziehung derurkommunistischen Vor-Klassengesellschaften im Vorwort bedeutet überhauptnicht, dass Marx es als nicht wichtig erachtete, sie zu untersuchen, imGegenteil. Von Anbeginn an erkannten die Begründer derhistorisch-materialistischen Methode, dass die menschliche Geschichte nicht mitdem Privateigentum beginnt, sondern mit dem Gemeineigentum: „Die erste Form desEigentums ist das Stammeseigentum. Es entspricht der unterentwickelten Stufeder Produktion, auf der ein Volk von Jagd und Fischfang, von Viehzucht oderhöchstens vom Ackerbau sich nährt. Es setzt in diesem letzteren Falle einegrosse Masse unbebauter Ländereien voraus. Die Teilung der Arbeit ist aufdieser Stufe noch sehr wenig entwickelt und beschränkt sich auf eine weitereAusdehnung der in der Familie gegebenen naturwüchsigen Teilung der Arbeit.“ [7]
Als diese Einsichten durch spätereForschungen – besonders durch das Werk von Lewis Henry Morgan über dieIndianerstämme Nordamerikas – bestätigt wurden, war Marx äusserst begeistertund verwendete einen grossen Teil seiner späten Jahre dafür, sich in dasProblem der urgesellschaftlichen Verhältnisse zu vertiefen, besonders imZusammenhang mit den Fragen, die ihm die revolutionäre Bewegung in Russlandstellte (siehe das Kapitel „Past and future communism“ in unserem BuchCommunism is not a nice idea but a material necessity). Nach Ansicht von Marx,Engels und auch von Rosa Luxemburg, die sehr ausgiebig darüber in ihrerEinführung in die Nationalökonomie (1907) schrieb, war die Entdeckung, dass dieursprünglichen Formen der menschlichen Beziehungen nicht auf Egoismus undKonkurrenz basierten, sondern auf Solidarität und Kooperation, und dass selbstJahrhunderte nach der Ankunft der Klassengesellschaft es noch immer ein tiefesund fortdauerndes Band zu den gemeinschaftlichen Gesellschaftsformen gab,insbesondere unter den unterdrückten und ausgebeuteten Klassen, eine deutliche Bestätigung derkommunistischen Weltanschauung und eine mächtige Waffe gegen dieMystifikationen der Bourgeoisie, für die die Gier nach Macht und Eigentumtypisch für die menschliche Natur ist.
In Engels‘ Ursprung der Familie, desPrivateigentums und des Staates, in Marx‘ Ethnologischen Exzerpten undLuxemburgs Einführung in die Nationalökonomie gibt es einen hohen Respekt vordem Mut, der Moral und der künstlerischen Kreativität der „wilden“ und„barbarischen“ Völker. Aber es gibt keine Idealisierung dieser Gesellschaften.Der Kommunismus, der in den frühesten Formen der menschlichen Gesellschaftpraktiziert wurde, wurde nicht durch die Idee der Gleichheit inspiriert,sondern durch die bittere Notwendigkeit erzeugt. Er war die einzig mögliche Formder gesellschaftlichen Organisation unter Bedingungen, wo die menschlichenProduktionskapazitäten noch nicht ein ausreichendes gesellschaftlichesMehrprodukt herstellen konnten, um eine privilegierte Elite, eine herrschendeKlasse zu ernähren.
Urkommunistische Verhältnisse tratenaller Wahrscheinlichkeit nach mit der Entwicklung der Menschheit auf, einerSpezies, deren Fähigkeit, ihre Umwelt umzuwandeln, um ihre materiellenBedürfnisse zu befriedigen, sie von allen anderen Bewohnern des Tierreichsunterschied. Diese Fähigkeiten erlaubten es den menschlichen Wesen, zurvorherrschenden Spezies auf dem Planeten zu werden. Doch wenn wir das, was wirüber die archaischste Form des Urkommunismus wissen und über die AboriginesAustraliens herausgefunden haben, verallgemeinern können, kommen wir zurErkenntnis, dass die Aneignungsformen des gesellschaftlichen Produkts, dievöllig kollektiv waren[8],auch die Entwicklung der individuellen Produktivität zurückhielten, mit demResultat, dass die Produktivkräfte im Grunde über Jahrtausende hinwegunverändert blieben. In jedem Fall machten wechselnde materielle undökologische Bedingungen, wie das Wachstum der Bevölkerung, den extremenKollektivismus der ersten Formen menschlicher Gesellschaft ab einem bestimmtenPunkt immer unhaltbarer, zu einem Hindernis der Weiterentwicklung vonProduktionstechniken (wie das Hirtentum und die Landwirtschaft), die grössereBevölkerungen oder Bevölkerungen, die nun unter veränderten materiellen undUmweltbedingungen lebten, hätten ernähren können.[9]
Wie Marx bemerkte: „Die Geschichte desVerfalls der Urgemeinschaften (…) ist noch zu schreiben. Bisher hat man dazunur magere Skizzen geliefert. Aber auf jeden Fall ist die Forschung weit genugvorgeschritten, um zu bestätigen (…) dass die Ursachen ihres Verfalls von denökonomischen Gegebenheiten herrühren, die sie hinderten, eine gewisse Stufe derEntwicklung zu überschreiten“.[10]Das Ableben des Urkommunismus und der Aufstieg der Klassenteilungen tut denallgemeinen Regeln, die im Vorwort umrissen wurden, keinen Abbruch: DieVerhältnisse, die die menschlichen Wesen schufen, um ihre Bedürfnisse zubefriedigen, waren immer weniger in der Lage, ihre ursprüngliche Funktion zuerfüllen, und stürzten daher in eine fundamentale Krise, mit der Folge, dassdie Gemeinwesen, die sie stützten, entweder verschwanden oder die altenVerhältnisse durch neue ersetzten wurden, die besser in der Lage waren, dieProduktivität der menschlichen Arbeit weiterzuentwickeln. Wir haben bereitsgesehen, dass Engels darauf bestand, dass an einem bestimmten historischenMoment die „Macht dieser naturwüchsigen Gemeinwesen (…) gebrochen werden(musste) – sie wurde gebrochen.“ Warum? „Der Stamm blieb die Grenze für denMenschen, sowohl dem Stammesfremden als auch sich selbst gegenüber: Der Stamm,die Gens und ihre Einrichtungen waren heilig und unantastbar, waren eine vonNatur gegebne höhere Macht, der der einzelne in Fühlen, Denken und Tununbedingt untertan blieb. So imposant die Leute dieser Epoche uns erscheinen,so sehr sind sie ununterschieden einer vom andern, sie hängen noch, wie Marxsagt, an der Nabelschnur des naturwüchsigen Gemeinwesens.“ [11]
Im Licht anthropologischer Hinweise magman die Behauptung von Engels anfechten, dass es den Menschen in denStammesgesellschaften völlig an Individualität gefehlt hatte. Doch die Einsichtin diesen Zeilen bleibt gültig: dass in einer Reihe von Schlüsselmomenten undSchlüsselregionen die alten Methoden und Verhältnisse der Gemeinwirtschaft zueiner Fessel der Weiterentwicklung wurden und, so widersprüchlich es erscheinenmag, der allmähliche Anstieg von individuellem Eigentum, Klassenausbeutung undeine neue Phase in der Selbstentfremdung des Menschen zu Faktoren derWeiterentwicklung wurden.
Die„asiatische“ Produktionsweise
Der Begriff „asiatische Produktionsweise“ist kontrovers. Engels versäumte es unglücklicherweise, das Konzept in seinzukunftsweisendes Werk über den Aufstieg der Klassengesellschaft, Ursprung derFamilie, des Privateigentum und des Staates, einzubinden, obwohl das Werk vonMarx bereits zahllose Bezüge dazu enthielt. Später wurde Engels‘ Versäumnis vonden Stalinisten verschlimmert, die im Grunde genommen das gesamte Konzeptächteten und eine sehr mechanistische und lineare Sichtweise der Geschichtevorstellten, nach der überall die Phasen des Urkommunismus, der Sklaverei, desFeudalismus und des Kapitalismus durchschritten würden. Dieses Schema hattebesondere Vorteile für die stalinistische Bürokratie: Einerseits befähigte essie, lange nachdem die bürgerliche Revolution von der Tagesordnung derWeltgeschichte verschwunden war, den Aufstieg einer fortschrittlichenBourgeoisie in Ländern wie Indien und China auszumachen, nachdem diese einmal„feudal“ getauft worden waren; andererseits erlaubte es ihnen, eine peinlicheKritik an ihrer eigenen Form des Staatsdespotismus zu vermeiden, da im Konzeptdes asiatischen Despotismus der Staat, und nicht eine Klasse von individuellenEigentümern, direkt die Ausbeutung der Arbeitskraft sicherstellt: DieParallelen zum stalinistischen Staatskapitalismus sind unübersehbar.
Doch seriösere Forscher, wie PerryAnderson in einem Anhang zu seinem Buch Lineagesof the Absolutist State, argumentieren, dass Marx‘Charakterisierung Indiens und anderer zeitgenössischer Gesellschaften alsFormen einer eindeutig „asiatischen Produktionsweise“ auf fehlerhaftenInformationen fusste und dass das Konzept in jedem Fall so allgemein gehaltenwurde, dass es an jeglicher präzisen Deutung mangelte.
Sicherlich ist das Attribut „asiatisch“irreführend. In einem grösseren oder kleineren Umfang nahmen alle frühen Formender Klassengesellschaft die Formen an, die von Marx unter diesem Titelanalysiert wurden, ob bei den Sumerern, in Ägypten, Indien, China oder inweiter entfernten Regionen wie Mittel- und Südamerika, Afrika und demPazifikraum. Sie gründete sich auf die Dorfgemeinschaft, einem Erbe der Epochevor dem Erscheinen des Staates. Die Staatsmacht, oft personifiziert durch einePriesterkaste, basierte auf dem Mehrprodukt, das den Dorfgemeinschaften in Formvon Tributen oder, im Fall grosser Bauprojekte (Bewässerung, Tempelbau, etc.)mit Zwangsarbeit (der„Fronarbeit“) entzogen wurde. Es mag bereits Sklaverei existiert haben, abersie war nicht die vorherrschende Form der Arbeit. Wir würden sagen, dass dieseGesellschaften, auch wenn sie untereinander viele bedeutende Unterschiedeaufwiesen, sich in einer Hinsicht glichen, die bei der Klassifizierung einer„antagonistischen“ Produktionsweise am wichtigsten ist: in der Hinsicht dergesellschaftlichen Verhältnisse, durch die das Mehrprodukt aus derausgebeuteten Klasse extrahiert wird.
Wenn wir uns der Untersuchung des Phänomensder Dekadenz in diesen Gesellschaftsformen zuwenden, so stellen wir fest, dasses wie bei den „primitiven“ Gesellschaften insofern eine Reihe von besonderenKennzeichen gibt, als diese Gesellschaften eine aussergewöhnliche Stabilitätoffenbarten und selten, wenn überhaupt, sich zu neuen Produktionsweisen„hinentwickelten“, ohne von aussen unter Schlägen dazu getrieben worden zusein. Es wäre jedoch ein Fehler, die asiatische Gesellschaft als etwas zubetrachten, das sich in der Geschichte nicht bewährt hätte. Es gibt himmelweiteUnterschiede zwischen den ersten despotischen Formen, die auf Hawaii oder inSüdamerika entstanden waren und die ihren ursprünglichen Stammeswurzeln vielnäher standen, und den gigantischen Reichen, die sich in Indien oder China ausbreitetenund die hochentwickelte kulturelle Formen in die Welt setzten.
Dennoch bleibt das zugrundeliegendeMerkmal die Zentralität der Dorfgemeinschaft, die den Schlüssel zur„unveränderlichen“ Natur dieser Gesellschaften liefert.
„Jene uraltertümlichen, kleinen indischenGemeinwesen z.B., die zum Teil noch fortexistieren, beruhn aufgemeinschaftlichem Besitz des Grund und Bodens, auf unmittelbarer Verbindungvon Agrikultur und Handwerk und auf einer festen Teilung der Arbeit, die beiAnlage neuer Gemeinwesen als gegebner Plan und Grundriss dient. Sie bilden sichselbst genügende Produktionsganze, deren Produktionsgebiet von 100 bis aufeinige 1.000 Acreswechselt. Die Hauptmasse der Produkte wird für den unmittelbaren Selbstbedarfder Gemeinde produziert, nicht als Ware, und die Produktion selbst ist daherunabhängig von der durch Warenaustausch vermittelten Teilung der Arbeit imgrossen und ganzen der indischen Gesellschaft. Nur der Überschuss der Produkteverwandelt sich in Ware, zum Teil selbst wieder erst in der Hand des Staats,dem ein bestimmtes Quantum seit undenklichen Zeiten als Naturalrente zufliesst(…) Der einfache produktive Organismus dieser selbstgenügenden Gemeinwesen, diesich beständig in derselben Form reproduzieren und, wenn zufällig zerstört, andemselben Ort, mit demselben Namen, wieder aufbauen, liefert den Schlüssel zumGeheimnis der Unveränderlichkeit asiatischer Gesellschaften, so auffallendkontrastiert durch die beständige Auflösung und Neubildung asiatischer Staatenund rastlosen Dynastenwechsel. Die Struktur der ökonomischen Grundelemente derGesellschaft bleibt von den Stürmen der politischen Wolkenregion unberührt.“ [12]
In dieser Produktionsweise waren dieBarrieren für die Weiterentwicklung der Warenproduktion weitaus höher als imantiken Rom oder im Feudalismus, und dies ist sicherlich der Grund, warum inRegionen, wo sie vorherrschte, der Kapitalismus nicht als Auswuchs des altenSystems erschien, sondern als fremder Eindringling. Es ist gleichermassenbemerkenswert, dass die einzige „östliche“ Gesellschaft, die zu einem gewissenUmfang ihren eigenen unabhängigen Kapitalismus entwickelte, Japan war, wo einFeudalsystem bereits am Platz war.
Somit erschien in dieserGesellschaftsform der Konflikt zwischen den Produktionsverhältnissen und derEvolution der Produktivkräfte oft eher als Stagnation denn als Niedergang, dadie fundamentalen gesellschaftlichen Strukturen stets blieben, während dieDynastien aufstiegen und niedergingen, indem sie sich selbst in unablässigeninneren Konflikten verzehrten und die Gesellschaft unter dem Gewicht riesiger,unproduktiver, „pharaonischer“ Staatsprojekte erdrückten; und wenn keine neuenProduktionsverhältnisse entstanden, lösten die Niedergangsperioden in dieserProduktionsweise im Grunde genommen keine Epochen der sozialen Revolution aus.Dies stimmt völlig mit der allgemeinen Methode von Marx überein, derkeinesfalls einen gradlinigen oder vorbestimmten Pfad der Evolution allerGesellschaftsformationen postulierte und sicherlich die Möglichkeit ins Augefasste, dass Gesellschaften in eine Sackgasse geraten können, in der keineweitere Evolution möglich ist. Wir sollten auch in Erinnerung rufen, dasseinige der isolierteren Ausdrücke dieser Produktionsweise vollkommenkollabierten, oft weil sie die Grenzen des Wachstums in einer besondersempfindlichen ökologischen Umwelt erreicht hatten. Dies scheint bei derMaya-Kultur der Fall gewesen zu sein, die ihre eigene landwirtschaftlicheGrundlage durch eine exzessive Abholzung der Wälder zerstört hatte. In diesemFall gab es sogar eine bewusste „Rückbildung“ auf Kosten eines grossen Teilsder Bevölkerung, der den Städten den Rücken kehrte und zum Jagen und Sammelnzurückkehrte, obwohl das Gedächtnis an die alte Maya-Zeitrechnung und an dieTraditionen unverdrossen hochgehalten wurde. Andere Kulturen, wie jene auf derOsterinsel, scheinen völlig verschwunden zu sein, aller Wahrscheinlichkeit nachdurch unlösbare Klassenkonflikte, Gewalt und Hunger.
Sklavereiund Feudalismus
Marx und Engels stritten niemals ab, dassihre Kenntnisse über die ursprünglichen und asiatischenGesellschaftsformationen aufgrund des Stands des zeitgenössischen Wissensäusserst beschränkt waren. Sie standen auf viel festerem Boden, wenn sie überdie „antike“ Gesellschaft (d.h. die Sklavengesellschaften Griechenlands undRoms) und über den europäischen Feudalismus schrieben. In der Tat spielte dasStudium dieser Gesellschaften eine bedeutende Rolle in der Erarbeitung ihrerGeschichtstheorie, da sie sehr deutliche Beispiele für den dynamischen Prozesslieferten, durch welchen eine Produktionsweise der anderen folgte. Dies waroffensichtlich in Marx‘ frühen Schriften (Diedeutsche Ideologie), in denen er den Aufstieg desFeudalismus unter den Bedingungen des niedergehenden Roms aufspürt.
„Die dritte Form ist das feudale oderständische Eigentum. Wenn das Altertum von der Stadt und ihrem kleinen Gebietausging, so ging das Mittelalter vom Lande aus. Die vorgefundene dünne, übereine grosse Bodenfläche zersplitterte Bevölkerung, die durch die Erobererkeinen grossen Zuwachs erhielt, bedingte diesen veränderten Ausgangspunkt. ImGegensatz zu Griechenland und Rom beginnt die feudale Entwicklung daher aufeinem viel ausgedehnteren, durch die römischen Eroberungen und die anfangsdamit verknüpfte Ausbreitung der Agrikultur vorbereiteten Terrain. Die letztenJahrhunderte des verfallenden römischen Reichs und die Eroberung durch dieBarbaren selbst zerstörten eine Masse von Produktivkräften; der Ackerbau wargesunken, die Industrie aus Mangel an Absatz verfallen, der Handeleingeschlafen oder gewaltsam unterbrochen, die ländliche und städtischeBevölkerung hatte abgenommen. Diese vorgefundenen Verhältnisse und die dadurchbedingte Weise der Organisation der Eroberung entwickelten unter dem Einflusseder germanischen Heerverfassung das feudale Eigentum. Es beruht, wie das Stamm-und Gemeineigentum, wieder auf einem Gemeinwesen, dem aber nicht wie demantiken die Sklaven, sondern die leibeignen kleinen Bauern als unmittelbarproduzierende Klasse gegenüberstehen.“ (MEW, Band 3, S. 24)
Der eigentliche Begriff „Dekadenz“ rufthäufig Bilder vom späten römischen Imperium hervor – von Orgien undmachttrunkenen Herrschern, von Gladiatorenkämpfen, denen eine riesige,blutdürstende Menge zuschaut. Solche Bilder tendieren sicherlich dazu, sich aufdie „Überbau“-Elemente der römischen Gesellschaft zu konzentrieren, aber siespiegeln eine Realität wider, die sich auch in den Fundamenten desSklavensystems abspielte; und so fühlten sich Revolutionäre wie Engels und RosaLuxemburg berechtigt, auf den Niedergang Roms als eine Art böses Omen dafür zuverweisen, was der Menschheit bevorsteht, wenn es dem Proletariat nichtgelingt, den Kapitalismus zu überwinden: „Untergang jeglicher Kultur, wie imalten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein grosser Friedhof“ [13].
Die antike Sklavengesellschaft war eineweitaus dynamischere Gesellschaftsformation als die asiatischeProduktionsweise, auch wenn Letztere ihren eigenen Beitrag zum Aufstieg derantiken griechischen Kultur und somit zur sklavischen Produktionsweise imAllgemeinen leistete (Ägypten insbesondere war als ehrwürdige Quelle derWeisheit angesehen). Diese Dynamik rührte zu einem grossen Teil aus derTatsache her, dass, wie ein zeitgenössisches Sprichwort sagte, „alles in Romkäuflich ist“: Die Warenform war bis zu dem Punkt fortgeschritten, wo die altenAgrargemeinschaften immer mehr zu einer schönen Erinnerung an ein verlorenesGoldenes Zeitalter wurden und Massen von Menschen selbst zu Waren gewordenwaren, die auf den Sklavenmärkten ge- und verkauft wurden. Auch wenn grosseWirtschaftsgebiete verblieben, wo die produktive Arbeit noch von Kleinbauernoder Handwerkern ausgeübt wurde, übernahm die Sklavenproduktion immer mehr eineSchlüsselrolle in den zentralen Brennpunkten der antiken Ökonomie – auf dengrossen Landgütern, bei öffentlichen Arbeiten und in den Bergwerken. Diesegrosse „Erfindung“ der antiken Welt war für eine beträchtliche Zeit eineeindrucksvolle Entwicklungsform, die es den freien Bürgern erlaubte, sich inmächtigen Armeen zu organisieren, die durch die Eroberung neuer Ländereien fürdas Imperium für frischen Nachschub an Sklaven sorgten. Doch aus dem gleichenGrund kam irgendwann der Punkt, wo die Sklaverei sich in eine eindeutige Fesselder Weiterentwicklung verwandelte. Ihr innewohnender unproduktiver Charakterlag in der Tatsache begründet, dass sie dem Produzenten absolut keinen Anreizbot, das Beste seiner Produktionskapazitäten zu geben; ebenso wenig bot sie demSklavenhalter einen Anreiz, in die Entwicklung besserer Produktionstechniken zuinvestieren, da die Versorgung mit frischen Sklaven stets die billigere Optionwar. Daher die ausserordentliche Kluft zwischen denphilosophisch-wissenschaftlichen Fortschritten, die von einer Klasse vonDenkern erzielt wurden, deren Musse erst auf der Grundlage der Sklavenarbeitmöglich war, und der äusserst beschränkten praktischen Anwendung dertheoretischen oder technischen Fortschritte, die erzielt worden waren. Dies warzum Beispiel der Fall bei der Wassermühle, die solch eine wichtige Rolle beider Entwicklung der feudalen Landwirtschaft spielen sollte. Sie wurdeeigentlich in Palästina zur ersten Jahrhundertwende n. Chr. erfunden, doch fandsie keine allgemeine Verbreitung im Imperium. An einem bestimmten Punkt machtedaher die Unfähigkeit der sklavischen Produktionsweise, die Produktivität derArbeit radikal zu steigern, es in zunehmendem Masse unmöglich, die riesigenArmeen, die erforderlich waren, um sie zu erhöhen, aufrechtzuerhalten. Rom überdehntesich selbst, gefangen im unlösbaren Widerspruch, der sich in all den bekanntenAuswüchsen seines Niedergangs ausdrückte. In Passages from Antiquity toFeudalism zählt der Historiker Perry Anderson einige ökonomische, politischeund militärische Ausdrücke der Verstopfung der Produktivkräfte der römischenGesellschaft durch die Sklavenverhältnisse im frühen 3. Jahrhundert auf: „AbMitte des Jahrhunderts gab es einen völligen Zusammenbruch desSilbermünzsystems, während am Ende des Jahrhunderts die Getreidepreise auf das200fache ihrer Standes in den früheren Principiaten hochschossen. Diepolitische Stabilität degenerierte so schnell wie die monetäre Stabilität. Inden chaotischen fünfzig Jahren von 235 bis 284 gab es nicht weniger als zwanzigKaiser, von denen achtzehn ein gewaltsames Ende fanden, einer im Auslandgefangen war und ein weiterer Opfer der Pest wurde – alle Schicksale Ausdrückeihrer Zeit. Bürgerkriege und Usurpationen waren im Grunde ununterbrochen an derTagesordnung, von Maxismus Thrax bis zu Diocletian. Sie wurden nochverschlimmert durch eine vernichtende Serie von fremden, tief ins Landvorstossenden Invasionen und Angriffen auf die Grenzen (…) Politischer Aufruhrzuhause und fremde Invasionen brachten bald aufeinanderfolgende Epidemien mitsich, die die Völker des Imperiums, die ohnehin durch die Kriegszerstörungdezimiert waren, noch weiter schwächten und reduzierten. Ländereien verödeten,und es entwickelten sich Engpässe bei der Versorgung mit Agrarprodukten. Mitder Abwertung der Währung löste sich das Steuersystem auf, und Steuerbeiträgeverwandelten sich zurück in Beiträge in Naturalien. Der Städtebau kam zu einemabrupten Ende, wie überall im Imperium archäologisch attestiert wurde: ineinigen Regionen schrumpften und schwanden die urbanen Zentren.“ [14]
Anderson zeigt ausserdem, wie dierömische Staatsmacht in ihrer Reaktion auf diese tiefe Krise in Gestalt einerreorganisierten und ausgeweiteten Armee ungeheuer anschwoll und eine gewisseStabilisierung der Gesellschaft erreichte, die etwa hundert Jahre andauernsollte. Doch da „das Anschwellen des Staates von einer Schrumpfung derWirtschaft begleitet wurde“ [15],ebnete diese Wiederbelebung bloss den Weg zur „Endkrise der Antike“, wie er esnennt, indem sie die Notwendigkeit erzwang, die Sklavenverhältnisseabzuschaffen. Ein gleichermassen wichtiger Faktor im Dahinscheiden dersklavischen Produktionsweise war die Häufung von Aufständen von Sklaven undanderen ausgebeuteten und unterdrückten Klassen im gesamten Imperium des 5.Jahrhunderts (wie die so genannten „Bacuadae-Aufstände“), die auf vielbreiterer Basis stattfanden als der Spartacus-Aufstand im ersten Jahrhundert –auch wenn letzterer wegen seiner unglaublichen Kühnheit und der tiefenSehnsucht nach einer besseren Welt, die ihn inspirierte, berechtigterweise inunserer Erinnerung verblieben ist.
Die Dekadenz Roms entsprach somit präziseder Formel von Marx und nahm einen unübersehbar katastrophalen Charakter an.Trotz jüngster Bemühungen seitens bürgerlicher Historiker, sie als einenallmählichen und unmerklichen Prozess darzustellen, manifestierte sich dieDekadenz als eine verheerende Unterproduktionskrise, in der die Gesellschaftimmer weniger in der Lage war, die grundlegenden, lebensnotwendigen Dingeherzustellen – eine wahrhafte Regression der Produktivkräfte, bei der zahlloseKenntnisse und Techniken im Endeffekt verschütt gingen und für Jahrhunderteverschollen blieben. Sie verlief durchaus nicht gradlinig – wie wir bemerkthaben, folgte der grossen Krise des 3. Jahrhunderts eine relative Wiederbelebung,die bis zur letzten Welle barbarischer Invasionen andauerte –, aber sie warunerbittlich.
Der Zusammenbruch des römischen Systemswar die Vorbedingung für das Aufkommen neuer Produktionsverhältnisse, als eineHauptschicht der Grundbesitzer den revolutionären Schritt unternahm, dieSklavenarbeit zugunsten des Fronsystems zu eliminieren – dem Vorläufer derfeudalistischen Leibeigenschaft, in welcher der Produzent, der direkt gezwungenwar, für die Grundbesitzerklasse zu arbeiten, auch ein eigenes Stückchen Landzum Kultivieren erhielt. Die zweite Ingredienz des Feudalismus, die von Marx ineiner Passage in Die deutsche Ideologie erwähnt wird, war das barbarische,„germanische“ Element, das die aufkommende Hierarchie einer Kriegeraristokratiemit den Überbleibseln des Gemeineigentums, das von der Bauernschaft hartnäckigaufrechterhalten worden war, kombinierte. Es folgte eine langeÜbergangsperiode, in der die Sklavenverhältnisse noch nicht vollständigverschwunden waren und das Feudalsystem sich nur allmählich durchsetzte, wobeies seinen wirklichen Aufstieg erst in den ersten Jahrhunderten des neuenJahrtausends erlebte. Auch wenn auf vielen Gebieten (Urbanisierung, relativeUnabhängigkeit des künstlerischen und philosophischen Denkens von der Religion,Medizin, etc.) der Aufstieg der feudalen Gesellschaft, wie wir angemerkt haben,einen markanten Rückschritt im Vergleich zu den Errungenschaften der Antikedarstellte, ist dennoch festzustellen, dass die neuen Gesellschaftsverhältnissesowohl dem Herrn als auch dem Leibeigenen ein direktes Interesse an steigendenErträgen ihrer Landanteile vermittelten und die allgemeine Verbreitung vonwichtigen technischen Fortschritten in der Landwirtschaft gestatteten: deneisernen Pflug und das eiserne Geschirr, das den Einsatz von Zugtierenerlaubte, die Wassermühle, das Drei-Felder-System der Wechselbewirtschaftung,etc. Die neue Produktionsweise ermöglichte so die Wiederbelebung der Städte undein neues Aufblühen der Kultur, was sich am anschaulichsten in den grossenKathedralen und Universitäten ausdrückte, die im 12. und 13. Jahrhundertentstanden.
Doch wie das Sklavensystem vor ihm begannauch der Feudalismus seine „äusseren“ Grenzen zu erreichen.
„... innerhalb der nächsten hundert Jahre(im 13. Jahrhundert) erfasste eine massive, allgemeine Krise den gesamtenKontinent (…) Die grösste Determinante dieser allgemeinen Krise warwahrscheinlich (…) die bis zum Äussersten gehende ‚Inanspruchnnahme‘ derReproduktionsmechanismen des Systems. Insbesondere ist es allem Anschein nachklar, dass der Basismotor der ländlichen Urbarmachung, der die gesamte feudaleÖkonomie drei Jahrhunderte lang angetrieben hatte, im Grunde die objektivenGrenzen sowohl des Terrains als auch der gesellschaftlichen Strukturenüberdehnt hatte. Während die Bevölkerung weiter anwuchs, fielen die Erträge aufden marginalen Ländereien, die noch für die Umwandlung auf dem damalsherrschenden technischen Niveau zur Verfügung standen; fruchtbarer Bodenverödete wegen hastiger oder falscher Bewirtschaftung. Die letzten Reservenzuletzt urbar gemachten Landes waren üblicherweise von schlechter Qualität,nasse oder dünne Erde, deren Bewirtschaftung schwieriger war und auf dieminderwertige Getreidearten wie Hafer ausgesät wurden. Die ältesten Ländereienunter dem Pflug waren ihrerseits zumeist steinalt, ihre Erträge sanken wegender Überholtheit ihrer Kultivierung.“ [16]
Als die Ausweitung der feudalenAgrarökonomie gegen diese Grenzen stiess, folgten katastrophale Konsequenzenfür das gesellschaftliche Leben: Ernteausfälle, Hungersnöte, Zusammenbruch derKornpreise kombiniert mit in die Höhe schnellenden Preisen von Gütern, die inden urbanen Zentren hergestellt wurden:
„Dieser widersprüchliche Prozess betrafden Adel drastisch, denn seine Lebensweise war noch abhängiger von den in denStädten produzierten Luxusgütern geworden (…) während die Erträge aus seinenLandgütern und aus den Abgaben der Leibeigenen fortschreitend zurückgingen. DieFolge war eine Schrumpfung der Einnahmen aus dem Grossgrundbesitz, wasseinerseits eine nie dagewesene Welle von Kriegen auslöste, als die Ritterüberall versuchten, ihre Vermögen durch Plünderungen zurückzugewinnen. InDeutschland und Italien bewirkte dieses Trachten nach Beute in einer Zeit derNot das Phänomen des unorganisierten und archaischen Räubertums einzelnerEdelleute (…) In Frankreich stürzte vor allem der ‚Hundertjährige‘ Krieg – einemörderische Kombination aus Bürgerkrieg zwischen den Capetisten und denburgundischen Herrschaftshäusern sowie einem internationalen Kampf zwischenEngland und Frankreich, unter Einbeziehung der flämischen und iberischen Mächte– das reichste Land Europas in eine Unordnung und Misere ohne Parallele. InEngland bestand der Epilog zur finalen Niederlage in Frankreich in adligem Banditentumwährend den Rosenkriegen (…) Um dieses Panorama der Entvölkerung zuvervollständigen, wurde diese strukturelle Krise durch eine zusätzlicheKatastrophe über die Massen hinaus verschärft – die Invasion des SchwarzenTodes aus Asien 1348.“ [17]
Die Pest, die bis zu einem Drittel dereuropäischen Bevölkerung auslöschte, beschleunigte das Hinscheiden derLeibeigenschaft. Sie brachte einen chronischen Mangel an Arbeitskräften auf demLand mit sich und zwang den Adel, von den traditionellen feudalenArbeitsabgaben auf die Zahlung von Löhnen überzuwechseln; doch gleichzeitigversuchte der Adel, die Uhr anzuhalten, indem er drakonische Restriktionen aufdie Löhne und auf die freie Bewegung von Arbeitskräften erzwang, eineeuropaweite Tendenz, die in klassischer Art in den Statutes of Labourerskodifiziert wurde, welche unmittelbar nach dem Schwarzen Tod in Englanddekretiert wurden. Ein weiteres Resultat dieser adligen Reaktion war dieProvozierung weit verbreiteter Klassenkämpfe, die erneut am bekanntestenGestalt annahmen im riesigen Bauernaufstand in England 1381. Doch überall inEuropa gab es vergleichbare Erhebungen in dieser Periode (die französische„Jacquerie“, Arbeiterrevolten in Flandern, die Rebellion der Ciompi in Florenzund so weiter).
Wie beim Niedergang des alten Rom fandendie anschwellenden Widersprüche des Feudalsystems auf der ökonomischen Ebenesomit auch ihren Niederschlag auf der Ebene der Politik (Kriege,gesellschaftliche Revolten) und im Verhältnis zwischen Mensch und Natur; undall diese Elemente beschleunigten und vertieften umgekehrt die allgemeineKrise. Wie in Rom war der allgemeine Niedergang des Feudalismus das Resultateiner Unterproduktionskrise, der Unfähigkeit der alten gesellschaftlichenVerhältnisse, die Befriedigung fundamentaler Bedürfnisse des täglichen Lebenszu ermöglichen. Es ist wichtig anzumerken, dass, obwohl das langsame Aufkommender Warenbeziehungen in den Städten als auflösender Faktor der feudalen Bandewirkte und durch die Auswirkungen der allgemeinen Krise (Kriege, Hungersnöte,Pest) weiter beschleunigt wurde, die neuen gesellschaftlichen Verhältnissenicht richtig Fahrt aufnehmen konnten, ehe das alte System nicht in einenZustand der Selbst-Schrumpfung eingetreten war, welche in einem rapiden Niedergangder Produktivkräfte mündete:
„Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen,die sich aus der Untersuchung des grossen Zusammenbruchs des europäischenFeudalismus ergeben, ist, dass sich – im Gegensatz zum unter Marxistenweitgehend verbreiteten Glauben – die charakteristische ‚Gestalt‘ einer Krisein einer Produktionsweise nicht daran festmacht, dass kräftige (ökonomische)Produktivkräfte rückschrittliche (gesellschaftliche) Produktionsverhältnissedurchbrechen und umgehend eine höhere Produktivität und Gesellschaft auf ihrenRuinen etablieren. Im Gegenteil, die Produktivkräfte neigen typischerweisedazu, in den herrschenden Produktionsverhältnissen steckenzubleiben undzurückzuweichen; letztere müssen erst radikal geändert und neu geordnet werden,ehe neue Produktivkräfte geschaffen und zu einer weltweiten neuenProduktionsweise kombiniert werden können. Mit anderen Worten, dieProduktionsverhältnisse ändern sich in einer Übergangsperiode in der Regel nochvor den Produktivkräften, und nicht umgekehrt.“ [18]Wie beim Niedergang Roms war auch hier eine Periode des Rückschritts dieVoraussetzung für das Aufblühen einer neuen Produktionsweise.
Ebenfalls analog der Periode derrömischen Dekadenz suchte die herrschende Klasse ihr wankendes System durchimmer willkürlichere Mittel zu beschützen. Die Einführung von Gesetzen zurbrutalen Kontrolle der Mobilität der Arbeit und zur Eindämmung der Landflucht,der Versuch, die zentrifugalen Tendenzen der Aristokratie durch dieZentralisierung der monarchistischen Macht zu bremsen, der Gebrauch derInquisition, um eine rigide ideologische Kontrolle über alle Ausdrückehäretischen und dissidenten Denkens zu erzwingen, die Verfälschung desMünzsystems, um das Problem der königlichen Verschuldung zu „lösen“ – all diese Tendenzen stellten den Versuch einessterbenden Systems dar, sein endgültiges Aushauchen hinauszuzögern, dochverhindern konnten sie es nicht. In der Tat verwandelten sich die Mittel, diezum Schutz des alten Systems verwendet wurden, zu einem grossen Teil in Brückenköpfedes neuen Systems: Dies war zum Beispiel der Fall bei den zentralisierendenMonarchien der Tudor in England, die weitgehend die notwendigen Bedingungen fürdas Auftreten des modernen kapitalistischen Nationalstaates schufen.
Noch deutlicher als die Dekadenz Roms wardie Epoche des feudalen Niedergangs auch eine Epoche der sozialen Revolution indem Sinn, dass eine authentische neue und revolutionäre Klasse aus ihrenEingeweiden heraustrat, eine Klasse mit einer Weltanschauung, die die altenIdeologien und Institutionen in Frage stellte, und mit einer Wirtschaftsweise,für deren Expansion die feudalen Verhältnisse ein unerträgliches Hinderniswaren. Die bürgerliche Revolution machte ihren ersten triumphalen Schritt aufder Bühne der Geschichte im England der 1640er Jahre, auch wenn esanschliessend über anderthalb Jahrhunderte dauerte, bis sie in den 1790er Jahreden nächsten und noch spektakuläreren Sieg in Frankreich errang. Dieser langeZeitrahmen war möglich, weil die bürgerliche Revolution nur die politischeKrönung eines langen Prozesses der wirtschaftlichen und gesellschaftlichenEntwicklung innerhalb des Gehäuses des alten Systems war und weil sieverschiedenen Rhythmen in den verschiedenen Nationen folgte.
DieTransformation ideologischer Formen
„In der Betrachtung solcher Umwälzungenmuss man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlichtreu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungenund den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oderphilosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen diesesKonflikts bewusst werden und ihn ausfechten.“ [19]
Alle Klassengesellschaften werden voneiner Kombination von offener Repression und ideologischer Kontrolleaufrechterhalten, die die herrschende Klasse durch ihre zahllosen Institutionenausübt: Familie, Religion, Erziehung und so weiter. Ideologien sind niemalseine rein passive Reflexion auf ökonomischer Basis, sondern enthalten ihreeigene Dynamik, die in bestimmten Momenten die zugrundeliegendengesellschaftlichen Verhältnisse aktiv beeinflussen können. Bei derUntermauerung der materialistischen Konzeption der Geschichte war Marxgezwungen, zwischen den „materiellen, naturwissenschaftlich treu zukonstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen“ und den„juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen,kurz, ideologischen Formen“ zu unterscheiden, da die vorherrschende Annäherungan die Geschichte bisher Letzteres zugunsten des Erstgenannten betont hatte.
Wenn man die ideologischen Umwandlungenanalysiert, die in einer Epoche der sozialen Revolution stattfinden, ist eswichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass diese, obwohl sie letztendlich von denökonomischen Produktionsbedingungen bestimmt werden, nicht auf starre undmechanische Weise vonstatten gehen, nicht zuletzt weil solch eine Periode nieeine reine Epoche des Abstiegs und Absterbens ist, sondern sich durch einenwachsenden Zusammenprall zwischen widersprüchlichen gesellschaftlichen Kräftenauszeichnet. Es ist bezeichnend für solche Perioden, dass die alte herrschendeIdeologie, die immer weniger einer sich ändernden gesellschaftlichen Realitätentspricht, dazu tendiert zu zerfallen und den Weg für neue Weltanschauungenfreimacht, die dazu dienen können, die gesellschaftlichen Klassen, die sich deralten Ordnung widersetzen, zu inspirieren und zu mobilisieren. ImZerfallsprozess unterliegen die alten Ideologien – Religionen, Philosophien,Künste – häufig dem Pessimismus, Nihilismus und einer obsessiven Beschäftigungmit dem Tod, während die Ideologien von im Aufstieg befindlichen oderrebellischen Klassen viel häufiger optimistisch, lebensbejahend sind und vollerHoffnungen der Morgendämmerung einer radikal anderen Welt entgegensehen.
Um ein Beispiel zu nehmen: In derdynamischen Periode des Sklavensystems neigte die Philosophie in den damaligenGrenzen dazu, die Bemühungen der Menschheit auszudrücken, sich „selbst zuerkennen“, um Sokrates‘ unsterblichen Satz zu übernehmen – die wirklicheDynamik von Natur und Gesellschaft durch das rationale Denken zu verstehen,ohne die Vermittlung eines Gottes. In der Abstiegsperiode des Sklavensystemstendierte die Philosophie dazu, sich in die Rechtfertigung der Verzweiflungoder Irrationalität zurückzuziehen, wie im Neoplatonismus und seinenVerbindungen zu zahllosen Mysterienkulten, die im späten Imperium aufblühten.
Diese Tendenz kann jedoch nicht aufeinseitige Art begriffen werden: In Perioden der Dekadenz waren die altenReligionen und Philosophien ebenfalls mit dem Aufstieg neuer revolutionärerKlassen oder mit der Rebellion der Ausgebeuteten konfrontiert, und dieseKonfrontationen nahmen im Allgemeinen ebenfalls religiöse Formen an. So begannim antiken Rom die christliche Religion, auch wenn sie sicherlich von denöstlichen Mysterienkulten beeinflusst war, als eine Protestbewegung derEigentumslosen gegen die vorherrschende Ordnung und schuf später, als eineetablierte Macht mit eigenen Rechten, einen Rahmen für die Bewahrung vieler kulturellerErrungenschaften der Antike. Diese Dialektik zwischen der alten Ordnung und derneuen war eine Form der ideologischen Umwandlungen auch während des Niedergangsdes Feudalismus. Einerseits:
„Die Periode der Stagnation erlebte denAufstieg des Mystizismus in all seinen Formen. Die intellektuelle Form mit der‚Abhandlung über die Kunst des Sterbens‘ und vor allem die ‚Nachahmung vonJesus Christus‘. Die emotionale Form mit den grossen Ausdrücken dervolkstümlichen Pietät, die durch den Einfluss der unkontrollierbaren Elementeder Bettelorden verschärft wurden: die ‚Flagellanten‘, die das Land bewandertenund auf den Plätzen der Städte ihreKörper mit der Peitsche geisselten, wobei sie auf die menschlichen Gefühleabzielten und die Christen zur Reue aufforderten. Diese Manifestationen riefenBilder von oft zweifelhaftem Geschmack hervor, wie die Fontänen von Blut, dieden Heiland symbolisieren. Sehr schnell taumelte die Bewegung in die Hysterie,und die geistliche Hierarchie musste gegen die Unruhestifter eingreifen, um zuvermeiden, dass deren Predigten zu einem weiteren Wachstum in der Zahl derVagabunden führten (…) Makabre Künste breiteten sich aus (…) der heilige Text,der von den nachdenklicheren Köpfen am meisten bevorzugt wurde, war die Apokalypse.“ [20]
Andererseits stand dem Ableben desFeudalismus auch der Aufstieg der Bourgeoisie und ihrer Weltsicht gegenüber,die ihren Ausdruck in der grossartigen Blüte von Kunst und Wissenschaft in derRenaissance fand. Und selbst mystische und chiliastische Bewegungen wie dieWiedertäufer waren, wie Engels hervorhob, oft eng mit den kommunistischenBestrebungen der ausgebeuteten Klassen verknüpft. Solche Bewegungen konntennoch keine historisch lebensfähige Alternative zum alten System der Ausbeutungaufstellen, und ihre Träume vom Tausendjährigen Reich waren oftmals auf eineprimitive Vergangenheit fixiert statt auf eine fortgeschrittenere Zukunft, dochspielten sie nichtsdestotrotz eine Schlüsselrolle in jenem Prozess, der dieZerstörung der verfallenden mittelalterlichen Hierarchie nach sich zog.
In einer dekadenten Epoche ist derallgemeine kulturelle Niedergang niemals absolut: In der Kunst zum Beispielkann die Stagnation der alten Schulen durch neue Formen kompensiert werden, dievor allem einen humanen Protest gegen eine wachsende inhumane Ordnung zumAusdruck bringen. Dasselbe kann zur Moral gesagt werden. Die Moral, dieletztlich ein Ausdruck des sozialen Wesens der Menschheit ist, wird inDekadenzperioden, die wiederum Ausdrücke des Zusammenbruchs dergesellschaftlichen Verhältnisse sind, mit ihrem Zusammenbruch, im Kollapsgrundlegender menschlicher Bande und mit dem Triumph der anti-sozialenTriebkräfte enden. Die Perversion und Prostitution des sexuellen Verlangens,das vermehrte Auftreten von absolut sinnlosen Tötungen, Diebstählen undBetrügereien sowie vor allem die Abschaffung jeglicher moralischen Regeln inder Kriegsführung sind an der Tagesordnung. Doch auch dies sollte nicht aufstarre und mechanische Weise betrachtet werden, in dem Sinn etwa, dass Periodendes Aufstiegs von höheren menschlichen Verhaltensweisen und Perioden desNiedergangs von einem plötzlichen Sturz in die Niedertracht und Verdorbenheitgekennzeichnet seien. Die Untergrabung und Erschütterung der alten moralischenGewissheiten können sich gleichermassen im Aufstieg eines neuenAusbeutungssystems ausdrücken, gegenüber dem die alte Ordnung sichvergleichsweise milde ausnimmt, wie im KommunistischenManifest mit Bezug auf den Aufstieg desKapitalismus bemerkt wurde:
„Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaftgekommen, hat alle feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnissezerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinennatürlichen Vorgesetzten knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Bandzwischen Mensch und Mensch übriggelassen, als das nackte Interesse, als diegefühllose ‚bare Zahlung‘. Sie hat die heiligen Schauer der frommenSchwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spiessbürgerlichen Wehmut indem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat die persönlicheWürde in den Tauschwert aufgelöst und an die Stelle der zahllosen verbrieftenund wohlerworbenen Freiheiten die eine gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt.“
Und dennoch war das Verständnis vonHegels „List der Vernunft“ derart präsent im Denken von Marx und Engels, dasssie imstande waren anzuerkennen, dass dieser moralische „Niedergang“, dieUmwandlung der Welt in Waren tatsächlich eine fortschrittliche Kraft war, diedie statische feudale Ordnung wegzuspülen half und den Weg für eineauthentische menschliche Moral ebnete, die vor ihr liegt.
Gerrard
[1] Marx, Zur Kritik der PolitischenÖkonomie, Vorwort, MEW, Bd. 13, S. 9.
[2] Vgl. den ersten Teil dieses Artikels.
[3] Engels, Anti-Dühring, Teil 3, „Sozialismus“, Kap. I, „Geschichtliches“, MEW, Bd. 20, S. 242f.
[4] MEW Bd. 21, S.173, bzw. Morgan, AncientSociety.
[5] Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgangder deutschen Philosophie
[6] Zum Beispiel die sesshaften und bereits sehr hierarchischenJägergesellschaften, die in der Lage waren, beträchtliche Vorräte anzulegen,die vielen halbkommunistischen Formen der Landwirtschaft, die „Stammesreiche“,die von halbbarbarischen Hirtenvölkern wie den Hunnen und den Mongolen gebildetwurden, etc.
[7] Die deutsche Ideologie, 1847
[8] Als die traditionelle Lebensweise noch in Kraft war, behielten unterden australischen Stämmen die Jäger, die Beute gemacht hatten, nichts für sichselbst, sondern händigten ihren Fang sofort der Gemeinschaft aus, die dieGestalt bestimmter komplexer Blutsverwandtschaftsstrukturen hatte. Laut desWerkes des Anthropologen Alain Testart, LeCommunisme Primitif, 1985, kann der BegriffUrkommunismus nur auf die Australier angewendet werden, die er als die letztenÜberbleibsel gesellschaftlicher Beziehungen betrachtet, die in derpaläolithischen Periode wahrscheinlich allgemein geherrscht haben. Dies stehtzur Debatte. Sicherlich gibt es selbst unter den nomadischenJäger-Sammler-Völkern grosse Unterschiede in der Art, wie das gesellschaftlicheProdukt verteilt wird, auch wenn alle von ihnen der Aufrechterhaltung derGemeinschaft Priorität einräumten. Wie Chris Knight in seinem Buch BloodRelations, Menstruation and the Origins of Culture,1991, hervorhob, ist das, was er das „Recht auf den eigenen Fang“ (own-killrule)“ nennt (d.h. vorgeschriebene Grenzen für denAnteil des Jägers an seinem Fang), äusserst weit verbreitet unter denJägervölkern.
[9] Man muss sich vergegenwärtigen, dass die Auflösung derurgesellschaftlichen Verhältnisse kein einmaliges Ereignis war, sondern inverschiedenen Rhythmen in verschiedenen Teilen der Erde erfolgte; es war einProzess, der sich über Jahrtausende erstreckte und dessen letzte tragischeKapitel erst jetzt in den abgelegensten Gebieten der Erde wie dem Amazonas undBorneo aufgeschlagen werden.
[10] Erster Entwurf des Briefes an Vera Sassulitsch, 1881.
[11] Engels, Vom Ursprung der Familie, desPrivateigentums und des Staates. MEW, Band 21, S. 97.
[12] Das Kapital, Band 1, 12. Kapitel, 4. Teilung der Arbeit innerhalb der Manufakturund Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft.
[13] Luxemburg, Junius-Broschüre.
[14] Perry Anderson, Passages from Antiquity toFeudalism, Verso Edition, 1978, S. 83 f., eigene Übersetzung.
[15] Ebenda, S. 92.
[16] Anderson, a.a.O. S. 197, eigene Übersetzung.
[17] Ebenda, S. 200 f.
[18] Ebenda, S. 204.
[19] Marx, Zur Kritik der PolitischenÖkonomie, Vorwort. MEW, Band 13, S. 9.
[20] J. Favier, From Marco Polo to Christopher Columbus, S. 152 f., eigene Übersetzung.
Erbe der kommunistischen Linke:
Die Grundlagen der kapitalistischen Akkumulation
- 3194 Aufrufe
Der These, der wir den Titel AusserkapitalistischeMärkte und Verschuldung gaben, behauptet, wie der Name suggeriert, dassdie Ventile, die es ermöglicht hatten, den für die kapitalistische Akkumulationin den 1950er und 1960er Jahren notwendigen Mehrwert zu realisieren, von denausserkapitalistischen Märkten und dem Kredit gebildet wurden. In dieserPeriode trat die Verschuldung allmählich an die Stelle der verbliebenenausserkapitalistischen Märkte, da diese nicht mehr ausreichten, um all die imKapitalismus produzierten Waren zu absorbieren.
Zwei Fragen sind zu dieser These gestellt worden:
- Kann sie durch eine Analyse des Handelszwischen verschiedenen Wirtschaftszonen verifiziert werden, die verschiedeneEbenen der Integration in die kapitalistischen Produktionsverhältnisserepräsentieren? Kann sie auch von einer Analyse der Schulden in dieser Periodeverifiziert werden? Ein späterer Artikel wird dieses Problem näher ins Augefassen.
- Auf welche Weise unterscheidet sich dieseThese von den anderen beiden? Inwieweit ist sie kompatibel mit ihnen? DieserArtikel beabsichtigt, eine kritische Analyse der These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus vorzunehmen, während ein weiterer esunternehmen wird, die Positionen zu kommentieren, die unter der Überschrift Kriegswirtschaftund Staat kapitalismus vertreten werden.
Wie wir bereits in dem Text über dieAusserkapitalistischen Märkte und Verschuldung, der in der InternationalenRevue Nr. 42 erschienen war, angedeutet hatten, können weder die Steigerung derKaufkraft der Arbeiterklasse noch die Staatsausgaben - von denen vieleunproduktiv sind, wie wir im Fall der Rüstungsindustrie sehen - zurBereicherung des globalen Kapitals beitragen. Dieser Artikel wird sich imWesentlichen dieser Frage widmen, die, wie wir glauben, einen ernstenWiderspruch in der These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus enthüllt, insbesondere was dieWirksamkeit steigender Arbeitslöhne für die kapitalistische Ökonomieanbetrifft. Laut dieser These war das „System (...) also zeitweise imstande, dieQuadratur des Kreises, die parallele Steigerung der Profitproduktion und derMärkte, zu bewerkstelligen, in einer Welt, in der die Nachfrage fortangrösstenteils von jener dominiert wurde, die aus der Lohnarbeit herrührt.[1]Was bedeutet es, die Profitproduktion zu steigern? Es bedeutet, Waren zuproduzieren und zu verkaufen, doch um welche Nachfrage zu befriedigen? Die derArbeiterInnen? Die folgende Sentenz aus dem gerade zitierten Artikel istgleichermassen widersprüchlich und bringt uns nicht weiter: „Die garantierteSteigerung der Profite, der Staatsausgaben und der Anstieg der Löhne waren inder Lage, die Endnachfrage zu garantieren, die so entscheidend ist, wenn das Kapitalseine Akkumulation fortsetzen wollte."[2]Wenn die Steigerung der Profite somit garantiert ist, dann ist es auch diekapitalistische Akkumulation, und in diesem Fall ist es unerheblich, eineErhöhung der Löhne und eine Steigerung der Staatsausgaben zu Hilfe zu rufen, umzu erklären, wie der Kapitalismus mit der Akkumulation fortfahren kann!
Diese Vagheit in der Formulierung desProblems lässt uns keine andere Wahl, als das Argument zu interpretieren, mitdem Risiko, Fehler in der Interpretation zu begehen. Bedeutet es tatsächlich,wie der Text in seiner Gesamtheit zu suggerieren scheint, dass die Endnachfragedurch Staatsausgaben und steigende Löhne garantiert ist, was es ermöglicht, dieProfite zu steigern, welche das Fundament der kapitalistischen Akkumulationsind? Wenn dies der Fall ist, dann stellt der Text ein reales Problem dar, daunserer Ansicht nach solch eine Idee die eigentlichen Fundamente dermarxistischen Analyse der kapitalistischen Akkumulation in Frage stellt, wiewir sehen werden. Wenn aber unsere Interpretation unrichtig ist, dann ist esnotwendig, uns zu zeigen, welche Nachfrage die Realisierung des Profits durchden Warenverkauf garantiert.
Die Kapitalisten akkumulieren, was nachAbzug der unproduktiven Kosten vom Mehrwert übrigbleibt, der aus der Ausbeutungder ArbeiterInnen gezogen wird. Da eine Steigerung der Reallöhne nur zumSchaden des Gesamtmehrwerts sein kann, geschieht sie somit auchnotwendigerweise zum Schaden des Anteils des Mehrwerts, der für dieAkkumulation bestimmt ist. In der Praxis läuft eine Erhöhung der Löhne daraufhinaus, dass den ArbeiterInnen ein Teil des Mehrwerts ausbezahlt wird, der ausihrer Ausbeutung stammt. Das Problem mit diesem Teil des Mehrwerts, der an dieArbeiterInnen zurückgezahlt wird, ist, dass er, da er nicht dazu bestimmt ist,die Arbeitskraft zu reproduzieren (die bereits durch den „nicht-erhöhten" Lohnabgesichert ist), auch nicht Teil der erweiterten Reproduktion sein kann.Tatsächlich kann er, gleich ob die ArbeiterInnen Nahrungsmittel, Wohnungen oderFreizeitwaren kaufen, niemals dazu benutzt werden, um zum Wachstum derProduktionsmittel (Maschinen, Löhne für neue ArbeiterInnen, etc.) beizutragen.Daher ist die Erhöhung von Löhnen über das für die Reproduktion derArbeitskraft Erforderliche hinaus - vom kapitalistischen Standpunkt aus -nichts anderes als reine Verschwendung von Mehrwert, der nicht zu einemBestandteil des Akkumulationsprozesses werden kann.
Es ist richtig, dass die Statistiken derBourgeoisie diese Realität verbergen. Die Berechnung des BSP(Bruttosozialprodukt) schliesst leichterdings alles ein, auch unproduktiveWirtschaftsaktivitäten, ob es sich um die Ausgaben für Waffen und Werbunghandelt, um die Gehälter für Priester und Polizisten oder den Konsum derherrschenden Klassen, und ebenfalls die Lohnerhöhungen, die den ArbeiterInnengewährt werden. Wie die Statistiken der Bourgeoisie verwechselt die These deskeynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus die „Steigerung der Produktion",die anhand des Wachstums des BSP gemessen wird, mit der „Bereicherung desKapitalismus"; diese beiden Begriffe sind alles andere als äquivalent, da die„Bereicherung des Kapitalismus" sich auf dem Wachstum des real akkumuliertenMehrwerts stützt und Mehrwert ausschliesst, der durch die unproduktivenAusgaben sterilisiert wird. Dieser Unterschied ist keineswegs unwichtig,besonders in der zur Diskussion stehenden Periode, die durch einen massivenAnstieg der unproduktiven Ausgaben charakterisiert ist: „Die Bildung einesinternen Marktes durch den Keynesianismus als eine unmittelbare Lösung zumAbsatz der massiven industriellen Produktion hat Illusionen in eine dauerhafteRückkehr des Wachstums wie zu Zeiten des aufsteigenden Kapitalismus geweckt.Doch seit der Markt komplett abgenabelt wurde von den Bedürfnissen derWertsteigerung des Kapitals, hatte dies die Sterilisierung eines beträchtlichenTeils des Kapitals zur Folge."[3]
Der Gedanke, dass ein Anstieg derArbeitslöhne unter bestimmten Umständen ein günstiger Faktor für diekapitalistische Akkumulation sein könnte, widerspricht völlig dieserGrundsatzposition des Marxismus (und nicht nur dieser!), derzufolge der ganzeCharakter der kapitalistischen Produktion die Verwertung des Kapitals ist, undnicht sein Verzehr [4].
Und dennoch - so werden jene Genossenantworten, die die These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus vertreten - stellt sich diese These aufdie Grundlage von Marx. Ihre Erklärung des Erfolges der staatskapitalistischenMassnahmen zur Vermeidung der Überproduktion basiert in der Tat auf demGedanken von Marx, dass „die Masse des Volks nie mehr als die average quantityof necessaries (durchschnittliche Menge der lebenswichtigen Güter) konsumierenkann, ihre Konsumtion also nicht entsprechend wächst mit der Produktivität derArbeit"[5].Mithilfe dieser Formulierung von Marx sieht die These einen Weg, um zuerklären, wie die kapitalistische Ökonomie in der Lage war, den Widerspruch zuüberwinden: Solange es Fortschritte in der Produktivität gibt, die ausreichen,damit der Konsum in demselben Rhythmus wie die Arbeitsproduktivität wächst,kann das Problem der Überproduktion gelöst werden, ohne die Akkumulation zuhemmen, da die Profite, die ebenfalls steigen, ausreichen, um die Akkumulationabzusichern. Während seines gesamten Lebens hat Marx nie einen Anstieg derLöhne im Gleichklang mit der Produktivität erlebt; ja, er nahm an, dass diesunmöglich sei. Dennoch hat sich genau dies in gewissen Momenten im Leben desKapitalismus ereignet; jedoch gestattet uns dieses Tatsache keineswegs, darauszu folgern, es könne, mindestens zeitweise, das fundamentale Problem derÜberproduktion lösen, das Marx hervorhob. Der Marxismus reduziert diesenWiderspruch der Überproduktion nicht einfach auf das Verhältnis zwischensteigenden Löhnen und wachsender Produktivität. Die Tatsache, dass Keynes solcheinen Mechanismus zur Verteilung des Reichtums als ein Mittel betrachtete, umzeitweise einen gewissen Grad an ökonomischer Aktivität im Zusammenhang miteiner steil ansteigenden Arbeitsproduktivität aufrechtzuerhalten, ist eineSache. Eine völlig andere Sache und darüber hinaus illusorisch ist es zubehaupten, dass die „Ventile", die auf diese Weise geschaffen werden, einewirkliche Entwicklung des Kapitalismus ermöglichen.
Hier müssen wir etwas näher dieAuswirkungen solch eines Mittels der „Regulierung" der Frage der Überproduktionmittels des Konsums der ArbeiterInnen auf die Mechanismen der kapitalistischenÖkonomie betrachten. Es trifft zu, dass der Konsum der ArbeiterInnen und dieStaatsausgaben es möglich machen, die Produkte einer gesteigerten Produktion zuverkaufen, doch wie wir gesehen haben, mündet dies in eine Sterilisierung desproduzierten Reichtums, da er nicht sinnvoll verwendet werden kann, um Kapitalzu verwerten. In der Tat hat die Bourgeoisie ähnliche Hilfsmittel ausprobiert,um die Überproduktion einzudämmen: die Zerstörung des landwirtschaftlichenMehrwerts besonders in den 1970er Jahren (als der Hunger bereits auf dergesamten Welt verbreitet war), Quotensysteme auf Welt- oder gar europäischerEbene bei Stahlproduktion und Erdölförderung, etc. Was immer die Mittel sind,die von der Bourgeoisie benutzt werden, um die Überproduktion zu absorbierenoder aus der Welt zu schaffen, letztlich enden sie alle in der Sterilisierungvon Kapital.
Paul Mattick[6],der im Artikel „Die Urspünge, Dynamiken und Grenzen des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus" zitiert wird[7],stellte ebenfalls eine Erhöhung der Löhne in dem Zeitraum, der uns hier angeht,fest, die mit einer gesteigerten Produktivität Schritt hielten: „Es istunbestreitbar, dass die Löhne in der modernen Epoche angestiegen sind. Jedochnur im Rahmen der Kapitalexpansion, die voraussetzt, dass das Verhältnis derLöhne zu den Profiten im Allgemeinen konstant bleibt. Die Arbeitsproduktivitätsollte daher mit einer Geschwindigkeit wachsen, die es gestattet, sowohlKapital zu akkumulieren als auch den Lebensstandard der ArbeiterInnenanzuheben."[8]
Doch unglücklicherweise geht die Thesedes keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismusnicht weiter in ihrem Gebrauch des Werkes von Mattick. Für Mattick wie auch füruns gilt: „jede Prosperität beruht auf der Vergrösserung des Mehrwerts zurweiteren Expansion des Kapitals"[9]Mit anderen Worten, sie wächst nicht durch die Verkäufe auf Märkten, die durchsteigende Löhne oder Staatsausgaben geschaffen werden: „Das ganze Problemreduziert sich zuletzt auf die einfache Tatsache, dass das, was konsumiertwird, nicht akkumuliert werden kann, so dass die wachsende ‚öffentlicheKonsumtion‘ kein Mittel sein kann, um eine zum Stillstand gekommene oder sichvermindernde Akkumulationsrate in ihr Gegenteil zu verkehren."[10]Diese Einzigartigkeit der Prosperität der 1950er und 1960er Jahre ist sowohlvon offiziellen bürgerlichen Ökonomen als auch von der These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus unbemerkt geblieben: „Da die Ökonomennicht zwischen Wirtschaft und kapitalistischer Wirtschaft unterscheiden, bleibtihnen auch verschlossen, dass Produktivität und ‚kapitalistisch produktiv' zweiverschiedene Dinge sind, dass öffentliche wie private Ausgaben nur dannproduktiv sind, wenn sie Mehrwert erzeugen, nicht weil sie materielle Güteroder Annehmlichkeiten mit sich bringen." Folglich: „Die durch die Defizitfinanzierung ermöglichte zusätzliche Produktionstellt sich als zusätzliche Nachfrage dar, aber es ist eine Nachfragebesonderer Art, da sie sich zwar aus der gesteigerten Produktion ergibt, aberes handelt sich um eine gesteigerte Gesamtproduktion ohne eine entsprechendeSteigerung des Gesamtprofits."[11]
Es folgt, was wir gerade gesagt haben,nämlich dass die tatsächliche Prosperität der 1950er und 1960er Jahre nicht sogrossartig war, wie die Bourgeoisie gern vorgibt, wenn sie stolz auf das BSPder wichtigsten Industrieländer jener Zeit verweist. Matticks Beobachtung indiesem Zusammenhang ist vollkommen richtig: „In Amerika blieb jedoch dieNotwendigkeit bestehen, das Produktionsniveau mittels öffentlicher Ausgabenstabil zu halten, was zu einem weiteren wenn auch langsameren Anwachsen der Staatsverschuldung.Dieser Zustand liess sich auch mit der imperialistischen Politik Amerikas undspäter besonders mit dem Krieg in Vietnam begründen. Aber da dieArbeitslosigkeit nicht unter vier Prozent der Gesamtbeschäftigung fiel und dieProduktionskapazität keine volle Ausnutzung fand, ist es mehr alswahrscheinlich, dass ohne den ‚öffentlichen Konsum‘ der Aufrüstung undMenschenschlächterei die Arbeitslosenzahl weit höher gestanden hätte, als estatsächlich der Fall war. Und da ungefähr die Hälfte der Weltproduktion aufAmerika fällt, liess sich trotz des Aufschwungs in Westeuropa und Japan nichtvon einer völligen Überwindung der Weltkrise sprechen, und besonders dannnicht, wenn die unterentwickelten Länder in die Betrachtung miteinbezogenwerden. So lebhaft die Konjunktur auch war, so bezog sie sich doch nur aufTeile des Weltkapitals, ohne es zu einem allgemeinen die Weltwirtschaftumfassenden Aufschwung zu bringen."[12]Die These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus unterschätzt diese Realität.
Für uns kann die wahre Quelle derAkkumulation nicht in den keynesianischen Massnahmen gesucht werden, diewährend dieses Zeitraums in Kraft gesetzt worden waren[13],sondern in der Realisierung des Mehrwerts durch den Absatz sowohl aufausserkapitalistischen Märkten als auch auf Kredit. Wenn wir richtig verstandenhaben, dann macht die These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus einen theoretischen Fehler auf dieserEbene, der den Weg freimacht für die Idee, dass es dem Kapitalismus möglich sei,die Krise zu überwinden, solange er in der Lage sei, beständig dieArbeitsproduktivität und im gleichen Verhältnis die Arbeitslöhne wachsen zulassen.
Zu Beginn dieser Debatte betrachtete sichdie These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus in Kontinuität mit dem theoretischenRahmen zum Verständnis der Widersprüche des Kapitalismus, der von Marxentwickelt und später von Rosa Luxemburg bereichert wurde. Unserer Ansicht nachmacht es keinen Unterschied, ob die These des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus Luxemburgs Theorie akzeptiert oderablehnt - sie ist unfähig, die Widersprüche zu erklären, die diekapitalistische Gesellschaft während der Periode des Nachkriegsboomsunterminierten. Wie man aus den vielen Zitaten von Mattick, auf die wir unsereKritik gründeten, entnehmen kann, hat die Auseinandersetzung mit dieser Thesenichts mit dem eher klassischen Gegensatz zwischen der Theorie derNotwendigkeit ausserkapitalistischer Märkte für die Entwicklung desKapitalismus (vertreten von Rosa Luxemburg) und der Analyse zu tun, die sichauf den Fall der Profitrate als alleinige Erklärung für die Krise desKapitalismus stützt, wie sie von Paul Mattick vertreten wird).
Was die andere Frage angeht - ob derAbsatz auf Kredit eine dauerhafte Basis für die reale Akkumulation schaffenkann -, so bringt uns dies zurück zu der Debatte über den Fall der Profitratebzw. die Sättigung der ausserkapitalistischen Märkte. Die Antwort auf dieseFrage findet sich in der Fähigkeit oder Unfähigkeit des Kapitalismus, seineSchulden zurückzuzahlen. Tatsächlich ist das fortgesetzte Schuldenwachstum seitdem Ende der 1950er Jahre ein Anzeichen dafür, dass die gegenwärtige offeneSchuldenkrise ihre Wurzeln exakt in der „Prosperitäts"-Periode der 1950er und1960er Jahre hat. Doch dies ist eine andere Debatte, zu der wir zurückkehrenwerden, wenn wir uns die Verifizierung der These der ausserkapitalistischenMärkte und Verschuldung im wahren Leben anschauen.
Silvio
[1] „Die Ursprünge, Dynamiken undGrenzen des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus", Internationale Revue Nr. 43.
[2] Ebenda.
[3] Internationale Revue Nr. 42 „Interne Debatte: Die Ursachen desWirtschaftsbooms nach 1945", Kapitel: „Ausserkapitalistische Märkte und Verschuldung".
[4] Das Kapital Band 3, MEW 25 S. 268
[5] Marx, Theorien über den Mehrwert, Zweiter Teil, MEW 26.2 S. 469
[6] Mattick war ein Mitgliedder Kommunistischen Linken und ein Mitglied der KAPD während der DeutschenRevolution. Nachdem er 1926in die USA emigriert war, trat er den IWW bei undschrieb über viele politische Themen, einschliesslich der Ökonomie. Zwei seinerWerke sind besonders erwähnenswert: Marxund Keynes - die Grenzen der gemischten Wirtschaft (1969) und Krisenund Krisentheorien (1974). ImWesentlichen erklärt Mattick die kapitalistische Krise mit dem Widerspruch, dervon Marx hervorgehoben wurde, mit dem tendenziellen Fall der Profitrate. Erstimmt also Luxemburgs Krisenerklärung nicht zu, welche - ohne die fallendeProfitrate zu leugnen - wesentlich auf dem Bedürfnis nach Märkten ausserhalbkapitalistischer Produktionsverhältnisse besteht, damit der Kapitalismus sichweiterentwickeln könne. Wir möchten gern Matticks Fähigkeit in Krisen und Krisentheorien hervorheben, die Beiträge zu Marxens Krisentheorie von seinenNachfolgern, von Rosa Luxemburg zu Henrik Grossmann, einschliesslichTugan-Baranowski und nicht zu vergessen Pannekoek, brillant zusammengefasst zuhaben. Seine Meinungsverschiedenheiten mit Luxemburg hinderten ihn nicht daran,das Werk der grossen Revolutionärin zur Ökonomie auf vollkommen objektive undverständliche Weise zu erklären.
[7] InternationaleRevue Nr.43
[8] PaulMattick, Intégration capitaliste et rupture ouvrière, EDI, S. 151, unsereÜbersetzung.
[9] Mattick, Krisen und Krisentheorien, 4. Kapitel „Glanz und Elend dergemischten Wirtschaft", Hervorhebungen hier und im Folgenden von uns.
[10] Ebenda.
[11] Ebenda.
[12] Ebenda.
[13] Ebenda.
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [37]
Interne Debatte in der IKS (III) Die Ursachen für die Aufschwungperiode nach dem Zweiten Weltkrieg
- 2927 Aufrufe
In der Internationalen Revue Nr. 42 wurden dieDarstellung des Rahmens der Debatte sowie drei Beiträge publiziert, welche diedrei gegenwärtigen Hauptpositionen zusammenfassten. In der Nr. 43 der Revueveröffentlichten wir einen Artikel Die Ursprünge, Dynamiken und Grenzen des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus, der ausführlicher die Thesedes keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus darlegte.
In dieser Nummer lassen wir die beiden anderen Positionenzu Wort kommen mit den folgenden Texten Die Grundlagen der kapitalistischenAkkumulation und Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus (zur Verteidigungder Positionen Ausserkapitistische Märkte und Verschuldung bzw.Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus). Wir müssen aber vor der Fortsetzungder Debatte einige Bemerkungen anbringen einerseits zur Entwicklung derdiskutierten Positionen, andererseits zur Wissenschaftlichkeit desDiskussionsstils.
Die Entwicklung der diskutierten Positionen
Während einer gewissen Zeit der Debatte haben sich alleStandpunkte auf den Rahmen der Analyse der IKS[1] berufen, der dabei oft als Bezugspunkt für die Kritikender einen oder anderen Position an den anderen Standpunkten diente. Dies istheute nicht mehr der Fall, und zwar schon während einiger Zeit. Eine solcheEntwicklung liegt im Bereich der Möglichkeiten einer jeden Debatte:Divergenzen, die zunächst als geringfügig erscheinen, stellen sich im Laufe derDiskussion als tiefer heraus, ja können den anfänglichen theoretischen Rahmender Diskussion selbst in Frage stellen. Das ist mit der Debatte in unsererOrganisation geschehen, insbesondere mit der These, die keynesiansich-fordistischerStaatskapitalismus heisst. So ergibt sichaufgrund der Lektüre des Artikels Die Ursprünge, Dynamiken und Grenzen des keynesianisch-fordistischenStaatskapitalismus (Internationale Revue Nr. 43), dass diese These nun offen verschiedenePositionen der IKS in Frage stellt. Da diese Infragestellungen eineAngelegenheit der Debatte selber sind, beschränken wir uns hier darauf, auf sieaufmerksam zu machen, und überlassen es späteren Beiträgen, darauf zurück zukommen. So gilt, für diese These, was folgt:
- „(...) der Kapitalismus generiert dauernd diegesellschaftliche Nachfrage, die der Entwicklung seines Marktes zu Grundeliegt"[2], während für die IKS „im Gegenteil zu dem, was dieVerehrer des Kapitals suggerieren, (...) die kapitalistische Produktion jedochnicht automa tisch und wunschgemäss die für ihr Wachstum notwendigen Märkte"schafft (Plattform der IKS).
- Den Kulminationspunkt des Kapitalismus würdenauf einer bestimmten Stufe „die Ausweitung der Lohnarbeit und ihre durch dieHerstellung des Weltmarktes erreichte allgemeine Herrschaft" bilden[3]. Für die IKS dagegen trat dieser Kulminationspunkt dannein, als die wichtigsten wirtschaftlichen Mächte sich die Welt aufteilt hattenund der Markt „die Schwelle zur Sättigung derselben Märkte (erreichte), die im19. Jahrhundert noch seine ungeheure Ausdehnung ermöglicht hatten" (Plattformder IKS).
- Die Entwicklung der Profitrate und die Grösseder Märkte seien vollkommen unabhängig, während für die IKS „durch diewachsende Schwierigkeit des Kapitals, Märkte zu finden, wo sein Mehrwertrealisiert werden kann, der Druck auf die Profitrate verstärkt und ihrtendenzieller Fall bewirkt (wurde). Dieser Druck wird durch den ständigenAnstieg des konstanten, "toten" Kapitals (Produktionsmittel) zu Lasten desvariablen, lebendigen Kapitals, die menschliche Arbeitskraft, ausgedrückt."(ebenda)
Es gehört zu einer proletarischen Debatte, die Klärungder Divergenzen systematisch und methodisch konsequent bis zu ihrer Wurzelvoranzutreiben, ohne Furcht vor allfälligen Infragestellungen, die sichaufdrängen können. Nur eine solche Debatte kann wirklich die theoretischenGrundlagen der Organisationen verstärken, die sich auf das Proletariat berufen.Folglich erfordert eine solche Debatte die strengstmögliche wissenschaftlicheund militante Klarheit, insbesondere was die Verweise auf Texte derArbeiterbewegung betrifft, die zur Unterstützung eines Arguments oder für diePolemik benutzt werden. Gerade der Artikel Die Ursprünge, Dynamiken und Grenzen deskeynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus in der Revue Nr. 43 stellt in dieser Hinsicht einProblem dar.
Ein Mangel an Wissenschaftlichkeit
Der fragliche Artikel beginnt mit einem Zitat aus Internationalisme Nr. 46 (Organ der Kommunistischen Linken Frankreichs,GCF): „1952 beendeten unsere Vorgänger in der GCF die Aktivitäten ihrer Gruppe,weil das „Verschwinden der ausserkapitalistischen Märkte (...) zu einerpermanenten Krise des Kapitalismus führt (...) Wir können hier die ins Augefallende Bestätigung von Rosa Luxemburgs Theorie sehen (...) In der Tat sind dieKolonien nicht mehr ein ausserkapitalistischer Markt für das kolonialeMutterland (...) Wir leben in einem Zustand des drohenden Krieges..." Geschriebenam Vorabend des Nachkriegsbooms, enthüllen diese wiederholten Fehler dieNotwendigkeit, über die „ins Auge fallende Bestätigung von Rosa LuxemburgsTheorie" hinauszugehen".
Wenn man diese Stelle liest, so springen die folgendenzwei Ideen ins Auge:
- 1952 (zur Zeit, als der Artikel von Internationalisme geschrieben wurde) waren die ausserkapitalistischenMärkte verschwunden, deshalb die Situation „einer permanenten Krise desKapitalismus".
- Die Voraussage der Gruppe Internationalisme vom unmittelbar drohenden Krieg ist eine Konsequenz ausder Analyse über das Verschwinden der ausserkapitalistischen Märkte.
Aber dies sind nicht die wirklichen Ideen von Internationalisme, sondern ihre entstellende Transkription in der Formeines Zitats (das wir gerade wiedergegeben haben), das gewisse Stellen desOriginaltextes der Zeitschrift Internationalisme von den Seiten 9, 11, 17 und 1 in dieser Reihenfolgeherauspflückt und neu zusammensetzt.
Auf die erste zitierte Stelle, nach der das „Verschwindender ausserkapitalistischen Märkte (...) zu einer permanenten Krise desKapitalismus führt", folgt in Internationalisme unmittelbar der folgende, nicht zitierte Satz: „RosaLuxemburg zeigte im übrigen auf, dass der Moment des Ausbruchs dieser Kriseeintritt, lange bevor dieses Verschwinden absolut geworden ist". Mit anderenWorten beinhaltete für Internationalisme (wie für Rosa Luxemburg) die Krisensituation, die imZeitpunkt der Verfassung dieses Artikels herrschte, keineswegs die Erschöpfungder ausserkapitalistische Märkte, denn für sie tritt die Krise ein, „langebevor dieses Verschwinden absolut geworden ist". Diese erste Entstellung derPositionen von Internationalisme hat durchaus Konsequenzen für die Debatte, denn sieunterstützt die Idee (welche von der These des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus verteidigt wird), dass die ausserkapitalistischenMärkte im Boom der 50er und 60er Jahre eine vernachlässigbare Grösse gewesenseien.
Die zweite Internationalisme untergeschobene Position vom unmittelbar drohenden Kriegals Konsequenz aus der Analyse über das Verschwinden der ausserkapitalistischenMärkte ist in Tat und Wahrheit nicht die Position der Gruppe Internationalisme als solcher, sondern von einigen Genossen in derOrganisation, mit denen die Diskussion im Gange war. Das zeigt sich in derfolgenden Textstelle von Internationalisme, die zwar im Zitat ebenfalls benutzt wird, aber mitwichtigen und bezeichnenden Amputationen: „Für einige unserer Genossen lebenwir in der Tat in einem Zustand des unmittelbar drohenden Krieges, dessenAusbruch nun bevorstehe. Wir lebten in einem Zustand des unmittelbarbevorstehenden Kriegs, und die Frage, die sich der Analyse stelle, sei nicht,die Faktoren zu untersuchen, die zum weltweiten Zusammenstoss führten - dieseFaktoren seien gegeben und wirkten bereits -, sondern vielmehr zu untersuchen,warum der Weltkrieg noch nicht ausgebrochen sei". Diese zweite Entstellung desGedanken von Internationalisme versucht, die Position von Rosa Luxemburg und Internationalisme zu diskreditieren, da der Dritte Weltkrieg, derangeblich die Folge der Sättigung des Weltmarktes hätte sein sollen, bekanntlichnie stattgefunden hat.
Diese Bemerkungen zielennicht auf die Diskussion der Analyse von Internationalisme ab, die in der Tat Fehler enthält, sondern auf dietendenziösen Interpretationen, die in den Spalten unserer Internationale Revue über die Positionen dieser Gruppe gemacht wurden.Es geht uns hier auch nicht darum, ein grundsätzliches Vorurteil gegen dieAnalyse des Artikels Die Ursprünge,Dynamiken und Grenzen des keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus aufzubauen, die absolut zu unterscheiden ist von denstrittigen Argumenten, die wir hier kritisiert haben. Nachdem diese nötigenKlärungen erfolgt sind, können wir uns wieder sachlich der Fortsetzung derDiskussion über die Divergenzen in unserer Organisation zuwenden.
[1] Wie wir ihn inder Einführung zur Debatte dargelegt haben (Internationale Revue Nr. 42).
[2] Diese Stelle ist aus derfranzösischen Internet-Version der Internationalen Revue zitiert(fr.internationalism.org/rint133/debat_interne_causes_prosperite_consecutive_seconde_guerre_mondiale_2.html)undübersetzt, da sie in den anderen Ausgaben fehlt.
[3] InternationaleRevue Nr. 43 S. 17
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [37]
Kriegswirtschaft und Staatskapitalismus
- 8670 Aufrufe
Wie dieeinleitenden Bemerkungen in Internationale Revue Nr.42 richtig hervorheben, geht die Bedeutung der Debatte weit über die Analysedes Nachkriegsbooms als solchen hinaus und umfasst fundamentalere Aspekte dermarxistischen Kritik an der politischen Ökonomie. Die Debatte sollte zu einembesseren Verständnis der Haupttriebkräfte der kapitalistischen Gesellschaftbeitragen. Diese Triebkräfte bestimmen sowohl die ausserordentliche Dynamik desKapitalismus in seiner Aufstiegsperiode, die ihn von seinen Anfängen in denStadtstaaten Italiens und Flanderns bis zur Schaffung der ersten planetarischenGesellschaft vorwärtstrieben, als auch die enormen zerstörerischen Kräfte desKapitalismus in seiner Dekadenzperiode, die die Menschheit zwei Weltkriegenaussetzte, deren Barbarei Dschingis Khan hätte erblassen lassen, und die heutedie unmittelbare Existenz unserer Spezies bedrohen.
Was liegtdem dynamischen Expansionsdrang derkapitalistischen Ökonomie zugrunde?
Der Schlüssel zum Verständnis der Dynamikdes Kapitalismus befindet sich im unmittelbaren Kern der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse:
- die Ausbeutung der produzierenden Klassedurch die herrschende Klasse nimmt die Form des Erwerbs der Ware Arbeitskraftan;
- das Produkt der Arbeit der ausgebeutetenKlasse nimmt die Form von Waren an (Warenkapital), was folglich bedeutet, dassdie Aneignung der Mehrarbeit notwendigerweise den Verkauf dieser Waren auf demMarkt beinhaltet.[2]
Um es mit einem einfachen Beispielauszudrücken: Der Feudalherr nahm das Mehrprodukt von seinen Leibeigenen undverwendete es direkt zur Aufrechterhaltung seiner Hofhaltung. Der Kapitalistnimmt den Arbeitern den Mehrwert in Gestalt von Waren, die als solche keinenNutzen für ihn haben und auf dem Markt verkauft werden müssen, um inGeldkapital umgewandelt zu werden.
Dies schafft unvermeidlich ein Problemfür den Kapitalisten: Wer soll die Waren kaufen, die den Mehrwert verkörpern,welcher von der Arbeitskraft erst geschaffen worden war? Grob gesagt, hat eshistorisch zwei Antworten auf diese Frage in der Arbeiterbewegung gegeben:
- Laut einigen Theorien gibt es gar keinProblem: Der Prozess der Kapitalakkumulation und der normale Kreditverkehrerlaube es den Kapitalisten, in einen neuen Produktionszyklus zu investieren,der auf höherer Ebene den Mehrwert absorbiere, der im vorherigen Zyklus produziertwurde, und der ganze Prozess beginne ganz einfach von Neuem.[3]
- Für die Mehrheit in der IKS ist dieseErklärung inadäquat.[4]Denn wenn der Kapitalismus ohne jegliches Problem auf seinen eigenenFundamenten unendlich expandieren kann, warum war dann die kapitalistischeKlasse von der Manie der Eroberung fremden Territoriums ergriffen? Warumverharrte die Bourgeoisie nicht ruhig daheim und setzte die Ausweitung ihresKapitals ohne das riskante, teure und gewaltsame Geschäft der ständigenErweiterung ihres Zugangs zu neuen Märkten fort? Luxemburg beantwortet dieseFrage in der Anti-Kritik wie folgt: „Es müssen dies also Abnehmer sein, die zuihren Kaufmitteln auf Grund von Warenaustausch, also auch von Warenproduktiongelangen, die ausserhalb der kapitalistischen Warenproduktion stattfindet; esmüssen dies somit Produzenten sein, deren Produktionsmittel nicht als Kapitalanzusehen und die selbst nicht in die zwei Kategorien: Kapitalisten undArbeiter, gehören, die aber dennoch so oder anders Bedarf nach kapitalistischenWaren haben."[5]
Bis zur Veröffentlichung seines letztenArtikels in Internationale RevueNr. 43 schien es so, als könne man von der Annahme ausgehen, das Genosse C.Mcl.diese grundsätzliche Sichtweise der Expansion des Kapitalismus in seineraufsteigenden Phase teilt.[6] Indiesem Artikel allerdings, der den Titel „Die Ursprünge, Dynamiken und Grenzendes keynesianisch-fordistischen Staatskapitalismus"trägt, scheint der Genosse seine Meinung in dieser Frage geändert zu haben.Deutlicher als alles andere zeigt dies, dass Ideen im Verlauf dieser Debattesich ändern können - dennoch erscheint es uns als notwendig, für einen Momentinnezuhalten, um einige der neuen Ideen zu betrachten, die er vorgestellt hat.
Es muss dazu gesagt werden, dass dieseIdeen auf dem ersten Blick nicht sehr klar sind. Einerseits teilt uns C.Mcl.mit (und wir möchten dem zustimmen), dass die ausserkapitalistische Welt durcheine „Reihe von Möglichkeiten" unter anderem für den Verkauf von überschüssigenGütern sorgt.[7] Andererseitsteilt uns C.Mcl. jedoch mit, dass diese „ausserkapitalistische Sphäre" nichtnur unnötig war, weil der Kapitalismus vollkommen in der Lage sei, seineeigenen „internen Regulierungsmethoden" zu entwickeln, sondern auch, dass dieäussere Expansion des Kapitalismus im Grunde seine eigene Entwicklung bremse.Wenn wir Genosse C.Mcl. richtig verstehen, ist dies so, weil die Waren, die inausserkapitalistischen Märkten verkauft werden, aufhören, als Kapital zufungieren, und folglich nicht zur Akkumulation beitragen, während Waren, dieinnerhalb des Kapitalismus verkauft werden, sowohl die Realisierung vonMehrwert (durch die Umwandlung von Warenkapital in Geldkapital) erlauben alsauch selbst als Elemente der Akkumulation fungieren, ob in Gestalt von Maschinen(Produktionsmittel, konstantes Kapital) oder als Konsumgüter(Konsumptionsmittel für die Arbeiterklasse, variables Kapital). Um diese Ideezu untermauern, setzt uns C.Mcl. darüber in Kenntnis, dass dienicht-kolonialistischen Länder weit höhere Wachstumsraten im 19. Jahrhunderterlebten als die Kolonialmächte.[8]Diese Sichtweise erscheint uns sowohl empirisch als auch theoretisch als völligfalsch. Sie ist eine statische Sichtweise, in der die ausserkapitalistischenMärkte nicht anderes sind als eine Art Überlaufventil für den kapitalistischenMarkt, wenn er zu voll wird.
Die Kapitalisten verkaufen nicht nur anausserkapitalistische Märkte, sie kaufen auch von ihnen. Die Schiffe, diebillige Konsumgüter zu den Märkten Indiens und Chinas[9]transportierten, kamen nicht leer zurück: Sie kehrten beladen mit Tee,Gewürzen, Baumwolle und anderen Rohstoffen zurück. Bis in die sechziger Jahredes 19. Jahrhunderts war die Hauptquelle der englischen Textilindustrie dieSklavenwirtschaft der amerikanischen Südstaaten. Während der durch denBürgerkrieg verursachten „Baumwollnot" wurdenErsatzquellen in Indien und Ägypten gefunden.
„Innerhalb seines Zirkulationsprozesses,wo das industrielle Kapital entweder als Geld oder als Ware fungiert,durchkreuzt sich der Kreislauf des industriellen Kapitals, sei es alsGeldkapital oder als Warenkapital, mit der Warenzirkulation der verschiedenstensozialen Produktionsweisen, soweit letztre zugleich Warenproduktion ist. Ob dieWare das Produkt der auf Sklaverei gegründeten Produktion, oder von Bauern(Chinesen, indische Ryots), oder Gemeinwesen (holländisch Ostindien), oder derStaatsproduktion (wie solche, auf Leibeigenschaft gegründet, in früherenEpochen der russischen Geschichte vorkommt), oder halbwilder Jägervölker etc.:als Waren und Geld treten sie gegenüber dem Geld und den Waren, worin sich dasindustrielle Kapital darstellt, und gehn ein ebensosehr in den Kreislaufdesselben, wie in den des vom Warenkapital getragnen Mehrwerts, sofern letztrerals Revenue verausgabt wird (...) Der Charakter des Produktionsprozesses, aus demsie herkommen, ist gleichgültig; als Waren fungieren sie auf dem Markt, alsWaren gehn sie ein in den Kreislauf des industriellen Kapitals, wie in dieZirkulation des von ihm getragnen Mehrwerts."[10]
Was ist zum Argument zu sagen, dass diekoloniale Expansion die Entwicklung des Kapitalismus bremse? Unserer Ansichtnach gibt es hier zwei Fehler:
1. Wie die IKS (Marx und Luxemburg folgend)wiederholt betont hat, stellt sich das Problem der ausserkapitalistischenMärkte auf der Ebene des globalen und nicht des individuellen oder auchnationalen Kapitals.[11]
2. Die Kolonialisierung ist nicht die einzigeForm der Expansion in ausserkapitalistische Märkte.
Die Geschichte der Vereinigten Staatenbietet eine besonders klare - und, angesichts der wachsenden Rolle derUS-Wirtschaft im 19. Jahrhunderts, wichtige - Veranschaulichung dieses Punktes.
Zunächst einmal war die Abwesenheit einesUS-Kolonialreiches nicht irgendeiner „Unabhängigkeit" gegenüber derausserkapitalistischen Welt zuzuschreiben, sondern der Tatsache, dass dieseWelt innerhalb der Grenzen der USA enthalten war.[12]Wir haben bereits die Sklavenwirtschaft des amerikanischen Südens erwähnt. ImAnschluss an die Zerstörung des Letztgenannten im amerikanischen Bürgerkrieg(1861-65) expandierte der Kapitalismus in den nächsten dreissig Jahrenkontinuierlich in den amerikanischen Westen, was in etwa so dargestellt werdenkann: Niedermetzelung und ethnische Säuberung der indigenen Bevölkerung;Einrichtung einer ausserkapitalistischen Ökonomie durch Verkauf und Gewährungvon neu erworbenem „Regierungsland" anKolonisten und Kleinbauern[13],Auslöschung dieser ausserkapitalistischen Ökonomie durch Verschuldung,Schwindel und Gewalt und die Ausweitung der kapitalistischen Ökonomie.[14]
1890 erklärte das Statistische Bundesamtder USA offiziell die inneren Grenzen für geschlossen. 1893 traf eine schwereDepression die US-Wirtschaft. Die US-Bourgeoisie war in den 1890er Jahren inwachsendem Masse mit der Notwendigkeit konfrontiert, ihre nationalen Grenzenauszuweiten.[15]1898 erklärte ein Dokument des State Department: „Es scheint bekannt zu sein,dass wir jedes Jahr mit einem wachsenden Überschuss von Fabrikprodukten für denVerkauf in fremde Märkte konfrontiert sind, wenn amerikanische Facharbeiter undHandwerker das ganze Jahr über beschäftigt bleiben sollen. Die Vergrösserungfremder Konsumtion von Produkten unserer Betriebe und Werkstätten ist daher zueinem ernsten Problem sowohl der Staatsmänner als auch der Geschäftsleute geworden".[16]Es folgte eine rapide imperialistische Expansion: Kuba (1898), Hawaii(ebenfalls 1898), die Philippinen (1899)[17],die Kanalzone Panama (1903). 1900 erklärte Albert Beveridge (ein führenderVertreter der „imperialistischen Interessen" der USA im Senat): „DiePhilippinen sind für immer unser (...) Und über die Philippinen hinaus gibt esChinas unbegrenzte Märkte (...) Der Pazifik ist unser Ozean (...) Wohin sollen wiruns auf der Suche nach den Konsumenten unseres Überflusses wenden? DieGeographie beantwortet die Frage. China ist unser natürlicher Konsument..."[18]
Dekadenz und Krieg
Unter Europäern wird die imperialistischeRaserei am Ende des 19. Jahrhunderts häufig in Begriffen wie das „Rennen umAfrika" betrachtet. Doch die US-Eroberung derPhilippinen war in vielerlei Weise von grösserer Bedeutung, da sie denAugenblick symbolisiert, in dem die imperialistische Expansion Europas genOsten auf die US-Expansion gen Westen traf. Der erste Krieg dieser neuenimperialistischen Epoche wurde zwischen asiatischen Mächten, Russland undJapan, ausgefochten, die um die Kontrolle über Korea und den Zugang zu denchinesischen Märkten rangen. Dies war wiederum ein Schlüsselfaktor in derersten revolutionären Erhebung des 20. Jahrhunderts, 1905 in Russland.
Was beinhaltete dieses neue „Zeitalterder Kriege und Revolutionen" (wie es die Dritte Internationale beschrieb) fürdie Organisation der kapitalistischen Ökonomie?
Sehr schematisch gesprochen, beinhaltetes die Umkehrung des Verhältnisses zwischen Wirtschaft und Krieg: Während inder aufsteigenden Periode des Kapitalismus die Kriegsführung eine Funktion derökonomischen Expansion war, steht in der Dekadenz die Ökonomie umgekehrt zuDiensten des imperialistischen Krieges. Die kapitalistische Ökonomie ist in derDekadenz eine permanente Kriegswirtschaft.[19]
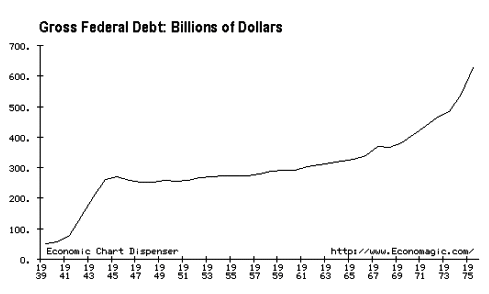
Grafik 1: Bruttoschulden der USA in Milliarden Dollar
Dies ist das fundamentale Problem, dasder gesamten Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie seit 1914 undinsbesondere der Wirtschaft während des Nachkriegsbooms nach 1945 zugrundeliegt.
Bevor wir fortfahren, den Nachkriegsboomaus diesem Blickwinkel zu untersuchen, erscheint es uns als notwendig, kurzeinige der anderen Positionen, die in dieser Debatte vorgestellt wurden, zubetrachten.
1) Die Rolle der ausserkapitalistischenMärkte nach 1945
Es lohnt sich, daran zu erinnern, dassbereits die Dekadenzbroschüre der IKS der fortgesetzten Zerstörungausserkapitalistischer Märkte in dieser Periode eine Rolle einräumte[20]und es für möglich hielt, dass wir ihre Rolle im Nachkriegsboom unterschätzthaben. In der Tat setzt sich die Zerstörung solcher Märkte (in dem klassischenSinn, wie er von Luxemburg beschrieben wurde) bis heute in den dramatischstenFormen fort, wie wir angesichts Zehntausender Selbstmorde unter den indischenBauern in jüngster Zeit sehen können, die nicht in der Lage sind, ihreKreditschulden zurückzuzahlen, die sie zum Kauf von Saatgut und Düngemittel vonMonsanto und anderen Konzernen aufgenommen haben.[21]
Nichtsdestotrotz ist es schwierig, sichvorzustellen, wie diese Märkte entscheidend zum Nachkriegsboom beigetragenhaben könnten, wenn wir folgende Faktoren berücksichtigen:
- die enorme Zerstörung, die die Kleinbauern invielen Ländern infolge von Krieg und Wirtschaftskatastrophe zwischen 1914 und1945 heimsuchte[22];
- die Tatsache, dass sämtliche westlichenÖkonomien die Landwirtschaft im Nachkriegsboom massiv subventionierten: Indiesen Ökonomien war die Bauernwirtschaft eher ein Kostenfaktor für denKapitalismus denn ein Markt.
2) Wachsende Verschuldung
Hier bewegen wir uns auf einen weitausfesteren Boden. Es trifft zu, dass das Schuldenwachstum, verglichen mit demastronomischen Ausmass, das es heute nach dreissig Jahren der Krise erreichthat, im Nachkriegsboom auf dem ersten Blick als trivial erscheint. Verglichenjedoch mit dem, was die Schulden zuvor betrugen, war ihr Anstieg spektakulär.In den USA stieg die bundesstaatliche Bruttoverschuldung von 48,2 MilliardenDollar 1938 auf 483,9 Milliarden Dollar im Jahr 1973, d.h. auf das Zehnfache.[23]
Auch die Schulden der US-Konsumentenstiegen massiv an, von ungefähr vier Prozent des BSP im Jahr 1948 auf mehr alszwölf Prozent in den frühen Siebzigern.
Anleihen auf Grundbesitz stiegenebenfalls an, von sieben Milliarden Dollar im Jahr 1947 auf 70,5 MilliardenDollar im Jahr 1970 - ein zehnfaches Wachstum in Zahlen, das die reale Lagesogar unterschätzt, da die massiven Anleihen der Regierung mit ihren niedrigenZinssätzen und günstigen Bedingungen bedeuteten, dass ab 1955 allein dieFederal Housing Administration und die Veterans Administration 41 Prozent allerHypotheken verwalteten.[24]
3) Steigende Löhne
Für Genosse C.Mcl. war die Prosperität imNachkriegsboom zu einem grossen Teil dem Umstand geschuldet, dass die Löhne imGleichklang mit der Produktivität stiegen, und zwar als Teil einer bewusstenkeynesianischen Politik, die darauf ausgerichtet war, überschüssige Kapazitätenaufzusaugen und so die fortgesetzte Expansion des Marktes zu erlauben.
Es ist sicherlich richtig, dass, wie Marxbereits im Kapitalhervorgehoben hatte, Löhne steigen können, ohne die Profite zu bedrohen, wenndie Produktivität gleichfalls ansteigt. Es ist ebenfalls zutreffend, dass dieMassenproduktion von Konsumgütern ohne den Massenkonsum durch dieArbeiterklasse unmöglich ist. Und es ist ebenfalls wahr, dass es eine bewusstePolitik war, die Löhne und den Lebensstandard der ArbeiterInnen nach dem II.Weltkrieg anzuheben, um soziale Revolten abzuwenden. Nichts von alledem löstjedoch das Problem, das sowohl von Marx als auch von Luxemburg ausgemachtwurde: dass die Arbeiterklasse nicht den vollen Wert dessen, was sieproduziert, absorbieren kann.
Darüber hinaus stützt sich die Hypothesevon C.Mcl. auf zwei Hauptannahmen, die unserer Ansicht nach empirisch nichtzutreffen:
1. Die erste ist, dass der Anstieg der Löhnedurch ihre Bindung an die Produktivität garantiert wird. Wir können dafür nochkein Anzeichen einer allgemeinen Praxis erkennen, ausser in unbedeutendenFällen wie in Belgien.[25] Umnur zwei Gegenbeispiele zu nennen: Die italienische Scalamobile, die 1945 eingeführt wurde, band die Löhne an die Inflation(insgesamt natürlich eine andere Sache), und der „Gesellschaftsvertrag", dervon Wilsons Labour-Regierung in Grossbritannien am Ende des Booms eingeführtwurde, war ein verzweifelter Versuch, die Löhne in einer Periode hoherInflation zu senken, indem sie an die Produktivität gebunden wurden.
2. Die zweite ist die Behauptung, dass daswestliche Kapital bis zum Beginn der Periode der „Globalisierung" in den 1980erJahren keine billige fremde Arbeitskraft verlangte. Dies ist schlicht falsch:In den USA reduzierte die Migration in die Städte die ländliche Bevölkerung von24,4 Millionen im Jahr 1945 auf nur noch 9,7 Millionen 1970.[26]In Europa war das Phänomen noch spektakulärer: Etwa 40 Millionen Menschenmigrierten vom Land oder von ausserhalb Europas in die industriellenHauptregionen.[27]
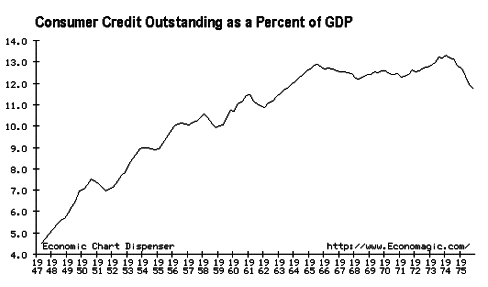
Grafik 2: Konsumkredite in Prozent des BIP
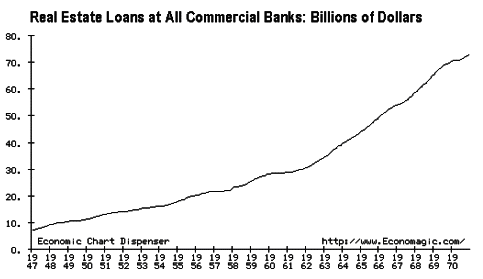
Grafik 3: Immobiliendarlehen von Geschäftsbanken, in Milliarden
Die Früchte des Krieges
Der II. Weltkrieg war - noch mehr als derI. Weltkrieg - eine schlagende Demonstration der fundamentalen Irrationalitätdes imperialistischen Krieges in der Dekadenz. Weit davon entfernt, die Siegermit der Eroberung neuer Märkte für die Kriegskosten zu entschädigen,hinterliess der Krieg sowohl Besiegte als auch Sieger ruiniert und ausgezehrt.Mit einer Ausnahme: die Vereinigten Staaten, das einzige kriegführende Land,das nicht die Zerstörung auf eigenem Territorium erlebte. Diese Ausnahme wardas Fundament für das ausserordentliche - und somit nicht wiederholbare -Phänomen des Nachkriegsbooms.
Einer der Haupteffekte der anderenPositionen, die in dieser Debatte vorgestellt wurden, ist, dass a) sie dazuneigen, das Problem in rein ökonomischen Begriffen zu sehen und dass b) sielediglich den Nachkriegsboom an sich betrachten und damit übersehen, dassdieser Boom von der durch den Krieg geschaffenen Lage bestimmt wurde.
Wie sah diese Lage nun aus?
Zwischen 1939 und 1945 verdoppelte sichdie Grösse der US-Wirtschaft.[28]In den existierenden Industrien (wie im Schiffbau) wurden Techniken derMassenproduktion angewendet. Ganze Industrien wurden neu geschaffen:Massenproduktion im Flugzeugbau, Elektronik und Computer (die ersten Computerwurden benutzt, um ballistische Flugbahnen zu kalkulieren), Pharmazeutika (mitder Entdeckung des Penicillins), Kunststoffe - die Liste geht ins Endlose. Und obwohl die Regierungsschuldenwährend des Krieges massiv nach oben schossen, war für die US-Bourgeoisie dieseEntwicklung zu einem bedeutenden Teil reine Kapitalanhäufung, da sie dasbritische und das französischen Imperium ausbluten liess und sich ihrenangesammelten Reichtum im Austausch gegen Waffen aneignete.
Trotz dieser überwältigendenÜberlegenheit waren die Vereinigten Staaten nach Kriegsende nicht ohneProbleme, um es vorsichtig auszudrücken. Wir können sie folgendermassenzusammenfassen:
1. Wo befanden sich die Absatzmärkte für dieVerdoppelung der US-Industrieproduktion, die während des Krieges stattgefundenhatte?[29]
2. Wie sollten die USA ihre nationalen Interessen- nun zum ersten Mal wirklich weltweit - gegen die Bedrohung durch densowjetischen Expansionsdrang schützen?
3. Wie konnte man grosse soziale Aufstände unddie potenzielle Bedrohung durch die Arbeiterklasse bannen? Keine Fraktion derWeltbourgeoisie hatte den Oktober 1917 vergessen - schon gar nicht in Europa.[30]
Zu verstehen, wie die USA den Versuch inAngriff nahmen, diese Probleme zu lösen, ist der Schlüssel zum Verständnis desNachkriegsbooms - und seines Scheiterns in den 1970er Jahren. Dies muss bis zueinem nächsten Artikel warten; dennoch ist es wert, hervorzuheben, dass RosaLuxemburg bereits vor der vollen Entwicklung der staatskapitalistischenÖkonomie während des Ersten und vor allem des Zweiten Weltkrieges eine kurzeVorwegnahme der ökonomischen Auswirkungen der Militarisierung der Wirtschaftgeliefert hatte: Nach ihr „tritt hier an Stelle einer grossen Anzahl kleinerzersplitterter und zeitlich auseinanderfallender Warennachfragen, die vielfachauch durch die einfache Warenproduktion befriedigt wären, also für dieKapitalakkumulation nicht in Betracht kämen, eine zur grossen einheitlichenkompakten Potenz zusammengefasste Nachfrage des Staates. Diese setzt aber zuihrer Befriedigung von vornherein die Grossindustrie auf höchster Stufenleiter,also für die Mehrwertproduktion und Akkumulation günstigste Bedingungen voraus.In Gestalt der militaristischen Aufträge des Staates wird die zu einergewaltigen Grösse konzentrierte Kaufkraft der Konsumentenmassen ausserdem derWillkür, den subjektiven Schwankungen der persönlichen Konsumtion entrückt undmit einer fast automatischen Regelmässigkeit, mit einem rhythmischen Wachstumbegabt. Endlich befindet sich der Hebel dieser automatischen und rhythmischenBewegung der militaristischen Kapitalproduktion in der Hand des Kapitals selbst- durch den Apparat der parlamentarischen Gesetzgebung und des zur Herstellungder sogenannten öffentlichen Meinung bestimmten Zeitungswesens. Dadurch scheintdieses spezifische Gebiet der Kapitalakkumulation zunächst von unbestimmterAusdehnungsfähigkeit. Während jede andere Gebietserweiterung des Absatzes undder Operationsbasis für das Kapital in hohem Masse von geschichtlichen,sozialen, politischen Momenten abhängig ist, die ausserhalb der Willenssphäredes Kapitals spielen, stellt die Produktion für den Militarismus ein Gebietdar, dessen regelmässige stossweise Erweiterung in erster Linie in den bestimmendenWillen des Kapitals selbst gegeben zu sein scheint."[31]
Weniger als fünfzig Jahre, nachdem dieAkkumulation des Kapitals geschrieben worden war, konnte die Realität desMilitarismus in folgenden Worten beschrieben werden: Die „Vereinigung einesimmensen militärischen Establishments und einer grossen Waffenindustrie isteine neue Erfahrung für die Amerikaner. Der totale Einfluss - ökonomisch,politisch und sogar geistig - ist in jeder Stadt spürbar, in jedemStaatsgebäude, jedem Amt der Bundesregierung (...) wir müssen ihre folgenschwerenImplikationen begreifen. Unser Schuften, unsere Ressourcen und unser Auskommensind davon betroffen und auch die unmittelbare Struktur unserer Gesellschaft.
Wir müssen in den Regierungsgremienwachsam sein gegenüber einer unerwünschten Einflussnahme durch denmilitärisch-industriellen Komplex, ob sie gewollt oder ungewollt ist. DasPotenzial für eine desaströse Zunahme fehlgeleiteter Macht existiert und wirdweiterexistieren.
(...) Ähnlich und grösstenteilsverantwortlich für die stürmischen Veränderungen unsererindustriell-militärischen Stellung war die technologische Revolution in denletzten Jahrzehnten gewesen.
„In dieser Revolution ist die Forschungin den Mittelpunkt gerückt; sie ist auch formalisierter, komplexer und teurergeworden. Ein ständig wachsender Anteil wird für, von oder in Richtung derBundesregierung betrieben." (eigene Übersetzung) Diese Worte wurden 1961ausgesprochen, nicht von irgendeinem linken Intellektuellen, sondern vonUS-Präsident Dwight D. Eisenhower.
Jens, 10. Dezember 2008
[1] Aus Platzgründen ist es unmöglich, der gesamten Periode von 1945 bis1970 gerecht zu werden. Wir schlagen daher vor, nicht weiter zu gehen, als eineAnalyse der Fundamente des Nachkriegsbooms vorzustellen, mit der wir uns späterdetaillierter, so ist zu hoffen, befassen werden.
[2] Es ist kein Zufall, dass das erste Kapitel von DasKapital den Titel „Die Ware" trägt.
[3] Wir lassen für einen Augenblick die Frage der zyklischen Krisenbeiseite, wodurch sich dies historisch entwickelt.
[4] Wir wollen hier nicht wiederholen, was die IKS bei vielenGelegenheiten bereits geschrieben hat, um unsere Sichtweise zu untermauern,dass für Marx und Engels - und im Besonderen für Luxemburg unter den Marxistender Nachfolgergeneration - das Problem der Unzulänglichkeit derkapitalistischen Märkte ein grundlegendes Problem war, das dem Prozess dererweiterten Reproduktion des Kapitals im Wege steht.
[5] Rosa Luxemburg, Antikritik, Gesammelte Werke Band 5 S. 427 f.
[6] Siehe besonders den Artikel, den derselbe Genosse in InternationaleRevue, Nr. 127 (eng., franz. und span. Ausgabe)verfasst hat, wo er - unter dem Untertitel „Die Identität der Analyse Rosas mitMarx" - sehr deutlich und gut dokumentiert demonstriert hat, dass die AnalyseLuxemburgs in Kontinuität mit jener von Marx steht.
[7] „Auch nachdem die Fundamente des Kapitalismus nach drei Jahrhundertender ursprünglichen Akkumulation (1500-1825) gesichert waren, im Grunde in dergesamten aufsteigenden Periode, bot dieses Milieu weiterhin eine ganze Reihevon Quellen des Profits, als Ventil für den Verkauf von Waren aus derÜberproduktion und als zusätzliche Quelle von Arbeitskräften."
[8] „Im 19. Jahrhundert, als die Kolonialmärkte am wichtigsten waren,wuchsen ALLE NICHT-kolonialen Länder schneller als die Kolonialländer (71%schneller im Durchschnitt). Diese Beobachtung ist in der gesamten Geschichtedes Kapitalismus zutreffend. Verkäufe ausserhalb des reinen Kapitalismusermöglichten es sicherlich individuellen Kapitalisten, ihre Waren zurealisieren, doch behinderten sie eine globale Akkumulation des Kapitalismus,da sie, wie die Waffen, materiellen Mitteln entsprechen, die den Kreislauf derAkkumulation verlassen."
[9] Bemerkenswerterweise Opium im Fall Chinas. Die äusserst„rechtschaffene" britische Bourgeoisie führte zwei Kriege, um die chinesischeRegierung zur Erlaubnis zu zwingen, ihre Bevölkerung mit britischem Opium zu vergiften.
[10] Das Kapital, Zweiter Band, I. Abschnitt „DieMetamorphosen des Kapitals und ihr Kreislauf", 4. Kapitel „Die drei Figuren desKreislaufsprozesses", MEW 24 S. 113
[11] Einfach ausgedrückt: Wenn die deutsche Industrie (keine Kolonien) diebritische Industrie (mit Kolonien) auf dem Weltmarkt hinter sich liess unddaher sich einer grösseren Wachstumsrate erfreute, dann deshalb, weil diedeutsche Industrie ebenfalls von den ausserkapitalistischen Märktenprofitierte, die vom britischen Imperialismus erobert worden waren.
[12] Nachdem die USA mit Lug und Trug sowie unter Zwang den MexikanernKalifornien (1845-47) und Texas (1836-45) abgenommen hatten, wurden dieseStaaten nicht in ein Kolonialreich einverleibt, sondern in das nationaleTerritorium der USA.
[13] Zum Beispiel der „Oklahoma Land Rush" von 1889: Das Rennen um das Landstartete am 22. April 1889 mittags mit geschätzten 50.000 Menschen, dieSchlange standen für einen Anteil an den zur Verfügung gestellten zweiMillionen Acres (8.000 Quadratkilometer).
[14] Die Geschichte der Entwicklung des Kapitalismus in den USA während des19. Jahrhunderts verdient an sich eine Reihe von Artikeln, und leider haben wirauch hier nicht den Platz, um mehr ins Detail zu gehen. Es lohnt sich fernerdarauf hinzuweisen, dass sich diese Mechanismen der kapitalistischen Expansionnicht auf die USA beschränkten, sondern - wie wir in Luxemburgs Einführungin die Nationalökonomie sehen können - auch präsentwaren in Russlands Expansion in den Osten und in der Einverleibung Chinas,Ägyptens und der Türkei, von denen keines jemals kolonialisiert worden war, indie kapitalistische Wirtschaft.
[15] Diese Konzentration hatte bereits in den Monroe-Doktrin ihren Ausdruckgefunden, die 1823 verabschiedet worden war und unmissverständlich feststellte,dass die USA den gesamten amerikanischen Kontinent, Nord und Süd, als ihreexklusive Interessenssphäre betrachteten - und der Monroe-Doktrin wurde durchwiederholte militärische Interventionen der USA in Lateinamerika Nachdruckverliehen.
[16] Zitiert beiHoward Zinn, A people'shistory of the United States (eigene Übersetzung).
[17] Die Einnahme der Philippinen, bei der die USA zunächst die spanischeKolonialmacht gewaltsam vertrieben und schliesslich einen fürchterlichen Krieggegen die philippinischen Insurrectos führten, ist ein besonders gelungenes Beispiel der kapitalistischenHeuchelei und Barbarei.
[18] Zinn, a.a.O.
[19] Ein Beispiel wird helfen, um dies zu veranschaulichen. 1805 war dieindustrielle Revolution in Grossbritannien bereits im Gange. Der Gebrauch derDampfkraft und der mechanisierten Textilproduktion hatte sich seit den 1770erJahren rapide verbreitet. Dennoch war im gleichen Jahr, als die Briten diefranzösischen und spanischen Flotten in der Schlacht von Trafalgar zerstörten,Nelsons Flagschiff HMS Victory fast fünfzig Jahre alt (das Schiff wurde nachEntwürfen gebaut, die 1756 gezeichnet wurden, und 1765 schliesslich vom Stapelgelassen). Man vergleiche dies mit der heutigen Lage, in der diefortgeschrittensten Technologien von der Rüstungsindustrie abhängig sind.
[20] Die Dekadenzbroschüre bringt dieses Phänomen - aus unserer Sicht zuRecht - mit dem wachsenden Militarismus in den „Drittwelt"-Ländern inZusammenhang.
[21] Man könnten auch die Eliminierung kleiner Händler in denfortgeschrittenen Ökonomien durch die Verbreitung von Supermärkten und derMassenvermarktung gewöhnlicher Haushaltsgegenstände (einschliesslich derErnährung natürlich) erwähnen, beides Phänomene, die sich in den 1950er und1960er Jahren auszubreiten begannen.
[22] Stalins Zwangskollektivierungsprogramm in der UdSSR in den 1930erJahren, Chinas Warlords und der Bürgerkrieg in den Zwischenkriegsjahren, dieUmwandlung der Bauernwirtschaften in Marktwirtschaften in Ländern wie Rumänien,Norwegen oder Korea, um sich der Forderungen des deutschen und japanischenImperialismus nach Nahrungsmittelautonomie zu erwehren, die katastrophalenAuswirkungen der Depression auf kleine Farmer in den USA (Oklohoma dust bowl),etc.
[23] Zahlen und Graphiken sind den US-Regierungsstatistiken entnommen undverfügbar unter: https://www.economagic.com [367] (Angaben ohne Gewähr). Wirkonzentrieren uns in diesem Artikel auf die US-Wirtschaft zum Teil deshalb,weil ihre Regierungsstatistiken leichter erhältlich sind, aber auch und vorallem wegen des erdrückenden Gewichts der US-Wirtschaft in der Weltwirtschaftin dieser Zeit.
[24] James T. Patterson, Grand Exspectations, S. 72.
[25] In der Tat existierten laut einer Studie (https://cedar.Barnard.columbia.edu/~econhist/papers/Hanes_sscale4.pdf [368]) in bestimmtenIndustrien in den USA und in Grossbritannien ab Mitte des 19. Jahrhunderts"gleitende" Lohnabkommen; erst nach dem Krieg wurden sie abgeschafft.
[26] Patterson, a.a.O. Dies war "eine der dramatischsten demographischenUmschichtungen in der modernen amerikanischen Geschichte".
[27] "Zwischen 1955 und 1971 zogen in Italien geschätzte neun MillionenMenschen von einer Region ihres Landes in eine andere (...) Sieben MillionenItaliener verliessen zwischen 1945 und 1970 ihr Land. In den Jahren 1950-1970verliess ein Viertel aller griechischen Arbeitskräfte ihr Land, um im AuslandArbeit zu finden (...) Es wird geschätzt, dass zwischen 1961 und 1974 anderthalbMillionen portugiesische Arbeiter Jobs im Ausland fanden - die grössteBevölkerungsbewegung in der Geschichte Portugals. Sie liessen gerade einmal 3,1Millionen Arbeitskräfte in Portugal zurück (...) Ab 1973 gab es allein inWestdeutschland fast eine halbe Million Italiener, 535.000 Jugoslawen und605.000 Türken." (Tony Judt, Postwar: a history of Europe since 1945, S. 334f., unsere Übersetzung ausdem Englischen)
[28] Die Vereinigten Staaten machten ungefähr 40 Prozent derWeltindustrieproduktion aus: 1945 produzierten allein die Vereinigten Staatendie Hälfte aller Kohle weltweit, zwei Drittel des Erdöls und die Hälfte derElektrizität. Hinzu kommt, dass die USA mehr als 80 Prozent derWeltgoldreserven hielten.
[29] Zinn (a.a.O.) zitiert einen Beamten aus dem State Department im Jahre1944: „Wie Sie wissen, planen wir nach dem Krieg eine enorme Steigerung derProduktion in diesem Land, und der amerikanische Heimatmarkt kann nichtunendlich all diese Produktion absorbieren. Es wird fraglos so sein, dass wirin stark wachsendem Masse der fremden Märkte bedürfen." (aus dem Englischen)
[30] Doch auch in den USA. Laut Zinn (a.a.O.S. 417): „Während des Krieges gab es vierzehntausend Streiks (in den USA) mit6.770.000 Arbeitern, mehr als in jedem anderen vergleichbaren Zeitraum in deramerikanischen Geschichte (...) Als der Krieg endete, setzten sich die Streiks inRekordhöhe fort - in der ersten Hälfte des Jahres 1946 drei Millionen Arbeiterim Streik."
[31] Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, 1913, Kapitel „Der Militarismus auf dem Gebiet derKapitalakkumulation"
(unsere Hervorhebungen).
Erbe der kommunistischen Linke:
- Staatskapitalismus [37]
Resolution zur internationalen Situation
- 3170 Aufrufe
Am 6. März 1991 verkündete der damalige Präsident George Bush nach dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Sieg der Koalition im Irak vor dem US-Kongress die Schaffung einer „neuen Weltordnung", die sich auf den „Respekt des Völkerrechts" stütze. Diese neue Weltordnung sollte der Welt „Frieden und Wohlstand" bringen. Das „Ende des Kommunismus" bedeute den „endgültigen Triumph des liberalen Kapitalismus". Einige, wie der „Philosoph" Francis Fukuyama, sagten gar das „Ende der Geschichte" voraus. Aber die Geschichte, d.h. die wirkliche und nicht die der Propagandareden, hat den Schwindel dieser Scharlatane sehr schnell als lächerlich entblösst. Statt Frieden brach im Jahr1991 ganz im Gegenteil der Krieg im ehemaligen Jugoslawien aus, mit Hunderttausenden Toten im Herzen Europas, auf einem Kontinent, der seit mehr als einem halben Jahrhundert von dieser Geissel verschont geblieben war. Die Rezession von 1993, dann der Zusammenbruch der asiatischen „Tiger" und „Drachen"1997 und schliesslich eine neuerliche Rezession im Jahr 2002 setzten der durch die „Internetblase" aufgekommenen Euphorie ein Ende und kratzten beträchtlich an den Illusionen über den von Bush Senior angekündigten „Wohlstand". Heute dagegen zeichnen sich die offiziellen Reden der herrschenden Klasse dadurch aus, die Reden von gestern zu ignorieren. Zwischen 2003 und 2007 wareneuphorische Töne in den offiziellen Reden der Herrschenden zu vernehmen. Man feierte den Erfolg des „angelsächsischen Modells", das beispiellose Profite, beträchtliche Wachstumsraten des BIP und selbst einen bedeutsamen Rückgang der Arbeitslosigkeit ermöglichte. Man konnte die Triumphe der „liberalen Wirtschaft" und den Nutzen der „Deregulierung" nicht genügend loben. Doch seit dem Sommer 2007 und vor allem seit dem Sommer 2008 ist dieser Optimismus wie Schnee in der Sonne geschmolzen. Jetzt blenden die Herrschenden Begriffe wie„Wohlstand", „Wachstum", „Triumph des Liberalismus" in ihren Reden diskret aus. Am Tisch des grossen Banketts der kapitalistischen Wirtschaft hat sich nun ein Gast niedergelassen, den man für immer verbannt zu haben glaubte: die Krise, das Gespenst einer „neuen weltweiten Depression", ähnlich wie die der 1930erJahre.
Die Vertuschung der Krisenursachen
2. Den Reden aller Verantwortlichen der herrschenden Klasse, aller„Wirtschaftsexperten", auch der bedingungslosesten Beweihräucherer des Kapitalismus zufolge ist die gegenwärtige Krise die schlimmste seit der grossen Depression, die 1929 ausgebrochen war. Die OECD meint: „Die Weltwirtschaft befindet sich inmitten der tiefsten Rezession, die wir zu unseren Lebzeiten je erlebt haben." (Zwischenbericht März 2009) Einige zögern nicht einmal, in Erwägung zu ziehen, dass sie noch schlimmer werden wird und dass der Grund, weshalb ihre Folgen nicht so katastrophal sein werden wie während der 1930erJahre, darin liege, dass seither die Führer der Welt aus dieser Erfahrung gelernt hätten und mittlerweile mit solchen Situationen umgehen könnten. Das werde insbesondere daraus ersichtlich, dass sie verhindert hätten, dass „jeder für sich handelt". „Obwohl dieser schwere weltweite Konjunkturabschwung von einigen bereits als ‘Grosse Rezession' bezeichnet wurde, sind wir weit davonentfernt, eine Wiederholung der Grossen Depression der 1930er Jahre zu erleben, was der Qualität und Intensität der gegenwärtig getroffenen staatlichen Massnahmen zu verdanken ist. Die Grosse Depression wurde durch verheerende wirtschaftspolitische Fehler verstärkt, von einer kontraktiven Geldpolitik bis hin zu einer Beggar-thy-Neighbour-Politik in Form einer protektionistischen Handelspolitik und eines Abwertungswettlaufs. Im Gegensatz hierzu hat die gegenwärtige Rezession alles in allem die richtigen Politikreaktionen ausgelöst." (ebenda) (www.oecd.org [369])
Auch wenn alle Teile der herrschenden Klasse die Tragweite der gegenwärtigen Erschütterungen der kapitalistischen Wirtschaft erkannt haben, sind ihre Erklärungen, die oft voneinander abweichen, selbstredend unfähig, die wahre Bedeutung dieser Erschütterungen und die Perspektive, die sich daraus für die gesamte Gesellschaft ergibt, zu begreifen. Einigen zufolge ist die „verrückte Finanzwelt" für die grossen Schwierigkeiten des Kapitalismus verantwortlich, d.h. die Tatsache, dass sich seit Anfang 2000 eine Reihe von „toxischen Finanzprodukten" entwickelt hat, die eine grenzenlose Krediterweiterung ohne ausreichende Zahlungsgarantien ermöglichte. Andere behaupten, dass der Kapitalismus international unter zu viel „Deregulierung" leide, eine Orientierung, die im Zentrum der „Reagonomics" Anfang der 1980er Jahre stand. Andere wiederum, insbesondere die Repräsentanten der Linken des Kapitals, beteuern, die eigentliche Wurzel liege in den zu niedrigen Einkommen der Beschäftigten, was diese insbesondere in den entwickeltsten Ländern dazu zwinge, die Flucht in eine noch grössere Verschuldung anzutreten, um ihre elementaren Bedürfnisse zu befriedigen. Aber ungeachtet all der unterschiedlichen Auffassungen liegt ihre Gemeinsamkeit darin zu behaupten, nicht der Kapitalismus als Produktionsweise sei die Ursache, sondern diese oder jene Erscheinungsform des Systems. Gerade dieses Ausgangspostulat hindert all diese Interpreten daran, die wahren Ursachen der gegenwärtigen Krise und das, was auf dem Spiel steht, zu begreifen.
Die Überproduktionskrise und die Droge der Verschuldung
3. In Wirklichkeit kann man nur durch eine globale und historische Ansicht der kapitalistischen Produktionsweise begreifen, welche Konsequenzen und Perspektiven sich aus der gegenwärtigen Krise ergeben. Auch wenn dies von allen „Wirtschaftsexperten" vertuscht wird, treten heute die Widersprüche des Kapitalismus offen zutage: die Überproduktionskrise des Systems, seine Unfähigkeit, die Masse der produzierten Waren zu verkaufen. Ergibt keine Überproduktion hinsichtlich der wirklichen Bedürfnissen der Menschheit, die noch weit davon entfernt sind, befriedigt zu werden. Es gibt nur Überproduktion im Verhältnis zu den zahlungsfähigen Märkten; das Geld zur Zahlung der Produkte ist nicht vorhanden. Die offiziellen Reden sowie die Massnahmen, die von den meisten Regierungen ergriffen werden, konzentrieren sich ausnahmslos auf die Finanzkrise, auf die Verhinderung des Bankrotts von Banken, aber in Wirklichkeit ist das, was die Kommentatoren (im Gegensatz zur„fiktiven Wirtschaft") die „reale Wirtschaft" nennen, dabei diese Tatsache zu verdeutlichen: Kein Tag vergeht, an dem nicht neue Werksschliessungen, Massenentlassungen, Pleiten von Industrieunternehmen angekündigt werden. Die Tatsache, dass General Motors, das jahrzehntelang das grösste Unternehmen der Welt war, sein Überleben nur der massiven Unterstützung des amerikanischen Staates verdankt, während Chrysler sich offiziell zahlungsunfähig erklärte und in die Hände der italienischen Firma Fiat fällt, spricht Bände über die tieferliegenden Probleme der kapitalistischen Wirtschaft. Der Rückgang des Welthandels, der zum ersten Mal seit dem 2. Weltkrieg registriert wurde und von der OECD für 2009 mit -13.2 Prozent prognostiziert wird, zeigt die Unfähigkeit der Unternehmen, die entsprechenden Abnehmer für ihre Waren zu finden.
Die heute offensichtlich gewordene Überproduktionskrise ist keine einfache Folge der Finanzkrise, wie uns die meisten „Experten" weiszumachen versuchen. Sie hat ihren Ursprung in den inneren Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaft selbst, wie es der Marxismus schon vor anderthalb Jahrhunderten aufgezeigt hat. Solange die Eroberung der Welt durch die kapitalistischen Metropolen andauerte, ermöglichten die neuen Märkte die vorübergehende Überwindung der Überproduktion. Aber sobald diese Eroberungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu Ende gingen, hatten die Metropolen, insbesondere jene, die beim Run auf die Kolonien zuletzt auf den Zug aufgesprungen war, Deutschland, keine andere Wahl als die Einflussgebiete der Rivalen anzugreifen, was den Ersten Weltkrieg auslöste, lange bevor die Überproduktionskrise zum Ausbruch kam. Diese trat jedoch mit dem Krach von 1929 und der grossen Depression der 1930er Jahre voll ans Tageslicht, wodurch die kapitalistischen Grossmächte zur Flucht in den 2.Weltkrieg getrieben wurden, der den Ersten Weltkrieg hinsichtlich der Massaker und der Barbarei bei weitem übertraf. All die von den Grossmächten nach dem 2.Weltkrieg ergriffenen Massnahmen, insbesondere die Organisierung grosser Bereiche der Wirtschaft unter US-Vorherrschaft wie auf der Ebene der Währung(Bretton Woods) und die Einführung neokeynesianischer Massnahmen durch die Staaten sowie die positiven Auswirkungen der Entkolonisierung auf die Märkte ermöglichten dem Weltkapitalismus, nahezu drei Jahrzehnte lang die Illusion zu verbreiten, er habe letztendlich doch seine Widersprüche überwunden. Doch diese Illusion wurde 1974 durch den Ausbruch einer gewaltigen Rezession erschüttert, die sich besonders stark auf die USA auswirkte. Diese Rezession bildete dabei nicht etwa den Auftakt zu den grossen Kalamitäten des Kapitalismus, da ihr bereits die Krise von 1967 vorausgegangen war und auch der Dollar sowie das britische Pfund Sterling bereits in der Krise steckten, d.h. zwei Hauptwährungen des Bretton Woods-Systems. Schon Ende der 1960er Jahre hatte der Neokeynesianismus sein historisches Scheitern offenbart, wie es seinerzeit die Gruppen betonten, die später die IKS bilden sollten.
Aber für alle bürgerlichen Kommentatoren und die Mehrheit der Arbeiterklasse läutete erst das Jahr 1974den Beginn eines neuen Zeitalters des Kapitalismus nach dem Krieg ein, insbesondere nach dem Wiederauftauchen eines Phänomens, das man in den entwickelten Ländern endgültig gebannt geglaubt hatte – die Massenarbeitslosigkeit. Damals nahm auch die Flucht in die Verschuldung an Fahrt auf. Zu jener Zeit standen die Länder der Dritten Welt an der Spitze der höchstverschuldeten Staaten; sie bildeten eine Zeitlang die "Lokomotive" des Wiederaufschwungs. Zu Beginn der 1980er Jahre, mit dem Ausbruch der Schuldenkrise, ging diese Phase zu Ende, nachdem die Länder der Dritten Weltunfähig waren, ihre Schulden zurückzuzahlen, die es ihnen eine Zeitlangermöglicht hatten, als Absatzmarkt für die Produktion der grossen Industrieländer zu dienen. Aber die Flucht in die Verschuldung ging damit nicht zu Ende. Die USA lösten die anderen Länder als "Lokomotive" ab, allerdings zum Preis eines beträchtlichen Anstiegs ihres Handelsbilanzdefizits und vor allem ihres Haushaltsdefizits. Diese Politik konnten sie aufgrund der privilegierten Rolle ihrer nationalen Währung, des Dollars, als Weltleitwährung betreiben. Auch wenn Reagans Credo zur Liquidierung des Neokeynesianismus lautete: "Der Staat ist nicht die Lösung, er ist das Problem", bildete der amerikanische Staat auf Kosten gewaltiger Haushaltsdefizite die Hauptkraft in der US-Wirtschaft wie auch in der Weltwirtschaft. Aber die Politik der "Reagonomics", die zunächst von Margaret Thatcher in Grossbritannien inspiriert worden war, bedeutete im Wesentlichen den Abbau des "Wohlfahrtstaats", d.h. noch nie dagewesene Angriffe gegen die Arbeiterklasse, wodurch die galoppierende Inflation überwunden werden konnte, die den Kapitalismus seit Ende der 1970er Jahre geprägt hatte.
In den 1990er Jahren bildeten die asiatischen "Tiger" und "Drachen" eine der Lokomotiven der Weltwirtschaft ;dort wurden spektakuläre Wachstumszahlen verbucht, allerdings auf Kosten einer beträchtlichen Verschuldung, die 1997 zu grossen Erschütterungen führte. Gleichzeitig wurde das "neue" und "demokratische" Russland zahlungsunfähig; dies war insbesondere für jene, die "auf das Ende des Kommunismus" gesetzt hatten, um die Weltwirtschaft wieder anzukurbeln, eine gewaltige Enttäuschung. Die "Internetblase" Ende der 1990er Jahre, die in Wirklichkeit eine frenetische Spekulation mit den "High-Tech"-Firmen war, löste sich 2001–2002 auf und brachte damit den Traum einer Ankurbelung der Weltwirtschaft durch die Entwicklung neuer Technologien im Bereich Information und Kommunikation zu Ende. So wurde die Verschuldung erneut angefacht, insbesondere mittels einer gewaltigen Aufblähung der Immobilienkredite in vielen Ländern, insbesondere in den USA. Die USA spielten somit erneut die Rolle der "Lokomotive" der Weltwirtschaft, wieder zum Preis einer grenzenlosen Verschuldung – diesmal insbesondere der amerikanischen Bevölkerung –, die sich auf alle möglichen “Finanzprodukte" stützte, die Risiken der Zahlungsunfähigkeit vermeiden sollten. In Wirklichkeit hat die Streuung der zweifelhaften Kredite keineswegs die Gefahr aus der Welt geschafft, die von ihnen ausgeht, nämlich als Damoklesschwert über der US-Wirtschaft und der Weltwirtschaft insgesamt zuhängen. Im Gegenteil, es kam zu einer Anhäufung von "toxischen Aktiva" in den Vermögen der Banken, die schliesslich den Zusammenbruch 2007 allmählich auslösten.
Eine erneute Flucht in die Verschuldung
4. So ist die Finanzkrise nicht die Wurzel der gegenwärtigen Rezession. Im Gegenteil, die Finanzkrise verdeutlicht nur die Tatsache, dass die Flucht in die Verschuldung, die die Überwindung der Überproduktion ermöglicht hatte, nicht endlos lange fortgesetzt werden kann. Früher oder später rächt sich dies in der "Realwirtschaft", d.h. was die Grundlagen der Widersprüche des Kapitalismus darstellt – die Überproduktion, die Unfähigkeit der Märkte, die Gesamtheit der produzierten Waren zu absorbieren. Diese Widersprüche treten dann wieder deutlich in Erscheinung.
Deshalb können die Massnahmen, die auf dem Gipfel der G20 in London im März 2009 beschlossen wurden – eine Verdoppelung der Reserven des Internationalen Währungsfonds, eine massive staatliche Unterstützung des zerbröckelnden Finanzsystems, eine Ermunterung der Staaten zu einer aktiven Ankurbelungspolitik auf Kosten einer spektakulären Erhöhung der Haushaltsdefizite – auf keinen Fall das grundlegende Problem lösen. Die Flucht in die Verschuldung ist eines der Merkmale für die Brutalität der gegenwärtigen Rezession. Die einzige "Lösung", die die herrschende Klasse umsetzen kann, ist eine weitere Flucht in die Verschuldung. Der G20-Gipfel konnte keine Lösung für die Krise erfinden, aus dem einfachen Grund, weil es keine Lösung für die Krise gibt. Seine Aufgabe war es, die Haltung des Jeder-für-sich zu vermeiden, die in den 1930er Jahren vorgeherrscht hatte. Ebenso wollte er ein wenig Vertrauen in die Träger der Wirtschaft schaffen, wohl wissend, dass das Vertrauen im Kapitalismus ein wesentlicher Faktor für einen zentralen Bestandteil seiner Funktionsweise ist: den Kredit. Diese Tatsache, dass man so stark das Element der "Psychologie" angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Erschütterungen und der materiellen Lage betont, verdeutlicht den zutiefst illusorischen Charakter der Massnahmen, die der Kapitalismus gegenüber der historischen Krise seiner Wirtschaft ergreifen kann. Auch wenn das kapitalistische System nicht wie ein Kartenhaus zusammenstürzen wird, auch wenn der Rückgang der Produktion nicht endlos weitergehen wird, bleibt es bei der Perspektive eines immer tieferen Versinkens in der historischen Sackgasse und der Vorbereitung von noch grösseren Erschütterungen als jene, die wir derzeit erleben. Seit mehr als vier Jahrzehnten hat sich die herrschende Klasse als unfähig erwiesen, die Zuspitzung der Krise zu verhindern. Heute ist die Lage viel verheerender als in den 1960er Jahren. Trotz all der Erfahrungen, die sie während all dieser Jahrzehnte gewonnen hat, kann die herrschende Klasse es nicht besser machen, sondern wird die Dinge nur noch schlimmer machen. Insbesondere die neokeynsianischen Massnahmen, die vom Londoner G20-Gipfel propagiert wurden (die gar bis zur Verstaatlichung von in Schwierigkeiten geratenen Banken gehen können) haben keine Aussicht darauf, den Kapitalismus irgendwie wieder "gesunden" zu lassen, denn der Beginn dieser grossen Schwierigkeiten Ende der 1960er Jahre war just auf das Scheitern dieser neokeynesianischen Massnahmen zurückzuführen, die nach dem 2. Weltkriegergriffen worden waren.
Die Frage der Methode
5. Während die brutale Zuspitzung der kapitalistischen Krise die herrschende Klasse sehr überrascht hat, gilt dies für die Revolutionäre keineswegs. In der Resolution, die von unserem letzten Internationalen Kongress noch vor dem Beginn der Panik im Sommer 2007 verabschiedet wurde, schrieben wir : "Schonjetzt lösen die Gewitterwolken, die sich im Immobiliensektor in den Vereinigten Staaten – einer wichtigen Triebkraft der nationalen Ökonomie – mit der Gefahr von katastrophalen Bankenpleiten zusammenbrauen, grosse Sorgen in den massgeblichen Wirtschaftskreisen aus" (Punkt 4, Internationale Revue Nr. 40,S. 10)
Dieselbe Resolution teilte auch nicht die grossen Erwartungen, die das "chinesische Wirtschaftswunder” hervorgerufen hatte: "Somit ist das ‘chinesische Wunder' und anderer Länder der Dritten Welt weit entfernt davon, einen ‘frischen Wind' für die kapitalistische Wirtschaft darzustellen. Es ist nichts anderes als eine Variante desniedergehenden Kapitalismus. Darüber hinaus stellt die extreme Exportabhängigkeit der chinesischen Wirtschaft einen empfindlichen Punkt im Falle eines Nachfragerückgangs dar, eines Rückgangs, der unweigerlich kommen wird, insbesondere wenn die amerikanische Wirtschaft gezwungen sein wird, etwas Ordnung in die schwindelerregende Schuldenwirtschaft zu bringen, die es ihr momentan erlaubt, die Rolle der ‘Lokomotive' der weltweiten Nachfrage zuspielen. So wie das ‘Wunder' der asiatischen ‘Tiger' und ‘Drachen', die durchzweistellige Wachstumsraten geglänzt hatten, 1997 ein schmerzhaftes Ende fand, wird das heutige ‘chinesische Wunder', auch wenn es andere Ursachen hat und über wesentliche ernsthaftere Trümpfe verfügt, früher oder später unweigerlich in der historischen Sackgasse der kapitalistischen Produktionsweise landen."(Punkt 6, ebenda, S. 11)
Der Rückgang des chinesischen Wachstums und die damit verbundene Explosion der Arbeitslosigkeit sowie die zwangsweise Rückkehr von Abermillionen Bauern, die in den Industriegürteln schufteten, um einer unsagbaren Armut zu entkommen, in ihre Dörfer, bestätigen diese Prognose vollauf.
Die Fähigkeit der IKS, das vorauszusehen, was dann eintrat, stellt kein "besonderes Verdienst" unserer Organisation dar. Das einzige "Verdienst" ist unsere Treue zur marxistischen Methode, die Fähigkeit, sie ständig bei der Analyse der Wirklichkeit anzuwenden, der Wille, den Sirenen standhaft zu widerstehen, die das “endgültige Scheitern des Marxismus" verkünden.
Der Kurs der amerikanischen Bourgeoisie unter Obama
6. Die Aktualität des Marxismus zeigt sich nicht nur in den wirtschaftlichen Vorgängen dieser Gesellschaft. Bei der Verschleierungskampagne, die Anfang der Neunzigerjahre unternommen wurde, ging es im Kern um die angebliche Eröffnung einer Friedensepoche für die ganze Welt. Das Ende des „Kalten Krieges", das Verschwinden des Ostblocks, der seinerzeit von Reagan als das „Reich des Bösen” dargestellt wurde, sollte angeblich die diversen militärischen Konflikte beenden, zu denen seit 1947 die Konfrontation zwischen den beiden imperialistischen Blöcken geführt hatte. Entgegen solchen Illusionen über die Möglichkeit des Friedens innerhalb des Kapitalismus hat der Marxismus stets in Abrede gestellt, dass die bürgerlichen Staaten fähig seien, ihre wirtschaftlichen und militärischen Rivalitäten insbesondere in der Niedergangsperiode des Kapitalismus zu überwinden. Daher konnten wir schon im Januar 1990 schreiben:
„Das Verschwinden desrussischen imperialistischen Gendarmen und damit auch die Auflösung der Gendarmenrolle des amerikanischen Imperialismus gegenüber seinen‚Hauptpartnern‘ von früher öffnet die Tür für das Aufbrechen von einer ganzen Reihe von lokalen Rivalitäten. Diese Rivalitäten und Zusammenstösse können gegenwärtig nicht in einen Weltkrieg ausarten (...). Weil die vom Block auferzwungene Disziplin nicht mehr gegeben ist, werden diese Konflikte dagegen viel häufiger und gewalttätiger werden, insbesondere in den Gegenden, wo die Arbeiterklasse am schwächsten ist." (Internationale Revue Nr. 12„Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks: Destabilisierung und Chaos") Die Weltlage bestätigte diese Analyse sehr schnell, insbesondere mit dem ersten Golfkrieg im Januar 1991 und dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien ab dem Herbstdesselben Jahres. Seitdem haben die blutigen und barbarischen Zusammenstösse nicht mehr aufgehört. Man kann sie hier nicht alle aufzählen, hier nur eine Auswahl von Kriegen:
– die Fortsetzung des Krieges im ehemaligen Jugoslawien, die 1999 zu einer direkten Intervention der USA und der wichtigsten europäischen Mächte, unter der Schirmherrschaft der NATO, führte;
– die zwei Kriege in Tschetschenien;
– die zahlreichen Kriege, die unaufhörlich den afrikanischen Kontinent verwüsten (Ruanda, Somalia, Kongo, Sudan usw.);
– die Militäroperationen von Israel gegen den Libanon und vor kurzem im Gazastreifen;
– der Krieg in Afghanistan von 2001;
– 2003 der Krieg im Irak, dessen Folgen weiterhin dramatisch auf diesem Land, aber auch auf der treibenden Kraft dieses Krieges, den USA, lasten.
Die Ausrichtung und die Auswirkungen der Politik dieser Supermacht sind von der IKS schon vor langer Zeitanalysiert worden:
„Zwar hat sich die akute Gefahr eines Weltkrieges vermindert, doch gleichzeitig fand eine wahre Entfesselung imperialistischer Rivalitäten und lokaler Kriege unter direkter Beteiligung der grösseren Mächte statt, allen voran der USA. Das weltweite Chaos, das seit dem Ende des Kalten Krieges um sich griff, zwang die USA, ihre Rolle als ‘Weltpolizist', die sie seit Jahrzehnten spielt, noch zu verstärken. Jedoch führt dies keineswegs zu einer Stabilisierung der Welt; den USA geht es nur noch darum, krampfhaft ihre führende Rolle aufrechtzuerhalten. Eine Führungsrolle, die vor allem durch die ehemaligen Verbündeten permanent in Frage gestellt wird, da die Grundvoraussetzung der ehemaligen Blöcke, die Bedrohung durch den anderen Block, nicht mehr existiert. In Ermangelung der ‘sowjetischen Gefahr' bleibt das einzige Mittel für die USA zur Durchsetzung ihrer Disziplin das Ausspielen ihrer grössten Stärke – der absoluten militärischen Überlegenheit. Dadurch wird die Politik der USA selbst zu einem der stärksten Zerrüttungsfaktoren der Welt." (Resolution des 17. Kongresses der IKS zur internationalen Lage, Punkt 7)
7. Dass der Demokrat Barrak Obama die Regierungsgeschäfte der führenden Weltmachtübernommen hat, hat viele Illusionen über eine mögliche Richtungsänderung ihrer Strategie hervorgerufen, eine Änderung, die ein „Friedenszeitalter" einläuten würde. Ein grundlegender Teil dieser Illusionen beruht auf den Tatsachen, dass Obama einer der wenigen Senatoren war, die gegen die Militärintervention in den Irak im Jahre 2003 stimmten, und dass er sich im Gegensatz zu seinem republikanischen Konkurrenten McCain zu einem Rückzug der amerikanischen Streitkräfte aus diesem Land verpflichtet hat. Doch diese Illusionen sind schnell mit den harten Tatsachen konfrontiert worden. So verfolgt Obama mit dem Rückzug der Truppen aus dem Irak lediglich den Zweck, sie dafür in Afghanistan und Pakistan einzusetzen. Im Übrigen wird die Kontinuität der Kriegspolitik der Vereinigten Staaten gut durch die Tatsache veranschaulicht, dass die neue Administration den von Bush ernannten Verteidigungsminister, Gates, übernommen hat.
In Wirklichkeit stellt die neue Ausrichtung der amerikanischen Diplomatie keineswegs den oben in Erinnerung gerufenen Rahmen in Frage. Sie verfolgt weiterhin das Ziel, mithilfeihrer militärischen Überlegenheit die Vorherrschaft der USA auf dem Planetenzurückzuerobern. So hat Obamas Orientierung zugunsten einer grösseren Rolle der Diplomatie hauptsächlich zum Ziel, Zeit zu gewinnen und somit den Zeitpunktunausweichlicher imperialistischer Interventionen der amerikanischen Truppenhinauszuschieben, die momentan zu zerstreut und erschöpft sind, um gleichzeitig Krieg im Irak und in Afghanistan zu führen.
Es gibt jedoch, wie die IKS oft unterstrichen hat, innerhalb der amerikanischen Bourgeoisie zwei Optionen, um dieses Ziel zu erreichen:
– die von der demokratischen Partei vertretene Option, die versucht, andere Staaten in diese Unternehmung zu integrieren;
– die Mehrheitsoption unter den Republikanern, die darin besteht, durch Militärschläge die Initiative an sich zu reissen und sie den anderen Mächten um jeden Preis aufzuzwingen.
Die erste Option wurde insbesondere Ende der neunziger Jahre durch die Clinton-Regierung im ehemaligen Jugoslawien umgesetzt, als es dieser Administration gelang, die wichtigsten Mächte Westeuropas, insbesondere Deutschland und Frankreich, zur Kooperation und Teilnahme an den Bombardierungen Serbiens durch die NATO zu veranlassen, um diesen Staat zum Auszug aus dem Kosovo zu zwingen. Die zweite Option ist jene, die 2003 der Auslösung des Krieges gegen den Irak zugrunde lag, eines Krieges, der auf den entschlossenen Widerstand Deutschlands und Frankreichs stiess, die sich unter den damaligen Umständen mit Russland im UNO-Sicherheitsrat zusammentaten.
Doch bis heute war keine dieser beiden Optionen in der Lage, den Kurs zum weiteren Verlust der amerikanischen Vorherrschaft zu ändern. Die Politik der „gewaltsamen Durchsetzung", die besonders die zwei Amtszeiten von George Bush junior prägte, führte nicht nur zum irakischen Chaos, das weit davon entfernt ist, sich aufzulösen, sondern auch zu einer wachsenden Isolierung der amerikanischen Diplomatie, was insbesondere durch die Tatsache verdeutlicht wurde, dass einige Länder, wie Spanien und Italien, die die USA 2003 unterstützt hatten, das Schiff des irakischen Abenteuers verliessen (abgesehen von der etwas diskreteren Distanzierung der Regierung von Gordon Brown, jedenfalls im Vergleich zur bedingungslosen Unterstützung, die diesem Abenteuer von Tony Blair gewährt wurde). Umgekehrt sichert die Politik der „Kooperation", der die Demokraten den Vorzug geben, auch nicht wirklich die „Treue" der Mächte, die die USA an ihre kriegerischen Unternehmungen zu binden versuchen, und zwar insbesondere deshalb, weil sie diesen Staaten einen grösseren Spielraum lässt, um ihre eigenen Interessen geltend zu machen.
So hat jetzt zum Beispiel die Obama-Regierung beschlossen, eine konziliantere Politik gegenüber dem Iran zu verfolgen und eine strengere Haltung gegenüber Israel einzunehmen, zwei Leitlinien, die im Sinn der Mehrzahl der Staaten der Europäischen Union sind, insbesondere Deutschlands und Frankreichs, zweier Länder, die wünschen, einen Teil des Einflusses zurückzugewinnen, den sie in der Vergangenheit im Iran und im Irak gehabt haben. Damit wird aber diese Neuorientierung nicht verhindern, dass wichtige Interessenkonflikte zwischen diesen zwei Ländern einerseits und den Vereinigten Staaten andererseits fortbestehen, insbesondere in Osteuropa (wo Deutschland versucht, „bevorzugte" Beziehungen mit Russland zu pflegen) oder Afrika (wo die beiden Fraktionen, die den Kongo im Blut ertränken, die jeweilige Unterstützung Frankreichs bzw. der USA geniessen).
Allgemeiner gesagt, hat die Auflösung der Blockkonstellation zum Auftauchen aufstrebender, zweitrangiger Imperialisten geführt, die die neuen Vorreiter bei der Destabilisierung der internationalen Lage bilden. Dies lässt sich am Beispiel des Irans aufzeigen, der eine Vormachtstellung im Nahen und Mittleren Osten unter der Fahne des„Widerstandes" gegen den „grossen amerikanischen Satan" und des Kampfes gegen Israel anstrebt. Mit sehr viel beträchtlicheren Mitteln zielt China darauf ab, seinen Einfluss auf andere Kontinente auszudehnen, insbesondere auf Afrika, womit seiner wachsenden wirtschaftlichen Präsenz auch eine diplomatische und militärische Etablierung in dieser Region der Welt einhergeht, wie es bereits im Krieg im Sudan deutlich wurde.
Somit unterscheidet sich die Perspektive, vor der die Welt nach der Wahl von Obama zum Präsidenten der grössten Weltmacht steht, nicht grundsätzlich von der Lage, die bis heute vorgeherrscht hat: fortgesetzte Konfrontationen zwischen erst– und zweitrangigen Imperialisten, fortdauernde kriegerische Barbarei mit immer tragischeren Folgen für die direkt betroffene Bevölkerung (Hungersnöte, Epidemien, Flüchtlingsströme). Es ist sogar zu erwarten, dass die Unbeständigkeit, die die beträchtliche Verschlimmerung der Krise in einer ganzen Reihe von Ländern der Peripherie verursachen wird, zu verstärkten Zusammenstössen zwischen den militärischen Cliquen in diesen Ländern führen wird – bei denen wie immer die verschiedenen imperialistischen Grossmächtekräftig mitmischen werden. Angesichts dieser Lage werden Obama und seine Administration nichts anderes tun können, als die kriegstreiberische Politikihrer Vorgänger fortzusetzen, wie wir es am Beispiel von Afghanistan sehen, eine Politik, die gleichbedeutend ist mit wachsender kriegerischer Barbarei.
Die Beschleunigung der Umweltzerstörung
8. So wenig die „guten Absichten", die Obama auf diplomatischer Ebene bekundet hat, das militärische Chaos eindämmen oder die Nation, an deren Spitze er steht, daran hindern werden, ein aktiver Faktor in diesem Chaos zu sein, wird die amerikanische Neuorientierung, die er heute im Bereich des Umweltschutzes ankündigt, die Verschlimmerung der Lage in diesem Bereich aufhalten. Diese Verschlechterung ist keine Frage des guten oder bösen Willens der Regierungen, so mächtig sie auch sein mögen. Jeder Tag, der vergeht, offenbart ein wenig mehr von der echten Umweltkatastrophe, die den Planeten bedroht: immer gewaltigere Orkane in Ländern, die bis vor kurzem davon verschont geblieben waren, Trockenheit, Hitzewellen, Überschwemmungen, Schmelzen des Packeises, Länder, die in den Fluten des ansteigenden Meeres zu versinken drohen ... die Perspektiven werden immer finsterer. Diese Zerstörung unserer Umwelt führt zu einer weiteren Zuspitzung der kriegerischen Zusammenstösse; insbesondere die versiegenden Trinkwasserreserven werden einen Krisenherd in künftigen Konflikten darstellen.
Wie es die Resolution des letzten internationalen Kongresses unterstrich:
„Wie die IKS schon vor mehr als 15 Jahren hervorgehoben hat, bedeutet der zerfallende Kapitalismus eine Bedrohung für das Überleben der Menschheit. Die von Engels Ende des 19.Jahrhunderts formulierte Alternative ‘Sozialismus oder Barbarei' ist im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer schrecklichen Realität geworden. Was uns das 21.Jahrhundert in Aussicht stellt, ist in der Tat ‘Sozialismus oder Zerstörung der Menschheit'. Und das ist die Herausforderung, vor der die einzige Klasse in der Gesellschaft steht, die den Kapitalismus überwinden kann, die Arbeiterklasse."(Punkt 10)
Das Wiedererstarken des Klassenkampfes
9. Diese Fähigkeit der Arbeiterklasse, der Barbarei des zerfallenden Kapitalismus ein Ende zu setzen, um aus der Vorgeschichte herauszugelangen und die Tür zum “Reich der Freiheit" zu öffnen, wie es Engels ausdrückte, bildet sich schonheute in den täglichen Kämpfen gegen die kapitalistische Ausbeutung. Nach demZusammenbruch des Ostblocks und der so genannten „sozialistischen Länder", den ohrenbetäubenden Kampagnen vom „Ende des Kommunismus", wenn nicht gar vom „Ende des Klassenkampfes", haben zu einem schweren Rückschlag des Bewusstseins und des Kampfgeistes geführt – einen Rückschlag, dessen Folgen zehn Jahre andauerten. Erst ab 2003 hatte das Proletariat, wie die IKS wiederholt unterstrich, diese Tendenz überwunden und erneut den Weg des Kampfes eingeschlagen, um sich gegen die kapitalistischen Angriffe zu wehren. Seither ist die neue Tendenz nicht umgedreht worden, und in den zwei Jahren seit unserem letzten Kongress sahen wir in allen Teilen der Erde die Fortsetzung von bedeutenden Kämpfen. Bei verschiedenen Gelegenheiten konnte man sogar eine Simultanität von wichtigen Kämpfen auf Weltebene beobachten. Anfang 2008 gab es in folgenden Ländern zeitgleich Kämpfe: Russland, Irland, Belgien, Schweiz, Italien, Griechenland, Rumänien, Türkei, Israel, Iran, Bahrain, Tunesien, Algerien, Kamerun, Swaziland, Venezuela, Mexiko, die USA, Kanada und China.
Die vergangenen Jahren waren Zeuge sehr bedeutender Klassenkämpfe. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wollen wir folgende Beispiele aufzählen:
– die grossen Streiks in der ägyptischen Textilindustrie im Sommer 2007, mit denen sich zahlreiche andere Sektoren (Hafenarbeiter, Krankenhäuser, Transportwesen) solidarisierten.
– der Streik der Bauarbeiter in Dubai im November 2007 (hauptsächlich Migranten) mit massiven Mobilisierungen.
– ein sehr kämpferischer Streik der Bahnarbeiter in Frankreich im November 2007, ausgelöst durch die Angriffe gegen die alten Rentenregelungen, wobei es Beispiele der Solidarisierung mit Studierenden gab, die gleichzeitig gegen die Versuche der Regierung mobilisierten, die gesellschaftliche Trennung an den Universitäten weiter voranzutreiben – ein Streik, der die Sabotagerolle der grossen Gewerkschaftsverbände, namentlich der CGT und der CFDT, entlarvte, so dass die Bourgeoisie gezwungen wurde, das Bild ihres Apparates zur Kanalisierung der Arbeiterkämpfe aufzupolieren.
– gegen Ende 2007der einmonatige Streik von 26.000 Arbeitern der Türk Telekom, die wichtigste Mobilisierung des türkischen Proletariats seit 1991, und dies, während die türkische Armee in eine Intervention im Irak verwickelt war.
– in Russland im November 2008, wo der wichtige Streik der Arbeiter der Ford-Werke in St.Petersburg stattfand, der die Fähigkeit unter Beweis stellte, der Einschüchterung durch die Polizei und den Geheimdienst FSB (ehemaliger KGB) zu trotzen.
– in Griechenland gegen Ende 2008, als in einem Klima grosser Unzufriedenheit, das sich bereits zuvor geäussert hatte, die Arbeiterklasse den Mobilisierungen der Studenten, von denen Teile die offiziellen Gewerkschaften in Frage stellten, gegen die Repression eine tiefe Solidarität entgegenbrachte; eine Solidarität, die nicht in den Grenzen des Landes gefangen blieb, sondern ein grosses Echo in vielen Ländern Europas auslöste.
– in Grossbritannien, wo der Streik der Lindsay-Raffinerie Anfang 2009 eine der wichtigsten Bewegungen der Arbeiterklasse in Grossbritannien seit zwei Jahrzehnten darstellte – einer Arbeiterklasse, die in den 80er Jahren grosse Niederlagen einstecken musste. Diese Bewegung zeigte die Fähigkeit der Arbeiterklasse, die Kämpfe auszuweiten, und es gab Anzeichen einer Konfrontation mit dem bleiernen Nationalismus, als sich britische und ausländische (polnische und italienische) Arbeiter in Solidaritätsdemonstrationen zusammenfanden.
Die Bedingungen für die Entwicklung einer revolutionären Perspektive
10. Die gegenwärtige Zuspitzung der Krise des Kapitalismus bildet ein wichtiges Element in der Entwicklung der Kämpfe der Arbeiterklasse. Schon jetzt ist die Arbeiterklasse weltweit mit massiven Entlassungen und einer steigenden Arbeitslosigkeit konfrontiert. Das Proletariat macht auf eine enorm konkrete Art und Weise seine Erfahrungen mit der Unfähigkeit des kapitalistischen Systems, auch nur die grundlegenden Lebensbedingungen der Arbeiter, die es ausbeutet, aufrechtzuerhalten. Noch schlimmer, der Kapitalismus ist immer weniger im Stande, den neuen Generationen der Arbeiterklasse eine Zukunft anzubieten, was nicht nur für die Jungen selber, sondern auch für deren Eltern einen Faktor der Angst und Perspektivlosigkeit darstellt. Damit reifen die Bedingungen für eine mögliche Verbreitung der Einsicht in den Reihen des Proletariates, dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Doch es genügt nicht, wenn die Arbeiterklasse feststellt, dass der Kapitalismus in einer Sackgasse steckt und einer anderen Gesellschaft Platz machen sollte, damit sie in die Lage versetzt wird, sich eine revolutionäre Perspektive zu geben. Es braucht auch die Überzeugung, dass eine solche Perspektive möglich ist und dass die Arbeiterklasse die Kraft hat, sie umzusetzen. Genau auf dieser Ebene hat die herrschende Klasse nach dem Zusammenbruch des angeblichen „Realsozialismus" eine wirkungsvolle Kampagne gegen die Arbeiterklasse geführt. Einerseits hat sie die Meinung verbreitet, der Kommunismus sei ein leerer Traum: „Der Kommunismus funktioniert nicht. Der Beweis dafür ist die Tatsache, dass er durch die Leute, die darin gelebt haben, zugunsten des Kapitalismus wieder abgeschafft wurde.” Andererseits ist es der herrschenden Klasse gelungen, innerhalb der Arbeiterklasse ein starkes Gefühl der Machtlosigkeit und der Unfähigkeit, selbst massive Kämpfe führen zu können, zu verbreiten. Diesbezüglich unterscheidet sich die heutige Situation sehr stark von derjenigen vor dem historischen Wiederauftauchen der Arbeiterklasse Ende der 1960er Jahre. Damals zeigten die massiven Arbeiterkämpfe, vor allem der gewaltige Streik im Mai 1968 in Frankreich und der Heisse Herbst in Italien 1969, dass die Arbeiterklasse innerhalb der Gesellschaft eine bestimmende Kraft sein kann und die Idee der Überwindung des Kapitalismus durch sie nicht nur unrealisierbare Träume sind. Doch da die Krise des Kapitalismus erst an ihrem Anfang stand, fehlte dem Bewusstsein über die absolute Notwendigkeit, das System zu überwinden, noch die materielle Grundlage zur Verbreitung in der Arbeiterklasse. Man kann diese Situation wie folgt zusammenfassen: Ende der 1960er Jahre mochte die Idee, dass die Revolution möglich ist, relativ verbreitet gewesen sein, aber die Idee, dass die Revolution unabdingbar ist, drängte sich noch nicht auf. Demgegenüber findet heute die Idee, dass die Revolution nötig ist, ein beträchtliches Echo, aber die Idee, dass sie auch möglich ist, ist ausserordentlich selten anzutreffen.
Gegen falsche Erwartungen an den Klassenkampf
11. Damit das Bewusstsein über die Möglichkeit der kommunistischen Revolution in der Arbeiterklasse wirklich Wurzeln schlagen kann, muss Letztere Vertrauen in ihre eigenen Kräfte gewinnen, und dies geschieht in massenhaften Kämpfen. Der gewaltige Angriff, der schon jetzt auf Weltebene gegen sie geführt wird, bildet eine objektive Grundlage für solche Kämpfe. Doch die wichtigste Form, in der diese Angriffe stattfinden – Massenentlassungen, läuft der Entwicklung solcher Kämpfe zunächst zuwider. Im Allgemeinen – und dies hat sich in den letzten vierzig Jahren immer wieder gezeigt – finden die wichtigsten Kämpfe nicht in Zeiten eines starken Anstiegs der Arbeitslosigkeit statt. Die Massenentlassungen und die Arbeitslosigkeit haben die Tendenz, momentan eine gewisse Lähmung der Klasse hervorzurufen. Diese sieht sich durch die Unternehmer erpresst: „Wenn ihr nicht zufrieden seid – es stehen viele andere Arbeiter bereit, um euch zu ersetzen." Die Bourgeoisie kann diese Lageausnutzen, um eine Spaltung der Arbeiterklasse zu bewirken, d.h. eine Gegenüberstellung zwischen denen, die ihre Arbeit verlieren, und denen, die das„Privileg" haben, sie zu behalten. Zudem verstecken sich die Unternehmen und die Regierungen hinter einem „entscheidenden" Argument: „Wir können nichts dafür, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt und ihr entlassen werdet: Die Krise ist schuld." Schliesslich wird die Waffe des Streiks angesichts von Fabrikschliessungen stumpf, was das Gefühl der Ohnmacht der Arbeiter verstärkt. Zwar können angesichts einer historischen Situation, in der das Proletariat keine entscheidende Niederlage eingesteckt hat – im Gegensatz zur Lage in den1930er Jahren -, Massenentlassungen, die bereits begonnen haben, durchaus sehr harte Kämpfe, wenn nicht gar Gewaltausbrüche hervorrufen. Doch zunächst werden es aller Voraussicht nach verzweifelte und vergleichsweise isolierte Kämpfe sein, auch wenn ihnen andere Teile der Arbeiterklasse ehrliche Sympathieentgegenbringen. Selbst wenn es also in der nächsten Zeit keine bedeutende Antwort der Arbeiterklasse auf die Angriffe gibt, dürfen wir nicht denken, dass sie aufgehört habe, für die Verteidigung ihrer Interessen zu kämpfen. Erst in einer zweiten Phase, wenn sie in der Lage sein wird, den Erpressungen der Bourgeoisie zu widerstehen, wenn sich die Einsicht durchgesetzt hat, dass nur der vereinte und solidarische Kampf die brutalen Angriffe der herrschenden Klasse bremsenkann – namentlich wenn diese versuchen wird, die gewaltigen Budgetdefizite, die gegenwärtig durch die Rettungspläne zugunsten der Banken und durch die „Konjunkturprogramme“ angehäuft werden, von allen Arbeiterinnen bezahlen zulassen -, erst dann werden sich Arbeiterkämpfe in grösserem Ausmass entwickeln können. Das bedeutet nicht, dass die Revolutionäre bei den gegenwärtigen Kämpfen abseits stehen sollten. Vielmehr sind diese Teil der Erfahrungen, die das Proletariat machen muss, um eine neue Stufe im Kampf gegen den Kapitalismus zu nehmen. Und es gehört zu den Aufgaben der kommunistischen Organisationen, in diesen Kämpfen die allgemeine Perspektive des proletarischen Kampfes und die folgenden Schritte, die in diese Richtung unternommen werden müssen, voran zustellen.
Hürden, die die Arbeiterklasse noch nehmen muss...
12. Der Weg, der uns zu revolutionären Kämpfen und zum Umsturz des Kapitalismusführt, ist lang und schwierig. Zwar erweist sich die Frage des Umsturzes mit jedem Tag dringlicher, doch die Arbeiterklasse wird noch wichtige Hürden nehmen müssen, ehe sie in der Lage sein wird, diese Aufgabe zu erfüllen:
– die Wiedererlangung der Fähigkeit, ihre Kämpfe in die eigenen Hände zu nehmen, denn gegenwärtig sind die meisten Kämpfe, insbesondere in den entwickelten Ländern, unter der festen Kontrolle der Gewerkschaften (im Gegensatz zu dem, was wir im Laufe der 1980er Jahre erlebten);
– die Entwicklung ihrer Fähigkeit, die bürgerlichen Manöver und Fallen zu durchschauen, die den Weg zu Massenkämpfen verbauen, und die Wiedergewinnung des Selbstvertrauens, denn der Massencharakter der Kämpfe Ende der 1960er Jahre lässt sich zu einemguten Teil dadurch erklären, dass die Bourgeoisie damals, nach Jahrzehnten der Konterrevolution, überrascht war, was heute offensichtlich nicht mehr der Fall ist;
– die Politisierung ihrer Kämpfe, das heisst die Fähigkeit, sie in ihrer geschichtlichen Dimension zu sehen, sie als ein Moment im langengeschichtlichen Kampfes des Proletariats gegen die Ausbeutung und für die Abschaffung derselben zu begreifen.
Diese Etappe ist offensichtlich die schwierigste, namentlich aufgrund:
– des Bruchs, den die Konterrevolution in der ganzen Arbeiterklasse bewirkt hat, zwischen den Kämpfen der Vergangenheit und den gegenwärtigen Kämpfen;
– des organischen Bruchs in der Kontinuität der revolutionären Organisationen, der Ergebnisdieser Situation war;
– des Rückflusses des Bewusstseins in der gesamten Klasse infolge des Zusammenbruchs des Stalinismus;
– des drückenden Gewichts des Zerfalls des Kapitalismus auf das Bewusstsein des Proletariats;
– der Fähigkeit der herrschenden Klasse, Organisationen aus dem Hut zu zaubern (wie die Neue Antikapitalistische Partei NPA in Frankreich oder Die Linke in Deutschland),deren Geschäft darin besteht, den Platz der stalinistischen Parteien, die heute verschwunden oder altersschwach geworden sind, oder der Sozialdemokratie einzunehmen, die nach mehreren Jahrzehnten des kapitalistischen Krisenmanagements entlarvt dasteht – neue Organisationen, die wegen ihrer Unverbrauchtheit in der Lage sind, wesentliche Mystifikationen innerhalb der Arbeiterklasse aufrechtzuerhalten.
Die Politisierung der Kämpfen des Proletariats steht faktisch in Zusammenhang mit einer entwickelten Präsenz der kommunistischen Minderheit in den Kämpfen. Die Feststellung, wie schwach die gegenwärtigen Kräfte des internationalistischen Milieus sind, ist ein Hinweis auf die Länge des Weges, den es noch zu beschreiten gilt, bis die Arbeiterklasse revolutionäre Kämpfe entfachen kann und ihre Weltparteihervorbringt, das wesentliche Organ, ohne das der Sieg der Revolution unmöglich ist.
Der Weg ist lang und schwierig, aber das soll die Revolutionäre nicht entmutigen, soll sie nicht in ihren Bemühungen um den proletarischen Kampf lähmen. Ganz im Gegenteil!
Aktuelles und Laufendes:
- Internationale Situation [370]
- Krise [371]
- Krieg [372]
- revolutionäre Perspektive [373]
Zwanzig Jahre nach dem Zusammenbruch des Stalinismus: Die Bourgeoisie nimmt den Mund nicht mehr so voll
- 2704 Aufrufe
Diese Ereignisse wurden von der herrschendenKlasse dazu verwendet, eine der massivsten und bösartigsten je gegen dieArbeiterklasse geführten ideologischen Kampagnen zu entfesseln. Noch einmalwurde lügnerisch der zusammenbrechende Stalinismus mit dem Kommunismusgleichgesetzt und der ökonomische Niedergang und die Barbarei derstalinistischen Regime als das Resultat der proletarischen Revolution dargestellt.Die herrschende Klasse wollte damit dem Proletariat jegliche revolutionärePerspektive rauben und den Kämpfen der Arbeiterklasse einen vernichtendenSchlag versetzen.
Gleichzeitig liess die Bourgeoisie eine zweitegrosse Lüge vom Stapel: Mit dem Untergang des Stalinismus trete derKapitalismus in eine Ära des Friedens und der Prosperität ein und könne nunendlich aufblühen. Sie versprach eine strahlende Zukunft.
Am 6. März 1991 verkündete der Präsident der USA George Bushsen. berauscht vom Sieg seiner Armee über Saddam Hussein das Anbrechen einer„neuen Weltordnung" und die Zukunft einer „Welt der Vereinten Nationen, die,befreit von der Sackgasse des Kalten Krieges, auf dem Weg sind, diehistorischen Visionen ihrer Gründer zu realisieren. Eine Welt, in der dieFreiheit und die Menschenrechte von allen Nationen respektiert werden."
Zwanzig Jahre danach könnte man darüber fast lachen, hättennicht das weltweite Chaos und die zunehmenden Konflikte in allen Teilen derErde, die sich seit jenem berühmten Ausspruch ereigneten, dermassen viel Todund Zerstörung mit sich gebracht. Diese Bilanz sieht 20 Jahre danach bitteraus.
Von einer Prosperität kann keine Rede sein. Seit Sommer 2007und verstärkt seit Sommer 2008 „blenden die Herrschenden Begriffe wie „Wohlstand",„Wachstum", „Triumph des Liberalismus" in ihren Reden diskret aus. Am Tisch desgrossen Banketts der kapitalistischen Wirtschaft hat sich nun ein Gastniedergelassen, den man für immer verbannt zu haben glaubte: die Krise, dasGespenst einer „neuen weltweiten Depression", ähnlich wie die der 1930erJahre."[1]Gestern bedeutete der Zusammenbruch des Stalinismus den Triumph des liberalenKapitalismus. Heute ist es derselbe Liberalismus, welcher sich von Seiten derSpezialisten und Politiker aller Übel beschuldigt sieht, selbst von denen, dieeinst seine bedingungslosesten Verteidiger waren wie der französische PräsidentSarkozy!
Man kann sich die Daten von Jahrestagen nicht auswählen, undklar ist, dass dieser hier für die herrschende Klasse kein guter ist. Wenn siebei der jetzigen Gelegenheit keine grosse Kampagne über den „Tod desKommunismus" und das „Ende des Klassenkampfes" vom Stapel lässt, dann nichtdeshalb, weil es ihr an Missgunst fehlen würde, sondern wegen der desolatenLage des Kapitalismus, die sie der Gefahr aussetzt, dass der letzte Schein umihre ideologischen Gebilde durchschaut wird. Aus diesem Grunde hat uns dieherrschende Klasse mit grossen Zeremonien über den Zusammenbruch der „letztenTyrannei" und den grossen Sieg der „Freiheit" verschont. Abgesehen von einigenernsten historischen Beschwörungen gibt es keine Euphorie und keineÜberschwänglichkeit.
Auch wenn der Frieden und die Prosperität, die uns derKapitalismus offenbar hätte bringen müssen, nicht Wirklichkeit wurden, soerscheint die heutige Barbarei und Misere in den Augen vieler Ausgebeuteternoch keinesweg als direkte Konsequenz der unüberwindbaren Widersprüche deskapitalistischen Systems. Die Propaganda der Bourgeoisie, die heute viel mehrauf die Notwendigkeit der „Humanisierung" und „Reformierung" des Kapitalismusausgerichtet ist, verfolgt die Absicht grösstmöglichste Barrieren gegen dieBewusstseinsentwicklung der Ausgebeuteten über die Realität zu errichten. DieWirklichkeit hat aber auch die andere Seite der Lüge, die Gleichsetzung desStalinismus mit dem Kommunismus, nicht wirklich aufgelöst und sie lastet nochimmer auf den Schultern der heutigen Generationen - auch wenn dies nicht imselben abstumpfenden Ausmass wie in den 1990er Jahren der Fall ist. Es istdaher wichtig, einige historische Tatsachen in Erinnerung zu rufen.
Einund dieselbe Krise des Kapitalismus ist Ursache des Zusammenbruchs desOstblocks und der heutigen Rezession
„Die weltweite Krise des Kapitalismus wirkt sich mit einerbesonderen Brutalität auf die Wirtschaft (der Staaten des Ostblocks) aus, dienicht nur rückständig, sondern auch unfähig ist, sich der Verschärfung derKonkurrenz innerhalb des Kapitals anzupassen. Der Versuch, „klassische" Normender kapitalistischen Zwangsverwaltung einzuführen anstelle der Steigerung derProduktivität, führt zu nichts anderem als einem noch grösseren Wirrwarr, fürdas in der UdSSR das Scheitern der „Perestroika" ein gutes Beispiel ist. (...)Die Perspektive aller stalinistischen Regime ist nicht die einer „friedlichenDemokratisierung" und auch nicht einer Straffung der Wirtschaft. Mit derVerschärfung der weltweiten Krise des Kapitalismus sind diese Länder in einePhase von Unruhen eingetreten, die auch in ihrer an gewalttätigen Ereignissen„reichen" Vergangenheit unbekannt sind." (Kapitalistischen Erschütterungen undKlassenkämpfe" (7.9.1989, Internationale RevueNr. 59, engl./franz./span. Ausgabe)
Diese katastrophale Situation in den Ländern des Ostblockshinderte die herrschende Klasse damals nicht daran, sie als immense neu zuerobernde Märkte darzustellen, da sie nun vom Joch des „Kommunismus" befreitseien. Es gelte dort eine moderne Ökonomie zu entwickeln, die die Aufgabe habe,die Auftragsbücher der westlichen Firmen für Jahrzehnte zu füllen. Die Realitätwar eine ganz andere: Es gab gewiss viel aufzubauen, doch niemanden, der esbezahlen konnte.
Der erwartete Boom im Osten trat nicht ein. Dafür wurdenumgekehrt die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die im Westen auftraten,skrupellos auf das Konto der nötigen Anpassung der rückständigen Länder desehemaligen Ostblocks geschoben. Dies war beispielsweise der Fall mit derInflation, die in Europa kaum zu kontrollieren war. Die Lage spitzte sich nichtviel später in der offenen Rezession von 1993 auf dem alten Kontinent zu[2].So änderte der neue Weltmarkt, in den nun die Länder Osteuropas vollständigintegriert waren, nicht das Geringste an den Grundgesetzmässigkeiten desKapitalismus. So nahm insbesondere die Verschuldung einen immer umfangreicherenPlatz bei der Finanzierung der Wirtschaft ein, wodurch diese angesichts jederDestabilisierung immer brüchiger wurde. Die Illusionen der Bourgeoisieverflüchtigten sich schnell, als sie mit der harten wirtschaftlichen Realitätihres Systems konfrontiert wurde. So knickte im Dezember 1994 Mexiko unter demZustrom der Spekulanten ein, die aus dem krisengeschüttelten Europa abgezogenwaren: Der Peso brach zusammen und drohte, einen grossen Teil derVolkswirtschaften des amerikanischen Kontinents mitzureissen. Die Drohung warreal und wurde verstanden. Eine Woche nach Ausbruch der Krise mobilisierten dieUSA 50 Milliarden Dollar, um die mexikanische Währung damit zu stützen. Damalsschien dieser Betrag immens ... Zwanzig Jahre später sollten es vierzehn Mal mehrsein, die die USA für ihre eigenen Wirtschaft aufbringen sollten!
Ab 1997 Neuauflage in Asien. Diesmal waren es die Währungender südostasiatischen Länder, die massiv an Wert verloren. Die berühmten Tigerund Drachen, Vorzeigeländer der wirtschaftlichen Entwicklung, Schaufenster der„Neuen Weltordnung", wo der Fortschritt selbst für die kleinsten Länder möglichschien, erfuhren ebenfalls die Härte des kapitalistischen Gesetzes.
Die Anziehungskraft dieser Volkswirtschaften hatte eineSpekulationsblase gefüllt, die Anfang 1997 platzte. In weniger als einem Jahrwaren alle Länder der Region betroffen. In der gleichen Zeit wurden 24Millionen Menschen arbeitslos. Aufstände und Plünderungen breiteten sich aus,dabei starben 1200 Personen. Selbstmorde nahmen rapide zu. Ab dem folgendenJahr wurde festgestellt, dass eine Ansteckungsgefahr auf Weltebene bestand,ernsthafte Schwierigkeiten entstanden in Russland.
Das asiatische Modell, der berühmte „dritte Weg", wurde nebendem „kommunistischen" Modell begraben. Es musste etwas Neues gefunden werden,um zu beweisen, dass der Kapitalismus der einzige Schöpfer des Reichtums aufErden sei. Dieses neue Wundermittel war das Internet. Wenn sich in derwirklichen Welt alles auflöst, so lasst uns in die virtuelle investieren! Wennden Reichen Geld zu leihen nicht mehr genügt, so lasst es uns denen leihen, dieuns versprechen, reich zu werden! Der Kapitalismus hat Angst vor der Leere,insbesondere vor derjenigen in der Geldbörse, und wenn die Weltwirtschaftunfähig zu sein scheint, immer grössere Profite anzubieten, um auf dieunersättlichen Bedürfnisse des Kapitals zu antworten, wenn keine Rentabilitätmehr zu finden ist, erfindet man einfach einen neuen Markt aus freien Stücken.Das System sollte noch einmal während einer gewissen Zeit weiterfunktionieren,indem sich die Wetten auf die Aktienkurse, die keinen vernünftigen Bezug mehrzur Realität hatten, breit machten. Unternehmen, die Verluste in Millionenhöheerlitten, hatten auf dem Markt einen Wert von mehreren Milliarden Dollar. DieBlase war geschaffen, sie wuchs bereits. Der Wahnsinn bemächtigte sich einerBourgeoisie, die sich Illusionen hingab über die langfristigeDauerhaftigkeit der „Neuen Ökonomie" unddamit auch die „alte" angriff. Die traditionellen Sektoren der Wirtschaftmachten auch mit, sie hofften damit eine Rentabilität zurück zu gewinnen, diesie in ihrem herkömmlichen Tätigkeitsbereich verloren hatten. Die „NeueÖkonomie" drang in die alte ein[3],und sie sollte sie beim Absturz mitreissen.
Der Sturz tat weh. Der Zusammenbruch eines solchen Konstrukts,das auf nichts anderem beruhte als dem gegenseitigen Vertrauen allerBeteiligten, dass niemand versage, konnte nur brutal sein. Der Platzen derBlase führte zu Verlusten von 148 Milliarden Dollar in den Unternehmen derBranche. Die Pleiten breiteten sich aus, die Überlebenden berichtigten den Wertihrer Aktiven um Hunderte von Milliarden Dollar. Mindestens 500 000Arbeitsplätze wurden in der Telekommunikationsbranche gestrichen. Die „NeueÖkonomie" erwies sich schliesslich als nicht fruchtbarer wie die alte, und dieGuthaben, die gerade noch rechtzeitig dem Untergang entronnen waren, suchtensich eine neue Anlagesphäre.
Und die Wahl traf auf die Immobilienbranche. Denn die Fragestellte sich ernsthaft: Wem konnte man noch Geld leihen, nachdem man es schonmit Ländern getan hatte, die über ihren Verhältnissen lebten, nachdem man dasGeld Unternehmen geliehen hatte, die auf Sand, ja Wind gebaut waren? DieBourgeoisie kennt keine Grenzen bei ihrem Profithunger. Das gute alte Sprichwort,dass „man nur Reichen Darlehen geben soll" ist definitiv ausser Kraft gesetzt,denn Reiche gibt es nicht mehr genug. Die Bourgeoisie nahm sich deshalb einenneuen Markt vor ... denjenigen der Armen. Ganz abgesehen vom Zynismus diesesKalküls, offenbart sich da eine gnadenlose Geringschätzung gegenüber dem Lebenvon Leuten, die bestimmt waren, zur Beute dieser Geier zu werden. Die gewährtenDarlehen wurden mit dem Schuldnervermögen pfandgesichert. Wenn dann diesesVermögen aufgrund einer Börsenhausse an Wert gewinnt, eröffnete sich dieMöglichkeit, den verschuldeten Familien noch mehr Kredite zu gewähren, mitdenen sie potentiell ins Desaster geführt wurden. Diese Möglichkeit wurde 2008zur Wirklichkeit, als das Schiff auf den harten Grund der Realität auflief -die Bourgeoisie beklagte ihre eigenen Opfer (die Geschäftsbanken und andereRefinanzierungsinstitute), aber sie vergass die Millionen von Familien, denenalles, was sie noch hatten (obwohl ohne jeden Marktwert), genommen wurde,Familien, die künftig auf der Strasse oder im Slum leben.
Die Fortsetzung ist sattsam bekannt, es erübrigt sich, daraufzurück zu kommen, ausser vielleicht in einer Kurzfassung, die eigentlich allessagt: eine offene Weltrezession, die schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg, inder Millionen von Arbeitern in allen Ländern auf die Strasse geworfen werden,eine beträchtliche Ausweitung des Elends.
DieKriege - vor und nach 1990 - sind die Folgen der immer gleichen Widersprüchedes Kapitalismus
Selbstverständlich warf der Zusammenbruch des Ostblocks dieganze imperialistische Konstellation durcheinander. Vor diesem Ereignis war dieWelt in zwei sich gegenüberstehende Blöcke aufteilt, beide um eineFührungsmacht gruppiert. Die ganze Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg bis zumZusammenbruch des Ostblocks war von sehr starken Spannungen zwischen denBlöcken geprägt, die in offenen Kriegen zwischen Stellvertretern in der DrittenWelt ausgetragen wurden. Um nur einige zu zitieren: Koreakrieg zu Beginn der50er Jahre, Vietnamkrieg in den ganzen 60er Jahren bis in die Mitte der 70er,Afghanistankrieg ab 1979, usw. Der Zusammenbruch des stalinistischen Gebäudes1989 war schlicht und einfach die logische Folge seiner wirtschaftlichen undmilitärischen Unterlegenheit gegenüber dem gegnerischen Block.
Aber die Auflösung des „Reichs des Bösen", das der in denAugen der westlichen Propaganda allein verantwortliche russische Blockdarstellte, bedeutete nicht das Ende der Kriege. Die IKS hatte damals, imJanuar 1990, folgende Analyse: „Das Verschwinden des russischenimperialistischen Gendarmen und damit auch die Auflösung der Gendarmenrolle desamerikanischen Imperialismus gegenüber seinen ‚Hauptpartnern‘ von früher öffnetdie Tür für das Aufbrechen von einer ganzen Reihe von lokalen Rivalitäten. DieseRivalitäten und Zusammenstösse können gegenwärtig nicht in einen Weltkriegausarten (selbst wenn das Proletariat nicht mehr dazu in der Lage wäre, sichdagegen zur Wehr zu setzen). Weil die vom Block auferzwungene Disziplin nichtmehr gegeben ist, werden diese Konflikte dagegen viel häufiger undgewalttätiger werden, insbesondere in den Gegenden, wo die Arbeiterklasse amschwächsten ist." (Internationale RevueNr. 12, Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks - Destabilisierung und Chaos). Esdauerte nicht lange, bis auf der Weltbühne der Beweis für die Richtigkeitdieser Analyse geführt wurde, so namentlich mit dem ersten Golfkrieg vom Januar1991 und dem Krieg im damaligen Jugoslawien ab Herbst des gleichen Jahres.Seither folgt eine blutige und barbarische Auseinandersetzung der nächsten. Wirkönnen hier nicht alle aufzählen, aber immerhin die folgenden hervorstreichen:die Fortsetzung des Jugoslawienkriegs, in den 1999 die USA und die wichtigsteneuropäischen Mächte unter der Aegide der NATO direkt eingegriffen haben; diebeiden Tschetschenienkriege; zahlreiche Kriege verwüsten anhaltend denafrikanischen Kontinent (Ruanda, Somalia, Kongo, Sudan usw.); dieMilitäroperationen Israels gegen den Libanon und kürzlich gegen denGazastreifen; der Afghanistankrieg von 2001, der immer noch andauert; derIrakkrieg von 2003, dessen Folgen dramatisch auf dem Zweistromland lasten, aberauch auf demjenigen, der den Krieg vom Zaun gerissen hat: Uncle Sam.
DerStalinismus - eine besonders brutale Form des Staatskapitalismus
Was nun folgt und sich auf die Charakterisierung desStalinismus bezieht, ist ein Ausschnitt aus einer Beilage zu den Publikationen,die wir im Januar 1990 breit verteilt haben (diese Beilage wurde vollumfänglichund neu abgedruckt im Artikel 1989-1999 - The world proletariat,the collapse of the Eastern bloc and the bankruptcy of Stalinism(„Das Weltproletariat, der Zusammenbruch des Ostblocks und der Bankrott desStalinismus") in der International Review Nr. 99, engl./franz./span. Ausgabe). Wir denken, dass dieseCharakterisierung auch 20 Jahre später noch ganz gut passt, und drucken siehier unverändert ab.
„Auf den Trümmern der Oktoberrevolution von 1917 errichteteder Stalinismus seine Herrschaft. Dank der Negation des Kommunismus in derTheorie des „Sozialismus in einem Land" wurde die UdSSR wieder zu einem injeder Hinsicht kapitalistischen Staat. Ein Staat, in der das Proletariatunterworfen war, mit dem Gewehr im Rücken, unterworfen unter die Interessen desnationalen Kapitals, im Namen der Verteidigung des „sozialistischenVaterlandes".
So wie der proletarische Oktober dank der Macht derArbeiterräte dem Ersten Weltkrieg schliesslich ein Ende setzte, kündete diestalinistische Konterrevolution durch die Zerstörung jeden revolutionärenGedankens, durch die Knebelung jedes noch so zögerlichen Klassenkampfes, durchdie Errichtung des Terrors und die Militarisierung des ganzengesellschaftlichen Lebens die Beteiligung der UdSSR am zweiten Weltgemetzel an.
Jeder Schritt des Stalinismus auf dem internationalen Parkettder 30er Jahre war gekennzeichnet durch seine imperialistischen Kuhhändel mitden wichtigsten kapitalistischen Mächten, die sich von Neuem daraufvorbereiteten, Europa in Schutt und Asche zu legen.
Nachdem Stalin zunächst auf ein Bündnis mit dem deutschenImperialismus gesetzt hatte, um dessen Expansionsversuchen gegen Osten zubegegnen, wechselte er Mitte 30er Jahre plötzlich das Hemd und verbündete sichmit dem „demokratischen" Block (1934: Aufnahme der UdSSR in die „Räuberbande",die der Völkerbund war; 1935: Laval-Stalin-Pakt; Beteiligung der KPs an den„Volksfronten" und am Krieg in Spanien, in dessen Verlauf die Stalinisten nichtzögerten, die gleichen blutigen Methoden anzuwenden und die Arbeiter undRevolutionäre, die ihrer Politik Widerstand leisteten, zu massakrieren).Unmittelbar vor dem Krieg streifte sich Stalin wieder das alte Hemd über undverkaufte Hitler die Neutralität der UdSSR im Austausch gegen gewisse Gebiete,bevor er sich doch wieder dem Lager der Alliierten anschloss, um sich seinerseits am imperialistischenGemetzel zu beteiligen, in dem der stalinistische Staat allein 20 MillionenMenschenleben opferte. Das war das Resultat der Drecksgeschäfte, die derStalinismus mit den verschiedenen imperialistischen Haien Westeuropas schloss.Auf diesen Leichenbergen konnte die stalinistische UdSSR ihr Reich aufbauen,ihre Schreckensherrschaft in allen Staaten errichten, die ihr aufgrund desVertrages von Jalta als ihre ausschliessliche Domäne zufielen. Dank derTeilnahme am allgemeinen Holocaust an der Seite der siegreichenimperialistischen Mächte und zum Blutpreis von 20 Millionen Opfern konnte dieUdSSR in den Rang einer Supermacht aufsteigen.
Doch wenn Stalin der „von der Vorsehung bestimmte Mann" war,dank dem der Kapitalismus als Weltsystem den Bolschewismus bezwingen konnte,war es doch nicht die Tyrannei eines einzigen Individuums, so paranoid diesesauch war, die das Werk dieser schrecklichen Konterrevolution vollbrachte. Derstalinistische Staat wurde wie jeder kapitalistische Staat durch die gleicheherrschende Klasse wie überall sonst gelenkt, durch die nationale Bourgeoisie.Eine Bourgeoisie, die sich mit der inneren Degenerierung der Revolution neugebildet hatte, aber nicht auf der Grundlage der alten zaristischen Bourgeoisie,die das Proletariat 1917 beseitigt hatte, sondern auf der Grundlage derparasitären Bürokratie des Staatsapparats, mit dem die bolschewistische Parteiunter der Führung von Stalin zunehmend verschmolz. Diese Bürokratie desPartei-Staats, die Ende der 20er Jahre all jene Sektoren beseitigte, aus denenallenfalls noch eine neue private Bourgeoisie hätte entstehen können und mitdenen sie sich verbündet hatte, um die Leitung der nationalen Wirtschaftsicherzustellen (Grundeigentümer und Spekulanten der NEP), übernahm dieKontrolle der Wirtschaft. Das sind die historischen Bedingungen, die erklären,weshalb der Staatskapitalismus in der UdSSR, anders als in anderen Ländern,diese totalitäre, karikaturale Form annahm. Der Staatskapitalismus ist die allgemeineHerrschaftsform des Kapitalismus in seiner Niedergangsphase, in der der Staatsich den Zugriff auf das ganze gesellschaftliche Leben sichert und überallparasitäre Schichten entstehen lässt. Aber in den andere Ländern derkapitalistischen Welt stand diese staatliche Kontrolle über die Gesamtheit derGesellschaft nicht in antagonistischem Widerspruch zur Existenz von privatenund auf Konkurrenz beruhenden Sektoren, die ihrerseits eine totaleVorherrschaft der parasitären Sektoren verhinderten. In der UdSSR dagegenkennzeichnete sich die besondere Form, die der Staatskapitalismus hier annahm,durch eine extreme Vergrösserung seiner parasitären Schichten, die aus derstaatlichen Bürokratie hervorgegangen waren und deren einzige Sorge nicht darinbestand, das Kapital unter Berücksichtigung der Marktgesetze Profite abwerfenzu lassen, sondern sich individuell die Taschen zu füllen auf Kosten derInteressen der nationalen Wirtschaft. Unter dem Gesichtspunkt derFunktionsweise des Kapitalismus war diese Form des Staatskapitalismus eineEntgleisung, die mit der Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise notwendigerweiseim Fiasko enden musste. Und genau dieser Zusammenbruch des russischenStaatskapitalismus, der aus der Konterrevolution hervorgegangen war, zog den Schlussstrichunter den Bankrott dieser ganzen bestialischen Ideologie, die während mehr alseinem halben Jahrhundert das stalinistische System zementiert und Millionen vonMenschen unter einem Bleideckel gehalten hatte.
Egal, was die Bourgeoisie und die ihr hörigen Medien sagen:Die grauenhafte Hydra des Stalinismus gleicht überhaupt nicht - weder im Inhaltnoch in der Form - der Oktoberrevolution von 1917. Diese musste zuerstuntergehen, bevor sich jene aufrichten konnte. Dieses radikalen Bruches, dieserAntinomie zwischen Oktober und Stalinismus, muss sich das Proletariat vollbewusst werden."
Zerstörung entweder desKapitalismus oder der Menschheit
Die Welt gleicht immer mehr einer Wüste, die von Leichenübersät ist, und Milliarden von Menschen kämpfen nur noch ums Überleben. JedenTag verhungern auf der Welt fast 20 000 Kinder, mehrere Tausend Stellen werdenabgeschafft, was die betroffenen Familien in die Verzweiflung stürzt;Lohnkürzungen, die sich ständig breiter machen, für diejenigen, die noch Arbeithaben.
Das ist die „Neue Weltordnung", die vor fast 20 Jahren GeorgeBush sen. versprochen hat. Sie gleicht eher der absoluten Unordnung! Diesesschreckliche Spektakel widerlegt gänzlich die Idee, wonach der Zusammenbruchdes Ostblocks das „Ende der Geschichte" bedeute (stillschweigend: der Anfangdes Ewigen Reiches des Kapitalismus), wie der „Philosoph" Francis Fukuyamaseinerzeit verkündete. Er bedeutete vielmehr einen wichtigen Einschnitt imNiedergang des Kapitalismus, der die Phase einläutete, in der die schwächstenBestandteile dieses System - das mit seinen geschichtlichen Grenzenkonfrontiert ist - unumkehrbar in sich zusammenbrechen. So hat denn auch derZusammenbruch des Ostblocks keineswegs zu einer Genesung des Systems geführt.Jene Grenzen bestehen fort, und sie bedrohen je länger je mehr den Kern desKapitalismus. Jede neue Krise ist ernsthafter als die vorangegangene.
Deshalb ist die einzig nützliche Lehre aus den letzten 20Jahren die, dass es keine berechtigte Hoffnung auf Frieden und Fortschritt imKapitalismus gibt. Es geht nach wie vor und bis auf weiteres um die AlternativeZerstörung des Kapitalismus oder Zerstörung der Menschheit.
Die Kampagnen über den „Tod des Kommunismus" haben zwar in derTat dem Bewusstsein der Arbeiterklasse einen schweren Schlag versetzt, aber sieist nicht geschlagen, die Möglichkeit besteht, das verloren gegangene Terrainzurückzuerobern und sich erneut in einen Prozess der weltweiten Entwicklung desKlassenkampfes zu werfen. Tatsächlich hat die Arbeiterklasse seit Beginn desJahrzehnts, nachdem sich die Kampagnen über den Tod des Kommunismus und desKlassenkampfes langsam abgenützt haben, angesichts von erheblichen Angriffenauf seine Lebensbedingungen den Weg des Kampfes wieder eingeschlagen. DieseWiederaufnahme, die sich schon jetzt in einem internationalen Bemühen einerMinderheit um politische Klärung ausdrückt, stellt die Vorbereitung aufMassenkämpfe dar, die in Zukunft die einzige Perspektive für das Proletariatund die Menschheit eröffnen - die Überwindung des Kapitalismus und dieErschaffung des Kommunismus.
GDS
[1] Resolution des18. Kongresses der IKS zur internationalen Lage, ebenfalls in der vorliegendenAusgabe der InternationalenRevueveröffentlicht.
[2] Vgl. z.B. „la récession de 1993 réexaminée" („Die Rezession von 1993 neuuntersucht"), Persée, Zeitschrift der OECD, 1994, Band49, Nr. 1
[3] Sie kaufte siesogar auf: Die Übernahme der Gesellschaft Time Warner durch AOL,Internet-Anbieter, bleibt Sinnbild jener Irrationalität, die sich damals derBourgeoisie bemächtigte.
Politische Strömungen und Verweise:
- Stalinismus [374]
