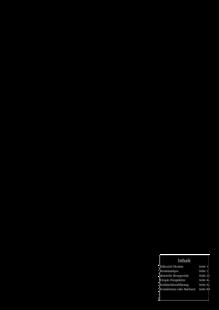Weltrevolution - 2010s
- 3012 Aufrufe
Weltrevolution - 2010
- 3358 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 158
- 2834 Aufrufe
150 Jahre nach dem Erscheinen Darwins Buch "Der Ursprung der Arten" - fortdauernder religiöser Obskurantismus
- 2677 Aufrufe
Noch vor kurzem hat Sarah Palin, die Vizepräsidentschaftskandidatin an der Seite des Wettbewerbers John McCain um das Präsidentenamt in den USA, ohne zu zögern behauptet, dass die Menschen und die Dinosaurier noch vor 6.000 Jahren gleichzeitig auf der Erde lebten, obwohl die Wissenschaft bewiesen hat, dass die letzten Dinosaurier von der Erdoberfläche vor mehr als 65.000.000 Jahren verschwunden sind, lange bevor der erste Homo Sapiens erschienen ist. Diese Ignoranz der historischen Entwicklung der Arten stellt eine direkte Fortsetzung der heute noch weit verbreiteten religiösen kreationistischen Doktrin dar. Wie weit dieses Dogma verbreitet ist, zeigt sich anhand der Neuerfindung der Geschichte des Universums, die zur Eröffnung einer Reihe von christlichen kreationistischen Museen in den USA seit 2005 geführt hat (insbesondere in Kentucky oder in Cincinnati, Ohio, und in einem Vergnügungspark, der 2007 in Lancashire, Großbritannien mittels der Initiative einer Gruppe von amerikanischen Geschäftsleuten eröffnet wurde, in dem versucht wird, die Entstehung des Universums in sieben Tagen in Übereinstimmung mit einer wortgetreuen Interpretation der Bibel zu erklären). Es ist schwierig, in Anbetracht des Hollywood- und operettenartigen Charakters dieser Disneylands oder Jurassic Parks, die die Ignoranz, die Leichtgläubigkeit und religiösen Vorurteile der Leute ausschlachten, dies alles ernst zu nehmen. Dennoch ist der Erfolg dieser obskurantistischen Ideologie besorgniserregend: mehr als 20% der Bevölkerung Flanderns und fast ein Amerikaner von zwei neigen Umfragen zufolge zu einer kreationistischen Sichtweise der Welt und zu einer feindseligen Haltung gegenüber der Evolutionstheorie, wie sie von Charles Darwin aufgestellt worden ist.
Die Darwinsche Evolutionstheorie gegen den Kreationismus
Vor 150 Jahren, im November 1859, veröffentlichte Darwin « Der Ursprung der Arten ». Dieses Werk, das auf der Ansammlung von Beobachtungen und Experimenten in der Natur fußte, hat die Sicht vom Ursprung des Menschen und seines Platzes unter den Lebewesen umgewälzt. Er zeigte zum ersten Mal auf, dass es eine gemeinsame Grundlage der Entwicklung der Arten und Lebewesen gab, wobei er sich auf die früheren Arbeiten der Naturalisten wie Buffon und Linné bis zu Lamarck stützte und über diese hinausging. Darwin’s Theorie versuchte auf dialektische, exakte und wissenschaftliche Art und Weise die Anpassungsfähigkeit der Lebewesen innerhalb ihrer Umgebung zu beweisen und diese Theorie in eine neue Auffassung von der Entwicklung der Arten zu integrieren. Dabei entstand die Auffassung eines gemeinsamen Stammbaums aller Lebewesen, bei dem der Mensch nicht mehr ein auserwähltes, von Gott geschaffenes Lebewesen ist, sondern das zufällige Ergebnis einer Herausdifferenzierung der Arten. Dies stellte eine radikale Infragestellung der «Lehren» der Bibel und ihrer Genese dar, denn er verwarf damit die Idee der Schöpfung Gottes und all der monotheistischen religiösen Traditionen (Christentum, Judentum, Islam). Diese materialistische und wissenschaftliche Herangehensweise Darwin’s wurde sofort von allen Seiten aufs heftigste angegriffen, insbesondere von den gleichen religiösen Dogmatikern, die das Gedankengut Galileis und Kopernikus an den Pranger gestellt hatten (beides Theoretiker, von denen der erste in seinen wissenschaftlichen Entdeckungen den religiösen Geozentrismus verwarf, der davon ausging, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums und vor allem das Zentrum der Schöpfung Gottes sei).
Der Skandal dieser Entdeckung Darwin’s bestand nicht so sehr in der Beweisführung der Entwicklung der Arten, sondern in der Tatsache, dass die in der Entwicklung stattfindenden Austausche keineswegs irgendeinem Zweck in der Natur folgten. Der «Stammbaum des Lebens» ähnelt nicht einem großen, hierarchisch aufgebauten genealogischen Baum, mit einer Grundlage und einem Gipfel, dessen Endergebnis der Mensch, Homo Sapiens, ist, sondern einem sich verästelnden Baum, dessen Stamm alle älteren Lebensformen zusammenfasst, und bei dem der Mensch nur ein besonderes Wesen unter unzähligen Millionen anderer Lebewesen ist. Diese Sicht leitet eine Verbindung und eine gemeinsame Abstammung zwischen den Menschen und den elementarsten Lebensformen wie den Amöben ab. All das scheint zahlreichen Leuten, die oft unbewusst unter dem Zwang religiöser Rückständigkeit leiden, unerträglich. Heute noch werden die Methode und die Herangehensweise Darwin’s ganz heftig angegriffen, obwohl alle wissenschaftlichen Beiträge der Paläontologie, Biologie, Genetik und anderer Wissenschaften die Gültigkeit der Theorie Darwin’s bestätigt haben. Die Religionen sind jedoch dazu gezwungen worden, die Fortsetzung ihres Kreuzzuges gegen Darwin zu kaschieren, indem sie eine Ideologie vorschlagen, die den religiösen Glauben unter dem Deckmantel einer alternativen pseudo- "wissenschaftlichen Konstruktion" aufrechterhalten soll: dem "intelligent Design". Der Kreationismus wird von der Kirche nicht mehr in der gleichen Art wie zur Zeit Darwin’s verteidigt. Erinnern wir uns an den Streit von 1860 zwischen dem Bischof von Oxford, Samual Wilberforce, und Thomas Huxley, einem energischen Verteidiger der Evolutionslehre. Man behauptet, dass der erste den zweiten verspottete, indem er ihn fragte: "Stammen Sie großväterlicherseits oder großmütterlicherseits vom Affen ab, Herr Huxley?" Dieser entgegnete ihm. "Niemand braucht sich zu schämen, einen Affen zum Urahn zu haben. Wenn ich mir einen Vorfahr aussuchen sollte und dabei wählen müsste zwischen einem Affen und einem gelehrten Mann, der seine Logik dazu missbraucht, ungeschulte Zuhörer in die Irre zu führen, und der eine schwerwiegende und philosophisch ernstzunehmende Fragestellung nicht mit sachlichen Argumenten angeht, sondern sie wissentlich der Lächerlichkeit preisgibt, wenn ich da wählen müsste, würde ich mich ohne zu zögern für den Affen entscheiden.“ Die katholische Kirche hat nie gewagt, den "Ursprung der Arten" auf die Liste der verbotenen Bücher zu setzen, aber sie hat das Buch halbamtlich verurteilt, indem sie eine heimtückischere und hinterlistigere Doktrin verbreitet: "das intelligente Design". Dieser "Theorie" zufolge hätte es sehr wohl Evolution gegeben, aber sie sei gewünscht und "gesteuert" gewesen durch eine "göttliche Kraft". Auch sei der Mensch kein "Zufallsprodukt der Natur", sondern Ergebnis des Willens eines allmächtigen Schöpfers, der ihn so "konzipiert" und "programmiert" habe.
Diese Variante des Kreationismus profitiert von der gegenwärtig erstarkenden Popularität spiritualistischer, obskurantistischer und sektenhafter Ideologien. Diese reaktionären Ideologien werden oft direkt von bestimmten Fraktionen der Herrschenden verbreitet, die diese als Manipulationsmittel für durch Armut, Barbarei und Perspektivlosigkeit im Kapitalismus desorientierte und verzweifelte Leute benutzen. Dies treibt sie dazu, vor der objektiven Wirklichkeit zu flüchten, indem sie sich in irgendeinen Glauben stürzen, einen blinden Glauben an ein Jenseits, an eine "höhere Ordnung", unsichtbar und allmächtig, welche außerhalb jeglichen verstandesmäßigen Denkens besteht. Der Glaube an einen allmächtigen Schöpfergott, wie auch das Wiederauftauchen aller möglichen Sekten (die übrigens daraus einen typisch kapitalistischen Nutzen ziehen), wird von den Ideologen des New Age ausgeschlachtet, um die Ängste und das Leiden all der Unglücklichen zu kristallisieren, die durch die Sackgasse der kapitalistischen Gesellschaft entstanden sind. Diese Feststellung belegt die Richtigkeit der Analyse, die Marx schon von 1843 an in „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ machte. „Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volkes.“ (K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung, MEW 1, S. 378). Die Religion ist immer das erste Bollwerk der konservativen und reaktionären Kräfte zur Betäubung des Bewusstseins gegen den wissenschaftlichen Fortschritt. Sie versucht sich anzupassen, um den Status quo aufrechtzuerhalten, indem sie immer behauptet eine Zuflucht für den "Trost der Unglücklichen dieser Gesellschaft" zu sein, damit sie sich einem Glauben und vor allem einer bestehenden gesellschaftlichen Ordnung unterwerfen.
Die reaktionäre Theorie des "intelligent Design"
"Intelligent Design" beansprucht in den Rang einer wissenschaftlichen Theorie eingestuft zu werden, weil man die Evolutionslehre und den Kreationismus unter einen Hut bringen wolle. "Intelligent Design" stellt die beiden auf irreführende Weise jeweils als eine "philosophische Wahl" zwischen zwei konkurrierenden Flügeln dar. Der Vorläufer des "intelligent Design", der Jesuit Teilhard de Chardin (1881-1955) versuchte zum Beispiel in den 1920er Jahren zu beweisen, dass es eine Teleologie gäbe, eine Zweckbestimmtheit in der Evolution, die als "Omega-Punkt", als der göttliche Pol der Konvergenz und der Harmonisierung bezeichnet und definiert wird, welcher in der "Noosphäre" gipfelt, einer Art himmlischer Glückseligkeit, die durch den göttlichen Geist getragen wird. Mehr noch als der Katholizismus sammelten sich im Protestantismus und seinen verschiedenen "evangelischer Kirchen", die sich auf eine eher wortgetreue Auslegung der Bibel berufen, die entschlossensten Gegner Darwin’s (dies ist der Grund für den Erfolg des „intelligent Design“ in den USA, insbesondere in der Amtszeit von G.W. Bush, als die Regierung diese quasi offen unterstützte). Die gegenwärtigen Propagandaziele des „intelligent Design“ wurden klar von dem "think tank" der Bewegung, dem Discovery Institute, in einem internen Dokument "The Wedge" zusammengefasst. Aufgrund einer undichten Stelle im Think Tank wurde der Text 1999 bekannt. In diesem Dokument werden die Hauptziele des Discovery Institutes ganz klar definiert: Erstens geht es ihnen darum, "den wissenschaftlichen Materialismus und seine moralischen, kulturellen und wissenschaftlichen Erben zu besiegen; die materialistischen Erklärungen schließlich zu ersetzen durch ein Begreifen, dass die Natur und der Mensch durch Gott geschaffen wurden". Er setzt sich das kurz- und mittelfristige Ziel, "dass die Theorie des „intelligent Design“ zu einer von den Wissenschaften akzeptierten Alternative wird, und dass wissenschaftliche Untersuchungen aus der Perspektive der Theorie des Designs unternommen werden; dass Hilfe beim Anschub geleistet wird für den Einfluss der Theorie des Designs in anderen Bereichen als den Naturwissenschaften; dass neue Grundsatzdebatten in der Bildung begonnen werden, bei denen lebensbezogene Themen aufgegriffen werden, die persönliche Haftung und Verantwortung wieder auf die nationale Tagesordnung gesetzt werden". Die Hauptstoßkraft der Offensive dieses Dogmas richtet sich deshalb auf die schulische Bildung und das Erziehungswesen insgesamt sowie gleichzeitig auf die juristische Ebene, während gleichzeitig versucht wird, in Wissenschaftskreisen Verwirrung zu stiften, um Anhänger in allen Teilen der Gesellschaft zu werben, insbesondere dank intensiver Werbung und einer Kampagne der Meinungsbildung (publicity and opinion making). Das Internet hat ihm ebenfalls neue Möglichkeiten zur Verbreitung seiner Propaganda eröffnet, so wie damals die Missionare zur "Bekehrung" der Welt im Zeitalter der Einverleibung neuer Kolonien aufbrachen. Sie arbeiten nach dem Prinzip, dass „intelligent Design“ als eine "wissenschaftliche" Hypothese dargestellt wird, die mit dem Darwinismus im Wettbewerb stehe. „Intelligent Design“ verfolgt auch das Ziel, «dass die Theorie des “intelligent Design“ als die vorherrschende Perspektive in den Wissenschaften angesehen wird, und dass die Ergebnisse der Theorie des “intelligent Designs“ in spezifischen Bereichen wie Molekularbiologie, Biochemie, Paläontologie, Physik und Kosmologie in den Naturwissenschaft angewandt werden, sowie in der Psychologie, Ethik, Politik, Theologie, Philosophie und Literaturwissenschaften und im Bereich der Kunst.» Aber diese Offenlegung der fundamentalistischen Absichten des „intelligent Design“ in der Öffentlichkeit hat auch eine Kehrseite der Medaille: seine Hauptverbreiter konnten die Existenz dieses Dokumentes nicht mehr leugnen. Heute verbreiten sie eine etwas entschärftere Version.
Aber dieses Projekt ist vor allem in der muslimischen Welt auf großen Widerhall gestoßen. Von der Türkei aus hat Harun Yahia, sein richtiger Name ist Adnan Oktar, an der Spitze einer mafiösen Lobby alles daran gesetzt, seine Propaganda kostenlos und massiv unter Lehrern und Leitern von Ausbildungseinrichtungen, Schulen usw. zu verbreiten. Er hat Schulen auf der ganzen Welt mit seinem "Atlas der Schöpfung" überflutet, der auch im Internet verbreitet wird. So wurden mehr als 200 Dokumentarfilme vertrieben und 300 Werke in mehr als 60 Sprachen übersetzt. Die Versuche, die Geschichte der Entwicklung der Arten und der Lebewesen zu verfälschen, sind wie all die von den herrschenden Klassen aufgetischten Lügen bezüglich der Geschichte der Menschheit, Teil der gleichen Manipulierungsversuche, um die Bewusstseinsentwicklung zu bremsen (insbesondere die Bewusstseinsentwicklung der Arbeiterklasse), sie daran zu hindern, sich von ihren Fesseln zu befreien. Und der Obskurantismus schlachtet so die Fäulnis der kapitalistischen Gesellschaft und die ideologische Maske, die sie über die Wirklichkeit der Welt legen, aus, um die Ausbeutungsverhältnisse aufrechtzuerhalten. Die religiöse Herangehensweise ist nur eine dieser Masken.
Wissenschaft und Gewissen
Religiöser Glauben und Wissenschaft sowie wissenschaftliche Methoden stehen sich völlig gegenüber. Aus der Sicht der Religion und der theologischen Tradition sind Wissen und Erkenntnis letztendlich nur das Resultat einer göttlichen Schöpfung. Den normal Sterblichen sind sie nicht zugänglich. Die materialistische Vorgehensweise in der Wissenschaft: Tatsachen und die Untersuchung von unterschiedlichen oder ähnlichen Reaktionen je nach dem Umfeld sind die Grundlagen jeden wissenschaftlichen Experiments. Sie ist weder eine "Philosophie" noch eine "Ideologie", sondern die notwendige Vorbedingung für eine bewusste und historische Herangehensweise der Untersuchung der Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer natürlichen Umgebung, auch indem man das eigene Verhalten als Untersuchungsgegenstand nimmt. Dies ist eine Untersuchung der Grenzen der Erkenntnis, für die keine Grenzen gesetzt werden können. Die Entwicklung der Wissenschaft ist aufs engste verbunden mit der Entwicklung des Gewissens der Menschheit. Die Wissenschaft hat eine Geschichte, die weder linear noch mechanisch mit dem technischen Fortschritt verbunden ist oder mit den technologischen Fortschritten (was jeden "Positivismus", jeden Gedanken eines unaufhörlichen "Fortschritts" ausschließt). Sie ist eng mit den gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen verflochten, durch welche sie bestimmt werden. Der Glauben stützt sich auf die Angst vor dem Unbekannten. Im Gegenteil zu den religiösen Vorurteilen (die vor allem eine Ideologie im Dienste der herrschenden Ordnung, der bestehenden Macht sind, welche ihren Fortbestand durch den Konservatismus und die Verteidigung des Status quo sicherstellen) ist die Entwicklung des Bewusstseins die treibende Kraft bei der Entwicklung der Wissenschaft. So fürchtet die wissenschaftliche Methode nicht die Infragestellung ihrer Hypothesen, die Umwälzung ihrer Errungenschaften; aus diesem Grunde hat sie sich weiter entfaltet, deshalb ist sie dynamisch. Wie Patrick Tort (L'effet Darwin, S. 170) schrieb: "Die Wissenschaft erfindet, schreitet voran und wandelt sich. Die Ideologie fängt und saugt alles auf, passt sich an.“
Und wie er in einem Artikel in "Le Monde de l'Education" im Juni 2005 schrieb: "Der "Dialog" zwischen Wissenschaft und Religion ist eine von der Politik erfundene Fiktion. Man kann nämlich zwischen einer Forschung, die der objektiven Erkenntnis immanent ist und Anrufung von etwas Übernatürlichem, die für die Haltung des Gläubigen typisch ist, nichts Gemeinsames aushandeln noch irgendetwas austauschen. Wenn man nur einmal zugibt, dass ein übernatürliches Element zur wissenschaftlichen Erklärung eines Phänomens beitragen könnte, verzichtete man gleichzeitig auf die methodologische Kohärenz der ganzen Wissenschaft. Die wissenschaftliche Methode kann nicht verhandelt werden. Es braucht die List des individualistischen Liberalismus (…), um davon zu überzeugen, dass man eine Wahl treffen kann zwischen einer wissenschaftlichen Erklärung und der theoretischen Interpretation, oder dass diese beiden kombiniert werden könnten, als ob die Anerkennung des Gesetzes des freien Falls eine Angelegenheit persönlicher Überzeugung, der elektiven Demokratie und der "Freiheit" wäre."
"Politik" hat dieser Ansicht nach nur einen Sinn als eine Politik der herrschenden Klasse. Deshalb wurde und wird die wissenschaftliche Herangehensweise eines Kopernikus, Marx, Engels oder Darwin so verbissen von den Verteidigern der "ewig" bestehenden Gesellschaftsordnung des Kapitalismus bekämpft oder entstellt.
W 24.11.09
Aktuelles und Laufendes:
- Darwin [1]
- Kreationismus [2]
- Intelligent Design [3]
20 Jahre „Deutsche Einheit“: Ostdeutschland: ein Klotz am Bein der deutschen Wirtschaft
- 3672 Aufrufe
Was war das für eine Euphorie in den Tagen und Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer! Ein ganzes Volk, Bourgeois und Arbeiter, Ost- und Westdeutsche, schwebte auf Wolke 7. „Wahnsinn“ war das am häufigsten benutzte Wort für die sich überschlagenden Geschehnisse damals. Und „freudetrunken“ der Begriff, der den Geisteszustand der Bevölkerung in Ost und West in jenen Tagen vielleicht am besten umschreibt. Die Erwartungen, die sich an der am 3. Oktober 1990 vollzogenen Wiedervereinigung knüpften, waren riesig. Die Arbeiter und Arbeiterinnen im Osten Deutschlands, also in der ehemaligen DDR, erhofften sich von ihr ein Leben in Freiheit und Wohlstand. Die Kapitalisten im Westen Deutschlands witterten ihrerseits große Geschäfte, riesige Märkte, die ihnen nun wie reife Früchte in den Schoß fielen. Die politische Klasse trug ihr Teil dazu bei, diesen Hoffnungen Auftrieb zu verleihen. Erinnert sei an die mittlerweile zum geflügelten Wort gewordene Formulierung von den „blühenden Landschaften“, die der damalige Bundeskanzler Kohl der ostdeutschen Arbeiterklasse versprach.
In diesem Jahr jährt sich der „Tag der deutschen Einheit“ nun zum zwanzigsten Mal. Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Was ist aus all den Hoffnungen und Erwartungen geworden? Sind sie erfüllt worden, oder sind sie in der rauen Realität des Kapitalismus westlicher Prägung zerstoben? Was ist aus den „blühenden Landschaften“ geworden? Hat Ostdeutschland Anschluss gefunden an das Niveau der westdeutschen Gesellschaft, oder hinkt es nicht vielmehr noch immer hoffnungslos hinterher? Kurz: ist die deutsche Wiedervereinigung eine Erfolgsgeschichte, ein Impuls, der einen Aufbruch der deutschen Bourgeoisie zu neuen Ufern bewirkt hat? Oder ist sie nicht eher eine Demonstration dafür, dass im Zeitalter des Niedergangs des Weltkapitalismus die bloße territoriale Erweiterung, wie sie sich durch die Vereinigung beider deutscher Staaten ergeben hat, nicht nur zu einem Machtzuwachs der deutschen Bourgeoisie geführt hat, sondern auch ein Kraftakt war (und ist), der die wirtschaftliche und finanzielle Substanz der Bundesrepublik erheblich beeinträchtigt, wenn nicht sogar bedroht.
Die Währungsunion – der Anfang vom Ende der DDR-Wirtschaft
Als am 1. Juli 1990 die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der BRD und der DDR in Kraft trat, geschah dies vor dem Hintergrund einer nicht abreißenden Auswanderungswelle von DDR-Bürgern. Täglich strömten Tausende und Abertausende von Menschen über die nun nicht mehr existente Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland, um ihr Glück im „goldenen Westen“ zu suchen. Zum Teil verließen sie ihre Heimat Hals über Kopf, alles, in einigen wenigen Fällen sogar die eigenen Kinder, hinter sich lassend, so als befürchteten sie, der Traum von der „grenzenlosen Freiheit“ könne bald wieder zerplatzen.
Die herrschende Klasse Westdeutschlands stand also unter einem mächtigen Zugzwang, wollte sie dem Exodus aus Ostdeutschland Einhalt gebieten. Außerdem ging es darum, die Gunst der Stunde auszunutzen, um die deutsche „Wiedervereinigung“ zu einer nicht mehr rückgängig zu machenden Tatsache werden zu lassen. Ihre Lösung lautete: Angleichung der Lebensumstände Ostdeutschlands an den Westen – und zwar so schnell wie möglich und koste, was es wolle. So kamen über Nacht mehr als 17 Millionen DDR-Bürger (noch bestand die DDR) nicht nur in den Genuss westdeutscher wohlfahrtsstaatlicher Leistungen (Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung), sie wurden auch, was ihre Zahlungsmittel anging, zu Bundesbürgern: Ihre Löhne und Gehälter bzw. Renten wurden fortan in D-Mark ausgezahlt, und ihre Ersparnisse zum Teil 1:1, zum Teil 1:2 in selbige umgewandelt, was angesichts des krassen Verfalls der DDR-Währung jeder finanzwirtschaftlichen Logik zuwider sprach, doch politisch gewollt war.
Noch viel gravierender waren die Folgen dieser mit heißer Nadel gestrickten Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion jedoch für die ostdeutsche Wirtschaft. Mit der Umwandlung der Löhne in D-Mark verteuerten sich von einem Tag auf den anderen die DDR-Produkte um ein Mehrfaches ihres ursprünglichen Preises. Nichts machte die hoffnungslose Unterlegenheit der DDR-Erzeugnisse deutlicher als die D-Mark in den Geldbeuteln der ostdeutschen Bevölkerung: Waren aus DDR-Produktion, für deren Erwerb die DDR-Bevölkerung gestern noch Schlange gestanden hatte, erwiesen sich nun als völlig überteuerte Ladenhüter. Konsumartikel westlicher Provenienz, vom Auto bis zum Waschmittel, vom Kaffee bis zur Hifi-Anlage, überschwemmten die (bis dato gähnend leeren) Regale der DDR-Warenhäuser und fanden reißenden Absatz in der nunmehr „solventen“ Bevölkerung Ostdeutschlands. Mit dem Zusammenbruch der ostdeutschen Konsumgüterindustrie brach auch die Grundlage der Produktionsgüterindustrie der DDR auseinander. Die Chemie- und Maschinenbaukombinate waren gleich in doppelter Weise gehandicapt: Neben dem Binnenmarkt brachen ihnen auch die traditionellen osteuropäischen Märkte der ehemaligen COMECON-Länder weg. Die Folge: „Mit Einführung der DM sank das Bruttoinlandsprodukt der Ex-DDR im zweiten Halbjahr 1990 real um 27,5 Prozent und im ersten Halbjahr 1991 nochmals über 25 Prozent.“[1]
Diese Entwicklung war durchaus absehbar. Die zahllosen Kontakte im Rahmen der deutsch-deutschen Handelsbeziehungen hatten der herrschenden Klasse der Bundesrepublik einen relativ tiefen Einblick in den hoffnungslosen Zustand der DDR-Ökonomie verschafft. Seit Anfang der 80er Jahre schwebte das Damoklesschwert des Staatsbankrotts über dem DDR-Regime, der zuletzt allein durch die Milliardenkredite der Bundesrepublik abgewendet werden konnte.[2] Die Wirtschaft befand sich größtenteils in einem völlig desolaten Zustand. Versorgungsengpässe und Mangelerscheinungen allerorten, überholte Technologien, marode Industrieanlagen, ruinierte Infrastrukturen und eine verwüstete Umwelt – dies alles waren trotz aller Geheimniskrämerei der DDR-Behörden schon lange unübersehbare Anzeichen dafür, dass sich die DDR-Wirtschaft spätestens seit den 70er Jahren im freien Fall befand.
Die Währungsunion vom 1. Juni 1990 war somit der Versuch, eine Wirtschaft, deren industrielle Substanz marode geworden war[3], ohne jeglichen Übergang in die „freie Marktwirtschaft“ der westlichen Industrienationen zu katapultieren. Dieser Versuch musste scheitern, und er sollte scheitern.
Die Treuhand: Die massivsteDe-Industrialisierung in der Geschichte
Waren die Konstrukteure der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion – neben dem Bestreben, die imperialistischen Rivalen so schnell wie möglich vor vollendete Tatsachen zu stellen - noch primär von der Sorge getragen, nur durch eine schnelle Angleichung der Lebensumstände in Ost und West eine weitere Entvölkerung der DDR zu verhindern, so standen bei der Treuhand-Anstalt andere Interessen im Vordergrund.
Die Treuhand-Anstalt, ursprünglich auf Initiative von DDR-Bürgerrechtlern per Beschluss vom DDR-Ministerrat im März 1990 gegründet, entwickelte sich spätestens nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 schnell zur größten Staatsholding der Welt. In ihrer kurzen Existenz (1994 wurde sie aufgelöst) übernahm sie die Geschicke von 8.000 sog. „Volkseigenen Betrieben“ (VEB) und vielen tausend Immobilien sowie Betriebsteilen. Ihre zentrale Aufgabe bestand darin, die „früheren volkseigenen Betriebe wettbewerblich zu strukturieren und zu privatisieren“[4]. Dabei sollte sie sich selbst über die Verkäufe dieser VEB’s finanzieren. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass sich die herrschende Klasse Westdeutschlands die Beute, die ihr da wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen war, prächtiger ausgemalt hatte, als sie in Wahrheit war. Schnell musste man anfängliche Schätzungen, die von einem Verkaufswert der DDR-Unternehmen in Höhe von 800 bis 1.000 Mrd. D-Mark ausgingen, nach unten revidieren. Im Treuhandbericht des Bundesfinanzministeriums vom 31. Oktober 1991 war nur noch von rund 200 Mrd. DM die Rede, die man aus der Liquidation der DDR-Wirtschaft einzunehmen gedenke. Aber auch dies waren Zahlen aus dem Wolkenkuckucksheim. Als die Treuhand 1994 aufgelöst wurde, hinterließ sie offiziell ein Defizit von 256,4 Mrd. DM. Und es sollte nicht die einzige Hinterlassenschaft der Treuhand sein...
Anfangs beherrschte ein interner Richtungsstreit den Kurs der Treuhand. Personifiziert wurde dieser Konflikt auf der einen Seite von Detlev Karsten Rohwedder – klassischer Vertreter des sozialdemokratisch geprägten Staatsinterventionismus, legendärer Sanierer des Stahlwerks Hoesch und seit August 1990 Vorsitzender der Treuhand-Anstalt – und auf der anderen Seite von Birgit Breuel – Verfechterin des Neoliberalismus, ehemalige CDU-Wirtschafts- und Finanzministerin in Niedersachsen und nun Stellvertreterin Rohwedders im Treuhand-Vorstand. Der eine legte das Hauptgewicht auf die staatliche Sanierung der Ostbetriebe vor ihrer Privatisierung; die andere drängte auf die schnelle Privatisierung vor der Sanierung. Neben den vielen ungeklärten Eigentumsfragen sollte vor allem diese Auseinandersetzung die Arbeit der Treuhand in den ersten Monaten lähmen. Erst der Tod Rohwedders[5] löste diesen Stau auf.
Mit Breuel als neue Treuhand-Vorsitzende setzte sich letztendlich die Mehrheitsfraktion innerhalb der deutschen Bourgeoisie durch. Nun begann der Ausverkauf der soeben verblichenen DDR. Privatisierungen wie am Fließband: „Bis Ende März 1991 geschah das in rund 1.200 Fällen; bis Ende Mai registrierte man 1.900 Privatisierungen, und dann folgten etwa 300 bis 400 Privatisierungen im Monat; im Oktober 1991 durchschnittlich 24 pro Tag!“[6] Am Ende waren es über 15.000 Betriebe, Betriebsteile und Immobilien, die verramscht wurden. Oberste Priorität bei der Veräußerung des DDR-Nachlasses war nicht, wie die Treuhand vorgab, der Erhalt der Arbeitsplätze oder etwa der industriellen Struktur Ostdeutschlands, sondern das Bestreben, eben jene „industriellen Kerne“ in Ostdeutschland zu verhindern. Das westdeutsche Kapital hatte nicht die Absicht, sich seine eigene Konkurrenz heranzuzüchten. Was es benötigte, waren nicht neue Produzenten, die die allseitige Überproduktion nur noch weiter verschärft hätten, sondern neue Märkte. So tat denn die Treuhand alles, Versuche einer eigenständigen industriellen Entwicklung in Ostdeutschland zu torpedieren. Verhandlungen mit Investoren wurden solange hinausgezögert, bis diese absprangen. Betriebe wurden gegen den Willen der Belegschaften zerstückelt und ausgeschlachtet, wobei die Rosinen verhökert, der Rest hingegen in sog. „Beschäftigungsgesellschaften“ umgewandelt wurde. Anderen Betrieben wiederum wurde buchstäblich der Boden unter den Füßen weggezogen, indem das Betriebsgelände an die Alteigentümer ausgehändigt wurde. Erfolg versprechende „Management-Buy-Out“-Konzepte (also der Erwerb des eigenen Betriebes durch leitende Angestellte und Vorstand) wurden von der Treuhand unter fadenscheinigen Gründen abgelehnt. Am Ende waren 85 Prozent des von der Treuhand privatisierten DDR-Vermögens in westdeutscher Hand, nur zehn Prozent in ausländischem Besitz und ganze fünf Prozent im Besitz ostdeutscher Eigentümer.
Als die Treuhand am 31. Dezember 1994 aufgelöst wurde, hinterließ sie nicht nur Schulden in Milliardenhöhe (s.o.), sondern auch ein Land, das seiner industriellen Struktur beraubt war. Die „blühenden Landschaften“, die der damalige Bundeskanzler Kohl auf seiner Wahlkampftour durch Ostdeutschland im Sommer 1990 versprochen hatte, sind nie über kleine Oasen (Jena, Dresden, Leipzig) hinausgewachsen, umgeben von einer einzigen industriellen Wüstung. Die Autoindustrie in Zwickau? Von der Bildfläche verschwunden. Der traditionsreiche Maschinenbau Mitteldeutschlands? Ersatzlos „abgewickelt“. Die Elektroindustrie Ostberlins? Gibt es nicht mehr. Bereits im zweiten Halbjahr 1991 erwirtschaftete die ostdeutsche Industrie nur noch ein Viertel des Bruttoinlandproduktes vom 1. Halbjahr 1990. Mit anderen Worten: Was sich zwischen 1990 und 1994 zwischen Rostock und Leipzig, zwischen Erfurt und Frankfurt/Oder ereignet hatte, war nichts Geringeres als eine der massivsten Wellen der De-Industrialisierung in der Geschichte des modernen Kapitalismus.
Es ist keine Überraschung, dass die Treuhand-Anstalt zu einer der meist verhassten Institutionen in Ostdeutschland avancierte. In der Tat ist die Treuhand eines der Synonyme schlechthin für die deutsch-deutsche Wiedervereinigung geworden – für eine Wiedervereinigung, die nicht auf Augenhöhe stattfand, sondern eher die Form einer Annexion annahm. Mit der Arroganz eines Siegers und im Stile eines Kolonialherrn fiel das westdeutsche Kapital, in seinem Schlepptau Heerscharen von Glücksrittern, Hochstaplern und Abenteurern, über Ostdeutschland her, machte alles platt, was noch nicht kaputt war, und sog alles aus diesem Land, was sich aus dessen Konkursmasse noch verwerten ließ. Übrig blieb ein Torso, der auf unabsehbare Zeit am Tropf westdeutscher Transferleistungen hängen wird.
(Fortsetzung folgt – Nächster Teil: Die Kosten der Wiedervereinigung)
[1] Martin Flug, „Treuhand-Poker. Die Mechanismen des Ausverkaufs“, Ch.Links-Verlag, Berlin, S. 54.
[2] "... Die Verschuldung im nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet ist seit dem VIII. Parteitag gegenwärtig auf eine Höhe gestiegen, die die Zahlungsfähigkeit der DDR in Frage stellt ...: von 2 Mrd. VM 1970 auf 49 Mrd. VM 1989." [VM: ValutaMark = DM West] (aus dem sog. „Schürer-Papier“ vom 18.10.89, benannt nach der Analyse des Chefs der staatlichen Planungskommission der DDR, Gerhard Schürer)
[3] Darüber können auch die internationalen Statistiken nicht hinwegtäuschen, die die DDR noch in den 80er Jahren als zehntstärkste (!) Industrienation aufführten.
[4] aus: Artikel 25 des Einigungsvertrages
[5] Rohwedder wurde am 1. April 1991 unter mysteriösen Umständen ermordet. Trotz eines angeblichen Bekennerschreibens bestehen erhebliche Zweifel an der offiziellen Version, die von der RAF als Täter ausgeht. Neben vielen anderen Ungereimtheiten entsprach auch das Tatmuster (Rohwedder wurde aus größerer Entfernung von einem Scharfschützen mit einem einzigen Schuss getötet) nicht dem üblichen Vorgehen der RAF-Terroristen. Die Täter sind bis heute nicht gefasst.
[6] Martin Flug: „Treuhand-Poker“, S. 44.
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Rohwedder [6]
- Treuhand [7]
- Birgit Breuel [8]
Historische Ereignisse:
Der Kapp-Putsch 1920
- 3839 Aufrufe
Die Rechten greifen an, die Demokratie fügt den Arbeitern die Niederlage bei
Der Artikel wurde erstmals in der Internationalen Revue Nr. 24 veröffentlicht.
In der Internationalen Revue Nr. 19 haben wir aufgezeigt, dass die Arbeiterklasse 1919 nach dem Scheitern des Januaraufstands in einer Reihe von zerstreuten Kämpfen schwerwiegende Niederlagen hinnehmen musste. Mit der blutrünstigsten Gewalt schlug die herrschende Klasse in Deutschland gegen die Arbeiter zu.
1919 war der Spitze der revolutionären Welle überschritten. Und nachdem die Arbeiterklasse in Russland gegenüber dem Ansturm der konterrevolutionären Truppen, die die demokratischen Staaten gegen Russland organisiert hatten, isoliert blieb, wollte in Deutschland die Bourgeoisie die Arbeiterklasse, die durch die 1919 erlittenen Niederlagen angeschlagen war, weiter angreifen und vollständig auf den Boden werfen.
Die Arbeiterklasse sollte die Kosten des Krieges tragen
Nach dem Desaster des Krieges, als die Wirtschaft dabei war zusammenzubrechen, wollte die herrschende Klasse die Situation ausnutzen, um der Arbeiterklasse die ganzen Kosten des Krieges aufzubürden. In Deutschland waren zwischen 1913 und 1920 die Ernten in der Landwirtschaft und die industrielle Produktion um mehr als die Hälfte gefallen. Von der vorhandenen Produktion sollte noch ein Drittel an die Siegerländer abgeführt werden. In vielen Wirtschaftszweigen brach die Produktion weiter zusammen. Unterdessen schossen die Preise rasant in die Höhe; betrugen die Lebenshaltungskosten 1913 100 Einheiten, waren sie 1920 auf 1.100 Einheiten angestiegen. Nach dem Hungern im Krieg stand jetzt wieder der Hunger im ‘Frieden’ auf dem Programm. Die Unterernährung dehnte sich weiter aus. Chaos und Anarchie der kapitalistischen Produktion, Verarmung und Hunger in den Reihen der Arbeiter herrschten überall.
Die Bourgeoisie setzt den Versailler Vertrag zur Spaltung der Arbeiterklasse ein
Gleichzeitig wollten die Siegermächte des Westens die deutsche Bourgeoisie als Verlierer des Krieges zur Kasse bitten. Zu dem Zeitpunkt bestanden jedoch große Interessensgegensätze zwischen den Siegermächten.
Während die USA daran interessiert waren, dass Deutschland als Gegenpol gegen England wirken könnte und sich deshalb gegen eine Zerschlagung Deutschlands stellten, wollte Frankreich die möglichst nachhaltigste militärische, wirtschaftliche und territoriale Schwächung und gar eine Zerstückelung Deutschlands. Im Versailler Vertrag (28. Juni 1919) wurde deshalb beschlossen, dass in Deutschland das Militär bis zum 10. April 1920 von 400.000 auf 200.000 Mann, bis 10. Juli auf 100.000 Mann reduziert werden solle. Von 24.000 Offizieren würden nur 4.000 in die neue republikanische Armee, die Reichswehr, übernommen werden. Die Reichswehr fasste diesen Beschluss als eine lebensgefährliche Bedrohung für sie auf und wollte sich mit allen Mitteln dagegen zur Wehr setzen. Unter allen bürgerlichen Parteien – von SPD über Zentrum bis zu den Rechten– herrschte Einigkeit, dass der Versailler Vertrag wegen nationaler Interessen verworfen werden sollte. Nur aufgrund des von den Siegermächten ausgeübten Zwangs beugten sie sich. Gleichzeitig benutzte die Bourgeoisie den Versailler Vertrag dazu, die schon im Krieg vorhandene Spaltung in der internationalen Arbeiterklasse noch weiter zu vertiefen: in Arbeiter der Siegermächte und der Verliererstaaten.
Vor allem große Teile des Militärs fühlten sich durch den Versailler Vertrag bedroht und wollten sofort ihren Widerstand organisieren. Erneut strebten sie einen Krieg mit den Siegermächten an. Dazu musste aber der Arbeiterklasse eine weitere entscheidende Niederlagen schnell beifügt werden.
Aber das Großkapital wollte die Militärs nicht an die Macht kommen lassen. Die SPD hatte bislang an der Spitze des Staates ganze Arbeit geleistet. Seit 1914 hatte sie die Arbeiterklasse gefesselt, in den revolutionären Kämpfen im Winter 1918/1919 die Sabotage und Repression organisiert. Das Kapital brauchte nicht die Militärs, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten, es hatte die Diktatur der Weimarer Republik und setzte weiter auf sie. So schossen von der SPD befehligte Polizeitruppen am 13. Januar 1920 auf eine Massendemo vor dem Reichstag. 42 Tote blieben auf der Strecke. In einer Streikwelle im Ruhrgebiet Ende Februar wurde von der ‘demokratischen Regierung’ die Todesstrafe gegen revolutionäre Arbeiter angedroht.
Als im Februar Teile des Militärs Putschbestrebungen in Gang setzten, wurden diese deshalb nur von wenigen Kapitalfraktionen gestützt. Vor allem der agrarische Osten bildete ihren Stützpunkt, da er besonders stark an einer Rückeroberung durch den Krieg verloren gegangener Gebiete interessiert war.
Der Kapp-Putsch Die Rechten greifen an ...
Dass ein Putschversuch in Vorbereitung war, pfiffen die Spatzen von den Dächern. Aber die SPD-geführte Regierung unternahm zunächst nichts gegen diese Bestrebungen. Am 13. März zog eine ‘Marine-Brigade’ unter dem Kommando des Generals von Lüttwitz in Berlin ein, umstellte das Regierungsgebäude und rief den Sturz der Ebert-Regierung aus. Nachdem Ebert die Generale Seeckt und Schleicher um sich versammelte, um mit ihnen die Niederschlagung des rechtsradikalen Putsches durch die SPD-geführte Regierung zu besprechen, weigerten sich die Militärs, denn wie der oberste Militärchef sagte: ‘Die Reichswehr will keinen ‘Bruderkrieg’ Reichswehr gegen Reichswehr zulassen’.
Die Regierung floh zunächst nach Dresden und dann nach Stuttgart. Zwar erklärte Kapp die bürgerliche Regierung für abgesetzt, aber sie wurde nicht einmal verhaftet. Vor ihrer Flucht nach Stuttgart konnte die Regierung noch einen Aufruf zum Generalstreik erlassen, der ebenfalls von den Gewerkschaften unterstützt wurde, und zeigte damit erneut, wie heimtückisch dieser linke Flügel des Kapitals gegen die Arbeiter vorzugehen verstand.
”Kämpft mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik. Lasst allen Zwist beiseite! Es gibt nur ein Mittel gegen die Diktatur Wilhelm II.:
- Lahmlegung jeden Wirtschaftslebens
- Keine Hand darf sich nicht mehr rühren
- Kein Proletarier darf der Militärdiktatur helfen
- Generalstreik auf der ganzen Linie
- Proletarier vereinigt Euch. Nieder mit der Gegenrevolution.
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Regierung: Ebert, Bauer, Noske,
Der Parteivorstand der SPD– O. Wels”
Gewerkschaften und SPD traten sofort für den Schutz der bürgerlichen Republik ein – auch wenn sie dabei eine ‘arbeiterfreundliche Sprache’ benutzten.[i] [10] Kapp erklärte die Nationalversammlung für aufgelöst, kündigte Neuwahlen an und drohte jedem streikenden Arbeiter mit der Todesstrafe.
Die Reaktion der Arbeiterklasse: Der bewaffnete Abwehrkampf
Die Empörung unter den Arbeitern war riesig. Ihnen war sofort klar, dass es sich um einen Angriff gegen die Arbeiterklasse handelte. Überall entflammte heftigster Widerstand. Natürlich ging es nicht darum, die für abgesetzt erklärte, verhasste Scheidemann-Regierung zu verteidigen, die vorher so blutig gegen die Arbeiterklasse gewütet hatte.
Von der Waterkant über Ostpreußen, Mitteldeutschland, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern bis zum Ruhrgebiet, keine Großstadt, in der es nicht Demonstrationen gab, kein Industriezentrum, wo nicht die Arbeiter in den Streik traten und versuchten, Polizeistationen zu stürmen und sich zu bewaffnen. Keine Fabrik, wo es keine Vollversammlung gab, um über den Widerstand zu entscheiden. In den meisten Großstädten fingen die putschistischen Truppen oder die Reichswehr an, auf demonstrierende Arbeiter zu schießen. Dutzende von Arbeitern fielen am 13. und 14. März unter den Schüssen der Putschisten.
In den Industriezentren wurden Aktionsausschüsse, Vollzugsräte, Arbeiterräte gebildet. Die Arbeitermassen strömten auf die Straße.
Seit dem November 1918 war die Mobilisierung der Arbeiter noch nie so stark gewesen.
Überall bäumte sich die heftigste Wut der Arbeiter gegen die rechten Militärs gleichzeitig auf.
Am 13. März, dem Tag des Einmarsches der Kapp-Truppen in Berlin, reagierte die KPD-Zentrale in Berlin mit Abwarten. In einer ersten Stellungnahme riet die KPD-Zentrale noch vom Generalstreik ab, ”Das Proletariat wird keinen Finger rühren für die demokratische Republik ... Die Arbeiterklasse, die gestern noch in Banden geschlagen war von den Ebert-Noske, und waffenlos, .. ist in diesem Augenblick nicht aktionsfähig. Die Arbeiterklasse wird den Kampf gegen die Militärdiktatur aufnehmen in dem Augenblick und mit den Mitteln, die ihr günstig erscheinen. Dieser Augenblick ist noch nicht da ...” Doch die KPD-Zentrale täuschte sich. Die Arbeiter selber wollten nicht abwarten, sondern innerhalb von wenigen Tagen reihten sich mehr Arbeiter in diesen Abwehrkampf ein, als sich seit Beginn der revolutionären Welle in den vielen zerstreuten Bewegungen zuvor mobilisiert hatten. Überall hieß die Parole ‘Bewaffnung der Arbeiter’, ‘Niederschlagung der Putschisten’.
Während 1919 in ganz Deutschland zerstreut gekämpft worden war, hatte der Putsch an vielen Orten die Arbeiterklasse gleichzeitig mobilisiert. Dennoch kam es abgesehen vom Ruhrgebiet kaum zu Kontaktaufnahmen der Arbeiter in den verschiedenen Städten untereinander. Landesweit erhob sich der Widerstand spontan, ohne eine ihn zentralisierende Bewegung.
Das Ruhrgebiet, die größte Konzentration der Arbeiterklasse, war zentrale Zielscheibe der Kappisten gewesen. So wurde das Ruhrgebiet zum Zentrum des Abwehrkampfes. Von Münster aus wollten die Kappisten die Arbeiter im Ruhrgebiet einkesseln. Nur die Arbeiter im Ruhrgebiet bündelten ihre Kämpfe in mehreren Städten und bildeten eine zentrale Streikleitung. Überall wurden Aktionsausschüsse gebildet. Es wurden systematisch bewaffnete Arbeiterverbände aufgestellt. Man spricht von 80.000 bewaffneten Arbeitern im gesamten Ruhrgebiet. Dies war die größte militärische Mobilisierung in der Geschichte der Arbeiterbewegung neben dem Abwehrkampf in Russland.
Obwohl der Widerstand der Arbeiter auf militärischer Ebene nicht zentral geleitet wurde, gelang es den bewaffneten Arbeitern, den Vormarsch der Kapp-Putschisten zu stoppen. In einer Stadt nach der anderen konnten die Putschisten verjagt werden. Diese Erfolge hatten die Arbeiter 1919 in den verschiedenen Erhebungen nicht verbuchen können. Am 20. März musste sich das Militär gar aus dem Ruhrgebiet ganz zurückziehen. Am 17. März war Kapp schon zurückgetreten, sein Putsch hatte keine 100 Stunden gedauert. Der Widerstand der Arbeiterklasse hatte ihn zu Fall gebracht.
Ähnlich der Entwicklung ein Jahr zuvor hatten sich die stärksten Widerstandszentren in Sachsen, Hamburg, Frankfurt und München gebildet.[ii] [10] Die machtvollste Reaktion der Arbeiter kam jedoch im Ruhrgebiet zustande.
Während in den anderen Orten Deutschlands die Bewegung nach dem Rücktritt Kapps und dem Scheitern des Putsches sofort wieder stark abflachte, war im Ruhrgebiet mit dem Rücktritt des Putschisten die Bewegung nicht zu stoppen. Viele Arbeiter glaubten, dass man jetzt weitergehen müsse.
Die Grenzen der Reaktion der Arbeiter
Während sich spontan und in Windeseile eine große Abwehrfront der Arbeiter gegen die blutrünstigen Putschisten erhoben hatte, war klar, dass die Frage des Sturzes der Bourgeoisie keineswegs auf der Tagesordnung stand, sondern es ging in den Augen der meisten Arbeiter nur um ein Zurückschlagen eines bewaffneten Angriffs.
Und welcher Schritt der erfolgreichen Abwehr des Putschistenangriffes hätte folgen sollen, war damals unklar.
Abgesehen vom Ruhrgebiet erhoben die Arbeiter in anderen Regionen kaum Forderungen, die der Bewegung der Klasse eine größere Dimension hätte geben können. Solange sich der Druck aus den Betrieben gegen den Putsch richtete, gab es eine einheitliche Linie unter den Arbeitern, aber sobald die putschistischen Truppen niedergeworfen wurden, trat die Bewegung auf der Stelle und suchte ein klares Ziel. Einen Teil des Militärs zurückschlagen, ihn in einer Gegend zum Rückzug zu zwingen, heißt noch nicht, die Kapitalistenklasse gestürzt zu haben,
An verschiedenen Orten gab es Versuche von anarcho-syndikalistisch-rätistischen Kräften, erste Maßnahmen in Richtung Sozialisierung der Produktion in Gang zu setzen, weil man glaubte, nachdem man in einer Stadt die rechtsradikalen Kräfte vertrieben hatte, die Tür zum Sozialismus öffnen zu können. So wurden vielerorts durch die Arbeiter eine Reihe von ‘Kommissionen’ gebildet, die dem bürgerlichen Staat Anweisungen geben wollten, was zu tun sei. Erste Maßnahmen der Arbeiter nach einer erfolgreichen ‘Schlacht’ auf dem Weg zum Sozialismus, erste winzige Ansätze einer Doppelmacht – als solche wurden sie dargestellt. Aber diese Auffassungen sind ein Zeichen der Ungeduld, die in Wirklichkeit von der dringendsten Aufgabe ablenkt. Solche Maßnahmen ins Auge zu fassen, nachdem man nur LOKAL ein günstiges Kräfteverhältnis aufgebaut hat, sind eine große Gefahr für die Arbeiterklasse, weil sich die Machtfrage zunächst für ein ganzes Land und in Wirklichkeit nur international stellt. Deshalb müssen solche Zeichen kleinbürgerlicher Ungeduld und des ‘sofort alles haben wollen’ bekämpft werden.
Während die Arbeiter wegen der Bedrohung durch die Militärs sich sofort militärisch mobilisierten, fehlte jedoch der unabdingbare Druck aus den Fabriken. Ohne den entsprechenden Impuls aus den Betrieben, ohne die Masseninitiative, die auf die Straße drängt und sich in Arbeiterversammlungen äußert, wo gemeinsam die Lage diskutiert wird und Entscheidungen getroffen werden, kann die Bewegung nicht wirklich von der Stelle kommen. Dazu ist aber die größtmögliche Eigeninitiative, das Bestreben nach der Ausdehnung und dem Zusammenschluss der Bewegung erforderlich, was wiederum mit einer tiefgreifenden Bewusstseinsentwicklung verbunden ist, wo die Feinde des Proletariats entlarvt werden.
Deswegen reicht nicht einfach die Bewaffnung und die entschlossene militärische Abwehrschlacht – die Arbeiterklasse selber muss ihr wichtigstes Geschütz auffahren: ihr Bewusstsein über ihre eigenen Rolle, ihre Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, vorantreiben. Dazu stehen die Arbeiterräte an zentraler Stelle. Die Arbeiterräte und Aktionsausschüsse, die in den Abwehrkämpfen wieder spontan entstanden waren, waren jedoch noch zu schwach entwickelt, um der Bewegung als Sammelpunkt und als Speerspitze zu dienen.
Hinzu kam, dass die SPD von Anfang an alles unternahm, um gerade ihren Sabotagehebel gegen die Räte anzusetzen. Während die KPD den Schwerpunkt ihrer Intervention auf die Neuwahl der Arbeiterräte setzte, die Initiative in den Räten selber verstärken wollte, blockierte die SPD diese Versuche ab.
SPD und Gewerkschaften: Speerspitze bei der Niederschlagung der Arbeiterklasse
Im Ruhrgebiet saßen wiederum viele SPD-Vertreter in den Aktionsausschüssen und in der zentralen Streikleitung. So versuchte die SPD erneut wie zwischen November 1918 und Ende 1919 die Bewegung sowohl von Innen wie auch von Außen her zu sabotieren, um, sobald die Arbeiter entscheidend geschwächt waren, mit der Repression gegen sie vorzugehen.
Denn nachdem am 17. März Kapp zurückgetreten war und seine Truppen aus dem Ruhrgebiet am 20. März abzogen, und nachdem die ‘geflüchtete’ SPD-geführte Regierung um Ebert-Bauer wieder die Geschäfte übernommen hatte, konnte die Regierung und mit ihr das Militär ihre Kräfte neu gruppieren.
Wieder einmal kamen SPD und Gewerkschaften dem Kapital zu Hilfe. Sie verlangten das sofortige Ende der Kämpfe. Die Regierung stellte ein Ultimatum. Mit großer demagogischer Kunst wollten sie die Arbeiter zum Einstellen der Kämpfe bewegen. Ebert und Scheidemann riefen sofort zur Wiederaufnahme der Arbeit auf: ”Kapp und Lüttwitz sind erledigt, aber junkerliche und syndikalistische Empörung bedrohen noch immer den deutschen Volksstaat. Ihnen gilt der weitere Kampf, bis auch sie sich bedingungslos unterwerfen. Für dieses große Ziel ist die republikanische Front noch inniger und fester zu schließen. Der Generalstreik trifft bei längerer Dauer nicht nur die Hochverräter, sondern auch unsere eigene Front. Wir brauchen Kohlen und Brot zur Fortführung des Kampfes gegen die alten Mächte, deshalb Abbruch des Volksstreiks, dafür aber stets Alarmbereitschaft.”
Gleichzeitig bot die SPD politische Scheinkonzessionen an, mit deren Hilfe sie der Bewegung die Spitze brechen wollte. So versprach sie ”mehr Demokratie” in den Betrieben, einen ”entscheidenden Einfluss auf die Neuregelung der wirtschaftlichen und sozialen Gesetzgebung” und die Säuberung der Verwaltung von putschfreundlich gesinnten Kräften. Vor allem die Gewerkschaften legten sich ins Zeug, damit ein Waffenstillstand unterzeichnet wurde. Im sogenannten Bielefelder Abkommen wurden dann Konzessionen versprochen, die aber nur ein Vorwand sein konnten, um nach dem Bremsen der Bewegung um so heftiger die Repression zu organisieren
Gleichzeitig wurde wieder mit der ‘ausländischen Intervention’ gedroht. Sollte es zu einer weiteren Ausdehnung der Kämpfe kommen, würden ausländische Truppen – vor allem die USA – eingreifen. Lebensmittellieferungen aus Holland an die hungernde Bevölkerung wurden von den Militärs unterbunden.
So sollten SPD und Gewerkschaften wieder zum Drahtzieher der Repression gegen die Arbeiter werden. Dieselbe SPD, deren Minister einige Tage zuvor noch, am 13. März, zum Generalstreik gegen die Putschisten aufgerufen hatten, nahmen jetzt wieder die Zügel in die Hand für die Repression. Denn während die ‘Waffenstillstandsverhandlungen’ stattfanden, die Regierung scheinbare Konzessionen machte, war die volle Mobilisierung der Reichswehr in Absprache mit der SPD schon im Gange. So gingen viele Arbeiter von der fatalen Illusion aus, da man Regierungstruppen vor sich habe, die der ‘demokratische Staat’ der Weimarer Republik gegen die Putschisten geschickt habe, würden diese keine Kampfhandlungen gegen die Arbeiter unternehmen. So rief das Verteidigungskomitee in Berlin-Köpenick die Arbeiterwehren dazu auf, den Kampf einzustellen. Nach dem Einzug der ‘regierungstreuen Truppen’ wurden sofort Standgerichte gebildet, deren Wüten sich in nichts von dem blutrünstigen Vorgehen der Freikorps ein Jahr zuvor unterschied. Jeder, der im Besitz von Waffen war, wurde sofort erschossen. Tausende Arbeiter wurden misshandelt, gefoltert und erschossen und unzählige Frauen vergewaltigt. Man spricht von mehr als 1.000 ermordeten Arbeitern allein im Ruhrgebiet.
Es waren die Truppen des frisch gegründeten demokratischen Staates, die gegen die Arbeiterklasse geschickt wurden.
Und während die Schergen der Putschisten es nicht geschafft hatten, die Arbeiter zu Boden zu werfen, sollten dies die Henker der Demokratie bewerkstelligen.
Seit dem 1. Weltkrieg sind alle bürgerlichen Parteien reaktionär und Todfeinde der Arbeiterklasse
In der dekadenten Phase des Kapitalismus hat die Arbeiterklasse seitdem diese Erkenntnis immer wieder gewinnen müssen: Es gibt keine Fraktion der herrschenden Klasse, die weniger reaktionär oder der Arbeiterklasse gegenüber weniger feindselig eingestellt ist. Im Gegenteil: Die linken Kräfte, wie die SPD es wieder einmal unter Beweis stellen sollte, sind nur noch hinterlistiger und heimtückischer in ihren Angriffen gegen die Arbeiter.
Im dekadenten Kapitalismus gibt es keine Fraktion der Bourgeoisie, die noch irgendwie fortschrittlich und unterstützungswert wäre. Deshalb sollten die Illusionen über die Sozialdemokratie in Wirklichkeit mit dem Blut der Arbeiterklasse bezahlt werden. Bei der Niederschlagung der Bewegung gegen den Kapp-Putsch zeigte die SPD erneut ihre ganze heimtückische List, wie sie im Dienste des Kapitals handelt.
Einmal trat sie als ”radikaler Vertreter der Arbeiter” auf. Nicht nur schaffte sie es, die Arbeiter zu täuschen, sondern auch die Arbeiterparteien ließen sich durch die SPD Sand in die Augen streuen. Denn während die KPD laut und deutlich vor der SPD auf Reichsebene warnte, vorbehaltlos den bürgerlichen Charakter ihrer Politik aufzeigte, wurde sie vor Ort selber Opfer der Heimtücke der SPD. Denn in den verschiedenen Städten unterzeichnete die KPD mit der SPD Aufrufe zum Generalstreik:
In Frankfurt z.B. riefen SPD, USPD und KPD dazu auf: ”Nun gilt es den Kampf aufzunehmen, nicht zum Schutze der bürgerlichen Republik, sondern zur Aufrichtung der Macht des Proletariats. Verlaßt sofort die Betriebe und die Büros!”
In Wuppertal beschlossen die Bezirksleitungen von SPD, USPD und KPD den Aufruf: ”Der einheitliche Kampf muss geführt werden mit dem Ziel:
1. Erringung der politischen Macht durch die Diktatur des Proletariats, bis zur Festigung des Sozialismus auf der Grundlage des reinen Rätesystems.
2. Sofortige Sozialisierung der dazu reifen Wirtschaftsbetriebe.
Dieses Ziel zu erreichen, rufen die unterzeichneten Parteien (USPD, KPD, SPD) dazu auf, am Montag, den 15. März, geschlossen in den Generalstreik zu treten ...”
Die Tatsache, dass KPD und USPD die wahre Rolle der SPD hier nicht entblößten, sondern der Illusion einer möglichen Einheitsfront mit dieser Partei Vorschub leisteten, die die Arbeiterklasse verraten hatte und der soviel Blut an den Fingern wegen der von ihr organisierten Repression gegen die Arbeiter klebte, sollte für die Arbeiterklasse verheerende Auswirkungen haben.
Die SPD wiederum zog in Wirklichkeit alle Fäden der Repression gegen die Arbeiter. Sie sorgte sofort nach Rückzug der Putschisten mit Ebert an der Regierungsspitze dafür, dass die Reichswehr einen neuen Chef – von Seeckt – bekam, der sich als ausgekochter Militär einen Ruf als Henker der Arbeiterklasse verdient hatte. Mit grenzenloser Demagogie stachelte das Militär den Hass gegen die Arbeiter an: ”Während der Putschismus von rechts zerschlagen abtreten muss, erhebt der Putschismus von links aufs neue das Haupt (..). wir führen die Waffen gegen jeden Putsch.” So wurden die Arbeiter, die gegen die Putschisten gekämpft hatten, als die eigentlichen Putschisten beschimpft. ”Lasst euch nicht irremachen durch bolschewistische und spartakistische Lügen. Bleibt einig und stark. Macht Front gegen den alles vernichtenden Bolschewismus. Im Namen der Reichsregierung: von Seeckt und Schiffer.”
Das wirkliche Blutbad gegen die Arbeiter übte die Reichswehr aus, die von der SPD dirigiert wurde. Es rückte die ‘demokratische Armee’, die Reichswehr gegen die Arbeiter vor, die Kappisten hatten längst die Flucht ergriffen!
Die Schwäche der Revolutionäre – für die Arbeiterklasse fatal
Während die Arbeiterklasse sich mit großem Heldenmut dem Angriff der Militärs entgegenwarf und nach einer weiteren Orientierung für ihre Kämpfe suchte, hinkten die Revolutionäre selbst der Bewegung hinterher. So wurde das Fehlen einer starken Kommunistischen Partei zu einer der entscheidenden Ursachen des erneuten Rückschlags, den die proletarische Revolution in Deutschland erleiden sollte.
Wie wir in früheren Artikeln aufgezeigt haben, war die KPD durch den Ausschluss ihrer Opposition auf dem Heidelberger Parteitag im Oktober 1919 entscheidend geschwächt worden, und im März 1920 gab es in Berlin gerademal einige Hundert Mitglieder, die Mehrzahl der Mitglieder war ausgeschlossen worden.
Zudem lastete über der Partei das Trauma der verheerenden Fehler der Revolutionäre aus der blutigen Januarwoche 1919, als die KPD nicht geschlossen die Falle, die die Bourgeoisie für die Arbeiter aufgestellt hatte, aufdecken und die Arbeiter nicht daran hindern konnte, in diese zu laufen.
So schätzte die KPD jetzt am 13. März das Kräfteverhältnis falsch ein, denn sie meinte, es sei zu früh zum Zurückschlagen. Fest stand, dass die Arbeiterklasse gegenüber einer Offensive der Bourgeoisie nicht die Wahl des Zeitpunktes hatte, und die Abwehrbereitschaft der Arbeiter war groß. In dieser Lage war die Orientierung der Partei vollkommen richtig: ”Sofortiger Zusammentritt in allen Betrieben zur Neuwahl von Arbeiterräten. Sofortiger Zusammentritt der Räte zu Vollversammlungen, die die Leitung des Kampfes zu übernehmen und die über die nächsten Maßnahmen zu beschließen haben. Sofortiger Zusammentritt der Räte zu einem Zentralkongreß der Räte. Innerhalb der Räte werden die Kommunisten kämpfen: für die Diktatur des Proletariats, für die Räterepublik ...” (15. März 1920).
Aber nachdem die SPD nach dem 20. März die Zügel der Regierungsgeschäfte wieder in die Hand genommen hatte, erklärte die KPD-Zentrale am 21. März 1920:
”Für die weitere Eroberung der proletarischen Massen für den Kommunismus ist ein Zustand, wo die politische Freiheit unbegrenzt ausgenützt werden, wo die bürgerliche Demokratie nicht als die Diktatur des Kapitals auftreten könnte, von der größten Wichtigkeit für die Entwicklung in der Richtung zur proletarischen Diktatur.
Die KPD sieht in der Bildung einer sozialistischen Regierung unter Ausschluß von bürgerlich-kapitalistischen Parteien einen erwünschten Zustand für die Selbstbetätigung der proletarischen Massen und ihr Heranreifen für die Ausübung der proletarischen Diktatur.
Sie wird gegenüber der Regierung eine loyale Opposition treiben, solange diese Regierung die Garantien für die politische Betätigung der Arbeiterschaft gewährt, solange sie die bürgerliche Konterrevolution mit allen ihr zu Gebot stehenden Mitteln bekämpft und die soziale und organisatorische Kräftigung der Arbeiterschaft nicht hemmen wird” (21. März 1920, Zentrale der KPD).
Wenn die KPD der SPD gegenüber eine ‘loyale Opposition’ versprach, was erwartete sie von dieser? War es nicht die gleiche SPD gewesen, die während des Krieges und seit Beginn der revolutionären Welle alles unternommen hatte, um die Arbeiter zu täuschen, sie an den Staat zu binden und immer wieder kaltblütig die Repression organisiert hatte!
Indem die KPD-Zentrale diese Haltung einnahm, ließ sie sich auf das gefährlichste durch die Manöver der SPD täuschen.
Wenn die Avantgarde der Revolutionäre sich schon so irreführen ließen, war es nicht verwunderlich, dass unter den Massen der Arbeiter die Illusionen über die SPD noch größer waren!
Diese Politik der Einheitsfront ‘von unten’, die im März 1920 von der KPD-Zentrale schon praktiziert wurde, sollte dann von der Komintern Zug um Zug übernommen werden. Die KPD hatte damit einen tragischen Anfang gesetzt.
Für die aus der KPD im Oktober 1919 ausgeschlossenen Genossen sollten die Fehler der KPD-Zentrale dann der Anlass sein, nur kurze Zeit später, Anfang April 1920, in Berlin die KAPD zu gründen.
Wieder einmal hatte die Arbeiterklasse in Deutschland heldenhaft gegen das Kapital gekämpft. Während international die Kampfeswelle schon stärker abgeklungen war, hatte sich die Arbeiterklasse in Deutschland ein weiteres Mal den Angriffen des Kapitals entschlossen entgegengeworfen. Aber erneut musste die Arbeiterklasse ohne eine wirklich schlagkräftige Organisation an ihrer Seite auskommen.
Das Zögern und die politischen Fehler der Revolutionäre in Deutschland verdeutlichen, wie schwerwiegend die Unklarheit und das Versagen einer revolutionären Organisation ins Gewicht fällt.
Diese von der Bourgeoisie angezettelte Provokation nach dem Kapp-Putsch endete leider in einer neuen und schwerwiegenden Niederlage der Arbeiterklasse in Deutschland. Trotz des heldenhaften Mutes und der Entschlossenheit, mit der sich die Arbeiter in den Kampf stürzten, mussten die Arbeiter erneut ihre weiterhin bestehenden Illusionen über die SPD und die bürgerliche Demokratie teuer bezahlen. Durch die chronische Schwäche ihrer revolutionären Organisation politisch gehandikapt, durch die Politik und das heimtückische Vorgehen der Sozialdemokratie getäuscht, erlitten sie eine Niederlage und wurden schließlich nicht den Kugeln der rechtsextremen Putschisten ausgeliefert, sondern der sehr demokratischen Reichswehr, die unter dem Befehl der SPD-geführten Regierung stand.
Aber diese neue Niederlage des Proletariats in Deutschland war vor allem ein Schlag gegen die weltweite revolutionäre Welle, wodurch Sowjetrussland noch weiter in die Isolation geriet.
Dv
[i] [10] Die Frage ist bis heute ungeklärt, ob es sich nicht um eine gezielte Provokation gehandelt hat, wo es eine Absprache zwischen den Militärs und Regierung gab. Man kann keinesfalls als ausgeschlossen betrachten, dass die herrschende Klasse einen Plan hatte, um die Putschisten als provozierenden Faktor einzusetzen nach dem Konzept: die ‘Rechten’ locken die Arbeiter in die Falle, die ‘demokratische’ Diktatur schlägt dann zu!
[ii] [10] In Mitteldeutschland trat zum ersten Mal Max Hoelz in Erscheinung, der durch die Organisierung von bewaffneten Kampfverbänden der Arbeiter Polizei und Militär viele Gefechte lieferte, bei seinen Aktionen in Geschäften Waren beschlagnahmte und sie an Arbeitslose verteilte. Wir werden in einem späteren Artikel erneut auf ihn zurückkommen.
Politische Strömungen und Verweise:
- Gründung der KAPD [11]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Kapp-Putsch 1920 [13]
Erdbeben in Haiti: Der Kapitalismus, seine Staaten, seine herrschende Klasse sind nichts anderes als Mörder.
- 3147 Aufrufe
Der Kapitalismus, seine Staaten, seine herrschende Klasse sind nichts anderes als Mörder. Zehntausende Menschen sind aufgrund dieses unmenschlichen Systems ums Leben gekommen.
Dienstag, 16.53 h Ortszeit, hat ein Erdbeben der Stärke 7 auf der Richterskala Haiti erschüttert. Die Hauptstadt Port-au-Prince, eine Monsterslumstadt von ca. 2 Millionen Einwohnern, ist schlicht und ergreifend vernichtet worden. Die Bilanz ist schrecklich. Und sie verschlimmert sich noch Stunde für Stunde. Vier Tage nach der Katastrophe, an diesem Freitag, den 15. Januar, rechnete das Rote Kreuz schon mit 40.000-50.000 Toten und einer « gewaltigen Zahl Schwerverletzter ». Dem Roten Kreuz zufolge sind mindestens drei Millionen Menschen [1]direkt von dem Erdbeben betroffen. Innerhalb weniger Sekunden haben 200.000 Familien ihr « Haus » verloren, das ohnehin oft genug nur aus einer Hütte besteht. Die großen Gebäude sind ebenfalls wie Kartenhäuser zusammengebrochen. Die eh schon im schlechten Zustand sich befindlichen Straßen, der Flughafen, die alten Eisenbahnstrecken … nichts hat dem Erdbeben widerstanden.
Die Ursache dieses Gemetzels ist empörend. Haiti ist eines der ärmsten Länder der Welt.75% der Menschen überleben dort mit weniger als 2 Dollar pro Tag und 56% mit weniger als einem Dollar. Auf dieser von der Geißel des Elends erfassten Insel gab es natürlich keine Vorkehrungen gegen Erdbeben. Dabei ist Haiti ein für Erdbeben bekanntes Gebiet. All diejenigen, die heute vorgeben, dass dieses Erdbeben von außergewöhnlicher Stärke und unvorhersehbar war, lügen. Der Professor Eric Calais, der 2002 in diesem Land Geologievorlesungen hielt, unterstrich, die Insel sei von « Seismen der Größe 7.5-8 auf der Richterskala » [2]bedroht. Die politischen Behören Haitis waren auch offiziell über diese Risiken informiert worden, wie ein Auszug aus der Webseite des Bergbau- und Energieamtes (das vom Ministerium für öffentliche Arbeiten abhängt) beweist : « Hispaniola (der spanische Name für die heute in zwei Teile -Haiti und Dominikanische Republik- gespaltene Insel) wurde in jedem Jahrhundert von mindestens einem großen Erdbeben erschüttert. Port-au-Prince wurde 1751 und 1771 durch Beben zerstört, Cap Haiti wurde 1842 vernichtet, 1887 und 1904 bebte die Erde im Norden mit großen Schäden in Port de Paix und Cap Haiti, 1946 kam es im Nord-Osten der Dominikanischen Republik zu einem großen Beben, das von einem Tsunami in der Region Nagua begleitet wurde. Es hat in der Vergangenheit große Beben in Haiti gegeben, und es wird in der Zukunft innerhalb von einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten weitere neue Beben geben – das ist wissenschaftlich erwiesen. [3]». Und welche Maßnahmen wurden in Anbetracht dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse getroffen? Überhaupt keine ! Im März 2008 noch hatte eine Gruppe Geologen vor der Gefahr eines großen Bebens innerhalb der nächsten beiden Jahre gewarnt, und einige Wissenschaftler hatten gar im Mai 2008 Konferenzen mit der Regierung Haitis abgehalten[4]. Weder der haitianische Staat, noch irgendein anderer Staat, die heute Krokodilstränen vergießen und Aufrufe zur « internationalen Solidarität » starten, mit den USA und Europa an der Spitze, haben auch nur irgend eine vorbeugende Maßnahme zur Vermeidung solch eines vorhersehbaren Dramas getroffen. Die in diesem Land errichteten Gebäude sind so zerbrechlich, dass eigentlich gar nicht erst ein Erdbeben eintreten muss, um sie zum Einsturz zu bringen: „2008 schon war eine Schule in Pétionville ohne besonderen geologischen Grund eingestürzt, dabei waren 90 Kinder verschüttet worden. [5].
Jetzt ist es zu spät. Obama, Merkel & Co. mögen wohl eine « große internationale Konferenz zum Wiederaufbau und der Entwicklung des Landes » ankündigen , der chinesische, englische, französische oder spanische Staat mögen zwar alle ihre Pakete und ihre Hilfsorganisationen schicken, aber sie bleiben trotzdem Kriminelle, denen das Blut an den Fingern klebt.
Wenn Haiti heute so im Elend lebt, wenn seine Bevölkerung in solcher Armut dahinvegetiert, wenn Infrastruktur gar nicht vorhanden ist, liegt der Grund darin, dass seit mehr als 200 Jahren die örtliche und die herrschende Klasse Spaniens, Frankreichs und der USA sich um dieses Gebiet und die Kontrolle über diesen kleinen Flecken der Erde streiten. Die englische Zeitung « The Guardian » brachte diese Stimme der britischen herrschenden Klasse zum Ausdruck, die auf die zum Himmel schreiende Verantwortung der imperialistischen Rivalen hinwies : « Die noble internationale Gemeinschaft », die sich heute gegenseitig übertreffen will um Haiti « humanitäre Hilfe » zu leisten, ist zum Großteil verantwortlich für all das Leiden, das sie heute zu lindern versucht. Seit dem Tag, als die USA 1915 in das Land einmarschiert sind und es besetzt haben, wurden alle Anstrengungen durch die US-amerikanische Regierung und ihre Verbündeten gewaltsam und bewusst sabotiert. Die Regierung Aristide, die im Jahre 2004 durch einen Staatsstreich mit internationaler Rückendeckung gestürzt wurde, wurde deren letztes Opfer. Während des Staatsstreichs kamen mehrere Tausend Menschen zu Tode. […] Seit dem Putsch von 2004 regiert die internationale Gemeinschaft Haiti. Diese Länder, die jetzt um Hilfeleistungen am Krankenbett Haitis wetteifern, haben aber in den letzten fünf Jahren systematisch dagegen gestimmt, dass das UN-Mandat über sein hauptsächlich militärisches Ziel ausgedehnt wird. Die Projekte zur Verwendung eines Teils dieser « Investitionen » mit dem Zweck der Armutsbekämpfung und der Förderung der Landwirtschaft sind blockiert worden, was typisch ist für die langfristigen Tendenzen bei der Verteilung der « internationalen Hilfe ». [6]
Aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Die USA und Frankreich kämpfen seit Jahrzehnten um die Kontrolle dieser kleinen Insel mit Hilfe von Putschen, Manövern und Korruption der örtlichen Bourgeoisie, und fördern damit das Elend, die Gewalt und die bewaffneten Milizen, welche ständig Männer, Frauen und Kinder terrorisieren.
Das Medienspektakel um die « internationale Solidarität » ist unausstehlich und widerwärtig. Sie wetteifern darum, welcher Staat die größte Werbung für seine « Hilfsorganisationen », « seine Geschenke » machen kann, welche Rettungsteams die besten Bilder erheischen, wenn sie einen Überlebenden aus den Trümmern ziehen. Schlimmer noch, selbst über die Leichen und Trümmerhaufen hinweg kämpfen Frankreich und die USA noch gnadenlos um Einfluss. Im Namen der humanitären Hilfe schicken sie ihre Marine vor Ort und versuchen die Kontrolle der Hilfsoperationen an sich zu reißen unter dem Vorwand der « Notwendigkeit der Koordinierung der Hilfsleistungen durch einen Orchesterchef. » Tatsächlich reißen die USA die Führung über die Hilfsmaßnahmen gänzlich an sich und übernehmen auch die Kontrolle über das Land mittels ihres Militärs. Es geht der Obama-Administration unter anderem darum zu versuchen, das in den letzten Jahren entstandene sehr schlechte weltweite Image des US-Militärs wieder aufzupolieren, indem dessen Einsatz wieder vermehrt mit scheinbar hehren Zielen wie humanitärer Hilfe und der Rettung von Menschenleben in Verbindung gebracht wird. Damit will man nicht nur den US-Führungsanspruch in der Welt wieder unterstreichen, sondern ideologisch den Weg vorbereiten für ganz andere Militäroperationen unter US-Führung, welche vermutlich vermehrt -wie unter dem Vorläufer von G.W. Bush, Bill Clinton - im Namen von humanitären Zielen durchgeführt werden.
Wie bei jeder Katastrophe werden all die Zusagen einer langfristigen Hilfe, all die Wiederaufbauversprechungen leere Worte bleiben. In den letzten 10 Jahren beklagte man bei den jüngsten Erdbeben
· 15 000 Tote in der Türkei 1999.
· 14 000 Tote in Indien 2001.
· 26 200 Tote im Iran 2003.
· 210 000 Tote in Indonesien 2004 (das unterirdische Beben hatte den gewaltigen Tsunami ausgelöst, der selbst noch an der afrikanischen Küste Opfer forderte).
· 88 000 Tote in Pakistan 2005.
· 70 000 Tote in China 2008.
Jedes Mal hat sich die « internationale Gemeinschaft » « erschüttert » gezeigt und eine erbärmliche Hilfe geschickt ; aber nie wurden wirksame Investitionen vorgenommen, um dauerhafte Verbesserungen herbeizuführen wie z.B. erdbebensichere Gebäude zu bauen. Die humanitäre Hilfe, die wirkliche Unterstützung für die Opfer, die Prävention sind für den Kapitalismus keine rentablen Aktivitäten. Die humanitäre Hilfe, wenn sie geleistet wird, dient aber auch nur dazu, einen ideologischen Schleier zu errichten, um uns glauben zu machen, dass dieses Ausbeutungssystem menschlich sein könnte; meist aber ist sie ohnehin ein direktes Alibi zur Rechtfertigung des Einsatzes von Truppen und sie dient dazu, um Einfluss in dem jeweiligen Gebiet der Welt zu erringen.
Ein Beleg für die Heuchelei der Herrschenden und der vorgetäuschten internationalen Hilfe der Staaten ist der Beschluss des französischen Einwanderungsministers, Eric Besson, der « vorübergehend » die Ausweisungen von Illegalen aus Haiti ausgesetzt hat. Das spricht für sich selbst.
Der Horror, der über die Bevölkerung Haitis gekommen ist, ruft eine ungeheure Traurigkeit in uns hervor. Die Arbeiterklasse wird wie bei jeder dieser Katastrophen durch ihre Spendenbereitschaft reagieren. Sie wird erneut zeigen, dass ihr Herz für die Menschheit schlägt, dass ihre Solidarität keine Grenzen kennt. Aber vor allem muss dieser Horror ihre Wut und ihre Kampfbereitschaft steigern. Die wahren Verantwortlichen der unzähligen Toten in Haiti sind keine Folge eines fatalen Naturereignisses, sondern der Politik des Kapitalismus und seiner Staaten, die allesamt imperialistische Aasgeier sind.
Pawel, 15. 1.2010,
[1] Libération , https://www.liberation.fr/monde/0101613901-pres-de-50-000-morts-en-haiti... [14]
[2] Libération (https://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/01/s%C3%A9isme-en-ha%C3%A... [15]).
[3] https://www.bme.gouv.ht/alea%20sismique/Al%E9a%20et%20risque%20sismique%... [16]
[4] Científicos alertaron en 2008 sobre peligro de terremoto en Haití sur le site Yahoomexico (Assiociated Press du 15/01/2010)
[5] PressEurop (https://www.presseurop.eu/fr/content/article/169931-bien-plus-quune-cata... [17]).
[6] https://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/jan/13/our-role-in-haitis-... [18]
Aktuelles und Laufendes:
- Erdbeben in Haiti [19]
Genosse Robert ist tot
- 4793 Aufrufe
Die Gruppe Proletarische Revolution GPR aus Österreich hat uns gebeten den folgenden Nachruf auf ihren am 7. Dezember verstorbenen Genossen Robert zu veröffentlichen. Die IKS hat mit grösster Betroffenheit vom überraschenden Tod Roberts erfahren. Wir möchten seinen Nächsten, und im Besonderen seiner Lebensparternerin, unsere tiefste Solidarität ausdrücken.
Mit dem Tod von Robert hat auch die IKS einen langjährigen engen Freund verloren. Mit seiner Offenheit, seinem Drang nach politischer Klärung und seiner grossen Geduld spielte er eine wichtige Rolle in der Entstehung eines Pols von Genossen, der sich Ende der 1980er Jahre im deutschsprachigen Raum linkskommunistischen Positionen annäherte. Dies besonders in der Schweiz, wo später eine Sektion der IKS daraus entstand.
Robert hatte nicht denselben Weg eingeschlagen. Doch Robert und die anderen Genossen der GPR blieben der IKS immer nächste politische Begleiter und Freunde in die wir vollstes Vertrauen haben.
Eine der grössten Qualitäten Roberts war sein solidarisches Auftreten und seine konsequente Haltung gegen jegliche Konkurrenzgefühle unter den verschiedenen Organisationen der Kommunistischen Linken.
Die IKS vermisst Robert.
Nachruf der Gruppe Proletarische Revolution auf den Tod unseres Genossen Robert
Unser Genosse Robert ist in der Nacht vom 6. auf den 7. 12. 09 tragisch aus dem Leben geschieden. Er war einer der Gründungsmitglieder der Gruppe, die sich damals 1983 Gruppe Internationalistische Kommunisten nannte und die politische und theoretische Tradition der Autonome Gruppe Kommunistische Politik, die durch Selbstauflösung endete, fortsetzte. Die Gründungsmitglieder fanden sich in der Gemeinsamkeit zusammen, dass die politischen und theoretischen Errungenschaften der AGKP, die sich aus dem linkskapitalistischen Wirrwarr der ausklingenden 68er-Bewegung gelöst und sich linkskommunistische politische Positionen erarbeitet hatte. Den Gründungsmitgliedern schien das theoretisch-politische Rüstzeug des Linkskommunismus als die einzig mögliche politische Orientierung, wenn man sich auf den politischen Klassenboden des Proletariats stellen und die Sache des Proletariats, seine unabkömmliche politische und organisatorische Autonomie als Bedingung für zukünftig Erfolge fördern und voranbringen wollte. Nur die linkskommunistische Strömung hatte der horriblen Konterrevolution, die sich in der fast lückenlosen politischen Kontrolle über die Arbeiterklasse durch Sozialdemokratie, Stalinismus, Maoismus und der Hauptströmung des Trotzkismus ausdrückt, politisch erfolgreich getrotzt und uns die aus dieser gigantischen Konterrevolution gezogenen politischen Lehren überliefert. Genosse Ro. und Mitstreiter fühlten die Verantwortung auf ihren Schultern liegen, dass sie dafür sorgen müssten, die gegen die an vorderster Stelle stalinistische Konterrevolution von den Linkskommunisten verteidigte revolutionäre Theorie vor der Arbeiterklasse in Österreich zu vertreten und gegenüber den Arbeiterinnen und Arbeitern nach Kräften die Möglichkeit zu bieten, wieder an ihre revolutionäre Tradition anzuknüpfen. Da wir alle bloss aus dem Sympathisantenkreis der AGKP kamen, stellte sich uns die Aufgabe das ganze theoretische Rüstzeug der AGKP kritisch prüfend anzueignen und soweit es uns unzureichend schien, es mit dem aus dem Studium des Linkskommunismus gezogenen Erkenntnissen weiterzuentwickeln, um die Gruppe auf eine möglichst gefestigte politische Grundlage zu stellen. Da in den 80er Jahren massive Angriffe auf die Arbeiterklasse im Zuge der Restrukturierung der Industrie (Stichwort VÖST) stattfanden, sah sich die Gruppe vor die Aufgabe gestellt, durch politische Einmischung mittels Flugblätter usw. die dort und da aufkeimenden Kampfansätze der Arbeiterinnen und Arbeiter zu unterstützen. Die mühsame theoretische Arbeit, die Diskussionen mit dem revolutionären Milieu, die allmähliche für die Formulierung in einer Plattform herangereiften politischen Positionen betrieb Genosse Robert in vorderster Reihe. Seiner Akribie des Fragens, Nachfragens und Hinterfragens und der unnachgiebigen Suche nach Klarheit ist es zu verdanken, dass die GIK, die wegen der späteren Umbenennung heute Gruppe Proletarische Revolution heisst, eine kohärente klar auf den Errungenschaften des Marxismus und der historischen Erfahrungen des Klassenkampfes und deren Analyse beruhende Plattform hat, die wir unsere Leitlinien nennen. Robert hinterlässt die GPR, die er durch seinen unermüdlichen Einsatz massgeblich geprägt hat und deren politisches Rüstzeug er massgebend erarbeitet hat im Zustand theoretischer Festigkeit. Der Verlust durch Roberts Tod ist gewaltig. Die Gruppe verliert einen ihrer besessensten Mitarbeiter, der durch sein geschultes politisches Urteilsvermögen, seine politische Weitsicht, seine politische Erfahrung und seine unermüdlichen Untersuchungen und Analysen der politischen Ereignisse die Gruppe und ihre politische Arbeit bereichert hat. Wir hofften alle auf seine Wiederkehr nach seiner überstandenen Krankheit und freuten uns auf seine wiedergewonnene geistige Präsenz. Wir bedauern den für unsere politische Praxis folgenschweren Verlust des Genossen Robert.
Wir ersuchen die Gruppen des revolutionären Milieus der Arbeiterklasse, die Trauer über den Weggang des Genossen Robert mit uns zu teilen und uns bei der Fortsetzung unserer politischen Arbeit für die vielleicht noch in weiter Ferne liegende Befreiung der Arbeiterklasse aus ihrer ökonomischen Ausquetschung und politischen Niederhaltung durch die Bourgeoisie solidarisch zu unterstützen. Wir danken.
GPR
Geographisch:
- Österreich [20]
Leute:
- Robert [21]
Politische Strömungen und Verweise:
Kundus und die Kriegsspirale
- 2726 Aufrufe
In den letzten Wochen standen die Vorfälle von Kundus immer wieder im bundesdeutschen Rampenlicht. Nachdem durchsickerte, dass das wahre Ausmaß des Massakers von Anfang September 2009 ziemlich schnell den deutschen Einsatzkräften vor Ort bekannt wurde, über die Ereignisse auch nach Berlin an die höchsten Stellen (im unterschiedlichen Maße) berichtet wurde, der gesamte Vorfall aber von den beteiligten Stellen dann doch heruntergespielt bzw. mit allen Tricks gemauert wurde, mussten die ersten Köpfe rollen. Rücktritt des Generalinspekteurs, eines Staatssekretärs – schließlich des damaligen Verteidigungsministers Jung und nunmehr wachsender Druck auf den neu eingesetzten Verteidigungsminister, den Shooting-Star zu Guttenberg. Mittlerweile wurde – der demokratischen Zeremonie folgend - ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss zur Angelegenheit eingesetzt (der dem Militär sichtlich wohl gesonnene Verteidigungsausschuss).
Wozu all diese Aufregung?
Der Verharmlosungsversuch des Krieges scheitert…
Nachdem uns in den letzten Jahren eingetrichtert worden war, bei all den Auslandseinsätzen des deutschen Militärs gehe es nicht um eine Kriegsbeteiligung, sondern um „friedenserhaltende“, „Stabilisierungsmaßnahmen“ usw., lässt sich heute die Wirklichkeit der deutschen Kriegsbeteiligung in Afghanistan nicht mehr leugnen. Krieg ist die Entfesselung einer Vernichtungsmaschinerie –und bei nichts anderem ist auch das deutsche Militär in Afghanistan oder anderswo involviert. Man tritt dort nicht martialisch ausgerüstet auf, um mit den todbringenden Waffen in die Luft zu ballern, sondern um damit Menschen und Material zu vernichten. Es gibt keinen Krieg ohne Töten. Um zu töten, muss man gezielt schießen, versuchen, den Gegner auszuschalten, ihn mit möglichst großem Schaden treffen. All das sollte uns verheimlicht werden.
Die Geschichte des Krieges seit mehr als einem Jahrhundert zeigt, dass dabei hauptsächlich nicht Soldaten, d.h. erkennbare Truppen des Gegners auf der Strecke bleiben, sondern meist Zivilisten. Während im 19. Jahrhundert noch das Verhältnis 1:10 (ein getöteter feindlicher Soldat zu 10 Zivilisten) lautete, hat sich dieses Verhältnis genau ins Gegenteil umgekehrt: 10:1. Diese Entwicklung wiederholt sich nahezu regelmäßig in allen, im Militarismus versinkenden Gesellschaften. Ob im zerfallenden römischen Reich, das begleitet von einer Reihe von Kriegen erschöpft niederging, oder im dreißigjährigen Krieg in Deutschland 1618-48, als die Zivilbevölkerung durch den Krieg dezimiert wurde. Aber all die Anstrengungen der Herrschenden, bei den letzten Kriegen nicht offen ihre Kriegsziele zu proklamieren, sondern ihre jeweiligen Mobilisierungen unter dem Deckmantel der „humanitären“ Hilfe zu verstecken, weil die Bevölkerung sich eigentlich nicht für den Krieg einspannen lassen will, haben am Ende wenig gefruchtet.
Erzählte uns nicht „Rot-Grün“ 1998, kaum nachdem sie die Regierungsgeschäfte übernommen hatten, dass man beim Balkankrieg und der Bombardierung Serbiens „einem verbrecherischen System“ auch unter Verwendung modernster mörderischer Waffen wie z.B. Streubomben den Garaus machen müsse? Wenn nun die Bundeswehr auch in Afghanistan die Politik des „shoot-to-kill“ praktiziert, dann gehört dies vollkommen zu den Gesetzen des Krieges. Dagegen entpuppen sich diejenigen, die behaupten, dies widerspreche dem Mandat der Bundeswehr, als Vertuscher des wahren Charakters des Krieges und seiner Gesetze. Tatsache ist, keine Armee kann sich den Mechanismen des Militarismus entziehen. So kommt es, dass die Machthabenden in Deutschland und anderswo immer mehr in Bedrängnis geraten, wenn es um die Rechtfertigung der Kriegseinsätze geht.
Versprechen und Wirklichkeit…
Vor diesem Problem steht auch der Friedensnobelpreisträger, Barack Obama. War er nicht in der Wahlkampagne angetreten, um den u.a. wegen des Irakkrieges sehr unpopulär gewordenen US-Präsidenten G.W. Bush abzulösen? Hatte er nicht eine atomare Abrüstung vorgeschlagen? Aber eigentlich geht es dem Friedensnobelpreisträger nur darum, die Kräfte des US-Militärs besser zu bündeln, sie wirksamer einzusetzen. Denn schon während der Wahlkampagne hatte er die Entsendung von zusätzlichen Truppen nach Afghanistan angekündigt. Auf der bevorstehenden Afghanistankonferenz möchten die USA denn auch andere Länder zum Einsatz weiterer Truppen verpflichten – obwohl ernst zu nehmende Militärexperten eingestehen, dass der Konflikt überhaupt nicht militärisch gelöst werden kann.
Während die USA unter dem an seinem Mandatsende stark verschlissenen G.W. Bush nach 2001 in Afghanistan und im Irak ab 2003 eine Politik der Bombardierung betrieben, die nirgendwo eine Stabilisierung herbeigeführt hat, sondern die US-Politik in einen noch größeren Schlamassel hineingerissen hat, hat der „Kampf gegen den Terror“ in Pakistan nur noch einen neuen Kriegsherd eröffnet. In dem mit Atomwaffen hochgerüsteten Pakistan reißt die Attentatsserie nicht ab, die sich immer mehr gegen die Regierung und „ausländische“ Einflüsse richtet. Auch hier hinterlässt der Militarismus immer mehr verbrannte Erde – und große Flüchtlingsströme…
Wenn nun die USA in Anbetracht des missglückten Attentats auf eine US-Passagiermaschine angekündigt haben, ihren „Krieg gegen den Terror“ auch auf den Jemen auszudehnen, in dem sich der Attentäter aufgehalten haben soll, dann ziehen die USA damit nur noch ein weiteres Land in ihren Kampf zur Aufrechterhaltung ihrer Vormachtstellung. Am Ende seines Mandats wird der Friedensnobelpreisträge Obama wohl mit so viel Blut an den Fingern dastehen wie sein Vorgänger Bush…. (1)
Dabei ist die Ausdehnung der Bombardierungen auf den Jemen aber nicht irgendein sekundärer Schritt, sondern von großer Bedeutung, denn das Land liegt an der strategisch wichtigen Schiffspassage – dem Horn von Afrika und der Route zum Suez-Kanal, wo –ohnehin schon bedrängt von Piraten aus dem failed-state Somalia – ein Großteil des Weltschiffverkehrs zwischen Asien und Europa abgewickelt wird. Das Eingreifen auf jemenitisches Territorium durch US-Truppen wird sicherlich von den Rivalen argwöhnisch beobachtet werden. Inzwischen wird darüber spekuliert, dass in Washington ein Militärschlag gegen den Iran vorbereitet wird, um die Entwicklung eines Atompotenzials dieses Landes noch zu verhindern.
Die USA setzen Deutschland einen Schuss vor den Bug
In der Zwischenzeit unterlassen die USA aber keine Gelegenheit, dem deutschen Rivalen eins vor den Bug zu schießen. Denn wenn die ISAF in ihrem Bericht die Politik des Bundeswehrkommandos hinsichtlich des Vorfalls von Kundus kritisierte, dann geschieht dies nicht ohne die direkte „Zuarbeit“ der USA, welche im Auftrag der Bundeswehr die Bombardierung bei Kundus ausgeführt haben, und somit bestens in der Lage sind, die deutschen Medien mit Enthüllungen darüber zu versorgen. So ruft die verbleibende Supermacht USA den herrschenden Politikern wie in Deutschland in Erinnerung, dass sie immer noch in der Lage sind, aussichtsreiche Politikerkarrieren scheitern zu lassen und jede x-beliebige Regierung der Welt innenpolitisch unter Druck zu setzen.
(1) In Kolumbien, wo die USA den Kampf gegen die Drogenbarone auch und vor allem mit militärischen Mitteln führen, wurden 2009 über 15.000 Menschen getötet, davon gingen allein 6.000 auf das Konto von Killerkommandos. Die US-Strategie, mit Waffengewalt für „Befriedung“ und „Sicherheit“ sorgen zu wollen, verschlimmert die Spirale der Gewalt nur noch mehr.
Aktuelles und Laufendes:
- Kundus [23]
- Guttenberg Afghanistan [24]
- Anschläge Jemen [25]
- Konflikt USA Iran [26]
Save the planet? No, they can't!
- 3317 Aufrufe
"Kopenhagen-Gipfel gescheitert" (Guardian, England), "Fiasko in Kopenhagen", "Groteskes Ergebnis", "Schlimmer als unnütz" (Financial Times, England), "Ein nutzloser Gipfel" (The Asian Age, Indien), "Kalte Dusche", "Das schlechteste Abkommen der Geschichte" (Libération, Frankreich). Die internationale Presse ist also fast einhelliger Meinung. 1 Dieser als historisch angekündigte Gipfel ist zu einer wahren Katastrophe geworden. Am Ende haben die Teilnehmerstaaten einer Reihe von vagen Zielen zugestimmt, die niemanden zu irgendetwas verpflichten. Die Erderwärmung auf unter 2°C bis 2050 reduzieren. "Das Scheitern des Kopenhagener Gipfels ist schlimmer als alles befürchtete", meinte Herton Escobar, der Wissenschaftsexperte der Zeitung O Estado De São Paulo (Brasilien). "Das größte diplomatische Ereignis der Geschichte hat zu überhaupt keiner Verpflichtung geführt." 2 Wer auch immer an ein Wunder geglaubt hatte, an die Geburt eines grünen Kapitalismus, wird jetzt damit konfrontiert, dass die Illusionen dahinschmelzen, genau wie das Eis in der Arktis und Antarktis.
Ein internationaler Gipfel zur Beruhigung der Ängste
Dem Kopenhagener Gipfel ging eine gewaltige, ohrenbetäubende internationale Medienkampagne voraus. Alle Fernsehkanäle, alle Zeitungen, alle Zeitschriften haben dieses Ereignis zu einem historischen Augenblick hochstilisiert. Eine Vielzahl von Beispielen zeigt das auf. Schon am 5. Juni 2009 wurde der Dokumentarfilm von Yann Arthus Bertrand, Home, der eine dramatische und schonungslose Bestandaufnahme des Ausmaßes der weltweiten Ökokatastrophe erstellt, gleichzeitig und kostenlos in 70 Ländern ausgestrahlt (im Fernsehen, im Internet, in den Kinos).
Hunderte Intellektuelle und Umweltverbände haben hochtrabende Erklärungen veröffentlicht, um "das Bewusstsein wachzurütteln" und "einen Druck der Bürger auf die Entscheidungsträger auszuüben". In Frankreich hat die Stiftung Nicolas Hulot von einer Art Ultimatum gesprochen: "Die Zukunft des Planeten und mit ihr das Schicksal von Milliarden Hungernder wird in Kopenhagen entschieden. Wir müssen wählen zwischen Solidarität oder Chaos, die Menschheit muss ihr Schicksal in die Hand nehmen". In den USA die gleiche dringliche, warnende Botschaft: "Die Staaten der Welt versammeln sich in Kopenhagen vom 7.-18. Dezember 2009 zu einer Klimakonferenz, die als ein Gipfel der letzten Chance angesehen wird. Entweder wird sie zu einem Erfolg, oder alles bricht zusammen, wörtlich genommen – schwimm oder geh unter. Man kann behaupten, dass es sich um das wichtigste Diplomatentreffen der Geschichte der Welt handelt." (Bill McKibben, Schriftsteller und amerikanischer Umweltaktivist, in Mother Jones) 3
Zu Beginn des Gipfels veröffentlichten 56 Zeitungen aus 44 Ländern – in einer bislang noch nie dagewesenen Initiative in ein und demselben Editorial einen Aufruf. „Der Klimawandel wird unseren Planeten und damit auch Wohlstand und Sicherheit zerstören, falls wir uns nicht auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.[…] Der Klimawandel ist über Jahrhunderte hinweg verursacht worden, seine Folgen werden weitere Jahrhunderte andauern. Lässt er sich zähmen? Das wird sich in den kommenden zwei Wochen entscheiden. Wir appellieren an die Vertreter der 192 Staaten in Kopenhagen, nicht zu zögern, nicht im Streit auseinanderzugehen und sich nicht gegenseitig die Schuld zuzuschieben […] Der Klimawandel betrifft alle, die Strategien dagegen müssen von allen getragen werden. 4
All diese Reden enthalten eine Halbwahrheit. Forschungsergebnisse belegen, dass der Planet dabei ist zerstört zu werden. Die Erderwärmung schreitet voran und damit auch der Vormarsch der Wüsten, Wirbelstürme, Brände… Die Verschmutzung und die intensive Ausbeutung der Ressourcen führen zu einem gewaltigen Artensterben. Es wird erwartet, dass 15-37% der Arten bis 2050 ausgestorben sein werden. Heute steht eins von vier Säugetieren, einer von acht Vögeln, ein Drittel der Amphibien und 70% der Pflanzen vor dem Aussterben 5. Prognosen des Weltforums zufolge wird der „Klimawandel“ für ca. 300.000 Menschen pro Jahr den Tod bedeuten (darunter wird die Hälfte an Unterernährung sterben). 2050 rechnet man mit ca. „250 Millionen Klimaflüchtlingen“ 6. Ja, die Sache wird dringlich. Ja, die Menschheit steht vor einer Schicksalsfrage, ja es geht ums Überleben!.
Aber die andere Hälfte der Botschaft ist eine riesige Lüge, die dazu dient der Arbeiterklasse auf der ganzen Welt Illusionen einzuflößen. Alle riefen sie die Regierung zu einem verantwortlichen Handeln und zur internationalen Solidarität gegenüber den „Klimagefahren“ auf. Als ob die Staaten ihre eigenen nationalen Interessen vergessen oder überwinden und sich zusammenschließen, zusammenarbeiten und im Interesse der Menschheit gegenseitig helfen könnten. All dies sind nur Märchengeschichten, die dazu dienen, eine Arbeiterklasse zu beruhigen, die sich Sorgen macht, dass die Erde schrittweise zerstört wird und Hunderte Millionen Menschen darunter leiden werden 7. Die Umweltkatastrophe führt deutlich vor Augen, dass nur eine internationale Lösung ins Auge gefasst werden kann. Um zu verhindern, dass die Arbeiter zu viel nachdenken und sich auf die Suche nach einer „Lösung“ begeben, haben die Herrschenden unter Beweis stellen wollen, dass sie dazu in der Lage wären, ihre nationalen Spaltungen zu überwinden, oder wie das internationale Editorial der 56 Zeitungen erklärte, „nicht im Streit auseinanderzugehen und sich nicht gegenseitig die Schuld zuzuschieben“ und „Der Klimawandel betrifft alle, die Strategien dagegen müssen von allen getragen werden.“
Das Geringste, was man sagen kann, ist dass dieses Ziel völlig verfehlt wurde. Wenn Kopenhagen etwas gezeigt hat, dann dass der Kapitalismus nur eine Dreckschleuder ist und sein kann.
Man durfte keine Illusionen haben; aus diesem Gipfel konnte nichts Gutes hervorgehen. Der Kapitalismus zerstört seit jeher die Umwelt. Schon im 19. Jahrhundert war London eine gewaltige Fabrik, die mit Rauch die Luft verpestete und ihren Müll in die Themse schmiss. Dieses System produziert einzig mit dem Ziel, mit allen möglichen Mitteln Profit zu erwirtschaften und Kapital anzuhäufen. Egal, wenn es dazu Wälder abholzen, die Meere plündern, Flüsse verschmutzen, das Klima durcheinander bringen muss….
Kapitalismus und Ökologie stehen sich notwendigerweise unversöhnlich gegenüber. All die internationalen Treffen, die Komitees, Gipfel (wie der von Rio de Janeiro 1992 oder der von Kyoto 1997) waren immer nur Masken, in den Medien aufgebauschte Inszenierungen, um uns glauben zu machen, dass die „Großen dieser Welt“ sich Gedanken machen über die Zukunft des Planeten. All die Nicolas Hulot, Yann Arthus Bertrand, Bill McKibben und andere wie Al Gore 8 wollten uns glauben machen, dass es dieses Mal anders werden würde, und dass sich in Anbetracht der Dringlichkeit der Lage die großen Führer der Welt „zusammenreißen“ würden. Während all diese Ideologen nur heiße Luft verbreiten, zogen dieselben „Führer“ ihre ökonomischen Waffen. Denn so sieht die Wirklichkeit aus: der Kapitalismus ist in Nationen gespalten, alle konkurrieren miteinander, stehen immerfort im Handelskrieg miteinander, und wenn nötig auch in militärischen Kriegen.
Nur ein Beispiel. Der Nordpol ist dabei zu schmelzen. Die Wissenschaftlicher sehen eine wahre Ökokatastrophe heraufziehen: der Meeresspiegel wird ansteigen, der Salzgehalt zunehmen, die Meeressströmungen werden verändert, die Infrastrukturen destabilisiert und die Küsten leiden unter Erosionen aufgrund des Schmelzens des Permafrosts, Freisetzung von CO2 und Methan aus den Permafrostböden, Zerstörung der arktischen Ökosysteme…9 Die Staaten dagegen sehen darin eine große Gelegenheit neue, bislang unzugänglich gebliebene Ressourcen auszubeuten und neue, eisfreie Schifffahrtswege zu gewinnen. Russland, Kanada, die USA, Dänemark (über Grönland) führen gegenwärtig einen gnadenlosen diplomatischen Krieg und zögern nicht, zum Zweck der militärischen Einschüchterung mit Waffen zu drohen. So „beteiligten sich letzten August ungefähr 700 kanadische Soldaten aus den drei Bereichen Heer, Marine und Luftwaffe an der kanadischen Operation NANOOK 09. Das militärische Manöver versucht zu beweisen, dass Kanada in der Lage ist, in der Arktis, auf die auch die USA, Dänemark und vor allem Russland Ansprüche erheben, seine Souveränität sicherzustellen. Russland hat in der jüngsten Zeit Ottawa irritiert, nachdem es Flugzeuge und U-Boote in die Arktis geschickt hat“. 10. In der Tat schickt Russland seit 2007 regelmäßig Jagdflugzeuge in den Luftraum über der Arktis und auch manchmal über kanadische Gewässer wie zur Zeit des Kalten Krieges.
Kapitalismus und Ökologie stehen sich immer diametral gegenüber
Den Herrschenden gelingt es nicht mehr den Schein zu bewahren
„Das Scheitern von Kopenhagen“ ist deshalb alles andere als eine Überraschung. Wir hatten dies schon in unserer letzten „Internationalen Revue“ (3. Quartal 2009) vorhergesehen: „Der Weltkapitalismus ist völlig unfähig um gegen die Gefahren der Umweltzerstörung gemeinsam anzutreten. Insbesondere in der Zeit seines gesellschaftlichen Zerfalls mit der wachsenden Tendenz, dass jede Nation im Konkurrenzkampf aller gegen alle auf internationaler Ebene ihre eigenen Karten spielt, ist solch eine Zusammenarbeit unmöglich.“ Es ist dagegen überraschender, dass all diese Staatschefs es nicht einmal geschafft haben, den Schein zu bewahren. Normalerweise wird am Schluss ein Abkommen mit großem Prunk unterzeichnet, wobei vorgetäuschte Ziele präsentiert werden, und solche Abkommen werden dann von allen begrüßt. Diesesmal wurde der Gipfel offiziell als „historisch gescheitert“ erklärt. Die Spannungen und das Geschacher konnten nicht mehr verborgen werden; sie sind groß auf der Bühne ausgebreitet worden. Selbst das traditionelle Gruppenphoto mit den Staatschefs, bei dem sie sich beglückwünschen und umarmen und immer eifrig in die Kameras lächeln, wurde nicht mal aufgenommen. Allein das spricht schon Bände!
Dieses Eingeständnis ist so offenkundig, lächerlich und beschämend, dass die Herrschenden ein niedriges Profil wahren. Dem Lärm um die Vorbereitungen des Kopenhagener Gipfels folgte ein ebenso betretenes Schweigen. So begnügten sich die Medien nach dem Gipfel mit einigen diskreten Zeilen der „Bilanz“ des Scheiterns (wobei übrigens systematisch der eine dem andere in die Schuhe schob), und man vermied in den darauf folgenden Tagen sorgfältig, auf diese schmutzige Angelegenheit zurückzukommen.
Warum haben die Staatschefs im Gegensatz zu früher nicht einmal mehr den Schein bewahren können? Die Antwort lautet: die Wirtschaftskrise. Im Gegensatz zu allem, was überall auf der Welt behauptet wird, treibt die schwere Wirtschaftskrise die Staatschefs nicht dazu, die „ausgezeichnete Gelegenheit“ zu ergreifen, um die ganze Welt in das „Abenteuer der green economy“ zu stürzen. Im Gegenteil, die Brutalität der Krise verschärft die Spannungen und die internationale Konkurrenz. Der Kopenhagener Gipfel hat bewiesen, dass sich die Großmächte einen gnadenlosen Kampf gegeneinander führen. Die Zeit ist vorbei, als sie vortäuschen konnten, dass sie sich gut verstehen und Abkommen (auch wenn sie verlogen sind) präsentieren. Sie haben die Messer gezogen, Pech gehabt, wenn das alles in den Medien verfolgt wurde.
Seit dem Sommer 2007 und dem Absturz der Weltwirtschaft in die tiefste Rezession der Geschichte des Kapitalismus, gibt es eine wachsende Versuchung, den Verlockungen des Protektionismus zu verfallen und eine zunehmende Tendenz des Jeder für sich. Natürlich ist der Kapitalismus aufgrund seiner Grundeigenschaften immer in Nationen gespalten, die sich einen gnadenlosen Konkurrenzkampf liefern. Aber der Krach von 1929 und die Krise der 1930er Jahre hatten den Herrschenden vor Augen geführt, wie gefährlich es war, wenn es überhaupt keine Regeln und internationale Absprachen im Welthandel gibt. Insbesondere nach dem 2. Weltkrieg hatte man im Ostblock und im westlichen Block organisatorische Maßnahmen ergriffen und ein Mindestmaß an Gesetzen verabschiedet, um die Wirtschaftsbeziehungen untereinander zu regeln. Überall wurde zum Beispiel der grenzenlose Protektionismus verboten, nachdem man ihn als einen schädlichen Faktor für den Welthandel und damit auch für alle Länder erkannt hatte. Die großen Abkommen (wie das von Bretton Woods 1944) und die Institutionen, welche die Einhaltung der neuen Regeln überwachen sollten (wie der Internationale Währungsfond), haben in der Tat dazu beigetragen, die wirtschaftliche Verlangsamung des kapitalistischen Wachstums seit 1967 abzufedern.
Aber die Tragweite der gegenwärtigen Krise hat all diese Regeln der Funktionsweise über Bord geworfen. Die Herrschenden haben gleichwohl versucht, gemeinsam und vereint vorzugehen, als sie z.B. den berühmten G 20 von Pittsburgh und von London organisiert haben, aber die Tendenz des Jeder für sich hat jeden Monat mehr an Boden gewonnen. Die Ankurbelungspläne werden immer weniger miteinander unter den Staaten abgesprochen und der Wirtschaftskrieg wird immer aggressiver. Der Kopenhagener Gipfel bestätigte diese Tendenz ganz deutlich.
Man muss unterstreichen, dass im Gegensatz zu einem angeblichen “Ende der Durststrecke” und einem bevorstehenden Wiederaufschwung der Weltwirtschaft die Rezession sich in Wirklichkeit immer weiter verschärft und sich sogar Ende 2009 weiter beschleunigt hat. „Dubai – Pleite des Emirs“, „Griechenland am Rande des Bankrotts“ (Libération, 27.11., 9.12.). 11 Diese Meldungen wirkten wie ein Blitz. Jeder Staat spürt, dass seine Wirtschaft in Gefahr ist und ist sich dessen bewusst, dass wir vor einer immer tieferen Rezession stehen. Um zu verhindern, dass die kapitalistische Wirtschaft zu schnell in einer Depression versinkt, haben die Herrschenden seit dem Sommer 2007 keine andere Wahl als massenhaft Geld zu drucken und in die Wirtschaft zu pumpen, womit die öffentliche und Staatsverschuldung nur weiter angeheizt wird. Die Bank Société Générale hat im November 2009 in einem Bericht darauf hingewiesen: „Das Schlimmste steht uns noch bevor“. Dieser Bank zufolge „haben die jüngsten Rettungspakete der Regierungen auf der Welt einfach den Schuldenberg der Privathaushalte auf die öffentlichen Haushalte übertragen, wodurch nur eine neue Reihe von Problemen entstanden ist. Das erste sind die Defizite. […] Das gegenwärtige Verschuldungsniveau kann langfristig nicht aufrechterhalten werden. Wir haben praktisch einen Punkt der öffentlichen Verschuldung erreicht, wo es kein zurück mehr gibt.“ 12. Die globale Verschuldung ist in den meisten hochentwickelten Staaten viel zu groß geworden im Verhältnis zum BIP. In den USA und in der Europäischen Union werden die Schulden in zwei Jahren auf 125% des BIP angewachsen sein. In Großbritannien werden sie 105% betragen, in Japan 270%. Und die Bank Société Générale ist nicht die einzige Bank, die die Alarmglocke läutet. Im März 2009 hatte die Crédit Suisse eine Liste der 10 am stärksten vom Bankrott gefährdeten Länder erstellt, indem man den Umfang der Verschuldung und das BIP verglich. Im Augenblick hat diese Liste der „Top 10“ den Nagel auf den Kopf getroffen; sie lautet: Island, Bulgarien, Litauen, Estland, Griechenland, Spanien, Lettland, Rumänien, Großbritannien, USA, Irland, Ungarn. 13 Ein anderes Zeichen der Sorgen auf den Finanzmärkten ist eine neu aufgekommene Abkürzung: PIGS. „Heute sind es die PIGS: Portugal, Italien, Griechenland, Spanien, die die Welt erschüttern. Nach Island und Dubai betrachtet man diese vier Länder der Eurozone als mögliche Zeitbomben der Weltwirtschaft.“ 14.
In Wirklichkeit werden alle Staaten aufgrund ihrer phänomenalen Defizite eine rigorose Sparpolitik betreiben müssen. Konkret heißt dies, dass sie:
- die Steuern erhöhen werden
- die Ausgaben noch drastischer kürzen werden, und dabei unzählige Arbeitsplätze streichen und eine Vielzahl von Kürzungen vornehmen werden bei Renten, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und medizinischer Versorgung.
- Natürlich eine immer aggressivere, rücksichtslose Politik auf dem Weltmarkt betreiben müssen.
Diese katastrophale Wirtschaftslage verschärft natürlich den Konkurrenzkampf. Jeder Staat sträubt sich heute davor, irgendwelche Konzessionen zu machen; jeder Staat führt einen Überlebenskampf seiner Volkswirtschaft gegen die anderen Rivalen. Diese Spannung, dieser Wirtschaftskrieg wurden in Kopenhagen greifbar.
Die ökologischen Quoten als ökonomische Waffe
In Kopenhagen sind die Staaten zusammengekommen, nicht um den Planeten zu retten, sondern um sich mit Händen und Füßen zu wehren. Ihr Ziel bestand einzig darin, die Frage des Umweltschutzes zu verwenden, um damit Maßnahmen zu ihren Gunsten durchzusetzen, und die vor allem anderen Schaden zufügen.
Die USA und China werden von den meisten Ländern beschuldigt für das Scheitern hauptsächlich verantwortlich zu sein. Diese beiden Länder haben sich in der Tat gegen eine Zielvereinbarung einer CO2-Reduzierung ausgesprochen, das als Hauptverantwortlicher des Treibhauseffektes gilt. Die beiden größten Umweltverschmutzer hatten natürlich auf dieser Ebene auch am meisten zu verlieren.15 "Wenn die Ziele der Expertengruppe des Climate Change 16 verfolgt werden (d.h. eine CO2-Reduzierung um 40% bis 2050), darf jeder Erdenbürger nur noch maximal 1,7 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen. Aber im Durchschnitt produziert jeder US-Amerikaner pro Jahr 20 Tonnen! 17 Und die chinesische Wirtschaft funktioniert heute hauptsächlich dank der Energiezufuhr von Kohlekraftwerken, die insgesamt 20% der weltweiten CO2-Emissionen verursachen. Das entspricht mehr als dem Ausstoß des gesamten Verkehrs, (Autos, LKW, Züge, Schiffe und Flugzeuge zusammengenommen)." 18. Man kann verstehen, warum all die anderen Länder so darauf erpicht waren, "Zahlenwerte" bei der CO2-Reduzierung vorzuschreiben.
Aber man darf dennoch nicht glauben, dass die USA und China irgendwie gemeine Sache gemacht hätten. Das Reich der Mitte hat nämlich ebenso eine CO2-Reduzierung von 40% bis 2050 gefordert, und zwar für die USA und Europa. Und China sollte natürlich als "Schwellenland" davon ausgespart bleiben. "Die Schwellenländer, insbesondere Indien, China, forderten von den reichen Ländern ein starkes Engagement zur Reduzierung der Treibhausgase, aber sie weigerten sich, sich irgendwelchen Einschränkungen zu unterwerfen." 19
Indien hat ungefähr die gleiche Strategie eingeschlagen, eine Reduzierung für die anderen einzufordern, aber von sich selbst keine zu erwarten. Es rechtfertigte seine Haltung damit, dass "Hunderte Millionen Arme im Land leben und das Land könne keine zusätzlichen Belastungen vertragen." Die "Schwellenländer" oder in "der Entwicklung befindlichen Länder" werden oft in der Presse als die ersten Opfer des Fiaskos von Kopenhagen dargestellt. Diese zögerten in Wirklichkeit nicht davor zurück, die Armut ihrer Bevölkerung für die Verteidigung ihrer bürgerlichen Interessen zu instrumentalisieren. Der Delegierte Sudans, der Afrika vertrat, verglich die Lage gar mit dem Holocaust: "Diese Lösung stützt sich auf die Werte, die sechs Millionen Menschen in die Krematorien in Europa geschickt haben." 20 Diese Führer, die ihre Bevölkerungen Hunger leiden lassen und auch ab und zu Massaker ausüben, wagen heute schamlos an deren "Unglück" zu erinnern. Im Sudan zum Beispiel sterben die Menschen schon heute durch Waffengewalt und nicht erst durch die zukünftigen Klimafolgen.
Und wie hat Europa, das die tugendhafte Dame spielt, die "Zukunft des Planeten" verteidigt? Schauen wir uns einige Beispiele an. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat eine lautstarke Erklärung am vorletzten Tag des Gipfels abgegeben. "Wenn wir so weitermachen, wird der Gipfel scheitern. […] Wir müssen alle Kompromisse eingehen. […] Europa und die reichen Länder müssen anerkennen, dass sie eine größere Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen uns mehr engagieren. […] Wer würde wagen zu behaupten, dass Afrika und die ärmeren Länder kein Geld brauchen?[…] Wer würde wagen zu sagen, dass man keine Organisation braucht, um die Umsetzung der Verpflichtungen der einzelnen Länder zu überprüfen?" 21 Hinter diesen großen Worten verbirgt sich eine ganz andere Wirklichkeit. Der französische Staat und Nicolas Sarkozy haben sich für eine Senkung der CO2-Emissionen eingesetzt, damit Atomkraft, eine lebenswichtige Ressource für die französische Wirtschaft, in keinster Weise begrenzt werde! Aber von dieser Energie geht eine große Gefahr aus, die wie ein Damoklesschwert über der Menschheit hängt. Der Unfall in Tschernobyl hinterließ den Schätzungen zufolge zwischen 4.000 und 200.000 Tote – je nachdem, ob man die Krebstoten infolge der Verstrahlungen berücksichtigt oder nicht. Mit der Wirtschaftskrise werden die Staaten in der Zukunft viel weniger Mittel haben, AKWs zu unterhalten; die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Störfällen in AKWs wird zunehmen. Dabei wirkt Atomstrom heute schon als großer Umweltverschmutzer. Der französische Staat will glauben machen, die radioaktiven Abfälle würden "sauber" in La Hague entsorgt. In Wirklichkeit werden aus Kostenersparnisgründen radioaktive Abfälle heimlich nach Russland verschickt. "Ca. 13% unserer nuklearen Abfälle schlummern irgendwo auf sibirischem Boden. Insbesondere im atomaren Komplex Tomsk-7, eine geheime Stadt mit 30.000 Einwohnern, wo man Journalisten den Zutritt versagt hat. Dort werden seit Mitte der 1990er Jahre 108 Tonnen abgereichertes Uran aus französischen AKWs in Containern auf einem großen Parkplatz bei offenen Himmel gelagert." 22. Ein anderes Beispiel. Skandinavische Staaten brüsten sich an der Spitze der Umweltschützer zu stehen; sie stellen sich gerne als kleine Modelle dar. Aber wenn es um den Kampf gegen die Rodung der Wälder geht, "blockieren Schweden, Finnland aber auch Österreich, damit auf dieser Ebene nichts geschieht". 23. Der Grund: ihre Energieproduktion hängt sehr stark von Holz ab, zudem sind sie große Papierexporteure. Deshalb standen in Kopenhagen Schweden, Finnland und Österreich Seite an Seite mit China, das als der Welt führender Möbelhersteller aus Holz auch keine Begrenzung der Rodung der Wälder zulassen wollte. Dabei geht es keineswegs um ein Ideal. "Die Entwaldung ist verantwortlich für ein Fünftel der weltweiten CO2 Emissionen." 24 und "die Zerstörung von Wäldern belastet die Klimabilanz sehr […] Ungefähr 13 Millionen Hektar Wald werden jedes Jahr gefällt, d.h. soviel wie die Fläche Englands, dadurch sind Indonesien und Brasilien zum dritt- und viertgrößten CO2- Emittenten der Welt geworden." 25. Diese drei europäischen Länder, die sich als lebendiger Beweis dafür ausgeben, dass die kapitalistische Wirtschaft mit Ökologie vereinbar ist, "erhielten am ersten Tag der Verhandlungen den Preis der „Fossilien des Tages“ 26, weil sie sich weigern, ihre Verantwortung bei der Neuaufforstung der Waldböden anzuerkennen." 27
Ein Land verkörpert schon ganz alleine den Zynismus der Herrschenden hinsichtlich der Frage der Ökologie. Seit Monaten verkündete Russland lauthals, dass es für eine zahlenmäßige Festlegung auf eine CO2-Reduzierung sei. Diese Position mag als überraschend erscheinen, wenn man das Wesen des russischen Staates kennt. Sibirien ist radioaktiv verseucht. Seine Atomwaffen (Bomben, U-Boote usw.…) verrosten auf "Friedhöfen". Hätte nun der russische Staat Gewissensbisse bekommen? „Russland stellt sich als Modellnation hinsichtlich der CO2-Emissionen dar. Aber das ist nur ein Taschenspielertrick. Im November verpflichtete sich der russische Präsident Dimitri Medvedev zu einer Reduzierung der russischen Emissionen um 20% bis 2020 (auf der Grundlage der Ausgangswerte von 1990) 28, d.h. mehr als die EU. Aber dadurch entsteht keine wirkliche Verpflichtung, denn tatsächlich sind die russischen Emissionen schon seit 1990 um ….33% gesunken, weil das russische BSP nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ebenfalls zusammengebrochen ist. In Wirklichkeit versucht nämlich Moskau in der Zukunft mehr CO2 auszustoßen, um sein Wachstum nicht zu bremsen (falls es wieder ansteigt…) Die anderen Länder werden solch eine Haltung nicht leicht übernehmen." 29".
Der Kapitalismus wird niemals "grün" werden. Morgen wird die Wirtschaftskrise uns noch härter treffen. Das Schicksal des Planeten ist die letzte Sorge der Herrschenden. Sie wird nur nach einem streben: Ihre eigenen nationalen Interessen fördern. Dabei wird es zu mehr und mehr Zusammenstößen zwischen den Ländern kommen, unrentable Betriebe werden geschlossen oder man lässt sie einfach herunterkommen, die Produktionskosten werden gesenkt, die Sicherheit und Wartung der Betriebe und der Energieerzeuger (Atomkraft – und Kohlekraftwerke) wird eingeschränkt. All dies bedeutet mehr Verschmutzung und Unfälle in der Industrie. Das ist die Zukunft im Kapitalismus – eine sich zuspitzende Wirtschaftskrise, eine verrottende und umweltverschmutzende Infrastruktur und ein immer größeres Leiden für die Menschheit.
Es ist Zeit, dass wir den Kapitalismus überwinden, bevor er den Planeten zerstört und die Menschheit dezimiert.
Pawel, 6.1.2010.
(aus Platzgründen haben wir hier die Fußnoten nicht mit aufgeführt. Sie sind auf unserer Webseite zugänglich).
1 Nur amerikanische und chinesische Journalisten sprachen von einem "Erfolg", "einem Schritt vorwärts“. Wir werden später erklären, warum das der Fall war.
2 www.estadao.com.br/estadaodehoje/20091220/not_imp484972,0.php [27]
3 https://www.courrierinternational.com/article/2009/11/19/un-sommet-plus-important-que-yalta [28]
4 https://www.courrierinternational.com/article/2009/12/07/les-quotidiens-manifestent-pour-la-planete [29]
5 https://www.planetoscope.com/biodiversite [30]
6 www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-rechauffement-climatique-vers-30000-morts-an-chine-2-c-19468 [31]
7 Man kann nicht ausschließen, dass ein großer Teil der Intellektuellen und Verantwortlichen der Umweltverbände selbst an die Geschichten glaubt, die sie erfinden. Dies ist ziemlich wahrscheinlich der Fall.
8 Er erhielt den Friedensnobelpreis für seinen Kampf gegen die Klimaerwärmung mit einem Dokumentarfilm "Eine unbequeme Wahrheit".
9 m.futura-sciences.com/2729/show/f9e437f24d9923a2daf961f70ed44366&t=5a46cb8766f59dee2844ab2c06af8e74
10 ici.radio-canada.ca/nouvelle/444446/harper-exercice-nord [32]
11 Die Liste müsste fortgesetzt werden, denn seit Ende 2008, Anfang 2009 wurden Island, Bulgarien, Litauen und Estland schon als "insolvente Staaten" eingestuft.
12 Bericht [33] – von Telegraph (englische Zeitung) am 18. November 2009 veröffentlicht worden.
13 Quelle : weinstein-forcastinvest.net/apres-la-grece-le-top-10-des-faillites-a-venir
14 Le nouvel Observateur, französisches Zeitschrift, 3. – 9. Dezember.
15 Deshalb der Siegesschrei der amerikanischen und chinesischen Presse (in unserer Einführung hervorgehoben), für die das Nichtzustandekommen eines Vertrages "ein Schritt nach vorne" darstellt.
16 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)
17 Le nouvel Observateur, 3. -9. 12.2009, Sondernummer Kopenhagen.
18 Idem.
19 www.rue89.com/planete89/2009/12/19/les-cinq-raisons-de-lechec-du-sommet-... [34]
20 Les Echos 19-12-2009.
21 Le Monde 17-12-2009.
22 "Nos déchets nucléaires sont cachés en Sibérie", Libération du 12 octobre 2009.
23 Euronews 15-12-2009 (fr.euronews.net/2009/12/15/copenhague-les-emissions-liees-a-la-deforestation-font-debat)
24 www.rtl.be/info/monde/international/wwf-l-europe-toujours-faible-dans-la-lutte-contre-la-deforestation-143082.aspx [35]
25 La Tribune (quotidien français) du 19 décembre 2009.
26 Dieser Preis wird von einer Gruppe von 500 NGO verliehen, die Einzelpersönlichkeiten oder Staaten "würdigen", die euphemistisch gesagt, "die Entscheidungen im Kampf gegen die Erderwärmung hinauszögern". Auf dem Kopenhagener Gipfel konnte allen Ländern der Preis des "Fossil of the Day [36].verliehen werden.
27 Le Soir (belgische Tageszeitung) 10-12- 2009.
28 1990 ist das Referenzjahr für alle Treibhausgasemissionen für alle Länder seit dem Kyoto-Protokoll
29 Le nouvel Observateur 3.- 9.12.2009.
Aktuelles und Laufendes:
- Ökologie [37]
- Kopenhagen Klimagipfel [38]
- Kapitalismus Ökologie [39]
- Ökologie Ökonomie [40]
Weltrevolution Nr. 159
- 2462 Aufrufe
20 Jahre „Deutsche Einheit“ - Die Kosten der ‚Wiedervereinigung‘, Teil 2
- 5636 Aufrufe
Bis heute hat sich noch jede Bundesregierung, die seit der Wiedervereinigung amtierte, geweigert, konkrete Angaben über die tatsächlichen Kosten der ‚Wiedervereinigung‘ zu machen. „Alle Bundesregierungen haben versucht, die Kosten der Vereinigung zu verschleiern, wohl um eine Neiddebatte zu verhindern“, schrieb bereits vor fünf Jahren der Leiter des Forschungsverbundes SED-Staat an der Freien Universität von Berlin, Klaus Schroeder, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es wäre wirklich eine noble Geste, wenn es den Herrschenden nur darum ginge, den Graben zwischen Ost und West, den sie selbst gegraben haben, nicht noch weiter zu vertiefen. Viel naheliegender ist jedoch das Motiv, mit der Verschleierung der Einheitskosten das ganze Ausmaß des Fiaskos der Wiedervereinigung auf ökonomischer Ebene zu verbergen.
Seriöse Untersuchungen schätzen, dass in den letzten 20 Jahren Transferleistungen in Höhe von 1,5 bis 2 Billionen Euro nach Ostdeutschland gepumpt wurden. Allein zwischen 1991 und 1994 betrug der Anteil dieser Leistungen am westdeutschen Bruttoinlandproduktes (BIP) vier Prozent jährlich. Ein gigantisches Konjunkturprogramm, dessen Dimensionen erst von Obamas Rettungsplan für die US-Wirtschaft nach der jüngsten Krise übertroffen wurde. Sichtbarste Zeichen dieses Programms sind sanierte Innenstädte, eine moderne Infrastruktur, gut ausgebaute Gewerbegebiete. Doch es sind Innenstädte ohne Leben, Infrastrukturen ohne Nutzer, Gewerbegebiete ohne Gewerbe. Es sind Potemkinsche Dörfer, die verbergen sollen, dass der „Aufschwung Ost“, wie dieses Konjunkturprogramm genannt wird, eine Schimäre ist, ein Hirngespinst der politischen Klasse Deutschlands, das an der Realität eines Kapitalismus zerschellt, der es nicht mit einer Unterkonsumtion zu tun hat, sondern mit einer permanenten und sich zuspitzenden Überproduktion. Dabei verhießen zunächst steigende Wachstumszahlen des ostdeutschen Bruttoinlandproduktes in der ersten Hälfte der 90er Jahre ein Aufschließen der ostdeutschen Wirtschaft an das westdeutsche Niveau auf absehbare Zeit.[1] Doch wer genauer hinschaute, musste feststellen, dass es nicht die Industrie, sondern das Bauhandwerk war, das den Löwenanteil zu diesem Wachstum beitrug.[2] Kaum waren die letzten Straßen erneuert und die Bevölkerung mit ‚adäquatem‘ Wohnraum versorgt, ging das ohnehin bescheidene Wachstum kontinuierlich zurück. So ist bis heute kein ‚selbsttragender‘ Aufschwung der ostdeutschen Wirtschaft in Sicht.
Es war eine geradezu groteske Illusion der deutschen Bourgeoisie zu glauben, dass die Einheitskosten allein durch ein als selbstverständlich vorausgesetztes ostdeutsches Wachstum und das damit einhergehende erhöhte Steueraufkommen sowie durch die Einsparung der Kosten der deutschen Teilung finanziert werden könnten. Diese Kalkulation erwies sich schnell als Milchmädchenrechnung; die einzige Größe, die beträchtliche Steigerungsraten aufwies, waren die galoppierenden Kosten der Einheit. Darüber konnte auch nicht das kurze Strohfeuer hinwegtäuschen, das den westdeutschen Banken, Industrien und Handelsgesellschaften in Folge der Währungsunion zu Rekordgewinnen verhalf und dafür sorgte, dass das westdeutsche Kapital vorerst von der Rezession verschont geblieben war, die seine internationalen Konkurrenten bereits erfasst hatte. Der sog. Einheitsboom wurde allein durch die künstliche Aufwertung der Kaufkraft der ostdeutschen Bevölkerung ermöglicht, als die DDR-Bevölkerung dank der Währungsunion in den Besitz von rund 115 Mrd. D-Mark kam. Bereits 1991 war jedoch klar, „daß die deutsche Volkswirtschaft nicht in der Lage war, die immensen Kosten des Aufbaus Ost aus dem inländischen Sparvolumen zu finanzieren.“[3]
Doch wie sollten diese Kosten dann finanziert werden? Die politische Klasse griff auf ein Potpourri von Finanzierungsmitteln zurück. Sie bediente sich diverser staatlicher Kapitalreserven und verkaufte ihr Tafelsilber, indem sie die Telekom und die Post privatisierte. Sie erhöhte die Mehrwert-, Mineralöl- sowie Tabaksteuern und belangte die Arbeiterklasse u.a. mittels der Einführung des sog. Solidaritätszuschlages. Sie strich Subventionen wie die sog. Berlinzulage und die Zonenrandförderung. Doch reichte all dies bei weitem nicht aus, um die nicht abreißenden Kosten für den „Aufbau Ost“ zu finanzieren. Die damals amtierende konservativ-liberale Regierungskoalition unter Bundeskanzler Kohl war gezwungen, ans Eingemachte zu gehen.
Zum einen plünderte sie die Sozialkassen aus. Allein zwischen 1991 und 1995 flossen 140 Milliarden Mark aus den Kassen der Arbeitslosen- und Rentenversicherung als Transferleistungen in den Osten; das waren 23 Prozent der Gesamtausgaben für den „Aufbau Ost“ in diesen Jahren! Die Folge: die sog. Sozialleistungsquote[4], die zwischen 1982 und 1990 von 30 auf 26,9 Prozent gesenkt werden konnte, stieg wieder an, diesmal auf 31,9 Prozent.[5]
Zum anderen trat die Kohl-Regierung die Flucht in die Schulden an. Sie lockte westdeutsche Privatanleger mit Steuervergünstigungen und Abschreibungsmodellen, aber vor allem bediente sie sich auf den internationalen Kapitalmärkten. Deutschland, noch in den 80er Jahren Kapitalexporteur, wurde zum Schuldnerland; 1991 schloss die Leistungsbilanz Deutschlands mit dem Ausland erstmals seit langer Zeit mit einem Defizit von 30 Mrd. D-Mark ab. Die öffentlichen Schulden explodierten förmlich: Von Ende 1989 bis Ende 1997 wuchsen die Staatsschulden um fast das Zweieinhalbfache, von 929 Mrd. auf 2.215 Mrd. D-Mark. Fast 50 Prozent der Neuverschuldung ging auf das Konto des Fonds „Deutsche Einheit“. „Der deutsche Staat ist auf allen Ebenen (Bund, Länderm Kommunen) an die Grenze seiner finanziellen Leistungsfähigkeit gestoßen.“[6]
All dies hatte erhebliche Folgen. 1993 erlebte Westdeutschland einen schweren wirtschaftlichen Einbruch. „Die Produktion des westdeutschen Wirtschaftsraumes sank um 1,8% unter das Niveau des Vorjahres. Das Exportvolumen ging im Vergleich zu 1992 sogar um 3,7% zurück. Dieser Abschwung verstärkte den Wettbewerb um die Auslastung von Produktionskapazitäten auf dem deutschen Binnenmarkt zusätzlich. Die unmittelbare Folge war, daß es ostdeutschen Unternehmen angesichts hoher westdeutscher Überkapazitäten noch schwerer fiel, sich beispielsweise in Branchen wie dem Maschinenbau oder der Chemie gegen die Konkurrenz aus den alten Bundesländern durchzusetzen bzw. neue Marktzugänge zu finden.“[7]
Spätestens ab jetzt ging das deutsche Kapital schweren Zeiten entgegen. Die Leitzinserhöhungen, die von der deutschen Bundesbank sukzessive vorgenommen wurden, um den infolge der Einheit entstandenen Kosten- und Preisauftrieb zu dämpfen, sorgten für eine Verteuerung der D-Mark auf den internationalen Märkten und erschwerten den Export deutscher Waren. Die immer drückendere Steuerlast schnürte gleichzeitig auch den Binnenmarkt ab; die ständigen Erhöhungen der Sozialabgaben bzw. die Schaffung neuer (Solidaritätsbeitrag, Pflegeversicherung), mit denen die Kohl-Regierung einen großen Teil der Einheitskosten finanzierte, bewirkten eine weitere Verteuerung der Bruttolöhne. Kurzum: es stand nichts Geringeres auf dem Spiel als die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitals. Besorgt schlagzeilte die internationale Presse: „Deutschland – der kranke Mann Europas!“ In allen wichtigen Parametern wies Deutschland die schlechtesten Zahlen innerhalb der EU auf: Es wies über Jahre die niedrigsten Wachstumsraten und die höchsten Arbeitslosenraten auf. Die sog. Staatsquote war unter allen EU-Ländern die höchste. Und ausgerechnet Deutschland, das am stärksten auf die Maastricht-Kriterien gedrängt hatte, überschritt in puncto Neuverschuldung in den 90er Jahren mehrmals die Drei-Prozent-Marke.
Die deutsche Bourgeoisie musste handeln, wollte sie gegenüber ihren Konkurrenten auf dem Weltmarkt nicht ins Hintertreffen geraten. Doch um die – in den Augen der Herrschenden - längst überfälligen Reformen endlich einzuleiten, bedurfte es einer anderen Regierungsmannschaft. Die christlich-liberale Koalition unter Kohl kam dafür nicht in Frage. Schließlich verbarg sich hinter der Chiffre „Reform des Sozialstaats“ nichts anderes als ein massiver Anschlag auf den Lebensstandard der Arbeiterklasse in Deutschland. Für solch ein Unterfangen hat die deutsche Bourgeoisie ein weitaus probateres Mittel zur Hand – die altbewährte Sozialdemokratie. Und Letztere sollte das Vertrauen der deutschen Bourgeoisie nicht enttäuschen. In ihren sieben Jahren schuf die Schröder-Regierung, eine Koalition aus SPD und Grüne, die Voraussetzungen für die Wende. Beschränkte sie sich in ihrer ersten Amtsperiode noch darauf, die Rahmenbedingungen für das deutsche Kapital durch massive Steuerentlastungen zu verbessern, holte sie nach ihrer Wiederwahl Ende 2002 zum großen Schlag gegen die Arbeiterklasse aus. Sie gab das bis dahin eherne Paritätsprinzip, das Kapital und Arbeit zu gleichen Teilen an der Finanzierung der Sozialversicherungskassen beteiligt hatte, zuungunsten der Arbeiterklasse auf. Sie sorgte mit der Einführung von Hartz IV für den Durchbruch bei den schon lange währenden Bemühungen des Kapitals in Deutschland, die Lohnkosten substanziell zu senken.[8] Und unter ihrer Ägide erlebte die Politik der sog. Flexibilisierung der Arbeit, d.h. ihre Prekarisierung (Leiharbeit, Zeitarbeit, Ich-AGs usw.), einen unerhörten Schub, so dass mittlerweile mehr als ein Viertel der Lohnabhängigen unter diesen Bedingungen existiert.
Für die deutsche Bourgeoisie bedeutete die „Agenda 2010“ die Wende auf der Talfahrt ihrer Ökonomie. Befeuert von den genannten Maßnahmen, erlangte die westdeutsche Wirtschaft schnell ihre Konkurrenzfähigkeit gegenüber dem Ausland wieder und erklomm bald darauf erneut die Spitze unter den führenden Exportnationen der Welt. Die Arbeitslosenzahlen gingen substanziell zurück, und auch der Staatshaushalt erholte sich allmählich wieder.[9] Für die Arbeiterklasse dagegen symbolisierte die „Agenda 2010“ das endgültige Ende des westdeutschen Wohlfahrtsstaates, wie er bis dato existiert hatte. Sie musste die Zeche der Wiedervereinigung nun zum zweiten Mal bezahlen, nachdem ihr bereits in den neunziger Jahren die Hauptlast der Wiedervereinigung aufgebürdet worden war – im Osten in Form der Massenarbeitslosigkeit, im Westen in Gestalt eines jahrelangen Lohnverzichts.
[1] „1994 erreichte das Wirtschaftswachstum in Ostdeutschland seinen bis dahin höchsten Wert. Eine reale Zunahme des BIP von 8,5% war zu verzeichnen.“ (Handbuch zur Deutschen Einheit, S. 853)
[2] „Während in Westdeutschland das Baugewerbe nur 5% zum BIP beisteuerte, war es in dieser Branche in Ostdeutschland dreimal soviel.“ (ebenda, S. 856)
[3] Ebenda, S. 852.
[4] Die Sozialleistungsquote entspricht dem Anteil des Sozialbudgets am Bruttoinlandsprodukts.
[5] Alle Zahlen aus: Gerhard A. Ritter, Der Preis der deutschen Einheit. Die Wiedervereinigung und die Krise des Sozialstaats, S. 127f.
[6] Flug, Treuhand-Poker, S. 861.
[7] Ebenda, S. 853.
[8] Indem Rot-Grün die Bezugsdauer der Arbeitslosenunterstützung von drei auf ein Jahr kürzte, die Arbeitslosenhilfe ersatzlos strich und so dafür sorgte, dass ArbeiterInnen bereits nach einem Jahr Arbeitslosigkeit in Hartz IV (eine bessere Sozialhilfe) abrutschten, erfüllte es einen langgehegten Wunsch des deutschen Kapitals – die Umwandlung der „stillen“ industriellen Reservearmee in eine Armee von jederzeit verfüg- und einsetzbaren Arbeitslosen. Denn erst Hartz IV schuf die „Anreize“, mit denen Arbeitslose dazu veranlasst werden konnten, auch für Niedrigstlöhne zu schuften, und übte darüber hinaus einen enormen Druck auch auf die Tariflöhne aus.
[9] Allerdings muss dabei eingeschränkt werden, dass die Kosten der Wiedervereinigung schon längst nicht mehr in den Haushaltsetats einfließen. Sie werden in einem Schattenhaushalt, dem „Fonds Deutsche Einheit“, budgetiert und üben nach wie vor einen erheblichen Druck auf den finanziellen Spielraum des deutschen Staates aus.
Aktuelles und Laufendes:
Bankrotte Staaten: Der Widerstand beginnt sich zu regen
- 3742 Aufrufe
Nachdem vor 18 Monaten die jüngste Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise mit dem Bankrott der Lehman-Brothers Bank die Bevölkerung der Welt mit voller Wucht traf, reagierten die Lohnabhängigen aller Länder zunächst einmal erschrocken, eingeschüchtert, wie gelähmt. Inzwischen hat sich diese Krise weiter ausgebreitet und vertieft. Man beginnt zu ahnen, dass es sich um keine vorübergehende Erscheinung handelt. In diesem Kontext beginnt sich das soziale Klima zu wandeln.
Der Klassenkampf kommt langsam in Fahrt
In Algerien kam es im Januar zu bedeutsamen Protesten von Arbeitslosen in Annaba im Osten des Landes und von Wohnungslosen in mehreren Landesteilen. Trotz Medienblack-outs streikten auch Arbeiter in Oran, Mosaganem, Constantine und vor allem im Industriegürtel um die Hauptstadt Algier. Es beteiligten sich Beschäftigte aus Betrieben der Privatwirtschaft und des öffentlichen Dienstes.
In der Türkei wirkte der Kampf der Tekel-Beschäftigten (siehe mehr auf unserer Webseite und an anderer Stelle in dieser Zeitung) wie ein Leuchtfeuer. In dem Kampf schlossen sich türkische und kurdische Arbeiter zusammen. Es gab eine große Entschlossenheit, den Kampf auf andere Betriebe auszudehnen und die Führung des Kampfes in den eigenen Händen zu behalten und sie nicht an die Gewerkschaften abzugeben, die diesen nur sabotieren.
Bemerkenswert an diesem Kampf bei Tekel in der Türkei war aber auch die Stärke der Regung der internationalen Solidarität unter einer Minderheit der Beschäftigten in einer Reihe von europäischen Ländern. Insbesondere aus Deutschland und der Schweiz wissen wir von einer Reihe von Solidaritätsinitiativen. Während die herrschende Klasse immer wieder versucht, die Migration aus ärmeren Ländern in den Industriestaaten dazu auszunutzen, nicht nur um die Löhne zu drücken, sondern die Arbeiter der Herkunftsländer und der sog. Gastländer gegeneinander aufzuhetzen, wird hier der Spieß vom Proletariat umgedreht. Durch das Phänomen der weltweiten Migration entstehen Brücken der internationalen Arbeitersolidarität.
Selbst wenn die gewerkschaftliche Kontrolle noch stark ist, gab es auch wichtige Streiks und Protestkundgebungen in den Kernländern Europas. In Frankreich z.B. wurde im öffentlichen Dienst wie auch in der Privatindustrie mehrfach die Arbeit niedergelegt – im Erziehungswesen, im Gesundheitswesen, bei den Raffinerien, Fluglotsen, Ikea, Philips. Aber wir könnten allein für Europa eine Reihe anderer Arbeiterkämpfe der jüngsten Zeit auflisten, welche diesen Trend bestätigen. Etwa den der Hafenarbeiter in Finnland oder die Streiks in Serbien. Die Frage der Solidarität rückt immer mehr in den Vordergrund. Bei Tekel in der Türkei war dies eine zentrale Frage, aber auch bei den Arbeitern in Nordspanien in Vigo (siehe dazu Artikel in dieser Zeitung).
Griechenland gegenwärtig im Brennpunkt der gegensätzlichen Klasseninteressen
Die Augen der herrschenden Klasse starren gebannt auf Griechenland, nicht nur weil der Bankrott der Wirtschaft das aufzeigt, was auf die anderen Länder Europas zukommt, sondern auch weil sie weiß, dass die soziale Situation im Land ein wahres Pulverfass ist.
Im Dezember 2008 wurde das Land nach der Ermordung eines jungen Anarchisten einen Monat lang von sozialen Protesten erschüttert, an deren Spitze hauptsächlich jugendliche Arbeiter standen. Dieses Jahr drohen die Sparmaßnahmen, welche von der sozialistischen Regierung angekündigt wurden, eine Explosion nicht nur unter den Studenten und Arbeitslosen auszulösen, sondern auch unter den Beschäftigten. Deshalb ist den Herrschenden sehr daran gelegen, ein Beispiel vorzuweisen, wo Arbeiter Sparbeschlüsse im Interesse der Wirtschaft einfach schlucken. Aber dieses Szenario ist bislang in Griechenland nicht eingetreten. Schon vor der Ankündigung der Sparmaßnahmen seitens der Regierung war ein 24 stündiger Generalstreik geplant, sowie Arbeitsniederlegungen der Zöllner, wodurch der Export und die Importe getroffen werden sollten, sowie Aktionen von anderen Regierungsangestellten, Fischern usw. "Nur wenige Stunden nach der Ankündigung der Sparmaßnahmen griffen Beschäftigte von Olympic Airways die Bereitschaftspolizei an, die vor einem Gebäude der Finanzverwaltung stand. Sie besetzten dieses Gebäude. Danach wurde die Hauptgeschäftsstraße Athens Panepistimio stundenlang abgesperrt. Donnerstag Morgen besetzten Arbeiter im Rahmen einer Aktion der von der Kommunistischen Partei PAME kontrollierten Gewerkschaft das Finanzministerium am Syntagma Platz (das weiterhin besetzt ist), sowie ein kommunales Gebäude in Trikala. Später besetzte die PAME ebenso vier Fernsehstudios in Patras, das staatliche Fernsehen in Thessaloniki, und zwang die Journalisten, eine DVD gegen die Sparmaßnehmen zu spielen. Donnerstag Nachmittag wurde auf den Straßen Athens protestiert. Es beteiligten sich PAME und OLME, die Lehrergewerkschaft, die von ADEDY unterstützt wurde. Nach einem Aufruf versammelten sich innerhalb von 24 h über 10.000 Teilnehmer. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Bereitschaftspolizei, die vor dem EU-Kommissionsgebäude postiert war. Gleichzeitig fanden in Thessaloniki und Lamia Protestzüge statt. Das Parteigebäude der PASOK wurde in Arta von wütenden Demonstranten zerstört" (leicht gekürzt aus dem blog von Taxikipali, der regelmäßig auf libcom.org: https://libcom.org/article/mass-strikes-greece-response-new-measures [43] schreibt.
Die Gewerkschaften haben sich radikalisiert, um die Lage im Griff zu behalten
Im Dezember 2008 entfaltete sich die Bewegung weitestgehend spontan und organisierte sich oft in Vollversammlungen in den besetzten Schulen und Universitäten. Die Zentrale des Gewerkschaftsverbandes, der der Kommunistischen Partei (KKE) nahesteht, wurde besetzt, wodurch ein klares Misstrauen gegenüber dem stalinistischen Gewerkschaftsapparat zum Vorschein trat, der die Jugendlichen oft als Lumpenproletarier und verwöhnte Bürgerkinder verunglimpft hatte.
Aber jetzt hat die KKE gezeigt, dass sie immer noch ein wichtiges Werkzeug in den Händen der Herrschenden ist, indem sie die Streiks, Demonstrationen und Besetzungen mit organisierte. Die Wut gegen die Sozialistische GSEE –Gewerkschaft ist groß, die als direkter Handlanger der PASOK-Bewegung angesehen wird. Panagopoulos, der Gewerkschaftsführer der GSEE, ein Dachverband von Gewerkschaften der Privatindustrie, wurde auf der Demo gewalttätig angegriffen und musste von der Präsidentenwache geschützt werden, aber bislang konnten die KKE und ihre Gewerkschaften sich als die Führer und Organisatoren der Bewegung darstellen. Für die Herrschenden in Griechenland besteht die Gefahr, wenn die Wut und die Ablehnung weiter zunehmen, werden die Arbeiter diese vorgetäuschte Radikalisierung durchschauen und den gewerkschaftlichen Rahmen zu durchbrechen versuchen. Dann könnten sie den Kampf in die eigenen Hände nehmen und damit wieder zu den Vollversammlungen vom Dezember 2008 zurückkehren.
Aber selbst im gegenwärtigen Stadium bereiten die Kämpfe in Griechenland der herrschenden Klasse insgesamt Sorgen. Ähnliche Maßnahmen in Spanien, die z.B. eine Verschiebung des Renteneintrittsalters um zwei Jahre vorsehen, verursachten eine Reihe von Demonstrationen in vielen Städten, während am 4. März (am gleichen Tag der Athener Demos) in Portugal ein 24 stündiger Streik des öffentlichen Dienstes stattfand.
Kurzum, das Gefühl der Angst und Passivität, das überall zu spüren war, als die Wirtschaftskrise 2008 ihre dramatische Wende nahm, weicht jetzt langsam der Empörung, nachdem Arbeiter offen fragen: warum sollten wir für die kapitalistische Krise zahlen?
Natürlich können und werden diese Regungen des Bewusstseins in ideologische Sackgassen geführt, insbesondere durch die weltweiten Versuche, überall die Banker oder die Neoliberalen als die 'Schuldigen' darzustellen. In Griechenland wird immer wieder die deutsche Bourgeoisie an den Pranger gestellt, weil sie die von PASOK geführte Regierung bisher nicht mit Kredithilfen unterstützt hat. Die deutschfeindlichen Gefühle, die noch aus der Nazi-Besatzung stammen, werden gegen die Bewegung ausgespielt.
Vater Staat enthüllt seine Fratze
Nunmehr ist eine Situation entstanden, wo neben den Entlassungen in den strauchelnden Betrieben der Staat immer mehr zum direkten Angriff gegen die Arbeiterklasse blasen muss, um die Kosten der Krise auf sie abzuwälzen. Der direkte Drahtzieher, der Verantwortliche dieser Angriffe, nämlich der Staat, ist in diesem Fall viel leichter erkennbar als bei Entlassungen. Dies begünstigt die Entfaltung des Klassenkampfes, das Streben nach einem Zusammenschluss und die Politisierung, denn der oberste Wächter der Interessen des Kapitals, der Staat, erscheint als entschlossenster Verteidiger der Kapitalisten gegen die Arbeiterklasse. Damit kommen immer mehr Faktoren zusammen, die zu einer Bewegung mit massiven Kämpfen führen können. Der auslösende Moment wird sicherlich die Anhäufung der Unzufriedenheit, die angestaute Wut und Empörung sein. Je mehr die Herrschenden versuchen, ihre Sparpakete umzusetzen, desto mehr werden die Betroffenen gezwungen sein in den Kampf zu treten und so Erfahrungen zu sammeln. Es lässt sich nicht vorhersagen, wie und wo es zu einer Zuspitzung von Kämpfen kommen wird, da der Auslöser irgendein Anlass sein kann, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Die Perspektive von massiveren Kämpfen
Der Zusammenbruch des Stalinismus und vor allem die Art und Weise, wie die Herrschenden dies ideologisch ausgeschlachtet haben, haben Spuren in der Arbeiterklasse hinterlassen, die auch heute noch zu erkennen sind. Die Kampagne "Der Kommunismus kann nicht funktionieren, seht doch, die Bevölkerung hat für den Kapitalismus gestimmt" hat eine abschreckende Wirkung gehabt und von der Suche nach einer Alternative zum Kapitalismus abgehalten. Insofern ist die Lage heute eine andere als Ende der 1960er Jahre. Damals hatten die massiven Kämpfe, insbesondere der große Generalstreik im Mai 1968 in Frankreich und der Heiße Herbst 1969 in Italien aufgezeigt, dass die Arbeiterklasse in der Gesellschaft eine wichtige Rolle spielt. Zu glauben, dass die Arbeiterklasse eines Tages den Kapitalismus überwinden könnte, erschien damals nicht als ein süßer Traum – im Gegensatz zu heute. Die Schwierigkeiten der Arbeiterklasse seit den 1990er Jahren in den Kampf zu treten, ist u.a. auf ein mangelndes Selbstvertrauen zurückzuführen, welches durch das Wiedererstarken der Kämpfe nach 2003 noch nicht überwunden ist. Aber erst wenn sich massive Kämpfe entwickeln, kann auch das notwendige Selbstvertrauen wieder entstehen, das für die Reifung einer Perspektive unerlässlich ist. 17.3.10
Aktuelles und Laufendes:
- Staatsbankrott [44]
- Vollversammlungen [45]
- Arbeiterkampf Griechenland [46]
- Algerien [47]
- Portugal [48]
- Türkei [49]
- Krise Griechenland [50]
Die einzigen Optionen… Rüstung und Handelskrieg
- 2442 Aufrufe
Während die Regierungen in allen Ländern der Welt der Arbeiterklasse Sparpakete in einem noch nie da gewesenen Ausmaß aufhalsen wollen, um so die Kosten der Krise auf die Arbeiter abzuwälzen, zögern sie nicht, für ihre imperialistischen Ambitionen ungeheure Summen aufzubringen. So war der deutsche Imperialismus einer der Hauptdrahtzieher des seit langem geplanten Militärtransporters A400M. Bislang muss z.B. das deutsche Militär für den Transport von Material und Soldaten nach Afghanistan auf russische & ukrainische Transportflugzeuge des Typs Antonov oder auf US-Maschinen zurückgreifen. Dieser Zustand der Abhängigkeit im Transportbereich ist nicht nur für das deutsche Militär, sondern für alle europäischen Staaten unhaltbar. Nun, mehr als 20 Jahre nach 1989, steht endlich ein europäisches Transportflugzeug zur Verfügung, das aber erst ab 2014 ausgeliefert werden kann. Airbus hatte sich 2003 verpflichtet, 180 Maschinen zu einem Festpreis von 20 Milliarden Euro auszuliefern. Deutschland hatte 60 Maschinen bestellt. Immer wieder aber waren weitere Kosten hinzugekommen. Die zu deckenden Mehrkosten von 5.2 Mrd. Euro werden jetzt unter die sieben Käuferstaaten aufgeteilt. Wo soll von den beteiligten Staaten das Geld hergeholt werden? Während die Regierungen auf allen Ebenen sparen, durfte dieses wichtige Projekt nicht der Sparpolitik zum Opfer fallen, im Gegenteil. Denn für die weitere Handlungsfähigkeit auf der imperialistischen Bühne ist solch ein Flugzeug unerlässlich. Für die Machthaber gibt es Bereiche, von denen sie nicht abrücken wollen! Auch diese Kosten muss die Arbeiterklasse tragen. Wenn es um den Widerstand gegen Spardiktate seitens der Regierungen geht, dürfen wir nicht vergessen, dass jeden Cent, den sie von uns erpressen, von ihnen wiederum für die Rüstung oder andere Projekte verbraten wird.
Handelskrieg an allen Fronten
Friedensnobelpreisträger Obama, der den durch den Krieg unpopulär gewordenen G.W. Bush abgelöst hat, zeichnet sich bislang durch eine große Entschlossenheit aus, die amerikanischen Rüstungspläne nicht nur uneingeschränkt weiter zu finanzieren, sondern er wirkt auch als treibende Kraft im Handelskrieg. Das jüngste Beispiel der Anschaffung von Tankflugzeugen für die US-Luftwaffe belegt dies. „Die US-Luftwaffe muss insgesamt 534 Tank- und Frachtflugzeuge ersetzen. Das verspricht langfristig ein Geschäft von 100 Milliarden Dollar. Die US-Rüstungsfirma Northrop Grumman (NGC) und der europäische Flugzeugbauer EADS hatten den Tankerauftrag 2008 bereits gewonnen, auf Protest von Boeing aber wieder aberkannt bekommen [51]. Der Rechnungshof des Kongresses erklärte das Vergabeverfahren für fehlerhaft und empfahl dem Pentagon die Neuausschreibung. Der Airbus-Konzern EADS war damit beim Jahrhundertgeschäft mit der US-Luftwaffe für 179 Tankflugzeuge im Wert von 35 Milliarden Dollar aus dem Rennen. Der US-Partner Northrop Grumman (NGC) zog das gemeinsame Angebot zurück. Er begründete die Entscheidung mit unfairen Wettbewerbsbedingungen. Die Ausschreibung sei voll auf den Konkurrenten Boeing zugeschnitten worden. US-Verteidigungsminister Robert Gates hatte 2009 erklärt, er könne auch nur mit einem Boeing-Angebot leben.“ (Spiegelonline, 5.3.2010)
Anfang März erklärte Obama, die USA wollen ihre Exporte in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Obama verkündete, „jede verfügbare Ressource für diese Mission zugänglich zu machen“. Weil zur Zeit fast alle Länder auf den Export zur Überwindung der Wirtschaftskrise setzen, die USA ihre Exporte bei einer Verdoppelung innerhalb der nächsten fünf Jahre damit jedes Jahr um 20% steigern müssten, China und Europa ähnliche Anstrengungen unternehmen, ist hier der große Handelskrieg programmiert. „Die französische Finanzministerin Lagarde drängt die Bundesrepublik, auf einen Teil ihres Ausfuhr-Überschusses zu verzichten - die deutsche Exportmacht schade den schwächeren Staaten. In der Bundesregierung rüstet man schon zum Verteilungskampf.“ (Spiegelonline, 15.3.2010). Denn zu einer Zeit, wo überall die Kaufkraft der Arbeiter drastisch reduziert wird, damit ein Nachfragerückgang vorprogrammiert ist, bleibt das Rätsel ungelöst, wer all die Waren kaufen soll? Einer der angestrebten Märkte ist jedenfalls der Rüstungsmarkt. Deutschland hat mittlerweile "seine Rüstungsexporte in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, der deutsche Weltmarktanteil stieg auf elf Prozent für den Zeitraum zwischen 2005 und 2009. Noch mehr exportierten nur die USA mit 30 Prozent und Russland mit 23 Prozent. (Welt-online., 15.3.10). 15.3.10
Aktuelles und Laufendes:
- Überproduktion [52]
- Handelskrieg [53]
- Rüstungsexporte [54]
- Militärtransporter [55]
- Tankflugzeuge [56]
- Airbus [57]
- Boeing [58]
Eindrücke von den diesjährigen Anarchietagen in Winterthur / Schweiz
- 3104 Aufrufe
Bereits zum sechsten Mal lädt die Libertäre Aktion Winterthur [59] - deine Ansprechpartnerin für anarchistische Theorie und Praxis - zu den lang begehrten Anarchietagen. Am Wochenende vom 12. bis 14. Februar erwartet dich ein Wellnessprogramm für Geist und Seele - begleitet von kulinarischen Feuerwerken und abgerundet von einem musikalischen Abendprogramm werden auch dieses Jahr eine handvoll hochwertiger Vorträge für Höhepunkte im politischen Jahreskalender Winterthurs sorgen. Präsentiert werden dir nichts weniger als die interessantesten Entwicklungen im internationalen Klassenkampf.“
Mit diesen einleitenden Worten rief die LAW dieses Jahr zu den Anarchietagen in Winterthur auf. Wir möchten hier ein paar Eindrücke von der Veranstaltung vermitteln, die aber schon allein deshalb sehr subjektiv und unvollständig sind, weil wir nicht am ganzen Programm teilnehmen konnten.
Im Unterschied zu früheren Jahren dauerten die Anarchietage nicht mehr einen ganze Woche, sondern nur noch von Freitagabend bis Sonntag. Diese Konzentration hat offenbar damit zu tun, dass es immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, die von weit her anreisen. Während früher diese Veranstaltung ein lokales Ereignis war, von dem man zwar auch im benachbarten Zürich je nachdem interessiert Notiz nahm, ist sie mittlerweile weit über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus ein Anziehungspunkt für Leute, die an einer ernsthaften Diskussion über die Möglichkeiten und Wege einer revolutionären Überwindung dieser Gesellschaft interessiert sind. So gab es nun mehrere Vorträge und Diskussionen am gleichen Tag mit dem Resultat, dass im Allgemeinen die Debatten mit wesentlich mehr Publikum stattfanden (80-100 Leute).
Auch die Themen haben sich gewandelt. An den 2. Anarchietagen 2006 waren beispielsweise typische Themen der abendlichen Veranstaltungen „Gewaltfreier Anarchismus, Geschichte und Gegenwart weltweit, Vortrag, Diskussion und Film“ oder „Naturismus, Eine Welt ohne Kleider, Vortrag, Diskussion“. Zu den Veranstaltungen 2010 sagte ein Genosse von LAW am alternativen Lokalradio Lora in Zürich: „Die diesjährigen Anarchietage stehen eigentlich im Zeichen der Wirtschaftskrise und der Krise des Kapitals und der Arbeitskämpfe dazu.“ Es gab jetzt beispielsweise folgende Referate und Diskussionen:
- Zum Konzept der gesellschaftlichen Veränderung im (Anarcho-)Syndikalismus; Holger Marcks, Referat und Diskussion
- Die revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats; Unabhängige Rätekommunisten, Referat und Diskussion
- Arbeiterwiderstand gegen die Pläne des Kapitals; Rainer Thomann, Referat und Diskussion
Stellvertreterpolitik oder Selbsttätigkeit des Proletariats?
Unter dem Titel „Die revolutionäre Selbstaufhebung des Proletariats“ stellte ein Genosse der Unabhängigen Rätekommunisten (aus Deutschland) die wichtigsten programmatischen Punkte seiner Gruppe vor: Wir Arbeiter und Arbeiterinnen der ganzen Welt können die Revolution niemand anderem überlassen, wir müssen unsere Aufhebung als Proletarier und Proletarierinnen selbst in die Hand nehmen - ohne den bürgerlichen Staat und seine Apparate, ohne Parlament, Gewerkschaften, linke Parteien und Berufspolitiker, ohne selbsternannte Stellvertreter, stattdessen mit selbstbestimmten Kämpfen, z.B. Streiks, mit selbst geschaffenen Organisationen, z.B. Arbeiterräten. Die Unabhängigen Rätekommunisten halten die Parteiform als solche für bürgerlich, ohne aber - wenn wir dies richtig verstanden haben - abzulehnen, dass sich Revolutionäre in einer besonderen Organisation zusammenschliessen.
Im Anschluss an das Referat wurden sehr grundsätzliche Fragen diskutiert:
- Wer ist die Arbeiterklasse?
- Wird die Revolution gewaltsam sein?
- Was hat die Arbeiterklasse mit Demokratie und Menschenrechten zu tun?
Einer der Teilnehmer meinte zwar, die Frage, wer zu Arbeiterklasse gehöre, sei ziemlich abstrakt und theoretisch. Aber es gab doch ein Bedürfnis in der Versammlung festzustellen, dass z.B. Arbeitslose ebenso zum Proletariat gehören wie die meisten Rentner, Studierenden und Hausfrauen. Bei denjenigen, die sich zu Wort meldeten, schien darüber auch Einigkeit zu herrschen: Die Arbeiterklasse bildet mindestens in den industrialisierten Ländern - und dazu gehören natürlich auch China oder Brasilien - die grosse Mehrheit der Bevölkerung. Wir sind viele, auch wenn sich die meisten heute nicht damit identifizieren, Proletarier und Proletarierinnen zu sein.
Die Gewaltfrage ist auch ein ständiges Thema an solchen Diskussionen, wie die vorher aus dem Jahre 2006 zitierte Veranstaltung über gewaltfreien Anarchismus zeigt. Man könnte sich vorstellen, dass diese Frage sehr unterschiedlich beantwortet wird. Und doch gab es an der diesjährigen Diskussion aus unserer Sicht eine klare Tendenz - nämlich dahin, dass die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft das bewusste Zusammenwirken aller daran Interessierten (eben der grossen Mehrheit der Bevölkerung = Proletariat) braucht und dass das erforderliche Bewusstsein nicht durch Gewalt, sondern durch Diskussion und solidarisches Handeln geschaffen wird. Die herrschende Klasse wird zwar ihre Macht nicht freiwillig aufgeben; ihr gegenüber wird es beim revolutionären Umsturz notwendigerweise zu Gewaltausübung kommen, auch wenn erfahrungsgemäss eine Situation des Massenstreiks - entgegen einem wohl verbreiteten Vorurteil - gerade nicht durch Chaos und Gewalt geprägt ist; Historiker aller Couleur sind sich darüber einig, dass es im Kapitalismus nie so wenige Verbrechen gab wie während der jeweils kurzlebigen Zeit einer Räteordnung (1905 Russland, 1917-19 Russland, Deutschland, Ungarn). Aber Gewalt innerhalb der Arbeiterklasse und gegenüber anderen Unterdrückten, die selber niemanden ausbeuten, sollte abgelehnt werden. Alle, die mindestens potentiell das gleiche Interesse an einer herrschaftsfreien Gesellschaft haben, müssen mit Überzeugung gewonnen werden, nicht mit der Pistole auf der Brust. Die gewaltsame Niederschlagung des Kronstädter Aufstands 1921 durch die Bolschewiki war ein tragischer Fehler; auf beiden Seiten wurde im Namen der Arbeiterklasse gefochten, solche Widersprüche können nicht mit Gewalt gelöst werden.
Und trotzdem - oder gerade deshalb - gab es in der Diskussion grosse Vorbehalte gegenüber einer proletarischen Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten. Die Menschenrechte sind eine Errungenschaft der aufgeklärten Bourgeoisie aus dem Zeitalter ihrer Revolutionen im 17. und 18. Jahrhundert. Sie beruhen auf dem Individuum und geben vor, jedes habe die gleichen Rechte, wobei von der Ungleichheit zwischen Arm und Reich abstrahiert wird. „Die Demokratie ist die Verschmelzung von sozialer Ungleichheit mit rechtlicher Gleichheit. (…) Die gleichen demokratischen Rechte bedeuten für Wirtschaftsbosse und die politische Klasse die soziale Herrschaft und für uns ArbeiterInnen und Arbeitslose weitgehend Ohnmacht. Für uns sind die demokratischen Rechte kaum mehr als Narrenfreiheiten.“ (aus einem aktuellen Flugblatt der Unabhängigen Rätekommunisten mit dem Titel: „Nicht nur gegen Nazis … - Kein Bock auf Nazis und Demokratie!“)
In der Diskussion am nächsten Tag zum Referat „Arbeiterwiderstand gegen die Pläne des Kapitals“ wurde anhand der Fabrikbesetzungen bei Continental in Clairoix/Frankreich[1] und INNSE in Mailand/Italien[2] im Jahre 2009 unter anderem über folgende Fragen debattiert:
- Wie kann ein Arbeitskampf erfolgreich geführt werden? Wie durchbricht man die Isolation? Wie können wir einen Kampf auf andere Teile der Arbeiterklasse ausdehnen?
- Warum ist der Kampf bei der INNSE gar nicht und derjenige bei Continental nur innerhalb des Unternehmens ausgedehnt worden? Hat dies etwas damit zu tun, dass man sich doch auf Gewerkschaftsstrukturen verliess, wenn auch nicht die offiziellen Zentralen?
- Soll man mit spektakulären Aktionen die bürgerlichen Medien mobilisieren? Soll man gegenüber den Medien drohen, sich das Leben zu nehmen, auch wenn man es gar nicht ernst meint?
An dieser Diskussion nahmen nicht mehr viele Leute teil, wahrscheinlich auch deshalb, weil das Referat lange dauerte und die Diskussion nach einer ebenfalls längeren Pause in einem anderen Raum stattfand. Auch der Dialog unter den Teilnehmenden war schwierig. Es schien, als prallten hier entgegen der gemeinsamen Einsichten vom Vortag über den Charakter der Gewerkschaften zwei grundverschiedene Visionen gegeneinander: einerseits die (auch von gewerkschaftlicher Seite) vertretene Sichtweise, nach der Aktivisten einen möglichst spektakulären, medienwirksamen Kampf notfalls allein und gegen den Rest der Welt organisieren sollen, andererseits das Anliegen, dass die kämpfenden Arbeiter die Solidarität von anderen Arbeitern suchen und die Ausweitung des Kampfes in die eigene Hand nehmen und selber organisieren.
Welche Bilanz?
Die gerade erwähnte Meinungsverschiedenheit zeigt, dass auch im Lager derjenigen, die sich als Anarchisten bezeichnen oder damit sympathisieren, keineswegs einheitliche Positionen vertreten werden. Unseres Erachtens kann man eine gute Bilanz aus den Diskussionen der Anarchietage ziehen, und zwar auf verschiedenen Ebenen:
1) Die Diskussionen waren (soweit wir es mitbekommen haben) geprägt vom Willen, sich gegenseitig zuzuhören und gemeinsam nach einer Klärung der offenen Fragen zu suchen. Die Debattenkultur war ein gemeinsames Anliegen.
2) Die Debatten waren weiter im Allgemeinen geprägt von einem internationalistischen Bewusstsein. Es gab zwar zweifellos auch Leute, die nach wie vor am Konzept der nationalen Befreiung festhalten oder das Chavez-Regime politisch unterstützen, also nationalstaatliche, bürgerliche Sichtweisen verteidigten. Aber solche Positionen lenkten nicht ab vom vorherrschenden Bemühen, auf einer internationalistischen Grundlage gemeinsam Fragen zu klären, unabhängig davon, ob man/frau sich als AnarchistIn oder KommunistIn versteht.
3) Wie der Genosse von LAW gegenüber dem Radio Lora ankündigt hatte, standen bei den diesjährigen Anarchietagen die Krise des Kapitals und der Klassenkampf des Proletariats im Zentrum der Veranstaltungen. Man spürte an den diesjährigen Anarchietagen, dass das Proletariat und sein Kampf konkretere Anliegen geworden sind. Niemand macht sich Illusionen darüber: Die Kämpfe unserer Klasse sind gegenwärtig noch sehr zögerlich, zu schwach, um schon heute am Kräfteverhältnis zur herrschenden Klasse unmittelbar etwas verändern zu können. Wir Revolutionäre sind aber Teil eines vor unseren Augen sich abspielenden Prozesses. So real die Arbeiterklasse mit ihren (noch schwachen) Kämpfen ist, so real sind wir Teil derselben Klasse und können Ferment im vor sich gehenden Gerinnungsprozess sein.
Kurz: Für uns waren die Anarchietage ein Ort der Debatte und der Klärung proletarischer Positionen für Leute, die für eine klassenlose, herrschaftsfreie Gesellschaft kämpfen wollen.
Lobo, 14.03.10
[1] Vgl. dazu unsere Artikel in Révolution Internationale und auf der französischsprachigen Webseite, z.B. RI Nr. 405, Oktober 2009: « Répression des ouvriers de Clairoix, Une tentative d’intimidation de toute la classe ouvrière »
[2] Vgl. dazu unsere Artikel in Rivoluzione internazionale und auf der italienischsprachigen Webseite, z.B. Nr. 162, Oktober/November 2009: „Solo una lotta unita e solidale può farci resistere agli attachi“
Aktuelles und Laufendes:
Politische Strömungen und Verweise:
Filmbesprechung: „Up in the Air“ – Leben auf der Überholspur?
- 3345 Aufrufe
Im Zentrum des Geschehens steht Ryan Bingham. Er ist fast immer auf Reisen. Firmen buchen ihn, damit er deren Angestellte und Arbeiter feuert. Um diesen Job erfüllen zu können, reist Bingham 322 Tage im Jahr kreuz und quer durch die USA. Die schlechte Nachricht für ihn: Das bedeutet „43 grässliche Tage zu Hause“. Bingham ist ein Mann ohne Ecken und Kanten – aalglatt. Er hat sich den kapitalistischen Mythos einer makellos funktionierenden Maschine zum Lebensprinzip erkoren. Zufriedene Momente erlebt er, wenn seine zahllosen Flüge und „Firmenbesuche“ wie am Schnürchen laufen. Die Blitzmontagen der Kamera verstärken diesen Eindruck bewusst – er funktioniert wie ein geöltes Getriebe: reibungslos. Bingham hat den perfekten Reisekoffer, den man als Handgepäck mitnehmen kann; er hat alle Vielfliegerprogramme, so dass er nie in einer Schlange am Counter warten muss; er muss nur seine Karte durchziehen und schon begrüßt ihn eine „freundliche“ Computerstimme.
Bingham geht sogar noch einen Schritt weiter. Er macht aus dieser Lebensart eine Lebensanschauung. Er hält vor Mitarbeitern und Managern „Rucksackvorträge“. Sein Motto: Alles, was man zum Leben wirklich braucht, passt in einen kleinen Rucksack. Der Rucksack ist ein zentrales Symbol des Films. Schließlich schmeißt Bingham nicht nur vertraute Wohngegenstände oder Erinnerungsstücke aus dem Rucksack raus, sondern gar jegliche soziale Bindungen wie Familie, Freunde und Kollegen. All diese „Gegenstände“ müsse man hinter sich lassen, da man sonst zu viel „Ballast“ mit sich herumtrage. Dies verdeutlicht, wie im Kapitalismus „freie“ Arbeiter gezwungen sind, kreuz und quer durch die Welt zu wandern, auf der Suche nach einer Gelegenheit, ihre Arbeitskraft zu verkaufen.
Bingham hat sich „frei“ gemacht; er lebt frei von jeglicher engerer emotionaler Bindung zu anderen Menschen. Menschen sind für ihn Dienstleistungsanbieter, einschließlich seiner selbst. Gerade deshalb ist er in seinem Beruf auch so erfolgreich. Schließlich lebt er davon, Menschen zu feuern und ihnen dadurch ihre Lebensgrundlage zu entreißen. Wie immer feuert er diese verzweifelten Menschen unglaublich freundlich und erzählt ihnen, welche ungeahnten Möglichkeiten ein solcher Rauswurf doch für die Zukunft bedeuten könnte. Die Betroffenen reagieren unterschiedlich, aber alle sind verzweifelt, können nicht begreifen, warum ihre jahrelange gute Arbeit nicht gewürdigt wird, fragen, ob sie denn etwas falsch gemacht hätten, was sie nun ihren Familien sagen sollten, und auch der Bank, die auf die nächsten Ratenzahlungen warte.
Diese Szenen gehören zu den stärksten des Films. Ein Grund könnte nicht zuletzt darin bestehen, dass der Regisseur Reitman mit Laiendarstellern gearbeitet hat. Diese Laiendarsteller haben 2007-2008 tatsächlich ihren Job im Taumel der Krise verloren. Hinter den anonymen Zahlen der Entlassungswellen weltweit, die man tagtäglich in den Nachrichten vernimmt, stehen ganze Menschen und ihre Familien. In diesen Szenen leidet man besonders mit, denn wir wissen: Diese Gesichter sind unsere Gesichter. Es geht nicht darum, ob man am Arbeitsplatz etwas falsch gemacht hat. Wie hilflos wir Arbeiter und Angestellte als Einzelne angesichts der sich rapide verschärfenden Überproduktionskrise sind, zeigt „Up in the Air“ mehr als deutlich. Bingham versucht all diesen Verzweifelten zu sagen, sie sollen das Beste aus der Situation machen. Leider schließt dies für manche auch den Selbstmord mit ein.
Wie kann Bingham einen solchen Beruf nur durchstehen? Seine junge, neue Kollegin Natalie Keener, die zunächst härter und unmenschlicher wirkt (ihre kostensenkende Idee für die Firma, in der Bingham arbeitet, lautet, Kündigungen per Internet durchzuführen), kündigt nach nur einem Monat. Was unterscheidet Keener von Bingham? Keener hat noch soziale Bindungen, leidet unter der Trennung von ihrem Verlobten, wünscht sich eine liebende Familie. Aufgrund dieser sozialen Gefühle ist ihr eines noch nicht abhanden gekommen: ihr Gewissen. Für sie werden diese Kündigungsgespräche immer unerträglicher.
Und nun begreift man nach und nach, dass Bingham vermutlich „gezwungen“ war, alle seine Beziehungen zu seiner Familie zu kappen, damit er seine soziale und emotionale Seite und sein Gewissen ganz tief begraben kann. Er kann seinen Job nur dann durchhalten, wenn er rein rational an die Entlassungen herangeht. Kosten-Nutzen-Rechnung geht nicht auf, also raus mit den Kostenverursachern. Natürlich nett verpackt. Bingham ist der entfremdete Mensch im Kapitalismus in Reinkultur. Aber er ist eben auch ein Mensch. Was zunächst als harmlose Affäre mit seinem weiblichen Gegenstück Alex Goran beginnt, wird für Bingham eine echte Beziehung. Er verspürt erstmals Nähe, Zugehörigkeitsgefühle, Vertrauen und Glück – aber dadurch bekommt seine Lebensart erste Risse. Er nimmt Kontakt zu seiner Familie auf und reist spontan zu Alex (um festzustellen, dass sie eine Familie hat). Er hat seine menschlichen Seiten zugelassen. Dies hat ihn verletzlich, aber auch glücklich gemacht.
Das Ende des Films bleibt offen. Bingham steht am Flughafen und schaut hinauf auf die Anzeigetafel. Reist er wieder zum nächsten Entlassungstermin, oder hat er ein Stück weit ausbrechen können aus dem Hamsterrad der völligen Entfremdung?
2.3.2010 t.t.
Aktuelles und Laufendes:
- Up in the Air [64]
Leute:
- Bingham [65]
Selbstmord und Leiden am Arbeitsplatz
- 7467 Aufrufe
Wir veröffentlichen nachfolgend das Einleitungsreferat, das wir in Frankreich bei Diskussionsveranstaltungen zum Thema Selbstmord am Arbeitsplatz und Arbeitsstress gehalten haben, nachdem in Frankreich z.B.bei France Télécom mehrere Beschäftigte Selbstmord am Arbeitsplatz begingen.
Das Auftauchen des Phänomens
Selbstmord am Arbeitsplatz ist kein ganz neues Phänomen, denn unter Bauern ist dieser schon seit längerem weit verbreitet. Der tiefere Grund ist, dass in diesem Bereich der private Lebensraum und der Arbeitsplatz im Allgemeinen miteinander verwoben sind. Die Wohnung des Bauern und der Hof, den er bewirtschaftet, befinden sich meist am gleichen Ort.
Das neue, seit Beginn der 1990er Jahre beobachtete Element ist, dass es zu mehr Selbstmorden am Arbeitsplatz in anderen Berufssparten, der Industrie und im Dienstleistungsgewerbe gekommen ist. Wenn sich jemand bei sich zu Hause oder an einem anderen Ort als am Arbeitsplatz umbringt, ist es nicht leicht zu beweisen, dass die Hauptursache der Geste in dem Leiden liegt, welches die Arbeit verursacht. Denn die Beschäftigten, die unter den Arbeitsbedingungen leiden, bringen sich nicht alle um, und diejenigen, die solch eine Tat begehen, sind meist ohnehin zerbrechliche Menschen. Darauf berufen sich die Unternehmen, um sich reinzuwaschen, wenn die Angehörigen versuchen, den Selbstmord eines Beschäftigten auf die Arbeitsbedingungen zurückzuführen. Wenn der Selbstmord aber am Arbeitsplatz selbst stattfindet, sind die Ausreden der Arbeitgeber schwieriger. Selbstmord am Arbeitsplatz muss man also als eine klare Botschaft der Person verstehen: „Nicht aufgrund des Bruch einer Liebesbeziehung, einer Scheidung oder eines ‚depressiven Wesens’ bringe ich mich um, sondern der Arbeitgeber oder das von ihm verkörperte System sind für meinen Tod verantwortlich.“
Die Zunahme von Selbstmorden am Arbeitsplatz aufgrund der Arbeitsbedingungen bringt somit ein viel breiteres Phänomen zum Ausdruck, von dem dies nur die Spitze des Eisberges ist: das immer größere Leiden, das durch die Arbeitsbedingungen hervorgerufen wird.
Das durch Arbeit verursachte Leiden ist auch wiederum kein neues Phänomen: Berufskrankheiten gibt es seit langem; vor allem seit der industriellen Revolution, welche die Arbeit für die meisten Lohnabhängigen zu einer wahren Hölle hat werden lassen. Kinderarbeit, 15 Stunden pro Tag, in großer Hitze und bei unausstehlichem Staub in einem Bergwerk oder einer Textilfabrik mit dem Lärm Hunderter Webstühle – all das war nie ein Vergnügen. Schon von Anfang des 19. Jahrhunderts an haben sozialistische Schriftsteller die Arbeitsbedingungen der Ausgebeuteten angeprangert. Gleichzeitig Trotzdem gehörte der Selbstmord vom 19. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts nicht zu den Reaktionen der Ausgebeuteten gegenüber dem durch die Arbeitsbedingungen verursachten Leiden.
Tatsächlich ist ein Selbstmord mehr auf ein psychisches als auf ein physisches Leiden zurückzuführen. Aber psychisches Leiden ist auch kein neues Phänomen. Die Chefs erniedrigen und drangsalieren ihre Beschäftigten seit jeher. Aber in der Vergangenheit führte dieses Leiden der Ausgebeuteten, von Ausnahmen abgesehen, nicht zum Selbstmord.
Die Zunahme des psychischen Leidens der Beschäftigten wurde Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre von den Arbeitsmedizinern festgestellt, insbesondere anhand der Zunahme von Skelett-Muskel-Erkrankungen (Bewegungsapparat, Gelenke usw.), die nicht im direkten Zusammenhang mit den physischen Arbeitsbedingungen standen, sondern auf psychosomatische Störungen zurückzuführen waren, d.h. physische Symptome eines moralischen Leidens am Arbeitsplatz.
Die spektakuläre Zunahme der Selbstmorde aufgrund des Leidens unter den Arbeitsbedingungen erscheint dann als zweite Etappe dieses Leidens, eine Art Zuspitzung des Phänomens.
Wie schätzen Spezialisten das Phänomen ein?
Selbstmord ist schon vor langer Zeit untersucht worden, insbesondere von dem Soziologen Emil Durkheim am Ende des 19. Jahrhunderts. Damals schon hatte Durkheim nicht einfach auf die Ursachen des Selbstmords beim Einzelnen hingewiesen, sondern die sozialen Ursachen aufgezeigt. «Wenn ein Einzelner durch die Umstände zu Fall gebracht wird und Selbstmord begeht, spiegelt das die Zustände einer Gesellschaft wider, wo jemand zum Opfer der Verhältnisse wird.»
Ebenso gibt es schon seit langem Untersuchungen, auch Untersuchungen der psychischen Aspekte des Leidens auf der Arbeit. Aber Untersuchungen über Selbstmord infolge der Arbeitsbedingungen sind eher jüngeren Datums, weil das Phänomen neu ist. Mehrere Hypothesen werden zur Erklärung vorgebracht, mehrere Feststellungen sind getroffen worden. Insbesondere die des Psychiaters, ehemaligen Arbeitsmediziners und Autors mehrerer berühmter Bücher über die Frage, Christophe Dejours, sind erwähnenswert (z.B. „Leiden in Frankreich: die Verharmlosung der sozialen Ungerechtigkeit“).
Einige Hypothesen :
1) Die Arbeit steht im Mittelpunkt: Die Arbeit (nicht nur als Mittel, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern als produktive und schöpferische Tätigkeit, die Anderen zunutze kommt) spielt eine zentrale Rolle bei der psychologischen Entwicklung jedes Einzelnen. Wenn man auf dieser Ebene leidet, hat dies letztendlich größere dramatische Folgen als ein Leiden, das aus dem privaten oder familiären Bereich herrührt. Wenn jemand in seinem Familienleben leidet, hat dies weniger Konsequenzen im Arbeitsleben als umgekehrt.
2) Die Anerkennung der Arbeit und ihrer Qualität seitens der Anderen. In einer hierarchisierten Gesellschaft wie der unsrigen kommt dies natürlich in der Anerkennung zum Ausdruck, die wir von unseren Chefs erhalten und in der Form des Lohns (man spricht hier von ‘vertikaler Anerkennung’). (…) Aber für die Beschäftigten gibt es eine im Alltag viel wichtigere Anerkennung: die Wertschätzung der Arbeit durch seine Kollegen. Ein Zeichen, dass sich jemand in die Gemeinschaft der «Leute seines Berufe » eingliedert, mit denen er seine Erfahrung und seine Kenntnisse teilt, wie auch seine Wertschätzung der Arbeitsqualität. Selbst wenn jemand kein hohes Ansehen bei seinen Chefs oder seinem Arbeitgeber genießt, weil sich jemand ihnen nicht unterwirft, kann man trotzdem ein gewisses Gleichgewicht aufrechterhalten, wenn die Kollegen nicht die Sichtweise der Vorgesetzten übernehmen und das Vertrauen in den Kollegen aufrechterhalten. Aber alles gerät aus dem Gleichgewicht, wenn man auch das Vertrauen der Kollegen verliert.
…. Einige Feststellungen
1) Eine immer größere Überlastung auf der Arbeit. Dies erscheint als paradox, denn mit der Entwicklung neuer Technologien, die die Automatisierung einer Reihe von Aufgaben ermöglichen, war von einigen Leuten schon das «Ende der Arbeit» angekündigt worden oder zumindest die Möglichkeit der drastischen Senkung der Arbeitsbelastung. Seit zwei Jahrzehnten sehen wir aber die entgegengesetzte Entwicklung. Das Arbeitspensum nimmt immer mehr zu. Das geht sogar so weit, dass man in einigen Ländern wie in Japan neue Begriffe entwickelt hat, wie Karôshi, ein plötzlicher Tod (infolge eines Herzinfarktes oder eines Schlaganfalls) von Leuten, die keine besondere Erkrankung hatten, die sich aber «auf der Arbeit umgebracht» haben. Dieses Phänomen ist nicht auf Japan beschränkt, auch wenn es in Japan ein besonderes Ausmaß angenommen hat. Auch in den USA und in Westeuropa gab es ähnliche Fälle.
2) Ein anderer Ausdruck dieser Arbeitsüberlastung, die einen neuen Begriff erforderlich machte, ist der «burn-out», die eine besondere Form der Depression infolge Erschöpfung ist. Der Begriff ist selbstredend: man ist völlig «ausgebrannt», weil man zu viel Energie verausgabt hat.
2) Das Aufkommen von Krankheiten infolge von Mobbing
Diese Erkrankungen sind heute relativ gut bekannt: Depressionssyndrom, Gedächtnisstörungen, Desorientierung in Raum und Zeit, ein Gefühl verfolgt zu werden, psychosomatische Störungen (insbesondere im Bereich der Gebärmutter, Brust, Schilddrüsen).
Christophe Dejours analysiert dieses Phänomen folgendermaßen:
«Mobbing am Arbeitsplatz ist nicht neu. Es ist so alt wie die Arbeit selbst. Was neu ist, sind die Erkrankungen. Das ist neu, weil es mittlerweile im Vergleich zu früher viele gibt. Immer mehr Leute werden für Mobbing anfälliger. […] Dies hängt mit der Destrukturierung dessen zusammen, was man «Verteidigungsstrukturen» nennt, insbesondere die kollektive Verteidigung und Solidarität. Dies ist das ausschlaggebende Element für die Zunahme von Erkrankungen. Mit anderen Worten – die Erkrankungen infolge Mobbings sind vor allem Erkrankungen infolge der Einsamkeit. […] Vor 30 oder 40 Jahren gab es auch Mobbing und Ungerechtigkeiten, aber es gab noch keine Selbstmorde auf der Arbeit. Diese Erscheinung hängt mit der zusammenbrechenden Solidarität unter den Beschäftigten zusammen.»
Dies ist ein sehr wichtiges Element des psychischen, mit der Arbeit verbundenen Leidens, und das zum Großteil eine Erklärung für die Zunahme der Selbstmorde liefert: Die Isolierung der Beschäftigten.
Was verstehen die Experten unter diesem Phänomen der Isolierung der Arbeiter?
Bei der Erklärung dieses Phänomen spielt laut Christophe Dejours die Einführung von Leistungsbeurteilungen jedes Beschäftigten während der letzten beiden Jahrzehnte eine große Rolle.
«Die individuelle Beurteilung, welche mit Zielvereinbarungen oder mit Zielmanagement und entsprechenden Leistungsvorgaben und Umsatzzahlen verbunden wird, bewirkt eine generalisierte Konkurrenz unter den Beschäftigten, unter Abteilungen im gleichen Betrieb, unter Filialen, Werkstätten usw.
Wenn diese Konkurrenz mit der Drohung von Entlassungen verbunden wird, führt dies zu einer tiefgreifenden Umwälzung der Beziehungen auf der Arbeit. Und die Arbeitsbeziehungen verschlechtern sich wiederum nochmals, wenn sie an perverse Prämiensysteme gekoppelt sind. Und wenn die Beurteilung nicht an Belohnungen geknüpft ist, sondern an Bestrafungen oder Entlassungsdrohungen, werden die schädlichen Auswirkungen greifbar. Die Individualisierung gleitet in ein Jeder-für-sich ab, die Konkurrenz mündet in unredliches Verhalten unter Kollegen, Misstrauen zieht ein unter den Beschäftigten.
Das Endergebnis der Beurteilungen und der damit verbundenen Maßnahmen ist schließlich die Untergrabung des Vertrauens, des Zusammenhaltes und der Solidarität. Schlussendlich werden die Schutzmechanismen gegen die krankmachenden Auswirkungen des Leidens und der Arbeitsbedingungen abgeschliffen.»
Er unterstreicht ebenfalls, dass einer der Gründe für den Erfolg dieser neuen Methoden der Unterwerfung in deren passiver Hinnahme durch die Mehrzahl der Beschäftigten liegt, insbesondere in dem Klima der Angst, das immer mehr zunimmt, vor allem der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes auf dem Hintergrund einer wachsenden Arbeitslosigkeit.
Er meint, die Einführung dieser neuen Methoden (die oft als angel-sächsisch bezeichnet werden, weil sie zunächst in den USA angewandt wurden) entspricht dem Triumph der liberalen Ideologie während der letzten 20 Jahre.
Er befasst sich auch mit dem «moralischen Leiden» : die Beschäftigten, die ein immer größeres, unerträgliches Arbeitspensum leisten müssen, und vor der Notwendigkeit stehen, dass man nicht zu verwirklichende Ziele anstreben muss, sind gezwungen zu pfuschen und «inderwertige Arbeit» abzuliefern, d.h. eine Arbeit zu verrichten, die sie moralisch verwerfen, wie z.B. bei der Telefonwerbung. Aber auch viele Führungskräfte spüren ebenso dieses moralische Leiden. Meist müssen sie diese neuen Methoden einführen und oft wird von ihnen erwartet, dass sie zu wahren Folterern werden. Dejours eint, der Aspekt der Zunahme des Leidens durch die Arbeit werde bei den Forderungen seitens der Gewerkschaften vernachlässigt.
Was halten wir als marxistische Organisation von diesen Auffassungen der Experten (insbesondere der von Christophe Dejours)?
Die IKS stimmt ganz und gar mit diesen Analysen überein, auch wenn natürlich unser Ausgangspunkt ein anderer ist. Christophe Dejours ist zunächst Arzt, der sich zur Aufgabe gesetzt hat, kranken Menschen zu helfen, hier Leute, die durch ihre Arbeit krank geworden sind. Aber seine intellektuelle Sorgfalt zwingt ihn die Wurzeln der Krankheit, von der er den Patienten heilen möchte, zu suchen. Die IKS versteht sich als revolutionäre Organisation, die den Kapitalismus mit der Perspektive seiner Überwindung durch die Arbeiterklasse bekämpft.
Aber wenn man jeden einzelnen Punkt aufgreift, kann man sehen, dass sie sehr gut mit unserer eigenen Auffassung übereinstimmen.
Die Arbeit im Mittelpunkt
Das ist eine der Grundlagen der marxistischen Analyse der Gesellschaft:
Grundlagen der marxistischen Analyse sind:
- Die Rolle der Arbeit, d.h. der Umwandlung der Natur, in der Entstehung der Menschheit wurde von Engels hervorgehoben, insbesondere in seiner Schrift: „Der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen".
- Die Produktionsverhältnisse, d.h. die Gesamtheit der Beziehungen, welche die Menschen bei der gesellschaftlichen Produktion ihrer Existenz eingehen, stellen aus der Sicht des Marxismus die Infrastruktur der Gesellschaft dar. Die anderen Bereiche, juristische Verhältnisse, Denkweisen usw. hängen in letzter Instanz von den Produktionsverhältnissen ab.
- Marx meinte, dass in der kommunistischen Gesellschaft, wenn die Arbeit von den Zwängen der kapitalistischen Gesellschaft befreit sein wird, welche diese oft zu einem wirklichen Unheil werden lassen, diese zum ersten Bedürfnis des Menschen werden wird.
Anerkennung durch andere
Dies ist eine der wesentlichen Grundlagen der Solidarität und der assoziierten Arbeit
Solidarität ist eine der Grundlagen der menschlichen Gesellschaft, eine Eigenschaft, die mit dem Kampf des Proletariats die höchst entwickelte Form annimmt: den Internationalismus. Solidarität wird nicht mehr gegenüber der Familie, dem Stamm oder der Nation bezeugt, sondern gegenüber der ganzen Menschengattung.
Assoziierte Arbeit bedeutet, dass man beim Produktionsprozess aufeinander bauen kann, sich gegenseitig anerkennt. Seit Beginn der Menschheit gibt es assoziierte Arbeit, aber in der kapitalistischen Gesellschaft ist sie am weitesten ausgedehnt. Diese Vergesellschaftung der Arbeit macht den Kommunismus notwendig und möglich.
Überlastung durch Arbeit
Sich auf unsere marxistische Auffassung stützend hat die IKS immer die Meinung vertreten, dass der technische Fortschritt keinesfalls als solcher eine Senkung des Arbeitspensums im kapitalistischen System mit sich bringt. Die «natürliche» Tendenz dieses Systems besteht im Herauspressen von immer mehr Mehrwert aus den Lohnabhängigen. Und selbst wenn die Arbeitszeit verkürzt wird (wie z.B. in Frankreich mit der 35 Stunden-Woche) ist das Arbeitspensum verdichtet, sind Pausen abgeschafft worden. All dies verschlimmert sich noch mehr unter dem Druck der Krise, welche die Konkurrenz zwischen den Betrieben und den Staaten verschärft.
Der Verlust an Solidarität lässt die Beschäftigen viel anfälliger werden für Mobbing.
Die IKS hat dieses Phänomen während der letzten beiden Jahrzehnte unter zwei Gesichtspunkten untersucht:
- Dem Rückfluss des Klassenbewusstseins und der Kampfbereitschaft in der Arbeiterklasse – als Folge des Zusammenbruchs der sogenannten ‘sozialistischen’ Regime 1989 und der Kampagnen vom angeblichen ‘endgültigen Sieg’ des ‘liberalen Kapitalismus’ und vom ’Verschwinden der Arbeiterklasse’.
- Den schädlichen Auswirkungen der zerfallenden kapitalistischen Gesellschaft, die Tendenzen wie des Jeder-für-sich, die Atomisierung, jeder muss sehen, wie er für sich selbst zurechtkommt, die Untergrabung der gesellschaftlichen Beziehungen (mehr dazu siehe unseren Artikel «Der Zerfall, Endphase der Niedergangsphase des Kapitalismus», Internationale Revue Nr.13)
- Diese beiden Faktoren liefern unter anderem die Erklärung dafür, dass seit der Kapitalismus in den letzten 20 Jahren neue Arbeitsmethoden einführen konnte, die eine entsprechende Reaktion Wirkung der Arbeiterklasse hervorgerufen haben, keine Abwehrkämpfe gegen diese wesentliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen stattgefunden haben.
- Wenn sich jemand wegen seiner Arbeit umbringt, gehört er in der Regel zu denjenigen, die gegen diese zunehmende Barbarei am Arbeitsplatz vorgehen möchten. Im Vergleich zu vielen anderen Kollegen unterwirft sich derjenige nicht passiv der Überlastung am Arbeitsplatz, dem Mobbing, der Verachtung gegenüber den Bemühungen, ‘gute Arbeit’ abzuliefern. Aber weil es noch keinen kollektiven Widerstand gibt, keine ausreichende Solidarität unter den Beschäftigten, bleiben sein Widerstand und seine Revolte gegen diese Verhältnisse individuell oder isoliert. Beide sind zum Scheitern verurteilt. In letzter Konsequenz dieses Scheiterns kommt es zum Selbstmord, der nicht nur ein Akt der Verzweiflung ist, sondern auch ein letzter Aufschrei der Revolte gegen ein System, das jemanden erdrückt hat. Die Tatsache, dass diese Revolte die Form der Selbstzerstörung annimmt, ist in letzter Instanz auch nur eine andere Erscheinungsform des Nihilismus, der die ganze kapitalistische Gesellschaft, welche sich auf dem Weg der Selbstzerstörung befindet, befallen hat.
- Wenn die Arbeiterklasse wieder massiv in den Kampf treten und die Solidarität wieder Einzug halten wird, wird es keine Selbstmorde auf der Arbeit mehr geben.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeitsstress [66]
- Selbstmord Arbeitsplatz [67]
- arbeitsbedingte Krankheiten [68]
- Arbeit Gesundheit [69]
Leute:
- Christophe Dejours [70]
Vigo/Spanien: Gemeinsame Vollversammlungen und Demonstrationen von Arbeitslosen und Beschäftigten
- 3597 Aufrufe
(Wir haben neulich eine Information aus der nordwestspanischen Hafenstadt Vigo über einen wichtigen Kampf erhalten, den wir hier gekürzt widergeben).
In Vigo (der Großraum der Stadt umfasst ca. 400.000 Einwohner) sind mehr als 60.000 Arbeitslose registriert. Allein im Jahre 2009 wurden im Metallbereich mehr als 8.000 Beschäftigte auf die Straße geschmissen. Nach einer Entlassungswelle wurden ca. 700 Beschäftigte in einer Auffanggesellschaft geparkt, mit der Zusage, dass sie jeweils – falls vorhanden - Stellenangebote erhalten würden. Als sie aber erfuhren, dass niemand jemals ein Stellenangebot erhielt, während gleichzeitig Billiglöhner aus dem Ausland herbeigeschafft wurden, die unter unvorstellbaren Bedingungen arbeiten sollten, (z.B. schliefen einige ausländische Beschäftigte auf Parkplätzen und hatten Geld nur für eine Mahlzeit am Tag) war das Fass übergelaufen. Die Arbeiter erklärten sofort, dass sie nichts gegen ausländische Arbeitskräfte hätten, man solle ihnen allerdings die tariflich vereinbarten Löhne zahlen. Tatsache war, dass mit den ausländischen Beschäftigten Lohndumping betrieben wurden, da sie nur 30-50% des Lohns spanischer Arbeiter bekamen. Dessen ungeachtet beschuldigten die Medien die spanischen Arbeiter sofort der Ausländerfeindlichkeit. Der Zynismus und das spalterische Verhalten der herrschenden Klasse sind unübertroffen. Wenn sich Beschäftigte gegen Lohndumping wenden, werden sie sofort der Ausländerfeindlichkeit des Rassismus und Nationalismus bezichtigt, ja man versucht ihnen gar rechtsextreme Gedanken anzuhängen.
Gemeinsame Vollversammlungen und Demonstrationen von Arbeitslosen und Beschäftigten
Am 3. Februar zogen die Arbeitslosen vor die Werkstore von Astilleros Barreras (dem größten Schiffsbaubetrieb in der Region) mit der Absicht, eine gemeinsame Vollversammlung mit den Beschäftigten dieses Betriebs abzuhalten. Da die Werkstore verschlossen waren, fingen sie an mit Megaphonen Parolen zu rufen und ihre Forderungen zu erklären, bis schließlich die große Mehrzahl der Beschäftigten das Werksgelände verließen und sich den Arbeitslosen anschlossen. Der Berichterstattung von Europa-Press zufolge „tauchten fünf Mannschaftswagen mit Sondereinheiten vor Ort auf. Die Polizisten bezogen dort Stellung in voller Montur, mit ihren Gummigeschossen ausgerüstet, aber schließlich zogen sie sich zur Straßenkreuzung Beiramar zurück.(…) Die Gruppe von Arbeitslosen und Beschäftigten zog demonstrierend in Richtung Bozas. Auf dem Demonstrationsweg durch den Industriegürtel schlossen sich Beschäftigte anderer Werften (wie Cardama, Armon, Freire-Asi) ihnen an, so dass die Arbeit in allen Schiffswerften niedergelegt wurde."
Das Beispiel verdeutlicht, wie die Solidarität und die Einheit unter den beschäftigten Kollegen und den Arbeitslosen konkretisiert werden kann; gemeinsame Vollversammlungen, Straßenkundgebungen um ihren Kampf den anderen Beschäftigten bekannt zu machen; Kontaktaufnahme und direkte Verbindung mit den Beschäftigen anderer Betriebe, um sie für den gemeinsamen Kampf zu gewinnen. D.h., eine Wiederholung der Ereignisse von Vigo 2006 (siehe dazu frühere Artikel auf unserer Webseite) Die Arbeiter wandten die Kampfmethoden an, die im Gegensatz zu den Spaltungen, dem Berufsegoismus, der Passivität, den typisch gewerkschaftlichen Methoden stehen.
Am 4. Februar wurden die gleichen Methoden wiederholt. Gegen 10 h vormittags zogen erneut Arbeitslose vor die Werkstore von Barreras. Erneut verließen die Beschäftigten das Werksgelände und schlossen sich ihnen an. Trotz der großen Polizeimobilisierung zogen sie gemeinsam in die Stadt. Die Zeitung "El Faro" aus Vigo meldete: "Der Protestzug wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Es gab einige Augenblicke große Spannungen, aber es kam schließlich zu keinen Zusammenstößen. Die Arbeitslosen demonstrierten in Beiramar und Bouzas, in Begleitung der Beschäftigten aus dem Viertel, und sie bekräftigten, dass sie weiterhin kämpfen werden, solange die Arbeitgeber nicht die Probleme der Arbeitsverträge lösen."
Aktuelles und Laufendes:
- Vigo [71]
- Arbeiterkampf Spanien [72]
- Solidarität Arbeitslose Beschäftigte [73]
- Vollversammlungen [45]
„Wildcat“ zur Krise - Wertvolle Anregungen des Nachdenkens
- 2577 Aufrufe
Ein Streifzug durch die Krisenherde
Allein in den Ausgaben Nr. 84 und 85 vom Frühjahr und Sommer 2009 beschäftigt sich Wildcat in sieben Artikeln mit der jüngsten Weltwirtschaftskrise. In „Update Krise“ (Nr. 84) beschreiben die Genossen das epidemische Ausmaß der Verschuldung des Staatshaushaltes und der privaten Haushalte in den USA – ein Ausmaß, das die Bonität der USA bei den Ratingagenturen beeinträchtige und „bereits jetzt zum Platzen der Mutter aller Blasen, des US-amerikanischen Bond-Bubble, führen“ könne.
Gleich zwei Artikel nehmen die Rolle der beiden Hauptakteure der Weltwirtschaft, China und die USA, und ihre fast schon „symbiotischen“ Beziehungen unter die Lupe: „Chimerika“ (Nr. 84) und „Alle Hoffnungen richten sich auf China“ (Nr. 85). Der Leser erfährt, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Nationen auf einem Prozess des Gebens und Nehmens beruhen, der kurzfristig durchaus die Weltwirtschaft stimuliert habe, längerfristig aber auf tönernen Füßen stehe: „In den Jahren zwischen dem Dot-com-Crash und dem Einsetzen der aktuellen Krise hat die Weltwirtschaft vor allem dank ‚Chimerika‘ funktioniert: der Symbiose zwischen den USA und China. Auf der einen Seite stand die gewaltige Verschuldung der US-amerikanischen Konsumenten, die mit ihrem Geld chinesische Waren kauften. Auf der anderen Seite die gewaltige chinesische Überproduktion und das Unvermögen, die vielen eingenommen Dollars produktiv in China anzulegen. Indem ein großer Teil der Einnahmen in US-Staatsanleihen zurückfloss, finanzierte China die amerikanischen Schulden, und der Kreis schloss sich. Damit ergab sich eine doppelte Abhängigkeit: Die USA sind von China als ihrem größten Kreditgeber abhängig, und China ist mit seinen über zwei Billionen Dollar Devisenreserven von der Stabilität des Dollar abhängig.“ („Alle Hoffnungen richten sich auf China“). Besser, als es die Genossen von Wildcat getan haben, kann man das Dilemma der US-chinesischen Symbiose nicht veranschaulichen. Dabei darf allerdings auch nicht vergessen werden, dass die USA und China Hauptkonkurrenten, ja tödliche Rivalen bleiben.
Noch ausgiebiger befassen sich die Genossen von Wildcat mit dem Phänomen der Spekulation. In „Wie die Welle auf den Boden kommt“ (Nr. 84) wird das Ausmaß der „Finanzialisierung der allgemeinen Reproduktionskosten“ geschildert, das dazu geführt habe, dass „viele Leute (...) gezwungenermaßen zu ‚Akteuren an den Finanzmärkten‘“ geworden seien. Gegenstand des Artikels „Wiederkehr der Realität“ (Nr. 84) ist die Alchimie der Finanzjongleure – die sog. „Mathematisierung des Finanzhandels“, mit der der Wert einer Anlage in der Zukunft vorhersehbar gemacht werden soll und die das globale Pilotenspiel mit den sog. Derivaten erst ermöglicht hat. Dieser Artikel gibt einen guten Einblick in die Scheinwelten postmoderner Vorturner wie Deleuze, Guttari oder Beaudrillard, die mit ihren Theorien über „signifikante Zeichenketten“ oder die „strukturale Revolution des Werts“ den Luftgeschäften an den Börsen die philosophischen Weihen verliehen haben.
Zweierlei fällt auf, wenn man diese Artikel auf ihren Inhalt abklopft. In all diesen Texten kommt ein hoher Kenntnisstand über die auslösenden Faktoren und die Erscheinungsformen der aktuellen Krise zum Ausdruck; sie sind gespickt mit Zahlen, Daten und Fakten zum aktuellen Stand der Dinge. Kurz: sie sind sehr anschauliche Schilderungen, fundierte Beschreibungen des Status quo der Weltwirtschaft. Doch die andere Aufgabe bleibt noch anzugehen, welche der Drang zur Wissenschaft immer auch von uns abverlangt: Den Dingen auf den Grund gehen, die tieferen Ursachen einer Oberflächenerscheinung zu beleuchten.
Profit- und Überproduktionskrise
In dieser Richtung versucht sich der Gastbeitrag von Paolo Guissani in Wildcat Nr. 84: „Des Kapitalismus neue Kleider“. Hier wird der Versuch unternommen, den Zustand des zeitgenössischen Kapitalismus in einen grundsätzlicheren, historischen Zusammenhang zu stellen. Der Autor dieses Beitrags fühlt sich dazu umso mehr bemüßigt, als es auch der marxistischen „Wirtschaftsliteratur“ (?) seiner Auffassung nach „noch nie gelungen ist, eine zusammenhängende Darstellung zu liefern, die dem magischen Wort ‚Krise‘ gerecht würde“.
Hauptgegenstand seines Beitrags ist die Umwandlung des Weltkapitalismus, die seit den 80er Jahren zu einer wachsenden „Verlagerung von Geldkapital in spekulative Anlagen“ geführt habe. So habe sich der Umsatz der Wall Street, der bis Mitte der 70er Jahre bei konstanten 15 Prozent des US-amerikanischen BIP gelegen habe, bis 2006 mehr als verzwanzigfacht (350%). Giussani weist darauf hin, dass im Unterschied zum Börsenboom der 20er Jahre heuer nicht nur Managergehälter und realisierte Profite an der Börse verzockt werden, sondern – „vermittelt durch die Fonds“ – auch Teile der Arbeitslöhne. Er behauptet sodann: „Ohne diese Verlagerung von Geldkapital aus der produktiven Akkumulation in spekulative Anlagen hätte es weder einen spekulativen Boom gegeben, noch hätte der Finanzsektor sich so sensationell ausweiten können.“
Doch warum fand diese Verlagerung statt? Was hat sie letztendlich bewirkt? Giussanis Antworten auf diese Frage erscheinen uns undeutlich. Da ist die Rede von einer „inneren Struktur der Aktiengesellschaft“, die der Grund dafür sei, „warum das moderne Kapital spontan zur Verwandlung in spekulatives Kapital tendiert“. Gleichzeitig räumt er ein, dass die Herrschaft des spekulativen Kapitals „einen anfänglichen Impuls von außen (braucht), denn niemand kann einen spekulativen Boom in Gang setzen“. Da es Giussani im Anschluss an dieser Feststellung jedoch versäumt, das Kind beim Namen zu nennen, können wir hier nur spekulieren, was denn nun nach seiner Auffassung den Impuls zum Börsenboom der letzten 20 Jahre gegeben hat. Wir denken, dass die Antwort darauf in seinen einleitenden Worten desselben Kapitels zu suchen ist: „Die parasitäre Transformation des Weltkapitalismus hat ihren Ursprung im Ende des Nachkriegs-Wirtschaftsbooms, der in die Rezessionen und in die Stagnation der 70er Jahre mündete, als der tendenzielle Fall der hohen Nachkriegs-Profitrate zu einem beträchtlichen Überschuss an Geldkapital führte.“
Nach seiner Ansicht würde der „Fall der Profitrate (...) mehr oder weniger direkt dazu führen, dass auch die Akkumulationsrate sinkt“. Und der einzige „Mechanismus“, der bisher in der Lage gewesen sei, den Fall der Profitrate umzukehren, sei der Weltkrieg gewesen. Leider hat es Giussani für überflüssig erachtet, diese Frage ausführlicher zu thematisieren, und sich stattdessen über Gebühr mit dem Phänomen der Aktiengesellschaft und der Spekulation gewidmet. So mutet es wie Schattenboxen an, auf Giussanis unterlassene Argumente in dieser zentralen Frage zu antworten: Stand am Anfang der Weltwirtschaftskrise allein der tendenzielle Fall der Profitrate?
Eine Fixierung auf die Profitraten als ausschließliche Krisenursache könnte dazu führen, die qualitativen Unterschiede zwischen den Wirtschaftskrisen im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhunderts zu ignorieren. Schließlich ist das Problem der immer höheren organischen Zusammensetzung des Kapitals fast so alt wie der Kapitalismus selbst. Dennoch waren die mehr oder weniger regelmäßigen „Zusammenbrüche“ der kapitalistischen Wirtschaft des 19. Jahrhunderts Wachstumskrisen eines juvenilen Kapitalismus; die Krisen von heute sind dagegen Manifestationen des Siechtums eines senilen Kapitalismus. Während der Kapitalismus zurzeit Marx‘ und Engels‘ aus jeder Wirtschaftskrise mit einem unerhörten Wachstumsschub hervortrat, taumelt der moderne Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts von einer Krise in die nächste und gerät dabei immer tiefer in den Sog seiner eigenen Widersprüche. Wie ist das zu erklären?
Wir meinen, dass der krisenhafte Fall der Profitrate im Kapitalismus heute wesentlich einhergeht mit einer allgemeinen Überproduktionskrise. Sicher, auch Letztere ist nichts Neues im Leben des Kapitalismus. Schon Marx erkannte, dass dem schier unendlichen Potenzial des kapitalistischen Produktionsapparates die eingeschränkte Konsumtionsfähigkeit der großen Masse gegenübersteht, die durch die „antagonistischen Distributionsverhältnisse“ verursacht wird. Sprich: der Massenkonsum wird systemisch begrenzt durch die Spaltung der Gesellschaft in Klassen, insbesondere durch den Warencharakter der Lohnarbeit. Die Konsumfähigkeit der Arbeiterklasse wird in elastischen aber engen Grenzen gehalten durch die Ausbeutungsmechanismen des Kapitalismus selbst.
Aber die Überproduktionskrisen zu seiner Zeit waren vorübergehend und erlebten schnell ihre Auflösung in der Erschließung neuer außerkapitalistischer Territorien. Die Überproduktionskrise in unseren Tagen ist hingegen permanent und kann nur dank einer schuldenfinanzierten, künstlichen Nachfrage mühsam eingedämmt werden, um dann wieder um so heftiger auszubrechen. Während im Zeitalter der Kolonialisierung das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate durch die Einbeziehung außerkapitalistischer Territorien eine Abschwächung erfuhr, wird es heute angesichts des erbitterten Kampfes der verschiedenen Produzenten um Anteile auf einem längst übersättigten Weltmarkt gar noch verschärft.
Die aktuelle Rezession ist unserer Auffassung nach zum wesentlichen Teil letztlich die Folge der immer größeren Schwierigkeiten des Kapitals, seinen Mehrwert auf den heillos überfüllten Märkten zu realisieren. Sie ist ferner das Ergebnis des jahrzehntelangen Krisenmanagements der Staaten, das sich darin auszeichnet, mittels der Politik des billigen Geldes und einer immer exzessiveren Verschuldung kurzfristig künstliche Nachfrage zu schaffen und langfristig für eine Verschärfung der Krisensymptome zu sorgen. Die Unmengen vagabundierenden Kapitals auf den Finanzmärkten wie die explodierenden Arbeitslosenzahlen, die Spekulationsblasen wie die sog. Wiedergeburt des Keynesianismus – sie sind alle in letzter Konsequenz auf einen Widerspruch zurückzuführen, der einst den Kapitalismus zur dynamischsten Gesellschaftsform in der Menschheitsgeschichte machte und ihn dazu antrieb, sich binnen kürzester Zeit die gesamte Welt untertan zu machen, und heute den Kapitalismus auf seiner verzweifelten Suche nach Märkten dazu treibt, sich selbst zu kannibalisieren. Es ist der auf die Spitze getriebene Antagonismus zwischen Produktion und Konsumtion: „Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde“. (Marx, Kapital, Bd. 3) Ried, 15.03.2010
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Paolo Guissani [75]
Weltrevolution Nr. 162
- 2402 Aufrufe
Abschiebung der Roma - Sündenböcke und ein Schleier über die Sparpolitik
- 2273 Aufrufe
Offensichtlich will Sarkozy weiter hart gegen die Migranten vorgehen. Nach der „Reinigung Frankreichs mit Hilfe des Kärchers“ (so seine Ausdrucksweise gegenüber den Unruhen in den französischen Vorstädten), mit dem Frankreich sich des „Unrats“ entledigen sollte, hat der französische Präsident nun eine verschärfte Unterdrückungspolitik gegenüber die Roma und Sinti angekündigt.
So wurden ca. einhundert Menschen eines Roma und Sinti-Lagers gewaltsam vertrieben, den Lagerbewohnern die Wohnwagen weggenommen, die Leute anschließend auf die Straße geworfen und schlimmer als Vieh behandelt - all das unter Waffenandrohung. Seit Ende Juli wurden mehr als 1000 Roma und Sinti aus Frankreich abgeschoben. Der Innenminister Hortefeux hofft, damit die Zahl von 9085 Abschiebungen nach Bulgarien und Rumänien im Jahre 2009 zu übertreffen, zumal seit Jahresbeginn schon mehr als 8.000 des Landes verwiesen wurden. Aber selbst im politischen Establishment Frankreichs äußerten mehrere „Stimmen“ ihre Ablehnung gegenüber dieser sehr fremdenfeindlich erscheinenden Politik, die einer Pogrompolitik gleicht. Lediglich Marine Le Pen und ihre Partei, die diese Politik seit mehr als 30 Jahren fordert, sowie die engsten Vertrauen Sarkozys wie Estro und… Kouchner haben die Haltung Sarkozys begrüßt,. Der Chef der französischen Diplomatie hat, und dabei konnte er sein Lachen wohl kaum unterdrücken, auf eine zweite Warnung der UNO mit den Worten reagiert: „Der Präsident der Republik hat nie eine Minderheit aufgrund ihres ethnischen Ursprungs benachteiligt“.
Selbst Villepin, der als Innenminister und schließlich als Premierminister unter Präsident Chirac zahlreiche migrantenfeindliche Maßnahmen unterzeichnet hatte, sprach sich vehement gegen diese Politik des Holzhammers aus, die einen „Makel auf der französischen Fahne“ hinterlasse. Bernard Debré, Abgeordneter der UMP aus Paris, zeigte sich „schockiert“ und unterstrich seinerseits das „Risiko des Abgleitens in die Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus“. Es kommen einem die Tränen!
Die Sozialistische Partei (PS), die dieses Vorgehen ebenfalls verurteilte, erklärte ebenso wie Rocard, dass man „seit den Nazis solch ein Vorgehen nicht mehr“ gesehen habe; sie kritisierten Sarkozy, jedoch nur, um ihn bei dessen Anstrengungen zu ermutigen. In einer Stellungnahme vom 18. August kritisiert die PS die Regierung, dass sie in den nächsten drei Jahren 3.500 Stellen bei der Polizei streichen will. Sie verkündete: „Nie hat es solch eine große Kluft zwischen den Worten und den Taten einer Regierung gegeben. Wenn die PS die Regierung kritisiert, dann nicht, weil die Regierung zu heftig auf dem Gebiet der Sicherheit vorgeht, sondern weil sie nicht wirklich handelt.“ Ja, die PS seit Joxe, Cresson und selbst Rocard weiß, wovon sie redet, schließlich hat sie selbst in den 1980er Jahren die ersten Charterflüge zur Rückführung von Migranten veranlasst.
Doch ungeachtet der Kritik, die aus allen Ecken zu hören ist - ob vom Papst, von der UNO oder der Europäischen Union - und trotz des wachsenden Widerstands der französischen Bevölkerung gegen diese widerliche Diskriminierungspolitik kündigten Sarkozy und sein Migrationsminister, der ehemalige Sozialist Éric Besson, am 24. August eine „Beschleunigung der Abschiebung bulgarisch und rumänisch stämmiger Bürger“ an. Dabei bedeutet die Ausweisung, die oft heuchlerisch als freiwillige Rückkehr dargestellt wird, dass die Menschen vor Ort verfolgt werden. Und um die „Schmarotzer“ und „Kriminellen“ daran zu hindern, erneut 300 Euro „Ausweisungsprämie“ zu beantragen, beabsichtigen die Behörden, biometrische Daten zu erstellen, um ihre Wiedereinreise nach Frankreich zu verhindern.
Mit diesen Verlautbarungen und der besonders heftigen Unterdrückungspolitik gegenüber den Roma verfolgt die Sarkozy-Regierung mehrere Ziele. Zunächst geht es darum, sich auf eine Randgruppe einzuschießen, die oft als rückständig und ungebildet angesehen wird, die angeblich eine geschlossene und wenig verständigungsbereite Gruppe darstellt, die daher sehr leicht kriminalisiert und zu einem Sündenbock für die Wirtschaftskrise gemacht sowie als Rechtfertigung für die allgemeine Unterdrückungspolitik des französischen Staates verwendet werden kann. Am widerwärtigsten ist, dass dieses „Volk“, das ohnehin auf die Müllhalden dieser Gesellschaft gedrängt wird, leicht instrumentalisiert werden kann. Der von Sarkozy geführte Angriff gegen die Roma konnte zurzeit allenfalls Mitleid auslösen, aber keine aktive Solidarisierungswelle innerhalb der Arbeiterklasse, zumal die meisten Rückführungen während der Ferienzeit stattfanden. Abgesehen von den hochtrabenden und heuchlerischen Erklärungen der Politiker und bestimmter politischer Gruppen waren keine ablehnenden Stimmen zu vernehmen.
Dieser große Medienrummel dient aber auch dazu, von den sozialen Spannungen, die aller Voraussicht nach diesen Herbst zunehmen werden, abzulenken. Und natürlich dient diese Propaganda als Rechtfertigung für Massenverhaftungen oder andere repressive Maßnahmen, wie z.B. die Androhung hoher Strafen gegen Migrantenfamilien, deren Kinder in Konflikt mit der Polizei geraten sind. Die Eltern sollen juristisch für die Taten ihrer minderjährigen Kinder zur Verantwortung gezogen werden, wenn die Kinder für ein Vergehen verfolgt oder bestraft werden oder wenn sie gegen Verbote und Auflagen verstoßen. Den Eltern drohen Strafen von bis zu zwei Jahren Freiheitsentzug und Geldstrafen in Höhe von 30.000 Euro, obwohl Arbeitslosigkeit, prekäre Lebens- und Arbeitsbedingungen und Armut diese Menschen oft gebrochen und außer Lage gesetzt haben, ihre Erziehungsrolle zu erfüllen.
Eines der Steckenpferde der neuen, von Sarkozy angekündigten Sicherheitsmaßnahmen ist die „Aberkennung der französischen Staatsbürgerschaft“. Eines der Argumente, die von den Befürwortern dieser Maßnahme vorgebracht werden, lautet : „Franzose zu werden ist ein Verdienst“ – ganz im Sinne von Raphaël Alibert, Justizminister unter Pétain, der im Juli 1940 ähnliche Worte gebrauchte, um ein Gesetz zu rechtfertigen, das die Schaffung einer „Kommission zur Überprüfung der Staatsangehörigkeit“ begründete, die später Hunderttausenden Franzosen deren Staatsangehörigkeit „aberkennen“ sollte, wobei es sich hauptsächlich um Juden handelte (2).
Solch eine Maßnahme kann natürlich heute nicht die gleiche Wirkung und denselben Einfluss haben wie 1940. Es handelt sich um eine sehr aufgeblasene Sache. Aber sie bietet den Vorteil, die Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse, zwischen französischen und ausländischen Arbeitern zu verschärfen. Sie ermöglicht einen Medienrummel um ein falsches Problem, die Frage der „Nationalität“, die den Interessen der Ausgebeuteten völlig entgegensetzt ist.
Nein, eine Nationalität zu erwerben ist kein Verdienst, und die Arbeiter haben nichts damit am Hut. Wie das Kommunistische Manifest von 1848 schrieb: „Die Arbeiter haben kein Vaterland“. Die Arbeiter müssen gemeinsam, unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer ethnischen oder nationalen Herkunft, diese Gesellschaft bekämpfen, die nichts als katastrophale Lebensbedingungen und eine schreckliche Zukunft für sie bereithält. Wilma, 27.08.2010
1) Und sein Kumpel Sarkozy war kein Opfer einer Verwechslung, als er Romas, „seit Jahrzehnten auf Wanderschaft befindliche Leute“ französischer Nationalität, Migranten und Delinquenten in einen Topf warf.
2) Sarkozy greift im Gegensatz zu Le Pen, dessen Wähler er abwerben will, nicht die Juden an. Laut jüdischer Tradition ist er übrigens selbst Jude, da seine Mutter Jüdin ist. Abgesehen davon, würde nach den Ereignissen des 2. Weltkriegs solch ein Verhalten seitens eines Präsidenten der Republik eher Unruhe stiften.
Aktuelles und Laufendes:
- Abschiebung Roma [76]
- Sintis [77]
- Sarkzoy Abschiebepolitik [78]
- EU Abschiebepolitik [79]
- Festung Europa [80]
Leute:
- Sarkozy [81]
Der Widerstand gegen die Sparpolitik ist international
- 1955 Aufrufe
Der Widerstand gegen die Sparpolitik ist international
In Südafrika ist die durch die Fußball-WM hervorgerufene patriotische Euphorie längst verflogen. In einem heftigen Streik von 1.3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, der von Lehrern und Krankenpflegern angeführt wird, kämpfen die Beteiligten um höhere Löhne. Die Krankenpfleger haben versucht, lebenswichtige Dienstleistungen in den Krankenhäusern aufrechtzuerhalten, aber in den Medien sind sie angeprangert worden, weil sie die Kranken und Verletzlichen im Stich gelassen hätten. Ihr Kampf aber erfreut sich großer Unterstützung in der Arbeiterklasse. Dem Streik haben sich Beschäftigte aus den Bereichen PKW-Produktion und Energieerzeugung angeschlossen, und eine kurze Zeit sogar Bergleute, gegen die jeweils Soldaten als Streikbrecher eingesetzt wurden, obgleich auch unter diesen die Unzufriedenheit zunimmt.
Unweit von Südafrika, in Mozambik, haben 30%ige Brotpreiserhöhungen Streiks und Unruhen in den Straßen der Hauptstadt Maputo, in Matola, Beira und Chimoio ausgelöst. Die Polizei hat brutal reagiert; sie schoss auf die Protestierenden – mit scharfer Munition und mit Gummigeschossen. Mindestens 10 Menschen wurden erschossen, Hunderte verletzt. Aus Ägypten wurden ebenso Zusammenstöße wegen der Erhöhung von Lebensmittelpreisen gemeldet. Die Preise für Lebensmittel steigen ständig an, insbesondere aufgrund zunehmender Dürreperioden und Überschwemmungen – wahrscheinliche Auswirkungen des Klimawandels, die große Schäden in der Landwirtschaft in Russland und Pakistan hervorgerufen haben. Die Medien äußern schon die Befürchtung, dass die Rebellion in Mozambik eine neue internationale Welle von Lebensmittelunruhen wie vor kurzem im Jahr 2008 auslösen könnte. Auf der ganzen Welt sind jetzt schon Millionen von Hunger bedroht und stöhnen unter den Folgen des ökonomischen und ökologischen Zusammenbruchs des Kapitalismus.
In Südafrika machten sich die Arbeiter über den offiziellen “feelgood” Slogan der WM „Feel it, it is here“ lustig und setzten dem ihren eigenen Slogan entgegen „Feel it, it is war“. Und der Klassenkampf ist international. Arbeiter in Ländern wie China, Bangladesh, Kambodscha, deren billige Arbeitskraft für fette Profite in den großen Multis gesorgt hat, weigern sich mittlerweile, sich den Auswirkungen der kapitalistischen Krise zu beugen. Riesige Streikwellen werden aus China und Bangladesh gemeldet, von denen viele außerhalb der Kontrolle der etablierten Gewerkschaften stattfinden, weil die Arbeiter diese als dem Kapital und Staat unterworfen und als korrupt ansehen. Die Herrschenden haben erneut mit brutaler Repression reagiert, aber auch mit dem Versuch, mehr „repräsentative“ Gewerkschaften aus der Taufe zu heben, die geschickter vorgehen, um die Arbeiter an der Leine zu halten. Eine ähnliche Taktik wird auch in Südafrika erkennbar, wo der Gewerkschaftskongress damit gedroht hat, seine Beziehungen zum regierenden ANC zu lockern, um sich gegenüber den unzufriedener werdenden Arbeitern als „unabhängige“ Kraft darzustellen.
In den höher entwickelten Ländern stehen die meisten Arbeiter nicht vor der Gefahr des Verhungerns; dennoch prasseln alle Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf sie nieder: explodierende Arbeitslosigkeit und von den Regierungen geschnürte Sparpakete. Arbeiter in Griechenland und Spanien, die mit am heftigsten von den neuen Sparmaßnahmen getroffen wurden, haben mit größeren Streiks und Demonstrationen reagiert. Aber woanders in Europa und Amerika entfaltet sich der Widerstand nur sehr zögerlich und zerstreut. Den Gewerkschaften gelingt es noch, einzelne Teile der Klasse getrennt voneinander zum Kampf aufzurufen – wie die Beschäftigten bei der britischen Fluggesellschaft BA und die U-Bahner in London. Dabei müssten eigentlich alle Beschäftigten gemeinsam mit gemeinsamen Forderungen reagieren. Noch mag es so aussehen, als ob es einen großen Graben gebe zwischen den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter und der ärmsten Schichten in den peripheren Ländern und den Alltagssorgen der Arbeiter in den kapitalistischen Zentren. Aber vieles deutet daraufhin, dass sich dies ändert. Aus dem jüngsten Kampf der Tekel-Beschäftigten in der Türkei z.B. ist eine Gruppe von militanten Arbeiter/Innen hervorgegangen, welche die Notwendigkeit der Kontaktaufnahme mit Arbeiter/Innen in anderen Ländern wie Deutschland und Griechenland erkannten, um ihre Kampferfahrungen auszutauschen und weiterzugeben. Dies wurde außerhalb der Kontrolle der Gewerkschaften organisiert, weil die „Plattform der kämpfenden Arbeiter“ verstanden hat, dass die Gewerkschaften nicht auf ihrer Seite stehen. Arbeiter aus Österreich und Deutschland besuchten sich gegenseitig. Auf einer breiteren Ebene können die massiven Kämpfe in den weniger entwickelten Ländern den Arbeitern im Zentrum des Kapitalismus ein Beispiel für die notwendige Entschlossenheit und den Mut liefern und aufzeigen, wenn diese sich nicht wehren, drohen sie Gefahr, ins furchtbarste Elend abzurutschen, denn die Krise des Kapitalismus kennt keinen anderen Ausweg. Amos 4.9.10
Aktuelles und Laufendes:
- China [82]
- Streiks in Bangladesh [83]
- Kambodscha [84]
- Südafrika [85]
Gegenstandpunkt und die IKS - Klassenbewusstsein: Ein individueller oder ein kollektiver Prozess?
- 4533 Aufrufe
Wir haben eine Zuschrift erhalten von einem Mitglied der Gruppe farbeROT aus Frankfurt, deren theoretische Grundlage der GegenStandpunkt (GSP) ist. Der Genosse schreibt, er sei zufällig auf unsere Webseite gestoßenr. „Von einigen Artikeln war ich positiv überrascht, was die konsequente Ablehnung von Nationalismus und bürgerlichem Staat mitsamt seines Herrschaftsprozederes anbelangt. Da ihr sagt, dass „die Diskussion auf der breitest möglichen Grundlage ein unabdingbares Mittel, um Klarheit zu erringen“ sei, gehe ich nicht davon aus, dass dieser Artikel böswillig Positionen des GegenStandpunktes falsch darstellt. Ihr scheint das einfach falsch verstanden zu haben. Ich stelle das einmal knapp richtig. Bei Bedarf führe ich das gerne weiter aus“. Der Genosse bezieht sich auf einzelne Stellen in unserer Presse, wo der Gruppe GegenStandpunkt die Haltung unterstellt wird, die Arbeiter als „nützliche Idioten“ und als „Arschlöcher“ zu beschimpfen, weil diese sich mit dem Kapitalismus identifizieren, statt, wie GegenStandpunkt selbst schreibt „dass sie ihren Verstand darauf verwenden, sich ein richtiges Bewusstsein von ihrer Lebenslage und deren Gründen zu erwerben“. Besonders bezieht sich der Genosse auf eine Stelle in unserer Presse, wo wir GSP bezichtigen, den Abwehrkampf des Proletariats gering zu schätzen. Er zitiert uns: „Mit Verachtung schauen sie auf jedwedes Bemühen der Arbeiter, ihren Lebensstandard innerhalb dieses Systems zu verteidigen“
Die Frage der Abwehrkämpfe
Dazu stellt der Genosse klar: „Allgemein: Wir beschimpfen nicht das Proletariat. Als „Lohnarbeiter“ sind(!) die Proletarier die nützlichen Idioten des Kapitals. Das ist mit dieser Rechtsordnung so festgelegt. Und weil es eben keine Freude ist, dieses bescheidene Leben zu führen, in dem man für den Reichtum verschlissen wird, von dem man ausgeschlossen ist, gehören auch nicht nur die Arschlöcher entmachtet, die das gut finden, sondern das System abgeschafft. Dafür würde allerdings schon ein konsequenter Lohnkampf reichen, der sich um die Notwendigkeit, von Staat und Kapital einen Dreck schert, der einfach mal ernst machen würde mit der Lüge(!), dass der Lohn doch ein Mittel für ein gutes Leben sei. Das stünde nämlich in einem unversöhnlichen Gegensatz zu dieser Gesellschaft, in dem der Lohn nichts anderes als ein Mittel des Profits ist. Wobei ein solcher Umsturz den Mangel hätte, dass er ein Ideal des Kapitalismus gegen die Wirklichkeit des Kapitalismus durchsetzen würde und somit ein – wenn auch idealisiertes – Prinzip des Kapitalismus zur neuen Maxime der neuen Gesellschaft machen würde. So etwas gab es ja schon und gut bekommen ist das den Arbeitern nicht. Folglich kritisieren wir die falsche Kapitalismuskritik und die daraus folgende Praxis von Sozialdemokratie und auch von den meisten kommunistischen Strömungen (Revisionisten, Revis). Denn diese kritischen und unkritischen Freunde des „Realsozialismus“ woll(t)en die Lohnarbeit und das Wertgesetz von den Fesseln des Kapitalismus befreien anstatt das die Mehrheit der Menschheit von deren schäbigen Rolle als Wertproduzenten zu befreien. Geld, Lohn, Preis, Zins, Kredit und Proft sind nämlich das Gegenteil einer Gebrauchswertproduktion, die gemäß der Bedürfnisse, Wünsche und Interessen Art und Menge der Produkte und Verteilung der Arbeit festlegt.
Kämpfe sind nicht schon deshalb etwas Positives, weil sie von Arbeitern geführt werden. Es kommt eben immer darauf an, wofür gekämpft wird. Wenn das z. B. die Forderungen des DGB sind, dann kann das für die Arbeiterklasse nichts Gutes bedeuten. Denn die berücksichtigen schon immer, dass die Gegenseite davon keinen Schaden nimmt: „Die Verhältnisse waren im Jahr 2009 wie ausgewechselt. Der Boom fand ein abruptes Ende, im vierten Quartal 2008 verzeichnete die deutsche Stahlindustrie einen Rückgang beim Auftragseingang um über 40 %, für 2009 wird ein drastischer Produktionsrückgang erwartet. Die Unternehmen reagierten personalpolitisch zunächst mit der breiten Einführung von Kurzarbeit in der gesamten Branche. Die IG Metall kündigte die Tarifverträge zum 31.3.2009 und beschloss erst kurz vorher eine Tarifforderung von 4,5 % bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Das war die bei weitem niedrigste Tarifforderung unter den größeren Branchen in dieser Tarifrunde.“ (https://www.boeckler.de/102230_95783.html [86]) Die IG Metall hat hier nicht in Hinblick auf das, was die Arbeiter bräuchten eine Forderung aufgestellt, sondern sich von vornherein an der Lage der Wirtschaft orientiert. Das ist eine Interessensvertretung, die ganz und gar unbekömmlich ist für die Lohnabhängigen. Dafür spenden wir keinen Applaus – auch keinen kritischen. Man klopft ja seinem besten Freund auch nicht auf die Schulter, wenn er sich etwas vornimmt, was ihm nicht gut bekommen wird.
Der Kampf der Arbeiterklasse für ihr Auskommen im Kapitalismus ist nichts Gutes, sondern eine pure, bleibende Notwendigkeit. „Um überleben zu können, mussten die Lohnarbeiter rebellisch werden. Zu arbeiten, wie es von ihnen verlangt wird, und sich mit dem gezahlten Lohn zu bescheiden – das langt nicht; mit Dienst nach dem Geschmack der Eigentümerklasse und Fügsamkeit nach Vorschrift der politischen Ordnungsmacht liefern sie sich bloß dem Zerstörungswerk aus, das ihre Arbeitgeber gemäß den Sachgesetzen ihres Metiers und ihrer Konkurrenz an ihrer Arbeitskraft vollziehen. Um sich zu erhalten und mit dem Verdienten über die Runden zu kommen, sind sie zu einer Zusatzanstrengung gezwungen: Sie müssen sich zusammentun und neben ihrer Lohnarbeit um aushaltbare Arbeitsbedingungen, um Lohn und um ein Minimum an lebenslanger Existenzsicherheit auch noch kämpfen. Gegen die Kapitalisten und gegen die Staatsmacht, die deren Interessen ins Recht setzt, so dass eine ganze Produktionsweise daraus wird, müssen sie sich als Gegengewalt aufbauen – und das nur, um überhaupt auf Dauer als ausgebeutete Klasse funktionieren zu können: ein politökonomischer Zynismus der höchsten Güteklasse.“ (Decker / Hecker, „Das Proletariat“, S. 29) Der Lohn ist und bleibt ein Mittel des Kapitals, um sein Kapital zu vermehren. Insofern hat jeder Kampf, der dieses Verhältnis nicht angreift, einen theoretischen und praktischen Mangel: Er schafft den Grund für die schlechte Lage der Arbeiterklasse nicht aus der Welt. Wenn man nicht genug Leute beisammen hat, um diesen Kampf aufzunehmen, dann kann doch daraus niemals der Schluss folgen, dann alle Kämpfe sein zu lassen.“
Wir wollen bereits an dieser Stelle anmerken, dass wir uns über diese Zuschrift sehr gefreut haben. Vor allem deren konstruktive Haltung begrüßen wir, die zunächst darin besteht, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen als eine erste Vorbedingung für einen Dialog, welcher einer wirklichen Klärung dienlich sein kann. So ist es aus unserer Sicht eine wichtige Richtigstellung, wenn der Genosse deutlich macht, dass es ihm (und hier möchte er für die Gruppe GSP insgesamt sprechen) nicht um die Geringschätzung des Abwehrkampfes geht, sondern im Gegenteil um deren Durchführung ohne Rücksicht auf die Verluste (des Kapitals) bis zur letzten revolutionären Konsequenz. Nicht hier liegt, so der Genosse, der Streitpunkt zwischen IKS und GSP.
Die Frage der Bewusstseinsentwicklung
„Aus meiner Sicht kommt eine entscheidende Differenz zwischen euch und uns (GegenStandpunkt) in der Frage, wie sich revolutionäres Bewusstsein entwickelt, zur Geltung. Ihr seht das, wenn ich euch richtig verstehe, als einen historischen Prozess an, der sich – so würde ich das kritisch bezeichnen – durch die Aktion der Arbeiter getrennt von ihrem individuellen Bewusstsein vollzieht und dann als dem einzelnen nicht bewusstes Wissen des Proletariats, sozusagen als latentes Bewusstsein, vorhanden ist. Wir hingegen sehen das ganz schlicht. Wer etwas tut, denkt sich etwas dabei. Wenn ein einzelner Prolet mit seiner Lage unzufrieden ist und sich klar macht, woran das liegt, dann erkennt er auch seine Ohnmacht im Kapitalismus: Der Staat zwingt ihn per Gesetz die Gesetze einzuhalten, deren Inhalt ist: Du darfst alles machen, wozu dich dein Eigentum in Stande setzt, d.h. Im Fall des Lohnarbeiters: sich für Profitinteressen von Kapitalisten dienstbar machen und dafür einen Lohn zu erhalten, der sich nicht nur nicht an den materiellen Interessen eines Lohnarbeiters bemisst, sondern der als Mittel für Profit tauglich sein muss, also nie niedrig genug sein kann. Mit diesem Bewusstsein seiner Lage fällt eine weitere Erkenntnis zusammen: Es gibt noch mehr von seiner Sorte und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Und von all denen hängt die ganze Gesellschaft ab: Ohne ihre Ausbeutung gäbe es keinen Profit und damit keine Kapitalistenklasse und folglich wäre dem kapitalistische Staat seine finanzielle Grundlage. Die Gesetze, die alle Staatsbürger auf die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Eigentum verpflichten, wären nicht das Papier wert, auf dem sie stehen, ohne ihr Wahlkreuz hätte der Staatsapparat nicht die Legitimation, dass das Volk ihn als Herrschaft über sich haben will – kurz gesagt: das richtige Bewusstsein von seiner Lage zeigt den Proleten ihre Ohnmacht im Kapitalismus auf und macht die Notwendigkeit klar, dass sie den Kapitalismus beseitigen müssen, wenn sie den Schäden ihres Materialismus (inkl. Ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit) entgehen wollen – und zeigt ihnen zugleich noch den Weg auf.“
Wir stimmen den Ausführungen des Genossen hier in zwei ganz wesentlichen Punkten zu. Erstens darin, dass die Unterschiede in der Auffassung darüber, wie proletarisches Klassenbewusstsein entsteht und sich entwickelt, eine der Hauptdivergenzen zwischen unseren beiden Gruppen darstellt. Zweitens darin, dass für die IKS dieser Prozess ganz entscheidend ein historischer und kollektiver Prozess ist, wobei diese beiden Dinge für uns unzertrennlich zusammen gehören. Denn, marxistisch gedacht, halten wir es für erwiesen, dass die Geschichte nicht durch Einzelne, sondern durch soziale Gruppen und Verbände (in der Klassengesellschaft im wesentlichen durch Klassen) der Gesellschaft „gemacht“ und „bestimmt“ wird.
Die Frage des Kollektivs
Dies gilt erst recht für die Geschichte des proletarischen Kampfes, da der vereinzelte Proletarier der Macht des Kapitals tatsächlich hilflos ausgeliefert ist, und erst durch den Zusammenschluss mit Anderen ein bewusster, zielgerichteter Kämpfer/In, ja im vollen Sinne ein menschliches Wesen wird. Und da fällt es auf, dass der Genosse, wenn er die eigene Sichtweise der Bewusstseinsentwicklung darstellen will, sofort vom „einzelnen Prolet“ ausgeht, der „mit seiner Lage unzufrieden ist und sich klar macht, woran das liegt.“ Erst in einem zweiten Schritt realisiert dieser fiktive, alleinstehende Lohnarbeiter, dass es „noch mehr von seiner Sorte“ gibt, „und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit“. Warum ist dieser unterstellte Proletarier, dieser – sagen wir mal – Robinson Crusoe der Lohnarbeit, der irgend wann auf seiner Insel seinen Mann Freitag entdeckt, hier nicht als zu unterwerfender Sklave, sondern als bereits versklavter Klassengenosse, aus unserer Sicht fiktiv? Denn in der Wirklichkeit wird unser Lohnarbeiter bereits in die Klassengesellschaft hineingeboren, wächst in einer Familie, in einer Nachbarschaft auf, die bereits von der Lohnsklaverei abhängig ist – oder eben in eine andere Familie und eine andere Nachbarschaft, wo er bereits die Furcht davor kennengelernt hat, proletarisiert zu werden. Kurzum: Unser Lohnarbeiter ist kein Einzelner, sondern wächst in der bestehenden Gesellschaft auf und wird davon entscheidend geprägt. Schon als junger Mann, als Lehrling oder als Hilfsarbeiter oder als „ewiger Praktikant“ im Büro oder im Krankenhaus lernt er - muss er lernen –, mit wildfremden Menschen, die ganz anderen Kulturkreisen angehören, zu kooperieren. Damit die moderne Produktion überhaupt vonstatten gehen kann, muss er lernen, Teil eines Kollektivs zu werden, Bestandteil einer gemeinsamen Intelligenz und eines Zusammenhaltes. Und zwar deshalb, weil der Kapitalismus weitestgehend die Produktion mit einzelnen Produktionsmitteln ersetzt hat durch Produktionsmittel, die nur durch ganze Gruppen von Arbeitern, durch die Assoziation der Arbeit (wie Marx das nennt) überhaupt in Gang gesetzt werden können, und welche Netzwerke entstehen lassen, wirtschaftliche Zusammenhänge, welche von vorn herein weltumspannend sind.
An dieser Stelle eine Präzisierung. Der Genosse schreibt, dass für die IKS die Bewusstseinsentwicklung sich „durch die Aktion der Arbeiter getrennt von ihrem individuellen Bewusstsein“ vollzieht. Es ist nicht so, dass das kollektive Bewusstsein „getrennt“ wäre von dem individuellen Bewusstsein der einzelnen Lohnabhängigen, sondern dass das Proletariat mehr ist als die Summe seiner Bestandteile, und dass sein Klassenbewusstsein weitaus mehr ist als das Bewusstsein der einzelnen ArbeiterInnen. Im bürgerlichen Alltag ist der Lohnabhängige ein Bürger wie andere auch, wie jeder andere der Atomisierung dieser Gesellschaft ausgeliefert, und in dieser Eigenschaft macht man auch z.B. das Kreuz auf den Wahlzettel. Zugleich aber bleibt der Lohnabhängige auch im Alltag geprägt von der Erfahrung der assoziierten Arbeit – ein Spannungsverhältnis, welches zugespitzt sozusagen beinahe schizophrene Formen annehmen kann. Die assoziierte Arbeit im Rahmen der kapitalistischen Ausbeutung ist gewissermaßen der Sockel, die permanente materielle Grundlage des Klassenbewusstseins. In diesem Sinne ist die Befreiungsbewegung des Proletariats – und damit auch der Abwehrkampf dieser Klasse - mehr als nur eine Messer- und Gabelfrage. Es ist eine große kulturelle Bewegung. Es ist die Verteidigung und die Entfaltung der Prinzipien der – internationalen – Solidarität und des Geistes der Kooperation, welche im Wesen der assoziierten Arbeit stecken, und zwar gegen das bürgerliche Prinzip des Jeder für sich, das die Gesellschaft insgesamt deswegen beherrscht, weil die Produktion im Kapitalismus zwar „vergesellschaftet“ ist, die Aneignung der Früchte dieser Arbeit aber privat und individuell geblieben ist. Es gibt in der Tat keine andere Lösung dieses Widerspruchs als die kommunistische Revolution.
Dieses Klassenbewusstsein ist, wie der Genosse unsere Position richtigerweise beschreibt, „latent“ vorhanden, und findet seinen klarsten und dauerhaftesten Ausdruck im Vorhandensein der revolutionären Theorie und der revolutionären Organisationen. Damit dieses Potential sich entfalten kann und zu einer materiellen Kraft wird, muss aber der Klassenkampf sich entfalten. Dies schafft den Rahmen, worin die von dieser Gesellschaft uns aufgedrängte Identität als „Bürger“ und Konkurrenten untereinander durch echtes Klassenbewusstsein zurückgedrängt werden kann. Entscheidend aber ist und bleibt, dass dieser Prozess ein kollektiver ist: sowohl die Lohnarbeit selbst als auch der Kampf der Lohnarbeiter ist per se ein kollektiver.
Die Frage der Intervention
Kurzum: Während GSP die Entwicklung des Klassenbewusstseins im Wesentlichen als einen individuellen Prozess zu begreifen scheint, ist die IKS ganz entschieden gegenteiliger Meinung. Und das hat offenbar wesentliche Konsequenzen, was das Selbstverständnis und die Aktivität der beiden Gruppen betrifft. GSP begreift seine Aufgabe unserem Eindruck zufolge ein wenig im Geiste der bürgerlichen Aufklärung, im Wesentlichen darin, den einzelnen Arbeiter zum Marxismus zu erziehen. Für uns hingegen ist der Marxismus selbst ein Produkt des kollektiven Klassenkampfes. Die revolutionäre Organisation selbst ist ein Teil der Klasse, Ausdruck von und aktiver, vorantreibender Teil des Klassenkampfes. In Bezug auf die Abwehrkämpfe der Klasse mag der entscheidende Unterschied in der Tat nicht darin liegen, dass GSP diese Kämpfe „verachtet“, sondern darin, dass GSP sich nicht an diesen Kämpfen beteiligt, um sie in einer Klassenrichtung voranzutreiben?
Ja, die Arbeiterklasse muss „erzogen“ werden. Aber ist der Kampf selbst nicht die große Schule der Befreiung der Arbeit? Und müssen dabei nicht auch die Erzieher erzogen werden, wie Marx es formulierte?
Die Frage der „Beschimpfung“ der Klasse
Wir haben bereits gesagt, dass das proletarische Klassenbewusstsein nicht nur kollektiv, sondern zugleich auch historisch ist. Soll heißen: Das Klassenbewusstsein ist nicht nur mehr als die Summe der einzelnen Bewusstseinszustände, es ist auch mehr als der Bewusstseinsstand einer einzelnen Generation der Klasse, ist somit ein kumulativer Prozess. Auch dieser Aspekt ist sehr entscheidend, denn weder der Zustand der Gesellschaft noch der des Klassenbewusstseins ist statisch. Beide befinden sich in ständiger Entwicklung. Diese Tatsache lässt übrigens GegenStandpunkt unserer Ansicht nach unberücksichtigt, wenn er die „Revis“ sprich, die Sozialdemokratie, die Stalinisten (und auch die Gewerkschaften) „beschimpft“ und sie dabei noch irgendwo als Ausdruck der Arbeiterklasse ansieht (und somit die Klasse irgend wie doch beschimpft?). Und zwar ohne die Frage zu stellen, ob das Zeitalter nicht vorbei ist, in dem die Arbeiterklasse noch über eigene Massenparteien und über permanente wirtschaftliche Abwehrorganisationen wie die Gewerkschaften überhaupt noch verfügen kann! Aber das wäre Gegenstand einer weiteren Diskussion…. (IKS 20.09.2010) .
Aktuelles und Laufendes:
- Gegenstandpunkt [87]
- Klassenbewusstsein [88]
Leserbrief: Populismus und Demokratie
- 2888 Aufrufe
Folgende Stellungnahme zur aktuellen Lage in der Welt ist am 26. August 2010 von einem engagierten und kämpferischen Leser unserer Presse eingegangen:
Eine Welt der Barbarei
„Das Schicksal der Sinti und der Roma in den letzten hundert Jahren ist ein schlagender Beweis und Anklage gegen das herrschende Profitsystem. Allein in der Zeit der Nazi-Barbarei sind schätzungsweise eine halbe Million von ihnen auf brutalste Art und Weise ermordet worden. Nun ist wieder das Profitsystem in einer der größten Krisen seines Bestehens eingetreten. Der weltweite Präventionskrieg der Herrschenden gegen die Errungenschaften der Arbeiter wird mit einer anderen Dimension ergänzt: Mit der Hetze gegen die Sinti, Roma, Muslime und die Formierung faschistischer Einschüchterungs-Truppen europaweit. In Ungarn, Rumänien, Italien und neuerlich in Frankreich werden Sinti und Roma wie Aussätzige behandelt: Die Welt verwandelt sich für diese Ethnien in einen Planeten ohne Visum! Der Burkha-Streit in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien und Niederland ist ein Bestandteil dieser zweiten Dimension des Präventivkrieges. Das gestankvolle Erbrechen eines Sarrazins ist ein eindrucksvoller Beweis des Zusammenrückens der verängstigten, noch gutbetuchten Mittelschichten und der deklassierten Elemente der Gesellschaft: Sarrazin liefert die Theorie der Brandstiftung! Sobald diese Theorie die Köpfe der deklassierten Elemente erreicht hat, wird sie zur furchterregenden materiellen Kraft! In den USA die Demonstrationen der Rechten gegen den Moschee-Bau, die rechts-radikale christliche Offensive in Form von Tea-Party sind unbestreitbare Anzeichen der Erstarkung der finsteren Kräfte der Gesellschaft! In der Schweiz wird eine erneute Debatte über die Wiedereinführung der Todesstrafe entfacht. In Deutschland wird in Form der Abschaffung des allgemeinen Wehrdienstes ein „kalter Putsch“ organisiert. Die Medien bereiten propagandistisch einen Angriff auf Iran vor. Die Steigerung der Ungleichgewichte zwischen China und Deutschland einerseits und den USA andererseits werden sehr bald in einen Handelskrieg übergehen! Die national-konservativen und rechten Denkfabriken sind dabei, den erwachenden Massen und der Jugend ein falsches Ziel vorzusetzen und von der Krise abzulenken, in dem sie wieder wie in der 30er Jahren des letzten Jahrhunderts den Weg für die offene Barbarei ebnen. Die drohende Wiederkehr der Rezession geht Hand in Hand mit dem scharfen Angriff auf die sozial Benachteiligten.
Werdet wach, morgen wird zu spät sein!“
Diese Stellungnahme bringt vieles der jetzigen Weltlage auf den Punkt. Insbesondere zeigt sie deutlich auf, dass das kapitalistische System die Ursache der allgegenwärtigen Barbarei ist, und dass die neue Stufe der kapitalistischen Krise – eine auswegslose Lage der Weltwirtschaft, blinde Hinwendung zum Krieg, Identifizierung der inneren Feinde – sozusagen der Motor der momentanen Zuspitzung dieser Barbarei darstellt.
Die Rolle der Zwischenschichten und der Brandstifter
Darüber hinaus geht es dem Genossen offenbar vor allem um zwei theoretische Fragen,
einerseits die besondere Rolle der Mittelschichten und der Deklassierten
zu unterstreichen und andererseits die Rolle der Brandstifter, welche
diesen Schichten ohne Zukunft die Themen zuwerfen. In einer zweiten
Stellungnahme vom 9. September schreibt
er dazu u.a.
„In der Zeit der Krise gerät aber die soziale Stellung dieser Schicht
unter das Feuer der Interessen der bis zur Zerrissenheit angespannten, sich
feindlich gegenüberstehenden Klassen: Die Mittelschicht verliert den Boden
unter den Füßen. Die gestrige Selbstüberschätzung verwandelt sich in Angst- und
Panik-Attacken. Alle die gesellschaftlichen Klassen sind ihrer sozialen
Stellung und ihrem sozialen Bewusstsein nach zutiefst heterogen. Im Gefüge
dieser Heterogenität kulminiert sich das zusammengedrängte Dasein der Klassen
und Schichten in der Aktion der Personen und der Individuen. Daher die Rolle
der Persönlichkeit in der Geschichte. Diese Rolle wird in den historischen
Übergängen von zufälligen Charakteren repräsentiert. Diese Personen haben eine
Rolle zu bewerkstelligen: Die Fackel der gesellschaftlichen Mission aus ihren
zitternden Händen an die historischen Persönlichkeiten weiterzureichen. Sie
sind im Grunde die zeitweilige Brücke, der Steigbügel: Sie sind der Ausdruck
des kurzen Übergangs zwischen den historischen Abläufen, sie sind der Ausdruck
des vergangenen gestrigen Tages und des noch nicht geborenen morgigen Tages.
Die Repräsentanten des Kleinbürgertums sind in diesen Übergängen der Ausdruck
der längst verloren gegangenen gestrigen Selbstüberschätzung und noch nicht zum
Prozess gewordenen Panik- und Angst-Abläufen. Sarrazin ist so eine Brücke: Er
hat die Aufgabe, die furchtbare Frage aufzuwerfen und sich hinter der Bühne der
Geschichte aufzulösen; so zufällig wie er kam, wird er auch sein Dasein fristen
und endlich von dem schwarzen Loch der Geschichte aufgesaugt werden, als ob es ihn
nie gegeben hätte. Die unter der Wirkung der Zentrifugalkräfte taumelnde
bürgerliche Gesellschaft wird jedes Wort von ihm aufsaugen und diesen Unrat wie
eine wundersame Pflanze in sich bewahren und kultivieren. Sarrazin ist
das Bindeglied zwischen den längst deklassierten Elementen und den von der
wirklichen oder vermeintlichen Deklassierung bedrohten Schichten. Sarrazin ist
der Ausdruck des eckel-erregenden Egoismus des in Panik geratenden
Kleinbürgertums. Sarrazin ist der Vagabund des zufälligen Beischlafes. Er wird
so schnell verschwinden wie er aufgetaucht ist, der Embryo droht im Bauch der
von Fäulnis befallenen bürgerlichen Gesellschaft zu einer Kreatur anzuwachsen.
Sarrazin hat als gesellschaftliche Figur seine Aufgabe schon erfüllt. Nun
werden die Schar der Journalisten und der Politiker sich seinen Kotzhaufen
zueigen machen: Das Opfer wird der Täter! Jeder wird dann vom
"Nicht-Integrationswilligen" sprechen. Dank Sarrazin wird die Tiefe
des kulturellen Verfalls der heutigen Gesellschaft sichtbar. Themen, die vor
zwei Jahren nur in Nazi-Blättern zu finden waren, werden ganz normal die besten
Sendezeiten im Fernsehen befüllen und als Hauptartikel in allen
Massen-Zeitungen erscheinen: Nicht der barbarische Kapitalismus ist seit 3
Jahren in einer ausweglosen Krise, nein die "Nicht-Integrationswilligen
Türken, Muslime" und die "Gene" des ewigen Juden sind das
Hauptproblem! Sarrazin ist der Ausdruck der qualitativen Änderung des
gesellschaftlichen Klimas“.
Wir wiederholen an dieser Stelle: Wir unterstützen im Wesentlichen die Analyse der Zuspitzung der Barbarei, welche der Genosse hier liefert. Das bedeutet nicht, dass wir alles teilen, was er darüber schreibt. Beispielsweise bezeichnet er die nun beschlossene Umwandlung der Bundeswehr in eine reine Berufsarmee als einen „kalten Putsch“ (was er damit meint, ist uns unklar), während für uns alle maßgebenden Fraktionen des deutschen Kapitals seit dem Ende des Kalten Kriegs gemeinsam und mehr oder weniger bewusst und zielstrebig auf dieses Ziel hingearbeitet haben.
Wichtiger aber als diese Detailfragen erscheint uns der theoretische Rahmen zu sein, welchen der Genosse entwickelt, insbesondere die Eckpunkte der Mittelschichten und der Brandstifter. Dabei greift der Genosse Ideen wieder auf, welche Trotzki Ende der 1920er und Anfang der 1930er Jahre anwandte, um die damalige Zuspitzung der Barbarei, um das Phänomen des aufkommenden Nazismus zu analysieren: die Rolle der Zwischenschichten, aber auch die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte. Wir sind damit einverstanden, dass gerade die Zwischenschichten besonders anfällig sind gegenüber dem Gift des Rassismus und des Populismus. Richtig ist auch, dass in manchen Lagen der Brandherd seinen Brandstifter braucht, um das Ganze zum Lodern zu bringen.
Und wir wollen klarstellen, dass wir diese Faktoren für unentbehrliche Bestandteile einer marxistischen Analyse halten. Nicht zuletzt diese Einsichten Trotzkis in die Bewegungen in der Tiefe der kapitalistischen Gesellschaft ermöglichten es ihm, zu einem frühen Zeitpunkt die welthistorische Bedeutung des Faschismus und insbesondere des Nazismus zu erkennen, während die stalinistisch entarteten „Kommunistischen Parteien“ mit ihrer Pervertierung des Marxismus auch nach 1933 das Hitlerregime für ein vorübergehendes, unbedeutendes Phänomen hielten, welches sich kaum mehr als ein paar Monate würde halten können.
Aufgrund einer verfeinerten und mit einem weiten Horizont operierenden Analyse können wir auch heute beispielsweise feststellen, dass die führenden Fraktionen der herrschenden Klasse zwar heilfroh sind, das Spaltpotential der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Vorurteile wo immer möglich gegen den Klassenkampf des Proletariats einzusetzen, und dennoch nicht alles beherrschen, was aus der Kloake ihrer Gesellschaft emporsteigt. So musste z.B. der US-amerikanische Präsident Obama höchst selbst in den politischen Ring steigen, um die in Florida von christlichen Fanatikern geplante öffentliche Koran-Verbrennung zu verhindern. Denn eine solche Aktion hätte den außerpolitischen Interessen des US Imperialismus sehr geschadet (Obama sprach allerdings nicht davon, sondern von der „Sicherheit unserer Soldaten“). Und in Deutschland fürchtet man nun in den Reihen der etablierten Parteien, dass der um Sarrazin verursachte Wirbel der Etablierung einer politischen Protestpartei rechts von der CDU/CSU Vorschub leisten könnte, welche Deutschlands „Ansehen in der Welt“ (d.h. die Berechenbarkeit des deutschen Staates als Standortfaktor) schädigen und darüber hinaus auch den handfesten Interessen des alteingesessenen Establishments zuwiderlaufen könnte. Das, was man den politischen Rechtspopulismus nennt, kann zwar und wird auch von der politischen Klasse glänzend instrumentalisiert, um angesichts der Zuspitzung der Weltwirtschaftskrise abzulenken und eine Hatz auf Sündenböcke vom Zaun zu brechen. Aber dieser Populismus hat tiefere Ursachen, er ist mehr als nur eine Täuschung aus der Trickkiste der Bourgeoisie, er ist Ausdruck der blinden Anarchie des Kapitalismus insgesamt. So stimmen wir auch hierin mit dem Text des Genossen überein.
Populismus und Demokratie
Dennoch fehlt in den Beiträgen des Genossen aus unserer Sicht ein wesentliches Element der Analyse, nämlich die Frage nach der Verbindung zwischen politischen Populismus und bürgerlicher Demokratie. Vielleicht ist der Genosse nur deshalb nicht darauf eingegangen, weil er sich kurz fassen und nicht zu viele Punkte auf einmal entwickeln wollte. Dennoch lohnt es unserer Meinung nach, sich bei diesem Punkt aufzuhalten, zumal gerade Trotzki in der Zeit um 1933 zwar die Frage der Zwischenschichten und der Brandstifter glänzend, diese Frage der Rolle der Demokratie hingegen gar nicht gut verstanden hat. Dies äußerte sich darin, dass Trotzki aus der Tatsache, dass der Nazismus damals keineswegs den engen Eigeninteressen von bedeutenden Fraktionen der herrschenden Klasse entsprach, welche lieber am „parlamentarischen System“ festhalten wollten, schloss, dass es notwendig und auch möglich sei, mit diesen Kräften zusammen die bürgerliche Demokratie zu verteidigen. Er irrte sich. Wurde die phantasierende Auffassung der Stalinisten vom Hitlerregime als Eintagsfliege nach 1933 rasch entkräftet, so wurde die Auffassung Trotzkis von der Demokratie und ihrem Anhänger, etwa die Sozialdemokratie, als mögliches Bollwerk gegen den Nazismus schon vorher durch den Sieg der Nationalsozialisten als Trugbild entlarvt. Warum?
Das Rätsel der kapitalistischen Herrschaft
Im Kapitalismus tritt der Mechanismus der Ausbeutung, anders als in der Sklavenhaltergesellschaft oder im Feudalismus, nicht mehr klar zutage. Der Leibeigene des Mittelalters etwa wusste immer genau, wann er nicht mehr für den eigenen Unterhalt schuftete, sondern Mehrarbeit für die Ausbeuter leistete, denn er musste von dem eigenen Produkt abgeben (z.B. das Kirchenzehnt) oder an bestimmten Tagen das Land des Herren bearbeiten. Diese Verhältnisse lagen klar zutage, weil es persönliche, durch Gewalt vermittelte Verhältnisse waren; der Sklavenhalter bzw. der Feudalherr konnten ihre Knechte auch richten. Diese konnten eben nicht weglaufen.
Im Kapitalismus als verallgemeinerte Warenwirtschaft ist das Ausbeutungsverhältnis nicht mehr persönlich; die Gewalt ist indirekt, vermittelt, der Akt der Ausbeutung sozusagen unsichtbar. Die Lohnarbeit ist „frei“, die Ausgebeuteten sind Staatsbürger, scheinbar mit denselben Rechten wie alle anderen ausgestattet, unter anderen das Recht, Verträge, und ganz besonders Arbeitsverträge abzuschließen. Dass die Lohnabhängigen ausgebeutet werden, wissen sie sehr wohl, denn sie merken das eigene Elend, während auf der Kapitalseite Reichtum und Macht sich auftürmen. Aber diese Ausbeutung ist nicht mehr persönlich, den Lohnabhängigen steht es frei, zu einem anderen „Arbeitgeber“ zu wechseln, ebenso wie der Unternehmer „frei“ ist, sich von seinen „Mitarbeitern“ zu trennen. Auch weiß niemand mit Gewissheit zu sagen, ab wann die ProletarierInnen nicht mehr für den eigenen Unterhalt, sondern nur noch für den Gewinn des Unternehmers schuften. Diese Grenze ist und bleibt unsichtbar. Bleibt die Tatsache der Ausbeutung also spürbar, so wird der Mechanismus der Ausbeutung selbst rätselhaft.
Bleiben aber die Lohnabhängigen in der Welt der Arbeit und der Produktion immerhin am Ort und damit auch am Geheimnis der kapitalistische Ausbeutung nah dran, fühlt man sich als Bürger, als Käufer und Verkäufer im Alltag der allumfassenden Warenwirtschaft erst recht der Hilflosigkeit und Verblüffung ausgeliefert, welche diese Welt des Scheins auslöst. Denn nicht mehr die Wirtschaftsprotagonisten selbst – ja nicht mal mehr die herrschende Klasse – bestimmt das wirtschaftliche Leben, sondern eine rätselhafte, unpersönliche Kraft, welche hinter unserem Rücken unser Schicksal bestimmt, ein neuer Gott, dem wir uns unterwerfen sollen: der Markt.
All das erscheint ebenso unbegreiflich wie beängstigend. Es gibt eine Kraft in der Gesellschaft, welche aufgrund der eigenen zentralen Stelle in diesem Wirtschaftssystem praktisch und theoretisch dieses Rätsel auflösen, diesen gordischen Knoten durchschlagen kann: das Proletariat. Aber dies erfordert eine kollektive Anstrengung im Klassenkampf des Proletariats; einen Kampf, welcher eine wirtschaftliche, politische und auch theoretische Dimension besitzt. Für die Zwischenschichten, deren wirtschaftliche Tätigkeit im Wesentlichen im Kauf und Verkauf von Waren besteht, ist die kapitalistische Wirklichkeit in der Tat unentwirrbar. Aber selbst für die Proletarier in ihrem Alltag als „Bürger“ ist es nicht immer einfach, sich zu orientieren. Erst im Kapitalismus ist die Wirtschaft voll und ganz keine geplante Wirtschaft mehr. Das kommt daher, dass die Warenwirtschaft nunmehr die Gesellschaft vollständig in Einzelne aufgesplittet hat, welche gegeneinander konkurrieren. Deren soziale Beziehungen werden über den Markt vermittelt. So hilflos ausgeliefert zu sein, ohne etwas zu begreifen, das hält kein Mensch aus! Irgend jemand muss daran Schuld sein! So erzeugt der Kapitalismus ständig und notwendig das Bedürfnis nach Personalisierung, nach Sündenböcken, nach Vorurteilen, nach Hass und Rassismus.
Das Gefängnis der Demokratie
An dieser Stelle entsteht die Verbindung zwischen Barbarei, Populismus und Demokratie. Der Kapitalismus, die Vollendung der Warenwirtschaft, die Gesellschaft der Vereinzelten, die gegeneinander konkurrieren müssen, bringt die Demokratie hervor als politisches Spiegelbild der eigenen Funktionsweise. Denn das Prinzip der Demokratie ist das der Vereinzelung: One man, one vote! Die Demokratie zementiert diese Vereinzelung, sie bestärkt den Einzelnen in der eigenen Borniertheit. Man klammert sich an die eigenen Vorurteile, als ob sie ein Eigentum wären. Die Wahlkabine ist der Krönungsort dieser Art von Volkssouveränität, wo die Bürger, von einander, von dem Kollektiv des Klassenkampfes abgeschirmt, der eigenen Ohnmacht, sprich allen Einflüssen der kapitalistischen Welt hilflos ausgeliefert, sich der Illusion hingeben, mitbestimmen zu können.
Ja, nur der Klassenkampf des Proletariats – denn nur dieser Klassenkampf ist wahrlich kollektiv und zukunftsträchtig – kann den Wahn der Vorurteile auflösen. Die Demokratie hingegen verstärkt das Vorurteil und den Hass, denn diese hilflose Wut hat etwas mit der Vereinzelung wesentlich zu tun. Daher suchen deren Opfer ihr Heil in irgendeinem Scheinkollektiv wie der Nation oder gar der Rasse, welche aber die Vereinzelung nur noch verstärken.
Und das ist der Grund, weshalb die Kommunistische Linke, insbesondere deren „italienische“ Fraktion - welche genau so wenig überrascht war wie Trotzki durch den Sieg des Nazismus 1933 - sich weigerte, gegenüber der NS-Bewegung in Deutschland, wie vorher gegenüber dem Faschismus in Italien, zur Verteidigung der Demokratie aufzurufen. Im Gegenteil! Diese GenossInnen sahen viel klarer als Trotzki, dass es die bürgerliche Gesellschaft insgesamt ist, und damit auch die Demokratie als dem ihr urwüchsig entsprechenden politischen System, welche Hass und Barbarei hervorbringen und verstärken. Auch der Faschismus und der Nazismus waren damals die legitimen Sprösslinge dieser Demokratie.
Das Zukunftsträchtige, Kollektive des proletarischen Klassenkampfes
Damals allerdings konnte Hitler in Deutschland nur deshalb triumphieren, weil bereits vorher die Arbeiterklasse weltweit durch Sozialdemokratie und Stalinismus besiegt wurde. Auch das erkannte damals die Kommunistische Linke, anders als Trotzki. Heute ist die Lage anders, das Weltproletariat hat noch keine solche Niederlage erlitten. Was bleibt, ist die Zuspitzung der Barbarei unter den Hammerschlägen der Krise und des kapitalistischen Zerfalls. Somit bleibt der bürgerlichen Demokratie nichts anderes übrig, als im Wettlauf zwischen den vornehmen, etablierten Parteien und den Populisten an der Schraube des Hasses und der Vorurteile weiter zu drehen. Darin hat der Genosse allerdings recht!
Die Verschärfung der Krise wird aber auch zur Verschärfung der Klassengegensätze führen, und allein hierin, in der Gemeinschaft des proletarischen Klassenkampfes, erblicken wir einen möglichen Ausweg aus der Barbarei.
Aktuelles und Laufendes:
- Populismus [89]
- Sarrazin-Debatte [90]
- Gefahr von Rechts [91]
- Rechtsradikalismus [92]
Leute:
Historische Ereignisse:
- Trotzki Nationalsozialismus [95]
- Volksfront [96]
Solidarität mit den Beschäftigten der Madrider Metro
- 2186 Aufrufe
Wir veröffentlichen nachfolgend die Stellungnahme der IKS in Spanien zum Streik bei der Madrider Metro, der wir eine Solidaritätserklärung von Beschäftigten der Madrider Post hinzufügen. Mit diesen Zeilen wollen wir unsere brüderliche und tiefe Solidarität mit den Beschäftigten der Madrider Metro zum Ausdruck bringen.
Erstens weil sie ein Beispiel dafür liefern, dass der massive und entschlossene Kampf das einzige Mittel der Ausgebeuteten gegen die brutalen Angriffe seitens der Ausbeuter ist. In diesem Fall ging es um eine fünfprozentige Lohnkürzung. Ein Schlag gegen die Arbeiter, der selbst vom Standpunkt der bürgerlichen Legalität aus völlig illegal ist, da er nichts anderes ist als eine einseitige Verletzung des zuvor abgeschlossenen Tarifvertrag. Und sie wagen es gar noch, die Beschäftigten der Metro als „Kriminelle“ zu beschimpfen.
Es geht um auch Solidarität gegen die Diffamierungskampagne und den Versuch einer „moralischen Lynchjustiz“ gegen dieser Kolleg/Innen. Eine typische, von den Politikern und den rechten Medien angeleierte Schmierenkampagne, in der die Streikenden als Bauern in einer Kampagne der PSOE gegen die „Anführerin“ der Partido Popular in Madrid, Esperanza Aguirre, dargestellt werden, die „Sanktionen“ und „Entlassungen“ gefordert hat (1). Aber man darf vor allem die intensive Beteiligung der Linken bei dieser Isolierungs- und Verleumdungskampagne gegen die Beschäftigten nicht vergessen. Aguirre oder Rajoy forderten Entschlossenheit und die Peitsche gegen diese „Vandalen“, doch der Industrieminister stellte der Region eine umfangreiche Reihe von anderen Transportmitteln zur Verfügung, um den Streik zu brechen, und der sozialistische Innenminister hat Aguirre bis zu 4.500 Polizisten geschickt. Was die „linken“ Medien betrifft, haben sie zwar weniger hasserfüllt, dafür jedoch umso heuchlerischer die Idee eines „Streiks mit Geiselnahme“ verbreitet, wie El País am 30. Juni schrieb. Vor die Frage gestellt, für Esperanza Aguirre oder für den Arbeiterkampf gegen die Forderungen der Ausbeuter zu sein, wissen diese Lakaien des kapitalistischen Systems, die so genannten „Roten“ - und die es noch wagen, sich mit dem Buchstaben O (für Obrero, dt.: Arbeiter) zu schmücken -, genau, für wen sie sich zu entscheiden haben.
Was sie am meisten gestört hat, waren nicht die „Unannehmlichkeiten“ für die Fahrgäste. Man betrachte nur, unter welchen Bedingungen die Pendler an „normalen“ Tagen unterwegs sind und welchem Chaos die „Bürger“ tagtäglich aufgrund der Vernachlässigung der Infrastruktur ausgesetzt sind, insbesondere im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs. Im Gegensatz zu ihren Aussagen sind sie auch nicht besonders verärgert über die entstandenen Unkosten für die Betriebe aufgrund verspätet oder gar nicht zur Arbeit erschienener Beschäftigter. Man muss schon besonders unverschämt sein, um zu behaupten, dass die Streikenden das „Recht auf Arbeit“ untergraben, denn in Wirklichkeit hat das spanische Kapital nicht weniger als fünf Millionen Lohnabhängigen dieses „Recht auf Arbeit“ vorenthalten.
Nein, was sie in Wirklichkeit verärgert und warum ihnen dieser Kampf der Madrider Metro-Beschäftigten Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass der Kampf überhaupt ausgebrochen ist, d. h. die Tatsache, dass die Beschäftigten nicht widerstandslos die Opfer und Angriffe hingenommen haben, mit denen sie konfrontiert sind. Und vor allem die Tatsache, dass sie, um die Ansprüche der Unternehmer aufzuhalten, nicht des allgemeinen Lamentierens anheimgefallen sind, wie es beim Streik der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes am 8. Juni der Fall war (2), sondern ein Beispiel für Einmütigkeit und Entschlossenheit abgegeben haben. El País gestand dies in dem eben erwähnten Leitartikel ein: „Der Betriebsrat beruft sich darauf, dass es einen bis 2012 gültigen Tarifvertrag gebe, der durch die Entscheidung der Madrider Stadtverwaltung einseitig gebrochen worden sei (…) Möglicherweise hat es an der nötigen Pädagogik gefehlt, um den Ernst der Lage zu erklären, der Opfer notwendig macht, um im Gegenzug mehr sichere Arbeitsplätze zu erhalten…“ Anschließend werden die Streikenden der Erpressung bezichtigt, um dann fortzufahren: „… und es fehlte vielleicht eine größere Klarheit um zu erklären, wie die Lohnsenkungen mit der später abgegebenen Garantie der Aufrechterhaltung der Kaufkraft übereinstimmen können.“
Der Kampf der Metro-Beschäftigten Madrids liefert viele Lehren für alle Beschäftigten. Heute steht der Kampf gewissermaßen am Scheideweg, und es ist schwierig einzuschätzen, wie er sich weiter entwickeln wird. Es ist noch zu früh, eine umfassende Bilanz zu ziehen. Aber einige Lehren schälen sich bereits jetzt heraus.
Die Vollversammlungen – Herz und Hirn des Arbeiterkampfes
Eines der Merkmale des Arbeiterkampfes bei der Madrider Metro war das Abhalten von großen Vollversammlungen. Schon am 29. Juni, als beschlossen wurde, die Regelung des Minimalverkehrs abzulehnen, mussten viele Beschäftigte wegen Platzmangels vor der Tür bleiben, aber am 30. Juni, als die Verleumdungskampagne ihren Höhepunkt erreicht hatte, war die Zahl der Teilnehmer noch mehr gewachsen. Warum? Die Beschäftigten der Metro selbst liefern eine Antwort: „Wir mussten zeigen, dass wir gemeinsam so stark sind wie die Finger einer Faust.“ Dank dieser Vollversammlungen gelang es ihnen, viele der üblichen gewerkschaftlichen Fallen zu vermeiden. Zum Beispiel die Verwirrung hinsichtlich der Streikaufrufe. So beschloss die Versammlung am 30. Juni, den Minimalverkehr am 1. und 2. Juli aufrechtzuerhalten, um nicht vor die falsche Alternative gestellt zu werden, zwischen einer Gewerkschaft, die zum Totalstreik aufrief, und den anderen, gemäßigteren Gewerkschaften wählen zu müssen. Die Versammlung beschloss auch, die verbalradikalen Parolen des ehemaligen Sprechers des Betriebsrates zu ignorieren, dessen Erklärungen („Wir werden Madrid zur Explosion bringen“) eher den Feinden des Kampfes und ihren Verleumdungskampagnen sowie ihren Versuchen zuträglich waren, die Metro-Beschäftigten zu isolieren.
Aber die Versammlungen dienten nicht nur dazu, unnötige, übertriebene Schritte zu verhindern und Provokationen zu vermeiden. Sie dienten vor allem dazu, allen Beschäftigten mehr Mut und Entschlossenheit zu verleihen und die tatsächliche Kampfbereitschaft einzuschätzen. Anstatt - wie üblich - geheime Einzelabstimmungen abzuhalten, wie die Gewerkschaften sie praktizieren, wurde der Metro-Streik durch Abstimmungen per Handaufheben beschlossen und organisiert. Dadurch wurde die Entschlossenheit der noch zögernden Kollegen gestärkt. Die Presse warnte lauthals vor dem angeblichen Druck, den die Streikposten auf einzelne Arbeiter ausüben würde. Doch es ist bekannt, dass die Beschäftigten lediglich dazu ermutigt wurden, sich dem Streik anzuschließen, und dass dessen Durchführung eine bewusste und freiwillige Entscheidung war, der eine offene und freimütige Diskussion vorausging, in der jeder seine Befürchtungen zum Ausdruck bringen, aber auch seine Motive für den Kampf erklären konnte. Auf einer Webseite, auf der man seine Solidarität mit dem Kampf äußern konnte, (usuariossolidarios.wordpress.com [97]), meinte eine junge Metro-Beschäftigte offen, sie habe sich an der Vollversammlung am 29. Juni beteiligt, „um nicht mehr Angst vor dem Kampf zu haben“.
Die Falle des „Minimalverkehrs“
Im Falle des Metrostreiks versuchte man, die Beschäftigten mit einem Erlass zur Aufrechterhaltung eines „Minimalverkehrs“ einzuschüchtern und zur Aufgabe des Kampfes zu bewegen. Lady Esperanza Aguirre mag sich in ihrem Madrider Präsidentenpalast zwar wie eine hilflose Dame in den Händen von besessenen Streikenden gerieren, doch in Wirklichkeit können die Behörden (mit anderen Worten: die Arbeitgeber der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes) die Streikenden zur Aufrechterhaltung eines Minimalverkehrs zwingen. Aus Erfahrung wusste Aguirre, dass sie diesen legalen Spielraum besaß, und vor allem weil sie sich der Unterstützung des ganzen Medienchors sicher war, versuchte die Chefin der Regionalregierung von Madrid, eine wahre Provokation auszuhecken: Zur Aufrechterhaltung des minimalen Betriebsprogramms sollten 50% der Beschäftigen verpflichtet werden. So sollten die Beschäftigten mit dem Rücken zur Wand gestellt werden. Wenn sie dieses minimale Betriebsprogramm akzeptierten, wäre ihre Entschlossenheit, sich dem Diktat der Arbeitgeber nicht zu beugen, infrage gestellt. Wenn sie dies jedoch nicht akzeptierten, würde die Verantwortung für alle Unannehmlichkeiten der anderen Beschäftigten, die den Großteil der Pendler stellen, auf ihre Schultern abgewälzt werden. Zudem ermöglicht das Konzept des „Minimalverkehrs“ den Arbeitgebern, gegenüber den Beschäftigten Sanktionen zu verhängen, falls dieser Minimalverkehr nicht eingehalten wird, wodurch ihr Verhandlungsspielraum noch vergrößert wird. Zwei Tage nachdem die Metro-Beschäftigten ihre Weigerung, den Minimalverkehr aufrechtzuerhalten, fallengelassen haben, erweiterte die Geschäftsführung den Kreis der von den Sanktionen betroffenen Beschäftigten von 900 auf 2800. Der einzige Ausweg aus solch einer Mausefalle besteht darin, Klassensolidarität zu praktizieren.
Die Klassensolidarität ist der Boden, auf dem die Kampfbereitschaft und die Kraft der Arbeiter wachsen können.
Die Kraft der Arbeiterkämpfe wird nicht an ihrer Fähigkeit gemessen, den kapitalistischen Betrieben Verluste zuzufügen. Dazu, und das bewies der Metro-Streik erneut, sind die Kapitalisten selbst in der Lage. Die Kraft der Arbeiterkämpfe wird auch nicht daran gemessen, ob man eine Stadt oder eine Branche lahmlegen kann. Auf dieser Ebene ist es ebenso schwierig, mit dem bürgerlichen Staat, der dies ausgezeichnet vermag, mitzuhalten. Die Kraft der Arbeiterkämpfe wird vor allem dadurch gespeist, dass sie mehr oder weniger explizit ein für alle Beschäftigten gültiges Prinzip verkünden: Die menschlichen Bedürfnisse dürfen nicht auf dem Altar des Profits und der dem Kapitalismus eigenen Konkurrenz geopfert werden.
Ein Zusammenstoß eines Teils der Arbeiter mit ihrem Arbeitgeber mag radikal erscheinen, aber wenn es den Herrschenden gelingt, diesen als etwas Besonderes darzustellen, können sie damit die Arbeiter besiegen und auch die Moral der ganzen Arbeiterklasse schwächen. Wenn es dagegen den Beschäftigten gelingt, die Solidarität der anderen Arbeiter zu gewinnen, wenn sie die andere Ausgebeutete überzeugen können, dass ihre Forderungen keine Bedrohung für sie, sondern Ausdruck der gleichen Klasseninteressen sind, und wenn sie die Vollversammlungen zu nützlichen Instrumenten machen können, an denen sich andere Arbeiter beteiligen können, dann können sie ihren Kampf und damit die ganze Arbeiterklasse stärken.
Am wichtigsten für den Kampf der Madrider U-Bahn-Beschäftigten ist nicht, dass es ihnen gelingt, so und so viel U-Bahn-Züge am Ausfahren zu hindern (auch wenn natürlich die Vollversammlung darüber Bescheid wissen muss, ob die getroffenen Entscheidungen umgesetzt werden), sondern dass es ihnen gelingt, ihren Kolleg/Innen, allen voran den anderen Beschäftigten des Personennahverkehrs (EMT), von Télémadrid (Regionalfernsehen von Madrid) und den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes die Gründe für ihren Kampf zu erklären. In der Zukunft ist es nicht ausschlaggebend, ob man so oder so viel Prozent des „Minimalverkehrs“ aufrechthält (auch wenn die Mehrheit der Beschäftigten nicht durch die Arbeit davon abgehalten werden darf, sich an den Streikversammlungen, Streikposten usw. zu beteiligen); weitaus wichtiger ist es, das Vertrauen und die Solidarität der anderen Teile der Arbeiterklasse zu gewinnen. Dazu müssen sich die Metro-Beschäftigten in die Stadtviertel begeben, um zu erklären, warum ihre Forderungen weder ihre eigene Privilegierung anstreben, noch eine Bedrohung für die anderen Beschäftigten sind, sondern eine Antwort auf die Angriffe, die durch die Krise hervorgerufen werden.
Von diesen Angriffen sind die Arbeiter aller Länder, aller Branchen usw. betroffen. Wenn es dem Kapital gelingen sollte, die Beschäftigten aufeinander zu hetzen oder auch nur sie isoliert kämpfen zu lassen, gleichgültig wie radikal diese Kämpfe erscheinen mögen, könnten die Ausbeuter ihre Ansprüche durchsetzen. Doch wenn es den Arbeiterkämpfen gelingt, zum Zusammenschluss und zu einer immer größeren Kampfbereitschaft angesichts dieser unverschämten Ansprüche der Kapitalisten beizutragen, können wir neue, noch schlimmere Opfer verhindern. Das wäre ein wichtiger Schritt für die Entwicklung einer proletarischen Alternative gegenüber dem Elend und der Barbarei des Kapitalismus. Acción Proletaria, (12.Juli 2010)
[1]) Die Regierung in Spanien ist in den Händen der Sozialistischen Partei (PSOE), während die Region Madrid (deren Chefin Aguirre ist) und die Stadt Madrid (die die Metro betreibt) von der Rechten regiert wird (Partido Popular, deren Landeschef Rajoy heißt). So haben die beiden politischen Lager das übliche Parteienspiel betrieben und sich wüst beschimpft, aber gegenüber dem Streik der U-Bahn-Beschäftigten sind sie Hand in Hand vorgegangen. .
2) Siehe unsere Bilanz zum 8. Juni auf unserer spanischen Webseite.
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf Spanien [72]
- Metro-Streik Madrid [98]
Welche Kraft kann Rassismus und Ausbeutung überwinden?
- 2720 Aufrufe
Die Parlamentswahlen in Schweden vom 19. September 2010 brachten u.a. den Einzug einer fremdenfeindlichen, rechtsradikalen Partei ins Abgeordnetenhaus. Als Reaktion darauf verbreitete eine siebzehnjährige Frau per Internet einen Aufruf zu einer Protestkundgebung. Daraufhin versammelten sich am darauf folgenden Tag zehntausende vorwiegend junge Leute im Zentrum von Stockholm, um gegen den zunehmenden Rassismus in der Gesellschaft die Stimme zu erheben. Dieses Ereignis lässt erahnen, welche wachsende Sorge und auch Kampfbereitschaft gerade auch in der jungen Generation steckt angesichts der um sich greifenden Ausgrenzung von Minderheiten in dieser Gesellschaft und der Suche nach Sündenböcken. Es ist heute mit Händen zu greifen, dass diese Zuspitzung des „jeder für sich“ etwas zu tun hat mit der Zuspitzung der weltweiten Wirtschaftskrise und mit der Sackgasse, in welcher die Menschheit im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft steckt.
Die Demokratie: Ein Bollwerk gegen Rechts?
Das herrschende System des Privateigentums an Produktionsmitteln, die „Marktwirtschaft“ und der Parlamentarismus beanspruchen gerne für sich die Fähigkeit, das Prinzip der Toleranz in der Gesellschaft hochzuhalten und ein friedliches Nebeneinander der Kulturen zu ermöglichen. Und man stellt die Sache gerne so hin, als ob es der berühmte Mann auf der Straße sei, der intolerant werde, während die Würdenträger der Demokratie politisch korrekt tapfer dagegen hielten: Die Demokratie als Bollwerk gegen Rechts.
Wir glauben, dass die wachsende Sorge in der Gesellschaft gegenüber dem Problem der Fremdenfeindlichkeit auch damit zusammenhängt, dass viele Menschen zu ahnen begonnen haben, dass dies nicht stimmt. In Frankreich ist es der amtierende, demokratisch gewählte Präsidenten Sarkozy, der die Roma und Sinti deportieren lässt. Und er tut es u.a. deshalb, um seine Chancen auf Wiederwahl ins höchste Amt des Staates zu vergrößern. In Deutschland ist der aktuelle Brandstifter des politischen Populismus, Sarrazin, jahrzehntelang eine Galionsfigur der SPD in Berlin gewesen. Er ist nicht einer der obersten Bundesbanker geworden seiner rassistischen Thesen zum trotz, sondern aufgrund dessen, d.h. aufgrund seiner bewährten Fähigkeit, durch spalterische Parolen Wähler für die Sozialdemokratie in der Hauptstadt zu gewinnen. Und jetzt, wo er sich politisch zu verselbständigen droht, tut man so, als ob seine Thesen neu wären, oder als ob man sie bisher nicht zur Kenntnis genommen hätte.
Von den politischen Populisten sagt man, dass sie gerne dem Volk aufs Maul schauen. Stimmt es also, dass Rassismus und Ausgrenzung sozusagen von unten ausgehend aufsteigen und von „denen da oben“ lediglich aufgegriffen werden, wie das andauernd in den Talkshows behauptet wird? Man muss feststellen, dass Hass und Verfolgungsbereitschaft sowohl „unten“ als auch „oben“ und ganz „oben“ ihre Blüten treiben, und dass es v.a. die kapitalistische Gesellschaft selbst ist, welche dieses Gift aus allen Poren absondert. Und in dieser Hinsicht trägt die herrschende Klasse die Hauptverantwortung für diese Entwicklung, nicht in erster Linie weil sie rassistischer wäre als der Stammtisch des „kleinen Mannes“, sondern weil sie das System verteidigt und aufrecht erhält, welche heute die Menschen voneinander entfremdet, sie zu Konkurrenten, zu Feinden macht.
Rassismus und Kapitalismus
Der „Antirassismus“ der Spitzenpolitiker und Würdenträger ist heuchlerisch. Aber diese Heuchelei ist nicht zuerst eine persönliche, sondern ein systembedingte. Der Kapitalismus ist vollendete „Marktwirkschaft“. Er ist das erste Wirtschaftssystem in der Menschheitsgeschichte, dessen Hauptziel nicht das Sichern des Konsums der Gesellschaft – nicht mal den der herrschenden Klasse – ist, sondern der Profit, das Erzielen eines Gewinns auf dem Markt. Der Konsum der Gesellschaft bzw. die Privilegien der Ausbeuter stellen sich nur ein, wenn der Konkurrenzkampf auf diesem Markt erfolgreich bestanden wird. Die Konkurrenz ist somit das A und O dieser Gesellschaft. Nicht nur die Besitzer der Produktionsmittel müssen gegeneinander konkurrieren, damit das System funktioniert, sondern auch die Produzenten, die Ausgebeuteten. Damit dieses System der Konkurrenz der LohnarbeiterInnen unter einander funktioniert, dafür hat der Kapitalismus sich des Rassismus, Nationalismus, ethnischen Hasses bedient, und zwar von dem Tag an, als er das Licht der Welt erblickte. Heutzutage macht sich beispielsweise der Standort Europa für die Konkurrenz mit Asien und anderen Weltgegenden fit durch ein ausgeklügeltes, weltweit umspannendes System der Mobilisierung von Arbeitskräften, darunter die „Saisonarbeit“ russischer oder ukrainischer Bauarbeiter, welche, 12 Stunden täglich ohne Unterbrechung arbeitend, im Schlafcontainer direkt an der Baustelle untergebracht, für einen Stundenlohn schuften, welcher konkurrieren kann mit den in China gezahlten. Dazu gehört das ganze System der „Festung Europa“; das System der Deportation von Flüchtlingen und der Errichtung von Auffanglagern in den Herkunftsländern, welche die Europäische Kommission in Brüssel – die Sarkozys „Abschiebung“ der Roma und Sinti kritisiert, weil sie gegen EU-Recht verstößt – völlig legitim findet. Dieses System ist nicht nur eine Barriere, um verzweifelte Menschen abzuhalten, es ist zugleich eine Schleuse, welche die illegale Einwanderung nach den Bedürfnissen des kapitalistischen Arbeitsmarkts reguliert. Denn auch die Millionen von Illegalen, welche ohne die geringsten Rechte oder soziale Absicherung der Gier des Ausbeutungssystems restlos ausgeliefert sind, sind Bestandteil des Kampfes der Standorte um die eigene Konkurrenzfähigkeit. So werden tagtäglich die Bedingungen des Hasses und der Ausgrenzung durch den kapitalistischen Arbeitsmarkt reproduziert. Und die Entrüstung der Machthaber, wenn die Opfer dieser Konkurrenz tatsächlich blind genug sind, um sich gegenseitig als die Schuldigen auszumachen, kann man nichts anders als heuchlerisch bezeichnen.
Ist der Kapitalismus von oben bis unten mit Rassismus durchsetzt, so kann eine Lösung, eine Überwindung dieses Problems nur von „unten“ her kommen. Denn die Kapitalisten sind nur stark, wenn sie konkurrenzfähig sind, das entspricht ihrer ganzen Lebensweise. Die Lohnarbeiter hingegen werden durch die Konkurrenz untereinander hilflos gehalten. Die Lohnabhängigen können nur stark werden durch die Aushebung der Konkurrenz in ihren Reihen, durch die Entwicklung einer Klassensolidarität, welche die weltumspannende Solidarität einer freien Menschheit vorwegnimmt. Für diese Klasse der Gesellschaft ist die Überwindung des Gifts der Spaltung nicht nur ein anstrebenswertes Ideal, sondern eine unmittelbare Notwendigkeit, Ausdruck der eigenen Interessenslage.
Welche Kraft kann Hass und Ausgrenzung überwinden?
In diesem Sommer sprach ein Vertreter der kämpfenden Belegschaft des staatlichen TEKEL-Konzerns aus der Türkei auf Solidaritätsveranstaltungen in Deutschland und der Schweiz (siehe den Artikel dazu in dieser Ausgabe). Diese Reise wurde durch den Wunsch motiviert, die Lehren aus den Kämpfen in der Türkei international bekannt zu machen und Kontakt aufzunehmen mit kämpferischen ArbeiterInnen in Europa, welche vor den gleichen Herausforderungen stehen. Die Augenzeugenberichte über die Kampferfahrungen bei TEKEL machten deutlich, wie zentral die Frage der Solidarität im Arbeiterkampf ist, um Jung und Alt, Mann und Frau, um türkische und kurdische, um Beschäftigte verschiedener Sektoren zusammenzuschweißen. Es wurde aber ebenso deutlich, wie im Verlauf eines solchen Abwehrkampfes (in diesem Fall gegen Massenentlassungen) das Bedürfnis entsteht, den eigenen Widerstand als Teil eines internationalen Kampfes zu begreifen. Schließlich ist die kapitalistische Konkurrenz eine weltweit operierende und kann letztlich nur auf globaler Ebene aufgehoben werden.
Wer der Praxis des „jeder für sich“ in dieser Gesellschaft wirklich auf den Grund gehen will, wird nicht um den Schritt herum kommen, die Wurzeln des Elends im kapitalistischen System zu suchen. Der Kampf um die Überwindung der Ausbeutung ist der Standpunkt, von dem aus sich ein tiefgreifender, theoretischer wie praktischer Kampf gegen die vorherrschende Barbarei führen lässt. 21.09.10
Aktuelles und Laufendes:
- Rassismus [99]
- Ausgrenzung [100]
Leute:
Zu den TEKEL-Veranstaltungen in Deutschland und der Schweiz - Grenzüberschreitende Suche nach Solidarität
- 2304 Aufrufe
Im Juni 2010 riefen die FAU[1], die IKS, die Karakök Autonomen[2] und andere politische Gruppen aus dem anarchistischen/linkskommunistischen Umfeld zu einer Reihe von Diskussionsveranstaltungen mit einer Delegation der kämpfenden TEKEL-Arbeiter und -Arbeiterinnen aus der Türkei auf. In neun deutschen Städten und in Zürich fanden darauf Treffen statt, an denen die Delegation die Erfahrung ihrer Kämpfe weiter vermittelte und zur Diskussion stellte.
„Seit Mitte Dezember protestieren die Beschäftigten des ehemals staatlichen Unternehmen „TEKEL“ gegen die Folgen der Privatisierung. Das staatliche Unternehmen war für die gesamte Tabak- und Alkoholproduktion in der Türkei allein verantwortlich. Das Unternehmen wurde 2008 an BAT (British American Tobacco) veräußert. Landesweit sollen nun 40 Produktionsstätten geschlossen werden, die rund 12.000 TEKEL-ArbeiterInnen sollen dann in anderen Betrieben arbeiten. Der Belegschaft drohen dadurch massive Gehaltskürzungen, der Verlust von tariflichen und sozialen Rechten oder die Arbeitslosigkeit.“ (aus dem Aufruf der FAU)
In Zürich organisierte die Gruppe Karakök Autonome die Veranstaltung, die von einem recht breiten Publikum besucht wurde. Wie bei den Veranstaltungen in Deutschland berichtete O., ein Arbeiter bei TEKEL, über den Kampf der Belegschaft gegen die Privatisierung und die massive Verschlechterung der Situation der Beschäftigen, die u.a. Lohnreduktionen von 600 auf 325 Euro beinhalteten. „Gegen diese Aussicht auf die permanente Misere durch Arbeit, richtet sich der aktuelle Kampf der entlassenen TEKEL-ArbeiterInnen. Mit öffentlichkeitswirksamen Protesten versuchen sie seit Monaten, die Gewerkschaften - allen voran Türk-Is - dazu zu bewegen, einen Generalstreik der staatlichen Beschäftigten, gegen diese Neuregelungen auszurufen. Doch die Gewerkschaften verhalten sich faktisch als Komplizen und Erfüllungsgehilfen der staatlich organisierten Verarmung. „Wir mußten zehn mal mehr gegen die Gewerkschaft kämpfen, als gegen die Polizei und den Staat“ sagte O. So wurde in Ankara die Gewerkschaftszentrale von bis zu 15.000 Polizisten geschützt, als Tausende von TEKEL-Beschäftigten in die Stadt kamen, um die Gewerkschaften dazu zu bewegen, sich für ihre Sache einzusetzen. „Wir standen vor den Polizeieinheiten, die uns mit Tränengas, Nebelbomben und Knüppeln angegriffen haben“ - berichtete O. - „und die Gewerkschaftsfunktionäre standen nicht solidarisch bei uns sondern hinter den Polizeiketten“. Trotzdem gelang es in Ankara die Gewerkschaftszentrale kurzfristig zu besetzen.“ (aus dem Bericht der FAU von der Veranstaltung in Duisburg)
Auf einem Platz in der Nähe der besetzten Gewerkschaftszentrale richteten die Arbeiter und Arbeiterinnen ein Zeltlager auf.
Eindrücklich war vor allem die Solidarität, die den Kämpfenden in Ankara aus der Bevölkerung entgegen gebracht wurde. Es gab nicht nur Demonstrationen mit bis zu mehreren Zehntausend Teilnehmern, sondern von der lokalen Bevölkerung Unterstützung für die TEKEL-Arbeiter und -Arbeiterinnen in der Form von Decken, Nahrungsmitteln, sanitären Anlagen, aufmunternden Worten und Spenden. „So etwas hat es in Ankara noch nie gegeben, auch in der ganzen Türkei noch nie. Wir waren alle zu Tränen gerührt von der Solidarität, die entsteht, wenn ArbeiterInnen sich gegenseitig helfen. Niemand von uns wird das jemals vergessen“, erzählte O.
Türkische und kurdische Arbeiter kämpften Seite an Seite, das Geschlechterverhältnis veränderte sich im Camp in Ankara. Im Kampfkomitee, das sich aus VertreterInnen der verschiedenen Betriebsstandorte zusammensetzt, spielen Frauen eine wichtige Rolle.
Die TEKEL-ArbeiterInnen suchten weiter aktiv die Solidarität anderer Teile der Klasse. Delegationen der Kämpfenden reisten in andere Städte zu Betrieben, in denen auch Kämpfe stattfanden - nach Antep, Izmir, Istanbul.
So gründeten sie zusammen mit streikenden ArbeiterInnen anderer Staatsbetriebe (u.a. Hafen- und Bauarbeiter, Feuerwehrleute) in Istanbul eine Plattform der kämpfenden Arbeiter[3]. Am 1. Mai besetzten sie bei der Maikundgebung von 350.000 Menschen auf dem Taksim-Platz in Istanbul die Bühne und verlasen eine Erklärung gegen die Komplizenschaft der Gewerkschaften mit dem Staat. Die Gewerkschaftsführer flüchteten von der Bühne und hetzten die Polizei auf die ArbeiterInnen.
Und schließlich entstand die Idee, dass man auch in anderen Ländern von den Erfahrungen des Kampfes berichten und die Diskussion über die Grenzen des türkischen Staates hinaus tragen sollte. So kam es zu den Diskussionsveranstaltungen in Deutschland und der Schweiz.
In Zürich wurde u.a. über folgende Fragen diskutiert:
- Wie haben die ArbeiterInnen im Streik Entscheide gefällt? Wie wurde diskutiert?
- Nach welchen Kriterien haben sie entschieden, wo nach Solidarität gesucht werden soll?
- Soll man einen Betrieb in einer solchen Situation besetzen? Macht eine Besetzung Sinn, wenn der Betrieb ohnehin geschlossen wird?
- Sind die Gewerkschaften nur in der Türkei auf der Seite des Staates?
- Welches sind die Schlussfolgerungen nach dem Kampf?
Wir ziehen nach dem Erlebten und Gesagten folgende Zwischenbilanz:
Ohne Zweifel sind die Angriffe auf die Arbeiterklasse weltweit gegenwärtig stärker als unsere Gegenwehr. Es gibt zwar in vielen Ländern und jeden Tag irgendwo Streiks und Demonstrationen, die aber bis jetzt höchstens ausnahmsweise einen massenhaften Charakter angenommen haben. Woran liegt das? Was fehlt für das Entstehen einer Massenbewegung? Was braucht es, damit die isolierten Kämpfe wirklich eine Ausstrahlung und eine Ausdehnung erfahren?
Angesichts einer wirtschaftlich ausweglosen Situation im Kapitalismus führt ein normaler Verteidigungskampf nicht mehr weiter. Wenn ein Betrieb ohnehin dicht macht und die Produktion in ein Gebiet ausgelagert wird, wo die Lohnkosten geringer sind, kann der Kampf lokal nicht gewonnen werden. Es geht ums Ganze: Die Arbeiterklasse muss sich über die Grenzen hinweg für den gleichen Kampf zusammenschließen - es geht letztlich um einen Infragestellung des kapitalistischen Produktions- und Verteilungssystems insgesamt. Wie kann ein solcher Kampf zustande kommen? - Offensichtlich schreckt unsere Klasse vor der Gewaltigkeit dieser Aufgabe zurück.
In und um den Kampf der TEKEL-ArbeiterInnen hat es einige Aspekte gegeben, die zwar nicht für sich allein ein großes Gewicht haben, aber von der politischen Stoßrichtung her bedeutsam sind.
Einerseits suchen kämpfende Arbeiter und Arbeiterinnen die Solidarität anderer Teile der Klasse. Nicht nur innerhalb der Türkei sind Delegationen in andere Städte geschickt worden, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus. Diese Initiative der Kämpfenden lief bezeichnenderweise nicht über die Gewerkschaften. Vielmehr stießen die Streikenden auf den Widerstand der Gewerkschaften, nahmen sie wahr als Teil des staatlichen Abwehrdispositivs. Die TEKEL-Leute organisierten sich selbständig und kontrollierten auch selber die Suche nach der Solidarität, ohne Gewerkschaften. Diese Erfahrung, von der O. berichtete, war für viele GenossInnen, die an den Veranstaltungen teilnahmen, nicht etwas Erstaunliches. Vielmehr machen auch wir hier die gleichen Erfahrungen, in der Schweiz beispielsweise bei den Kämpfen in Reconvilier oder Deisswil.
Andererseits gibt es gleichzeitig Diskussionen unter politisierten Minderheiten in der Türkei, Deutschland und weiteren Ländern, die miteinander die Erfahrungen von TEKEL verarbeiten, für die Zukunft fruchtbar machen wollen. Dabei kommen Leute zusammen, die unterschiedliche politische Wurzeln haben, aber offensichtlich ein gemeinsames Ziel der revolutionären Überwindung dieser Gesellschaft haben.
Insofern weisen die Initiativen um den TEKEL-Streik eine neue Qualität auf, die es zu vertiefen und zu verallgemeinern gilt. Nur über diese Offenheit gegenüber anderen Teilen der Klasse, durch das Hinaustragen der Lehren über den eigenen lokalen Zusammenhang hinaus wird sich die Klasse nach und nach zu einer größeren Kraft zusammenschließen können. Es braucht solche Schritte, die zu Beginn zwar nach nicht viel aussehen, aber in die richtige Richtung gehen. Diese neue Qualität ist für eine Revolution unabdingbar.
Die Klasse hat in ihrem Kampf nur zwei Stärken, auf die sie sich verlassen kann: ihre Einheit und ihr Bewusstsein. Beides hängt zusammen, und beides wird durch solche Bestrebungen, die die TEKEL-ArbeiterInnen entwickelten, vorangetrieben.
Gerade auf der Ebene des Klassenbewusstseins waren die Diskussionen alles andere als banal: Die Gewerkschaften standen dem Kampf im Weg; die Streikenden stellten dies fest und organisierten den Kampf und seine Ausweitung selbständig, ohne Gewerkschaften, ja gegen den Widerstand derselben. Wir müssen dafür sorgen, dass sich breitere Teile der Klasse diese Lehren ebenfalls aneignen. Je kollektiver das Gedächtnis der Klasse wird, desto weniger müssen die gleichen Erfahrungen in jedem Kampf neu gemacht werden.
Und während Revolutionäre in den 1990er Jahren zwar vielleicht diese Lehren aus früheren Kämpfen zu propagieren versuchten (wie beispielsweise die IKS in zahlreichen Zeitungsartikeln jener Zeit), aber einsame Rufer in der Wüste waren, fallen die Erfahrungen der TEKEL-ArbeiterInnen heute auf einen Boden, auf dem es zu sprießen beginnt - nicht üppig zwar, aber immerhin: die Lehren werden diskutiert von Leuten, die konkret mit denselben Problemen konfrontiert sind. In jedem Kampf heute stellen sich genau solche Fragen: Wie wehren wir uns am besten? Wo können wir Solidarität suchen? Wie organisieren wir unseren Kampf?
Und obwohl die Angriffe des türkischen Staats auf die TEKEL-Angestellten nicht gestoppt werden konnten, führten die Kämpfe nicht zu einer Demoralisierung, sondern zu einer Radikalisierung bei einem kleinen Teil der Klasse. Ein Teil, der die Hand ausstreckt zu den Klassenschwestern und -brüdern.
Die Diskussionen, die um den TEKEL-Streik in Gang gekommen sind, ziehen ihre Stärke weniger aus dem Hier und Jetzt, als aus der Perspektive, der Zukunft. Sie schlagen eine neue Richtung ein, sind ein Wegweiser. Die Kampfbereitschaft der Klasse kann von den revolutionären Minderheit nur in geringem Ausmass beeinflusst werden; die Kämpfe brechen spontan aus. Aber für die Richtung der Diskussionen, für die bereits gemachten Lehren, die Perspektive in den Kämpfen sind die heute noch kleinen Minderheiten unabdingbar. Sie können zu einem Faktor werden unter der Bedingung, dass auch sie sich ihrer potentiellen Stärke, ihrer Verbundenheit und gemeinsamen Aufgaben bewusst werden.
Joel, 16.09.10
Aktuelles und Laufendes:
- Kampf der Tekel-Beschäftigten [104]
- Tekel Türkei [105]
Weltrevolution Nr. 163
- 2339 Aufrufe
Buchrezension: Ante Ciliga - Im Land der verwirrenden Lüge
- 4160 Aufrufe
Wir haben die Zusendung eines Lesers erhalten, dem der bloße Verweis auf die Arbeiterkämpfe als Grundlage einer eigenen Organisierung zu wenig geworden ist. Seit mehreren Monaten beschäftigt er sich intensiver mit der revolutionären Tradition in der Arbeiterbewegung und nimmt Teil an den Diskussionen im linkskommunistischen Milieu. Wir begrüßen die Initiative des Lesers und ermutigen alle anderen Leser/Innen uns solche Texte zur Verfügung zu stellen.
Zeugnis einer fast verschütteten Diskussion
1953 erschien mitten im Kalten Krieg in der Reihe »Rote Weißbücher« im Verlag für Politik und Wirtschaft Ante Ciligas Aufzeichnungen »Im Land der verwirrenden Lüge«. Gekürzt aufgelegt als anti-kommunistische Agitationsausgabe bei Kiepenheuer und Witsch, dem damaligen »Hausverlag« des Gesamtdeutschen Ministeriums. Die schon längst vergriffene Ausgabe ist in dem Berliner Kleinverlag »die Buchmacherei«[i] neu erschienen. Diese Wiederveröffentlichung ist nun eingebettet in die Wiederaneignung eines Teils der verschütteten linkskommunistischen Geschichte. Es gibt ein neues Vorwort der Herausgeber und ein biografisch interessantes Nachwort.
Worin besteht der besondere Wert von Ante Ciligas Aufzeichnungen? Kritik aus revolutionärer Perspektive hatte es schon vor ihm gegeben: Früh wurde die anarchistische Kritik, wie Alexander Berkmans 1925 erschienenes Buch »Der Bolschewistische Mythos – Tagebuch aus der russischen Revolution 1920–1922«, bekannt. Panait Istrati hatte nach seiner zweiten Reise 1929 durch das post-revolutionäre Russland die Lage der Arbeiterklasse dramatisch geschildert (dieses Buch erschien 1929 auf französisch und 1930 auf deutsch). Victor Serges aus Russland herausgeschmuggelter Brief[ii] entwarf schon 1933 ein beklemmendes Bild der politischen Enge und Repression. Was Ante Ciliga auszeichnet ist sein besonderes Drama: Im Herbst 1926 wurde er von der jugoslawischen KP aus seinem Exil in Österreich, wo er als Delegierter der KPJ im Balkansekretariat der Komintern tätig war, an die Kommunistische Universität der nationalen Minderheiten des Westens in Moskau entsandt, 1927 nahm er Kontakt mit der trotzkistischen Opposition auf, damit begann seine Reise durch Knast, Lager und Verbannung. Die Jahre 1931 – 33 verbrachte er im Lager »Isolator« in Werchne-Uralsk und nahm dort aktiv teil an den Auseinandersetzungen zwischen den diversen trotzkistischen Gruppen, der Arbeitergruppe und den Dezisten, an deren Ende die Gründung der »Föderation der Linkskommunisten« stand[iii].
Dieser Text möchte untersuchen, wie diese Diskussion durch die Veröffentlichung des Buches[iv] in die internationale revolutionäre Diskussion eingeflossen ist. Wie die Diskussion der russischen Linken – die sämtlich liquidiert wurden – die internationalistische linkskommunistische Auseinandersetzung nach einigen Jahren doch noch bereichern konnte. Vorangestellt ist ein Blick auf die Generation der »Bewegung für die Befreiung der Arbeiterklasse« und eine kurze Skizze der diskutierten Themen.
Generation 1917
Verfügte Ante Ciliga über eine besonders geniale Persönlichkeit, die ihn zu einer solchen Erfahrung befähigte? Nein – er war wie seine ganze Generation 1917 euphorisiert worden. Viele verbanden wie Ciliga ihre eigene elendige Situation mit der ihrer ganzen Klasse. Der Kampf der russischen Arbeiterklasse riss den Horizont auf für eine emanzipatorische Zukunft und machte zugleich offenkundig, wer den Schlüssel zu dieser in der Hand hatte. Das Ende des imperialistischen Weltgemetzels schien greifbar nahe. Hunderttausende junge Arbeiter in Europa traten ein in die »Bewegung für die Befreiung der Arbeiterklasse« (so Agis Stinas über sein Engagement als Jugendlicher 1917). Sie nahmen an vorderster Front Teil an den Klassenkämpfen in ihren Ländern, sie beteiligten sich an den Auseinandersetzungen mit Sozialdemokraten und innerhalb der Gewerkschaften für eine revolutionäre Politik und gegen die staatlichen Institutionen und den Krieg. Sie wurden durch die revolutionäre Welle zu Revolutionären gemacht und als Revolutionäre nahmen sie an ihr begeistert teil. Auch Ante Ciliga war als Soldat der k.u.k Armee von der russischen Revolution begeistert. Er organisierte sich gleich in dem linken Flügel der kroatischen Sozialdemokraten, nahm an der ungarischen Räterepublik teil und polemisierte 1919 innerhalb der Partei für die Weltrevolution. Hunderttausende seiner Generation gingen den gleichen Weg und bauten die kommunistische(n) Partei(en) mit auf. Die russische Revolution und die Gründung der Kommunistischen Internationale war für sie der Beginn der Weltrevolution. Ihre Arbeit in der Arbeiterklasse und in der Partei war Teil dieser weltweiten Kampfbewegung. Konnte diese Kampfwelle erlahmen? Konnte diese Partei Fehler machen oder gar zu einer konterrevolutionären Kraft werden? Bis auf wenige spektakuläre Ausschlüsse (z. B. Boris Souvarine 1924) und die besondere Entwicklung in Italien und Deutschland[v] blieben die meisten Revolutionäre mindestens bis 1926 (Agis Stinas gar bis 1931) in der Partei, obwohl die Degeneration der Revolution und ihrer Organisationen immer offensichtlicher wurden. Ciligas Weg ist auch hier typisch: »Während meiner Haft im »Isolator« beteiligte ich mich erst spät an Diskussionen über Lenins Rolle. Ich gehörte einer Generation junger KommunistInnen an, für die Lenin unantastbar war. Für mich stand außer Frage, dass er immer recht gehabt hatte. Die Ergebnisse - die revolutionäre Eroberung der Macht wie ihr Erhalt - sprachen schließlich dafür. Dadurch waren für mich und meine Generation sowohl Taktik als auch Mittel gerechtfertigt.«
Die »kommunistische Linke« in Russland
Die Opposition der russischen Linken[vi] hatte sich in der Regel um einen Antrag auf den jährlichen Parteikongressen Anfang der 20er organisiert. So führten die Demokratischen Zentralisten auf dem IX. Parteitag vom März-April 1920 ihre Kampagne gegen die »Militarisierung der Arbeit«, die Arbeiteropposition auf dem X. Parteikongress im März 1921 die sogenannte Gewerkschaftsdiskussion. 1921 kam Kronstadt und das Fraktionsverbot. Die Arbeitergruppe um Gavriel Miasnikow (ehemaliges Mitglied der Arbeiteropposition) veröffentlichte ihr Manifest zum XII. Parteitag 1923[vii] und intervenierte illegal in der Streikwelle. Damit wurde klar zum Ausdruck gebracht: das Klassenterrain zu diesem Zeitpunkt umfasste den Kampf in der Partei und an der Seite des kämpfenden Proletariats. Doch der Niedergang der Revolution schritt weiter fort.
Als Ciliga Ende 1930 im Lager eintraf, waren fast alle übriggebliebenen Militanten der Opposition im Lager oder der Verbannung. Beeindruckend ist, welche Tiefe und Ernsthaftigkeit die Diskussion im Lager annahm. Die Gruppen hielten Sitzungen ab und jede Tendenz gab ihre eigene Zeitung heraus. Die Diskussionen[viii] waren bestimmt von »sozialistischen Illusionen«, viele Linke hatten sich mit Trotzki am »linken« Kriegskommunismus orientiert und jede noch so radikale Kritik an der NEP war letztendlich ein Plädoyer für die Kollektivierung (die Stalin nach seinem »Linksschwenk« scheinbar Trotzkis Plan folgend durchführte). Doch auch die Kritiken aus der Arbeiterperspektive, die mit Trotzki gebrochen hatten, gingen letztendlich davon aus, dass der Sozialismus in Russland aufzubauen sei. Andere sahen die historische Klemme und verwarfen nicht nur die Möglichkeit des »Sozialismus in einem Land«, sondern stellten gleich den proletarischen Charakters der Revolution von 1917 in Frage. Die Diskussionen im Lager waren somit ein Panoptikum angefüllt mit Leidenschaft, aber von Ungenauigkeiten und Verwirrungen. Konnte die Diktatur des Proletariats, die eine Diktatur der Partei geworden war, als eigenständige Gesellschaftsform »in Richtung auf den Sozialismus«[ix] bezeichnet werden. Nach zehn Jahren war die internationale Ausweitung ausgeblieben, welche Schlüsse sind daraus zu ziehen?
Zusätzlich beachtenswert ist an Ante Ciligas Buch, dass er nicht nur die Diskussion um die politische und ökonomische Macht in Russland nachzeichnet, sondern sich auch bemühte die soziale Realität der Arbeiterklasse und der Bauernschaft in Russland einzufangen. Die Berichte über das Massensterben auf dem Land erreichten die Lager, die Lage der Arbeiterklasse war verheerend[x]. Nach dieser Bestandsaufnahme erfolgte für Ciliga und andere nicht nur der Bruch mit dem herrschenden russischen Stalinismus, sondern auch mit dem Trotzkismus.
Miasnikow in Paris
Die Analysen der russischen Linken waren in den 20ern einer kleinen Schar von oppositionellen Linken in Westeuropa bekannt. 1923 verteilte die KAI[xi] in Berlin Flugblätter gegen die Repression der Arbeitergruppe, 1923 und '24 veröffentlichte Worker's Dreadnought Texte der Arbeitergruppe auf englisch, 1925 besuchte Sapranow als Vertreter der Dezisten illegal Karl Korsch, 1927 veröffentlichten »le reveil communiste« und »von den aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossenen Hamburger Oktoberkämpfern« (übersetzt von Hedda Korsch) die Plattform der 15[xii]. Somit waren die Diskussionen der linken Kommunisten bereits bekannt, als 1930 Gavriel Miasnikow nach Knast und Folter nach Paris fliehen konnte. In Paris schließt sich Miasnikow der Gruppe »l'ouvrier communiste« (ein Nachfolgeprojekt von »le reveil communiste«) um Pappalardi (ehemaliges Gründungsmitglied der italienischen Fraktion) an. Warum führte dies nicht zu einer Umgruppierung der oppositionellen Kommunisten im Allgemeinen und der internationalistischen Linken im besonderen?
Zehn Jahre nach der Oktoberrevolution hatte sich die Welt dramatisch gewandelt. Die Revolution in Deutschland war blutig unterdrückt und spätestens 1923 hatte die Arbeiterklasse eine herbe Niederlage erleiden müssen. Der britische Generalstreik 1926 war niedergeschlagen worden und die chinesischen Revolutionäre wurden mehrmals der Konterrevolution ausgeliefert, bevor 1929 die Weltwirtschaftskrise ausbrach. Die euphorische Stimmung war abgeklungen, die wenigen Revolutionäre, die sich außerhalb der bereits stalinisierten Parteien organisierten, waren eingeklemmt zwischen Stalinismus und Faschismus. Frankreich war zwar das Zentrum der internationalen Diskussion, KommunistInnen aus Deutschland, Italien, Rumänien usw. fanden sich hier ein, doch beschränkte dieses Milieu sich auf einige Dutzend. Die Tiefe und Dramatik des historischen Wendepunktes war zwar spürbar, jedoch noch nicht analysiert. In welcher historischen Phase befinden wir uns? Welche politischen und organisatorischen Schlüsse sind daraus abzuleiten?
Die Gruppe »l'ouvrier communiste« um Miasnikow war politisch stark der Traditionslinie der KAPD verpflichtet. Somit waren sie früh dazu in der Lage, das politische Scheitern der russischen Revolution festzustellen. Doch befand sich nach ihrer Analyse nicht nur der Kapitalismus in seiner Todeskrise, sondern wir befanden uns weiterhin in einer offenen revolutionären Phase. Welche Probleme diese Analyse mit sich zog, erkennen wir im nächsten Abschnitt.
Internationalistische Diskussion in Frankreich
Während Trotzki innerhalb der Arbeiterklasse Russlands wegen der »Militarisierung der Arbeit« verhasst war, galt er für die meisten kommunistischen Oppositionellen außerhalb Russland nach seiner Ausweisung 1929 als tadelloser Führer der Weltrevolution. Trotzki strebte sofort eine Umgruppierung an. Alfred Rosmer wurde nach Deutschland geschickt, französische Genossen reisten nach Prinkipo. Trotzkis Entscheidungskriterium für eine Zusammenarbeit war die Haltung zum russischen Staat. So brach er mit den »Korschisten«[xiii] und lobte die »linke Fraktion der PCI« für ihr Gründungsmanifest von Pantin 1927 und den Bruch mit »le reveil communiste«. Die italienische Fraktion akzeptiert 1930 Trotzkis Plattform der ILO als Grundlage der Diskussion. Während »le reveil communiste« 1929 in einem offenen Brief[xiv] an die Basis der PCF und der Kommunistischen Internationalen die Möglichkeit einer Wiederbelebung der KI verwirft und die fraktionelle Orientierung der Trotzkisten und Bordigisten (so wurde die Fraktion um die Zeitschrift »Prometeo« bezeichnet) als konterrevolutionär denunzierte.
An dieser Stelle müssen wir innehalten und uns den Hintergrund der Diskussion verdeutlichen. Tiefere Grundlage für die unterschiedlichen Einschätzungen (innerhalb der Linkskommunisten von »Prometeo« und »le reveil communiste« und den Trotzkisten) ist nicht die Frage des »Staatskapitalismus«, sondern die Analyse der historischen Phase. Hier verläuft die Frontstellung für die folgenden Jahre. »le reveil communiste«[xv] (und ab 1930 »l'ouvrier communiste«) geht ähnlich wie Trotzki von einer offenen revolutionären Phase aus. Dieser kann sich nicht von der Einschätzung der »revolutionären Phase« trennen und orientiert sich ab 1933 hin zum Aufbau einer neuen (vierten) Internationale. Die Analyse der historischen Phase ist also eng verbunden mit der Frage der Organisierung[xvi]. Kein Wunder, dass der Bruch zwischen Fraktion und Trotzki schon 1931/32 erfolgt. Die Fraktion entschließt sich gegen solche voluntaristischen Abenteuer und für das intensive Studium der dramatischen Kernfragen: wie konnte die erste erfolgreiche proletarische Revolution solch ein Gebilde hervorbringen, wie konnte die Führerin der Weltrevolution – die KI – zu einer Kraft der Konterrevolution werden, wie konnte sich die Phase des revolutionären Aufbegehrens und der Euphorie in eine der Desillusionierung und Isolation wenden? Angetrieben von diesen Fragen wurde 1933 Bilan gegründet[xvii].
Die ernsthafte und tiefe Analyse der russischen Revolution befähigte die Fraktion dazu, einige wichtige Prinzipien zu konkretisieren, hierzu zählen insbesondere die Kritik der nationalen Befreiungsbewegungen[xviii] und die Kritik der demokratischen Illusionen. Die größte Prüfung kam mit dem spanischen Bürgerkrieg[xix]. Die UdSSR und ihre Kommunistischen Parteien traten als imperialistische Macht mit Deutschland und Italien in den europäischen (wenn nicht schon in den globalen) Machtkampf ein, Trotzki sprang ihnen an die Seite und sah eine neue »revolutionäre Phase« eintreten. Doch auch die vielen linkstrotzkistischen Gruppen[xx], die bereits mit Trotzki gebrochen hatten, und auch die Minderheit der Fraktion schlossen sich dieser »revolutionären Hoffnung« an. Spätestens hier erkannte die Fraktion das Gift der antifaschistischen Ideologie.
Umgruppierung und Bereicherung während des 2. Weltkriegs
Die Politik der Volksfront und des Antifaschismus hatten den internationalen Klassenkampf in die Irre geführt und das Klassenterrain verlassen. Der Ausbruch des 2. Weltkriegs verschärfte die Lage noch mehr. Die Reste der revolutionären Linken waren desorientiert, die trotzkistischen Gruppen hatten endgültig das eine oder andere imperialistische Lager gewählt. Doch traten erstmals wieder neue und junge Militanten auf. Der Kern der zukünftigen französischen Fraktion orientierte sich an den Lehren der Arbeit von Bilan und war ab 1941 gar wieder in der Lage jährliche Konferenzen abzuhalten. Der Vormarsch der Nationalsozialisten hatte die RKÖ/RKD[xxi] ins Exil nach Frankreich und Belgien getrieben. Als ursprünglich trotzkistische Organisation hatten sie 1938 als einzige gegen die Gründung der IV. Internationalen gestimmt und entwickelten einen unnachgiebigen revolutionären Defätismus. Die Wühlarbeit der RKD, die Flugblätter unter deutschen Soldaten und unter der französischen Zivilbevölkerung zur Fraternisation verteilte, war Orientierung für alle Revolutionäre, die die Aufgabe des Klassenterrains nicht mitmachen wollten. So gründeten sich um die RKD 1942 die »communiste revolutionaire«. Die RKD und die CR schrieben und verteilten teilweise zusammen mit dem Kern der späteren französischen Fraktion Flugblätter, und sie begannen eine vertiefende Diskussion über die russische Frage. In dieser Diskussion spielte das Buch von Ciliga eine große Rolle. Nun kamen unnachgiebiger Internationalismus, Einschätzung der historischen Phase und Arbeiterperspektive (»von unten«) in der Diskussion zusammen und machten es möglich, dass die Positionen der italienischen, deutschen und russischen Linken sich gegenseitig befruchteten[xxii].
Die Linkskommunisten in der Tradition der italienischen Linken waren bisher sehr skeptisch gegenüber der frühzeitigen Einschätzung des russischen Staates als »Staatskapitalismus« gewesen. Ihnen war es wichtiger, eine fundamentale Bilanz der revolutionären Welle zu ziehen und sich daran zu organisieren.
Der Fraktion gelang es, sich durch die gemeinsame illegale Arbeit und tiefen Diskussionen, die ernsthaften Auseinandersetzungen, die Ante Ciliga aus dem Lager schildert, anzueignen. Es ist nun keine Überraschung mehr, dass auch um diese Zeit herum das Studium von Rosa Luxemburg intensiviert wurde und die Auseinandersetzung mit der deutsch-holländischen Linken ernsthaftere Formen annahm. Internationalistische Perspektive und die Überzeugung, dass die Revolution nur die Sache der Arbeiterklasse selbst sein könne, waren der Kern des Linkskommunismus. 1943 stellt die Konferenz der Fraktion erstmals fest, dass die UdSSR »staatskapitalistisch« sei. Doch war dies nun kein Label, sondern fußte auf dem Kampf um eine revolutionäre Position in den düstersten Zeiten des Weltgemetzels und der Konterrevolution. Zum 1. Mai 1945 verteilten RKD, CR und die Fraktion gemeinsam ein Flugblatt an die Proletarier in Russland, Italien, Deutschland, Frankreich .... »Vorwärts zur kommunistischen Weltrevolution!«
Diese revolutionäre Position ist bis heute nicht abgebrochen, doch um die heutigen Aufgaben auf den historischen Lehren aufzubauen, müssen diese erstmal wieder freigeschaufelt und angeeignet werden. Die Herausgeber des Ciliga Buches sind ebenso um das »historische Erbe des Marxismus« bemüht und beziehen sich mit Rosa Luxemburg auf die Grundlage jeder revolutionären Veränderung der »lebendigen Quell selbst, aus dem heraus alle angeborenen Unzulänglichkeiten der sozialen Institutionen allein korrigiert werden können: das aktive, ungehemmte, energische politische Leben der breitesten Volksmassen«[xxiii] - dem ist zuzustimmen. Das Interesse an der Wiederaneignung scheint vorhanden, die erste Auflage ist schon ausverkauft und eine Diskussionsveranstaltung in Berlin brachte dreißig Interessierte GenossInnen zusammen.
[i] Das Buch ist erhältlich bei: https://www.diebuchmacherei.de [106]
[iii] die er jedoch aufgrund seiner Deportation nach Sibirien nicht mehr miterleben durfte
[iv] Der erste Teil »Au
pays du grand mensonge« erschien 1938 und umfasst die Jahre 1926 - 1933, der
zweite Teil erschien 1950 unter dem Titel »Sibérie, terre d'exil et de
l'industrialisation« und behandelt die Jahre seiner Verbannung
1933 – 1935.
[v] In Italien und Deutschland waren die Klassenkämpfe am stärksten entwickelt und die fraktionellen Kämpfe um die richtige Parteipolitik tobten entsprechend am heftigsten. In Italien wurde die Mehrheit um Amadeo Bordiga ab 1923 kaltgestellt, in Deutschland wurde die Mehrheit (die spätere KAPD) schon 1919 ausgeschlossen.
[vi] siehe die Artikelserie zur russischen Linken https://de.internationalism.org/KomLiRu [108] und das englischsprachige Buch »The Russian Communist Left«
[vii] siehe die englische Ausgabe der International Review 142
[viii] siehe die Erstübersetzung des Abschnitts aus »Lenin auch...« auf https://stinas.blogsport.de [109]
[ix] so Trotzki im Entwurf der Plattform für die Internationale Linke Opposition (ILO) April 1930, der 1932 im Lager bekannt wird und Ciliga entsetzt: »Es war fortan vergeblich zu hoffen, dass Trotzki je zwischen Bürokratie und Proletariat, zwischen Staatskapitalismus und Sozialismus würde unterscheiden können. Am meisten schockierte mich an Trotzkis Programm, dass es die Illusionen des westlichen Proletariats über Russland eher verstärkte als zerstörte.« S. 118
[x] »Es ist wohl nicht übertrieben, zu behaupten, dass ein Drittel der Arbeiterklasse in Russland aus Sklaven besteht.« .S112
[xi] Kommunistische Arbeiter Internationale – das kurzlebige Produkt der KAPD Essener Richtung gemeinsam mit den Gruppen um Herman Gorter in den Niederlanden, um Sylvia Pankhurst in Britannien und weiteren Gruppen in Belgien, Bulgarien und unter Exilanten aus der Sowjetunion, 1922 - 25
[xiii] Korsch hatte 1926 die »Entschiedene Linke« als Fraktion der KPD mit der Monatszeitschrift »Kommunistische Politik« gegründet und war gleich ausgeschlossen worden. Nach der Auflösung der »Entschiedenen Linken« arbeiteten korschistische Zirkel bis zur nationalsozialistischen Machtübernahme 1933.
[xv] Sie zerfallen 1931 und ein Teil kehrt später zur Fraktion zurück. Dennoch lohnt sich das Studium dieses Versuchs, welches sich in der Veröffentlichung und/oder Kommentierung von Gorter, Bordiga, Trotzki und Korsch auszeichnet.
[xvi] siehe dazu die Broschüre »Das Verhältnis Fraktion – Partei in der marxistischen Tradition« der IKS
[xvii] genauer, siehe das Buch »Die Italienische Kommunistische Linke«
[xix] hier gibt es nicht den Platz die Klassenkämpfe in Spanien und die Volksfront in Frankreich zu analysieren, siehe: https://de.internationalism.org/spanien/38 [113]
[xx] Union Communiste führte im März 1937 in Paris eine internationale Konferenz durch, an der League for a RWP, LCI, RWL (Oehler), GIK, die Minderheit der Fraktion, Miasniskow, Ruth Fischer, Arkadi Maslow u. a. teilnahmen
[xxi] Revolutionäre Kommunisten Österreich bzw. Deutschland - siehe dazu die empfehlenswerte Broschüre »Gegen den Strom!« der Bibliothek des Widerstands https://sites.google.com/site/bibliothekdeswiderstandes/ [114]
[xxii] Der letzte bedeutendere Versuch, der sich im Briefwechsel zwischen Korsch und Bordiga 1926 ausdrückt, war ergebnislos verlaufen, siehe: https://www.sinistra.net/lib/upt/comsmo/keru/keruahecad.html [115]
[xxiii] Rosa Luxemburg »Zur russischen Revolution« 1915
Leute:
- Ante Ciliga [116]
- Miasnikow [117]
Historische Ereignisse:
- Stalinistische Gefangenenlager [118]
- RKD [119]
- stalinistische Schauprozesse [120]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Deutsche Wiedervereinigung Teil 5
- 2789 Aufrufe
Die deutsche Wiedervereinigung hat in ökonomischer, politischer und sozialer Hinsicht die Erwartungen, die sie Anfang der neunziger Jahre geweckt hatte, zweifellos enttäuscht. Von der furchtbaren Ernüchterung insbesondere der ostdeutschen Lohnabhängigen haben wir schon gesprochen. Aber auch die (westdeutsche) Bourgeoisie hatte sich gründlich verrechnet, als sie, überwältigt von dem Kollaps des Ostblocks, von riesigen Märkten in Osteuropa fabulierte und einen „selbsttragenden Aufschwung“ Ostdeutschlands schon in wenigen Jahren erwartete. Doch warum war die Wiedervereinigung nicht die erhoffte Initialzündung für eine Wiederholung der sog. „Gründerjahre“, die einst dem deutsch-französischen Krieg 1871 gefolgt und Zeuge eines beispiellosen Booms des deutschen Kapitalismus gewesen waren? Warum ist Ostdeutschland bis heute ein Klotz am Bein des deutschen Kapitals? Immerhin fiel der westdeutschen Bourgeoisie mit der DDR ein durch und durch industrialisiertes Land mit einer gut ausgebildeten Arbeiterklasse und deren unendlichen Bedürfnissen in den Schoß.
Es wäre zu kurz gegriffen, würde man mit dem Hinweis auf den maroden Zustand der ostdeutschen Industrie antworten. Die Kosten der Sanierung von Bitterfeld, Wismar, der Braunkohletagebaustätten etc. waren, wenngleich kein Pappenstiel, von einmaliger Natur; da bereitet die ständige Alimentierung großer Teile Ostdeutschlands der deutschen Bourgeoisie weitaus mehr Kopfzerbrechen. Wir meinen, dass man auf der Suche nach den Ursachen für das ökonomische und soziale Fiasko der deutschen Wiedervereinigung woanders ansetzen muss. Eine Analyse dieser Ursachen muss zuvorderst den zeitlichen Zusammenhang, die Epoche berücksichtigen, in der die deutsche Wiedervereinigung stattfand - eine Epoche, die ganz im Zeichen des Niedergangs der kapitalistischen Produktionsweise steht.
Um zu begreifen, was dies für die Wiedervereinigung bedeutete (und bedeutet), bietet es sich an, auf die Methode der historischen Gegenüberstellung zurückzugreifen. Deutschland ist nicht die erste Nation, die eine gewisse Zeitlang geteilt war und die sich schließlich wieder vereinigte. Auch die US-Bourgeoisie durchlebte einst das Trauma einer Sezession: Von 1861 bis 1865 wütete ein blutiger Bürgerkrieg zwischen den Südstaaten, den Konföderierten, und den Nordstaaten der USA, den Unionisten. Auslöser dieses Bürgerkriegs war die Sklavenfrage. Während der industrielle Norden (die Neuengland-Staaten, Ohio, etc.) grundsätzlich für die Abschaffung der Sklaverei, zumindest aber für die Aufrechterhaltung des Status quo, den sog. Missouri-Kompromiss von 1820[1], eintrat, strebte der Baumwolle produzierende Süden (Alabama, Georgia, Louisiana) eine Ausweitung der Sklaverei auf die gesamten USA an; denn „fortwährende Ausdehnung des Territoriums und fortwährende Verbreitung der Sklaverei über ihre alten Grenzen hinaus ist ein Lebensgesetz für die Sklavenstaaten der Union“[2]. Als der Bürgerkrieg 1865 mit der Niederlage der Konföderierten endete, lag die Wirtschaft der Südstaaten darnieder; die hohen Kriegskosten trieben die Vereinigten Staaten in den Schuldenstand, und zudem stand die junge amerikanische Nation unter dem noch frischen Schock eines Bruderkrieges. Keine günstigen Voraussetzungen für eine Wiedervereinigung, sollte man meinen.
Und dennoch sollte der Ausgang des amerikanischen Bürgerkrieges den Grundstein für ein einheitliches Nationalbewusstsein in den USA legen, das auf dem stolzen Bekenntnis zu den universellen Menschenrechten und auf das für jeden Menschen geltende Recht des Strebens nach Glück (pursuit of happiness) fußte. In den dem Bürgerkrieg folgenden Jahrzehnten erlebten die USA einen fulminanten wirtschaftlichen Aufstieg, der aus einem vorwiegend agrarwirtschaftlich orientierten Land eines der mächtigsten Industrieländer machte. Die vielen Hunderttausend Afroamerikaner, die aus der Sklaverei befreit worden waren, verdingten sich fortan als Lohnarbeiter in den wie Pilze aus dem Boden schießenden Fabriken der US-Industrie und verstärkten so das Heer der Arbeiterklasse. Es war die Zeit, als der Mythos von Amerika als dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ geboren wurde.
Das Geheimnis hinter dieser Dynamik, die der Sieg des Nordens im Bürgerkrieg auslöste, lag in einer Eigentümlichkeit des US-amerikanischen Kapitalismus, die ihn zu jener Zeit von den europäischen Industrieländern unterschied. Während Letztere mangels ausreichender inländischer nicht-kapitalistischer Märkte bereits gezwungen waren, einen Teil ihres Mehrwerts auf dem Wege der Einverleibung fremder nicht-kapitalistischer Territorien zu realisieren, sei es durch Kolonialisierung oder durch Kapitaltransfer, zehrte der US-Kapitalismus noch lange Zeit von den unermesslichen Weiten seines Territoriums, die noch ihrer Durchkapitalisierung harrten und von Subsistenz- und Sklavenwirtschaft dominiert waren. Der Bürgerkrieg setzte diesem Zustand „ein jähes Ende (...) Die enorme Staatsschuld von 6 Milliarden Dollar, die er der Union aufgebürdet hatte, zog eine starke Erhöhung der Steuerlasten nach sich. Namentlich beginnt aber seit dem Kriege eine fieberhafte Entwicklung des modernen Verkehrswesens, der Industrie, besonders der Maschinenindustrie, unter Beihilfe des steigenden Schutzzolls (...) Das Eisenbahnnetz wuchs denn auch in beispielloser Weise. 1860 betrug es noch nicht 50 000 Kilometer, 1870 über 85 000, 1880 aber mehr als 150 000 (...) Die Eisenbahnen und die Bodenspekulationen riefen eine massenhafte Einwanderung aus Europa nach den Vereinigten Staaten herbei (...) Im Zusammenhang damit emanzipierte sich die Union nach und nach von der europäischen, hauptsächlich englischen Industrie und schuf eigene Manufakturen, eine eigene Textil-, Eisen-, Stahl- und Maschinenindustrie. Am raschesten wurde die Landwirtschaft revolutioniert. Bereits in den ersten Jahren nach dem Bürgerkriege wurde die Plantagenbesitzer durch die Emanzipation der Neger gezwungen, den Dampfflug einzuführen.“[3] Mit anderen Worten: der amerikanische Bürgerkrieg war der Türöffner zur Durchkapitalisierung des Südens und Westens Nordamerikas; er öffnete ein Ventil, das der Akkumulation des US-Kapitals neue Betätigungsfelder bot und die Realisierung seines vollständigen Mehrwerts ermöglichte.
Der Unterschied zur deutschen Wiedervereinigung mehr als 120 Jahre später liegt auf der Hand. Die Wiedervereinigung Deutschlands fand nicht inmitten der geographischen Expansion eines noch im Aufstieg befindlichen Kapitalismus statt. Sie spielte sich vielmehr vor dem Hintergrund chronischer Absatzprobleme eines niedergehenden Kapitalismus ab, der schon längst an seine Grenzen gestoßen ist, d.h. die letzten großen außerkapitalistischen Territorien in den kapitalistischen Weltmarkt einverleibt hat. Nichts macht dies deutlicher als die Bevölkerungsstruktur der alten DDR.
Um zu erläutern, was wir meinen, möchten wir etwas weiter ausholen und auf Rosa Luxemburgs Werk Die Akkumulation des Kapitals zu sprechen kommen. Bei ihrer Analyse des Marxschen Schemas einer erweiterten Reproduktion stieß sie auf einen Widerspruch in seiner Argumentation, der ihrer Auffassung nach eine erweiterte Reproduktion eigentlich unmöglich machen musste. Marx ging nämlich, als er die erweiterte Reproduktion des Kapitals unter die Lupe nahm, von einem Kapitalismus unter Laborbedingungen aus, der von allen „störenden“ Einflüssen anderer Gesellschaftsschichten und –klassen befreit war und in dem nur noch die beiden historischen Hauptklassen, Arbeit und Kapital, übrigblieben. Rosa Luxemburg wies nach, dass ein solch „reiner“ Kapitalismus in der Realität zum Scheitern verurteilt wäre, denn in ihm „wird die Akkumulation zur Unmöglichkeit: Die Realisierung und Kapitalisierung des Mehrwerts verwandelt sich in eine unlösbare Aufgabe.“[4] In der Tat kann nicht der gesamte, aus der Arbeiterklasse herausgepresste Mehrwert innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse realisiert werden; ein kleiner, aber wichtiger Teil dieses Mehrwerts muss außerhalb dieser Verhältnisse abgesetzt werden.
Für Rosa Luxemburg war dieser „reine“ Kapitalismus lediglich eine „wissenschaftliche Fiktion“[5], doch zumindest die DDR kam diesem kapitalistischen Endstadium sehr nahe. Die „Kollektivierung“ der Landwirtschaft in den fünfziger Jahren und die Enteignung des Handwerks in den sechziger Jahren hatten zu einer nahezu vollständigen Ausmerzung der letzten Reste außerkapitalistischer Produzenten geführt (außerkapitalistische Produktion meint in diesem Kontext eine Produktion, die nicht auf der Grundlage der Lohnarbeit stattfindet). Laut Statistischen Bundesamt wies die DDR zuletzt den weltweit höchsten Industriearbeiteranteil an der Bevölkerung auf. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in der verblichenen DDR waren auf die ausschließliche Konfrontation zwischen den beiden Hauptklassen im Kapitalismus zusammengedampft: auf der einen Seite die „Werktätigen“, auf der anderen die „Nomenklatura“ eines despotischen Staatskapitalismus.
Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer.
· Der Ausgang des amerikanischen Bürgerkrieges, der totale Sieg der Nordstaaten, verschaffte dem Heißhunger des noch jungen, aber aufstrebenden US-Kapitalismus nach neuen ungenutzten Verwertungsmöglichkeiten neue Nahrung in den nicht-kapitalistischen Territorien innerhalb seiner Grenzen und ließ ihn binnen kurzen zur größten Industrienation der Welt avancieren. Doch ihren kometenhaften Aufstieg zu einer imperialistischen Hauptmacht, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dem Bürgerkrieg folgte, verdankten die USA in erster Linie dem Umstand, dass ihr noch ein weites inneres Akkumulationsfeld in Gestalt der noch mehr oder weniger unabhängigen Bauern sowie ein äußeres Akkumulationsfeld in Gestalt des lateinamerikanischen Halbkontinents zur Verfügung stand, der noch seiner Durchkapitalisierung harrte. Das westdeutsche Kapital nach der Wiedervereinigung dagegen suchte solvente Märkte im angeblich nicht-kapitalistischen Osten Deutschlands und fand eine völlig durchkapitalisierte Gesellschaft in Agonie vor. Darüber hinaus stand die deutsche Wiedervereinigung unter dem unglücklichen Stern einer chronischen Übersättigung der Märkte weltweit. Und mit der Auflösung der staatlichen Strukturen des Ostblocks Anfang der 1990er Jahre brachen auch die osteuropäischen Märkte weg, von denen man sich einst soviel versprochen hatte. Der „Hinterhof“ des deutschen Imperialismus war, ökonomisch betrachtet, nicht das erhoffte Eldorado für die Akkumulationsbedürfnisse des deutschen Kapitalismus, sondern ein Fass ohne Boden.
· Der US-Kapitalismus nach dem Bürgerkrieg laborierte nicht an einem Mangel von Märkten, sondern an chronischen Unterkapazitäten auf dem Arbeitsmarkt, die er nur mühsam durch die Einwanderer aus der Alten Welt und die befreiten Sklaven in den Südstaaten kompensieren konnte. Der deutsche Kapitalismus nach der Wiedervereinigung jedoch leidet bekanntlich an chronisch überfüllten Märkten und beileibe nicht an einem Mangel von Arbeitskräften.
· Der Sieg des Nordens im amerikanischen Bürgerkrieg versetzte der Sklavenwirtschaft in den Südstaaten der USA und der Bauernwirtschaft in den westlichen Territorien den Todesstoß und ersetzte beide durch den modernen Kapitalismus – einer Gesellschaft, die wie keine andere zuvor auf den gesellschaftlichen Charakter der Produktion beruht und die vom Kommunismus „allein“ die private Aneignung der Produktionsmittel trennt. Daher die Unterstützung der Nordstaaten im Bürgerkrieg durch die internationale Arbeiterbewegung[6] und die Glückwünsche der Internationalen Arbeiterassoziation an den US-Präsidenten Lincoln anlässlich des Sieges der Unionisten. Der Triumph der westlichen „Marktwirtschaft“ über den „Realsozialismus“ des Ostens – mit dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung als Höhepunkt – hingegen leitete keineswegs einen gesellschaftlichen Umbruch ein; hier wurde lediglich eine Variante des staatskapitalistischen Regimes durch eine andere, subtilere und flexiblere Variante abgelöst. Weder haftet der westdeutschen Bourgeoisie auch nur im Entferntesten etwas Fortschrittliches an, das es von Seiten der revolutionären Kräfte zu unterstützen gilt; noch hatte das stalinistische Regime in der ehemaligen DDR auch nur das Geringste mit dem Sozialismus zu tun, wie uns Linksextremisten vom Schlage der Trotzkisten weismachen wollten.
So besteht denn die Aufgabe der heutigen Kommunisten nicht mehr – wie 1861, als der amerikanische Bürgerkrieg ausbrach – darin, sich für die nationale Einheit der Bourgeoisie, für die Bildung von bürgerlichen Nationalstaaten stark zu machen, um die lokale und regionale Zersplitterung der Arbeiterklasse zu überwinden. Heute geht es vielmehr darum, die globale Einheit anzustreben, um die Arbeiterklasse aus ihrer nationalen Zersplitterung zu befreien.
Resümee
Fassen wir zum Schluss in aller Kürze noch einmal zusammen: Ökonomisch betrachtet, erwies sich das, was dem westdeutschen Imperialismus im November 1989 mit der Auflösung der DDR in den Schoß gefallen war, als eine faule Frucht. Der politisch zwingende, aber vom Standpunkt der wirtschaftlichen Notwendigkeiten her wohl völlig überhastete Anschluss Ostdeutschlands war vielleicht politisch geboten, vor allem um die imperialistischen Kontrahenten vor vollendete Tatsachen zu stellen, aber wirtschaftlich führte er zu einer massiven De-Industrialisierung und einer daraus folgenden Alimentierung Ostdeutschlands, die die ökonomische Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik überstieg und die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitalismus vorübergehend in Frage stellte.
Vom imperialistischen Standpunkt aus betrachtet, war die Wiedervereinigung gleichermaßen Fluch und Segen für das deutsche Kapital. Sie führte unbestreitbar zu einer Aufwertung Deutschlands in der Weltpolitik, denn in der kapitalistischen Arithmetik der Macht bedeutet der Zugewinn von Territorien und „Menschenmaterial“ fast zwangsläufig auch einen Zugewinn an Gewicht und Einfluss auf imperialistischer Ebene. Sie verbaute gleichzeitig aber auch den Weg zu einer militärischen Unterfütterung dieses gewachsenen politischen Einflusses, was die Rolle Deutschlands auf unabsehbare Zeit auf die einer imperialistischen Mittelmacht reduziert, weil sie beispielsweise durch die Alimentierung der vielen Arbeitslosen erhebliche Mittel bindet, die sonst zur Aufrüstung eingesetzt werden könnten.
Auch vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus betrachtet, provoziert die deutsche Wiedervereinigung durchaus gemischte Reaktionen. Es überwiegt zunächst der Eindruck, dass die Nach-Wende-Jahre sowohl in sozialer Hinsicht als auch auf der Ebene des Klassenbewusstseins einen herben Rückschlag für die Arbeiterklasse in Deutschland bedeuteten. Massenarbeitslosigkeit dort und Lohnraub hier hinterließen tiefe Spuren in der geistigen Verfassung unserer Klasse. Demoralisiert und desorientiert, war sie ein willfähriges Opfer jener unseligen Kampagne über das angebliche Ende des Kommunismus und Klassenkampfes. In Ermangelung einer Perspektive verirrten sich Teile der Arbeiterklasse auf dem Terrain des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit. Überdies litt die Arbeiterklasse in Deutschland unter einer tiefen Ost-West-Spaltung, die ihre Widerstandskraft aushöhlte und sie zur Hinnahme der schlimmsten Angriffe gegen ihren Lebensstandard seit Bestehen der beiden deutschen Staaten 1949 zwang.
Doch mit dem Fall der Berliner Mauer wurde eine weitaus größere Spaltung der Arbeiterklasse überwunden. Nach fast 30 Jahren strikter Trennung und hermetischer Isolation der im Herrschaftsbereich des sog. Realsozialismus lebenden ArbeiterInnen gegenüber ihren Leidensgenossen in den westlichen Demokratien kann man mittlerweile auch faktisch von einer globalen Arbeiterklasse sprechen, die unter denselben Lebens- und Arbeitsbedingungen sichtlich vereint ist und die befreit ist von den ideologischen Gräben des Kalten Krieges. Noch nie war die Welt und mit ihr die internationale Arbeiterklasse so eng zusammengerückt wie heute. Und noch nie war die Gelegenheit, den Klassenkampf gegen das Kapital zu globalisieren, so günstig wie heute.
[1] Dieser Kompromiss sah den 36. Breitengrad als Grenze zwischen den sklavenhaltenden und nicht-sklavenhaltenden Staaten vor.
[2] Marx, Der nordamerikanische Bürgerkrieg, MEW Bd. 15, S. 335).
[3] Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Gesammelte Werke, Bd. 5, S. 345f.
[4] Ebenda, S. 364.
[5] Ebenda, S. 365.
[6] So weigerten sich beispielsweise britische Hafenarbeiter, Schiffe mit Fracht aus den Südstaaten zu löschen.
Aktuelles und Laufendes:
Erste Lehren aus den Kämpfen in Frankreich
- 2308 Aufrufe
Kaum ist die Bewegung in Frankreich aus den Schlagzeilen verschwunden, regt sich verstärkter Widerstand in Großbritannien gegen die brutalen Sparbeschlüsse. An der Spitze der ersten Proteste standen die Studenten (siehe dazu das Flugblatt auf unserer Webseite). Wird es den anderen Betroffenen der Opfer der Sparpolitik, allen voran den Arbeitern, gelingen, eine breite Front des Widerstands gegen das Kapital aufzubauen?
In den jüngsten Abwehrkämpfen und Protesten kommt eine Bereitschaft zum Widerstand zum Ausdruck, die sich nicht „nur“ gegen die Sparbeschlüsse der Regierungen richtet, sondern auch eine viel tiefergreifende Angst und Empörung über das, was diese Gesellschaft für die Menschheit bereithält, zum Ausdruck bringt.
Zum einen reagiert die Arbeiterklasse auf die jüngste Entwicklung der Krise, die geprägt wird von dem jetzt einsetzenden weltweiten Währungskrieg, zu dem die neue Konjunkturspritze der US-Regierung von 600 Milliarden Dollar gehört, welche nicht zuletzt die US-Währung verbilligen soll, und damit die US-Exporte beflügeln und die in Dollar gehaltenen US-Schulden im Ausland zum Teil abschmelzen sollen. Washington reagierte damit auf die Exportoffensiven vor allem Chinas und Deutschlands, wobei Obama eine US-Exportgegenoffensive in Seoul auf dem G20 Gipfel ankündigte. Somit droht hinter dem sogenannten Währungskrieg ein offener Handelskrieg auszubrechen, welcher längerfristig die Sonderkonjunktur der Exportweltmeister Deutschland und China untergraben kann.
Während man in den letzten Monaten den Eindruck zu erwecken versuchte, als ob die schlimmste Weltwirtschaftskrise seit der Depression der 1930er Jahre erfolgreich überstanden wäre – einschließlich der jüngsten Griechenlandkrise – zeichnet sich nunmehr am Horizont neues Unheil ab in Form einer drohenden erneuten Krise des Euros. Hinter dem Schreckgespenst des Bankrotts Irlands oder Portugals wirft sich der Schatten der Insolvenz größerer Volkswirtschaften wie Spanien, Italien…
Die Regierungen zeigen sich nicht nur unfähig dazu, ihre eigene Wirtschaft zu bändigen: sie sind genauso wenig in der Lage und außerdem sichtlich uninteressiert daran, den Bevölkerungen besonders notleidender Gebiete, wirksam Hilfe zu leisten – z.B. gegenüber dem Ausbruch der Cholera in Haiti oder gegenüber der Obdachlosigkeit Millionen Obdachloser in Pakistan angesichts des bevorstehenden Winters.
Die Meldungen über bevorstehende Terroranschläge in den großen Industriezentren Europas (als Folge des unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Terror geführten Kriegs in Afghanistan und im Irak), die in der Bevölkerung Angst auslösen und den Ruf nach dem Staat erschallen lassen sollen, erfolgt just zu einem Zeitpunkt, wo der Staat brutaler als je die Sparbeschlüsse durchpeitschen will.
Neben der unmittelbaren Wut über die Auswirkungen der Sparbeschlüsse entwickeln immer mehr lohnabhängige Menschen ein Gespür dafür, dass dieses System in einer Sackgasse steckt und die Menschheit in den Abgrund reißt. Dem Kampf des jeder gegen jeden freien Lauf lassen oder kollektiver, klassenmäßiger Widerstand dagegen, woraus die Perspektive einer solidarischen Gesellschaft entstehen könnte: So lautet die Frage. Welche Lehren in dieser Hinsicht die jüngste Bewegung in Frankreich bietet, haben wir als Schwerpunkt dieser Zeitung gewählt. (21.11.2010)
(nachfolgende Artikel wurden schon als Beilage auf unserer Webseite veröffentlicht).
Wie den Kampf in die eigenen Hände nehmen?
Die Bewegung gegen die Rentenreform dauert nun schon acht Monate. Der erste Aktionstag fand am 23. März statt, damals beteiligten sich 800.000 Menschen, die Atmosphäre war eher schlaff und ein wenig hoffnungslos. Aber seitdem hat der Kampf an Stärke gewonnen. Mehr und mehr Beschäftigte, Arbeitslose, Prekäre, ganze Arbeiterfamilien, Gymnasiasten und Studenten haben sich schrittweise der Bewegung angeschlossen. Zeitweise kamen regelmäßig mehr als drei Millionen auf der Straße zusammen!
In Wirklichkeit ist diese Reform zum Symbol der allgemeinen und brutalen Verschlechterung unserer Lebensbedingungen geworden. Die Jugendlichen stehen wie vor einer Mauer: im öffentlichen Dienst werden fast keine Leute mehr eingestellt; in der Privatindustrie gibt es kaum Stellen, und wenn dann nur zu sehr prekären, unhaltbaren Bedingungen. Eingefrorene Löhne, Preissteigerungen, insbesondere Mieterhöhungen, drastische Kürzungen bei der Erstattung von medizinischen Leistungen und der Sozialhilfe, Kürzungen bei Beschäftigungsgesellschaften usw… all diese unzähligen Angriffe treiben uns alle langsam aber sicher in die Armut.
In dieser Lage war es lange bei vielen die Vorstellung, nach Jahren Plackerei und Lohnsklaverei bald eine „wohlverdiente Rente“ zu bekommen, die einen hoffen und durchhalten ließ. Es war das Licht am Ende des Tunnels. In den 1950er und 1960er Jahren konnten noch viele Beschäftigte von diesem relativen „Eldorado“ profitieren. Aber seit 20 Jahren sinken die Renten unaufhörlich. Mittlerweile sind sie auf ein miserables Niveau gefallen; viele Rentner sind gezwungen, noch irgendwelche kleine Jobs anzunehmen. Und jeder weiß, dass diese Reform diese dramatische Lage noch weiter zuspitzen wird. Wie viele Demonstranten rufen, ist die einzige Zukunft, die uns das Kapital bieten kann: „Métro, boulot, caveau“ („Zur Arbeit pendeln, schuften, verrecken“).
Die Weltwirtschaftskrise treibt heute die ganze Menschheit in eine Spirale der Verarmung. Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Sieben Monate Kämpfe … immer wieder Aktionstage, ganze Wirtschaftsbereiche haben wiederholt gestreikt, ganze Standorte wurden von entschlossenen und kämpferischen Beschäftigten lahmgelegt, die zudem noch mit der staatlichen Repression konfrontiert wurden. „Die Jugend steckt in einer Galeere, die Alten in der Misere“. Kein Zweifel, die Wut ist riesig und in der ganzen Arbeiterklasse zu spüren!
Und dennoch die Regierung zieht ihre Rentenreform nicht zurück. Selbst zu Millionen auf die Straße zu ziehen, reicht nicht. Jeder spürt, dass irgendetwas dieser Bewegung fehlt. Was fehlt ist, dass die Arbeiter die Bewegung in die eigenen Hände nehmen. Wenn wir nur wie Schafe den gewerkschaftlichen Anordnung folgen, werden wir wie 2003 und 2007 eine Niederlage einstecken. Das Misstrauen gegenüber den Gewerkschaften wird unter den Arbeitern immer größer. Aber bislang hat nur eine Minderheit gewagt, diesen Schritt zu vollziehen, hat es gewagt, sich selbst in unabhängigen Vollversammlungen zu organisieren, die nicht von den Gewerkschaften kontrolliert werden. So weit wir wissen, gibt es heute ein gutes Dutzend branchenübergreifende Vollversammlungen dieser Art in Frankreich. Zum Beispiel kommen regelmäßig Eisenbahner, Lehrer, Arbeitslose und prekär Beschäftigte in der Bahnhofshalle des Pariser Ostbahnhofs zusammen. Straßenversammlungen werden regelmäßig in Toulouse vor den Arbeitsbörsen abgehalten und am Ende von Demonstrationen. Aber sie werden bislang nur von Minderheiten getragen.
Die Arbeiterklasse muss ihr Selbstvertrauen in ihre Fähigkeit zu kämpfen und sich kollektiv als Klasse zu organisieren, entwickeln. Wie? Wie können die Arbeiter ihre Kämpfe in die eigene Hand nehmen? Wir versuchen darauf in den nachfolgenden Artikeln einzugehen, weil diese Frage wesentlich und ausschlaggebend ist für den weiteren Verlauf der Kämpfe. IKS 22.10.2010
Raffinerien blockieren – ein zweischneidiges Schwert
20% der Tankstellen ohne Benzin. Endlos lange Schlagen. Überall Schlagzeilen in den Medien wegen der wirtschaftlichen Lähmung des Landes. Kämpferische und entschlossene Arbeiter. Und ein Präsident der Republik, der mit der Faust auf den Tisch schlägt, die „Diebe“ mit den schlimmsten Repressalien bedroht. Diese Szenen sind überall in den Medien zu sehen und werden weltweit verbreitet.
Die Beschäftigten, die vor den Raffinerien ausharren, tun dies im Namen der Arbeitersolidarität. Wenn sie den Mut haben, sich der wütenden Polizeirepression und den Strafen ihrer Arbeitgeber auszusetzen (z.B. Grandpuits, in der Pariser Region, der gedroht hat, den Standort dicht zu machen und alle zu entlassen), tun sie dies, weil sie sich dessen bewusst sind, dass sie für eine gerechte Sache kämpfen, die weit über ihr sie hinausgeht: Die Rentenreform, die uns alle betrifft, und die miserablen Renten, die sich daraus ergeben. Sie kämpfen für die Interessen der gesamten Klasse.
Die Lähmung des Verkehrs, welche durch die Blockade entstanden ist, offenbart auch, dass die Arbeiterklasse die Kraft ist, von der alle Räder in dieser Welt abhängen. Die Arbeiter produzieren alle Reichtümer. Die Kapitalisten sind letzten Endes nur Parasiten, die auf unsere Kosten leben und sich die Erzeugnisse unserer Arbeit aneignen. Es reicht aus, dass ein strategischer Bereich wie die Raffinerien nicht mehr normal funktioniert, und schon gerät die ganze Wirtschaft aus den Fugen.
Aber diese Waffe ist ein zweischneidiges Schwert.
Wer leidet am meisten unter den Blockaden?
Die Blockade der Raffinerien verfolgt das erklärte Ziel der Lähmung der Wirtschaft, um Druck auf das Kapital auszuüben. Es stimmt, dass den Kapitalisten nichts wichtiger ist als der Profit. Aber wer wird am meisten durch die Benzinknappheit getroffen? Wer ist wirtschaftlich am härtesten getroffen? Das Kapital oder die Arbeiter? Konkret sind die größten Betriebe des Landes (Carrefour, L’Oréal, BNP Paribas, Société Générale, Danone usw.) nicht in Gefahr. Sie sitzen relativ fest im Sattel und können auf die Unterstützung des Staates bauen (auch auf finanzielle Hilfe). Aber die Arbeiter leiden tag- täglich unter den Schwierigkeiten, Benzin zu tanken und zur Arbeit zu fahren. Sie leiden unter den Strafen der Arbeitgeber oder den Sanktionen durch ihre Vorgesetzten, weil man zu spät zur Arbeit kommt. Und die Beschäftigten, die seit Wochen immer wieder gestreikt haben, müssen sich jetzt den Gürtel enger schnallen wegen der dadurch entstandenen Lohnverluste.
„Die Wirtschaft lahmzulegen, um Druck auf das Kapital auszuüben“, ist übrigens ein Mythos, der aus dem 19. Jahrhundert stammt. Vor mehr als einem Jahrhundert konnten die Beschäftigten ihre Betriebe lahmlegen und somit ihre Arbeitgeber zum Nachgeben zwingen. Einerseits ermöglichten die Solidaritätskassen, den Arbeitern „durchzuhalten“, andererseits musste der bestreikte Unternehmer mit ansehen, wie seine Konkurrenten die Lage ausnutzten und ihm Kunden webschnappten. Es gab ernste Gefahren, bankrott zu gehen, und oft konnten die Arbeiter einen Sieg davontragen. Heute sind die Verhältnisse aber ganz anders. Es mag zwar noch Solidaritätskassen geben; so gibt es welche für die „Blockierer“ der Raffinerien. Aber die Arbeitgeber fallen sich in einem Arbeitskampf nicht mehr gegenseitig in den Rücken; im Gegenteil sie unterstützen sich gegenseitig. Sie verfügen gar über schwarze Kassen, um mit solch einer Lage umzugehen. Somit treten die Beschäftigten der Raffinerien nicht nur „ihrem“ Arbeitgeber gegenüber, sondern dem Kapital insgesamt, und vor allem der geballten Staatsmacht. Das Kräfteverhältnis auf rein ökonomischer Ebene besteht nicht mehr zugunsten der Streikenden. Aber das ist nicht die einzige Falle.
Die Gefahr der Isolierung und „unpopulär“ zu werden
Streiks, über deren jeweilige Fortsetzung immer von neuem entschieden wird, sind heute noch nicht sehr verbreitet. Nur in einigen Bereichen wird zurzeit ununterbrochen gekämpft: im Verkehrswesen (vor allem bei der SNCF), den Häfen und der Müllabfuhr in Marseille und den Raffinerien. Weil sie isoliert sind, laufen diese Beschäftigen Gefahr, sich zu erschöpfen, im Falle einer Niederlage entmutigt und gewaltsam bestraft zu werden. Deshalb sind ja auch so viele Arbeiter zu den blockierten Raffinerien gekommen, um vor Ort ihre Solidarität durch ihre Anwesenheit zu bekunden.
Aber es gibt ein noch größeres Risiko, nämlich dass diese Bewegung „unpopulär“ wird. Im Augenblick unterstützt noch der größte Teil der Arbeiterklasse und der Bevölkerung insgesamt diesen Kampf gegen die Rentenreform. Seit dem ersten Aktionstag am 23. März haben sich immer mehr Lohnabhängige der Bewegung angeschlossen (selbst kleine Händler, Freiberufler, Handwerker und Bauern). Ihre Stärke besteht gerade darin, dass immer mehr Bereiche sich dem Kampf anschließen. Den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben sich Schritt für Schritt die der Privatindustrie, ganze Arbeiterfamilien (insbesondere während der Samstagsdemos), prekär Beschäftigte, Arbeitslose, dann Gymnasiasten und Studenten angeschlossen… Der Kampf gegen die Rentenreform ist für alle eine Kampf gegen die Verschlechterung unserer Lebensbedingungen und gegen die Verarmung geworden.
Aber weil die Blockade des Verkehrswesens schlussendlich in erster Linie diejenigen trifft, die sich am Kampf beteiligen, besteht die Gefahr der Spaltung und dass diese Dynamik gebrochen und ein Hindernis wird für die notwendige massive Ausdehnung der Kämpfe. Bislang unterstützen viele Arbeiter diese Blockadeaktionen, aber im Laufe der Zeit kann sich das Blatt wenden.
Übrigens würde die vollständige Lähmung des Transportwesens ein Zusammenkommen bei den Demonstrationen unmöglich machen. Eine große Erleichterung für das Zusammenkommen wäre es vielmehr, wenn man kostenlos mit der Bahn reisen könnte, wäre das keine wirksamere Vorgehensweise zur Stärkung der Bewegung?
Ein politisches Kräfteverhältnis aufbauen
Soll das damit heißen, wir würden sagen, Blockaden und Besetzungen wären keine nützlichen Kampfmittel? Natürlich nicht! Es geht nur darum, dass diese Aktionen nicht als vorrangiges Ziel haben können, ökonomisch zu punkten, sondern sie müssen ein politisches Kräfteverhältnis aufzubauen.
Jegliches Handeln sollte bestimmt sein durch das Bemühen, den Kampf auszudehnen. Unsere Stärke ist unsere massive Einheit und unsere Solidarität im Kampf.
Zum Beispiel fingen die Streiks an den Unis während der Bewegung gegen den CPE im Frühjahr 2006 durch Blockaden an. Mit Hilfe der Blockaden gelang es den bewusstesten und kämpferischsten Studenten, eine große Zahl von Kommilitonen/Innen für die Vollversammlungen zu mobilisieren, wo ein beträchtlicher Teil der Studenten, die nicht die Bedeutung der Angriffe der Regierung oder die Notwendigkeit eines Abwehrkampfes dagegen verstanden hatte, durch die Debatte und den darin vorgebrachten Argumenten überzeugt wurde.
Die Blockade und die Besetzung eines Industriestandortes, einer schulischen Einrichtung oder einer Verwaltung kann auch dieses massive Zusammenkommen in Vollversammlungen, diese Debatten ermöglichen, wo die am meisten Zögernden überzeugt werden und sich dem Kampf anschließen. Einzig diese Dynamik der Ausdehnung jagt den Herrschenden wirklich Angst ein. Und schlussendlich, welche Rolle auch immer eine Fabrikbesetzung oder eine Blockade zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Streik spielen mag, auf den Straßen können die Beschäftigten, Rentner, Arbeitslosen, Arbeiterfamilien usw. am leichtesten massiv zusammenkommen. IKS, 22.10.2010
Die Gewerkschaftsbündnisse führen uns in die Niederlage
„Wir sind zu Millionen auf die Straße gezogen und haben an den vergangenen Aktionstagen gestreikt. Die Regierung gibt immer noch nicht nach. Nur eine Massenbewegung wird sie dazu zwingen. Diese Idee kommt immer mehr in Diskussionen um einen unbegrenzten, jeweils erneuerbaren Generalstreik und der Blockierung der Wirtschaft auf. (…) Die Gestalt, die diese Bewegung annehmen wird, hängt von uns ab. (…) Wir müssen über die Aktionsformen, Forderungen usw. selbst entscheiden. Niemand anders darf uns dies abnehmen.
Wenn wir die Chérèque (CFDT), Thibault (CGT) & Co. An unserer Stelle entscheiden lassen, stehen nur neue Niederlagen bevor. Chérèque ist für die Regelung, dass 42 Beitragsjahre gezahlt werden müssen [was dem Vorhaben der Regierung entspricht]. Thibault verlangt nicht die Rücknahme des Gesetzentwurfes. Wir haben auch nicht vergessen, dass er 2009 mit Sarkozy Champagner trank, während Tausende von uns entlassen wurden und wir alleine, isoliert voneinander kämpfen mussten. Wir haben auch kein Vertrauen mehr in die angeblich „Radikalen“. Die Radikalität Mailly (FO/Gewerkschaft) besteht darin, der PS-Vorsitzenden Aubry die Hand zu schütteln, während die PS selbst für die 42-Beitragsjahre stimmt. (…)
Wenn sie heute die Idee eines erneuerbaren Streiks propagieren, dann wollen sie vor allem vermeiden, dass sie von der Bewegung überrollt werden. Deren Kontrolle über unsere Kämpfe gilt für sie als Faustpfand, um zum Verhandlungstisch zugelassen zu werden. Warum? In einem Brief von sieben Gewerkschaftsorganisationen der CFTC an Sud-Solidaires, schrieben diese: „Um den Standpunkt der Gewerkschaftsorganisationen bekannt zu machen mit dem Ziel, eine Gesamtheit von gerechten und wirksamen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des bisherigen Rentensystems sicherzustellen“. Soll man wirklich glauben, dass es eine gemeinsame Basis mit den Leuten geben kann, die seit 1993 unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen systematisch untergraben haben?
Die einzige wirkliche Einheit, die diese Regierung und die herrschende Klasse zurückdrängen kann, besteht in dem Zusammenschluss der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und der Privatindustrie, von Beschäftigten und Arbeitslosen, Rentnern und Jugendlichen, legal und illegal Beschäftigten, Gewerkschaftsmitgliedern und Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern, an der Basis in den Betrieben in den gemeinsamen Vollversammlungen und indem wir den Kampf in die eigene Hand nehmen.“
Dies ist ein Auszug aus einem Flugblatt, das bei den Demonstrationen in Paris massenhaft verbreitet und unterzeichnet wurde von „Arbeitern und prekär Beschäftigten der branchenübergreifenden Vollversammlung des Ostbahnhofs“.
Zahlreiche andere Texte mit der gleichen Stoßrichtung und einem ähnlichen Ton sind von anderen branchenübergreifenden Zusammenschlüssen, Kampfkomitees, Diskussionsgruppen oder kleinen politischen Organisationen verfasst worden, die ihr wachsendes Misstrauen gegenüber dem Gewerkschaftsbündnis geäußert haben und dieses beschuldigen, uns absichtlich in die Niederlage zu führen. Alle ermuntern die Arbeiter, den Kampf in die eigenen Hände zu nehmen.
Aktuelles und Laufendes:
- Handelskrieg [53]
- Währungskrieg [123]
- Cholera Haiti [124]
- Klassenkampf England [125]
Studenten und Arbeiterdemonstrationen: Wir müssen den Kampf selbst kontrollieren!
- 2455 Aufrufe
Das nachfolgende Flugblatt wurde am Montag, den 15. November, auf einer Versammlung am Londoner Kings College verteilt, die dort vom linken Flügel des Gewerkschaftsapparates (Education Activists Network) abgehalten wurde. Wir würden uns über Kommentare, Kritiken und vor allem Angebote zum Weiterverteilen oder Verbesserungsvorschläge zur Aktualisierung auf dem Hintergrund des bevorstehenden Aktionstages nächste Woche freuen. Ein Genosse der Sektion der IKS in Toulouse, Frankreich, die sich aktiv an der Bewegung in Frankreich zur Bildung von Kampfkomitees und Vollversammlungen beteiligt hat, konnte auf diesem Treffen das Wort ergreifen, und trotz eines heftigen Angriffs gegen die Taktik der französischen Gewerkschaften wurde sein Redebeitrag applaudiert. Wir werden mehr Informationen über dieses Treffen zusammentragen und veröffentlichen.
Flugblatt der IKS
Lange erschien es, dass die Arbeiterklasse in Großbritannien durch die Brutalität der Angriffe, welche die neue Regierung eingefädelt hat, zum Schweigen verdammt sei: Behinderte werden zu Aufnahme einer Arbeit, Arbeitslose zum kostenlosen Arbeiten gezwungen, das Pensionsalter wird angehoben, drastische Einschnitte erfolgen im Bildungswesen, Hunderttausende Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen, Verdreifachung der Immatrikulationsgebühren und Streichung von Ausbildungsförderungsleistung für die 16-18 Jahre alten Schüler. Die Liste ist endlos lange. Die jüngsten Arbeiterkämpfe – British Airways, U-Bahn, Feuerwehrleute – sind alle total isoliert voneinander abgelaufen.
Aber wir sind eine internationale Klasse und die Krise dieses Systems ist auch international. In Griechenland, Spanien und jüngst in Frankreich haben die Arbeiter sich massiv gegen die neuen Sparprogramme zur Wehr gesetzt. In Frankreich bündelte die Reaktion gegen die „Rentenreform“ die wachsende Unzufriedenheit mit der Gesellschaft, insbesondere in der Jugend.
Die riesige Demonstration in London am 10. November brachte aber zum Vorschein, dass das gleiche Potenzial zum Widerstand heute im Vereinigten Königreich vorhanden ist. Die Teilnehmerzahl, die Beteiligung sowohl von Studenten als auch von Beschäftigten des Erziehungswesens, die Weigerung, eine zahme Demonstration von A nach B durchzuführen – all das bringt ein weitverbreitetes Gefühl zum Ausdruck, dass wir uns nicht der Logik der staatlichen Angriffe gegen unsere Lebensbedingungen unterwerfen sollen. Die zeitweise Besetzung der Tory-Zentrale war nicht das Machwerk irgendeiner Verschwörung einer Handvoll Anarchisten sondern das Ergebnis einer viel stärker verbreiteten Wut, und die Mehrheit der Studenten und die Demonstration unterstützenden Beschäftigten weigerten sich, diese Aktion zu verurteilen, wie es die Führung der NUS-Gewerkschaft und die Medien taten.
Viele meinten, diese Demonstration sei erst der Auftakt. Ein zweiter Aktions- und Demonstrationstag ist schon für den 24. November geplant. Bislang sind solche Aktionen von den „offiziellen“ Organisationen wie die NUS veranstaltet worden, die aber schon unter Beweis gestellt haben, dass sie Teil der bestehenden Ordnung sind. Aber das ist kein Grund, sich nicht massiv an den Demonstrationen zu beteiligen. Im Gegenteil, in Scharen zusammenzukommen, ist die beste Grundlage für die Schaffung neuer Organisationsformen, die den wirklichen Bedürfnissen des Kampfes Rechnung tragen können.
Was können wir vor solchen Aktionstagen oder Demonstrationen unternehmen? Wir müssen Vollversammlungen und Treffen in den Universitäten und Schulen einberufen, die allen Studenten, Schülern und Beschäftigten offenstehen, um für Unterstützung der Demonstrationen zu werben und deren Ziele zu diskutieren.
Die Initiative einiger Leute, “einen Block radikaler Studenten und Arbeiter“ auf den Demonstrationen zu bilden, muss unterstützt werden, aber wenn immer möglich, sollte man sich vorher treffen, um genau zu diskutieren, wie man seine Unabhängigkeit von den offiziellen Organisatoren zum Ausdruck bringt.
Wir müssen aus der jüngsten Erfahrung in Griechenland lernen, als Besetzungen (auch die des Gebäudes der Gewerkschaftszentrale) dazu benutzt wurden, einen Raum zu schaffen, wo Vollversammlungen abgehalten werden konnten. Und was zeigt uns die Erfahrung in Frankreich? Es gab eine bedeutsame Minderheit von Studenten und Arbeitern in vielen Städten, die Versammlungen auf der Straße abhielten, welche nicht nur am Ende der Demos stattfanden, sondern regelmäßig, solange die Bewegung sich weiter aufwärts entwickelte.
Wir müssen uns auch dessen bewusst sein, dass die Ordnungskräfte in der Zukunft nicht mit „Samthandschuhen“ wie am 10. November vorgehen werden. Sie werden bestens ausgerüstet sein und versuchen, uns in verfrühte Zusammenstöße mit ihnen zu locken, damit sie einen Vorwand haben, ihre ganze martialische Stärke zur Schau zu stellen – so wie das eine bekannte Taktik in Frankreich war. Die Organisierung unserer Selbstverteidigung und Solidarität gegen die Kräfte der Repression muss aus den gemeinsamen Diskussionen und Entscheidungen hervorgehen.
Der Kampf spielt sich nicht nur im Bildungswesen ab. Die ganze Arbeiterklasse wird angegriffen und der Widerstand muss bewusst ausgedehnt werden sowohl auf den öffentlichen Dienst wie auch die Privatwirtschaft. Den Kampf zu kontrollieren ist der einzige Weg ihn auszudehnen.
Internationale Kommunistische Strömung 15.11.10
Aktuelles und Laufendes:
- Arbeiterkampf England [126]
- Studentenproteste England [127]
Tekel-Türkei - Die Erfahrungen des Klassenkampfes weitergeben
- 2408 Aufrufe
Ende 2009 begann in der Türkei ein Arbeitskampf, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden ist - nicht zuletzt deshalb, weil eine Delegation der Streikenden sich im Juni und Juli 2010 auf eine Reise nach Westeuropa begeben hat, um hier über die Erfahrungen zu berichten und mit anderen Interessierten gemeinsam Lehren daraus zu ziehen.
Kurze Rückblende: Mehrere Tausend Arbeiter und Arbeiterinnen des ehemals staatlichen Tabak- und Spirituosenunternehmens TEKEL protestierten gegen dessen Privatisierung und die damit verbundenen Angriffe, namentlich gegen Lohnkürzungen und Entlassungen. Die betroffenen ArbeiterInnen versammelten sich zum Protest in der Hauptstadt Ankara, erhielten viel Sympathie und Solidarität von der dort lebenden Bevölkerung und suchten Unterstützung bei weiteren Teilen der Arbeiterklasse, insbesondere in anderen Betrieben im ganzen Land, in denen ebenfalls gekämpft wurde. Die TEKEL-ArbeiterInnen stießen bei ihrem Protest und den Versuchen, den Kampf auszuweiten, auf den Widerstand der Gewerkschaften, die sich als Teil des staatlichen Apparates entlarvten. Sie gründeten zusammen mit streikenden ArbeiterInnen anderer Staatsbetriebe (u.a. Hafen- und Bauarbeiter, Feuerwehrleute) in Istanbul eine Plattform der kämpfenden Arbeiter. Am 1. Mai besetzten sie bei der Maikundgebung von 350.000 Menschen auf dem Taksim-Platz in Istanbul die Bühne und verlasen eine Erklärung gegen die Komplizenschaft der Gewerkschaften mit dem Staat. Die Gewerkschaftsführer flüchteten von der Bühne und hetzten die Polizei auf die ArbeiterInnen. Trotz dieser Unterstützung, die der TEKEL-Kampf erfuhr, war er insofern erfolglos, als die Privatisierung und die Angriffe nicht rückgängig gemacht werden konnten.
Aber die Kämpfenden beschlossen, dass sie ihre Erfahrung den ArbeiterInnen nicht nur in der Türkei, sondern über die Landesgrenzen hinaus vermitteln sollten. Schon während des Kampfes waren Verbindungen zu politisierten Leuten in anderen Ländern geknüpft worden. Insbesondere in Deutschland, wo die Zahl emigrierter ArbeiterInnen aus der Türkei am größten ist, war der Kampf mit viel Anteilnahme verfolgt worden. So kam mit der Unterstützung von verschiedenen Gruppen aus dem anarchistischen und linkskommunistischen Umfeld eine Tournee durch Deutschland und die Schweiz zustande. Eine Delegation der TEKEL-Arbeiter besuchte insgesamt 10 Städte in Deutschland und der Schweiz, in denen vor unterschiedlichem Publikum Informations- und Diskussionsveranstaltungen durchgeführt wurden, über die wir hier berichten möchten.
Die Rundreise
Die Stationen der Rundreise zwischen Mitte Juni und Anfang Juli 2010 waren Hannover, Berlin, Braunschweig, Hamburg, Duisburg, Köln, Dortmund, Frankfurt, Nürnberg und Zürich. Vor allem die IKS hat die Reise nach Europa ermöglicht. Organisiert waren die meisten Treffen von der Freien ArbeiterInnen Union (FAU), in Berlin vom Sozialrevolutionären Diskussionszirkel und die Versammlung in Zürich von der Gruppe Karakök Autonome. Mit gemeinsamen Kräften riefen diese und auch noch weitere Gruppen zu den Veranstaltungen auf. Die Zahl der TeilnehmerInnen bewegte sich zwischen 10 und etwa 40, wobei berücksichtigt werden muss, dass gleichzeitig die Fussball-Weltmeisterschaft in Südafrika stattfand und die Spiele oft zu der Zeit übertragen wurden, wo die Veranstaltungen stattfanden. Das Publikum war überwiegend jung, aber keineswegs ausschließlich; gerade in den Städten, wo viele türkische und kurdische ArbeiterInnen teilnahmen, war auch die Generation der Eltern der 20- bis 30-jährigen anwesend.
Ein Arbeiter von TEKEL hielt ein Einführungsreferat, das auf die Geschichte des Kampfes zwischen Dezember 2009 und Mai 2010 einging. Lebendig vermittelte er die Erfahrung der Kämpfenden, wie sie vergeblich versuchten, die Gewerkschaften dazu zu bewegen, einen Generalstreik der staatlich Beschäftigten auszurufen, von der kurzfristigen Besetzung der Gewerkschaftszentrale Türk-Is in Ankara, wie die Polizei die Gewerkschaft schützte, vom Zeltlager in Ankara und der Solidarität der lokalen Bevölkerung. Er berichtete, wie im Kampf der TEKEL-ArbeiterInnen die Spaltungen zwischen KurdInnen und TürkInnen oder Männern und Frauen oder WählerInnen dieser oder jener Partei überwunden wurden. So hatte zwar die Polizei die Busse der 8'000 ArbeiterInnen vor den Toren Ankaras gestoppt und erklärt, dass sie nur diejenigen in die Stadt lassen würde, die nicht aus kurdischen TEKEL-Werken stammen würden; darauf stiegen aber alle Streikenden gemeinsam aus den Bussen und marschierten zu Fuß an der verdutzten Polizei vorbei den weiten Weg ins Stadtzentrum. Eine Aufspaltung in kurdische und türkische ArbeiterInnen kam für sie nicht in Frage.
Die Diskussionen
Die Diskussionen nach dem Referat drückten ein lebhaftes Interesse der Anwesenden am Kampf in der Türkei aus. Die Stimmung war brüderlich, solidarisch, mitfühlend - auch Tränen flossen. Die meisten der Teilnehmenden identifizierten sich mit den Zielen der TEKEL-ArbeiterInnen. Diejenigen, die noch nicht viel über den Kampf wussten, stellten konkrete Fragen, die erkennen ließen, dass man auch hier in Deutschland oder der Schweiz sich mit Kämpfen beschäftigt.
Gerade die Einheit der Arbeiter und Arbeiterinnen über die verschiedenen sichtbaren oder unsichtbaren Grenzen hinaus wurde in fast allen Diskussionen als wichtiges Anliegen unterstrichen. Der türkische Staat versuchte, die Kämpfenden zu spalten; diese aber ließen solche Pläne ins Leere laufen und suchten die größtmögliche Solidarität in anderen Teilen der Klasse. Nur so kann ein Gefühl der Stärke entstehen, aber auch ein reales Kräfteverhältnis zu unseren Gunsten geschaffen werden. Der Kampf in der Türkei hat zwar die gesteckten Ziele nicht erreicht, doch der eingeschlagene Weg war der richtige. Gerade in einem Land, in dem seit Jahrzehnten von allen möglichen Gruppierungen und dem Staat der türkische und kurdische (oder auch der armenische) Nationalismus geschürt werden, ist eine solche Entwicklung hin zur Einheit bemerkenswert.
Für viele stand die Gewerkschaftsfrage im Zentrum des Interesses. Auf der Ebene der unmittelbar gemachten Erfahrungen war man sich einig: Die Türk-Is verrichtete in diesem Kampf eine ähnliche Aufgabe, wie sie von den bestehenden Gewerkschaften auch in anderen Ländern sattsam bekannt ist. Sie versuchen die Arbeiter passiv zu halten, mobilisieren höchstens unter dem Druck der kämpfenden ArbeiterInnen und auch dies möglichst so, dass die Energie der Kämpfenden ohne Resultate verpufft. Gleichzeitig im Frühjahr fanden ja die Kämpfe in Griechenland statt, wo die großen Gewerkschaftsverbände eine ähnliche Rolle spielten und sich im Zweifelsfall immer als Verteidiger der herrschenden Ordnung und des Staates herausstellten. Auch in Deutschland und der Schweiz kennt man die Gewerkschaften in dieser Rolle. Das Publikum war beeindruckt davon, wie sich die TEKEL-ArbeiterInnen und diejenigen, die sich ihrem Kampf anschlossen, den Gewerkschaften entgegen stellten und sie offen bekämpften.
Aber hätte man nicht eine "eigene" Gewerkschaft haben sollen? Ist der Kampf bei TEKEL nicht daran gescheitert? Bei fast allen Diskussionen, die von der FAU organisiert worden waren, wurde die Frage aufgeworfen, ob man nicht neue, "revolutionäre" oder "anarchistische" Gewerkschaften gründen sollte. In einigen Städten wie z.B. in Duisburg wurde von Genoss/Innen aus dem Umkreis der FAU die Tatsache thematisiert, dass es sich bei TEKEL weniger um eine Streikbewegung als um einen Demonstrations- und Protestkampf handelte. Läge dieser Tatbestand nicht daran, dass es an einer proletarischen Gewerkschaft fehlte? Der TEKEL-Arbeiter, der das Einführungsreferat hielt, teilte diese Auffassung nicht. Er argumentierte anhand seiner Erfahrung, dass die Gewerkschaften aufgrund ihrer Rolle sich letztlich immer auf die Seite des Staates stellen werden, selbst wenn kämpfende Arbeiter oder Revolutionäre sie gründen und zunächst für die unmittelbaren Zwecke des Kampfes benützen können. Was haben wir für andere Möglichkeiten? Wie sollen wir uns im Kampf organisieren? - Die Antwort des TEKEL-Arbeiters war: in Kampf- oder Streikkomitees. Solange ein Kampf anhält, sollen sich die ArbeiterInnen selbständig mit jederzeit abwählbaren Delegierten organisieren. Die Vollversammlung wählt ein Kampfkomitee, das gegenüber der Vollversammlung rechenschaftspflichtig ist. Jede ständige Repräsentation umgekehrt, die unabhängig ist von der Mobilisierung der Kämpfenden, ist dazu verurteilt, zu einer "normalen", bürokratischen Gewerkschaft zu werden. Diese Diskussion wurde nicht überall in der gleichen Deutlichkeit und Tiefe geführt, aber beispielsweise in Braunschweig stellten sich die Alternativen auf diese Weise, und ein Großteil der Anwesenden schien recht überzeugt von der Auffassung der Genossen aus der Türkei, d.h. eine Mehrheit neigte dazu, die Möglichkeit der Gründung "revolutionärer" Gewerkschaften abzulehnen. Diese Diskussion über die Gewerkschaftsfrage, von der konkreten Erfahrung des TEKEL-Kampfes ausgehend, scheint uns umso wichtiger und aktueller zu sein, da wir wissen, dass innerhalb des anarcho-syndikalistischen Milieus in Deutschland derzeit teilweise kontrovers darüber diskutiert wird, ob man wie zuletzt von Seiten des Berliner Syndikats der FAU geschehen, um die Anerkennung des Staates als offizielle Gewerkschaft ringen darf (in Berlin geschah dies sogar vor dem bürgerlichen Gericht)? Nicht nur aus marxistisch linkskommunistischer Sicht, sondern auch noch vom Standpunkt des Anarcho-Syndikalismus erscheint dies als Widerspruch in sich.
Eine andere Frage, die an verschiedenen Orten aufgeworfen wurde, war diejenige der Fabrikbesetzung. Weshalb habt ihr nicht die Fabriken besetzt? Warum habt ihr nicht den Betrieb selber übernommen und ohne Chefs weiterproduziert? - Diese Fragen wurden auf dem Hintergrund von gewissen Kämpfen der letzten Jahre in Deutschland, Italien und der Schweiz gestellt, bei denen die Belegschaften vor Betriebsschließungen standen. Bei TEKEL verhielt es sich aber anders, da ja die Fabriken zum Teil nicht geschlossen, sondern privatisiert wurden. Die Produktion wurde in solchen Fällen also unter anderen Chefs weitergeführt. Trotzdem unterstrich der Delegierte der TEKEL-ArbeiterInnen, dass die Stärke des Kampfes gerade darin bestand, dass man sich nicht auf die einzelnen im Land verstreuten TEKEL-Betriebe zurückzog, sondern gemeinsam in Ankara zusammenkam. Nur so mit Tausenden von versammelten ArbeiterInnen konnte das Gefühl der Stärke entstehen, das für diesen Kampf (auch wenn er nicht mit einem materiellen Sieg endete) charakteristisch war.
Was bleibt?
Stehen wir nach dieser Veranstaltungsreihe am gleichen Ort wie vorher? - Wir meinen, in verschiedener Hinsicht Veränderungen festzustellen, die wir hier - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - benennen möchten.
Zunächst einmal verdient die Tatsache erwähnt zu werden, dass für die Rundreise verschiedene Gruppen zum ersten Mal öffentlich zusammengearbeitet haben, insbesondere die anarchosyndikalistische FAU und die linkskommunistische IKS. In unserer Tradition ist die Zusammenarbeit mit internationalistischen Anarchisten zwar schon lange verwurzelt , aber sie ist hier bei einer Gelegenheit neu konkretisiert worden, die für uns nicht zufällig ist. Die hier gemeinsam geleistete Arbeit ist ein Zeichen dafür, dass das Bedürfnis nach Einheit auf proletarischer Grundlage erwacht, ein Bedürfnis in der Arbeiterklasse nach Überwindung eines gewissen Gruppenegoismus. Wir haben uns zwar schon vorher gegenseitig zur Kenntnis genommen und auch bei gewissen Gelegenheiten zusammen diskutiert. Aber eine Zusammenarbeit, wie sie hier im Frühsommer aus konkretem Anlass entstand, ist etwas Neues.
Die Suche nach Einheit in der Arbeiterklasse, nach Überwindung der Spaltungen lag ja von Anfang an der Initiative für die TEKEL-Rundreise zugrunde. Diese Reise hatte den Zweck, die Erfahrungen und Lehren eines Kampfes weit über die lokalen oder nationalen Verhältnisse hinauszutragen. Dabei stand die internationale Dimension im Zentrum. Es ging nicht darum, eine türkische Besonderheit als etwas Exotisches in die Welt hinauszutragen, sondern darum nach Gemeinsamkeiten im internationalen Maßstab zu suchen und darüber zu diskutieren. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Erfahrungen der TEKEL-ArbeiterInnen mit den Gewerkschaften und ihre Reaktionen darauf nicht etwas Isoliertes gewesen sind, sondern eine Tendenz angekündigt haben, die seither immer wieder zum Ausdruck kommt. Während den Kämpfen im Frühjahr in Griechenland stießen die ArbeiterInnen ebenfalls auf die Gewerkschaften und begannen, sich gegen sie zur Wehr zu setzen. In Frankreich bei den Mobilisierungen gegen die Rentenreform schlossen sich in verschiedenen Städten vor allem Junge zusammen, die zu Vollversammlungen nach den Demos aufriefen, wo gemeinsam darüber diskutiert wurde: Wie können wir unabhängig von den Gewerkschaften kämpfen? Wie können wir die Grenzen in der Arbeiterklasse zwischen den verschiedenen Berufssparten, zwischen Pensionierten und noch Erwerbstätigen, zwischen Arbeitslosen und denjenigen, die noch eine Stelle haben, zwischen fest und prekär Angestellten etc. überwinden? Wofür kämpfen wir? Wie kommen wir dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft näher?
In Italien gab es im Juni und Oktober dieses Jahres zwei Versammlungen von kämpferischen ArbeiterInnen aus ganz Italien in Mailand, so genannte Autoconvocazioni. Daran nahmen gut 100 Leute teil und diskutierten ganz ähnliche Fragen: Wie können die Spaltungen innerhalb der Arbeiterklasse überwunden werden? Wie gegen die Sabotage der Gewerkschaften kämpfen? Wie dieses krisengeschüttelte kapitalistische System überwinden?
Türkei, Griechenland, Frankreich, Italien - vier Beispiele, die zeigen, dass die Arbeiterklasse in Europa seit dem Frühjahr 2010 beginnt, die Schockstarre nach der Finanzkrise von 2008 zu überwinden. Die Klasse insgesamt traut sich noch nicht, den Kampf selber in die Hand zu nehmen, aber Minderheiten in der Klasse stellen sich die genannten Fragen und versuchen voranzugehen. Dass solche Diskussionen gleichzeitig an verschiedenen Orten geführt werden, zeigt, dass es sich um ein grenzüberschreitendes Bedürfnis handelt. Die TEKEL-Rundreise war eine Antwort auf dieses Bedürfnis. Die TEKEL-Delegation hatte das Ziel, die internationale Dimension unserer erst lokalen Kämpfe und Diskussionen aufzuzeigen. Die Solidarität ist das Gefühl, das die Einheit der Arbeiterklasse ausdrückt. Verschiedentlich ist an den Veranstaltungen gefragt worden: "Wie kann der Kampf aus dem Ausland unterstützt werden?" Der TEKEL-Arbeite antwortete: "Indem ihr selber den Kampf aufnehmt".
Die politisierten Minderheiten der ArbeiterInnen beginnen zu spüren, dass der Kampf weltweit ist und als solcher bewusst geführt werden muss. Die Berichte über die Solidarität gegenüber dem TEKEL-Kampf waren eine Inspiration für die Teilnehmenden an den Veranstaltungen, und wir werden die Botschaft auf die eine oder andere Art weitertragen. Die politisierten und kämpferischen Minderheiten in der Klasse sind Katalysatoren für die zukünftigen Kämpfe. Der Kampf bei TEKEL war nicht umsonst, auch wenn die Entlassungen nicht aufgehalten werden konnten.
Aktuelles und Laufendes:
- Klassenkampf Türkei [128]
- Tekel-Kampf [129]
„Bürgerproteste“ in Deutschland - Kampf dem Kapitalismus 21
- 2809 Aufrufe
In Deutschland geht derzeit ein Spuk herum, der in der politischen Landschaft einigen Wirbel ausgelöst hat – die so genannten Bürgerproteste. Überall gehen Menschen auf die Straße, um gegen den Neubau eines Bahnhofs oder gegen die Flugrouten des neuen Flughafens zu demonstrieren, sammeln Unterschriften und bilden „Bürgerinitiativen“, um Schulreformen oder die Privatisierung kommunaler Einrichtungen zu verhindern, oder laufen Sturm gegen die Installierung von Mobilfunkmasten und Windrädern. Die Protagonisten dieser Proteste kommen, wie die bürgerlichen Medien verblüfft konstatieren, „aus der Mitte der Gesellschaft“. Es handelt sich hier neben vorwiegend gebildeteren Teilen der Arbeiterklasse um überraschend viele Angehörige des Mittelstandes – kurzum: „unbescholtene Bürger“, die Demonstrationen bisher nur aus dem Fernsehen kannten, und keine „Chaoten“. Um so aufgeschreckter wirkt die politische Klasse. Sie wittert großes Ungemach für die „Modernisierung“ Deutschlands, sollten sich die „Verweigerer“ in der Bevölkerung durchsetzen. Was sie aber vor allem entrüstet, ist, dass diese Proteste sich einen Teufel um das Prinzip des politischen Mandats scheren, dem Blankoscheck der parlamentarischen Demokratie, den die Wähler mit ihrem Kreuz in der Wahlkabine gewähren und mit dem die politische Klasse bisher nach Belieben schalten und walten konnte.
Doch was verbirgt sich wirklich hinter den „Bürgerprotesten“? Handeln die Protestierenden schlicht nach dem Sankt-Florian-Prinzip: ‚Zünde das Haus meines Nachbarn an, aber verschone meins‘? Oder ist diese Protestform im Gegenteil gar die endlich gefundene neue Form des „zivilen Ungehorsams“, die im Begriff ist, den „alten“ Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital abzulösen?
„Stuttgart 21“: Die Vernachlässigung des sozialen Aspektes
Der Kampf gegen den Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofes steht exemplarisch für einen tiefgreifenden Wandel im Verhältnis der Regierten zu ihren politischen Repräsentanten, der in den letzten Jahren stattgefunden hat. Die Wucht der Weltwirtschaftskrise, deren Höhepunkt keine zwei Jahre zurückliegt, und die Dramatik der ökologischen Katastrophe, die sich schon heute in Klimakatastrophen äußert, haben auch in den großen bisher als unpolitisch geltenden Bevölkerungskreisen erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Herrschenden geweckt, mit den großen und kleinen Krisen dieser Welt fertig zu werden. Immer mehr Menschen – darunter viele, die bisher ihre Stimme den bürgerlichen politischen Parteien anvertraut hatten – dämmert, dass es so, mit den herkömmlichen Mitteln der parlamentarischen Demokratie, nicht mehr weiter geht. Die politische Klasse ist im Begriff, da zu landen, wo sich die Banker und Broker schon seit einiger Zeit befinden – auf dem Tiefpunkt ihres Ansehens in der Bevölkerung.
In diesem Rahmen muss man auch die Mobilisierung der Stuttgarter Bevölkerung gegen den Neubau ihres Hauptbahnhofs betrachten. Die Proteste gegen Stuttgart 21 waren, nachdem sie vor drei Jahren mit nur gering frequentierten „Montagsdemonstrationen“ begonnen hatten, in diesem Sommer zu einer imposanten Bewegung geworden. Auf ihrem Höhepunkt im September und Oktober zogen mehrmals wöchentlich Zehntausende Demonstranten durch Stuttgart, darunter auffällig viele alte Menschen, aber auch ganze Schulklassen, Arbeiter, Angestellte, Hausfrauen, Architekten, Ärzte, Anwälte, Kaufleute und andere Freiberufler. Die meisten dieser Menschen, die so gar nicht dem Bild von „Berufsdemonstranten“ entsprachen, trieb es weniger aus eigennützigen und schon gar nicht aus ideologischen Gründen auf die Straße. Sie einte vielmehr die Empörung über die Informationspolitik des Bahn-Vorstandes und der Landesregierung, aber vor allem über die Megalomanie einer herrschenden Klasse, die einem technisch hochriskanten Projekt bedenkenlos milliardenschwere Nachschläge gewährt (so sind die ursprünglich veranschlagten Kosten von 2,6 Milliarden Euro auf mittlerweile 4,1 Mrd. gestiegen, und Experten schätzen den tatsächlichen Bedarf auf über 10 Mrd. Euro), aber im sozialen und im Bildungsbereich die Ausgaben drastisch kürzt.
In der Gegenüberstellung der Milliardenausgaben für Stuttgart 21 einerseits und den Sparmaßnahmen im sozialen Bereich andererseits steckte durchaus mehr Potenzial, als es den Anschein hatte. Denn in der Tat hätte eine Verknüpfung von Stuttgart 21 mit der sozialen Frage die sowohl örtlich als inhaltlich stark limitierte Bewegung zu einer breiteren Perspektive verholfen. Die ganze Brisanz dieser Bewegung lässt sich erahnen, wenn man sich vor Augen hält, dass sie in einer Region – dem Großraum Stuttgart – stattfand, die mit ihrer gewaltigen Automobilindustrie und der ihr angeschlossenen Zulieferindustrie sowie eine der Industriehochburgen Deutschlands ist (außerdem bildet es eines der Gravitationszentren des deutschen Maschinenbaus), mit Zehntausenden von größtenteils hoch qualifizierten ArbeiterInnen. Und zunächst trug die baden-württembergische Landesregierung, mit dem Haudrauf Mappus an ihrer Spitze, ihr Scherflein dazu bei, um die Bewegung weiter zu radikalisieren. Am 30. September, an jenem Tag, als die Polizei mit brutaler Gewalt den Schlossplatz vor dem Hauptbahnhof räumte und dabei auch erstmals in der Geschichte Stuttgarts Wasserwerfer einsetzte, drohten mehr als nur ein paar alte Bäume gefällt zu werden; auf dem Spiel stand nichts geringeres als ein Teil der Legitimation der politischen Klasse. Die Tür zu einer weiteren, möglicherweise unkontrollierbaren Eskalation des Konflikts stand an jenem Tag ein Stück weit offen.
Dies war der Moment, wo Berlin die Reißleine zog; Mappus‘ Konfrontationskurs wurde gestoppt. Zwar zeigen die herrschenden Kreise in Stuttgart und Berlin sich im Augenblick (noch?) nicht bereit, auch nur einen Millimeter von ihren Plänen abzurücken, doch gelobten sie dafür eine bessere „Kommunikation“ und Informationspolitik: „Jahr für Jahr muss man die Leute mitnehmen und erklären, warum das Projekt notwendig ist. Es ist offensichtlich nicht hundertprozentig gelungen, sonst hätten wir das Problem nicht“, meinte nun auch ein offenbar über Nacht „geläuterter“ Mappus. Flugs wurde ein „Runder Tisch“ eingerichtet, an dem Gegner und Befürworter von Stuttgart 21 platziert wurden, und so erlebte die sog. öffentliche Schlichtung unter der Leitung des alten Fahrensmannes der deutschen Bourgeoisie, Heiner Geißler, ihre Erstaufführung.
Nichts konnte die Protestbewegung effektiver abwürgen als diese öffentliche Huldigung der „direkten Demokratie“. Von nun an ging die Zahl der Demonstrationen und Demonstranten rapide zurück. Das öffentliche Interesse fokussierte sich fast ausschließlich auf die im Internet und Fernsehen live übertragenen „Schlichtungsgespräche“, deren stundenlanges, dröges Gefeilsche um Fahrpläne, technische Details u.ä. wie ein Narkotikum auf die Stuttgarter Protestbewegung wirkten. Und wenn da und dort dennoch Flammen des Protestes emporzüngelten (wie die vorübergehende Besetzung des Südflügels des Hauptbahnhofs von Stuttgart-21-Gegnern), wurden sie von Kretschmer und Konsorten, den Repräsentanten der Gegner von Stuttgart 21 am „Runden Tisch“, umgehend ausgetreten: „Denn es herrscht ja Friedenspflicht, und diese Aktion könnte die Gespräche beeinträchtigen“ (Kretschmer zur dpa).
„Bürgerproteste“ und Klassenkampf
Mit den „Bürgerprotesten“, die mit dem Kampf gegen Stuttgart 21 und den Demonstrationen und Blockaden gegen den diesjährigen Castor-Transport nach Gorleben ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatten, erleben die Klassen übergreifenden Protestbewegungen, die zuletzt in den 70er und 80er Jahren in Deutschland von sich reden gemacht hatten, eine Renaissance. So verdanken die „Bürgerproteste“ ihren Namen der Tatsache, dass die Akteure nicht in ihrer Eigenschaft als Angehöriger einer Klasse auftreten, sondern sozusagen als „Bürger“. Ob in Hamburg, wo unter der ideologischen Führung des Bürgertums per Volksentscheid eine Schulreform der schwarz-grünen Koalition abgeschmettert wurde, oder in Stuttgart, wo gar eine Initiative „Unternehmer gegen Stuttgart 21“ gegründet wurde, oder in Gorleben – die Renitenz von Teilen der Bevölkerung gegen „die da oben“ ist unübersehbar.
Solche Klassen übergreifenden Bewegungen gilt es differenziert zu betrachten. Solche Bewegungen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass die Ausdifferenzierung der Interessen des Proletariats von denen anderer, nicht ausbeutender Schichten der Bevölkerung bzw. des Kleinbürgertums nicht stattfindet. Findet diese Differenzierung statt, so gelingt es dem Proletariat mittels seiner großen Massenkämpfe – wie in der jüngeren und älteren Geschichte stets geschehen-, große Teile des Mittelstandes mitzureißen, sie für seinen Kampf zu mobilisieren.
Jedoch zeichnen sich die jüngsten „Bürgerproteste“ dadurch aus, dass sie in einem Vakuum stattfinden, in einer Phase, in der die Arbeiterklasse zumindest in Deutschland abwesend zu sein scheint. Diejenigen kleinbürgerlichen Kräfte, die sich zu den Hauptprotagonisten solcher Bewegungen aufschwingen, werden von der Empörung angetrieben, dass „die da“ in Berlin Politik „über die Köpfe der Leute hinweg“ machen. Bei aller Kritik an den Parteien und der Regierung kommt von ihnen aber nicht der Hauch einer grundsätzlichen Kritik, geschweige denn einer Ablehnung des Parlamentarismus über die Lippen. Im Gegenteil, der Grundtenor der Forderungen, die diese „Bürgerproteste“ äußerten, ist das Verlangen nach „mehr Mitspracherecht“, nach „Mitgestaltung der Gesellschaft“, ist der Wunsch, dass „den Bürgern Gehör geschenkt“ wird – kurzum: mehr Demokratie in der bürgerlichen Demokratie. Aufgerieben von den beiden großen historischen Klassen, dem Proletariat und der Bourgeoisie, und bar jeder eigenständigen historischen Perspektive, verbleibt der mittelständische Diskurs treu im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft. In dem Verlangen nach „mehr Demokratie“ kommt (unbewusst) sein Wunsch nach Restaurierung jener Zeiten zum Ausdruck, als die Bourgeoisie noch fortschrittlich war und ihr kleiner Bruder, das Kleinbürgertum, noch eine tragende Rolle in den Parlamenten spielte.
Daher ist es nicht überraschend, dass Protestbewegungen wie die gegen Stuttgart 21 und gegen den Castor-Transport zum Tummelplatz der oppositionellen Parteien geworden sind. Insbesondere die Grünen haben von ihnen profitiert. Sie sind zum Hoffnungsträger des frustrierten Mittelstandes geworden, der trotz seines immer lauter werdenden Lamentierens nicht vom Glauben an die bürgerliche Demokratie abkehren will. Seine ganze Militanz, seine ganze ohnmächtige Wut verpufft in einem Akt der „Abstrafung“ der Regierenden an der Wahlurne. Seine Perspektive erschöpft sich darin, die eine Regierungsmannschaft gegen die andere auszutauschen. Seine Alternative lautet: Pest oder Cholera. Aber diejenigen unter den Teilnehmern an solchen inter-klassistischen Bewegungen, welche von der proletarischen Sorge und Zorn um den Zustand der heutigen Welt angetrieben werden, werden nicht dort die Perspektive finden, die sie suchen, sondern im Kampf der Arbeiterklasse, sobald diese die Bühne der Geschichte erkennbar betritt.
Nein, die „Bürgerproteste“, die derzeit für Furore sorgen, können den Klassenkampf zwischen den Ausgebeuteten und ihren Ausbeutern beileibe nicht ersetzen. Es sind nicht die „Bürgerproteste“, die den Klassenkampf obsolet machen; es ist vielmehr das Fehlen des Klassenkampfes, das diese Mobilisierung von Teilen des Mittelstandes erst ermöglicht hat. Wenn hierzulande Bürger- statt Arbeiterproteste die Szenerie beherrschen, dann liegt das u.a. daran, dass es den Herrschenden in Deutschland bisher gelungen ist, den Kern der Arbeiterklasse mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen ruhig zu halten, angefangen vom ausgiebigen Gebrauch der Kurzarbeit, die die befürchteten Massenentlassungen verhindert hat, bis hin zu Sonderzahlungen, mit denen Großunternehmen ihre Beschäftigten nun, da das Geschäft wieder boomt, bei Laune halten.
Ganz anders dagegen die jetzige Lage in Frankreich, wo die Arbeiterklasse wochenlang die Öffentlichkeit mit Streiks, Blockadeaktionen und Massendemonstrationen in Atem hielt (mehr dazu in dieser Ausgabe). Im Unterschied zu Deutschland richteten sich die Proteste in Frankreich nicht gegen den Neubau von Bahnhöfen, die Installierung von Windrädern bzw. Mobilfunkmasten o.ä., sondern gegen die massiven Angriffe der Sarkozy-Regierung gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der ArbeiterInnen. Anders ausgedrückt: in Frankreich ging es nicht um infrastrukturelle, sondern um existenzielle Fragen – sprich: um die soziale Frage.
Während die Forderungen, die in den „Bürgerprotesten“ erhoben werden, partikularistisch sind, lokal begrenzt bleiben und den Kurs der bürgerlichen Politik (durch das Einziehen zusätzlicher „demokratischer“ Ebenen) allenfalls verzögern, enthalten Kämpfe wie die Protest- und Streikbewegung gegen die Verlängerung der Lebensarbeitszeit in Frankreich gesellschaftliches Dynamit. „Weg mit der Rente mit 67!“: Es sind solche Forderungen, die den Katalysator für proletarische Massenbewegungen bilden; Forderungen, mit denen sich die gesamte Klasse identifizieren kann, weil sie sich auf proletarischem Terrain befinden. Und es sind exakt solcherlei Forderungen, die am Anfang eines Prozesses stehen könnten, an dessen Ende der Albtraum der Bourgeoisie schlechthin wahr werden könnte: dass die Arbeiterklasse sich nicht mehr nur gegen die Bedingungen der Ausbeutung zur Wehr setzt, sondern der Ausbeutung selbst den Kampf ansagt... 19.11.2010
Aktuelles und Laufendes:
- Bürgerproteste [130]
- Stuttgart 21 [131]
- Proteste gegen Castor-Transporte [132]
- Proteste Schulreferendum Hamburg [133]
Weltrevolution Nr.160
- 2695 Aufrufe
Anti-Autoritäre in Griechenland: Reflexionen über die Gewalt
- 2289 Aufrufe
Am 5. Mai wurde während der riesigen Demonstrationen in Athen gegen die Austeritätsmaßnahmen der griechischen Regierung die Marfin-Bank offenbar von Brandsätzen, die aus der Menge heraus geworfen worden waren, in Brand gesetzt. Drei Bankangestellte starben an Rauchvergiftung. Dieser Zwischenfall provozierte eine hektische Antwort der Regierung, die darauf erpicht war, sämtliche Demonstranten als extrem gewalttätige Rowdys zu brandmarken, und der Polizei, die eine Reihe von brutalen Razzien im von „Anarchisten“ dominierten Athener Bezirk Exarcheia durchführte. Die Toten wirkten sich auch eine Zeitlang betäubend auf die Entwicklung des Kampfes aus, da viele ArbeiterInnen sich nicht im Klaren waren, wie sie weiter verfahren sollen, oder gar die Notwendigkeit anerkannten, Austeritätsmaßnahmen zu akzeptieren, um „die Wirtschaft zu retten“ oder einen Rutsch ins Chaos zu vermeiden (zumindest laut jüngsten Meinungsumfragen, die behaupten, dass über 50 Prozent der Bevölkerung bereit seien, das drakonische EU/IWW-Paket zu akzeptieren, oder Lohnkürzungen dem nationalen Bankrott vorziehen).
Von Seiten der „Protestierenden“, von jener sehr beträchtlichen Zahl von Proletariern, die davon überzeugt sind, dass man sich den ökonomischen Angriffen widersetzen müsse, hat es vielfältige Reaktionen gegeben. Viele Stellungnahmen haben mit einiger Rechtfertigung dem Bankeigentümer, Vgenopoulos, die Schuld zugeschrieben, der Angestellte mit der Drohung des Arbeitsplatzverlustes dazu zwang, auf Arbeit zu bleiben, obwohl bekannt war, dass die Demonstrationsroute an der Bank vorbeiführte und Brandanschläge gegen Banken bei solchen Gelegenheiten allgemein üblich waren. Darüber hinaus waren die Eingänge zur Bank verschlossen, was es äußerst erschwerte, das Gebäude zu verlassen. (1) Andere (siehe beispielsweise die Stellungnahme von der „Anarchistischen Hocke“ auf dem „Occupied London Blog“ (2)) beschuldigten paramilitärische Banden, den Anschlag begangen zu haben.
Dies mag so sein oder auch nicht; doch eine Antwort, die an diesem Punkt verharrt, hilft uns nicht wirklich weiter, um zu verstehen, warum die Bourgeoisie in Griechenland solch einen extensiven Gebrauch von Agenten „unter falscher Fahne“ gemacht hat, um Provokationen und Gewalttätigkeiten zu begehen. Die Wahrheit ist, dass solche Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Kultur der Gewalt von Minderheiten in einem beträchtlichen Teil des „antiautoritären“ Milieus in Griechenland durchaus gedeihen. Eine Hingabe zur Gewalt als Selbstzweck kann leicht zu einem positiven Hindernis für die Entwicklung einer breiten Klassenbewegung und ihrer Bemühungen werden, den Kampf gegen die staatlichen Anschläge auf die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse zu organisieren und auszuweiten.
Die folgenden Stellungnahmen zeigen jedoch, dass die jüngste Tragödie einen ernsthaften Prozess der Selbstprüfung und des Nachdenkens innerhalb dieses Milieus andlungen Handlungenb
angeschoben hat. Die erste Stellungnahme ist ein Text von Genossen, die ebenfalls zum „Occupied London Blog“ beitragen, viele von ihnen griechischer Herkunft. Obgleich sie keinesfalls die Bourgeoisie von der Verantwortung für die Toten freispricht, versucht ihre Stellungnahme, zu den Wurzeln des Problems vorzudringen. „Es ist an der Zeit für uns, offen über die Gewalt zu sprechen und kritisch eine spezifische Gewaltkultur zu untersuchen, die sich in den letzten Jahren in Griechenland entwickelt hat. Unsere Bewegung war nicht stark geworden wegen den dynamischen Mitteln, die sie gelegentlich nutzt, sondern wegen ihrer politischen Artikulierung. Die Bewegung vom Dezember 2008 wurde nicht zu einem historischen Ereignis, weil Tausende von Leuten Steine und Molotow-Cocktails warfen, sondern hauptsächlich wegen ihrer politischen und sozialen Charakteristiken – und ihrer reichhaltigen Vermächtnisse auf dieser Ebene.“ (3)
Die zweite Stellungnahme ist aus einem längeren Text („Die Kinder von der Galerie“) von TPTG, einer libertär-kommunistischen Gruppe in Griechenland.(4) In der vorletzten Ausgabe unserer Zeitung veröffentlichten wir Teile eines Artikels, der von derselben Gruppe (auch wenn unter anderem Namen) (5) verfasst wurde, ein Text, der klar die Sabotagerolle enthüllt, die von den Gewerkschaften und der griechischen Kommunistischen Partei in der gegenwärtigen Welle von Streiks und Demonstrationen gespielt wird. Wie unsere französischen Genossen hervorgehoben haben, schienen einige Passagen in der vollständigen Ausgabe jenes Artikels nicht die Gefahr zu berücksichtigen, dass einige Gewaltakte, die im Verlauf breiter Kämpfe ausgeübt werden, ein kontraproduktives Resultat haben können. (6) Die unten veröffentlichte Passage zeigt im Gegenteil dieselbe kritische Herangehensweise wie das Statement von Occupied London, wenn beispielsweise geschrieben wird: „Was das anarchistisch/antiautoritäre Milieu selbst und seine vorherrschende rebellische Tendenz angeht, ist die Tradition einer fetischisierten, macho-haften Glorifizierung der Gewalt zu alt und zu durchgängig, als dass man ihr gleichgültig gegenüberstehen kann. Die Gewalt als ein Selbstzweck ist in all ihren Variationen (einschließlich des eigentlichen bewaffneten Kampfes) ständig und mittlerweile jahrelang propagiert worden, und besonders nach der Dezember-Rebellion ist ein gewisser Grad nihilistischen Zerfalls deutlich geworden.“
Wir können diesen Denkprozess nur ermutigen und hoffen, dass wir an den Debatten teilnehmen können, die von ihm ausgelöst werden. Sowohl das Statement von Occupied London als auch die vielen Artikel der TPTG argumentieren, dass die wahre Stärke der Bewegung in Griechenland und eigentlich jeder proletarischen Bewegung ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation, Ausweitung und „politischen Artikulierung“ ist; und wir fügen hinzu, dass dies die wahre Alternative nicht nur zur substitutionistischen Gewalt einer Minderheit, sondern auch zur Unterdrückung der Klassenbewegung durch die „offiziellen“ Kräfte ist, die ihre Führung beanspruchen – die Gewerkschaften, die KP und die Linksextremen. World Revolution, 16.5.2010
Stellungnahme von Occupied London
Was haben wir ernsthaft zu den Zwischenfällen vom Mittwoch zu sagen?
Der folgende Text fasst einige anfängliche Gedanken von einigen unter uns hier bei Occupied London über die tragischen Ereignisse am Mittwoch zusammen. Die englische und griechische Version folgt – bitte verbreitet den Text weiter.
Was haben wir ernsthaft zu den Zwischenfällen vom Mittwoch zu sagen?
Was bedeuten die Ereignisse vom Mittwoch (5.5.) ganz ehrlich für die anarchistisch-antiautoritäre Bewegung? Wie verhalten wir uns gegenüber dem Tod dieser drei Menschen – ungeachtet dessen, wer ihn verursacht hat? Wie verhalten wir uns als Menschen und als Leute im Kampf? Wir, die wir nicht akzeptieren, dass solche Dinge „isolierte Vorfälle“ (der Polizei- oder Staatsgewalt) sind, und die auf die tägliche Gewalt zeigen, die vom Staat und vom kapitalistischen System ausgeübt wird. Wir, die wir den Mut haben, die Dinge beim Namen zu nennen; wir, die jene, die Migranten auf Polizeirevieren foltern, oder jene entlarven, die in den glamourösen Amtsräumen und TV-Sendern mit unserem Leben spielen. Also, was haben wir nun zu sagen?
Wir könnten uns hinter der Stellungnahme verstecken, die von der Gewerkschaft der Bankangestellten (OTOE) herausgegeben wurde, oder hinter den Anschuldigungen der Arbeitgeber in der Bankenbranche; oder wir könnten uns an der Tatsache halten, dass die Dahingeschiedenen gezwungen wurden, in einem Gebäude ohne Brandschutz zu verbleiben – und dabei sogar eingeschlossen wurden. Wir könnten auch dabei bleiben, was für ein Abschaum Vgenopoulos, der Besitzer der Bank, ist; oder auch dabei, wie dieser tragische Vorfall dafür benutzt wird, eine unerhörte Repression auszulösen. Wer immer es wagte, am Mittwochabend durch Exarcheia zu gehen, hat bereits eine klare Vorstellung darüber. Doch darum geht es nicht.
Für uns geht es darum zu sehen, wie groß unser, unser aller Anteil an der Verantwortung ist. Wir sind alle gemeinsam verantwortlich. Ja, wir haben recht, wenn wir mit all unserer Kraft gegen die ungerechten Maßnahmen kämpfen, die uns aufgezwungen werden; wir haben recht, wenn wir mit all unserer Macht und Kreativität für eine bessere Welt kämpfen. Doch als politische Wesen sind wir alle gleich verantwortlich für jede einzelne politische Wahl, die wir treffen, für die Mittel, die wir uns angeeignet haben, und für unser Schweigen, jedes Mal wenn wir unsere Schwächen und unsere Fehler nicht einräumen. Wir, die wir nicht die Leute bescheißen, um Stimmen zu gewinnen, wir, die wir kein Interesse haben, jemand auszubeuten, haben die Fähigkeit, unter diesen tragischen Umständen ehrlich mit uns selbst und jenen um uns herum zu sein.
Was die griechische anarchistische Bewegung derzeit erlebt, ist die totale Lähmung. Weil es bedrückende Bedingungen für eine harte Selbstkritik sind, für eine Kritik, die weh tut. Abgesehen von der schrecklichen Tatsache, dass Leute gestorben sind, die auf „unserer Seite“ waren, auf der Seite der ArbeiterInnen – ArbeiterInnen unter äußerst schwierigen Bedingungen, die es ziemlich sicher vorgezogen hätten, an unserer Seite mit zu marschieren, wenn die Dinge sich verschlimmern auf ihrem Arbeitsplatz -, abgesehen davon sind wir hiermit auch mit Protestierenden konfrontiert, die das Leben von Menschen in Gefahr bringen. Selbst wenn (und dies steht außer Frage) es keine Absicht gab zu töten, so ist dies eine wichtige Frage, die einige Diskussionen auslösen kann – so manche Diskussion bezüglich der Ziele, die wir uns gesetzt haben, und der Mittel, die wir wählen.
Der Vorfall ereignete sich nicht bei Nacht, als eine Sabotageaktion. Er geschah während der größten Demonstration in der zeitgenössischen griechischen Geschichte. Und hier stellt sich eine Reihe schmerzender Fragen: Ganz allgemein, gibt es in einer Demonstration von 150-200 000 Menschen, einmalig in den letzten Jahren, wirklich ein Bedürfnis nach einer „Heraufstufung der Gewalt“? Wenn man sieht, wie Tausende rufen: „Brenne, Parlament, brenne!“ und auf die Bullen fluchen, hat da eine weitere niedergebrannte Bank der Bewegung wirklich mehr anzubieten?
Wenn die Bewegung sich anschickt, massenhaft zu werden – wie im Dezember 2008 -, was kann eine Aktion anbieten, wenn sie die Grenzen dessen überschreitet, was eine Gesellschaft (zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt) aushalten kann, oder wenn sie menschliches Leben in Gefahr bringt?
Wenn wir uns auf die Straße begeben, sind wir eins mit den Leuten um uns herum, auf ihrer Seite, mit ihnen – darum geht es, wenn wir unsere Hintern bewegen, um Texte und Plakate zu verfassen -, und unsere Vorbehalte sind ein einzelner Parameter unter vielen, die zusammenkommen. Es ist an der Zeit für uns, offen über die Gewalt zu sprechen und kritisch eine spezifische Gewaltkultur zu untersuchen, die sich in den letzten Jahren in Griechenland entwickelt hat. Unsere Bewegung war nicht stark geworden wegen den dynamischen Mitteln, die sie gelegentlich nutzt, sondern wegen ihrer politischen Artikulierung. Die Bewegung vom Dezember 2008 wurde nicht zu einem historischen Ereignis, weil Tausende von Leuten Steine und Molotow-Cocktails warfen, sondern hauptsächlich wegen ihrer politischen und sozialen Charakteristiken – und ihrer reichhaltigen Vermächtnisse auf dieser Ebene. Natürlich reagieren wir auf die Gewalt, die gegen uns ausgeübt wird, und dennoch sind wir umgekehrt dazu aufgefordert, über unsere politischen Alternativen wie auch über die Mittel zu reden, die wir uns angeeignet haben, wobei wir unsere – und ihre – Grenzen erkennen müssen.
Wenn wir über Freiheit sprechen, bedeutet es, dass wir in jedem einzelnen Moment daran zweifeln, was wir gestern noch für selbstverständlich hielten. Dass wir es wagen, den ganzen Weg zu gehen und ohne klischeehafte politische Formulierungen den Dingen ins Auge schauen, wie sie sind. Es ist klar, dass wir, weil wir Gewalt nicht als Selbstzweck betrachten, ihr nicht gestatten dürfen, ihren Schatten auf die politische Dimension unserer Aktionen zu werfen. Wir sind weder Mörder noch Heilige. Wir sind Teil einer sozialen Bewegung, mit unseren Schwächen und Fehlern. Statt uns nach einer solch enormen Demonstration stärker zu fühlen, fühlen wir uns heute wie betäubt, um es vorsichtig zu formulieren. Dies an sich spricht Bände. Wir müssen diese tragische Erfahrung in eine Gewissensprüfung umwandeln und uns einander inspirieren, da wir letztendlich alle auf der Grundlage unseres Bewusstseins handeln. Und die Pflege solch eines kollektiven Bewusstseins steht dabei auf dem Spiel.
Aktuelles und Laufendes:
Bundeswehr in Afghanistan - Die Logik des Krieges
- 2341 Aufrufe
Vor über sieben Monaten, am 4. September 2009, ließ ein Oberst der deutschen ISAF-Kräfte in Afghanistan entgegen aller Einsatzregeln und trotz wiederholter Einwände der amerikanischen Piloten zwei angeblich von den Taliban bei Kunduz entführte Tanklaster von amerikanischen Militärjets bombardieren, was zum Tod von über 140 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten, führte. Vor gut einem Monat, am 2. und 15. April 2010, wurden bei Angriffen der Taliban in der Provinz Baghlan insgesamt sieben deutsche Soldaten getötet, was die Gesamtzahl der in Afghanistan getöteten deutschen Soldaten auf 43 hochschnellen ließ. Kurz darauf erschossen Bundeswehrsoldaten versehentlich sechs afghanische Regierungssoldaten, als diese der Aufforderung, anzuhalten, nicht nachkamen. Diese Vorfälle stehen im Zeichen einer Akzentverschiebung in der Afghanistan-Politik des deutschen Imperialismus. Vorbei die Zeiten, als die deutsche Diplomatie einen regelrechten Eiertanz um das Unwort Krieg veranstaltete, wenn es darum ging, den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan zu erklären. Vorüber auch die Zeiten, als die deutsche Politik uns den Afghanistan-Einsatz noch vornehmlich als humanitären Einsatz und die deutschen ISAF-Kräfte als Wiederaufbauhelfer in Uniform verkaufen wollte. Jetzt wird Tacheles geredet: Schneidig erklärt der neue Verteidigungsminister Guttenberg nun, dass die deutschen Soldaten sich in Afghanistan in einem veritablen Krieg befinden.
Die Rückkehr des deutschen Militarismus
In gewisser Weise war dies ein Tabubruch. Seit Gründung der Bundesrepublik 1949 war die deutsche Bourgeoisie stets emsig darum bemüht gewesen, ihren fortbestehenden imperialistischen Heißhunger hinter einer Fassade des Pazifismus und Antimilitarismus zu verbergen. So gehörte zu ihrer Gründungsmythologie der schöne Vorsatz, dass von deutschem Boden kein Krieg mehr ausgehen dürfe. Alles Militärische verschwand aus der Öffentlichkeit, eine Glorifizierung und Verherrlichung der eigenen kriegerischen Vergangenheit, wie sie sonst überall noch heute selbstverständlich ist, wird bis heute von der deutschen Bourgeoisie tunlichst unterlassen. Das Primat der Zivilgesellschaft trieb dabei seltsame Blüten: Soldaten wurden nicht mehr Soldaten genannt, sondern waren fortan „Bürger in Uniform“. Militärische Rituale wie der Zapfenstreich und die öffentliche Vereidigung von Rekruten verschwanden für lange Zeit in der Mottenkiste.
Dieser formelle Antimilitarismus war sicherlich dem Umstand geschuldet, dass der deutsche Imperialismus als Verlierer aus dem II. Weltkrieg hervorgegangen war. Und das nicht nur militärisch; auch moralisch war der deutsche Imperialismus aufgrund der ungeheuren Verbrechen, die die Wehrmacht und SS im II. Weltkrieg begangen hatten, zutiefst diskreditiert. Doch in den 40 Jahren des Kalten Krieges zwischen Ost und West erwies sich diese teils aufgezwungene, teils freiwillige Zurückhaltung in Sachen Militarismus durchaus als vorteilhaft für die deutsche Bourgeoisie. Letztere verstand es meisterhaft, die Welt von ihrer Läuterung zu überzeugen und in die Rolle des „friedlichen Maklers“ zwischen Ost und West, Nord und Süd zu schlüpfen. Gar nicht zu reden von den ökonomischen Vorteilen, die sich daraus ergaben, dass die deutsche Wirtschaft weitaus weniger von unproduktiven Rüstungsausgaben belastet wurde als andere Volkswirtschaften.
Auch nach dem Zusammenbruch des Ostblocks blieb der deutsche Imperialismus zunächst seiner Linie treu, als es ihm gelang, sich von einer militärischen Beteiligung am sog. Golfkrieg Anfang der 90er Jahre frei zu kaufen. Und selbst als sich die Einsätze deutscher Soldaten im Rahmen von UN- oder NATO-Missionen im Verlaufe der folgenden zwei Jahrzehnte häuften, hielt die deutsche Politik unbeirrt an ihrer Friedensrhetorik fest. Entweder sie verklärte diese Militäreinsätze als „Friedensmissionen“, als „humanitäre Hilfe“, oder sie bemühte gar – wie im Kosovo-Krieg – ihre eigene dunkle Vergangenheit, indem sie den Slogan: „Nie wieder Krieg!“ in „Nie wieder Ausschwitz!“ umwandelte. Dabei kam ihr der Umstand entgegen, dass es bei diesen Einsätzen – mit Ausnahme des Kosovo-Kriegs – so gut wie nie zu militärischen Auseinandersetzungen kam. Und dies obwohl beispielsweise die Kette der Balkankriege anfangs maßgeblich durch Deutschland angezettelt wurde, indem es die Unabhängigkeitsbestrebungen Sloweniens und Kroatiens gegen den Willen der anderen Großmächte unterstützte.
So verhielt es sich bis in die jüngste Zeit auch im Fall Afghanistan. Der deutsche Imperialismus verfuhr hier nach dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach‘ mich nicht nass. Militäreinsatz ja, aber bitte ohne Krieg! Er verweigerte sich konsequent der wiederholt vorgetragenen Bitte der USA um massive Aufstockung der eigenen Truppen und ihre Entsendung in den umkämpften Süden Afghanistans. Stattdessen verfolgte er die Absicht, gegen den militärisch übermächtigen US-Imperialismus zu punkten, indem er die Prioritäten des ISAF-Einsatzes umzukehren versuchte. Gebetsmühlenartig wiederholten deutsche Politiker ihr Mantra: zivile Aufbauhilfe vor militärischer Niederschlagung der Taliban.
Nun scheint jedoch die Zeit des Versteckspielens vorbei. Der Mythos von einem pazifistischen, antimilitaristischen Deutschland ist in der afghanischen Einöde zerschellt. Nach Jahren der relativen Ruhe in Kunduz sehen sich die deutschen Soldaten nunmehr fast täglich Anschlägen der Taliban ausgesetzt. Und siehe da, unter dem humanitären Schleier der Bourgeoisie blitzt plötzlich das altbekannte Antlitz des deutschen Militarismus wieder hervor. Während das Massaker vom 4. September tagelang von der Bundesregierung vertuscht wurde und bis heute ungeahndet ist, kam die Reaktion des Bundesverteidigungsministers Guttenberg auf die tödlichen Anschläge auf Bundeswehrsoldaten im vergangenen April prompt. Da war die Rede von einem „hinterhältigen Anschlag“, von „feigen Mördern“ und von „Terroristen“, die es zu verfolgen gelte, von „Kameraden“, die „gefallen“ sind. Vielen Überlebenden der Weltkriegsgeneration dürfte dieser markige Jargon bekannt vorkommen, hatte sich doch die Wehrmacht gegenüber den Freischärlern in den von ihr besetzten Ländern einer ähnlichen Wortwahl bedient.
Afghanistan – ein deutsches Vietnam?
Immer größeren Kreisen der herrschenden Klasse dämmert, dass der Krieg in Afghanistan militärisch nicht zu gewinnen ist. Es gibt gar Stimmen, die über ein drohendes „deutsches Vietnam“ unken. Dennoch deutet vieles darauf hin, dass der deutsche Imperialismus nolens volens immer tiefer in den Krieg in Afghanistan verstrickt wird. Gefangen in der Logik des Krieges, antwortet er auf jeden erfolgreichen Anschlag der Taliban mit einer weiteren Aufrüstung und personellen Aufstockung seiner Truppen vor Ort. So forderte der Wehrbeauftragte der Bundeswehr nach den tödlichen Anschlägen gegen deutsche Soldaten Anfang und Mitte April den Einsatz von Leopard II-Panzern in Afghanistan – eine Forderung, die nicht etwa aus politischen Erwägungen, sondern aus militärischen Gründen abgelehnt wurde. Dafür kündigte Guttenberg den Einsatz von Panzer-Haubitzen mit großer Reichweite an und unternimmt damit einen weiteren Schritt bei der Ausweitung des militärischen Engagements.
Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Neben den geostrategischen Interessen, die auch der deutsche Imperialismus in dieser Region hat, gibt es noch einen anderen gewichtigen Grund, warum die deutsche Bourgeoisie ihr militärisches Engagement in Afghanistan vorläufig nicht beendet. Er ist in der Änderung der Strategie des US-Imperialismus seit dem Machtantritt Obamas zu finden, die der Niederlage des US-Unilaterialismus unter Bush jun. Rechnung trägt und eine Politik der verstärkten Einbindung der Alliierten forciert. Während die Bush-Administration sich zwar über die „feigen Deutschen“ in Afghanistan mokierte, sie ansonsten aber in Ruhe ließ, lässt Obama über die deutsche Rolle in Afghanistan offiziell nur Gutes verbreiten, um hinter den Kulissen umso resoluter eine Ausweitung der deutschen Beteiligung an den internationalen Truppen zu fordern. Nur so lässt sich die zusätzliche Entsendung von 500 Soldaten nach Afghanistan und die Ausweitung des deutschen Engagements nach Baghlan (eben jene Provinz, in der die jüngsten tödlichen Anschläge gegen deutsche Truppen stattfanden) erklären. Denn der Preis, den der deutsche Imperialismus im Falle seiner Verweigerung gegenüber den USA oder gar seines Rückzugs aus Afghanistan bezahlen müsste, wäre hoch: Deutschland würde sich in den Rang eines Zaungastes des imperialistischen Schauspiels katapultieren, verschmäht und geringgeschätzt von den USA und anderen Großmächten. Und dies just zu einem Zeitpunkt, wo dank des neuen Multilateralismus der Obama-Administration die eigenen Einflussmöglichkeiten potenziell gestiegen sind.
Der Afghanistan-Krieg als Katalysator des Klassenbewusstseins
Es gibt Kriege im niedergehenden Kapitalismus, die eine negative Auswirkung auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse haben, die es trüben und verwirren. Ein solcher Krieg war beispielsweise der II. Weltkrieg. Damals war es insbesondere den angelsächsischen Bourgeoisien gelungen, ihre Völker mittels der demokratischen und antifaschistischen Mystifikation für den Eintritt in den Krieg gegen die Achsenmächte zu erwärmen und zu mobilisieren, und dies obwohl die britische und US-amerikanische Arbeiterklasse nicht – wie ihre deutschen Klassenbrüder- und schwestern – traumatisiert war durch eine niedergeschlagene Revolution wie 1918-23 in Deutschland. Auch die sog. Befreiungskriege, die in den 60er und 70er Jahren insbesondere den afrikanischen Kontinent erschütterten, waren einer Bewusstseinsbildung in der Arbeiterklasse vor Ort in keiner Weise dienlich. Sie ertränkten sie vielmehr in einem Meer von Nationalismus und erstickten ihre aufkommenden Kämpfe.
Es gibt jedoch auch Kriege in derselben Epoche, die das Klassenbewusstsein stimulieren und den ArbeiterInnen die Augen über die inhumane, destruktive Natur des dekadenten Kapitalismus öffnen. Das Beispiel schlechthin für einen solchen Fall ist zweifellos der I. Weltkrieg, der von der revolutionären Welle des Proletariats beendet wurde, die damals halb Europa überflutet und in Russland sowie in Deutschland ihren Höhepunkt gefunden hatte. Es gibt Gründe anzunehmen, dass auch der Afghanistan-Krieg zu einem wichtigen Katalysator des Klassenbewusstseins werden kann, denn vielleicht, wenn natürlich auch nicht vergleichbar mit der Wirkung des I. Weltkriegs. In der Tat ist dieser Krieg in Deutschland – und nicht nur dort - ziemlich unpopulär. Gelang es anfangs noch, der Arbeiterklasse den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan als „Kampf gegen den Terrorismus“ zu verkaufen, sind heute laut offiziellen Umfragen zwei Drittel der Bevölkerung der Auffassung, dass – al-Qaida hin, Taliban her - deutsche Truppen nichts in Afghanistan zu suchen haben. Auch und gerade unter den deutschen Soldaten in Kunduz – zumeist junge Angehörige der Arbeiterklasse, die sich in Ermangelung von Jobs auf dem zivilen Arbeitsmarkt für einige Jahre bei der Bundeswehr „selbstverpflichtet“ haben – wachsen die Zweifel über ihren Einsatz; die Zahl der Selbstmorde in „Camp Warehouse“, dem Stationierungsort der deutschen Soldaten, wächst.
Vor allem aber der Umstand, dass der Afghanistan-Krieg just zu dem Zeitpunkt zu eskalieren scheint, wo die Arbeiterklasse von den Folgen der schlimmsten Weltwirtschaftskrise seit 1929 heimgesucht wird, könnte zu einer Beschleunigung des Denkprozesses in der Arbeiterklasse in Deutschland führen. Angesichts der Milliardenausgaben für das Afghanistan-Abenteuer wird es den Herrschenden schwerfallen, ihren bevorstehenden Generalangriff auf die Arbeiterklasse zu legitimieren. Und die Schar jener wird steigen, die sich angewidert von diesem Gesellschaftssystem abwenden, das nichts als Tod und Verderben, Krise und Krieg zu bieten hat. Jo 18.5.2010
Aktuelles und Laufendes:
- Bundeswehreinsatz Afghanistan [137]
- Kunduz [138]
- deutscher Militarismus [139]
Leute:
- Guttenberg Afghanistan [140]
Die Folgen der Wiedervereinigung für die Arbeiterklasse in Ost und West - Teil 3
- 4271 Aufrufe
Die ostdeutsche Arbeiterklasse erlebte in den Wendejahren eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach der Erleichterung über das unblutige Ende des stalinistischen Regimes, dem ekstatischen Freudentaumel bei der Einführung der D-Mark und der Euphorie über die Wiedervereinigung folgte im Laufe des Jahres 1990 jäh ein Katzenjammer, von dem sich die Arbeiterklasse in Ostdeutschland bis heute nicht richtig erholt hat. Die Unterschriften unter dem Einheitsvertrag waren noch nicht trocken, da wurden die ostdeutschen Lohnabhängigen schon mit einem für sie völlig neuen Phänomen konfrontiert – mit der Arbeitslosigkeit. Waren sie zu DDR-Zeiten per Verfassung noch vor Entlassungen geschützt gewesen (was sie allerdings nicht vor der versteckten Arbeitslosigkeit bewahrt hatte), mussten sie nun miterleben, wie sich ihre beruflichen Existenzen in Luft auflösten. „In Ostdeutschland war der Beschäftigungsabbau seit 1989 rasant. Waren im Umbruchjahr noch rund 9,7 Mio. Erwerbstätige zu verzeichnen, erreichte die Zahl der Erwerbstätigen 1997 mit 6,05 Mio. ihren absoluten Tiefpunkt, der den bisherigen Tiefststand von 1993 (knapp 6,6 Mio.) nochmals deutlich unterschritt (...) Nachdem die Arbeitslosenquote bis 1995 auf 14,9% in den ostdeutschen Bundesländern gesunken war, ist sie bis 1997 auf fast 19,5% angestiegen. Ihren bisherigen Höchstpunkt erreichte die Unterbeschäftigung in Ostdeutschland im Februar 1998 mit einer Arbeitslosenquote von 22,9%.“[1] Das ganze Ausmaß dieser Explosion der Arbeitslosigkeit enthüllt sich erst, wenn man berücksichtigt, dass ein großer Teil der Beschäftigten sein Dasein in sog. ABM-Maßnahmen fristete und nicht in die offizielle Statistik einfloss. Besonders hart getroffen wurde der Industriesektor: Vier von fünf Arbeitsplätzen gingen über den Jordan.
Neben dem wirtschaftlichen Verlust, der mit der Arbeitslosigkeit einherging, wog besonders der Umstand schwer, dass mit dem Verlust des Arbeitsplatzes auch der Lebensmittelpunkt, die Identität der ostdeutschen Arbeiterklasse verloren ging. Denn anders als westdeutsche und Westberliner ArbeiterInnen definierten (und definieren) sich die Angehörigen der ostdeutschen Arbeiterklasse noch schlicht und einfach als... Arbeiter.[2] Hier zählte noch das Kollektiv, anders als der Individualismus, wie er vorwiegend unter ihren westlichen Klassenbrüdern und -schwestern noch herrscht. Darüber hinaus – und in krassem Gegensatz zur tatsächlichen materiellen Lage – war das DDR-Regime stets darum bemüht gewesen, die ostdeutsche Arbeiterklasse propagandistisch zu überhöhen („führende Kraft beim Aufbau des Sozialismus“ u.ä.). All dies wurde nun, kaum dass die DDR ihr elendes Leben ausgehaucht hatte, in Abrede gestellt. Die westdeutschen Invasoren gaben sich keine große Mühe, ihre Geringschätzung gegenüber dem Tun und Schaffen der „Ossis“ zu verbergen; ganze Biographien wurden in Frage gestellt. Es war die Zeit, als das Wort vom „Besserwessi“ die Runde machte, also von jenen Westdeutschen, die sich bei ihrem Auftreten in den „neuen Bundesländern“ wie Kolonialherren gegenüber primitiven Eingeborenen aufführten.
Es versteht sich von selbst, dass angesichts dieser maßlosen Entwertung ihrer bisherigen Existenz die Einheitseuphorie der Ostdeutschen abrupt einer großen Verbitterung wich. Dass diese nicht in eine größere Protestbewegung mündete, hat sicherlich auch mit der Demoralisierung zu tun, die sich gleichzeitig in der ostdeutschen Bevölkerung breitmachte. Schließlich hatte sich ausgerechnet ihre größte Hoffnung, der Anschluss an die Verheißungen des „goldenen Westens“, als größte Bedrohung ihrer Existenz und Biographie entpuppt. Stattdessen suchten (und suchen) immer mehr Menschen in Ostdeutschland Zuflucht in der „Ostalgie“, der Verklärung der alten DDR, die allem Anschein nach mit zunehmender zeitlicher Distanz sogar noch wächst.[3]
Schlimmer noch: bei ihrer Suche nach einem Sündenbock für ihre entwürdigende Lage verirrten sich Teile der ostdeutschen Arbeiterklasse auf das Terrain der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus. Die neunziger Jahre waren gezeichnet von einer nicht enden wollenden Kette von gewalttätigen Übergriffen gegen Ausländer, besonders gegen Südeuropäer und Afrikaner, mit Toten und Schwerverletzten, von Brandanschlägen gegen Asylheime (Rostock-Lichtenhagen, um nur das spektakulärste Beispiel zu nennen) und Döner-Buden. Diese entsetzlichen Taten - begangen von jungen ostdeutschen Arbeitern, unter stillschweigender Zustimmung der Älteren - konnten geschehen, weil die Xenophobie schon lange zuvor zum Alltag der ostdeutschen Arbeiterklasse gehört hatte.[4] Diese fürchterliche Intoleranz gegenüber dem Fremden – die giftige Frucht des Stalinismus, der seit jeher ein Virtuose auf dem Gebiet des Völkerhasses war, aber auch das Ergebnis einer jahrzehntelangen Isolierung von der Welt und dem Weltmarkt – wurde darüber hinaus von westdeutschen Neonazis angestachelt, die schon kurz nach der Wende ihre Pflöcke in den Osten steckten und erfolgreich Kapital aus den ausländerfeindlichen Ressentiments schlugen. Auch der deutsche Staat trug sein Scherflein zur Pogromstimmung in den ostdeutschen Gemeinden bei, indem er ostdeutschen Dörfern Asylheime vor die Nase setzte, deren Bewohnerzahl deutlich die der Dörfler überstieg. Erst als auch EU-Europäer, Japaner und Amerikaner Opfer von rechtsradikal motivierten Übergriffen wurden und die internationale Reputation der Bundesrepublik sowie ihr Ruf als Wirtschaftsstandort Schaden zu nehmen drohte, trat der „Rechtsstaat“ energischer auf den Plan. Ohne jedoch für ein endgültiges Ende dieses Spukes zu sorgen.
Dass es den Neonazis gelang, sich in ostdeutschen Gemeinderäten, ja sogar Länderparlamenten vorübergehend zu etablieren, erklärt sich aber auch aus der demographischen Entwicklung in Ostdeutschland, die sich in einer enormen Ausdünnung der Bevölkerung äußerte. Allein in den ersten Jahren, von der Wende 1989 bis 1995, verließen fast 1,7 Millionen Ostdeutsche ihre Heimat, um ihr berufliches Glück in Westdeutschland oder gar im Ausland (Schweiz, Österreich) zu suchen. Seitdem hat der Strom der Auswanderer zwar abgenommen, dennoch ist die Bevölkerungsbilanz Ostdeutschlands auch heute noch negativ. Dabei fällt auf, dass es vor allem junge, gut qualifizierte Frauen sind, die ihrer ostdeutschen Heimat den Rücken kehren. Zurück bleiben, neben den Alten, viele frustrierte Männer, oft ungebildet und anfällig für die rechten Rattenfänger.
Doch die Bevölkerung Ostdeutschlands wird nicht nur durch die Abwanderung dezimiert, sondern auch durch den „Gebärstreik“ der ostdeutschen Frauen: So „betrug der ostdeutsche Geburtenrückgang von 1990 auf 1991 40%, von 1991 auf 1992 19% und von 1992 auf 1993 nochmals 8%, und er hat sich erst seit 1994 stabilisiert. Ab 1996 ist wieder eine leichte Zunahme zu verzeichnen; mit einer Geburtenrate von 6,5 pro 1.000 Einwohner im Jahre 1997 hat sich das ostdeutsche Geburtenniveau gegenüber dem Jahr 1989 beinahe halbiert und erreicht lediglich 60% des westdeutschen Niveaus, das in diesem Zeitraum praktisch stabil geblieben ist.“[5] Das Statistische Bundesamt hat im Rahmen der „11. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung nach Bundesländern“ prognostiziert, dass die Bevölkerung Ostdeutschlands, Ende der achtziger Jahre noch über 17 Millionen stark, bis zum Jahr 2050 auf 9,1 Millionen sinken werde. Was dies bedeutet, kann man sich in vielen Regionen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns bereits heute anschauen. Ganze Dörfer vergreisen und werden auf kurz oder lang ganz verlassen sein; in vielen Städten ist das öffentliche Leben erloschen, denn fast alles, was jung ist, hat das Weite gesucht. Und während in den alten Bundesländern Wohnungsmangel herrscht, wurden in vielen ostdeutschen Städten ganze Wohnsiedlungen wegen Leerstand abgerissen. So rückt die Vision eines helvetischen Naturparkexperten, große Teile der neuen Bundesländer wieder der Natur zu überlassen, immer näher...
Das Schicksal der ostdeutschen Arbeiterklasse in den letzten zwanzig Jahren ist in gewisser Weise einmalig. Anders als die ArbeiterInnen aus den anderen Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes erlebte sie den Übergang von der stalinistischen „Plan“wirtschaft zur westlichen „Markt“wirtschaft im Zeitraffer. Ihr Sturz ins soziale Nichts geschah rasend schnell, ihre Desillusionierung über den westlichen Kapitalismus war unermesslich. Doch auch ihre Klassenbrüder und -schwestern jenseits des einstigen Eisernen Vorhangs kamen nicht ungeschoren davon. Immerhin trugen sie über die Sozialversicherungskassen (s.o.) maßgeblich zur Finanzierung der Wiedervereinigung bei. Durch die steigenden Abgaben für die Arbeitslosen-, Renten- und Krankenversicherung kam es im Verlaufe der neunziger Jahre zu erheblichen Reallohneinbußen, was dazu führte, dass der westdeutsche Durchschnittslohn im internationalen Vergleich zurückfiel. Ferner litt die Lebensqualität in Westdeutschland noch in einem anderen Sinn unter der Wiedervereinigung: Während in Ostdeutschland im Rahmen des „Aufbaus Ost“ an vielen Orten eine moderne Infrastruktur entstand, verrotteten in den westdeutschen Kommunen die Straßen und Brücken, wurden Büchereien und Kindergärten geschlossen. Und um das Maß vollzumachen, wurde (und wird) den Lohnabhängigen (und nur ihnen!) der sog. „Solidaritätsbeitrag“ für Ostdeutschland abverlangt.[6] In Berlin, wo Ost und West direkt aufeinanderprallten, gab es noch ein weiteres Opfer der Wiedervereinigung: die Arbeitsimmigranten. Sie wurden im Verlaufe der neunziger Jahre aus der Produktion ausgemustert und durch hoch motivierte Ostberliner Arbeiter und Arbeiterinnen ersetzt. Die Folge: in Berlin konzentrieren sich die Problemgebiete nicht im Ostteil der Stadt, sondern in den Westberliner Bezirken mit hohem Immigrantenanteil (Kreuzberg, Neukölln, Wedding, Spandau).
Wir sehen also, dass die Arbeiterklasse in Ost- und Westdeutschland gemeinsam, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, an den Folgen der Wiedervereinigung litt. Doch gemeinsame Not schweißt nicht unbedingt zusammen. Dies lehrt uns jedenfalls die Erfahrung aus den ersten zwanzig Jahren der deutschen „Einheit“. Kaum war die erste Euphorie über den Fall der Mauer verflogen, machten sich die ersten Risse zwischen den beiden Teilen der Arbeiterklasse in Deutschland bemerkbar. Insbesondere unter den ArbeiterInnen Westdeutschlands und Westberlins machte sich schon früh Skepsis hinsichtlich der Folgen der Wiedervereinigung breit. In den grenznahen Regionen stöhnte man unter der Invasion der „Ossis“, die die Geschäfte leer kauften. Auch fühlten sich viele aufgeschlossene ArbeiterInnen, die die Arbeitsimmigranten stets als ein Teil ihrer Arbeitswelt wahrgenommen hatten, von der plumpen Ausländerfeindlichkeit mancher ihrer ostdeutschen KollegInnen abgestoßen. Noch schwerer wog der Vorwurf, die ostdeutschen ArbeiterInnen würden mit ihrer Übermotiviertheit die Standards untergraben, die sich die Arbeiterklasse Westdeutschlands mühsam erkämpft hatte.
Es versteht sich von selbst, dass diese Misshelligkeiten flugs von den bürgerlichen Boulevardmedien aufgegriffen wurden, um die Spaltung zu vertiefen und zu verinnerlichen. „Jammerossis gegen Besserwessis“ hieß es jahrelang in den Schlagzeilen der west- und ostdeutschen Revolverblätter. Den Vogel schossen allerdings die Gewerkschaften ab. Sie zementierten durch eine geteilte Tarifpolitik die Spaltung auf dem ökonomischen Gebiet. Bis heute müssen ArbeiterInnen in Ostdeutschland für weniger Geld länger arbeiten. Auch der traurige Höhepunkt in der Entfremdung zwischen der Arbeiterklasse in Ost- und Westdeutschland geht auf das Konto der gewerkschaftlichen Spalter – der Streik der ostdeutschen Metaller im Jahr 2003 für die 35-Stunden-Woche. Hier spielte die IG Metall ein doppeltes Spiel: Einerseits trieb sie die ostdeutschen Metallarbeiter in diesen Konflikt, wohl wissend, dass Wohl und Weh ihes Kampfes von der Zustimmung und Solidarität ihrer KollegInnen in Westdeutschland abhing. Andererseits verhinderte sie eben diese Solidarisierung durch ihre Betriebsratsbonzen in den Betrieben der westdeutschen Metallbranche. Es drohte eine direkte Konfrontation zwischen ost- und westdeutschen Arbeitern; denn der Streik in den ostdeutschen Zulieferbetrieben drohte die Produktion in den westdeutschen Automobilfabriken lahmzulegen. Zudem gab es hässliche Auseinandersetzungen zwischen den Streikenden und Streikbrechern, die aus Westdeutschland herangekarrt wurden. Unter dem Druck der Öffentlichkeit wurde der Streik ergebnislos beendet. Es sollte der erste und letzte nennenswerte Widerstand der ostdeutschen Arbeiterklasse bleiben.
Mittlerweile sind fast zwanzig Jahre seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 vergangen. Eine neue Generation ist ins Arbeitsleben getreten, die in den Wendejahren geboren wurde und nichts anderes kennt als den Kapitalismus westlicher Prägung. Sie ist frei von vielen Gebrechen, unter denen die noch in der DDR sozialisierten Generationen nach dem Fall der Mauer litten – das Gefühl, ein Underdog zu sein, die xenophoben Ressentiments, etc. Sie ist unbelastet von dem Dünkel, der das Denken und Verhalten nicht weniger in der Bonner Republik aufgewachsener ArbeiterInnen gegenüber den ostdeutschen Klassenbrüdern und -schwestern prägte. Und sie kann auf einen Schatz von Erfahrungen bauen, der einmalig in der Welt ist. Denn die deutsche Arbeiterklasse bündelt in sich die Erfahrungen aus den drei großen Ideologien des Kapitalismus im 20. Jahrhundert. Keine andere Arbeiterklasse kann von sich sagen, Stalinismus, Faschismus und Demokratie gleichermaßen am eigenen Leib erlebt zu haben.
[1] Handbuch zur Deutschen Einheit, S. 859.
[2] Ebenda, S. 530.
[3] Laut Meinungsumfragen sind heute mehr Ostdeutsche denn je für eine Wiederkehr der DDR.
[4] Es war beispielsweise übler Brauch gewesen, die wenigen ausländischen Arbeitskollegen, die in der DDR-Wirtschaft beschäftigt gewesen waren, mit solch diffamierenden Wörtern wie „Presspappe“ (gemeint waren die Angolaner und Mosambiquaner) oder „Fidschi“ (die Vietnamesen) zu titulieren.
[5] Handbuch zur Deutschen Einheit, S. 525.
[6] Übrigens verwendete die deutsche Bourgeoisie einen großen Teil der Erträge aus dem „Solidariträtsbeitrag“ dafür, sich aus einer aktiven militärischen Beteiligung am ersten Golfkrieg Anfang der neunziger Jahre freizukaufen.
Historische Ereignisse:
Direkte Demokratie - Noch eine Illusion, die uns ans System binden soll
- 2821 Aufrufe
In vielen Diskussionen oder Interventionen, sei es beim Presseverkauf auf der Strasse, auf den Demonstrationen oder unseren öffentlichen Veranstaltungen, aber auch anderswo, hört man Sorgen oder Befürchtungen über die Zukunft. Im selben Atemzug werden Politiker oder Parlamentarier für das herrschende Elend verantwortlich gemacht, beschuldigt, dass sie unfähig seien, sich für ein besseres Leben einzusetzen, dafür zu kämpfen, den Lebensstandard zu erhöhen. Da hat die Bourgeoisie mit ihrer „besten aller Regierungsformen“, der Demokratie, eine Reihe von Alternativen anzubieten. Das bekannteste Beispiel dafür ist aktuell der „Obamaismus“. Vor den Präsidentschaftswahlen in den USA wurden die Auftritte Obamas mediengerecht aufgezogen, wurde er selbst – nicht nur im eigenen Land – wie ein Popstar gefeiert. Viele Leute haben noch einmal Hoffnung auf eine Veränderung geschöpft – eine Veränderung im Rahmen dieses Systems.
In der Schweiz werden diese demokratischen Illusionen nicht nur durch Wahlen von Personen, sondern zusätzlich durch Referenden und entsprechende Abstimmungskämpfe um so genannte Sachvorlagen genährt.
Am diesjährigen 1. Mai in der Schweiz feierten die Redner der Gewerkschaften den „Sieg“ vom 7. März 2010, als das „Stimmvolk“ in einem Referendum der Linken die Senkung des Umwandlungssatzes bei der beruflichen Vorsorge (Rentenklau bei den Pensionskassen) ablehnte. Die „kommunistische“ PdA sagte am 7. März: „Der heutige Sieg ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die weiteren geplanten Abbaumassnahmen des Sozialstaats der bürgerlichen Parteien.“ Die Linken riefen gleich auf zum nächsten „fulminanten Abstimmungskampf“ beim Referendum gegen die Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, für das am 1. Mai eifrig Unterschriften gesammelt wurden - gerade auch von vielen jungen Unzufriedenen. Sie sammelten Unterschriften gegen diese Gesetzesänderung, die natürlich eine Verschlechterung für die Arbeitslosen vorsieht; andere sammelten Unterschriften für eine Initiative „Gemeinsam für gerechte Löhne“ oder für eine andere Initiative „Familiengerechte Stadt Zürich“; die Gruppe Schweiz ohne Armee mobilisiert potenzielle Unterschriftensammler für eine geplante Initiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“[1].
Sind diese direktdemokratischen Mittel der Volksinitiative und des Referendums nicht geeignete Mittel für all diejenigen, die gesellschaftlich etwas verändern wollen? Soll man nicht mit denjenigen Mitteln anfangen, die uns das System zur Verfügung stellt? Würden wir nicht auch in einer herrschaftsfreien Gesellschaft mit Mehrheitsentscheiden bestimmen, wie die Zukunft aussehen soll? Was ist denn da falsch an der direkten Demokratie?
Was ist ein Referendum?
Wir können hier nicht einen umfassenden Überblick über alle möglichen Arten von Referenden geben[2]. Da aber dieses Mittel (zusammen mit der Volksinitiative) in der Schweizer Politik ein so grosses Gewicht besitzt und unter den Menschen, die etwas ändern wollen, nach wie vor relevant ist und da Referenden zunehmend auch von anderen Ländern für gewisse Teilbereiche der Politik übernommen werden, möchten wir kurz darlegen, wie und zu welchen Zwecken Volksinitiativen und Referenden in der Schweiz eingeführt wurden. Mit einem Referendum kann eine vom Parlament bereits beschlossene Gesetzesänderung zur Volksabstimmung gebracht werden, sofern 50'000 Stimmberechtigte dies mit ihrer Unterschrift verlangen; eine Volksinitiative, die 100‘000 Unterschriften erfordert, kann eine Änderung in der Bundesverfassung (entspricht dem Grundgesetz in Deutschland), begehren. Diese beiden direktdemokratischen Mittel wurden in der Schweiz im 19. Jahrhundert eingeführt (wobei es anfangs weniger Unterschriften brauchte), um den nationalen Zusammenhalt zu stärken. Die Schweiz war 1848 nach dem Sonderbundskrieg zwischen Liberalen und Konservativen als Bundesstaat entstanden. Die siegreichen Liberalen konnten aber nicht regieren, ohne auf die starken Minder- und Besonderheiten Rücksicht zu nehmen: die verschiedenen Sprachen, Kulturen und Konfessionen, Stadt und Land, Berg und Tal. Die damals 25 Kantone und Halbkantone entsprachen einer gesellschaftlichen Heterogenität, die zwar im zentralisierten Bundesstaat zusammengefasst wurde, aber doch irgendwie föderalistisch abgefedert werden musste. So führte die Bourgeoisie 1874 die Initiative und das Gesetzesreferendum ein. Damit hatten die für das System wichtigen politischen Minderheiten ein Mittel in der Hand, um für sie nachteilige Änderungen zu blockieren bzw. zur Volksabstimmung zu bringen oder Verfassungsänderungen vorzuschlagen. Es sind Mittel, die im 19. Jahrhundert vor allem für die ländlichen, katholischen, konservativen Teile der staatstragenden Klasse eingeführt wurden. Allein die Drohung mit dem Referendum führt dazu, dass sich das Parlament genau überlegt, wie der (sprichwörtlich schweizerische) Kompromiss formuliert sein muss, damit er alle Klippen umschiffen kann.
Dieser kurze Ausflug in die Geschichte macht deutlich, dass diese direktdemokratischen Mittel eingeführt wurden, nicht um die bürgerliche Gesellschaft in einem fortschrittlichen Sinne zu verändern, sondern um konservative Teile der Gesellschaft zufriedenzustellen und besser in den Staat zu Bundesstaat zu integrieren. Diese Funktion, die Referendum und Initiative im 19. Jahrhundert hatten, änderte sich mit dem Auftreten des Proletariats als revolutionäre Klasse am Ende des 1. Weltkrieges. Seither dienen die direktdemokratischen Mittel in erster Linie der Ablenkung des selbständigen Kampfes der Arbeiterklasse in die Bahnen des bürgerlich-demokratischen Systems.
Könnte man aber nicht mit einer Volksinitiative eine revolutionäre Verfassungsänderung erwirken? Dabei desillusioniert schon ein Blick auf die Statistik der bis heute zur Abstimmung gebrachten Initiativen: Von deren 171 wurden gerade einmal 16 angenommen (d.h. weniger als 10%); die letzte Initiative, die angenommen wurde, war das Minarettverbot – wahrlich (k)eine revolutionäre Leistung …
Ist das Referendum eine Alternative für die Arbeiterklasse?
Sollen die Arbeiter aber nicht trotzdem zur Urne gehen und ihre Stimme abgeben, wenn sie schon gefragt werden? Man kann doch nichts dagegen haben, wenn die Leute als Stimmbürger und -bürgerinnen selbst entscheiden können, ob sie mit dem einen oder anderen Anliegen einverstanden sind oder nicht?
Um diese Fragen besser beantworten zu können, um gegen jene, die diese Wahlmethode befürworten, argumentieren zu können, reicht es nicht aus, verschiedene Texte oder unsere Plattform zu zitieren[3].
Wer aber die Frage nach dem Nutzen von Referenden für die Arbeiterklasse stellt, geht mit uns offenbar darin einig, dass die Arbeiterklasse diejenige gesellschaftliche Kraft ist, welche vorangehen muss, wenn es darum geht, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwälzen. Die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, können wir nur gemeinsam lösen. Eine wirklich klassenlose Gesellschaft lässt sich nur verwirklichen, wenn wir weltweit bewusst und gemeinsam dieses Ziel erkämpfen. In diesem Kampf müssen wir miteinander diskutieren, die beste Lösung in der klärenden, solidarischen Kontroverse suchen. Die demokratische Stimmabgabe ist dagegen ein Einzelakt von Individuen, die möglichst nicht wissen dürfen, wem der Nachbar die Stimme gegeben hat – schliesslich gilt ja das Abstimmungsgeheimnis bzw. das geheime Wahlrecht. Die bürgerliche Demokratie behauptet, dass die Stimmabgabe eine direkte Beteiligung auch der Arbeiter an der politischen Macht beinhalte. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Mit dem passiven Einwerfen eines Stimmzettels stirbt das wirkliche politische Denken. Es wird zu einem leeren Ritual, das uns zwingt, uns entweder hinter die eine oder andere Version bürgerlicher Alternativen zu stellen – Alternativen, welche stets im nationalstaatlichen Denken gefangen sind. In einer Vollversammlung von Arbeitern, die einen Streik beschliessen, werden zwar auch die Stimmen gezählt, doch dient dieser „demokratische“ Akt nur dazu, den Stand der Einigkeit in einem Kollektiv abzuschätzen: Sind wir uns heute einig genug, dass wir den Kampf in dieser oder jener Form aufnehmen? Oder sollen wir noch weiter diskutieren? Das Stimmenverhältnis in einer Vollversammlung oder in einem Arbeiterrat ist nur ein Moment in einem dynamischen Prozess, in dem weiter diskutiert und gekämpft wird. Die Demokratie in der kapitalistischen Gesellschaft ist aber das Gegenteil: Man gibt seine Stimme ab, dann wird ausgezählt – und am Ende hat die Mehrheit hat recht bzw. hat sich durchgesetzt. Das Gesetz, das vorher von den Parlamentariern ausgehandelt wurde, kann nur noch angenommen oder abgelehnt werden. Wollt ihr eine Arbeitslosenversicherung, die pleite geht? Oder wollt ihr schon heute bei der Arbeitslosenentschädigung Abstriche machen, damit die Pleite hinausgeschoben werden kann? Nur das steht im „fulminanten Abstimmungskampf“ um das Arbeitslosenversicherungs-Referendum zur Diskussion.
Fängt denn politisches Denken nicht mit der Diskussion um einen Abstimmungskampf an? Wir meinen, dass das Gegenteil der Fall ist: Spätestens wenn man an der Urne seine Stimme für die eine oder andere der uns vorgelegten systemkonformen „Lösungen“ abgibt, hört das politische Denken und vor allem die gemeinsame Suche nach wirklichen Alternativen zu dieser Gesellschaft auf.
Sicherlich können wir hier nicht verkennen, dass Teile der Arbeiterklasse trotzdem zur Urne gehen, egal ob es sich um Wahlen zur Repräsentation im Parlament oder um Abstimmungen über ein Referendum handelt. Deshalb sind die Arbeiter noch lange nicht dumm oder unfähig; sie sind auch nicht als Privilegierte anzusehen, die auf die Seite der bürgerlichen Klasse gewechselt wären. Es handelt sich um einen Ausdruck der Schwierigkeiten der Arbeiterklasse, zu einem wirklichen Klassenbewusstsein zu gelangen. Dieses Bewusstsein ist noch nicht an jenem Punkt angelangt, wo die Manöver und Spaltungstaktiken der herrschenden Klasse kollektiv durchschaut werden. Auch wenn die Bourgeoisie bei ihrem Spiel mit der Demokratie mitunter Schwierigkeiten hat, gelingt es ihr immer wieder, kurzfristig ihre Interessen durchzusetzen. Dabei ist die demokratische Methode eine ihrer Waffen, mit der sie Illusionen verbreiten kann. Und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die parlamentarische (repräsentative) Demokratie bei vielen Leuten je länger je weniger verfängt, ist zu beobachten, dass die herrschende Klasse auch in anderen Ländern direktdemokratische Mittel in Teilbereichen der Politik einführen will. In Österreich und Deutschland gibt es Bürgerinitiativen, die sich für „mehr Demokratie“ einsetzen. In Italien gibt es schon verschiedene Arten von Referenden, die vor allem von der parlamentarischen Linken propagiert werden[4].
Gerade die demokratischen Illusionen der Arbeiterklasse sind für den Kapitalismus sehr wichtig. Sie binden die Arbeiterklasse an die herrschende Logik des Staates und hindern sie daran, nach ihren eigenen Lösungen zu suchen und gemeinsam dafür zu kämpfen – über alle Grenzen hinweg! Ghz & Flc, 16.05.10
[1] Vgl. unseren Artikel von 2009 über diese Gruppe: /content/1826/initiative-der-gruppe-schweiz-ohne-armee-gegen-neue-kampfflugzeuge [142]
[2] Um diesbezüglich genauere Informationen zu bekommen, siehe den Link: https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum [143]
[3] Wir haben darüber einige Artikel veröffentlicht. Interessenten möchten wir wir auf unsere territoriale und internationale Presse, insbesondere auf den Artikel „Wählt nicht, kämpft“, verweisen. Ebenfalls möchten wir auf unsere Broschüre „Plattform und Manifeste“, insbesondere auf den Plattformpunkt acht über die parlamentarischen Wahlen, hinweisen.
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
- Referendum Schweiz [146]
Griechenland: TPTG-Artikel „In kritischen und erstickenden Zeiten“
- 2291 Aufrufe
(dieser Text wurde von Genoss/Innen ua. Der „Freunde der klassenlosen Gesellschaft“ übersetzt und zirkuliert. Wir bedanken uns für die Zusendung des Textes und möchten unseren Leser/Innen hier die ungekürzte Version zur Verfügung stellen. In unserer Zeitung haben wir einen Auszug veröffentlicht-IKS)
Kritische und erstickende Zeiten
Ein Bericht über die Demonstrationen in Athen vom 5. und 6. Mai sowie einige allgemeine Gedanken zur gegenwärtigen kritischen Situation der Bewegung in Griechenland
Obwohl sich der akute fiskalpolitische Terrorismus zurzeit mit ständigen Drohungen eines unmittelbar bevorstehenden Staatsbankrotts und „notwendigen Opfern“ von Tag zu Tag verschärft, war die Antwort des Proletariats unmittelbar vor der Verabschiedung neuer Austeritätsmaßnahmen im griechischen Parlament beeindruckend. Es war vermutlich die größte Demonstration von Arbeitern seit dem Ende der Diktatur, größer noch als die im Jahr 2001, die zum Ergebnis hatte, dass eine geplante Rentenreform zurückgezogen wurde. Nach unseren Schätzungen waren im Athener Stadtzentrum mehr als 200.000 und im Rest des Landes weitere 50.000 Demonstranten auf der Straße. In fast allen Sektoren des (Re-)Produktionsprozesses fanden Streiks statt. Auch eine proletarische Menge, die jener ähnelte, die im Dezember 2008 auf die Straße gegangen war (und die in der Propaganda der Mainstream-Medien abwertend als „vermummte Jugendliche“ bezeichnet wird), war mit dabei, ausgerüstet mit Äxten, Hämmern und Vorschlaghammern, Molotowcocktails, Steinen, Gasmasken, Schutzbrillen und Stöcken. Obwohl die Vermummten mitunter ausgebuht wurden, wenn sie zu gewaltsamen Angriffen auf Gebäude übergingen, passten sie insgesamt gut in den bunt zusammengewürfelten und wütenden Strom von Demonstranten. Die Parolen reichten von einer vollständigen Ablehnung des politischen System („Brennen wir dieses Bordell von Parlament nieder!“) bis zu patriotischen („IWF raus!“) und populistischen Losungen („Diebe!“, „Das Volk verlangt, dass die Gauner ins Gefängnis gesteckt werden!“). Parolen, die sich aggressiv gegen Politiker im Allgemeinen richten, gewinnen gegenwärtig mehr und mehr Verbreitung.
Auf der Demo der Gewerkschaftsverbände GSEE (privater Sektor) und ADEDY (öffentlicher Dienst) überfluteten die Leute den Platz zu Tausenden; als der GSEE-Vorsitzende seine Rede begann, wurde er ausgepfiffen. Wie bereits auf der Demo vom 11. März schlug die GSEE-Führung einen Umweg ein, um die Masse zu umgehen und sich an die Spitze des Zugs zu setzen, aber diesmal folgten ihr nur wenige…
Die Demo von PAME (der „Arbeiterfront“ der Kommunistischen Partei) war mit deutlich über 20.000 Teilnehmern ebenfalls groß und kam als erste am Syntagma-Platz an. Geplant war, dass sie dort eine Weile bleibt und dann vor dem Eintreffen der größeren Hauptdemonstration den Platz verlässt. Doch die Mitglieder wollten nicht gehen, sondern blieben stehen und riefen wütende Parolen gegen die Politiker. Die KP-Vorsitzende erklärte später, faschistische Provokateure (konkret beschuldigte sie die LAOS-Partei, ein Mischmasch aus rechtsradikalen Schlägern und einem Abschaum von Nostalgikern der Junta) hätten PAME-Tafeln getragen und KP-Mitglieder dazu angestachelt, das Parlament zu stürmen, und damit die Verfassungstreue der KP diskreditiert! Das ist zwar insofern nicht ganz falsch, als dort tatsächlich Faschisten gesichtet wurden, doch wie Augenzeugen berichten, bereitete es der KP-Führung in Wahrheit gewisse Schwierigkeiten, ihre Mitglieder eilig von dem Platz wegzulotsen und daran zu hindern, wütende Parolen gegen das Parlament zu rufen. Vielleicht ist es zu gewagt, darin ein Anzeichen für aufkeimenden Ungehorsam in der straff disziplinierten monolithischen Partei zu sehen, aber in so bewegten Zeiten kann das niemand mit Gewissheit sagen...
Die gut 70 Faschisten, die sich gegenüber der Bereitschaftspolizei aufgestellt hatten, verfluchten die Politiker („Hurensöhne, Politiker!“), sangen die Nationalhymne und warfen sogar ein paar Steine auf das Parlament; wahrscheinlich wollten sie eine Eskalation der Gewalt verhindern, doch sie wurden rasch von den riesigen Wellen von Demonstranten verschluckt, die sich dem Platz näherten.
Größere Gruppen von Arbeitern (Elektriker, Postarbeiter, Angestellte der Stadtverwaltung) versuchten sogleich, auf jedem erdenklichen Weg in das Parlamentsgebäude zu gelangen, doch mehrere Hundert Bullen auf dem Vorplatz versperrten sämtliche Eingänge. Eine andere Menge von Arbeiterinnen und Arbeitern aller Altersgruppen stellte sich den Bullen entgegen, die vor dem Grab des Unbekannten Soldaten standen, und beschimpften und bedrohten sie. Die Bereitschaftsbullen konnten die Menge zwar durch einen massiven Gegenangriff mit Tränengas und Rauchbomben auseinander treiben, doch es zogen ständig neue Blöcke von Demonstranten vor das Parlament, während diejenigen, die zurückgedrängt worden waren, sich von Neuem in der Panepistimiou-Straße und der Syngrou-Allee sammelten. Sie zerstörten, was immer gerade in Reichweite war, und attackierten die Einheiten der Bereitschaftspolizei, die über die angrenzenden Straßen verteilt waren. Obwohl die meisten großen Gebäude im Stadtzentrum mit Rollläden geschlossen waren, konnten sie auch einige Banken und staatliche Gebäude angreifen. Insbesondere in der Syngrou-Allee gab es erheblichen Sachschaden, da nicht genug Bullen da waren, um sofort einzuschreiten, denn die oberste Anweisung lautete, das Parlament zu schützen und die Panepistimiou-Straße und die Stadiou-Straße zu räumen, durch welche die Menge immer wieder vor das Parlament zog. Luxusautos, ein Finanzamt und die Präfektur von Athen wurden in Brand gesetzt und noch Stunden später sah es in der Gegend aus wie in einem Kriegsgebiet.
Die Straßenschlachten dauerten beinahe drei Stunden. Es ist unmöglich, das Geschehen hier vollständig darzustellen. Nur ein Beispiel: Einigen Lehrern und Arbeitern gelang es, Bereitschaftsbullen der Gruppe D – einer neuen Einheit mit Motorrädern – zu umzingeln und zu verprügeln, während die Bullen riefen: „Bitte nicht, wir sind auch Arbeiter!“
Die in die Panepistimiou-Straße zurückgedrängten Demonstranten zogen immer wieder in Blöcken vor das Parlament und die Zusammenstöße mit der Polizei hörten nicht auf. Auch hier war die Menge bunt gemischt und wollte nicht gehen. Mit Steinen in den Händen erzählte uns ein Gemeindearbeiter sichtlich bewegt, wie sehr ihn die Situation an die ersten Jahre nach dem Ende der Diktatur erinnerte; 1980 hatte er an der Demonstration zum Gedenken an den Aufstand im Polytechnikum teilgenommen, bei der die Polizei die 20 Jahre alte Arbeiterin Kanellopoulou ermordete.
Kurz darauf erreichte die entsetzliche Meldung ausländischer Nachrichtenagenturen die Handys: drei oder vier Tote in einer ausgebrannten Bank!
Es hatte an mehreren Stellen Versuche gegeben, Banken niederzubrennen, aber die Menge ließ davon jeweils ab, da in den Gebäuden Streikbrecher eingeschlossen waren. Nur das Gebäude der Marfin Bank in der Stadiou-Straße wurde schließlich in Brand gesetzt. Es waren allerdings nicht „vermummte Hooligans“ gewesen, die die Bankangestellten nur wenige Minuten vor der Tragödie unter anderem als „Streikbrecher“ angebrüllt und sie aufgefordert hatten, das Gebäude zu verlassen, sondern organisierte Blöcke von Streikenden. Aufgrund der Größe und Dichte der Demo, des allgemeinen Aufruhrs und der lauten Sprechchöre herrschte natürlich – wie immer in solchen Situationen – ein gewisses Durcheinander, das es schwierig macht, die Tatsachen über den tragischen Vorfall exakt wiederzugeben. Es scheint jedoch der Wahrheit nahe zu kommen (wenn man einzelne Informationen von Augenzeugen zusammenfügt), dass in dieser Bank, mitten im Zentrum Athens und am Tag eines Generalstreiks, etwa 20 Angestellte von ihrem Boss zur Arbeit gezwungen und „zu ihrem Schutz“ eingeschlossen worden waren und drei von ihnen schließlich an Erstickung starben. Durch ein Loch, das in die Fensterscheibe geschlagen worden war, wurde ein Molotowcocktail ins Erdgeschoss geworfen, doch als mehrere Bankangestellte auf den Balkonen gesehen wurden, riefen ihnen Demonstranten zu, das Gebäude zu verlassen, und versuchten das Feuer zu löschen. Was dann tatsächlich geschah und wieso das Gebäude in so kurzer Zeit in vollen Flammen stand, ist bislang unklar. Über die makabre Serie von Vorfällen – Demonstranten versuchten, den Eingeschlossenen zu helfen, die Feuerwehr brauchte zu lang, einige von ihnen aus dem Gebäude zu holen, und der grinsende Milliardär und Chef der Bank wurde von der wütenden Menge verjagt – wurde wohl hinreichend berichtet. Etwas später gab der Ministerpräsident die Nachricht im Parlament bekannt und verurteilte die „politische Unverantwortlichkeit“ derjenigen, die Widerstand gegen die Maßnahmen leisteten und „zum Tod von Menschen führen“, während die „Rettungsmaßnahmen“ der Regierung „für das Leben“ seien. Diese Verdrehung hatte Erfolg. Kurz darauf folgte ein Großeinsatz der Polizei: die Mengen wurden auseinandergejagt, die gesamte Innenstadt bis spät in die Nacht abgesperrt, der Stadtteil Exarchia einem Belagerungszustand unterworfen; die Polizei drang in ein anarchistisches besetztes Haus ein und nahm viele der Anwesenden fest, ein Zentrum von Migranten wurde zerstört und der Rauch über der Stadt wollte ebenso wenig verschwinden wie ein Gefühl der Bitterkeit und Betäubung…
Die Folgen wurden bereits am nächsten Tag deutlich: Die Aasgeier von den Medien beuteten die tragischen Tode aus, lösten sie als eine „persönliche Tragödie“ aus ihrem allgemeinen Kontext (bloße Leichen, abgetrennt von allen gesellschaftlichen Beziehungen) und gingen in einigen Fällen so weit, Protest und Widerstand zu kriminalisieren. Die Regierung gewann etwas Zeit, indem sie das Thema der Auseinandersetzungen verschob, und die Gewerkschaften sahen sich von jeglicher Pflicht entbunden, für den Tag der Verabschiedung der Maßnahmen zum Streik aufzurufen. In diesem Klima der Angst, Enttäuschung und Erstarrung versammelten sich abends trotzdem ein paar Tausend Leute auf einer Kundgebung vor dem Parlament, zu der die Gewerkschaften und linke Organisationen aufgerufen hatten. Die Wut war noch immer da, es wurden die Fäuste gereckt, Wasserflaschen und ein paar Böller auf die Bullen geworfen und Parolen gegen das Parlament und die Polizei gerufen. Eine alte Frau forderte die Leute zu Sprechchören auf, dass „sie [die Politiker] verschwinden sollen“, ein Typ pinkelte in eine Flasche und warf sie auf die Bullen; nur wenige Antiautoritäre waren gekommen, und als es dunkel wurde und die Gewerkschaften und die meisten Organisationen gingen, blieben noch immer Leute da, vollkommen unbewaffnete, gewöhnliche, alltägliche Leute. Von der Polizei brutal angegriffen, zurückgedrängt und die Stufen am Syntagmaplatz hinuntergeworfen, wurde die von Panik ergriffene, aber zugleich wütende Menge aus jungen wie alten Leuten schließlich in den angrenzenden Straßen auseinander getrieben. Die Ordnung war wieder hergestellt. Es stand ihnen jedoch nicht nur die Angst ins Gesicht geschrieben; auch ihr Hass war unübersehbar. Es ist sicher, dass sie wiederkommen werden.
Abschließend einige allgemeinere Reflexionen:
§ Ein hartes Durchgreifen gegen Anarchisten und Antiautoritäre hat bereits eingesetzt und wird sich noch verschärfen. Die Kriminalisierung eines gesamten sozialen und politischen Milieus, das bis zu den Organisationen der extremen Linken reicht, war schon immer ein Ablenkungsmanöver des Staates, das nun, da ihm der mörderische Angriff so günstige Bedingungen bietet, erst recht zum Einsatz kommen wird. Doch den Anarchisten etwas anzuhängen, wird nicht dazu führen, dass die mehreren Hunderttausend Demonstranten und die noch viel größere Zahl von Menschen, die untätig geblieben, aber ebenfalls besorgt sind, den IWF und das „Rettungspaket“ vergessen, das ihnen die Regierung anbietet. Niemand kann seine Rechnungen bezahlen oder in eine weniger düstere Zukunft blicken, nur weil unser Milieu schikaniert wird. Die Regierung wird in absehbarer Zeit den Widerstand überhaupt kriminalisieren müssen, und wie die Vorfälle vom 6. Mai zeigen, hat sie damit bereits begonnen.
§ In begrenztem Maße wird der Staat zudem versuchen, die „Schuld“ bestimmten Politikern zuzuschieben, um die „Stimmung im Volk“ zu besänftigen, die sich durchaus zu einem „Blutdurst“ entwickeln könnte. Um die Wogen zu glätten, wird er möglicherweise ein paar eklatante Fälle von „Korruption“ aburteilen und ein paar Politiker opfern.
§ Im Zuge eines Spektakels der Schuldzuweisungen sprechen sowohl LAOS wie die KP von einer „Abweichung von der Verfassung“. Darin drückt sich die zunehmende Angst der herrschenden Klasse vor einer Verschärfung der politischen Krise, einer Verschärfung der Legitimationskrise aus. Derzeit erleben verschiedene Szenarien eine Neuauflage (eine Partei der Geschäftsleute, eine Art Regime der Junta), die die tiefe Angst vor einem proletarischen Aufstand offenbaren und de facto dazu dienen, das Problem der Schuldenkrise wieder von der Straße auf die Bühne der großen Politik zu verschieben – zu der banalen Frage „Wer wird die Lösung sein?“ statt „Was ist die ‚Lösung’?“.
§ Vor dem Hintergrund all dessen ist es höchste Zeit, zu den entscheidenden Fragen zu kommen. Es ist mehr als deutlich, dass bereits das widerliche Spiel begonnen hat, die Angst und Schuldgefühle wegen der Schulden in Angst und Schuldgefühle wegen des Widerstands und des (gewaltsamen) Aufruhrs gegen den Terrorismus der Schulden zu verwandeln. Wenn der Klassenkampf eskaliert, könnte sich die Lage mehr und mehr wie ein regelrechter Bürgerkrieg darstellen. Die Gewaltfrage ist bereits zentral geworden. So wie wir die staatliche Handhabung der Gewalt beurteilen, müssen wir auch die proletarische Gewalt beurteilen: Die Bewegung muss sich in praktischen Begriffen mit Legitimation und Inhalt aufrührerischer Gewalt auseinandersetzen. Was das anarchistisch-antiautoritäre Milieu und die in ihm vorherrschende insurrektionalistische Strömung betrifft, ist die Tradition der Fetischisierung und machoartigen Verherrlichung von Gewalt zu lang und ungebrochen, als dass man ihr gleichgültig gegenüberstehen könnte. Seit Jahren wird die Gewalt als Selbstzweck in allen möglichen propagiert (bis hin zum richtiggehenden bewaffneten Kampf) und insbesondere nach der Rebellion vom Dezember ist ein gewisses Maß an nihilistischem Zerfall zutage getreten (in unserem Text The Rebellious Passage haben wir an einigen Stellen darauf hingewiesen), der sich auf das Milieu selbst erstreckt. An den Rändern des Milieus ist eine wachsende Zahl sehr junger Leute sichtbar geworden, die für nihilistische grenzenlose Gewalt (kostümiert als „Nihilismus des Dezember“) und Zerstörung eintreten, selbst wenn dies das variable Kapital einschließt (in Gestalt von Streikbrechern, „kleinbürgerlichen Elementen“, „gesetzestreuen Bürgern“). Dieser Verfall, der aus der Rebellion und ihren Grenzen sowie aus der Krise erwächst, ist unübersehbar. In gewissem Maße wurde im Milieu bereits damit begonnen, solche Verhaltenweisen zu verurteilen und Selbstkritik zu leisten (einige anarchistische Gruppen haben die Verantwortlichen für den Anschlag auf die Bank sogar als „parastaatliche Schlägertypen“ bezeichnet) und es ist durchaus möglich, dass organisierte Anarchisten und Antiautoritäre (Gruppen wie besetzte Häuser) versuchen werden, solche Tendenzen sowohl politisch wie in der Praxis zu isolieren. Die Situation ist jedoch komplizierter und übersteigt das theoretische wie praktische (selbst-)kritische Vermögen dieses Milieus. Im Rückblick betrachtet, hätte es auch während der Rebellion vom Dezember zu solchen tragischen Vorfällen mit allen Konsequenzen kommen können – verhindert wurde dies nicht nur durch Zufall (neben Gebäuden, die am 7. Dezember in Brand gesetzt wurden, befand sich eine Tankstelle, die aber nicht explodierte, und die gewalttätigsten Riots fanden nachts statt, als die meisten betroffenen Gebäuden leer waren), sondern auch durch die Schaffung einer (wenngleich begrenzten) proletarischen Öffentlichkeit und von Kampfgemeinschaften, die sich nicht nur durch Gewalt zusammenfanden, sondern auch durch ihre Inhalte, ihren Diskurs und andere Formen der Kommunikation. Diese bereits existierenden Gemeinschaften (von Studierenden, Fußballhooligans, Einwanderern, Anarchisten), die sich durch die rebellierenden Subjekte selbst in Kampfgemeinschaften verwandelten, waren es, die der Gewalt einen sinnvollen Ort zuwiesen. Wird es solche Gemeinschaften nun, da nicht mehr nur eine proletarische Minderheit aktiv ist, von Neuem geben? Werden sich am Arbeitsplatz, in den Stadtteilen oder auf der Straße praktische Formen von Selbstorganisation entwickeln, um Form und Inhalt des Kampfes zu bestimmen und die Gewalt auf diese Weise in eine Perspektive der Befreiung zu stellen?
Beunruhigende Fragen in schwierigen Zeiten, doch während wir kämpfen, werden wir die Antworten finden müssen.
TPTG
9. Mai 2010
Aktuelles und Laufendes:
- Kämpfe in Griechenland [147]
Türkei: Solidarität mit dem Widerstand der Tekel-Beschäftigten
- 2265 Aufrufe
Türkei: Solidarität mit dem Widerstand der Tekel-Beschäftigten gegen die Regierung und die Gewerkschaften (Teil 3) & Lehren: Wozu bestehen Gewerkschaften? Was ist ihre Funktion?
Wir bedanken uns sehr bei dem Tekel-Beschäftigten, der diesen Artikel verfasst hat, und sich mit der Zeit zwischen dem 2. März und dem 2. April befasst, und Lehren aus der allgemeinen Entwicklung zieht. IKS
(Die IKS erstellt gegenwärtig auf Deutsch eine Textsammlung mit Dokumenten zum Tekel-Streik. Der hier veröffentlichte 3. Teil baut auf den 1. Teil (welcher schon auf unserer Webseite veröffentlicht wurde) und den 2. (in Übersetzung befindlichen) Teil.
Beitrag des Genossen aus der Türkei
Am 2. März wurden, obwohl wir das ablehnten, die Zelte von den Gewerkschaftsbossen abgerissen, die Straße vor dem Turk-Is-Gebäude geräumt, und wir wurden aufgefordert, wieder nach Hause zurückzukehren. 70-80 verblieben in Ankara, um zu beraten, was wir in den nächsten drei Tagen tun könnten. Nach diesen drei Tagen kehrten 60 von uns nach Hause zurück, und 20 von uns, ich gehörte dazu, blieben noch weitere zwei Tage. Obwohl der Kampf in Ankara 78 Tage dauerte, blieben wir 83 Tage. Wir stimmten darin überein, dass wir uns sehr anstrengen mussten, den Kampf weiterzubringen, und ich kehrte schließlich auch nach Adiyaman zurück. Sobald ich aus Ankara zurückkehrte, fuhren 40 von uns zu unseren Brüdern und Schwestern, die in Gaziantep in der Textilindustrie im Streik stehen. Der Tekel-Kampf war ein Beispiel für unsere Klasse. Als ein Tekel-Beschäftigter war ich sowohl stolz als auch bewusst, dass ich mehr für unsere Klasse tun könnte und selbst dazu beitragen müsste. Obgleich meine wirtschaftliche Lage dies nicht zuließ und trotz der Erschöpfung nach 83 Tagen Kampf und anderen Problemen wollte ich mich noch mehr anstrengen, um den Prozess weiter zu treiben. Wir wollten ein formales Komitee gründen und den Prozess in unsere eigenen Hände nehmen. Auch wenn wir dies noch nicht formalisieren können, mussten wir es zumindest gründen, indem wir in Kontakt mit Beschäftigten aus anderen Städten blieben, da wir am 1. April nach Ankara zurückkehren wollten.
Wir müssen überall hingehen wo wir können und den Leuten über den Tekel-Kampf bis ins letzte Detail berichten. Dazu müssen wir ein Komitee bilden und innerhalb der Klasse zusammenschließen. Unsere Aufgabe ist schwerer als sie erscheint. Wir müssen uns auf der einen Seite mit dem Kapital auseinandersetzen, der Regierung und den Gewerkschaftsführern auf der anderen Seite. Auch wenn unsere wirtschaftliche Lage nicht gut ist, auch wenn wir körperlich müde sind, wenn wir den Sieg wollen, müssen wir kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen!
Obgleich ich von meiner Familie 83 Tage getrennt war, bin ich anschließend nur eine Woche zu Hause geblieben. Ich bin nach Istanbul gefahren, um die Leute über den Widerstand der Tekel-Beschäftigten zu berichten, ohne die Gelegenheit zu haben, mit meiner Frau und meinen Kinder die Zeit nachzuholen. Wir hatten viele Treffen unter den Beschäftigten des Tekel-Komitees, insbesondere in Diyarbakir, Izmir, Hatay, und ich habe mich an vielen Treffen mit Kollegen aus dem informellen Komitee in Istanbul getroffen. Wir hatten ebenso viele Treffen in der Mimar Sinan Universität, eines in dem Lehrerwohnhein Sirinevler, eins in dem Gebäude der Ingenieursgewerkschaft, wir diskutierten mit Piloten und anderen Beschäftigten der Luftfahrtindustrie aus der dissidenten Regenbogenbewegung in Hava-Is, und mit Beschäftigten der Justiz. Wir trafen ebenso den Istanbuler Vorsitzenden der Friedens- und Demokratiepartei und baten darum, dass Tekel-Beschäftigte die Gelegenheit erhalten, am Newroz Feiertag zu reden.
In den Treffen wurden wir alle sehr warmherzig empfangen. Die Bitte der PDP wurde akzeptiert, ich wurde gebeten, auf den Newroz Demonstrationen als Redner aufzutreten. Weil ich nach Adiyaman zurückkehren musste, schlug ich einen Kollegen aus Istanbul als Redner vor. Als ich in Istanbul war, besuchte ich die kämpfenden Feuerwehrleute, die Sinter Metaller, die Esenyurt Kommunalbeschäftigten, den Sabah Verlag, und streikende ATV Fernsehbeschäftigte und am letzten Tag die Beschäftigten der Istanbuler Wasser- und Kanalisationsbetriebe (ISKI). Einen halben Tag lang diskutierten wir mit den Arbeitern, um zu sehen, wie wir den Kampf stärken können; dabei unterrichteten wir sie über den Kampf der Tekel-Beschäftigten. Die ISKI-Beschäftigten berichteten mir, dass sie ihren Kampf begannen, weil sie sich ermutigt fühlten durch den Kampf der Tekel-Beschäftigten. Egal welche Arbeiter ich besuchte, egal bei welcher Demonstration ich mich beteiligte, überall hörte ich „der Kampf der Tekel-Beschäftigten hat uns Mut gegeben“. Während der Woche meines Aufenthaltes in Istanbul machte mich dies sehr glücklich. Mein ganzer Aufenthalt in Istanbul war für mich sehr erfüllend. Natürlich gab es auch Negativerlebnisse. Leider verstarb einer meiner Angehörigen, aber ich blieb dennoch eine ganze Woche wie geplant in Istanbul.
Zu den schlechten Nachrichten gehörte, dass in dieser Zeit 24 Studenten von ihrer Schule verwiesen wurden (Mehmetcik Gymnasium), weil sie den Tekel-Kampf unterstützt haben. Und in Ankara wurde auch eine Klassenschwester von uns aus dem Wissenschafts- und Technologieforschungsrat der Türkei (TUBITAK), Aynur Camalan, entlassen. Wenn das Kapital Arbeiter wie wir so brutal angreift, müssen wir uns dagegen zusammenschließen. So verfassten wir zwei Stellungnahmen für die Presse in Adiyaman und zeigten, dass unsere Freunde nicht alleine dastanden. Wir bereiteten uns auch für Demonstration des 1. April vor. Die Gewerkschaftsführer wollten, dass lediglich 50 Beschäftigte aus jeder Stadt nach Ankara kommen sollten, so dass insgesamt nicht mehr als 1000 Arbeiter zusammenkommen sollten. Als ein informelles Komitee erhöhten wir diese Zahl von 50 auf 180 in Adiyaman allein, und ich kam am 31. März schon mit 10 Kollegen nach Ankara.
Trotz all der Ankündigungen der Gewerkschaften, die Zahl auf 50 pro Stadt zu beschränken, gelang es uns, 180 Arbeiter zu mobilisieren (wobei wir die Kosten übernahmen, nicht die Gewerkschaften), weil wir uns dessen bewusst waren, dass die Gewerkschaften wie früher wieder zu manipulieren versuchen wollten. Wir hatten viele Treffen mit Massenorganisationen, Vereinigungen und Gewerkschaften. Wir besuchten Aynur Camalan, die Klassenschwester von TUBITAK, die ihren Job verloren hatte.
Am 1. April versammelten wir uns in Kizilay, aber wir mussten uns sehr bemühen, vor das Turk- Is zu gelangen, weil 15.000 Polizisten das Gebäude bewachten. Was taten all diese Polizisten vor uns und dem Gewerkschaftsgebäude? Jetzt müssen wir diejenigen fragen, die sich gegen uns richten. (…) Wenn ein Bollwerk von 15.000 Polizisten zwischen uns und den Gewerkschaften aufgebaut wird, warum bestehen dann überhaupt Gewerkschaften? Wenn ihr mich fragt, ist es ganz natürlich, dass die Polizei die Gewerkschaften und die Gewerkschaftsführer schützt, denn stellen sich die Gewerkschaften und deren Führer nicht vor die Regierung und das Kapital? Bestehen die Gewerkschaften nicht nur, um die Arbeiter im Interesse des Kapitals unter Kontrolle zu behalten?
Am 1. April gelang es ca. 35-40 von uns trotz alledem die Barrikaden einzeln zu durchbrechen und vor das Gebäude der Gewerkschaft Turk-Is zu gelangen. Es ging uns darum, eine gewisse Mehrheit zu erreichen, und dass auch andere dort hin gelangen könnten; aber das gelang uns nicht, unglücklicherweise gelang es unserer Mehrheit nicht, mit 15.000 Polizisten fertig zu werden. Die Gewerkschaften hatten verkündet, dass nur 1000 von uns nach Ankara kommen würden. Als informellem Komitee gelang es uns, diese Zahl auf 2300 zu erhöhen. 15.000 Polizisten blockierten den 2300 den Weg. Wir versammelten uns auf der Sakarya-Straße. Dort sollten wir mindestens die Nacht verbringen, mit all denjenigen, die gekommen waren um uns zu unterstützen. Tagesüber waren wir zweimal von der Polizei angegriffen worden, die dabei Pfefferspray und Polizeiknüppel einsetzte. Wir wollten natürlich die Nacht vor dem Hauptquartier der Gewerkschaft Turk-Is verbringen, aber als wir auf die Polizei stießen, verharrten wir in der Sakarya-Straße. Im Laufe der Nacht riefen jedoch die Gewerkschaftsleute die uns unterstützenden Arbeiter leise und gerissen dazu auf, das Gebiet zu räumen. So blieben wir nur als eine Minderheit vor. Die Gewerkschafter forderten mich auch mehrmals auf, den Rückzug anzutreten, aber wir beugten uns ihnen nicht und blieben vor Ort. Aber als unsere Unterstützer gegen 23.00h abzogen, mussten wir auch gehen.
Für den 2. April wurde eine Presseankündigung erwartet. Als wir gegen 9.00 h in der Sakarya-Straße eintrafen, wurden wir von der Polizei angegriffen, die erneut Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzte. Eine Stunde später oder so gelang ca. 100 von uns, die Polizeiabsperrungen zu durchbrechen und ein Sit-in zu beginnen. Die Polizei bedrohte uns. Wir widersetzten uns. Die Polizei musste die Absperrung öffnen, und uns gelang es mit der anderen Gruppe, die draußen geblieben war, zusammenzuschließen. Wir begannen, in Richtung des Gebäudes der Turk-Is zu marschieren, aber die Gewerkschaftsbosse taten erneut das, was sie tun mussten, und machten ihre Stellungnahme gegenüber der Presse ca. 100 m von der Gewerkschaftszentrale entfernt. Egal wie stark wir dies forderten, die Gewerkschaftsführer weigerten sich, vor das Gewerkschaftsgebäude auf die Straße zu kommen. Die Gewerkschaften und die Polizei handelten Hand in Hand; und da einige von uns abrückten, gelang es uns nicht dorthin zu gehen, wohin wir wollten. Es gab einen interessanten Punkt, den die Gewerkschafter verkündet hatten. Sie sagten, sie würden am 3. Juni zurückkommen und dort drei Nächte verbringen. Es ist schon merkwürdig, wie wir dort drei Nächte verbringen sollen, da es uns nicht mal gelang, eine einzige Nacht dort auszuhalten. Danach musste die Polizei zunächst die Gewerkschafter vor uns schützen und ihnen den Fluchtweg freihalten; dann standen wir der Polizei allein gegenüber. Ungeachtet der Drohungen und dem Druck der Polizei, zerstreuten wir uns nicht; darauf folgte ein Angriff mit Pfefferspray und Schlagstöcken, worauf wir uns am Nachmittag zerstreuten. Wir ließen einen schwarzen Trauerkranz von einigen Floristen binden, um das Verhalten der Turk-Is und der Regierung zu verurteilen, den wir vor der Gewerkschaftszentrale niederlegten.
Meine lieben Klassenbrüder und –schwestern: Was wir uns fragen müssen, wenn 15.000 Polizisten vor dem Gewerkschaftsgebäude und den Arbeitern zusammengezogen sind und Absperrungen errichtet haben, wozu bestehen eigentlich Gewerkschaften? Ich rufe alle meine Klassenbrüder- und schwestern auf, wenn wir den Sieg erringen sollen, müssen wir gemeinsam kämpfen.
Wir als Tekel-Beschäftigte haben einen Funken gezündet; alle zusammen werden wir diesen zu einem gewaltigen Feuerball machen. Deshalb möchte ich meinen Respekt für euch alle zum Ausdruck bringen, indem ich meinen Text mit einem Gedicht ende:
The steam of the tea flies away while our lives are still fresh
Cloths get as long as roads, and only sorrow returns
A bown of rice, they say our food has landed on our homes
Yearnings become roads, roads, where does labour go
Hunger is for us, cold is for us, poverty is for us
They have called in fate, living with it is for us
Us who feed, us who hunger, us who are naked again
We have not written this fate, it is us who will break it yet again
Wir als Tekel-Beschäftigte sagen, auch wenn wir eine Niederlage einstecken sollten, werden wir unseren Kindern eine ehrbare Zukunft hinterlassen.
Ein Tekel-Beschäftigter aus Adiyaman
Aktuelles und Laufendes:
- Tekel-Streik Türkei [148]
- Gewerkschaften in der Türkei [149]
- Turk-Is [150]
Vor 30 Jahren: Massenstreik in Polen 1980
- 3876 Aufrufe
Im Sommer 1980 hielt die polnische Arbeiterklasse die ganze Welt in Atem. Eine riesige Massenstreikbewegung entfaltete sich: Mehrere Hunderttausend Arbeiter streikten wild in verschiedenen Städten und brachten die herrschende Klasse in Polen, aber auch in den anderen Ländern zum Zittern.
Heute, wo in Griechenland die Arbeiterklasse wieder anfängt, den Folgen der Wirtschaftskrise massenhaft die Stirn zu bieten, ist es umso wichtiger, sich mit der Frage des Massenstreiks und insbesondere mit seinem letzten Beispiel damals in Polen zu befassen.
Was war passiert?
Nach der Ankündigung von Preiserhöhungen für Fleisch reagierten die Arbeiter in vielen Betrieben prompt mit Arbeitsniederlegungen. Am 1. Juli 1980 streikten Arbeiter in Tczew bei Danzig und in dem Warschauer Vorort Ursus. In Ursus wurden Vollversammlungen abgehalten, ein Streikkomitee gebildet, gemeinsame Forderungen aufgestellt. In den Tagen danach weitere Ausdehnung der Streiks: Warschau, Lodz, Danzig.... Die Regierung versuchte mit schnellen Konzessionen in Form von Lohnerhöhungen eine weitere Ausdehnung einzudämmen. Mitte Juli traten die Arbeiter der verkehrsmäßig zentral gelegenen Stadt Lublin in den Streik. Diese Stadt liegt an der Strecke UdSSR - DDR, der Versorgungsader der sowjetischen Truppen in der DDR. Ihre Forderungen lauteten: keine Repression gegen die Streikenden, Abzug der Polizei aus den Fabriken, Lohnerhöhungen und freie Gewerkschaftswahlen.
An einigen Orten wurde die Arbeit wieder aufgenommen, in anderen schlossen sich weitere Arbeiter der Bewegung an. Ende Juli hoffte die Regierung, sie hätte durch ihre Taktik, mit jedem Betrieb gesondert zu verhandeln, die Flamme der Streiks ausgelöscht. Aber am 14. August erhielt die Bewegung wieder Auftrieb: Die Bediensteten der Verkehrsbetriebe von Warschau und die Werftarbeiter von Danzig traten in den Streik. Und wieder aus immer mehr Orten neue Streikmeldungen.
Was die Arbeiter stark machte
Die Arbeiter hatten aus den Kämpfen von 1970 und 1976 die Lehren gezogen. Sie hatten gesehen, dass die offiziellen Gewerkschaften Teil des stalinistischen Staatsapparates waren und bei jeder Forderung der Arbeiter auf Seiten der Regierung standen. Deshalb war ein Ausschlag gebendes Moment für die Streikbewegung von 1980 die Selbstinitiative der Arbeiter; sie warteten auf keine Anweisung von oben, sondern kamen selbst zusammen, um Zeitpunkt und Schwerpunkt ihrer Kämpfe zu bestimmen.
Am deutlichsten wurde dies in der Region Danzig-Gdynia-Zopot, dem Industriegürtel an der Ostsee. Die Lenin-Werft in Danzig beschäftigte allein ca. 20.000 Arbeiter. In einer Massenversammlung wurden gemeinsam Forderungen aufgestellt. Ein Streikkomitee wurde gebildet, anfangs standen ökonomische Forderungen im Vordergrund.
Die Arbeiter waren entschlossen: Eine blutige Niederschlagung der Kämpfe wie 1970 und 1976 sollte sich nicht wiederholen. Gerade in einer Industriehochburg wie Danzig-Gdynia-Zopot war es so offensichtlich, dass sich alle Arbeiter zusammenschließen mussten, um das Kräfteverhältnis zu ihrem Gunsten zu beeinflussen. Ein überbetriebliches Streikkomitee (MKS) wurde gebildet. Ihm gehörten 400 Mitglieder an, zwei Vertreter je Fabrik. In der zweiten Augusthälfte gab es ca. 800-1000 Delegierte. Durch die Bildung eines überbetrieblichen Streikkomitees wurde die Zersplitterung in verschiedene Betriebe und Industriebranchen überwunden. Die Arbeiter traten dem Kapital in geschlossener Front entgegen. Sie versammelten sich täglich auf dem Gelände der Lenin-Werft.
Lautsprecher wurden angebracht, damit die Diskussionen des Streikkomitees von Allen mitgehört werden konnten. Kurze Zeit später wurden Mikrofone außerhalb des Versammlungsraumes des Streikkomitees installiert, damit die Arbeiter aus den Versammlungen heraus direkt in die Diskussion eingreifen konnten. Abends fuhren die Delegierten - meist mit Kassetten über die Verhandlungen ausgerüstet - in ihre Betriebe zurück und stellten sich den Vollversammlungen.
Durch diese Vorgehensweise wurde ein Großteil der Arbeiter direkt an den Kämpfen beteiligt, die Delegierten mussten Rechenschaft ablegen, waren jederzeit abwählbar, und die Vollversammlungen in den jeweiligen Betrieben konnten nicht hinters Licht geführt werden, wie es die Gewerkschaften üblicherweise tun. In einzelnen Betrieben wurden zusätzliche Forderungen formuliert.
Unterdessen breitete sich nach Eintritt der Arbeiter von Danzig-Gdynia und Zopot die Bewegung auf andere Städte weiter aus. Um den Kontakt der Arbeiter untereinander zu blockieren, unterbrach die Regierung am 16. August die Telefonleitungen. Die Arbeiter drohten sofort mit einer weiteren schnellen Ausdehnung der Streiks. Die Regierung gab nach!
Die Vollversammlung der Arbeiter beschloss die Bildung einer Arbeitermiliz. Da der Alkoholkonsum gerade auch in den Reihen der Arbeiter sehr stark war, beschloss man gemeinsam, den Alkoholkonsum zu verbieten. Die Arbeiter wussten, sie brauchen einen klaren Kopf, um der Regierung entgegenzutreten!
Eine Regierungsdelegation kam zu Verhandlungen mit den Arbeitern - vor versammelter Belegschaft, nicht hinter verschlossenen Türen. Die Arbeiter verlangten die Neuzusammensetzung der Regierungsdelegation, weil deren Anführer nur eine Marionette war. Die Regierung gab nach.
Als die Regierung mit dem Einsatz von Militär gegen die Arbeiter in Danzig drohte, reagierten die Eisenbahner von Lublin: „Wenn den Arbeitern in Danzig auch nur ein Haar gekrümmt wird, dann legen wir die strategisch wichtige Eisenbahnverbindung von der UdSSR in die DDR lahm“. Die Regierung hatte verstanden! Dies hätte bedeutet, dass ihre Kriegswirtschaft, ihre Truppen an einem lebenswichtigen Nerv getroffen worden wären, und dies zu Zeiten des Kalten Krieges.
In nahezu allen Großstädten waren die Arbeiter mobilisiert.
Über eine halbe Million Arbeiter hatten gemerkt, dass sie die entscheidende Kraft im Lande waren, die direkt der Regierung gegenübertrat. Sie hatten gespürt, was sie stark machte:
- die schnelle Ausdehnung des Kampfes, anstatt sich in gewaltsamen Konfrontationen wie 1970 und 1976 aufzureiben,
- die Selbstorganisierung ihrer Kämpfe, die Selbstinitiative, anstatt sich den Gewerkschaften anzuvertrauen,
- die Vollversammlungen, die Verhandlungen des überbetrieblichen Streikkomitees mit der Regierung vor den Augen und Ohren der Arbeiter, die die Kontrolle über die Bewegung ausüben, größtmögliche Massenaktivität vor Ort.
Kurzum: die Ausdehnung der Bewegung war die beste Waffe der Solidarität. Hilfe nicht nur durch Deklarationen, sondern indem man selbst in den Kampf trat. Das veränderte das Kräfteverhältnis von Grund auf. Und weil die Arbeiter so massiv auf den Plan traten, konnte die Regierung keine Repression ausüben. Während der Sommerstreiks, als die Arbeiter in einer Front geschlossen dem Kapital gegenübertraten, gab es keinen einzigen Verletzten oder Toten. Die polnische Bourgeoisie wusste, dass sie diesen Fehler nicht begehen durfte, dass sie stattdessen die Arbeiterklasse erst von innen schwächen musste.
Schließlich forderten die Arbeiter in Danzig, denen die Regierung nachgegeben hatte, die zugestandenen Konzessionen auf die anderen Städte anzuwenden. Sie wollten sich nicht spalten lassen, sondern boten ihre Solidarität den Arbeitern in den anderen Städten an.
Die Arbeiterklasse war der Anziehungspunkt:
Arbeiter aus verschiedenen Städten reisten nach Danzig, um direkt mit den Streikenden dort Kontakt aufzunehmen. Aber auch Bauern und Studenten kamen zu den Fabriktoren, um die Streikbulletins, die Informationen selbst entgegenzunehmen. Die Arbeiterklasse war die führende Kraft.
Die Reaktion der Bourgeoisie: Isolierung
Welche Gefahr von den Kämpfen in Polen ausging, konnte man anhand der Reaktion der herrschenden Klasse in den Nachbarländern erkennen.
Sofort wurde die Grenze zur DDR, zur CSSR und zur Sowjetunion dicht gemacht. Während noch zuvor Tag für Tag polnische Arbeiter in die DDR, vor allem nach Berlin zum Einkaufen fuhren, da es in den leeren Regalen in Polen noch weniger Erzeugnisse als in der DDR gab, wollte die osteuropäische Bourgeoisie nun die polnische Arbeiterklasse isolieren. Eine direkte Kontaktaufnahme zu den Arbeitern in den anderen Ländern sollte mit allen Mitteln verhindert werden! Und zu dieser Maßnahme gab es allen Anlass. Denn in der benachbarten CSSR streikten im Kohlerevier um Ostrau - dem polnischen Beispiel folgend - die Kumpel. Auch im rumänischen Bergbaurevier und im russischen Togliattigrad griffen die Arbeiter das Beispiel der polnischen Arbeiter auf. Auch wenn es im Westen zu keinen Solidaritätsstreiks kam, so griffen doch die Arbeiter an vielen Orten die Losungen ihrer Klassenbrüder und -schwestern in Polen auf. In Turin skandierten im September 1980 die Arbeiter ‘Machen wir es wie in Danzig’.
Aufgrund seines Ausmaßes sollte der Massenstreik in Polen eine gewaltige Ausstrahlung auf die Arbeiter in anderen Ländern haben. Wie 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und Polen und 1970 sowie 1976 erneut in Polen zeigten die polnischen Arbeiter mit ihrem Massenstreik von 1980 auf, dass die sich „sozialistisch“ schimpfenden Regimes staatskapitalistische, arbeiterfeindliche Regierungen waren. Trotz des Sperrringes, der um Polen gelegt wurde, trotz des „Eisernen Vorhangs“ stellte die Massenbewegung der polnischen Arbeiterklasse einen weltweiten Bezugspunkt dar. Es war die Zeit des Kalten Krieges, des Afghanistankrieges; doch die Arbeiter hatten ein Zeichen gesetzt. Mit ihrem Kampf traten die Arbeiter der militärischen Aufrüstung, der Kriegswirtschaft entgegen. Die Vereinigung der Arbeiter von Ost und West tauchte, auch wenn sie noch nicht konkret formuliert wurde, zumindest wieder als Perspektive auf.
Jeder musste die Kraft und die Ausstrahlung der Arbeiterklasse anerkennen.
Wie die Bewegung untergraben wurde
Die Bewegung konnte solch eine Kraft entfalten, weil sie sich schnell ausgedehnt hatte und die Arbeiter selbst die Initiative ergriffen hatten. Ausdehnung über alle Fabriktore hinweg, Abwählbarkeit der Delegierten, Vollversammlungen usw., all das hatte ihre Stärke ermöglicht. Anfangs war die Bewegung noch frei von gewerkschaftlichen Fesseln.
Im Laufe der Bewegung jedoch gelang es den Mitgliedern der frisch gegründeten „freien Gewerkschaft“ Solidarnosc, der Bewegung Fesseln anzulegen.
Während zunächst die Verhandlungen offen geführt wurden, verbreitete sich schließlich die Meinung, dass „Experten“ notwendig seien, um Details mit der Regierung auszuhandeln. Immer öfter wurden die Verhandlungen geheim weitergeführt, die Lautsprecheranlagen auf den Werften, die vorher die Verhandlungen übertrugen, funktionierten plötzlich „aus technischen Gründen“ immer seltener. Lech Walesa, von dem später bekannt wurde, dass er ein Spitzel der polnischen Geheimpolizei war, wurde zum Anführer der neuen Gewerkschaftsbewegung gekürt (1). Der neue Feind der Arbeiter, die frisch aus der Taufe gehobene Gewerkschaft „Solidarnosc“, hatte sich eingeschlichen und ihre Sabotagearbeit begonnen. So gelang es den Gewerkschaftsanhängern um Walesa, die Forderungen umzukrempeln. Während anfangs ökonomische und politische Forderungen an oberster Stelle standen, rückte jetzt die Anerkennung der Gewerkschaften an die erste Stelle. Erst danach folgten ökonomische und politische Forderungen (2). Die altbekannte Taktik: Verteidigung der Gewerkschaften statt Verteidigung der Arbeiterinteressen.
Mit dem Ende der Bewegung war eine neue Gewerkschaft aus der Taufe gehoben worden, die die Schwächen der Arbeiterklasse voll auszuschlachten wusste.
Denn war es vorher eine Stärke der Arbeiter in Polen gewesen, sich der Tatsache bewusst zu sein, dass die offiziellen Gewerkschaften auf Staatsseite standen, meinten viele Arbeiter jetzt, dass die neu gegründete, 10 Mio. Mitglieder starke Gewerkschaft Solidarnosc nicht korrupt sei und unsere Interessen verteidige. Die Arbeiter in Polen hatten noch nicht die Erfahrung der Arbeiter im Westen mit „freien Gewerkschaften“ gemacht.
Als Walesa damals predigte: „Wir wollen ein zweites Japan aufbauen, Wohlstand für alle“, glaubten viele Arbeiter in Polen aus Unerfahrenheit mit den kapitalistischen Verhältnissen im Westen an solche Illusionen. So übernahm Solidarnosc und Walesa an der Spitze sehr schnell die Feuerwehrrolle. Denn als die Arbeiter begriffen, dass man jetzt zwar eine neue Gewerkschaft hatte, aber die wirtschaftliche Situation noch schlechter war als zuvor, und im Herbst 1980 unter anderem aus Protest über den Abschluss des Abkommens erneut in den Streik traten, da zeigte die neue Gewerkschaft bereits ihr wahres Gesicht. Schon wenig später wurde Lech Walesa im Armeehubschrauber durchs Land geflogen, um streikende Arbeiter zur Aufgabe zu bewegen: „Wir wollen keine weiteren Streiks, weil sie das Land in den Abgrund führen, wir brauchen Ruhe“.
Von Anfang an betrieb die Gewerkschaft Solidarnosc eine systematische Untergrabungsarbeit. Immer wieder entriss sie den Arbeitern die Initiative, hinderte sie daran, neue Streiks auszulösen. Die Massenstreikbewegung hatte im Sommer 1980 dieses ungeheure Ausmaß annehmen können, weil die polnische Bourgeoisie, wie die stalinistische Regierungen im Ostblock überhaupt, politisch schlecht ausgerüstet war, um der Arbeiterklasse anders als mit Repression entgegenzutreten. Im Westen erledigen die Gewerkschaften und die bürgerliche Demokratie diese Arbeit eines Auffangbeckens. Vor dem Hintergrund dieser politischen Rückständigkeit der dortigen Kapitalistenklasse sowie des Kalten Krieges kam der polnischen Bourgeoisie die neue Gewerkschaft äußerst suspekt vor. Aber nicht das subjektive Empfinden sollte den Ausschlag geben, sondern die objektive Rolle, die Solidarnosc gegen die Arbeiter spielte. So begann die stalinistische Regierung 1981 allmählich zu begreifen, dass trotz der Tatsache, dass Solidarnosc im stalinistischen Herrschaftssystem ein „Fremdkörper“ war, sie nützliche Dienste leistet. Das Kräfteverhältnis begann sich zu wandeln.
Im Dezember 1981 konnte die polnische Bourgeoisie dann die von ihr lange vorbereitete Repression durchführen. Die Solidarnosc hatte die Arbeiter politisch entwaffnet und damit ihre Niederlage möglich gemacht. Während im Sommer 1980 dank der Eigeninitiative der Arbeiter und der Ausdehnung ihrer Kämpfe - ohne eine Gewerkschaft an ihrer Seite - keinem Arbeiter ein Haar gekrümmt wurde, wurden im Dezember 1981 über 1200 Arbeiter ermordet, Tausende ins Gefängnis gesteckt und in die Flucht getrieben. Diese Repression fand nach intensiven Absprachen zwischen den Herrschenden in Ost und West statt.
Nach den Streiks im Sommer 1980 gewährte die westliche Bourgeoisie Solidarnosc alle mögliche „Aufbauhilfe“, um sie gegen die Arbeiter zu stärken. Es wurden Kampagnen wie „Pakete für Polen“ lanciert, Kredithilfen im Rahmen des Währungsfonds gewährt, damit niemand auf den Gedanken kam, dass die Arbeiter im Westen dem Weg der Arbeiter in Polen folgen und den Kampf in die eigenen Hände nehmen. Vor der Repression im Dezember 1981 wurden die Pläne der Niederschlagung zwischen den Regierungschefs direkt abgesprochen. Am 13. Dezember 1981, dem Tag des Beginns der Repression, saßen Helmut Schmidt (Sozialdemokrat) und Altstalinist Erich Honecker unweit von Berlin zusammen und wuschen ihre Hände in Unschuld. Dabei hatten sie nicht nur grünes Licht für die Repression gegeben, sondern auch ihre Erfahrung in diesen Fragen weitergegeben.
Im Sommer 1980 war es wegen des Absperrringes nicht möglich, dass die IKS in Polen selbst intervenierte. Ab September 1980 haben wir jedoch ein internationales Flugblatt zu den Massenstreiks in Polen in nahezu einem Dutzend Staaten verbreitet und mit Hilfe von Kontakten damals auch in Polen zirkulieren lassen. Bei nachfolgenden Interventionen der IKS in Polen kritisierten wir immer wieder die Illusionen der polnischen Arbeiter. Für uns als Revolutionäre galt es, sich nicht den Illusionen der Arbeiter zu beugen, sondern durch das Aufzeigen ihrer mangelnden Erfahrung mit den „radikalen“ Gewerkschaften, wie sie die Arbeiter im Westen gemacht hatten, die Arbeiter zu warnen. Auch wenn unsere Position zu den Gewerkschaften zunächst in Polen unpopulär war und wir in dieser Frage gegen den Strom schwammen, gab uns die Erfahrung letztendlich recht.
Ein Jahr später, im Dezember 1981, zeigte Solidarnosc, welche Niederlage der Arbeiter sie ermöglicht hatte! Nach dem Streikende 1980 war kein Winter vergangen, und schon war Solidarnosc zu einem staatstragenden Element geworden. Dass der ehemalige Führer Lech Walesa später gar Staatspräsident wurde, ist sicherlich nicht nur darauf zurückzuführen, dass er das Vertrauen von Kirche und westlichen Regierungen besaß, sondern auch weil er als Gewerkschaftsvertreter ein ausgezeichneter Verteidiger des Staates ist. Mittlerweile ist er genauso verhasst wie seinerzeit der stalinistische Oberhenker Gierek.
Wenn wir die positiven Lehren vom Sommer 1980 – Ausdehnung der Kämpfe, Selbstorganisierung des Massenstreiks - heute in Erinnerung rufen, dann weil wir auf deren heutige Gültigkeit hinweisen wollen. Auch wenn heute durch die Änderung der internationalen Lage ähnlich selbständige Massenstreiks in nächster Zeit nicht zu erwarten sind, müssen die Lehren aus dieser Bewegung der Arbeiterklasse wieder aufgegriffen werden und in die nächsten Kämpfe mit einfließen. Dav.
1) Auch wenn die Gründung einer „freien Gewerkschaft“ nur durch die Illusionen und Unerfahrenheit der Arbeiter in Polen selbst erklärt werden kann, steht außer Zweifel, dass die Organisationsbestrebungen seitens des KOR (eine teilweise pro-westliche Oppositionsgruppe) nur möglich waren wegen der Hilfestellung aus dem Westen für den systematischen Aufbau der Solidarnosc. Trotz der Gegnerschaft zwischen den beiden imperialistischen Blöcken gab es eine Einheit gegen die Arbeiterklasse.
(2) ‘Sicherheit der Streikenden, Freilassung aller politischen Häftlinge und der Arbeiter, die in Streiks von 1970/76 verurteilt worden waren, Veröffentlichung der Informationen des Streikkomitees, Zahlung der Löhne während des Streiks, Lohnerhöhungen, Inflationsausgleich, bessere Lebensmittelversorgung, Abschaffung der Privilegien für die Staatsbonzen, Herabsetzung des Rentenalters, Verbesserung der medizinischen Versorgung und mehr Kindergartenplätze, mehr Wohnungen, der Samstag soll arbeitsfrei werden, mehr Urlaub für Schichtdienstler’.
Leute:
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Polen 1980 [154]
- Masssenstreik Polen [155]
- Solidarnosc [156]
Ölpest am Golf von Mexiko: Der Kapitalismus – eine Katastrophe für die Natur und die Menschheit
- 2610 Aufrufe
Die jüngste Ölpest im Golf von Mexiko wirft ein grelles Licht auf die Rücksichtslosigkeit und den unglaublich nachlässigen und waghalsigen Umgang der Kapitalisten mit den Ressourcen der Natur.
Seit dem Untergang der Ölplattform "Deepwater Horizon" am 22. April, bei dem elf Arbeiter starben, strömen jeden Tag mindestens 800.000 Liter Rohöl in den Golf von Mexiko, verseuchen auf Hunderten von Kilometern die Küsten und hinterlassen einen riesigen Ölteppich im Golf von Mexiko selbst. Dabei kann niemand genau feststellen, wie viel Öl seit dem 22. April aus dem Leck ausströmt. (1) „Einen Monat nach dem Untergang der Bohrplattform ‚Deepwater Horizon‘ ist der Großteil des bisher ausgetretenen Öls unter Wasser geblieben. Bis zu 16 Kilometer lang, sechs Kilometer breit und hundert Meter hoch sind die (...) riesigen Ölschwaden unter der Oberfläche des Golfs von Mexiko.“ Durch den Einsatz von sogenannten Dispergatoren hat man verhindert, „dass ein Teil des Öls an Land geht. Das ist da, wo die größte Konzentration an Journalisten wartet“ (d.h. die größte Öffentlichkeit). (Chemikalien gegen die Ölkatastrophe. Operation Verschleiern und Verschieben, Spiegelonline, 18.05.2010).
Erste Ermittlungen haben ergeben, dass „die für die Aufsicht der Ölförderung verantwortliche Rohstoffbehörde MMS ohne genaue Sicherheits- und Umweltprüfungen Genehmigungen erteilt (…) Im konkreten Fall habe die MMS es unterlassen, den Blowout Preventer [zentrales Abstellventil] vor dem Einsatz auf Tauglichkeit zu prüfen (…) in einem entscheidenden Hydrauliksystem des tonnenschweren Bauteils habe es offenbar ein Leck gegeben. Außerdem sei ein Sicherheitstest wenige Stunden vor der Explosion fehlgeschlagen.“ www.spiegel.de/wissenschaft/natur/us-oelpest-schwere-sicherheitsmaengel-vor-explosion-der-oelplattform-a-694602.html [157] und https://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,694271,00.html [158]
Weitere Ermittlungen haben aufgezeigt, dass gar keine Absauganlagen entwickelt wurden, die austretendes Öl am Meeresboden auffangen könnten. Genauso wenig gibt es Möglichkeiten von Entlastungsbohrungen für solche Notfälle. Welche Haltung verbirgt das wohl, wenn man Ölvorkommen tief am Meeresboden anzapft, ohne überhaupt irgendwelche „Auffangmöglichkeiten“ zu haben und vorgesehene Schließeinrichtungen nicht funktionieren?
„Die 560 Millionen Dollar teure Ölplattform ‚Deepwater Horizon‘ etwa war eine der modernsten Bohrplattformen der Welt. Zwölf Meter hohen Wellen und Winden in Orkanstärke konnte sie trotzen.“(ebenda) Auf der einen Seite astronomische Produktionskosten für den Bau einer solchen Plattform (mehr als eine halbe Milliarde Dollar!) und 100 Millionen Euro Kosten für eine Bohrung, wie sie die Ölplattform zum Zeitpunkt des Unglücks vornahm, und auf der anderen Seite entweder gar nicht vorhandene oder nicht funktionierende Sicherheitssysteme für Notfälle unter Wasser - wie kann man so etwas erklären?
Profitjagd auf Kosten der Natur
Als die systematische Erdölförderung vor ca. 100 Jahren einsetzte, musste nur ein geringer finanzieller und technischer Aufwand betrieben werden, um die Ölquellen anzuzapfen. Mittlerweile, ein Jahrhundert später, stehen die Ölgesellschaften vor einer neuen Situation. „Ein großer Teil des globalen Erdöls wird aus Feldern gepumpt, die zum Teil bereits vor mehr als 60 Jahren ohne großen technologischen Aufwand gefunden wurden. Heute jedoch müssen die Prospektoren mit kostspieligen Methoden nach Feldern suchen, die an den unzugänglichen Standorten der Erde liegen - und die Ölmengen liefern, die früher als marginal angesehen wurden. (…) Vor allem den westlichen Unternehmen fehlt inzwischen weitgehend der Zugang zu den einfachen, billigen, aussichtsreichen Quellen in Asien und Lateinamerika. Diese nämlich befinden sich inzwischen alle in der Hand nationaler Ölgesellschaften. Sie heißen Saudi Aramco (Saudi-Arabien), Gazprom (Russland), NIOC (Iran) oder PDVSA (Venezuela) und stehen unter staatlicher Obhut. Sie sind die wahren Giganten im Geschäft; sie kontrollieren mehr als drei Viertel der globalen Reserven.
‘Big Oil‘, wie die alten privaten Konzerne noch immer genannt werden, kontrolliert gerade noch rund zehn Prozent der globalen Öl- und Gasreserven. BP und Co. bleiben nur die aufwendigen, teuren und gefährlichen Projekte. Aus der Not heraus stoßen die Konzerne zu den letzten Grenzen vor, zu Vorkommen, die sonst keiner anfassen mag. (…) Milliarden wurden von den Konzernen investiert, um in früher für undenkbar gehaltene Tiefen vorzudringen. Jede neue Explorationsmethode wird von der Industrie bejubelt, treibt sie doch jenen Zeitpunkt weiter hinaus, an dem der Ölfluss versiegen wird. (…) Rund 60 Milliarden Barrel Öl, so eine aktuelle Schätzung der US-Regierung, lagern unter dem Meeresgrund des Golfs von Mexiko. Das gigantische Vorkommen reicht aus, um Amerikas Wirtschaft, (…) fast für ein Jahrzehnt am Laufen zu halten. Erst Ende März hatte US-Präsident Obama verkündet, neue Seegebiete vor der Ostküste der USA, nördlich von Alaska und im östlichen Golf von Mexiko, für Offshore-Bohrungen freizugeben (…) Dass BP und andere Ölgesellschaften bei der Suche und Erschließung an die technologischen Grenzen gehen müssen, liegt daran, dass ihnen keine anderen Möglichkeiten mehr bleiben".
Immer höhere Kosten, immer größere Risiken
„Längst haben sich die Ölgesellschaften von Plattformen verabschiedet, die auf dem Meeresboden fest verankert sind. Schwimmende Monstren, sogenannte Halbtaucher, dümpeln auf den Ozeanen, unter sich Kilometer von Wasser. Steigleitungen aus Spezialstahl oder extrem festen Verbundwerkstoffen führen in die stockdunkle Tiefe. Normale Leitungen würden unter ihrem eigenen Gewicht zerbersten. In 1500 Meter Tiefe ist das Wasser fünf Grad kalt - das Öl jedoch kommt fast kochend aus dem Grund. Extreme Belastungen des Materials sind die Folge. Die Risiken sind beträchtlich. Mit der Tiefe vergrößern sich die technischen Anforderungen an die Bohrung enorm, Die Technik ist gefährlich: Beim Aushärten entstehen Risse im Zement, durch die Öl und Gas mit Urgewalt nach oben zischen können. Ein Funken reicht dann - und es kommt zur Explosion.“ (ebenda) …wie jetzt!
Fieberhaft kämpfen Zehntausende von Einsatzkräften bislang weitestgehend vergeblich darum, das Öl von weiteren Stränden fernzuhalten. Flugzeuge vom Typ Lockheed C-130 versprühten Tonnen des Chemikaliengemischs Corexit, das den Ölteppich auflösen soll - und das selbst im Verdacht steht, die maritime Lebenswelt zu schädigen. Langfristig können also durch die chemischen Rettungsmaßnahmen durchaus noch größere, unabsehbare Schäden entstehen(2). Die wirtschaftlichen Folgen für die Bevölkerung vor Ort sind aber schon jetzt katastrophal, weil viele Fischer in den Ruin getrieben werden.
Während der Wettlauf um die Erschließung neuer Ölquellen immer höhere Investitionen erfordert, müssen gleichzeitig immer größere technische Wagnisse eingegangen werden. Die kapitalistischen Konkurrenzbedingungen treiben die Rivalen dazu, immer mehr zu riskieren und immer weniger Rücksicht auf die Bedürfnisse der Natur zu nehmen. Schmelzende Polkappen und die damit frei werdenden Nordwest-Passage sowie das auftauende Eis in den Permafrostzonen haben schon seit langem den Appetit der Ölgesellschaften geweckt und zu Spannungen zwischen Ländern geführt, die Gebietsansprüche in der Region erheben.
Während die grenzenlose Verwendung von nicht erneuerbaren, fossilen Energiequellen wie Öl im Grunde ohnehin die reinste Verschwendung und die permanente Suche nach neuen Ölquellen eine reine Absurdität ist, treibt die Wirtschaftskrise und der mit ihr verbundene Konkurrenzkampf die Unternehmen dazu, immer weniger Geld für mögliche und erforderliche Sicherheitssysteme aufzubringen. Das System plündert immer waghalsiger, rücksichtsloser und räuberischer die Ressourcen des Planeten aus. War es seit jeher eine gängige Kriegsmethode, die Politik der „verbrannten“ Erde zu praktizieren, die z.B. auch von den USA im ersten Golfkrieg 1991 eingesetzt wurde, als sie Ölförderanlagen am Persischen Golf in Brand schossen und Unmengen von Öl ausliefen bzw. riesige Brände verursachten, bewirkt der alltägliche Druck der Krise nun, dass man billigend „verbrannte Erde“ und verpestete Meere in Kauf nimmt, um seine ökonomischen Interessen durchzusetzen.
Die jetzige Ölpest war vorhersehbar – genau wie die Katastrophe von 2005, als Hurrikan Katrina die Stadt New Orleans überflutete und ca. 1800 Menschen in den Tod riss, als eine ganze Stadt evakuiert, Hunderttausende umgesiedelt werden mussten. So wie die Katastrophe von New Orleans ein Ergebnis der Unfähigkeit des Kapitalismus war, für ausreichenden Schutz vor den Gefahren der Natur zu sorgen, ist die jetzige Ölpest das Ergebnis kapitalistischen Profitstrebens.
USA und Haiti – zwei Gesichter des gleichen Systems
Innerhalb kurzer Zeit sind der Golf von Mexiko und die Karibik Schauplatz gewaltiger Katastrophen geworden. Reiner Zufall?
Als die Erde unter der Karibikinsel Haiti bebte und mehr als 200.000 Menschen den Tod fanden, 300.000 Menschen verletzt und 1.5 Mio. Menschen obdachlos wurden, wurde offensichtlich, dass die Menschen Opfer einer unglaublich nachlässigen Baupolitik geworden waren (s. frühere Artikel auf unserer Webseite). Dass das chronisch verarmte, seit langem von Rückständigkeit geplagte Haiti zum Friedhof für so viele Menschen wurde, erscheint leicht nachvollziehbar. Aber ist es ein Zufall, dass die Umweltkatastrophe im Golf von Mexiko eines der technisch höchst entwickelten Länder, die USA, trifft?
In der Golfregion und der Karibik kommen in Wirklichkeit himmelschreiende Gegensätze und Widersprüche zum Vorschein, die ein typischer Ausdruck eines niedergehenden Systems sind. Sowohl das Schicksal der Menschen im bettelarmen Haiti (wie auch z.B. das Leiden der Opfer im vom Drogenkrieg geplagten Mexiko) als auch die Lage in den USA zeigt, in welches Stadium diese Gesellschaft eingetreten ist.
Einerseits melden immer mehr US-Bundesstaaten Bankrott an (s. Artikel auf unserer Webseite zu den Studentenprotesten in den USA), immer mehr Menschen hausen in Zeltstädten. Andererseits verkündet die US-Regierung mit Stolz: „Das erste Raumschiff der US-Luftwaffe hat seine Feuertaufe bestanden: Am frühen Freitagmorgen [23. April, ein Tag nach dem Beginn der Ölpest] ) startete das geheimnisumwobene Space Plane erfolgreich zu seinem Testflug im All. Vom militärischen Teil des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral im Bundesstaat Florida wurde das unbemannte Mini-Shuttle von einer Atlas-V-Rakete in den Orbit befördert. Der unbemannte Weltraumgleiter X-37-B wurde in den vergangenen zehn Jahren unter strengster Geheimhaltung entwickelt (…) Eine naheliegende und mehrfach geäußerte Vermutung ist, dass die X-37-B als Weltraumdrohne zum Einsatz kommen könnte, um strategisch wichtige Ziele überall auf der Welt aufzuklären.“
Während man sich erhofft, damit Gefahren für die Sicherheit der USA aus der Luft aufzuspüren, lässt man die Kräfte weitestgehend frei walten, die unbehindert von oder gar mit Zustimmung und Wohlwollen seitens der US-Behörden die gefährlichsten und bedrohlichsten Eingriffe an der Natur vornehmen, dabei Menschenleben fahrlässig gefährden und, wie jetzt bei den Ölbohrungen, eine auf Jahre hinaus vergiftete Natur hinterlassen.
Die Prioritäten dieses verfaulenden, am Militarismus erkrankten Systems sind klar: Man investiert 35 Milliarden Euro in 180 neue Tankflugzeuge, die u.a. Bomber und andere Massenvernichtungsflugzeuge auftanken sollen, man befördert 30.000 US-Soldaten mit Riesenaufwand durch sieben Länder über Tausende von Kilometern vom Irak nach Afghanistan, damit sie dort weiter wüten können… aber gleichzeitig landen immer mehr Obdachlose auf der Straße, verkommen immer mehr Stadtviertel, verfällt die Infrastruktur und kämpfen immer mehr Menschen ums Überleben. Der Gegensatz zwischen dem, was möglich wäre - eine Gesellschaft, die nicht auf Profit basiert, sondern auf der Bedürfnisbefriedigung der Menschen -, und der grausigen Wirklichkeit im Kapitalismus könnte nicht eklatanter sein. Jeder Tag, den die kapitalistische Produktionsweise die Menschheit weiter im Würgegriff hält, ist ein Tag zu viel. Dv. 18.05.2010
(1) An der Unglücksstelle liefen nach ersten Angaben täglich etwa 1.000 Barrel [159] (160.000 Liter) Rohöl ins Meer. Einige Tage später wurden die Schätzungen durch die Entdeckung eines dritten Lecks auf eine Austrittsmenge von etwa 5.000 Barrel (etwa 800.000 Liter) pro Tag korrigiert. Neuere Berechnungen verschiedener Forscher, die auf Unterwasservideos der Lecks beruhen, liefern eine Austrittsmenge von mindestens 50.000 Barrel (etwa 8 Millionen Liter) täglich.
(2) Bisher sind 1.8 Millionen Liter der Spezialflüssigkeit Corexit im Golf von Mexiko eingesetzt worden... Es besteht die Gefahr dass ein Teil der unterirdischen Ölschwaden in Richtung des offenen Atlantik getragen wird.
Aktuelles und Laufendes:
- Umweltverschmutzung [160]
- Ölpest Golf von Mexiko [161]
- Deepwater Horizon [162]
- Kapitalismus Umweltverschmutzung [163]
- Katrina 2005 [164]
- Haiti Erdbeben [165]
Weltrevolution Nr.161
- 2696 Aufrufe
Das Ende der Konjunkturprogramme und die Rückkehr der Depression
- 2515 Aufrufe
(leicht gekürzter Artikel aus unserer International Review Nr. 142 – 3. Quartal 2010)
Der Ausbruch der Finanzkrise 2008 hatte zu einem Produktionsrückgang in den meisten Ländern der Welt geführt (und hauptsächlich zu einer Verlangsamung in China und Indien). Um diesem Phänomen entgegenzutreten, hatten die Herrschenden in den meisten Ländern Konjunkturprogramme verabschiedet, wobei die Chinas und der USA am umfangreichsten waren. Nachdem diese Konjunkturpakete einen teilweisen Anschub der weltwirtschaftlichen Aktivitäten und eine Stabilisierung der Wirtschaft der am meisten entwickelten Länder bewirken konnten, sind die Auswirkungen auf die Nachfrage, die Produktion und den Handel dabei zu verpuffen.
Trotz der Propaganda über den Aufschwung, der in Gang gekommen sei, sind die Herrschenden nunmehr gezwungen einzugestehen, dass die Dinge sich nicht in diese Richtung entwickeln. [Die Wachstumsprognosen werden nach unten korrigiert] In den USA und in Europa nehmen die Investitionen ab, was darauf schließen lässt, dass die Unternehmen selbst mit keiner anziehenden Produktion rechnen. […] Auch der Baltic Dry Index, welcher die Entwicklung des Welthandels misst, zeigt nach unten.
Staatsbankrotte…
Immer mehr Staaten haben Schwierigkeiten, ihre Zinszahlungen für ihre Schulden zu erfüllen.
Aber die Zinszahlungen sind eine unabdingbare Bedingung dafür, dass die großen Banken weiterhin Kredite vergeben. Jedoch sind die PIIGs nicht die einzigen Staaten mit wachsender Verschuldung. Die Ratingagenturen haben auch ausdrücklich gedroht, Großbritannien herabzustufen und es in die Reihe der PIIGs einzuordnen, falls das Land keine großen Anstrengungen zur Reduzierung seiner öffentlichen Schulden unternähme. Auch Japan (das in den 1990er Jahren als ein Land gehandelt wurde, das die USA als wirtschaftlich führende Macht überholen könnte) hat ein öffentliches Verschuldungsniveau erreicht, das der zweifachen Summe seines BIP entspricht (5). Diese Liste, die wir noch verlängern könnten, zeigt, dass die Tendenz zur Zahlungsunfähigkeit der Staaten eine weltweite Tendenz ist, weil alle Staaten von der Zuspitzung der Krise seit 2007 betroffen sind und auch vor ähnlichen Gleichgewichtsstörungen wie in Griechenland oder Portugal stehen.
Aber nicht nur Staaten nähern sich der Zahlungsunfähigkeit. Das Bankensystem ist auch immer mehr aufgrund folgender Faktoren gefährdet:
- Alle Spezialisten wissen und sagen, dass die Banken ihre „giftigen Produkte“ nicht wirklich „entsorgen“ konnten, die Ende 2008 zum Bankrott zahlreicher Finanzinstitute geführt hatten ;
- trotz dieser Schwierigkeiten haben die Banken aber nicht aufgehört auf den Weltfinanzmärkten mit dem Kauf von Hochrisikoprodukten zu spekulieren. Im Gegenteil, sie mussten damit fortfahren, um zu versuchen, die massiv eingefahrenen Verluste auszugleichen;
- die Zuspitzung der Krise seit Ende 2007 hat zu zahlreichen Firmenpleiten geführt, so dass viele arbeitslos gewordene Beschäftigte ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.
Ein Beispiel hierzu gab es neulich am 22. Mai, als die Caja Sur in Spanien vom Staat übernommen werden musste. Aber dieses Beispiel ist nur die Spitze des Eisberges der Schwierigkeiten der Banken in der letzten Zeit. Andere Banken in Europa wurden von Ratingagenturen heruntergestuft (Caja Madrid in Spanien, BNP in Frankreich), aber vor allem hat die EZB die Finanzwelt darüber informiert, dass die europäischen Banken in den nächsten beiden Jahren ihre Aktiva um 195 Milliarden senken müssten, und dass der geschätzte Kapitalbedarf bis 2012 auf 800 Mrd. Euro ansteigen werde. Ein anderes Ereignis der letzten Zeit wirft ebenso ein krasses Licht auf die gegenwärtige Zerbrechlichkeit des Bankensystems: Siemens hat beschlossen, eine eigene Bank aufzubauen. D.h. eine Bank, die nur Siemens und seinen Kunden zu Diensten stünde. Nachdem Siemens schon bei der Lehman Brothers Pleite ca. 140 Millionen Dollar hat abschreiben müssen, hat der Konzern Angst, dass sich Ähnliches wiederholen könnte mit seinem Guthaben bei anderen « klassischen » Banken. Andere Firmen wie Veolia, das mit British American Tobacco und anderen Firmen zusammenarbeitet, hatten schon im Januar 2010 den gleichen Schritt vollzogen (6). Es ist klar, wenn Firmen, deren Solidität im Augenblick nicht infrage gestellt wird, ihre Gelder nicht mehr den großen Banken anvertrauen, wird deren Lage sich nicht verbessern. [166]
Die Divergenzen unter den Staaten hinsichtlich der einzuschlagenden Politik [166]
Welche Perspektiven ? [166]
Fußnoten: [166]
Aktuelles und Laufendes:
- Wirtschaftskrise [167]
- Staatsbankrott [44]
- Handelskrieg [53]
- Finanzkrise [168]
- Schuldenkrise [169]
Historische Ereignisse:
- Krise 1929 [170]
Der russische Imperialismus kämpft verzweifelt um die Kontrolle in seinem Einflussgebiet
- 3765 Aufrufe
Spektakuläre Neuigkeiten konnte man der Presse entnehmen: eine Annäherung der neuen ukrainischen Regierung Janukowitsch an Russland und der Abschluss eines Vertrages, der die russische Truppenpräsenz in der Ukraine auf lange Zeit sichern soll; ein Vertrag Moskaus mit Ankara zum Bau eines russischen Kernkraftwerks in Akkuyu in der Südtürkei; die enthusiastische Reise Medwedews nach Syrien im Mai, und all die Berichte, dass der Sturz der Regierung von Bakijew in Kirgistan zum großen Vorteil Moskaus sei. All dies hat den Eindruck hinterlassen der russische Imperialismus gewinne unaufhaltsam an Terrain. Doch entspricht dies der Wirklichkeit?
Zweifellos befindet sich Russland nicht mehr in derselben geschwächten Situation wie in den 1990er Jahren. Damals verlor Russland die meisten seiner ehemaligen Satellitenstaaten und erlebte nach 1989 auch im Inneren eine Periode der unkontrollierten Mafiapolitik unter der Jelzin-Regierung. Der russische Staat war damals gezwungen, als Priorität die Situation in Russland selbst sowie die Außenpolitik wieder unter eine einheitliche Disziplin des Staates zu bringen. Die Wahl Putins und seiner Gefolgschaft im Jahre 2000 war ein klares Zeichen für die Straffung der staatlichen Autorität und die Einführung einer gezielteren imperialistischen Politik gegen Außen.
Doch lassen diese Anstrengungen der russischen Bourgeoisie die Schlussfolgerung zu, der russische Imperialismus befinde sich auf einem gradlinigen Weg zum Erfolg? Nein, denn in Tat und Wahrheit steckt Russland heute in einem verzweifelten Kampf gegen die Destabilisierung und das Chaos im Gebiet des ehemaligen Ostblocks. Der Kontrollverlust ist heute ein generelles Phänomen, unter dem vor allem die USA als „Weltpolizist“ leidet. Doch es ist für Russland, das nach wie vor größte Ambitionen auf die Rolle des Platzhirsches in seiner Region hat, heute nicht möglich, von der Schwächung der USA dauerhaft zu profitieren. Der russische Imperialismus kann sich dieser internationalen Tendenz des Kontrollverlustes mitnichten entziehen.
Kirgistan: Die Ausweitung des unkontrollierbaren Chaos
Auf den ersten Blick und oberflächlich betrachtet erschien der Regierungswechsel in Kirgistan im April 2010 als Erfolg für den russischen Imperialismus. Die Regierungsclique um Bakijew hatte ihr abgegebenes Versprechen gegenüber Russland, die amerikanische Truppenbasis im Lande zu schließen, nicht eingehalten. Der Gedanke lag auf der Hand, dass die neue Regierung um Otunbajewa mit der direkten Unterstützung Russlands an die Macht befördert wurde, um sich am wortbrüchigen Bakijew zu rächen. Doch die Situation in Kirgistan ist nicht dermaßen simpel. Sie lässt sich nicht auf einen Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse reduzieren, welche entweder von Russland oder von den USA gestützt werden - ein Szenario, das im Kalten Krieg bei den meisten Konflikten in der Dritten Welt anzutreffen war. Es ist falsch zu glauben, dass der Rauswurf der Bakijew-Regierung Russland handfeste und dauerhafte Vorteile bringt oder sich die Situation gar stabilisiert.
In Kirgisien findet heute eine gefährliche Ausweitung des Chaos mit undurchschaubaren Zusammenstößen verschiedener nationaler Cliquen statt. Der russische Imperialismus ist in der jetzigen Situation alles andere als der große Sieger. Durch die blutigen Unruhen im Süden Kirgistans, in der Region von Djalalabad und Och, entfaltet sich eine offene Instabilität vor den Toren Russlands. Und das in einem Grenzgebiet zu China, einer international immer aggressiver und selbstbewusster auftretenden imperialistischen Macht. Kirgistan ist schon seit geraumer Zeit Dreh- und Angelpunkt für den chinesischen Warenimport in die Länder der GUS, den traditionellen Wirtschaftsraum Russlands. Doch auch wenn Russland und China harte Rivalen sind im Kampf um Einfluss in Kirgistan, so haben sie dort heute vor allem eine große gemeinsame Sorge: das Zittern der herrschenden Klasse in beiden Ländern vor einem Überschwappen unkontrollierbarer regionaler Konflikte, die mit ethnischen Pogromen begleitet sind, auf ihre eigenen Vielvölkerstaaten Russland und China. Der russische und chinesische Imperialismus sind alles Andere als Friedenstifter, doch in Kirgistan überwiegt ihre Angst, dass das Chaos auch in ihrem eigenen Land Schule macht, der Politik des gegenseitigen offenen Unruhe Stiftens. Und ohne Zweifel werden auch die USA eine Gefährdung ihrer militärischen Präsenz in Kirgistan nicht akzeptieren! Für die USA ist Kirgistan vor allem aus militärischen Gründen wichtig, und viel weniger ökonomisch, um einen gesicherten Kriegsstützpunkt Richtung Irak und Afghanistan zu haben.
Da es in Kirgistan heute keine geeinte herrschende Klasse gibt, ist dieses Land fast unmöglich zu regieren und stellt ein tragisches Beispiel für den Kontrollverlust dar, den die großen imperialistischen Staaten fürchten. Die mörderischen Ereignisse in Och im Juni haben auch gezeigt, wie heikel die Situation gerade für Russland ist. Von der Regierung Otunbajewa aufgefordert, militärisch zu intervenieren, um das Chaos einzudämmen, konnte Russland nur zögernd ablehnen und Medwedews Furcht, in ein zweites Afghanistan-Abenteuer zu geraten, war offensichtlich. Unabhängig davon, welche nationale Clique in Kirgistan an der Macht ist, stellt für das krisengeschüttelte Russland ein tatkräftiges Engagement in Kirgistan, das mit enormen Kosten verbunden ist, fast eine Unmöglichkeit dar, und es wird so immer schwieriger für den russischen Imperialismus, seine Interessen zu verteidigen. Russlands Politik zur Verteidigung seiner Rolle als regionaler Gendarm wird auch aktiv von anderen Nachbarn sabotiert. Es ist kein Zufall, dass eine imperialistische Hyäne kleineren Zuschnittes wie die weissrussische Regierung Lukaschenkos sofort Öl ins Feuer goss, indem sie Bakijew Asyl in Minsk anbot.
Die Wahlen in der Ukraine: Ein grosser Sieg für Russland?
Zweifellos haben die Wahlen in der Ukraine vom Februar 2010 mit Janukowitsch eine Fraktion der herrschenden Klasse an die Macht gebracht, welche deutlich offener gegenüber Russland eingestellt ist, als ihre Vorgänger. Kurz nach den Wahlen, im April, hat die Ukraine einen Vertrag mit Russland abgeschlossen, der Russland die Truppenpräsenz ihres Hafen-Stützpunktes Sebastopol auf der Krim-Halbinsel bis ins Jahr 2042 garantiert. Im Gegenzug liefert Russland der Ukraine bis ins Jahr 2019 Erdgas zu bedeutend günstigeren Preisen als in die EU. Im Juni hat die Ukraine bekannt gegeben, dass die NATO-Beitrittspläne welche, von der alten Regierung Juschtschenko eingefädelt worden waren, gestoppt werden. Dennoch sind die Beziehungen Russlands zur Ukraine alles andere als glänzend. Sie zeigen vielmehr das Dilemma, in dem sich der russische Imperialismus befindet.
Die Ukraine ist zwar enorm von der Krise betroffen und auf sofortige finanzielle Erleichterungen angewiesen. Doch die herrschende Klasse der Ukraine wirft sich nicht einfach Hals über Kopf in die Arme des großen russischen Bruders, und schon gar nicht für alle Ewigkeiten. Russland muss sich die temporäre Gunst der Regierung Janukowitsch mit milliardenschweren Preissenkungen für Gaslieferungen erkaufen, alles nur, um seine Truppenpräsenz nicht zu verlieren. Doch die wirklichen Ambitionen und Notwendigkeiten für den russischen Imperialismus gegenüber der Ukraine reichen viel weiter als der Vertrag, der mit der neuen ukrainischen Regierung abgeschlossen wurde, welcher für Russland lediglich den status quo sichert. Geografisch stellt die Ukraine den wohl wichtigsten Verbindungsweg für russisches Erdgas nach Westeuropa dar, ein Handel von, dem die russische Ökonomie enorm abhängt. Um den Transportengpass Ukraine (und Weißrussland) zu umgehen, ist Russland gezwungen, gigantisch teure Pipelineprojekte zu realisieren, wie „Northstream“ durch die Ostsee.
Für Russland ist eine dauerhafte stabile Beziehung zu der Ukraine ein absolutes Muss, und zwar nicht nur auf der ökonomischen Ebene der Gaslieferwege, sondern vielmehr noch aus geostrategischen Gründen zur militärischen Absicherung. Doch die Ukraine mit ihrer zerstrittenen herrschenden Klasse ist kein stabiler imperialistischer Partner, auf den man sich verlassen kann. Wenn die Clique um Timoschenko wieder an die Macht gelangt, werden erneute Abgrenzungsmanöver gegen Russland nicht lange auf sich warten lassen. Für die ukrainische Bourgeoisie, die grundlegend von ihren eigenen nationalen Interessen getrieben ist, hat der gegenwärtige Schwenker hin zu Russland nichts mit einer tiefen Bruderschaft mit Russland zu tun. Die Schwäche der EU (die damit als Perspektive in die Ferne gerückt ist), die ökonomischen Zwänge und die schnelle Jagt nach billiger Energie, drängt die herrschende Klasse in der Ukraine einen Kurs zu fahren, der für die heutige Phase der imperialistischen Beziehungen typisch ist: fast karikaturartig hin und her schwankend, instabil und komplett dominiert vom Gesetz des „Jeder gegen Jeden“.
Nach dem Georgienkrieg: keinerlei Stabilität im Kaukasus
Selbst wenn Russlands Armee im Krieg 2008 gegen Georgien geografisches Terrain gewonnen hat und nun die Gebiete von Südossetien und Abchasien kontrolliert, und auch wenn die im Irak und Afghanistan kläglich in der Tinte steckende USA ihrem georgischen Schützling damals nicht zu Hilfe Eilen konnte, so hat sich für Russland die Situation auch m Kaukasus alles andere als beruhigt. Russland kann von der Schwäche der USA nicht wirklich profitieren. Der Krieg im Kaukasus 2008 stellte vor allem den Beginn einer neuen Etappe in den imperialistischen Konfrontationen dar. Das erste Mal seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 standen sich die USA und Russland wieder in einem offenen Konflikt gegenüber, zwar nicht direkt mit Truppen aber als Hauptdrahtzieher.
Der Krieg in Georgien hat aber auch klar gezeigt, dass es in der heutigen Phase des Kapitalismus falsch ist zu glauben, dass aus einem Krieg automatisch ein Sieger und ein Verlierer hervorgehen. Dieser Krieg hat schlussendlich nur Verlierer hervorgebracht! Und dies nicht lediglich auf der Seite der Arbeiterklasse (welche in jeder militärischen Konfrontation auf allen Seiten immer der Verlierer ist!), sondern auch vom Standpunkt der beteiligten imperialistischen Staaten. Georgien ist deutlich geschwächt worden, die USA haben in der Region an Einfluss eingebüßt und vor allem ihr Prestige als „big brother“, auf den man zählen kann, verloren und Russland ist heute im Kaukasus mit einem zugespitzten Chaos konfrontiert, das es nicht mehr eindämmen kann.
In vielen Regionen im Kaukasus, die offiziell zum russischen Staatsgebiet gehören, wie Dagestan oder Iguschetien, spielen die Streitkräfte und die Polizei des russischen Staates heute vielmehr die Rolle einer Besatzungsmacht als diejenige eines verwurzelten Staatsapparates. Sie treten in einer enorm brutalen Form auf, sind jedoch machtlos gegen die verschiedensten lokalen Clans und schüren damit das Feuer noch mehr. Über die Notwendigkeit der Verteidigung strategischer und unmittelbarer ökonomischer Interessen hinaus, beinhaltet das aggressive Auftreten des russischen Imperialismus auch eine historische Dimension. Aus einer Geschichte der permanenten Expansion seit den Zeiten des Zarismus im 18. Jahrhundert hervorgegangen, ist Russland heute in ein reduziertes geografisches Korsett gezwängt, welches die russische Bourgeoisie nicht akzeptieren kann. Die Attentate vom Mai 2010 in unmittelbarer Nähe des Hauptquartiers des russischen Geheimdienstes in Moskau und später in der Stadt Stavropol zeigten auf, wie direkt die Autorität des russischen Staates durch diese Terrorakte in Frage gestellt wird. Die darauf folgenden Bemühungen, den Handlungsspielraum des russischen Geheimdienstes FSB gesetzlich zu erweitern, sind kein Zeichen der Stärke, sondern vielmehr der Angst der russischen Regierung, welche der Situation nur mit mehr Repression Herr zu werden versucht.
Die gesamte Situation im nördlichen Kaukasus, in dem sich Russland in einem fast offenen Krieg auf eigenem Staatsgebiet befindet – also in einer Situation des Kontrollverlustes und der ständigen Gefahr der Ausbreitung in andere Gebiet im eigenen Land, in denen lokale Cliquen nur auf ein Signal warten – beinhaltet eine Dynamik, die Russland zusehends schwächt. Russland befindet sich damit in einer Lage, welche seine anderen großen imperialistischen Rivalen wie die USA und Deutschland so nicht kennen und China bisher nur in einem geringen Masse. Selbst wenn sich der russische Imperialismus mit allen Mitteln bemüht, sein historisches Tief nach dem Zusammenbruch des stalinistischen Ostblocks wieder wett zu machen, so bleiben die zentrifugalen Tendenzen in seinem Einflussgebiet Gebiet bestehen und werden zusehends stärker. Das Einflussgebiet Russlands ist ein tragisches Beispiel für die Sackgasse und die Irrationalität des Kapitalismus. Auch wenn sich die herrschende Klasse bis an die Zähne bewaffnet, ihre eigene Welt kann sie nicht mehr wirklich kontrollieren.
Mario 29.6.2010
Aktuelles und Laufendes:
- russischer Imperialismus [171]
- Unruhen Kirgisistan [172]
- Wahlen Ukraine [173]
- Krieg Georgien [174]
Die Folgen der Wiedervereinigung für den deutschen Imperialismus
- 3072 Aufrufe
Als sich in den Monaten zwischen November 1989 und Oktober 1990 die Wiedervereinigung beider deutscher Staaten immer deutlicher abzeichnete, stieß dies auf heftigen Widerstand seitens des französischen und britischen Imperialismus. Von François Mitterand, damaliger französischer Staatspräsident, ist der Satz überliefert, dass er Deutschland so sehr liebe, dass er gern zwei davon habe. Der britische Imperialismus unter Maggie Thatcher drückte sich weniger charmant aus: Dort betrachtete man in Helmut Kohl, dem „Einheitskanzler“, bereits die Reinkarnation Adolf Hitlers. Beide Staaten fürchteten sich vor einem wiedererstarkten „Großdeutschland“, das allein durch seine schiere Größe zu übermächtig werden könnte. Und in der Tat schien zunächst einiges auf die Wiedergeburt des deutschen Großmachtdenken hinzudeuten. Kaum wiedervereinigt, begann der deutsche Imperialismus an seine alten Ambitionen auf dem Balkan anzuknüpfen. Er unterstützte offen die sezessionistischen Absichten Sloweniens und vor allem Kroatiens, wo er schon seit Mitte der achtziger Jahre heimlich Kontakte zu Ustascha-Nationalisten um Franjo Tudjman geknüpft hatte. Als sich dann Anfang der neunziger Jahre zunächst Slowenien und Kroatien von Jugoslawien abspalteten, warf die Kohl-Genscher-Regierung ihr ganzes Gewicht in die Waagschale, um die Anerkennung dieser neuen Staaten durch die Europäische Gemeinschaft durchzusetzen. Dabei griff sie auch zum Mittel der Erpressung, indem sie sich sträubende EG-Mitgliedsländer wie Frankreich offen drohte, im Falle einer Nichtanerkennung der neuen Ordnung auf dem Balkan das Maastricht-Abkommen zu torpedieren.
Die realpolitischen Machtgrenzen des deutschen Imperialismus
Doch der Höhenflug des deutschen Imperialismus auf dem Balkan war nur von kurzer Dauer. Bereits der Verlauf des Jugoslawien-Krieges, der sich an der Abspaltung der drei genannten Republiken anschloss, zeigte deutlich die politischen und militärischen Grenzen des deutschen Imperialismus auf. Weder war er im Stande, das Miloşevic-Regime mitsamt seinen 5. Kolonnen in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und im Kosovo in die Schranken zu weisen; noch war er in der Lage, Frankreich und Großbritannien zu neutralisieren, die traditionell gute Beziehungen zu den Serben pflegten und keinesfalls gewillt waren, sich vom deutschen Imperialismus die Butter vom Brot nehmen zu lassen. So musste er mit ansehen, wie die nationalen Bestandteile „Friedenstruppen“ der Europäischen Gemeinschaft ihre jeweiligen Verbündeten vor Ort unterstützten, und damit die deutschen Absichten in der Region auf heftigste zu durchkreuzen versuchten. Ohne jegliches „hartes“ Mandat[1] versehen, so dass der Bürgerkrieg in Jugoslawien nicht einmal im Ansatz eingedämmt werden konnte, machten sie sich sogar zu Komplizen des Völkermordes.[2] Es war nicht der deutsche Imperialismus, der den Widerstand des Miloşevic-Regimes letztendlich brach, sondern die US-amerikanische Supermacht. In den folgenden Jahren wurde die ambitionierte deutsche Bourgeoisie endgültig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Es gelang ihr nicht, den Ausbruch des ersten Golfkrieges zu verhindern; sie musste sich gar, von den USA dazu genötigt, mit vielen Milliarden von einer eigenen militärischen Beteiligung freikaufen. Ihr Vorhaben, die Europäische Gemeinschaft in eine politische Union unter ihrer Führung umzuwandeln, erwies sich als völliger Fehlschlag; allen voran die britische Bourgeoisie obstruierte erfolgreich jeden dahingehenden Versuch. Ihre „strategischen“ Partner, ob Frankreich oder Russland, erwiesen sich als zu sehr auf ihre eigenen Interessen bedacht, um mit Deutschland einen dauerhaften Gegenpol zur US-Übermacht und gegen die sich ausbreitende Tendenz des Jeder-gegen-Jeden zu bilden.
So bleibt denn dem deutschen Imperialismus heute nichts anderes übrig, als kleinere Brötchen zu backen. Die Befürchtungen Mitterands und Thatchers, so legitim sie historisch auch waren, haben sich als unrealistisch und überzogen herausgestellt. Sicherlich, das Ende des Kalten Krieges hat der deutschen Bourgeoisie nach fast 45 Jahren alliierter Besetzung und eiserner Blockdisziplin gegenüber den Anführern der beiden Blöcke, USA und UdSSR, die uneingeschränkte nationale Souveränität zurückgegeben. Doch der deutsche Imperialismus zahlt auch einen hohen Preis für die Wiedervereinigung. Noch immer verschlingt der „Aufbau Ost“ Milliardengelder und bindet damit einen großen Teil der Staatsfinanzen. Gelder, die an anderer Stelle fehlen bzw. eingespart werden. Neben dem Sozialstaat, der – wie schon geschildert – weitestgehend entkernt wurde, entpuppte sich vor allem das Militär als Hauptleidtragender dieser Unwucht im deutschen Staatshaushalt. Der Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee, die den Erfordernissen des Kalten Krieges, sprich: der Erwartung eines Militärschlages seitens des Warschauer Paktes entsprochen hatte, zu einer Interventionsstreitkraft, die weltweit operieren kann, ist bis dato nur in Ansätzen vollzogen. Es fehlt an allem: Transportkapazitäten, mit denen Truppen und Ausrüstung binnen 24 Stunden an jeden Ort der Erde befördert werden können; moderne Waffensysteme in Armee, Marine und Luftwaffe; eine satellitengestützte Infrastruktur, mit der das deutsche Militär ohne die „gütige“ Hilfe des US-Militärs seine Truppen überall auf der Welt in Echtzeit steuern kann. Die Bundeswehr zehrt von ihrer Substanz; ehrgeizige Rüstungsvorhaben wie der Eurofighter oder der Airbus-Militärtransporter mussten mangels finanzieller Unterstützung massiv abgespeckt werden. Verglichen mit den US-Rüstungsausgaben nimmt sich der „Verteidigungs“etat der Bundesrepublik wie Peanuts aus.
Um jedoch einen ernst zu nehmenden Gegenpol, einen ebenbürtigen Block gegen die militärische Übermacht des US-Imperialismus zu bilden, reichen diplomatische Winkelzüge und Nadelstiche, wie sie die Politik der deutschen Bourgeoisie derzeit kennzeichnen, nicht aus. Diese können bestenfalls den Unilateralismus der USA aushöhlen und führen allenfalls zu temporären Koalitionen mit anderen Mittelmächten gegen die US-Supermacht. Um an seiner historischen Rolle als Hauptrivale der USA anzuknüpfen, müsste der deutsche Imperialismus ein geradezu gigantisches Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr auflegen. Nicht nur, um den USA militärisch Paroli zu bieten, sondern auch, um einen militärischen Schutzschirm zu spannen, unter dem er seine Vasallenstaaten zu einem Block sammeln kann. Doch davon ist der deutsche Imperialismus Lichtjahre entfernt. Und dies auf unabsehbare Zeit. Auf dem politischen Terrain steht die Arbeiterklasse einer Wiedergeburt des deutschen Militarismus im Weg. Und auf finanziellem Gebiet die Wiedervereinigung: Zwar hat sie der deutschen Bourgeoisie, die zurzeit des Kalten Krieges ökonomisch ein Riese, politisch aber ein Zwerg war, mehr politisches Gewicht in der Kakophonie des internationalen Imperialismus verliehen. Doch gleichzeitig verhindert sie bzw. ihre immensen Kosten den Wiederaufstieg des deutschen Imperialismus zum Hauptrivalen des US-Imperialismus, der er in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war.
Aktuelles und Laufendes:
Die Kommunistische Linke und internationalistischer Anarchismus: Was wir gemeinsam haben
- 5890 Aufrufe
Seit ungefähr drei Jahren haben einige einzelne Anarchisten oder anarchistische Gruppen und die IKS einige Hürden überwunden, indem sie angefangen haben, offen und brüderlich miteinander zu diskutieren. Die von vornherein bestehende Gleichgültigkeit oder eine systematische gegenseitige Verwerfung sind einem Willen zur Diskussion gewichen, einem Willen, die Position des jeweils anderen zu verstehen und ehrlich die Punkte der Übereinstimmung und Differenzen zu erfassen.
In Mexiko hat diese neue Geisteshaltung die gemeinsame Herausgabe eines Flugblattes ermöglicht, das von zwei anarchistischen Gruppen (GSL und PAM) (1)) und einer Linkskommunistischen Gruppe (der IKS) unterzeichnet wurde. In Frankreich hat jüngst die CNT-AIT aus Toulouse die IKS dazu eingeladen, ein Einleitungsreferat auf einer ihrer öffentlichen Veranstaltungen zu halten (2). In Deutschland hat man auch angefangen, Verbindungen miteinander aufzunehmen.
Auf der Grundlage dieser Dynamik hat die IKS versucht, die Frage des Internationalismus innerhalb der anarchistischen Bewegung vertieft zu untersuchen. Im Jahre 2009 haben wir eine Artikelreihe „Die Anarchisten und der Krieg“ veröffentlicht (3). Unser Ziel bestand darin zu zeigen, dass es bei jedem imperialistischen Konflikt einem Teil der Anarchisten gelungen war, die Falle des Nationalismus zu vermeiden und den proletarischen Internationalismus hochzuhalten. Wir zeigten auf, dass diese Genoss/Innen es geschafft hatten, weiterhin für die Revolution und im Interesse des internationalen Proletariats zu wirken, währen um sie herum die kriegerische Barbarei und Chauvinismus tobten.
Wenn man die Bedeutung versteht, welche die IKS dem Internationalismus als Grenze zwischen den Revolutionären beimisst, die wirklich für die Befreiung der Menschheit eintreten, und denjenigen, die den Kampf des Proletariats verraten, kann man sehen, dass diese Artikel offensichtlich nicht nur eine gnadenlose Kritik an den kriegsbefürwortenden Anarchisten waren, sondern auch und vor allem eine Unterstützung für die internationalistischen Anarchisten!
Doch ist diese Absicht nicht richtig verstanden worden. Die Artikelserie hat sogar zeitweise eine gewisse Abkühlung aufkommen lassen. Einerseits haben Anarchisten dahinter einen Pauschalangriff gegen deren Bewegung gesehen. Andererseits haben Sympathisanten der Linkskommunisten und der IKS nicht unsere Absicht verstanden, dass wir auf die „Anarchisten zugehen“ wollen (4).
Abgesehen von einigen ungeschickten Formulierungen in unseren Artikeln, welche dazu führten, dass manche eine ablehnende, sich „sperrende“ Haltung einnahmen (5), haben diese scheinbar widersprüchlichen Kritiken in Wirklichkeit die gleiche Wurzel. Sie verdeutlichen die Schwierigkeit, über die Divergenzen hinweg die wesentlichen Punkte zu erkennen, die die Revolutionäre einander näherbringen.
Über die Etiketten hinaus!
Diejenigen, die sich auf den Kampf für Revolution berufen, werden traditionell in zwei Kategorien eingeteilt: die Marxisten und die Anarchisten. Tatsächlich gibt es zwischen beiden sehr große, sie trennende Divergenzen:
- Zentralisierung – Förderalismus;
- Materialismus – Idealismus;
- „Übergangsperiode“ zwischen Kapitalismus und Kommunismus oder „unmittelbare Abschaffung des Staates“;
- Anerkennung oder Verwerfung der Oktoberrevolution 1917 und der Bolschewistischen Partei.
- …
All diese Fragen sind in der Tat sehr wichtig. Wir dürfen diesen Fragen nicht ausweichen, müssen sie offen diskutieren. Aber aus der Sicht der IKS entstehen damit keine „zwei Lager“. Unsere Organisation, die sich als marxistisch bezeichnet, kämpft für die Sache des Proletariats Seite an Seite mit internationalistischen anarchistischen Militanten und auch gegen die „Kommunistischen“ und maoistischen Parteien (die sich auch als marxistisch bezeichnen). Warum?
Innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft gibt es zwei grundsätzliche Lager: das der Herrschenden und das der Arbeiterklasse. Wir verwerfen und bekämpfen all die politischen Organisationen, die für die Seite der Herrschenden eintreten. Wir diskutieren, manchmal hitzig aber immer brüderlich, mit allen Angehörigen des Lagers der Arbeiterklasse und versuchen mit ihnen zusammenzuarbeiten. Aber unter der gleichen „marxistischen“ Etikette verbergen sich richtige bürgerliche und reaktionäre Organisationen. Auch hinter dem Label „anarchistisch“ gibt es solche Organisationen.
Es handelt sich hier nicht um reine Rhetorik. Die Geschichte liefert uns eine Vielzahl von Beispielen von „marxistischen“ oder „anarchistischen“ Organisationen, die die Hand zum Schwur erheben, um zu sagen, dass sie die Sache des Proletariats verteidigen, um ihm nur besser in den Rücken zu fallen. Die deutsche Sozialdemokratie behauptete 1919 von sich „marxistisch“ zu sein, während sie gleichzeitig Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und Tausende Arbeiter ermorden ließ. Die stalinistischen Parteien haben 1953 in Berlin und 1956 in Ungarn die Arbeiteraufstände im Blut erstickt; all das geschah im Namen des „Kommunismus“ und des „Marxismus“ (in Wirklichkeit aber erfolgte dies im Interesse des imperialistischen Blockes, der von der UdSSR angeführt wurde). 1937 haben in Spanien Führer der CNT durch ihre Regierungsbeteiligung den stalinistischen Henkern Rückendeckung geliefert, die Tausende anarchistischer Revolutionäre blutig niedergeworfen und massakriert haben. Heute wirken in der „CNT“ in Frankreich zwei anarchistische Organisationen; eine, welche echt revolutionäre Positionen vertritt (CNT-AIT) und eine andere, welche rein „reformistische“ und reaktionäre (CNT Vignoles) vertritt (6).
Die « falschen Freunde » aufzuspüren, die sich hinter diesen „Etiketten“ verstecken, ist also lebenswichtig.
Aber man darf nicht den gleichen Fehler in der entgegen gesetzten Richtung begehen und meinen, man sei alleine auf der Welt und man vertrete als einziger die „revolutionäre Wahrheit“. Die kommunistischen Militanten sind heute zahlenmäßig sehr klein und es gibt nichts Verhängnisvolleres als die Isolierung. Deshalb muss man auch gegen die noch zu starke Tendenz der Verteidigung seiner „Kapelle“, „seiner Familie“ (ob anarchistisch oder marxistisch) antreten und auch gegen eine kleinkrämerische Haltung angehen, die nichts mit dem Lager der Arbeiterklasse zu tun hat. Revolutionäre stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Auch wenn die Divergenzen noch so tiefgreifend sind, sie sind eine Quelle der Bereicherung für das Bewusstsein der ganzen Arbeiterklasse, wenn sie offen und aufrichtig diskutiert werden. Deshalb ist es absolut unerlässlich, Verbindungen und Debatten auf internationaler Ebene aufzubauen.
Aber dazu ist es auch erforderlich, zwischen den Revolutionären (welche die Perspektive der Umwälzung des Kapitalismus durch das Proletariat befürworten) und den Reaktionären (die auf die eine oder andere Art zur Aufrechterhaltung des Systems beitragen) zu unterscheiden, ohne sich durch Etiketten wie „Marxismus“ oder „Anarchismus“ vernebeln zu lassen.
Was Marxisten und internationalistische Anarchisten verbindet
Aus der Sicht der IKS gibt es grundlegende Kriterien, die bürgerliche von proletarischen Organisationen trennen.
Den Kampf der Arbeiterklasse gegen den Kapitalismus zu unterstützen, bedeutet, sowohl unmittelbar gegen die Ausbeutung zu kämpfen (z.B. durch Streiks) als auch nie die historische Dimension dieses Kampfes aus den Augen zu verlieren – die Überwindung dieses Ausbeutungssystems durch die Revolution. Deshalb darf eine solche Organisation nie (auch nicht auf „kritische“ oder „taktische“ Weise) einen Teil der Herrschenden unterstützen – weder die „demokratischen“ gegen die „faschistischen“ Machthaber, noch die Linken gegen die Rechten, auch nicht palästinensische gegen israelische Herrscher usw. Eine solche Politik hat zwei konkrete Folgen:
1) Man muss jede Unterstützung für Wahlen, für eine Zusammenarbeit mit den Parteien, verwerfen, welche das kapitalistische System verwalten oder verteidigen (Sozialidemokratie, Stalinismus, „Chavismus“, usw.);
2) Vor allem in Kriegen muss man einen unnachgiebigen Internationalismus aufrechterhalten und sich weigern, die eine oder andere Seite der Kriegsparteien zu unterstützen. Während des 1. Weltkriegs wie auch während all der imperialistischen Kriege im 20. Jahrhundert haben all die Organisationen, welche eine der Kriegsparteien unterstützen wollten, den Boden des Internationalismus aufgegeben, damit die Arbeiterklasse verraten. Sie sind damit übergetreten ins Lager der Bürgerlichen (7).
Diese hier sehr zusammengerafften Kriterien sind ein Anhaltspunkt dafür, warum die IKS einige Anarchisten als Mitkämpfer/Innen betrachtet und mit ihnen diskutieren und zusammenarbeiten will, während wir gleichzeitig andere anarchistische Organisationen heftig verwerfen und anprangern.
So arbeiten wir beispielsweise mit der KRAS (der anarcho-syndikalistischen Sektion der AIT in Russland) zusammen; veröffentlichen und begrüßen deren internationalistischen Positionen gegenüber dem Krieg, insbesondere gegenüber dem Tschetschenienkrieg. Die IKS betrachtet diese Anarchisten ungeachtet der zwischen ihnen und uns sonst bestehenden Divergenzen als dem Lager der Arbeiterklasse angehörend. Sie heben sich klar von all diesen Anarchisten und „Kommunisten“ (wie denen der „Kommunistischen“ Parteien oder Maoisten oder Trotzkisten) ab, die in der Theorie den Internationalismus für sich beanspruchen, ihn in der Praxis aber bekämpfen, indem sie in jedem Krieg irgendeine Seite gegen die andere unterstützen. Man darf nicht vergessen, dass 1914, zur Zeit des Ausbruchs des 1. Weltkriegs, und 1917, zur Zeit der Russischen Revolution, die meisten „Marxisten“ der Sozialdemokratie auf die Seite der Bürgerlichen gegen die Arbeiterklasse gewechselt waren, während die spanische CNT damals den imperialistischen Krieg anprangerte und die Revolution unterstützte! In revolutionären Bewegungen nach dem Ersten Weltkrieg kämpften die Anarchisten und die Marxisten, welche aufrichtig für die Sache der Arbeiterklasse eintraten, Seite an Seite – ungeachtet anderer Divergenzen untereinander. Damals gab es sogar Anläufe zur Zusammenarbeit auf größerer Ebene zwischen den revolutionären Marxisten (den Bolschewiki, den deutschen Spartakisten, den holländischen Tribunisten, den italienischen Abstentionisten usw.), welche sich von der niedergehenden Zweiten Internationale gelöst hatten, und zahlreichen Gruppen, die sich auf den internationalistischen Anarchismus beriefen. Ein Beispiel dieses Prozesses ist die Tatsache, dass eine Organisation wie die CNT die Möglichkeit ins Auge gefasst hatte – auch wenn sie letztendlich verworfen wurde – der Dritten Internationale beizutreten (8).
Und um ein jüngeres Beispiel aufzugreifen: An vielen Orten auf der Welt gibt es heute gegenüber der Entwicklung der Lage anarchistische Gruppen und Sektionen der AIT, die nicht nur eine internationalistische Position aufrechterhalten sondern auch für die Autonomie des Proletariats gegenüber all den Ideologien und allen Strömungen der Herrschenden eintreten:
- Diese Anarchisten treten für den direkten und massive Kampf sowie für die Selbstorganisierung in Vollversammlungen und in Arbeiterräten ein;
- Sie verwerfen jede Beteiligung am Wahlzirkus und jede Unterstützung sich daran beteiligender politischer Parteien, auch wenn sie sich noch so „fortschrittlich“ ausgeben
Mit anderen Worten, sie stützen sich auf eines der Prinzipien, das von der Ersten Internationale ausgerufen worden war: „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss die Tat der Arbeiter selbst sein“. Damit beteiligen sie sich am Kampf für die Revolution und die Errichtung einer menschlichen Gemeinschaft.
Die IKS gehört dem gleichen Lager an wie diese internationalistischen Anarchisten, die wirklich die Arbeiterautonomie verteidigen! Ja, wir betrachten sie als Genoss/Innen, mit denen wir diskutieren und zusammenarbeiten wollen. Ja, wir denken ebenso, dass diese anarchistischen Militanten viel mehr mit den Linkskommunisten gemeinsam haben als mit denjenigen, die zwar ein anarchistisches Label tragen, aber in Wirklichkeit nationalistische oder „reformistische“ Positionen vertreten und die tatsächlich Verteidiger des Kapitalismus, der Reaktionäre sind!
In der sich nun langsam entfaltenden Debatte zwischen all den Leuten oder internationalistischen Gruppen der Welt werden unvermeidlich Fehler begangen; ebenso wird wie es hitzige und wortreiche Debatten, ungeschickte Formulierungen, Missverständnisse - und echte Divergenzen geben. Aber die Bedürfnisse des Kampfes der Arbeiterklasse gegen einen immer unausstehlicheren und barbarischeren Kapitalismus, die unabdingbare Perspektive der proletarischen Weltrevolution, die eine Vorbedingung für das Überleben der Menschheit und des Planeten ist, verlangen diese Anstrengungen. Es handelt sich hierbei um eine Pflicht. Und nachdem heute neue revolutionäre proletarische Minderheiten in vielen Ländern auftauchen, die sich entweder auf den Marxismus oder den Anarchismus berufen (oder die gegenüber beiden offen sind), muss dieser Aufgabe der Debatte und Zusammenarbeit entschlossen und enthusiastisch nachgegangen werden. IKS (Juni 2010)
Die nächsten Artikel dieser Serie werden sich mit folgenden Fragen befassen:
Zu unseren Schwierigkeiten zu diskutieren und die Mittel zur Überwindung dieser Schwierigkeiten
Wie die Debatte fördern?
1. GSL: Grupo Socialista Libertario (https://webgsl.wordpress.com/ [176]). PAM: Proyecto Anarquista Metropolitano (proyectoanarquistametropolitano.blogspot.com).
2. Ein sehr warmherzige Diskussionsatmosphäre war während des ganzen Treffens zu spüren. Siehe dazu unseren Bericht „Réunion CNT-AIT de Toulouse du 15 avril 2010 : vers la constitution d’un creuset de réflexion dans le milieu internationaliste [177]”.
3. “Les anarchistes et la guerre (I) [178]” (RI no 402), [179] “La participation des anarchistes à la Seconde Guerre mondiale (II) [180]” (RI no 403), [181]“De la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui [182] (III)” (RI no 404 [183]), “L’internationalisme, une question cruciale [184] (IV)” (RI no 405 [185]). “Die Anarchisten und der Krieg,I, Weltrevolution, “Die Beteiligung der Anarchisten am Zweiten Weltkrieg II, „Vom Zweiten Weltkrieg bis heute, III“, „Der Internationalismus, eine Schlüsselfrage, IV“ (siehe die Webseite der IKS auf deutsch)
4. Insbesondere waren diese Genoss/Innen anfänglich irritiert und verwundert über die Erstellung eines gemeinsamen Flugblattes zwischen GSL-PAM-IKS. Wir haben übrigens auf unserer spanischen Webseite unsere Herangehensweise zu erklären versucht. „Was ist unsere Methode gegenüber Genoss/Innen, die sich auf den Anarchismus berufen?“ (https://es.internationalism.org/node/2715 [186])
5. Einige Genossen haben zu recht gewisse ungeschickte oder ungenaue Formulierungen oder auch gar historische Fehler hervorgehoben. Wir werden später darauf zurückkommen. Wir wollen aber jetzt schon zwei der gröbsten Fehler korrigieren:
– Mehrfach wird in der Artikelserie „Die Anarchisten und der Krieg“ behauptet, dass die Mehrheit der anarchistischen Bewegung im Ersten Weltkrieg dem Nationalismus verfallen sei, während nur eine kleine Minderheit unter Lebensgefahr eine internationalistische Position vertreten habe.
Die von den Mitgliedern der AIT in der Debatte seitdem vorgebrachten historischen Fakten, die durch unsere eigenen Recherchen bestätigt wurden, belegen, dass in Wirklichkeit ein großer Teil der Anarchisten sich schon von 1914 an gegen den Krieg gewandt hat (manchmal im Namen des Internationalismus oder des Anationalismus, öfter noch im Namen des Pazifismus).
- Einer der störendsten (und bislang von niemandem aufgegriffenen) Fehler in diesem Artikel betrifft den Aufstand in Barcelona im Mai 1937. Wir schrieben in dem Artikel: „Die Anarchisten wurden zu Komplizen bei der Unterdrückung der Volksfront und der Regierung von Katalonien.“ In Wirklichkeit waren es die Mitglieder der CNT oder der FAI, die den Großteil der aufständischen Arbeiter stellten, welche zu den Hauptopfern der von den stalinistischen Banden organisierten Repression wurden. Es wäre zutreffender gewesen, die Zusammenarbeit bei diesem Massaker durch die Führung der CNT anzuprangern, anstatt „Anarchisten“ schlechthin. Dies ist übrigens der Kern unserer Positionen gegenüber dem Spanienkrieg, wie sie auch im Artikel von „BILAN“ in „Lehren aus den Ereignissen in Spanien“ Nr. 36, November 1936, BILAN, entwickelt werden.
6. “Vignoles” ist der Name der Straße, wo ihr Hauptsitz liegt.
7. Einzelpersonen oder Gruppen haben sich jedoch aus Organisationen lösen können, die vorher ins bürgerliche Lager übergewechselt waren, wie beispielsweise die Tendenz Munis oder jene, die in der trotzkistischen “Vierten Internationale” “Socialisme ou Barbarie” hervorbrachten.
8. Siehe “Histoire du mouvement ouvrier: la CNT face à la guerre et à la révolution (1914-1919) [187]”, zweiter Artikel einer Artikelreihe zur Geschichte der CNT in Revue internationale Nr. 129.
Aktuelles und Laufendes:
- Anarchosyndikalismus [188]
- Anarchismus Krieg [189]
- Internationalismus Anarchismus [190]
Politische Strömungen und Verweise:
Kommentar der IKS zu: "Am Anfang war eine informelle Arbeiterpartei..."
- 2978 Aufrufe
Wir veröffentlichen an dieser Stelle ein Diskussionspapier, Ausdruck des derzeitigen politischen Lebens in den Betrieben Norditaliens. Die hier wiedergegebenen Anmerkungen sind von einigen Arbeitern der INNSE diskutiert und überarbeitet worden. Die GenossInnen reagieren auf die Erfahrungen des dort lange geführten Kampfes, versuchen daraus, allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen und sie in eine internationale Debatte zu stellen. In Italien, Deutschland und woanders werden sie auch von politisierten Minderheiten besonders in den Betrieben diskutiert. Genosse Riga aus Hamburg hat u.a. die IKS dazu aufgefordert, zu einer möglichst umfangreichen Verbreitung des Papiers beizutragen. Wir kommen dieser Aufforderung gerne nach, umso lieber, da der Text bereits eine Reihe von Kommentaren und eine Debatte auf unserer Webseite hervorgerufen hat. En gros wurde der INNSE-Beitrag durch diese Kommentare zwar begrüßt. Dennoch fiel die Reaktion mehrheitlich eher negativ aus. Das Papier aus Italien enthalte nichts Neues, heißt es beispielsweise dort, huldige dem alten Kult des Industriearbeiters, des blue collar workers, stelle eine Neuauflage des Operaismus minus Lenin dar usw. (siehe die Kommentare dazu auf unserer Webseite). Tatsächlich gibt es einiges in dem Text „Am Anfang war eine informelle Arbeiterpartei“, was klärungsbedürftig erscheint – und das ist gut so. So wird beispielsweise die Fabrik als ein Gebiet verstanden, „das von der Politik verlassen ist“, und somit als die vornehmste Wirkungsstätte der „informellen Arbeiterpartei“ erscheint. Aus unserer Sicht lässt man hierbei außer Betracht, dass insbesondere die Gewerkschaften im Auftrag des kapitalistischen Staates gerade in den Betrieben wirksam sind.
Die Wichtigkeit der aufgeworfenen Fragen
Es lohnt sich also, diesen Text zur Debatte zu stellen. Dabei sollte man ihn sorgfältig lesen und versuchen zu vermeiden, voreilige Schlüsse daraus zu ziehen. So ist es unserer Meinung nach gar nicht so sicher, dass hier ein Kult der Arbeiter im Blaumann betrieben wird, jedenfalls spricht er von der Fabrik „oder irgendeinem Arbeitsplatz“, und will alle Politisierten willkommen heißen, welche sich für die Sache des Proletariats einsetzen (allerdings werden die Erwerbslosen im Text nicht erwähnt). Ein Kult der Verherrlichung des Arbeiters wäre in der Tat fatal. Andererseits stimmen wir dem Text zu, wenn es heißt, dass es „ohne das Auftreten der Arbeiter keine echte Alternative zu diesem System gibt“.
Vor allem aber sollte man einen Text nicht allein daran messen, ob und in wie fern er neue Antworten liefert. Es ist oft viel wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen. Und in diesem Text finden wir zwei Fragen aufgeworfen, welche nicht nur sehr wichtig, sondern auch von höchster Aktualität sind: Erstens, wie entstehen Massenkämpfe der Arbeiterklasse, und zweitens, wie entsteht eine Klassenpartei des Proletariats?
Was die erste Frage betrifft, gibt es in der Regel zwei Antworten darauf, welche einander zumeist gegenübergestellt werden: Entweder die Massenkämpfe entstehen spontan, oder sie sind das Werk einer Partei. Was lehrt uns aber die Geschichte? Sie lehrt uns, dass die großen Kämpfe der Klasse, und erst recht die revolutionären Erhebungen, spontan ausbrechen, und dabei fast immer alle Beteiligten, einschließlich die ArbeiterInnen selbst, einschließlich ihrer revolutionären Minderheiten überraschen. Sie lehrt uns aber auch, und genauso, dass zwar der Ausbruch und die unmittelbare Organisationsform urwüchsig entstehen, dass aber die Bewegung selbst keineswegs ein spontanes Produkt der Geschichte ist, sondern politisch vorbereitet wird. Die Pariser Kommune, der Massenstreik von 1905 in Russland, die Revolutionen in Russland 1917 und Deutschland 1918 konnten gerade deshalb so elementar ausbrechen, weil sich lange zuvor eine politische Kultur in den Reihen der Arbeiter entwickelt hat. Ausdruck dieser politischen Kultur waren die Proudhonisten und die Blanquisten usw. in Paris, die Entstehung der Arbeiterzirkel und das Wirken der Sozialdemokratie in Russland vor 1905, die Arbeit von Spartakus, der Bremer Linken, die Obleute in Deutschland während des Kriegs (und der marxistischen Linken in der Sozialdemokratie vor dem Krieg) usw. Die politischen Arbeiterparteien und Gruppen waren in den Betrieben präsent, ihre jeweilige Positionen wurden dort diskutiert, mit einander verglichen.
Was die zweite Frage betrifft, so finden wir, dass die Formulierung „informelle Arbeiterpartei“, welche im Text verwendet wird, nicht sehr glücklich getroffen ist. Für uns kann man erst dann von einer Arbeiterpartei reden, wenn es ein Gebilde gibt, welches unmittelbar den Ausgang der Klassenkämpfe nicht nur beeinflussen, sondern sogar mit entscheidend prägen kann. Davon sind wir heute noch meilenweit entfernt. Somit wäre es aus unserer Sicht besser, von der Vorbereitung einer künftigen Klassenpartei zu sprechen. Ansonsten läuft man Gefahr, Opfer eines eigenen Bluffs zu werden bzw. an einer der unzähligen „linken“ Betriebsorganisationen zu basteln, welche von den Gewerkschaften aufgesogen werden.
Klassenautonomie und Politisierung
Wenn man aber die Sache in den Rahmen einer politischen Vorbereitung stellt, so hat der INNSE Text eine entscheidende Frage ausgeworfen! Sowohl für die Entwicklung künftiger Massenkämpfe als auch für die Vorbereitung einer Klassenpartei ist es unbedingt erforderlich, dass eine Schicht von hoch politisierten ArbeiterInnen innerhalb (und auch außerhalb) der Betriebe entsteht. „Können heute die Arbeiter keine derartige politische Schicht mehr hervorbringen? Sind sie nicht mehr in der Lage, Kämpfer für ihre Sache hervorzubringen?“ Warum sind diese Fragen so wichtig? In den beiden Jahrzehnten nach den internationalen Klassenkampfexplosionen von 1968-1972 hat das Proletariat zwar elementar erkannt, dass die einst zur Klasse gehörenden Organisationen wie die Gewerkschaften, die Sozialdemokratie, die Kommunistische Parteien, der Sache der ArbeiterInnen nicht mehr dienen, aber sie haben sich deren Einflusses zu erwehren versucht, indem sie sich eine a-politische bis anti-politische Haltung zu eigen machten. Diese Art und Weise, die eigene Klassenautonomie zu bewahren, erwies sich aber als Sackgasse, ja als Boomerang. Denn die Autonomie der Klasse ist nicht denkbar ohne eine eigene Politik, ohne eine eigene Vision vom Endziel und ohne entsprechende Mittel des Kampfes. Außerdem wussten die linken Aktivisten, welche eine klassenfremde Politik betrieben und für eine Reform des Kapitalismus, für Moskau oder Peking schwärmten, sehr wohl, wie sie ihre eigenen Aktivitäten tarnen, ihnen einen nicht politischen Anstrich geben könnten. So zerrann am Ende ein Großteil der Energien der Generation von 1968. Vor allem gelang es nicht, eine eigene politische Alternative zum Kapitalismus – auch gegenüber seiner stalinistischen Variante – zu formulieren. So brach denn auch der Stalinismus am Ende in sich zusammen, anstatt dass er vom Proletariat gestürzt wurde, was die Herrschenden auszunutzen versuchten, um die Frage der Überwindung des Kapitalismus ad acta zu legen.
Wie gesagt: die meisten Kommentare auf unserer Webseite beklagten im Text der INNSE- GenossInnen das Fehlen von etwas Neuem. Aber es gibt etwas Neues, was nicht so sehr in diesem oder jenem Textbeitrag liegt, sondern in der historischen Lage selbst. Das Neue besteht darin, dass kämpferische Minderheiten sich bilden, welche branchenübergreifend und international Solidarität entwickeln und dabei Kontakte suchen und die Lehren aus ihren Kämpfen austauschen und auswerten. Sie versuchen also zu „politisieren“, und zwar auf einer Klassengrundlage. Dieser Vorgang ist wesentlich dafür, eine eigene Klassenidentität zurückzuerobern, um dem eigenen Abwehrkampf Sprengkraft zu verleihen, um eine eigene gesellschaftliche Perspektive zu entwickeln. Dabei müsste eine der vornehmsten Aufgaben der politisierten Schichten darin bestehen, sich allenthalben dafür einzusetzen, dass die Klasse selbst ihr Schicksal in die eigenen Hände nimmt und zu diesem Zweck die Diskussionen, Vollversammlungen, die Kämpfe insgesamt usw. in Eigenregie führt. Sonst droht auch diesen Ansätzen die Gefahr, gewerkschaftlich aufgesogen zu werden. Daher ist es so wichtig, dass diese Arbeit „nicht geografisch, lokal oder national begrenzt ist“ wie es im Text heißt. Ja, es handelt sich um die Aktivität von kleinen Minderheiten, natürlich. Aber diese Aktivitäten können der Vorbote sein von etwas, was unter der Oberfläche in der Klasse insgesamt sich zu rühren beginnt: Der berühmte „alte Maulwurf“, von dem Marx sprach, die unterirdische Bewusstseinsreifung des Proletariats.
Text aus Italien
Am Anfang war eine informelle Arbeiterpartei...
Sich als Arbeiter zu organisieren und als solche zu handeln, ist bereits ein Programm. Sobald die Arbeiter sich als solche zusammenschliessen und einen Ausweg aus ihrer prekären gesellschaftlichen Lage suchen, finden sie schon bei der Suche die Mittel und Wege, um diesen Ausweg in die Tat umzusetzen. Sie brauchen kein fertiges Programm, bis in alle Einzelheiten ausgearbeitet, mit einer Liste von Forderungen, halbwegs zwischen grossspurigen Zielen und kleinen, vergänglichen Ergebnissen.
Diese Partei richtet sich auf einem Gebiet ein, das nicht geografisch, lokal oder national begrenzt ist: Es ist ein gesellschaftliches Territorium, auf dem sie ihre Kraft entfaltet. Die Fabrik oder irgendein Arbeitsplatz, wo es eine Arbeitergemeinschaft gibt, das ist das Gebiet der Arbeiterpartei. Dort muss ein unerbittlicher Kampf gegen die politischen Parteien der andern Klassen geführt werden. Der politische Einfluss auf die Arbeiter kommt von ausserhalb dieses Gebiets; die politischen Parteien beinflussen die Arbeiter zu Hause, am Wohnort, als Einwohner, als Staatsbürger unter Staatsbürgern; die Arbeiterpartei hat ein Gebiet zur Verfügung, das von der Politik verlassen ist. Bei der Teilung der Macht obliegt es dem Unternehmer, seine Leute direkt zu verwalten; es wird keine Einmischung geduldet, die Produktion ist heilig. Die Arbeiterpartei kann diesem Umstand zu ihren Gunsten aus-nutzen, die Arbeitergemeinschaft kann diesen Hohlraum ausfüllen, indem sie zu einer unabhängigen und eigen-ständigen Art von politischem Handeln findet.
Die Arbeiterpartei führt den Widerstand der Arbeiter über die versöhnlerische Gewerkschaftspolitik hin-aus. Die alte Gewerkschaftspolitik des kleineren Übels („Lieber den Spatz in der Hand...“) wird von der Wirtschaftskrise überrannt, die den Arbeitern nicht einmal mehr das „kleinere Übel“ gewährt, sondern sie mit weniger als Nichts dastehen lässt. Statt aus der Wirtschaftskrise – als Beweis für den Bankrott der auf dem Profit aufge-bauten Produktionsweise – Kraft zu schöpfen, verständigen sich die eingespielten Gewerkschaftsführer darauf, mit sozialen Abfederungen das Elend der Arbeiter zu verwalten, in der Erwartung, dass der Sturm vorübergehe. Gesetzt den Fall, dass das Unwetter nicht so schnell vorbeigeht und dass die Überwindung der Krise unerträgliche Opfer verlangt, so dass die Arbeiter im Widerstand gegen die Auswirkungen der Krise zur Überzeugung gelangen, dass die Zeit für diese Art von Produktion und Austausch abgelaufen ist und dass sie überwunden werden muss, in welche Richtung und auf welche Perspektiven hin müssen wir uns dann bewegen? Wird es dann nicht vielleicht die Aufgabe der informellen Arbeiterpartei sein, mit der Ausarbeitung von Antworten zu beginnen?
Die Tatsache, dass namhafte Teile der Arbeiter den klassischen parlamentarischen Parteien fremd gegen-über stehen, zeigt sich auf alle Arten. Nicht so sehr in der Stimmenthaltung, die eine zahlenmässig bedeutende Erscheinung ist, als vor allem in der Militanz, im konkreten Beitrag zur Unterstützung dieses oder jenes politischen Vorhabens. Die Parteien, die wir kennen, fischen ihre Führungsgruppen und Mitglieder aus den andern Klassen, sie sind Ausdruck von andern gesellschaftlichen Klassen. An der aktiven Mitgliederbasis der Parteien, die sich als Parteien der Arbeiter (“dei lavoratori”) bezeichnen, finden wir bestenfalls Lehrer, Angestellte, Techniker, aber nie Arbeiter. Die Arbeiter hingegen, seit sie auf dem Schauplatz der Gesellschaft aufgetaucht sind, haben Organisatoren, Agitatoren und Propagandisten hervorgebracht, welche Parteien mit grossen Mitteln und grosser finanzieller Unterstützung in den Sack gesteckt haben. Können heute die Arbeiter keine derartige politische Schicht mehr her-vorbringen? Sind sie nicht mehr in der Lage, Kämpfer für ihre Sache hervorzubringen? Diese Möglichkeit zu verneinen, kommt andern gelegen, nicht uns selber; es kommt darauf an, für welche Partei man sich einsetzen soll, für welche Partei zu kämpfen man anfangen soll, und eine Möglichkeit ist heute gegeben: Man kann Mitstreiter und Organisator für eine Partei werden, die unser ist, für eine Arbeiterpartei, oder wenigstens die ersten Schritte in diese Richtung tun. Die Programme und Organisationsformen werden wir miteinander finden, wenn wir uns allmählich als Klasse und damit als unabhängige politische Partei zusammenschliessen.
Am Anfang soll jeder bleiben, wo er ist, und weiterhin mit den politischen Formationen sympathisieren, mit denen er will, sich an den Aktivitäten von Komitees, autonomen Zentren, dieser oder jener Basisgewerkschaft beteiligen. Die informelle Arbeiterpartei verlangt keine Glaubensbekenntnisse, als vielmehr dass man damit beginne, als Arbeiter zu denken und zu handeln, zu allen Fragen, die uns direkt betreffen, einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten und zu vertreten. Die grosse Krise hat den Nebel aufgelöst, der den Interessengegensatz, auf dem diese Gesellschaft aufgebaut ist, verschleiert hatte: Wo ist die produktive Arbeit von Millionen Arbeitern all dieser Jahre verschwunden? In den Taschen der Unternehmer, in den Kassenschränken der Banken, in den goldenen Gehältern der Staatsbeamten. Den Arbeitern blieben die Brosamen -und heute das Elend. Es ist zum Lachen, mit welcher Frechheit sie von allen, uns eingeschlossen, verlangen, gemeinsam Opfer zu bringen um die Krise zu überwinden. Die Krise jedoch ist die Krise ihres Systems. Es ist ihre Art, aus unserer Arbeit Reichtum anzuhäufen, die an einem bestimmten Punkt in sich zusammengefallen ist. Und nun sollten wir wie kopflose Lämmer uns bereit erklären, weitere Opfer zu bringen, damit sie sich noch mehr bereichern können, bis dann eine neue, noch erschütterndere Krise auf uns wartet? Heissen wir die grosse Krise willkommen! Die sozialen Revolutionen reifen dort heran, wo die alten wirtschaftlichen Strukturen nicht mehr in der Lage sind, ihren Ablauf von Kapitalanhäufung fortzusetzen. Die Arbeiterrebellion ist heute zu einer realen Möglichkeit geworden. Die direkt produktive Arbeit der Arbeiter kann für eine andere Gesellschaftsordnung ohne Unternehmer, Banker und gut bezahlte Staatsbeamte verwendet werden, sie kann den Arbeitern selber dienen.
Wir haben keine Zeit, die Kapitalbesitzer werden an einem bestimmten Punkt darauf angewiesen sein, die Befehlsgewalt über die Gesellschaft zu zentralisieren, die Beziehungen zwischen den Klassen neu festzulegen, um den Vorgang der Kapitalanhäufung wieder in Gang zu setzen. Sie selber werden die Arbeitsweise der politischen und staatlichen Institutionen in Frage stellen. Wenn die demokratische Form ihnen nicht mehr dient, werden sie die ersten sein, die ihre Überwindung fordern. Verdammen wir uns nichts selbst dazu, unter jenen zu sein, die immer die Vergangenheit verteidigen, neben der Republik der Unternehmer, kann es in der geschichtlichen Reihenfolge auch die Republik der Arbeiter sein. Wenn den Unternehmern, um ihr Kapital zu retten, Kraftproben auf dem Weltmarkt dienen, werden sie „aus Notwendigkeit auf den Krieg hinsteuern“. Die ständigen Aufrufe zur nationalen Einheit gehen in diese Richtung. Wer wird sie aufhalten können, wenn nicht die Arbeiter, die eine inter-nationale Klasse sind? Arbeiter, wir haben keine Zeit! Eine Parteiorganisation ist nötig, die -in jeder Fabrik an-wesend -damit beginnt, sich ohne unnütze Formalitäten zu bilden und stattdessen schon heute anfängt zu handeln. Es ist kein Zufall, dass ab und zu sich jemand daran erinnert, dass die lebendigen Arbeiter aus Fleisch und Blut existieren und dass niemand fähig ist, sie politisch zu vertreten. Wir haben die Absurdität, dass die Lega von Bos-si sich die Fähigkeit anmasst, auch Arbeiterschichten „des Nordens“ zu vertreten und einige Sektionen in den Fabriken gründet. Ausgerechnet die Lega, welche die übelsten Unternehmer und Kleinunternehmer vertritt, die um Profit zu machen zu einer unerhörten Ausbeutung der Arbeiter fähig sind! Die Arbeiterpartei wird – indem sie sich auf dem ihr eignen Gebiet, in der Fabrik, Achtung verschafft – alle andern auf Trab halten und die klassenübergreifende Farce von den „Norditalienern“ („Padani“) auflösen. Denn dort, wo es einen Unternehmer gibt, hat es auch Arbeiter, der ihm den unerbittlichen Kampf ansagen. Der schreckliche Kampf zwischen den Klassen, der so sehr Angst einflösst, auch der „kämpferischen und regierungsverantwortlichen“ Lega (Lega di „lotta e di go-verno“).
Nun sind einige Anmerkungen zu machen zu unserem Lager, zu den von der Krise betroffenen Arbeitern und jenen, die auf irgendeine Art behaupten sie zu vertreten. Die gesellschaftliche Struktur in Italien bringt immer neue poltische Gruppen hervor. Wir stehen nicht nur einer Masse von Gewerbetreibenden und Krämern gegen-über, sondern auch Selbständigerwerbenden sowie Staatsangestellten und freien Berufen, Angestellten in der Produktion, die die Ausbeutung der Arbeiter verwalten... Jeder mit seinen eigenen wirtschaftlichen und eigenen politischen Interessen. Es stimmt zwar, dass die Krise für viele, die geglaubt hatten, eine befriedigende Arbeit und Anstellung gefunden zu haben, einen sozialen Abstieg hervorbringt. Unter allen Arbeitenden wächst die Unzufriedenheit, das ist das Ergebnis der Krise. Die politischen Antworten, die jeder dieser Sektoren gibt, entspricht den besonderen gesellschaftlichen Bedingungen, die sie verspüren und die sie voneinander unterscheiden. Die Staatsangestellten wollen die Verteidigung des „öffentlichen Dienstes“, die Angestellten des Handels eine Politik der Ankurbelung des privaten Konsums, die Forscher eine Förderung der nationalen Forschungsprojekte, und so weiter... Lassen wir hier den eigentümliche Wahn beiseite, Linksparteien links von der Rifondazione zu erfinden, jede in der Hoffnung, in den regionalen, kommunalen Behörden oder im Parlament wieder eine Rolle zu spielen. Sprechen wir lieber von den verschiedenen Versuchen: Koordinationskomitees, Basisgewerkschaften, autonome Zentren, Studentenkomitees, die alle im Kampf um die Vorherrschaft miteinander wetteifern, ins Leben zu rufen, und sagen wir ihnen, dass es ohne das Auftreten der Arbeiter keine echte Alternative zu diesem System gibt, dass ohne die zentrale Bedeutung der Arbeiter („centralità operaia“) die kleinen Gruppen nicht überwunden werden können. Ab sofort, auch auf informelle Weise, eine Arbeiterpartei zu gründen, das ist im Interesse all jener, welche die Absicht haben, die Krise zu benützen, um diese Art von Produktion und Austausch in Frage zu stellen. Vom kläglichen „eure Krise bezahlen wir nicht“ werden wir übergehen zum Schlachtruf „Unternehmer, wir wer-den in der Krise mit euch abrechnen“. Sollte hingegen die notwendige Vereinigung der Arbeiter zur Partei als neue, zentrale Tatsache anerkannt werden, könnte ein wichtiger Beitrag auch von jenen Mitstreitern kommen, die selber zwar keine Arbeiter sind, jedoch mühsam aus eigener Erfahrung, aus theoretischer Aneignung dazu gelangt sind, die Rolle zu begreifen, welche die Arbeiter in der Möglichkeit der Überwindung dieses Systems haben.
Vom Sprechen über die Arbeiterpartei überzugehen zu ihrer Gründung, ist ein sehr schwieriger Sprung. Nahezu unmöglich, aber die unmöglichen Aufgaben, einmal verwirklicht, können sich als die einzigen erweisen, die grosse Resultate bringen. Bei INNSE hat die informelle Arbeiterpartei vorgemacht, was eine Arbeitergemeinschaft, die einig ist und weiss, wohin sie will, zustande bringen kann. Warum nicht in anderen Fabriken die gleiche organisatorische Praxis versuchen? Kurzum, ist es derart schwierig, an allen Arbeitsplätzen, unter Arbeitern, sich als Sektion einer noch informellen Partei, die ihren Wegen finden muss, zu verstehen und zu vereinen? Die Antwort kann nur aus den Betrieben kommen. Zum Zeitpunkt, in dem wir uns gegenseitig bewusst werden, dass dieses Projekt anfangen kann auf eigenen Füssen zu stehen, können wir mit öffentlichen Versammlungen in den verschiedenen Industriezentren anfangen und zu neuen Gedankengängen übergehen. Die weltlichen Prediger der politischen Klein-und Kleinstgruppen, die sich an die Lohnabhängigen richten, werden diesen Vorschlag hinlänglich prüfen und sogleich als Sektiererum verwerfen, oder versuchen ihn totzuschweigen. Sie haben jedoch auf der ganzen Linie versagt: Bei ihren öffentlichen Auftritten langweilen sie die Leute mit den üblichen Litanein über die Kämpfe, die nie organisiert werden, über die Verallgemeinerungen der Initiativen, die sich in einer privaten Vereinbarung zwischen zwei oder drei Individuen erschöpfen, über die Hirngespinste grosser Bewegungen, die sich nie bewegen, über ihre unklaren Ziele. Nun, wenn es den fortgeschrittensten Arbeitern nicht gelingt, mit diesen Leuten abzurechnen, dann wird es sehr schwierig in Richtung einer Arbeiterpartei zu gehen. Aber auch von dieser Seite her hilft uns die Krise: Der Zusammenprall zwischen Arbeitern und Unternehmern wird immer heftiger, und für manches Geschwätz über eine linke politische Verwaltung des reformierten Kapitalismus ist die Zeit abgelaufen.
Diese Anmerkungen sind von einigen Arbeitern der INNSE diskutiert und überarbeitet worden. Es sind dieselben, die den langen Kampf angeführt haben und sich dabei die Anerkennung ganz vieler, die sie dabei unterstützten, erworben haben. Was wir verlangen, zum Besseren oder zum Schlechteren, ist eine Antwort auf die Fragen, die wir gestellt haben. Besser als Schweigen und Gleichgültigkeit... Es ist unsere Absicht, allen zu antworten. Falls Zustimmungen zum Projekt kommen werden, werden wir raschmöglichst, noch vor den Sommerferien, eine öffentliche Versammlung organisieren, um uns zu treffen und die nächsten Schritte festzulegen. Auf der Tagesordnung wird nicht das abgenützte Verlangen zur Koordinierung der Kämpfe stehen; wie aus der Krise herauszukommen ohne den Mut zu haben, über den Kapitalismus hinauszuschauen; zu retten, was zu retten ist. Das Thema wird schlicht und einfach die Organisierung der Arbeiter zur Partei sein; festzustellen, in welchen Betrieben es möglich ist oder bereits begonnen hat; wir werden darüber diskutieren, wie ihre Tätigkeit zusammengefasst werden kann. Das kann tatsächlich zur poltischen Wende führen, zu der uns die grosse Krise gezwungen hat. Das wäre ein Resultat von geschichtlicher Bedeutung. Es liegt an uns!
Aktuelles und Laufendes:
- INNSE [191]
- Arbeiterkämpfe in Italien [192]
- Arbeiterkomitees [193]
Historische Ereignisse:
Schweizer Imperialismus im Gegenwind: Eine Bilanz nach den Affären um Bankgeheimnis, Gaddafis und Polanski
- 2642 Aufrufe
Im Juni 2010 konnte die herrschende Klasse in der Schweiz zwei ihrer größten Probleme, wenigstens für den Moment, für beendet erklären.
Diese Probleme hielten sie während gut einem Jahr so in Atem, dass ihre Medien jetzt laut über eine Auswechslung von verschiedenen Regierungsmitgliedern nachdenken. Immerhin hat die herrschende Klasse im Steuerstreit mit den USA um Bankkonten von amerikanischen Kunden der Schweizer Bank UBS eine bittere Pille geschluckt und in der so genannten Libyenaffäre vor vielen anderen Staaten das Gesicht verloren.
Welche Bilanz ist heute zu ziehen? War es nur ein Sturm im Wasserglas? Zur Ablenkung von der wahren Krise, derjenigen der Wirtschaft?
Die Geiseln von Gaddafi und das Hickhack der Schweizer Bourgeoisie
Die im letzten Artikel angesprochene Affäre Libyen mit den sich in der Wirkung widersprechenden Positionen der Innen- und Außenpolitik ist für die Schweizer Bourgeoisie mit einem großen Prestigeverlust zu Ende gegangen. Vorausgegangen sind diverse Ereignisse eines Schlagabtauschs, die das absurde Leben der kleinen Staaten im Zerfall des Kapitalismus gut demonstrieren.
Die Schweizer Bourgeoisie tritt nicht mehr nur als einheitlicher neutraler und diplomatischer Staat auf, sondern ist immer mehr geprägt durch die Einzelinteressen verschiedener Parteien und Fraktionen mit ihren Exponenten. Die Homogenität der Bourgeoisie leidet in jedem Fall darunter. Ausdruck davon ist der Verlauf der Affäre Libyen.
Auf den abgeschlossenen Staatsvertrag zwischen den Staaten im Herbst 2009 wurde von libyscher Seite her nicht reagiert. In der Folge hat die Schweiz die Visumsvorschriften für Libyer verschärft und im Februar „hochrangige“ libysche Staatsangehörige an der Einreise gehindert.
Am 31. Januar wurde die eine Schweizer Geisel in Libyen freigesprochen und die andere zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Zudem verschärfte sich der Konflikt im Februar durch die Visa-Sperre von Libyen für die meisten Länder der Schengen Zone. Der Konflikt weitete sich somit auf die EU aus, die sich wiederum von der Schweiz distanzierte.
Am 25. Februar ruft Gaddafi an einer Rede zum heiligen Krieg gegen die Schweiz auf - als Reaktion auf das Minarettverbot der Schweiz Ende November 2009. Dies ist ein weiterer heikler Punkt der Schweizer Bourgeoisie, die diese Abstimmung ideologisch unterschätzt und weltweit viel Kritik geerntet hat.
Nach einem „totalen Wirtschaftsboykott“ von der Seite Libyens gegen die Schweiz im März wurde die zweite Geisel im Juni schließlich freigelassen. Bedingung war, dass die Schweiz auf ein deutsches Sperrkonto eine Kaution von 1.5 Millionen Franken einbezahlt. Dies als Sicherheit dafür, dass derjenige, der die Polizeifotos von Hannibal Gaddafi publizierte, in der Schweiz gerichtlich zur Rechenschaft gezogen wird. Die Schweiz beugte sich schlussendlich, wobei die Verhandlungen mit Libyen vor allem durch die EU mit ihren Exponenten Berlusconi und Co. geführt wurden. Selbst der schlechte Deal mit dem Gesichtsverlust für die Schweiz kam also nur deshalb zustande, weil sich prominente Mittelsleute für eine Schlichtung des Streits einsetzten. Die Schweiz allein hätte nicht einmal für eine schlechte Lösung genügend Gewicht in die Waagschale werfen können.
Während Bundesrat H.-R. Merz in August 2009 das erste Mal versuchte, die beiden Geiseln freizukriegen und dabei sichtlich scheiterte, war es diesmal Bundesrätin Calmy-Rey der Sozialdemokraten, die sich vor den Medien als Befreierin profilierte. Das Scheitern des einen und der Erfolg der anderen können als Episoden der Konkurrenz innerhalb der Schweizer Regierung verstanden werden und sind bezeichnend für die Situation innerhalb des Bundesrats, wie wir sie im letzten Artikel beschrieben.
Als gäbe es in dieser Sache nicht schon genug Fehltritte und Widersprüche innerhalb der Regierung, wurde nach der Freilassung durch eine Indiskretion ein Plan für eine militärische Befreiung der Geiseln bekannt. Dass die „neutrale“ Schweiz einen inoffiziellen bewaffneten Einsatz im Ausland plant, zeigt einerseits ihre Verzweiflung in der isolierten Situation und macht andererseits auch die Impotenz des Schweizer Militärs deutlich. Die anschließende Diskussion über die völkerrechtliche Legimitation eines solchen Einsatzes lenkt großmäulig vom Umstand ab, dass es der Schweiz gar nicht möglich ist, militärisch im Ausland zu intervenieren, nicht einmal eine Polizeioperation des Geheimdienstes wäre realisierbar.
An diesem Beispiel, aber auch im unten angesprochenen Steuerstreit zeigt sich, wie die Schweiz in Konflikten mit anderen Staaten alleine dasteht. Nicht nur in Auseinandersetzung mit als „verrückt“ geltenden Führern und symbolischen Geiselnahmen, sondern auch in anderen Konflikten mit einschneidendem ökonomischem Einfluss auf das Budget der Schweizer Bourgeoisie.
Zum Streit mit den USA
Ohne Zweifel war das Problem mit den USA weit ernsthafter als dasjenige mit Libyen: Es ging um die Herausgabe von Bankkundendaten der UBS, die eigentlich dem Bankgeheimnis unterstehen, an die US-Steuerbehörden. Damit sind nicht nur das Bankgeheimnis - als Garantie der Schweizer Banken, ihre Kunden gegenüber anderen Staaten geheim zu halten - betroffen, sondern erhebliche wirtschaftliche Interessen der Schweizer Bourgeoisie. Gerade die Aussicht von Reichen der ganzen Welt, einen Teil ihres Vermögens unversteuert durch Schweizer Banken verwalten zu lassen, führte zu einem Vorteil des Finanzplatzes Schweiz gegenüber anderen Staaten, die weniger diskret mit den Daten ausländischer Bankkunden umgingen.
Dieses Angebot hat auch eine Nachfrage. Die bisherige Diskretion der Schweizer Banken befriedigte Bedürfnisse von Kapitalisten der ganzen Welt mindestens in dreifacher Hinsicht:
- als Steuerparadies, als Anlagemöglichkeit für Reiche, die steuerlich unbehelligt davonkommen;
- als Geldwaschanlage für kriminelle Aktivitäten, die Mafias, Drogen- und Waffenhändler usw.
- als Drehkreuz für Geldzahlungen, die aus imperialistischen Gründen Diskretion erfordern, z.B. zur Finanzierung von terroristischen / antiterroristischen Aktivitäten, Geheimdienstaktionen, die nicht kontrolliert werden sollen.
Gerade bei Finanzströmen der letzten Art müssen die USA als Weltpolizist ein Interesse daran haben, freien Zugang zu sämtlichen Bankdaten in anderen Ländern zu bekommen. Bei den USA liegt dieser Aspekt im Vordergrund, während beim Druck, den die deutschen Steuerbehörden gegenüber der Schweiz (Razzias bei der Credit Suisse in Deutschland) und Liechtenstein ausüben, eher direkte ökonomische und ideologische Interessen eine Rolle spielen - bankrotte Staaten müssen ihre Löcher stopfen und Sünder vorweisen.
Der im Juni 2010 vom Parlament genehmigte Staatsvertrag zwischen den USA und der Schweiz über die Herausgabe von UBS-Akten (vgl. dazu die Einzelheiten in „Weltrevolution“ Nr. 156) ist aus der Perspektive der Arbeiterklasse auch in wirtschaftlicher Hinsicht interessant: Was heißt die faktische Aufhebung des Bankgeheimnisses für die Wirtschaft? Wird sich die Krise in der Schweiz aus diesem Grund zusätzlich verschärfen?
Wirtschaftlicher Aspekt der Aufhebung des Bankgeheimnisses
Die Bourgeoisie ist sich einig darin, dass der Staatsvertrag mit den USA der mittelfristigen Aufhebung des Bankgeheimnisses gleichkommt. Obwohl die Schweizer Wirtschaft mit vielen verschiedenen Ländern verknüpft und insofern diversifiziert ist, hat sie zu wenig Rückhalt bei großen und treuen Verbündeten, um wirtschaftlichen Erpressungen Stand zu halten. Deutschland drängt sich zwar als Beschützer geradezu auf. Es ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner, und eine völlige Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft vom deutschen Reich ist auch historisch gesehen viel eher eine romantisierte Staatsideologie (Wilhelm Tell) als Realität. Aber solange Nationalstaaten bestehen, wollen die kleinen nicht von den großen geschluckt werden. Vom besten „Beschützer“ geht also in der nationalstaatlichen Logik gleichzeitig die größte Drohung aus. Gerade aus diesem Widerspruch heraus hat die Schweizer Bourgeoisie in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer versucht, sich bei den USA einzuschmeicheln, um sich auch da eine „Freundschaft“ zu erhalten.
Was haben die USA nun faktisch getan? Sie stellten die Schweizer Bourgeoisie, die UBS, die Regierung (alle zusammen offen als Einheit auftretend) vor die Alternative: steuerstrafrechtliche Konfiskation der Güter der UBS in den USA und damit wahrscheinlicher Untergang dieser Großbank mit katastrophalen Folgen für die Wirtschaft (vgl. Island) oder Öffnung der unter Bankkundengeheimnis stehenden Konten-Dossiers von US-Steuerpflichtigen. Längst steht die offizielle Schweiz unter etwas sanfter vorgetragenem, aber im Resultat gleich gerichtetem Druck der EU und insbesondere einzelnen Länder aus ihr: Deutschlands, Italiens, Frankreichs, Spaniens etc. Der langen Rede kurzer Sinn: das Schweizer Bankgeheimnis wird begraben. Die tödlichen Spritzen haben die beiden „Patenonkel“ USA und Deutschland gesetzt.
Was bedeutet dies für die Wirtschaft? – Dank dem Steuervorteil, den Reiche mit dem Verstecken ihrer Gelder auf Schweizer Bankkonten genossen, flossen riesige Vermögen auf diesen Finanzplatz. Man braucht nicht Hellseher zu sein, um vorauszusagen, dass dieser Strom abnehmen wird. Je kleiner die auf Schweizer Banken verwalteten Vermögen, desto prekärer wird die Situation unter den kleinen bzw. kapitalschwachen von ihnen. Die Konkurrenz wird zunehmen, es wird Pleiten geben – und mehr Arbeitslose. „Etwa 30’000 der in der Schweiz tätigen Bankangestellten sind im grenzüberschreitenden Vermögensverwaltungsgeschäft tätig. Das ist rund ein Viertel der 110'000 Arbeitsplätze, welche die Schweizer Banken im Inland anbieten.“ (Tagesanzeiger 16.02.2010). Ob aber 30’000 Arbeitsplätze auf dem Finanzplatz Schweiz verloren gehen, hängt auch von anderen Faktoren ab: weitere Entwicklung der Weltwirtschaftskrise, Konkurrenzvorteile für die Schweiz als Investitionsstandort, Stärke der hiesigen Währung gegenüber Dollar, Yen, Euro etc. Während die wirklichen Konsequenzen auf die Wirtschaftslage in der Schweiz unklar sind, können wir umgekehrt sicher sein, dass die Bourgeoisie versuchen wird, eine Verschärfung der Krise in der Schweiz auf diese Veränderungen im Finanzsektor - also auf Sonderumstände - zurück zu führen, damit die Einsicht, das System sei als Ganzes faul, sich nicht zu einfach durchsetzt.
Auf imperialistischer Ebene musste die Schweizer Bourgeoisie in den letzten 12 Monaten einige Kröten schlucken. Sie sprach von Erpressung sowohl durch Gaddafi wie durch die USA - und hatte für einmal recht: So sind nun halt die Verhältnisse für Kleinstaaten im weltweiten Hickhack nach 1989. Der einzige Trost („Rache ist süß“) war die Weigerung der Schweiz, Roman Polanski an die USA auszuliefern. Dass dieser Entscheid zur Chef-Sache erklärt und von Justizministerin Widmer-Schlumpf persönlich eröffnet wurde, ist eine kleine Demonstration - insofern nicht ganz auf der Linie der bisher stets gepflegten Diskretion. Der Schweizer Imperialismus kläfft. Frankreich und Polen (die hinter Roman Polanski stehen) streicheln ihm den Pelz. Bald schon dürften die nächsten Läuse jucken.
17.07.2010, K und H
Aktuelles und Laufendes:
- Schweiz Außenpolitik [195]
- Bankgeheimnis Schweiz [196]
Leute:
- Wilhelm Tell [197]
Historische Ereignisse:
- Schweiz [198]
Sparprogramm der Bundesregierung: Die Arbeiter sollen für die Krise blechen
- 2179 Aufrufe
Genau wie alle anderen Regierungen der Welt hat auch die deutsche Regierung ein Sparpaket verabschiedet, welches wie woanders die Kosten der Krise auf die Arbeiter abwälzen soll.
Die Bedürftigsten wie immer zuerst…
„Bis 2014 wollen Union und FDP im Bundeshaushalt 81,6 Milliarden Euro einsparen. Die Arbeitslosen sind wohl die großen Verlierer des Sparpakets. Rund 30 Milliarden Euro will die Regierung bis 2014 aus dem Sozialbereich quetschen - Langzeitarbeitslose können sich auf allerlei Kürzungen einstellen. So soll der befristete Zuschlag beim Übergang vom Arbeitslosengeld I ins Arbeitslosengeld II ebenso gestrichen werden, wie der Zuschuss zur Rentenversicherung. Hartz-IV-Empfänger verlieren zudem ihren Anspruch auf Elterngeld. Künftig soll die Bundesagentur für Arbeit stärker selbst entscheiden können, wem welche Gelder zugestanden werden. Dazu sollen Pflichtleistungen in Ermessensleistungen umgewandelt werden. Der Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger, der 2009 wegen der hohen Energiekosten eingeführt worden war, wird wieder abgeschafft. Im Öffentlichen Dienst sollen 15.000 Stellen gestrichen werden.“ (Siehe Spiegelonline)
Bei den ersten Reaktionen auf die Ankündigung der Sparbeschlüsse konnte man selbst in den bürgerlichen Medien häufig lesen: „Wieder einmal wird auf Kosten der Armen gespart“, so dass sogar Manager aus dem Unternehmerlager, die eingestanden, ziemlich ungeschoren davonzukommen, ihre Bereitschaft bekundeten, ebenfalls ihren Beitrag zu den Sparanstrengungen zu leisten. Aber das hielt die Bundesregierung nicht davon ab, just gegen Ende der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika, die für genügend Ablenkung gesorgt hatte, zuzuschlagen und kräftige Erhöhungen der Beiträge im Gesundheitswesen durchzudrücken.
Sparpaket = Spaltungspaket
Auch wenn die Bundesregierung mit ihrem Sparpaket in die gleiche Richtung drängt wie die anderen Regierungen auf der Welt, die die Arbeiterklasse zur Kasse bitten, geht sie dennoch nicht blindlings und unüberlegt vor. Denn während sie zwar unnachgiebig gegenüber anderen Regierungen wie z.B. der griechischen brutale Sparprogramme fordert, bevor sie irgendwelche Rettungspakete unterschreibt, und auch (wie wir im nebenstehenden Artikel dargestellt haben) international im Vergleich zu den USA auf rigorose Sparprogramme drängt, hat sie im Augenblick noch den Spielraum und auch die politische Cleverness, in Deutschland scheibchenweise zuzuschlagen. Es geht explizit darum, Erwerbslose und Beschäftigte auseinander zu dividieren. Zwar wurde der Kern der industriellen Arbeiterklasse beim ersten Sparpaket noch von den heftigsten Angriffen weitestgehend ausgenommen. Die Zuschläge für Nachtschicht- und Wochenendarbeit in der Industrie bleiben vorerst von der Steuer verschont; auch werden Sozialabgaben auf die Löhne noch nicht erhöht. Aber wie wenig die Beschäftigten in Wirklichkeit ausgespart werden sollen, hat gleich die „Gesundheitsreform“ gezeigt, die alle Lohnabhängigen kräftig zur Kasse bittet, dafür aber die Entlastung der Unternehmer für die nächsten Jahren schon festgeschrieben hat.
Der Hintergrund: Gegenwärtig zieht vor allem im Exportsektor die Produktion wieder an. Auf den ersten Blick scheint eine Rechnung aufgegangen zu sein, die das deutsche Kapital zu Beginn der Beschleunigung der Krise aufgestellt hatte. Über eine Million Arbeiter - vor allem im Maschinenbau und anderen exportstarken Branchen (z.B. Chemie, Elektroindustrie, Autobau) - wurden in Kurzarbeit geschickt. Davon sind nun wider Erwarten viele nicht arbeitslos geworden, sondern konnten wieder in die Produktion mit einsteigen. Und während in den Nachbarländern die Arbeitslosigkeit stark anschwoll (zum Teil um mehr als 50%) oder sie sich wie in den USA verdoppelte, ist sie in Deutschland 2009 nur geringfügig angestiegen, in der jüngsten Zeit gar minimal rückläufig. Deutschland ist das einzige Land, in dem die offizielle Arbeitslosenquote heute niedriger liegt als vor dem Ausbruch der Wirtschaftskrise im Frühjahr 2008 (Spiegel, 17/2010).
Die widersprüchliche Lage des deutschen Kapitals
Diese gegenwärtig günstige Situation für das deutsche Kapital ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Deutschland profitiert von den Konjunkturprogrammen, die in den USA und vor allem in China für eine Ankurbelung der Wirtschaft sorgten. (1)
Während der Gesamtexport 2009 um fast 18% sank, stiegen die Ausfuhren nach China um 7%. „Den deutschen Maschinenbau hat Fernost regelrecht gerettet. China ist jetzt der wichtigste Auslandsmarkt. Für VW ist China wichtiger als Deutschland. Auf deutscher Seite hat sich der Anteil Chinas an den Ausfuhren in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdreifacht.“ (FAZ, 12.5.10). Generell hat der Export die Wirtschaft angefeuert. „Die Unternehmen verkauften Waren im Wert von 77,5 Milliarden Euro ins Ausland - 28,8 Prozent mehr als im Mai 2009. Das war der kräftigste Anstieg seit Mai 2000 mit 30,7 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Allerdings waren die Exporte vor einem Jahr wegen der weltweiten Wirtschaftskrise auch um ein Viertel eingebrochen. Besonders stark stiegen die Ausfuhren in die Staaten außerhalb Europas: Hier lag das Plus bei 39,5 Prozent, während die Geschäfte mit den anderen Euro-Staaten um 21,4 Prozent zulegten.“ (Spiegelonline)
Dies wird zurzeit begünstigt durch den seit Jahresbeginn stark gefallenen Eurokurs (-15%). Erleichtert wurde die Exportoffensive auch durch die stark gesunkenen Lohnstückkosten, welche nach einer vor Jahren eingefädelten Ausweitung des Niedriglohnsektors landesweit gesunken sind. Denn in anderen EU-Ländern waren die Lohnstückkosten in den ersten Jahren des ersten Jahrzehnts gestiegen, wohingegen sie in Deutschland im ersten Jahrzehnt fielen. Dass nun diese Lohnsenkungen, die in anderen Ländern zum Teil eher in einem „Hau-Ruck-Ansatz“ eingeführt werden, in Deutschland schon vor Jahren umgesetzt wurden, ist eines der "historischen Verdienste" der rot-grünen Regierung, das dem deutschen Kapital zugute kommt. Auch dieses Jahr noch hat der jüngste IG-Metall-Abschluss in enger Absprache mit der SPD für weitere Lohnverzichte gesorgt.
Darüber hinaus profitieren deutsche Firmen im Augenblick von günstigen Zinskonditionen. Denn während die Staatsanleihen in den „PIIGS“-Ländern nur zu hohen Zinsen gekauft werden können, hat in Deutschland ein Run auf zinsgünstige deutsche Staatsanleihen eingesetzt. Dies begünstigt im Augenblick noch die günstige Kreditaufnahme für das deutsche Kapital, mit dem Vorteil einer großen Zinsersparnis für den deutschen Staat, der auch trotz aller Sparbeschlüsse noch immer neue Rekordverschuldungen eingehen muss.
Der vorübergehende Charakter der jetzigen „Erholung“
Auf der einen Seite schnellen die Schulden des deutschen Staats in die Höhe. Bund, Länder und Kommunen mussten im ersten Quartal neue Verpflichtungen eingehen – sie stehen mit insgesamt 1,711 Billionen Euro in der Kreide. Die Schulden des Bundes stiegen um 1,1 Prozent auf 1,066 Billionen Euro, die der Länder um 1,2 Prozent auf 533 Milliarden Euro und die der Kommunen um ein Prozent auf 112,5 Milliarden Euro. Dies zwingt zur Verabschiedung von Sparpaketen.
Gleichzeitig hat die Verabschiedung der jüngsten Rettungspakete zur Stützung des Euros deutlich werden lassen, dass das deutsche Kapital innerhalb der EU am stärksten mit einspringen muss. So muss das deutsche Kapital selbst immer größere Risiken eingehen um der Gefahr der Zahlungsunfähigkeit europäischer Konkurrenten entgegenzutreten, es muss also immer waghalsiger und somit immer verletzlicher werden – auch wenn es im Augenblick noch die Mittel hat, Zeit herauszuschinden. Die Stunde der Wahrheit aber wird kommen.
Was bislang als große Stärke angesehen werden konnte, d.h. die Exportrekorde, bewirkt aber auch eine besondere Verwundbarkeit Deutschlands. Jeder fünfte Arbeitsplatz hängt am Export, das sind acht Millionen Jobs. Inzwischen beträgt der Anteil der Ausfuhren am BIP 47%, Anfang der 1990er Jahre lang er noch bei ca. 20%. Selbst China, die Werkbank der Welt, besitzt mit einem Exportanteil von 36% eine Wirtschaft, die nicht so stark exportabhängig ist. Jedes Mal, wenn der Weltmarkt schrumpft, wird wegen der hohen Exportabhängigkeit die deutsche Wirtschaft stärker angeschlagen. So sank in Deutschland das BIP 2009 um -5.3%, in Frankreich -2.4%, in Großbritannien -4.4%, in den USA -2.7% gegenüber 2008. Eine Folge: In Deutschland stieg die Arbeitslosigkeit in Süddeutschland, insbesondere in Baden-Württemberg, d.h. in den exportstarken Regionen am stärksten. Zwar trägt zum Beispiel in Großbritannien das verarbeitende Gewerbe nur noch zu 13% zur Wertschöpfung bei, in Deutschland sind es ca. 23%, dennoch schrumpfen die Weltmärkte, weil Konjunkturblasen irgendwo platzen und gerät besonders Deutschland in Bedrängnis. Deshalb bangen alle darum, wann die chinesische Blase platzen wird. „Manche Experten fürchten, dass die Wirtschaft nach kurzem Aufflackern der Wachstumskräfte weltweit wieder in die Rezession zurückfällt, weil zahlreiche Konjunkturprogramme auslaufen. Sie sprechen in diesem Zusammenhang von einem „double dip“, als einem zweifachen Knick nach unten“. (Spiegel, 27/2010).
Insofern ist es nur eine Frage der Zeit, bis es auch den in Lohn und Brot stehenden Arbeitern im exportstarken Deutschland so richtig an den Kragen geht….
Und die Arbeiter sich hierzulande noch mehr wehren müssen.
(1) China ist der grösste Automarkt der Welt.
„Gegen die Bremswirkung der globalen Krise, die selbstverständlich auch China getroffen hat, ist Peking mit einem gigantischen Konjunkturpaket vorgegangen: Umgerechnet 400 Milliarden Euro pumpte der Staat vor allem in Infrastrukturinvestitionen wie Straßen- und Schienennetze, Flughäfen und Sportstätten – ganz gleich, ob sie gebraucht wurden oder nicht. Hinzu kamen Anreize für den Autokauf und andere Waren. Doch das war alles nichts gegen die umgerechnet fast 1000 Milliarden Euro, die von den Banken an Krediten unters Volk gebracht wurden.“ (Rheinische Post, 15.7.10) Im Juni wurden in China 1,04 Millionen Autos verkauft. Im März aber gab es noch einen Rekordabsatz von 1,7 Millionen Fahrzeugen. 2000 Autos werden jeden Tag in Peking verkauft. In Berlin waren es 2009 täglich 261.
Aktuelles und Laufendes:
Von Israel über die Türkei - alle Staaten sind Kriegstreiber
- 2342 Aufrufe
Am 31. Mai ist der israelische Angriff auf die von der Türkei angeheuerte “Hilfsflotte”, die den Bewohnern des Gaza-Streifens humanitäre Hilfe leisten wollte, in die Chronik der Geschichte eingegangen. Das Ereignis selbst war in der Tat besonders schockierend: eine der modernsten und am besten ausgebildeten Armeen der Welt tötete gnadenlos unbewaffnete propalästinensische Aktivisten. Und um dem Zynismus noch eins draufzusetzen, die Verantwortlichen in Israel schoben als Vorwand die „Selbstverteidigung“ gegen mit Eisenstangen oder Schweizer Messern kämpfenden Aktivisten vor.
Viele Auseinandersetzungen haben über die wahre Zahl der Verletzten stattgefunden oder laufen immer noch. Alle Zeugen bestätigen, dass es sicher mehr als neun Tote gegeben hat (die meisten wurden aus unmittelbarer Nähe erschossen) und 60 Verletzte (von denen einige noch im Gefängnis in Israel sitzen); einige Verletzten wurden sogar über Bord geworfen. Gleich welche Zahl Tote und Verletzte es tatsächlich gegeben hat, was in den Köpfen haften bleiben wird, ist die Gewalt der israelischen Armee, die in keinem Verhältnis zur wirklichen „Bedrohung“, die von diesem Konvoi ausging, ausgeübt wurde.
Um diesen Überfall zu rechtfertigen, hat der israelische Premierminister Netanyahu kurz nach dem Ereignis erklärt: “Unsere Soldaten mussten sich schützen, um ihr Leben zu verteidigen”. „Sie wurden attackiert, geprügelt, mit Messern angegriffen; es gab sogar Schüsse und unsere Soldaten mussten sich verteidigen, ihr Leben schützen, sonst wären sie getötet worden.“ Und gleichzeitig behauptet er schamlos: „Wir wollen schnellstmöglich zu direkten Gesprächen mit den Palästinensern kommen, denn das Problem, was wir mit ihnen haben, kann friedlich gelöst werden, wenn wir uns alle an einen Tisch setzen.“ Solche Erklärungen sind jämmerlich, und Zahal (israelische Streitkräfte) und der israelische Staat haben sich lächerlich gemacht in den Augen der „internationalen Gemeinschaft“.
Der Chef des Verbindungs- und Koordinierungsbüros für die palästinensische Enklave, Kolonel Moshe Levi, hat in einer Pressekonferenz provozierend hinzugefügt, dass es im Gazastreifen keinen Lebensmittel- und Gütermangel gebe: „Die Flotte, die nach dem Gazastreifen wollte, war eine sinnlose Provokation; die humanitäre Lage im Gazastreifen ist stabil und gut.“ Er fügte hinzu, dass viele Güter in den Gazastreifen gelangen, und „dass der Zugang nur für jene Güter verwehrt wird, die den terroristischen Aktivitäten der Hamas dienen könnten.“
Die palästinensische Bevölkerung: eine Kriegsgeisel
1.5 Millionen Einwohner, die auf 378 km2 leben, die ihr Essen mit schmutzigem Wasser kochen oder sich damit waschen, oder dreckiges Wasser trinken müssen, die regelmäßig durch die israelische Armee mit Bomben terroririsiert werden, die ihre Drohnen und andere neue Waffensysteme testet(1 [202]): so sieht der Alltag im Gazastreifen aus. Der Müll stapelt sich so hoch, dass man Kindern in den improvisierten Schulen unterrichtet, wie man Produkte zu Schmuck oder Kinderspielzeug recycelt, um damit sowohl die überall herumliegenden Müllberge zu reduzieren als auch die Schüler zu beschäftigen und zu hoffen, damit ein paar Cent in der lokalen Wirtschaft herauszuschinden.
Sowohl im Gazastreifen als auch in Transjordanien sind der Boden und damit auch das Grundwasser stark verseucht. Wenn Müll gelagert, Abwasser ungereinigt ins Erdreich geschüttet, Tausende Phosphorbomben zum Teil mit schwach angereichertem Uran und ungefähr 30 giftigen Schwermetallen, welche Israel seit Jahren abgeworfen hat, herumliegen und sich zersetzen, entstehen große Verunreinigungen. So konnte man in den Körpern der direkten Opfer der Offensive „gegossenes Blei“ vom Januar 2009 erhöhte Werte an Uran, Zink, Blei, Kobalt und anderen krebserregenden Stoffen feststellen. Seit Jahren sind landwirtschaftliche Erzeugnisse dadurch verschmutzt. Auch Bäume, welche die Armee mit ihrem weißen Phosphor noch nicht verbrannt hat, wurden beschädigt. All das hat verstärkt zu Krebserkrankungen, Nierenerkrankungen und Missbildungen bei der Geburt geführt. So sieht die Lage für die Bewohner der palästinensischen Gebiete aus, die seit mehr als 40 Jahren von allen imperialistischen Gangstern als Geisel genommen werden. Jeden Tag befürchtet man Schlimmeres; deshalb nimmt die Wut unter den Jugendlichen, die unter der israelischen Besatzung leben, immer mehr zu. Aufgrund des Elends in den Lagern sind Zusammenstöße mit den israelischen Truppen aufgrund der völlig fehlenden Perspektive zu einem beliebten „Zeitvertreib“ der Jugendlichen geworden. Andere schließen sich terroristischen Gruppen an, um als Kamikaze zu dienen.
Der türkische Imperialismus – ein anderer Kriegstreiber
Die Ereignisse des 31. Mai sind eine neue Episode in dem nun seit Jahrzehnten dauernden Krieg, der nicht nur zwischen Israelis und Palästinensern geführt wird, sondern auch und vor allem unter den verschiedenen Mächten, ob groß oder klein, die bei der Verteidigung ihrer Interessen auf den einen oder anderen Flügel setzen.
So steht die IHH („Stiftung für die Menschen- und Freiheitsrechte“, sie ist in der Türkei in den der AKP politisch nahestehenden Stadträten gut verankert. Die AKP ist eine seit 2002 an der Macht befindliche islamistische Partei), die von der türkischen Regierung beim Anheuern der Schiffe unterstützt wurde, der Hamas nahe. Sie hat gar ein Repräsentationsbüro im Gazastreifen und hat schon andere Hilfslieferung in die Palästinensergebiete organisiert.
Gegenüber diesem “Hilfskonvoi”, dessen provozierende Ankunft von den Medien besonders hochgespielt worden war, hatte der israelische Staat keine große Wahl: Entweder hätte er die Schiffe durchlassen sollen und damit einen Sieg der Islamisten der Hamas ermöglicht, oder er hätte mit Gewalt eingreifen müssen, um seinen Anspruch zu unterstreichen, dass nur er die Kontrolle über den Gazastreifen ausübe. Dieses harte Durchgreifen wurde von der israelischen Regierung als beispielhaft dargestellt. Aber dieses Vorgehen hat nun eine Welle des Protestes ausgelöst und Israel international weiter isoliert. Das jämmerliche Bild hat aber nicht nur das Ansehen des Staates Israel geschädigt, sondern auch das seines Tutors, die USA. Und das geschah zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
Die US-Großmacht, deren internationales Ansehen sowohl auf politischer wie auf Handelsebene immer mehr sinkt, insbesondere in den Augen der arabischen Länder mit stark muslimischen Bevölkerungsanteil, hat einen neuen Tiefschlag erlitten mit diesem israelischen Angriff auf die “Hilfsflotte”. Die USA haben ihren Protest gegenüber ihrem Hauptverbündeten in der Region nur sehr zurückhaltend geäußert. Die Politik der USA im Gebiet des Mittleren Osten, das sich vom Maghreb bis nach Pakistan erstreckt, hat sich als ein riesiges Fiasko für die USA herausgestellt, in dem die USA jeden Tag mehr geschwächt werden.
In der Angelegenheit sticht die herausragende Rolle des türkischen Staates hervor, der den Schiffsverband organisiert hat, welcher als eine “humanitäre Initiative“ dargestellt wird. Die offensive Rede des türkischen Premierministers Erdogan und seines Außenministers belegen dies auch: „Das Vorgehen Israels wird nicht unbestraft bleiben. Die internationale Gemeinschaft muss handeln…“ Die Türkei, die vorgibt, der palästinensischen Bevölkerung Hilfe zu leisten, betreibt in Wirklichkeit eine schamlose Propaganda für ihre eigenen imperialistischen Interessen. Bis vor kurzem war die Türkei einer der wenigen Verbündeten Israels im Verbund mit den USA in der muslimischen Welt. Heute hebt sie ein Kriegsgeschrei gegen den Zionismus an und beansprucht eine wichtige Rolle im Mittleren und Nahen Osten.
Der wachsende Vertrauensverlust und die Schwächung der USA auf Weltebene sind ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung in der Region.
Die Achse Iran-Syrien, die bis vor einigen Monaten bestand und sich in der Hilfe der beiden Länder für die Hisbollah äußerte, ist momentan um die Türkei erweitert worden. Die Türkei blickt immer misstrauischer auf Unabhängigkeitsbestrebungen der irakischen Kurden und die wirtschaftliche Hilfe, die diese von Washington erhalten, wie auch die Unterstützung derselben für die iranischen Kurden (2 [203]). Der amerikanische Staat versucht somit die imperialistischen Ambitionen Ankaras gegenüber dem Kurdengebiet einzudämmen, während man gleichzeitig den kurdischen Sezessionisten mehr Raum lässt, insbesondere jenen, die in Ostanatolien leben, welches die Türkei immer versucht hat, unter seine Knute zu bringen. Diese imperialistische Orientierung der USA lässt die Türkei, Syrien und den Iran näher zusammenrücken, zumal diese drei Länder bei den politischen Entscheidungen hinsichtlich des Iraks, dessen Invasion und dem Umgang mit der gegenwärtigen und der zukünftigen Ausrichtung nicht befragt wurden. Der Anschluss an diese Achse stärkt der Türkei den Rücken wenn es um die Frage ihres Beitrittsantrags zur Europäischen Union geht (3 [204]).
Der Mittlere Osten – ein Nest von Geiern
Aber dieser neuen Achse muss momentan auch Russland hinzugefügt werden, dass nur darauf gelauert hat, seine „Vermittlungsdienste“ gegen den amerikanischen Paten anzubieten. Nachdem drei führende Staaten im Mittleren Osten in eine Phase intensiver Zusammenarbeit getreten sind, und innerhalb weniger Monate ihre Grenzen geöffnet und ihren Handel untereinander liberalisiert haben, hat sich Russland diesem Vorgehen schnell angeschlossen. Innerhalb weniger Monate haben Russland und die Türkei die Abschaffung der Visapflicht für ihre jeweiligen Staatsangehörigen beschlossen. So kann ein türkischer Staatsangehöriger ohne irgendwelche Einreiseformalitäten nach Russland reisen, während er immer noch nicht in die USA und auch nicht in die Europäische Union darf, obwohl die Türkei Nato-Mitglied und Beitrittskandidat der Europäischen Union ist. Moskau fördert auch das Zusammenrücken zwischen Hamas und Fatah; es möchte seine Raketen RPG und S-300 verkaufen, die die israelischen Panzer durchschlagen können (sie sollen auch an den Iran geliefert werden, um für eventuelle US-Bombardements gerüstet zu sein). Das dient Medwedew und Putin. Die russischen Firmen Rosatom und Atomstroyexport, die den Bau eines zivilen AKW im Iran fertigstellen (in Bushehr) und über den Bau neuer Anlagen verhandeln, werden ein AKW in der Türkei für 20 Milliarden Dollar errichten. Ein ähnliches Projekt wird in Syrien untersucht. Darüberhinaus werden Stroitransgaz und Gazprom den Transit des syrischen Gases nach Libanon sicherstellen, da Beirut durch seinen israelischen Nachbarn daran gehindert wird, seine großen off shore Ölreserven zu fördern (4 [205]). Aber Russland hat vor allem eine militärische Position konsolidiert, indem es seinen neuen Marinestützpunkt in Syrien geliefert hat. Dieser wird es ihm erlauben, ein Gleichgewicht im Mittelmeer wiederherzustellen, aus dem es seit der Auflösung der UdSSR verdrängt wurde.
Die Drohungen gegen den Iran
Der amerikanische Rückzug aus dem Irak dauert endlos lange, der Krieg ist in Afghanistan festgefahren und dehnt sich immer mehr in Pakistan aus. Der Iran ist jetzt ins Visier geraten. Mit dem immer häufigeren Scheitern und der Isolierung Israels im Mittleren Osten und der USA in der Welt beschleunigen sich die Dinge. Was vor einem Jahr noch als wenig wahrscheinlich erschien, wird nun erkennbar. Zwei Wochen nach dem Angriff auf die palästinensische „Hilfsflotte“ haben die Spannungen trotz der Zusagen Tel-Avivs, mehr Hilfsgüterlieferungen in den Gazastreifen zuzulassen, nicht nachgelassen. Im Gegenteil. Zwei US-Kriegsschiffe fuhren durch den Suez-Kanal in den Persischen Golf, während gleichzeitig mehrere israelische atomgetriebene U-Boote, die jedwedes Ziel im Iran erreichen können, sich auf den gleichen Weg begaben. Im Augenblick handelt es sich um Drohgebärden, die den Reden Obamas gegen Teheran Nachdruck verleihen sollen. Aber der internationale Kontext und die imperialistischen Spannungen haben ein solches Ausmaß angenommen, dass man ein gewisses Abgleiten oder eine neue „geplantere“ Episode der wahnsinnigen Flucht nach vorn hin zum Krieg in einer zerfallenden kapitalistischen Welt nicht ausschließen kann. Wilma, 28.6.10
1 [206]) Die Waffen, insbesondere Drohnen wie die Heron, welche von Israel an EU-Staaten oder an die USA für deren Kriegsführung in Afghanistan verkauft werden, oder auch diejenigen, welche im Krieg zwischen Georgien und Abchasien 2008 zum Einsatz kamen, werden in der Werbung mit der Aussage angepriesen: „Im Krieg getestet“, d.h. in den besetzten Gebieten.
2 [207]) Man muss wissen, dass Israel auf ökonomischer und militärischer Ebene sich den Löwenanteil im irakischen Kurdistan unter den Nagel gerissen hat, womit das Land ein direkter Konkurrent mit der Türkei wird.
3 [208]) Der Angriff gegen die „humanitäre Flotte“ am 31. Mai hatte zur Folge, dass der 2. Gipfel der Mittelmeerunion, der so sehr dem kleinen Zwerg aus dem Elysée-Palast am Herzen liegt, bis November verschoben wurde. Diese Union befürwortete unter anderem die Integration Israels bei der Aufrechterhaltung des Friedens im Mittelmeer. Nachdem der erste Gipfel völlig durch den Angriff Israels auf den Gazastreifen geprägt worden war, verdient die Rechte Frankreichs erneut ihren Titel, die dümmste herrschende Klasse der Welt zu sein.
4 [209]) Man sieht, dass der „Energiekrieg“ eine immer schärfere und dramatischere Wende um den Iran annimmt, welche Washington immer größere Schwierigkeiten bereitet und es zu neuen Fehlern treibt. So hat der Iran mit Pakistan ein Abkommen im Wert von 7 Milliarden Dollar unterzeichnet, wodurch der Bau einer Gasleitung vom Iran nach Pakistan gestartet werden soll. Das 17 Jahre alte Projekt war bislang von den USA blockiert worden. Ungeachtet dessen hat der Iran schon 900 der 1500 dieser Gasleitung gebaut, von den Quellen in South Pars bis zur Grenze mit Pakistan, das die verbleibenden 700 km Leitung bauen wird. Durch diesen Energiekorridor werden von 2014 an jeden Tag aus dem Iran ca. 22 Millionen Kubikmeter Gast in Pakistan ankommen. China möchte auch gerne iranisches Gas importieren: Die China Petroleum Company hat mit dem Iran den Abkommen im Wert von 5 Milliarden Dollar für die Entwicklung der Förderstätte von South Pars unterzeichnet. Für den Iran handelt es sich also um ein strategisch bedeutsames Projekt. Nach Russland besitzt der Iran die größten Gasreserven; dabei sind die größten Vorkommen noch gar nicht erschlossen. Mittels des Energiekorridors Richtung Osten kann der Iran die von den USA gewünschten Sanktionen umgehen. Aber es gibt einen Schwachpunkt: sein größtes Gasvorkommen, South Pars, liegt offshore im Persischen Golf. Damit könnte das Land einer Seeblockade ausgesetzt werden, wie jene, welche die USA schon ausüben, wobei sie sich auf die vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen Sanktionen stützen.
Aktuelles und Laufendes:
- Gaza [210]
- Hilfsflotte Gaza [211]
- Drohungen Iran [212]
- Türkei Imperialismus [213]
- Konflikt Israel Palästina [214]
Weltrevolution - 2011
- 3771 Aufrufe
Weltrevolution - 164
- 2668 Aufrufe
Alle „Heilmittel“ der Herrschenden verschlimmern die Lage nur noch
- 2422 Aufrufe
Der Kapitalismus steckt in einer Sackgasse:
Die „Rettung“ europäischer Staaten
Just zum Zeitpunkt, als Irland über sein „Rettungspaket“ verhandelte, räumte der Internationale Währungsfond ein, dass Griechenland nicht in der Lage sei, die Gelder zurückzuzahlen, welche der IWF und die EU im April 2010 ausgehandelt und die zu einer Umschichtung der Schulden Griechenlands geführt hatten. Der IWF vermied das Wort „Zahlungsunfähigkeit“. Strauss-Kahn, Chef des IWF, zufolge sollte der Zeitraum, in dem Griechenland die sich aus dem „Rettungsplan“ resultierenden Schulden zurückzahlen muss, von 2014 auf das Jahr 2015 verlängert werden – in Anbetracht der Geschwindigkeit, mit der sich die Staatskrisen in Europa ausweiten, also bis zum Sankt Nimmerleinstag. Dies spiegelt die ganze Zerbrechlichkeit einer Reihe, wenn nicht gar der meisten europäischen Staaten wider, die unter der Schuldenkrise ächzen.
Sicher, dieses neue „Geschenk“ für Griechenland geht mit zusätzlichen Sparmaßnahmen einher. Nach den Sparbeschlüssen vom April 2010, die zur Streichung von zwei Monatsrenten, zu Lohnkürzungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes und Preiserhöhungen (Strom, Heizung, Alkohol, Tabak etc.) führten, wird an einem weiteren Plan für Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst gebastelt.
Ein ähnliches Szenario lässt sich auch in Irland beobachten, wo die ArbeiterInnen das vierte Sparpaket hintereinander schlucken sollen. Im Jahr 2009 wurden Lohnsenkungen zwischen fünf und 15 Prozent beschlossen, Sozialleistungen wurden gestrichen, in die Rente entlassene Mitarbeiter nicht mehr ersetzt. Der neue Sanierungsplan, der als Vorbedingung für den „Rettungsschirm“ für Irland ausgehandelt worden war, umfasst Kürzungen des Mindestlohnes um 11,5 Prozent, eine weitere Kürzung von Sozialleistungen, die Streichung von 24.750 Stellen im öffentlichen Dienst und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 21 auf 23 Prozent. Und wie im Fall Griechenlands ist es offensichtlich, dass ein Land, das lediglich 4,5 Millionen Einwohner hat und dessen Bruttoinlandsprodukt (BIP) 164 Milliarden Euro betrug, nicht in der Lage ist, ein Rettungspaket in Höhe von 85 Milliarden Euro zurückzuzahlen. Es besteht kein Zweifel daran, dass dieses drakonische Sparregime die Arbeiterhaushalte und den größten Teil der Bevölkerung dieser Länder in solche Schwierigkeiten stürzen wird, dass viele weder ein noch aus wissen.
Die Unfähigkeit anderer Länder wie Portugal, Spanien, etc., ihre Schulden zu begleichen, ist mittlerweile sattsam bekannt. Auch in diesen Ländern sind bereits Sparpakete geschnürt worden, auch hier werden weitere folgen.
Wozu dienen die diversen „Rettungsschirme“? Was soll damit gerettet werden?
(…) Eins ist sicher: Sie dienen nicht dazu, Millionen von Menschen vor der Verarmung zu bewahren (…) Auslöser der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands ist das phänomenale Haushaltsdefizit, das infolge ausufernder öffentlicher Ausgaben (insbesondere im Rüstungsbereich) entstanden war und das durch die staatlichen Steuereinnahmen, die durch die Zuspitzung der Krise 2008 weiter gesunken war, nicht mehr gegenfinanziert werden konnte. Auch der irische Staat und sein Bankensystem hatten einen Schuldenberg von 1.432 Milliarden Euro angehäuft (dabei beträgt das irische BIP gerade einmal 164 Milliarden Euro, was ein Schlaglicht auf die ganze Absurdität der gegenwärtigen Lage wirft). Als es zur o.g. Verschärfung der Krise gekommen war, konnten die Zinsen nicht mehr beglichen werden. So musste das Bankenwesen zum Großteil verstaatlicht und die Forderungen an den Staat übertragen werden. Nachdem ein kleiner Teil der Schulden beglichen war, hatte Irland 2010 mit einem Staatsdefizit von 32 Prozent des BIP zu kämpfen. Auch wenn der Werdegang dieser beiden Volkswirtschaften unterschiedlich ist, sind die Folgen – neben dem wahnwitzigen Ausmaß der Schulden – die gleichen. In beiden Fällen musste der Staat die durch die gigantische öffentliche wie private Verschuldung beeinträchtigte Vertrauenswürdigkeit wiederherzustellen versuchen, indem er für die finanziellen Verpflichtungen einsprang.
Die Folgen einer Zahlungsunfähigkeit Griechenlands und Irlands reichen weit über die Grenzen der beiden Länder hinaus. Es ist dieser Umstand, der für Panik in den höchsten Kreisen der herrschenden Klasse weltweit sorgt. So wie die irischen Banken beträchtliche Mengen an Schuldscheinen aus einer Reihe von Staaten überall auf der Welt besitzen, haben die Banken der großen Industrieländer erhebliche Forderungen gegenüber dem griechischen und irischen Staat. Es gibt keine übereinstimmenden Zahlen über den exakten Umfang der Forderungen gegenüber dem irischen Staat. Einige Quellen, die eher „durchschnittliche“ Zahlen nennen, sprechen von Forderungen französischer Banken in Höhe von 21,1 Mrd. Euro (Quelle: Les Echos); es folgen deutsche Banken (46 Mrd.), britische (42,3 Mrd.) und US-amerikanische Banken (24,6 Mrd. Euro). Gegenüber Griechenland belaufen sich die Forderungen französischer Banken auf 75 Mrd. Euro, Schweizer Banken auf 63 Mrd. und deutscher Banken auf 43 Mrd. Euro. Eine Zahlungsunfähigkeit Griechenlands und Irlands hätte die großen Gläubigerbanken in große Schwierigkeiten gebracht und somit auch die hinter ihnen stehenden Staaten. Dies trifft insbesondere auf jene Staaten zu, die sich wie Portugal und Spanien ebenfalls in einer kritischen Lage befinden und ebenfalls Forderungen gegenüber Griechenland und Irland geltend machen. Für diese Länder wäre der Staatsbankrott Griechenlands und Irlands fatal gewesen.
Eine Weigerung der EU und des IWF, strauchelnden Ländern wie Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, etc Garantien zu gewähren, hätte eine „Rette-wer-sich-kann“-Reaktion ausgelöst und mit Sicherheit den Bankrott der Schwächsten unter ihnen bewirkt. Der Euro wäre zusammengebrochen, Finanzstürme entfesselt worden. Die Folgen des Bankrotts der Lehmann-Bank im Jahre 2008 wären im Vergleich zu dem Sturm, den dies ausgelöst hätte, wie ein laues Lüftchen erschienen. Mit anderen Worten: als die EU und der IWF Griechenland und Irland zu Hilfe eilten, ging es ihnen nicht vorrangig um die Rettung der beiden Staaten und schon gar nicht um das Wohlergehen der Bevölkerung beider Länder, sondern darum, den Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems zu verhindern.
Nicht nur in Irland, Griechenland und anderen südeuropäischen Länder hat sich die Lage rapide verschlechtert, wie folgende Zahlen belegen: „Im Januar 2010 wurden folgende Verschuldungsraten (prozentual im Verhältnis zum BIP )registriert: 470 Prozent Vereinigtes Königreich und Japan: Ihnen gebührt die Goldmedaille in der Gesamtverschuldung; 360 Prozent Spanien, 320 Prozent Frankreich, Italien und die Schweiz, 300 Prozent die USA, 280 Prozent Deutschland.“(3) Alle Länder – ob sie der Euro-Zone angehören oder nicht – sind derart verschuldet, dass sie diese nie mehr zurückzahlen können. Doch die Euro-Länder haben es mit einem weiteren Problem zu tun: Einmal verschuldet, haben sie nicht die Möglichkeit, sich selbst Geldmittel zu beschaffen, um ihre Defizite zu „finanzieren“, denn dazu sind allein besondere Institutionen wie die Europäische Zentralbank (EZB) befugt. Andere Länder wie Großbritannien oder die USA stehen nicht vor diesem Problem, da sie ihr Geld selbst drucken können.
Wie auch immer, das Verschuldungsniveau der Staaten macht deutlich, dass ihre Verpflichtungen die Tilgungsmöglichkeiten bei weitem übersteigen. All das hat absurde Ausmaße angenommen. Berechnungen zufolge müsste Griechenland jährlich Haushaltsüberschüsse von 16 bis 17 Prozent erzielen, um seine Staatsverschuldung auch nur zu stabilisieren. Tatsächlich aber haben sich alle Staaten der Welt derart verschuldet, dass eine Rückzahlung ausgeschlossen ist.(4) Das heißt aber umgekehrt auch, dass die Staaten auf Forderungen sitzen bleiben, die nie beglichen werden. Die folgende Statistik mit Zahlen über die Verschuldung eines jeden europäischen Landes (die Verschuldung der Banken nicht mit einbezogen) vermittelt einen Eindruck vom Umfang der Schulden und von der Zerbrechlichkeit der am höchsten verschuldeten Länder.
Der Kapitalismus kann nur dank seiner Rettungsprogramme überleben
Das „Rettungsprogramm“ für Griechenland hat 110 Mrd. Euro, das für Irland 85 Mrd. Euro gekostet. Diese vom IWF, der EU und Großbritannien (Letzteres stellte 8,5 Milliarden Euro bereit, während die Cameron-Regierung gleichzeitig ihr eigenes Sparprogramm umsetzt, das zum Ziel hat, die öffentlichen Ausgaben bis 2015 um 25 Prozent zu kürzen) zur Verfügung gestellten Gelder werden aus dem „Reichtum“ der verschiedenen Länder gespeist. Mit anderen Worten: die Mittel für die Rettungspläne rühren nicht aus etwaigen neu geschaffenen Quellen her, sondern stammen direkt aus der Notenpresse. Diese Unterstützung des Finanzsektors, der die Realwirtschaft finanziert, läuft in Wirklichkeit auf eine Ankurbelung der wirtschaftlichen Aktivitäten hinaus. Während also einerseits drastische Sparprogramme verabschiedet werden, die von noch drastischeren Sparprogrammen abgelöst werden, sind die Staaten andererseits gezwungen, kostspielige Unterstützungsmaßnahmen zu ergreifen, um einen Kollaps des Finanzsystems und die Blockade der Weltwirtschaft zu verhindern – Maßnahmen, die in ihrem Kern Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung sind. Die USA sind am weitesten in diese Richtung gegangen: Die zweite Auflage des so genannten quantitative easing in Höhe von 900 Mrd. Dollar ist im Wesentlichen der Versuch, das amerikanische Finanzsystem zu retten, das auf einem Berg fauler Kredite sitzt. Gleichzeitig soll dadurch das US-Wachstum angestoßen werden. Die USA, die noch immer vom Vorteil des Dollars als weltweite Referenzwährung nutznießen, unterliegen nicht den gleichen Zwängen wie Griechenland oder Irland. Es ist daher nicht auszuschließen, dass demnächst eine dritte Auflage des quantitative easing verabschiedet wird, wie viele vermuten. Zweifellos unterstützt die Obama-Administration die US-Wirtschaft weitaus stärker, als dies in Europa der Fall ist. Doch auch den USA bleibt es nicht erspart, drastische Sparmaßnahmen zu ergreifen, wie das jüngst von Präsident Obama vorgeschlagene Einfrieren der Gehälter der Bediensteten der Bundesstaaten zeigt. Tatsächlich zeichnen sich alle Staaten durch diese Widersprüchlichkeit in ihrer Wirtschaftspolitik aus.
Die Herrschenden sind über die Schuldengrenze, die das kapitalistische System verkraften kann, hinausgegangen.
In einem Atemzug werden Sparprogramme und Konjunkturpakete verabschiedet. Wie ist eine solch widersprüchliche Politik zu erklären? Wie Marx aufzeigte, leidet der Kapitalismus grundsätzlich an einem Mangel von Absatzmärkten. Die Ausbeutung der Arbeiterklasse führt zwangsläufig zur Schaffung eines Mehrwerts, der größer ist als die Summe der ausgezahlten Löhne, da die Arbeiterklasse viel weniger konsumiert, als sie produziert. Lange Zeit – nämlich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts – hatte die kapitalistische Klasse dieses Problem durch die Eroberung von Territorien, in denen noch vorwiegend unter vorkapitalistischen Verhältnissen produziert wurde – kompensiert. Sie zwang die Bevölkerung in den Kolonien auf unterschiedliche Weise zum Kauf ihrer kapitalistisch produzierten Waren. Die Krise und Kriege des 20. Jahrhunderts haben deutlich werden lassen, dass diese Art des Umgangs mit der Überproduktion, die der kapitalistischen Ausbeutung der Produktivkräfte eigen ist, an ihre Grenzen gestoßen war. Anders ausgedrückt: die außerkapitalistischen Territorien auf der Welt reichten nicht mehr aus, diesen Warenüberschuss, dessen Realisierung (sprich: Verkauf) erst die erweiterte Akkumulation ermöglicht, aufzunehmen.
Die Ende der 1960er Jahre einsetzenden Verwerfungen der Weltwirtschaft, die sich in Währungskrisen und Rezessionen äußerten, verdeutlichten eben diesen Mangel an außerkapitalistischen Märkten als ein Mittel zur Absorbierung der überschüssigen kapitalistischen Produktion. Die einzige Lösung bestand in der Schaffung eines künstlichen, schuldenfinanzierten Marktes. So konnten die Kapitalisten ihre Waren an Staaten, Unternehmen und Privathaushalte verkaufen, ohne dass diese über die eigentlich erforderliche Kaufkraft verfügen mussten.
Wir haben dieses Problem oft angesprochen und betont, dass der Kapitalismus die Politik der Verschuldung als ein Hilfsmittel benutzt hat, um die Überproduktionskrise einzudämmen, in die er seit Ende der 60er Jahre wieder versunken ist. Doch Schulden lösen nicht in Luft auf, sie müssen mitsamt den Zinsen früher oder später beglichen werden, andernfalls kommt der Gläubiger nicht auf seine Kosten, sondern läuft selbst Gefahr, pleite zu gehen.
Immer mehr europäische Staaten geraten zunehmend in eine Lage, in der sie ihre Schulden nicht mehr begleichen können. Mit anderen Worten, diese Staaten müssen ihre Schulden reduzieren. Dies geschieht insbesondere durch Einschnitte auf der Ausgabenseite, obwohl der Krisenverlauf während der vergangenen 40 Jahre deutlich gemacht hat, dass die wachsende Verschuldung absolut notwendig war, um die Weltwirtschaft vor noch größeren Erschütterungen zu bewahren. Es ist dieser unlösbare Widerspruch, mit dem es mehr oder weniger alle Staaten heute zu tun haben.
Die finanziellen Erschütterungen, die gegenwärtig in Europa zu konstatieren sind, sind letztendlich das Resultat der antagonistischen Widersprüche des Kapitalismus. Sie verdeutlichen die Ausweglosigkeit dieser Produktionsweise. Andere Merkmale der gegenwärtigen Lage sind noch nicht erwähnt, spielen aber ebenfalls eine wichtige Rolle.
Die Inflation zieht wieder an
Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem viele Länder auf der Welt zu mehr oder weniger drastischen Sparmaßnahmen greifen, die zu einer Senkung der Binnennachfrage, auch die nach Grundnahrungsmitteln, führen werden, steigen allerorten die Lebensmittelpreise stark an. Binnen eines Jahres ist der Preis für Baumwolle um mehr als 100 Prozent in die Höhe geschnellt, die Preise für Weizen und Mais zwischen Juli 2009 und Juli 2010 um mehr als 20 Prozent gestiegen (3). Eine ähnliche Preisentwicklung ist auch auf den Metall- und Erdölmärkten zu verzeichnen. Sicherlich spielen klimatische Faktoren eine gewisse Rolle in der Entwicklung der Agrarpreise, jedoch ist der Preisanstieg so hoch, dass auch andere Faktoren notwendigerweise mit ins Auge gefasst werden müssen. Alle Staaten machen sich Sorgen um die Inflation, die immer stärker wird. Einige Beispiele aus den „Schwellenländern“:
· Offiziell hat die Inflation in China im November 2010 ein Jahreshoch von 5,1 Prozent erreicht, doch alle Experten stimmen darin überein, dass die wirkliche Inflation zwischen acht und zehn Prozent beträgt.
· In Indien war die Inflation im Oktober 2010 auf 8,6 Prozent gestiegen.
· In Russland betrug sie 2010 8,5 Prozent.
Das Anziehen der Inflationsrate ist kein auf die Schwellenländer beschränktes Phänomen, denn auch die hoch entwickelten Industrieländer sind immer stärker davon betroffen: Schon die 3,3 Prozent in Großbritannien im Oktober und die 1,9 Prozent in Deutschland werden mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, befindet sich die Inflation doch noch immer im Anstieg.
Wie lässt sich die Rückkehr der Inflation erklären?
Die Ursache der Inflation liegt nicht immer in einer zu hohen Nachfrage im Verhältnis zum Angebot begründet, die den Anbietern Preiserhöhungen ermöglicht, ohne zu befürchten, dass sie ihre Waren nicht mehr loswerden. Ein anderer Faktor, der ursächlich wirkt und seit drei Jahrzehnten festzustellen ist, ist das Ansteigen der Geldmenge. Der Einsatz der Notenpresse, d.h. die Ausgabe neuen Geldes ohne einen entsprechenden Anstieg der Warenproduktion, führt zwangsläufig zu einer Abwertung der Währung oder umgekehrt zu Preiserhöhungen. Alle seit 2008 veröffentlichten Daten weisen auf einen starken Anstieg der Geldmenge in den großen Wirtschaftsräumen der Erde hin.
Ein weiterer preistreibender Faktor ist die Spekulation. Bei einer zu geringen Nachfrage, insbesondere aufgrund von Stagnation oder sinkender Löhne, können die Unternehmen die Preise für ihre Produkte nicht erhöhen, da sie auf dem Markt nicht abgesetzt werden können und sie somit Verluste hinnehmen müssen. Die Unternehmen bzw. Investoren stellen folglich ihre Investition in eine Produktion ein, die nicht rentabel und somit zu riskant ist. Stattdessen suchen sie nach anderen Anlagemöglichkeiten: den Erwerb von Finanzprodukten, Rohstoffen oder Währungen, in der Hoffnung, diese mit einem satten Gewinn weiter zu veräußern. Diese Produkte werden zu Spekulationsobjekten. Das Problem dabei ist, dass viele dieser Produkte, besonders die landwirtschaftlichen Rohstoffe, gleichzeitig Waren sind, die von einem Großteil der ArbeiterInnen, Bauern, Arbeitslosen etc. konsumiert werden. So wird der überwiegende Teil der Weltbevölkerung nicht nur mit Lohnsenkungen konfrontiert, sondern auch mit drastischen Preiserhöhungen bei Reis, Brot, Kleidung etc.
Deren Preise sind seit Anfang 2010 stark angestiegen. Gleiche Ursachen – gleiche Wirkungen: Bereits 2007/08 lösten drastische Preiserhöhungen bei den Grundnahrungsmitteln wie Reis und Weizen, die beträchtliche Teile der Weltbevölkerung in große Not stürzten, Hungerrevolten aus. Die Folgen des gegenwärtigen Preisauftriebs sind bereits in den aktuellen Revolten in Tunesien und Algerien deutlich geworden.
Die Inflationsrate steigt unvermindert an. Dem „Cercle Finance“ vom 7. Dezember zufolge ist die Zinsrate für T-Bonds mit zehnjähriger Laufzeit von 2,94 auf 3,14 Prozent und die Bonds mit 30jähriger Laufzeit von 4,25 auf 4,425 Prozent angestiegen. Das heißt, die Kapitalisten selbst rechnen mit einem Wertverlust des Geldes und erwarten höhere Zinsen für ihre Anlagen.
Die Spannungen zwischen den nationalen Kapitalen
Während der Großen Depression in den 1930er Jahren erlebte der Protektionismus als Mittel des Handelskriegs seine Blütezeit; stellenweise war es gar zu einer „Regionalisierung“ des Warenaustausches gekommen. Und heute? Im Gegensatz zu den frommen Erklärungen des jüngst in Seoul stattgefundenen G20-Gipfels, in denen die Teilnehmerstaaten den Protektionismus einhellig ablehnten, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Protektionistische Tendenzen nehmen stetig zu, man nennt sie nur nicht so, sondern verschämt „Wirtschaftspatriotismus“. Die Liste protektionistischer Maßnahmen, die die Staaten bereits ergriffen haben, ist viel zu lang, um sie hier zu zitieren. Wir wollen hier lediglich erwähnen, dass die USA im September vergangenen Jahres bereits insgesamt 245 sog. Antidumpingmaßnahmen in ihrem Repertoire hatten, dass Mexiko von März 2009 an 89 Gegenmaßnahmen gegen die USA eingeleitet hat und dass China eine drastische Einschränkung des Export von „seltener Erden“, die zur Herstellung eines Großteils der Produkte der heutigen Hochtechnologie benötigt werden, beschlossen hat.
Gegenwärtig jedoch stellt der Währungskrieg das Hauptmerkmal des Handelskriegs dar. Wie oben geschildert, war die zweite Auflage des quantitative easing aus Sicht des US-amerikanischen Kapitals notwendig, führte aber gleichzeitig – durch die permanente Ausgabe neuer Banknoten – zum Wertverlust des Dollars und damit zum Wertverlust der Produkte „made in USA“ auf dem Weltmarkt. Diese Politik ist eine besonders aggressive Variante des Protektionismus, und mit der Unterbewertung des Yuan verfolgt das chinesische Regime ähnlich Ziele.
Und dennoch: ungeachtet des sich verschärfenden Wirtschaftskriegs sahen sich die rivalisierenden Staaten gezwungen, eine Übereinkunft anzustreben, um die Zahlungsunfähigkeit Griechenlands und Irlands zu verhindern. Was nichts anderes heißt, als dass die herrschende Klasse sich auch hier in eine widersprüchliche Politik verwickelt, die ihr durch die total Sackgasse des Systems aufgezwungen wird.
Hat die herrschende Klasse eine Lösung in parat? Im Grunde bleibt ihr nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder bewegt sie, wie im Fall Griechenlands und Irlands, eine Menge Geld, was zu einer Entwertung desselben und zu inflationären Tendenzen führt, die sich im Laufe der Zeit zu einer galoppierenden Inflation auswachsen könnten. Oder sie betreibt eine drastische Sparpolitik, die auf eine Eindämmung der Neuverschuldung abzielt und die von Deutschland hinsichtlich der Euro-Zone favorisiert wird. Die Folge wäre ein Absturz in die Depression, mit ähnlichen Produktionsrückgängen wie in Griechenland, Irland und Spanien nach der Verabschiedung ihrer Sparpakete.
Der einzige Ausweg aus der Sackgasse des Kapitalismus ist die Entwicklung von Kämpfen, die die Arbeiterklasse immer häufiger, massiver und bewusster führen muss. Diese Kämpfe müssen letztendlich zu einer Überwindung des kapitalistischen Gesellschaftssystems führen, dessen Hauptwiderspruch darin besteht, für den Profit und nicht für die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen zu produzieren.
(leicht gekürzte Fassung eines Artikels aus unserer International Review, Nr. 144, 1. Quartal 2011).
Aktuelles und Laufendes:
- Wirtschaftskrise [167]
- Währungskrieg [123]
- Rettungspakete [215]
- Inflation [216]
Auch in Großbritannien – die junge Generation nimmt den Kampf auf
- 2015 Aufrufe
Am ersten Samstag nach der Ankündigung des brutalen Sparpakets der Regierung mit drastischen Kürzungen der Staatsausgaben am 23. Oktober, haben einige, von den Gewerkschaften organisierte Demonstrationen im ganzen Land stattgefunden. Die hohe, im ganzen Land unterschiedliche Teilnehmerzahl ließ das Ausmaß der Wut erahnen (in Belfast beteiligten sich 15.000, in Edinburgh 25.000). Ein anderes Beispiel ist die Rebellion der Studenten gegen die Erhöhung der Studiengebühren um bis zu 300%.
Die bisherigen Studiengebühren führten schon zu gewaltigen Schuldenbergen, die sie nach Studienabschluss zurückzahlen müssen. Die Erhöhung der Studiengebühren haben im ganzen Land eine Reihe von Demonstrationen ausgelöst (5 Mobilisierungen innerhalb eines Monats im November –am 10., 24. und 30.; am 4. und 9. Dezember).
Diese Erhöhung wurde im Parlament am 8. Dezember trotz der Proteste beschlossen. Es haben sich einige Kampfherde herausgebildet: in den Universitäten, in den Colleges (die in Deutschland der gymnasialen Oberstufe entsprechen). Universitäten wurden besetzt, zahlreiche Versammlungen auf dem Campus oder auf den Straßen abgehalten, um über den Kampf zu diskutieren. Die Studenten und Schüler werden von zahlreichen Lehrkräften unterstützt.
Die herrschende Klasse hat große Angst vor dieser Bewegung. Ein klares Zeichen dafür ist das Niveau der Polizeirepression gegen die Demonstranten. Die meisten Versammlungen endeten mit gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der bürgerkriegsmäßig ausgerüsteten Polizei und den Demonstranten. Die Polizei verfolgte eine Taktik der Einkesselungen, verprügelte unzählige Demonstranten. Zahlreiche Personen wurden verletzt und verhaftet, vor allem in London. Am 10. November hatten Studenten den Sitz der Konservativen Partei gestürmt, am 8. Dezember versuchten sie ins Finanzministerium und das höchste Gericht vorzudringen. (…)
Die Studenten und ihre Unterstützer waren in friedfertiger Stimmung zu den Kundgebungen gekommen; sie hatten ihre eigenen Spruchbänder hergestellt. Einige Teilnehmer waren zum ersten Mal zu einer Demo gekommen. Die spontanen Arbeitsniederlegungen, die Stürmung des Sitzes der Konservativen Partei in Millbank, die Auseinandersetzungen an den Polizeiabsperrungen, die Art und Weise, wie diese umgangen wurden, die Besetzung der Rathäuser und anderer öffentlicher Gebäude sind nur einige Beispiele dieser offen rebellischen Haltung. Die Studenten waren erzürnt und erbittert über die Haltung von Porter Aaron, dem Vorsitzenden der NUS (Studentengewerkschaft), der die Stürmung des Sitzes der Konservativen verurteilt hatte und die Gewalt einer winzigen Minderheit unter die Schuhe schob. Am 24. November wurden Tausende Demonstranten in London eingekesselt, sobald sie vom Trafalgar Square losgezogen waren, und trotz einiger erfolgreicher Versuche, die polizeilichen Absperrungen zu durchbrechen, haben die Polizeikräfte Tausende Demonstranten stundenlang in eisiger Kälte festgehalten. Berittene Polizei ist in die eingekesselte Demonstrantenmenge eingedrungen. In Manchester, Lewisham Town Hall und anderen Städten die gleichen Szenen.
Nach der Stürmung des Parteisitzes der Konservativen in Millbank haben die Zeitungen Fotos von angeblichen Krawallmachern und Horrorgeschichten über revolutionäre Gruppen veröffentlicht, die angeblich die Jugend im Lande mit ihrer unheilvollen Propaganda verführen. All das zeigt das wahre Gesicht der „Demokratie“, in der wir leben. Die Studentenrevolte in Großbritannien ist die beste Widerlegung der Behauptung, dass die Arbeiterklasse in Großbritannien passiv all die Angriffe durch die Regierung gegen alle Lebensbereiche hinnehmen werde: Job, Löhne, Gesundheitswesen, Arbeitslosigkeit, Zahlungen für Behinderte und Ausbildungsförderungen. Eine ganze Generation der Arbeiterklasse ist nicht mehr bereit, die Logik der Ausbeutung und die Sparmaßnahmen, welche die Herrschenden und ihre Gewerkschaften aufzwingen, zu schlucken. 14.1.2011
Der Klassenkampf ist international - Unsere Zukunft liegt in den Händen des Klassenkampfes
- 2054 Aufrufe
Unsere Zukunft liegt in den Händen des Klassenkampfes
Studenten haben in mehreren Ländern gegen Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsbedingungen, Erhöhung von Studiengebühren, Kürzungen im Bildungswesen usw. protestiert – hier erwähnen wir nur Großbritannien, Italien und die Niederlande. In den USA haben mehrere größere Streiks, auch wenn sie in der gewerkschaftlichen Zwangsjacke steckenblieben, seit Frühjahr 2010 stattgefunden, um sich den Angriffen zu widersetzen: im Erziehungswesen in Kalifornien, im Gesundheitswesen (Krankenschwestern) in Philadelphia und Minneapolis-Saint-Louis, Bauindustrie in Chicago, Nahrungsmittelindustrie in New York, Lehrer in Illinois, Beschäftigte bei Boeing, und einem Coca-Cola-Werk in Bellevue (Washington), Hafenarbeiter in New Jersey und Philadelphia.
Zum Zeitpunkt des Schreiben dieses Artikels breitet sich im Maghreb, insbesondere in Tunesien, die seit Jahrzehnten angehäufte Wut aus, nachdem sich ein Jugendlicher am 17. Dezember öffentlich verbrannt hatte (siehe dazu Artikel in dieser Ausgabe).
Die Wirtschaftskrise und die herrschende Klasse schlagen überall auf der Welt zu. In Algerien, Jordanien, China und anderen Ländern sind die Proteste gegen die Verarmung äußerst brutal niedergeschlagen worden. Diese Repression muss die Arbeiter/Innen der Industriestaaten, die über eine größere Erfahrung verfügen, dazu bewegen, sich über die Sackgasse bewusst zu werden, in welcher der Kapitalismus steckt, um ihre Solidarität gegenüber ihren Klassenbrüdern- und Schwestern durch die Entfaltung des Klassenkampfes zum Ausdruck zu bringen. Schrittweise fangen die Beschäftigten langsam an, sich gegen die Verarmung, die Sparpolitik und die von ihnen abverlangten Opfer zu wehren.
Im Augenblick reicht diese Reaktion noch nicht aus und hinkt weit hinter dem Niveau der Angriffe zurück. Aber eine Dynamik hat eingesetzt, das offene Nachdenken und die Kampfbereitschaft werden weiter zunehmen. Ein Beleg dafür ist, dass Minderheiten versuchen sich selbst zu organisieren, aktiv zur Entfaltung massiver Kämpfe beizutragen und sich von den gewerkschaftlichen Fesseln zu lösen. Ein Beispiel dafür ist die Versammlung am Pariser Ostbahnhof, von der wir einen Aufruf in dieser Zeitung veröffentlichen.14.1.2011
Aktuelles und Laufendes:
Deutsche Konjunktur: Alles Gold was glänzt?
- 2235 Aufrufe
Zu Jahresanfang verkündeten Wirtschaftsforschungsinstitute, Regierungsstellen usw. , man habe ein „tolles Jahr“ hinter sich, mittlerweile sei nach dem großen Zittern der vergangenen Jahre wieder Optimismus eingekehrt, das Weihnachtsgeschäft habe alle Erwartungen übertroffen, Wachstumsprognosen werden laufend nach oben revidiert, der höchste Anstieg der deutschen Wirtschaftsleistung seit über zwei Jahrzehnten sei 2010 verbucht worden, die Arbeitslosenzahlen seien noch nie so niedrig gewesen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Also, alles in Butter?
Exporterfolge – ein zweischneidiges Schwert
Obwohl Deutschland von China als Exportweltmeister überholt wurde, spielen die deutschen Exporte mehr denn je eine zentrale Rolle für die Wirtschaft. So konnten die Ausfuhren nach Asien um 36%, nach China um 55%, nach Nord- und Südamerika um 23% und nach Europa um 10% gesteigert werden. Der deutsche Weltmarktanteil lag zwischen 2005 und 2009 bei elf Prozent. Worauf ist der Erfolg der fortgesetzten deutschen Exportoffensive zurückzuführen? Zunächst wurde die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals durch eine seit Jahren dauernde Senkung der Löhne, Intensivierung des Arbeitsrhythmus usw. gesteigert. Dann konnten Abnehmer leichter gefunden werden dank der riesigen Konjunkturpakete, die in den USA, China, Japan, Russland, Brasilien usw. astronomische Summen von Geld in die Wirtschaft pumpten. Insgesamt wurden seit der Beschleunigung der Wirtschaftskrise über 3.000 Milliarden Dollar in Umlauf gebracht. Zudem begünstigte der vorübergehende Kursverlust des Euros die Exportbemühungen, weil dadurch die deutschen Exporte in den Dollarraum und andere Währungsräume verbilligt wurden. Und was nicht alles verkauft wird! Deutschland ist mittlerweile zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt geworden und hält einen Weltmarktanteil am Rüstungsgeschäft von ca. 10%. Indien will z.B. 126 Eurofighter kaufen. Auch im Ausbau von Grenzanlagen ist das deutsche Kapital führend. Die Geschichte zahlt sich aus! (1)
Während die deutsche Exportwirtschaft zwar wieder an Fahrt gewonnen hat, nachdem sie zuvor massive Einbrüche von 20-50% hinnehmen musste (der Markt in Russland war während der Krise 2009 um 50% eingebrochen), kraxeln die anderen europäischen Wirtschaften und die USA weiter am Boden herum. In den anderen Ländern Europas schwankt das Wachstum nämlich zwischen 0 bis 1%. Die deutsche Wirtschaft kann nicht die Rolle einer Lokomotive übernehmen, da ihr Erfolg gerade u.a. darin besteht, nicht die anderen mit zu ziehen, sondern auf deren Kosten die deutschen Wettbewerbsvorteile auszubauen.
Während die deutschen Exportrekorde auf der einen Seite die Stärke der deutschen Wirtschaft zum Vorschein bringen, darf damit nicht verborgen bleiben, welche Abhängigkeit vom Export damit entstanden ist. Inzwischen beläuft sich das deutsche Exportvolumen auf fast 44% des deutschen BIP. Sobald die Weltwirtschaft schrumpft, wird der deutsche Export dadurch stärker als die Konkurrenten erfasst. Das deutsche Kapital ist wegen seiner enormen Exportabhängigkeit viel anfälliger für Beben der Weltwirtschaft. Was bedeutet dies?
Trotz großer Exportsteigerungen nach China und Asien insgesamt macht Asien lediglich 15%, Amerika 15% aus, der Löwenanteil der Exporte geht noch immer in die EU – nämlich zwei Drittel. Kommt es u.a. infolge der Sparpakete in den westlichen Industriestaaten zu einem Nachfragerückgang, wirkt sich das auf den deutschen Export viel stärker aus. Der deutsche Handelsüberschuss gegenüber Spanien ist von 26.9 Milliarden Euro im Jahr 2007 auf 12.3 Milliarden Euro im Jahr 2009 gesunken; der Überschuss mit Italien betrug 2007 19,8 Milliarden, im Jahr 2009 13,4 Mrd. Euro; auch gegenüber Griechenland und Portugal wurden rückläufige Handelsüberschüsse registriert.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis dieses Export-Feuerwerk vorüber ist. Irgendwann werden die Konjunkturprogramme verpufft sein, die Sparprogramme die Kaufkraft so stark gesenkt haben, dass diese Sonderstellung Deutschlands und China nicht mehr fortbestehen kann.
Ein weiteres Beispiel: VW will eine Million PKW in Shanghai vom Band laufen lassen; ein Viertel mehr als in Wolfsburg. Innerhalb von drei Jahren sollen vier neue VW-Standorte in China in Betrieb gehen. VW-Vorstandschef Winterkorn: „China ist inzwischen der größte und wichtigste Absatzmarkt der Welt“. Bis 2013 sollen von den chinesischen VW-Dependancen jährlich drei Millionen Autos produziert werden. (2) Somit wird Produktion von Deutschland nach China ausgelagert.
Alles Gold was glänzt?
Zum Jahreswechsel kommentierte die FrankfurterRundschau: „„Wow, die Sensationsnachrichten aus der deutschen Wirtschaft reißen nicht ab. Die Superstar-Economy, wie die hiesige international nur noch genannt wird, stellt nun auch noch die wichtigste Bank der Welt. Diesen Titel verlieh die japanische Finanzaufsicht der Deutschen Bank. (…) Auf den ersten Blick kann man diese Platzierung als Auszeichnung interpretieren, (….[weil] es keine andere Bank gibt, die für das weltweite Finanzsystem relevanter ist. Wer den zweiten Blick bevorzugt (…), den muss es schaudern: Der darf glatt wichtigste Bank mit gefährlichste Bank übersetzen. Und er liegt richtig. Denn die Fragestellung, die der Rangliste zugrunde lag, lautete: Der Kollaps welcher Bank hätte aus Sicht der japanischen Regulierer die gravierendsten Folgen für das weltweite Finanzsystem?“ (FrankfurterRundschau, Kommentar).
In den letzten Jahren hat das deutsche Finanzkapital gierig bei den Spekulationen mitgemischt. Die Folge – deutsche Banken waren auch sehr stark von dem Platzen der verschiedenen Blasen getroffen. Deutsche Banken haben umfangreiche Forderungen gegenüber den jetzt von der Zahlungsunfähigkeit bedrohten PIGS Staaten. Mit über 400 Milliarden Euro stehen die vier finanzschwachen Euro-Staaten gegenüber deutschen Banken in der Kreide (Irland: 138 Milliarden, Portugal: 37 Milliarden Griechenland: 37 Milliarden, Spanien: 182 Milliarden). Allein die HRE hat Forderungen von ca. 35 Milliarden Euro gegenüber Griechenland, Portugal, Spanien, Irland. Bei einem drohenden Kollaps dieser Staaten würde das Beben auch das deutsche Kapital mit in den Strudel ziehen. Dabei hat der deutsche Staat schon große Rettungsringe auswerfen müssen. Liquiditätsgarantien von insgesamt 124 Milliarden Euro wurden für die bankrotte Hypo Real Estate vergeben; die Commerzbank, die zweitgrößte Bank in Deutschland erhielt eine Kreditspritze von nahezu 20 Mrd. Euro. Ohne die staatlichen Rettungsschirme von 10 Milliarden Euro für die Bayern LB, 5 Milliarden für die Landesbank Baden-Württemberg, 3 Mrd. Euro für die WestLB und HSH Nordbank hätten diese nicht überlebt. D.h. die Spirale immer größerer Rettungspakete dreht sich endlos weiter….
Weltweit haben die USA die höchste Staatsverschuldung (knapp 14 Billionen Dollar). Darauf folgen Japan mit 6 Billionen Dollar an zweiter Stelle, gefolgt von Deutschland mit 1,502 Billionen Euro. Während in den großen Industriestaaten ein noch brutaleres Sparpaket nach dem anderen geschnürt wird, hat die Bundesregierung u.a. in Anbetracht der Sonderkonjunktur noch nicht so stark auf die Ausgabenbremse getreten wie anderswo. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch in Deutschland viel umfangreichere Kürzungen vorgenommen werden. Dann werden auch hierzulande die Glocken anders läuten…. Anfang Januar 2011, Dv.
(1) „Indien will für seine Luftwaffe 126 Kampfflugzeuge kaufen; der Preis wird auf bis zu 20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Um den Auftrag bemüht sich trotz starker Konkurrenz unter anderem aus Schweden und Russland der deutsch-französische EADS-Konzern. ThyssenKrupp Marine Systems will Indien U-Boote verkaufen, der Panzerhersteller Krauss-Maffei Wegmann ist ebenfalls auf der Suche nach neuen Kunden. Hintergrund ist, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren voraussichtlich wegen der angekündigten Etatkürzungen bei Neueinkäufen sparen muss. Die deutschen Waffenschmieden, die schon heute 70 Prozent des von ihnen produzierten Kriegsgeräts exportieren, bemühen sich nun verstärkt um Absatzchancen in aller Welt, zumal einige Traditionskunden - insbesondere Spanien und Griechenland - wegen finanzieller Schwierigkeiten ausfallen. Auch Indien soll jetzt mit dem Kauf deutscher Kampfflieger und Panzer die Profite der Rüstungshersteller in die Höhe treiben.
Bis 2014 wird EADS die 9.000 Kilometer lange Außengrenze Saudi-Arabiens mit Zäunen, Infrarotkameras und Bodenradar ausstatten, System für die Überwachung von Flughäfen und Häfen installieren…, ein milliardenschwerer Auftrag.“ German-Foreign-Policy, 19.11.2010).
(2) Selbst bürgerliche Kommentatoren erkennen: „Der chinesische Automarkt profitiert besonders vom staatlichen Konjunkturprogramm und der massiven Ausweitung der Kreditvergabe. Doch rechnet Volkswagen damit, dass diese Effekte abnehmen werden und eine Normalisierung eintreten wird.“ (https://www.abendblatt.de/wirtschaft/article1526410/VW-verdoppelt-Produk... [220])
Aktuelles und Laufendes:
Die Märzaktion 1921: Die Gefahr kleinbürgerlicher Ungeduld
- 2747 Aufrufe
(Wir veröffentlichen hier den ungekürzten Artikel, den wir in unserer Internationalen Revue schon veröffentlicht haben, der in unserer Zeitung aus Platzgründen jedoch gekürzt gedruckt werden muss).
Im vorigen Artikel zum Kapp-Putsch 1920 haben wir herausgestellt, dass die Arbeiterklasse nach den Niederlagen von 1919 wieder auf dem Vormarsch war. Aber weltweit war die revolutionäre Welle doch absteigend.
Die Beendigung des Krieges hatte in vielen Ländern den revolutionären Elan gebrochen und es vor allem der Bourgeoisie ermöglicht, die Spaltung der Arbeiterklasse in Arbeiter der „Siegermächte" und der besiegten Staaten auszunutzen. Zudem schaffte es das Kapital, die revolutionäre Bewegung in Russland immer weiter zu isolieren. Die Siege der Roten Armee über die Weißen Truppen, die von den westlichen bürgerlichen Demokratien kräftig unterstützt wurden, hinderte die herrschende Klasse nicht daran, ihre Konteroffensive international fortzusetzen.
In Russland selber forderten die Isolierung der Revolution und die wachsende Integration der Bolschewistischen Partei in den russischen Staat ihren Preis. Im März 1921 erhoben sich in Kronstadt revoltierende Arbeiter und Matrosen.
Auf diesem Hintergrund sollte in Deutschland die Arbeiterklasse noch immer eine stärkere Kampfbereitschaft zeigen als in den anderen Staaten. Überall standen die Revolutionäre vor der Frage: nachdem der Höhepunkt der internationalen Welle revolutionärer Kämpfe überschritten war und die Bourgeoisie weiter in der Offensive blieb, wie auf diese Situation reagieren?
Innerhalb der Komintern setzte sich eine politische Kehrtwende durch. Die auf dem 2. Kongress im Sommer 1920 verabschiedeten 21 Aufnahmebedingungen verdeutlichten dies klar. Hierin wurde die Arbeit in den Gewerkschaften wie die Beteiligung an den Parlamentswahlen bindend vorgeschrieben. Damit hatte die Komintern einen Rückschritt zu den alten Methoden aus der Zeit des aufsteigenden Kapitalismus gemacht, in der Hoffnung, dass man damit größere Kreise von Arbeiter erreichen würde.
Diese opportunistische Kehrtwende äußerte sich in Deutschland darin, dass die Kommunistische Partei im Januar 1921 einen „Offenen Brief" an die Gewerkschaften und SPD wie auch an die Freie Arbeiterunion (Syndikalisten), USPD und KAPD richtete, in dem „sämtlichen sozialistischen Parteien und Gewerkschaftsorganisationen vorgeschlagen (wurde), gemeinsame Aktionen zur Durchsetzung der dringendsten wirtschaftlichen und politischen Forderungen der Arbeiter zu führen". Durch diesen Aufruf insbesondere an die Gewerkschaften und die SPD sollte die „Einheitsfront der Arbeiter in den Betrieben" hergestellt werden. Die VKPD betonte, „sie wollte zurückstellen die Erinnerung an die Blutschuld der mehrheitssozialdemokratischen Führer. Sie wollte für den Augenblick zurückstellen die Erinnerungen an die Dienste, die die Gewerkschaftsbürokratie den Kapitalisten im Krieg und in der Revolution geleistet hat." (aus „Offener Brief", Rote Fahne, 8.1.1921) Während man mit opportunistischen Schmeicheleien Teile der Sozialdemokratie auf die Seite der Kommunisten ziehen wollte, wurde gleichzeitig in den Reihen der Partei zum ersten Mal die Notwendigkeit einer proletarischen Offensive theoretisiert. Und „sollten die Parteien und Gewerkschaften, an die wir uns wenden, nicht gewillt sein, den Kampf aufzunehmen, so würde die VKPD sich verpflichtet erachten, diesen Kampf allein zu führen, und sie ist überzeugt, dass ihr die Arbeitermassen folgen werden". (ebenda)
Gleichzeitig hatte der im Dezember 1920 vollzogene Zusammenschluss zwischen KPD und USPD, der zur Gründung der VKPD führte, in der Partei die Auffassungen von der Möglichkeit einer Massenpartei erstarken lassen. Dies wurde dadurch verstärkt, dass die Partei jetzt über 500000 Mitglieder verfügte. So ließ sich die VKPD selbst blenden durch den Stimmenanteil bei den Wahlen zum Preußischen Landtag, wo sie im Februar nahezu 30% aller Stimmen erzielte (1).
Die Idee machte sich breit, man könne die Lage in Deutschland „aufheizen". Vielen schwebte die Idee eines Rechtsputsches vor, der wie ein Jahr zuvor im Kapp-Putsch eine mächtige Reaktion der gesamten Arbeiterklasse mit Aussichten auf die Machtergreifung auslösen würde. Diese irrigen Auffassungen sind im wesentlichen auf den verstärkten Einfluss des Kleinbürgertums in der Partei seit dem Zusammenschluss zwischen KPD und USPD zurückzuführen. Die USPD war wie jede zentristische Richtung in der Arbeiterbewegung stark von den Auffassungen und Verhaltensweisen des Kleinbürgertums beeinflusst. Das zahlenmäßige Wachstum der Partei neigte zugleich dazu, das Gewicht des Opportunismus, Immediatismus und der kleinbürgerlichen Ungeduld zu vergrößern.
Auf diesem Hintergrund – Rückgang der revolutionären Welle international, tiefgreifende Verwirrung innerhalb der revolutionären Bewegung in Deutschland – leitete die Bourgeoisie im März 1921 eine neue Offensive gegen das Proletariat ein. Hauptzielscheibe ihres Angriffs sollten die Arbeiter in Mitteldeutschland sein. Im Krieg war dort im Industriegebiet um Leuna, Bitterfeld und das Mansfelder Becken eine große Konzentration von Proletariern entstanden, die überwiegend relativ jung und kämpferisch waren, aber über keine große Organisationserfahrung verfügten. So zählte die VKPD dort allein über 66000 Mitglieder, die KAPD brachte es auf 3200 Mitglieder. In den Leuna-Werken gehörten von 20000 Beschäftigten ca. 2000 den Arbeiterunionen an.
Da nach den Auseinandersetzungen von 1919 und nach dem Kapp-Putsch viele Arbeiter bewaffnet geblieben waren, wollte die Bourgeoisie den Arbeitern weiter an den Kragen.
Die Bourgeoisie versucht die Arbeiter zu provozieren
Am 19. März 1921 zogen starke Polizeitruppen in Mansfeld ein, um die Arbeiter zu entwaffnen.
Der Befehl ging nicht vom „rechten" Flügel der Herrschenden (innerhalb der Militärs oder der rechten Parteien) aus, sondern von der demokratisch gewählten Regierung. Es war die bürgerliche Demokratie, die die Henkersrolle der Arbeiterklasse spielte und darauf abzielte, diese mit allen Mitteln zu Boden zu werfen.
Es ging der Bourgeoisie darum, durch die Entwaffnung und Niederlage eines sehr kämpferischen, relativ jungen Teils des deutschen Proletariats die Arbeiterklasse insgesamt zu schwächen und zu demoralisieren. Vor allem aber verfolgte die Bourgeoisie das Ziel, der Vorhut der Arbeiterklasse, den revolutionären Organisationen, einen fürchterlichen Schlag zu versetzen. Das Aufzwingen eines vorzeitigen Entscheidungskampfes in Mitteldeutschland sollte dem Staat vor allem die Gelegenheit geben, die Kommunisten gegenüber der gesamten Klasse zu isolieren, um diese Parteien dann in Verruf zu bringen und der Repression auszusetzen. Es ging darum, der frisch gegründeten VKPD die Möglichkeit zu rauben, sich zu konsolidieren, sowie die sich anbahnende Annäherung zwischen KAPD und VKPD zunichte zu machen. Schließlich wollte das deutsche Kapital stellvertretend für die Weltbourgeoisie die Russische Revolution und die Kommunistische Internationale weltweit weiter isolieren.
Die Komintern hatte gleichzeitig jedoch verzweifelt nach Möglichkeiten einer Hilfe von Außen für die Revolution in Russland gesucht. Man hatte gewissermaßen auf die Offensive der Bourgeoisie gewartet, damit die Arbeiter weiter in Zugzwang gerieten und endlich losschlagen würden. Anschläge wie der gegen die Siegessäule in Berlin am 13. März, der von der KAPD initiiert wurde, hatten dazu dienen sollen, die Kampfbereitschaft weiter anzustacheln.
Levi berichtete von einer Sitzung der Zentrale, wo der Moskauer Gesandte Rakosi meinte: „Russland befinde sich in einer außerordentlich schwierigen Situation. Es sei unbedingt erforderlich, dass Russland durch Bewegungen im Westen entlastet würde, und aus diesem Grunde müsse die deutsche Partei sofort in Aktion treten. Die VKPD zähle jetzt 500000 Mitglieder, mit diesen könne man 1500000 Proletarier auf die Beine bringen, was genügt, um die Regierung zu stürzen. Er sei also für sofortigen Beginn des Kampfes mit der Parole: Sturz der Regierung". (P. Levi, „Brief an Lenin", 27.03.1921)
„Am 17. März fand die Zentralausschusssitzung der KPD statt, in der die Anregungen oder Weisungen des aus Moskau gesandten Genossen zur Richtlinie gemacht wurden.
Am 18. März stellte sich die Rote Fahne auf diesen neuen Beschluss um und forderte zum bewaffneten Kampf auf, ohne zunächst zu sagen, für welche Ziele, und hielt diesen Ton einige Tage fest." (Levi, ebenda)
Die erwartete Offensive der Regierung im März 1921 war mit dem Vorrücken der Polizeitruppen nach Mitteldeutschland eingetreten.
Die Revolution forcieren?
Die vom sozialdemokratischen Polizeiminister Hörsing am 19. März nach Mitteldeutschland beorderten Polizeikräfte sollten Hausdurchsuchungen vornehmen und die Arbeiter um jeden Preis entwaffnen. Die Erfahrung aus dem Kapp-Putsch vor Augen, hatte die Regierung davor zurückgeschreckt, Soldaten der Reichswehr einzusetzen.
In derselben Nacht wurde vor Ort der Entschluss zum Generalstreik ab dem 21. März gefasst. Am 23. März kam es zu ersten Kämpfen zwischen Truppen der Sicherheits-Polizei und Arbeitern. Am gleichen Tag erklärten die Arbeiter der Leuna-Werke bei Merseburg den Generalstreik. Am 24. März riefen die VKPD und KAPD gemeinsam zum Generalstreik in ganz Deutschland auf. Nach diesem Aufruf kam es sporadisch in mehren Städten des Reichs zu Demonstrationen und Schießereien zwischen Streikenden und Polizei. Etwa 300000 Arbeiter beteiligten sich landesweit an den Streiks.
Der Hauptkampfplatz blieb jedoch das mitteldeutsche Industriegebiet, wo sich ca. 40000 Arbeiter und 17000 Mann Polizei- und Reichswehrtruppen gegenüberstanden. In den Leuna-Werken waren insgesamt 17 bewaffnete proletarische Hundertschaften aufgestellt worden. Die Polizeitruppen setzten alles daran, die Leuna-Werke zu stürmen. Erst nach mehreren Tagen gelang es ihnen, die Fabrik zu erobern. Dazu schickte die Regierung kurzerhand Flugzeuge und bombardierte die Leuna-Werke. Gegen die Arbeiterklasse waren ihr alle Mittel recht.
Auf Initiative der KAPD und VKPD wurden Dynamit-Attentate in Dresden, Freiberg, Leipzig, Plauen und anderswo verübt. Die besonders hetzerisch gegen die Arbeiter vorgehende Hallische – und Saale-Zeitung sollten am 26. März mit Sprengstoff zum Schweigen gebracht werden.
Während die Repression in Mitteldeutschland spontan die Arbeiter zu bewaffnetem Widerstand trieb, gelang es diesen jedoch wiederum nicht, den Häschern der Regierung einen koordinierten Widerstand entgegenzusetzen. Die von der VKPD aufgestellten Kampforganisationen, die von Hugo Eberlein geleitet wurden, waren militärisch und organisatorisch völlig unzureichend vorbereitet. Max Hoelz, der eine ca. 2500 starke Arbeiter-Kampftruppe aufgestellt und es geschafft hatte, bis einige Kilometer vor die von Regierungstruppen belagerten Leuna-Werke zu gelangen, versuchte vor Ort eine Zentralisierung aufzubauen. Aber seine Truppen wurden ebenso am 1. April aufgerieben, nachdem die Leuna-Werke zwei Tage zuvor schon erstürmt worden waren.
Obwohl in anderen Städten die Kampfbereitschaft nicht im Ansteigen begriffen war, hatten VKPD und KAPD zu einem sofortigen militärischen Zurückschlagen gegen die eingerückten Polizeikräfte aufgerufen.
„Die Arbeiterschaft wird aufgefordert, den aktiven Kampf aufzunehmen mit folgenden Zielen:
1. Sturz der Regierung...
2. Entwaffnung der Konterrevolution und Bewaffnung der Arbeiter"
(Aufruf vom 17. März).
In einem weiteren Aufruf der Zentrale der VKPD schrieb sie am 24. März:
„Denkt daran, dass ihr im Vorjahr in fünf Tagen mit Generalstreik und bewaffnetem Aufstand die Weißgardisten und Baltikumstrolche besiegt habt. Kämpft mit uns wie im Vorjahr Schulter an Schulter die Gegenrevolution nieder!
Tretet überall in den Generalstreik! Brecht mit Gewalt die Gewalt der Konterrevolution, Entwaffnung der Konterrevolution, Bewaffnung, Bildung von Ortswehren aus den Kreisen der organisierten Arbeiter, Angestellten und Beamten!
Bildet sofort proletarische Ortswehren! Sichert Euch die Macht in den Betrieben! Organisiert die Produktion durch Betriebsräte und Gewerkschaften! Schafft Arbeit für die Arbeitslosen!"
Vor Ort jedoch waren die Kampforganisationen der VKPD und die spontan bewaffneten Arbeiter nicht nur schlecht organisatorisch und militärisch gerüstet; die örtlichen Parteileitungen selber hatten keinen Kontakt zu ihren Parteizentralen. Verschiedene Truppenverbände (die von Max Hoelz und Karl Plättner waren die bekanntesten) kämpften an mehreren Orten im Aufstandsgebiet unabhängig voneinander. Nirgendwo gab es Arbeiterräte, die ihre Aktionen hätten koordinieren können. Dagegen standen die Repressionstruppen der Bürgerlichen natürlich im engsten Kontakt mit ihrem Generalstab und koordinierten ihre Taktik!
Nachdem die Leuna-Werke gefallen waren, zog die VKPD am 31. März 1921 den Aufruf zum Generalstreik zurück. Am 1. April lösten sich die letzten bewaffneten Arbeitertruppen in Mitteldeutschland auf.
Wieder herrschten Ruhe und Ordnung! Wieder schlug die Repression zu. Wieder wurden viele Arbeiter ermordet und misshandelt. Hunderte waren erschossen worden, über 6000 wurden verhaftet.
Die Hoffnung großer Teile der VKPD und KAPD, ein provokatives Vorgehen des staatlichen Repressionsapparates würde eine Spirale des Widerstandes in den Reihen der Arbeiter auslösen, war enttäuscht worden. Die Arbeiter in Mitteldeutschland waren relativ isoliert geblieben.
In dieser Situation hatten die VKPD und die KAPD derart auf ein Losschlagen gebrannt, ohne die Gesamtlage im Auge zu behalten, dass sie sich durch die Devise „Wer nicht für uns ist, der ist wider uns" (Editorial der Roten Fahne, 20. März), von den unentschlossenen und nicht-kampfbereiten Arbeitern völlig isolierten und einen Graben der Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse aushoben.
Anstatt zu erkennen, dass die Lage nicht günstig war, schrieb die Rote Fahne am 30. März: „Nicht nur auf das Haupt eurer Führer, auf das Haupt jedes einzelnen von euch kommt die Blutschuld, wenn ihr stillschweigend oder auch nur unter lahmen Protesten duldet, dass die Ebert, Severing, Hörsing den weißen Schrecken und die weiße Justiz gegen die Arbeiter loslassen (...)
Schmach und Schande über den Arbeiter, der jetzt noch beiseite steht, Schmach und Schaden über den Arbeiter, der jetzt noch nicht weiß, wo sein Platz ist."
Um die Kampfbereitschaft weiter anzustacheln, hatte man die Arbeitslosen als Speerspitze einsetzen wollen.
„Die Arbeitslosen wurden als Sturmkolonnen vorangeschickt. Sie besetzten die Tore der Fabriken. Sie drangen in die Betriebe ein, löschten hier und da die Feuer und versuchten, die Arbeiter aus den Betrieben herauszuprügeln... Es war ein entsetzlicher Anblick, wie die Arbeitslosen, laut weinend über die Prügel, die sie empfangen, aus den Betrieben hinausgeworfen wurden, und wie sie denen fluchten, die sie dahin gesandt."
Dass die VKPD-Zentrale vor dem Beginn der Kämpfe das Kräfteverhältnis falsch eingeschätzt hatte und nach Auslösung der Kämpfe ihre Einschätzung nicht revidierte, war schon tragisch genug. Es kam noch schlimmer, denn statt dessen verbreitete sie die Parole: „Leben oder Tod". Nach dem falschen Motto: „Kommunisten weichen nie zurück"!
„Unter keinen Umständen darf ein Kommunist, auch wenn er in Minderheit ist, zur Arbeit schreiten. Die Kommunisten gingen hinaus aus den Betrieben. In Trupps von 200, 300 Mann, oft mehr, oft weniger, gingen sie aus den Betrieben: der Betrieb ging weiter. Sie sind heute arbeitslos, die Unternehmer haben die Gelegenheit benutzt, die Betriebe ‘kommunistenrein’ zu machen in einem Falle, in dem sie selbst ein groß Teil der Arbeiter auf ihrer Seite hatten." (Die Rote Fahne)
Welche Bilanz aus den März-Kämpfen?
Während dieser Kampf der Arbeiterklasse von der Bourgeoisie aufgezwungen wurde und sie ihm nicht ausweichen konnte, hatte die VKPD den Fehler begangen, dass sie „den defensiven Charakter des Kampfes nicht klar genug hervorhob, sondern durch den Ruf von der Offensive den gewissenlosen Feinden des Proletariats, der Bourgeoisie, der SPD und der USPD Anlass gab, die VKPD als Anzettlerin von Putschen dem Proletariat zu denunzieren. Dieser Fehler wurde von einer Anzahl von Parteigenossen gesteigert, indem sie die Offensive als die hauptsächlichste Methode des Kampfes der VKPD in der jetzigen Situation darstellten" („Thesen und Resolutionen des 3. Weltkongresses der Kommunistischen Internationale",
S. 52/53, Juni 1921).
Dass die Kommunisten weiter für eine Verstärkung der Kampfbereitschaft eintraten, war ihre erste Pflicht. Aber Kommunisten sind nicht einfach Aufpeitscher der Kampfbereitschaft. Die „Kommunisten sind (...) praktisch der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegungen voraus." (Kommunistisches Manifest) Deshalb müssen sie sich gegenüber der Klasse insgesamt durch ihre Fähigkeit auszeichnen, das Kräfteverhältnis richtig einzuschätzen, die Strategie des Klassengegners zu durchschauen, denn eine für entscheidende Kämpfe noch zu schwache Arbeiterklasse in eine sichere Niederlage zu führen, oder sie in die von der Bourgeoisie gestellten Fallen zu treiben, ist das Unverantwortlichste, was Revolutionäre tun können. Insbesondere erfordert dies vor allem auch die Fähigkeit zu entwickeln, den jeweiligen Bewusstseinsstand und die Kampfbereitschaft innerhalb der Arbeiterklasse einschätzen zu können, und die Vorgehensweise der Herrschenden zu durchschauen. Nur so können revolutionäre Organisationen ihre wirkliche Führungsrolle in der Klasse übernehmen.
Sofort nach dem Ende der März-Aktion kam es zu heftigen Debatten innerhalb der VKPD und der KAPD.
Falsche Organisationsauffassungen — eine Fessel für die Fähigkeit der Partei zur Selbstkritik
In einem Leitartikel vom 4.–6. April verkündete die Rote Fahne, dass die „VKPD eine revolutionäre Offensive eingeleitet" habe und die März-Aktion „der Beginn, der erste Abschnitt der entscheidenden Kämpfe um die Macht" sei.
Am 7./8. April tagte der Zentralausschuss der VKPD. Anstatt eine kritische Einschätzung der Intervention zu liefern, versuchte Heinrich Brandler vor allem die Politik der VKPD-Zentrale zu rechtfertigen. Er begründete die Hauptschwäche in einer mangelnden Disziplin der VKPD-Mitglieder vor Ort und im Versagen der sogenannten Militärorganisation. Brandler meinte gar, „Wir haben keine Niederlage erlitten, wir hatten eine Offensive".
Gegenüber dieser Einschätzung sollte Paul Levi innerhalb der VKPD zum heftigsten Kritiker der Vorgehensweise der Partei in der März-Aktion werden.
Nachdem er neben Clara Zetkin im Februar 1921 schon aus dem Zentralausschuss ausgeschieden war, weil es unter anderem zu Divergenzen um die Gründung der KP in Italien gekommen war, sollte er sich erneut als unfähig erweisen, die Organisation durch Kritik nach vorne zu treiben. Das Tragische war, dass er „mit seiner Kritik an der März-Aktion 1921 in Deutschland in vielem dem Wesen der Sache nach recht" hatte (Lenin, „Brief an die deutschen Kommunisten", Werke Bd. 32, S. 541). Aber anstatt seine Kritik innerhalb des Rahmens der Organisation den Regeln und Prinzipien derselben folgend vorzubringen, verfasste er am 3./4. April eine Broschüre, die am 12. April veröffentlicht wurde, ohne dass die Partei ihren Inhalt kannte (2).
In dieser Broschüre brach er nicht nur die Organisationsdisziplin, sondern er veröffentliche Details aus dem internen Leben der Partei. Somit brach er ein proletarisches Prinzip, gefährdete gar die Organisation, indem er in aller Öffentlichkeit die Funktionsweise der Organisation preisgab. Dafür wurde er am 15. April aus der Partei wegen parteischädigenden Verhaltens ausgeschlossen(3).
Levi, der wie wir in einem früheren Artikel zum Oktoberparteitag der KPD 1919 festgestellt haben, dazu neigte, jede Kritik als Angriff auf die Organisation, als Infragestellung einer ganzen Linie und somit als Bedrohung der Organisation, aber auch seiner Person aufzufassen, sabotierte jeden Versuch einer kollektiven Funktionsweise. Seine Einstellung offenbart dies: „Ist die März-Aktion richtig, dann gehöre ich hinausgeworfen (aus der Partei). Oder ist die März-Aktion ein Fehler, dann ist meine Broschüre gerechtfertigt." (Levi, „Brief an die Zentrale der VKPD") Diese organisationsschädigende Haltung war von Lenin wiederholt kritisiert worden. Nach Bekanntwerden seines Austritts aus der Zentrale der VKPD im Februar schrieb Lenin dazu: „Aber Austritt aus der Zentrale!!?? Das jedenfalls der größte Fehler! Wenn wir solche Gepflogenheiten dulden werden, dass verantwortliche Mitglieder der Zentrale austreten, wenn sie in der Minderheit geblieben sind, dann wird die Entwicklung und Gesundung der kommunistischen Parteien niemals glatt gehen. Statt auszutreten – die strittige Frage mehrere Male besser mit der Exekutive ventilieren (...). Alles mögliche und etwas unmögliches dazu zu tun – aber, es koste was es wolle, Austritt vermeiden und Gegensätze nicht verschärfen." (Lenin an Clara Zetkin und Paul Levi, 16.4.1921).
Levis zum Teil maßlosen und überspitzten Beschuldigungen (dass er die Verantwortung der Bourgeoisie für die Kämpfe im März in den Hintergrund geraten ließ und der VKPD praktisch die Alleinschuld aufbürdete) verzerrten die Wirklichkeit.
Nachdem er aus der Partei ausgeschlossen war, gab er eine kurze Zeit die Zeitschrift ‚Sowjet’ heraus, die zum Sprachrohr der Gegner dieses Kurses der VKPD wurden. Levi wollte seine Kritik an der Taktik der VKPD dem Zentralausschuss vortragen, wurde aber zur Tagung nicht mehr zugelassen. Statt dessen trug Clara Zetkin eine Reihe seiner Kritiken vor. „Die Kommunisten haben nicht die Möglichkeit (...) die Aktion an Stelle des Proletariats, ohne das Proletariat, am Ende gar gegen das Proletariat zu machen" (Levi). Zetkin schlug eine Gegenresolution zur Stellungnahme der Partei vor. Mehrheitlich verwarf die Sitzung des Zentralausschusses jedoch die Kritik und hob hervor, dass ein „Ausweichen vor der Aktion (...) unmöglich für eine revolutionäre Partei, (...) ein glatter Verzicht auf ihren Beruf, die Revolution zu führen" gewesen wäre. Die VKPD „muss, wenn sie ihre geschichtliche Aufgabe erfüllen will, festhalten an der Linie der revolutionären Offensive, die der März-Aktion zugrunde liegt, und sie muss entschlossen und sicher auf diesem Wege fortschreiten" („Leitsätze über die März-Aktion", Die Internationale Nr. 4, April 1921).
Die Zentrale bestand auf der Fortsetzung der eingeschlagenen Offensivtaktik und verwarf alle Kritiken. In einem vom 6. April 1921 gezeichneten Aufruf hatte das EKKI (Erweitertes Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationalen) noch die Haltung der VKPD gebilligt und aufgerufen, „Ihr habt richtig gehandelt (...) Rüstet zu weiteren Kämpfen" (Rote Fahne, 14.4.1921).
So waren auf dem 3. Weltkongress der Komintern weder das EKKI noch der Kongress selber einig über die Einschätzung der deutschen Ereignisse. Vor allem die Gruppe um Clara Zetkin in der KPD wurde in dem ersten Teil der Diskussion erbittert angegriffen. Erst das Eingreifen und die Autorität Lenins und Trotzkis in der Debatte brachten die Wende in der Auseinandersetzung, indem die Hitzköpfe zur Abkühlung gebracht wurden.
Lenin, der sowohl durch die Ereignisse in Kronstadt wie auch durch die Staatsführung so beschäftigt war, dass er die Ereignisse und die Debatten um die Bilanz nicht hatte näher verfolgen können, fing an, sich eingehend mit der Bilanz der März-Aktion zu befassen. Während er den Disziplinbruch Levis auf das schärfste verwarf, trat er dafür ein, dass die März-Aktion wegen ihrer „großen internationalen Bedeutung dem 3. Weltkongress der Komintern unterbreitet werden solle". Breitestmögliche, ungehinderte Diskussion innerhalb der Partei, hieß seine Devise.
W. Koenen, der Vertreter der VKPD beim EKKI, wurde im April vom EKKI mit dem Auftrag nach Deutschland geschickt, dass der Zentralausschuss keine endgültigen Beschlüsse gegen die Opposition fassen sollte. In der Parteipresse kamen dann auch wieder die Kritiker der März-Aktion zu Wort. Die Diskussion über die Taktik wurde fortgesetzt.
Dennoch vertrat die Mehrheit der Zentrale weiterhin ihre im März eingenommene Haltung. Arkady Maslow verlangte die neuerliche Billigung der März-Aktion. Guralski, ein Gesandter des EKKI forderte gar: „keine Beschäftigung mit der Vergangenheit. Die beste Antwort auf Angriffe der Richtung Levi sind die weiteren politischen Kämpfe der Partei". Auf der Sitzung des Zentralausschusses vom 3.-5. Mai trat Thalheimer dafür ein, die Aktionseinheit der Arbeiter wieder aufzunehmen. Fritz Heckert plädierte für verstärkte Arbeit in den Gewerkschaften.
Am 13. Mai veröffentlichte die Rote Fahne Leitsätze, die auf eine künstliche Beschleunigung der revolutionären Entwicklung abzielten. Als Beispiel wurde dafür die März-Aktion hingestellt. Die Kommunisten „müssen in zugespitzten Situationen, wo wichtige Interessen des Proletariats bedroht sind, den Massen einen Schritt vorausgehen und versuchen, sie durch ihre Initiative in den Kampf zu führen, auch auf die Gefahr hin, nur Teile der Arbeiterschaft mit sich zu reißen". Wilhelm Pieck, der sich schon in der Januar-Woche 1919 mit Karl Liebknecht entgegen den Parteibeschluss am Aufstand beteiligt hatte, meinte: Auseinandersetzungen unter den Arbeitern „werden wir noch häufiger erleben. Die Kommunisten müssen sich gegen die Arbeiter wenden, wenn diese nicht unseren Aufrufen folgen".
Die Reaktion der KAPD
Während VKPD und KAPD einen Schritt vorwärts gemacht hatten und zum ersten Mal gemeinsam losschlagen wollten, lag das Drama darin, dass diese Aktionen selbst unter ungünstigen Bedingungen stattgefunden hatten. Auch war der gemeinsame Nenner der VKPD und KAPD bei der März-Aktion gewesen, der Arbeiterklasse in Russland zu Hilfe zu eilen. Im Gegensatz zu den späteren Rätekommunisten verteidigte die KAPD damals noch die Revolution in Russland.
Gegenüber der Bilanz der März-Aktion waren die Haltung und Intervention der KAPD jedoch widersprüchlich. Einerseits rief sie gemeinsam mit der VKPD zum Generalstreik auf, schickte F. Jung und F. Rasch als Vertreter der Zentrale nach Mitteldeutschland zur Unterstützung der Koordinierung der Kampfhandlungen. Andererseits hielten die örtlichen Führer der KAPD, Utzelman und Prenzlow, aufgrund ihrer Kenntnis der Lage im mitteldeutschen Industriegebiet einen Aufstandsversuch für unsinnig und wollten nicht über den Generalstreik hinausgehen. Deshalb waren sie gegenüber den Leuna-Arbeitern dafür eingetreten, im Werksbereich zu verbleiben und sich auf einen Defensivkampf einzustellen. Die KAPD-Leitung reagierte ohne Abstimmung mit der Partei vor Ort.
Im Anschluss an die Bewegung lieferte die KAPD Ansätze zu einer kritischen Einschätzung ihrer eigenen Intervention. Sie reagierte sehr widersprüchlich. In einer Antwort auf die Broschüre Levis griff sie jedoch die grundsätzliche Problematik auf, die hinter der Vorgehensweise der VKPD-Zentrale stand. So schrieb Herman Gorter: „Die VKPD hatte durch die parlamentarische Aktion – die unter dem bankerotten Kapitalismus keine andere Bedeutung mehr hat, als die Irreführung der Massen – das Proletariat vom revolutionären Handeln abgelenkt. Sie hatte Hunderttausende von nichtkommunistischen Mitgliedern gesammelt, war also zu einer ‘Massenpartei’ geworden. Die VKPD hatte durch die Zellentaktik die Gewerkschaften unterstützt (...) als die deutsche Revolution immer machtloser zurückwich, als ihre besten Elemente dadurch unzufrieden, stets mehr auf die Aktion drängten – da beschloss sie auf einmal eine große Aktion zur Eroberung der politischen Gewalt. D.h. vor der Herausforderung Hörsings und der Sipo hat sie zu einer künstlichen Aktion von oben, ohne spontanen Drang großer Massen, d.h. zur Putschtaktik, den Beschluss gefasst.
Das Exekutiv-Komitee und seine Repräsentanten in Deutschland hatten schon lange darauf gedrängt, die VKPD solle losschlagen. Sie sollte sich als eine richtige revolutionäre Partei erweisen. Als ob in dem Losschlagen allein schon das Wesen einer revolutionären Taktik besteht! Wenn eine Partei, die statt die revolutionäre Kraft des Proletariats aufzubauen, Parlament und Gewerkschaften unterstützt und dadurch das Proletariat schwächt und seine revolutionäre Kraft unterminiert, dann (nach diesen Vorbereitungen!!) auf einmal losschlägt und eine große, angreifende Aktion beschließt, für dies selbe, von ihr selbst geschwächte Proletariat, so ist das im Grunde ein Putsch. Das heißt eine von oben beschlossene, nicht aus den Massen selbst hervorkommende, von vornherein zum Scheitern verdammte Tat. Und diese Putschtaktik ist nicht revolutionär, sondern genau so opportunistisch, wie der Parlamentarismus und die Zellentaktik selbst. Ja, diese Putschtaktik ist die notwendige Gegenseite des Parlamentarismus und der Zellentaktik, der Sammlung nichtkommunistischer Elemente, der Führer – statt Massen- oder besser Klassenpolitik. Diese schwache, innerlich faule Taktik muss notwendig zu Putschen führen." („Lehren der März-Aktion", Nachschrift zum „Offenen Brief an den Genossen Lenin" von Herman Gorter, in Der Proletarier, 5/1921)
Damit legte dieser KAPD-Text richtigerweise den Finger auf den Widerspruch zwischen der Taktik der Einheitsfront, die die Illusionen der Arbeiter über Gewerkschaften und Sozialdemokratie verstärkt hatte, und dem plötzlichen gleichzeitigen Aufruf zum Sturmangriff gegen den Staat. Gleichzeitig finden sich in diesem Text jedoch Widersprüche, denn während die KAPD einerseits von einer Verteidigungshandlung der Arbeiter sprach, schätzte sie die März-Aktion gleichzeitig als „ersten bewussten Angriff der revolutionären Arbeiter Deutschlands gegen die bürgerliche Staatsmacht" ein (S. 21). Dabei hatte die KAPD selbst festgestellt, dass „selbst die großen Arbeitermassen neutral, wenn nicht feindlich gegenüber der kämpferischen Avantgarde eingestellt blieb" (S. 24). Auch auf dem außerordentlichen Parteitag der KAPD im September 1921 wurden die Lehren aus der März-Aktion nicht weiter aufgegriffen.
Auf diesem Hintergrund heftiger Debatten innerhalb der VKPD und widersprüchlicher Reaktionen der KAPD begann Ende Juni der 3. Weltkongress der Komintern.
Die Haltung der Komintern zur März-Aktion
Innerhalb der Komintern war der Prozess der Bildung verschiedener Flügel in Gang gekommen. Das EKKI selber hatte gegenüber den Ereignissen in Deutschland weder eine einheitliche Meinung, noch sprach es mit einer Stimme. Bei der Einschätzung der Lage in Deutschland war das EKKI lange Zeit gespalten.
Radek hatte zahlreiche Kritiken an den Positionen und dem Verhalten des Vorsitzenden der KPD, Levi, entwickelt, die von anderen Mitgliedern der Zentrale aufgegriffen wurden.
Innerhalb der KPD wurden diese Kritiken jedoch nicht offen und auf einem Parteitag oder in anderen Parteiinstanzen in entsprechender Form formuliert.
Anstatt offen über die Einschätzung der Lage zu debattieren, war von Radek eine Funktionsweise gefördert worden, die der Partei zutiefst schädlich sein sollte. Kritiken wurden häufig nicht brüderlich in aller Deutlichkeit vorgetragen, sondern in verdeckter Form. Im Mittelpunkt stand oft nicht die jeweilige Fehleinschätzung durch ein Zentralorgan, sondern die Suche nach Schuldigen. Der Trend setzte sich durch, Positionen jeweils mit Personen zu verbinden. Anstatt die Einheit als Organisation um eine Position und Vorgehensweise herzustellen, anstatt für und als ein kollektiv funktionierender Körper zu kämpfen, untergrub man das Organisationsgewebe auf eine völlig unverantwortliche Weise.
Darüber hinaus waren die Kommunisten in Deutschland selber ebenfalls zutiefst gespalten. Zum einen gehörten zum damaligen Zeitpunkt der Komintern die VKPD und die KAPD an, die allerdings aufs heftigste wegen der Orientierung der Organisation aufeinander prallten.
Gegenüber der Komintern waren vor der März-Aktion von Teilen der VKPD sowohl Informationen über die Einschätzung der Lage verschwiegen wie auch die unterschiedlichen Positionen und Einschätzungen der Komintern nicht umfassend mitgeteilt worden.
In der Komintern selber gab es keine wirklich gemeinsame Reaktion und kein einheitliches Vorgehen gegenüber der Entwicklung. Der Kronstädter Aufstand hatte die ganze Aufmerksamkeit der Führung der Bolschewistischen Partei auf sich gezogen und sie daran gehindert, die Lage in Deutschland näher zu verfolgen. Zudem war es oft nicht klar, wie Entscheidungen innerhalb des Exekutivkomitees zustande gekommen waren und wie Mandate erteilt wurden. Gerade gegenüber Deutschland scheinen die Mandate von Radek und anderen Delegierten des EKKI nicht immer klar genug festgelegt worden zu sein (4).
So hatten in dieser Situation der zunehmenden Spaltung innerhalb der VKPD Mitglieder des EKKI, unter Radeks Federführung, inoffiziellen Kontakt mit Flügeln in beiden Parteien – VKPD und KAPD – aufgenommen, um unter Umgehung der Zentralorgane der beiden Organisationen Vorbereitungen für putschistische Maßnahmen zu treffen. Anstatt also auf eine Klärung und Mobilisierung der Organisationen zu drängen, begünstigte man eine Spaltung der Parteien und förderte Schritte, die Entscheidungen außerhalb der verantwortlichen Organe zu treffen. Diese Haltung, die im Namen des EKKI eingenommen wurde, leistete somit dem organisationsschädlichen Verhalten innerhalb VKPD und KAPD Vorschub.
Paul Levi kritisierte: „Der Fall war schon häufiger, dass Abgesandte des EKKI über ihre Vollmacht hinausgingen, d.h. dass sich nachträglich ergab, die Abgesandten hätten zu dem oder jenem keine Vollmachten gehabt." („Unser Weg, Wider den Putschismus", S. 63, 3. April 1921).
Von den Statuten festgelegte Entscheidungsstrukturen in der Komintern wie auch innerhalb der VKPD und KAPD wurden umgangen. Tatsache war, dass in der März-Aktion dann von beiden Organisationen zum Generalstreik aufgerufen wurde, ohne dass die ganze Organisation an der Einschätzung der Lage und den Entscheidungen beteiligt war. In Wirklichkeit hatten Genossen des EKKI mit den Elementen und den Flügeln innerhalb der beiden Organisationen Kontakt aufgenommen, die nach Aktionen drängten. Die Partei als solche wurde „umgangen"!
So konnte es nie zu einer einheitlichen Vorgehensweise der einzelnen Parteien und noch weniger zu einem gemeinsamen Vorgehen der beiden Parteien kommen.
Aktivismus und Putschismus hatten in diesen Organisationen teilweise die Oberhand gewonnen – mit einem sehr zerstörerischen Verhalten für die Partei und die Klasse insgesamt. Jeder Flügel fing an, seine eigene Politik zu betreiben und seine eigenen informellen, parallelen Kanäle aufzubauen. Die Sorge um die Einheit der Partei, eine statutengemäße Funktionsweise war einem Großteil der Partei abhanden gekommen.
Obwohl die Komintern durch die Identifikation der Bolschewistischen Partei mit den Interessen des russischen Staates und durch die opportunistische Kehrtwendung hin zur Einheitsfront geschwächt war, sollte der 3. Weltkongress dennoch ein Moment der kollektiven, proletarischen Kritik an der März-Aktion werden.
Für den Kongress hatte das EKKI aus richtiger politischer Sorge auf Anregung Lenins auch die Entsendung von Vertretern der Opposition innerhalb der VKPD durchgesetzt. Während die Delegation der VKPD-Zentrale weiter jegliche Kritik an der Haltung der VKPD zur März-Aktion unterbinden wollte, beschloss das Politbüro der KPR(B) auf Vorschlag Lenins: „Als Grundlage der Resolution ist der Gedanke zu nehmen, dass man vielmals detaillierter die konkreten Fehler der VKPD in der März-Aktion aufzeigen und vielmals energischer vor der Wiederholung dieser Fehler warnen muss."
Welche Haltung einnehmen?
In der Eingangsdiskussion über „Die wirtschaftliche Krise und die neuen Aufgaben der Kommunistischen Internationale" hatte Trotzki hervorgehoben: „Erst jetzt sehen und fühlen wir, dass wir nicht so unmittelbar nahe dem Endziel, der Eroberung der Macht, der Weltrevolution stehen. Wir haben damals im Jahre 1919 uns gesagt: es ist die Frage von Monaten, und jetzt sagen wir, es ist die Frage vielleicht von Jahren (...) Der Kampf wird vielleicht langwierig sein, wird nicht so fieberhaft, wie es wünschenswert wäre, voranschreiten, der Kampf wird höchst schwierig und opferreich sein (...)" („Protokoll des 3. Kongresses",
S. 90).
Lenin: „Deshalb musste der Kongress gründlich mit den linken Illusionen aufräumen, dass die Weltrevolution ununterbrochen in ihrem stürmischen Anfangstempo weiterrase, dass wir von einer zweiten revolutionären Welle getragen würden, und dass es einzig und allein vom Willen der Partei und ihrer Aktion abhänge, den Sieg an unsere Fahne zu fesseln (...)" (Zetkin, „Erinnerungen an Lenin")
Für den Kongress hatte die VKPD-Zentrale unter der Federführung A. Thalheimers und Bela Kuns einen Thesenentwurf zur Taktik geschickt, der forderte, dass die Komintern jetzt zu einer neuen Periode der Aktionen übergehen müsse. In einem Brief vom 10. Juni an Sinowjew hatte Lenin den Thesenentwurf als „politisch grundfalsch, als linksradikale Spielerei" eingeschätzt und gefordert, ihn gänzlich abzulehnen. „Die Mehrheit der Arbeiterklasse haben die kommunistischen Parteien noch nirgends erobert. Nicht für die organisatorische Führung, aber auch nicht für die Prinzipien des Kommunismus (...) Deshalb muss die Taktik darauf gerichtet werden, unentwegt und systematisch um die Mehrheit der Arbeiterklasse, in erster Linie innerhalb der alten Gewerkschaften zu ringen." (10. Juni, 1921, Lenin, Briefe, Bd. 7, S. 269). Gegenüber dem Delegierten Heckert meinte Lenin: „Die Provokation lag doch glatt auf der Hand. Statt von der Verteidigung aus die Arbeitermassen gegen die Angriffe der Bourgeoisie zu mobilisieren und so den Massen zu zeigen, dass das Recht auf eurer Seite ist, habt ihr die sinnlose ‘Offensivtheorie’ erfunden, die allen Polizeikerls und den reaktionären Regierungen die Möglichkeit gibt, euch als die Angreifer darzustellen, vor denen man das Volk schützen muss." (Erinnerungen, F. Heckert, „Meine Begegnungen mit Lenin")
Während Radek selbst vorher die März-Aktion unterstützt hatte, sprach er in seinem Referat im Namen des EKKI vom widersprüchlichen Charakter der März-Aktion, lobte den Heldenmut der kämpfenden Arbeiter und kritisierte andererseits die falsche Politik der Zentrale der VKPD. Trotzki charakterisierte die März-Aktion als ganz unglücklichen Versuch, der, „wenn er wiederholt werden sollte, diese gute Partei wirklich zugrunde richten könnte". Er unterstrich, „wir sind verpflichtet, der deutschen Arbeiterschaft klipp und klar zu sagen, dass wir diese Offensivphilosophie als die größte Gefahr und in der praktischen Anwendung als das größte Verbrechen auffassen". („Protokoll des 3. Kongresses", S. 644-646).
Die Delegation der VKPD und die gesondert eingeladenen Delegierten der VKPD-Opposition prallten auf dem Kongress aufeinander.
Der Kongress war sich der Gefahren für die Einheit der Partei bewusst. Deshalb drängte man auf eine Einigung zwischen VKPD-Führung und Opposition. Eine Übereinkunft mit folgendem Inhalt wurde erzielt: „Der Kongress erachtet jede weitere Zerbröckelung der Kräfte innerhalb der VKPD, jede Sonderbündelei – von Spaltung gar nicht zu sprechen – als die größte Gefahr für die ganze Bewegung". Gleichzeitig wurde vor einer revanchistischen Haltung gewarnt: „Der Kongress erwartet von der Zentrale und der Mehrheit der VKPD die tolerante Behandlung der früheren Opposition, falls diese die vom 3. Kongress gefassten Beschlüsse loyal durchführt" („Resolution zur März-Aktion und über die Lage in der VKPD", 21. Sitzung des 3. Weltkongresses, 9.7.1921).
In den Debatten auf dem 3. Kongress äußerte sich die KAPD-Delegation kaum selbstkritisch zur März-Aktion. Sie schien sich mehr auf die Prinzipienfrage der Arbeit in den Gewerkschaften und den Parlamentarismus zu konzentrieren.
Während der 3. Kongress so selbstkritisch vor den putschistischen Gefahren, die in der März-Aktion sichtbar geworden war, gewarnt hatte und diesem „blinden Aktionismus" eine Abfuhr erteilt hatte, schlug der Kongress selber tragischerweise den unheilvollen Kurs der „Einheitsfront von Unten" ein. Zwar hatte er die putschistische Gefahr abgewandt, aber die opportunistische Kehrtwende, die durch die Verabschiedung der 21 Thesen eingeleitet worden war, wurde bestätigt und beschleunigt. Die wirklichen Fehler, die in der Grundsatzkritik der KAPD von Gorter aufgeworfen worden waren, nämlich die Rückkehr zur gewerkschaftlichen und parlamentarischen Ausrichtung, wurden nicht korrigiert.
Ermuntert durch die Ergebnisse des 3. Kongresses schlug die VKPD dann ab Herbst 1921 den Kurs der Einheitsfront ein.
Gleichzeitig hatte der 3. Kongress der KAPD ein Ultimatum gestellt: entweder Beitritt zur VKPD oder Ausschluss aus der Komintern.
Im September 1921 trat die KAPD dann aus der Komintern aus – Teile von ihr stürzten sich anschließend in das Abenteuer der Bildung einer Kommunistischen Arbeiterinternationale. Nur wenige Monate vergingen bis zur Spaltung der KAPD.
Für die KPD (die im August 1921 wieder ihren Namen von VKPD zu KPD geändert hatte) war die Tür zu einer opportunistischen Entwicklung weiter aufgestoßen.
Die Bourgeoisie ihrerseits hatte ihr Ziel erreicht: Erneut hatte sie mit der März-Aktion ihre Offensive fortsetzen können. Sie hatte die Arbeiterklasse weiter geschwächt.
Aber noch verheerender als die Konsequenzen dieser putschistischen Haltung für die Arbeiterklasse insgesamt waren die Folgen für die Kommunisten selber: erneut wurden sie Opfer der Repression. Die Jagd auf Kommunisten wurde wieder verschärft. Bei der KPD kam es zu einer großen Austrittswelle aus der Partei. Viele Mitglieder zeigten sich zutiefst enttäuscht über die gescheiterte Erhebung. Anfang des Jahres zählte die VKPD ca. 35000–400000 Mitglieder. Ende August 1921 gehörten ihr nur noch ca. 160000 an, im November sogar nur noch 135000–150000 zahlende Mitglieder.
Zum wiederholten Male hatte die Arbeiterklasse in Deutschland gekämpft, ohne eine starke, schlagkräftige Partei an ihrer Seite zu haben. Dv.
- (1) Bei den Wahlen zum Preußischen Landtag im Februar 1921 entfielen auf die VKPD 1.1 Mio., die USPD 1.1 Mio. und die SPD 4.2 Mio. Stimmen. In Berlin übertrafen VKPD und USPD die SPD-Stimmenanteile.
- (2) Clara Zetkin, die mit der inhaltlichen Kritik Paul Levis übereinstimmte, hatte in mehreren Briefen aufgefordert, sich nicht organisationsschädlich zu verhalten. So schrieb sie am 11. April an Levi.: „(...) dem Vorwort sollten Sie die persönliche Note nehmen. Ebenso scheint mir politisch wirksam, dass Sie über die Zentrale und ihre Mitglieder kein ‘persönliches Urteil’ fällen, sie reif für die Kaltwasserheilanstalt erklärten und ihre Entfernung fordern etc. (...) Es ist klüger, dass Sie sich bloß an die Politik der Zentrale halten, die Leute außer Spiel lassen, die ihre Träger sind (...) Nur die persönlichen Wallungen sollten gestrichen werden." Levi ließ sich nicht belehren. Stolz und Rechthaberei, sowie sein monolithisches Organisationsverständnis sollten fatale Folgen haben.
- (3) „Paul Levi hat der Parteileitung von seiner Absicht, eine solche Broschüre zu veröffentlichen, weder Kenntnis gegeben noch ihr Mitteilung von den in der Broschüre aufgestellten Behauptungen gemacht (...)
- Paul Levi hat seine Broschüre in Druck gegeben am 3. April, zu einer Zeit, wo der Kampf noch in vielen Teilen des Reiches im Gange war und in der Tausende von Kämpfern vor den Sondergerichten stehen, die Paul Levi durch die Veröffentlichung seiner Broschüre zu den Bluturteilen gerade anreizt (...)
- Die Zentrale anerkennt in vollem Umfange das Recht der Parteikritik vor und nach Aktionen, die von der Partei geführt werden. Kritik auf dem Boden des Kampfes und dem der vollen Kampfsolidarität ist eine Lebensnotwendigkeit für die Partei und revolutionäre Pflicht. Paul Levis Haltung (...) läuft nicht auf die Stärkung, sondern auf die Zerrüttung und Zerstörung der Partei hinaus". (Zentrale der VKPD, 16.4.1921).
- (4) Der Delegation des EKKI gehörten Bela Kun,
- Pogany und Guralski an. Karl Radek wirkte insbesondere seit der Gründung der KPD als „Verbindungsmann" zwischen der KPD und der Komintern. Ohne immer über ein klares Mandat zu verfügen, praktizierte vor allem er die Politik der „informellen" und parallelen Kanäle.
Leute:
- Paul Levi [225]
- Clara Zetkin [226]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- Märzaktion 1921 [227]
- Kronstadt 1921 [228]
- Kommunistische Arbeiterinternationale [229]
- KAPD [230]
- VKPD [231]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
Einige Gedanken zur Demokratie nach der Abstimmung über die Ausschaffungsinitiative
- 2347 Aufrufe
In verschiedenen Artikeln berichteten wir in letzter Zeit über Rassismus und Ausbeutung als eine sich seit langem verschärfende Tendenz, auch und vor allem in den Vorzeigestaaten Europas. In Griechenland, Italien und Spanien werden Flüchtlinge aus dem Maghreb oder Anatolien, die es mit Schleppbooten ans Festland schaffen, in menschenunwürdigen Lagern eingesperrt. In Frankreich lässt Sarkozy Romas als kriminalisierte Ethnie nach Rumänien deportieren. In Deutschland lanciert Sarrazin rassistische Thesen gegen muslimische Migranten und mobilisiert als SPD-Politiker nun auch so genannt linke Stimmen. Die Liste der Kampagnen und Gesetzesänderungen könnte man beliebig erweitern, vor allem auch mit Beispielen aus der Schweiz.
In der Weltrevolution 162 haben wir im Artikel „Welche Kraft kann Rassismus und Ausbeutung überwinden“ auch über die Empörung berichtet, die zeigt, dass viele Leute die Ausgrenzung und den versteckten und offenen Rassismus nicht mehr akzeptieren. Wie im beschriebenen Beispiel von Stockholm wurde auch in der Schweiz nach der Bekanntgabe des Abstimmungsresultats für eine Annahme der Ausschaffungsinitiative zu öffentlichen Demonstrationen aufgerufen und dies in mehreren Städten gleichzeitig, was sonst nur am 1. Mai üblich ist. Tausende gingen an diesem Abend auf die Strasse, um der Empörung Ausdruck zu geben. Die Mobilisierungen, aber auch laute Aktionen im Vorfeld der Abstimmung haben gezeigt, dass die Frage polarisiert hat – es war und ist noch heute eine deutliche Empörung zu spüren. Die Empörung richtet sich hauptsächlich gegen die Schweizerische Volkspartei (SVP), welche die Initiative lanciert hat. Sie steht heute als verantwortliche Kraft – auch für die gesamte Entwicklung der „Gesellschaft“ in Richtung rechtem Gedankengut.
Die Empörung richtete sich vor allem dagegen, dass einfach aufgrund der Staatszugehörigkeit entschieden wird, ob ein Mensch noch länger in der Schweiz bleiben kann oder nicht - unabhängig davon, ob er hier aufgewachsen ist, ob er hier Kinder oder andere Angehörige hat, ob er etwas Schlimmes verbrochen oder nur einen Ladendiebstahl begangen hat.
Wo es Lohnarbeit gibt, gibt es Migration. Viele von uns sind Kinder von „Ausländern“. Wir selber arbeiten vielleicht heute in einem Land, wo nicht dieselbe Sprache gesprochen wird wie an unserem Geburtsort. Die Arbeiterklasse ist eine Klasse von Aus- und Einwanderern. Der Rassismus war mit dem internationalen Charakter der Arbeiterklasse noch nie vereinbar, wird aber heute für viele ganz handgreiflich absurd. Hinzu kommt, dass die Fremdenfeindlichkeit eine Sündenbockhaltung ausdrückt: Die „Fremden“ sollen schuld sein an den gegenwärtigen gesellschaftlichen Problemen.
Die Empörung gerade bei vielen Jungen ist also nicht nur verständlich, sondern muss Ausgangspunkt sein für eine Veränderung in der Gesellschaft, im Umgang von Menschen mit anderen Menschen. Aber wie?
Nach einer langen Kampagne, die die Befürworter wie in der Schweiz üblich mit einer riesigen bildhaften Medienkampagne mit dem schwarzen Schaf und dem kriminellen Osteuropäer führten, wurde die Initiative bei überdurchschnittlicher Stimmbeteiligung (52.6%) mit 52.9% Ja-Stimmen angenommen. Man könnte sich nun über vieles unterhalten und sich darüber äussern, weil es z.B. eine unendliche Polemik der Bilder war, man könnte sich in die unzähligen rein juristischen, aber auch moralischen Diskurse einschalten oder die schlussendliche Relevanz der Gesetzesänderung genau betrachten. Interessant ist aus unserer Sicht, und darauf möchten wir hier genauer eingehen, wie es die herrschende Klasse in der Schweiz schafft, ihr System der so genannt direkten Demokratie zu gebrauchen, dass die Arbeiterklasse immer wieder gegen sich selber stimmt und sich mit dem Staat und der Herrschaftsform der Demokratie identifiziert.
Heuchlerische Methode der Demokratie und ihre integrativen Fähigkeiten
Wie bereits erwähnt, ist eine Wut und Empörung auch noch zwei Monate nach der Abstimmung zu spüren. Dass es diese Wut gibt und diese auch offen geäußert wird, ist gut. Die Wut zeigt eine richtige Haltung in Situationen, wo die Bourgeoisie versucht, die Klasse zu spalten.
Bedauernswert ist dabei, dass die Wut auch politisierte Leute dazu bringt, die Stimme gegen die Initiative auch auf dem demokratischen Weg der Wahl zu äussern. Anscheinend haben Einige an der Urne ihre Nein-Stimme abgegeben, und das obwohl die Demokratie als Herrschaftsform der Bourgeoisie von denselben abgelehnt wird. Warum also geht man stimmen, wenn damit das Instrument der demokratischen Abstimmung im bürgerlichen Staat akzeptiert wird? Wahrscheinlich ist es die Ohnmacht gegenüber dem politischen Apparat, wobei man trotz Bedenken mit der Möglichkeit rechnet, der SVP-Kampagne etwas entgegen zu setzen. Der Frage nach der Demokratie im Kapitalismus, die sich als politisches System bis heute am besten bewährt hat, möchten wir an diesem Beispiel nachgehen.
Hätte das Abstimmungsresultat bei der Ausschaffungsinitiative anders ausgesehen, wenn alle AusländerInnen in der Schweiz auch hätten abstimmen können statt nur die volljährigen Schweizer BürgerInnen? – Vielleicht. Sollten wir also dafür kämpfen, dass das Abstimmungs- und Wahlrecht ausgedehnt wird auf AusländerInnen?
Sobald man solche Fragen stellt, begibt man sich in die nationalstaatliche Logik. Wer definiert, wer wo AusländerIn ist? – Die Geburt. Der Ort deiner Geburt und die Staatsangehörigkeit deiner Eltern bestimmen, ob du in diesem oder jenem Land AusländerIn bist. Ob du bei einer Abstimmung in der Schweiz an die Urne gehen darfst oder nicht.
Dieses System der demokratischen Abstimmungen und Wahlen, wie es angeblich in der Schweiz in vorbildlicher Weise funktioniert, ist unauflöslich mit dem Nationalstaat verknüpft. Mit dem bürgerlichen Staat, der bestimmte Grenzen hat. Kann ein solches demokratisches System von uns dazu benutzt werden, den Rassismus einzudämmen? – Dies scheint ein Widerspruch in sich zu sein: Der Nationalstaat definiert, wer einheimischer Staatsbürger und wer Ausländer ist. Nur auf dieser Grundlage kann auch Ausländerfeindlichkeit entstehen, denn wo keine Ausländer sind, kann man sie auch nicht als solche zu Sündenböcken machen. Man muss also zuerst den Nationalstaat mit seinen Grenzen anerkennen, dieses System, das die Menschen in In- und Ausländer unterteilt, akzeptieren, bevor man innerhalb dieser Logik zwischen mehr oder weniger rassistischen Lösungen wählen darf.
Wenn wir uns also an den Abstimmungen beteiligen, haben wir schon eine erste Konzession gemacht. Wir bejahen dieses System der parlamentarischen oder direkten Demokratie im schweizerischen Nationalstaat. Es geht aber noch weiter: Indem wir konkret sowohl gegen die Ausschaffungsinitiative als auch gegen den Gegenvorschlag der Regierung votieren, bejahen wir – ob wir wollen oder nicht – die geltende Gesetzesordnung, das heisst das Ausländergesetz, das seit dem 1. Januar 2008 gilt und bereits eine Verschärfung des früheren Gesetzes bedeutet hat. Dieses neue Gesetz teilt die Menschen in drei Kategorien ein: Schweizer, EU-Bürger, übrige Ausländer - wehe dem, der zur dritten Kategorie gehört…. Wenn wir also gegen die beiden „schlimmeren“ Varianten zur Urne gehen, sind wir dem System schon doppelt auf den Leim gekrochen: indem wir es generell bejahen und indem wir Ja zum scheinbar geringeren Übel sagen.
Offensichtlich passt das bestehende demokratische System gut zur herrschenden Ordnung. Es ist flexibel und kann ständig an die sich ändernden Bedürfnisse angepasst werden. Diejenigen, die in diesem System zu den Verlierern (zu den Unterdrückten) gehören (die grosse Mehrheit), sind aufgeteilt in In- und Ausländer und meinen, dass sie ja mitbestimmen können – die Inländer, indem sie wählen und abstimmen, die Ausländer, indem sie die „Wahl“ haben, hier zu bleiben oder „nach Hause“ zu gehen und sich dort am demokratischen Spiel zu beteiligen. Gerade diese „Freiheiten“ führen dazu, dass das demokratische System immer wieder selbst von den Verlierern akzeptiert oder mindestens nicht aktiv in Frage gestellt wird. Und dort, wo es keine Demokratie gibt – in den Diktaturen – soll man angeblich für sie kämpfen.
Die Beteiligung an den Abstimmungen im demokratischen Staat bejaht aber nicht nur immer von Neuem das bestehende System, sondern zersetzt umgekehrt auch das Gefühl der Klassenzugehörigkeit im Proletariat. An die Urne geht man einzeln als Individuum, und nicht als kämpfende Klasse. Und man geht hin als StaatsbürgerIn, und nicht als ArbeiterIn. Was im Altertum das Joch für die Versklavten war, ist heute die Wahlurne für die ProletarierInnen.
Wollen wir denn in einer klassenlosen Gesellschaft, wo es keine Privilegien der Geburt und keine Ausbeutung mehr gibt, keine Mitbestimmung wie in der Demokratie? – Sicher schon, aber irgendwie doch anders. Was die bürgerliche Demokratie ausmacht, ist die Repräsentation: Es gibt eine in Klassen und Individuen gespaltene Gesellschaft, die zusammen gehalten werden muss. Die Parlamentarier, die Regierung werden gewählt und repräsentieren das „Gemeinwohl“. Das vermeintliche Gesamtinteresse in dieser Klassengesellschaft wird im Staat verkörpert. Dieser ist aber der Garant der herrschenden Ordnung, also ein Instrument der Herrschenden. Die Repräsentanten dieser Ordnung sind bevollmächtigt, während einer gewissen Zeit, z.B. vier Jahren, die Macht innerhalb des Nationalstaats auszuüben und ihn nach aussen zu vertreten.
In einer Gesellschaft umgekehrt, die nicht aus egoistischen Individuen besteht und keine Ausbeutung kennt, besteht das allgemeine Interesse darin, dass sich möglichst alle ständig mit ihren Ideen und ihrer Kreativität beteiligen. Es soll nicht bloss alle vier Jahre Wahlen geben, sondern ständig Diskussionen darüber, welchen Weg die Gesellschaft weiter verfolgen soll. Dabei wird es vermutlich auch zu Abstimmungen kommen, wenn es keine Einigkeit gibt. Aber die Betroffenen sollen sich aktiv beteiligen, die Entscheide sollen auch wieder in Frage gestellt, die Gewählten jederzeit abgewählt werden können. Das ist nicht mehr ein System der Repräsentation, sondern die Selbsttätigkeit der revolutionären Massen wie sie in den Arbeiterräten in der Russischen Revolution 1917 oder während kurzer Zeit in Deutschland und Ungarn 1918/19 existiert hat.
Eine Abstimmung wie vor einem Jahr gegen die Minarette oder jetzt für die „Ausschaffung krimineller Ausländer“ ist von einem emanzipatorischen Standpunkt aus (oder was für uns dasselbe ist: von einem proletarischen Standpunkt aus) von Anfang an eine Farce – eine falsche Frage im falschen Rahmen gestellt. Nationalstaat, bürgerliche Demokratie, Repräsentation sind die Mittel der Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung ihrer kapitalistischen Ordnung – Weltgemeinschaft aller Unterdrückten, offene Debatte, Selbsttätigkeit und -organisation der Massen sind die entsprechenden Werkzeuge unserer Befreiung.
Dies setzt voraus, dass wir uns für unsere wirklichen Interessen wehren und uns in diesem Kampf zusammentun, über die Grenzen der Nationalstaaten, der Berufsbranchen, des Geschlechts, der Herkunft, der Beschäftigung – unabhängig davon, ob arbeitslos oder angestellt, ob fest oder prekär angestellt oder noch in Ausbildung. Unsere KlassengenossInnen in Frankreich, England, Italien haben es uns in den letzten Monaten vorgemacht. Schliessen wir uns ihnen an.
22.01.11, K und H
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
Wir müssen international und selbständig kämpfen
- 2303 Aufrufe
Die Bewegung in Frankreich im vergangenen Herbst zeigt diese Dynamik, die zuvor durch die Anti-CPE-Bewegung ausgelöst wurde, sehr gut auf.
Regelmäßig sind Millionen Arbeiter/Innen aus allen Bereichen in Frankreich auf die Straßen gegangen. Gleichzeitig war es seit September 2010 zu immer radikaleren Streiks gekommen, die eine tiefgreifende und wachsende Unzufriedenheit zum Ausdruck brachten. Diese Mobilisierung ist die erste große Auseinandersetzung in Frankreich seit der Beschleunigung der Krise, die das Weltfinanzsystem 2007-2008 erschüttert hat.
Sie ist nicht nur eine Reaktion auf die Rentenreform ; ihr Ausmaß und ihre Tiefe sind eine klare Antwort auf die Brutalität aller Angriffe der letzten Jahre. Seit dieser Reform und den anderen gleichzeitig angekündigten oder vorbereiteten Angriffen ist die ablehnende Haltung der Arbeiter/innen und großer Teile der Bevölkerung gegenüber einer weiteren Verarmung und Prekarisierung förmlich mit Händen zu greifen. Doch in Anbetracht der unaufhaltsamen Zuspitzung der Wirtschaftskrise werden diese Angriffe nicht nachlassen. Es liegt auf der Hand, dass dieser Abwehrkampf nur der Auftakt weiterer Kämpfe ist und in einer Reihe mit anderen Abwehrkämpfen (z.B. in Griechenland oder Spanien) gegen die drastischen Sparmaßnahmen steht.
Trotz des massiven Widerstands hat die Regierung in Frankreich nicht nachgegeben. Im Gegenteil, unbeeindruckt vom Druck von der Straße verkündete sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit ihre Entschlossenheit, die Rentenreform, koste was es wolle, durchzusetzen. Dabei wiederholte sie stets, dass diese Reform im Namen der «Solidarität» zwischen den Generationen notwendig sei.
Warum konnte diese Maßnahme, die doch unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen so gravierend betrifft, trotz der großen Empörung und breiten Ablehnung durch die gesamte Bevölkerung durchgesetzt werden? Warum ist es trotz der massiven Mobilisierung nicht gelungen, die Regierung zum Nachgeben zu zwingen? Weil die Regierung die Gewissheit hatte, die Lage mit Hilfe der Gewerkschaften im Griff zu haben, denn Letztere haben mit Unterstützung der linken Parteien im Prinzip stets die «notwendige Reform» der Renten akzeptiert. Im Vergleich dazu war es der Bewegung von 2006 gegen den CPE, für die die Medien anfangs nur die größte Verachtung übrighatten, sei sie doch nur ein «vorübergehender Studentenprotest», damals gelungen, die Regierzung zum Nachgeben und zur Aufgabe des CPE zu zwingen.
Wo liegt der Unterschied ? Zunächst darin, dass die Studenten sich in Vollversammlungen organisiert hatten, die allen offenstanden, gleich, ob man im öffentlichen Dienst oder in der Industrie beschäftigt war, arbeitslos oder beschäftigt, prekär beschäftigt oder fest angegestellt. Dieses gewaltige Vertrauen in die Fähigkeiten der Arbeiterklasse und ihre Stärke hatten eine dynamische Ausdehnung der Bewegung ermöglicht; immer mehr Menschen aus allen Altersgruppen reihten sich in die Bewegung ein. Denn während auf der einen Seite in den Vollversammlungen die breitestmöglichen Diskussionen stattfanden, die sich nicht auf die Probleme der Studenten beschränkten, schlossen sich andererseits bei den Demonstrationen immer mehr Arbeiter mit den StudentInnenen und den immer zahlreicher werdenden Schülern/Innen zusammen.
Doch mit ausschlaggebend war auch, dass die Entschlossenheit und die offene Haltung der StudentInnen, die immer größere Teile der Arbeit/Innen in den offenen Kampf ziehen konnten, es den Gewerkschaften unmöglich machten, ihre Sabotage auszuüben. Im Gegenteil, als die Gewerkschaften, insbesondere die CGT, versuchten, sich an die Spitze der Demonstrationen zu stellen, um die Kontrolle zu übernehmen, haben die Student/Innen und Schüler/Innen mehrfach die gewerkschaftlichen Spruchbänder verdrängt und betont, dass sie sich in dieser Bewegung, die sie selbst initiiert hatten, nicht beiseite oder ans Ende drängen lassen wollten. Aber vor allem bekräftigten sie ihren Willen, mit den Arbeiter/Innen die Kontrolle über die Bewegung zu behalten und sich von den Gewerkschaften nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen.
Einer der Aspekte, die den Herrschenden am meisten Sorgen bereiteten, war, dass die Organisationsform, die die Student/Innen im Kampf entwickelt hatten - die souveränen Vollversammlungen, die ihre Koordinationskomitees selbst wählten, allen offenstanden und in denen die studentischen Gewerkschaften gezwungen waren, sich zumeist zurückzuhalten - sich ausbreiteten und für Nachahmung unter den Beschäftigten sorgten, sofern diese in den Streik traten. Es war kein Zufall, als im Verlaufe dieser Bewegung Thibault mehrfach verlautbarte, dass die Beschäftigten von den Student/Innenen nicht lernen müssten, wie man sich organisiert. Während die Student/Innen ihre Vollversammlungen und ihre Koordinationen hatten, hätten die Beschäftigten ihre Gewerkschaften, denen sie vertrauten. Angesichts der Entschlossenheit der Student/Innen und der Gefahr eines Kontrollverlustes durch die Gewerkschaften musste der französische Staat nachgeben, denn schließlich sind Erstere das letzte Bollwerk der herrschenden Klasse gegen die Ausdehnung von massiven Kämpfen.
In der Bewegung gegen die Rentenreform haben die Gewerkschaften mit aktiver Unterstützung durch Polizei und Medien die notwendigen Anstrengungen unternommen, um die Zügel in der Hand zu behalten, die Stimmung auszuloten und sich dementsprechend zu verhalten.
Die Forderung der Gewerkschaften lautete überigens nicht : «Rücknahme des Angriffs durch die Rentenreform», sondern «Änderung der Reform». Sie riefen zu fairen Verhandlungen mit der Regierung auf und traten für eine «gerechtere, humanere» Reform ein. Von Anfang an haben sie auf Spaltung gesetzt, trotz der angeblichen Einheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses (Intersyndicale), der herbeigeführt worden war, um der Gefahr zu begegnen, von den Ereignissen überrollt zu werden. Die Gewerkschaft FO hielt anfangs eigene Kundgebungen ab, während der gewerkschaftliche Zusammenschluss (Intersyndicale) mit der Vorbereitung des Aktionstages vom 23. März die Verabschiedung der Rentenreform vorbereitete. Sodann wurden zwei weitere Aktionstage angekündigt, der erste für den 26. Mai und der zweite für den 24. Juni, am Vorabend der Sommerferien. Es ist allgemein bekannt, dass eine Aktionstag so kurz vor den Sommerferien üblicherweise einer Bewegung den Rest gibt. An diesem letzten Aktionstag, dem 24. Juni, beteiligten sich jedoch unerwartet viele – nämlich doppelt so viele Arbeiter/Innen, Arbeitslose, prekär Beschäftigte usw. Und während die Stimmung an den beiden vorhergehenden Aktionstagen ziemlich gedrückt war, spürte man am 24. Juni deutlich die Wut und Empörung. Der Aktionstag hat der Arbeiterklasse wieder Auftrieb verliehen. Die Idee, dass es durchaus möglich ist, durch den Kampf Druck auszuüben, gewinnt an Boden. Die Gewerkschaften wittern natürlich auch, dass der Wind sich dreht. Sie wissen, die Frage, wie man kämpfen soll, weicht nicht aus den Köpfen. So beschließen sie, das Terrain umgehend zu besetzen und in die ideologische Offensive zu gehen. Sie wollen verhindern, dass die ArbeiterInnen selbständig, außerhalb der gewerkschaftlichen Kontrolle denken und handeln. Alle linken Parteien, die sich an die Bewegung angehängt haben, um ihre Glaubwürdigkeit nicht ganz zu verlieren, waren sich eigentlich in der Notwendigkeit einig gewesen, die Arbeiterklasse auf dieser Ebene zur Kasse zu bitten.
Um sicherzustellen, dass das selbständige Denken eingedämmt wird, mieten sie gar Flugzeuge an, die mit Spruchbändern mit Aufrufen zu den Kundgebungen am 7. September über die Badestrände fliegen. Aber ein anderes Ereignis, das normalerweise unter „Sonstiges“ abgehandelt werden könnte, ließ im Sommer die Wut weiter wachsen – die „Woerth-Affäre“. Es geht hierbei um politische Begünstigung unter gegenwärtig an der Macht befindlichen Politikern und eine der reichsten Erbinnen des französische Kapitals, Frau Bettencourt, Chefin von L’Oréal, sowie der Beschuldigung von Steuerhinterziehungen und illegalen Absprachen aller Art. Nun ist just dieser Eric Woerth der für die Rentenreform verantwortliche Minister. Die Empörung über die Ungerechtigkeit ist daher groß: Die Arbeiterklasse soll den Gürtel enger schnallen, während die Reichen und Mächtigen „ihre Geschäfte untereinander machen“.
Unter dem Druck der zunehmenden und offenen Unzufriedenheit und der wachsenden Erkenntnis über die Folgen dieser Reform für unsere Lebensbedingungen waren die Gewerkschaften dazu gezwungen, schon für den 7. September einen neuen Aktionstag anzuberaumen. Diesmal erweckten sie den Anschein gewerkschaftlicher Einheit. Seither haben alle Gewerkschaften zur Beteiligung an den Aktionstagen aufgerufen, an denen sich mehrfach bis zu drei Millionen Arbeiter/Innen beteiligt haben. Die Rentenreform wurde zum Symbol der brutalen Verschlechterung der Lebensbedingungen.
Doch diese Einheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses war ein Täuschungsversuch, der dazu dienen sollte, der Arbeiterklasse zu suggerieren, dass die Gewerkschaften entschlossen seien, eine breite Offensive gegen die Reform zu organisieren und dass die wiederholten Aktionstage dazu dienten, diesem Protest Ausdruck zu verleihen. Daher tauchten an diesen Aktionstagen stets deren Führer auf und schwafelten von der «Fortsetzung» der Bewegung. Vor allem fürchteten sie, dass die Beschäftigten die gewerkschaftliche Zwangsjacke ablegen und sich selbst organisieren. Dies gestand Thibault, der Generalsekretär der CGT ein, als er am 10. September in einem Interview mit Le Monde der Regierung eine «Botschaft» übermittelte : «Es kann sein, dass es zu einer Blockierung kommt, zu einer großen sozialen Krise. Das könnte eintreten. Aber wir haben dieses Risiko nicht auf uns nehmen wollen.» Dann nannte er ein Beispiel, um besser zu veranschaulichen, was den Gewerkschaften als zentral erschien. «Wir kennen sogar einen mittelständischen Betrieb, ohne Gewerkschaften, wo 40 von 44 Beschäftigte gestreikt haben. Das ist ein Zeichen. Je unnachgiebiger man ist, desto stärker erhält die Idee Auftrieb, dass man immer weiter streiken soll».
Es liegt auf der Hand, dass, wenn die Gewerkschaften nicht präsent sind, die Beschäftigten sich selbst organisieren und nicht nur selbst entscheiden, was sie tun wollen, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen und dass weitaus mehr Menschen sich engagieren. Dagegen versuchten die Gewerkschaftszentralen, insbesondere die CGT und SUD, emsig anzugehen : Sie versuchten auf gesellschaftlicher Ebene und in den Medien massiv Flagge zu zeigen. Mit derselben Entschlossenheit versuchten sie vor Ort jegliche wirkliche Solidarität abzuwürgen. Kurzum, großes Medienspektakel auf der einen Seite und reges Treiben auf der anderen Seite, um die Bewegung vor falsche Alternativen zu stellen, Spaltung und Verwirrung zu stiften, um der Bewegung eine Niederlage beizufügen.
Die Blockade der Ölraffinerien ist eines der deutlichsten Beispiele. Selbst konfrontiert mit geplanten Stellenstreichungen, war die Kampfbereitschaft unter den Beschäftigten der Ölraffinerien gewachsen ; auch war die Zahl jener gestiegen, die bereit waren, ihre Solidarität mit der ganzen Arbeiterklasse gegen die Rentenreform zum Ausdruck zu bringen. Doch die CGT unternahm alles, um dieses Streben nach Solidarität zu einem abschreckenden Beispiel eines Streiks umzuwandeln.
Die Blockade der Raffinerien wurde nie in Vollversammlungen beschlossen, in denen die Beschäftigten ihren Standpunkt hätten einbringen können. Diese Entscheidung ist einzig durch gewerkschaftliche Manöver möglich geworden, auf die die Gewerkschaftsführer spezialisiert sind. Diskussionen wurden abgewürgt, stattdessen wurden sinnlose Aktionen vorgeschlagen. Trotz dieser Abwürgungstaktik der Gewerkschaften haben einige Raffineriearbeiter versucht, Kontakt zu Beschäftigten aus anderen Branchen aufzunehmen. Doch die Schlinge der «Blockade bis zum Ende» zog sich immer mehr zu; die meisten Beschäftigten der Raffinerien gerieten in die Falle der Isolierung und betrieblichen Abschottung. Nichts konnte die Ausdehnung des Kampfes besser aufhalten. Obwohl es den Raffinerienarbeitern darum ging, die Bewegung zu stärken und ihr mehr Kraft zu verleihen, um die Regierung zum Nachgeben zu zwingen, hat sich die Blockade der Raffinerien, wie sie von den Gewerkschaften ausgeheckt worden war, vor allem als eine Waffe der Herrschenden und der in ihrem Dienst stehenden Gewerkschaften gegen die ArbeiterInnen erwiesen.
Nicht nur, dass die Raffineriearbeiter durch die Blockade isoliert wurden, hinzu kommt, dass ihr Streik in der Öffentlichkeit gegeißelt wurde, indem man Panik verbreitete und mit einer allgemeinen Benzinknappheit drohte Die Medien hetzten gegen diese «Geiselnehmer», die die Leute daran hindern, zur Arbeit oder in die Ferien zu fahren. Die Beschäftigten dieser Branche wurden auch physisch isoliert: Sie wollten zum solidarischen Kampf beitragen, damit die Regierung nachgibt, doch letztendlich richtete sich diese Blockage gegen sie selbst und gegen die ursprünglichen Ziele der Blockade.
Es gab zahlreiche ähnliche Gewerkschaftsaktionen in einigen anderen Branchen wie im Transportwesen, vor allem aber in Regionen mit wenig Industrie, denn die Gewerkschaften wollten das Risiko der Ausdehnung und der aktiven Solidarisierung weitestgehend minimieren. Sie mussten den Eindruck erwecken, als ob sie die radikalsten Kämpfe zusammenführten; bei den Demos zogen sie die Nummer der Gewerkschaftseinheit ab. Überall sah man die in der Intersyndicale zusammengeschlossenen Gewerkschaften, wie sie Einigkeit vortäuschten. Sie riefen zu Vollversammlungen auf, in denen es keine wirkliche Diskussionen gab und in denen ein auf die Branche beschränkter Blick herrschte, während sie gleichzeitig behaupteten, für «alle gemeinsam» zu kämpfen. In Wirklichkeit ließen sie jeden in seiner Ecke zurück, unter Führung der jeweiligen Gewerkchaftsfunktionäre protestieren und verhinderten die Aufstellung von Massendelegationen, die die Solidarität anderer Beschäftiger in anderen, nahegelegenen Betrieben hätten einfordern können.
Die Gewerkschaften waren nicht die einzigen, die solch eine Mobilisierung verhinderten. Sarkozys Polizei, die wegen ihrer Feindseligkeit gegen die Linke berüchtigt ist, erwies sich als unersetzliche Hilfstruppe für die Gewerkschaften, indem sie wiederholt sehr provozierend vorging. Nehmen wir beispielsweise die Vorfälle auf dem Bellecour-Platz in Lyon, wo die Anwesenheit einiger «Krawallmacher» (die wahrscheinlich von der Polizei manipuliert wurden) als Vorwand für einen gewaltsamen Einsatz gegen Hunderte von Gymnasiast/Innen diente, von denen die meisten am Ende einer Demonstration der Beschäftigten zu Diskussionen zusammenkommen wollten.
Eine Bewegung mit großen Perspektiven
Die Medien erwähnten mit keiner Silbe die zahlreichen Comités oder branchenübergreifenden Vollversammlungen (AG inter-pros), die damals existierten. Deren Ziel war die Selbstorganisierung außerhalb der Gewerkschaften, die Durchführung von allen ArbeiterInnen offen stehenden Diskussionen und Aktionen, mit denen sich die gesamte Arbeiterklasse nicht nur identifizieren, sondern an denen sie sich auch massiv beteiligen kann.
Dies ist es, was die Herrschenden ganz besonders fürchteten: dass es zu Kontakten unter den Beschäftigten kommt, dass sich Junge und Alte, Arbeitslose und Beschäftigte zusammenschließen.
Es gilt nun die Lehren aus dem Scheitern der Bewegung zu ziehen.
Zunächst muss man feststellen, dass die Gewerkschaften dafür gesorgt haben, dass die Rentenreform verabschiedet werden konnte; und dies ist kein vorübergehendes Phänomen. Sie haben ihre schmutzige Arbeit verrichtet, eine Arbeit, die von allen Experten wie auch von der Regierung und Sarkozy persönlich als sehr «verantwortlich» begrüßt wurde. Ja, die Herrschenden können froh sein, derart «verantwortungsbewusste» Gewerkschaftsführer auf ihrer Seite zu haben, die eine Bewegung solchen Ausmaßes scheitern lassen können und dabei gleichzeititg den Eindruck vermitteln, sie hätten alles Mögliche unternommen, um die Bewegung zum Erfolg zu führen. Dabei haben die gleichen Gewerkschaftsapparate die ganz realen Stimmen des selbstständigen Arbeiterkampfes entweder zum Verstummen gebracht oder zu marginalisieren versucht.
Dieses Scheitern hinterlässt jedoch auch positive Spuren, denn trotz all der Anstrengungen der herrschenden Klasse, die Wut der ArbeiterInnen zu kanalisieren, ist es ihr nicht gelungen, Beschäftigten einer Branche eine Niederlage beizufügen, wie das 2003 noch der Fall war beim Kampf der Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes um die Renten, als die Beschäftigten des Erziehungswesen nach wochenlangen Streiks eine herbe Niederlage einstecken mussten.
Schließlich sind im Verlauf der Bewegung wachsende Minderheiten in mehreren Städten zusammengekommen, die klare Vorstellungen von den tatsächlichen Bedürfnissen des Kampfes der gesamten Arbeiterklasse haben: die Notwendigkeit, den Kampf selbst in die Hand zu nehmen, um ihn auszudehnen und zu verbreitern. Diese spiegeln somit eine echte Reifung im Denkprozess wider. Sie zeigen, dass die Bewegung zwar erst am Anfang steht, dass man aber willens ist, die Lehren zu ziehen, um für zukünftige Kämpfe besser vorbereitet sein will.
Wie in einem Flugblatt der « AG interpro » des Pariser Ostbahnhofs vom 6. November gesagt wird : « Man hätte sich von Anfang an auf die Branchen stützen müssen, in denen gestreikt wurde, anstatt die Bewegung auf die Forderung der Rücknahme der Rentenreform zu begrenzen, während gleichzeitig weitere Entlassungen, Stellenstreichungen, Kürzungen im öffentlichen Dienst und Lohnsenkungen angekündigt werden. Wenn wir diese Fragen insgesamt aufgegriffen hätten, hätten wir die anderen Beschäftigten mit in die Bewegung einbeziehen und sie damit ausdehnen und vereinigen können.
Nur ein Massenstreik, der auf örtlicher Ebene organisiert und auf nationaler Ebene mit Hilfe von Streikkomitees, branchenübergreifenden Vollversammlungen koordiniert werden muss, und der es erforderlich macht, dass wir selbst über unsere Forderungen und Handlungen entscheiden und dabei die Kontrolle über die Bewegung bewahren, hat Aussicht auf Erfolg.
« Die Stärke der Beschäftigten besteht nicht nur darin, hier und da eine Ölraffinerie oder gar eine Fabrik zu blockieren. Die Stärke der Beschäftigten besteht darin, sich an ihrem Arbeitsplatz zu versammeln, dabei alle Barrieren von Branchen, Werken, Betrieben, Gruppieruengen usw. zu überwinden und gemeinsam zu entscheiden. (…) Denn die Angriffe fangen jetzt erst an. Wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Die Herrschenden erklären uns ihren Klassenkrieg, aber wir haben die Mittel diesen Krieg zu führen. » (Flugblatt : « Niemand darf an unserer Stelle kämpfen, entscheiden und gewinnen », unterzeichnet von Beschäftigen und prekär Beschäftigten der «branchenübergreifenden Vollversammlung des Pariser Ostbahnhofs und Ile de France », oben erwähnt).
Wir haben keine andere Wahl : Um uns zu wehren, müssen wir unsere Kämpfe massiv ausdehnen und erweitern, also sie in die eigene Hand nehmen.
Dieser Wille äußerste sich klar in Gestalt von :
- wirklichen branchenübergreifenden Vollversammlungen, die zwar nur kleine Minderheiten bündelten, aber ihren Willen bekundeten, für zukünftige Kämpfe besser vorbereitet zu sein ;
- Versuchen, Versammlungen auf der Straße oder Protestversammlungen am Ende von Demonstrationen abzuhalten; insbesondere in Toulouse ist dies gelungen.
Dieser von Minderheiten zum Ausdruck gebrachte Wunsch, sich selbst zu organisieren, zeigt auf, dass die Arbeiterklasse insgesamt anfängt, die Gewerkschaftsstrategie infrage zu stellen, ohne allerdings zu wagen, heute schon all die Konsequenzen aus ihren Zweifeln und Infragestellungen zu ziehen. In allen Vollversammlungen (ob von den Gewerkschaften einberufen oder nicht) kreisten die meisten Debatten in der unterschiedlichsten Form um solch wichtige Fragen wie « Wie können wir kämpfen?, Wie können wir die anderen Beschäftigen unterstützten?, Wie können wir unsere Solidarität zeigen ? Welche andere branchenübergreifende Vollversammung können wir treffen? « Wie können wir unsere Isolierung überwinden und die größtmögliche Zahl von Beschäftigten ansprechen, um mit ihnen über unsere Widerstandsmöglichkeiten zu reden ? Was können wir blockieren ? »… Tatsächlich begaben sich einige Dutzend Beschäftigte aus allen Bereichen, Arbeitslose, prekär Beschäftigte, Rentner täglich vor die Werkstore der zwölf blockierten Raffinerien, um gegenüber den CRS ihr „Gewicht in die Waagschale“ zu werfen, ihnen Essenskörbe zu bringen und vor allem moralische Unterstützung zu leisten.
Diese Zeichen der Solidarisierung sind ein wichtiges Element; sie belegen erneut das tiefgreifende Wesen der Arbeiterklasse. « Vertrauen in unsere eigenen Kräfte gewinnen » sollte ein zukünftiger Schlachruf sein.
Dieser Kampf ist dem Schein nach eine Niederlage, schließlich hat die Regierung nicht nachgegeben. Aber für unsere Klasse stellt sie einen Schritt nach vorne dar. Die Minderheiten, die aus dieser Bewegung hervorgegangen sind und versucht haben, sich, in den branchenübergreifenden Vollversammlungen zusammenzuschließen oder in den auf der Straße abgehaltenen Versammlungen zu diskutieren - diese Minderheiten, die versucht haben, den Kampf in die eigenen Hände zu nehmen und dabei die Gewerkschaften wie die Pest gemieden haben, bringen die Fragestellungen in der Klasse zum Vorschein, mit denen sich immer mehr ArbeiterInnen vertieft auseinandersetzen. Dieser Denkprozess wird weitergehen und langfristig auch seine Früchte tragen. Dies ist kein Aufruf zum Abwarten, zur Passivität. Auch heißt das nicht, dass die reife Frucht einfach vom Baum fallen wird. Alle diejenigen, die sich bewusst sind, dass es in der Zukunft noch mehr Angriffe hageln und eine wachsende Verarmung auf uns zukommen wird, gegen die wir uns zur Wehr setzen müssen, sollten daher schon heute die künftigen Kämpfe vorbereiten. Wir müssen weiterhin diskutieren, die Lehren aus dieser Bewegung ziehen und sie so breit wie möglich streuen. Jene, die in dieser Bewegung, auf den Demonstrationen und Vollversdammlungen ein vertrauensvolles Verhältnis und brüderliche Beziehungen untereinander unterhalten haben, sollten sich weiterhin treffen (in Form eines Diskussionszirkels, Kampfkomitees, einer Volksversammlung oder als „Treffpunkt zum Reden), denn eine Klärung vieler Fragen steht weiterhin an:
- Welche Rolle spielen wirtschaftliche Blockaden im Klassenkampf?
- Was ist der Unterschied zwischen staatlicher Gewalt und der Gewalt der Beschäftigten?
- Wie kann man der Repression entgegentreten?
- Wie können wir unsere Kämpfe in die eigene Hand nehmen? Wie können wir uns organisieren?
- Was ist eine gewerkschaftliche Vollversammlung und was ist eine souveräne Vollversammlung?
Diese Bewegung ist schon reich gewsen an Lehren für die Arbeiterklasse auf der ganzen Welt. Die jüngsten Mobilsierungen der Studenten in Großbritannien sind in ihrer Art und Weise ebenso verheißungsvoll für die weitere Entwicklung des Klassenkampfes.
14. Januar, (gekürzte Fassung aus International Review Nr. 144).
Aktuelles und Laufendes:
- Rentenreform Frankreich [234]
- Studentenproteste Großbritannien [235]
- Klassenkampf Frankreich [236]
- Kämpfe Tunesien [237]
Weltrevolution Nr. 165
- 3327 Aufrufe
1871 - Pariser Kommune
- 3377 Aufrufe
Für Generationen von Arbeitern war die Pariser Kommune der Bezugspunkt in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Die Russischen Revolutionen von 1905 und 1917 stützten sich auf die Pariser Kommune und ihre Lehren, bis die Revolution von 1917 als Hauptbezugspunkt an deren Stelle trat.
Heute versuchen die Propagandakampagnen der herrschenden Klasse die revolutionäre Erfahrung des Oktober 1917 zu begraben und zu verfälschen, um die Arbeiter von ihrer eigenen Geschichte abzustoßen. Die Herrschenden wollen, dass wir Kommunismus mit Stalinismus identifizieren. Da die Pariser Kommune sich nicht für die gleichen Lügen eignet, hat die herrschende Klasse immer versucht, ihre wahre Bedeutung zu verdrehen und sie als eine patriotische Bewegung oder als einen Kampf für die Verteidigung der bürgerlichen Werte darzustellen.
Ein Kampf gegen das Kapital und kein patriotischer Kampf
Die Pariser Kommune entstand 7 Monate nach Napoleons Niederlage in Sedan, als dieser im französisch-preußischen Krieg von 1870 besiegt worden war. Am 4. Sept. 1870 erhoben sich die Pariser Arbeiter gegen die furchtbaren Lebensbedingungen, unter denen sie nach Napoleons militärischem Abenteuer litten. Die Republik wurde ausgerufen, während Bismarcks Truppen in der Nähe von Paris in Zeltstädten lagerten. Von dem Zeitpunkt an kümmerte sich die Nationalgarde, die sich aus Truppen aus den unteren mittleren Schichten zusammensetzte, um die Verteidigung der Hauptstadt gegen den preußischen Feind. Die Arbeiter, die mittlerweile Hunger litten, traten schnell der Nationalgarde bei und stellten bald die Mehrheit ihrer Truppen. Die herrschende Klasse möchte diese Episode in patriotischen Farben malen, um aufzuzeigen, dass es sich um eine "Volkserhebung" gegen den preußischen Aggressor gehandelt habe. Aber sehr schnell brachten die Kämpfe zur Verteidigung von Paris die unlösbaren Klassengegensätze ans Tageslicht, die die beiden grundlegenden Klassen der Gesellschaft aufeinanderprallen ließen: Bourgeoisie und Proletariat. Nach 135 Tagen der Belagerung kapitulierte die französische Regierung und unterschrieb den Waffenstillstand mit der preußischen Armee. Thiers, der neue Führer der republikanischen Regierung verstand, dass es mit dem Ende der Feindseligkeiten zwischen preußischen und französischen Truppen nötig wäre, das Pariser Proletariat zu entwaffnen, da dieses eine Bedrohung für die herrschende Klasse darstellte. Am 18. März 1871 versuchte er es zunächst mit Tricks. Er behauptete, die Waffen wären Staatsbesitz. Deshalb schickte er Truppen, die der Nationalgarde die Artillerie von mehr als 200 Kanonen abnehmen sollten, die die Arbeiter in Montmartre und Belleville versteckt hielten. Der Versuch scheiterte, weil die Arbeiter erbitterten Widerstand leisteten und es zur Verbrüderung zwischen der Pariser Bevölkerung und den Truppen kam. Das Scheitern dieses Versuchs, Paris zu entwaffnen, brachte ein Pulverfass zur Explosion, und löste den Bürgerkrieg zwischen den Arbeitern von Paris und der bürgerlichen Regierung aus, die nach Versailles geflüchtet war. Am 18. März erklärte das Zentralkomitee der Nationalgarde, das die Macht vorübergehend übernommen hatte: "Die Proletarier von Paris, inmitten der Niederlagen und des Verrats der herrschenden Klassen, haben begriffen, dass die Stunde geschlagen hat, wo sie die Lage retten müssen... Sie haben begriffen, dass es ihre höchste Pflicht und ihr absolutes Recht ist, sich zu Herren ihrer eigenen Geschichte zu machen und die Regierungsgewalt zu ergreifen" (In Karl Marx : "Der Bürgerkrieg in Frankreich", MEW, Bd. 17, S. 335). Am gleichen Tag kündigte das Komitee sofortige Wahlen der Delegierten aus den Arrondissements (Pariser Stadtbezirken) an, die nach allgemeinem Wahlrecht gewählt werden sollten. Diese wurden am 26. März abgehalten; zwei Tage später wurde die Kommune ausgerufen. Es gab mehrere Tendenzen: eine von den Blanquisten beherrschte Mehrheit, und eine Minderheit, die zumindest aus Proudhon nahestehenden Sozialisten bestand und der 1. Internationale angehörte.
Die Versailler Regierung ging sofort zum Gegenangriff über, um Paris aus den Händen der Arbeiterklasse zu reißen. Die französische Bourgeoisie, die die Bombardierung von Paris durch die preußischen Truppen aufs Schärfste verurteilt hatte, bombardierte jetzt selbst zwei Monate lang die Stadt.
Es ging dem Proletariat nicht darum, das Vaterland gegen einen ausländischen Feind zu verteidigen, sondern sich gegen den Feind zu Hause zu wehren, gegen die "eigene" Bourgeoisie, die sich in der Versailler Regierung zusammengeschlossen hatte. Deshalb weigerte sich das Pariser Proletariat, seine Waffen zu strecken und sich den Ausbeutern zu ergeben. Stattdessen errichtete es die Kommune.
Ein Kampf zur Zerstörung des bürgerlichen Staates und nicht zur Verteidigung der republikanischen Freiheiten
Die Bourgeoisie stützt ihre schlimmsten Lügen immer auf einen Schein von Wirklichkeit. Sie versucht die Tatsache zu ihren Gunsten zu verwenden, dass die Kommune sich tatsächlich auf die Prinzipien von 1789 berief, um die erste revolutionäre Erfahrung des Proletariats auf eine bloße Verteidigung der republikanischen Freiheiten zu reduzieren, sie als einen Kampf der bürgerlichen Demokratie gegen die monarchistischen Truppen darzustellen, um die sich die französische Bourgeoisie geschart hatte. Aber der wahre Geist der Kommune kann nicht verstanden werden anhand des Gewandes, den sich das junge Proletariat 1871 angelegt hatte. Diese Bewegung ist ein erster lebenswichtiger Schritt im weltweiten Befreiungskampf des Proletariats gewesen. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass die offizielle Macht der Bourgeoisie in einer ihrer Hauptstädte umgeworfen wurde. Und dieser Titanenkampf ist das Werk der Arbeiterklasse und keiner anderen Klasse gewesen. Sicher war die Arbeiterklasse damals wenig entwickelt, sie war kaum ihrer alten Handwerkervergangenheit entronnen und schleppte noch das ganze Gewicht des Kleinbürgertums mit sich herum und die Illusionen, die 1789 enstanden waren. Dennoch war diese Arbeiterklasse die treibende Kraft in der Kommune gewesen. Obgleich die Revolution historisch gesehen noch nicht möglich war (weil das Proletariat insgesamt noch zu unreif war und vor allem, weil der Kapitalismus noch nicht die Produktivkräfte soweit entwickelt hatte, dass sie in einen unüberwindbaren Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen gerieten), zeigte die Kommune die Richtung auf, in die sich die zukünftigen Arbeiterkämpfe entwickeln würden.
Und obgleich die Kommune sich auf einige Prinzipien der bürgerlichen Revolution berief, füllte sie sie nicht mit dem gleichen Inhalt aus. Für die Bourgeoisie bedeutete "Freiheit" freier Handel und die "Freiheit" Arbeitskraft auszubeuten; "Gleichheit" hieß nichts anderes als Gleichheit unter den Bourgeois in ihrem Kampf gegen feudale Privilegien; "Brüderlichkeit" hieß Harmonie zwischen Kapital und Arbeit, mit anderen Worten Unterwerfung der Ausgebeuteten unter die Ausbeuter. Für die Arbeiter der Kommune hieß "Freiheit, Gleicheit, Brüderlichkeit" die Abschaffung der Lohnarbeit, der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen und einer Gesellschaft, die in Klassen aufgespalten ist. Diese Auffassung einer anderen Welt, die von der Kommune selber zum Ausdruck gebracht wurde, spiegelte sich in der Organisierung des gesellschaftlichen Lebens durch die Arbeiterklasse während der zweimonatigen Existenz der Kommune wider. Das wahre Klassenwesen der Kommune ist in ihren ökonomischen und politischen Maßnahmen zu suchen, und nicht so sehr in den Slogans, die aus der Vergangenheit übernommen wurden.
Zwei Tage nach ihrer Ausrufung bestätigte die Kommune ihre Macht, indem sie direkt den Staatsapparat durch eine Reihe von politischen Maßnahmen angriff: Abschaffung der Polizeikräfte, die die gesellschaftliche Repression ausüben, der stehenden Armee und der Wehrpflicht (die einzig anerkannten militärischen Kräfte waren die Truppen der Nationalgarde), Zerstörung der staatlichen Verwaltung, Beschlagnahme des Kircheneigentums, Abschaffung der Guillotine, kostenlose Schulen, all die anderen symbolischen Maßnahmen wie die Zerstörung des Monuments der Vendome, des Symbols des Chauvinismus der herrschenden Klasse, das von Napoleon I. errichtet worden war. Am gleichen Tag bestätigte die Kommune ihr proletarisches Wesen durch die Tatsache, dass die "Fahne der Kommune die der Universellen Republik, der Weltrepublik" sein sollte. Das Prinzip des proletarischen Internationalismus wurde durch die Wahl von Ausländern zur Kommune verdeutlicht (so wurden der Pole Dombrowski als Beauftragter für die Verteidigung und der Ungar Frankel für den Bereich Arbeit ernannt).
Unter all diesen politischen Maßnahmen gab es eine, die besonders deutlich aufzeigte, wie falsch die Auffassung war, der zufolge das Pariser Proletariat die demokratische Republik angeblich verteidigt hätte: es handelt sich um die jeder Zeit mögliche Abwählbarkeit der Delegierten der Kommune, die ständig gegenüber den Organen, die sie gewählt hatten, verantwortlich waren. Dies geschah lange vor der Entstehung der Arbeiterräte in der Russischen Revolution von 1905 - die wie Lenin später sagen sollte "die endlich gefundene Form der Diktatur des Proletariats" waren. Dieses Prinzip der Abwählbarkeit, das das Proletariat bei seiner Machtergreifung praktiziert hatte, bestätigt erneut das proletarische Wesen der Kommune. Die Diktatur der Bourgeoisie, von der der "demokratische" Staat nur die heimtückischste Variante ist, bündelt all die Staatsmacht der ausbeutenden Klasse in den Händen einer Minderheit zusammen, die die große Mehrheit der Produzenten unterdrückt und ausbeutet. Das Prinzip der proletarischen Revolution besteht auf der anderen Seite darin, dass keine Macht entstehen soll, die sich über die Gesellschaft stellen könnte. Nur eine Klasse, die auf die Abschaffung jeglicher Klassenherrschaft einer Minderheit von Unterdrückern abzielt, sollte die Macht ausüben.
Weil die politischen Maßnahmen der Kommune eindeutig deren proletarisches Wesen verdeutlichten, konnten ihre auch noch so begrenzten ökonomischen Maßnahmen auch nur die Interessen der Arbeiter verteidigen: Abschaffung der Mieten, Abschaffung der Nachtarbeit in gewissen Branchen wie bei den Bäckern, Abschaffung der Strafen, die von den Löhnen abgezogen wurden, Wiedereröffnung von geschlossenen Werkstätten, die von den Arbeitern übernommen werden sollten. Die Bezahlung der Delegierten der Kommune sollte einen Arbeiterlohn nicht übersteigen usw.
Sicher hatte diese Art der Organisierung der Gesellschaft nichts zu tun mit der "Demokratisierung" des bürgerlichen Staates, sondern sie richtete sich im Gegenteil auf dessen Zerstörung. Und dies ist in der Tat eine Hauptlehre, die die Kommune der ganzen späteren Arbeiterbewegung hinterließ. Dies war eine Lehre, die die Arbeiterklasse nicht zuletzt aufgrund des Drängens Lenins und der Bolschewiki viel deutlicher im Oktober 1917 in die Tat umsetzte. Wie Marx schon 1852 im "18. Brumaire des Louis Bonaparte" gesagt hatte, hatten alle politischen Revolution bislang nur die Staatsmaschinerie perfektioniert anstatt sie zu zerschlagen.
Obgleich die Bedingungen für die Zerstörung des Kapitalismus noch nicht reif waren, kündigte die Pariser Kommune als letzte Revolution des 19. Jahrhunderts schon die revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts an. Sie zeigte in der Praxis: "die Arbeiterklasse kann nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eigenen Zwecke in Bewegung setzen" ("Der Bürgerkrieg in Frankreich", ebenda, S. 336).
Gegen die Gefahr einer Bedrohung durch das Proletariat entwickelte die herrschende Klasse ihre blutrünstige Wut
Die herrschende Klasse konnte nicht akzeptieren, dass die Arbeiterklasse es wagen sollte, gegen ihre Ordnung anzutreten. Als die Bourgeoisie Paris wieder mit Waffengewalt erobert hatte, zielte diese nicht nur darauf ab, ihre Macht in der Hauptstadt wieder herzustellen, sondern sie wollte auch vor allem in der Arbeiterklasse ein Blutbad anrichten, das den Arbeitern als Lehre dienen sollte. Ihre Wut und Verachtung bei der Niederschlagung der Kommune entsprach der Angst, die ihr das Proletariat eingejagt hatte. Von Anfang April an fingen die Truppen Thiers und Bismarcks, deren Truppen die militärischen Festungen im Norden und Osten Paris besetzt hielten, an ihre "heilige Allianz" zur Niederschlagung der Kommune zu organisieren. Damals schon zeigte die Bourgeoisie die Fähigkeit, ihre nationalen Interessensgegensätze in den Hintergrund zu rücken, um dem gemeinsamen Klassenfeind entgegenzutreten. Diese enge Zusammenarbeit zwischen den französischen und preußischen Armeen führte zur Einkreisung der Hauptstadt. Am 7. April eroberten die Versailler Truppen die Forts im Westen der Stadt. Konfrontiert mit dem erbitterten Widerstand der Nationalgarde, überzeugte Thiers Bismarck, 60.000 in Sedan gefangene französische Soldaten freizulassen, wodurch die Versailler Regierung von Mai an ein zahlenmäßiges šbergewicht erlang. In der ersten Maihälfte brach die südliche Front zusammen. Am 21. Mai marschierten Versailler Truppen unter dem General Gallifet im Norden und Osten Paris ein, weil die preußische Armee für sie eine Flanke eröffnet hatte. Acht Tage lang wüteten die Kämpfe in den Arbeitervierteln der Stadt. Die letzten Kämpfer der Kommune kamen massenweise auf den Hügeln der Stadt um Belleville und M‚nilmontant um. Aber die blutige Niederschlagung der Kommune machte da nicht halt. Die herrschende Klasse wollte ihren Triumpf noch auskosten, indem sie ihre Rache an dem geschlagenen und niedergekämpften, entwaffneten Proletariat ausübte, diesem "niedrigen, dreckigen Volk", das gewagt hatte, ihre Klassenherrschaft in Frage zu stellen. Während Bismarcks Truppen Befehl hatten, jeden Flüchtenden festzunehmen, übten die Horden Gallifets ein gewaltiges Massaker an den wehrlosen Männern, Frauen und Kindern aus. Sie mordeten kaltblütig mit Erschießungskommandos und Maschinengewehren.
Die "blutige Woche" endete mit einem unglaublichen Massaker: mehr als 20.000 Tote. Dann folgten Massenverhaftungen, die Hinrichtung von Gefangenen, um "ein Beispiel zu setzen", Verschleppung in Zwangarbeitslager, Hunderte von Kindern wurden in sog. "Erziehungsanstalten" gesteckt.
So stellte die herrschende Klasses ihre Ordnung wieder her. So reagierte sie, als ihre Klassenherrschaft bedroht wurde. Aber die Kommune wurde nicht mal nur durch die reaktionärsten Teile der herrschenden Klasse niedergemetzelt. Obgleich sie die schmutzigste Arbeit den monarchistischen Truppen überließen, waren es die "demokratischen" republikanischen Fraktionen, die mit der Nationalversammlung und den liberalen Parlamentariern an der Spitze die volle Verantwortung für das Massaker und den Terror trugen. Die Arbeiterklasse darf diese "heldenhaften" Taten der bürgerlichen Demokratie nie vergessen!
Indem sie die Kommune niederschlugen, was wiederum zur Auflösung der 1. Internationale führte, fügte die herrschende Klasse den Arbeitern der ganzen Welt eine Niederlage zu. Und diese Niederlage war besonders schmerzhaft für die Arbeiterklasse in Frankreich, die seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts an der Spitze der Arbeiterkämpfe gestanden hatte. Die französische Arbeiterklasse sollte danach bis zum Mai 1968, als ihre massiven Streiks nach 40 Jahren Konterrevolution eine neue Kampfperspektive eröffneten, nicht mehr an vorderster Stelle des Klassenkampfes treten. Und dies ist kein Zufall: indem es - wenn auch nur vorübergehend - wieder seinen Platz als "Leuchtfeuer" des Klassenkampfes einnahm, den es ein Jahrhundert zuvor hatte aufgeben müssen, kündigte das französische Proletariat die große Lebendigkeit, die Vitalität, die Stärke und Tiefe der neuen Stufe in diesem historischen Kampf der Arbeiterklasse zum Umsturz des Kapitalismus an.
Avril (aus Révolution Internationale, Zeitung der IKS in Frankreich) (Erstveröffentlichung 1991)
Geschichte der Arbeiterbewegung:
- 1871 - Pariser Kommune [238]
Historische Ereignisse:
- Pariser Kommune 1871 [239]
Der Wettlauf gegen die Zeit: Eine neue Gesellschaft oder Barbarei
- 2182 Aufrufe
– die Revolten in den nordafrikanischen Ländern und im Nahen & Mittleren Osten, welche mittlerweile nahezu alle Länder in der Region erfasst haben und quasi alle Regimes erzittern lassen (Saudi-Arabien, Syrien, Jemen, Bahrain usw.);
– die tragische Entwicklung in Libyen, wo die sozialen Proteste zu Beginn der Bewegung umschlugen und durch Machtbestrebungen der lokalen, bürgerlichen Cliquen verdrängt wurden. Dadurch wurden die imperialistischen Hyänen der Nato- und anderer Staaten angelockt (siehe dazu den Artikel in dieser Zeitung);
– die dramatischen Ereignisse in Japan rund um das Erdbeben, den Tsunami und die Nuklearkatastrophe (siehe dazu den Artikel in dieser Ausgabe);
– all das vor dem Hintergrund einer weiteren Zuspitzung der Wirtschaftskrise, wo der Euro-Rettungsschirm immer weiter ausgedehnt werden muss und die Schuldenkrise trotzdem immer verheerendere Ausmaße annimmt. In den USA und Europa wird ein Sparprogramm nach dem anderen verabschiedet; massivste Kürzungen stehen in vielen US-Bundesstaaten an.
Die Details der Ereignisse wurden von den Medien in zahllosen Sondersendungen ausführlich dargestellt. Wir wollen deshalb darauf verzichten, im Einzelnen näher auf sie einzugehen.
Ereignisse, die Hoffnung oder Angst und Schrecken auslösen…
Stattdessen müssen wir versuchen, die Entwicklung in ihrem Gesamtzusammenhang zu begreifen und nach den Konsequenzen fragen.
Zunächst werfen diese Ereignisse ein Licht auf das ungeheure Potenzial sozialen Widerstands, das jetzt zum ersten Mal in diesem Maße in den arabisch-sprachigen Ländern deutlich geworden ist. Überall tauchte eine neue Generation auf, die sich nicht den Zwangsgesetzen des Kapitalismus unterwerfen will und gegen die ökonomischen und politischen Verhältnisse protestiert. Diese – mit Ausnahme von Libyen - bislang nicht niedergeworfene Protestbewegung hat sich auf der arabischen Halbinsel fortgepflanzt; niemand kann zurzeit ihren weiteren Verlauf vorhersagen.
Gleichzeitig werfen die jüngsten Ereignisse ein grelles Licht auf die ungeheuren Gefahren und Bedrohungen, vor denen die Menschheit steht. Zum einen die Gefahr, die vor allem durch die Nuklearkatastrophe in Japan vor Augen geführt hat, dass die waghalsige, völlig unverantwortliche Politik des Kapitals in punkto Atomkraft die Menschheit direkt in die Vernichtung führen kann. Hinzu kommt: allein im Jahr 2010 registrierte man eine Reihe von verheerenden Umweltkatastrophen – die Ölverschmutzung im Golf von Mexiko nach der Explosion von Deepwater Horizon, Hitzewelle und Brände in Russland, Überschwemmungen in Pakistan und Australien, usw., die erahnen ließen, wie verheerend die durch das System verursachte Umweltzerstörung und die Folgen der Klimakatastrophe sein können. Und nun hat die jüngste Nuklearkatastrophe in Japan nach Three Mile Island und Tschernobyl erneut die Gefahr aufgezeigt, dass nicht nur das unmittelbare Umfeld eines AKWs durch solche Unfälle bedroht wird, sondern ganze Landstriche und große Teile des Planeten bedroht sind, ja gar unbewohnbar werden können. Wenn nun zum ersten Mal eine der größten Bevölkerungskonzentrationen in der Welt, der Großraum Tokio mit 38 Millionen Menschen, radioaktiv verseuchtes Wasser trinken muss, kann man sich vorstellen, was passiert, wenn die kapitalistischen Mechanismen der Umweltzerstörung ungehindert weiter wirken: Das Überleben der Menschen auf diesem Planeten insgesamt wird gefährdet.
Aber neben der Umweltzerstörung wird die Menschheit auch durch die Gefahr bedroht, in endlose Kriege zu versinken. Die jüngste Entwicklung in Libyen verdeutlicht dieses Drama. Den anfänglichen Sozialprotesten gelang es nicht, sich ausreichend aufs ganze Land auszudehnen, stattdessen gewannen rivalisierende bürgerliche Cliquen aller Art die Oberhand und waren bereit, die Bevölkerung in einer grausamen Konfrontation mit Gaddafis Killerkommandos aufzureiben. Zudem forderten sie die militärische Unterstützung der Staaten an, die vorher jahrelang Gaddafi unterstützt und hochgerüstet hatten. Mittlerweile ist der Konflikt in einen regelrechten Krieg ausgeartet (siehe dazu den Artikel in unserer Zeitung). Der Klassenkampf ist im Augenblick in diesem Land zu Grabe getragen! Und in vielen anderen Ländern der Erde eskalieren Gewalt und Kriminalität immer mehr. Allein im Nachbarland der USA, in Mexiko, wurden letztes Jahr über 15.000 Menschen im Drogenkrieg ermordet. Ein mörderischer Alltag, in dem man jeden Tag um sein Leben fürchten muss.
Wie eng beieinander diese beiden Tendenzen miteinander ringen, kann man anhand der Lage in der Region um Israel sehen. Auf der einen Seite beschießen sich die israelische Armee und die Nationalisten von Hamas und Hisbollah, auf der anderen Seite rebellieren in den Nachbarländern wie Syrien oder Jordanien die Ausgebeuteten und Unterdrückten gegen die diktatorischen Regimes. So traten die beiden Richtungen, in die sich diese Gesellschaft bewegen kann – die Intensivierung der sozialen Proteste, die Verschärfung des Klassenkampfes, mit der langfristigen Perspektive der Überwindung des Kapitalismus auf der einen Seite und das Versinken im Krieg und die Vernichtung der Menschheit, der Natur insgesamt infolge der kapitalistischen Produktionsweise -, innerhalb weniger Wochen deutlich erkennbar zu Tage.
Die Notwendigkeit, die Lage mit Abstand und Weitblick einzuschätzen
Angesichts solch einer rasanten Beschleunigung der Geschichte kann man leicht den Kopf verlieren; vor allem, wenn man an den Ereignissen unmittelbar haften bleibt und ihnen hinterherläuft, statt sie mit Abstand, mit Überblick, in ihrem Zusammenhang zu betrachten. Deshalb ist es wichtig, die jüngste Entwicklung historisch einzuordnen, sie vertieft, mit Weitblick, zu analysieren. Leicht gesagt! Denn diese Analyse fällt nicht vom Himmel, sie muss das Werk kollektiver Anstrengungen sein und sich auf eine Methode der Vertiefung stützen. Wir haben deshalb einige Eckpunkte in dieser Zeitung zur Lage im Nahen Osten veröffentlicht, die wir als Beitrag zur Diskussion stellen wollen.
Gerade in Anbetracht der Gleichzeitigkeit zweier unterschiedlicher Dynamiken, die der zunehmenden Bedrohung der Lebensgrundlagen durch den Zerstörungsdrang der kapitalistischen Produktionsweise (die durch Japan und Libyen verkörpert wird) und die der Intensivierung des Klassenkampfes auf mehreren Kontinenten, ist es wichtig, nicht nur bei einer „Seite“ der Wirklichkeit stehenzubleiben, sondern beide Dynamiken zu erfassen und den Zusammenhang zwischen ihnen zu erkennen. Wir müssen die verschiedenen Teile des Mosaiks zusammenbringen und die Verkettung untereinander herausarbeiten. Lediglich einen Aspekt zu beachten kann nur in die Irre führen. Deshalb darf man sich nicht ausschließlich gegen einen Aspekt der kapitalistischen Wirklichkeit richten, z.B. die Atomkraft oder die Flüchtlingsfrage, sondern man muss deren Verwurzelung im kapitalistischen System sehen. Während es in den 1980er und 1990er Jahren viele „Ein-Punkt-Bewegungen“ gab (Atomkraft, Wohnungsnot, Nachrüstungen usw.), die den Blick jeweils auf eine Frage beschränkten, geht es heute mehr denn je darum, den globalen Bankrott, die Sackgasse des Systems weltweit aufzuzeigen. Zugegeben, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Ebenen sind nur schwer zu durchleuchten, aber wenn man diesen Zusammenhang nicht berücksichtigt, landet man in einer Sackgasse, glaubt, dass man innerhalb des Systems etwas „reformieren“, „ausmerzen“ könnte. Letztendlich wird man dann durch das System unschädlich gemacht.
Diese Zusammenhänge muss man kollektiv erarbeiten. Dies wird zudem noch dadurch erschwert, dass die Kraft, welches dieses System überwinden kann, die Arbeiterklasse, noch nicht überzeugend in Erscheinung getreten ist.
Eine neue Generation auf dem Vormarsch?
Die jüngsten Kämpfe in Nordafrika zeigen sowohl eine Kontinuität mit den Arbeiterkämpfen und Protesten der letzten Zeit in Griechenland, China, Bangladesch, Frankreich, Italien, Großbritannien usw. Gleichzeitig haben sie eine neue Dimension zum Vorschein gebracht. Auch wenn es mit dem Kampf gegen den CPE in Frankreich 2006, den Studentenprotesten in Italien, Spanien, Deutschland usw. schon erste Anzeichen des Erwachens einer neuen Generation gab, brachte das Auftreten einer neuen Generation von Protestierenden in Nordafrika und im Nahen & Mittleren Osten einen neuen Schub mit sich.
Die jüngsten Kämpfe in Nordafrika haben gezeigt, dass sich in die Arbeiterstreiks gegen die Preissteigerungen, die Wohnungsnot und die zunehmende Verarmung soziale mit politische Forderungen gemischt haben. Am deutlichsten wurde dies in Ägypten (siehe dazu den Artikel in dieser Ausgabe), wo die pulsierenden Aktivitäten auf dem Tahrir-Platz am deutlichsten die Tendenz zum Zusammenkommen und den Willen, die Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen, zum Ausdruck brachten. Die Bewegung beschränkte sich nicht auf einen Protest gegen bestehende Machtstrukturen, sondern man spürt ein Rütteln an etwas tiefer Liegendem, ein Aufbegehren nicht nur gegen Ungerechtigkeit sondern gegen die Ausweglosigkeit und die Mechanismen dieses Systems.
An vorderster Front standen dabei Jugendliche, überwiegend aus ärmeren Schichten, aber auch aus dem Mittelstand, mit einer tiefen Sehnsucht nach einer anderen Welt, auch wenn sie sich noch nicht in der Formulierung der Suche nach einer ausbeutungs- und unterdrückungsfreien Welt äußerte und insgesamt mit vielen Illusionen über die bürgerliche Demokratie belastet ist, was von der herrschenden Klasse ausgenutzt wird, wie die jüngsten Wahlen in Ägypten belegen.
– Dennoch gibt es so etwas wie einen Aufbruch, der nicht zuletzt verkörpert wird durch die massive Beteiligung und das Verhalten der Frauen, die – in der arabischen Welt von besonderer Bedeutung – sehr engagiert waren und insbesondere bei der Frage der Gewalt in Ägypten eine ausgesprochen kluge Vorgehensweise gegenüber den Rekruten einschlugen, diese nämlich zu „umgarnen“ und so zu destabilisieren. Im Gegensatz zu den Hoffnungen der Fundamentalisten liefen die Frauen diesen nicht scharenweise in die Arme, sondern zeigten sich radikal, kämpferisch und nicht bereit, sich „neue Schleier“ überzustreifen.
– Überhaupt scheint sich diese neue Generation nicht so leicht für den Nationalismus oder den islamischen Fundamentalismus einspannen zu lassen; stattdessen spürt man eher weltoffene Tendenzen und eine Abneigung, sich hinter Religionen zu verschanzen.
– Eine Stärke der Bewegung liegt auch darin, dass in ihr mehrere Generationen zusammenkommen, Alt und Jung haben gemeinsame Forderungen; im Gegensatz zu 1968 gibt es keinen Graben zwischen den Generationen.
Bislang wurde durch den Elan der Bewegung nur die alte, führende diktatorische Clique in einigen Ländern verjagt; damit ist noch kein System gestürzt. Auch wenn dadurch einerseits ein Gefühl der Stärke und der eigenen Macht aufkeimte, besteht andererseits die Gefahr, dass man sich durch Illusionen über die Demokratie, durch die Unerfahrenheit mit den Bollwerken der kapitalistischen Macht hinters Licht führen lässt. Zudem gibt es die Besonderheit, dass die Bewegung sich über die eigenen Perspektiven, die eigene soziale Identität, die eigene Rolle nicht so bewusst ist.
Ihre weitere Entwicklung hängt zweifellos ab von der Rolle, die die Arbeiterklasse dort vor Ort, aber vor allem in den westlichen Industriestaaten einnehmen wird. Eine wesentliche Verschärfung des Klassenkampfes in den Industriezentren hätte eine enorme Ausstrahlung auf den Rest der Welt. Wenn z.B. die Arbeiter in den westlichen Industriezentren an den Pfeilern der Demokratie rüttelten und sich selbständig, außerhalb der gewerkschaftlichen Kontrollorgane in Bewegung setzen, würde das den sozialen Protestbewegungen weltweit einen gewaltigen Schub geben. Welche Rolle dabei kämpferische und entschlossene Minderheiten spielen können, möchten wir anhand eines Artikels zu einem Treffen in Alicante zeigen (siehe dazu den Artikel in dieser Zeitung).
Ein Wettlauf gegen die Zeit hat eingesetzt. Entweder vernichtet der Kapitalismus den ganzen Planeten, treibt die Menschheit in immer mehr Kriege – oder den Ausgebeuteten und Unterdrückten, mit der Arbeiterklasse an ihrer Spitze, gelingt es, das System zu überwinden. Einen anderen Weg gibt es nicht. 26.03.11
Aktuelles und Laufendes:
Libyen - Ein imperialistischer Krieg
- 2377 Aufrufe
Erneut schwingen die Führer dieser Welt große Reden mit toll ausgeschmückten humanitären Phrasen über „Demokratie“, „Frieden“, „Sicherheit der Bevölkerung“, um ihre eigenen imperialistischen Abenteuer zu vertuschen. So hat seit dem 20. März eine „internationale Koalition“ (1) eine umfangreiche militärische Operation in Gang gesetzt, die poetisch von den USA „Operation Odyssey Dawn“ genannt wird. Jeden Tag heben Dutzende Bomber von den beiden großen französischen und amerikanischen Flugzeugträgern ab, um ihre Bomben auf all die Teile abzuwerfen, in denen sich dem Gaddafi-Regime treue Truppen aufhalten (2). Wenn man kein Blatt vor den Mund nimmt, heißt dies sie führen Krieg!
All diese Staaten verteidigen nur ihre eigenen Interessen mit Hilfe von Bombardierungen
Natürlich ist Gaddafi ein blutiger und verrückter Diktator. Nach wochenlangem Zurückweichen gegenüber der Rebellion, gelang es dem selbsternannten „lybischen Führer“ seine Elitetruppen für einen Gegenangriff zu organisieren. Jeden Tag konnte er Boden zurückgewinnen; dabei wurde alles plattgemacht, was ihm Wege stand; „Rebellen“ wie Zivilbevölkerung. Und er schickte sich sicherlich an, die Bevölkerung von Bengasi im Blut zu ertränken, als die Operation „Operation Odyssey Dawn “ ausgelöst wurde. Die Luftschläge der Koalition haben den lybischen Repressionskräften arg zugesetzt und in der Tat das angekündigte Massaker verhindert. Aber kann man wirklich auch nur einen Augenblick glauben, dass dieser Aufmarsch der ‚Koalitionsarmeen‘ dazu dient, dem Wohl der libyschen Bevölkerung zu dienen? Wo war diese Koalition, als Kaddafi 1996 im Gefängnis Abu Salim in Tripolis 1000 Gefangene ermorden ließ? In Wirklichkeit betreibt dieses Regime seit 40 Jahren nichts anderes als Leute ungestraft zu foltern, zu terrorisieren, sie verschwinden zu lassen oder zu ermorden. Wo war diese Koalition vor kurzem, als Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten oder Bouteflika in Algerien bei den Aufständen im Januar und Februar auf die Leute schießen ließen? Und was macht heute diese Koalition gegenüber den Massakern in Jemen, Syrien oder Bahrain? Oh Entschuldigung, wir können gar nicht sagen, dass sie hier ganz abwesend ist, denn eines ihrer Mitglieder, Saudi Arabien, greift in der Tat ein, um das Regime in Bahrain zu unterstützen und die Demonstranten niederzuschlagen! Ihre Komplizen verschließen die Augen.
Sarkozy, Cameron, Obama und Konsorten mögen sich gerne stolz als die Retter, die Verteidiger der Witwen und Waisenkinder darstellen, aber die leidenden Zivilisten Bengasis waren für sie nur ein Alibi, um vor Ort militärisch einzugreifen und ihrer eigenen schmutzigen imperialistischen Interessen zu verteidigen. All diese Gangster kennen nur einen Grund – und der ist keineswegs altruistisch, sich an diesem imperialistischen Kreuzzug zu beteiligen:
Im Gegensatz zu den früheren Kriegen stehen die USA dieses Mal nicht an der Spitze. Warum? In Libyen muss die US-Bourgeoisie eine ‚ausgleichende‘ Rolle spielen. Einerseits können sie es sich nicht erlauben, Bodentruppen zum Einsatz zu bringen. In der ganzen arabischen Welt würde dies als eine Aggression und neuer US-Einmarsch aufgefasst. Die Kriege im Irak und Afghanistan haben ja die allgemeine Aversion gegenüber dem „US-Imperialismus, dem Verbündeten Israels“ noch verstärkt. Und der Regimewechsel in Ägypten, das traditionell Verbündeter von Uncle Sam war, hat die Position der USA in der Region noch weiter geschwächt (3). Aber andererseits können sie nicht zulassen, völlig außen vor zu bleiben, denn dann würden sie Gefahr laufen, ihre Glaubwürdigkeit und ihren Status als „Kämpfer für die Demokratie auf der Welt“ völlig zu verlieren. Und es geht natürlich auch nicht, dass sie dem französisch-britischen Tandem das Jagdrevier überlassen.
Die Beteiligung Großbritanniens verfolgt zwei Ziele. Es versucht ebenfalls bei den arabischen Ländern seinen Ruf zu erneuern, der durch seine Beteiligung an den Kriegen im Irak und Afghanistan gelitten hat. Aber es versucht auch seine eigene Bevölkerung an ausländische Militärinterventionen zu gewöhnen, die in der Zukunft noch häufiger notwendig werden. „Die Bevölkerung vor Gaddafi zu retten“ ist dazu eine willkommene Gelegenheit (4).
Im Falle Frankreichs liegen die Dinge etwas anders. Es ist das einzige größere Land des Westens, das über eine gewisse Popularität im arabischen Raum verfügt, die es unter De Gaulle erworben hatte, und durch seine Weigerung sich am Irakkrieg 2003 zu beteiligen, noch ausbaute. Durch seine Intervention zugunsten des „libyschen Volkes“ wusste der französische Präsident Sarkozy genau, dass dies in der Bevölkerung gut aufgenommen werden würde, und dass die arabischen Nachbarstaaten dieser Intervention gegen Gaddafi wohlwollend gegenüberstünden, weil dieser zu wenig kontrolliert werden kann und für deren Geschmack zu unberechenbar ist. „Es lebe Sarkozy“, „Es lebe Frankreich“ (5). Zumindest dieses Mal ist es dem französischen Staat gelungen, punktuell aus der US-Schwäche Vorteile zu erzielen. Der französische Präsident hat auch die Gelegenheit ausgenutzt, um wieder Boden zu gewinnen in Anbetracht all der Fehltritte seiner Regierung gegenüber Tunesien und Ägypten (Frankreich hatte die später durch die sozialen Revolten abgesetzten Diktatoren unterstützt, notorische Kumpanei während dieser Kämpfe zwischen seinen Ministern und den Regimes in diesen Ländern; der Vorschlag, Polizeikräfte zur Verstärkung der Repression nach Tunesien zu schicken…).
Wir können hier nicht genauer auf die einzelnen Interessen eines jeden Staates dieser Koalition eingehen, die heute gegen Libyen vorgeht, aber eins ist sicher: ihnen geht es nicht um humanitäre oder philanthropische Interessen. Und das trifft auch auf die Staaten zu, die sich bei der Abstimmung der UN-Resolution enthalten haben : China, Russland und Brasilien stehen dieser Intervention sehr feindselig gegenüber, weil sie beim Sturz Gaddafis nichts gewinnen können. Italien kann dagegen alles verlieren. Das gegenwärtige Regime hat bislang einen leichten Zugang zu den Ölquellen und eine drakonische Kontrolle der Grenzen gewährleistet. Die Destabilisierung des Landes kann all das infragestellen. Angela Merkels Deutschland ist bislang noch ein militärischer Zwerg. All seine Kräfte sind in Afghanistan gebunden. Sich an solch einer Operation zu beteiligen, hätte erneut diese Schwäche noch deutlicher werden lassen. Wie die spanische Zeitung El Pais schrieb: „Es gibt eine gewisse Neuauflage der ständigen Wiederherstellung des Gleichgewichtes zwischen der deutschen ökonomischen Größe, die während der Eurokrise sichtbar war, und der politischen Fähigkeit Frankreichs, die sich auch auf militärischer Ebene zeigt“ (6). So gleicht Libyen wie der gesamte Nahe und Mittleren Osten einem riesigen Schachbrett, wo die Großmächte ihre jeweiligen Figuren zum Zug bringen.
Warum greifen die Großmächte jetzt ein?
Seit Wochen befanden sich die Truppen Gaddafis auf dem Vormarsch Richtung Bengasi, der Rebellenhochburg; sie wälzten dabei alles nieder, was ihnen im Weg stand. Warum haben die Länder, obwohl sie so große Interessen an diesem Land haben, so lange gezögert? In den ersten Tagen wehte der Wind der Revolte, der auch in Libyen zu spüren war, aus Tunesien und Ägypten. Die gleiche Wut über die Unterdrückung und die Armut erfasste alle Gesellschaftschichten. Es stand also außer Frage, dass die „großen Demokratien der Welt“ diese soziale Bewegung unterstützten, obwohl sie große Reden schwangen gegen die Repression. Ihre Diplomatie stellte sich völlig heuchlerisch gegen jede Einmischung und hob das „Recht der Völker auf Selbstbestimmung“ hervor. Die Erfahrung zeigt, dass es bei jedem sozialen Kampf so verläuft: die Herrschenden aller Länder verschließen die Augen vor der furchtbarsten Repression, wenn sie diese nicht direkt selbst unterstützen!
Aber in Libyen ist das, was anfangs als eine wahre Revolte „von Unten“ mit unbewaffneten Zivilisten anfing, die mutig zum Sturm auf die Kasernen ansetzten und die Büros der sogenannten „Volkskomitees“ anzündeten, in einen blutigen „Bürgerkrieg“ umgeschlagen, der jetzt zwischen verschiedenen Flügeln der Herrschenden ausgetragen wird. Mit anderen Worten, die Bewegung ist den nicht-ausbeutenden Schichten aus der Hand geraten. So ist zum Beispiel einer der Anführer der Rebellion und des Übergangsrates Al Jeleil, ehemaliger Justizminister unter Gaddafi gewesen. Diesem Führer klebt natürlich so viel Blut an den Fingern wie seinem früheren „Führer“, der zu dessen Rivalen geworden ist. Ein anderer Beleg: die provisorische Regierung hat die Fahne des alten, königlichen Libyens wieder hervorgeholt. Der französische Präsident Sarkozy hat den Übergangsrat als die „legitimen Repräsentanten des libyschen Volkes“ anerkannt. Die Revolte in Libyen hat also eine völlig andere, entgegengesetzte Wendung genommen als die Bewegung in Tunesien und Ägypten. Dies ist hauptsächlich auf die Schwäche der Arbeiterklasse dieser Länder zurückzuführen. Die Ölindustrie, die Haupteinnahmequelle des Landes, beschäftigt fast ausschließlich ausländische Arbeitskräfte aus Europa, anderen Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas. Dies haben sich von Anfang an nicht an dieser Bewegung beteiligt. So konnte die lokale Kleinbourgeoisie dem Kampf ihren Stempel aufdrücken und zum Beispiel die Bewegung unter der alten königlichen Fahne sammeln. Schlimmer noch! Die ‚ausländischen‘ Arbeiter konnten sich nicht mit diesem Kampf identifizieren; sie sind geflüchtet. Wenn sie nicht gar verfolgt wurden, wie es mit vielen schwarzafrikanischen Arbeitern geschah, die in die Hände der ‚Rebellen‘ fielen, denn es gab zahlreiche Gerüchte, denen zufolge gewisse Söldner aus Schwarzafrika von Gaddafis Regime rekrutiert worden waren, um die Aufstände niederzuschlagen, wodurch alle Migranten aus Afrika in Verruf gerieten.
Die Kehrtwendung der Lage in Libyen hat Konsequenzen, die weit über die Grenzen des Landes hinausreichen. Die Repression durch die Truppen Gaddafis und die Intervention der internationalen Koalition üben eine bremsende Wirkung aus für all die sozialen Bewegungen in der Region. Dies ermöglicht den anderen diktatorischen Regimen, die mit Sozialprotesten zu kämpfen haben, eine ungebändigte blutige Repression auszuüben: dies wird ersichtlich anhand der Lage in Bahrain, wo die saudi-arabische Armee das Regime vor Ort unterstützt, um die Demonstrationen gewaltsam niederzuschlagen(7); in Jemen, wo die Regierungstruppen am 18. März nicht zögerten, auf die Menge zu schießen. 51 Menschen wurden erschossen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es seit kurzem in Syrien. Aber es ist keineswegs sicher, dass es sich um eine unumkehrbare Entwicklung handelt. Die Lage in Libyen lastet wie eine große Bürde auf dem Weltproletariat, aber die Wut ist so groß über die Zuspitzung der Armut, dass die Arbeiterklasse nicht völlig gelähmt ist. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels wurden Demonstrationen in Riad angekündigt, obwohl das saudi-arabische Regime dekretiert hat, dass alle Demonstrationen der Scharia widersprechen. In Ägypten und Tunesien, wo die ‚Revolution‘ angeblich triumphiert hat, kommt es ständig zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und dem ‚demokratischen‘ Staat, obwohl dieser von Kräften regiert wird, die mehr oder weniger die gleichen sind, die vor dem Abflug der ‚Diktatoren‘ die Zügel in der Hand hatten. In Marokko gehen die Proteste weiter, trotz der Verbesserungen, die Mohammed VI angekündigt hat.
Wie auch immer, die Lage der Bevölkerung, die unter der schrecklichen Repression unter den Bombardierungen der Demokratien der verschiedenen Staaten der internationalen Koalition leidet, wird sich erst dann verbessern, wenn das Proletariat der zentralen Länder, insbesondere Westeuropas, seinen Kampf massiv und entschlossen verstärken wird. Dann kann die Arbeiterklasse, die über eine größere Erfahrung verfügt und mit den Fallen der Gewerkschaften und der bürgerlichen Demokratie gebrochen hat, zeigen, dass man sich selbst organisieren und eine wirklich revolutionäre Perspektive aufbauen kann, welche als einzige einen Ausweg für die Menschheit bietet. Mit all den Menschen solidarisch zu sein, die heute durch Kugeln sterben, heißt nicht, das Regime Gaddafis zu unterstützen, auch nicht die ‚Rebellen‘ und erst recht nicht die UNO-Koalition. Man muss im Gegenteil all diese Kräfte als imperialistische Geier entblößen. Solidarisch sein heißt die internationalistische proletarische Seite zu wählen, gegen die eigenen Ausbeuter und Massakrierer in allen Ländern anzukämpfen, sich an der Stärkung der Arbeiterkämpfe und des Bewusstseins überall in der Welt zu beteiligen! Pawel, 25.3.2011.
<!--[if !supportLists]-->(1) <!--[endif]-->Großbritannien, Frankreich, USA insbesondere, aber auch Italien, Spanien, Belgien, Dänemark, Griechenland, Norwegen, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Qatar,
<!--[if !supportLists]-->(2) <!--[endif]-->Wenn man den westlichen Medien glauben würde, dann sterben nur die Anhänger Gaddafis durch die Bomben. Aber erinnern wir uns, dass dieselben Medien auch während des Golfkrieges die Lüge von einem „sauberen Krieg“ verbreiteten. Tatsächlich kamen 1991 im Namen des Schutzes des „kleinen Kuwaits“, das von der Armee des ‚Schlächters‘ Saddam Hussein besetzt wurde, mehrere Hunderttausend Menschen um.
<!--[if !supportLists]-->(3) <!--[endif]-->Auch wenn der US-Bourgeoisie eine Schadensbegrenzung gelang, als sie die Armee unterstützte, um das von der Bevölkerung verabscheute Regime zu ersetzen.
<!--[if !supportLists]-->(4) <!--[endif]-->Man sollte nicht vergessen, dass 2007 der ehemalige britische Premierminister Tony Blair in Tripolis den Führer Gaddafi herzlich umarmte und ihm mit der Unterschrift eines Vertrages mit BP dankte. Die gegenwärtigen Verurteilungen des „verrückten Diktators“ sind reiner Zynismus und Heuchelei!
<!--[if !supportLists]-->(5) <!--[endif]-->Erinnern wir uns daran, dass die französische Bourgeoisie auch hier umgeschwenkt ist, nachdem sie 2007 Gaddafi ebenso pompös empfing. Damals gingen die Bilder der Zelte Gaddafis, die mitten in Paris errichtet worden waren, um die Welt; all das machte Sarkozy und seine Clique lächerlich.
<!--[if !supportLists]-->(6) <!--[endif]-->https://elpais.com/articulo/internacional/guerra/europea/elpepuint/20110321elpepiint_6/Tes [243]
<!--[if !supportLists]-->(7) <!--[endif]-->Die Schwäche der Arbeiterklasse begünstigt die Repression. Die Bewegung wird nämlich von der schiitischen Bevölkerungsmehrheit dominiert, welche vom Iran unterstützt wird.Aktuelles und Laufendes:
- Libyen Krieg [244]
- internationale Koalition [245]
- UN Resolution 1973 [246]
- Gaddafi Unterstützer [247]
- Rebellion Aufstand Libyen [248]
Leute:
- Gaddafi [249]
Weltrevolution Nr. 166
- 2472 Aufrufe
1. Mai 2011 in Zürich - Demokratie und Repression
- 2146 Aufrufe
In Zürich hat dieses Jahr am 1. Mai die demokratische Bourgeoisie das traditionelle „Nachdemonstrations-Ritual“, welches mit „Randale“ verbunden war, radikal verhindert. Man könnte darüber spekulieren, wieso gerade in diesem Jahr so ein rigoroser Schritt gegen die für den Staat keineswegs gefährlichen Nachdemonstranten beschlossen wurde.
Schon bei den Studentenunruhen im letzten Winter in England ging die „freundlichste“ Polizei der Welt maßlos repressiv gegen die meist jugendlichen Demonstranten vor. Nach den Unruhen in den arabischen Ländern, gibt es auch in den fortgeschrittensten demokratischen Ländern eine gewisse Angst vor der unbändigen Jugend, die in immer mehr Ländern sich gegen das menschenverachtende kapitalistische System wehrt. Der Hintergrund der ansteigenden Repressionsspirale ist die zunehmende Armut und Perspektivlosigkeit aufgrund der aktuellen Krise, vor allem der Jugendlichen, die keinen Eintritt in das Erwerbsleben finden.
Diese Situation birgt einen enormen Zündstoff für eine soziale Revolte. Darum reagiert die hiesige herrschende Klasse präventiv mit äußerst repressiven Mitteln, indem sie fast 600 willkürlich am Helvetiaplatz (Platz in Zürich) sich befindende Menschen festnahm und in eine sogenannte Haftstraße überführte, wo die Personalien aufgenommen und einige über Nacht verwahrt wurden. Dies geschah alles, bevor sich irgendetwas im Sinne des üblichen Katz-und-Maus-Spiels mit entsprechenden Sachbeschädigungen wie in den Vorjahren abzeichnete.
Es gebührt dem allerdemokratischsten Polizeivorsteher der Grünen, Leupi, solche weitgehende präventive Repressionsmaßnahmen umgesetzt zu haben. Auch die Gewerkschaften, die linken und linksextremen Gruppierungen rund um das 1.-Mai-Komitee hatten sich mit den Polizeikräften über die Repressionsmaßnahmen ‚verständigt‘. Mit dieser repressiven „Einheitsfront“ wird heute gegen die noch wenigen zornigen jungen und teilweise weniger jungen Leute vorgegangen. In Zukunft wird sich die repressive Einheitsfront auch gegen breitere Kreise und vor allem gegen die Arbeiterklasse richten.
Dabei verfolgt die demokratische Repression verschiedene Ziele. Zunächst einmal geht es der Polizei darum zu zeigen, dass sie sich auf den Ernstfall vorbereitet und handfest zuschlägt. Alle, die sich in einem bestimmten Gebiet aufhalten – egal welcher Gesinnung und mit welchen Motiven – werden mit Gewalt verhaftet, bis auf die Unterhosen kontrolliert und fichiert. Dazu gehört, dass man stundenlang massenhaft an einem bestimmten Ort festgehalten und später einzeln gedemütigt wird. Es ist eine Machtdemonstration, die abschrecken und einschüchtern soll. Und wehe dem, der nächstes Jahr ein zweites Mal unter den Festgenommenen ist! Er wird kaum damit rechnen können, nach 24 Stunden wieder auf freiem Fuß zu sein, selbst wenn er nichts anderes verbrochen hat, als sich am 1. Mai am falschen Ort aufzuhalten. Trotz Sparmaßnahmen bei allen kantonalen und städtischen Angestellten scheut die Polizei am 1. Mai keine Kosten; laut offiziellen Angaben kostete der Einsatz der Stadtpolizei allein rund 1 Million Franken, mehr als je zuvor – dazu kommen noch die Kosten der aufgebotenen Kantonspolizei. Die Ereignisse rund um den 1. Mai sind für die Polizei ein willkommenes Exerzierfeld für den Straßenkampf mit Einkesselungen von Hunderten von Leuten, Absperrung von Straßen und Plätzen, mit dem Einsatz von Helikoptern während des ganzen Nachmittags, Überwachungsdrohnen usw. Dabei setzt die Polizei auch zivile Trupps in den Reihen der Demonstranten und Gaffer ein, die als Teilnehmer erscheinen sollen und oft auch selber Sachbeschädigungen provozieren, um dann vermeintliche Bösewichte in flagranti festzunehmen.
Diese Machtdemonstration der Polizei darf uns aber nicht abschrecken. Sie zeigt, dass die demokratische herrschende Klasse selber weiß, dass ihre Macht weder ewig noch selbstverständlich ist. Wenn die Beherrschten die bestehende Ordnung nicht mehr akzeptieren, bleibt den Herrschenden nur noch die offene Gewalt. Deshalb trainiert sie ihre Repressionskräfte und versucht, diejenigen einzuschüchtern, die aufbegehren oder daran denken, es zu tun.
Auf der Ebene der offenen Gewalt hat die herrschende Klasse eine große Erfahrung, und die Arbeiterklasse hat auf dieser Ebene in nicht revolutionären Zeiten zumeist schlechte Karten.
Um ein besseres Kräfteverhältnis gegenüber der Unterdrückerklasse herzustellen, muss die Arbeiterklasse versuchen sich selbst zu organisieren, wie sie es z.B. in Frankreich gemacht hat, als sie in Millionen auf die Straße ging und die ArbeiterInnen dort auch Vollversammlungen abhielten. „Prinzipiell ist es enorm wichtig, dass die Streikenden, Schüler, Rentner, prekär Beschäftigten und Arbeiter ihre Kämpfe selbst organisieren. Nur so können sie zusammen kommen und ihre Forderungen in gemeinsamen Diskussionen herausfinden. Gerade für die Letztgenannten ist diese Einsicht wichtig, da die Gewerkschaften sich ja stets als Vertreter der Beschäftigten für die jeweiligen Branchen ausgeben. Doch gerade auf die Gewerkschaftspolitik ist man so sauer gewesen. Wenn man sich die Streiks und Demos der vergangenen Monate in Frankreich anschaut, würde ich sagen, dass wir erst am Anfang von selbst organisierten Kämpfen stehen. Es gab Ansätze von Eigeninitiativen, oft auch angeregt von politisch organisierten Leuten. Aber dies sind auf jeden Fall erste wichtige Erfahrungen von Selbstorganisierung.“ (Wo geht’s lang zum (selbstorganisierten) Klassenkampf https://de.internationalism.org/IKSonline2011_interviewfrankreich [250])
Nebst den Erfahrungen in Frankreich gibt es auch die Erfahrungen in Tunesien und Ägypten und an anderen Orten, wo auch Vollversammlungen gemacht wurden, von denen wir einiges lernen können, wie man Maßnahmen ergreifen kann, um das kapitalistische System wirksam in Frage zu stellen. Anfang Mai 2011, D+C
Aktuelles und Laufendes:
- 1. Mai Zürich [251]
- Repression Zürich [252]
Die BRIC -Staaten: Hinter dem wirtschaftlichen Aufstieg verschärfte Militarisierung
- 2898 Aufrufe
Dabei werden meist die oft zweistelligen Wachstumszahlen dieser Staaten als Beleg für den Erfolg und das Aufstreben dieser Staaten angeführt. In diesem Artikel wollen wir uns nicht näher mit der ökonomischen und desaströsen ökologischen Bilanz dieser Staaten befassen - wir sind in anderen Artikeln unserer Presse ausführlicher darauf eingegangen. Stattdessen wollen wir hier nur eine Frage behandeln: ist eine friedliche Entwicklung dieser neuen Staatengruppe denkbar? Ist der wirtschaftliche Aufschwung in diesen Staaten und deren Aufsteigen in der imperialistischen Hackordnung ohne militärische Konflikte möglich?
Die hohen Wachstumszahlen dieser Staaten - bei manchen mehrere Jahre lang fast zweistellig – dienen den Ökonomen als Argument für die Vitalität des Kapitalismus. Aber noch stärker als die Wachstumszahlen der Wirtschaft ragen die überaus hohen Steigerungen der Rüstungsausgaben heraus – denn diese sind in diesen Staaten überproportional und viel stärker als das BIP gewachsen:
- China hat seinen Militärhaushalt in den letzten 10 Jahren auf zuletzt 63 Mrd. USD verdreifacht (vermutlich beträgt er in Wirklichkeit das Doppelte).
- Seit 1998 hat Indien seinen Rüstungsetat jährlich zwischen 13-25% erhöht.
- Nach einem drastischen Rückgang der Militärausgaben in Russland nach 1989 sind diese aber seit 2001 um ca. 80%, im Vergleich zu 1998 inflationsbereinigt gar um nahezu 200% gestiegen.
- Während die Rüstungsausgaben in den letzten 10 Jahren in Lateinamerika insgesamt um 50% stiegen, will allein Brasilien seine Militärausgaben in den nächsten Jahren um über 20% erhöhen.
Wie kann man dieses enorme Anwachsen der Militärausgaben erklären? Was verheißen diese?
China – Vom „underdog“ zum Herausforderer
China, das in den letzten 100 Jahren immer wieder vom Militarismus verwüstet wurde, erhebt mittlerweile Großmachtansprüche. Weltweit liegt es bei den Rüstungsausgaben hinter den USA mittlerweile an zweiter Stelle.
In den 1920er und 1930er Jahren wurde das Land durch Auseinandersetzungen zwischen warlords zerrüttet; in den 1930er Jahren überzog der Krieg zwischen verschiedenen Flügeln der chinesischen Bourgeoisie (Kuomintang und den maoistisch-stalinistischen Truppen) weite Landesteile, gefolgt von einem Krieg mit dem japanischen Besatzer von 1937-45. Kaum war der Zweite Weltkrieg beendet, wütete erneut der Krieg zwischen den Truppen Maos und der Kuomintang. Kurz nach der Teilung des Landes in die Volksrepublik China und Taiwan 1949 trat die Volksrepublik an der Seite Russlands im Koreakrieg (1950-53) in die erste große Auseinandersetzung mit den USA ein. Ende der 1950er Jahre begann die Konfrontation mit der Sowjetunion, die zu großen Spannungen und Zusammenstößen entlang dem Ussuri-Fluss in den 1960er Jahre führte, mit der Gefahr eines Atomwaffenganges. Zwischendurch gab es 1962 erste Scharmützel mit Indien.
Aufgrund der skizzierten Geschichte Chinas im 20. Jahrhunderts wucherte ein gewaltiger Militärapparat, der zur Zeit des Maoismus aus einer waffentechnisch rückständigen Armee bestand, die jedoch über einen nahezu grenzenlosen Vorrat an „Kanonenfutter“ verfügte. Nachdem Ende der 1980er Jahre mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine Umwälzung nicht nur auf ökonomischer Ebene eingeleitet wurde, sondern auch auf militärischer, hat China gewaltige Massen an Soldaten (seine Landstreitkräfte umfassen immer noch 1.4 Mio. Soldaten) „freigesetzt“, um mehr Ressourcen in die Erneuerung seiner Waffensysteme zu stecken. In allen Bereichen soll die Ausrüstung modernisiert werden. Zwar verpulvern weltweit die USA noch am meisten Geld für ihre Streitkräfte. Mit einem Militäretat in Höhe von 661 Milliarden Dollar waren sie 2009 für 43 Prozent der weltweiten Rüstungsausgaben verantwortlich, offiziell gab China 2008 63.6 Mrd. USD aus, d.h. ein Zehntel von dem, was die USA in die Rüstung steckten. Die Zunahme der Militärausgaben in China ist jedoch eine der stärksten Wachstumsraten weltweit, auch wenn China in Anbetracht des vorhandenen Abstands zu den USA diese vermutlich nie einholen wird. Aber das neue militärische Gewicht und die Ambitionen Chinas haben schon jetzt eine destabilisierende Wirkung, welche die Rüstungsspirale weltweit mit verschärft.
Zudem muss China durch seine Abhängigkeit von Rohstoffen (es ist zu mehr als 50% bei der Energieversorgung vom Ausland abhängig) insbesondere in Afrika, Südamerika und in Asien nach Einflussmöglichkeiten und Verbündeten suchen, womit es automatisch mit den USA und anderen Ländern in Konflikt gerät. Auch wenn China im Vergleich zu dem militärischen Riesen USA als ein Zwerg erscheint, hat dies dennoch besorgte Reaktionen der Nachbarn ausgelöst. So sehen sich nicht nur die USA zu entsprechenden Anstrengungen gezwungen, der Modernisierung der chinesischen Streitkräfte gegenzusteuern. Auch Japan, das sich durch Nordkorea bedroht sieht, versucht sich militärisch auf die Herausforderung durch China einzustellen. Aber vor allem Indien betrachtet China als einen Erzrivalen.
Der Aufstieg Chinas zur herausfordernden, nach mehr Einfluss und Selbständigkeit drängenden Macht muss notwendigerweise an der weltweiten imperialistischen Hackordnung rütteln und Gegenreaktionen der Rivalen auslösen.
Die Entwicklung Chinas ist ein deutliches Beispiel für den kapitalistischen Niedergang, wo ein zuvor quasi aufgeteiltes, besetztes, zersplittertes und vom Militarismus ausgeblutetes Land, das als „underdog“ galt, sich zum „eigenständigen“ Akteur gemausert hat, das nun Großmachtambitionen zeigt. Es kann keinen „Aufstieg“ einer neuen Großmacht geben, ohne dass dies als Bedrohung der imperialistischen Interessen der Rivalen angesehen wird.
Indien – im Rüstungswettlauf mit dem Erzrivalen China
Das Land, das 1947 bei seiner Unabhängigkeit von Großbritannien von der ehemaligen Kolonialmacht in Pakistan, (das damals noch aus dem Westteil, dem heutigen Pakistan und dem Ostteil, dem heutigen Bangladesch bestand) und Indien geteilt wurde, führte schon 1949 seinen ersten Krieg gegen Pakistan, 1965 erneut gegen Pakistan um Kaschmir. 1962 gerieten Indien und China das erste Mal direkt aneinander. Seitdem wird die indische Politik durch die Rivalität mit dem großen Nachbarn im Nordosten beherrscht. Erschwerend kommt hinzu, dass China in Pakistan einen Verbündeten gefunden hat, der – mittlerweile zur Atommacht geworden – Indien bereits in einen permanenten Rüstungswettlauf treibt. Die chronische Rückständigkeit und Verkrüppelung der indischen Wirtschaft, die durch die langjährige koloniale Fesselung entstand, wurde nach der Unabhängigkeit noch durch die nationalistische Abschottungspolitik verstärkt. Seit den 1990er Jahren hat auch Indien angefangen, sich den neuen Verhältnissen der „Globalisierung“ anzupassen. Das Land, einst eine „amputierte“ Kolonie, wird jetzt zur „herausfordernden“ Macht in der Region, die als Gegengewicht zum Aufsteiger China auftritt. Indien ist mittlerweile zum wichtigsten Kunden für die internationale Rüstungsindustrie geworden, in das neun Prozent aller weltweit gehandelten Waffen exportiert werden. Auf Rang zwei der wichtigsten Waffenkunden folgt China. Sechs Prozent aller weltweit gehandelten Waffen importiert China. Indien hat seinen Wehretat 2010 um gut ein Drittel erhöht. Mit 126 Kampfflugzeugen im Wert von umgerechnet 7,3 Milliarden Euro hat das Land einen der größten Einzelaufträge ausgeschrieben. Eine der technologisch wichtigsten Waffenlieferanten Indiens ist Israel. Die indische Marine will ihren Einfluss vom Persischen Golf bis zur Straße von Malakka geltend machen können sowie die Fähigkeit zu offensiven Operationen über die Landesgrenzen hinaus entwickeln. Indien ist besorgt wegen der Kette von Marinebasen, die Peking vom Chinesischen Meer über den Indischen Ozean bis zur afrikanischen Küste (Seychellen) aufzubauen versucht (Le Monde, 10/2009). So verkündete Indien 2008 das Ziel, bis 2022 eine mindestens 160 Schiffe umfassende Flotte um drei Flugzeugträgerkampfverbände, 20 U-Boote und 400 Flugzeuge mit Langstreckenpräzisionswaffen aufzubauen. Diese Programme spiegeln die Ambitionen Indiens wider. Zur Modernisierung seiner Armee hat Indien weiterhin 350 T-90S-Kampfpanzer aus Russland bestellt, das Land will selbst 1000 Panzer herstellen. Indien hat Pläne, von Russland in den nächsten zehn Jahren zwischen 250 bis 300 Kampfflugzeuge im Wert von 30 Milliarden US-Dollar zu kaufen. 2008 lief das erste indische Atom-U-Boot vom Stapel. Weil Indien bislang bei seinen Rüstungsprogrammen stark von Russland, von dem es 80% seiner modernen Waffen erhielt, abhängig war, will es eine eigenständige Rüstungsindustrie aufbauen. Das Land unterhält nach den China und den USA mit 1.3 Millionen Soldaten die drittgrößte Streitmacht der Erde.
Neben den unmittelbaren Nachbarn Pakistan, von dem es sich ständig bedroht sieht (über 10 Milliarden Dollar wurden in die Grenzbefestigung zu Pakistan gesteckt), und Bangladesch (entlang der Grenze zum östlichen Nachbarn wurde ein 4000 km langer Stacheldrahtzaun errichtet) wird Indien aber vor allem von den USA umworben, um als Gegenmacht gegenüber China aufgebaut zu werden. Die USA haben deshalb 2008 Indien als „verantwortungsvolle“ Atommacht anerkannt. So gerät die ganze imperialistische Landschaft in Fernost und Südasien durch den Aufstieg Chinas und Indiens und die sich daraus ergebenden Folgen für die imperialistische Rangordnung in der Region in Umwälzung. In ganz Asien ist ein Rüstungswettlauf entbrannt.
Zum Beispiel hat selbst ein Land wie Malaysia zwischen 2005 und 2009 sieben Mal so viel Geld für Rüstungsimporte ausgegeben wie in den fünf Jahren zuvor.
Während wir also durch die phänomenalen Wachstumsraten der asiatischen Schwellenländer geblendet werden sollen, hat sich in Wirklichkeit dort auch das Krebsgeschwür des Militarismus festgefressen.
Und wie sieht es mit dem Shooting-Star Brasilien aus?
Der Krebs des Militarismus verschont auch Lateinamerika nicht
Lateinamerika blieb im 2. Weltkrieg und auch im Kalten Krieg eine Beteiligung an den Kampfhandlungen erspart. Zwar gibt es eine Reihe von Konflikten zwischen mehreren Nachbarstaaten (Venezuela u.a. mit russischen Waffenlieferungen – Kolumbien erhält Unterstützung durch die USA; Kolumbien – Ecuador, Chile-Peru-Bolivien); aber bislang haben diese bei weitem nicht die Schärfe erreicht wie im Mittleren Osten oder in Fernost oder in Südostasien. Aber auch in dieser Region, die bislang der Hinterhof der USA war, verschärfen sich die Rivalitäten. An erster Stelle drängt Brasilien, die neue Regionalmacht, auf eine Aufwertung seiner Position. Brasilien rüstet kräftig auf und stellt seinen Streitkräften gut 25 Prozent mehr Mittel zur Verfügung. Auf der Einkaufsliste der Militärs: Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber. „Das südamerikanische Land soll gemäß der nationalen Verteidigungsstrategie wieder ein großer weltweiter Rüstungslieferant werden, wie schon einmal vor 30 Jahren…. Zwar kürzte die neue Regierung unter Dilma Rousseff den Rüstungsetat. So stoppte sie den bereits vergebenen Auftrag an die französische Dassault für 36 Kampfflugzeuge des Typs Rafale im Wert von zehn Milliarden Euro. Auch strich sie einen Auftrag für zwölf russische Hubschrauber. Aber die Regierung verschonte die laufenden [nationalen] Entwicklungsprojekte. "Wir sparen beim Einkauf von Technologie, nicht bei der Entwicklung", sagte Verteidigungsminister Nelson Jobim dem Handelsblatt. "Oberste Priorität hat für uns der Aufbau einer eigenen Industrie. Für weltweite Aufmerksamkeit der Branche sorgt zudem die Entwicklung des militärischen Transportflugzeugs KC-390 durch den brasilianischen Flugzeugbauer Embraer I [253]ndustrie." „Nach dem nationalen Strategieplan sind Ausgaben in Höhe von rund 90 Milliarden Euro für die nächsten 30 Jahre notwendig. Dabei geht es nicht nur um Rüstung und Verteidigung im engeren Sinne, sondern auch um Überwachung und Sicherung von Grenzen und Küsten sowie den Ölplattformen im Meer.“ Die langfristigen militärischen Strategien vor Augen, lautete der Regierungsbeschluss: Mit der Entdeckung immenser Erdölvorkommen in der exklusiven Wirtschaftszone vor der Atlantikküste entsteht ein neuer „Verteidigungsbedarf“. „Truppen und Material werden künftig in Amazonien und im Südatlantik konzentriert, um einer militärischen Intervention der USA vorzubeugen“. 2010 wurden die Rüstungsausgaben um 10% erhöht.
Zwar ist Brasilien eine strategische Partnerschaft mit Frankreich eingegangen, aber Deutschland hat 2006 eine große Bestellung Brasiliens für 220 Leopard Panzer erhalten. Wie kann man erklären, dass ein Land, das unmittelbar nicht vor Kriegshandlungen mit seinen Nachbarn steht, so viele Panzer erwirbt? Vor allem fordert Brasilien zusammen mit anderen Staaten auf diplomatischer Ebene immer häufiger die USA heraus, will deren Schwächung nutzen und sich auf deren Kosten besser positionieren. D.h. selbst in Ländern wie Brasilien, die bislang nicht durch starke Rivalitäten in direkte Auseinandersetzungen getrieben wurden, frisst sich das Krebsgeschwür des Militarismus weiter ein.
Der letzte der BRIC-Staaten – Russland – kann eigentlich nur hohe Wachstumszahlen vorweisen, weil er dank seiner Erdöl- und Erdgasexporte sowie anderer Rohstoffe von deren hohen Preisen profitierte. An auf dem Weltmarkt konkurrenzfähigen Fertigwaren, vor allem im zivilen Bereich, hat die russische Industrie ohnehin nichts zu bieten. Stattdessen zeichnet sich Russland als niedergegangene Militärmacht noch immer als zweitgrößter Waffenexporteur aus. Sein Weltmarktanteil liegt bei 23 Prozent.
Wie stark sich das Krebsgeschwür des Militarismus in den letzten Jahren ausgedehnt hat, lässt sich auch anhand der Militärausgaben in einigen anderen Ländern verfolgen. Die sprudelnden Rohstoffeinnahmen (Erdöl, Erdgas, usw.), über die beispielsweise Angola oder Nigeria verfügen, haben dort zu keinem Wachstumsschub geführt, sondern deren Einnahmen gingen hauptsächlich in Waffenkäufe. Noch eklatanter fällt dies bei Saudi-Arabien aus. Waffen im Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar wollen US-Firmen in den kommenden fünf bis zehn Jahren an Saudi-Arabien liefern, unter anderem 84 neue F-15-Kampfjets und 178 Hubschrauber. Anstatt die Öleinnahmen in zivile Projekte zu stecken, werden riesige Beträge für die Rüstung verpulvert. Die USA wollen dabei u.a. Saudi-Arabien unbedingt als Gegenpol zum Iran weiter hochrüsten.
Der ganze Nahe und Mittlere Osten, wie die jüngsten Proteste zeigen, ist ein einziges Armenhaus für die meisten Menschen, aber er erstickt gleichzeitig unter dem Gewicht des Militarismus.
Nach einem kurzen Rückgang zogen die Rüstungsausgaben wieder an
Zwischen 1989 und 2000 sind die weltweiten Militärausgaben um 43 Prozent gesunken. Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist jedoch vielerorts ein neuer Aufrüstungstrend zu beobachten. Weltweit sind die Militärausgaben seit 2000 um 49 Prozent gestiegen und haben 2009 mit 1572 Milliarden US-Dollar in konstanten Preisen einen neuen Höchststand erreicht. Maßgeblichen Anteil an den weltweiten Militärausgaben und der Zunahme der letzten Jahre hatten die USA. Im Jahr 2009 hatte das Land mit 663 Milliarden US-Dollar einen Anteil von 43 Prozent an den globalen Ausgaben, nachdem Washington seine Rüstungsausgaben seit 2001 um 81 Prozent gesteigert hat. Nun muss zwar auch Washington auf die Bremse treten. Auch haben einige europäische Staaten unter dem Druck der Wirtschafts- und Finanzkrise ihre Verteidigungsbudgets gesenkt und einige Rüstungsbeschaffungsprojekte ausgesetzt. Aber diese Entwicklung ist uneinheitlich. Denn während die Militärausgaben in Europa 2010 um 2,8 Prozent sanken, stiegen sie in Afrika im letzten Jahr um 5,2 Prozent. In Schwellenländern und zahlreichen erdölexportierenden Staaten ist hingegen ein
umgekehrter Trend zu beobachten: eine schier ungebremste konventionelle Aufrüstung.
Dv, 25.5.2011
Aktuelles und Laufendes:
- China [82]
- BRIC-Staaten [254]
- Aufrüstung Militarismus Indien [255]
- Brasilien [256]
- Russland [257]
- Malaysia [258]
- Rüstungswettlauf Asien [259]
- Militarismus 21. Jahrhundert [260]
Historische Ereignisse:
- Teilung Indiens [261]
- Entwicklung Chinas 20. Jahrhhundert [262]
- war lords China [263]
- Maoismus [264]
Ein schmerzhafter Verlust für die IKS : der Tod des Genossen Enzo
- 4926 Aufrufe
Wer Enzo persönlich gekannt hat, weiß, dass er nicht nur als Mitglied unserer Organisation, sondern in seiner ganzen politischen Tätigkeit, mit seinen Beiträgen in den Diskussionen seine Leidenschaft und seinen Schmerz angesichts der Tortur, die der Kapitalismus der menschlichen Gattung auferlegt, zum Ausdruck gebracht hat – mitunter mit Tränen in den Augen. Enzo war ein junger Proletarier, der in seiner eigenen Haut die Ausbeutung erlebte, Kurzarbeit und schließlich die Entlassung, der aber gleichzeitig überzeugt war, dass man darauf reagieren , gegen diese Barbarei kämpfen und eine menschliche Gesellschaft aufbauen kann. Seine Mitgliedschaft in der IKS war immer von dieser Überzeugung und seiner Entschlossenheit geprägt, auch in schwierigen Zeiten und Situationen seinen Beitrag zu diesem Kampf zu leisten. Sein Tod ist ein Verlust für die IKS und die ganze Arbeiterklasse.
Wir werden zunächst in der italienischsprachigen Presse einen längeren Text schreiben, um unseres Genossen zu gedenken. Wir möchten aber schon hier den Angehörigen gegenüber unsere Solidarität ausdrücken, den Eltern und Freunden in einem Moment, der uns im Schmerz vereint, und möchten unsere Entschlossenheit unterstreichen, den Kampf für die lang und heiß ersehnte menschliche Gesellschaft voranzutreiben, für die Enzo zusammen mit uns gekämpft hat.
IKS, 19. Mai 2011
Resolution des 19. Internationalen Kongresses der IKS zur Internationalen Situation
- 2551 Aufrufe
1. Die am letzten Kongress der IKS angenommene Resolution unterstrich zunächst, wie die Fakten die optimistischen Voraussagen der Führer der bürgerlichen Klasse zu Beginn des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts widerlegt hatten, insbesondere die Voraussagen nach dem Zusammenbruch des "Reichs des Bösen", als welches der so genannte "sozialistische" Block galt. Die Resolution zitierte die bereits berühmte Erklärung von George Bush sen. im März 1991, in der er die Geburt einer "neuen Weltordnung" ankündigte, die auf dem "Respekt vor dem Völkerrecht" beruhe, und sie hob hervor, wie surrealistisch solche Voraussagen angesichts des sich ausbreitenden Chaos in der heutigen kapitalistischen Gesellschaft sind. Zwanzig Jahre nach dieser "prophetischen" Rede, insbesondere nach Beginn dieses neuen Jahrzehnts, bietet die Welt ein chaotischeres Bild als je seit dem Zweiten Weltkrieg. Innerhalb von einigen wenigen Wochen wurden wir Zeugen eines neuen Kriegs in Libyen, der die Liste all der blutigen Konflikte, die den Planeten in der letzten Zeit überzogen haben, verlängert, von weiteren Massakern an der Elfenbeinküste und der Tragödie, die eines der mächtigsten und modernsten Länder der Welt heimsuchte, nämlich Japan. Das Erdbeben, das einen Teil dieses Landes verwüstete, unterstrich einmal mehr, dass es nicht "Naturkatastrophen" gibt, sondern katastrophale Folgen von natürlichen Erscheinungen. Es zeigte, dass die Gesellschaft heute über die Mittel verfügt, Gebäude zu erstellen, die den Erschütterungen widerstehen, Mittel, die es erlauben würden, Tragödien wie diejenige vom letzten Jahr in Haiti zu vermeiden. Aber es zeigte ebenso, wie wenig selbst ein so fortgeschrittener Staat wie Japan Gefahren voraussieht: Das Erdbeben selber forderte nur wenige Opfer, aber der darauf folgende Tsunami tötete beinahe 30'000 Menschen in wenigen Minuten. Darüber hinaus offenbarte das neue Tschernobyl in Fukushima, dass es der herrschenden Klasse nicht nur an Voraussicht mangelt, sondern dass sie schlicht dem Zauberlehrling gleicht, der nicht in der Lage ist, die Geister zu bändigen, die er rief. Das Unternehmen Tepco, welches das Atomkraftwerk betreibt, ist nicht der hauptsächliche, und schon gar nicht der einzige Verantwortliche der Katastrophe. Vielmehr ist das kapitalistische System als ganzes, das auf dem unbändigen Streben konkurrierender nationaler Einheiten nach Profit, statt auf der Bedürfnisbefriedigung der Menschheit beruht, für die gegenwärtigen und noch kommenden Katastrophen, welche die menschliche Gattung erleiden muss, verantwortlich. In letzter Instanz ist das japanische Tschernobyl ein neuer Beweis für den endgültigen Bankrott der kapitalistischen Produktionsweise, eines Systems, dessen Überleben eine zunehmende Gefahr für das Überleben der Menschheit selber darstellt.
Die Wirtschaftskrise - Grenzen der Hilfsmittel
2. Offensichtlich drückt die Krise, die gegenwärtig der Weltkapitalismus durchmacht, am unmittelbarsten die geschichtliche Hinfälligkeit dieser Produktionsweise aus. Vor zwei Jahren ergriff eine helle Panik die Bourgeoisie aller Länder angesichts der Ernsthaftigkeit der wirtschaftlichen Lage. Die OECD schrieb unverblümt: "Die Weltwirtschaft befindet sich inmitten der tiefgreifendsten Rezession, die wir zu unseren Lebzeiten je gesehen haben" (Zwischenbericht März 2009). Wenn man weiß, mit welcher Zurückhaltung sich diese hochehrwürdige Institution normalerweise ausdrückt, kann man ermessen, wie sehr die herrschende Klasse vom Schrecken gepackt war angesichts des möglichen Bankrotts des internationalen Finanzsystems, des brutalen Einbruchs des Welthandels (im Jahre 2009 mehr als 13%), der Gewalt der Rezession in den wichtigsten Ländern, der Welle von Pleiten, die Vorzeigeunternehmen der Industrie wie General Motors oder Chrysler erfasste oder bedrohte. Dieser Schrecken der Bourgeoisie veranlasste sie, Gipfeltreffen der G20 einzuberufen, wobei derjenige vom März 2009 in London die Verdoppelung der Reserven des Weltwährungsfonds und die massive Einschießung von Liquidität in die Wirtschaft durch die Staaten beschloss, um das Bankensystem vor dem Absturz zu bewahren und die Produktion wieder anzukurbeln. Das Gespenst der "Großen Depression der 1930er Jahre" ging um, was die gleiche OECD veranlasste, solche Dämonen mit den Worten zu beschwören: "Obwohl dieser schwere weltweite Konjunkturabschwung von einigen bereits als ‚Große Rezession' bezeichnet wurde, sind wir weit davon entfernt, eine Wiederholung der Großen Depression der 1930er Jahre zu erleben, was der Qualität und der Intensität der gegenwärtig getroffenen staatlichen Maßnahmen zu verdanken ist" (a.a.O.). Doch wie die Resolution des 18. Kongresses sagte, besteht "ein Wesensmerkmal der offiziellen Reden der herrschenden Klasse heute darin, die Reden von gestern in Vergessenheit geraten zu lassen", und der gleiche Zwischenbericht der OECD vom Frühjahr 2011 verleiht einer wahren Erleichterung Ausdruck angesichts der Wiederherstellung des Bankensystems und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Die herrschende Klasse kann nicht anders. Unfähig zu einer klaren, umfassenden und historischen Sicht auf die Schwierigkeiten, in denen ihr System steckt - da umgekehrt eine solche Klarsicht sie dazu führen würde, die endgültige Sackgasse des Systems zu entdecken -, ist sie dazu verdammt, die Wechsel der unmittelbaren Lage von Tag zu Tag zu kommentieren und zu versuchen, darin Momente des Trostes zu finden. Bei diesem Unterfangen unterschätzt sie immer wieder die Bedeutung des Hauptphänomens der letzten beiden Jahre: die Krise der Staatsanleihen in gewissen europäischen Ländern - auch wenn die Medien manchmal bei diesem Thema einen alarmierten Ton anschlagen. In der Tat stellt diese potentielle Pleite einer wachsenden Reihe von Staaten eine neue Phase im Versinken des Kapitalismus in der unüberwindlichen Krise dar. Sie verdeutlicht die Grenzen der Maßnahmen, mit denen es der Bourgeoisie gelungen ist, den Fortgang der kapitalistischen Krise seit mehreren Jahrzehnten zu bremsen.
3. Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren steht das kapitalistische System der Krise gegenüber. Der Mai 68 in Frankreich und die Gesamtheit der proletarischen Kämpfe, die weltweit darauf folgten, breiteten sich nur deshalb so aus, weil sie genährt wurden durch eine globale Verschärfung der Lebensbedingungen, die ihrerseits auf den Auswirkungen der kapitalistischen Krise beruhte, insbesondere der Anstieg der Arbeitslosigkeit. Diese Krise verschärfte sich 1973-75 brutal mit der ersten großen internationalen Nachkriegs-Rezession. Seither folgten neue Rezessionen, welche die Weltwirtschaft jedes Mal tiefer und weiterreichender trafen und schließlich in der derjenigen von 2008-2009 einen vorläufigen Tiefpunkt erreichten, der das Gespenst der 1930er Jahre hervorrief. Die Maßnahmen, die der G20 im März 2009 zur Vermeidung einer neuen "Großen Depression" ergriffen, zeigen die Politik auf, welche die herrschende Klasse seit einigen Jahrzehnten anwendet: Sie lässt sich zusammenfassen als Einschießung von beträchtlichen Kreditmassen in die Wirtschaft. Solche Maßnahmen sind nicht neu. Tatsächlich stellen sie seit 35 Jahren den Kern der Wirtschaftspolitik der herrschenden Klasse dar beim Versuch, dem großen Widerspruch der kapitalistischen Produktionsweise zu entgehen: der Unfähigkeit, zahlungsfähige Märkte zu finden, die ihre Produktion aufnehmen. Die Rezession von 1973-75 wurde durch massive Kredite an die Länder der Dritten Welt überwunden, doch ab Beginn der 1980er Jahre, mit der Schuldenkrise dieser Länder, musste die Bourgeoisie der am meisten entwickelten Länder auf diese Lunge für ihre Wirtschaft verzichten. Die Staaten der am weitesten entwickelten Länder, allen voran die USA, übernahmen nun die Rolle der "Lokomotive" der Weltwirtschaft. Die "Reaganomics" (neoliberale Politik der Reagan-Administration) zu Beginn der 80er Jahre, die einen bedeutenden Aufschwung der Wirtschaft dieses Landes erlaubten, beruhten auf einer noch nie dagewesenen Ausschöpfung der Budgetdefizite, während Ronald Reagan gleichzeitig erklärte: "Der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem." Zugleich ermöglichten es die ebenfalls beträchtlichen Handelsdefizite dieser Großmacht, dass die in anderen Ländern produzierten Waren hier einen Absatz fanden. In den 1990er Jahren standen die asiatischen "Tiger" und "Drachen" (Singapur, Taiwan, Südkorea usw.) eine Weile den USA in dieser Rolle als "Lokomotive" bei: Ihre spektakulären Wachstumsraten verwandelten jene in wichtige Absatzmärkte für die Waren der am meisten industrialisierten Länder. Aber diese "Erfolgsgeschichte" hatte den Preis einer beträchtlichen Verschuldung, die jene Länder 1997 in große Schwierigkeiten führte vergleichbar mit denen des "neuen" und "demokratischen" Russland, das vor der Zahlungsunfähigkeit stand und grausam diejenigen enttäuschte, die auf das "Ende des Kommunismus" setzten, um einen dauerhaften Aufschwung der Weltwirtschaft vorauszusagen. Zu Beginn der 2000er Jahre erfuhr die Verschuldung eine neue Beschleunigung, insbesondere dank der enormen Wucherung der Hypothekardarlehen im Bausektor von mehreren Ländern, vor allem in den USA. Dieses Land trieb seine Rolle als "Lokomotive der Weltwirtschaft" auf die Spitze, aber zum Preis eines schwindelerregenden Wachstums der Schulden - insbesondere der US-amerikanischen Bevölkerung -, die auf allen möglichen "Finanzprodukten" beruhten, die angeblich die Risiken einer Zahlungsunfähigkeit vermindern sollten. In Tat und Wahrheit führte die Verteilung von zweifelhaften Krediten keineswegs dazu, das über der amerikanischen Wirtschaft und derjenigen der Welt hängende Damoklesschwert in Sicherheit zu bringen. Im Gegenteil häuften sich im Kapital der Banken "toxische Guthaben" an, die schließlich 2007 zu ihrem Zusammenbruch und 2008-2009 zur brutalen Weltrezession führten.
4. Die vom letzten Kongress angenommene Resolution sagte: "So ist die Finanzkrise nicht die Wurzel der gegenwärtigen Rezession. Im Gegenteil, die Finanzkrise verdeutlicht nur die Tatsache, dass die Flucht nach vorne in die Verschuldung, welche die Überwindung der Überproduktion ermöglicht hatte, nicht endlos lange fortgesetzt werden kann. Früher oder später rächt sich die " reale Wirtschaft ", d.h. was die Grundlagen der Widersprüche des Kapitalismus darstellt - die Überproduktion, die Unfähigkeit der Märkte, die Gesamtheit der produzierten Waren aufzusaugen. Diese Widersprüche treten dann wieder deutlich in Erscheinung." Und die gleiche Resolution präzisierte nach dem Gipfel des G20 vom März 2009, dass "die Flucht in die Verschuldung (…) eines der Merkmale der Brutalität der gegenwärtigen Rezession (ist). Die einzige " Lösung ", die die herrschende Klasse umsetzen kann, ist eine erneute Flucht in die Verschuldung. Der G20 konnte keine Lösung für die Krise erfinden, ganz einfach, weil es keine Lösung für die Krise gibt."
Die Krise der Staatsanleihen, die sich heute ausweitet, die Tatsache, dass die Staaten unfähig werden, den Schuldendienst zu leisten, illustriert drastisch diese Realität. Der mögliche Zusammenbruch des Bankensystems und die Rezession zwangen alle Staaten, beträchtliche Summen in ihre Wirtschaft einzuschießen, während umgekehrt die Einnahmen sich im freien Fall befinden, weil die Produktion zurückgeht. Aus diesem Grund nahmen die Staatsdefizite in den meisten Ländern beträchtlich zu. Für die am meisten gefährdeten unter ihnen wie Irland, Griechenland oder Portugal bedeutete dies der potentielle Bankrott, die Unfähigkeit, die Staatsangestellten zu bezahlen und die Schulden zu begleichen. Seither weigern sich die Banken, ihnen neue Darlehen zu geben, außer gegen exorbitant hohe Zinsen, da diese Länder keine Gewähr bieten, die Darlehen wieder zurück zu zahlen. Die "Rettungspläne", welche die Europäische Bank und der Weltwährungsfond für sie ausarbeiteten, stellen lediglich neue Schulden dar, die ebenso wie die früheren zurück bezahlt werden müssen. Es ist mehr als ein Teufelskreis, es ist eine Höllenspirale. Die einzige "Effizienz" dieser Pläne besteht in den noch nie dagewesenen Angriffen gegen die ArbeiterInnen, gegen die Staatsangestellten, deren Löhne und Stellen drastisch abgebaut wurden, aber auch gegen die Gesamtheit der Arbeiterklasse durch die Kürzungen von Ausgaben bei den Schulen, der Gesundheit und den Altersrenten wie auch durch starke Steuererhöhungen. Doch all diese Angriffe gegen die Arbeiterklasse beschneiden einmal mehr die Kaufkraft der ArbeiterInnen und leisten so einen weiteren Beitrag zur nächsten Rezession.
Krise der Staatsschulden
5. Die Krise der Staatsschulden in den PIIGS (Portugal, Island, Irland, Griechenland und Spanien) ist nur ein kleiner Teil des Erdbebens, das die Weltwirtschaft bedroht. Nur weil die großen Industriemächte gegenwärtig noch über die Note AAA auf der Bewertungsskala der Rating-Agenturen verfügen (der gleichen Agenturen, die am Vorabend des Debakels der Banken von 2008 diesen ebenfalls die Bestnote erteilt haben), heißt nicht, dass sich jene besser aus der Affäre ziehen würden. Ende April 2011 äußerte sich die Agentur Standard and Poor's negativ über ein bevorstehendes Quantitative Easing Nr. 3, das heißt einen 3. Aufschwungsplan des amerikanischen Staats zur Ankurbelung der Wirtschaft. Mit anderen Worten läuft die größte Weltmacht Gefahr, dass ihr das "offizielle" Vertrauen in ihre Fähigkeit zur Bezahlung der Schulden entzogen wird - mindestens mit Dollars, die noch etwas wert sind. Tatsächlich hat dieses Vertrauen halb-offiziell schon zu schwinden begonnen mit dem Entscheid Chinas und Japans seit dem letzten Herbst, massiv Gold und Rohstoffe zu kaufen an Stelle von amerikanischen Staatsanleihen, was die Amerikanische Zentralbank dazu zwang, jetzt 70% bis 90% der ausgegebenen Anleihen selber zu kaufen. Und dieser Vertrauensverlust ist vollkommen gerechtfertigt, wenn man das unglaubliche Ausmaß der Verschuldung der amerikanischen Wirtschaft betrachtet: Im Januar 2010 betrug die öffentliche Verschuldung (Bundesstaat, Gliedstaaten, Gemeinden usw.) schon fast 100% des BIP, was aber nur einen Teil der Gesamtverschuldung des Landes im Umfang von 300% des BIP ausmachte (die auch die Schulden der Haushalte und der nicht im Finanzsektor tätigen Unternehmen beinhaltet). Und die Lage in den anderen großen Ländern ist nicht besser, in denen die Gesamtschuld im gleichen Zeitpunkt für Deutschland 280% des BIP ausmachte, für Frankreich 320%, für Großbritannien und Japan 470%. In Japan erreichte die öffentliche Schuld allein 200% des BIP. Und seither hat sich die Lage in allen Ländern mit den verschiedenen Aufschwungplänen nur noch verschlimmert.
So stellt der Bankrott der PIIGS nur die Spitze des Eisbergs des Bankrotts einer Weltwirtschaft dar, die ihr Überleben seit Jahrzehnten nur der verzweifelten Flucht nach vorn in die Verschuldung verdankt. Die Staaten, die über ihre eigene Währung verfügen wie Großbritannien, Japan und natürlich die USA, konnten diesen Bankrott verstecken, indem sie die Notenpresse heiß laufen ließen (im Gegensatz zu denjenigen der Euro-Zone wie Griechenland, Irland oder Portugal, die nicht über diese Möglichkeit verfügen). Aber diese ständigen Betrügereien der Staaten, die tatsächlich zu wahrhaften Falschmünzern mit dem Bandenboss USA wurden, können nicht endlos auf gleiche Art fortgesetzt werden, so wie auch die Betrügereien im Zusammenhang mit dem Finanzsystem mit dem Ausbruch der Krise von 2008 Schiffbruch erlitten haben und es fast ganz in den Abgrund getrieben hätten. Eines der sichtbaren Zeichen dieser Realität ist die gegenwärtige Beschleunigung der weltweiten Inflation. Die Krise der Verschuldung verschob sich von der Bankensphäre in diejenige der Staaten, wodurch die kapitalistische Produktionsweise in eine neue Phase ihrer zugespitzten Krise eingetreten ist, in der sich die Gewalt und die Ausdehnung ihrer Erschütterungen noch einmal beträchtlich verschärfen werden. Es gibt für den Kapitalismus keinen "Ausgang aus dem Tunnel". Dieses System kann die Gesellschaft nur noch in eine ständig wachsende Barbarei ziehen.
Flucht nach vorn in die Kriegspolitik
6. Der imperialistische Krieg ist der wichtige Ausdruck der Barbarei, in welche der dekadente Kapitalismus die menschliche Gesellschaft stößt. Die tragische Geschichte des 20. Jahrhunderts ist der schlagendste Beweis dafür: Angesichts der historischen Sackgasse, in der sich ihre Produktionsweise befindet, angesichts der Zuspitzung der Handelskonkurrenz zwischen Staaten, ist die herrschende Klasse zu einer Flucht nach vorn in ihrer Kriegspolitik gezwungen, zu militärischen Konfrontationen. Für die meisten Historiker - auch solche, die sich nicht auf den Marxismus berufen - ist klar, dass der Zweite Weltkrieg ein Abkömmling der Großen Depression der 1930er Jahre war. Ebenso hatte die Zuspitzung der imperialistischen Spannungen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zwischen den damaligen Blöcken, dem amerikanischen und dem russischen (Invasion der UdSSR in Afghanistan 1979, Kreuzzug der Reagan-Regierung gegen das "Reich des Bösen"), ihre Beweggründe zu einem wesentlichen Teil in der Rückkehr der offenen Wirtschaftskrise Ende der 1960er Jahre. Doch hat die Geschichte gezeigt, dass diese Verbindung zwischen der Zuspitzung der imperialistischen Zusammenstöße und der wirtschaftlichen Krise des Kapitalismus nicht direkt oder unmittelbar ist. Die Intensivierung des "Kalten Krieges" führte schließlich zum Sieg des westlichen Blocks durch die Implosion des Gegners, was wiederum die Auflösung des ersteren zur Folge hatte. Die Welt entging zwar der Gefahr eines neuen verallgemeinerten Krieges, der zur Vernichtung der menschlichen Gattung hätte führen können, aber dafür explodierten überall militärische Spannungen und offene Zusammenstöße: Das Ende der rivalisierenden Blöcke bedeutete auch das Ende der Disziplin, die sie zuvor noch in ihren jeweiligen Gebieten hatten durchsetzen können. Seither wird die globale imperialistische Bühne durch den Versuch der größten Weltmacht beherrscht, ihre Führerrolle über den Rest der Welt und insbesondere über ihre früheren Bündnispartner aufrecht zu erhalten. Der erste Golfkrieg von 1991 offenbarte bereits diese Zielsetzung, aber die Geschichte der 1990er Jahre zeigte insbesondere mit dem Krieg in Jugoslawien, dass dieses Vorhaben zum Scheitern verurteilt ist. Der "Krieg gegen den Weltterrorismus", den die USA nach den Attentaten des 11. September 2001 erklärten, hatte den Anspruch, diese Führerrolle erneut zu behaupten, aber die festgefahrene Situation in Afghanistan und im Irak haben verdeutlicht, dass sie diese Rolle nicht mehr zurück erobern können.
Die Misserfolge der USA
7. Die Misserfolge der USA haben diese Macht nicht davon abgebracht, ihre Offensivpolitik, die sie seit Beginn der 1990er Jahre führte und sie zum wichtigsten destabilisierenden Faktor im Weltmaßstab machte, fortzusetzen. Die Resolution des letzten Kongresses sagte dazu: "Angesichts dieser Lage werden Obama und seine Administration nichts anderes tun können, als die kriegstreiberische Politik ihrer Vorgänger fortzusetzen" (…) "So verfolgt Obama mit dem Rückzug der Truppen aus dem Irak lediglich den Zweck, sie dafür in Afghanistan und Pakistan einzusetzen." Dies hat sich kürzlich mit der Exekution Bin Ladens durch ein amerikanisches Kommando auf pakistanischem Gebiet bewahrheitet. Diese "heldenhafte" Operation ist natürlich im Rahmen der Vorbereitung auf die nächsten Wahlen, die in anderthalb Jahren stattfinden, zu sehen. Sie zielte insbesondere darauf ab, den republikanischen Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen, da sie ihm vorwarfen, er sei zu weich bei der Bekräftigung der Vorreiterrolle der USA auf militärischer Ebene, wobei diese Kritiken anlässlich der Intervention in Libyen lauter wurden, als die Führerrolle bei dieser Operation dem französisch-britischen Tandem überlassen wurde. Sie bedeutete auch, dass es nach 10 Jahren, in denen Bin Laden als der Böse schlechthin herhalten musste, Zeit wurde, sich seiner zu entledigen, wenn man nicht als ohnmächtig dastehen wollte. Mit dieser Kommandoaktion stellten die USA unter Beweis, dass sie die einzige Macht sind, die die Mittel hat, eine solche Operation in militärischer, technologischer und logistischer Hinsicht durchzuführen, und zwar genau zu der Zeit, als Frankreich und Großbritannien Mühe mit ihrer Operation gegen Ghaddafi bekunden. Sie zeigte aller Welt, dass die USA nicht zögern, die "nationale Souveränität" eines "Bündnispartners" zu verletzen, dass sie die Spielregeln bestimmen, wenn immer sie es für nötig erachten. Schließlich zwang diese Aktion die meisten Regierungen der Welt dazu, ihren erfolgreichen Ausgang zu begrüßen, obwohl dies vielen gegen den Strich ging.
8. Trotzdem ist dieser Schlag Obamas in Pakistan keineswegs geeignet, die Lage in der Region, insbesondere in Pakistan selber zu stabilisieren; vielmehr besteht gerade hier die Gefahr, dass diese Ohrfeige für den "nationalen Stolz" alte Konflikte zwischen verschiedenen Sektoren der Bourgeoisie und dem Staatsapparat schürt. Weiter wird der Tod Bin Ladens nicht dazu führen, dass nun die USA und die anderen in Afghanistan engagierten Staaten die Kontrolle in diesem Land zurück gewinnen und die Autorität eines Karzai-Regimes konsolidieren könnten, das durch Korruption und Stammesfehden vollständig untergraben ist. Allgemeiner gesagt, wird der Tod Bin Ladens die Tendenzen des "Jeder-für-sich" nicht bremsen, ebenso wenig wie den Widerstand gegen die Autorität der ersten Weltmacht, wie er weiterhin beispielsweise in erstaunlichen punktuellen Allianzen zum Ausdruck kommt: in der Annäherung zwischen der Türkei und dem Iran; in den Allianzen zwischen dem Iran, Brasilien und Venezuela (strategisch und gegen die USA gerichtet); zwischen Indien und Israel (militärisch und zum Aufbrechen der Isolation); zwischen China und Saudi-Arabien (militärisch und strategisch); usw. Insbesondere wird er China nicht davon abhalten, seine imperialistischen Ansprüche zur Geltung zu bringen, die ihm sein neuer Status als industrielle Großmacht zu haben erlaubt. Es ist klar, dass dieses Land trotz seiner demographischen und wirtschaftlichen Stärke überhaupt nicht die militärischen oder technologischen Mittel hat und in absehbarer Zeit nicht haben wird, um selber ein Blockführer zu werden. Doch hat es die Mittel, um die amerikanischen Ansprüche noch mehr zu durchkreuzen - sei dies in Afrika, im Iran, in Nordkorea, Burma - und seinen Teil zur wachsenden Instabilität beizutragen, welche die imperialistischen Beziehungen prägen. Die "neue Weltordnung", die Vater George Bush vor 20 Jahren prognostizierte und die er sich unter der Vorherrschaft der USA erträumte, entlarven sich je länger je mehr als ein "Weltchaos" - ein Chaos, das die Konvulsionen der kapitalistischen Wirtschaft nur noch verschlimmern werden.
Die Schlüsselstellung der Arbeiterklasse
9. Angesichts des Chaos das die bürgerliche Gesellschaft auf allen Ebenen, der Ökonomie, des Krieges und auch auf der Ebene der Umwelt, so wie wir es kürzlich in Japan erlebt haben, ergriffen hat, hat nur die Arbeiterklasse eine Lösung anzubieten. Ihre Lösung ist die kommunistische Revolution. Die unüberwindbare Krise der kapitalistischen Wirtschaft, die Erschütterungen, welche sie in immer schärferer Form kennt, bilden die objektiven Bedingungen dafür. Einerseits ist die Arbeiterklasse gezwungen, ihre Kämpfe gegen die dramatischen Angriffe von Seiten der ausbeutenden Klasse zu verstärken. Andererseits erlaubt dies der Arbeiterklasse zu verstehen, dass ihre Kämpfe eine große Bedeutung haben, als Vorbereitung zur entscheidenden Auseinandersetzung mit einer Produktionsweise, dem Kapitalismus, der von der Geschichte verdammt ist unterzugehen. Wie in der Resolution des letzten internationalen Kongress beschrieben: "Der Weg, der uns zu revolutionären Kämpfen und zum Umsturz des Kapitalismus führt, ist lang und schwierig. (…) Damit das Bewusstsein über die Möglichkeit der kommunistischen Revolution in der Arbeiterklasse wirklich Wurzeln schlagen kann, muss Letztere Vertrauen in ihre eigenen Kräfte gewinnen, und dies geschieht in massenhaften Kämpfen. Der gewaltige Angriff, der schon jetzt auf Weltebene gegen sie geführt wird, bildet eine objektive Grundlage für solche Kämpfe." Zum Unmittelbaren stellte die damalige Resolution fest: "Doch die wichtigste Form, in der diese Angriffe stattfinden - Massenentlassungen, läuft der Entwicklung solcher Kämpfe zunächst zuwider. (…) Erst in einer zweiten Phase, wenn sie in der Lage sein wird, den Erpressungen der Bourgeoisie zu widerstehen, wenn sich die Einsicht durchgesetzt hat, dass nur der vereinte und solidarische Kampf die brutalen Angriffe der herrschenden Klasse bremsen kann - namentlich wenn diese versuchen wird, die gewaltigen Budgetdefizite, die gegenwärtig durch die Rettungspläne zugunsten der Banken und durch die "Konjunkturprogramme" angehäuft werden, von allen ArbeiterInnen bezahlen zulassen -, erst dann werden sich Arbeiterkämpfe in größerem Ausmaß entwickeln können."
10. Die zwei Jahre, die uns vom letzten Kongress trennen, haben dies vollauf bestätigt. Diese Periode war nicht gezeichnet von verbreiteten Kämpfen gegen die massiven Entlassungen oder gegen die steigende Arbeitslosigkeit, welche die Arbeiterklasse in den am meisten fortgeschrittenen Ländern über sich ergehen lassen muss. Gleichzeitig gibt es aber bedeutende Kämpfe gegen die "notwendigen Kürzungen der Sozialausgaben". Doch diese Antwort ist immer noch schüchtern, vor allem dort, wo die Sparmaßnahmen die brutalsten Formen angenommen haben, in Ländern wie z.B. Griechenland oder Spanien, auch wenn die Arbeiterklasse dort in letzter Zeit ein bedeutendes Niveau an Kampfbereitschaft gezeigt hat. In gewisser Weise scheint die Brutalität der Angriffe in den Reihen der Arbeiterklasse ein Gefühl der Machtlosigkeit ausgelöst zu haben, vor allem auch, weil sie durch "linke" Regierungen durchgesetzt wurden. Paradoxerweise hat sich dort, wo die Angriffe am wenigsten stark waren, wie z.B. in Frankreich, die Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse am massivsten manifestiert - mit der Bewegung gegen die Rentenreform im Herbst 2010.
Eine neue Dynamik in der “Peripherie”
11. Die massivsten Bewegungen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben, entfalteten sich nicht in den am höchsten industrialisierten Ländern, sondern in Ländern der Peripherie des Kapitalismus, vor allem in einigen Ländern der arabischen Welt wie in Tunesien und Ägypten. Dort war die herrschende Klasse, nachdem sie erst mit einer brutalen Repression geantwortete hatte, gezwungen, die Diktatoren abzusetzen. Diese Bewegungen waren nicht klassische Arbeiterkämpfe, wie sie sich in diesen Ländern kurz zuvor ereignet hatten (z.B. die Arbeitskämpfe in Gafsa in Tunesien 2009 oder die massiven Streiks in der ägyptischen Textilindustrie während des Sommers 2007, die eine große Solidarität von anderen Sektoren erhielten). Sie haben oft die Form sozialer Revolten angenommen, in denen sich verschiedenste Teile der Gesellschaft wiederfanden: Beschäftigte des Staates und der Privatwirtschaft, Arbeitslose, aber auch Kleinhändler und Bauern und Freiberufliche, die Jugend usw. Aus diesem Grund ist die Arbeiterklasse über die meiste Zeit hinweg nicht direkt als solche erkennbar aufgetreten (wie zum Beispiel in den Streiks in Ägypten in der Endphase der Revolte) und konnte noch weniger eine führende Rolle einnehmen. Dennoch ist der Ursprung dieser Revolten (was sich in vielen Forderungen widerspiegelte) derselbe wie derjenige von Arbeiterkämpfen in anderen Ländern: die dramatische Zuspitzung der Krise und die zunehmende Misere, welche innerhalb der gesamten nichtausbeutenden Bevölkerung um sich greift. Wenn die Arbeiterklasse in diesen Kämpfen im arabischen Raum im Allgemeinen nicht als Klasse aufgetreten ist, so war ihr Einfluss in den Ländern, in denen sie ein stärkeres Gewicht hat, dennoch spürbar. Dies vor allem durch die Atmosphäre einer großen Solidarität in den Revolten und die Fähigkeit, Fallen von blinder und verzweifelter Gewalt zu vermeiden, auch dann, wenn sie mit einer starken Repression konfrontiert waren. Wenn schlussendlich die herrschende Klasse in Tunesien und Ägypten auf den Ratschlag der USA hin die alten Diktatoren über die Klinge springen ließ, so geschah dies weitgehend wegen der starken Präsenz der Arbeiterklasse in diesen Bewegungen. Beweis dafür ist die Entwicklung der Bewegung in Libyen: nicht die Absetzung des alten Diktators Ghaddafi, sondern eine militärische Konfrontation zwischen bürgerlichen Cliquen, in der die Ausgebeuteten als Kanonenfutter dienen. In Libyen ist ein großer Teil der Arbeiterklasse aus eingewanderten Arbeitern zusammengesetzt (aus Ägypten, Tunesien, China, Schwarzafrika, Bengalen), deren überwiegende Reaktion die Flucht vor der blindwütigen Repression war, welche in den ersten Tagen entfesselt wurde.
Das Gewicht der Illusionen
12. Das militärische Resultat der Ereignisse in Libyen durch das Eingreifen der NATO in den Konflikt erlaubte es der herrschenden Klasse, Kampagnen der Verschleierung gegenüber der Arbeiterklasse der fortgeschrittenen Länder vom Stapel zu reißen, deren spontane Reaktion die Solidarität und das Begrüßen des Mutes und der Entschlossenheit der Demonstranten in Tunis und Kairo war. Vor allem die massive Präsenz der gut ausgebildeten Jugend, welche mit einer Zukunft in Arbeitslosigkeit und Armut konfrontiert ist, ist ein Echo auf die kürzlich erfolgten Bewegungen der jungen Generation in verschiedenen europäischen Ländern: die Bewegung gegen das CPE-Gesetz in Frankreich im Frühling 2006, Revolten und Streiks in Griechenland Ende 2008, Demonstrationen und Streiks in den Hochschulen und Universitäten in Großbritannien Ende 2010, Studentenbewegungen in Italien und in den USA 2009-2010, usw. Die Kampagnen der herrschenden Klasse, welche darauf abzielen, die Bedeutung der Revolten in Tunesien und Ägypten zu verwischen, werden erleichtert durch die großen demokratischen Illusionen, die tatsächlich noch auf der Arbeiterklasse in diesen Ländern lasten: Nationalismus, demokratische und vor allem gewerkschaftliche Illusionen, ähnlich wie es 1980-81 im Kampf der Arbeiterklasse in Polen der Fall war.
Die Rolle des Proletariats in Europa und den USA
13. Vor 30 Jahren sah sich die IKS angesichts dieser Bewegung in Polen gezwungen, eine kritische Analyse gegenüber der Theorie des "Schwächsten Gliedes", welche vor allem von Lenin in der Zeit der Russischen Revolution vertreten wurde, zu formulieren. Damals argumentierte die IKS auf der Basis der Positionen, die von Marx und Engels entwickelt wurden, dass der Funke zur proletarischen Revolution vor allem in den zentralen Ländern des Kapitalismus entspringen wird. Dies aufgrund der großen Konzentration der Arbeiterklasse in diesen Ländern und vor allem aufgrund ihrer historischen Erfahrung, welche sie eher in die Lage versetzt, von der herrschenden Klasse gestellte ideologische Fallen zu durchschauen. Einer der wichtigsten Schritte für die weltweite Arbeiterklasse in der Zukunft wird nicht nur die Entfaltung massiver Kämpfe in den zentralen Ländern Westeuropas sein, sondern auch die Fähigkeit, die demokratischen und gewerkschaftlichen Fallen zu vermeiden, indem sie den Kampf in die eigenen Hände nimmt. Diese Bewegungen werden für die weltweite Arbeiterklasse ein Orientierungspunkt sein, einschließlich für die Arbeiterklasse im mächtigsten kapitalistischen Land, den USA, wo das Abgleiten in die zunehmende Armut, das schon heute Millionen von Beschäftigten betrifft, den "amerikanischen Traum" in einen Albtraum verwandelt hat.
14. Die Bewegung im Herbst 2010 gegen die Rentenreform in Frankreich, in einem Land, in dem das Proletariat seit dem Mai 1968 als eine Art Bezugspunkt für viele Arbeiter in anderen europäischen Ländern gilt, hat gezeigt, dass wir noch ein weites Stück entfernt sind von einer Überwindung der gewerkschaftlichen Kontrolle und dem eigenen in die Hände Nehmen der Kämpfe. Dies wurde noch deutlicher ersichtlich während den massiven „Mobilisierungen“ der britischen Gewerkschaften gegen die Sparpläne der Cameron-Regierung im März 2011. Dennoch, die Tatsache, dass innerhalb dieser Bewegungen gegen die Rentenreform in Frankreich trotz des allgegenwärtigen Klammergriffs von Intersyndical sich in verschiedenen Städten eine Anzahl von „überberuflichen Vollversammlungen“ bildete, ist Ausdruck des Willens der Arbeiterklasse, auf die gewerkschaftliche Umklammerung zu reagieren und selbst eine direkte Kontrolle mittels für alle offenstehende Vollversammlungen zu suchen und damit die berufliche Aufsplitterung zu überwinden. Es ist ein Anzeichen, dass die Arbeiterklasse beginnt, den Weg in Richtung dieser wesentlichen Etappe einzuschlagen. Überdies sind die in der letzten Zeit ausgebrochenen Kämpfe in peripheren Ländern Zeichen für die Entwicklung einer Situation, in der in der Zukunft entscheidende Kämpfe in den zentralen Ländern sofort Signal für die weltweite Ausbreitung der Bewegung der Arbeiterklasse sein können. Die Krise erschüttert die Arbeiterklasse auf der ganzen Welt mit enormer Brutalität. Wie auch immer die Fallen der herrschenden Klasse aussehen werden, wie heftig auch immer das Zögern der Arbeiterklasse angesichts der bevorstehenden Aufgaben sein wird, das Proletariat ist gezwungen, immer massiver und bewusster zu kämpfen - und es ist die Aufgabe der Revolutionäre, sich an diesen Kämpfen in entschlossener Art und Weise zu beteiligen. Das Proletariat soll fähig werden, seine historische Aufgabe zu erfüllen: die Überwindung des Kapitalismus mit all seiner Barbarei, der Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft, der Weg der Menschheit aus dem Reich der Notwendigkeit in dasjenige der Freiheit.
Mai 2011
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Bin Laden [268]
Tod durch Kredit
- 4327 Aufrufe
Als entscheidendes Argument zur Begründung optimistischer Zahlen werden immer wieder die Aktien genannt, deren Kurse steigen und steigen… Aber kündigt dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels wirklich einen Aufschwung an? Ist es nicht viel mehr die klassische Halluzination eines Dahinsiechenden?
Misere, Misere
In den USA, so wird behauptet, gehe es langsam wieder aufwärts. Das Schreckgespenst des Krachs von 1929 sei verschwunden. Die endlos langen Warteschlangen vor den Arbeitsämtern in den scheußlichen Zeiten der großen Depression der 1930er Jahre werde man nicht mehr antreffen. Ende März kündigte McDonals gar die außergewöhnliche Neueinstellung von 50.000 Leuten an einem Tag an. Am 19. April, dem schicksalhaften Tag, standen dann ca. Drei Millionen Jobbewerber Schlange vor den Restaurants, um einen der Jobs zu ergattern!
Die Wirklichkeit der gegenwärtigen Krise wird so anhand des Leidens, das der Arbeiterklasse zugefügt wird, deutlich. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist zwar offiziell rückläufig, aber die staatlichen Statistiken sind ohnehin nur ein gewaltiges Täuschungsmanöver. So berücksichtigt man beispielsweise bei der Arbeitslosenstatistik gar nicht mehr die sogenannten NLF („Not in the Labor Force“, die Nichtaktiven). Dabei handelt es sich um ältere Arbeitslose Beschäftigte, entmutigte Arbeitslose, Studenten und Jugendliche, Arbeitslose, die selbst nach einem Job suchen… im Januar betrug diese Zahl 85.2 Millionen! Der Staat selbst muss eingestehen, dass die Zahl der Armen, die mittlerweile mit 15% der Bevölkerung angegeben wird, ständig steigt.
Die Explosion der Verarmung in der weltweiten führenden Macht wirft ein entsprechendes Licht auf die Weltwirtschaft. In allen Kontinenten werden die Lebensbedingungen immer unmenschlicher. Schätzungen der Weltbank zufolge leben jetzt schon 1,2 Milliarden Menschen unter der Armutsgrenze (1,25 Dollar pro Tag). Aber die Zukunft sieht noch düsterer aus. Für einen wachsenden Teil der Bevölkerung bedeutet die steigende Inflation, dass es immer schwieriger für sie wird, ein Dach über dem Kopf zu finden oder sich zu ernähren. Die Lebensmittelpreise sind im Vergleich zum Vorjahr um 36% gestiegen. Dabei lässt den Aussagen von Food Price Watch zufolge, einem Institut der Weltbank, eine 10%ige Preiserhöhung mindestens 10 Millionen Menschen zusätzlich unter die extreme Armutsgrenze sinken. So sind diesen Berechnungen zufolge allein seit Juni 2010 ca. 44 Millionen Menschen zusätzlich in die Armut gerutscht. Konkret werden immer mehr lebenswichtige Güter unerschwinglich: innerhalb eines Jahres ist der Maispreis um 74%, der Weizenpreis um 69% gestiegen, der für Soja um 36%, Zucker um 21% usw.
Ein neues Kapitel der historischen Krise des Kapitalismus hat angefangen
Seit dem Sommer 2007 und dem Platzen der sog. Immobilienblase in den USA hat sich die Weltwirtschaftskrise weiter zugespitzt; ihr Rhythmus hat sich beschleunigt, ohne dass die Herrschenden auch nur einen Lösungsansatz gefunden hätten. Schlimmer noch, ihre verzweifelten Versuche der Begrenzung des Übels bereiten in Wirklichkeit nur neue Beben vor. Die Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren sieht wie eine endlose Spirale aus, ein Strudel, der alles nach unten zieht. Dieses Drama hat sich in den letzten 40 Jahren angebahnt. Seit dem Ende der 1960 Jahre bis zum berühmt berüchtigten Sommer 2007 hat die Weltwirtschaft nur überlebt dank der systematischen und wachsenden Verschuldung. Warum? Wir müssen einen kurzen theoretischen Schwenk machen.
Der Kapitalismus produziert immer mehr Waren als der Markt absorbieren kann. Es handelt sich fast um eine Tautologie: Das Kapital beutet seine ArbeiterInnen aus (oder anders gesagt, ihre Löhne liegen unter dem Wert dessen, was sie durch ihre Arbeit schaffen). Somit kann das Kapital die hergestellten Waren mit Gewinn verkaufen. Aber die Frage lautet: an wen kann es verkaufen? Natürlich kaufen die ArbeiterInnen diese Waren – in dem Umfang der ihnen zur Verfügung stehenden Kaufkraft. Aber sie alleine können nicht all die Waren kaufen, die den erzeugten Mehrwert verkörpern. Das würde keinen Sinn machen. Das Kapital kann nicht, um Profit zu machen, seine eigenen Waren aufkaufen; so als ob man Geld aus der linken Tasche nähme, um es in die rechte Tasche zu stecken. So könnte sich niemand bereichern, die Armen können das bestätigen.
Um zu akkumulieren, um sich zu entfalten muss das Kapital also andere Käufer finden als die ArbeiterInnen und die Kapitalisten. Mit anderen Worten - es muss Absatzmärkte außerhalb seines Systems finden, sonst steht es vor einem Berg unverkäuflicher Waren, die den Markt überfüllen – dann entsteht die berühmte „Überproduktionskrise“!
Dieser innere Widerspruch (die natürliche Tendenz zur Überproduktion und der Zwang, unaufhörlich äußere Absatzmärkte zu finden), ist auch eine der Wurzeln dieser unglaublichen Dynamik dieses Systems. Der Kapitalismus musste deshalb den Handel mit allen Wirtschaftsbereichen aufnehmen: den alten herrschenden Klassen, den Bauern und Handwerkern auf der ganzen Welt. Die Geschichte des ausklingenden 18. Jahrhunderts und des 19. Jahrhunderts war die der Kolonisierung, der Eroberung der Welt durch den Kapitalismus! Die herrschende Klasse dürstete nach neuen Gebieten, in denen sie die Bevölkerung mit verschiedenen Mitteln zwang, ihre Produkte zu erwerben. Aber dadurch verwandelte sie auch diese Naturalwirtschaften; sie integrierte sie schrittweise in ihr System. Die Kolonien wurden langsam auch zu kapitalistisch dominierten Gebieten, die anfingen, nach den Gesetzen dieses Systems zu produzieren. Somit war die Wirtschaft in diesen Ländern immer weniger in der Lage, die Waren Europas und der USA aufzunehmen, sondern dort entstand selbst eine Überproduktion. Das Kapital musste für seine Entwicklung unaufhörlich immer neue Absatzmärkte entdecken.
Das hätte zu einer endlosen Geschichte werden können, aber unsere Erde ist halt eine runde Kugel. Pech für das Kapital, dass es den Erdball innerhalb von 150 Jahren erobert hat. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren alle Gebiete erobert; die großen Mächte des Kapitalismus haben die Welt unter sich aufgeteilt. Dann war es nicht mehr möglich, neue Gebiete zu entdecken, sondern jetzt ging es darum, den Konkurrenten deren Gebiete mit Gewalt zu entreißen. Deutschland, das Land mit den wenigsten Kolonien, musste die aggressivste Rolle einnehmen und den Ersten Weltkrieg auslösen aufgrund der Notwendigkeit, die Hitler später bei der Vorbereitung des 2. Weltkrieges deutlich formulierte : Exportieren oder krepieren! Nach 150 Jahren Expansion trat das System in seinen Niedergang ein. Der Horror der beiden Weltkriege und der großen Depression der 1930er Jahre waren unwiderlegbare, dramatische Beweise dieses Niedergangs.
Aber selbst nach der Zerstörung der noch vorhandenen außerkapitalistischen Märkte in den 1950er Jahren (wie z.B. die Bauernschaft in Frankreich) versank der Kapitalismus nicht in einer tödlichen Überproduktionskrise. Warum? Damit kehren wir zu unserem Anfangsgedanken zurück, den wir erläutern wollten: „Der Kapitalismus produziert immer mehr Waren als der Markt absorbieren kann.“ Er musste einen künstlichen Markt schaffen: Von Ende der 1960er Jahre an bis zum berüchtigten Jahr 2007 hat die Weltwirtschaft nur dank des systematischen und wachsenden Rückgriffs auf die Verschuldung überleben können.
So kann man die letzten 40 Jahre als eine Reihe von Rezessionen und Wiederankurbelungen zusammenfassen, die durch Schuldenaufnahme finanziert wurden. Bei jeder offenen Krise musste das Kapital immer massiver auf die Verschuldung zurückgreifen. Dabei geht es nicht nur um die Verschuldung der Privathaushalte mittels staatlicher Kreditspritzen; nein die Staaten selbst haben sich verschuldet, um die Wettbewerbsfähigkeit des jeweiligen nationalen Kapitals gegen die Rivalen künstlich aufrechtzuerhalten (indem z.B. direkt in die Infrastruktur investiert wurde, Banken zu niedrigen Zinsen Kredite aufnehmen konnten, damit diese wiederum den Unternehmen und Privathaushalten günstig Kredite einräumen konnten…). Kurzum indem der Kredithahn weit aufgedreht wurde, floss das Geld in Strömen; Schritt für Schritt standen dann aber alle Branchen der Wirtschaft vor der klassischen Überverschuldung. Jeden Tag mussten mehr Schulden aufgenommen werden… um die Altschulden zu begleichen. Diese Dynamik führte notwendigerweise in eine Sackgasse.
Im Sommer 2007 begann ein neues Kapitel der Geschichte des Niedergangs. Die Herrschenden auf der Welt sind nicht mehr dazu in der Lage, die Zuspitzung der Krise zu verlangsamen, indem man immer massiver zur Kreditspritze greift. Heute kommt es zu immer mehr Erschütterungen, ohne eine wirkliche Atempause oder einen Aufschwung in den Zwischenphasen. Die Unfähigkeit der Herrschenden gegenüber der neuen Lage sticht immer mehr ins Auge. Nach dem Platzen der Blase der „Subprimes“ 2007 und 2008 mit dem Bankrott des Bankenriesens Lehman Brothers konnten alle Staaten der Welt nur eins tun: die Finanzwelt mit Liquidität versorgen, auch wenn dadurch die öffentliche Verschuldung explodierte. Aber das war kein einmaliges, begrenztes Einschreiten. Seit 2007 überleben die Weltwirtschaft, die Banken und die Börsen nur dank der ständigen Transfusion von öffentlichen Geldern, die durch Neuverschuldung oder das Ankurbeln der Notenpresse zur Verfügung gestellt werden. Nur ein Beispiel: die USA. Um 2008 den Bankensektor vor dem allgemeinen Bankrott zu retten, beschloss die Fed einen ersten Plan zum Aufkauf von Aktivvermögen (QE 1 = Quantitative Easing1); er hatte einen Umfang von mehr als 1400 Milliarden Dollar. Zwei Jahre später, im Januar 2010, musste ein zweiter Rettungsplan erstellt werden – QE 2: Ca. 600 Milliarden Dollar wurden in die Wirtschaft gepumpt, indem man einfach mehr Geldscheine druckte. Aber das reichte immer noch nicht. Kaum sechs Monate später, im Sommer 2010, musste die Fed erneut fällige Schuldtitel zum Preis von 35 Milliarden Dollar pro Monat aufkaufen. Damit hat die Fed seit dem Beginn der Krise ca. 2300 Milliarden Dollar ausgegeben. Dies entspricht dem BIP eines Landes wie Brasilien oder Italien! Aber damit war die Sache nicht ausgestanden. Im Sommer 2011 muss die Fed einen neuen Plan, QE3 verabschieden, dem ein QE4 folgen wird[1]...
Die Wirtschaft ist zu einem Fass ohne Boden geworden, oder eher ein schwarzes Loch. Sie saugt immer astronomische Massen an Schulden auf…
Die Zukunft : Inflation und Rezession!
Aber es wäre falsch zu behaupten, dass die gewaltigen Kreditspritzen, die heute von allen Staaten verwendet werden, keine Wirkung zeigen würden. Sie haben eine doppelte Wirkung. Ohne sie würde die Wirtschaft sprichwörtlich zusammenbrechen. Aber gleichzeitig bewirkt die bislang nie dagewesene Zunahme der Geldmenge weltweit, insbesondere das Aufblähen der Dollarmengen, eine Untergrabung des Systems; sie wirkt wie ein Gift. Der Kapitalismus ist wie ein todgeweihter Kranker, der von seiner Morphinspritze abhängt. Ohne diese stirbt er; aber jede neue Dosis schwächt ihn noch ein wenig mehr. Während die Kreditspritzen von 1967-2007 der Wirtschaft ermöglicht haben, sich über Wasser zu halten, beschleunigen dagegen die jetzt notwendigen Dosen ihren Zusammenbruch.
Indem die Notenpresse angekurbelt wird, produzieren die verschiedenen Zentralbanken das, was die Ökonomen wertloses Geld nennen. Wenn die Geldmenge schneller wächst als die Wirtschaft, verliert diese an Wert. Infolge dessen steigen die Preise; die Inflation zieht an[2]… Natürlich sind die USA in diesem Bereich Sieger aller Klassen! Sie wissen, dass ihre Währung der Pfeiler der wirtschaftlichen Stabilität seit dem Ende des 2. Weltkriegs ist. Auch heute noch kann niemand ohne Dollars auskommen. Deshalb haben die USA seit 2007 die größte bislang dagewesene Geldmenge in Umlauf gebracht, um ihre Wirtschaft zu stützen. Der Dollar ist deshalb noch nicht zusammengebrochen, weil China, Japan usw. gegen ihren Willen dazu gezwungen waren, Dollars zu erwerben. Aber dieses prekäre Gleichgewicht neigt auch seinem Ende zu. Es gibt immer weniger Käufer für US-Staatsanleihen (T-Bonds), denn jeder weiß, dass diese in Wirklichkeit nichts wert sind. Seit 2010 kauft die Fed selbst ihre eigenen T-Bonds auf, um deren Wert künstlich hochzuhalten! Und in den USA hat die Inflation auch stark angezogen (je nach Quelle zwischen 2% und 10%; der höhere Wert ist der wahrscheinlichere, jedenfalls ist es die von den ArbeiternInnen beim Einkaufen gefühlte Inflation). Der Präsident der Fed in Dallas, Richard Fisher, der dieses Jahr Mitglied im Komitee der Währungspolitik ist, warnte jüngst vor der Gefahr der Hyperinflation, die ein Ausmaß wie die Inflation 1923 in der Weimarer Republik annehmen könnte.
Hierbei handelt es sich nur um eine grundlegende Tendenz; die Inflation breitet sich mittlerweile in allen Ländern aus. Und das Misstrauen der Kapitalisten gegenüber allen Währungen nimmt immer mehr zu. Die zukünftigen Erschütterungen, die wahrscheinlichen Pleiten von großen Unternehmen, Banken, gar Staaten rufen große Unsicherheit hervor hinsichtlich des Verhaltens der internationalen Währungsmärkte. Die Konsequenzen werden ersichtlich: Die Goldpreise explodieren. Nach einem Anstieg des Goldpreises von 29% 2010 steigt dessen Preis immer weiter an, zum ersten Mal wird die magische Marke von 1500 Dollar übertroffen; dies ist fünfmal mehr als vor 10 Jahren. Und auch der Silberpreis hat den höchsten Preis seit 31 Jahren erreicht. Die Universität von Texas, an der Ökonomen ausgebildet werden, hat neulich ihre Reserven (es soll sich um eine Milliarde Dollar handeln) in Gold angelegt. Hier kann man erkennen, wie viel Vertrauen die Herrschenden in den USA in ihrer eigenen Währung haben! Und dies ist keine Begleiterscheinung…. Die Zentralbanken selbst haben 2010 mehr Gold gekauft als sie verkauften; dies geschah zum ersten Mal seit 1988. Dies ist der jüngste Schritt bei der Beerdigung des Abkommens von Bretton Woods (nicht offiziell aber in Wirklichkeit), in dem nach dem 2. Weltkrieg ein an die Stabilität des Dollars gebundenes internationales Währungssystem beschlossen worden war.
Die Herrschenden sind sich natürlich dieser Gefahren bewusst. Unfähig, den Kredithahn zuzudrehen und die Notenpresse anzuhalten, versuchen sie eine Schadens- und Schuldenbegrenzung, indem sie drastische Sparmaßnahmen auf Kosten der Arbeiterklasse durchzusetzen versuchen. Fast überall werden die Löhne der Beschäftigen in der Privatindustrie und der Staatsangestellten eingefroren oder gekürzt; die Sozialhilfen oder Ausgaben im Gesundheitswesen werden gekürzt, kurzum die Armut nimmt weiter zu. In den USA hat Obama einen Kürzungsplan von 4000 Milliarden Dollar für die nächsten 12 Jahre angekündigt. Die damit verbundenen Opfer für die Bevölkerung sind unvorstellbar. Aber dies stellt in Wirklichkeit gar keine Lösung dar. In Griechenland, Portugal, Irland, Spanien usw. wird ein Sparpaket nach dem anderen verabschiedet, aber die Defizite steigen weiter an. Die einzige Wirkung dieser Politik besteht darin, dass die Wirtschaft noch mehr in die Rezession rutscht. Für diese Dynamik gibt es nur einen Ausweg: nach dem Bankrott der US-Haushalte 2007, der Banken 2008 rutschen die Staaten immer mehr in den Staatsbankrott ab. Man darf sich keine Illusionen machen; die Zahlungsunfähigkeit z.B. Griechenlands lässt sich nicht ewig weiter aufschieben. Aber selbst amerikanische Bundesstaaten wie Kalifornien werden davon nicht verschont bleiben.
Es ist unmöglich irgendwelche Daten ins Auge zu fassen und genau zu wissen, wo und wann die Weltwirtschaft platzen wird. Könnte die Katastrophe, von der Japan erfasst worden ist (die Wirtschaftsleistung der drittgrößten Wirtschaftsmacht der Erde ist im März um 15% gesunken), der Auslöser sein? Oder welche Rolle spielen die Erschütterungen im Nahen und Mittleren Osten? Was ist mit dem Zusammenbruch des Dollars oder dem Staatsbankrott Griechenlands oder Spaniens? Niemand kann dies vorhersehen. Nur eins ist sicher: Wir stehen vor einer Reihe von äußerst brutalen Rezessionen! Nach der langsamen Entwicklung der Weltwirtschaftskrise von 1967-2007 stehen wir heute vor einem neuen Kapitel des Niedergangs des Kapitalismus, das von neuen, endlosen Erschütterungen des Systems und explodierender Armut gekennzeichnet sein wird. Pawel, 30.04.2011.
[1] Aber sie werden es dieses Mal sicher tun, ohne es offiziell zu verkünden, um nicht das Scheitern all der vorherigen Maßnahmen einzugestehen!
[2] Pedantische Leser werden sagen: „aber die Geldmenge ist zwischen 1990-2000 auch gewaltig gewachsen, ohne dass es zu einem Inflationsschub kam“. Das stimmt, der Grund dafür liegt darin: die Sättigung der wirklichen Märkte hat das Kapital dazu gezwungen, in die virtuelle Wirtschaft zu flüchten (Aktien). Mit anderen Worten: die Geldmenge stieg beträchtlich an, vor allem im Finanzsektor; nicht die Preise der produzierten Güter sind so stark gestiegen, sondern vor allem die Aktienkurse. Aber diese Spekulation, so verrückt und losgelöst sie auch von der Wirklichkeit ist, fußt letzten Endes auf Betriebe, die einen echten Wert herstellen. Wenn diese massiv von Pleiten bedroht sind (insbesondere die Banken), wird diese Sache brenzlig. So war es beim Krach 2008, und so wird es in Zukunft sein. Deshalb flüchten übrigens die Anleger jetzt ins Gold und in die Spekulation mit Lebensmitteln; sie suchen Fluchtanlagen.
Aktuelles und Laufendes:
- Überproduktion [52]
- Währungskrieg [123]
- Inflationsgefahr [269]
- hyperinflation [270]
Vom Tahrir-Platz zur Puerta del Sol
- 3100 Aufrufe
Wie immer die Ereignisse in Spanien sich letzten Endes entwickeln werden und ungeachtet der Konfusionen oder Illusionen der Beteiligten, diese Ereignisse sind von historischer Bedeutung; sie stellen eine wichtige Stufe der Entwicklung des Klassenkampfes dar.
Ein Glied in der internationalen Kette von Klassenkämpfen
Es wird behauptet, die Ereignisse könnten anhand von vermeintlich nationalen Faktoren erklärt werden, die man als die berühmte „Spanische Revolution" umreißen könnte. Aber nichts ist falscher und irreführender als das. Die Enttäuschung über die sogenannte „politische Klasse" ist weltweit zu beobachten; es gibt kaum ein Land auf der Welt, wo die Menschen noch Vertrauen in ihre „Repräsentanten" haben; das triff sowohl auf die im Wahlzirkus „gewählten" als auch auf die diktatorisch auferzwungenen zu. Die als weitere mögliche Erklärung angeführte Korruption[1] ist ebenso auf der ganzen Welt anzutreffen; sie ist mehr oder weniger stark in allen Ländern vorhanden. Aber diese Unterschiede sind der Baum, der uns daran hindert, den Wald zu sehen, nämlich das Phänomen des weltweiten und historischen Niedergangs und der Fäulnis des Kapitalismus.
Ein anderes, oft zu hörendes Argument ist die in Spanien massive, unter den Jugendlichen besonders hohe Arbeitslosigkeit. Ebenso wird immer auf die prekären Arbeitsverhältnisse verwiesen, auf die tiefen sozialen Einschnitte, die schon eingeleitet wurden oder für nach den Wahlen angesagt sind.
All das ist aber nicht typisch Spanisch. Wir sehen das Gleiche nicht nur in Griechenland, Irland oder Portugal, sondern auch in den USA und Großbritannien. Auch wenn es stimmt, dass diese Angriffe gegen die Arbeiterklasse und die große Mehrheit der Bevölkerung in den jeweiligen Ländern in unterschiedlichem Maße durchgeführt werden, verschärft der Kapitalismus ständig die Ungleichheit und schafft unaufhörlich Neid. Es ist eine Sackgasse, sich auf Vergleiche einzulassen wie „X ist weniger arm als Y", denn in Wirklichkeit werden wir alle immer ärmer.
Die finstere Fratze der Arbeitslosigkeit - sie ist sowohl in Madrid als auch in Kairo, in London wie in Paris, in Athen wie in Buenos Aires zu sehen. Deshalb ist es absurd und sinnlos, unaufhörlich nach Unterschieden zu suchen; in Wirklichkeit geht es darum das zu sehen, was uns vereint und was wir generalisieren können. Jetzt sieht man immer offensichtlicher, dass sich die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Ausgebeuteten auf der Welt verschlechtern. Wir sind alle mit dem Problem konfrontiert, dass das System uns in den Abgrund stürzt; dies wird ersichtlich anhand der Arbeitslosigkeit, Inflation, Prekarität, der Abschaffung von Sozialleistungen, der Zunahme von Nuklearkatastrophen, Kriegen und der Auflösung gesellschaftlicher Beziehungen, verbunden mit einer zunehmenden moralischen Barbarei.
Es ist offensichtlich, dass der Druck der herrschenden Ideologie versucht, die gegenwärtige Bewegung auf die „Spanische Revolution" auszurichten. Es stimmt, dass die Schwierigkeiten der Bewusstseinsentwicklung dazu führen, dass viele Beteiligte die Ereignisse durch diese Brille betrachten. Deshalb spürt man in den Versammlungen nur sehr selten ein Nachdenken über die weltweite Lage oder über die Lebensbedingungen des Großteils der ArbeiterInnen, der gewaltigen Mehrheit der Beschäftigten[2]....
Aber wie kann man von einem Glied in der internationalen Bewegung der Arbeiterklasse sprechen, wenn die meisten Beteiligten sich nicht als zugehörig zur Arbeiterklasse betrachten, obwohl sie ihr angehören, und der Begriff Arbeiterklasse in den Versammlungen kaum erwähnt wird?[3]
Verschiedene Faktoren sind für diese Schwierigkeit verantwortlich: die Arbeiterklasse leidet an einem Identitätsproblem und einem Mangel an Selbstvertrauen. Gleichzeitig beschränkt sich die allgemeine Unzufriedenheit nicht nur auf die Arbeiterklasse, sondern auf breite Schichten der unterdrückten und ausgebeuteten Bevölkerung, was sich in einer Proletarisierung kleinbürgerlicher und freiberuflicher gesellschaftlicher Schichten äußert.[4] All das führt dazu, dass die Bewegung bei oberflächlichem Betrachten als interklassistisch (zwischen den Klassen) erscheint, die sich chaotisch in einer Reihe von Fragestellungen verzettelt und sehr anfällig ist für demokratische Anbändelungsversuche.... Aber wenn man näher hinschaut, wird offensichtlich, dass die Bewegung ein Teil des internationalen Kampfes der Arbeiterklasse ist. Wir befinden uns in einem Prozess hin zu massiven Kämpfen, die dazu führen werden, dass die Arbeiterklasse wieder Selbstvertrauen in ihre eigene Kraft schöpft und sich als eigenständige gesellschaftliche Klasse auffassen wird, die dazu in der Lage ist, eine Alternative gegenüber dieser Gesellschaft aufzubauen, die sich immer mehr dem Abgrund nähert. Der tektonische Bruch, der sich von Frankreich 2006[5] nach Griechenland 2008[6] zog, um erneut 2010 in Frankreich[7] aufzutauchen, sich dann in Großbritannien 2010 und 2011 in Tunesien-Ägypten[8] fortsetzte, hat jetzt auch das Beben in Spanien ausgelöst. Die Grundlagen für große soziale Beben reifen heran, welche langfristig den schmerzhaften Weg freilegen werden für die Befreiung der Menschheit.
Die unmittelbaren Auslöser der Bewegung
Eine internationale und historische Analyse wird viel genauer, wenn wir die besonderen nationalen oder vorübergehenden Faktoren berücksichtigen. Gleichzeitig können wir niemals die Lage verstehen, wenn wir von diesen spezifischen Faktoren ausgehen. Die jüngste Bewegung wurde ausgelöst durch einen Protest „gegen die Politiker", sie wurde organisiert durch „Ja zur echten Demokratie". Die Demonstrationen am 15. Mai wurden zu einem spektakulären Erfolg: die allgemeine Unzufriedenheit, die Sorge über die fehlenden Perspektiven kamen in diesen Protesten zum Ausdruck.
Scheinbar war mit dem Ende des Protesttages alles vorbei, aber in Madrid und Granada ging die Polizei brutal gewalttätig gegen die Demonstranten vor; mehr als 20 Leute wurden verhaftet und auf den Polizeiwachen misshandelt. Die Verhafteten kamen schließlich in einer Versammlung zusammen und verfassten ein Kommuniqué[9], dessen Verbreitung einen großen Eindruck hinterließ und für gewaltige Empörung und Solidarität sorgte. Eine Gruppe Jugendlicher beschloss ein Zeltlager auf dem zentralen Platz Puerta del Sol in Madrid zu errichten. Ab dem darauffolgenden Montag wurde das Beispiel in Barcelona, Granada und Valencia aufgegriffen. Ein weiteres gewalttätiges Vorgehen der Repressionskräfte entzündete erneut die Gemüter; seitdem haben sich die Zeltlager auf mehr als 70 Städte ausgedehnt, der Zustrom von Leuten ist seitdem ständig gestiegen.
Der Dienstagnachmittag war ein entscheidender Moment. Die Organisatoren hatten Schweigeminuten oder sinnlose Spielszenen (die sogenannten „performances") vorgesehen, aber die Teilnehmer forderten lautstark die Abhaltung von Versammlungen. Am Dienstagabend um 20.00 h fanden schließlich Versammlungen in Madrid, Barcelona, Valencia und anderen Städten statt; ab Mittwoch kam es zu einer richtigen Lawine; das ganze verwandelte sich in offene Versammlungen.
Um auf ein Symbol verweisen zu können, nannte sich die Bewegung 15D (der demokratische 15. Mai). Aber in Wirklichkeit stellt dieser Bezug eine gewisse Fesselung dar, denn damit wird ein utopisches und mystifizierendes Ziel vorgegeben: die „demokratische Erneuerung" des spanischen Staates[10]. Die gewaltige soziale Unzufriedenheit soll in eine sogenannte „zweite Übergangszeit" kanalisiert werden. Nach 34 Jahren Demokratie ist der Großteil der Bevölkerung zutiefst enttäuscht; aber das „könne man erklären, denn wir haben bislang nur eine unvollkommene und begrenzte Demokratie erfahren", weil man einen Pakt mit den „intelligenten Teilen" des Franquismus eingehen musste; jetzt sei eine „zweite Übergangszeit" erforderlich, die uns eine „richtige Demokratie" bescheren werde.
Die Arbeiterklasse in Spanien ist gegenüber solchen Mystifikationen anfällig, da die Rechte in Spanien sehr autoritär, arrogant und unverantwortlich auftritt, womit die Glaubwürdigkeit der „wirklich existierenden Demokratie" untergraben wird. Aber indem das „Volk" aufgefordert wird, „gegen die Politiker zu rebellieren" und ein „Ja zur echten Demokratie" zu fordern, versuchen die Herrschenden zu verschleiern, dass dies die einzig mögliche Demokratie ist und es keine andere gibt.
Die Zapatero-Regierung ist nicht mit großem Fingerspitzengefühl gegenüber dieser explosiven Lage vorgegangen, wo mehr als 40% Jugendliche arbeitslos sind. Zapatero bezeichnete diejenigen, die es wagten, die „großen sozialen Errungenschaften" seiner Regierung infragezustellen, als „Schurken", was wiederum die Entschlossenheit vieler Jugendlicher verstärkt hat. Aber dahinter verbirgt sich etwas viel Tiefergehendes: die demokratische Trickkiste schlug als Alternative zur PSOE die PP vor, vor der sich jeder fürchtet, weil deren Arroganz, Brutalität und deren autoritären Reflexe wohl bekannt sind. Spanien ist nicht Großbritannien, wo Cameron - von den liberalen „Erneuerern" hofiert, vorher über einen viel besseren Ruf verfügte. In Spanien hat die PSOE immer die schlimmsten Angriffe gegen die Arbeiter in die Hand genommen; die Rechte hat zurecht den Ruf, der Feind der Arbeiterklasse und ein wilder Haufen korrupter Persönlichkeiten zu sein.[11]
Die große Mehrheit der Bevölkerung sieht mit Schrecken die Möglichkeit auf sich zukommen, dass den Schweinereien der sozialistischen "Freunde" nun noch größere Schweinereien - wenn überhaupt möglich - folgen werden, diesmal von den erklärten Feinden, der PP, ausgeheckt. Soweit zum Vertrauen in das Spiel der Demokratie und deren Wahlergebnisse. In Anbetracht solch unhaltbarer Verhältnisse und einer deprimierenden Zukunft sind die Leute auf die Straße gezogen. Ihre eigenen Konfusionen und Illusionen und das Gewicht der demokratischen Propaganda haben dazu geführt, dass der Vorschlag der Überwindung des Zweiparteiensystems in den Versammlungen auf großes Interesse stößt. Aber es handelt sich um eine unrealistische und rein verschleiernde Idee. Die spanische Parteienlandschaft ist streng auf ein Zweiparteiensystem aufgebaut; sie ist eine Fortsetzung des langen Zeitraums der Zweiparteienherrschaft Cánovas,[12] und wie die jüngsten Ergebnisse bei den Kommumal- und Gemeindewahlen zeigen, verstärkt sich diese Konstellation noch.[13]
Die Versammlungen - eine Waffe für die Zukunft
Aber gegenüber dieser Demokratie, die die „Beteiligung" darauf beschränkt, dass alle vier Jahre ein Politiker gewählt wird, welcher nie die Wahlversprechen einhält und immer ein „okultes" Programm ausführt, von dem vorher nie gesprochen wurde, hat die Bewegung in Spanien eine mächtige Waffe entdeckt, mit deren Hilfe die große Mehrheit der Bevölkerung sich vereinigen, denken und entscheiden kann: die verschiedenen Versammlungen in den Städten.
In der bürgerlichen Demokratie wird die Entscheidungsbefugnis einem bürokratischen Körper von Berufspolitikern übertragen, die wiederum den Befehlen ihrer Partei folgen, welche zu Verteidigern und Ausführenden der Interessen des Kapitals geworden sind. Im Gegensatz dazu wird die Entscheidungsbefugnis in den Versammlungen direkt durch die Beteiligten ausgeübt, die gemeinsam nachdenken, diskutieren und entscheiden. Sie organisieren sich selbst, um die Entscheidungen in die Praxis umzusetzen.
In der bürgerlichen Demokratie wird die Atomisierung des Einzelnen verfestigt, die Konkurrenz institutionalisiert und eine Haltung des Rückzugs des "jeder für sich" begünstigt. In den Versammlungen dagegen kann ein gemeinsames Nachdenken entstehen; alle können ihr bestmögliches beitragen, alle können die Stärke und die gemeinsame Solidarität fühlen. Es entsteht ein Raum, wo man einen Gegenpol gegen die Spaltung und die Auswirkungen der kapitalistischen Gesellschaft schafft und die Grundlagen einer neuen Gesellschaft legt, die sich auf die Abschaffung der Ausbeutung und der Klassen stützen wird und aus der schließlich eine neue menschliche Weltgemeinschaft hervorgehen wird.
Während die bürgerliche Demokratie sicherlich einen unleugbaren Fortschritt gegenüber der absoluten Macht der Monarchen darstellte, hat die Entwicklung des Staates seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bewirkt, dass die Macht in den Händen eines Zusammenschlusses zwischen dem, was man politische Klasse nennt, und den großen führenden wirtschaftlichen und Finanzmächten, d.h. dem Kapital ingesamt, gehalten wird. Auch wenn noch so viele offene Listen aufgestellt und das Zweiparteiensystem geschminkt wird, die Macht liegt immer in den Händen dieser privilegierten Minderheit. Sie wird dabei noch absoluter und diktatorischer ausgeübt als es der absolutistischste der feudalen Monarchen tun könnte. Aber im Gegensatz zu diesen wird die Diktatur des Kapitals regelmäßig durch das Wahlspektaktel abgesegnet.
Die Versammlungen kreuzen sich mit der Arbeitertradition der Arbeiterräte 1905 und 1917,[14] die sich damals während der revolutionären Welle von Kämpfen 1917-23 auf Deutschland und andere Länder ausdehnten. Später sind diese oder ähnliche Strukturen dann in Ungarn 1956 oder in Polen 1980 aufgetaucht. Wie unerträglich ist dagegen die Atmosphäre in einem Wahllokal, wo die „Bürger" schweigsam zusammenkommen, ihre Pflicht der Stimmenabgabe erfüllen, ohne davon überzeugt zu sein; man empfindet ein gewisses Schuldgefühl, weil man immer für den „Falschen" stimmt. Und wie erregend anders ist dagegen die Atmosphäre, die man in diesen Tagen in den Versammlungen erleben konnte! Man spürt einen großen Enthusiasmus und eine enorme Lust, sich an den Aktivitäten zu beteiligen. Viele Leute ergreifen das Wort und werfen alle möglichen Fragen auf. Sobald die Versammlungen zu Ende gegangen sind, trifft man sich in Kommissionen, die sich oft den ganzen Tag lang treffen. Man stellt Kontakte her, lernt Leute kennen, denkt laut nach, überprüft von neuem alle Aspekte des politischen, gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Man merkt, dass man sprechen kann, dass alle Fragen gemeinsam angegangen werden... Auf den besetzten Plätzen werden Bibliotheken errichtet. Ein besonderer Ort wird geschaffen, wo man Referate hält zu allen möglichen Themen - wissenschaftliche wie kulturelle, künstlichere, politische oder wirtschaftliche. Es werde Solidaritätsgefühle geäußert, man hört einander aufmerksam zu, ohne dass irgendjemand irgendwelchen Unfug faselt; ein Raum wird geschaffen für allgemeine Empathie. Auch wenn noch schüchtern, es entsteht dennoch eine massive Debattenkultur;[15] man denkt über viele Themen nach, greift verschiedene Ideen auf. Man hat den Eindruck, als ob die Teilnehmer ihre Gedanken, ihre Gefühle der Öffentlichkeit vortragen wollen, die sie zuvor lange Zeit in der Einsamkeit der Atomisierung durchgekaut haben. Auf den Plätzen strömt eine gewaltige und kollketive Flut von Ideen zusammen; der Masse gelingt es, ihr Bestes und Tiefstes zum Ausdruck zu bringen. Diese anonyme Masse von Leuten, die angeblich die Verlierer dieser Gesellschaft sind, birgt in sich intellektuelle Fähigkeiten, aktive Gefühle, unerwartete gewaltige und tiefgreifende soziale Emotionen.
Die Leute fühlen sich befreit und genießen leidenschaftlich das große Vergnügen, gemeinsam diskutieren zu können. Allem Anschein nach scheint der Strom an Gedanken zu keinem konkreten Punkt zu gelangen. Es werden keine konkreten Vorschläge gemacht. Aber das ist nicht unbedingt eine Schwäche. Nach vielen Jahren erdrückenden kapitalistischen Alltags, in dem der Großteil der Menschen unter der Diktatur der Verachtung, den höchst entfremdeten Routinen, den schädlichsten Schuldgefühlen, der Frustration und Atomisierung gelitten hat, ist eine erste Etappe der chaotischen Explosion unvermeidlich.
Es gibt keine andere Art, keine anderen Mittel, damit sich die Gedanken des Großteils der Bevölkerung äußern. Dieser Weg ist unerlässlich. Auf den ersten Blick scheint er nirgendwohin zu führen, bevor alles sich selbst umwälzt und das gesellschaftliche Panorama insgesamt umgewälzt wird.
Die Organisatoren haben immer wieder demokratische und nationalistische Orientierungen eingebracht. Zum Teil spiegeln diese die Illusionen und Verwirrungen wider, die noch in den Köpfen der meisten Menschen stecken, aber gleichzeitig merkt man anhand der Gedanken vieler Teilnehmer, dass sie in anderen Richtungen suchen. So ist zum Beispiel in Madrid ein Slogan ziemlich populär geworden: „Alle Macht den Versammlungen", oder „Arbeitslos, obdachlos, furchtlos", „Das Problem ist nicht die Demokratie, das Problem ist der Kapitalismus". „ArbeiterInnen - wacht auf!". In Valencia sagten einige Frauen: „Unsere Großeltern wurden getäuscht, unsere Kinder wurden in die Irre geführt, unsere Enkel dürfen sich nicht verarschen lassen!" Oder „600 Euro pro Monat, das ist ein Gewaltverhältnis!"
In den Versammlungen hat es Debatten gegeben, die eine Art Spannungsverhältnis zwischen drei verschiedenen Betonungen zum Ausdruck brachten:
1. Soll man sich auf die demokratische Erneuerung beschränken,[16] oder sind die Probleme nicht im Kapitalismus verwurzelt, der keine Reformen mehr zulässt und deshalb überwunden werden muss?
2. Soll die Bewegung mit dem 22. Mai beendet werden, d.h. dem Wahltag, oder soll sie nicht im Gegenteil fortgesetzt werden, um massiv gegen die Kürzungspläne, die Arbeitslosigkeit, die prekären Verhältnisse, die Verzweiflung über die Perspektivlosigkeit anzukämpfen?
3. Sollten die Versammlungen nicht auf die Arbeitsplätze, die Betriebe, die Stadtviertel, die Arbeitsämter, Schulen und Universitäten ausgedehnt werden, damit sich die Bewegung in der Arbeiterklasse verwurzelt, die als einzige die Kraft und die Grundlagen besetzt, um einen generalisierten Kampf zu führen?
In den Versammlungen spürt man zwei "Stimmen": die demokratische Stimme, die eine konservative Bremse darstellte, und die proletarische Stimme, die danach strebt, die Probleme auf einer klassenmäßigen Ebene zu stellen.
Zuversichtlich in die Zukunft schauen
Die Versammlungen vom 22. Mai beschlossen hinsichtlich des zweiten Punktes die Fortsetzung der Bewegung. Viele Wortmeldungen sagten: „Wir sind nicht hier wegen der Wahlen, obgleich sie ein auslösender Faktor waren." Hinsichtlich des dritten Punktes äußerten sich mehrere: „Wir müssen zu den ArbeiternInnen gehen". Sie schlagen Forderungen vor, um gegen die Arbeitslosigkeit, die prekären Verhältnisse, die sozialen Einschnitte vorzugehen. Ebenso wurde beschlossen, die Versammlungen auf die Stadtviertel auszudehnen. Es werden schon Stimmen laut, die deren Ausdehnung auf die Betriebe, Universitäten und Arbeitsagenturen fordern... In Malaga, Barcelona und Valencia sind Demonstrationen gegen Sozialkürzungen vorgesehen, an einen neuen Generalstreik wird gedacht, der diesesmal ein „richtiger" sein soll, wie ein Redner meinte. Die Anfangsphase ist schon ein großer Erfolg der Bewegung. Sie zeigt, dass viele Ausgebeutete angefangen haben, Widerstand zu zeigen. Sie wollen „nicht mehr leben wie bislang". Die Empörung macht eine moralische Erneuerung nötig, einen kulturellen Wandel. Auch wenn manche Vorschläge ein wenig blauäugig oder seltsam erscheinen, sie spiegeln eine Begierde wider, die noch schüchtern und konfus zum Ausdruck kommt, „anders leben zu wollen".
Aber kann die Bewegung gleichzeitig auf dieser Ebene stehen bleiben, ohne konkrete Ziele zu formulieren?
Es ist schwierig darauf zu antworten. Zwei Bestrebungen ringen „geräuschlos" miteinander; sie sind ein Ausdruck der beiden erwähnten „Stimmen" der Demokratie und der Arbeiterklasse. Die Demokratie hat ihre Wurzeln in dem mangelnden Selbstvertrauen der Arbeiterklasse in ihre eigenen Fähigkeiten, in dem Gewicht der nicht-proletarischen, nicht ausbeutenden Schichten, in den Auswirkungen des gesellschaftlichen Zerfalls,[17] wodurch man sich an das Eingreifen eines „gerechtigkeitsliebenden" und „rechtstreuen" Staates klammert.
Der andere Weg, nämlich die Ausdehnung der Versammlungen auf die Betriebe, Arbeitsagenturen, Stadtviertel, der zu einer Polarisierung des Kampfes gegen die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit und die prekären Verhältnisse als Reaktion auf die unzähligen Angriffe gegen unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen führen würde, wird durch einen besonders kämpferischenTeil verkörpert. In Barcelona haben sich Beschäftigte der Telefongesellschaften, des Gesundheitswesens, Feuerwehrleute, Studenten, die alle gegen die Sozialkürzungen protestieren wollen, versammelt. Sie haben angefangen, eine andere Tonart anzuschlagen. Die zentrale Versammlung von Barcelona scheint dem Anliegen der demokratischen Erneuerung am weitesten entfernt gegenüberzustehen. Die zentrale Versammlung in Madrid hat zu Versammlungen in allen Stadtvierteln aufgerufen. In Valencia gab es einen Zusammenschluss mit einem Protestzug von Busfahrern sowie mit einer Demonstration von Bewohnern eines Stadtviertels, wo man Kürzungen im Bildungswesen vornehmen will. In Zaragoza haben sich die Busfahrer den Versammlungen mit großem Enthusiasmus angeschlossen.
Dieser zweite Weg bringt eine weitere Schwierigkeit mit sich. Die Gefahr, dass der Versuch der „Ausdehnung" der Bewegung zu ihrer Zersplitterung und zum Versickern in Forderungen für bestimmte Branchen oder Teile führt, ist real. Es handelt sich um einen wirklichen Widerspruch. Einerseits kann die Bewegung sich nur weiter entwickeln, wenn es ihr gelingt, die Arbeiterklasse als solche zumindest wachzurütteln oder sie gar zur Beteiligung an ihr zu gewinnen. Gleichzeitig wird solch eine Ausdehnung den Gewerkschaften die Gelegenheit bieten, auf den fahrenden Zug aufzuspringen und für Forderungen einzutreten, die die Bewegung auf Teilbereiche, auf Stadtviertel oder lokalistische Belange usw. begrenzen. Ohne diese Gefahr zu leugnen, muss man die Frage stellen: Bietet der Versuch - selbst wenn er scheitert - nicht die Möglichkeit, die Grundlagen für einen gemeinsamen Kampf zu schaffen, der uns später große Kraft verleiht?
Welchen Weg auch immer die Bewegung einschlagen wird, jetzt schon ist ihr Beitrag zum internationalen Kampf der Arbeiterklasse unleugbar:
- Es handelt sich um eine massive und breit gefächerte Bewegung, an der sich alle gesellschaftlichen Bereiche beteiligen;
- Auslöser ist kein konkreter Angriff wie seinerzeit in Frankreich oder in England, sondern die allgemeine Empörung über die Lage. Dies macht es schwerer, sich auf konkrete Forderungen zu konzentrieren, wodurch es wiederum schwerer fällt, ihren Charakter als Teil des Arbeiterkampfes zu erkennen.[18] Aber gleichzeitig wird dadurch ein deutliches Erwachen großer Bevölkerungsteile gegenüber den Problemen der Gesellschaft ersichtlich und damit Wege ihrer Polisierung erkennbar.
- In ihrem Mittelpunkt standen die Versammlungen.
Um die Ereignisse zu begreifen, müssen wir alte Schemen über Bord werfen. Die Russische Revolution 1905 brachte eine neue Art des Handelns der Massen zum Vorschein. Dies rief unter vielen Gewerkschaftsführern und sozialdemokratischen Führern Ratlosigkeit hervor und führte später gar zum Verrat einiger so wichtiger Theorektiker wie Kautsky und Plechanow, die sich verzweifelt an den alten Schemen des „systematischen Aufbaus eines Kräfteverhältnis mittels einer Gewerkschafts- und Parlamentsarbeit" festklammern wollten.[19]
Wir müssen solch eine Falle vermeiden. Die Ereignisse entwickeln sich aber nicht auf diese Weise; auch dürfen wir uns nicht an das Schema der Entwicklung der Kämpfe in den 1970er und 80er Jahren klammern. Sicherlich tritt ein Proletariat, das Schwierigkeiten mit seiner eigenen Identität hat und unter mangelndem Selbstvertrauen leidet, nicht „lautstark" auf. Gleichzeitig treten neben der Arbeiterklasse nicht-ausbeutende Schichten auf den Plan. Der Drang zu massiven Kämpfen, zu einem revolutionären Kampf verläuft nicht über vorher genau festgelegte Wege, in denen das Klassenterrain klar erkennbar ist. Dies birgt Risiken: ein noch schwaches Proletariat kann sich orientierungslos und verwirrt fühlen trotz einer breiten sozialen Bewegung. Es könnte auch sein, dass es vollkommen verloren dasteht wie bei den Ereignissen in Argentinien 2001.
All dies ändert nichts an dem Potenzial der gegenwärtigen Bewegung.
- Heute stellen die großen Industriezentren ein geringeres Gewicht dar und scheinen in einem umfangreichen nationalen und internatioanlen Netz an Betrieben „unterzugehen", wodurch die Vorstellung, dass die Kämpfe traditionell von den großen Betrieben ausgehen, hinfällig geworden ist. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, hat das Proletariat das Mittel gefunden, in großen Mengen auf den Straßen mit den anderen nicht- ausbeutendenden Schichten zusammenzukommen. All das bewirkt, dass der Klassencharakter nicht so leicht und direkt erkennbar ist wie früher, aber er bahnt sich seinen Weg mit einer größeren Bewusstseinsentwicklung und Klärung.
- In Anbetracht des gesellschaftlichen Zerfalls, der die gesellschaftlichen Beziehungen zerstört und den moralischen Niedergang verschärft, ist die Orientierung der Versammlungen des bewussten, wenn auch konfusen Nachdenkens über das Leben der Menschen und das Zusammenkommen, wodurch sich soziale Beziehungen aufbauen lassen und die proletarische Moral verteidigt wird, eine Alternative gegenüber einer im Konkurrenzkampf versinkenden Gesellschaft.
- Es stimmt, dass die Arbeiterklasse auf dem Hintergrund einer verzweifelten Situation, in der langfristig alles der Fäulnis preisgegeben ist, in einen Kampf eintritt, bei dem sie neben nicht-ausbeutenden sozialen Schichten kämpft, die nicht notwendigerweise die gleichen revolutionären Ziele verfolgen und dazu neigen, die Arbeiterklasse in einer diffusen Masse aufzulösen. Dies beinhaltet ernsthafte Gefahren, aber gleichzeitig entsteht dadurch der Vorteil, dass man im Kampf eine Kampfgemeinschaft herstellt, dass man methodisch alle Fragen angeht, sich gegenseitig besser versteht. All das wird für die zukünftigen Zusammenstöße mit dem bürgerlichen Staat entscheidend sein.
IKS - 25.5.2011
[1] Die Korruption ist zutiefst im Kapitalismus verwurzelt, da seine "Moral" darin besteht, alles zu verwerten, was einen größtmöglichen Profit abwirft. Mit diesem „Geburtsfehler" behaftet und auf dem Hintergrund der Zuspitzung der Wirtschaftskrise, die das verantwortungslose Handeln der Unternehmer und Politiker nur noch verschärft, wird die Korruption in jedem Staat unvermeidlich, egal welche Gesetze dazu bestehen.
[2] Aber in den Versammlungen gibt es Ansätze, dass die Fragen auf internationaler Ebene gestellt werden. In Valencia bezeichnete sich am Sonntag ein Redner als „Weltbürger", er betonte, wir könnten den Blick nicht auf Spanien beschränken. Anstrengungen werden unternommen, um die Kommuniqués der Versammlungen in alle möglichen Sprachen der Welt zu übersetzen; dies steht in starkem Gegensatz zu der anfänglichen spanischen Brille. Während die Versammlungen in vielen Ländern außerhalb Spaniens sich als eine „Angelegenheit der Spanier auf der ganzen Welt" darstellten, scheinen einige Versammlungen eine andere Botschaft aussenden zu wollen.
[3] Obwohl sich dies von den Versammlungen am Sonntag, den 22. Mai, an wiederholte.
[4] Nicht nur in den Ländern der "Dritten Welt" (welch anachronistischer Begriff), sondern auch in den zentralen Ländern. Selbst hochqualifizierte Informatiker, Rechtsanwälte, Redakteure usw. überleben immer mehr unter prekären Bedingungen oder als freelance. Kleine Selbständige arbeiten oft länger als die Uhr Stunden hat...
[5] Siehe unsere Thesen zu den Kämpfen gegen den CPE in Frankreich: /content/876/thesen-ueber-die-studentenbewegung-frankreich-im-fruehling-2006 [271]
[6] Siehe „Der Aufstand der Jugend in Griechenland bestätigt die Entwicklung des Klassenkampfs": https://de.internationalism.org/node/1810 [272]
[7] Siehe das Editorial der Internationalen Revue Nr. 144 - "Frankreich, Großbritannien, Tunesien - die Zukunft liegt in der Entfaltung des internationalen selbständigen Klassenkampfes [273]".
[8] "Was ist los in Nordafrika, im Nahen & Mittleren Osten? [274]"
[9] Siehe das Kommuniqué madrid.indymedia.org/node/17370, wo die Verhafteten die Misshandlungen durch die Polizei beschreiben.
[10] Der Staat ist das Organ der herrschenden Klasse. Auch wenn er unter demokratischem Deckmantel auftritt, stützt sich seine Struktur auf die Delegierung der Macht, was für die ausbeutende Minderheit kein Problem darstellt, die durch den Besitz an Produktionsmitteln das Heft in der Hand behält und den Berufspolitikern die Verwaltung ihrer Interessen überlassen kann. Aber für die Arbeiterklasse und die gewaltige Mehrheit der Bevölkerung sieht es anders aus: ihre Beteiligung besteht darin, dass sie diesen Herrschaften einen Blankoscheck ausstellen, die sich dann - auch wenn sie noch mit größter Ehrlichkeit handeln und auf die Verteidigung persönlicher Interessen verzichten - im bürokratischen Spinnengewebe des Staates verstricken.
[11] Es spricht Bände, dass die von dem Kandidaten der PP, Rajoy, eingeschlagene Strategie darin besteht, überhaupt keine Aussagen zu machen. Er redet nur sehr vage, mit sehr vielen Allgemeinplätzen. Dadurch will er verhindern, dass mögliche Linkswähler gegen ihn stimmen.
[12] Nach der Revolution von 1868 - die als „glorreich" bezeichnet wird, - und den nachfolgenden umwälzungsreichen Jahren, gelangen 1876 die konservative Partei Cánovas und die liberale Partei Sagastas an die Macht. Sie behielten sie bis 1900.
[13] Die kleinen Parteien, auf welche viele Leute bei den Versammlungen hoffen, treten nicht nur für ein Programm zur Verteidigung des Kapitalismus ein, das dem der großen Parteien in nichts nachsteht; sie haben auch Strukturen entwickelt, die ebenso bürokratisch und diktatorisch sind wie diese. Sie spielen keine eigenständige Rolle. Sie dienen als Auffangbecken für mit der Regierung und Opposition Unzufriedene.
[14] Siehe unsere Serie "Was sind die Arbeiterräte? [275]".
[15] Siehe "Die Debattenkultur, eine Waffe im Klassenkampf": /content/1654/die-debattenkultur-eine-waffe-des-klassenkampfes [276]
[16] Dies wurde in dem Forderungskatalog aufgeführt, der von der Madrider Versammlung erstellt wurde: offene Listen, Wahlreform...
[17] Siehe "Der Zerfall - letzte Phase des kapitalistischen Niedergangs": /content/1384/der-zerfall-der-kapitalistischen-gesellschaft [277]
[18] Im Unterschied zu den Ereignissen in Frankreich und Großbritannien, wo die Mobilisierungen sich um die Reaktion auf viel härtere Angriffe der Regierungen drehten.
[19] Im Gegensatz dazu gelang es Rosa Luxemburg mit "Massenstreik, Partei und Gewerkschaften" oder Trotzki mit "Bilanz und Perspektiven 1905" die Charakteristiken und die Dynamik der neuen Epoche des Klassenkampfes herauszuarbeiten.
Aktuelles und Laufendes:
- Proteste in Spanien [278]
- Puerta del Sol [279]
Leute:
Westliche Militärintervention in Libyen : ein neues kriegerisches Inferno
- 2317 Aufrufe
Seit dem Beginn des militärischen Eingreifens am 19. März in Libyen unter den Fahnen der UNO und der NATO hat sich die Lage nicht entspannt. Aber seien wir beruhigt! Der letzte G8 Gipfel hat bekräftigt, dass die Koalitionäre ungeachtet ihrer Divergenzen « entschlossen sind, zum Ziel zu gelangen ». Sie riefen den libyschen Führer zur Abdankung auf, weil er « jede Legitimität » verloren habe. Russland hat sich dem Lager der Gaddafi-Gegner angeschlossen und seine Unterstützung bei einer Vermittlung angeboten. Als Zeichen der Unterstützung der « arabischen Revolutionen » und mit Blick auf die libysche Bevölkerung haben die Führer des Westens den « arabischen Revolutionen » ein Geschenk von 45 Milliarden Dollar gemacht (dabei haben sie Saudi-Arabien dazu gedrängt, auch in die Tasche zu greifen).
Diese « Solidarität » mit den Gaddafi-Gegnern, die sich im libyschen Übergangsrat zusammengeschlossen haben, macht aber den Krieg, der immer mehr ins Stocken gerät, nicht populärer. Die Truppen Gaddafis, gegen die mehr als 3000 Luftangriffe durchgeführt wurden, ballern weiterhin wild auf die Rebellen – sowohl in Bengasi als in Misrata. Man ist weit davon entfernt, den libyschen Führer von der Macht zu verdrängen, der jüngst von der « internationalen Gemeinschaft » wegen seiner Gräueltaten angeprangert wurde. Die Einführung der Demokratie, die als Vorwand für dieses neue imperialistische Abenteuer diente, ist nicht in Reichweite. Denn der Führer der « grünen Revolution » klebt weiterhin verzweifelt an der Macht. Das Land bietet ein Bild der Verwüstung; nichts von der Hoffnung und dem Enthusiasmus, den die Bewegungen in Tunesien und Ägypten auslösten. Jeden Tag gibt es Dutzende Tote in Misrata. Überall findet man entlang der Straßen Wracks von Panzern und anderen Militärfahrzeugen, während die Städte immer mehr zu Ruinen werden – sie erinnern an Beirut in den 1970er und 1980er Jahren oder an Grosny (Tschetschenien). Natürlich klagen die westlichen Führer weiterhin die libysche Regierung an und fordern, dass die Verantwortlichen der libyschen Regierung zur Rechenschaft gezogen werden. Der Internationale Gerichtshof wird eingeschaltet, um die « Verbrechen » zu verfolgen. Aber ihre Reden sind nichts als Heuchelei. In Wirklichkeit sind auch sie schuldig für die Toten und Verletzten unter den libyschen Zivilisten. Die Luftangriffe verschonen nämlich nicht die Zivilisten. Die Luftangriffe der beiden Kriege im Irak und in Afghanistan haben Hunderttausende Tote hinterlassen, ganze Dörfer wurden ausgelöscht – alles wurde als Kollateralschäden entschuldigt. Die Liste der Verbrechen, die die Großmächte bei ihren Kriegen an Zivilisten begangen haben, schmälert nicht die Verbrechen der kleineren Staaten. Und die Großmächte haben jeweils ein riesiges kriegerisches Chaos hinterlassen.
Die Erklärung des letzten G8 Gipfels, wonach der militärische Druck auf Gaddafi erhöht und Hubschrauberangriffe mit französischen und britischen Hubschraubern durchgeführt werden sollen, bedeutet, dass man sich immer mehr in Richtung eines Bodenkrieges begibt. Von Anfang an fußte die militärische Intervention auf unklaren, schwammigen und instabilen Grundlagen. Die USA und Italien zögerten, Russland hatte sich dagegen ausgesprochen; heute dagegen scheint immer mehr der Kurs zu sein: Beutejagd zu betreiben. Die libysche Bevölkerung, die von den Missionaren der westlichen Demokratie « gerettet » werden soll, wird nun auf den gleichen Leidensweg geschickt wie die Bevölkerung anderer Länder, die unter Diktatoren oder dem internationalen Terrorismus schmachten. Wenn Gaddafi tatsächlich eines Tages ausgeschaltet sein sollte, werden die Stammesrivalitäten nur noch zunehmen, wobei die verschiedenen Mächte vor Ort kräftig mitmischen werden; mit anderen Worten – jeder für sich und jeder gegen jeden.
Die Frage muss aufgeworfen werden, ob die syrische Bevölkerung das gleiche Schicksal erleiden wird. Seit dem Beginn der Proteste gegen Assad wurden mindestens Tausend Menschen getötet, Zehntausende ins Gefängnis geworfen oder gefoltert. Folter, Prügel, Exekutionen – gehören heute zum Alltag in Syrien. Unter den Regierungen in Europa das gleiche Maulen, man akzeptiere nicht mehr das Vorgehen der syrischen Regierung. Die Regierungen des Westens haben dem syrischen Regime internationale Sanktionen angedroht, die diesem natürlich nicht weh tun.
Im Gegensatz zum Verlauf der Ereignisse in Libyen ist die UNO weit davon entfernt, eine Übereinkunft zu erzielen und eine Resolution zu beschließen, die ein militärisches Eingreifen in Syrien legitimieren würde. Zunächst, weil der syrische Staat militärisch besser gerüstet ist als die Truppen Gaddafis, dann weil die Region strategisch wichtiger ist als Libyen. Dies zeigt wiederum die mangelnde Glaubwürdigkeit der westlichen Staaten, die vorgeben die « arabischen demokratischen Revolutionen » zu unterstützen. Auch im Falle Syriens haben die westlichen Regierungen diesen Henker und seinen Clan seit Jahrzehnten unterstützt. Syrien ist ein zentrales Land auf dem imperialistischen Schachbrett. Als Nachbar und Verbündeter Iraks, wo die USA immer noch versuchen, einen « ehrenwerten » Rückzug für ihre Truppen zu finden, hat Syrien auch stetig mehr Hilfe von Iran erhalten. So hat der Iran erfahrene Repressionstruppen nach Syrien entsandt, die sich mit allen möglichen Misshandlungen und den Erfordernissen einer massiven Repression gegen die Bevölkerung auskennen.
Die USA können es sich nicht leisten, in Syrien in einen neuen Sumpf zu geraten. Dies würde ihr Ansehen in den arabischen Ländern noch mehr schwächen, nachdem die USA jetzt schon immer mehr Schwierigkeiten haben, die israelisch-palästinensischen Spannungen abzuschwächen, die gerade von Israel und Syrien weiter angefacht werden. Und der momentane US-Erfolg auf Weltebene, den sie durch die Exekution Bin Ladens erzielen konnten, der in den Medien als eine « Wiedergutmachung » des 11. Septembers 2001 dargestellt wurde, bedeutet überhaupt nicht, dass der Terrorismus ausgeschaltet worden wäre – ein Ziel, das die USA seit 20 Jahren als Begründung für ihr kriegerisches Vorgehen angegeben haben. Im Gegenteil – dadurch werden mörderische Attentate nur noch zunehmen – wie die jüngsten Anschläge in Pakistan und in Marokko belegen. Überall breiten sich die Kriegsschauplätze aus, man tritt immer mehr die Flucht nach vorn in den Militarismus an. Vor uns steht eine noch größere Destabilisierung und Barbarei. Mulan, 28.5.2011
Aktuelles und Laufendes:
- Krieg Libyen [282]
- Repression Syrien [283]
Leute:
- Gaddafi [249]
Weltrevolution Nr. 167
- 2584 Aufrufe
Die Mobilisierung der Empörten in Spanien und ihre Auswirkungen in der Welt: eine Bewegung welche die Zukunft in sich trägt
- 5442 Aufrufe
Die Bewegung „15M“ in Spanien - der Name entspricht dem Datum ihrer Geburt, dem 15. Mai - ist ein Ereignis von großer Bedeutung und mit bisher unbekannten Charakteristiken. Wir wollen in diesem Artikel die prägnantesten Episoden festhalten, um zu versuchen, die Lehren aus den einzelnen Episoden zu ziehen und die Perspektiven vorzuzeichnen.
Rechenschaft ablegen über das, was wirklich geschehen ist, stellt einen notwendigen Beitrag dar, um zu verstehen, welche Dynamiken der Klassenkampf hin zu einer massiven Bewegung annimmt. Wie verschafft sich eine solche Bewegung das Selbstvertrauen, das es ihr erlaubt, die Mittel zu finden, dieser todkranken Gesellschaft eine Alternative entgegenzustellen?[1]
Das kapitalistische „No Future“ ist der wirkliche Hintergrund der Bewegung 15M
Das Wort Krise hat eine dramatische Bedeutung für Millionen von Menschen, die von lawinenartigen Angriffen auf ihre Lebensbedingungen betroffen sind. Die unbefristete Arbeitslosigkeit, die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse, die es verunmöglicht, dass sich eine minimale, alltägliche Stabilität einstellt, bis zu den extremsten Fällen, die direkt Ausdruck von großer Armut und Hunger sind.[2]
Was aber am meisten beunruhigt, ist das völlige Fehlen einer Zukunftsperspektive. Dieser Zustand wurde von der Gefangenenversammlung in Madrid[3] angeprangert. Das war, wie wir sehen werden, der Funke, der das Feuer der Bewegung entfachte: „Wir finden uns einer Zukunft gegenüber, welche ohne die mindeste Hoffnung auf ein ruhiges Leben ist, wo wir uns dem widmen könnten, was uns gefallen würde“.[4] Die OECD erklärt uns, dass es 15 Jahre brauche, bis das Beschäftigungsniveau wieder auf der Höhe von 2007 sei, d.h. eine ganze Generation werde ohne Arbeit sein. Diese Zahlen können auch auf die USA und Großbritannien übertragen werden, daran sieht man, in was für eine Abwärtsspirale von Armut, Arbeitslosigkeit und Barbarei diese Gesellschaft hineingeraten ist.
Die Bewegung hat sich, wenn man sie nur oberflächlich betrachtet, auf das Zweiparteiensystem eingeschossen (auf der Rechten der Partido popular [PP] und auf der Linken die sozialistische Arbeiterpartei Spaniens [PSOE], die zusammen 86% der Stimmenden vertreten).[5] Dieser Faktor hat eine Rolle im Zusammenhang mit der Zukunftslosigkeit gespielt, nachdem die Rechten einen arroganten und arbeiterfeindlichen Ruf hatten, stellten weite Teile der Bevölkerung mit Sorge fest, dass die Angriffe vom PSOE – den angeblichen Freunden – durchgeführt wurden. Die deklarierten Feinde des PP drohen somit für lange Zeit, sich an der Macht zu halten, ohne dass es irgendeine Alternative innerhalb des parlamentarischen Spiels noch geben würde. Dies widerspiegelt die allgemeine Blockierung der Gesellschaft.
Dieses Gefühl wurde verstärkt durch die Haltung der Gewerkschaften, die zunächst für einen „Generalstreik“ am 29. September 2010 aufriefen, der aber nur ein Scheingefecht war, und dann im Januar 2011 einen Sozialpakt unterschrieben, der brutale Reformen gegen die Rentner vorsah und alle Möglichkeiten einer Mobilisierung unter ihrer Führung verunmöglichte.
Zu diesen Faktoren gesellte sich noch ein tiefes Gefühl der Empörung. Es ist die Folge der Krise, wie das in einer Versammlung von Valencia festgehalten wurde: dass „die Wenigen, die viel besitzen, noch weniger werden und immer mehr besitzen, währenddem die anderen, die viel zahlreicher sind, immer weniger besitzen“. Die Kapitalisten und ihr politisches Personal werden immer arroganter, gieriger und korrupter. Sie zögern nicht, riesige Vermögen anzuhäufen, während sich gleichzeitig rund um sie herum Armut und Verzweiflung verbreitet. All das lässt uns begreifen, leichter als eine Demonstration es könnte, dass die sozialen Klassen existieren und dass wir nicht „alles gleichgestellte Bürger“ sind.
Ende 2010 haben sich infolge dieser Situation Kollektive gebildet, die dazu aufgerufen haben, dass man sich auf der Strasse vereinigen müsse, dass man am Rande der Gewerkschaften und Parteien agieren muss, sich in Versammlungen organisieren … Der alte Maulwurf, von dem Marx sprach, wühlte in den Eingeweiden der Gesellschaft, indem er eine unterirdische Reifung voranbrachte, die dann im Monat Mai ans Tageslicht kam. Die Mobilisierung der „Jugend ohne Zukunft“ brachte 5000 Jugendliche in Madrid auf die Strasse. Im Übrigen waren der Erfolg der Demonstration der Jugend in Portugal – Geraçao à Rasca (die Generation am Abgrund) –, welche mehr als 200.000 Personen umfasste, und das sehr populäre Beispiel vom Tahrir-Platz in Ägypten anspornend für die Bewegung.
Die Versammlungen: ein erster Blick auf die Zukunft
Am 15. Mai berief ein Zusammenschluss von mehr als 100 Organisationen - unter dem Namen Democracia Real Ya (DRY)[6] - Demonstrationen in den großen Provinzstädten „gegen die Politiker“ ein und forderte „echte Demokratie“.
Kleine Gruppen von Jugendlichen (Arbeitslose, prekär Arbeitende und Studenten), die nicht einverstanden waren mit der Rolle eines Ventils der sozialen Unzufriedenheit, welche die Organisatoren der Bewegung zuschreiben wollten, versuchten, auf zentralen Plätzen in Madrid, Granada und anderen Städten Zelte aufzustellen, um die Bewegung fortzusetzen. DRY fiel ihnen in den Rücken und ließ den Polizeitruppen freie Hand für eine brutale Repression, die insbesondere auf den Polizeiposten verübt wurde. Doch die Opfer der Repression beriefen eine Versammlung der Verhafteten von Madrid ein und stellten innert Kürze ein Communiqué her, das die durch die Polizei verübten entwürdigenden Misshandlungen anprangerte. Dieser Schritt hinterließ einen starken Eindruck und ermutigte zahlreiche Jugendliche, sich den Zeltstätten anzuschließen.
Am Dienstag, dem 17. Mai, versuchte DRY, die Zelte in die Rolle eines symbolischen Protestes zu drängen, aber die gewaltige Masse, die zu ihnen strömte, führte unweigerlich zur Abhaltung von Vollversammlungen. Am Mittwoch und Donnerstag breiteten sich die Massenversammlungen in mehr als 73 Städte aus. Hier drückte sich ein interessantes Nachdenken über vernünftige Vorschläge aus, wo alle Aspekte des sozialen, wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Lebens behandelt wurden. Nichts, was menschlich ist, war dieser unermesslichen improvisierten Agora fremd!
Ein Demonstrantin in Madrid sagte: „Das Beste sind die Versammlungen, das Wort befreit sich, die Leute verstehen sich, man kann laut nachdenken, Tausende von Leuten, die sich nicht kennen, schaffen es, sich einig zu sein. Ist das nicht wunderbar?“ Die Versammlungen waren von einer anderen Welt, im Gegensatz zu der finsteren Atmosphäre in den Wahlbüros und Hunderte von Meilen entfernt von der Marketingbegeisterung im Wahlkampf der Bourgeoisie. „Brüderliche Umarmungen, Rufe des Entzückens und der Begeisterung, Freiheitslieder, frohes Gelächter, Humor und Freude hörte man in der vieltausendköpfigen Menge, die vom Morgen bis Abend in der Stadt wogte. Die Stimmung war eine gehobene, man könnte beinahe glauben, dass ein neues, besseres Leben auf Erden beginnt. Ein tiefernstes und zugleich idyllisches, rührendes Bild“[7]. Tausende von Menschen diskutierten leidenschaftlich und hörten sich aufmerksam zu in einer Stimmung des tiefen Respekts und in bewundernswerter Ordnung. Sie waren durch die Empörung und die Sorgen um die Zukunft vereint, aber insbesondere auch durch den Willen, die Ursachen des Elends zu begreifen; deshalb diese Anstrengungen für eine Debatte, für die Analyse einer Unzahl von Fragen, Hunderte von Sitzungen und die Schaffung von Straßenbibliotheken … Eine Anstrengung scheinbar ohne konkretes Ergebnis, aber die alle Geister in Bewegung gebracht und den Samen des Bewusstseins in die Felder der Zukunft gesät hat.
In subjektiver Hinsicht steht der Klassenkampf auf zwei Pfeilern: einerseits auf dem Bewusstsein, andererseits auf dem Vertrauen und der Solidarität. Gerade auch bei diesem zweiten Aspekt waren die Versammlungen Träger der Zukunft: die menschlichen Beziehungen, die gewoben wurden, der Strom von Empathie, der die Plätze belebte, die Solidarität und die Einheit, die blühten, hatten mindestens ebenso viel Bedeutung wie die Notwendigkeit, Entscheidungen zu treffen oder sich auf eine bestimmte Forderung zu einigen. Die Politiker und die Presse verlangten wütend mit der charakteristischen Ungeduld und dem typischen Utilitarismus der bürgerlichen Ideologie, dass die Bewegung ihre Forderungen in einem „Protokoll“ zusammenfasse, was DRY dann versuchte, in einen „Dekalog“ zu verwandeln, der alle lächerlichen und stumpfen demokratischen Maßnahmen wie Listen der offenen Kandidaten, Gesetzesinitiativen und die Reform des Wahlgesetzes aufführte.
Der eifrige Widerstand, auf den diese überstürzten Maßnahmen stießen, veranschaulichte, wie die Bewegung die Zukunft des Klassenkampfs ausdrückte. In Madrid schrien die Leute: „Wir gehen nicht langsam, sondern wir werden sehr weit gehen!“ In einem offenen Brief an die Versammlungen sagte eine Gruppe von Madrid: „Das schwierigste besteht darin, zusammenzufassen, was unsere Demonstrationen wollen. Wir sind überzeugt, dass es nicht um etwas Einfaches geht, wie es die eigennützigen Politiker und all jene gerne hätten, die wollen, dass sich nichts ändert, oder besser gesagt: jene, die einige Einzelheiten ändern wollen, damit es im übrigen bleibt, wie es ist; dass sich unser Protest nicht ausdrückt und stärkt, indem er plötzlich einen „Forderungskatalog“ vorschlägt oder einen kleinen Forderungshaufen schafft“[8].
Die Anstrengung, die Ursachen einer dramatischen Lage und einer unsicheren Zukunft zu begreifen und die beste Art zu finden, wie folglich zu kämpfen ist, stellte die Achse der Versammlungen dar. Von daher ihr beschlussfassender Charakter, der all jene verwirrte, die auf einen Kampf hofften, der auf präzise Forderungen ausgerichtet ist. Die Anstrengung zu Überlegungen über ethische, kulturelle, künstlerische und literarische Fragen (es gab Interventionen in Form von Liedern oder Gedichten), hat fälschlicherweise das Gefühl entstehen lassen, es handle sich um eine kleinbürgerliche Bewegung „von Empörten“. Wir müssen hier die Spreu vom Weizen trennen. Jene ist sicher in der demokratischen und bürgerlichen Hülle zu finden, die oft die auf die Straße getragenen Anliegen umwickelten. Aber diese sind vom Weizen, denn die revolutionäre Umwandlung der Welt stützt sich auf eine gewaltige kulturelle und ethischen Veränderung - und stimuliert diese gleichzeitig; „die Welt und das Leben verändern, indem wir uns selber verändern“, das ist die revolutionäre Devise, die Marx und Engels in der Deutschen Ideologie vor mehr als anderthalb Jahrhunderten formulierten: „dass sowohl zur massenhaften Erzeugung dieses kommunistischen Bewusstseins wie zur Durchsetzung der Sache selbst eine massenhafte Veränderung der Menschen nötig ist, die nur in einer praktischen Bewegung, in einer Revolution vor sich gehen kann; dass also die Revolution nicht nur nötig ist, weil die herrschende Klasse auf keine andre Weise gestürzt werden kann, sondern auch, weil die stürzende Klasse nur in einer Revolution dahin kommen kann, sich den ganzen alten Dreck vom Halse zu schaffen und zu einer neuen Begründung der Gesellschaft befähigt zu werden“[9].
Die massenhaften Vollversammlungen waren in erster Linie Ausdruck einer Antwort gegenüber einem generellen gesellschaftlichen Problem, welches wir schon seit mehr als 20 Jahren thematisieren: der soziale Zerfall des Kapitalismus. In den „Thesen über den Zerfall“, die wir damals schrieben[10], beschrieben wir die Tendenz des Zerfalls der Ideologie und des Überbaus der kapitalistischen Gesellschaft, die einhergeht mit der Auflösung der sozialen Beziehungen, die auch die Bourgeoisie und das Kleinbürgertum erfasst. Die Arbeiterklasse kann dem nicht entfliehen, da sie Berührungspunkte mit dem Kleinbürgertum hat. Wir betonten in diesem Dokument gegen den Effekt dieser Entwicklung folgendes: „1.) Das kollektive Handeln, die Solidarität; all das hebt sich ab von der Atomisierung, dem Verhalten, 'Jeder für sich', 'jeder schlägt sich individuell durch; 2.) Das Bedürfnis nach Organisierung steht dem gesellschaftlichen Zerfall entgegen, der Zerbröckelung der Verhältnisse, auf die jede Gesellschaft baut; 3.) Die Zuversicht in die Zukunft und in die eigenen Kräfte wird ständig untergraben durch die allgemeine Hoffnungslosigkeit, die in der Gesellschaft immer mehr überhand nimmt, durch den Nihilismus, durch die Ideologie des 'No future'; 4.) Das Bewusstsein, die Klarheit, die Kohärenz und den Zusammenhalt des Denkens, den Geschmack für die Theorie, all diese Elemente müssen sich behaupten gegenüber den Fluchtversuchen, der Gefahr der Drogen, der Sekten, dem Mystizismus, der Verwerfung der theoretischen Überlegungen, der Zerstörung des Denkens, d.h. all den destruktiven Elementen, die typisch sind für unsere Epoche.“
Was die massiven Vollversammlungen in Spanien zeigen – gleich wie 2006 in Frankreich während der Mobilisierungen der Studenten[11] ist, dass die dem Zerfall gegenüber empfindlichsten Sektoren - die Jugend und die Arbeitslosen (aufgrund der geringen Erfahrung im Arbeitsleben) – sich dennoch in der Vorhut der Vollversammlungen befanden und sich bemühten, das Bewusstsein, die Solidarität und eine Empathie zu entwickeln.
Aus all diesen Gründen sind die massenhaften Vollversammlungen ein erster Vorgeschmack dessen, was vor uns steht. Für diejenigen, die erwarten, dass die Arbeiterklasse wie ein Gewitter aus heiterem Himmel auf den Plan tritt und klar und ohne Schwankungen als revolutionäre Klasse der Gesellschaft handelt, ist dies sicher sehr unbefriedigend. Dennoch, aus einem geschichtlichen Blickwinkel und unter Einbezug der enormen Schwierigkeiten, vor denen das Proletariat steht, um dieses Ziel zu erreichen, sind diese Ereignisse ein guter Anfang, weil das subjektive Terrain klar vorangetrieben wird.
Paradoxerweise waren diese Charakteristiken auch die Achillesverse der „M15“-Bewegung, wie es sich in der ersten Phase ihres Entstehens ausdrückte. Entstanden ohne klares Ziel, waren die Ermüdung und die Schwierigkeit, über erste Schritte hinauszugehen, große Probleme. Die Abwesenheit von Bedingungen für die Arbeiterklasse, auch an den Arbeitsplätzen in den Kampf einzutreten, hatten die Bewegung in eine Leere stürzen lassen und auf ein vages Terrain gebracht, das sich nicht lange halten konnte. DRY konnte dort mit ihren Forderungen nach „demokratischen Reformen“, die angeblich „leicht“ und „realisierbar“ seien, einhaken, sie waren aber nur utopisch und reaktionär.
Fallen, die der Bewegung lauerten
Während nahezu zwei Jahrzehnten hat die weltweite Arbeiterklasse einen Gang durch eine Wüste durchmachen müssen, gezeichnet von der Abwesenheit massiver Kämpfe und vor allem einem Verlust an Selbstvertrauen und Identität als Klasse[12]. Auch wenn diese Atmosphäre vorüber ist und seit 2003 fortschreitend bedeutende Kämpfe in verschiedenen Ländern und die Herausbildung einer neuen Generation von revolutionären Minderheiten Realität sind, so bleibt das stereotype Bild einer Arbeiterklasse, die „sich nicht bewegt“ und die „komplett abwesend“ ist, noch heute dominant.
Das plötzliche Eintreten großer Massen auf die soziale Bühne ist mit dem Gewicht dieser Vergangenheit beladen. Ein Gewicht, welches auf einer Bewegung sozialer Schichten, die auf dem Weg hin zur Proletarisierung sind und die auch anfällig sind für die Fallen der Demokratie und des „Bürger-Gedankens“, besonders lastet. Dazu kommt die Tatsache, dass die Bewegung nicht als Antwort auf einen konkreten Angriff entstanden ist. Sie ist aus einem Paradoxon hervorgegangen, welches nicht neu ist in der Geschichte[13], bei dem die beiden großen Klassen der Gesellschaft – das Proletariat und die Bourgeoisie – einem offenen Kampf ausweichen, was den Eindruck einer friedlichen Bewegung unter „Zustimmung aller“ erweckt[14].
Doch in der Realität war die Konfrontation zwischen den verschiedenen Klassen vom ersten Tag an präsent. Gab die PSOE-Regierung nicht eine klare Antwort mit ihrer brutalen Repression gegen eine Handvoll junger Leute? War es nicht die sofortige und leidenschaftliche Antwort der Vollversammlungen an die Inhaftierten von Madrid, welche die Bewegung entfesselte? War es nicht die Denunzierung dieser Ereignisse, welche vielen jungen Menschen die Augen öffnete, welche dann skandierten: „Sie nennen es Demokratie, doch das ist es nicht!“? Eine schwammige Parole, die dann von einer Minderheit in: „Sie nennen es Diktatur, und es ist eine!“ umgewandelt wurde.
Für alle, welche denken, der Klassenkampf sei ein Ergebnis „starker Emotionen“, ist der „friedliche“ Aspekt der Vollversammlungen etwas, das sie meinen lässt, diese seien nichts weiter als die „Ausübung eines harmlosen verfassungsmäßigen Rechtes“. Auch viele Teilnehmer glaubten wirklich, dass ihre Bewegung darauf reduziert sei.
Doch die Vollversammlungen auf den öffentlichen Plätzen mit den Parolen „Nehmen wir uns den Platz, den wir brauchen!“ drückten eine Infragestellung der demokratischen Ordnung aus. Was die sozialen Beziehungen bestimmt und das Gesetz absegnet, ist, dass sich die ausgebeutete Mehrheit um „ihre Dinge“ kümmern soll, und wenn sie „teilnehmen“ will an den öffentlichen Angelegenheiten, so soll sie die Stimme an der Urne abgeben und den gewerkschaftlichen Protest wählen, Formen welche nur noch mehr zur Atomisierung und Individualisierung beitragen. Sich versammeln, Solidarität leben, gemeinsam diskutieren, als kollektiver unabhängiger sozialer Körper handeln, das ist in Wirklichkeit eine unwiderstehliche Kraft gegen die bürgerliche Ordnung.
Die herrschende Klasse unternahm alles, um die Vollversammlungen zu beenden. Vordergründig zum Schein mit der widerlichen Heuchelei, die sie charakterisiert, spendete sie Lob und Augengezwinker an die „Empörten“, doch die Wirklichkeit sah ganz anders aus.
Angesichts des nahenden Wahltages am Sonntag, 22. Mai hatte die zentrale Wahlversammlung beschlossen, Vollversammlungen für den Samstag, 21. Mai im ganzen Lande zu verbieten, zu welchen als „Tag des Nachdenkens“ aufgerufen wurde. Ab Samstag Mitternacht kreiste ein enormes Aufgebot von Polizisten die Puerta del Sol ein, doch die Polizei wurde daraufhin selbst von einer riesigen Menschenmenge eingekesselt, was den Innenminister drängte, zum Rückzug zu blasen. Mehr als 20`000 Menschen besetzten in einer Explosion der Freude den Platz. Wir sehen hier eine andere Konfrontation zwischen den Klassen, auch wenn sich die offene Gewalt auf wenige Ausbrüche reduzierte.
DRY schlägt vor, die Camps aufrecht zu erhalten, für Ruhe zu sorgen, um damit die „Tage des Nachdenkens“ zu respektieren, aber keine Vollversammlungen zu machen. Doch niemand folgt ihnen und die Versammlungen am Samstag, dem 21., die formell illegal sind, verzeichnen die größte Beteiligung. In der Vollversammlung in Barcelona verkünden Schilder, im Chor gerufene Parolen und Plakate als Antwort auf die Wahlversammlung: „Wir sind diejenigen, die nachdenken!“.
Am Sonntag, dem 22. Mai, dem Tag der Wahlen, wurde ein weiterer Versuch gestartet, die Vollversammlungen zu beenden. DRY verkündete: „die Ziele sind erreicht“ und dass sich die Bewegung auflösen solle. Die Antwort kam postwendend: „Wir sind nicht hier für die Wahlen!“. Am Montag und Dienstag 23./24. erreichten die Vollversammlungen bezüglich Beteiligung und Qualität der Diskussionen ihren Höhepunkt. Die Redebeiträge, Parolen und Schilder manifestierten ein vertieftes Nachdenken: „Wo ist denn die Linke? Schlussendlich bei den Rechten!“, „Die Urnen enthalten nicht unsere Träume!“, „600 Euros pro Monat, das ist Gewalt!“, „Wenn ihr uns nicht träumen lässt, dann stören wir euren Schlaf!“, „Ohne Arbeit, ohne Wohnung, ohne Angst!“, „Sie haben unsere Großeltern betrogen, sie haben unsere Kinder betrogen, sie werden unsere Enkelkinder nicht betrügen!“. Es tauchte aber auch ein Bewusstsein über die Perspektiven auf: „Wir sind die Zukunft, der Kapitalismus ist die Vergangenheit!“, „Alle Macht den Vollversammlungen!“, „Es gibt keine Entwicklung ohne Revolution!“, „Die Zukunft beginnt jetzt!“, „Glaubst du noch immer, dass es eine Utopie ist?“
Nach diesem Höhepunkt flauen die Vollversammlungen ab. Einerseits wegen der Ermüdung, aber auch wegen den permanenten Bombardement der DRY, man müsse ihren «Demokratischen Dekalog» akzeptieren. Die Punkte des Dekalogs sind alles andere als neutral, sie richten sich direkt gegen die Vollversammlungen. Die „radikalste“ Forderung, die „gesetzgebende Volksinitiative“[15], welche endlose parlamentarische Verfahren zu überwinden vorgibt, entmutigt selbst die Hartnäckigsten, denn sie ersetzt jegliche massenhafte Debatte oder alle Gefühle, an einem kollektiven politischen Leben teilzunehmen, durch individuelles Handeln, als Bürger, eingekerkert in den Mauern des Gesetzes.[16]
Die Sabotage von Innen ergänzte sich mit den repressiven Angriffen von Außen, welche aufzeigten, wie heuchlerisch die herrschende Klasse ist, wenn sie vorgibt, dass Versammlungen ein „Recht in der Verfassung des Staates“ seien. Am Freitag 27. unternimmt die Katalanische Regierung – in Absprache mit der Zentralregierung – einen Sturmangriff: die „mossos de esquadra“ (Polizeitruppe der Region) stürmten die Plaça de Catalunya in Barcelona und schlugen wild drauflos. Es gab zahlreiche Verletzte und Verhaftungen. Die Vollversammlung von Barcelona – bis anhin die am meisten von Klassenpositionen geprägte – lief in die Falle der klassischen demokratischen Forderungen: Eine Petition für die Absetzung des Ministers des Inneren, Zurückweisung der „übertriebenen“ Repression“[17], Forderung nach einer „demokratischen Kontrolle der Polizei“. Ihre Kehrtwendung wurde noch offensichtlicher als sie dem nationalistischen Gift erlag und in ihre Forderungen das „Recht auf Selbstbestimmung“ einfügte.
Die Repression steigerte sich in der Woche vom 5.-12. Juni: Valencia, Santiago de Compostela, Salamanca… Der brutalste Angriff aber wurde vom 14. auf den 15. Juni in Barcelona verübt. Das Katalanische Parlament diskutierte ein Gesetz namens Omnibus, welches harte soziale Abbaumaßnahmen vorsieht, vor allem im Schul- und Gesundheitssektor (im letzteren unter anderem 15000 Entlassungen). DRY rief, komplett außerhalb jeglicher Dynamik der Versammlungen der Arbeiter, zu einer „pazifistischen Demonstration“ auf, welche das Parlamentsgebäude einkreisen sollte, um „die Parlamentarier daran zu hindern, über ein ungerechtes Gesetz abzustimmen“. Es handelte sich dabei um eine typische symbolische Aktion, welche anstelle eines Kampfes gegen ein Gesetz und gegen die Institutionen, die es lancieren, sich an das „Bewusstsein“ der Parlamentarier richtet. Den in die Falle gelockten Demonstranten blieb nur die Wahl zwischen zwei falschen Alternativen: das demokratische Terrain und das hilflose Jammern der Mehrheit oder, das Gegenteil, die „radikale“ Gewalt einer Minderheit.
Beleidigungen und Handgreiflichkeiten gegenüber einigen Parlamentariern wurden zum Vorwand einer hysterischen Kampagne, welche die „Gewalttätigen“ kriminalisierte (Leute, die Klassenpositionen vertraten, wurden in dieselbe Ecke gestellt) und dazu aufrief, „die gefährdeten demokratischen Institutionen zu verteidigen“. Um die Schleife ganz zusammen zu ziehen, übersah DRY seinen Pazifismus und spornte die Demonstranten an, gegen die „gewalttätigen“ Demonstranten[18] vorzugehen, und forderte sogar offen, diese an die Polizei auszuliefern und Letzterer auch noch für ihre „guten Dienste“ zu applaudieren!
Die Demonstrationen des 19. Juni und die Ausdehnung auf die Arbeiterklasse
Von Anfang an hat die Bewegung zwei Seelen in ihrer Brust gehabt: einerseits eine durch Verwirrungen und Zweifel genährte, sehr breite demokratische Seele, die zum sozial heterogenen Charakter und der Tendenz passt, der direkten Konfrontation aus dem Wege zu gehen. Aber es gab auch eine proletarische Seele, die sich in den Versammlungen[19] und einer immer gegenwärtigen Tendenz ausdrückte, „auf die Arbeiterklasse zuzugehen“.
An der Versammlung von Barcelona beteiligten sich Arbeiter der Telekommunikation und des Gesundheitswesens, Feuerwehrmänner, Studenten der Universität, die sich gegen die Angriffe im Sozialbereich wehrten. Sie setzen einen Ausschuss zur Ausdehnung und für den Generalstreik ein, dessen Debatten sehr lebhaft sind, und organisieren ein Netz der empörten Arbeiter von Barcelona, das eine Versammlung von kämpfenden Betrieben für Samstag, den 11. Juni einberuft, dann ein Treffen für Samstag, den 3. Juli. Am Freitag, dem 3. Juni, demonstrieren Arbeitslose und Beschäftigte auf der Plaça de Catalunya unter einem Transparent, auf dem steht: "Nieder mit der Gewerkschaftsbürokratie! Generalstreik!". In Valencia unterstützt die Versammlung eine Demonstration der Arbeiter der öffentlichen Verkehrsbetriebe und auch eine Quartierdemonstration, die gegen die Kürzungen im Schulsektor protestiert. In Saragossa schließen sich die Arbeiter des öffentlichen Verkehrs der Versammlung mit Begeisterung an[20]. Die Versammlungen beschließen Quartiersversammlungen zu bilden[21].
In der Demonstration des 19. Juni stärkt sich die „proletarische Seele“ erneut. Diese Demonstration wird von den Versammlungen von Barcelona, Valencia und Malaga einberufen und ist gegen die Kürzungen im Sozialbereich gerichtet. DRY versucht, sie zu beschneiden, indem sie nur demokratische Parolen vorschlägt. Dies ruft Widerstand hervor, der sich in Madrid in der spontanen Initiative ausdrückt, zum Kongress zu gehen, um gegen die Angriffe zu demonstrieren; an dieser Demonstration beteiligen sich mehr als 5.000 Personen. Außerdem erlässt eine Koordination der Quartiersversammlungen des Südens von Madrid, die nach dem Fiasko des Streiks des 29. September ins Leben gerufen wurde und eine Richtung eingenommen hat, die stark jener der interprofessionellen (verschiedene Berufsgruppen umfassenden) Vollversammlungen ähnelt, die in Frankreich in der Hitze der Ereignisse des Herbstes 2010 gebildet wurden, den folgenden Aufruf: „Aus der Bevölkerung und den Arbeiterquartieren von Madrid gehen wir zum Kongress, wo, ohne uns zu fragen, die Kürzungen im Sozialbereicht beschlossen werden, um zu sagen: basta! (…) Diese Initiative geht von einer Auffassung der Basisversammlungen im Arbeiterkampf aus, gegen all jene, die Entscheidungen hinter dem Rücken der Arbeiter fällen, ohne sie nach ihrer Zustimmung zu fragen. Weil der Kampf lang ist, möchten wir dich ermutigen, dich in den Versammlungen der Stadt oder des Stadtviertels zu organisieren, oder am Arbeits- und Studienplatz.“
Die Demonstrationen des 19. Juni werden zum Erfolg, die Unterstützung ist in mehr als 60 Städten massenhaft, aber noch wichtiger ist ihr Inhalt. Sie sind eine Antwort auf die brutale Kampagne gegen „die Gewalttätigen“. Diese Antwort ist Ausdruck einer Reifung zahlreicher Debatten unter den Aktivsten der Bewegung[22]; so ist die am häufigsten ausgegebene Parole zum Beispiel in Bilbao: „Gewalt ist, wenn die Kohle nicht bis zum Monatsende reicht!“ oder in Valladolid: „Gewalt = Arbeitslosigkeit und Räumungen!“.
Es ist aber insbesondere die Demonstration in Madrid, welche die Kurve des 19. Juni in Richtung Zukunft nimmt. Sie wird durch ein Organ einberufen, das direkt mit der Arbeiterklasse verknüpft ist und aus ihren aktivsten Minderheiten hervorgegangen ist[23]. Das Thema dieser Versammlung ist: „Marschieren wir gemeinsam gegen die Krise und das Kapital“. Die Forderungen sind: „Nein zu den Kürzungen von Löhnen und Renten; um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen: Arbeiterkampf gegen die Erhöhung der Preise, für die Erhöhung der Löhne, für die Erhöhung der Steuern der Bestverdienenden, zur Verteidigung des öffentlichen Dienstes, gegen die Privatisierung des Gesundheitswesen und der Bildung … Es lebe die Einheit der Arbeiterklasse!“[24]
Ein Kollektiv von Alicante nimmt dasselbe Manifest an. In Valencia verteilt ein "Autonomer und antikapitalistischer Block" aus mehreren sehr aktiven Kollektiven in den Versammlungen ein Manifest, in dem steht: "Wir wollen eine Antwort auf die Arbeitslosigkeit. Auf dass die Arbeitslosen, die Prekarisierten, die schwarz Arbeitenden, sich in Versammlungen treffen und dass sie gemeinsam über ihre Forderungen entscheiden, und dass diese erfüllt werden. Wir verlangen den Widerruf der Revision des Arbeitsgesetzes und von jener Gesetzesänderung, die Sozialpläne ohne Kontrolle und mit einer Entschädigung von nur 20 Tagen erlaubt. Wir verlangen den Widerruf des Gesetzes über die Rentenreform, denn nach einem Leben von Entbehrungen und Elend wollen wir nicht in noch mehr Elend und Unsicherheit dahin siechen. Wir verlangen, dass die Räumungen und Ausweisungen aufhören. Das menschliche Bedürfnis nach einer Wohnung wiegt schwerer als die blinden Gesetze des Handels und des Strebens nach Profit. Wir sagen NEIN zu den Kürzungen im Gesundheits- und Schulwesen, NEIN zu den künftigen Entlassungen, welche die regionalen Regierungen und die Gemeindevorsteher nach den letzten Wahlen vorbereiten.[25]
Zur Demo in Madrid haben sich die Leute in mehreren Zügen zusammengefunden, die von sieben Vororten und weiteren Quartieren der Peripherie losmarschieren; in dem Maße, wie diese Züge vorrücken, stoßen immer mehr Menschen dazu. Diese Massen knüpfen an die Arbeitertradition der Streiks von 1972-76 in Spanien (aber auch die Tradition von 1968 in Frankreich) an, wo, ausgehend von einer Arbeiterkonzentration oder einer „Brennpunkt-Fabrik“ wie seinerzeit der Standard in Madrid, die Demonstrationen wachsende Massen von Jugendlichen, Bewohnern, Arbeitslosen, Arbeitern anzogen, und diese ganze Masse ins Zentrum der Stadt strömte. Diese Tradition ist im Übrigen bereits in den Kämpfen von Vigo von 2006 und 2009 wieder erwacht.[26]
In Madrid ruft das während der Kundgebung verlesene Manifest dazu auf, „Versammlungen zur Vorbereitung des Generalstreiks“ abzuhalten, was mit Rufen: „Es lebe die Arbeiterklasse!" quittiert wird.
Begeisterung ja, aber nicht kopflos
Die Demonstrationen des 19. Juni lösen Gefühle der Begeisterung aus; eine Demonstrantin in Madrid erklärt: „Es war eine richtige Feststimmung. Wir gingen alle zusammen, sehr verschiedene Leute und sehr verschiedenen Alters: von den Jugendlichen um die 20 bis zu den Rentnern, Familien mit ihren Kindern, und noch mal andere Menschen … und das, während Leute von ihren Balkonen aus uns zu applaudieren. Ich kam erschöpft nach Hause, aber mit strahlender Freude. Ich hatte nicht nur das Gefühl, soeben meinen Beitrag zu einer guten Sache geleistet zu haben, sondern hatte darüber hinaus einen starken Moment erlebt“. Ein anderer sagt: „Es ist wirklich wichtig, all diese an einem Ort versammelten Leute zu sehen, die politisch diskutieren oder die für ihre Rechte kämpfen. Habt ihr nicht das Gefühl, dass wir daran sind, die Straße zurück zu erobern?“
Nach den ersten Explosionen, die von den Versammlungen als solche der „Suche“ bezeichnet wurden, beginnt die Bewegung jetzt, den offenen Kampf zu suchen, beginnt vorauszusehen, dass die Solidarität, die Vereinigung, der Aufbau einer gemeinsamen Stärke zum Erfolg führen können[27]. Die Idee beginnt sich zu verbreiten, dass „wir stark sein können gegenüber dem Kapital und seinem Staat!“ und dass der Schlüssel zu dieser Stärke der Eintritt der Arbeiterklasse in den Kampf sein wird. In den Quartiersversammlungen in Madrid war eine der geführten Debatten zum Thema der Einberufung eines Generalstreiks im Oktober, mit dem „die Kürzung der Sozialleistungen“ bekämpft werden soll. Die Gewerkschaften CCOO und UGT schrien entsetzt, dass diese Einberufung „illegal“ sei, und dass sie allein dies machen dürften, worauf viele Sektoren laut und stark antworteten: „Einzig die Massenversammlungen können ihn einberufen“.
Wir dürfen uns aber nicht von der Euphorie mitreißen lassen, der Eintritt der Arbeiterklasse in den Kampf wird kein einfaches Unterfangen sein. Die Illusionen und Verwirrungen in der Frage der Demokratie, der Bürgergesichtspunkt, die „Reformen“ wiegen schwer und werden verstärkt durch den Druck von DRY, der Politiker, der Medien, welche die Zweifel und die vorherrschende Ungeduld, „sofort greifbare Resultate“ zu haben, ausnutzen, aber auch die Angst angesichts der Gewaltigkeit der Fragen, die sich stellen. Es ist besonders wichtig zu verstehen, dass die Mobilisierung der Arbeiter an ihren Arbeitsstätten heute wirklich sehr schwierig ist wegen des hohen Risikos, den Arbeitsplatz zu verlieren und ohne Einkommen da zu stehen, was für viele bedeutet, die Grenze zwischen einem elenden, aber erträglichen Leben und einem elenden Leben in extremer Armut zu überschreiten.
Nach den demokratischen und gewerkschaftlichen Kriterien ist ein Kampf die Summe individueller Entscheidungen. Sind Sie nicht unzufrieden? Fühlen Sie sich nicht zertreten? Wenn Sie sich so fühlen: Warum lehnen Sie sich dann nicht auf? Es wäre so einfach, wenn es für den Arbeiter nur darum ginge, zu wählen, ob er „mutig“ oder „feige“ sein wolle, allein mit seinem Gewissen, wie in einem Wahlbüro! Der Klassenkampf folgt diesem idealistischen und den wahren Prozess verfälschenden Schema nicht, er ist vielmehr das Ergebnis von kollektiver Stärke und ebensolchem Bewusstsein, die sich nicht allein aus dem Unbehagen in einer unerträgliche Lage nähren, sondern auch die Wahrnehmung voraussetzen, dass es möglichst sei, gemeinsam zu kämpfen, und dass es ein Mindestmaß an Solidarität und Entschlossenheit gebe, das den Kampf ermöglichte.
Eine solche Situation ist das Produkt eines unterirdischen Vorgangs, der auf drei Pfeilern gründet: die Organisation in offenen Versammlungen, die es erlauben, sich der verfügbaren Kräfte und der nächsten Schritte bewusst zu werden, die es braucht, um stärker zu werden; das Bewusstsein, um zu bestimmen, was wir wollen und wie wir es erkämpfen; die Kampfbereitschaft angesichts der Unterhöhlungsarbeit der Gewerkschaften und aller Mystifizierungorgane.
Dieser Prozess läuft bereits, aber es ist schwierig zu wissen, wann und wie er sich Bahn brechen wird. Ein Vergleich kann uns vielleicht helfen. Beim großen massenhaften Streik vom Mai 68[28] gab es am 13. Mai eine gigantische Demonstration in Paris zur Unterstützung der brutal unterdrückten Studenten. Das Stärkegefühl, das sie freisetzte, äußerte sich schon vom nächsten Tage an in einer Reihe von spontan ausbrechenden Streiks wie jenem von Renault in Cléon und dann Paris. Dies ist aber nach den großen Demonstrationen des 19. Juni in Spanien nicht passiert. Warum?
Die Bourgeoisie war im Mai 1968 politisch kaum vorbereitet, um der Arbeiterklasse entgegen zu treten, die Repression goss bloß Öl ins Feuer; heute dagegen kann sie sich in zahlreichen Ländern auf einen hoch ausgeklügelten Apparat von Gewerkschaften und Parteien stützen und ideologische Kampagnen lancieren, die auf der Demokratie beruhen und einen politisch sehr wirksamen Einsatz der selektiven Repression erlauben. Heute erfordert die Aufnahme eines Kampfes eine viel höhere Anstrengung des Bewusstseins und der Solidarität, als dies in der Vergangenheit der Fall war.
Im Mai 1968 stand die Krise gerade an ihrem Anfang, heute dagegen reißt sie den Kapitalismus klar in eine Sackgasse. Diese Situation schüchtert ein, sie erschwert die Aufnahme eines Streiks, selbst wenn es nur um eine „einfache“ Lohnerhöhung gehen würde. Der Ernst der Lage führt dazu, dass Streiks ausbrechen, weil „das Fass voll“ ist, aber daraus müsste sich dann die Schlussfolgerung ergeben, dass „das Proletariat nur die Ketten zu verlieren und eine Welt zu gewinnen“ hat.
Diese Bewegung hat keine Grenzen
Der Weg scheint also länger und schmerzhafter als im Mai 1968 zu sein, aber die Grundlagen, die sich bilden, sind tragfähiger. Eine der heutigen Stärken ist, das man sich als Teil einer internationalen Bewegung sieht. Nach einer „Versuchsphase“ mit einigen massenhaften Bewegungen (der Studentenbewegung in Frankreich im Jahre 2006 und der Revolte der Jugend in Griechenland im Jahre 2008[29]), reißt nun schon während neun Monaten eine Folge sehr viel breiterer Bewegungen nicht ab, welche die Möglichkeit aufscheinen lassen, die barbarische Hand des Kapitalismus zu lähmen: Frankreich im Herbst 2010, Großbritannien im November und Dezember 2010, Ägypten, Tunesien, Spanien und Griechenland im Jahre 2011.
Das Bewusstsein, dass die Bewegung „15M“ Teil dieser internationalen Serie ist, beginnt sich in Ansätzen zu entwickeln. Die Parole „Diese Bewegung hat keine Grenzen“ wurde durch eine Demonstration in Valencia aufgenommen. Demonstrationen „für eine europäische Revolution“ wurden von verschiedenen Zeltlagern organisiert; am 15. Juni gab es Demonstrationen zur Unterstützung des Kampfes in Griechenland, und sie wiederholten sich am 29. Am 19. begannen bei Minderheiten internationalistische Parolen aufzutauchen - auf einem Transparent stand: „Glückliche weltweite Vereinigung!“ und auf einem anderen stand auf Englisch: „World Revolution“.
Während Jahren diente der linken Bourgeoisie das, was sie die „Globalisierung der Wirtschaft“ nannte, als Vorwand für die Propagierung nationalistischer Reaktionen; ihr Diskurs bestand darin, die „nationale Souveränität“ angesichts „staatenloser Märkte“ zu fordern. Sie schlug den Arbeitern nichts Geringeres vor als, nationalistischer zu sein als die Bourgeoisie! Mit der Entwicklung der Krise, aber auch dank der allgemeinen Verbreitung des Internets, der sozialen Netzwerke usw. beginnt die Arbeiterjugend, diese Kampagnen gegen ihre Autoren zu wenden. Die Idee setzt sich durch, dass man „angesichts der Globalisierung der Wirtschaft mit der internationale Globalisierung der Kämpfe“ antworten müsse, dass angesichts des weltweiten Elends die einzig mögliche Antwort der weltweite Kampf ist.
Der „15M“ hatte eine breite Wirkung auf internationaler Ebene. Die Mobilisierungen in Griechenland folgen seit zwei Wochen demselben „Modell“ von massenhaften Versammlungen auf dem wichtigsten Platz der Stadt; sie haben sich bewusst von den Ereignissen in Spanien[30] leiten lassen. Nach Kaosenlared vom 19. Juni ist „es nun schon der vierte Sonntag in Folge, wo Tausende von Personen jeden Alters auf dem Syntagma-Platz vor dem griechischen Parlament demonstrieren; sie folgen einem Aufruf der paneuropäischen Bewegung der „Empörten“, um gegen die Sparmaßnahmen zu protestieren“.
In Frankreich, Belgien, Mexiko, Portugal finden regelmäßige Versammlungen von kleinen Minderheiten statt, wo sich Leute mit den Empörten solidarisieren und versuchen, die Debatte und die Antwort voranzutreiben. In Portugal schlossen sich „etwa 300 Personen, in ihrer Mehrheit Jugendliche, am Sonntagnachmittag im Zentrum von Lissabon einem Aufruf von Democracia Real Ya an, Bezug nehmend auf die spanischen Empörten. Die portugiesischen Demonstranten marschierten ruhig hinter einem Transparent, auf dem man lesen konnte: „Spanien, Griechenland, Irland, Portugal: unser Kampf ist international!““[31]
Die Rolle der aktiven Minderheiten bei der Vorbereitung neuer Kämpfe
Die weltweite Schuldenkrise veranschaulicht die Ausweglosigkeit der Krise des Kapitalismus. In Spanien wie in den anderen Ländern hagelt es frontale Angriffe, und es gibt keine Feuerpause, im Gegenteil folgen neue und schlimmere Tiefschläge gegen unsere Lebensbedingungen. Die Arbeiterklasse muss antworten, und zu diesem Zweck muss sie sich auf den Impuls stützen, den die Versammlungen vom Mai und die Demonstrationen des 19. Juni gaben.
Um diese Antworten vorzubereiten, bringt die Arbeiterklasse aktive Minderheiten hervor; GenossInnen, die versuchen, die Ereignisse zu begreifen; sich politisieren, die Debatten, Aktionen, Sitzungen, Versammlungen beleben; versuchen, jene zu überzeugen, die noch zweifeln; denen Argumente bringen, die welche suchen. Wie wir es zu Beginn sahen, trugen diese Minderheiten zum Entstehen des „15M“ bei.
Mit ihren bescheidenen Kräften hat sich die IKS an der Bewegung beteiligt und versucht, Orientierungen zu geben. „Während einer Kraftprobe zwischen den Klassen erlebt man wichtige und schnelle Fluktuationen, bei denen man wissen muss, wie man sich - geleitet von Prinzipien und Analysen - zu orientieren hat, ohne unterzugehen. Man muss in der Strömung der Bewegung sein und wissen, wie die „allgemeinen Ziele“ zu konkretisieren sind, um auf die wirklichen Anliegen eines Kampfes zu antworten, um die positiven Tendenzen, die sich zeigen, zu unterstützen und zu stimulieren“[32]. Wir haben zahlreiche Artikel geschrieben, die versuchen, die verschiedenen Phasen zu begreifen, durch die die Bewegung gegangen ist, indem wir konkrete und realisierbare Vorschläge gemacht haben: das Auftauchen der Versammlungen und ihre Vitalität, der Angriff von DRY gegen sie, die Falle der Repression, die Wende, die die Demonstrationen des 19. Juni darstellen[33].
Ein weiteres Bedürfnis der Bewegung ist die Debatte, weshalb wir auf unserer Webseite in spanischer Sprache eine Rubrik mit dem Titel „Debates del 15M“ eröffnet haben, wo sich GenossInnen mit verschiedenen Analysen und Positionen zu Wort melden können.
Mit anderen Kollektiven und aktiven Minderheiten zusammen zu arbeiten, war eine weitere Priorität für uns. Wir haben uns koordiniert und an gemeinsame Initiativen teilgenommen mit dem Círculo obrero de debate von Barcelona, der Red de Solidaridad von Alicante und verschiedenen Versammlungskollektiven von Valencia.
In den Versammlungen haben unsere Mitglieder zu konkreten Punkten interveniert: Verteidigung der Versammlungen, den Kampf auf die Arbeiterklasse ausrichten, Anregung von massenhaften Versammlungen in den Arbeits- und Studienzentren, Zurückweisung der demokratischen Forderungen, um sie durch den Kampf gegen die Kürzungen der Sozialausgaben zu ersetzen, die Unmöglichkeit, den Kapitalismus zu reformieren oder zu demokratisieren, während umgekehrt die einzige realistische Möglichkeit seine Zerstörung ist[34]. Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir auch aktiv an Quartiersversammlungen teilgenommen.
Nach dem „15M“ hat sich die Minderheit, die für eine Klassenorientierung eintritt, vergrößert und ist dynamischer sowie einflussreicher geworden. Sie sollte jetzt zusammen bleiben, eine Debatte führen, sich auf nationaler und internationaler Ebene koordinieren. Gegenüber der Gesamtheit der Arbeiterklasse muss sie eine Position behaupten, die ihre tiefsten Bedürfnisse und Ansprüche zusammenfasst: gegenüber den demokratische Lügen aufzeigen, was sich hinten der Parole „Alle Macht den Versammlungen!“ abzeichnet; gegenüber den demokratischen Reformforderungen den konsequenten Kampf gegen die Kürzungen im Sozialbereich führen; gegenüber den illusorischen „Reformen“ des Kapitalismus den zähen und beharrlichen Kampf im Hinblick auf die Zerstörung des Kapitalismus voranstellen.
Wichtig ist, dass sich in diesem Milieu eine Debatte und ein Kampf entwickeln. Eine Debatte über die zahlreichen Fragen, die sich in den letzten Monaten gestellt haben: Reform oder Revolution? Demokratie oder Versammlungen? Bürgerbewegung oder Klassenbewegung? Demokratische Forderungen oder Forderungen gegen die sozialen Angriffe? Generalstreik oder Massenstreik? Gewerkschaften oder Versammlungen? etc. Ein Kampf darum, die Selbstorganisation und den unabhängigen Kampf zu propagieren, und insbesondere ein Kampf zur Befähigung, die zahlreichen Fallen zu vermeiden und zu überwinden, die uns die herrschende Klasse unweigerlich stellen wird.
10.07.2011, C. Mir
[1] Internationale Revue Nr. 144 (franz./engl./span.): „Mobilisierungen der Rentner in Frankreich, Antwort der Studenten in Großbritannien, Arbeiterkämpfe in Tunesien – Die Zukunft liegt in der internationalen Entwicklung und indem wir die Kämpfe in die eigenen Hände nehmen.
[2] Ein Verantwortlicher von Caritas in Spanien - einer kirchlichen NGO, die sich der Armut widmet - gab an, dass „wir gegenwärtig von 8 Millionen Menschen sprechen, die daran sind, ausgeschlossen zu werden, und von 10 Millionen unter der Armutsgrenze“. Vgl. www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/tenemos-18-millones-de-excluidos-o-pobres-francisco-lorenzo-responsable-de-caritas.230828 [284]. 18 Millionen Menschen sind ein Drittel der Bevölkerung Spaniens! Und dies ist alles andere als eine spanische Besonderheit, der Lebensstandard der Griechen hat sich in einem Jahr um 8% verschlechtert.
[3] Auf sie werden wir detaillierter im nächsten Abschnitt eingehen.
[4] Vgl. Wir haben dieses Communiqué [285] in verschiedene Sprachen übersetzt.
[5] Zwei Parolen waren oft zu hören: „PSOE-PP - die gleiche Scheiße“ und „Ob mit Rosen oder mit Möwen, sie walzen uns platt!“, darauf anspielend, dass die Rose das Emblem des PSOE ist, während die Möwe dasjenige des PP.
[6] Um sich ein Bild von dieser Bewegung und ihren Methoden zu machen, vgl. unseren Artikel „Spanien: Bürgerbewegung Echte Demokratie jetzt! - staatliche Diktatur gegen Massenversammlungen [286]“, der in verschiedene Sprachen übersetzt ist.
[7] Dieses Zitat aus Rosa Luxemburgs Massenstreik, Partei und Gewerkschaften, das sich auf den großen Streik 1903 im Süden Russlands bezieht, passt wie ein Handschuh zur ausgelassenen Stimmung der Versammlungen ein Jahrhundert später.
[8] Vgl. „Offener Brief an die Versammlungen [287]“.
[9] Vgl. im Kapital „Feuerbach - Gegensatz von materialistischer und idealistischer Anschauung“, B. Die wirkliche Basis der Ideologie
[10] siehe dazu: „Der Zerfall, letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus“, in Internationale Revue Nr. 13
[11] siehe dazu: „Thesen über die Studentenbewegung in Frankreich im Frühling 2006“, https://de.internationalism.org/frank06 [288]
[12] Unserer Meinung nach liegt die Ursache dieser Schwierigkeiten in den Ereignissen von 1989, welche die fälschlich als „sozialistisch“ bezeichneten Regime zu Fall brachten und der herrschenden Klasse erlaubten eine großangelegte Kampagne über den „Tod des Kommunismus“, das „Ende des Klassenkampfes“ und das „Scheitern des Kommunismus“, usw. vom Zaun zu reißen, die mehrere Generationen von Arbeitern und Arbeiterinnen beeinflusste. Siehe: „Die Arbeiterklasse vor einer schwierigen Lage“, Internationale Revue Nr. 12
[13] Erinnern wir uns, wie zwischen Februar und Juni 1848 in Frankreich sich ebenfalls ein solches „großes Fest aller sozialen Klassen“ ereignete, das sich in den Junitagen steigerte, wo das Proletariat von Paris mit der Waffe in der Hand gegen die Provisorische Regierung kämpfte. Während der Russischen Revolution 1917 dominierte während Februar und April ebenfalls die Stimmung eines großen Zusammenschlusses unter der „revolutionären Demokratie“.
[14] Mit Ausnahme der extremen Rechten, welche getrieben durch ihren irrationalen Hass auf die Arbeiterklasse lauthals das verkündete, was sich die anderen Fraktionen der herrschenden Klasse nur im Versteckten zuflüsterten.
[15] Möglichkeit für die Bürger, eine gewisse Anzahl Unterschriften zu sammeln, um damit im Parlament Abstimmungen über Gesetze und Reformen zu erreichen.
[16] Die Demokratie basiert auf der Passivität und Atomisierung der überwiegenden Mehrheit und reduziert sie zu einer Summe von Individuen, die noch anfälliger und wehrloser werden, wenn sie denken, dass ihre Stimme eine Macht beinhalte. Vollversammlungen basieren auf einer diametral entgegen gesetzten Auffassung: Die Individuen sind deshalb stark, weil sie sich auf „den Reichtum ihrer sozialen Beziehungen“ (Marx) abstützen und sich in einen großen kollektiven Körper integrieren, von dem sie ein Teil werden.
[17] Als gäbe es eine „angemessene“ Repression!
[18] DRY verlangte, dass die Demonstranten jede „gewalttätige“ oder „verdächtig gewalttätige“ Person einkreisen und sie öffentlich an den Pranger stellen sollen!
[19] Die am weitesten zurück liegenden Ursprünge liegen in den Bezirksversammlungen während der Pariser Kommune, aber eigentlich bestätigten sie sich in der revolutionären Bewegung von 1905 in Russland, und seither brachte jede große Bewegung der Arbeiterklasse solche Strukturen mit unterschiedlichen Formen und Namen hervor: Russland 1917, Deutschland 1918, Ungarn 1919 und 1956, Polen 1980 … 1972 gab es in Vigo/Spanien eine städtische Vollversammlung, die 1973 in Pamplona und 1976 in Vitoria neu aufgelegt wurde. Wir veröffentlichten zahlreiche Artikel über die Ursprünge dieser Arbeiterversammlungen. Vgl. insbesondere die Serie „Was sind Arbeiterräte“ ab Nr. 140 der International Review (engl./frz./span. Ausgabe).
[20] In Cadiz organisiert die Vollversammlung eine Debatte über die prekäre Arbeit, an der viele Leute teilnehmen. In Caceres wird der Mangel an Nachrichten über die Bewegung in Griechenland gebrandmarkt, und in Almeria wird am 15. Juni ein Treffen zur „Lage der Arbeiterbewegung“ organisiert.
[21] Diese sind in Tat und Wahrheit ein zweischneidiges Schwert: Einerseits beinhalten sie positive Aspekte wie zum Beispiel die Ausweitung der massenhaften Debatte in die tieferen Schichten der Arbeiterbevölkerung und die Möglichkeit – die auch umgesetzt wurde -, Versammlungen gegen die Arbeitslosigkeit und die prekäre Arbeit zu initiieren, die die Vereinzelung und das Schamgefühl durchbrechen, mit denen viele Arbeitslose kämpfen, und damit die Lage der Verletzlichkeit zu ändern, in der sich die prekär Angestellten im Kleingewerbe befinden. Andererseits ist der negative Punkt, dass solche Quartierversammlungen auch dazu benützt werden, die Bewegung zu zerstreuen, die allgemeineren Sorgen vergessen zu lassen, sie in eine Dynamik der „Bürger“ einzuschließen, welche durch die Tatsache begünstigt wird, dass im Quartier – einem Rahmen, der die Arbeiter mit dem Kleinbürgertum, den Unternehmern, etc. vermischt – sich solche Sorgen vordrängen.
[22] Vgl. u.a. das „Anti-Gewalt-Protokoll“ esparevol.foroactivo.com [289]
[23] In der Koordination der Versammlungen der Quartiere und Vororte des Südens von Madrid befinden sich hauptsächlich die Delegierten der Arbeiterversammlungen der verschiedenen Sektoren, auch wenn sich einige kleine radikale Gewerkschaften ebenfalls beteiligen. Vgl. https://asambleaautonomazonasur.blogspot.com/ [290]
[24] Die Privatisierung von Teilen des öffentlichen Dienstes und der Sparkassen ist eine Antwort des Kapitalismus auf die Verschärfung der Krise und - konkreter - auf die Tatsache, dass der je länger je stärker verschuldete Staat gezwungen ist, seine Ausgaben zu senken mit der Folge einer unerträglichen Verschlechterung auch der wesentlichen Dienste. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass die Alternative zu den Privatisierungen nicht der Kampf für den Erhalt der Dienste in staatlicher Hand ist. Denn zunächst einmal bleiben die „privatisierten“ Dienstleistungen oft unter der organischen Kontrolle von staatlichen Institutionen, welche die Arbeit an private Unternehmen weiter vergeben. Hinzu kommt, dass der Staat und das staatliche Eigentum nichts „Soziales“ an sich haben und nichts zu tun mit einem irgendwie gearteten „Wohlergehen der Bürger“. Der Staat ist ein Organ, das ausschließlich im Dienste der herrschenden Klasse steht, und beruht auf der Lohnsklaverei. Dieses Problem beginnt, in gewissen Arbeiterkreisen diskutiert zu werden, so namentlich in der Versammlung von Valencia gegen die Arbeitslosigkeit und die prekäre Arbeit. kaosenlared.net/noticia/cronica-libre-reunion-contra-paro-precariedad
[26] Vgl. „Streik der Metallarbeiter in Vigo, Spanien: die proletarische Kampfmethode“ (/content/1016/streik-der-metallarbeiter-vigo-spanien-die-proletarische-kampfmethode [292]) und auch „Vigo/Spanien: Gemeinsame Vollversammlungen und Demonstrationen von Arbeitslosen und Beschäftigten“ (/content/1943/vigospanien-gemeinsame-vollversammlungen-und-demonstrationen-von-arbeitslosen-und [293])
[27] Dies bedeutet nicht, die Hindernisse zu unterschätzen, die das eigentliche Wesen des Kapitalismus, der auf der Konkurrenz und dem Misstrauen den anderen gegenüber beruht, diesem Prozess der Vereinigung in den Weg stellt. Dieser Prozess wird sich nur nach gewaltigen und vielfältigen Anstrengungen durchsetzen, die ihre Grundlage im gemeinsamen und massenhaften Kampf der Arbeiterklasse hat, einer Klasse, die kollektiv, mittels der assoziierten Arbeit die wesentlichen gesellschaftlichen Reichtümer schafft - und die deshalb in sich das gesellschaftliche Sein des Menschen trägt.
[28] Vgl. dazu diverse Artikel in unserer Presse, z.B. /content/1668/40-jahre-seit-mai-1968-das-ende-der-konterrevolution-das-historische-wiedererstarken [294]
[29] Vgl. die „Thesen über die Studentenbewegung in Frankreich im Frühling 2006“, /content/876/thesen-ueber-die-studentenbewegung-frankreich-im-fruehling-2006 [271], und „Griechenland: Der Aufstand der Jugend in Griechenland bestätigt die Entwicklung des Klassenkampfs“, in der Internationalen Revue Nr. 43
[30] Die Zensur über die Ereignisse in Griechenland und die massenhaften Bewegungen dort ist so vollständig, dass wir diese Geschichte nicht wirklich in unsere Analyse einbetten können.
[31] Von https://www.kaosenlared.net/ [295]
[32] International Review Nr. 20 (engl./frz./span. Ausgabe), „Über die Intervention der Revolutionäre: Antwort an unsere Kritiker“
[33] Vgl. die verschiedenen Artikel in der Presse / auf der Webseite, die jeden dieser Aspekte beleuchten.
[34] Dieses Anliegen ist nicht eine Besonderheit der IKS, vielmehr lautete eine ziemlich populäre Parole: „Realistisch zu sein, heißt antikapitalistisch zu sein!“, ein anderes Transparent erklärte: „Das System ist unmenschlich - seien wir gegen das System“.
Geographisch:
- Spanien [296]
Aktuelles und Laufendes:
- Indignados [297]
- Empörte in Spanien [298]
- Bewegung 15M [299]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [300]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [301]
Eurokrise - Staatsbankrotte...
- 2414 Aufrufe
Normalerweise schlägt die Schuldenfalle zu, wenn der Schuldner seine Schulden nicht mehr begleichen kann und insolvent wird. Dann kann der Gläubiger eine Reihe von Ansprüchen geltend machen (z.B. Pfändungen), wenn nötig mit Gerichtsvollzieher, Zwangsvollstrecker, Abtretungen usw. Dies ist die Alltagspraxis bei der Regelung von Insolvenzen. Was aber wenn ein Staat pleite geht? Zurzeit stehen immer mehr Staaten vor dem Staatsbankrott.
Verträge zwischen Staaten werden durch internationale, bilaterale oder multilaterale Übereinkommen zwischen Staaten abgesichert. Dies funktioniert meistens gut, weil das Überleben der Nationalstaaten vom Welthandel und internationalen Finanzsystem abhängt. In Anbetracht des Staatsbankrotts von immer mehr Staaten – auch und vor allem im Euro-Bereich – stellt sich mittlerweile heraus, dass es keine Instanz gibt, die die üblichen Insolvenzmaßnahmen gegenüber einem bankrotten Staat durchsetzen kann.
Der berühmte Artikel 125 des Europäischen Vertrages, der die Grundlage der gemeinsamen europäischen Währung ist, sieht vor, dass im Falle eines Bankrotts eines Mitgliedstaates kein anderer Mitgliedsstaat haften oder unterstützend einspringen muss. Dies bedeutet, dass unter solchen Bedingungen ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden muss. Es ist mittlerweile klar geworden, dass zum Zeitpunkt, als der Vertrag aufgesetzt wurde, keiner der Verantwortlichen diesen schlimmsten Fall, der in Artikel 125 behandelt wird, jemals für möglich gehalten hatte. Aber die Wirklichkeit hat sie überholt, denn nunmehr stehen Griechenland und andere Staaten vor dem Bankrott. Und was ist aus diesem Insolvenzverfahren geworden? Es hat bislang nicht stattgefunden. Warum nicht? Die üblichen Erklärungen lauten, dass dann Griechenland aus der Eurozone ausscheren müsste (obwohl dies nicht sicher ist), und dass dies das Ende des Euro bedeuten würde (auch das ist nicht sicher!). Eine Insolvenz würde in solch einem Fall wahrscheinlich zu einem „haircut“ für Griechenland führen, wie es die Experten nennen: ein Teil der Schulden würde gestrichen, aber gleichzeitig würde der souveräne griechische Staat teilweise „enteignet“.
In Wirklichkeit aber gibt es solch einen Insolvenzmechanismus für Nationalstaaten, der jetzt eigentlich nötig wäre, nirgendwo auf der Welt, und genauso wenig gibt es irgendwelche Institutionen, die solch eine Insolvenz durchsetzen könnten. Auf diesem Hintergrund würde ein Insolvenzverfahren zum Beispiel in Griechenland unter ganz chaotischen, unkontrollierbaren Bedingungen stattfinden, ohne irgendwelche solide staatliche Regulierung. Unter diesen Bedingungen würde in der Tat der Euro in Gefahr geraten, ja das ganze internationale Finanzgefüge. Deshalb sind diese Institutionen gezwungen gewesen, Griechenland, Irland und Portugal mit immer neuen Rettungspaketen zu versehen. Wahrscheinlich werden sie bald Spanien und Italien „retten“ müssen. Es liegt auf der Hand, dass dieser ganze Prozess nicht endlos so weitergehen kann.
Die Weltwirtschaftskrise 1929 war damals die schlimmste Wirtschaftskrise; sie war die erste große Krise im niedergehenden Kapitalismus. Aber das Ausmaß dieser Katastrophe wurde noch verschlimmert durch zwei schwere „Fehler“ einer noch ziemlich unerfahrenen herrschenden Klasse: Man drehte den Kredithahn zu und ließ der Autarkie freien Lauf. Mittlerweile hat die herrschende Klasse die Lehren aus diesen Ereignissen gezogen. Gegenüber der Zuspitzung der Wirtschaftskrise hat sie mit der Vergabe von noch mehr Krediten reagiert und mit verschiedenen Maßnahmen zum Ausbau des internationalen Wesens der Weltwirtschaft. Aber nunmehr werden die Grenzen dieser Maßnahmen immer deutlicher – auch für die herrschende Klasse. Es wird immer offensichtlicher, dass das Ausmaß des Schuldenbergs selbst zum zentralen Problem geworden ist. Heute ist die Gefahr von zahlungsunfähigen Nationalstaaten, die zum Auseinanderbrechen des Weltmarktes führen können, noch größer als die Auseinandersetzungen um den Zugang zu den Märkten.
Vermutlich wäre Europa die wahrscheinlichste Bruchstelle, da es sich um eines der Hauptzentren der Weltwirtschaft handelt und es gleichzeitig in eine Reihe von Nationalstaaten gespalten ist. Falls es dazu kommen sollte, wären auch heute wie 1929 (seinerzeit Deutschland und die USA) die höchst entwickelten Industriestaaten die Hauptleidtragenden (zu denen Deutschland und China gehören).
Die einzige „Alternative“ gegenüber einem Auseinanderbrechen des Weltmarktes scheint aus der Sicht der Herrschenden darin zu bestehen, dass eine Reihe von mächtigeren Staaten den schwächeren Nationalstaaten die Souveränität raubt, so dass diese dazu gezwungen würden, sich wegen ihres Bankrotts den „Gesetzen“ und „Regeln“ der Stärkeren zu unterwerfen. Innerhalb der Europäischen Union scheint ein solches Tauziehen eingesetzt zu haben, vor allem zwischen Berlin und Athen (als Repräsentanten der beiden extremsten Positionen). Athen hat damit gedroht, die ihm auferlegten Bedingungen nicht zu akzeptieren, oder es hat Gerüchte verbreitet, man werde die Euro-Zone verlassen – um so zu versuchen, bessere Bedingungen für sich herauszuschlagen. Berlin und „Brüssel“ an seiner Seite sind mehr und mehr dazu übergangen, dem griechischen Kapital und seiner Regierung ihre Wirtschaftspolitik zu diktieren. Unter anderem wird Athen dazu gezwungen, große Teile seiner verstaatlichten Wirtschaft zu privatisieren. Diese Maßnahmen dienen nicht dazu, Geld zusammenzukratzen, um damit Schulden oder auch nur Schuldzinsen zu begleichen, sondern um die Kontrolle über die Schaltstellen seiner Wirtschaft zu übernehmen.
Seit 1989 wird die Weltwirtschaft nicht mehr unter den gleichen Rahmenbedingungen betrieben, wie zur Zeit der beiden imperialistischen Blöcke nach dem 2. Weltkrieg. Die Art Disziplin, welche die stärkeren Länder den schwächeren aufzuzwingen versuchen, mit dem Ziel, ein Mindestmaß an Regeln in der Weltwirtschaft einzuhalten und „vertragstreu“ zu bleiben, kann sich nicht mehr auf die drohende Rolle eines imperialistischen Blockführers stützen. Solch eine Disziplin durchsetzen könnte nur eine führende Regionalmacht (wie zum Beispiel Deutschland in Europa) – aber das müsste dann Schritt für Schritt, pragmatisch, empirisch und unvermeidlich total chaotisch erfolgen. Zu Beginn der „Griechenlandkrise“ verbarg die herrschende Klasse in Deutschland kaum ihre Methoden des Umgangs mit solch einer Lage. Jedes Mal, wenn die „Rettung Griechenlands“ zur Debatte stand, verlangte Berlin die Errichtung eines förmlichen „Insolvenzverfahrens“ für die Eurozone. Aber es musste bald einsehen, dass dieses Ziel, zumindest unmittelbar, politisch nicht durchsetzbar war. Ist es überhaupt durchsetzbar? Ökonomisch vielleicht, wenn man die Abhängigkeit eines Landes wie Griechenland von den zentralen Ländern berücksichtigt, die in Anbetracht der grenzenlos wachsenden Schulden nur noch weiter zunehmen wird. Auf der anderen Seite aber verfügen diese Länder paradoxerweise über mehr Möglichkeiten, die größeren Staaten zu erpressen, je mehr ihre Schulden zunehmen. Sie können zum Beispiel damit drohen, ihre Zahlungen einzustellen, mit anderen Worten keine Politik des traditionellen „nationalen Widerstandes“, sondern eine Politik des reinen „Vandalismus“, Chaos schaffen, etwas zum Einsturz bringen.
Damit beschränken sich die Probleme nicht nur auf den Bereich der Wirtschaft, sondern sie werden politisch. Schwächeren Ländern ihre Souveränität zu rauben, heißt Öl aufs Feuer des Nationalismus zu gießen. Aber nicht nur das. Wenn Länder wie Deutschland oder Frankreich für Rettungspakete in einer Reihe anderer Staaten blechen müssen, ohne Aussicht auf eine effektive Reduzierung der Schulden, kann dies langfristig zu einer Explosion des politischen Populismus in den zentralen Ländern selbst führen und es wäre dann nicht ausgeschlossen, dass „unverantwortliche“, unberechenbare Flügel der Herrschenden die Regierung übernehmen, die eine engstirnige und bornierte Form des Nationalismus praktizieren würden, und für welche die Aufrechterhaltung einer „funktionierenden“ Weltwirtschaft keine Priorität mehr wäre. Wie zwischen 1914-45 würde eine Phase kapitalistischer Globalisierung zu einer ökonomischen Zersplitterung und nationalistischen Vandalismus führen. Wir denken dabei nicht unbedingt an den Aufstieg faschistischer Regime wie in den 1920er und 1930er Jahren, da wir nicht mehr in einer Zeit der Konterrevolution leben. Aber es liegt auf der Hand, dass das Aufblühen des Nationalismus heute auf dem Hintergrund einer zerfallenden Gesellschaft große Probleme nicht nur für die Herrschenden mit sich bringt, sondern auch für die Arbeiterklasse. In Kairo und Athen sieht man oft Nationalfahnen bei Kundgebungen, nicht dagegen in Madrid und Barcelona! Aber natürlich beschränkt sich die Frage der „schwachen Glieder“ unter den Nationalstaaten nicht nur auf Europa; ein Blick auf die Beziehung zwischen den USA und China und den schwebenden Bankrott des US-Staats genügt. Hier verläuft die Nahtstelle nicht zwischen stärkeren und schwächeren Staaten, sondern zwischen den beiden Großen der Weltwirtschaft überhaupt, mit unglaublicher Sprengkraft für die Weltwirtschaft insgesamt. 22.7.2011
Aktuelles und Laufendes:
- Staatsbankrotte [302]
- Eurokrise [303]
- staatliche Insolvenzen [304]
Kapitalismus und Umweltzerstörung: Die Menschheit am Scheideweg
- 4602 Aufrufe
Ein Blick auf die Katastrophenbilanz der jüngsten Vergangenheit reicht aus, um zu begreifen, dass die Menschheit sich bereits heute mit den Folgen der von ihr – oder besser: von der kapitalistischen Produktionsweise – verursachten Veränderung des globalen Klimas konfrontiert sieht. Ob die verheerenden Waldbrände in Russland oder die nicht minder schlimme Überschwemmungskatastrophe in Pakistan im vergangenen Jahr, ob die Häufung von außergewöhnlich kalten Wintern in Europa oder die Heimsuchung der USA von immer zerstörerischeren Tornados, die eine Spur der Verwüstung hinter sich lassen – all dies und vieles mehr lässt sich in seiner Häufung und Intensität nur um den Preis der Lächerlichkeit mit klimatischen Kapriolen, mit den „Launen der Natur“ erklären. All diese Katastrophen sind – darüber gibt es in der seriösen Wissenschaft keinen ernsthaften Zweifel mehr - direkt oder indirekt Folgen der von Menschenhand verursachten Erderwärmung. Und als ob dies nicht genug wäre, reißen die Meldungen über katastrophale Havarien im kapitalistischen Produktionsapparat nicht ab: im letzten Sommer die Explosion der „Deepwater Horizon“ im Golf von Mexiko (deren Langzeitfolgen sich bereits heute im Massensterben von größeren Meerestieren äußert), nun die Kernschmelze der Atomreaktoren von Fukushima (unter deren Folgen die japanische Bevölkerung noch lange Zeit zu leiden haben wird), um nur die größten zu nennen.
Ist die Welt angesichts all dessen noch zu retten? Und wenn ja, wie?
Umweltkatastrophen gestern und heute
Dass der Mensch mit seiner Produktionsweise imstande ist, seine eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, ist beileibe keine Erfahrung, die sich ausschließlich auf den Kapitalismus beschränkt. Spätestens mit der Einführung der Sesshaftigkeit und der Landwirtschaft (der so genannten neolithischen Revolution vor rund 11.000 Jahren in der Region des so genannten Fruchtbaren Halbmonds) ging es dem Menschen vornehmlich darum, der natürlichen Umwelt urbares Land „abzuringen“, die Naturkräfte zu „zähmen“ – oder um es in den Worten der Bibel zu sagen: sich die Erde „untertan“ zu machen. Der Erfolg einer jeden Gesellschaft, der Aufstieg von Hochkulturen maß sich nun an ihrer Fähigkeit, die Grundlagen für das Wachstum ihrer Bevölkerung zu legen. Bereits die frühgeschichtlichen Häuptlings-und Priestergesellschaften griffen dabei massiv in die natürliche Umwelt ein, indem sie durch Brandrodungen und Be- und Entwässerungssysteme die Wildnis urbar machten und die Urwälder u.a. für ihre Sakralbauten abholzten.
Dabei liefen insbesondere jene Völker Gefahr, Opfer ihres eigenen Erfolges zu werden, die sich in ökologisch besonders sensiblen Regionen angesiedelt hatten. Etliche von ihnen schwangen sich zu großartigen kulturellen Zeugnissen auf, um anschließend nicht einfach nur als Gesellschaft zu kollabieren, sondern auch physisch zu verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen (ausgenommen ihre Artefakte) – wie die Maya im heutigen Mexiko, die kulturell am höchsten entwickelte Gesellschaft der präkolumbianischen Neuen Welt (eigene Schrift, Städtebau), die um 3000 v.Chr. aus dem Dunklen der Geschichte auftauchten und deren Spuren sich um 900 n. Chr. im Nichts verloren, oder die Anasazi im heutigen New Mexico im Südwesten der USA, eine Hochkultur (600-ca.1150n.Chr.), die in der Lage war, Häuser von einer Höhe zu bauen, die erst von den Wolkenkratzern im 19. Jahrhundert übertroffen wurden, oder die Osterinsulaner mitten im Pazifik, von denen nicht viel mehr übrig blieb als eine Unzahl imposanter, metergroßer Götzenstatuen. Noch heute liegt ein großer Teil der Geschichte dieser Völker im Verborgenen. Doch eine Fülle von Indizien spricht dafür, dass es - neben den auch in den frühen Klassengesellschaften üblichen Phänomenen wie Krieg und Konkurrenz - der Verlust der natürlichen Lebensgrundlage war, der diese Gesellschaften zunächst in den Kollaps, dann in den Kannibalismus trieb und schließlich auslöschte. All ihnen war gemeinsam, dass sie in relativ regenarmen Breitengraden existierten, deren Vegetation eine vergleichsweise geringe Wachstums- und Regenerationsrate aufwies – eine Rate, die nicht Schritt halten konnte mit dem Raubbau durch den Menschen. Letztendlich führten Bevölkerungsdruck und Konkurrenz, das Füttern von immer mehr hungrigen Mäulern und die Befriedigung der Imponierbedürfnisse der Herrschenden[1] zuerst zur Entwaldung, dann zur Bodenerosion und –versalzung und schließlich zur Desertifikation. Um es bildlich auszudrücken: diese Gesellschaften sägten an dem Ast, auf dem sie selbst saßen.
Fazit: alle Klassengesellschaften, angefangen von den frühgeschichtlichen Häuptlings- und Priestergesellschaften über die antiken Sklavenhaltergesellschaften und die mittelalterlichen Feudalgesellschaften bis hin zum modernen Kapitalismus, haben sich an der Umwelt „versündigt“. So wie sie die menschlichen Arbeitskräfte ausgebeutet haben, so haben sie auch die natürlichen Schätze unserer Erde geplündert und dabei in vielen Fällen buchstäblich verbrannte Erde hinterlassen. Doch es hieße, die Umweltzerstörung im Kapitalismus zu bagatellisieren, beließe man es bei dieser eher banalen Feststellung. In der Tat hat die Zerstörung der natürlichen Umwelt im Kapitalismus Dimensionen erreicht, die sich qualitativ wie quantitativ von den Brandrodungen, Abholzungen und Überweidungen in vorkapitalistischen Gesellschaften unterscheiden:
· Die Auswirkungen der vorkapitalistischen Umweltzerstörung waren allenfalls regionalen Charakters und blieben in der Regel überschaubar – bis auf die oben genannten Beispiele von ökologisch besonders sensiblen Umwelten. Die Folgen der Umweltzerstörung im Kapitalismus haben dagegen längst globale Ausmaße angenommen; mögen sich einige Staaten im „Ruhm“ ihrer angeblichen ökologischen Politik noch so sehr sonnen – auch sie sind Leidtragende der Globalität der Umweltzerstörung. Darüber hinaus sind die Folgen des alltäglichen Umweltfrevels im Kapitalismus auch unüberschaubar geworden. Überall lauern tickende Umweltzeitbomben, drohen unübersehbare Gefahren mit Langzeitwirkung, sieht sich die Menschheit einem globalen Feldversuch des Kapitalismus mit zweifelhaftem Ausgang ausgesetzt.
· Die frühgeschichtlichen, aber auch die antiken und mittelalterlichen Gesellschaften waren noch weitestgehend in Unkenntnis über die größeren Zusammenhänge des natürlichen Kreislaufes und somit über die langfristigen Folgen ihrer Eingriffe in die Umwelt. Sie eroberten sich mit Brandrodungen ihren Lebensraum, weil sie eine nachhaltigere Bewirtschaftung des Bodens schlicht und einfach noch nicht kannten. Sie holzten die Urwälder ab, weil sie in ihnen eine bedrohliche Wildnis wahrnahmen und nicht ihre eminent wichtige Bedeutung für den eigenen Lebensraum. Der Kapitalismus rennt dagegen sehenden Auges in den Abgrund. Der „Club of Rome“ in den 1960er Jahren, danach die unzähligen staatlichen, nicht-staatlichen und supranationalen Umweltinstitutionen und nun der Weltklimarat – der Weg des Kapitalismus in den ökologischen Abgrund war und ist gesäumt von unzähligen Mahnern und Kritikern, die seit Jahr und Tag dem Kapitalismus in Sachen Umweltverschmutzung den Spiegel vorgehalten haben.
· Der ökologische Raubbau in den vorkapitalistischen Gesellschaften war der Unterentwicklung ihrer Produktivkräfte geschuldet. Ihnen fehlte die entsprechende Technik für einen schonenderen Umgang mit der natürlichen Umwelt. So griffen die Menschen dieser Gesellschaften in Ermangelung anderer Energiequellen auf Brennholz zur Aufbereitung ihrer Lebensmittel, zur Herstellung ihrer Werkzeuge und zur Beheizung ihrer Häuser zurück, was zur Vernichtung unzähliger Wälder führte. Im Kapitalismus dagegen wird die Umwelt trotz und wegen der hochentwickelten Produktivkräfte zerstört. Einerseits basiert die ungeheure Leistungskraft und Mobilität des modernen Kapitalismus auf der Verfeuerung fossiler Brennstoffe, was zu eben jener fatalen Aufheizung der Atmosphäre geführt hat, unter deren Folgen wir heute bereits leiden. Andererseits hat die kapitalistische Produktionsweise der Menschheit auch die technologischen Möglichkeiten verliehen, auf andere Energieformen auszuweichen, ohne in die Steinzeit zurückzufallen. Die technischen Mittel für eine nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Umwelt sind längst vorhanden, allein es fehlt der Wille und das Vermögen der herrschenden Klasse.
· In den vorkapitalistischen Gesellschaften waren es neben den Überlebensbedürfnissen der Menschen vor allem die Machtgelüste der Herrschenden, die die natürliche Umwelt in Mitleidenschaft zogen. So wurden die Wälder Siziliens zugunsten des Aufbaus einer großen Kriegsflotte geopfert, die das junge Römische Reich in den so genannten Punischen Kriegen in den letzten drei Jahrhunderten vor Christi Geburt gegen Karthago benötigte. Ähnlich erging es den Wäldern Spaniens, die im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen dem spanischen Thron und dem aufstrebenden, kapitalistischen Großbritannien Ende des 16. Jahrhunderts für den Aufbau der „Armada“ abgeholzt wurden. Im Kapitalismus gibt es jedoch daneben noch einen weiteren Faktor, der zur Umweltzerstörung beiträgt: die Jagd nach den Profiten. Sie ist zum beherrschenden Faktor bei der täglichen Zerstörung unserer Biosphäre geworden. Zum Zweck der Profitmaximierung werden die Flüsse verseucht, die Böden vergiftet, Regenwälder abgeholzt, Landschaften zubetoniert, die Weltmeere leergefischt und zugemüllt und nicht zuletzt der Mensch krank gemacht.
Wie lernfähig ist der Kapitalismus?
Spielen wir einmal den Advocatus diaboli und untersuchen die Substanz der „grünen“ Politik, derer sich nicht nur die politische Klasse, sondern auch so mancher Topmanager hierzulande rühmt. Hat der Kapitalismus in den hochentwickelten Ländern nicht bewiesen, dass er in Sachen Ökologie lernfähig ist? Hat er nicht dafür gesorgt, dass sich die Luft- und Wasserqualität in den Industrieländern in den vergangenen Jahrzehnten deutlich verbessert hat? Der Smog in den Ballungsgebieten und das Umkippen ganzer Seen und Flüsse gehören dort zweifellos der Vergangenheit an. Und hat sich das kapitalistische Regime nach zähem Widerstand nicht schließlich zu einem Verbot verschiedener hochgiftiger Substanzen wie DDT, Asbest etc. durchgerungen? Dem Waldsterben ist dank der Einführung von Rauchgasentschwefelungsanlagen in den Kraftwerken allem Anschein nach Einhalt geboten worden; der Benzinverbrauch pro PKW ist dank etlicher technologischer Verbesserungen im Laufe der letzten Jahrzehnte erheblich gesenkt worden. Illegale Giftmülldeponien, die noch in den 70er Jahren in den Medien skandalisiert wurden, gibt es nicht mehr, dafür aber jede Menge Naturparks, Nationalreservate, Renaturierungen. Daneben hat sich eine mächtige Umweltbewegung etabliert, der sich mittlerweile kein etablierter Politiker mehr entziehen kann. Und kaum ein Konzern kann es sich leisten, auf eins der Öko-Labels zu verzichten, um seine Waren loszuwerden.
Ist es dem Kapitalismus der Industrieländer also gelungen, über seinen Schatten zu springen? Angesichts der Tatsache, dass die westlichen Industrieländer noch immer den mit Abstand größten Beitrag zur Verschmutzung der Atmosphäre leisten und immer noch Spitzenreiter im Energieverbrauch sind, relativieren sich allerdings die umweltpolitischen Leistungen der staatskapitalistischen Regimes in Europa, Nordamerika und Japan. Dies umso mehr, als dass bestimmte ökologische Erfolge wie die unbestreitbare Verbesserung der Luft- und Wasserqualität in erster Linie ein Abfallprodukt massiver Umstrukturierungen in der Industrielandschaft bzw. der De-Industrialisierung sind, die in vielen traditionellen Industrienationen im Laufe der 70er, 80er und 90er Jahre um sich gegriffen haben. Und kaum sind die alten Umweltgefahren gebannt, tauchen neue am Horizont auf. Smog war gestern, heute wird die Bevölkerung der fortgeschrittenen Industrieländer vom Albtraum der radioaktiven und chemischen Verseuchung heimgesucht (Tschernobyl, Seveso, Bhopal, Fukushima). Die Gewässer sind heute zwar frei von Tensiden und industriellen Abwässern, dafür lassen sich im Wasser fast aller Flüsse und Seen Spurenelemente von Pharmazeutika wie die Antibabypille nachweisen. Die Verseuchung der Böden mit DDT und anderen Chemiekeulen ist Vergangenheit, die Verschmutzung der Weltmeere (nebst ihrer Überfischung) durch Kunststoffabfälle dagegen traurige Gegenwart. Alljährlich werden rund 6,5 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren entsorgt. Mit fatalen Folgen für Mensch und Umwelt: mittlerweile sind für die Kunststoffherstellung notwendige Chemikalien, insbesondere die so genannten Weichmacher, selbst im Blut von Eskimos nachgewiesen worden.
Doch abgesehen von diesen „Kleinigkeiten“ hat der niedergehende Kapitalismus des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts vor allen Dingen eins bewirkt: Mit der Entfesselung des Freihandels durch die GATT-Abkommen in den 90er Jahren und der Öffnung Chinas gegenüber dem Weltmarkt hat eine Globalisierung der Umweltzerstörung stattgefunden, die jeglichen Umweltschutz in den westlichen Industrieländern, selbst wenn er ehrlich gemeint wäre, wirkungslos verpuffen lässt. Alle Experten sind sich darüber einig, dass eine Industrialisierung der Schwellenländer nach dem Vorbild der westlichen Konsumgesellschaft die bereits feststehende Erwärmung der Atmosphäre (zwischen zwei und vier Grad Celsius) vervielfachen würde. Angesichts dieser globalen Dimensionen der Zerstörung unserer „äußeren Natur“ sind nationale Alleingänge zwecklos; was nottut, ist ein globales Vorgehen aller Länder, ist mithin nichts Geringeres als eine Weltgemeinschaft, die den kapitalistischen Zug in den Abgrund zum Halten bringt, eine Gesellschaft, die planvoll und vereint eine Kurskorrektur herbeiführt.
Nun ist es nicht so, dass sich die Weltbourgeoisie dessen nicht bewusst wäre. Die zahllosen supra- und transnationalen Institutionen, die in den letzten Jahrzehnten im Umweltbereich gegründet wurden, stehen für den Versuch der kapitalistischen Klasse, die nationalstaatliche Fragmentierung angesichts der gewaltigen Herausforderungen, die sich auch und gerade auf dem Gebiet des Umweltschutzes stellen, zumindest teilweise zu überwinden. Einige Teile der Bourgeoisie sind in ihrem Denkprozess noch weiter gegangen. So hat der „Wissenschaftliche Beirat der deutschen Bundesregierung zur Großen Umweltveränderung“ (wbgu.de) der Öffentlichkeit in diesem Sommer einen „Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“ vorgestellt, der nichts anderes als den Abschied vom „kohlenstoffbasierten Weltwirtschaftsmodell“ ankündigt. Die Autoren – Wissenschaftler bzw. Wissenschaftsfunktionäre diverser Disziplinen – scheuen nicht davor zurück, diese „Transformation“[2] in einem Atemzug mit der neolithischen und der industriellen Revolution zu nennen. Im Unterschied zu den bisherigen Umwälzungen, fahren die Autoren des Beirats fort, bestehe „die historisch einmalige Herausforderung bei der nun anstehenden Transformation zur klimaverträglichen Gesellschaft (…) darin, einen umfassenden Umbau aus Einsicht, Umsicht und Voraussicht voranzutreiben“. Die Autoren gehen sogar noch weiter und wagen den Nationalstaat als „alleinige Grundlage“ für den angestrebten neuen „Gesellschaftsvertrag“ anzuzweifeln; sie streben nichts Geringeres als eine „Kooperationsrevolution“ an.
Und genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Denn hier zeigen sich die Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise. Unsere Gesellschaft, deren Grundlage eigentlich die assoziierte Arbeit ist, hat die Konkurrenz unter den Menschen zu ihrem Lebensprinzip und Hauptantrieb gemacht. Sie stellt den Egoismus vor dem Gemeinsinn und ist zerrissen von tausenderlei Partikularinteressen. Nirgendwo wird dabei die Unfähigkeit des Kapitalismus zu einem einheitlichen Handeln deutlicher demonstriert als in der Frage der Ökologie. Kyoto und Kopenhagen, Schauplätze der letzten beiden Umweltkonferenzen vor Cancún, stehen für das jämmerliche Versagen der internationalen Staatengemeinschaft; beide Konferenzen scheiterten an den nationalen Egoismen der Beteiligten. Die einen – Industrieländer wie Japan, Skandinavien, der deutschsprachige Raum, etc. – drängen auf die Einführung neuer Umweltstandards, denn sie versprechen sich davon Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz, da sie im Laufe der letzten Jahrzehnte ein beachtliches Know-how in umweltschonenden Produktionsverfahren und –anlagen erworben und ihre Claims auf diesem Markt bereits abgesteckt haben. Die Anderen – die Entwicklungsländer, sog. Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien, aber auch Industrieländer wie die USA – sträuben sich mit Händen und Füßen gegen eben jene Standards, weil sie befürchten, dass sie in ihrer Aufholjagd von den etablierten Industrieländern ausgebremst werden bzw. gegenüber ihren Konkurrenten ins Hintertreffen geraten. Der Umweltschutz ist mithin selbst zum Gegenstand der Konkurrenz unter den imperialistischen Staaten geworden.
Die kapitalistische Produktionsweise generiert aber nicht nur tödliche Konkurrenz, sie ist auch eine planlose, erratische Wirtschaftsform, deren „ordnende Hand“ (Adam Smith), der Markt, nur auf unmittelbare Nachfrage reagiert, nicht aber auf langfristige Erfordernisse und schon gar nicht auf die Bedürfnisse der natürlichen Umwelt. Nur so ist zu erklären, warum sich die Manager der deutschen Automobilindustrie anlässlich regelmäßiger Rekordabsätze auf dem chinesischen Markt die Hände reiben, obwohl sie wissen, dass eine Motorisierung der chinesischen Bevölkerung katastrophale Auswirkungen auf unser Klima hätte. Nur so ist auch zu erklären, warum die petrochemische Industrie unbeirrt auf Wachstumskurs ist, obwohl die globalen Ölförderkapazitäten, der sog. oil peak, seit einigen Jahren bereits ihr Maximum überschritten haben. Nur so ist zu erklären, dass Shell, BP und die anderen Ölkonzerne mit ihrer üblen Praxis der Gasabfackelung bei der Erdölförderung jährlich mehr als vier Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen. In dieser Vogel-Strauß-Politik offenbart sich das ganze Dilemma der kapitalistischen Produktionsweise. Ihre Protagonisten sind nicht Herren über ihr eigenes Geschick; sie sind zur Akkumulation verdammt und verschwenden keinerlei Gedanken für die Konsequenzen ihres Handelns. Um es in den Worten von Engels zu formulieren: „… jede auf Warenproduktion beruhende Gesellschaft hat das Eigentümliche, daß in ihr die Produzenten die Herrschaft über ihre eigenen gesellschaftlichen Beziehungen verloren haben. Jeder produziert für sich mit seinen zufälligen Produktionsmitteln und für sein besondres Austauschbedürfnis. Keiner weiß, wieviel von seinem Artikel auf den Markt kommt, wieviel davon überhaupt gebraucht wird, keiner weiß, ob sein Einzelprodukt einen wirklichen Bedarf vorfindet, ob er seine Kosten herausschlagen oder überhaupt wird verkaufen können. Es herrscht Anarchie der gesellschaftlichen Produktion.“[3] Die „Zwangsgesetze der Konkurrenz“ (ebenda) lassen den einzelnen Kapitalisten (aber auch den einzelnen Staaten) keine andere Wahl, als die Rentabilität vor der Nachhaltigkeit, den Profit vor den gesellschaftlichen (und ökologischen) Nutzen zu stellen.
Um zur Ausgangsfrage dieses Kapitels zurückzukehren: es bestehen ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit des Kapitalismus als globales System, rechtzeitig und adäquat auf eine derart existenzielle Gefahr wie die globale Erwärmung der Atmosphäre zu reagieren. Nichts spricht dafür, dass sich die kapitalistischen Führer der Weltgemeinschaft zu einem gemeinsamen und entschlossenen Handeln zusammenraufen werden, um noch Schlimmeres zu verhüten. Im Gegenteil: selbst jene Staaten, denen eine gewisse Vorreiterrolle in Sachen Umweltschutz nachgesagt wird, schlagen schnell alle ökologischen Vorbehalte in den Wind, wenn es um ihre nackten ökonomischen Interessen geht.[4] Was wunder, dass die Emporkömmlinge aus den sog. BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) in dem Bohei der Führer der westlichen Welt um den Umweltschutz nur ein billiges Manöver wittern und nicht im Traum daran denken, von ihrem Wachstumskurs abzuweichen. Ein grundsätzlicher Kurswechsel sieht anders aus. Die Jagd nach Rohstoffen für den unersättlichen Appetit des Kapitals geht unvermindert weiter, ja hat sich verschärft, weil neben den etablierten Industrieländern nun auch die Emporkömmlinge aus Asien und Lateinamerika mitmischen. Nachdem der Kapitalismus bereits zu Lande eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen hat, ist er nun dabei, nun auch die letzten natürlichen Refugien, die Antarktis und die Tiefsee auszuplündern (Erdöl, Mangan und viele andere Rohstoffe) – mit unabsehbaren Folgen für unseren Planeten.
Hatte der „juvenile Kapitalismus“ (R. Luxemburg) des 18. und 19. Jahrhunderts der Menschheit neue Lebensräume erschlossen, so ist er nun, in seiner Niedergangsphase, im Begriff, dieselben wieder zu zerstören und darüber hinaus den Rest der Welt unbewohnbar zu machen. Der dekadente Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts zehrt nur noch von seiner eigenen Substanz. Oder anders ausgedrückt: er befindet sich mitten in einem Prozess der Kannibalisierung. So wie er auf der ökonomischen Ebene seit Jahrzehnten nur mittels astronomischer Schulden überleben kann und dabei die Zukunft der Menschheit buchstäblich ruiniert, so opfert er die natürlichen Lebensgrundlagen der Menschheit auf dem Altar des kurzfristigen Profits. Kurzum: die Gegenwart des Kapitalismus bedroht die Zukunft der Menschheit.
Ökologie, Klassenkampf und Kommunismus
Was haben die Frage der Emanzipation der Frau und die Frage des Umweltschutzes gemeinsam? Beide sind Schlüsselfragen für die Menschheit im Allgemeinen und für die Arbeiterklasse im Besonderen. Die Befreiung der Frau, dem ersten Opfer von Unterdrückung und Ausbeutung in der Menschheitsgeschichte, ist gewissermaßen das Synonym für den Kommunismus, die klassenlose Gesellschaft; der Schutz der natürlichen Umwelt, die Aussöhnung des Menschen mit seiner äußeren Natur kann erst allgegenwärtige Realität werden, wenn Ausbeutung und Unterdrückung überwunden sind und somit der Entfremdung des Menschen vom Mitmenschen, aber auch von der natürlichen Umwelt ein Ende gesetzt ist. Dennoch ist weder die Frauenbewegung noch die Umweltschutzbewegung der Schlüssel zur Überwindung des Status quo. Beide zeichnen sich dadurch aus, dass sie Ein-Punkt-Bewegungen sind, die sich mit Symptomen statt mit ihren Ursachen auseinandersetzen. Die Aktivisten dieser Bewegungen ignorieren, dass diese Ursachen in erster Linie in der spezifischen kapitalistischen Produktionsweise zu suchen sind. Und nicht in den bösen Absichten ihrer Protagonisten.
Die natürliche Umwelt wird nicht durch Appelle an den „guten Willen“ der kapitalistischen Regimes vor ihrer Zerstörung beschützt, sondern allein durch die Ersetzung dieser räuberischen Wirtschaftsweise durch ein nachhaltigeres Wirtschaften nicht nur mit den natürlichen, sondern auch mit den menschlichen Ressourcen. Dass dies aber nur auf dem Weg einer Revolution an Haupt und Gliedern unserer Zivilisation geschehen kann, versteht sich von selbst. Die Umweltfrage kann nur im Rahmen der sozialen Frage gelöst werden oder gar nicht. Während Umweltschutzbewegungen, so militant sie sich auch gebärden mögen, in ihrer Limitiertheit unweigerlich in die reformistische Spur geraten, lauert in jedem Streik der Arbeiterklasse, das hat bereits der preußische Innenminister Puttkamer erkannt, „die Hydra der Revolution“. Das mag in Jahren der sozialen Grabesruhe etwas anmaßend klingen, bewahrheitet sich in Krisenzeiten, wie sie heute herrschen, allerdings umso mehr. Eine Wirtschafts- und Finanzkrise, wie sie die Welt seit einigen Jahren in Atem hält, ist weitaus brisanter, rückt sie doch das Verhältnis zwischen den beiden großen Gesellschaftsklassen, Bourgeoisie und Proletariat, gewissermaßen wieder gerade: hier eine dünne Schicht von Superreichen, Spitzenmanagern, Bankern und alteingesessenen Familienclans, die sich an und in der Krise noch eine goldene Nase „verdient“ haben, dort die große Mehrheit der Bevölkerung, die die Zeche für die Schuldenkrise zahlt und sich zunehmend einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sieht. Nie war die Wut und die Empörung „der da unten“ gegen „die da oben“ größer. Der Gesellschaftsvertrag, der in den Jahrzehnten des Wohlfahrtstaates zwischen Arbeit und Kapital in aller Munde war, gehört der Vergangenheit an. Alle Zeichen stehen auf Radikalisierung des Klassenkampfes weltweit. Mit den Massenbewegungen in Nordafrika, Spanien, Griechenland, Chile und anderswo ist der Anfang gemacht. Ungeachtet all ihrer Illusionen über die bürgerliche Demokratie, ungeachtet auch der Tatsache, dass sich diese Bewegungen noch im Rahmen von Klassen übergreifenden Volksaufständen abspielen – die Massenversammlungen auf dem Tahirplatz in Kairo, auf den Plätzen Madrids und Barcelonas lassen erahnen, welche Kraft und Kreativität der künftige Arbeiterkampf entfalten kann, sobald er auf dem ureigenen Terrain der Arbeiterklasse geführt wird. Während sich die Scharmützel der Umweltaktivisten von Greenpeace & Co. in Blockaden, spektakulären Einzelaktionen, Menschenketten, Kampagnenpolitik erschöpfen und in der Borniertheit des Ein-Punkt-Ziels verlieren, schöpft der Kampf der Arbeiterklasse seine Kraft aus dem Massenversammlungen, in denen alles, aber auch wirklich alles auf den Prüfstand gestellt wird, aus der autonomen und kollektiven Organisation der Bewegung und vor allem aus seiner tendenziellen Neigung, die Grundfeste des kapitalistischen Regimes und die Logik des Kapitals in Frage zu stellen. In einem Satz: der ausschließlich ökologisch orientierte Kampf der Umweltaktivisten muss zwangsläufig in der Sackgasse des bürgerlichen Reformismus enden, wofür die Entwicklung der grünen Parteien beispielhaft steht; der Klassenkampf der Arbeiterklasse dagegen birgt die Perspektive in sich, das Tor zu einer neuen, klassenlosen Gesellschaft zu öffnen: dem Kommunismus, der allein eine endgültige Aufhebung der Spaltung des Menschen von seinen „äußeren Natur“ bewirken kann.
Doch ebenso wenig wie der Weg der Menschheit automatisch zum Kommunismus führt, ist der Kommunismus als Option eine ewige Gewissheit, eine historische Wahrheit, die sich stets und unveränderlich einstellt, gleichgültig, wann es der Arbeiterklasse gelingt, den Kapitalismus zu stürzen.
Aus ihrer Auseinandersetzung mit den utopischen Sozialisten (Saint-Simon, Owen, Fourier u.a.), die letztlich an der Frage scheiterten, wann aus der moralischen Notwendigkeit des Sozialismus eine materielle Möglichkeit wird, zogen Marx und Engels eine ganz wichtige Schlussfolgerung: „… wenn hiernach die Einteilung in Klassen eine gewisse geschichtliche Berechtigung hat, so hat sie eine solche doch nur für einen gegebnen Zeitraum, für gegebne gesellschaftliche Bedingungen. Sie gründete sich auf die Unzulänglichkeit der Produktion; sie wird weggefegt werden durch die volle Entfaltung der modernen Produktivkräfte (…) Die Abschaffung der gesellschaftlichen Klassen (…) hat also zur Voraussetzung eine Höhegrad der Entwicklung der Produktion, auf dem Aneignung der Produktionsmittel und Produkte und damit der politischen Herrschaft, des Monopols der Bildung und der geistigen Leitung durch eine besondre Gesellschaftsklasse nicht nur überflüssig, sondern auch ökonomisch, politisch und intellektuell ein Hindernis der Entwicklung geworden ist.“[5] In der Tat konnten sich die utopischen Sozialisten nie von dem Dilemma befreien, zwischen den beiden Polen Freiheit und (materielle) Gleichheit wählen zu müssen. Die Welt war zu ihren Lebzeiten noch von vor-kapitalistischen Gesellschaftsformen dominiert, die von unterentwickelten Produktivkräften und einem allseitigen Mangel gekennzeichnet waren. Erst der moderne Kapitalismus, so erkannten Marx und Engels, schuf mit seinen modernen Produktivkräften, die assoziierte Arbeit, den Wissenschaften und der modernen Technologie die Mittel zur endgültigen Überwindung des Mangels. Die kapitalistische Produktionsweise mit ihrer Massenproduktion machte aus der Notwendigkeit des Kommunismus erst eine reale Möglichkeit, da Letzterer nur auf der Grundlage des Überflusses existieren kann.
Doch nun, rund hundert Jahre nach dem Eintritt des Kapitalismus in seine Niedergangsphase, drohen alle Errungenschaften dieser Produktionsweise im Kampf gegen den existenziellen Mangel sich in ihr Gegenteil zu verkehren. Je länger dieses System noch dahinvegetiert, desto größer ist die Gefahr, dass es der Menschheit ein Erbe hinterlässt, das den Kommunismus zu einer Unmöglichkeit macht. Denn was wir derzeit erleben, ist eine rapide, nahezu exponentielle Einschränkung des natürlichen Lebensraums des Menschen. Fangen wir mit der Entwaldung an: mehr als die Hälfte aller ursprünglich vorhandenen Wälder der Welt sind bereits verschwunden; geht die Abholzung der Regenwälder im heutigen Tempo weiter, so ist damit zu rechnen, dass in den nächsten fünfzig Jahren ein weiteres Viertel der noch existierenden Waldgebiete abgeholzt sein wird. Nehmen wir die Bodenerosion: mehr als eine Milliarde Menschen oder ein Drittel aller landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete der Welt sind von ihr betroffen; die Folgen sind Versalzung der Böden[6], Desertifikation und Staubstürme[7]. Oder die Überfischung der Weltmeere: „Einer Prognose zufolge droht ein Rückgang der Fänge um 90% gegenüber dem jeweiligen Höchststand aller derzeit kommerziell genutzten Fischarten, sollte die Befischung unverändert fortgesetzt werden. Laut Zahlen der Food and Agriculture Organization (FAO) waren 2005 drei Viertel der weltweiten Bestände überfischt oder bis an die Grenzen der Regenerationsfähigkeit ausgebeutet. Bei rund einem Viertel der Bestände ist eine Steigerung der Fänge noch möglich. Zu Beginn der Überwachung des globalen Fischbestandes im Jahre 1974 betrug dieser Anteil noch 40%.“[8]i Vergessen wir auch nicht die chemische und radioaktive Verseuchung ganzer Regionen, die unabsehbare Zeit unbewohnbar bleiben; ganz zu schweigen von den Hinterlassenschaften des atomaren Zeitalters, die noch viele tausend Jahre vor sich hin strahlen werden und deren Entsorgung nach wie vor völlig ungeklärt ist.
Dies alles vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung der Atmosphäre betrachtet, bleibt nur noch die Feststellung, dass die Menschheit am Scheideweg steht. Namhafte Wissenschaftler räumen der Menschheit nicht mehr viel Zeit ein. Falls in den nächsten zwanzig Jahren kein entscheidender globaler Kurswechsel stattfindet, werden die Folgen der menschengemachten Klimaveränderung aller Voraussicht nach so gravierend sein, dass sie kaum mehr beherrschbar sind. Mit anderen Worten: die Arbeiterklasse hat nicht mehr allzu lange Zeit, diese völlig unverantwortliche bürgerliche Klasse endlich in die Wüste zu schicken, bevor diese noch mehr Unheil anrichtet und den Rubikon überschreitet. Ihr zu Hilfe kommt dabei der Umstand, dass die Umweltkatastrophe einhergeht mit der weiteren Verschärfung der Weltwirtschaftskrise mit ihren verheerenden Folgen für die Arbeiterhaushalte. Nichts erschüttert das Vertrauen der ArbeiterInnen in dieses System so sehr wie die Unfähigkeit der Herrschenden, für ihr Auskommen zu sorgen, und sei es noch so bescheiden. Sie ist der Antrieb für die Beherrschten, nach eigenen Lösungen Ausschau zu halten, der Motor des Bewusstseinsprozesses, an dessen Ende ein revolutionäres Klassenbewusstsein stehen könnte, sofern die Revolutionäre dieser Welt ihren Beitrag leisten.
„Schmeicheln wir uns indes nicht zu sehr mit unsern menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. Jeder hat in erster Linie zwar die Folgen, auf die wir gerechnet, aber in zweiter und dritter Linie hat er ganz andre, unvorhergesehene Wirkungen, die nur zu oft jene ersten Folgen wieder aufheben. Die Leute, die in Mesopotamien, Griechenland, Kleinasien und anderswo die Wälder ausrotteten, um urbares Land zu gewinnen, träumten nicht, daß sie damit den Grund zur jetzigen Verödung jener Länder legten, indem sie ihnen mit den Wäldern die Ansammlungszentren und Behälter der Feuchtigkeit entzogen. Die Italiener der Alpen, als sie die am Nordabhang des Gebirgs so sorgsam gehegten Tannenwälder am Südabhang vernutzten, ahnten nicht, daß sie damit der Sennwirtschaft auf ihrem Gebiet die Wurzel abgruben; sie ahnten noch weniger, daß sie dadurch ihren Bergquellen für den größten Teil des Jahrs das Wasser entzogen, damit diese zur Regenzeit um so wütendere Flutströme über die Ebene ergießen könnten. Die Verbreiter der Kartoffel in Europa wußten nicht, daß sie mit den mehligen Knollen zugleich die Skrofelkrankheit verbreiteten. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, daß wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht - sondern daß wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehn, und daß unsre ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen andern Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können.“ (Friedrich Engels, Dialektik der Natur, „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen)
[1] So wurde ein Großteil der Wälder auf der Osterinsel vermutlich für den Transport der riesigen Statuen zu ihrem Standort abgeholzt. Allein die schiere Zahl der auf der Insel aufgefundenen Statuen lässt vermuten, dass zwischen den Häuptlingen der verschiedenen Stämme ein regelrechtes „Wettrüsten“ um den Bau der größten und meisten Götzenstatuen stattgefunden hat.
[2] Mit dem Begriff der „Großen Transformation“ nehmen die Autoren Bezug auf den ungarisch-österreichischen Wirtschaftstheoretiker Karl Polanyi, der in seinem Hauptwerk The Great Transformation die These vertrat, dass – um es in den Worten der Autoren zu sagen – „die Stabilisierung und Akzeptanz der ‚modernen Industriegesellschaften‘ erst durch die Einbettung der ungesteuerten Marktdynamiken und Innovationsprozesse in Rechtsstaat, Demokratie und wohlfahrtsstaatliche Arrangements gelang“.
[3] Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW Bd. 19, S. 214f.
[4] So weigert sich die politische Klasse in Deutschland beharrlich, ein Tempolimit auf den Autobahnen einzuführen, und wehrte sich vehement und erfolgreich gegen eine Sonderbesteuerung PS-starker Kfz durch die EU – alles im Interesse der deutschen Autoproduzenten.
[5] Engels, Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, MEW Bd. 19, S. 225.
[6] „Heute sind bereits neun Prozent aller gerodeten Landflächen Australiens davon betroffen, und wenn man die derzeitige Entwicklung fortschreibt, wird der Anteil nach Berechnungen auf etwa 25 Prozent ansteigen.“ (aus: J. Diamond, Kollaps, S. 497)
[7] „Von 300 n. Chr. bis 1950 suchten Staubstürme durchschnittlich alle 31 Jahre einmal Nordwestchina heim; von 1950 bis 1990 betrug der Abstand durchschnittlich nur 20 Monate; und seit 1990 ereignen sie sich fast jedes Jahr. Am 5. Mai 1993 kamen in einem gewaltigen Staubsturm ungefähr 100 Menschen um.“ (aus: J. Diamond, Kollaps, S. 456)
[8] „Überfischung der Meere“, Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages.
Aktuelles und Laufendes:
- Ökologie [37]
- Umweltzerstörung [305]
- Ökologie Kapitalismus [306]
Krieg in Libyen: Eine internationalistische Haltung der KRAS
- 2937 Aufrufe
Wenn der Krieg zwischen dem russischen und georgischen Staat, ein Krieg zwischen einer Großmacht und einem Zwerg, offen als Konfrontation zwischen zwei imperialistischen Gangstern erkennbar war, so ist der imperialistische Charakter des Krieges in Libyen getarnt hinter der Lüge einer „humanitären“ Intervention. Die Regierungen der Länder, welche seit Wochen mit massiven Bombardierungen gegen das brutale und irrationale Regime von Gaddafi auftreten, benützen und verdrehen die Sympathien in der Arbeiterklasse für die Aufstände in Nordafrika. Ihren Krieg geben sie aus als „Unterstützung des demokratischen Hoffnungsschimmers gegen die kapitalistischen Diktatoren“, die vor allem in der jungen Generation im Maghreb vorhanden sind. Nichts ist verlogener als das, so wie es die Stellungnahme der KRAS auch klar aufzeigt! Wir möchten dennoch zwei kurze Bemerkungen machen, vor allem um die Diskussion innerhalb der Arbeiterklasse anzuregen:
1. Wir teilen die Auffassung der KRAS, dass sich in Ländern Nordafrikas wie Tunesien und Ägypten keine „proletarischen Revolutionen“ abgespielt haben, im Gegensatz zum dem, was gegen Ende des Ersten Weltkrieges der Fall war, als sich in Russland das Proletariat als Klasse formieren konnte und die Macht übernahm. Die Situation in Ägypten zum Beispiel, in der bürgerlichen Presse als große „Revolution für die Demokratie“ präsentiert, zeigt deutlich, wie die herrschende Klasse ihre Macht mit einer geschickten Strategie des zum Teufel Jagens des Mubarak-Clans sicherte und ein Regime mit demokratischerem Antlitz installierte. Dennoch glauben wir, dass, auch wenn die Arbeiterklasse in diesen Ländern noch stark von Illusionen in die Demokratie, den Nationalismus und selbst die Religion gefangen ist, sie in der vergangenen Zeit eine wichtige Kampferfahrung gemacht hat, welche einen historischen Wert hat auf dem Weg hin zum revolutionären Bewusstsein. Die Kampfmethoden der Arbeiterklasse hatten einen Einfluss auf die sozialen Revolten in der arabischen Welt: die Tendenz zur Selbstorganisierung, Besetzung zentraler Plätze, um sich zu versammeln und sich massiv zu organisieren, Organisierung gegen Diebe und die Polizei, Zurückweisen von unnötiger Gewalt und Anstrengungen, religiöse und andere Spaltungen zu überwinden, Verbrüderungen mit den einfachen Soldaten… „Es ist kein Zufall, dass diese Tendenzen sich am stärksten in Ägypten entwickelten, wo die Arbeiterklasse auf eine lange Tradition von Kämpfen schauen kann und in einer entscheidenden Phase der Bewegung als eine eigenständige Kraft in Erscheinung trat, indem sie eine Reihe von Kämpfen begann, die – wie jene von 2006-07 – als „Keime“ des zukünftigen Massenstreiks angesehen werden können. Diese Kämpfe enthielten viele der wichtigsten Merkmale des Massenstreiks: die spontane Ausdehnung von Streiks und Forderungen von einem Bereich auf den anderen, die kompromisslose Ablehnung der staatlichen Gewerkschaften, gewisse Tendenzen zur Selbstorganisierung, das Formulieren von politischen und ökonomischen Forderungen. Hier erkennt man in Ansätzen die Fähigkeit der Arbeiterklasse, als Tribüne, als Dreh– und Angelpunkt für alle Unterdrückten und Ausgebeuteten aufzutreten und die Perspektive einer neuen Gesellschaft anzubieten“.[1] Auf der Basis von politischen Schwächen, den demokratischen und nationalistischen Illusionen, entwickelte sich die besondere Situation in Libyen von einem ursprünglichen Aufstand der Bevölkerung gegen das Regime von Gaddafi hin zu einem Krieg zwischen verschiedenen bürgerlichen Cliquen um die Kontrolle des libyschen Staates. Die blutigen imperialistischen Aktionen der Großmächte stiegen in dieses Szenario ein. Diese Verwandlung in einen Krieg zwischen verschiedenen bürgerlichen Lagern war möglich, weil die Arbeiterklasse in Libyen sehr schwach ist. Mehrheitlich aus Arbeitsimmigranten zusammengesetzt, ergriff diese die Flucht vor Massakern, weil sie sich schwer in einer Bewegung mit nationalistischem Inhalt wiederkennen konnte. Das Beispiel Libyens zeigt tragisch die Notwendigkeit für die Arbeiterklasse auf, sich bei sozialen Revolten ins Zentrum zu stellen: ihre Zersetzung erklärt weitgehend die Entwicklung der Situation in Libyen.
2. Die Stellungnahme der KRAS ruft die ArbeiterInnen Europas und in den USA dazu auf, gegen diesen „humanitären“ Krieg aufzutreten. Dieser Aufruf ist grundsätzlich absolut richtig, denn nur die Arbeiterklasse der in Libyen kriegführenden Länder kann die blutige Schlächterei stoppen. Aber im Moment müssen wir feststellen, dass diese Möglichkeit (leider!) nicht unmittelbar besteht. Auch wenn es Anzeichen von Protesten gegen die Intervention der NATO gibt, so bleiben diese sehr minoritär. In Frankreich zum Beispiel, der wohl offensivsten imperialistischen Großmacht in diesem Krieg, werden die Bombardierungen kaum in Frage gestellt. Der Krieg wird auch durch die Linke des Kapitals klar verteidigt. Es fällt der herrschenden Klasse momentan leicht, ihren Krieg unter dem Deckmantel der Solidarität mit den Unterdrückten des Gaddafi-Regimes zu verkaufen.
IKS, Juli 2010
Nieder mit dem neuen Krieg in Nordafrika!
Stellungnahme der КRАS, Sektion der Internationalen Arbeiterassoziation in der russischen Region
https://www.aitrus.info/node/1399 [307]
Die „humanitäre“ Intervention der NATO-Mächte in Libyen, die dazu aufruft, eine der beiden Seiten im Bürgerkrieg dieses Landes militärisch zu unterstützten, hat wieder einmal bewiesen: In den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens finden keine „Revolutionen“ statt. Vielmehr tobt dort ein hartnäckiger und grausamer Kampf um Macht, Gewinne, Einfluss sowie die Kontrolle über die Erdölressourcen und die strategischen Gebiete.
Die tiefe Unzufriedenheit sowie die sozialen und wirtschaftlichen Proteste der arbeitenden Massen der Region, Folgen der weltweiten Wirtschaftskrise (mit ihren Angriffen auf die Lebensbedingungen der Arbeiter, dem Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Vertiefung des Elends, der Ausbreitung der prekären Beschäftigung), werden von den oppositionellen politischen Gruppen benützt, um Staatsstreiche durchzuführen, um die Tyrannei korrupter, seniler Diktatoren zu stürzen und selbst ihren Platz einzunehmen. Indem die unzufriedenen Teile der herrschenden Klasse Arbeitslose, Arbeiter und Arme als Kanonenfutter mobilisieren, lenken sie von deren sozialen und ökonomischen Forderungen ab und versprechen ihnen „Demokratie“ und „Veränderung“. Tatsächlich wird die Machtergreifung durch diesen bunten Block von „Hinterbänklern“ der herrschenden Elite, von Liberalen und religiösen Fundamentalisten keine Veränderungen zum Besseren bringen. Wir wissen sehr wohl, wozu der Sieg der Liberalen führt: zu neuen Privatisierungen, der Vertiefung des marktwirtschaftlichen Chaos, dem Auftauchen der nächsten Milliardäre und der weiteren Verstärkung des Elends, der Qualen und der Leiden der Unterdrückten und Ausgebeuteten. Der Triumph religiöser Fundamentalisten würde die Verstärkung der kirchlichen Reaktion, der schonungslosen Unterdrückung der Frauen und der Minderheiten und unvermeidlich die Vorbereitung zu einem neuen arabisch-israelischen Krieg bedeuten, dessen Lasten wieder auf die Schultern der arbeitenden Massen gelegt würden. Aber sogar im „idealen“ Fall der Errichtung von repräsentativ-demokratischen Regimes in den nordafrikanischen und nahöstlichen Ländern würde das werktätige Volk nichts gewinnen. Der Arbeiter, der bereit ist, sein Leben für die „Demokratie“ zu riskieren, gleicht dem Sklaven, der schwört, für sein „Recht“ zu sterben, den eigenen Herrn zu wählen. Die repräsentative Demokratie ist keinen Tropfen menschlichen Blutes wert.
Seit dem Beginn des Machtkampfes in der Region haben die europäischen Nato-Staaten und die USA je länger je mehr Partei für die politischen Gruppen der Opposition ergriffen, da immer offensichtlicher geworden ist, dass der Sieg dieser Kräfte und die Durchsetzung des „demokratischen“ Modells der politischen Herrschaft ihnen neue Vorteile und Privilegien bringen wird. Indem sie die „Demokratie“ in Tunesien und Ägypten unterstützen, hoffen sie, dort ihren Einfluss zu festigen, ihre „investierenden“ Kapitalisten von der Korruption der Diktatoren zu befreien und an der künftigen Privatisierung des Eigentums der bisher herrschenden Clans teilzunehmen. Sie unterstützen die liberale, monarchistische und religiös-fundamentalistische Opposition in Libyen, die im Bündnis von ehemaligen höchsten Beamten des Gaddafi-Regimes auftritt, und rechnen damit, sich die Kontrolle über die reichen Erdölvorräte zu sichern. Seite an Seite mit ihnen schreiten in diesem Kampf um Einfluss in der Region auch einige arabische Staaten, die eigene Ambitionen haben.
Und wieder einmal legen die Mächte mit Bomben und Beschießungen los, um das Leben der Leute zu „retten“, und „befreien“ die Menschen von den Diktaturen, indem sie sie töten. Die Regierungen der westeuropäischen Länder und der USA sind verlogen und heuchlerisch: Gestern noch halfen sie den Diktatoren, sie ließen sich von ihnen umarmen und verkauften ihnen Waffen. Heute raten sie den Diktatoren, „auf die Forderungen des Volkes zu hören“ und abzutreten, aber gleichzeitig unterdrücken sie, ohne zu zögern, die Proteste der Bevölkerung in ihren eigenen Ländern und ignorieren ihre Forderungen vollständig. Wenn die überwiegende Mehrheit der Bewohner Frankreichs oder Großbritanniens, Griechenlands oder Spaniens, Portugals oder Irlands erklärt, dass sie nicht bereit ist, die staatliche Hilfe für die Banken und die Unternehmen zu bezahlen, und fordert, die harten Sparmaßnahmen und die antisozialen Rentenreformen zurück zu nehmen, so antworten ihr die Herrschenden, dass in der Demokratie „nicht die Straße regiert“.
Die „humanitäre“ Intervention gibt den Herrschenden Westeuropas und der USA die vorzügliche Gelegenheit, die unterjochte Bevölkerung in ihren Ländern von den Folgen der Krise abzulenken. Unter den Parolen eines „kurzen und siegreichen Kriegs“ für „die Rettung der Menschen und der Demokratie“ werden die europäischen und nordamerikanischen Arbeiter aufgefordert, die antisoziale Politik der Regierungen und der Kapitalisten zu vergessen und stattdessen stolz zu sein auf ihre „menschlichen“ und „rechtmäßigen“ Regierenden, die „ein heiliges Bündnis“ mit den Unterdrückten eingegangen sind.
Wir rufen die Arbeiter und Arbeiterinnen der ganzen Welt auf, auf den „demokratischen“ und „humanitären“ Betrug nicht hereinzufallen und gegen die neue Eskalation der kapitalistischen Barbarei in Nordafrika und im Nahen Osten entschlossen aufzutreten. Wenn wir unsere Stimme genügend erheben und den Unterdrückten und Werktätigen der Region über alle Entfernungen und sprachlichen Grenzen hinweg zurufen könnten, würden wir sie auffordern, zu den ursprünglichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Forderungen und Themen ihres Protestes zurückzukehren, zu rebellieren, zu den Demonstration herauszukommen und gegen die niedrigen Gehälter, die Teuerung und die Arbeitslosigkeit, für die soziale Befreiung zu streiken - aber sich nicht auf politische Spiele, auf den Kampf um die Macht der verschiedenen Gruppierungen der herrschenden Klassen einlassen.
Wir rufen die Arbeiter und Arbeiterinnen Europas und Amerikas auf, auf die Straße zu gehen zum Protest gegen den neuen „humanitären“ Krieg im Interesse der Machthaber und der Kapitalisten. Wir wenden uns an die Sektionen der Internationalen Arbeiterassoziation mit der Bitte, die internationalistische und antimilitaristische Agitation zu verstärken und als Initiatoren von kriegsfeindlichen Demonstrationen und Streiks aufzutreten.
Nieder mit dem Krieg!
Nieder mit allen Staaten und Armeen!
Keinen Tropfen Blut weder für die Diktaturen noch die Demokratien!
Nein zu den Regierungen und den „Oppositionen“!
Für die Solidarität mit dem Kampf der Arbeiter und Arbeiterinnen für die soziale Befreiung!
Er lebe die allgemeine Arbeiterselbstverwaltung!
KRAS-IAA
Aktuelles und Laufendes:
Politische Strömungen und Verweise:
Waffenlieferungen und Hungerhilfe
- 2152 Aufrufe
Als die geplante Panzerlieferung an Saudi-Arabien in den Medien publik wurde, schrie die parlamentarische Opposition – von Linkspartei über Grüne bis SPD - auf, der Panzerverkauf verletze die Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung und den Standpunkt der EU. Ähnliche Töne bei der Verkündung des geplanten Verkaufs von Patrouillenbooten an Angola.
Auch wenn die parlamentarische Opposition noch so lauthals „Skandal“ brüllt, Tatsache ist, die zahlreichen Rüstungsexporte aus deutschen Waffenschmieden sind ein Eckpfeiler der deutschen Erfolgsstory als Exportvizeweltmeister. Zwar liegen deutsche Waffenexporteure noch weit hinter den USA und Russland zurück, die einen Weltmarkanteil von 30% bzw. 23% halten, aber Deutschland hat sich in der Zwischenzeit zum drittgrößten Waffenexporteur weltweit gemausert. Deutsche Rüstungsexporteure haben ihren Weltmarktanteil von 7% auf 11% steigern können. Wie nicht anders bei einem High-Tech-Exporteur zu erwarten, gehören hochentwickelte Waffensysteme zu den Bestsellern deutscher Waffenexporteure. Die Lieferung von Schiffen und U-Booten (z.B. an Israel, Griechenland, Türkei) macht fast die Hälfte aller Exporte aus, auch Flugzeuge wie Eurofighter sind sehr begehrt; man hofft an Indien 126 Eurofighter im Wert von 8-10 Mrd. zu verkaufen. Und während Deutschland an das bankrotte Griechenland z.B. 200 Panzerhaubitzen verkaufte, rüstete es gleichzeitig den Erzrivalen Türkei auf. Allein die Türkei nahm ca. 10% deutscher Waffenlieferungen ab. Der Deal mit Saudi-Arabien soll zwischen 1.7 und 2 Milliarden Euro einbringen. Waffenverkäufe gehören zum Kerngeschäft aller Industrieländer, wenn nicht gar zu deren Hauptgeschäft wie im Falle der USA oder Russland. Natürlich geht es nicht nur um kommerzielle Interessen der Waffenlobby, sondern auch um militärstrategische und politisch-soziale Aspekte. Der Deal mit Saudi-Arabien betrifft ein Land, dessen Arsenale zwar jetzt schon randvoll sind, das aber als wichtiger Gegenpol gegen die Regionalmacht Iran gestärkt werden soll. Zwar galt Saudi-Arabien jahrelang als zentraler arabischer Kontrahent Israels, längst haben sich aber die Konfrontationslinien verlagert; die Auseinandersetzungen mit dem Iran rücken stärker in den Vordergrund. Bislang hat Riad auch schon 72 Eurofighter erworben, so dass die Panzerlieferungen nicht das erste große Rüstungsgeschäft mit den Saudis sind.
Die Bundespolizei bildet saudi-arabische Grenzschützer aus, die Bezahlung der Beamten läuft über den privaten deutsch-französischen Rüstungskonzern EADS, der über eine Tochterfirma umfangreiche Technologie zur Grenzsicherung (Stacheldrahtzäune, Überwachungseinrichtungen usw.) lieferte.
Gleichzeitig gilt das Regime der Saudis als Bollwerk gegen soziale Erhebungen im arabischen Raum. Der Leopard 2A7+ ist speziell für den Kampf im bebauten Gelände konstruiert und daher besonders für die Niederschlagung von Aufständen geeignet. Wie entschlossen die Saudis sind, ihre Truppen als Killerkommandos loszuschicken, bewies deren Rolle bei der Niederschlagung der Opposition in Bahrain. Während deutsche Politiker in den Medien so tun, als ob sie den „arabischen Frühling“ unterstützten, stärkt das deutsche Kapital in Wirklichkeit all den Kräften den Rücken, die sich nicht davor scheuen, Panzer, Heckenschützen, Scharfschützen usw. gegen Aufständische einzusetzen, wie immer wieder in Ägypten, Syrien geschehen.
Wenn nun die Bundesregierung von der Opposition kritisiert wird, dass die Entscheidung geheim im Bundessicherheitsrat getroffen wurde, dabei die Rüstungsexportrichtlinien missachtet würden usw., tut man so, als ob der Verkauf von Waffen an und die Unterstützung (z.B. Beratung und Ausbildung von Polizeikräften) von „demokratischen“ Regimes moralisch „sauberer“, „unanfechtbar“ wären.
Dass der deutsche Imperialismus an den verschiedensten Fronten immer mehr mitmischt und sich auf noch mehr Auslandseinsätze vorbereitet, zeigen nicht nur die jüngsten Äußerungen des Verteidigungsministers, der anlässlich der ruhenden Wehrpflicht noch mehr Auslandseinsätze vorhersagte, sondern auch das 1.5 Milliarden teure neue Gebäude des Bundesnachrichtendienstes, der zuletzt aufgrund der Pressemeldung über den Diebstahl von Bauplänen, im Blickpunk der Öffentlichkeit geriet..
Kanonen statt Hungerhilfe.
Nicht weniger aufschlussreich war in diesem Zusammenhang die jüngste Reise von Merkel nach Afrika.
UNO und NGO haben Alarm geschlagen wegen der sich ausbreitenden Hungernot in Ostafrika. „Rund zwölf Millionen Menschen brauchen wegen der Dürre am Horn von Afrika laut Uno schnell Hilfe. Es hat dort so wenig geregnet wie seit fast 60 Jahren nicht mehr. Durch den ausbleibenden Regen sind in der Region nämlich die Getreidepreise explodiert, in Somalia ist Hirse so teuer wie noch nie - im vergangenen Jahr stieg der Preis um 240 Prozent. In Äthiopien ist der Maispreis in die Höhe geschnellt. Die bewaffneten Konflikte im Süden Somalias verschärfen die Dürre-Katastrophe zusätzlich. Viele Menschen trauen sich aus Angst vor Milizen-Angriffen kaum noch, ihre Felder zu bestellen. Auch Nomaden können in viele Gebiete nicht mehr mit ihren Tieren ziehen, weil dort Bürgerkrieg herrscht. Häufig treiben die bewaffneten Milizen Schutzgelder ein. URL:
www.spiegel.de/politik/ausland/duerre-in-ostafrika-wie-es-zur-jahrhundertkatastrophe-kam-a-774114.html [309], 13.07.2011.
So ist in Kenia das größte Flüchtlingslager der Welt - Dadaab - mit ca. 400.000 Menschen entstanden, wo diese um ihr Überleben kämpfen.
Mitten in diesem Inferno wurde jüngst ein neuer Staat ausgerufen, Südsudan, der schon jetzt als einer der ärmsten Staaten der Welt gilt und wegen seiner Rohstoffvorkommen zur bevorzugten Zielscheibe imperialistischer Ambitionen mehrerer Staaten geworden ist. In dieser Region, die alle Plagen des niedergehenden Kapitalismus aufweist –
auseinanderbrechende Staaten („failed-states“), explodierende Lebensmittelpreise, völlig verarmte Fischer und Bauern, (von denen einige versuchen, sich als moderne Seeräuber durchzuschlagen während ein bedeutende Teil der Minderjährige als Kindersoldaten sich verdingen müssen), die massive Zunahme von Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen. Dies alles hat zur Folge, dass nun nach der Dürre nahezu ein Dutzend Millionen Menschen vom Hunger bedroht sind. In Anbetracht von dieser Katastrophe hat nun die Bundeskanzlerin des Exportweltmeisters und drittgrößten Rüstungslieferanten Deutschland doch ihr wohltätiges Herz gespürt und dem weltweitgrößten Flüchtlingslager Dadaab EINE Million Euro, (nein, kein Irrtum, nicht eine Milliarde) Dollar versprochen (mittlerweile ist das Erbarmen etwas größer geworden und man hat auf 5 Millionen aufgestockt). Und ein paar Stunden später saß sie schon im Flugzeug nach Angola, um dort weitere Rüstungsgüter in Form von Patrouillenbooten zu verkaufen.
Solch ein Verhalten deckt nicht nur den Zynismus und die ganze Menschenverachtung des deutschen Kapitals wie überhaupt des Kapitals auf, sondern es entblößt auch den abgrundtiefen Interessensgegensatz, den die herrschende Klasse der ganzen Welt vom Rest der Menschheit trennt.
Denn während die Regierenden vor dem Hintergrund von immer häufigeren Truppeneinsätzen an immer weiter entfernten Kriegsschauplätzen Milliarden verpulvern, um Militärtransportflugzeuge zum Transport von Truppen und Kriegsgerät zu bauen und Tankflugzeuge zum Auftanken von Bombern in Auftrag geben, während zum Beispiel der Einsatz eines Eurofighters pro Stunde 74.000 Euro kostet, während man Milliarden in Rettungspakete für Banken und Firmen steckt, wirft man den Hungernden der Welt ein paar Brosamen hin und verkauft gleichzeitig den Herrschern vor Ort oder in der Region Waffen aller Art. Und wenn dann die Flüchtlinge es wagen sollten, zu versuchen, sich unter Lebensgefahr nach Europa durchzuschlagen, um hier einen miserablen bezahlten Job zu ergattern, dann ist eine der dringendsten Sorgen, die Festung Europa weiter auszubauen. Denn eines der ersten Abkommen, das mit der neuen Übergangsregierung in Libyen geschlossen wurde, war die weitere Verriegelung und Rückführung von Flüchtlingen.
Hier über eine „Verletzung der Waffenexportregelungen“ oder eine Missachtung des Parlaments zu jammern, wie es die Opposition in Deutschland tut, ist die reinste Augenwischerei. Denn es handelt sich um keinen parlamentarischen Skandal, sondern um die alltägliche Fratze eines vor Blut triefenden Systems.
17.7.2011
P.s.
Dass die Hungerkatastrophe durch neue Trends mit verschärft wurde, die die Bauernbevölkerung vor Ort (ob Vieh hütende Nomaden oder ‚ortsansässige‘ Bauern) vertreibt und in eine noch größere Misere stürzt, zeigen folgende Beispiele: „In Äthiopien scheint die drohende Katastrophe hingegen nicht nur dem Wetter geschuldet zu sein, sondern auch dem Bestreben der äthiopischen Regierung, Landwirtschaft im industriellen Maßstab anzusiedeln. Große Flächen, die ursprünglich als Ausweichflächen für die Viehherden der Nomaden dienten, sind inzwischen an indische, chinesische und südkoreanische Agrarkonzerne verpachtet worden. Die äthiopische Regierung setzt eigenen Angaben zufolge lieber auf moderne Industrie als auf pastorale Tradition.“ (FAZ, 14.07.2011) „Seit mehreren Jahren versuchen alle arabischen Regimes, ihre Versorgung mit Grundnahrungsmitteln so weit wie möglich vom Weltmarkt abzukoppeln, indem sie über Staatsfonds riesige Ländereien in Afrika und Zentralasien aufkaufen. (…) In Reaktion auf die Aufstandsbewegung kaufte die Militärregierung (Ägyptens) große Flächen im Nordsudan, die sie ägyptischen Firmen zur Bearbeitung übergab.“ (Wildcat, Sommer 2011, S. 66).
Aktuelles und Laufendes:
- Hungersnot Afrika [310]
- Waffenlieferung Angola [311]
- Waffenlieferung Saudi-Arabien [312]
- Welthungerhilfe [313]
- Entwicklungshilfe [314]
Zu den Büchern von Stéphane Hessel „Empört euch!“ und „Engagiert euch!“
- 2850 Aufrufe
Sich empören, ja – über die kapitalistische Ausbeutung!
Die Schriften „Empört euch!“ und „Engagiert euch!“ des Schriftstellers, Lyrikers und französischen Diplomaten Stéphane Hessel sind wahre Bestseller. Jetzt schon sind sie zu einem Bezugspunkt für all jene geworden, die über die Ungerechtigkeit in der Welt nachdenken. Die Bewegung der sozialen Wut, die in der jüngsten Zeit über Spanien hinweg gerollt ist (und in einem geringeren Maße auch in anderen europäischen Ländern zu sehen ist), hat sich sogar die „Empörten“ genannt und dabei ausdrücklich Bezug genommen auf sein erstes Buch (1).
„Empört euch“! ist eine ca. 30 Seiten umfassende Schrift. Der Text wurde in verschiedene Sprachen übersetzt, millionenfach auf der ganzen Welt zu einem Spottpreis verkauft, um eine möglichst große Verbreitung zu finden. Seine Veröffentlichung war von Anfang an sehr erfolgreich. Aus gutem Grund, denn sein Titel ist allein schon ein Aufschrei gegen die Barbarei dieser Welt. Er entspricht voll und ganz dem weit verbreiteten Gefühl, das sich immer mehr unter den Unterdrückten ausbreitet und ausgelöst wird durch den Horror, den Armut und Krieg auf der ganzen Welt hervorrufen, die als immer unausstehlicher und widerwärtiger angesehen werden. Der „arabische Frühling“ in Tunesien und Ägypten und die Bewegung der „Empörten“ belegen dies.
Von welcher Gesellschaft träumt Stéphane Hessel? [1]
Stéphane Hessel ist 93 Jahre alt und hat noch die Energie, seine Empörung über diese ungerechte Welt zum Ausdruck zu bringen. Als solches kann dies nur Bewunderung und Sympathie hervorrufen. Aber die Frage steht im Raum, für welche Welt wir aus seiner Sicht schlussendlich kämpfen sollen?
Schon am Anfang seines Buches plädiert Stéphane Hessel für die Prinzipien und Werte, die den Nationalen Widerstandsrat (CNR) [2] Ende des 2. Weltkriegs dazu veranlassten, ein Wirtschaftsprogramm zu verfassen. Auf die Frage, ob diese Maßnahmen noch immer aktuell seien, antwortet Hessel:
“Natürlich haben sich die Dinge während der letzten 65 Jahre entwickelt. Heute stehen wir nicht vor den gleichen Herausforderungen wie die zur Zeit der Résistance. Das damals von uns vorgeschlagene Programm ist heute in der Form nicht mehr gültig, dem gegenüber dürfen wir nicht die Augen verschließen. Aber die Werte, für die wir damals eingetreten sind, sind die gleichen; wir müssen sie weiter hochhalten. Es sind die Werte der Republik und der Demokratie. Man kann die jeweiligen Regierungen anhand dieser Werte überprüfen. Im Programm des Widerstandsrates vertrat man eine gewisse Vision, und diese Vision bleibt heute weiterhin gültig. Sich dem Diktat des Profits und des Geldes entgegenzustellen, sich über das Nebeneinander einer extremen Armut und eines arroganten Reichtums zu empören, wirtschaftlichlich feudale Verhältnisse zu verwerfen, die Notwendigkeit einer wirklich unabhängigen Presse zu betonen, soziale Sicherheit in all ihren Formen sicherzustellen – eine ganze Reihe dieser Werte und Errungenschaften, für die wir damals eingetreten sind, sind heute bedroht. Viele der jüngst beschlossenen Maßnahmen schockieren meine Kameraden aus der Zeit der Résistance – denn sie richten sich gegen unsere Grundwerte. Ich glaube, man muss sich empören, insbesondere die Jugend. Und Widerstand leisten!“ [3]. Aber wer ist für diese Verhältnisse verantwortlich? „Dies scheint nur möglich, weil die von der Résistance bekämpfte Macht des Geldes niemals so groß, so anmaßend und egoistisch war wie heute und bis in die höchsten Ränge des Staates hinein, über eigene Interessensvertreter verfügt. Die inzwischen privatisierten Banken kümmern sich nur noch um ihre Dividenden und die ausufernden Einkommen ihrer leitenden Manager, nicht aber um das Gemeinwohl. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird ständig größer und das Streben nach Geld und Einfluss gewinnt immer mehr an Bedeutung.“ [4] Hessel zufolge müsse die Demokratie das Handeln der Führer leiten, weil die Demokratie im Gegensatz zum Egoismus der Finanzwelt und Banker sich mehr um die Interessen der Allgemeinheit kümmere: „Wir sagen ihnen: „nehmt es auf Euch, empört Euch!“ Die Verantwortlichen der Politik, Wirtschaft, die Intellektuellen und die Gesamtheit der Gesellschaft dürfen nicht klein beigeben, sich auch nicht beeindrucken lassen durch die aktuelle internationale Diktatur der Finanzmärkte, die den Frieden und die Demokratie bedrohen. [5] Dies ist also das hochheilige Interesse der Allgemeinheit, das Politiker, Wirtschaftsführer und Beschäftigte, Arbeitslose, Studenten, Rentner, Prekäre vereint… Mit anderen Worten, die Demokratie des Stéphane Hessel ist ein Mythos; sie täuscht einen Zustand vor, in dem sich Ausbeuter und Ausgebeutete wie durch ein Wunder auf Augenhöhe begegnen, in dem sie angeblich über die gleichen „Rechten und Pflichten“ verfügen und als Bürger die gleichen demokratischen Interessen gegen die Diktatur der Finanzmagnaten vertreten. Und wohin führt das Ganze? Welche Seite sollen wir aus seiner Sicht unterstützen?
„Indem wir heute überlegen, schreiben, uns demokratisch an der Wahl der Regierungen beteiligen, kann man hoffen, die Dinge auf eine kluge Art voranzutreiben…, kurzum mit einer langfristigen Sicht. [6]. Und welche Seite sollen wir aus seiner Sicht unterstützen? „Ich betrachte mich noch immer als Sozialisten, d.h. so wie ich diesen Begriff sehe, mit einem Bewusstsein der sozialen Ungerechtigkeit. Aber die Sozialisten müssen Anregungen erhalten. Ich habe die Hoffnung, dass eine mutige, wenn nötig „freche“ Linke entsteht, die ihr Gewicht in die Waagschale wirft und eine Vision von der Freiheit der Bürger vertritt. Ich halte es auch für wichtig, dass Vertreter der Grünen in den Institutionen tätig sind, damit die Idee des Umweltschutzes Fortschritte macht.“ [7]. Letztendlich führt aus Hessels Sicht unsere Empörung dazu, dass wir alle einen Slogan übernehmen, den wir schon kennen, nämlich: “Wir sollen wählen gehen“. Wir sollen für ein neues Alternativprogramm stimmen (das als eine weitere Schrift erscheinen wird), das vom Nationalen Widerstandsrat inspiriert wurde und alle möglichen Leute zusammenfasst: radikale Linke, Globalisierungsgegner, Gewerkschafter usw., d.h. Parteien und Organisationen, denen das allgemeine Interesse des Kapitals sehr am Herzen liegt. Glücklicherweise haben all die unzähligen Jugendlichen in Portugal und Spanien, an die sich Hessel besonders wendet, nicht auf all diese linksorientierten Reden gehört und sind den Urnen ferngeblieben. Schließlich hatten sie genügend Gelegenheiten gehabt, sozialistische Regierungen in ihrem Land am Werk zu sehen. Sie haben mit eigenen Augen wahrnehmen können, zu welch drastischen Sparmaßnahmen die sozialistischen Parteien in der Lage sind, die sie zudem noch auf ganz demokratische Weise verabschiedet haben (was übrigens auch auf Griechenland zutrifft). Und sie haben Erfahrung gemacht mit den Schlagstöcken der demokratischen Polizei der demokratischen, sozialistischen Regierung Zapateros.
Trotz alledem besteht Hessel weiterhin auf der Unterstützung dieser Parteien und erklärt: “Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die junge Generation? Wir müssen die Werte ernst nehmen, auf die sie ihr Vertrauen oder ihr Misstrauen in Regierenden stützen – das sind die Werte der Demokratie, mit Hilfe derer man Einfluss nehmen kann auf die Entscheidungsträger.“ [8] Welchen Einfluss kann diese junge Generation auf die demokratischen Staaten ausüben, die ihnen so viel Elend aufzwingen? Vielleicht könnte man einen unbeliebt gewordenen Minister ersetzen - und dann? Was würde sich dadurch wirklich ändern? Nichts! Auf alle Länder trifft dasselbe zu: Gleichgültig, ob rechte oder linke Regierungen an der Macht sind (oder auch linkextreme wie in Südamerika), der Graben zwischen der großen Mehrheit der Bevölkerung, die sich mit einer allgemeinen Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen konfrontiert sieht, und einem bürgerlich-demokratischen Staatsapparat, der eine rigorose Sparpolitik betreibt, um den Bankrott der Wirtschaft zu vermeiden, wird immer tiefer. Es gibt keinen anderen Weg. Hinter der demokratischen Maske des Staates verbirgt sich immer die Diktatur des Kapitals.
Den Kapitalismus nicht berühren!
“Meine Generation hat eine richtige Allergie entwickelt gegenüber der Idee der Weltrevolution. Ein wenig, weil wir mit ihr geboren wurden. Ich wurde 1917 geboren, dem Jahr der Russischen Revolution, das ist ein Merkmal meiner Persönlichkeit. Ich habe das Gefühl entwickelt, vielleicht zu unrecht, dass wir nicht mit gewalttätigen, revolutionären Aktionen die bestehenden Institutionen umstürzen können; so kann man die Geschichte nicht vorantreiben“ [9]. Und etwas später fährt Hessel fort: „In allen Gesellschaften gibt es eine latente Gewalt, die zügellos zum Vorschein kommen kann. Dies war der Fall bei den Kämpfen der kolonialen Befreiung. Man muss sich bewusst sein, dass Revolten, zum Beispiel Arbeiterrevolten, noch möglich sind. Aber dies ist wenig wahrscheinlich in Anbetracht der fortgeschrittenen Globalisierung der Wirtschaft. Das Genre Germinal ist ein wenig überholt.“ [10].
Das ist also der Appell, den Hessel an die junge Generation richtet: Schlagt euch die Ideen einer Weltrevolution, des Klassenkampfes aus dem Kopf! All das gehört der Vergangenheit an. Versucht eher die Funktionsweise des Systems zu verbessern. Wie? Hier kommt Hessel mit einem „genialen und innovierenden“ Vorschlag, der seit mehr als einem Jahrhundert von allen linken Parteien vorgetragen wird: der Schaffung eines Wirtschafts- und Sozialrates, in dem die mächtigsten Staaten der Erde zusammenkommen, eine Art globales Steuerungsgremium. Dieses globale Gremium der Welt solle dabei das Ziel verfolgen, die Wirtschaft zu regulieren, um Krisen zu vermeiden und eine effektive Kontrolle über alle großen Finanzinstitutionen auszuüben, die profit- und machtgeil sind. Erinnern wir uns daran, dass der Völkerbund, der später in die UNO überging, nach dem 1. Weltkrieg mit fast gleicher offizieller Begründung geschaffen wurde. Sie lautete, den Rückfall in den Krieg mit Hilfe eines internationalen Organismus vermeiden, der die Interessen der verschiedenen Nationen miteinander versöhnt. Das Ergebnis? Der 2. Weltkrieg und … 14 Tage Frieden auf der Welt seit 1950. Tatsächlich ist die Welt in untereinander rivalisierende Nationen gespalten; sie führen ständig einen gnadenlosen Handelskrieg gegeneinander, wenn nötig auch mit Waffen. All diese „steuernden Weltorganismen“ (Welthandelsorganisation, Internationaler Währungsfond, UNO, Nato usw.) sind nur räuberische Organisationen, innerhalb derer sich die Staaten unerbittlich bekämpfen. Aber dies einzugestehen will Stéphane Hessel unbedingt vermeiden, denn dann müsste er die Notwendigkeit eines neuen Weltsystems, einer internationalen Revolution einräumen.
Lieber schickt er die Jugend in eine Sackgasse, anstatt ihr einen Ausweg zu weisen, der sie zu einer zu radikalen Infragestellung dieses Ausbeutungssystems führen würde. Stattdessen ermutigt er sie, Druck auf die jeweiligen Staaten auszuüben, damit diese eine neue Politik innerhalb des neuen Sozial- und Wirtschaftssicherheitsrates betreiben. Aus seiner Sicht reichte eine massive Einmischung der bürgerlichen Gesellschaft, eine umfangreiche Mobilisierung der Bürger aus, um die Entscheidungen der Staaten zu beeinflussen. Dieses Engagement müsse auch mit einer größeren Beteiligung der Jugend an den Nicht-Regierungsorganisationen und anderen Organismen dieser Art einhergehen, denn es gäbe eine Menge Herausforderungen und somit viele Kämpfe zu führen: ökologische, soziale, antirassistische, pazifistische und der Kampf für eine solidarische Wirtschaft… In Wirklichkeit bietet uns Hessel den gleichen alten reformistischen Brei an. Mit einigen wohl ausgewählten Ingredienzen (eine Bürgerbeteiligung der Bevölkerung, intelligente Wahlbeteiligungen usw.) könne der Kapitalismus aufhören, das zu sein, was er ist, nämlich ein Ausbeutungssystem, und er könne menschlicher, sozialer werden.
Reform oder Revolution?
„Die Geschichte besteht aus einer Reihe aufeinanderfolgender, heftiger Erschütterungen als Preis dieser Herausforderung. Die Gesellschaftsgeschichte schreitet voran, und am Ende, nachdem der Mensch seine vollständige Freiheit erlangt hat, erreichen wir den demokratischen Staat in seiner Vollendung“,sagt uns Hessel in Indignez-vous!. Es stimmt, die Menschheit steht vor großen Herausforderungen: Sie muss die Lösung für all diese Probleme finden, oder sie wird verschwinden. Im Mittelpunkt dieser Frage steht die Notwendigkeit der Umwälzung der Gesellschaft. Aber welche Umwälzung? Kann man den Kapitalismus reformieren, oder muss man ihn zerstören, um eine neue Gesellschaft aufzubauen?
Den Kapitalismus reformieren zu wollen ist ein Irrweg. Dies tun zu wollen heißt, sich seinen Regeln, seinen Gesetzen zu unterwerfen, die Widersprüche zu akzeptieren, die die Menschheit ins Elend, in den Krieg, ins Chaos, in die Barbarei stürzen. Das kapitalistische System ist ein Ausbeutungssystem, aber kann Ausbeutung menschlich gestaltet werden? Kann ein System menschlich werden, dessen einziges Ziel darin besteht, einer Klasse die größtmögliche Anhäufung von Reichtümern zu ermöglichen, indem Profit auf Kosten von Millionen Beschäftigten erwirtschaftet wird? Und wenn die Konkurrenz zwischen den Kapitalisten sich zuspitzt, die Wirtschaftskrise immer härter zuschlägt, bezahlt die Arbeiterklasse dafür den Preis: Massenarbeitslosigkeit, Ausdehnung von prekären Verhältnissen, grenzenlose Ausbeutung am Arbeitsplatz, Lohnsenkungen usw. Dabei sind alle Mittel vorhanden, damit die Menschen ihre Grundbedürfnisse befriedigen und eine klassenlose Gesellschaft aufbauen, d.h. ohne Ungerechtigkeit, ohne kriegerische Barbarei, durch Abschaffung der Nationalstaaten und Landesgrenzen. Nur die Arbeiterklasse kann die Perspektive solch einer Gesellschaft umsetzen. Dieser Keim ist übrigens schon in der Bewegung der „Empörten“ vorhanden: die gegenseitige Hilfe, man teilt untereinander, zeigt Solidarität und Hingabe, ist froh, zusammen zu sein. Die beeindruckende Bewegung, die man in Spanien beobachten konnte, ist kein Strohfeuer; sie kündigt weitere Kämpfe überall auf der Welt an. Kämpfe, in denen die Arbeiterklasse immer massiver auf den Plan treten und die anderen unterdrückten Schichten mit sich reißen wird. Diese Kämpfe werden sich immer deutlicher gegen das unmenschliche kapitalistische System richten; aus ihnen wird ein größeres Bewusstsein hervorgehen, dass es notwendig ist, die Gesellschaft zu ändern, um eine neue Gesellschaft aufzubauen. Antoine 2.7.2011,
1. Stéphane Hessel ist in Spanien ziemlich bekannt, mindestens so gut wie in Frankreich. Er lebt dort und ist mit Jose Luis Sampedro befreundet, einem spanischen Schriftsteller und Ökonom, der vor allem auch Initiator von „Democracia Real Ya“ ist. Jose Luis Sampedro hat eine Broschüre veröffentlicht, die von seinem Kompagnon inspiriert wurde, er schrieb auch für die spanische Ausgabe von „Empört euch!“ ein Vorwort.
2. Der CNR ist für Stéphane Hessel der historische Referenzpunkt, ein Beispiel, dem man folgen soll. Wir wollen später auf diese Frage zurückkommen.
3. Indignez-Vous !, S. 15.
4. Idem, S. 11.
5. Idem, S. 12.
6. Engagez-vous !, S. 16.
7. Idem, S. 43 et 44.
8. Engagez vous !, S. 22.
9. Idem, S. 20.
10. Idem, S. 21.
Aktuelles und Laufendes:
- Empört Euch [315]
- Engagiert Euch [316]
Leute:
- Stephane Hessel [317]
Weltrevolution Nr. 168
- 2573 Aufrufe
19. Kongress der IKS: Bereiten wir uns auf die Klassenkonfrontationen vor
- 1953 Aufrufe
In unseren Statuten steht: „Der internationale Kongress ist das souveräne Organ der IKS. Deshalb hat er folgende Aufgaben:
- Ausarbeitung von Analysen und generellen Orientierungen für die Organisation, vor allem bezüglich der internationalen Situation;
- Untersuchen und Bilanzieren der Aktivitäten der Organisation seit dem letzten Kongress;
- Formulieren unserer Arbeitsperspektiven für die Zukunft.“
Auf dieser Grundlage wollen wir den 19. Kongress bilanzieren und betrachten.
Die internationale Situation
Als ersten Punkt wollen wir unsere Analysen und Diskussionen über die internationale Situation erwähnen. Wenn die Organisation nicht in der Lage ist, sich ein klares Verständnis darüber zu erarbeiten, läuft sie Gefahr, nicht in angemessener Weise politisch intervenieren zu können.
Heute ist es überaus wichtig für revolutionäre Organisationen, eine richtige Analyse der internationalen Situation machen zu können, nur schon deshalb, weil die Herausforderungen der Geschichte, die sich in der letzten Zeit beschleunigt hat, bedeutend sind.
Wir haben in der letzten Nummer der Internationalen Revue die vom Kongress angenommene Resolution veröffentlicht und es ist nicht notwendig, auf alle darin enthaltenen Aspekte zurückzukommen. Wir wollen lediglich deren wichtigste noch einmal unterstreichen.
Der erste und grundlegendste Aspekt ist der Weg, den die Krise des Kapitalismus durch die Staatsverschuldungen europäischer Staaten wie Griechenland eingeschlagen hat. „In der Tat stellt diese potentielle Pleite einer wachsenden Reihe von Staaten eine neue Phase im Versinken des Kapitalismus in der unüberwindlichen Krise dar. Sie verdeutlicht die Grenzen der Maßnahmen, mit denen es der Bourgeoisie gelungen ist, den Fortgang der kapitalistischen Krise seit mehreren Jahrzehnten zu bremsen.“ (Resolution zur internationalen Situation, Punkt 2)
Diese Politik
basierte auf einer Flucht nach vorne in die Verschuldung, um den Mangel an
ausreichenden Märkten für die Industriegüter zu kompensieren. Mit der
Verschuldungskrise der Staaten selber, der Staaten, welche für die
kapitalistische Ökonomie der letzte Rückhalt sind, ist das System brutal mit
seinen grundlegenden Widersprüchen konfrontiert und mit der Tatsache, diese
nicht überwinden zu können. In diesem Sinne: „Die Krise der Staatsschulden in
den PIIGS (Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien) ist nur ein
kleiner Teil des Erdbebens, das die Weltwirtschaft bedroht.“ und „Mit
anderen Worten läuft die größte Weltmacht Gefahr, dass ihr das „offizielle“
Vertrauen in ihre Fähigkeit zur Bezahlung der Schulden entzogen wird -
mindestens mit Dollars, die noch etwas wert sind. (…) Die Krise der
Verschuldung verschob sich von der Bankensphäre in diejenige der Staaten,
wodurch die kapitalistische Produktionsweise in eine neue Phase ihrer
zugespitzten Krise eingetreten ist, in der sich die Gewalt und die Ausdehnung
ihrer Erschütterungen noch einmal beträchtlich verschärfen werden. Es gibt für
den Kapitalismus keinen „Ausgang aus dem Tunnel“. Dieses System kann die
Gesellschaft nur noch in eine ständig wachsende Barbarei ziehen.“ (Punkt 5)
Die Zeit unmittelbar nach dem Kongress hat diese Analyse bestätigt: erneute
Zunahme der Verschuldung Griechenlands und eine Herabstufung der USA im Juli,
Börsenkrach im August, die Lage verschlechtert sich laufend in dramatischer Art
und Weise…
Die Bestätigung der Analysen, die am Kongress gemacht worden sind, ist nicht etwa ein besonderes Verdienst unserer Organisation. Der einzige „Verdienst“, den sie für sich beanspruchen können, ist die Treue gegenüber den klassischen Analysen der Arbeiterbewegung, welche immer, seit der Entwicklung der marxistischen Theorie, unterstrichen haben, dass die kapitalistische Produktionsweise, gleich wie die vorangegangenen, nur einen Übergangscharakter hat und ihre wirtschaftlichen Widersprüche nicht überwinden kann. Die Diskussion am Kongress hat sich in diesem marxistischen Rahmen entfaltet. Es wurden verschiedene Standpunkte ausgetauscht, vor allem bezüglich der fundamentalen Gründe der kapitalistischen Widersprüche (welche im Wesentlichen in unserer Debatte über die 30 glorreichen Jahre dargelegt sind) und über die Möglichkeit, dass die Weltwirtschaft durch die hemmungslose Ankurbelung der Geldpresse in eine Hyperinflation stürzt, vor allem in den USA. Eine große Einigkeit bestand über die Dramatik der aktuellen Lage; die Resolution wurde einstimmig angenommen.
Der Kongress nahm
sich ebenfalls der Entwicklung der imperialistischen Konflikte an, wie man an
der Resolution erkennen kann. Diesbezüglich gab es im Vergleich zu den zwei dem
letzten Kongress von 2009 vorangegangenen Jahren keine grundlegenden
Veränderungen, sondern im Wesentlichen eine Bestätigung dessen, dass die größte
Weltmacht USA trotz all ihrer militärischen Bemühungen unfähig ist, ihre
„Leadership“ wieder herzustellen, die seit dem Ende des „Kalten Krieges“
bestanden hatte. Ihr Engagement im Irak und in Afghanistan konnten der Welt
keine „Pax Americana“ mehr aufzwingen, im Gegenteil: „Die „neue Weltordnung“,
die Vater George Bush vor 20 Jahren prognostizierte und die er sich unter der
Vorherrschaft der USA erträumte, entlarven sich je länger je mehr als ein
„Weltchaos“ - ein Chaos, das die Konvulsionen der kapitalistischen Wirtschaft
nur noch verschlimmern werden.“ (Punkt 8)
Es war wichtig, dass sich der Kongress ganz besonders der heutigen Entwicklung
im Klassenkampf gewidmet hat, denn neben der Wichtigkeit, welche diese Frage
für Revolutionäre immer hat, steht heute die Arbeiterklasse in allen Ländern
vor Angriffen auf ihre Existenzbedingungen wie selten zuvor. Diese Angriffe
sind besonders brutal in den Ländern, die der Europäischen Zentralbank und dem
IWF unterworfen sind, wie das Beispiel Griechenlands zeigt. Doch sie breiten
sich auch auf alle anderen Länder aus durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit
und die Notwendigkeit für die Regierungen, die Staatsschulden zu reduzieren,
was mehr und mehr eine entschlossene und massive Antwort der Arbeiterklasse
notwendig macht. Doch der Kongress stellte auch fest: „Diese Antwort ist immer
noch schüchtern, vor allem dort, wo die Sparmaßnahmen die brutalsten Formen
angenommen haben, in Ländern wie z.B. Griechenland oder Spanien, auch wenn die
Arbeiterklasse dort in letzter Zeit ein bedeutendes Niveau an Kampfbereitschaft
gezeigt hat. In gewisser Weise scheint die Brutalität der Angriffe in den
Reihen der Arbeiterklasse ein Gefühl der Machtlosigkeit ausgelöst zu haben, vor
allem auch, weil sie durch „linke“ Regierungen durchgesetzt wurden.“ Seither
hat die Arbeiterklasse in diesen Ländern aber bewiesen, dass sie nicht
resigniert. So vor allem in Spanien, wo die Bewegung der „Empörten“ während
mehrerer Monate zu einem Orientierungspunkt für die anderen Länder in Europa
und in anderen Kontinenten geworden ist.
Diese Bewegung begann just im Moment, als der Kongress stattfand und deshalb
konnten diese Ereignisse auf dem Kongress nicht diskutiert werden. Somit war
der Kongress vor allem geprägt vom Nachdenken über die sozialen Bewegungen, welche
die arabischen Länder seit Ende 2010 erfasst hatte. In den Diskussionen zeigte
sich keine absolute Einigkeit darüber, vor allem nicht über die Frage ihres
neuartigen Charakters. Doch der gesamte Kongress sammelte sich um die Analyse,
welche in der Resolution enthalten ist: „Diese Bewegungen waren nicht
klassische Arbeiterkämpfe… Sie haben oft die Form sozialer Revolten angenommen,
in denen sich verschiedenste Teile der Gesellschaft wiederfanden: Beschäftigte
des Staates und der Privatwirtschaft, Arbeitslose, aber auch Kleinhändler und
Bauern und Freiberufliche, die Jugend usw. Aus diesem Grund ist die
Arbeiterklasse über die meiste Zeit hinweg nicht direkt als solche erkennbar
aufgetreten. Dennoch ist der Ursprung dieser Revolten (…) derselbe wie derjenige
von Arbeiterkämpfen in anderen Ländern: die dramatische Zuspitzung der Krise
und die zunehmende Misere, welche innerhalb der gesamten nichtausbeutenden
Bevölkerung um sich greift. Wenn die Arbeiterklasse in diesen Kämpfen im
arabischen Raum im Allgemeinen nicht als Klasse aufgetreten ist, so war ihr
Einfluss in den Ländern, in denen sie ein stärkeres Gewicht hat, dennoch
spürbar. Dies vor allem durch die Atmosphäre einer großen Solidarität in den
Revolten und die Fähigkeit, Fallen von blinder und verzweifelter Gewalt zu
vermeiden, auch dann, wenn sie mit einer starken Repression konfrontiert waren.
Wenn schlussendlich die herrschende Klasse in Tunesien und Ägypten auf den
Ratschlag der USA hin die alten Diktatoren über die Klinge springen ließ, so
geschah dies weitgehend wegen der starken Präsenz der Arbeiterklasse in diesen
Bewegungen.“
Die Intervention der IKS in den sich entfaltenden Kämpfen
Auf der Grundlage der Einschätzung der Wirtschaftskrise, der furchtbaren Angriffe, die diese für die Arbeiterklasse nach sich zieht, und auf der Grundlage der ersten Antworten derselben auf diese Angriffe ging der 19. Kongress der IKS davon aus, dass wir in eine neue Zeit der Entwicklung der Klassenkämpfe eintreten, die deutlich intensiver und massenhafter sein werden als in der Zeitspanne zwischen 2003 und jetzt. In dieser Hinsicht ist es aber vielleicht noch schwieriger als beim Verlauf der Krise, der diese Entwicklung im Großen und Ganzen bestimmt, kurzfristige Voraussagen zu treffen. Es gilt hingegen, eine allgemeine Tendenz auszumachen und angesichts der Entwicklung der Lage besonders wachsam zu sein, um schnell und angemessen reagieren zu können, wenn sie es erfordert, sei es mittels Stellungnahmen oder der direkten Intervention in den Kämpfen.
Der 19. Kongress
schätzte die Bilanz der Intervention der IKS seit dem letzten Kongress als
unbestreitbar positiv ein. Immer wenn es nötig war, und oft sehr schnell wurden
Stellungnahmen in zahlreichen Sprachen auf unserer Webseite und in den
territorialen Zeitungen veröffentlicht. Im Rahmen dessen, war wir mit unseren
bescheidenen Kräften leisten konnten, verbreiteten wir die Presse auf
Demonstrationen, welche die sozialen Bewegungen begleiteten. Solche Bewegungen
waren in der letzten Zeit insbesondere die Bewegung gegen die Rentenreform im
Herbst 2010 in Frankreich oder die Mobilisierungen der Schülerinnen und Schüler
gegen die Angriffe, die vor allem die zukünftigen Studentinnen und Studenten
aus der Arbeiterklasse zum Ziel hatten. Gleichzeitig hielt die IKS öffentliche
Diskussionsveranstaltungen in zahlreichen Ländern auf verschiedenen Kontinenten
ab, welche die sozialen Bewegungen zum Thema hatten. Gleichzeitig
intervenierten die Mitglieder der IKS, wenn immer es möglich war, in den
Versammlungen, Kampfkomitees, Diskussionszirkeln, Internetforen, um die
Positionen und Analysen der Organisation zu verbreiten und an der
internationalen Debatte teilzunehmen, die diese Bewegungen ausgelöst hatten.
Weiter zog der Kongress eine positive Bilanz über unsere Intervention gegenüber
Leuten und Gruppen, die kommunistische Positionen verteidigen oder sich solchen
Positionen annähern.
Der Bericht über die Kontakte, der am Kongress angenommen wurde, „schenkte den neuen Entwicklungen hinsichtlich unserer Kontakte besondere Aufmerksamkeit, namentlich der Zusammenarbeit mit Anarchisten. Es gelang uns, bei gewissen Gelegenheiten in Kämpfen gemeinsame Sache mit Leuten und Gruppen zu machen, die sich im gleichen Lager wie wir befinden – in demjenigen des Internationalismus.“ (Einführung des Berichts am Kongress) Diese Zusammenarbeit mit Leuten und Gruppen, die sich auf den Anarchismus berufen, stieß in der Organisation zahlreiche und fruchtbare Diskussionen an, die es uns erlaubten, die verschiedenen Facetten dieser Strömung besser kennen zu lernen und insbesondere die ganze Vielfältigkeit, die es in diesem Milieu gibt, besser zu verstehen …
Die Organisationsfragen
Jede Diskussion über die Tätigkeit einer revolutionären Organisation muss sich auch der Bilanz ihrer Funktionsweise widmen. Gerade hier stellte der Kongress auf der Grundlage der verschiedenen Berichte die größten Schwächen in unserer Organisation fest. Der Kongress setzte sich lange mit diesen Schwierigkeiten auseinander, insbesondere mit dem oft bedauerlichen Zustand des Organisationsgewebes und der kollektiven Arbeit, unter dem gewisse Sektionen leiden. Alle Genossinnen und Genossen der Sektionen, in denen sich diese Schwierigkeiten zeigen, sind voll überzeugt von der Richtigkeit des Kampfes, den die IKS führt, sind absolut loyal ihr gegenüber und beweisen ihren selbstlosen Einsatz. Oft kennen sich diese Genossen und Genossinnen bereits seit mehr als dreißig Jahren und kämpfen so lange gemeinsam. Häufig gibt es aus diesem Grund zwischen ihnen freundschaftliche und von Vertrauen geprägte Beziehungen. Aber kleine Fehler, kleine Schwächen, Verschiedenheiten im Charakter, die jeder und jede bei den anderen akzeptieren muss, führten manchmal zu Spannungen oder zu einer wachsenden Schwierigkeit, nach Jahrzehnten überhaupt noch zusammen zu arbeiten in kleinen Sektionen, die insbesondere wegen des allgemeinen Zurückweichens der Arbeiterklasse nach dem Zusammenbruch der „sozialistischen“ Regimes keine „Blutauffrischung“ mit neuen Mitgliedern erfahren haben. Heute beginnt diese „Blutauffrischung“ gewisse IKS-Sektionen wieder zu beleben, aber es ist klar, dass die neuen Mitglieder sich nur dann gut in die Organisation werden integrieren können, wenn sich das Organisationsgewebe verbessert. Der Kongress diskutierte über diese Schwierigkeiten im Klartext, was einige der eingeladenen Gruppen dazu verleitete, auch über ihre Organisationsschwierigkeiten zu berichten. Doch fand der Kongress keine „Zauberlösung“ für diese Probleme, die auch schon an früheren Kongressen festgestellt wurden. Die Aktivitätsresolution, welche die Organisation angenommen hat, erinnert an die auch schon früher vertretene Herangehensweise und ruft alle Genossinnen und Genossen und Sektionen dazu auf, sie systematisch in die Tat umzusetzen: „der gegenseitige Respekt, die Solidarität, die Reflexe der Zusammenarbeit, ein herzlicher Geist des Verständnisses und der Sympathie für die anderen, soziale Beziehungen und die Großzügigkeit müssen sich entwickeln“ (Punkt 15).
Die Diskussion über „Marxismus und Wissenschaft“
Eines der Anliegen in den Diskussionen und der vom Kongress angenommenen Aktivitätsresolution drehte sich um die Notwendigkeit, auch die theoretischen Aspekte der vor uns stehenden Fragen zu vertiefen. Aus diesem Grund widmete dieser Kongress - wie auch schon die früheren - einen Punkt der Tagesordnung einer theoretischen Frage: „Marxismus und Wissenschaft“. Aus Platzgründen werden wir nicht hier über die angeschnittenen Themen berichten. Aber es gilt trotzdem darauf hinzuweisen, dass die Delegationen mit dieser Diskussion sehr zufrieden waren, was insbesondere auch den Beiträgen eines Wissenschaftlers, Chris Knights, zu verdanken war, den wir eingeladen hatten, an einem Teil des Kongresses teilzunehmen. Wir möchten uns herzlich dafür bedanken, dass er die Einladung angenommen hat, und die Qualität seiner Interventionen wie auch deren Lebendigkeit und Verständlichkeit für wissenschaftliche Laien, die wir zum größten Teil sind, begrüßen. Auf unserer englischen Webseite haben wir seinen Redebeitrag als podcast veröffentlicht: https://en.internationalism.org/podcast/20110925/chris-knight-origins-of... [318]
Nach dem Kongress haben alle Delegationen die Diskussion über „Marxismus und Wissenschaft“ und die Beteiligung von Chris Knight daran als einen der interessantesten und anregendsten Momente des Kongresses hervorgehoben – einen Moment, der die Gesamtheit der Sektionen im Interesse für solche theoretischen Fragen bestärkt.
Wir ziehen keine triumphalistische Bilanz des 19. Kongress der IKS, vor allem weil er die Organisationsschwierigkeiten abstecken musste, mit denen wir kämpfen; Schwierigkeiten, die wir überwinden müssen, wenn die Organisation weiterhin die Herausforderungen meistern will, welche die Geschichte einer revolutionären Organisationen stellt. Vor uns steht deshalb ein langer und schwieriger Kampf. Doch soll uns diese Perspektive nicht entmutigen. Denn schließlich ist der Kampf der ganzen Arbeiterklasse auch lang und schwierig, voller Tücken und Niederlagen. Diese Perspektive soll die Organisationsmitglieder vielmehr in ihrem Willen bestärken, diesen Kampf zu führen. Ein grundlegender Wesenszug eines/r jeden kommunistischen Militanten ist, ein/e Kämpfer/in zu sein.
IKS, 31. Juli 2011
Aktuelles und Laufendes:
- Kongress IKS [319]
Der Marxismus und das Mensch-Natur-Verhältnis
- 8198 Aufrufe
In der Diskussion innerhalb der Umweltbewegung wird eine Menschheitsfrage& aufgeworfen, doch noch ist die Fragestellung verkürzt auf Reformationen innerhalb des bestehenden Systems. Folgende Einsendung hat die Diskussion innerhalb der IKS aufgenommen, um die Frage nach dem 'Marxismus und das Mensch-Natur-Verhältnis' zu vertiefen.
Der gesellschaftliche und der natürliche Leib der Gattung Mensch – Der Marxismus und das Mensch-Natur-Verhältnis
„Die Natur ist der unorganische Leib des Menschen, nämlich die Natur, soweit sie nicht selbst menschlicher Körper ist. Der Mensch lebt von der Natur, heißt: Die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben. Dass das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, hat keinen anderen Sinn, als dass die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein Teil der Natur.“ K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, MEW 40,S. 516.
Was hat der Marxismus zu dieser Fragestellung beizutragen? Waren Marx und Engels nicht noch geblendet von der gewaltigen historischen Aufgabe des Kapitalismus, die Produktivkraft zu entwickeln? Übersahen sie nicht das zerstörerische Potential, welches uns heute bedroht? Haben Marx und Engels schlicht zu früh gelebt, um uns heute eine Orientierung zu bieten? Ist der Marxismus eine unvollständige Wissenschaft, welche erweitert bzw. abgeschrieben werden muss?
Die stalinistischen Parteien und ihre bürgerlichen Kritiker haben die lebendige marxistische Methode zu einer ökonomistischen bzw. rein philosophischen Lehre oder Weltanschauung degradiert, diese ist sicherlich endgültig gescheitert, ihre staatskapitalistische Form trieb besonders skurrile Formen in der ökologischen Zerstörung (Baikal-See). Dagegen gilt es die lebendige Sprengkraft der marxistischen Methode für die gegenwärtigen Menschheitsfragen frei zu legen und zu prüfen, welche Orientierung sie uns an diesem Scheideweg geben kann.
Der Stoffwechsel
Von Anbeginn stand die tiefe historische Perspektive im Zentrum der militanten, kommunistischen Tätigkeit von Marx und Engels. Sie versuchten Lehren aus der gesamten Menschheitsgeschichte zu ziehen, um die Untersuchung der Gegenwart zu vollziehen und den Blick nach vorn zu wagen. So trieb sie die Frage um, was uns – als Gattung Mensch – von den anderen Lebewesen unterschied - eine Frage die sie nie mehr loslassen sollte. Sie stellten fest, dass der Mensch ein Teil der Natur war (und ist) und sich erst aus ihr herausgeschält hat:
„Die Arbeit ist zunächst ein Prozess zwischen Mensch und Natur, ein Prozess, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrolliert. Er tritt dem Naturstoff selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte, Arme und Beine, Kopf und Hand, setzt er in Bewegung, um sich den Naturstoff in einer für sein eigenes Leben brauchbaren Form anzueignen. Indem er durch diese Bewegung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur. Er entwickelt die in ihr schlummernden Potenzen und unterwirft das Spiel ihrer Kräfte seiner eigenen Botmäßigkeit.“ (K. Marx, Kapital I, MEW 23, 192).
Schon der homo habilis verwendete vor ca. 2,5 Millionen Jahren Steinwerkzeuge, eine Potenzierung der »seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte«, die erste rohe Form dessen, was unter den Menschen dann als Produktivkraft zum Einsatz kommt. Die Veränderung des Mensch-Natur-Verhältnisses ist also ein evolutionäres und ein historisches. Evolutionär, als Teil der natürlichen Gattungsveränderung zum homo sapiens. Historisch, als Bewusstwerdung der Natur und des Menschen und somit der »menschlichen Geschichte«:
„Aber gerade die Veränderung der Natur durch den Menschen, nicht die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage des menschlichen Denkens, und im Verhältnis, wie der Mensch die Natur verändern lernte, in dem Verhältnis wuchs seine Intelligenz.“ (F. Engels, Naturdialektik, MEW 20, 498.)
Eine bedeutende Stufe im Mensch-Natur-Verhältnis war erklommen. Was unterscheidet nun den Mensch von den anderen Lebewesen?
„Dass das Bedürfnis des einen durch das Produkt des anderen und vice versa befriedigt werden kann und der eine fähig ist, den Gegenstand dem Bedürfnis des andren gegenübersteht, zeigt, dass jeder als Mensch über sein eigenes besonderes Bedürfnis etc. übergreift und dass sie sich als Mensch zueinander verhalten; dass ihr gemeinschaftliches Gattungswesen von allen gewusst ist.“ (Marx, Grundrisse MEW 42, S. 168)
Die Fähigkeit des sozialen Handelns – als Menschen zueinander – unterscheidet die Gattung Mensch von den anderen Lebewesen. Dieses soziale Handeln besitzt schon eine rohe Form von Bewusstsein in sich (siehe Engels »Naturdialektik«). Dieser gesamte Bereich wird als „gesellschaftlicher Stoffwechsel“ in aller Ausführlichkeit und auf den unterschiedlichsten Ebenen von Marx und Engels entwickelt (Klassenanalyse, Fetischismus, Warenproduktion, Wertform usw.). Und genau in dieser Fähigkeit zum sozialen Handeln „als Menschen zueinander“ sehen sie die Möglichkeit des Kommunismus. Wenn die Produktivkräfte soweit entwickelt sind, dass ein Leben aller Menschen frei von mühsamer Arbeit und Ausbeutung möglich ist und eine gesellschaftliche Kraft entstanden ist, deren Kampf zum Kampf der gesamten Menschheitsbefreiung wird, die den blinden gesellschaftlichen Antagonismus überwindet, dann kann die Menschheit ihre unbewusste Vorgeschichte hinter sich lassen und das Zeitalter der bewussten Vergesellschaftung – den Kommunismus – einläuten.
Soweit bekannt.
Den gesellschaftlichen Stoffwechsel bezeichnen Marx und Engels gerne auch als „zweite“ Natur. Einmal, um auf die materielle Wirklichkeit, dann jedoch auch, um auf den entscheidenden Unterschied hinzuweisen. Der gesellschaftliche Stoffwechsel – aus dem im historischen Verlauf die Klassengesellschaften entstanden sind – ist zwar in seiner Gesamtheit für den Menschen unbewusst, doch ausschließlich Mensch-gemacht. Im Unterschied dazu die „erste“ Natur. „Die Natur ist sein Leib mit dem er in beständigem Prozess bleiben muss, um nicht zu sterben.“ Dies ist ein Stoffwechsel mit der Natur. Wir können die Natur bearbeiten, erkunden, nutzen, zähmen, beeinflussen – aber wir können sie nicht erschaffen, sondern sind abhängig von dem „beständigem Prozess“ mit ihr. Während der gesellschaftliche Stoffwechsel von Menschen gemacht wird, ist der „beständige“ Stoffwechsel mit der Natur Voraussetzung für unsere Existenz als Gattung!
Ungeheure Naturkräfte
Vielleicht war Marx und Engels dieses Verhältnis des Menschen zu seinem eigenen Leib abstrakt bewusst, doch kommen wir zu dem eingangs formulierten Vorwurf zurück: Sie haben einfach zu früh gelebt - waren sie tatsächlich blind gegenüber dem zerstörerischen Potential der Produktivkräfte gegenüber der Natur?
Zuerst sollte deutlich darauf hingewiesen werden, dass in der bei weitem längsten Zeit der Menschheitsgeschichte für die absolute Mehrheit der Weltbevölkerung die Arbeit mühsam und qualvoll an den Boden gefesselt war und nicht nur der herrschaftlichen, sondern auch und häufig sehr drastisch der natürlichen Willkür (Klimaveränderungen, Dürren, Unwetter, Flutwellen, Einfall von „Schädlingen“ und wilden Tieren, Vulkanausbrüche …) ausgeliefert war. Der langsame Einblick in die Bewegungsgesetze der Natur, die Entwicklung der Wissenschaft waren wichtige Schritte der menschlichen Vergesellschaftung im Stoffwechselprozess mit der Natur, als auch für den gesellschaftlichen Stoffwechsel (die qualitativen Sprünge in der Entwicklung der Produktivkräfte sprengten die starren gesellschaftlichen Formen).
Marx und Engels wiesen jedoch drastisch auf die Perfidie der Produktivkraftentwicklung (der „Einverleibung ungeheurer Naturkräfte und der Naturwissenschaft“ MEW 23, S. 408) im Kapitalismus hin: Statt die Menschen von der mühsamen Arbeit zu befreien, forcierte die kapitalistische Entwicklung die Lohnarbeit. Der Einsatz der Maschinerie bedeutete eine Verlängerung und Intensivierung der Arbeit.
Und da Marx und Engels sowohl über eine tiefe historische Perspektive verfügten, als auch bemüht waren, vom modernen Stand der Wissenschaften zu lernen, entgingen ihnen nicht die ersten Auswirkungen auf den „unorganischen Leib“ Natur: „Wie in der städtischen Industrie wird in der modernen Agrikultur die gesteigerte Produktivkraft und größere Flüssigmachung der Arbeit erkauft durch Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft selbst. Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt in Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Je mehr ein Land, wie die Vereinigten Staaten von Nordamerika z.B. von der großen Industrie als dem Hintergrund seiner Entwicklung ausgeht, desto rascher dieser Zerstörungsprozess. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (K. Marx, Kapital I, MEW 23, S.529) Dies muss heute stark unterstrichen werden.
Der Blick zurück legt das Grundproblem offen:
„Das Fazit ist, dass die Kultur - wenn naturwüchsig vorschreitend und nicht bewusst beherrscht Wüsten hinter sich zurücklässt, Persien, Mesopotamien etc. Griechenland „ (Brief von Marx an Engels, 26. März 1868). Das Grundproblem liegt also in dem unbewussten „Fortschritt“ der Vergesellschaftung – welcher seit den frühen Gesellschaftsformen von Persien und Mesopotamien und ihrem relativ niedrigen Stand der Produktivkräfte heute ins Unermessliche gestiegen ist – eine zerstörerische Unermesslichkeit, wie immer wieder betont werden muss.
Fassen wir zusammen: die Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus schuf mit der „Einverleibung ungeheurer Naturkräfte und der Naturwissenschaft“ erstmals in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit für die Überflussproduktion, somit die Möglichkeit der Sicherung der Reproduktion der gesamten Weltbevölkerung. Beides konnte sich im Kapitalismus nur in seiner pervertierten Form ausdrücken, anarchische Krisen produzierende Überproduktion von Waren(müll) bei gleichzeitiger Verelendung der Weltbevölkerung. Dies beruhte auf einer Veränderung im Stoffwechselprozess mit der Natur, welche in der Wucht nur mit der neolithischen Revolution verglichen werden kann. Welche jedoch in ihrer weiteren Entwicklung auf die Zerstörung der „Beständigkeit“ des Prozesses hinausläuft. Solange die Produktivkraftentwicklung der Kapitalakkumulation bzw. dem Profit untergeordnet bleibt, wird sich daran nichts ändern. Nur die bewusste Vergesellschaftung ist in der Lage, auch den Stoffwechselprozess mit der Natur auf eine neue Stufe zu heben, die als Grundlage die „Beständigkeit“ des Stoffwechselprozess setzt.
„Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse sich erweitern; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, die diese befriedigen. Die Freiheit in diesem Gebiet kann nur darin bestehen, dass der vergesellschaftete Mensch, die assoziierten (frei und bewusst vereinten) Produzenten, diesen ihren Stoffwechsel mit der Natur rational regeln, unter ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, statt von ihm als von einer blinden Macht beherrscht zu werden; ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und passendsten Bedingungen vollziehen.“ (K. Marx, Kapital III, MEW 25, 828).
Marx und Engels hatten also eine Methode erarbeitet, welche ihnen schon im aufstrebenden Kapitalismus die Möglichkeit gab, das antagonistische System in seiner Komplexität und seiner Dialektik von erster und zweiter Natur zu begreifen und sie ermahnten uns, dass erst die bewusste Vergesellschaftung unsere „natürlich“ und „sozial“ würdige Gattungsnatur erreichen könne.[1]
Bebels Energiewende
Warum scheint dieser zentrale Aspekt der Marxschen Methode heute so tief verschüttet? Ist er in der Arbeiterbewegung nicht aufgenommen worden?
Schon ein Blick in die Leserbriefspalten der bürgerlichen Presse lässt diese Frage klar beantworten. Allein am 25. März 2011 wiesen zwei Leserbriefschreiber der FAZ auf die Bedeutung von August Bebels Buch „Die Frau im Sozialismus“ in der heutigen Klimadebatte hin. Im aufstrebenden Kapitalismus hatte sich besonders in Deutschland unter kritischer Begleitung von Engels die sozialdemokratische Partei als die Partei der Arbeiterbewegung etabliert. Sie war eine machtvolle Massenpartei, die das Parlament und ihre Presse als Agitations- und Propagandabühne nutzte. Arbeiterkulturvereine, Lese- und Bildungsgruppen bildeten eine eigene proletarische Gegenwelt, man bereitete sich auf den Weg zum Sozialismus vor. Dieses Selbstbewusstsein der revolutionären sozialdemokratischen Bewegung drückt sich voll in August Bebels 1879 erschienen Buch „Die Frau im Sozialismus“ aus. Bebel breitet hier umfangreiches empirisches Material aus und stellt Überlegungen an, wie die kapitalistischen Antagonismen mit dem damaligen Stand der Produktivkräfte und ihrer Befreiung und Weiterentwicklung im Sozialismus zu überwinden wären. Es ist keine Übertreibung zu behaupten, dass Bebel, neben vielen weiteren Menschheitsfragen, auch die Energiewende um über 130 Jahre vorweggenommen hat:
„Die vollste Ausnutzung und umfassendste Anwendung aber wird diese Kraft erst in der sozialisierten Gesellschaft erlangen. Sie wird sowohl als motorische Kraft wie als Licht- und Heizquelle in ungemeinem Maße zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gesellschaft beitragen. Die Elektrizität zeichnet sich vor jeder anderen Kraft dadurch aus, dass sie in der Natur im Überfluss vorhanden ist. Unsere Wasserläufe, Ebbe und Flut des Meeres, der Wind, das Sonnenlicht liefern ungezählte Pferdekräfte, sobald wir erst ihre volle und zweckmäßige Ausnützung verstehen.“ (A. Bebel Die Frau im Sozialismus S. 428)[2]
Doch hier sollen keine Illusionen genährt werden, Bebel machte dem Kapitalismus keine Vorschläge: „Das Kapital tut nicht mit, wo kein Profit herausspringt. Die Menschlichkeit hat keinen Kurs an der Börse.“ (A. Bebel S. 427) Ein neuer Schritt im Stoffwechselprozess des Menschen mit (seiner) Natur war für ihn nur im Sozialismus möglich und er ahnte schon, welche enorme Bereicherung dies bedeuten würde: „Der Mensch würde an Milde und Moral gewinnen“
„Der sozialistische Mensch … wird die Natur … beherrschen“
Als Trotzki sich nach Lenins Tod schon weit isoliert im Zentralkomitee und gesundheitlich angeschlagen im Jahr 1922/23 für einige Monate aufs Land zurückzog, schrieb er große Teile der Texte, die später als „Literatur und Revolution“ herausgegeben wurden. Auch Trotzki lässt seinen Blick mit bildmächtiger Sprache in die Zukunft schweifen. Hier finden sich berührend visionäre Ausblicke auf die Reichhaltigkeit und Tiefe der nach-revolutionären kommunistischen Debatte[3], aber auch deutliche Worte zum zukünftigen Verhältnis des Menschen zu seiner Natur:
„Der sozialistische Mensch will und wird die Natur in ihrem ganzen Umfang einschließlich der Auerhähne und der Störe mit Hilfe von Maschinen beherrschen. Er wird beiden ihren Platz anweisen und zeigen, wo sie weichen müssen. Er wird die Richtung der Flüsse ändern und den Ozeanen Regeln vorschreiben. […] Natürlich wird dies nicht bedeuten, dass der ganze Erdball in Planquadrate eingeteilt wird und dass die Wälder sich in Parks und Gärten verwandeln. Wildnis und Wald, Auerhähne und Tiger wird es wahrscheinlich auch dann noch geben, aber nur dort, wo ihnen der Mensch der Platz anweist. Und er wird dies so gescheit einrichten, dass selbst der Tiger den Baukran nicht bemerken und nicht melancholisch werden, sondern wie in Urzeiten weiterleben wird. Die Maschine steht nicht im Gegensatz zur Erde.“ (L. Trotzki „Literatur und Revolution“, S. 212)
Von heute aus gelesen, bekommt dieser Textausschnitt neben dem visionären auch einen schalen Beigeschmack. Zu sehr schiebt sich hier der über die Natur herrschende Mensch mit dem konterrevolutionären Programm „Aufbau des Sozialismus in einem Land“ unter Stalin zusammen. Trotzki hat Stalin zwar politisch bekämpft, jedoch hat er sich nie von seiner Analyse getrennt, in der Sowjetunion würden die ersten Schritte zum Sozialismus gemacht. Doch wir müssen scharf trennen zwischen dem menschen- und naturverachtenden Gigantomanismus des Stalinismus und der Kreativität der klasssenlosen Gesellschaft. Der Bau des Stalin-Kanals (der spätere Weißmeer-Ostsee-Kanal) 1931 – 33 änderte nicht nur „die Richtung der Flüsse“, es wurden auch Zehntausende durch Zwangsarbeit vernichtet.
Trotzkis Perspektive war (zehn Jahre vorher) trotz verheerendem Bürgerkrieg, katastrophalen Lebensbedingungen, dem beginnenden Rückfluss der revolutionären Welle und seiner eigenen politischen Isolation noch sehr optimistisch, was die zukünftige Kämpfe und den Weg zum Sozialismus betrifft und er hatte ein tiefes Vertrauen in die Menschheit und ihre kreatives Potential: „Schließlich wird er die Erde, wenn auch nicht nach seinem Vor- und Ebenbild, so doch nach seinem Geschmack umbauen. Wir haben keinen Grund zu der Befürchtung, dass dieser Geschmack ein schlechter sein wird.“ (S. 211). Ähnlich wie Bebels Visionen deuten Trotzkis Überlegungen auf eine enorme Kreativität und Radikalität hin – eben Menschheitsfragen. Damals wäre es notwendig gewesen, eine offene Parteidebatte um die Frage des dialektischen Verhältnisses des Menschen zu seiner eigenen Natur einzuläuten. Doch die Konterrevolution war schon weit fortgeschritten, die innerparteiliche Debatte war erstickt und es gehört zu den traurigen Kapiteln der Menschheitsgeschichte, dass Stalin an vielen Stellen Ideen von Trotzki aufnahm, um sie mit aller Menschen- (und Natur-)Verachtung umzusetzen (erinnert sei nur an das Programm gegen die angeblichen Kulaken auf dem Land und die Zwangskollektivierung, welche Millionen von Menschen das Leben kostete). Ein deutlicher Beleg dafür, dass der Stalinismus nicht nur eine un- sondern gar ein anti-marxistische Politik war.
Die Konterrevolution schritt voran. Die Perversion und Vernichtungskraft des ersten Weltkrieges wurde im zweiten um ein Vielfaches überschritten. Die Flächenbombardements von Großstädten und der Abwurf der Atombomben sollten jeden Gedanken an eine soziale Revolte nach der Menschenschlächterei zermalmen. Die wenigen Revolutionäre, die überlebt hatten, versuchten die Klassenperspektive aufrecht zu halten und den historischen Kurz zu bestimmen. Pannekoek schrieb 1955 im Alter von 82 Jahren: „Die Menschheit ist damit beschäftigt, sich selbst zu vernichten. In diesem kurzen Satz ist die atomare Bedrohung treffend formuliert.“ (A. Pannekoek, „Atompolitik“,1955 – wieder veröffentlicht in „Arbeiterräte – Texte zur sozialen Revolution“, Germinal 2008). Hiermit schließt sich Pannekoeks Analyse des niedergehenden Kapitalismus. Schon 1906 hatte er darauf hingewiesen: „Der Kapitalismus ist jetzt ein Hemmnis des Fortschritts.“ (A. Pannekoek, „Zukunftsstaat“, 1906 bei www.marxist.org [320]) und 1918, während des ersten Weltkriegs, hat er darauf hingewiesen, dass nun alle Produktionskräfte in den Dienst des Krieges gestellt worden wären und für Chaos und Verwüstung gesorgt hätten. Im niedergehenden Kapitalismus ist die Frage „Sozialismus oder Barbarei“ zu einer Gattungsfrage geworden: „Sozialismus oder Zerstörung der menschlichen Natur“. Diese zutiefst marxistische Analyse enthält zugleich schon einen deutlichen Hinweis auf die Haltung, die wir uns nur durch die Revolution zu unserer Natur erkämpfen müssen und deren Grundverhältnis bereits bei Marx angelegt war[4].
[1] „Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen.“ Marx, K. : Das Kapital, Band III S. 784
„Antizipation der Zukunft – wirkliche Antizipation – findet überhaupt in der Produktion des Reichtums nur statt mit Bezug auf den Arbeiter und die Erde. Bei beiden kann durch vorzeitige Überanstrengung und Erschöpfung, durch Störung des Gleichgewichts zwischen Ausgabe und Einnahme, die Zukunft realiter [in Wirklichkeit] antizipiert und verwüstet werden. Bei beiden geschieht es in der kapitalistischen Produktion.“ Marx, K., Kritik der politischen Ökonomie, S. 303)
[2] das hier angeführte Zitat stammt aus der 50. Auflage von 1909, hier zitiert er auch den britischen Physiker Sir S. Thomson: „Nicht allzufern ist der Tag, da die Ausnutzung der Sonnenstrahlen unser Leben revolutionieren wird, von der Abhängigkeit von Kohle und Wasserkraft befreit sich der Mensch, und alle großen Städte werden umringt sein von gewaltigen Apparaten, regelrechten Sonnenstrahlenfallen, in denen die Sonnenwärme aufgefangen und die gewonnene Energie in mächtigen Reservoirs aufgestaut wird ... Es ist die Kraft der Sonne, die, in der Kohle, in den Wasserfällen, in der Nahrung aufgestapelt, alle Arbeit in der Welt verrichtet. Wie gewaltig diese Kraftabgabe ist, die die Sonne über uns ausschüttet, wird klar, wenn wir erwägen, daß die Wärme, die die Erde bei hoher Sonne und klarem Himmel empfängt, nach den Forschungen von Langley einer Energie von 7.000 Pferdekräften für den Acre gleichkommt. Wenngleich unsere Ingenieure einstweilen noch nicht den Weg gefunden haben, diese riesenhafte Kraftquelle auszunutzen, so zweifle ich doch nicht, daß ihnen dies schließlich gelingen wird. Wenn einst die Kohlenvorräte der Erde erschöpft sind, wenn die Wasserkräfte unserem Bedürfnis nicht mehr genügen, dann werden wir aus jener Quelle alle Energie schöpfen, die notwendig ist, um die Arbeit der Welt zu vollenden. Dann werden die Zentren der Industrie in die glühenden Wüsten der Sahara verlegt werden, und der Wert des Landes wird danach gemessen werden, inwieweit es geeignet ist für die Aufstellung der großen 'Sonnenstrahlenfallen'. Hiernach wäre die Sorge, daß es uns jemals an Heizstoffen fehlen könnte, beseitigt. Und da durch die Erfindung des Akkumulatoren es möglich ist, große Kraftmengen zu binden und sie für einen beliebigen Ort und eine beliebige Zeit aufzusparen, so daß neben der Kraft, die Sonne, Ebbe und Flut uns liefert, die Kraft des Windes und der Bergbäche, die nur periodisch zu gewinnen sind, erhalten und ausgenutzt werden können, so gibt es schließlich keine menschliche Tätigkeit, für die, wenn notwendig, motorische Kraft nicht vorhanden ist. (A. Bebel Die Frau im Sozialismus S. 428/429)
[3] siehe, die Internationalen Revue Nr. 31, https://de.internationalism.org/node/616 [321]
[4] „Der Kommunismus als positive Aufhebung des Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens durch und für den Menschen; darum als vollständige, bewußt und innerhalb des ganzen Reichtums der bisherigen Entwicklung gewordne Rückkehr des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d.h. menschlichen Menschen. Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus = Humanismus, als vollendeter Humanismus = Naturalismus, er ist die Wahrhafte Auflösung des Widerstreites zwischen dem Menschen mit der Natur und mit dem Menschen, die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung.“ Marx, K., Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1844, S. 135.
Quelle des Briefs von Marx an Engels, 26. März 1868:
Aktuelles und Laufendes:
- Marxismus Umwelt [323]
- Marxismus Ökologie [324]
Leute:
Deutschland nach Fukushima - Die grüne Allzweckwaffe des deutschen Imperialismus
- 3809 Aufrufe
Die Katastrophe von Fukushima im Anschluss an das verheerende Erdbeben in Japan im März dieses Jahres hat weltweit Bestürzung hervorgerufen. Mit Entsetzen nahm die Weltöffentlichkeit die Hilflosigkeit des japanischen Kapitalismus angesichts dieser Katastrophe wahr, eines Hochtechnologielandes, dessen Ingenieure berühmt sind für ihre Kreativität. Doch nirgendwo waren die Reaktionen auf die Ereignisse in Japan so heftig wie in Deutschland: Fukushima war der endgültige Todesstoß für die deutsche Atomenergie; ihre ohnehin geringe Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung fiel angesichts der Bilder von den explodierenden Kraftwerksblöcken in Fukushima auf ein zu vernachlässigendes Maß. Die Folge: Noch nie hatte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine Bundesregierung ein von ihr selbst erlassenes Gesetz so schnell wieder kassiert wie die Merkel-Regierung, die in Windeseile das Gesetz zur Verlängerung der AKW-Laufzeiten, das sie gegen den heftigen Widerstand von erheblichen Teilen der Öffentlichkeit im Herbst vergangenen Jahres durchgepaukt hatte, im Juni dieses Jahres durch eine Novelle ersetzte, die das faktische Aus der Kernenergie in Deutschland in gut einem Jahrzehnt (2022) bedeutet. Hinter dieser ostentativen Abwendung von der Kernenergie, die sie noch Wochen zuvor noch als „Brückentechnologie“ auf dem Weg zu einer „nachhaltigen“ Energiepolitik gepriesen hatte, steckt zweifellos das Kalkül Merkels, ihre Regierung aus der Schusslinie der nun überwältigenden Mehrheit der Atomkraftgegner in der Bevölkerung zu bugsieren. Indem Merkel gegen innerparteiliche Widerstände und gegen die sich sträubende FDP versuchte, die Grünen, die Anti-Atomkraft-Partei schlechthin, links zu überholen (die nun verabschiedeten Restlaufzeiten der AKW sind kürzer als die ursprünglich von der rot-grünen Bundesregierung beschlossenen), bewies sie lediglich, dass ihr das eigene politische Überleben allemal wichtiger ist als das wirtschaftliche Wohlergehen der Energiekonzerne.
Doch es wäre zu kurz gegriffen, würde man diese überraschende Wende allein dem opportunistischen Machterhalt bestimmter Teile der politischen Klasse zuschreiben. Fukushima kam zwar unerwartet, aber durchaus nicht unwillkommen für die herrschende Klasse Deutschlands. Die 1800-Wende der Merkel-Regierung wurde von einer breiten Mehrheit nicht nur der Bevölkerung, sondern auch des deutschen Kapitals getragen (sehen wir einmal von den Energiekonzernen ab, denen jetzt natürlich ein äußerst lukratives Geschäft durch die Lappen geht). Worauf ist dieser krasse Unterschied in der Wahrnehmung dieser Katastrophe zwischen Deutschland und dem Rest der Welt (eingeschlossen Japan) zurückzuführen? Was sind die tieferen Hintergründe für den deutschen Alleingang in der Kernenergie-Frage? Und welche Folgen wird er innen- und außenpolitisch haben?
Die Rolle des Umweltschutzes in Deutschland
Die deutsche Umweltschutzbewegung ist nicht nur mittlerweile Vorreiter der modernen internationalen ökologischen Bewegung; sie ist bis heute auch ihre führende und erfolgreichste Kraft geblieben. Ihr politischer Arm – die Grünen – hat es bereits in etliche Landesregierungen und sogar den Sprung in die höchsten Machtebenen der Bundespolitik geschafft (dazu später mehr). Der lange Arm der privaten Naturschutzorganisationen und Umweltverbände wie auch der Umweltbehörden reicht weit bis in jedes kleine und größere Infrastrukturvorhaben. Kein größeres Unternehmen kann heute auf eine Umweltzertifizierung seiner Produkte und Produktion mehr verzichten. Die deutsche Bourgeoisie hat – mit einem Wort – die Ökologie für sich entdeckt. Dabei markierte Fukushima gewiss nicht den Beginn ihres Lernprozesses in Sachen Umwelt, sondern beschleunigte ihn bestenfalls.
Wie ist dieser Erfolg der Umweltbewegung in Deutschland zu erklären? Und warum hat sie in den anderen traditionellen Industrieländern nicht – oder zumindest nicht in einem vergleichbaren Ausmaß - Fuß gefasst? Einen Teil der Antwort findet man sicherlich in der Entstehungsgeschichte der Nachkriegs-Umweltbewegung in Deutschland. Letztere hatte, nachdem ihre ersten Vorläufer bereits Anfang der 1970er Jahre aufgekommen waren, ihre eigentliche Initialzündung mit dem Kampf gegen das geplante Atomkraftwerk Whyl, der 1973 begann und sich Mitte der 1970er, Anfang der 1980er Jahre zu einer Massenbewegung auswuchs. Auffällig dabei sind der Ort ihrer Entstehung und der Zeitpunkt ihrer Ausbreitung. Whyl, der Standort des geplanten (und dann doch nicht gebauten) AKW, befindet sich am Kaiserstuhl im Südwesten von Baden-Württemberg, einem traditionellen Weinanbaugebiet, fernab jeder Industrie. Ihren ersten Höhepunkt erlebte die Umweltbewegung mit der Bauplatzbesetzung von Whyl 1975 und der ersten Großdemonstration in Brokdorf 1976, Jahre nachdem Deutschland die letzten großen Arbeiterkämpfe erlebt hat. Die Öko-Bewegung war mithin im Schatten der Arbeiterkämpfe Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre entstanden, ihren Aufstieg zu einer Massenbewegung verdankte sie dem Abflauen derselben. Wie der Terrorismus der RAF und die Massenblüte der erzstalinistischen K-Gruppen war der massenhafte Zulauf zur Umweltbewegung in gewisser Hinsicht der aufkommenden Resignation vieler junger, militanter ArbeiterInnen gegenüber ihrer Klasse geschuldet, der es nicht gelang, ihre Kämpfe zu politisieren, sprich: in einen antikapitalistischen Zusammenhang zu stellen.
Neben der Schwäche der Arbeiterklasse in Deutschland gibt es aber auch historische Gründe für die verhältnismäßig große Bedeutung des Natur- bzw. Umweltschutzes in Deutschland. Schon in der Romantik eines Heinrich Heine u.a. und in den deutschen Mythen und Märchen (Gebrüder Grimm) spiegelt sich das besondere Verhältnis der Deutschen zum Wald als Symbol der unberührten Natur wider. „Entstanden sind die ersten umweltrelevanten Organisationen um die Jahrhundertwende (zum 20. Jahrhundert) im Kontext der Naturschutz-, Lebensreform- und Heimatbewegung. Prägend war für sie vor allem die Kritik an der technischen Moderne und der Zersiedelung der Landschaft infolge der Industrialisierung. Naturschutz- und Heimatbewegung lassen sich durchaus als antimodernistische soziale Bewegung verstehen, die überwiegend vom Bildungsbürgertum und dem städtischen Mittelstand getragen wurden.“[1] Auch die deutsche Arbeiterbewegung blieb nicht unberührt von dieser Frage. In zahlreichen Texten setzten sich ihre Vordenker – Marx, Engels, aber auch Bebel und andere – mit dem Verhältnis des Menschen zu seiner „äußeren Natur“ (Marx) im Allgemeinen und mit den verheerenden Folgen der kapitalistischen Produktionsweise für die natürliche Umwelt im Besonderen auseinander, wobei sie allerdings zwischen der kapitalistischen Produktionsweise und ihren Produktivkräften zu unterscheiden wussten und somit der Maschinenstürmerei des Kleinbürgertums nicht auf den Leim gingen.[2]
Diese Affinität der Deutschen zur Natur hat auch mit dem Umstand zu tun, dass Deutschland zurzeit der Industrialisierung Europas der Entwicklung lange Zeit hinterhergehinkt war, um dann das Versäumte umso schneller aufzuholen. Während Länder wie England, Belgien, die Niederlande Jahrhunderte Zeit für ihre kapitalistische Transformation gehabt hatten und sich die Intensität der Umwelteingriffe somit auf einen verhältnismäßig langen Zeitraum verteilt hatte, erlebte Deutschland, nachdem es gegen Mitte des 19. Jahrhunderts aus seinem Dornröschenschlaf erwacht war, die Entwicklung zu einem Industrieland fast im Zeitraffer. Weniger als zwei Generationen waren Zeuge und Opfer einer abrupten Veränderung ihrer eigenen Lebensumstände und der natürlichen Umwelt. Dies wird besonders deutlich in der Frage der Urbanisierung. Während sich in England, dem Vorreiter der industriellen Revolution, die Urbanisierungsrate von 1500 bis 1800 kontinuierlich von drei auf zwanzig Prozent erhöhte, legte sie im deutschsprachigen Raum im selben Zeitraum nur um etwas mehr als zwei Prozent zu (von 3,2 auf 5,5 Prozent), um dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts regelrecht zu explodieren. „Hatten bei der Gründung des Deutschen Reichs 1871 lediglich acht Städte mehr als 100.000 Einwohner, waren es 1910 bereits 48 Städte“.[3] Es liegt nahe, dass sich dieser plötzliche Einbruch der Moderne in die überwiegend agrarisch geprägte Gesellschaft Deutschlands in weiten Teilen der Bevölkerung als eine traumatische Erfahrung niederschlug. Eine Erfahrung, die bleibende Spuren hinterließ: zunächst in Gestalt einer antimodernistischen kleinbürgerlichen Naturschutz- und Heimatbewegung, die sich in der Idealisierung der Natur und der bäuerlichen Kultur äußerte, und schließlich in Form der Umweltbewegung von heute, der es mittlerweile gelungen ist, zum moralischen Imperativ von Politik und Wirtschaft zu avancieren.
Die Hintergründe der grünen Häutung der deutschen Bourgeoisie
Der Prozess der „Ökologisierung“ der deutschen Bourgeoisie begann gegen Mitte der 1980er Jahre. Die bürgerlichen Massenmedien begannen sich zunehmend des Themas des Umweltschutzes zu bemächtigen. Daneben sorgten Umweltkatastrophen wie die von Bhopal (1984) in Indien und Tschernobyl (1986) für eine weitere Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Umweltfragen. Sichtbarster Ausdruck dafür, dass die Umweltbewegung in der bürgerlichen Gesellschaft angekommen war, war sicherlich die Ernennung von Joschka Fischer zum Umwelt- und Energieminister in der hessischen Landesregierung 1985.
Der seitdem beständig wachsende Stellenwert der Ökologie in Politik und Wirtschaft war jedoch nicht in erster Linie das Ergebnis einer echten Einsicht und Umkehr der Herrschenden. Wann immer ökologische Bedenken gegen infrastrukturelle Maßnahmen (wie z.B. den Ausbau von Autobahnen durch Naturschutzgebiete) geäußert wurden, wann immer heimischen Industrien Beeinträchtigungen von außen drohten (wie beispielsweise die Sonderbesteuerung PS-starker Pkw durch Brüssel), verfuhren die Herrschenden in Deutschland noch unter jeder Regierungskonstellation nach dem Motto: ‚Was kümmert mich mein Öko-Geschwätz von gestern…‘ und ließen ihre umweltpolitischen Vorsätze fallen. Dennoch erkannten Teile der Wirtschaft in Deutschland schon recht früh, dass sich Teilbereiche der Ökologie durchaus mit den Akkumulationsbedürfnissen des Kapitals vereinbaren lassen. Schließlich kristallisierte sich im Rahmen der Umweltbewegung in Deutschland eine Schicht von Menschen heraus – eine Schicht von sehr gut, oftmals akademisch ausgebildeten Menschen, die fälschlicherweise von den bürgerlichen Soziologen ausnahmslos dem Mittelstand zugerechnet werden, in Wahrheit aber mehrheitlich „nur“ den höher gebildeten Teil der modernen Arbeiterklasse in Deutschland verkörpern -, die sich durch zwei Eigenschaften auszeichnet: einen relativ hohen Wohlstand und die Bereitschaft, für Bioprodukte und umweltverträgliche Produktion tiefer in die Tasche zu greifen. Diese solvente Gesellschaftsgruppe bildete die Grundlage für die Entstehung eines kleinen, aber lukrativen und vor allem wachsenden Absatzmarktes für Öko-Produkte. Darüber hinaus erwies sich der bundesdeutsche Staat, gleichgültig wer die Regierungsgeschäfte tätigte, mit zunehmender Dauer als der wichtigste Impulsgeber für das grüne Wachstum. Heute ist die Umweltindustrie in Deutschland auch und gerade dank staatlicher Lenkungspolitik in Form des gesetzgeberischen Instrumentariums, von Subventionen, Steuernachlässen und staatlichen Investitionen „für die deutsche Wirtschaft zum großen Geschäft (geworden). Mehr als 1,8 Millionen Beschäftigte verdienen mittlerweile ihr Einkommen damit - mehr als je zuvor. Das geht aus dem ersten ‚Umweltwirtschaftsbericht‘ des Bundesumweltministeriums hervor. Demnach hängt jeder zwanzigste Job in Deutschland an Gütern und Dienstleistungen rund um die Umwelt. Auch dient inzwischen jedes zwanzigste deutsche Industrieprodukt in irgendeiner Form dem Umweltschutz, mit wachsender Tendenz: Allein zwischen 2005 und 2007 wuchs die Produktion um 27 Prozent.“[4]
Die politische Klasse Deutschlands hatte mit ihrer Umweltpolitik jedoch von Anfang an mehr im Sinn als die Schaffung eines neuen Segments im Binnenmarkt, d.h. die Abschöpfung der Kaufkraft der „Ökos“. Mit der staatlichen Förderung der „ökologischen Modernisierung“ der deutschen Industrie bezweckte sie auch und vor allem eins: Die deutsche Wirtschaft sollte fit gemacht werden für den „grünen Weltmarkt“. Dank dieser – für bürgerliche Verhältnisse – weitsichtigen Politik gelang es dem deutschen Kapital, sich eine starke Stellung in diesem Markt zu sichern. Mittlerweile ist die deutsche Industrie mit 16 Prozent Weltmarktführer im Umweltbereich. „Besondere Stärken weist Deutschland bei der nachhaltigen Energiewirtschaft und bei der Abfall- und Kreislaufwirtschaft auf. Hier entfällt mehr als ein Viertel des Weltmarktes auf deutsche Unternehmen.“[5] Und nachdem die regionalen Auswirkungen der Umweltverschmutzung (wie der saure Regen und das Waldsterben in den 1980er Jahren) von der globalen Umweltkrise – die Erderwärmung - abgelöst wurden, wittert die deutsche Bourgeoisie nun das große Geschäft. Nichts Geringeres als einen „Green New Deal“ verspricht sie sich von den internationalen Klimaschutzprogrammen, zu denen sich ein Großteil der internationalen Staatengemeinschaft verpflichtet hat. Große deutsche Unternehmen bauen derzeit ihre Konzernstrukturen um, indem sie sich von Produktionssparten verabschieden, die im Verdacht stehen, die Umwelt zu belasten, und neue, „grüne“ Geschäftsfelder gründen. Der Siemens-Konzern beispielsweise plant per 1. Oktober dieses Jahres eine neue Produktionssparte namens „infrastructure & cities“, die laut Siemens-Vorstand das ehrenwerte Ziel verfolgt, die Megacities dieser Welt ökologisch umzubauen. „Idealismus? Tatsächlich geht es um dicke Geschäfte, den Kampf um Umsätze und Renditen. Zu einem erträglichen Leben gehören zum Beispiel U-Bahnen, leistungsfähige Stromnetze und eine Gebäudetechnik, die viele Menschen sicher auf engem Raum unterbringt. Siemens schätzt das Volumen dieses Marktes auf jährlich 300 Milliarden Euro, und will hier — wie überall — Marktführer sein. Auf 100 Milliarden Euro veranschlagt Siemens das Volumen allein von öffentlichen Auftraggebern.“[6] Schätzungen gehen davon aus, dass der Gesamtumsatz von Umwelttechnologien, der im 2005 noch eine Billion Euro betrug, auf 2,2 Billionen Euro im Jahr 2020 steigen wird. „Davon wird die deutsche Umweltindustrie kräftig profitieren", frohlockten das Bundesumweltministerium und das Umweltbundesamt in ihrem Bericht von 2009.
Neben den ökonomischen Motiven spielen aber auch strategische Gründe eine wichtige Rolle beim ökologischen Umbau von Teilen der deutschen Wirtschaft. Dies wird besonders in der Energiepolitik der herrschenden Klasse in Deutschland deutlich. Der deutsche Imperialismus hat in seiner Geschichte nie einen direkten Zugriff auf fossile Energiequellen wie Erdöl oder Erdgas besessen, was seine Großmachtambitionen von Anbeginn stark beeinträchtigte. Die Erdölförderung befand sich stets in der Hand seiner anglo-amerikanischen und niederländischen Kontrahenten; und auch heute, wo neue Tiefseeölfelder erschlossen werden und die Gruppe der global player im Großen Spiel ums Erdöl um neue Mitstreiter – von Norwegen über Venezuela bis Brasilien – erweitert wurde, hat Deutschland das Nachsehen. Auch in Sachen Kernkraft ist das deutsche Kapital schon längst aus dem Geschäft. Das letzte kommerzielle Kernkraftwerk in Deutschland wurde vor über 22 Jahren fertiggestellt; der so genannte Atomkonsens zwischen der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder und der Energiewirtschaft im Jahr 2000 segnete den Ausstieg aus der Kernkraft auch politisch ab, und 2001 beschloss Siemens indirekt den Ausstieg „aus dem sogenannten heißen Teil der Nukleartechnik“.[7] Angesichts dieser Abhängigkeit Deutschlands von fremden Energiequellen war es stets allgemeiner Konsens in der politischen Klasse der Bundesrepublik, die nationale Energiewirtschaft besonders zu fördern. Hier ist der Grund dafür zu suchen, dass die Strompreise in Deutschland die mit Abstand höchsten unter den Industrieländern sind. Die Mondpreise auf dem deutschen Strommarkt sind nicht ökonomisch bedingt, sondern politisch gewollt. Die vier Energieriesen E.on, RWE, EnBW und Vattenfall[8] gehören zu den strategisch relevanten Unternehmen des deutschen Staatskapitalismus. Ihr staatlich begünstigter Extraprofit dient nicht nur als Kriegskasse für den Erwerb ausländischer Energiekonzerne, sondern verfolgte auch stets den Zweck, dem deutschen Imperialismus eine größere Unabhängigkeit in der Energieversorgung zu ermöglichen – einst durch den milliardenschweren Ausbau der Kernenergie, nun durch die Forcierung der Nutzung alternativer, nicht-fossiler Energiequellen, insbesondere der Windenergie, aber auch anderer alternativer Energiequellen. Schon liegen in den Schubläden deutscher Stromkonzerne mehr oder minder konkrete Pläne zur Ausbeutung der Sonnenenergie in Gestalt riesiger „Solarfarmen“ in Nordafrika („Desertec“) und Südeuropa vor. Doch solange die alternative Energie noch nicht die fossile Energie vollständig ersetzen kann, soll eine Diversifizierung der Energiequellen (der berühmte „Energiemix“) einstweilen die einseitige Abhängigkeit des deutschen Imperialismus vom Erdöl mindern: Neben dem Neubau von Kohlekraftwerken (!) soll dies hauptsächlich durch Erdgaslieferungen aus Russland, ein Kernbestandteil der so genannten strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland, geschehen.
Der überstürzte Ausstieg aus der Kernenergie, der nun von der Merkel-Regierung beschlossen wurde, hat im Ausland viel Kopfschütteln ausgelöst. Für die imperialistischen Rivalen fügt sich dieser Alleingang in der Energiepolitik in das Bild eines Deutschlands, das sich allmählich von seiner Einbindung und Unterordnung in das Gleichgewicht der Kräfte löst, das die alliierten Sieger des II. Weltkriegs festgezurrt hatten. In der Tat versucht der deutsche Imperialismus schon seit geraumer Zeit seinen Platz in einer Welt zu finden, in der – nach der Aufhebung der alten Nachkriegsordnung des Kalten Krieges – die Karten neu gemischt werden. Da kommt die Ökologie wie gerufen. Sollte vor hundert Jahren die Welt noch am „deutschen Wesen“ genesen, so geriert sich die deutsche Bourgeoisie nun als das grüne Gewissen der Welt. Ginge es nach ihr, sollen deutsche Umweltstandards und –technologien die Welt vor der Umweltkatastrophe bewahren. Geschickt setzt sie die Ökologie auch als Mittel ein, um ihre imperialistischen Kontrahenten wie die USA (Kyoto) oder China (Kopenhagen) unter Druck zu setzen. Damit nicht genug. Auch auf innenpolitischer Ebene, im ideologischen Kampf gegen die Arbeiterklasse, erfindet sich der deutsche Nationalismus derzeit neu.
Der Umweltschutz als neuer nationaler Leitgedanke
Eine der vielen Hypotheken, die auf dem deutschen Imperialismus seit den unseligen Tagen des Nationalsozialismus lasteten, war seine Schwierigkeit im Umgang mit dem Nationalismus herkömmlicher Art. Die Monstrosität der Verbrechen im „III. Reich“ machten es den Herrschenden in Deutschland bis in die jüngste Zeit schwer, sich jener patriotischen Symbolik zu bedienen, die für den Rest der Welt so selbstverständlich ist. So mussten sie erst erhebliche Widerstände in der westdeutschen Öffentlichkeit überwinden, ehe sie es wagten, das Bundeswehrgelöbnis, den sog. Fahneneid der Wehrpflichtigen, außerhalb der Kasernen in aller Öffentlichkeit zu veranstalten. Und es bedurfte erst der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, um die Deutschland-Fahne gewissermaßen gesellschaftsfähig, zu einem selbstverständlichen Utensil für Jedermann zu machen. Auch die Nationalhymne trägt wenig zur Identitätsstiftung bei. Zwar wurde sie schamhaft bis auf eine einzige Strophe gekürzt, doch auch die amputierte Version geht vielen Menschen hierzulande noch immer schwer über die Lippen, verglichen mit der Inbrunst, mit der Franzosen, Amerikaner, Italiener, etc. ihre Hymne singen.
Nicht Schwarz-Rot-Gold oder Nationalflagge sorgten also für eine nationale Identität in der Nachkriegszeit, sondern… die D-Mark. Die D-Mark galt als sog. Hartwährung; im Vergleich zum Franc, zur Lira, zum Pfund oder zum Dollar schien sie ihre ganze Existenz hindurch unbeirrt auf Stabilitätskurs zu bleiben. Die „Deutschmark“ war überall auf der Welt angesehen, ja begehrt; wenigstens auf sie konnte man als Deutscher stolz sein im Ausland. Unvergessen bleiben die Szenen, als 1990, noch vor der offiziellen Wiedervereinigung, die D-Mark in die DDR eingeführt wurde – Szenen, die an Hysterie grenzten, an einen ekstatischen Tanz ums Goldene Kalb. So gehörte denn auch Deutschland zu den Ländern in der EU, in denen sich Widerstand gegen die Einführung des Euro regte. Das Unbehagen darüber, die „geliebte“ D-Mark aufzugeben, war bis weit in die Arbeiterklasse verbreitet und konnte nur durch das Versprechen besänftigt werden, dass der Euro nach denselben Stabilitätskriterien wie die D-Mark geführt werde, dass er quasi die D-Mark auf europäisch sei.
Keine zehn Jahre nach der pompösen Einführung des Euro ist von den guten Vorsätzen der Schöpfer des Euro nicht mehr viel übrig geblieben; alle Stabilitätsversprechen haben sich im Angesicht der aktuellen Schuldenkrise als Makulatur erwiesen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik macht sich in der Bevölkerung so etwas wie Angst vor der Entwertung des Euro bemerkbar, was sich daran ablesen lässt, dass die Sparguthaben der Bundesbürger insgesamt zurückgehen. Das Ersparte ausgeben, ehe es von der Inflation aufgefressen wird, heißt offenbar die Devise. Denn das Krisenmanagement der Regierenden erweckt kein Vertrauen in der Bevölkerung, im Gegenteil. Je länger die „Euro-Krise“ andauert, desto deutlicher wird, dass die Merkel-Regierung und mit ihr die gesamte politische Klasse Getriebene, Geisel der Märkte sind. All ihre Bemühungen, den Bankrott Griechenlands durch Rettungspläne zu verhindern, sind fehlgeschlagen, ja haben den Zustand des griechischen Patienten noch weiter verschlechtert. Die Verschuldung Griechenlands steigt trotz (oder gerade wegen) aller durch die EU aufgezwungenen Sparmaßnahmen im Staatshaushalt unaufhaltsam an. Es gibt zwei Möglichkeiten: Man lässt Griechenland pleitegehen, was von einer Minderheit in der CDU/CSU und FDP gefordert wird. Doch eine solche staatliche Insolvenz hätte unabsehbare Folgen nicht zuletzt für die anderen Wackelkandidaten Italien, Spanien, Portugal und damit auch für die EU selbst. Oder man greift zum sog. haircut, d.h. man erlässt Griechenland einen Großteil seiner Schulden, mit nicht minder heiklen Folgen. Denn auch wenn Merkel vorgibt, die Großbanken für den Fall eines solchen Schuldenerlasses in Regress zu nehmen, auch wenn sie zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Sarkozy neulich ihre Liebe zur Finanztransaktionssteuer entdeckt hat, so wird am Ende die Arbeiterklasse den Löwenanteil der aus einem solchen haircut entstehenden Kosten tragen.
Diese Entwicklung birgt brisante Perspektiven für die deutsche Bourgeoisie in sich. Zum einen ist auch die politische Klasse in Deutschland nicht vor den Gefahren eines Populismus gefeit. Nicht zuletzt der Wahlerfolg der „Wahren Finnen“ zeigt, dass wirtschaftlicher Wohlstand allein nicht vor einem europafeindlichen Rechtspopulismus schützt. Für das deutsche Kapital käme eine solche Entwicklung sehr ungelegen; eine derart engstirnige, den globalen Interessen des nationalen Kapitals zuwiderlaufende Bewegung, wie sie der Populismus auszeichnet, passt auf die Bedürfnisse des aktuellen Exportvizeweltmeisters wie die Faust aufs Auge. Zum anderen besteht, sollten die Lasten aus dem Griechenland-Abenteuer zu ungleich verteilt werden, durchaus die Gefahr einer sprunghaften Entwicklung des Bewusstseins in der Arbeiterklasse hierzulande. Überflüssig zu sagen, dass eine solche Entwicklung den Herrschenden noch viel weniger gefallen kann.
Was die deutsche Bourgeoisie in dieser Situation dringender denn je benötigt, ist ein nationales Projekt, ein nationaler Leitgedanke, in dem die Beherrschten Trost finden können, der sie dazu bringt, sich mit „höheren Interessen“ zu identifizieren und bereitwillig ihre eigenen Ansprüche zu opfern. Hier kommt spätestens die Frage der Ökologie ins Spiel, denn im Umweltschutz schlummert neben dem – wie wir gesehen haben – ökonomischen, strategischen und imperialistischen auch ein ideologisches Potenzial. Die grüne Ideologie bietet all das, was zu den Ingredienzen einer nationalistischen Ideologie gehört. Sie ist nationaler Konsens; ob Proletarier, Kapitalist, Kleinbürger oder Bauer, alle sind im Prinzip damit einverstanden, dass die natürliche Umwelt in Gefahr ist und dass man etwas dagegen unternehmen muss. Oder wie eine Autorin des Berliner Tagesspiegels schreibt: „Die Naturzerstörung ist für meine Generation das, was der Weltkrieg für die meines Vaters war. Die drohende Klimakatastrophe ist unsere größte gemeinsame Angst und unser kleinster gemeinsamer Nenner, und längst ist Sorge um die Umwelt kein parteiliches Alleinstellungsmerkmal mehr.“[9] Mit anderen Worten: der Umweltschutz ist zur Ersatzreligion geworden, zu der sich mehr oder weniger jeder bekennt. Die Rettung der Welt vor der Klimakatastrophe macht sich aber auch gut als nationale Mission, mit der die deutsche Bourgeoisie das eigene Volk für ihre imperialistischen Interessen gewinnen kann. Sie verschafft der Nation ein moralisches Überlegenheitsgefühl gegenüber dem Rest der Welt und trägt so zur Entfremdung gegenüber anderen Völkern bei. Und nicht zuletzt eignet sich der Umweltschutz geradezu vorzüglich als Mittel zur Auspressung der heimischen Arbeiterklasse. So kann es trotz gegenteiliger Beteuerungen seitens der bürgerlichen Politik keinen Zweifel daran geben, dass der Großteil der immensen Kosten, die der Ausbau der alternativen Energiegewinnung erfordert, von den Verbrauchern getragen werden wird. Ähnlich verhält es sich auf dem Wohnungssektor: Nicht genug damit, dass es durch die derzeitige Verknappung von verfügbaren Mietwohnungen zu erheblichen Mietsteigerungen gekommen ist, droht durch die staatlich geförderte Ausstattung öffentlicher und privater Gebäude mit Wärmedämmung eine neue Lawine von Mietsteigerungen. Unter dem Vorwand des Umweltschutzes können die Herrschenden bei ihren künftigen Angriffen gegen die Lohn- und Gehaltsempfängern einen erheblichen moralischen Druck ausüben. Wer sich dagegen zur Wehr setzt, gerät schnell ins gesellschaftliche Abseits. Keiner will sich nachsagen lassen, ihm sei der Schutz der Umwelt nicht ein paar Euro Mehrausgaben wert.
Es gibt kein Zweifel: Grün ist derzeit en vogue in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, und niemand profitiert politisch derzeit davon mehr als die Grünen – und mit ihnen der deutsche Kapitalismus.
Grüne und FDP – des einen Freud’ ist des andren Leid
Wir sind momentan Zeugen einer Wachablösung im politischen Herrschaftsapparat der deutschen Bourgeoisie. Um seine Bedeutung zu verstehen, ist es notwendig, einen kurzen Blick auf die jüngste Vergangenheit der politischen Klasse Deutschlands zu werfen. In den ersten fünf Jahrzehnten nach ihrer Gründung 1949 galt die Bundesrepublik als ein Hort politischer Stabilität und Kontinuität. Ihre Regierungskonstellationen überstanden oft mehr als zwei, drei Wahlperioden: Die CDU/CSU stellte von 1949 bis 1969 durchweg die stärkste Regierungspartei und errang in den Bundestagswahlen von 1957 sogar die absolute Mehrheit. Die sozialliberale Koalition, die nach einem dreijährigen Intermezzo einer Großen Koalition (von 1966 bis 1969) gebildet wurde, hielt immerhin dreizehn Jahre. Und die Ära Kohl, die 1982 begann, endete erst nach mehr als sechzehn Jahren, mit ihrer Ablösung durch Rot-Grün 1998. Es ist bezeichnend, dass bis zur Wahlniederlage der christlich-liberalen Koalition unter Helmut Kohl 1998 keine dieser Koalitionen durch den Wählerwillen zur Aufgabe gezwungen wurde. Weder die Ablösung der christlich-liberalen Koalition unter Ludwig Erhard durch die Große Koalition unter Kiesinger und Brandt noch das Ende Letzterer durch die Bildung der sozialliberalen Koalition unter Brandt und Scheel 1969 wurde durch Wahlen herbeigeführt. Auch der Wechsel von der sozialliberalen zur christlich-liberalen Koalition 1982 war mitnichten das Ergebnis „demokratischer Wahlen“, sondern das Resultat einer Hinterzimmer-Diplomatie.
Ein wesentlicher Grund für diese Beständigkeit von Regierungskonstellationen und für die Reibungslosigkeit beim Auswechseln von Regierungsmannschaften war die Existenz eines Dreiparteiensystems, das bis in die 1980er Jahre die politische Landschaft der Bundesrepublik beherrschte. Neben den beiden großen Volksparteien SPD und CDU/CSU existierte eine dritte Kraft, die eine Rolle spielte, welche weit über ihre eigentliche Größe hinausging: die FDP. Diese Partei, die selten mehr als zehn Prozent Stimmenanteil bei Bundestagswahlen errang, ist länger in der Regierungsverantwortung als jede andere Partei in Deutschland. Lange Zeit war die FDP mit ihren rechts- bzw. linksliberalen Flügeln das Zünglein an der Waage, das den Ausschlag für die eine oder andere politische Richtung gab. So verhalf die FDP 1949 der von Adenauers CDU betriebenen Westanbindung der noch jungen Bundesrepublik zum Erfolg und verhinderte somit einen Neutralitätskurs, wie ihn die SPD unter Kurt Schumacher vertrat. So sorgte sie aber auch zwanzig Jahre später mit ihrer Beteiligung an der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt für die Durchsetzung der so genannten Entspannungspolitik. Mit den Liberalen besaß die westdeutsche Bourgeoisie ein Instrument, mit dem sie sich von dem Zwang befreite, ihr politisches Schicksal allein den Wahlen zu überlassen, die bei allen Manipulationskünsten der Herrschenden immer auch eine Portion Ungewissheit beinhalten.
Mit der Etablierung der Grünen 1983 und der PDS/Linken 1990[10] als Bundestagsparteien verlor das bewährte Dreiparteiensystem allerdings seine Geschäftsgrundlage. Das nunmehr praktizierte Fünfparteiensystem war Ausdruck sowohl der Schwäche als auch der Stärke der deutschen Bourgeoisie. Es war ein Ausdruck von Schwäche insofern, als dass dies eine Zersplitterung der politischen Landschaft bedeutete und die Unwägbarkeiten im parlamentarischen Prozess vergrößerte. Das politische System war schwerfälliger geworden und komplizierter für die herrschenden Kreise in Deutschland zu handhaben. Es war aber ein Ausdruck von Stärke in dem Sinn, dass wichtige Bevölkerungsschichten, die sich von den etablierten Parteien abgewandt hatten, durch die Grünen und die Linke parlamentarisch gebunden wurden. Zudem wurde der Anschein eines Pluralismus erweckt; in den Medien wurde über alle (theoretisch) möglichen Parteienkonstellationen spekuliert: über Rot-Grün, Schwarz-Gelb, Rot-Rot-Grün und Schwarz-Grün, über Jamaika und Ampelkoalition, sogar über die Wiederauflage der sozialliberalen Koalition. Doch in der Praxis reduzierte sich diese vermeintlich große Auswahl bisher auf die altbekannte Farbenlehre - Schwarz-Gelb gegen Rot-Grün - oder gar auf die unbeliebteste aller Konstellationen - die Große Koalition von SPD und CDU/CSU.
Dies hatte zwei Ursachen: Zum einen zeigte sich schnell, dass die PDS alias Die Linke in ihrer bisherigen Zusammensetzung für eine Regierungsverantwortung auf Bundesebene völlig untauglich ist. Innerlich zerrissen vom Gegensatz zwischen Reformern und orthodoxen Stalinisten, zwischen alten SED-Kadern und westdeutschen Gewerkschaftsaktivisten sowie Trotzkisten, erfüllt die Linke heute allenfalls die Rolle des linken Populismus. Zum anderen ist der FDP unter Guido Westerwelle endgültig ihre Fähigkeit abhanden gekommen, gegenüber beiden großen politischen Lagern koalitionsfähig zu sein. Schlimmer noch: die dramatischen Verluste in den letzten Landtagswahlen und die katastrophalen Umfragewerte auf Bundesebene signalisieren auch das Ende der FDP als Mehrheitsbeschaffer für die Christsozialen. Der Wirtschaftsliberalismus bzw. Neoliberalismus, der seit der Eliminierung des linksliberalen Flügels uneingeschränkt in der FDP herrschte, ist spätestens seit dem Ausbruch der Finanz- und Schuldenkrise unwiderruflich diskreditiert. Die FDP hat somit ihre letzte Grundlage verloren; ihr droht der Absturz in die politische Bedeutungslosigkeit. Panisch versucht die neue Führung zu retten, was zu retten ist, und flüchtet sich dabei gar in populistische Ausfälle gegen den Euro. So ist die FDP dabei, auch ihr letztes Pfund zu verspielen, mit dem sie bisher wuchern konnte: das Vertrauen, das sie in der deutschen Bourgeoisie genoss.
Diametral entgegengesetzt zum Absturz der FDP verläuft derzeit die Leistungskurve der Grünen. Seit Fukushima schwimmen sie auf einer Erfolgswelle, die Ihresgleichen sucht. Die letzten Landtagswahlen waren für die Grünen geradezu ein Triumphzug: in NRW als gleichberechtigte Regierungsfraktion auf Augenhöhe mit der SPD, im Mecklenburg-Vorpommern zum ersten Mal in den Landtag gewählt, in Berlin Rekordergebnis erzielt und potenzieller Regierungspartner der SPD. Doch der Höhepunkt war zweifellos die Wahl des ersten grünen Ministerpräsidenten, und dies nicht in irgendeinem Bundesland, sondern ausgerechnet in Baden-Württemberg, der – neben Nordrhein-Westfalen und Bayern – wichtigsten industriellen Hochburg des deutschen Kapitalismus. Kurz nach den Vorfällen in Fukushima, die Grünen drohten in den Umfragen die SPD einzuholen, wurde in der Öffentlichkeit gar die Möglichkeit eines grünen Bundeskanzlers ins Auge gefasst. Die Grünen avancierten zum Darling der bürgerlichen Medien; nun wurden sie nicht nur bei „grünen“ Themen um Stellungnahme gebeten, sondern auch zu Fragen der Schulden- bzw. Eurokrise noch vor den SPD-Repräsentanten interviewt – was einem medialen Ritterschlag zur Hauptoppositionspartei gleichkam. Gerüchte gingen um, dass Joschka Fischer wieder zu joggen begonnen habe… Auch Jürgen Trittin, der bad guy der ersten rot-grünen Bundesregierung, wurde plötzlich als grüner Kanzlerkandidat gehandelt.
Nun, mittlerweile hat sich der Medienrummel um die Grünen etwas gelegt. Renate Künast, Spitzenkandidatin der Grünen für die Senatswahlen in Berlin, ist trotz Rekordergebnis mit ihrem ehrgeizigen Unterfangen gescheitert, die CDU als zweitstärkste Kraft, ja gar Wowereit als Regierenden Bürgermeister abzulösen. Auch der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, hat im Zusammenhang mit Stuttgart 21 schon den ersten Gegenwind zu verspüren bekommen. Dennoch scheint sich ein Trend zu verfestigen: Aus dem Fünfparteiensystem, das in den letzten zwei Dekaden dominierte, schält sich allmählich ein Dreiparteiensystem light heraus, in dem die Linke und die FDP zu marginaler Bedeutung, wenn nicht gar zur Bedeutungslosigkeit verdammt sind, während die Grünen im Begriff sind, zum Königsmacher für die beiden Großparteien SPD und CDU/CSU zu werden. Noch betrachtet die Führung der Grünen die SPD als „natürlichen Partner“, was auch damit zu tun hat, dass ein großer Teil der Gründergeneration der Grünen aus dem linksbürgerlichen Milieu – der sog. Spontibewegung und den K-Gruppen – stammt, das eine gewisse Affinität zur SPD besaß. Doch wie man so schön sagt: In der Politik gibt es keine Freundschaft, sondern nur Interessen. Es spricht Einiges dafür, dass die Bindung der Grünen an der SPD nur noch temporärer Natur ist. Eines der Haupthindernisse für eine schwarz-grüne Regierungskoalition auf Bundesebene ist bereits aus dem Weg geräumt: Auch die Konservativen, einst die eifrigsten Befürworter der Kernkraft, haben sich von ihr verabschiedet. Die Ablehnung der Kernkraft im Besonderen und der Schutz der Umwelt im Allgemeinen haben aufgehört, „parteiliches Alleinstellungsmerkmal“ oder Unterscheidungskriterium zwischen dem rechten und linken Lager der politischen Klasse in Deutschland zu sein. Sie sind zum allgemeinen ideologischen Glaubensbekenntnis der deutschen Bourgeoisie geworden.
20.09.2011
[1] Aus: „Umweltgutachten 1996“, Rat der Sachverständigen für Umweltfragen.
[2] Siehe dazu den Text „Der Marxismus und das Mensch-Natur-Verhältnis“, den wir Anfang August auf unserer Homepage veröffentlicht haben.
[4] Süddeutsche Zeitung, 16. Januar 2009.
[5] Aus einem Bericht des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes, Januar 2009.
[6] Nürnberger Nachrichten, 31. März 2011.
[7] Aus einem Interview mit dem Siemens-Vorstandsvorsitzenden Löscher in: Der Spiegel, Nr. 38, 19. Sept. 2011.
[8] Man könnte einwenden, dass im Falle Vattenfalls, dem kleinsten unter den vier Monopolisten, diese Politik keinen Sinn macht, handelt es sich doch bei Vattenfall um einen schwedischen Energiekonzern. Dies ist sicherlich richtig. Doch zeigt die Affäre um die Störfälle im AKW Krümmel im Jahr 2009, dass die herrschende Klasse hierzulande durchaus in der Lage ist, sich auch einen ausländischen Konzern gefügig zu machen, wenn es darauf ankommt.
[9] Der Tagesspiegel, 10. September 2011.
[10] Allerdings war die PDS anfangs nur durch sog. Direktmandate im Bundestag vertreten. Erst bei den Bundestagswahlen 1998 gelang es ihr erstmals, die Fünfprozenthürde zu überspringen.
Aktuelles und Laufendes:
- Atomausstieg Fukushima [329]
- deutsche Atompolitik [330]
- Atomausstieg Grünen [331]
- Rolle der Grünen [332]
Die Weltwirtschaftskrise: Ein mörderischer Sommer
- 2193 Aufrufe
Von den Lügen zur Wirklichkeit
Gehen wir ein bisschen zurück. Ende 2007, Anfang 2008 zog der Kollaps der Lehman-Bank die Wirtschaft an den Rand des Abgrunds. Das gesamte Weltfinanzsystem drohte wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Der Staat musste einen Großteil der Bankschulden übernehmen, die bereits unkalkulierbare Ausmaße angenommen hatten. Infolgedessen gerieten nun die Zentralbanken selbst in eine gefährliche Lage. Und die ganze Zeit hindurch bewies die Bourgeoisie ihren Zynismus. Wir wurden mit einer Reihe von Argumenten bombardiert, eines unehrlicher als das andere. Natürlich ist die Bourgeoisie von ihrem eigenen Diskurs übertölpelt worden. Die Ausbeuter können niemals einen ungetrübten Blick auf den Zusammenbruch ihres eigenen Systems haben. Dennoch ist das Lügen, das Betrügen, das Verbergen von Fakten eine Notwendigkeit für die Ausbeuter, um die Ausgebeuteten in ihrem Joch festzuhalten.
Begonnen damit, dass sie sagen, dies alles sei nicht so schlimm, dass sie die Lage unter völliger Kontrolle haben. Bereits dies wirkt etwas lächerlich. Doch das Beste sollte noch kommen. Anfang 2008, nach einem fast 20-prozentigen Rückgang des Weltwachstums, versprachen sie uns, ohne eine Miene zu verziehen, ein rasches Ende der Krise. Sie sei ein vorübergehendes Unwetter; doch die Tatsachen erwiesen sich als widerspenstig. Die Situation verschlechterte sich weiter. Unsere famosen Führer bedienten sich dann der krudesten nationalistischen Argumente. Uns wurde erzählt, dass alles der Fehler der amerikanischen Bevölkerung sei, die gedankenlos Kredite aufgenommen und Häuser gekauft habe, ohne die Mittel zur Bezahlung der Hypotheken zu haben. Es sei vor allem die „Grundstücksspekulation“ gewesen. Natürlich war diese Argumentation nicht sehr nützlich, als die Krise die Euro-Zone traf, als deutlich wurde, dass der griechische Staat nicht in der Lage, seinen Ausfall zu vermeiden. Daraufhin wurden die Argumente noch schamloser: Die Ausgebeuteten dieses Landes wurden als Betrüger und Profiteure beschrieben. Die Krise in Griechenland beträfe nur dieses Land, so wie zuvor Island und ein paar Monate später Irland. Im Fernsehen und Radio fügten all die Weltführer ihre mörderischen Phrasen hinzu. Laut ihnen gaben die Griechen zu viel aus. Die unteren Schichten lebten über ihre Kosten, wie die Herren! Doch angesichts des berechtigten Zorns innerhalb dieser Länder wurden die Lügen noch einen Zacken schärfer. In Italien wurde der gute, alte Berlusconi als alleiniger Verantwortlicher für eine total irrationale Politik ausgemacht. Doch mit dem sehr seriösen Präsidenten Spaniens, Zapatero, ging das nicht so leicht.
Nun wies die Bourgeoisie den Finger auf Teile ihrer selbst. Die Krise sei zumindest teilweise das Versagen der Finanzwelt, jener Haie, die gierig auf wachsende Profite seien. In den USA wurde im Dezember 2008 Bernie Madoff, ein ehemaliger Chef der Nasdaq und einer der bekanntesten und am meisten respektierten Investmentberater in New York, über Nacht zu einem der größten Ganoven auf dem Planeten. Auch die Ratingagenturen wurden als Sündenböcke benutzt. Ende 2007 wurden sie der Inkompetenz bezichtigt, weil sie das Gewicht der Umschuldung in ihren Kalkulationen vernachlässigt hätten. Und jetzt werden sie beschuldigt, zu viel Aufhebens über die Umschuldung in ihrer Beurteilung der Euro-Zone (für Moody’s) und der USA (Standard and Poor’s) zu machen.
Die Krise war
mittlerweile offen, weltweit sichtbar, so dass eine glaubwürdigere Lüge
benötigt wurde, eine, die der Realität gerechter wurde. Also hat es einige
Monate lang Gerüchte gegeben, dass die Krise durch unhaltbare und allgemeine
Schulden ausgelöst worden sei, die im Interesse der großen Spekulanten
aufgenommen worden seien. Im Sommer 2011, mit dem neuerlichen Ausbruch der
Finanzkrise, begann diese Argumentationslinie unsere Bildschirme zu erobern.
Auch wenn all diese Beispiele zeigen, dass die Bourgeoisie immer mehr
Schwierigkeiten hat, glaubwürdige Lügen zu erfinden, können wir davon ausgehen,
dass sie uns jederzeit neue Lügen auftischen wird. Dies zeigt sich am Lärm, den
die linken Parteien, die Rechtsextremen und eine Anzahl von Ökonomen
veranstalten, für die die gegenwärtige Verschlimmerung der Krise auf den
Finanzsektor zurückgeht und nicht auf den Kapitalismus als solchen. Natürlich
stöhnt die Wirtschaft unter dem Gewicht der Schulden, die sie weder
zurückzahlen noch bedienen kann. Dies untergräbt den Wert von Währungen,
steigert die Preise von Gütern und öffnet einer Reihe von Zusammenbrüchen von
Banken, Versicherungsunternehmen und Staaten. Es droht eine Paralyse der
Zentralbanken. Die eigentliche Ursache all dieser Schulden ist nicht die
unersättliche Gier von Finanzmaklern und Spekulanten und noch weniger der
Konsum der Ausgebeuteten. Im Gegenteil, die allgemeine Verschuldung ist eine
lebenswichtige Notwendigkeit für das Überleben des Systems im letzten halben
Jahrhundert gewesen und ermöglichte dem System, eine massive Überproduktion zu
vermeiden. Die fortschreitende Entwicklung der Finanzspekulation ist nicht die Ursache
der Krise, sondern eine Konsequenz aus den Mitteln, die von den Staaten benutzt
wurden, um zu versuchen, mit der Krise in den vergangenen fünfzig Jahren fertig
zu werden. Ohne die Politik des leichten Geldes, der Schulden bis zu dem Punkt,
wo sie unkontrollierbar werden, wäre der Kapitalismus nicht in der Lage
gewesen, ständig wachsende Warenmengen zu verkaufen. Es war die Anhebung der
Schulden, die das System befähigt hatte, das Wachstum in dieser Zeit zu
erhalten. Die monströse Entwicklung der Finanzspekulation, die in der Tat zu
einem ausgewachsenen Krebs für den Kapitalismus geworden ist, ist in Wahrheit
nur das Produkt der wachsenden Schwierigkeiten des Kapitalismus, profitabel zu
investieren und zu verkaufen. Die historische Erschöpfung dieser Fähigkeit Ende
2007, Anfang 2008 hat das Tor zur aktuellen Depression weit aufgestoßen.[1]
Eine Zeit der Depression und des Bankrotts
Die Ereignisse im August sind ein deutlicher Ausdruck davon. Der Präsident der Europäischen Zentralbank, J.C. Trichet, hatte kürzlich erklärt, dass „die gegenwärtige Krise so ernst wie die von 1930 ist“. Zum Beweis: seit dem Ausbruch der aktuellen Krisenphase kann das Überleben der Weltwirtschaft im wenigen Worten zusammengefasst werden: immer schnelleres und massives Drucken von Banknoten durch die Zentralbanken, vor allem in den USA. Was sie „Quantative Easing“ 1 und 2[2] nannten, war nur die Spitze des Eisbergs. In Wirklichkeit hat die Fed die Wirtschaft, die Banken und den amerikanischen Staat mit neuen Dollars buchstäblich überflutet. Und nachem sie diese Praxis ausgeweitet hat, gilt dies auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Das Bankensystem und der weltweite Wachstum sind dank dieser Bluttransfusionen am Leben erhalten worden. Die Depression, die vier Jahre zuvor begonnen hatte, ist dadurch etwas abgemildert worden. Doch im Sommer 2011 ist sie wieder zurückgekehrt.
Eines der Dinge, die der Bourgeoisie die meisten Sorgen bereitet, ist die aktuelle brutale Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten. Das Wachstum vom Ende 2009 und 2010 ist zusammengebrochen. In den USA erreichte das Bruttosozialprodukt (BSP) im dritten Quartal 2010 einen Wert von 14.730 Milliarden Dollar. Es ging hoch auf 3,5 Prozent seit dem niedrigsten Stand Mitte 2009, der noch 0,8 Prozent niedriger als jener Ende 2007. Nun, wo zu Beginn von 2011 ein Jahreswachstum von 1,5 Prozent prognostiziert wurde, fielen die realen Zahlen um etwa 0,4 Prozent. Für das zweite Quartal sind 1,3 Prozent Wachstum vorausgesagt worden, wohingegen es real nahe Null geht. Wir sehen dasselbe in Großbritannien und in der Euro-Zone. Die Weltwirtschaft sieht sich mit fallenden Wachstumsraten konfrontiert, und in einigen großen Ländern, wie die USA, sieht sich die Wirtschaft einem negativen Wachstum ausgesetzt, wie die Bourgeoisie dies nennt. Und trotz der Rezession steigt die Inflation an. Sie beträgt in den USA offiziell 2,985 Prozent, aber nach den Berechnungen des früheren Direktors der Fed, Paul Volcker, zehn Prozent. In China, das für all die „aufstrebenden“ Länder steht, steht sie bei neun Prozent jährlich.
In diesem August führte die allgemeine Panik auf den Finanzmärkten unter anderem zu der Erkenntnis, dass das Geld, das seit Ende 2007 hineingepumpt wurde, die Wirtschaft nicht in Bewegung versetzt und aus der Rezession verholfen hatte. Gleichzeitig hat es in den vier Jahren die Entwicklung der globalen Schulden bis zu dem Punkt zugespitzt, wo der Kollaps des Finanzsystems einmal mehr auf der Tagesordnung steht, dies allerdings in einer allgemein schlimmeren wirtschaftlichen Lage als 2007. Heute ist die wirtschaftliche Lage so schlecht, dass das Injizieren neuer Geldmittel, wenn auch in einem verminderten Maße, so überlebenswichtig wie nie zuvor ist. Die Europäische Zentralbank ist gezwungen, täglich eine Summe von rund zwei Milliarden Euro italienischer und spanischer Schulden aufzukaufen, um zu verhindern, dass diese Länder untergehen. Doch während dieses Geld unerlässlich für das tägliche Überleben des Systems ist, hat dies nicht einmal den limitierten Einfluss, den die Steigerung der Geldversorgung seit Ende 2007 hatte. Es würde eine Menge mehr erfordern, die Schulden aufzusaugen, die für Spanien und Italien (und sie sind nicht die einzigen) Hunderte von Milliarden Euros betragen. Die Möglichkeit, dass Frankreich sein Triple-A-Kreditrating verliert, wäre ein Schritt zu viel für die Euro-Zone. Allein Länder, die in dieser Kategorie eingestuft werden, können den europäischen Reservefonds finanzieren. Wenn Frankreich dies nicht mehr tun kann, wird die gesamte Euro-Zone auseinanderfallen. Die Panik, die wir in der ersten Hälfte des August gesehen haben, ist noch nicht vorbei. Wir sind Zeuge, wie die Bourgeoisie brutal gezwungen ist anzuerkennen, dass die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Stützung des Wirtschaftswachstums unmöglich geworden ist, selbst in begrenztem Ausmaß. Dies hat das gegenwärtige beklagenswerte Spektakel provoziert. Dies sind die grundlegenden Ursachen für die Spaltungen in der US-amerikanischen Bourgeoisie in der Frage des Anhebens der Schuldenobergrenze. Dasselbe trifft auf die mit viel Tamtam angekündigten Abkommen zu, die von den Führern der Euro-Zone entworfen worden waren, um Griechenland aus der Patsche zu helfen, und die nur ein paar Tage später von einigen europäischen Ländern in Frage gestellt wurden. Der Konflikt zwischen den Demokraten und Republikanern in den USA ist nicht eine bloße Unstimmigkeit zwischen verantwortlichen Leuten und unverantwortlichen Leuten auf der Rechten, wie die bürgerliche Presse es darstellt – selbst wenn die dogmatischen, absurden Forderungen der Rechten und der Tea Party insbesondere sicherlich die Probleme verschärfen, denen sich die herrschende Klasse in den USA gegenübersieht. Die Unfähigkeit der Führer der Euro-Zone, zu einem geordneten, im gegenseitigen Einvernehmen beschlossenen Abkommen gegenüber den europäischen Ländern, die nicht in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen, zu gelangen, ist nicht nur das Produkt der schäbigen Interessen der jeweiligen nationalen Kapitalien. Sie drücken eine tiefergehende Realität aus, eine, die für den Kapitalismus dramatisch ist. Der Bourgeoisie wird ganz einfach bewusst, dass eine neue Ankurbelung der Wirtschaft, wie dies zwischen 2008 und 2010 geschah, besonders gefährlich ist. Sie riskiert den Kollaps des Wertes der Schuldverschreibungen und der Währungen dieser Länder, einschließlich des Euro; ein Kollaps, der, wie wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, einen Anstieg der Inflation provoziert.
Welche Perspektiven für die Weltwirtschaft?
Die Depression ist da, und die Bourgeoisie kann sie nicht stoppen. Dies hat der Sommer 2011 mit sich gebracht. Die führende Weltmacht, um die herum die Wirtschaft des gesamten Planeten seit 1945 organisiert ist, ist dabei, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachzukommen. Einige Zeit zuvor wäre dies unvorstellbar gewesen, aber diese historische Realität ist ein Zeichen des Bankrotts der gesamten Weltwirtschaft. Die Rolle, die die USA mehr als 60 Jahre lang gespielt, nämlich die Rolle der ökonomischen Lokomotive, ist nun beendet. Die USA hat dies in aller Öffentlichkeit demonstriert: Sie können nicht mehr weitermachen wie bisher, auch wenn ein großer Teil ihrer Schulden von Ländern wie China und Saudi-Arabien übernommen wurden. Die Finanzen Letzterer sind selbst zu einem großen Problem geworden, und sie sind nicht in der Position, die globale Nachfrage zu bezahlen. Wer wird jetzt die Zügel übernehmen? Die Antwort ist ganz einfach: niemand! Die Euro-Zone gerät auf der Ebene sowohl der öffentlichen als auch der privaten Schulden von einer Krise in die nächste und sieht sich dem Ruin gegenüber. Die berühmten „Schwellenländer“ wie China sind umgekehrt völlig abhängig vom amerikanischen, europäischen und japanischen Markt. Trotz ihrer sehr niedrigen Produktionskosten, haben diese Ökonomien, wie die letzten Jahre gezeigt haben, das, was die Medien bubble economies nennen, entwickelt, d.h. auf der Grundlage kolossaler Investitionen, die nie zurückgezahlt werden können. Es ist dasselbe Phänomen, das wir in der von den Spezialisten so genannten Immobilienkrise in den USA und in der new economy einige Jahre zuvor betrachten konnten. In beiden Fällen ist das Resultat gut bekannt: ein Crash. China kann die Kosten für seine Kredite anheben, dennoch droht auch dem Reich der Mitte der Crash, so wie es im Westen geschehen war. Weit entfernt davon, die künftigen Pole des Wirtschaftswachstums zu sein, können China, Indien, Brasilien nur ihren Platz auf der Fahrt in die globale Depression einnehmen. Alle diese ökonomischen Emporkömmlinge werden das System noch weiter destabilisieren und desorganisieren. Was nun in den USA und in der Euro-Zone passiert, wird die Welt in die Depression treiben, wobei jeder Bankrott den nächsten nährt, und dies mit wachsendem Tempo. Die relative Atempause, die uns seit Mitte 2009 vergönnt war, ist nun vorüber. Der um sich greifende Bankrott der kapitalistischen Weltwirtschaft stellt die Ausgebeuteten der Welt nicht nur vor die Notwendigkeit, sich zu weigern, für die Auswirkungen der Krise zu zahlen. Es geht nicht mehr um massive Entlassungen oder die Senkung der Reallöhne. Es geht darum, dass wir einer Verallgemeinerung der Armut entgegengehen, einer wachsenden Unfähigkeit für Proletarier, für ihre grundlegendsten Bedürfnisse zu bezahlen. Diese dramatische Perspektive zwingt uns zu verstehen, dass es nicht eine besondere Form des Kapitalismus ist, der hier kollabiert, wie das Finanzkapital etwa, sondern der Kapitalismus als solcher. Die gesamte kapitalistische Gesellschaft eilt dem Abgrund entgegen, und mit ihr auch wir, wenn wir es zulassen. Es gibt keine Alternative außer ihren völligen Sturz, eingeleitet von der Entwicklung massiver Kämpfe gegen dieses zukunftslose, dem Untergang geweihte System. Angesichts dieses Scheiterns des Kapitalismus müssen wir für eine neue Gesellschaftsform kämpfen, in der die Menschen nicht mehr für den Profit einiger weniger produzieren, sondern um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen: eine wahrhaft humane, kollektive Gesellschaft – der Kommunismus (der nichts mit den politischen Regimes und Modellen der ökonomischen Ausbeutung der früheren UdSSR oder Chinas zu tun hat). Diese Gesellschaft ist sowohl notwendig als auch möglich.
TX, 14. August 2011
[1] Unter Depression meinen wir eine lange Periode fallender wirtschaftlicher Aktivitäten wie in den 1930er Jahren. Die Medien heute sprechen von dem Risiko einer neuen „Rezession“. Die amerikanische Administration definiert eine „Rezession“ als einen Produktionsrückgang über drei aufeinanderfolgende Quartale. Wenn wir die gegenwärtige Periode eine Depression nennen, dann weil die Periode der Stagnation und der fallenden Produktion, die wir gerade durchschreiten, nichts mit dem gemeinsam hat, was die Bourgeoisie als Rezession definiert.
[2] Die Zentralbanken drucken immer mehr Geld, um die Zirkulation der Warenmassen, die vom nationalen Kapital geschaffen werden, zu ermöglichen. In normalen Zeiten hängt die Steigerung der Geldproduktion vom Wachstum der allgemeinen Produktion ab. Tatsächlich aber haben die Zentralbanken seit der Verschärfung der Krise 2007 mehr Geld gedruckt, als für die Warnzirkulation (die in den entwickelten Ländern allgemein abgenommen hat) notwendig war, da es für die Zentralbanken sehr schnell notwendig wurde, Anleihen aufzukaufen, die von den Schuldnern – Banken und Staaten - nicht mehr zu ihrem Wert zurückgezahlt werden können. Trotz dieser Steigerung war die Federal Reserve, da weder die Zentralbanken noch der amerikanische Staat in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen, gezwungen, mehr Geld zu drucken, als ihre Berechnungen und Regeln normalerweise zulassen, um diese „toxischen“ Schulden auszugleichen. So entschied sie Ende 2009, einen zusätzlichen Betrag von 1.700 Milliarden Dollar auszuteilen (dies war QE1), und im November 2010 beschloss sie, weitere 600 Milliarden Dollar auszuteilen – QE2.
Aktuelles und Laufendes:
- Weltwirtschaftskrise [333]
- weltwirtschaftliche Depression [334]
- Schuldenkollaps [335]
- Währungsunion [336]
Proteste in Israel: „Mubarak, Assad, Netanjahu“
- 5126 Aufrufe
In den letzten drei Wochen sind Hunderttausende auf die Straße gegangen, um gegen die schwindelerregenden Lebenshaltungskosten, die wachsende Unmöglichkeit für einen Normalverbraucher, um sich ein Unterkommen zu leisten, den Abbau der Wohlfahrtsleistungen zu protestieren. Die Demonstranten forderten „soziale Gerechtigkeit“, doch viele sprachen auch über „Revolution“. Sie machten keinen Hehl aus der Tatsache, dass sie von der Welle von Aufständen in der arabischen Welt angeregt worden sind, die sich nun nach Spanien und Griechenland ausbreitet. Israels Ministerpräsident Netanjahu, dessen dreiste rechte Politik bis dahin scheinbar die Unterstützung der Bevölkerung hatte, wird plötzlich mit den Diktatoren Ägyptens (Mubarak, der mittlerweile wegen des Niederschießens von Protestierenden vor Gericht steht) und Syriens (Assad, der grauenhafte Massaker gegen eine Bevölkerung angeordnet hat, die von seinem Regime zur Verzweiflung getrieben wurde) verglichen.
Wie die Bewegungen in der arabischen Welt und in Europa scheinen die Demonstrationen und Zeltstädte, die mittlerweile in zahllosen Städten Israels, aber besonders in Tel Aviv aus dem Boden schießen, aus dem heiteren Himmel gefallen zu sein: Botschaften auf Facebook, ein paar Leute, die auf städtischen Plätzen Zelte aufstellen… und heraus kommt an einem Wochenende eine Demonstration von 50.000 bis 150.000 Menschen (und am vergangenen Samstag eine Demo von mehr als 200.000 Menschen) in Tel Aviv und annähernd das Drei- oder Vierfache im ganzen Land, die Mehrheit von ihnen junge Leute.
Wie in den anderen Ländern gab es des Öfteren Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei. Wie in den anderen Ländern haben die offiziellen politischen Parteien und Gewerkschaften keine führende Rolle in der Bewegung gespielt, auch wenn sie sicherlich vor Ort sind. Die in der Bewegung involvierten Leute werden häufig mit Ideen über die direkte Demokratie und selbst über den Anarchismus in Verbindung gebracht. Ein Demonstrant wurde in einem Interview mit dem Nachrichtensender RT gefragt, ob die Proteste von den Ereignissen in den arabischen Ländern inspiriert worden seien. Er antwortete: „Das, was auf dem Tahrir-Platz passierte, hat einen großen Einfluss. Das heißt, wenn Menschen begreifen, dass sie die Macht haben, dass sie sich selbst organisieren können, brauchen sie keine Regierung mehr, die ihnen erzählt, was sie tun sollen. Sie können nun ihrerseits der Regierung klar machen, was sie wollen.“ Diese Auffassungen spiegeln, auch wenn sie lediglich die Meinung einer bewussten Minderheit wiedergeben, mit Sicherheit ein weitaus allgemeineres Gefühl der Desillusionierung gegenüber dem gesamten bürgerlichen politischen System wider, gleichgültig ob in seiner diktatorischen oder demokratischen Form.
Wie seine Pendants anderswo ist diese Bewegung in ihrer Bedeutung historisch, wie von dem israelischen Journalisten Noam Sheizaf angemerkt wurde: „Anders als in Syrien oder Libyen, wo Diktatoren ihre eigenen Bürger zu Hunderten abschlachten, war es in Israel nie die Unterdrückung, die die Gesellschaftsordnung zusammenhielt, soweit es die jüdische Gesellschaft betraf. Es war die Indoktrination – eine vorherrschende Ideologie, um einen Begriff zu verwenden, der von kritischen Theoretikern bevorzugt wird. Und es war diese kulturelle Ordnung, die in dieser Protestwelle Dellen abbekam. Erstmals erkannte der Kern des israelischen Mittelstandes – es ist zu früh, um einzuschätzen, wie groß diese Gruppe ist -, dass er kein Problem mit anderen Israelis oder mit den Arabern oder mit bestimmten Politikern hat, sondern mit der gesamten Gesellschaftsordnung, mit dem gesamten System. In diesem Sinn ist es ein einmaliges Ereignis in der Geschichte Israels.
Daher hat dieser Protest solch ein enormes Potenzial. Dies ist ebenfalls der Grund dafür, dass wir nicht nur auf den unmittelbaren politischen Flurschaden schauen sollten – ich denke nicht, dass die Regierung demnächst stürzen wird -, sondern auch auf die langfristigen Konsequenzen, auf die Unterströmungen, die mit Sicherheit an die Oberfläche kommen werden“. („Die wahre Bedeutung des Zeltprotestes“ – [1])
Die Verharmlosung der Bedeutung dieser Ereignisse
Und doch gibt es auch jene, die nur zu gerne die Bedeutung dieser Ereignisse herunterspielen. Die offizielle Presse hatte Letztere weitestgehend alle ignoriert. Es gibt einen 800-1.000köpfigen Auslandspressekorps in Jerusalem (der zweitgrößte nach Washington), der erst Interesse zu zeigen begann, nachdem die Bewegung schon ein paar Wochen unterwegs war. Man muss schon lange nach einer Erwähnung dieser Bewegung in „fortschrittlichen“ Zeitungen wie The Guardian oder Socialist Worker in Großbritannien suchen.
Eine andere Methode besteht darin, sie als eine Bewegung des „Mittelstandes“ zu etikettieren. Es trifft zu, dass es sich, wie bei den anderen Bewegungen, hier um einen breiten sozialen Aufstand handelt, der die Unzufriedenheit vieler verschiedener Gesellschaftsschichten ausdrückt, vom kleinen Geschäftsmann bis zum Produktionsarbeiter, alle von ihnen von der Weltwirtschaftskrise, von der wachsenden Kluft zwischen Reich und Arm und von der Verschärfung der Lebensbedingungen durch den unersättlichen Hunger der Kriegswirtschaft in einem Land wie Israel in Mitleidenschaft gezogen. Doch der „Mittelstand“ ist ein vager, alles und nichts sagender Begriff, der sich auf jedermann mit einer Ausbildung oder einem Job und – in Israel wie in Nordafrika, Spanien oder Griechenland – auf die wachsende Zahl von ausgebildeten jungen Menschen bezieht, die in die Reihen des Proletariats gedrängt werden und in schlecht bezahlten und unqualifizierten Jobs arbeiten, wenn sie denn welche finden. Fest steht, dass auch die eher „klassischen“ Bereiche der Arbeiterklasse bei den Demonstrationen dabei waren: der öffentliche Dienst und Industriearbeiter, die ärmsten Bereiche der Arbeitslosen, einige von ihnen nicht-jüdische Immigranten aus Afrika und anderen Drittweltländern. Es gab auch einen 24-stündigen Generalstreik, mit dem der Gewerkschaftsbund Histradut versuchte, die Unzufriedenheit seiner eigenen Mitglieder in den Griff zu bekommen.
Doch die größten Verleumder der Bewegung sind die Linksextremisten. Wie in einem der Beiträge auf Libcom[2] formuliert wurde: „Ich hatte eine lautstarke Auseinandersetzung mit einem der führenden SWP-Leute in meiner Gewerkschaftsbranche, deren Argument darin bestand, dass Israel keine Arbeiterklasse hat. Ich fragte sie, wer dann die Busse fährt, die Straßen baut, nach den Kindern schaut, etc., und sie umging einfach die Frage und schwadronierte über den Zionismus und die Besetzung.“
Denselben Faden greift auch ein Link zu einem linksextremistischen Blog[3] auf, der eine raffiniertere Version dieses Arguments vorstellt: „Mit Sicherheit sind alle Ebenen der israelischen Gesellschaft, von den Gewerkschaften bis zum Bildungssystem, von den bewaffneten Kräften bis zu den dominierenden politischen Parteien, im Apartheidsystem verwickelt. Dies galt von Anbeginn, in der Keimzelle des israelischen Staates, der in der Zeit des britischen Mandats aufgebaut wurde. Israel ist eine Gesellschaft von Siedlern, und dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Klassenbewusstseins. Solange das Volk danach strebt, koloniale Außenposten zu errichten, solange es seine Interessen mit der Expansion des Siedler-Kolonialismus identifiziert, gibt es wenig Aussichten darauf, dass die Arbeiterklasse eine unabhängige revolutionäre Tagesordnung entwickelt. Nicht nur dass Israel eine Siedler-koloniale Gesellschaft ist, es wird darüber hinaus von den materiellen Ressourcen des US-Imperialismus unterstützt.“
Der Gedanke, dass die israelische Arbeiterklasse eine spezieller Fall ist, verleitet viele Linksextremisten zur Argumentation, dass die Protestbewegung nicht unterstützt oder nur unterstützt werden sollte, wenn sie Stellung zur palästinensischen Frage bezieht: „Die sozialen Proteste waren als Israels größte Protestbewegung seit den 1970er Jahren tituliert worden und werden aller Voraussicht nach in eine erneuerte Politik oder gar in eine Umbildung der Regierungsbehörden münden. Doch solange die Reformen sich nicht mit allen Kernfragen der unterdrückerischen und diskriminierenden Wohnsituation in Israel befassen, solange der Politikwechsel die Palästinenser nicht auf Augenhöhe mit den Israelis stellt, solange die Räumungsanzeigen aus Lust und Laune ausgesprochen werden, sind die Reformen gegenstandslos und die Proteste nutzlos.“ („Israels einseitige, ‚liberale‘ Wohnungsproteste sind keine Bewegung, der man sich anschließen oder die man gar verfechten sollte“, Sami Kishawi[4], Sixteen Minutes to Palestine-Blog)
In Spanien haben unter den Teilnehmern der 15M-Bewegung ähnliche Debatten stattgefunden, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Vorschlag, „dass die israelischen Protestler nur unterstützt werden sollten, wenn sie als Bewegung Stellung zur palästinensischen Frage beziehen, indem sie deutlich und offen die Besetzung und die Blockade von Gaza anprangern sowie zur Beendigung der Besiedlung (aufrufen)‘.“ (aus dem gleichen Diskussionsstrang auf Libcom)
Diese linksextremistischen Argumente sind durch die Praxis der Bewegung in Israel beantwortet worden. Zunächst einmal stellen die Fragen, die auf den Straßen Israels diskutiert werden, bereits die Spaltung zwischen Juden und Arabern und anderen in Frage. Einige Beispiele: in Jaffa trugen Dutzende von arabischen und jüdischen Protestlern Schilder, auf denen auf Hebräisch und Arabisch zu lesen war: „Araber und Juden wollen erschwingliche Wohnungen“ und „Jaffa will nicht Angebote nur für die Reichen“.
Arabische Aktivisten errichteten ein Lager im Zentrum von Taibeh, das von Hunderten von Menschen besucht wurde. „Dies ist ein sozialer Protest, der aus der tiefen Not in der arabischen Gemeinschaft herrührt. Alle Araber leiden unter den Lebenshaltungskosten und dem Wohnungsmangel“, sagte einer der Organisatoren, Dr. Zoheir Tibi. Eine Anzahl von drusischen Jugendlichen errichtete Zelte außerhalb der Ortschaften von Yarka und Julis im westlichen Galiläa. „Wir versuchen, jedermann in die Zelte zu ziehen, um sich dem Protest anzuschließen“, sagte Wajdi Khatar, einer der Initiatoren des Protestes. In der City von Akko wie auch in Ostjerusalem, wo es anhaltende Proteste sowohl von Juden als auch von Arabern gegen Wohnungsräumungen Letzterer im nahegelegenen Sheikh Jarrah gibt, wurden gemeinsame jüdische und arabische Zeltlager errichtet. In Tel Aviv wurden Kontakte zu den Bewohnern der Flüchtlingslager in den besetzten Gebieten geknüpft, die die Zeltstädte besuchten und sich an den Diskussionen mit den Protestierenden beteiligten.[5]
Im Levinsky-Park im Süden Tel Avivs, wo sich seit über einer Woche die stadtweit größte Zeltstadt befindet, versammelten sich am Montag, den 1. August, Hunderte afrikanische Immigranten und Flüchtlinge zu einer Diskussion[6] über die anhaltenden Proteste für eine bessere Lebensqualität, die in ganz Israel stattfinden.
Kein Grund, sich die Sparpolitik gefallen zu lassen
Zahllose Demonstranten haben ihre Frustration über die Art und Weise ausgedrückt, wie die endlose Litanei der „Sicherheit“ und der „Gefahr des Terrorismus“ benutzt wurde, um die Menschen dazu zu bringen, sich das wachsende wirtschaftliche und soziale Elend gefallen zu lassen. Einige haben offen vor der Gefahr gewarnt, dass die Regierung militärische Auseinandersetzungen oder gar einen neuen Krieg provozieren werde, um die „nationale Einheit“ wiederherzustellen und die Protestbewegung zu spalten.[7] Die Netanjahu-Regierung scheint auf den falschen Fuß erwischt worden zu sein und versucht sich derzeit in allerlei Beschwichtigungen, um der Bewegung die Spitze zu nehmen. Was wichtig ist, ist die Tatsache, dass es in der Tat ein wachsendes Bewusstsein darüber gibt, dass die militärische Lage und die soziale Situation eng miteinander verknüpft sind.
Wie immer ist die materielle Situation der Arbeiterklasse der Schlüssel zur Entwicklung von Bewusstsein, und die jüngste soziale Bewegung erhöht die Möglichkeit außerordentlich, mit einem Klassenstandpunkt an die militärische Situation heranzugehen. Das israelische Proletariat, das vom linken Flügel des Kapitals als eine „privilegierte“ Kaste porträtiert wird, die vom Elend der Palästinenser lebe, zahlt faktisch schwer für die israelischen Kriegsanstrengungen, und zwar mit dem Leben, mit psychischen Schäden und mit materieller Verarmung. Ein sehr prägnantes Beispiel, das zudem mit einer der Kernfragen hinter der Bewegung verknüpft ist, ist die Wohnungsfrage: Die Regierung lässt einen überproportionalen Geldbetrag dem Bau neuer Siedlungen zukommen, statt den Bestand an Wohnungen im restlichen Israel zu erhöhen.
Die Bedeutung der gegenwärtigen Bewegung in Israel besteht, trotz all ihrer Konfusionen und ihrem Zaudern, darin, dass sie sehr deutlich die Existenz von Klassenausbeutung und Klassenkonflikten innerhalb der scheinbar monolithischen Nation Israel bestätigt. Die Verteidigung des Lebensstandards der Arbeiterklasse wird unweigerlich mit den Erfordernissen des Krieges zusammenstoßen; und infolgedessen werden alle konkreten politischen Probleme, die der Krieg verursacht, aufgeworfen, diskutiert und geklärt werden müssen: die Apartheid-Gesetze in Israel und den besetzten Gebieten, die Brutalität der Besetzung, der Wehrdienst, bis hin zur Ideologie des Zionismus und zum falschen Ideal des jüdischen Staates. Sicherlich sind dies schwierige und potenziell entzweiende Fragen, und die Versuchung ist groß, zu vermeiden, sie direkt aufzuwerfen. Doch die Politik kennt den Weg, in jeden gesellschaftlichen Konflikt einzudringen. Ein Beispiel dafür waren die wachsenden Konflikte zwischen den Demonstranten und Repräsentanten der Rechtsextremisten gewesen – Kahanisten, die die Araber aus Israel vertreiben wollen, und fundamentalistische Siedler, die die Demonstranten als Verräter betrachten.
Doch es wäre kein Fortschritt, wenn die Bewegung diese rechten Ideologien ablehnte und dafür die Positionen des linken Flügels des Kapitals annähme: die Unterstützung des palästinensischen Nationalismus, für eine Zwei-Staaten-Lösung oder einen „demokratisch-säkularen Staat“. Die jüngste internationale Welle von Revolten gegen die kapitalistische Sparpolitik öffnet die Tür zu einer anderen Lösung: die Solidarität aller Ausgebeuteten über religiöse oder nationale Spaltungen hinweg; Klassenkampf in allen Ländern mit dem ultimativen Ziel einer weltweiten Revolution, die die Negation der nationalen Grenzen und Staaten sein wird. Ein oder zwei Jahre zuvor wäre eine solche Perspektive für die meisten völlig utopisch gewesen. Heute betrachtet eine wachsende Zahl von Menschen die globale Revolution als eine realistische Perspektive gegenüber der kollabierenden Ordnung des globalen Kapitals.
Amos, 7.8.2011
[4] smpalestine.com
[5] Einer der Israelis, die an diesen Treffen teilgenommen hatten, beschrieb die positiven Effekte, die die Diskussion auf die Entwicklung des Bewusstseins und der Solidarität hatte: „Unsere Gäste, einige von ihnen in frommer Tracht, hörten aufmerksam der Geschichte über die mittelständischen jüdischen Jugendlichen – kein Platz, wo man leben, studieren und arbeiten kann – zu. Es gibt so viele, so kleine Zelte. Sie nicken verblüfft, drücken ihre Sympathie oder vielleicht sogar ihr Gefallen über das neue Potenzial für die Solidarität aus. Die Scharfzüngige präsentiert schnell eine Pointe, auf die keiner von uns gekommen wäre: ‚Hada Muchayem Lajiyin Israeliyin!‘ – ‚Ein Flüchtlingslager für Israelis‘, ruft sie.“
„Wir lachen über diesen schlauen Fuchs. Überhaupt keine Ähnlichkeit, das steht fest – oder vielleicht eine ganz geringe immerhin. Die jungen Leute von Rothschild (Allah möge ihnen helfen, möge ihr Protest Früchte tragen) sind vermutlich imstande, jederzeit aufzustehen und zum harten Leben zurückzukehren, das sie gewohnt waren, bevor sie sich auf dem brodelnden Boulevard niederließen. Jedoch sind sie dazu verurteilt, am hinteren Ende der israelischen Wohnungskette zu leben – ohne Eigentum, ohne Land und ohne Dach über ihrem Kopf. Einige Frauen, die an diesem Abend mit uns unterwegs waren – überschwänglich, voller Neugier und Spaß an der Freude –, haben die meiste Zeit ihres Lebens in ‚echten‘ Flüchtlingslagern gelebt. Einige wurden dort geboren, andere verheirateten sich und zogen dorthin, um das Los von Großfamilien zu teilen, die zusammengepresst in zerbröckelnden Wohnstätten hausen, die vor vielen Jahren als provisorische Zeltlager am Rande von Städten und Ortschaften in der West Bank begonnen hatten.“
„Die wütenden Bewohner der ‚Flüchtlingslager‘ Israels überall im Land durchlaufen in diesen Tagen einen Erweckungsprozess, weg vom falschen Bewusstsein, das sie zu dieser heiklen Weggabelung des Sommers 2011 brachte. Es ist kein leichter Prozess, aber Wert genug, sich die Mühe zu machen, den ganzen Weg zu den Wurzeln unserer Probleme zu gehen. Jene von uns, die das Privileg hatten, am letzten Wochenende mit unseren Freunden aus den Dörfern und Flüchtlingslagern der besetzten Gebiete auf einem Tel Aviver Hausdach zu tanzen, zu singen und sich zu umarmen, werden niemals zustimmen, den warmherzigen menschlichen Kontakt mit Leuten, die wir einst als unsere Feinde betrachtet hatten, wieder aufzugeben. Man stelle sich vor, wie viele gute Wohnungen mit den Gewinnen hergestellt werden könnten, die jahrzehntelang für die Untermauerung des blödsinnigen Konzeptes verschwendet wurden, wonach alle Nicht-Juden eine ‚Gefahr für unsere Demographie‘ seien.“ (https://en.internationalism.org/icconline/2011/08/social-protests-israel [341]).
[7] Siehe zum Beispiel das Interview mit Stav Shafir in den RT-Nachrichten [343] (https://www.youtube.com/watch?v=6i6JKSGEs8Y&feature=player_embedded#... [344]
Geographisch:
- Israel [345]
Aktuelles und Laufendes:
- Palästinakonflikt [346]
- Proteste in Israel [347]
Theoretische Fragen:
- Internationalismus [348]
Schweiz/Wirtschaftskrise - Auch in sogenannt reichen Ländern weiss die Bourgeoisie keinen Ausweg
- 2383 Aufrufe
Was passierte in den letzten 12 Monaten?
Ende Oktober 2010 lag der Kurs für 1 € bei 1 Franken 37 Rappen. In mehreren Schüben verschlechterte sich dieser Wechselkurs und erreichte in der ersten Augusthälfte 2011 fast die Grenze von 1 Franken (1.03). Die Stärkung des Frankens zeigte sich nicht nur gegenüber dem Euro, sondern auch gegenüber dem US-Dollar: Im letzten Herbst war 1 $ etwa 1 Franken wert; im August 2011 bezahlte man aber dafür manchmal weniger als 0.75 Franken.
Obwohl die Schweizer Industrie international wettbewerbsfähig ist, hat sie gerade im weltweiten Warentausch mit einem Nachteil zu kämpfen: Weil die Waren aus der Schweiz einen Preis in Franken haben, verteuern sich diese für die Käufer im Euro- oder Dollarraum (die weit überwiegenden Destinationen schweizerischer Exporte) um rund ein Viertel, also beträchtlich. Solche Preiserhöhungen kann man nicht so leicht wettmachen - viele Schweizer Betriebe lassen aber beispielsweise die Angestellten zwei Stunden pro Woche gratis länger arbeiten, um den Stückpreis einer Ware zu senken.
Oder wie der
Südkurier aus Konstanz vom 03.08.11 schreibt: „Der starke Frankenkurs bringt
die Schweizer Exportwirtschaft immer mehr in Nöte. Die Auftragsbücher der
Industrie sind zwar voll, aber wegen des Wechselkurses werden die Gewinnmargen
immer kleiner. Unbezahlte Mehrarbeit reicht einigen Schweizer
Exportwirtschaftsbetrieben nicht mehr, die wegen des starken Frankens
schmelzenden Gewinnmargen zu stabilisieren. Einige wollen jetzt die Grenzgänger
bluten lassen. Laut Berichten Schweizer Medien will die
Metallverarbeitungsfirma Angenstein in Aesch im Kanton Basel Land
Grenzgängerlöhne an den Eurokurs koppeln. Die Betroffenen haben dadurch
Lohneinbußen von bis zu zehn Prozent zu befürchten. Laut Gewerkschaften tragen sich
andere Betriebe mit ähnlichen Gedanken.“
Oder die Tagesschau des Schweizer Fernsehen vom 18.08.11: „Die
Medizinaltechnik-Firma Storz Medical im thurgauischen Tägerwilen will ihren 130
Angestellten den Lohn um monatlich 10 % kürzen und sie erst noch zwei Stunden
pro Woche länger arbeiten lassen.“
Wie immer ist es die Arbeiterklasse, die die Zeche bezahlt.
Insbesondere auch die Tourismusindustrie in der Schweiz hat einen katastrophalen Sommer hinter sich, weil nicht nur wegen des schlechten Wetters, sondern insbesondere wegen des teuren Frankens die ausländischen Gäste einen weiten Bogen um die Schweiz machten.
Die Schweizer Bourgeoisie war sich im Laufe des Sommers 2011 insofern einig, als der Staat etwas gegen die Frankenstärke und für die bedrängte Export- und Tourismuswirtschaft tun müsse:
- Um die Kapitalisten dieser Branchen etwas zu beruhigen, kündigt der Bundesrat (die Exekutive des Staates Schweiz) Mitte August 2011 ein Zwei-Milliarden-Franken-Hilfspaket für Exportindustrie und Tourismusgewerbe an. Ob und wieweit dieses Hilfspaket des Staates für die Kapitalistenklasse ausgepackt wird, ist noch offen. Einig ist man sich aber darin: „Es gehe um ein Angebot an die betroffene Wirtschaft, das in erster Linie psychologische Wirkung habe, betonte Bundesrat Johann Schneider-Ammann.“ (NZZ 15.9.11)
- Am 6. September entscheidet die Nationalbank SNB, dass der €/CHF-Kurs bei 1.20 zu stabilisieren sei und greift entsprechend mit massiven Verkäufen von Schweizerfranken in den internationalen Währungstausch ein. Seither ist der Euro-Kurs nicht mehr unter CHF 1.20 gefallen.
Die Staatsverschuldung in der Schweiz ist relativ gering. Sie beträgt etwa 209 Mrd. Franken (rund 177 Mrd. Euro). Da die Schweiz über 1.040 Tonnen Gold im Wert von etwa 48 Mrd. Euro verfügt, ist die Schweizer Staatsverschuldung zu 27 Prozent mit Gold gedeckt. Zum Vergleich: Die deutsche Staatsverschuldung ist zu etwa 7 Prozent durch den Goldpreis gedeckt.
Die Staatsverschuldung betrug Ende 2010 (in % des BIP):
- USA 95%
- DE 83 %
- EU 80%
- CH 55%
Trotz vergleichsweise gutem Wirtschaftsgang im laufenden Jahr gibt es ständig weitere Entlassungen. In allen Landesteilen werden Betriebe geschlossen oder redimensioniert. Auch in der Bankenbranche geht man von anstehenden Stellenverlusten von etwa 10'000 aus.
Fazit bis hierher: Ob die Bourgeoisklasse in der Schweiz unter der Frankenstärke so stark leidet, wie sie jammert, ist eine offene Frage, da sie ja ihr Vermögen mindestens zu einem wesentlichen Teil in Schweizer Franken angelegt haben wird, welcher Teil - dank der Verteuerung des Frankens - nun gemessen am Euro oder US-Dollar 10-20% mehr wert ist. Wer aber unter der aktuellen Entwicklung in der Schweiz sicher leidet, ist das Proletariat: durch unbezahlte Mehrarbeit, Lohnkürzungen, Arbeitslosigkeit, kürzere Bezugsdauer bei den Arbeitslosentaggeldern usw. - dies betrifft alle Arbeiter und Arbeiterinnen unter schweizerischem Kapitalkommando grundsätzlich gleich.
Welche Triebkräfte hinter diesen Erscheinungen?
Die Frankenstärke und umgekehrt die Euro- und Dollarschwäche haben etwas mit der Verschuldung der jeweiligen Staaten zu tun, die hinter den Währungen stehen. Insofern ist es naheliegend, dass in einer Situation, in welcher der Euro und der Dollar aufgrund der Krisenentwicklungen in den entsprechenden Wirtschaften an Wert verlieren, der Schweizer Franken diesen Absturz nicht mitmacht oder wenigstens nicht im gleichen Tempo. Wenn die Zahlungsfähigkeit eines Staates oder einer Staatengruppe, die eine Währung herausgibt, abnimmt, schwindet auch der Wert dieser Währung, die ja einen anteilmässigen Anspruch auf den Reichtum des Staates bzw. der Staatengruppe verbrieft.
Die Schweizer Wirtschaft steht auch hinsichtlich der Produktivität und der Wachstumsraten nicht schlecht da, wenigstens wenn man letztere mit denjenigen von anderen alten Industrieländern vergleicht. Die Schweiz ist nicht nur ein Finanzplatz, sondern verfügt auch über eine konkurrenzfähige Industrie von Produktions- und Konsumgütern.
Unbestritten ist, dass der Frankenkurs zusätzlich aufgrund der Währungsspekulation so stark gestiegen ist. Angesichts der Probleme der Euro-Zone mit der drohenden Staatspleite Griechenlands und angesichts der massiven Ausweitung der Geldmenge in den USA suchen die Reichen dieser Welt, die bisher ihr Geld in Dollar oder Euro angelegt hatten, nach neuen sicheren Häfen für ihre zusammengerauften Vermögen. Bei solchen Fluchtbewegungen bieten sich die Schweizer Banken seit langem an - der Franken ist eine Fluchtwährung. Dabei steigt der Preis des Frankens über seinen eigentlichen Wert. Die Spekulanten sind bereit, selbst einen zu hohen Preis zu bezahlen, weil sie damit rechnen, dass der Kurs morgen noch höher sein werde. Ob er dies auch tatsächlich sein wird?
Was bewirken die staatlichen Maßnahmen?
Die Schweiz ist klein und stark exportabhängig. Das hier ansässige Kapital und sein Staat (kurz: der schweizerische Staatskapitalismus) haben noch weniger Entscheidungsfreiheit als ihre grösseren Konkurrenten. Kurz: Die Schweizer Bourgeoisie muss sich anpassen, vor allem gegenüber denjenigen, welche die stärksten Wirtschaftsverflechtungen mit den hiesigen Unternehmen haben - dem EU-Raum und den USA. Diese Zwangslage der Schweizer Wirtschaft wird auch in den ständig neu aufgelegten Steuerstreitigkeiten der USA und der EU mit den schweizerischen Banken deutlich. Der Finanzplatz Schweiz hat bis jetzt zu einem erheblichen Teil damit Geschäfte gemacht, dass sie reichen Ausländern half, ihr Geld vor dem eigenen Finanzamt in Sicherheit zu bringen. Insbesondere die grossen europäischen Staaten und die USA nehmen dies nicht mehr hin und üben entsprechend Druck aus, teilweise mit Strafverfahren gegen die Grossbanken UBS und CS. Und jedes Mal müssen diese Banken Federn lassen und Milliardenbeträge bezahlen.
Was den überbewerteten Franken betrifft, gibt es als Variation auf das Dilemma der Bourgeoisie in den anderen Industriestaaten folgende Alternative für den Staat und seine Dirigenten:
- Lässt die Nationalbank den Frankenkurs an den Euro binden, verliert sie die Herrschaft über die Inflation. Die Konsequenz einer Inflation ist eine faktische Enteignung der Geldbesitzer, auch der Proletarier, soweit ihr Lohn nicht gleich schnell steigt, wie der Wert des Frankens fällt. Die Inflation endet meist in einer offenen Rezession.
- Bleibt der Staat untätig, wird der Franken so teuer, dass die Industrie die Konkurrenzfähigkeit angesichts der Rivalen in den anderen starken Exportländern definitiv verliert. Auch bei diesem Szenario sind also die Verwüstungen der Weltwirtschaftskrise unvermeidlich, nur kommen sie hier durch die Hintertür ins Haus.
Die Bourgeoisie versucht auch in der Schweiz Zeit zu gewinnen, damit die Auswirkungen der Krise etwas verteilt werden können und nicht alle Angriffe und die zu erwartenden Firmenpleiten gleichzeitig erfolgen.
Im internationalen Geflecht der Beziehungen verfolgt die Regierung mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg die Politik, sich möglichst lange alle Optionen offen zu halten. Bezogen auf die EU hat dies immer geheissen, dass man sich so wenig wie möglich einbinden lässt, aber trotzdem nicht alle Türen verschliesst. Damit will die Bourgeoisie den Kopf nicht in die Schlinge stecken, welche die EU für sie darstellen würde. Sie will z.B. nicht für Länder wie Griechenland mit haften müssen. Doch auch diese vorsichtige Strategie bewahrt die Schweizer Kapitalisten nicht vor den Problemen der Weltwirtschaftskrise. Die Verflechtungen des Marktes sind viel zu stark, um einen Teil des Kapitals vor den negativen Auswirkungen der weltweit relativ abnehmenden zahlungskräftigen Nachfrage zu verschonen.
Im Kapitalismus keine Lösung
Es gibt keine Lösung mehr, die auch nur die Herrschenden, geschweige denn die arbeitenden Massen befriedigt. Kein Land und v.a. kein Teil der Arbeiterklasse wird von den Auswirkungen der Krise verschont.
Immer offener ist selbst in bürgerlichen Medien von der Sackgasse die Rede, in welcher die kapitalistische Wirtschaft steckt - manchmal sogar unter Bezugnahme auf Karl Marx. So schreibt Res Strehle im Tagesanzeiger vom 14.09.11: „Marx wies (…) darauf hin, dass in der kapitalistischen Form der Marktwirtschaft ein grundlegender Widerspruch steckt: Jeder Anbieter versucht in einem funktionierenden Markt so billig wie möglich zu produzieren. Das Zaubermittel dafür heisst bei existenzsichernden oder gar guten Löhnen Rationalisierung. Die teure, in fortgeschrittenen Sozialstaaten durch staatliche Abgaben zusätzlich belastete Arbeiterkraft wird nach Möglichkeit durch Maschinen, Software, Technologie ersetzt. Dieses aus Sicht des einzelnen Anbieters rationale Verhalten ist im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang irrational. Denn so geht einer wachsenden Bevölkerung längerfristig die Arbeit aus, dem Unternehmer der Gewinn (der sich laut Marx aus der Differenz zwischen Lohn und Wertschöpfung ergibt) und der Volkswirtschaft die breite Schicht der zahlungskräftigen Konsumenten. So kann auf Dauer keine Volkswirtschaft prosperieren.“
Was für den Einzelkapitalisten rational ist, wird im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang irrational. Die Menschheit braucht eine neue Produktionsweise: Nicht für den Profit, sondern für die Bedürfnisse der Menschen soll produziert und das Produkt verteilt werden.
SRM, 22.09.11
Aktuelles und Laufendes:
Wirtschaftliche Depression, Krieg, gesellschaftlicher Zerfall – nur der Klassenkampf bietet einen Ausweg
- 2462 Aufrufe
Und die Krise ist nicht nur global, sie ist auch historisch. Der Schuldenberg, der in den letzten Jahren so stark in Erscheinung getreten ist, ist nur die Folge der Versuche des Kapitalismus die Wirtschaftskrise aufzuschieben oder sie zu vertuschen, die schon Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre ausbrach. Und die heutige „Rezession“ zeigt ihr wahres Gesicht als eine richtige Depression. Wir müssen erkennen, dass es sich um die gleiche tiefgreifende Krise handelt, die die Produktion schon in den 1930er Jahren lähmte und die Welt damals in den imperialistischen Krieg, den 2. Weltkrieg, trieb. Diese Krise spiegelt die Tatsache wider, dass das kapitalistische System historisch obsolet geworden ist.
Der Unterschied zwischen der Depression heute und der der 1930er Jahre ist, dass der Kapitalismus heute über keine Mittel mehr verfügt. In den 1930er Jahren konnte die herrschende Klasse ihre eigene barbarische Lösung für die Krise durchsetzen – die Mobilisierung der Gesellschaft für den imperialistischen Krieg und die Neuaufteilung der Welt. Die Neuorganisierung schuf die Grundlagen für das Wiederaufbauwunder nach dem 2. Weltkrieg in den 1950er und 1960er Jahren. Damals bestand diese Möglichkeit, zum Teil weil der Weltkrieg nicht automatisch bedeutete, dass der Kapitalismus sich selbst zerstören würde, und es gab noch Raum für das Aufkommen von neuen imperialistischen Herren nach dem Krieg. Aber es war auch und vor allem eine Option, weil die Arbeiterklasse zuvor versucht hatte, ihre Revolution im Anschluss an den 1. Weltkrieg zu machen und dabei die schlimmste Niederlage ihrer Geschichte durch den Stalinismus, den Faschismus und die Demokratie erlitten hatte.
Heute ist der Weltkrieg nur eine Option im abstraktesten theoretischen Sinne. In Wirklichkeit wird der Weg zu einem globalen imperialistischen Krieg durch die Tatsache versperrt, dass nach dem Zusammenbruch des Systems der beiden Blöcke der Kapitalismus heute unfähig ist, irgendein stabiles imperialistisches Bündnis zu errichten. Der Weg wird ebenso versperrt durch eine fehlende Ideologie, die dazu in der Lage wäre die Mehrheit der Ausgebeuteten in den wichtigsten kapitalistischen Ländern zusammenzuschweißen und zu überzeugen, dass es sich lohnt für dieses System zu kämpfen und zu sterben. Diese beiden Elemente sind mit etwas Tieferem verbunden: der Tatsache, dass die Arbeiterklasse heute nicht besiegt und immer noch in der Lage ist, für ihre eigenen Interessen gegen die des Kapitals einzutreten.
Gefahren, vor denen die Arbeiterklasse steht
Bedeutet dies, dass es irgendeinen Automatismus hin zur Revolution gäbe? Nein, überhaupt nicht. Die Revolution der Arbeiterklasse kann überhaupt nicht „automatisch“ sein, weil sie eine höhere Bewusstseinsebene verlangt als irgendeine Revolution in der Vergangenheit. Sie ist nichts anderes als der Moment, wenn die Menschen zum ersten Mal die Kontrolle über ihre eigene Produktion und Verteilung in einer Gesellschaft übernehmen, wo das Prinzip der Solidarität im Mittelpunkt steht. Sie kann deshalb nur durch eine Reihe von zunehmend massiver werdenden Kämpfen vorbereitet werden, die wiederum ein tieferes und breiteres Klassenbewusstsein anstoßen.
Seitdem die letzte Phase der Krise Ende der 1960er Jahre eingetreten ist, ist es zu vielen wichtigen Kämpfen der Arbeiterklasse gekommen, angefangen bei der internationalen Welle von Kämpfen, welche die Ereignisse des Mai 68 in Frankreich auslösten bis zu den Massenstreiks in Polen 1980 und dem britischen Bergarbeiterstreik Mitte der 1980er Jahre. Auch wenn es einen langen Rückfluss der Klassenkämpfe in den 1990er Jahren gab, ist in den letzten Jahren eine neue Generation in Erscheinung getreten, die sich aktiv „empört“ (um den spanischen Begriff zu benutzen) über die Unfähigkeit der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung, ihr irgendeine Zukunft anzubieten. In den Kämpfen in Tunesien, Ägypten, Griechenland, Spanien, Israel und anderswo ist die Idee der „Revolution“ ein ernsthaftes Diskussionsthema geworden, genau wie es damals in den Straßen von Paris 1968 oder Mailand 1969 der Fall war.
Aber im Augenblick bleibt diese Idee noch sehr konfus und vage: ‘Revolution’ kann leicht verstanden werden als die einfache Übergabe der Macht von einem Teil der herrschenden Klasse an einen anderen, wie das am deutlichsten in Tunesien und Ägypten der Fall war, und jetzt auch wieder in Libyen. Und in den jüngsten Bewegungen war es nur eine Minderheit, die begriff, dass der Kampf gegen das herrschende System sich offen als Klassenkampf verstehen muss, als einen Kampf der Arbeiterklasse gegen die gesamte herrschende Klasse. Nach vier Jahrzehnten Krise hat die Arbeiterklasse insbesondere in den wichtigsten Ländern des Kapitalismus nicht mehr das gleiche Aussehen wie Ende der 1960er Jahre. Viele der größten Industriehochburgen und der stärksten Klassenmilitanz haben sich aufgelöst, sind zerbröselt. Ganze Generationen sind durch ständige Unsicherheit und die Atomisierung infolge der Arbeitslosigkeit angeschlagen. Die verzweifeltesten Bereiche der Arbeiterklasse laufen Gefahr, in die Kriminalität, Nihilismus oder religiösen Fundamentalismus abzurutschen.
Kurzum, der lange, sich verschärfende Prozess des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft kann die schlimmsten negativen Folgen für die Fähigkeit der Arbeiterklasse haben, ihre Klassenidentität wieder zu gewinnen und das Selbstvertrauen aufzubauen, dass sie in der Lage ist, die Führung in der Gesellschaft zu übernehmen und diese in eine neue Richtung zu lenken.
Und ohne das Beispiel einer Arbeiterklasse, die gegen die kapitalistische Ausbeutung ankämpft, mag es viele wütende Reaktionen gegen das ungerechte, unterdrückende, korrupte Wesen des Systems geben, aber daraus alleine wird kein Ausweg hervorgehen. Einige Reaktionen können die Gestalt von riots, Aufständen und ziellosen Plünderungen annehmen, wie diesen Sommer in Großbritannien. In anderen Teilen der Welt können berechtigte Wutausbrüche gar von den Herrschenden kanalisiert und eingesetzt werden, um ein imperialistisches Lager gegen das andere zu unterstützen, wie in Libyen.
Im pessimistischsten Szenario wird der Kampf der Ausgebeuteten in sinnlosen und selbstzerstörerischen Aktionen zerstreut werden, wobei die Arbeiterklasse insgesamt zu atomisiert, zu sehr gespalten sein wird, um als eine wirkliche gesellschaftliche Kraft in Erscheinung zu treten. Falls dies eintritt, wird nichts den Kapitalismus daran hindern, uns alle in den Abgrund zu treiben; dazu ist dieser sehr wohl in der Lage, ohne dass ein Weltkrieg entfacht wird. Aber wir haben diesen Punkt noch nicht erreicht. Im Gegenteil, es gibt viele Hinweise, dass eine neue Generation von ArbeiternInnen nicht bereit ist, sich passiv und widerstandslos in einer kapitalistischen Zukunft von wirtschaftlichem Zusammenbruch, imperialistischen Konflikten, Zerstörung der Umwelt verheizen zu lassen, und es gibt Anzeichen, dass sie in der Lage ist, die älteren Generationen der Arbeiterklasse und all diejenigen, deren Leben durch das Kapital bedroht wird, um sich zu scharen. WR 1.9.2011
Aktuelles und Laufendes:
- Weltwirtschaftskrise [333]
Weltrevolution Nr. 169
- 2194 Aufrufe
Attac treibt in die ideologischen Fallen der Herrschenden
- 2196 Aufrufe
Während die jungen Generationen an vielen Orten der Welt ihre Wut gegenüber ihrer Lage zum Ausdruck bringen und zum Beispiel gegen die Massenarbeitslosigkeit in ihren Reihen, die schlecht bezahlten, prekären Beschäftigungsverhältnisse protestieren, hört und liest man immer mehr in den Netzwerken und den neuen Medien Losungen wie „Eine andere Welt ist möglich“, ohne dass der Kapitalismus überwunden werden muss. Eine „echte Demokratie“ sei möglich innerhalb dieses Systems (siehe dazu die Webseite von Attac). Weniger offen proklamierte Attac schon 2006, dass die „Überwindung der Arbeitslosigkeit und der prekären Bedingungen“ möglich sei (so stand es in den Flugblättern von Attac, die während des Kampfes gegen den CPE 2006 verteilt wurden). Jetzt prangert Attac vor allem „die Macht des Finanzkapitals und dessen unverantwortliches Verhalten, die Komplizenschaft der politischen Führer mit ihm“ an. Mit der Forderung „die Krise soll durch deren Hauptverantwortlichen bezahlt werden, insbesondere durch die Finanzwirtschaft und die Banken“ behauptet Attac gar, dass wir gegenwärtig „nicht in einer Krise stecken, sondern einem gewaltigen Betrugsmanöver unterliegen“. Damit scheint Attac die Existenz der unüberwindbaren Wirtschaftskrise des Kapitalismus zu leugnen, dieses Ausbeutungssystems, das der Menschheit nur noch mehr Armut und Barbarei anzubieten hat. Kurzum, Attac verbreitet die Illusion, dass es möglich sei, in einem „echten demokratischen‘ Kapitalismus ‚mit menschlichem Gesicht‘ zu leben, wenn die „Bürger“ der Welt sich friedlichen auf der ganzen Welt für die Losungen von Attac einsetzen. Heute ist die reformistische Ideologie von Attac in der Bewegung der „Empörten“ in Spanien stark verbreitet, genau wie damals schon 2006 in Frankreich. Sie zielt darauf ab, das Bewusstsein der jungen Generation über den Bankrott des Kapitalismus zu vernebeln, indem sie uns glauben machen will, dass es innerhalb dieses Systems „nicht notwendigerweise zu Arbeitslosigkeit und Präkarisierung kommen muss. Bei diesem Machtkampf gegen die Tyrannei der Märkte und der Banken kommt es vor allem auf die gesellschaftliche Mobilisierung und den politischen Willen an“ (Flugblatt von Attac). Natürlich können diese scheinradikalen Behauptungen nur auf Sympathie und Interesse bei vielen jungen Beschäftigten stoßen, die die „Welt verändern“ wollen und auf der Suche nach einer echten revolutionären Perspektive sind. Deshalb veröffentlichen wir nachfolgend einen Artikel, den wir schon im März 2006 veröffentlicht haben und dessen Aussagen aus unserer Sicht weiterhin gültig sind [1].
Wofür steht Attac
1999 wurde die « Association pour une taxation des transactions financières pour l’aide aux citoyens » (ATTAC) von einer Gruppe von Leuten gegründet, zu denen unter anderem Le Monde diplomatique, Alternative économique, FSA, der Bauernverband, Handwerker der Welt usw. Gehörten. Attac besteht mittlerweile in mehr als 50 Ländern und wurde schnell dadurch berühmt, dass es insbesondere große internationale Konferenzen zu einer Tribüne für die Verteidigung von benachteiligten Ländern machte, wie z.B. 1999 in Seattle, und indem es sich an zahlreichen Foren in vielen Ländern beteiligte (Porto Alegre, Genua, Paris usw.).
Attac will sich als “alternative” Kraft darstellen, die sich von traditionellen politischen Parteien abhebt, mit Kommissionen, in denen Wissenschaftler und Ökonomen mitarbeiten unter dem Slogan „Eine andere Welt ist möglich“. Auf dem Hintergrund einer durch die Wirtschaftskrise erschütterten Welt behauptet Attac mit größter Ernsthaftigkeit Lösungen zur „Änderung der Welt“ vorzuschlagen und diese „gerechter“ werden zu lassen. Attac zieht viele aufrichtige Leute an, die den Glauben an linke Parteien verloren haben. Der Zeitung „Libération“ zufolge verfügt Attac über „alles, um eine der politischen Kräfte zu sein, die die Welt nach dem kalten Krieg prägen“. Attac ist in den Medien groß herausgeputzt worden. Man kann sich kaum heute mit sozialen Fragen beschäftigten, ohne sofort auf das Gedankengut von Attac zu stoßen. In Frankreich ist Attac besonders hervorgetreten durch seine aktive Kampagne für ein „Nein“ zum Referendum über die europäische Verfassung und 2006 tauchte Attac immer wieder in den Vollversammlungen und den Kundgebungen der Bewegungen der Studenten gegen den CPE auf.
Was schlägt Attac vor?
Schauen wir uns an, was Attac “gegen den Neoliberalismus” vorschlägt. Attac meint, dass wir gegenwärtig nicht in einer Krise des kapitalistischen Systems stecken, sondern in einer „konservativen Revolution“, die für die Arbeitslosigkeit und die Präkarisierung verantwortlich ist. In Spanien befürwortet Attac eine „direkte Demokratie“ außerhalb der beiden großen traditionellen Parteien PP und PSOE. Attac zufolge wären die „ultraliberalen politischen Orientierungen verantwortlich für die Verschlechterung der Sozialstandards“. Eigentlich geht es dem Kapitalismus Attac zufolge gut; man müsse nur seinen „Ultraliberalismus“ bekämpfen, der dazu neigt, die Sozialgesetzgebungen aufzulösen und die „Arbeitererrungenschaften“ aufzugeben, obwohl es „große Spielräume gibt, um neue Jobs zu schaffen“. Mit anderen Worten es gibt andere politische Optionen der Verwaltung des Kapitalismus, um diese Art Extremismus zu vermeiden und zu den glorreichen Tagen zurückzukehren, die vor 30 Jahren herrschten. Man müsse also nicht gegen den Kapitalismus ankämpfen, sondern gegen den Neoliberalismus mit dem Vorschlag von Sozialreformen zur „Verbesserung“ eines durchaus lebensfähigen Systems.
Was schlägt Attac vor zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit?
- die Schaffung von Jobs, um auf die individuellen und kollektiven Bedürfnisse der Bevölkerung zu reagieren,
- die Kürzung der Arbeitszeit, bezahlt durch die Umverteilung der Produktivitätsgewinne an die Beschäftigen;
- Einführung der Tobin-Steuer zur Schaffung von Millionen Jobs auf europäischer Ebene.
Was soll man von diesen Vorschlägen halten?
Zunächst könnte man sich fragen, warum die Kapitalisten nicht darauf gekommen wären, Arbeitsplätze zu schaffen, “um den Bedürfnissen der Bevölkerung” zu entsprechen. Aber Attac liefert selbst die Antwort: „Während es in der Gesellschaft große, unbefriedigte Bedürfnisse gibt und Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden können, um diese zu befriedigen (…) stellen die Privatbetriebe aufgrund der Art Arbeitsverträge keine Leute ein, sondern aufgrund der bei ihnen eingegangenen oder erwarteten Auftragseingänge.“ „Die Tyrannei der Märkte“ soll also Attac zufolge eingegrenzt werden mit einer „Haushaltspolitik, die eine radikale Abkehr darstellt von dem neoliberalen Rahmen, der durch das Europa der Banken auferlegt wird.“ Attac zufolge „kann die wachsende Nachfrage nach gemeinnützigen Leistungen ein gewaltiges Arbeitskräftereservoir darstellen“. Es ist erstaunlich, dass Attac für solche Vorschläge auf die Mitarbeit von „Intellektuellen“ und „Akademikern“ zurückgreifen musste, um festzustellen, dass die „neoliberale“ Politik dahin führt, dass die Hauptmotivation der Kapitalisten darin besteht Profite zu erzielen… aber das seitdem der Kapitalismus existiert war dies nicht anders. Der Kapitalismus hat seinen Arbeitskräften immer so wenig wie möglich bezahlt, das trifft auch im Allgemeinen auf die Löhne zu, die der Staat seinen Beschäftigten zahlt, sowie auch die Bereiche des gesellschaftlichen Lebens wie das Erziehungs- und Gesundheitswesen. Und während heute die Welt immer tiefer in der Krise versinkt, versucht jedes nationale Kapital Arbeitskräfte abzubauen und deren Löhne noch mehr zu senken, um der Konkurrenz auf dem Weltmarkt besser entgegentreten zu können. Indem man aufruft, gegen den „Neoliberalismus“ anzukämpfen, verschweigt Attac die Wirklichkeit der jetzigen Verhältnisse im Kapitalismus, die auf der Ausbeutung der Arbeitskraft und die Jagd nach Profiten fußt. Es handelt sich nämlich um eine Krise des Systems und nicht um eine „schlechte“ Verwaltung des Kapitalismus durch „Neoliberale“, wodurch der Schrecken der Lohnarbeit immer offensichtlicher wird.
Was die „Verkürzung der Arbeitszeit“ angeht, ist dies eine Politik der linken Parteien, die die Arbeiter an ihrem eigenen Leib erfahren haben. Die 35 Stundenwoche bedeutete vor allem eine Verschärfung der Ausbeutung, mit erhöhten flexiblen Arbeitszeiten, der Intensivierung des Arbeitsrhythmus und Lohnstops.
Was die Tobin-Steuer angeht, ist dies das Steckenpferd von Attac. Damit soll uns weisgemacht werden, dass es auf dieser Welt, in der die Herrschenden das Sagen haben, möglich wäre, in die Taschen der Reichen zu greifen, um den Armen zu geben…
Attac – Verteidiger der kapitalistischen Ordnung
Mit Hilfe dieser Verschleierungsreden will Attac uns glauben machen, dass es einen “guten” und “schlechten” Kapitalismus gebe; wobei der „gute“ Kapitalismus trotz seiner Ausbeutung der Arbeiterklasse „humaner“ sei und mehr darauf bestrebt, das Leben der Menschen und ihr Umfeld zu verbessern. Attac bringt nur eine Neuauflage des ganzen Geredes der Linken des Kapitals, die alles andere als die Gesellschaft ändern wollen, sondern die Arbeiterklasse nur zur Annahme von Maßnahmen zwingen wollen, welche den Kapitalismus und seinen Staat verstärken.
Attac verlangt eine „gerechtere“ Verteilung der Reichtümer unter der Führung des Staates wie die Linke es in den 1970er Jahren machte. „Die Arbeitslosigkeit ist eine Waffe in den Händen der Multis zur Verschlechterung der Lage der Arbeiter, um Profite zu erhöhen.“ Wenn der Staat in jedem Land drastisch die Sozialleistungen kürzt, geschieht dies aber nicht, wie uns die linken Parteien und Attac einbläuen wollen, weil er unter der Fuchtel der „Multis“ stünde, sondern weil die Überproduktionskrise es unmöglich macht, soziale Mindeststandards einzuhalten, um einen gewissen sozialen Frieden aufrechtzuerhalten.
In Wirklichkeit ist der Staat selbst die Speerspitze des Angriffs gegen die Lebensbedingungen, wenn es um Kürzung von Sozialleistungen, die Streichung von Arbeitsplätzen insbesondere in der Bildung und im Gesundheitswesen geht. Der Staat zeigt immer mehr, was er in Wirklichkeit ist: ein Instrument zur Aufrechterhaltung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse und der Verteidigung der Interessen der Ausbeuterklasse.
Indem Attac die Themen wieder aufgreift, die zuvor von den linken Parteien des Kapitals vorgekaut wurden, eilt es der herrschenden Klasse zur Hilfe. Während die Arbeiterklasse immer mehr bohrende Fragen über die Wirklichkeit der Weltlage stellt, ist es kein Zufall, dass Attac auf den Plan tritt, um den kämpfenden ArbeiternInnen, insbesondere der jungen Generation Antworten anzubieten. Diese ganze Palette von „Antworten“ auf die angeblichen Mängel des Systems dienen nur dazu, die einzige Perspektive zu verdunkeln, die dazu in der Lage ist die Barbarei und die Armut aus der Welt zu schaffen – die Überwindung des Kapitalismus.
Heute haben die Jugendlichen überall auf der Welt angefangen zu begreifen, dass Arbeitslosigkeit und generalisiertes Präkariat ein Ausdruck der Sackgasse des Kapitalismus sind, des „no future“, vor dem dieses System steht, welches Attac vor den ArbeiterInnen zu vertuschen versucht. Die einzige Revolution, die diese Armut, die Arbeitslosigkeit, die kriegerische Barbarei überwinden kann, ist die Weltrevolution der Arbeiterklasse, deren Ziel in der Überwindung des Kapitalismus besteht, um eine neue Gesellschaft ohne Klasse und ohne Ausbeutung aufzubauen.
Sandrine
1. siehe unseren Artikel zu Stéphane Hessel.
Aktuelles und Laufendes:
- Empört Euch [315]
- ATTAC [351]
- Stephane Hessel [352]
- Reformismus Attac [353]
- Auswege Krise [354]
Demokratie und Repression - zwei Gesichter der gleichen Herrschaft
- 2158 Aufrufe
Die Arbeiterklasse ist gegenüber der Repression und den Drohgebärden des bürgerlichen Staates nicht hilflos. Anstatt an die Demokratie zu appellieren, muss sie sich darauf besinnen, was ihre eigentliche Stärke ist. Vor 30 Jahren, am 13. Dezember 1981, wurde die Arbeiterklasse in Polen zur Zielscheibe einer blutigen Repression. Tausende von Arbeiter wurden verhaftet und sollten eingeschüchtert werden. Ein Jahr zuvor noch, als die Arbeiter im Sommer 1980 durch große Massenstreiks ihre Kräfte bündelten und die Initiative in der Hand hielten, schreckte die herrschende Klasse in Polen, die 1956, 1970 und 1976 ihre Entschlossenheit zum gewalttätigen Vorgehen gegen die Arbeiter unter Beweis gestellt hatten, vor einem gewaltsamen Vorgehen gegen die Arbeiter zurück. Die herrschende Klasse in Polen hatte nämlich die vereinte Kraft der Arbeiter gespürt. Zudem hatten die Eisenbahner in dem strategisch wichtigen polnischen Eisenbahnknotenpunkt Lublin der Regierung nach der Drohung derselben, man werde gegen die Arbeiter in Danzig Truppen schicken, angekündigt, die Eisenbahner würden die Eisenbahnverbindung zwischen dem damaligen Blockführer Sowjetunion und der DDR lahmlegen, wodurch die Verbindung zwischen den russischen Truppen in der DDR und Russland gekappt würde. Die herrschende Klasse in Polen und der Sowjetunion hatte die Gefahr verstanden. Ein gewaltsames Vorgehen gegen die Arbeiter war nicht möglich, solange die Arbeiterklasse mobilisiert und zu solidarischem Handeln fähig war. Erst nachdem die Arbeiterklasse sich durch die neu gegründete Gewerkschaft Solidarnosc hatte entwaffnen lassen, konnten die Herrschenden in Polen gegen die Arbeiterklasse gewaltsam vorgehen und ihr eine Niederlage beizufügen. Die Waffe gegen die Repression ist und bleibt die Mobilisierung der ArbeiterInnen! Illusionen in die Demokratie dagegen tragen zur Entwaffnung der ArbeiterInnen bei.
Aktuelles und Laufendes:
- Demokratie Repression [355]
- Volksherrschaft [356]
- Repression Polen 1981 [357]
- Solidarnosc 1981 [358]
- Staatsgewalt [359]
Der Kampf gegen den Kapitalismus ist ein Kampf zwischen den Klassen
- 3551 Aufrufe
Noch keine Revolution, noch nicht die 99%
Das Wort “Revolution” macht wieder die Runde, und der “Kapitalismus” wird an vielen Orten wieder als die Quelle der Verarmung, Kriege und Umweltzerstörung angesehen.
Das sind alles positive Entwicklungen. Aber wie die ausgebeutete und unterdrückte Mehrheit in Ägypten schmerzvoll anerkennen muss, eine Gallionsfigur oder eine Regierung davonzujagen ist noch keine Revolution. Das Militärregime, das Mubarak ablöste, schmeißt weiter Leute ins Gefängnis, foltert und tötet diejenigen, die ihre Unzufriedenheit mit der neuen Lage zum Ausdruck bringen.
Selbst der populäre Slogan der Occupy-Bewegung „Wir sind die 99%“ trifft auch noch nicht zu. Trotz weitverbreiteter großer öffentlicher Sympathie haben die Occupy-Proteste noch nicht die aktive Unterstützung des Großteils der 99% der Bevölkerung gewonnen. Millionen haben Angst vor der unsicheren Zukunft, die der Kapitalismus uns bietet, aber diese Angst und Unsicherheit hat auch ein verständliches Zögern geschaffen, die Risiken auf sich zu nehmen, die entstehen, wenn man streikt, protestiert, besetzt und demonstriert.
Bislang ist nur ein Bruchteil des großen Potenzials einer wirklichen Massenbewegung gegen den Kapitalismus zutage getreten, und es wäre töricht und gefährlich, den Anfang schon als das Ende betrachten. Aber diejenigen, die schon in den Kampf getreten sind, können auch durch ihre eigenen Illusionen gebremst werden, welche wiederum durch die Propaganda des Systems noch einmal verstärkt werden.
Illusionen wie:
“Die Banken und/oder der Neoliberalismus sind schuld”
Hinter dem Kapitalismus steckt mehr als nur Banken oder ein “deregulierter“ Markt. Der Kapitalismus stellt vor allem ein Verhältnis auf der Grundlage der Lohnarbeit, der Produktion von Waren für den Profit dar, und er hat seit jeher seine Gesetze weltweit auf der ganzen Welt durchsetzen müssen. Die Wirtschaftskrise des Kapitalismus ist zu einer Fessel und zu einem Hindernis für jeglichen zukünftigen Fortschritt geworden.
Eine Regulierung der Banken, die Einführung einer “Robin Hood-Steuer” (Transaktionssteuer) oder verstärkte staatliche Kontrollen ändern nichts an den wesentlichen kapitalistischen Beziehungen zwischen den Ausgebeuteten und ihren Ausbeutern. Solch eine Forderung soll uns für falsche Ziele mobilisieren. Der Ruf der Gewerkschaften nach „mehr Wachstum“ hilft auch nicht. Im Kapitalismus kann dies nur eine Verschärfung der Ausbeutung und der Umweltzerstörung mit sich bringen, und heute kann dies nur geschehen durch die Anhäufung von weiteren Schulden, obwohl die Schuldenspirale schon zu einem Hauptfaktor der Zuspitzung der Wirtschaftskrise geworden ist.
“Die Rechten sind unsere Hauptfeinde”
Ebenso wie die Banker lediglich Handlanger des Kapitals sind, sind die Politiker – von Rechts bis Links – Werkzeuge des kapitalistischen Staats, deren einzige Rolle darin besteht, für die Aufrechterhaltung des Systems zu sorgen. Die Tories um Cameron machen da weiter, wo Labour stehen geblieben war, und trotz all der Hoffnungen, die viele in ihn gesetzt hatten, setzt Obama die gleiche Politik wie die von Bush fort – imperialistische Kriege und Angriffe gegen unsere Lebensbedingungen.
“Wir müssen dafür sorgen, dass die parlamentarische Demokratie besser funktioniert“
Wenn der Staat unser Feind ist, dann tragen Rufe nach seiner Reform nur zu unserer Schwächung bei. In Spanien hat die Bewegung „Echte Demokratie jetzt“ versucht, die Leute für einen Kampf um ein stärkeres parlamentarisches Leben, mehr Kontrolle über die Aufstellung von Parlamentsabgeordneten usw. einzuspannen. Aber ein radikalerer Flügel hat sich gegen diese Ausrichtung gestellt. Sie hoben hervor, dass die Vollversammlungen, welche überall zur Organisationsform für die Proteste geworden waren, selbst zum Kern einer neuen Art der Organisierung des gesellschaftlichen Lebens werden können.
Wie kann der Kampf voranschreiten? Indem wir einige grundlegende Punkte berücksichtigen und umsetzen:
-Dass der Kampf gegen den Kapitalismus ein Kampf zwischen den Klassen ist. Auf der einen Seite kämpft die herrschende Klasse mit dem Staat an ihrer Seite, auf der anderen Seite steht die arbeitende Klasse, die nichts als ihre Arbeitskraft zu verkaufen hat, und all die anderen Ausgebeuteten und Unterdrückten.
-Der Kampf muss somit übergreifen auf die Teile der Arbeiterklasse, wo diese am stärksten und ihre Kraft am deutlichen gebündelt ist: die Betriebe, Krankenhäuser, Schulden, Universitäten, Büros, Häfen, Baustellen, Post, öffentlicher Verkehr usw. An Beispielen mangelt es nicht: die Streikwelle in Ägypten Anfang 2011, als der „Tahrir-Platz zu den Fabriken kam“ und das Militär gezwungen wurde, Mubarak fallen zu lassen. In Oakland, Kalifornien, wo die „Occupier“ zu einem Generalstreik nach der blutigen Polizeirepression aufriefen und zu den Häfen zogen und aktive Unterstützung von den Hafenarbeitern und LKW-Fahrern erhielten.
-Um den Kampf auszuweiten, brauchen wir neue Organisationen: die Praxis von Vollversammlungen mit gewählten und ernannten Delegierten, breitet sich immer mehr aus, weil die alten Organisationen Schiffbruch erlitten haben. Nicht nur die parlamentarischen Vertretungen haben sich als stumpf herausgestellt, sondern auch die Gewerkschaften; sie dienen nur dazu die ArbeiterInnen zu spalten und sicherzustellen, dass der Klassenkampf niemals die Gesetze des Kapitalismus überschreitet. Um diese Spaltungen zu überwinden und die Arbeiterkämpfe unter der Kontrolle der ArbeiterInnen zu halten, brauchen wir Versammlungen und gewählte Komitees sowohl in den Betrieben als auch auf der Straße.
-Um den Kapitalismus zu überwinden, ist eine Revolution erforderlich. Die herrschende Klasse hält ihre Herrschaft nicht nur durch Lügen aufrecht, sondern auch durch Repression. Der Klassenkampf kann nicht „gewaltlos“ sein. Gerade weil die herrschende Klasse uns in verfrühte und sinnlose gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften locken möchte, müssen wir aber in Wirklichkeit erst ein Kräfteverhältnis aufbauen müssen, um uns gegen den staatlichen Terror wirkungsvoll mit unserer Klassengewalt zu wehren.
Die einzige Alternative gegenüber dem Kapitalismus ist der Kommunismus. Nicht staatlich kontrollierte Ausbeutung wie unter dem Stalinismus, und auch keine Rückkehr zu isolierten Gemeinschaften mit Güteraustausch, sondern eine weltweite Assoziierung der Produzenten – kein Lohnsystem, kein Geld, keine Grenzen, kein Staat. IKS, 5.11.2011
Aktuelles und Laufendes:
Deutschland nach Fukushima: Die grüne Allzweckwaffe des deutschen Imperialismus/2
- 2145 Aufrufe
Der Artikel wurde schon vollständig auf unserer Webseite in Weltrevolution 168 veröffentlicht. Wir drucken hier den 2. Teil ab.
https://de.internationalism.org/Weltrevolution168_2011_deutschlandfukushima [362]
Filmbesprechung: "Die Höhle der vergessenen Träume"
- 1793 Aufrufe
Diskussionsbeitrag eines Sympathisanten aus England zur Frühzeit der Menschheit:
"Die Höhle der vergessenen Träume" des gefeierten Regisseurs Werner Herzog ist gerade in Großbritannien angelaufen (und seit Anfang November auch in deutschen Kinos zu sehen). Herzog hat für seinen neusten Film Zugang zu der Höhle von Chauvet im Ardèche-Tal in Südfrankreich bekommen. Diese ist – neben der Höhle von Lascaux – die bisher dramatischste Entdeckung von (Wand-)Kunst in einer Altsteinzeit Höhle. Der Zugang während der Dreharbeiten war in Raum und Zeit beschränkt [der Zugang ist überhaupt für die Öffentlichkeit unmöglich und selbst Wissenschaftler durchlaufen ein aufwändiges Genehmigungsverfahren und enge zeitliche und räumliche Beschränkungen zum Schutz der über Jahrtausende quasi konservierten Malereien – Anmerkung des Übesetzers]. Der Regisseur und drei bis vier Mitglieder der Filmcrew mussten mit spezieller batteriebetriebener Beleuchtung arbeiten. Doch das Ergebnis ist sehenswert!
Herzog hatte sich bisher von Filmarbeiten in 3D-Technik fern gehalten, doch hier erzielt der Einsatz von 3D eine bemerkenswerte Wirkung. Es braucht nicht viel, um die Radierungen und Gemälde hervorzuheben, doch lässt 3D das Innenleben und die Topographie geradezu in neuem Licht erstrahlen.
Durch einen glücklichen Zufall wurde der Höhleneingang vor vielen Monden durch einen großen Felssturz versiegelt, dies schuf annähernd perfekte Bedingungen, um die Gemälde zu bewahren.
Herzog und andere sprechen über einige der Radierungen, die aussehen: „als ob sie gestern gemalt worden wären“. Diese Kunst ist ca. 32.000 Jahre alt und die Arbeit zog sich über eine Periode von 5.000 Jahren hin. Während ihrer Entdeckung 1994 waren diese Daten noch umstritten, hauptsächlich – denke ich – da sie nicht mit den Theorien der „alte Garde“ (einschließlich einiger junger Vertreter) übereinstimmten. Diese konnten nicht begreifen, dass solch ausdrucksstarke und detailreiche Kunst schon so alt sei (sie hätten es bereits aus der Zeit des Schwäbischen Jura wissen können – dazu später). Heute ist die Datierung unbestritten, doch die Arbeit der Ausgrabungen, der Entdeckungen und Interpretationen hält an. Hierzu ist dieser Film ein wichtiger Beitrag.
In der Höhle von Chauvet lebten keine Menschen, zumindest gibt es dafür bisher keine Hinweise. Die nachgewiesenen Feuerstellen dienten (nach den derzeitigen Hinweisen) wohl zur Beleuchtung und nicht zur Zubereitung von Speisen. Die Fackel-Pfoten an den Höhlenwänden sind mit Holzkohle hergestellt. In der Höhle lebten sowohl vor als auch nach den Arbeiten an den Malereien Bären. Wie der Film zeigt, gibt es Hinweise darauf, dass Bärenschädel bewusst platziert wurden. Ähnlich wie die Bärenknochen, die in Spalten und Boden der Höhlenwände angeordnet wurden, deutet dies auf religiöse Praktiken hin, die wohl dem Beschwören des Zutritts in „andere Welten“ dienten. Auch der Aufenthalt eines Kindes konnte in der Höhle nachgewiesen werden. Weiterhin charakteristisch für die Kommunikation mit der »geistigen Welt« durch die Höhlenwand, sind die vielen Handflächenabdrücke, die wohl das Werk einer einzelnen Person waren. All dies unterstreicht die These von einer Gemeinschaft des Glaubens.
Als die Höhle geöffnet wurde, traf man, im Halblicht der Bärengrube auf eine Wand, die für Malereien geradezu perfekt war. Und doch beginnen die Malereien und Radierungen erst dahinter, in den Kammern und Galerien der totalen Dunkelheit. Der Film zeigt Tupfer und „Zeichen“, die an Insekten und Vögel erinnern. Auffällig ist, dass mit der Ausnahme einer Zauberin, eines weiblichen Schamdreiecks und einer weiblichen Silhouette zusammen mit einem Bärenwesen, keine menschlichen Figuren dargestellt wurden.
Wie die meisten populären Untersuchungen behandelt auch dieser Film nicht die geometrischen Zeichen, die in der Höhlenkunst über eine Periode von 20.000 Jahren allgegenwärtig waren: Zirkel, Kreise, Striche, unterbrochene Linien, Tupfer usw. In einigen Teilen der Höhle von Chauvet sind diese Zeichen – und nicht die Darstellung von Tieren - das charakteristische Merkmal. Viele Tiere sind mit »Zeichen« versehen und bei einigen scheint Blut aus den Augen oder Nasen zu strömen. Dies ist wiederum charakteristisch für wenn auch sehr frühe schamanistische Rituale. Die »Zeichen« werden in »Themen« fortgeführt und diese ergeben zusammen den Sog einer Geschichte. Diese „Zeichen“ stellen für mich vor über 30.000 Jahren die bisher engste Annäherung an eine geschriebene Sprache dar. Dort, wo die Zeichnungen und Radierungen konzentriert sind, haben vermutlich die Zeremonien, Rituale und religiösen Praktiken stattgefunden.
Es gibt einige Beispiele von Tieren, die nicht üblich in der Höhlenkunst des Jungpaläolithikum sind: zwei Jaguare, eine langohrige Eule, ein Moschusochse und – das einzig mir bekannte Beispiel für einen Affen- oder Menschenaffen der gesamten Periode bisher – ein Pavian, in der Grube eines Rhinozerus‘. Der Film kommentiert diese Sensation leider nicht. Ebenso werden Tiere gezeigt, die aus Furchen und Spalten der Höhle erwachsen, diese Furchen und Spalten sind selbst Teil der Darstellung, doch ohne Hintergrundwissen, bekommen wir keine Gelegenheit dies zu verstehen. Tiere tauchen aus Senken oder Spalten in Wänden auf, die selbst Teil eines Themas sind, und während wir die Details nicht kennen können, liefern sie dennoch einen Rahmen zum Begreifen des Ganzen. Meist sind ungejagte und gefährliche Arten dargestellt, hier geht es also nicht um die Ernährung von Menschen - dies ist das Bedeutende von Chauvet.
Die frühe Datierung dieser Kunst stellte die Vorstellung der »alten Garde«: von der allmählichen Entwicklung der Höhlenmalerei von der einfachen zur immer komplexeren in Frage. Dies war der Hintergrund der Einwände der „alten Garde“. Chauvet enthüllt die Komplexität auf einen oder in mehreren Schlägen. Es ist weder die „Magie der Jagd“, also die „Fixierung“ auf das Töten, noch „Kunst um der Kunst willen“. Als Beleg: 81% der dargestellten Tiere sind ungejagte und man ging in die dunkelsten Teile der Höhle, um zu malen.
Der Film - und Herzog –stellen eine interessante Verbindung mit der Kunst der Schwäbischen Hochebene im heutigen Baden-Württemberg (Deutschland) her. Hier gibt es viele prähistorische Höhlen und felsige Unterstände. Diese Hochebene ist ca. 400 Meilen von Chauvet entfernt und liegt seit der letzten Eiszeit im gleichen Tal. Auf dieser Hochebene produzierten vor ca. 40.000 Jahren Angehörige der Homo Sapiens Skulpturen, die wohl herumgetragen wurde. In vielen Fällen stellten diese tragbaren Figuren gefährliche Tiere dar, die in einer Haltung von Aggression, Stärke oder Kraft „gefangen“ waren. Daneben gibt es sowohl anthropomorphe (menschengestaltige) Figuren als auch überdeutliche Venusfiguren großer und fruchtbarer Frauen, mit eingravierter oder gemalter Vulva. Doch nicht die drei-dimensionale (schwäbische) Kunst hat die zwei-dimensionale Kunst (Chauvet) übernommen, sondern die zwei-dimensionale war schon drei-dimensional. Die im Film hergestellte Verbindung ist sehr interessant.
Die Neandertaler waren während der gesamten Zeitspanne in unmittelbarer Nähe, aber es gibt keinen Beweis dafür, dass sie selbst Kunst produziert hätten. Ich bin vorsichtig gegenüber jeder Vorstellung von einer „Wiege der Kunst“ an diesem Ort, dies wird lang vorher in Afrika der Fall gewesen sein. Aber es gibt keinen Zweifel, dass die Höhlenkunst von Chauvet Teil einer "kreativen Explosion" mit starken spirituellen Untertönen darstellt. Jean Clottes (der im Film kurz auftritt) leitete das Spezialistenteam, welches die Höhle untersuchte. In seinem Buch [1] sagt er, dass die entdeckte Höhle von schamanistischen Praktiken und Glauben erfüllt ist. Dies ist nicht der Beginn von Kunst überhaupt, doch die Höhle – und dies unterstreicht der Film – ist repräsentativ für eine tiefe [und bedeutende] psychische und soziale Veränderung, den die Menschheit durchgemacht hat.
Baboon 15/4/11
[1] Return To Chauvet Cave, Thames and Hudson – sehr empfehlenswert [noch nicht auf deutsch verfügbar]
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Werner Herzog [364]
Griechenland: Widerstand der Arbeiterklasse gegen das Sparpaket
- 1952 Aufrufe
Wenn Griechenland zahlungsunfähig würde, hätte dies enorme Konsequenzen weit über die nationalen Grenzen hinaus. Tatsächlich sind Griechenland schon Milliarden an Schulden erlassen worden. Es wurde abgemacht, dass die Gläubiger Griechenlands 50% ihrer Forderungen streichen, so dass mit einem Schlag 106 Milliarden Euro wegradiert waren. Dies wurde als „Haarschnitt“ verkauft. Der Kapitalismus hat keine Lösung für seine historische Krise, die einzige Antwort ist weiteres Sparen. Keine der von den verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie vorgeschlagenen Alternativmaßnahmen bietet eine Perspektive der Erholung der Wirtschaft an. Dies betrifft ebenso das Drucken von Geldnoten und den Rückgriff auf mehr Schulden und Lockerung bei der Geldmenge wie die brutalen und wiederholten Kürzungen bei den staatlichen Ausgaben ohne Rücksicht auf die Konsequenzen für ein künftiges Wachstum.
Die einzige Aussicht ist Sparen
Im Mai 2010, nach der ersten großen Rettungsaktion über 110 Milliarden Euro musste Griechenland 10% der Löhne im öffentlichen Dienst streichen und eine ganze Reihe anderer Sparmaßnahmen umsetzen. Das war nur die Spitze eines schon bestehenden Sparplans. Dieser „Rettungsplan“ vom Mai 2010 stellte sich bald als unwirksam heraus, und ein zweites Paket wurde im Juli 2011 geschnürt, das wiederum zu weitreichenden Kürzungen führte.
Wie schon vorausgesagt worden war, hatte auch die neue Aktion keine positive Wirkung auf die Wirtschaft. So gab es im Oktober eine neue Verhandlungsrunde. Die Banken mochten ihren „Haarschnitt“ verpasst kriegen, aber weitere 30'000 Staatsangestellte verlieren ihre Arbeit und noch schärfere Kürzungen von Löhnen und Renten stehen an. Die europäischen Führer sagten, es gebe kein Geld mehr, wenn Griechenland sich nicht gegenüber dem Euro verpflichte. Es gibt keine wirkliche Alternative, weder für Griechenland noch für Europa, da alle eingeschlagenen Wege die Wirtschaftskrise eher verschärfen als lindern. Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia kritisierte Papandreous PASOK-Regierung in scharfem Ton, aber in der Sache selbst krittelt sie an Details herum. Schließlich unterstützte sie auch das letzte Sparprogramm. Schon vor der Machtübernahme durch die PASOK im Mai 2009 hatte die damalige ND-Regierung mit den Angriffen auf die Lebensbedingungen der Bevölkerung angefangen, welche die Regierung von Papandreou dann nur verstärkte.
Arbeiterwiderstand gegen die Angriffe
Genau während der Regierungszeit der Nea Dimokratia im Dezember 2008 und Anfang 2009 brach eine Welle militanten Protests wegen der Erschießung eines 15-jährigen Studenten durch die Polizei aus. In den Besetzungen und Versammlungen, die während dieser Bewegung stattfanden, kam das Kampfpotential klar zum Ausdruck.
Die Massenhaftigkeit und die Kampfbereitschaft in den vielen Generalstreiks 2010 zeigten, dass sich die Arbeiterklasse in Griechenland angesichts der frontalen Angriffe auf ihre Lebensbedingungen nicht einfach duckte. Doch der Grad der gewerkschaftlichen Kontrolle hielt die Auswirkungen dieser Arbeiterkämpfe in engen Grenzen.
2011 war in Griechenland neben den Streiks, zu denen die Gewerkschaften als Reaktion auf eine wirkliche Wut in der ganzen Arbeiterklasse aufgerufen hatten, auch ein Echo der „Indignado“-Bewegung aus Spanien zu hören mit Vollversammlungen in vielen Städten. Unter anderem sprachen sie über die Perspektiven für die Entwicklung des Kampfes.
Und als neue Regierungsmaßnahmen angekündigt, vorgeschlagen oder gerüchtehalber bekannt wurden, gab es weitere Streiks und Proteste. An diesen beteiligten sich bestimmte Gruppen von ArbeiterInnen oder - wie beim Beispiel des Generalstreiks vom 5. Oktober - gar der ganze öffentliche Dienst. Der 48-stündige Generalstreik vom 19./20. Oktober war der breiteste Protest seit Jahrzehnten. Es gab mehr Besetzungen und Initiativen, die über die von den Gewerkschaftsführungen vorgeschlagenen Aktionen hinausgingen; und die ganze Breite des Protests und das ganze Spektrum von denen, die an den Demonstrationen teilnahmen, wurde wahrgenommen - z.B. von der zynischen ausländischen Presse. Büros, Regierungsgebäude, Schulen und Gerichte wurden geschlossen. Spitäler nahmen nur noch NotfallpatientInnen auf. Der öffentliche Verkehr stand still.
Während einer der größeren Demonstrationen vor dem griechischen Parlament taten sich die stalinistische KKE mit ihrer Gewerkschaft PAME dadurch hervor, dass sie das Parlament verteidigten. Dabei ging es keineswegs bloß um die Hütung einer Zeremonie, sondern um brutale Schläge und Einschüchterung der Widerständigen. Sie gaben sich nicht damit zufrieden, diejenigen anzugreifen, die zur Demonstration gekommen waren, sondern überstellten einige von ihnen der Polizei. Dieses Vorgehen führte unweigerlich zu Zusammenstößen mit denjenigen, die zum Parlament gelangen wollten. Das war kein isolierter Ausbruch von Gewalt, den die Stalinisten griffen die DemonstrantInnen auch an zahlreichen anderen Orten an.
Nationalismus als ewiger Feind
Jedes Jahr am 28. Oktober finden in Griechenland Paraden zum Gedenken an den Tag im Jahre 1940 statt, an dem der griechische Diktator Metaxas ein Ultimatum Mussolinis ablehnte. Dieser Schritt führte seinerzeit zu einer italienischen Invasion und dem Eintritt Griechenlands in den Zweiten Weltkrieg. Normalerweise ist diese Orgie griechischen Nationalismus’ gekennzeichnet von einer Flutwelle griechischer Fahnen und den üblichen Reden, doch dieses Jahr gab es Widerstand gegen das Sparregime. In ganz Griechenland flogen Steine, wurden Paraden blockiert, Parlamentarier der großen Parteien belästigt und an verschiedenen Orten Paraden schlicht abgesagt.
In Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, wurde der Präsident von 30'000 DemonstrantInnen empfangen. Der Polizei gelang es nicht, die Demonstrierenden zu vertreiben, die Parade wurde abgesagt und das Podium von den Protestierenden übernommen. Diese Widerstandsaktionen wurden nicht von den Gewerkschaften organisiert, sondern scheinen zu einem wesentlichen Teil spontan entstanden zu sein. Der Präsident sagte, die Wahl sei die zwischen der Teilnahme am Widerstand oder den Wahlen. Papandreou geißelte die „Beleidigung“ griechischer „nationaler Kämpfe und Institutionen“, und der Führer von Nea Dimokratia beklagte sich darüber, dass die Proteste „unseren Nationalfeiertag verdorben“ hätten.
Auch wenn es zutrifft, dass die Störung der Feierlichkeiten zum 28. Oktober einigermaßen unerhört (d.h. noch nie zu Ohren gekommen, also bisher noch nie geschehen) ist, so waren die Proteste doch nicht völlig frei von Nationalismus. So gab es insbesondere gewisse anti-deutsche Gefühle, die teilweise in der Rolle Deutschlands innerhalb der EU begründet sind. Ein Transparent in Kreta trug die Aufschrift: „Nein zum Vierten Reich“. Papandreou wurde in einer Weise als „Verräter“ hingestellt, die nur als nationalistisch motiviert ausgelegt werden konnte. Doch insgesamt betrachtet sind diese neusten Proteste eine weitere Bestätigung dafür, dass die Arbeiterklasse keinesfalls gewillt ist, vor ihren Herren zu buckeln.
Die Bourgeoisie kann nicht mit einer passiven Arbeiterklasse rechnen
Die Bourgeoisie hat für ihre wirtschaftlichen Probleme keine Lösung. Dazu kommt, dass sie mit einer schwierigen sozialen Lage konfrontiert ist, in der ArbeiterInnen an gewissen Orten Widerstand leisten gegen die Versuche, sie für die kapitalistische Krise zahlen zu lassen. Brutale Angriffe führen nicht notwendigerweise sofort zu Arbeiterkämpfen. Siehe dazu das Beispiel Irlands, wo die Antworten auf die Einschnitte beim Lebensstandard bis jetzt sehr verhalten waren.
Doch die Bourgeoisie muss früher oder später mit einer Antwort auf ihre Maßnahmen rechnen, denn sie hat sonst nichts mehr zu bieten. In Spanien beispielsweise hat die (noch) regierende Sozialistische Partei bereits die Steuern erhöht, die Löhne gekürzt und die Ausgaben drastisch eingeschränkt. Für den Fall, dass die PSOE die Wahlen vom kommenden 20. November verliert, hat die neue Regierung bereits angekündigt, mit den Budgetkürzungen fortzufahren. Das wird den wirtschaftlichen Aufschwung nicht fördern, sondern einen weiteren Beitrag zur weltweiten Rezession leisten. Dies wiederum dürfte, wie kürzlich ein Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation feststellte, zu weit reichenden sozialen Unruhen führen.
Papandreous Manöver mit dem Referendum war auch ein Beweis dafür, dass die herrschende Klasse Griechenlands die Arbeiter nicht einfach zwingen kann, das Sparprogramm zu schlucken, so sehr die Führer von EU und IWF dies auch verlangen. Doch diese gleichen Führer werden auch in „ihren eigenen“ Ländern Arbeiter vorfinden, die in naher Zukunft in gleich grober und unerhörter Weise Widerstand leisten.
Car 5.11.11
Aktuelles und Laufendes:
- Proteste [365]
- Streiks Griechenland [366]
Occupy London: Das Gewicht von Illusionen
- 2060 Aufrufe
Diese Stellungnahme begrüßt einem auf der Occupy London Website occuplsx.org. Richtig, es gab und gibt Besetzungen an vielen Orten auf der Welt mit Aktionen, die schnell vom Startpunkt an der Wall Street auf über hundert Städte in den USA und auch nach Europa übergesprungen sind. Die allgemeine Aktionsform war die Besetzung von öffentlichem Raum, mit anschließenden Diskussionen, Protesten und gemeinsamen Aktionen.
Leute beteiligen sich in dieser Bewegung und den Besetzungen, weil sie eine tiefe Sorge über die Weltlage haben, über Ökonomie und Politik wird dabei diskutiert. Ein Genosse unserer Sektion in Großbritannien schildert seine Eindrücke: „Ich war am Finsbury Square und sprach mit zwei jungen Frauen, eine arbeitslos, die andere hat einen Job. Die eine beschrieb den Grund ihrer Präsenz mit einem Gefühl des Unglücklichseins darüber, wie heute die Dinge laufen.“ Die Besetzungen eröffnen etwas, das in Großbritannien nicht Alltag ist – einen öffentlicher Raum, zu dem Leute einfach kommen und in Vollversammlungen diskutieren können, um gemeinsam die Probleme dieser Welt zu verstehen. Die Leute in den Besetzungen kommen aus verschiedenen Teilen des Landes, und auch aus dem Ausland. Einige gehen ihrer Lohnarbeit nach und sind fester Teil der Proteste. Es gab Versuche, Delegierte an andere Orte auszusenden wie den gegenwärtigen Protest der Elektriker. All das in einer Zeit, in der es trotz der großen Angst und Empörung über die niederprasselnden Sparmaßnahmen in ganz Großbritannien nur spärlich Ansätze eines Widerstandes der Arbeiterklasse gibt.
Die Ereignisse vor kurzem in Spanien und Griechenland haben gezeigt, dass die Vollversammlungen das Lebenszentrum der Selbstorganisierung der Arbeiter- und Arbeiterinnen sind. Sie sind der Ort, an dem politische Konfrontationen, Klärungen und Reflexionen stattfinden können. Klarstes Beispiel waren die intensiven Diskussionen in Spanien zwischen Menschen, die für eine „echte Demokratie“, also für eine demokratischere Regierung waren, und anderen, die mehr eine proletarische Perspektive im Auge haben: „Es gab sehr bewegende Momente, wo Leute sehr aufgewühlt waren und von Revolution sprachen und das System radikal kritisierten - man muss das Problem bei den Wurzeln packen - wie Einer sagte.“[1]
Die Diskussionen rund um die Occupy-London-Proteste drehen sich meist um zwei Hauptfragen: wie die parlamentarische Demokratie „verbessern“, um sie „für das Volk“ zurückzugewinnen, gegen die Reichen, die Banker, die Elite; und zweitens: wie mehr soziale Gerechtigkeit erreichen – sprich eine gerechtere Verteilung im Kapitalismus. Unser Genosse formulierte es so: „Ich kam zu den späten Treffen im Universitätszelt, wo eine Diskussion über die Demokratie stattfand. Dort vernahm ich, dass es in Spanien keine wirkliche Demokratie gebe, da man nur einer Liste einer Partei die Stimme geben könne, was zu einer proportionalen Sitzverteilung führe, ohne Möglichkeit, einen bestimmten Parlamentarier zu wählen, und dass die Parteien ein Teil des Staates seien. Einige meinten dies seien alles Nachwehen aus der Zeit Francos… In dieser Diskussion waren die Politiker so fast an allem schuld. Doch es gab auch andere Stimmen, die versuchten, Fragen der Ökonomie einzubringen und den Standpunkt formulierten, dass die Demokratie in Großbritannien keinen Deut besser sei als in Spanien. Es gab auch bizarre Beiträge wie z.B. die Idee, wir sollten dafür sorgen, dass Laien die öffentlichen Ämter übernehmen, ähnlich wie sie für Geschworenengerichte beigezogen werden, dies würde die Vetternwirtschaft im Oberhaus beseitigen …oder wir sollten bessere Manager in die Regierung wählen wie in China …Einer sagte, am System der Parlamentswahlen herumzubasteln sei ein Weg, um die Erfahrung der Vollversammlungen auf eine höhere Ebene zu bringen. Ich beteiligte mich mit drei kurzen Beiträgen an der Diskussion: 1. Dass die Art und Weise, wie Politiker handeln, nicht von spanischen, britischen oder sonstigen parlamentarischen Systemen herrührt, sondern von ihrer Aufgabe, den Kapitalismus zu verteidigen. 2. Dass die Rolle der ökonomischen Krise generell zu beachten ist und die Krise nicht alleine auf die Kappe der Banker geht. 3. Ich sagte auch, dass ich gehofft hätte mehr über die Vollversammlungen selbst zu hören und mir den Einbezug historischer Beispiele wie der Arbeiterräte wünsche. Auch wenn es einige Zustimmungen mit dem Zeichen des Händeschüttelns gab, so schwenkte die Diskussion wieder auf die Suche nach perfekteren Formen der bürgerlichen Demokratie ein.“
Occupy London ist nicht nur kleiner als die Bewegungen in Spanien und den USA - von denen sie inspiriert wurde -, sondern auch schwächer an Stimmen für eine Perspektive, die sich an der Arbeiterklasse orientiert, während umgekehrt Voten für die Verbesserung der parlamentarischen Demokratie häufiger zu hören sind. Die Bemühung, „Delegationen“ an die Proteste der Elektriker, die nicht weit davon entfernt stattfanden, zu senden, wurden mehr als individuelle Entscheidungen und Aktivitäten derjenigen, die sich gerade beteiligten, angesehen. In Oakland hatte die Occupy-Bewegung sogar zu einem Generalstreik und zu Abendmeetings aufgerufen, damit Arbeitende sich daran beteiligen können (siehe: www.occupyoakland.org [367]). All das lässt Occupy London sehr verletzlich bleiben gegenüber dem Hin und Her um die Frage der drohenden Vertreibung – oder eines alternative Platzes für 2 Monate mit reduzierter Anzahl von Zelten – und dem ganzen Medienzirkus um die Reibereien der Obrigkeiten der St Paul’s Cathedral, mit dem Rücktritt des Domherrn und später des Dekans.
Die Reaktion der Boulevardpresse war wie vorhersehbar im Stile der geschockten Entrüstung über die „Horror-Bewegung“. Die liberalere und linke Presse meinte, diese Bewegung sei eine „Auffrischung“ und ein „Aufrütteln“ für ein demokratischeres System. Unter dem Strich haben sich der Großteil der Presse und die offizielle Kirche zum Argument durchgerungen, die Politiker sollten auf die „Anliegen“ des berechtigten Protests eine „Antwort“ geben. Doch wenn die Bewegung keine Perspektive des Hinausgehens eröffnet, um den Kontakt mit dem Rest der Arbeiterklasse zu suchen, werden der Medienrummel und die Art, wie diese die Bewegung darstellen, zu einem Gefängnis.
Die drohende Räumung und die Frage, wie man sich gegen Gewalt und Repression verteidigt, sind zweifelsohne wichtig. An vielen Orten in den USA nahm diese geforderte „Antwort“ von gewählten Politikern gegenüber der Bewegung die Form harter Repression an (wie die 700 Leute, die auf der Brooklyn Bridge eingekesselt und dann verhaftet wurden, und Verhaftungen und Schläge an anderen Orten mit Besetzungen[2]). Auf einer Vollversammlung auf dem Finsbury Square, an der ein Genosse von uns teilnahm und auf der über die angedrohte Räumung bei der St Paul’s Cathedral gesprochen wurde (bevor die Kirche das Angebot von zwei Monaten Bleiberecht mit vereinbartem Wegzugsdatum machte), war das Hauptanliegen, wie wohl die Medien die Reaktion der Vollversammlung präsentieren würden. Auf einen Vorschlag von unserem Genossen, direkt zu Arbeitern zu gehen, und die Mahnung eines anderen Teilnehmers, dass die Ziele der Bewegung über eine unendliche Besetzung hinausgingen, wurde nicht eingegangen. Beide fühlten sich etwas störend.
Die große Gefahr ist nun, dass Occupy London in die Falle einer hoffnungslosen, nach innen gerichteten Dynamik gerät und der Kirche und den Medien das Zepter überlässt.
Graham 4.11.2011
[1] http:/en.internationalism.org/icconline/2011/september/indignados
[2] The Guardian berichtete am 14. Oktober, dass der Sohn des legendären Bluesmusikers Bo Diddley verhaftet wurde, als er seine Unterstützung für die Bewegung kundtat… und dies auf einem Platz in Florida, der nach seinem Vater benannt ist!
Aktuelles und Laufendes:
- Occupy London [368]
Occupy-Wall-Street Proteste: Der Kapitalismus als Ganzes ist das Problem
- 1874 Aufrufe
Wirtschaftskrise: Die Antwort ist nicht finanzielle Regulierung, sondern Sturz des Kapitalismus
- 3123 Aufrufe
„Der nächste Crash kommt bestimmt, und er wird schlimm werden.“ „Absolut niemand glaubt an die Rettungspläne. Sie wissen, dass der Mark ausgepresst und die Börse am Ende ist.“ „Händler geben einen Dreck darauf, wie die Wirtschaft gerettet werden kann; unser Job ist es, Geld zu machen in dieser Situation.“ „Jede Nacht träume ich von der Rezession.“ „1929 machten einige wenige Leute Geld mit dem Crash; heute kann dies jeder tun, nicht nur die Eliten.“ „Diese Wirtschaftskrise ist wie ein Krebs.“ „Rechnet mit dem Schlimmsten! Es ist nicht der Augenblick, darauf zu hoffen, dass die Regierung das Problem lösen wird. Regierungen regieren nicht die Welt. Goldman Sachs regiert die Welt. Diese Bank kümmert sich nicht um Rettungspläne.“ „Ich sage voraus, dass in weniger als zwölf Monaten Millionen von Menschen verschwinden werden, und dies ist erst der Anfang.“ Dies alles sind Zitate aus einem Gespräch, das die BBC am 26. September mit dem Londoner Händler Alessio Rastani führte. Das Video hat seitdem einen regelrechten Hype im Internet ausgelöst.[1]
Gewiss stimmen wir diesem Ökonomen in seiner schwarzen Perspektive zu. Ohne zu versuchen, selbst präzise Vorhersagen zu machen, können wir dennoch ohne Zögern zustimmen, dass der Kapitalismus dabei ist, seinen Sturzflug fortzusetzen, dass die Krise noch schlimmer und verheerender wird und dass ein wachsender Teil der Menschheit im Begriff ist, die Konsequenzen daraus zu tragen.
Und dennoch: die Erklärung von Alession Rastani nährt eine der größten Lügen der letzten Jahre: dass der Planet wegen der Finanzwelt und nur wegen der Finanzwelt in Schwierigkeiten ist: „Goldman Sachs regiert die Welt“. Und all die Stimmen der Linken, der Linksextremen, der „Anti-Globalisierer“ stimmen in diesen Chor ein: „Es ist entsetzlich! Hier liegt die Ursache all unserer Probleme. Wir müssen die Kontrolle über die Wirtschaft zurückgewinnen. Wir müssen den Banken und der Spekulation Grenzen setzen. Wir müssen für einen stärkeren und humaneren Staat kämpfen!“ Diese Art von Sprüchen ertönt nonstop seit dem Kollaps des US-Bankgiganten Lehman Brothers 2008. Heute schenken selbst Teile des klassischen rechten Flügels dieser „radikalen“ Kritik an der „wildgewordenen“ Finanzwirtschaft Glauben und rufen zu einer moralischeren Vorgehensweise und zu einer größeren Rolle des Staates auf. All diese Propaganda ist nichts anderes als ein verzweifelter ideologischer Vorwand, um die wahren Ursachen dieser zeitgenössischen Verheerungen zu verbergen: der historische Bankrott des Kapitalismus. Hier geht es nicht um Nuancen oder Begriffsfragen. Den Neoliberalismus anzuklagen und den Kapitalismus anzuklagen sind zwei fundamental unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite ist da die Illusion, dass dieses Ausbeutungssystem reformiert werden kann. Auf der anderen Seite ist das Verständnis, dass der Kapitalismus keine Zukunft hat, dass er total zerstört und von einer neuen Gesellschaft ersetzt werden muss. Wir können daher begreifen, warum die herrschende Klasse, ihre Medien und ihre Experten so viel Energie aufwenden, um mit dem Finger auf das unverantwortliche Handeln der Finanzmärkte zu weisen und sie für all die gegenwärtigen wirtschaftlichen Kalamitäten schuldig zu sprechen: Sie versuchen so, die Aufmerksamkeit vom System wegzulenken, das aufkommende Nachdenken über die Notwendigkeit eines radikalen Wechsels, d.h. einer Revolution, zu behindern.
„Die Finanzhändler sind schuld“ oder: Die Suche nach einem Sündenbock
In den letzten vier Jahren wurde bei jedem Börsencrash das Märchen vom zwielichtigen Finanzhandel intoniert. Im Januar 2008 stand der Skandal um Jerome Kirviel in den Schlagzeilen. Er wurde als Verantwortlicher für das Fiasko in der französischen Bank Societé Générale ausgemacht, die 4,82 Milliarden Euro durch schlechte Investments verloren hatte. Der wahre Grund für diese Krise, die Immobilienblase in den USA, wurde in den Hintergrund gerückt. Im Dezember 2008 wurde gegen den Investor Bernard Madoff wegen Unterschlagung von 65 Milliarden Dollar ermittelt. Er wurde zum größten Halunken aller Zeiten, was praktischerweise die Aufmerksamkeit vom Ruin des US-Giganten Lehman Brothers weglenkte. Im September 2011 wurde der Händler Kweku Adoboli an der Schweizer Bank UBS der Unterschlagung von 2,3 Milliarden Dollar beschuldigt. Diese Affäre kam „zufällig“ ans Tageslicht, als sich die Weltwirtschaft erneut in großer Unordnung befand.
Natürlich weiß jeder, dass diese Individuen lediglich Sündenböcke sind. Die Fäden, die von den Bänken gezogen wurden, um ihre eigenen Verbrechen zu rechtfertigen, sind zu dick, um nicht bemerkt zu werden. Doch die intensive Medienpropaganda macht es möglich, jedermanns Aufmerksamkeit auf die verrottete Welt der Hochfinanz zu fokussieren. Das Image dieser Spekulationshaie wird benutzt, um unsere Köpfe zu erobern und unsere Gedanke zu benebeln.
Gehen wir einen Schritt zurück und denken einen Moment lang nach: Wie können diese vielfältigen Ereignisse in sich selbst erklären, warum die Welt am Rand des Zusammenbruchs ist? Wie Abscheu erregend diese milliardenschweren Unterschlagungen auch sein mögen zu einer Zeit, in der Millionen überall auf der Welt vor Hunger sterben, wie zynisch und schändlich die Worte von Alessio Rastani auch sein mögen, wenn er sagt, dass er hofft, durch Spekulationen mit den Börsenkrachs reich zu werden, so erklärt nichts von dem das Ausmaß der Weltwirtschaftskrise, die heute jeden Bereich und jedes Land trifft. Die Kapitalisten haben, ob sie nun Banker oder Industriekapitäne waren, stets ohne jegliches Interesse an dem Wohlergehen der Menschheit nach dem maximalen Profit gestrebt. Nichts davon ist neu. Von seinem Beginn an war der Kapitalismus immer ein System der unmenschlichen Ausbeutung gewesen. Die barbarische und blutige Ausplünderung Afrikas und Asiens im 18. und 19. Jahrhundert ist ein tragischer Beweis dafür. Die Kleptokratie der Finanzhändler und Banker teilt uns daher nichts Neues über die gegenwärtige Krise mit. Wenn nun betrügerische Finanzdeals in kolossalen Verlusten enden und manchmal drohen, Banken in den Abgrund zu stoßen, so ist dies in der Tat ein Resultat der Fragilität, die von der Krise verursacht wurde – und nicht umgekehrt. Wenn beispielsweise Lehman Brothers 2008 pleiteging, so nicht wegen ihrer unverantwortlichen Investmentpolitik, sondern weil der US-amerikanische Immobilienmarkt im Sommer 2007 kollabierte und weil diese Bank sich in der misslichen Lage befand, auf Massen von wertlosen Schulden zu sitzen. Mit der Subprime-Krise zeigte sich, dass die amerikanischen Haushalte insolvent waren und die an ihnen verliehenen Kredite niemals zurückgezahlt werden konnten.
„Es ist die Schuld der Kreditratingagenturen“ oder: Die Beschuldigung gegen das Thermometer, das Fieber erzeugt zu haben
Auch die Kreditratingagenturen standen unter Feuer. Ende 2007 wurden sie der Inkompetenz beschuldigt, weil sie das Gewicht der Schulden des staatlichen Souveräns vernachlässigt hätten. Heute werden sie des Gegenteils beschuldigt; sie würden den Staatsschulden in der Euro-Zone (für Moody’s) und in den USA (für Standard and Poor’s) zu viel Aufmerksamkeit schenken.
Es ist richtig, dass diese Agenturen besondere Interessen haben, dass ihr Urteil nicht neutral ist. Die chinesischen Ratingagenturen waren die ersten, die die Kreditwürdigkeit des amerikanischen Staates herunterstuften; die amerikanischen Agenturen wiederum verhielten sich gegenüber Europa rigider als gegenüber dem eigenen Land. Und es trifft zu, dass mit jeder Herabstufung die Finanzwelt die Gelegenheit zur Spekulation ergriff und so den Verfall der Wirtschaftslage weiter beschleunigte. Die Spezialisten sprechen in dem Fall von einer „sich selbst erfüllenden Prophezeiung“.
Doch in Wahrheit unterschätzen alle diese Agenturen das Ausmaß der Situation komplett: Die Ratings, die sie vergeben, sind viel zu hoch im Verhältnis zu den tatsächlichen Kapazitäten der Banken, der Unternehmen und gewisser Staaten, ihre Schulden zurückzuzahlen. Es ist im Interesse dieser Agenturen, nicht zu kritisch hinsichtlich der ökonomischen Essentials zu sein, weil dies Panik schaffen würde, und die Weltwirtschaft ist der Ast, auf dem sie alle sitzen. Wenn sie die Ratings herabstufen, dann geschieht dies, um ein Minimum an Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Den Ernst der Lage, der sich die Weltwirtschaft gegenübersieht, völlig zu leugnen wäre grotesk, und niemand würde ihnen glauben. Vom Standpunkt der herrschenden Klasse ist es intelligenter, gewisse Schwächen anzuerkennen, um die grundlegenden Probleme des Systems zu verschleiern. All jene, die jüngst die Ratingagenturen beschuldigten, sind sich dessen voll bewusst. Wenn sie sich über die Qualität des Thermometers beschweren, dann nur, um uns daran zu hindern, über die seltsame Krankheit nachzudenken, die den Weltkapitalismus in Mitleidenschaft zieht, aus Furcht, zugeben zu müssen, dass diese Krankheit unheilbar ist und sich noch verschlimmern wird.
„Es ist die Schuld der Finanzwelt“ oder: Die Verwechslung des Symptoms mit der Krankheit
Die Kritik an die Trader und Ratingagenturen ist Teil einer größeren Propagandakampagne über den Irrsinn und Größenwahn des Finanzsektors. Wie immer basiert die dem zugrundeliegende Ideologie auf ein Körnchen Wahrheit. Es kann nicht bestritten werden, dass in den letzten Jahrzehnten die Finanzwelt in der Tat zu einer aufgeblasenen und immer irrationaleren Monstrosität herangewachsen ist. Die Beweise dafür gehen in die Legion. Im Jahr 2008 stieg die Gesamtsumme der globalen Finanztransaktionen auf 2200.000 Milliarden Dollar, verglichen mit einem globalen Bruttosozialprodukt von 55.000 Milliarden Dollar[2] Die spekulative Ökonomie ist somit rund vierzigmal größer als die so genannte „Realwirtschaft“! Und diese Billionen sind über Jahre auf immer verrücktere und selbstzerstörerische Weise investiert worden. Ein anschauliches Beispiel: der Leerverkaufsmechanismus. Worum geht es hierbei? „Beim Leerverkaufsmechanismus beginnen wir damit, eine Anlage zu verkaufen, die wir nicht besitzen, um sie später zu kaufen. Das Ziel dieses Tricks besteht offensichtlich darin, eine Anlage zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, um sie später zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen und die Differenz als Gewinn zu verbuchen. Wie wir sehen, ist dieser Mechanismus das völlige Gegenteil davon, etwas zu erwerben und dann weiterzuverkaufen.“[3]
Konkret beinhalten Leerverkäufe einen riesigen Fluss von spekulativem Kapital zu bestimmten Anlagen, die auf den Fall ihrer Preise wetten, was gelegentlich zum Zusammenbruch der anvisierten Anlage führt. Dies ist nun zum Skandal geworden, und ein Haufen Ökonomen und Politiker erzählt uns gar, dass dies das Hauptproblem sei. DER Grund für den Bankrott und den Fall des Euro. Ihre Lösung ist daher simpel: Leerverkäufe verbieten, und alles wird gut in der besten aller Welten. Es stimmt, dass Leerverkäufe völliger Irrsinn sind und dass sie die Vernichtung weiter Teile der Wirtschaft beschleunigen. Aber genau das sind sie: Sie sind bloße „Beschleuniger“ und nicht ihre Ursache. Es bedarf zuallererst einer wütenden Wirtschaftskrise, damit solche Deals so profitabel sein können. Die Tatsache, dass die Kapitalisten nicht auf einen Anstieg in den Märkten zocken, sondern auf ihren Fall, zeigt, wie wenig Vertrauen sie in die Zukunft der Weltwirtschaft haben. Daher gibt es auch immer weniger langfristige, stabile Investments: Die Investoren sind auf den schnellen Gewinn aus, ohne jegliche Sorge um die Langlebigkeit von Unternehmen und besonders von Fabriken, da es nahezu keinen Industriesektor gibt, der langfristige Profite verspricht. Und hier schließlich kommen wir zum Kern des Problems: Die so genannte Real- oder traditionelle Wirtschaft sitzt schon seit Ewigkeiten in der Tinte. Das Kapital flüchtet aus dieser Sphäre, weil sie immer weniger profitabel ist. Die Weltwirtschaft ist gesättigt, und die Waren können nicht mehr verkauft werden, die Fabriken produzieren und akkumulieren nicht mehr. Das Resultat: die Kapitalisten investieren ihr Geld in die Spekulation, in die „virtuelle“ Ökonomie. Daher der Größenwahn der Finanzwelt, der nur ein Symptom der unheilbaren Krankheit des Kapitalismus, die Überproduktion, ist.
„Der Neoliberalismus hat Schuld“ oder: Wie man die Ausgebeuteten an den Staat bindet
Jene, die das Problem im Neoliberalismus lokalisieren, stimmen durchaus zu, dass die Realwirtschaft in echten Nöten ist. Aber sie führen dies nicht eine Sekunde lang auf die Unmöglichkeit des Kapitalismus zurück, sich weiter zu entwickeln. Sie streiten ab, dass das System dekadent geworden ist und sich in seiner Agonie befindet. Die Antiglobalisierungsideologen geben die Schuld für die Zerstörung der Industrie seit den sechziger Jahren der schlechten Politik und somit der neoliberalen Ideologie. Für sie wie für unseren Trader Alessio Rastani „regiert Goldman Sachs die Welt“. So kämpfen sie also für mehr Staat, für mehr Regulierung, für mehr soziale Politik. Sie beginnen mit der Kritik an den Neoliberalismus und enden bei einer neuen Fata Morgana, die uns leiten soll: Dirigismus. „Mit mehr staatlicher Kontrolle über die Finanzen können wir eine neue Wirtschaft aufbauen, eine, die sozialer und wohlhabender ist.“
Doch ein bisschen mehr Staat wird es nicht ermöglichen, die ökonomischen Probleme des Kapitalismus zu lösen. Um es noch einmal zu sagen: Was das System unterminiert, ist seine Tendenz, mehr Waren zu produzieren, als der Markt absorbieren kann. Jahrzehntelang ist es gelungen, die Paralyse der Wirtschaft zu vermeiden, indem ein künstlicher Markt geschaffen wurde, der auf Schulden basierte. Mit anderen Worten, seit den sechziger Jahren hat der Kapitalismus auf Pump gelebt. Daher ächzen Haushalte, Unternehmen, Banken und Staaten heute unter einem gewaltigen Schuldenberg, deshalb wird die gegenwärtige Rezession „Kreditkrise“ genannt. Allein, was haben die Staaten und ihre Zentralbanken, insbesondere die Fed und die Europäische Zentralbank seit 2008, seit dem Scheitern von Lehman Brothers getan? Sie haben Milliarden von Dollar und Euro in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, um weitere Bankrotte zu verhindern. Und woher kamen diese Milliarden? Von neuen Schulden! Alles, was sie tun, ist, private Schulden in öffentliche Schulden umzuwandeln und so den Boden für den Bankrott ganzer Staaten zu bereiten, wie wir bereits bei Griechenland gesehen haben. Die ökonomischen Stürme, die vor uns liegen, drohen von ungeahnter Brutalität zu werden.[4]
„Doch auch wenn wir die Krise nicht kontrollieren können, so schützt uns der Staat zumindest und kann sozialer sein“, singt der ganze linke Chor. Kein Wort darüber, dass der Staat stets der Schlimmste aller Bosse gewesen war. Verstaatlichungen waren nie gute Neuigkeiten für die ArbeiterInnen. Die große Verstaatlichungswelle nach dem II. Weltkrieg hatte den Zweck, den Produktionsapparat, der im Krieg zerstört wurde, wiederzubeleben, und wurde von einer brutalen Steigerung des Arbeitstempos begleitet. Damals richtete Thorez, der Generalsekretär der französischen KP und Vizepräsident der De Gaulle-Regierung, seinen berühmten Appell an die Arbeiterklasse Frankreichs, besonders an die ArbeiterInnen der verstaatlichten Unternehmen: „Wenn Bergarbeiter auf ihrem Posten sterben, werden ihre Ehefrauen sie ersetzen.“ Oder: „Knüpft eure Gürtel enger für den nationalen Wiederaufbau“ und „Streiks sind die Waffe der Trusts“. Willkommen in der wundervollen Welt der verstaatlichten Unternehmen! Es gibt nichts Unerwartetes oder Überraschenden an ihnen. Seit den Erfahrungen der Pariser Kommune 1871 haben kommunistische Revolutionäre stets auf die eingefleischte Anti-ArbeiterInnen-Funktion des Staates bestanden: “Und der moderne Staat ist wieder nur die Organisation, welche sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äußern Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise aufrechtzuerhalten gegen Übergriffe, sowohl der Arbeiter wie der einzelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, was auch seine Form, ist eine wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, der ideelle Gesamtkapitalist. Je mehr Produktivkräfte er in sein Eigentum übernimmt, desto mehr wird er wirklicher Gesamtkapitalist, desto mehr Staatsbürger beutet er aus. Die Arbeiter bleiben Lohnarbeiter, Proletarier. Das Kapitalverhältnis wird nicht aufgehoben, es wird vielmehr auf die Spitze getrieben.“ (www.mlwerke.de/me/me20/me20_239.htm#Kap_V [370], Anti-Dühring, MEW 20).
Friedrich Engels schrieb 1878 diese Zeilen, die zeigten, dass damals schon der Staat im Begriff war, seine Tentakeln auf die gesamte Gesellschaft auszustrecken und die gesamte nationale Wirtschaft, öffentliche Unternehmen wie auch die großen Privatunternehmen, zu übernehmen. Seither ist der Staat nur noch stärker geworden: Jede nationale Bourgeoisie reiht sich hinter ihrem Staat ein, um den unerbittlichen kommerziellen Krieg zu führen, der zwischen allen Ländern ausgefochten wird.
„Die BRICS werden uns retten“ oder: Für ein Wirtschaftswunder beten
Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (die BRICS) haben in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Ausmaß an wirtschaftlichem Erfolg an den Tag gelegt. Besonders China wird mittlerweile als zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt betrachtet, und viele denken, dass es die USA bald entthronen wird. Diese auffällige Leistung hat Ökonomen zur Hoffnung verleitet, dass diese Gruppe von Ländern die neue Lokomotive der Weltwirtschaft wird, so wie die USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Jüngst hat China, angesichts des Risikos, dass die Euro-Zone in Folge der Staatsschuldenkrise auseinanderbricht, gar vorgeschlagen, Italiens Staatssäckel teilweise zu füllen. Die Leute von der Anti-Globalisierungs-Front glauben hier einen Grund zum Frohlocken zu sehen: Da sie argumentieren, dass die US-amerikanische Überlegenheit des Neoliberalismus die schlimmste aller Geißeln ist, wird der Aufstieg der BRICS ihnen zufolge in eine ausbalanciertere, fairere Welt münden. Diese Hoffnung in die Entwicklung der BRICS, die von der Großbourgeoisie und den „Anti-Kapitalisten“ gemeinsam geteilt wird, entbehrt nicht nur einer gewissen Komik; sie zeigt auch, wie sehr Letztere der kapitalistischen Welt anhängen.
Diese Hoffnung ist im Begriff, wie eine Seifenblase zu zerplatzen. Das Gerede über dieses „Wirtschaftswunder“ weckt ein Déjá-vu-Gefühl. Argentinien und die asiatischen Tiger in den achtziger und neunziger Jahren oder erst jüngst Irland, Spanien und Island wurden alle zu ihrer Zeit als „Wirtschaftswunder“ gepriesen. Und wie alle Wunder stellten sie sich durchgängig als Schwindel heraus. Alle diese Länder verdanken ihr rapides Wachstum der ungezügelten Verschuldung. Sie gingen daher alle demselben zähen Ende entgegen: Rezession und Bankrott. Mit den BRICS wird es sich genauso verhalten. Es gibt bereits eine wachsende Sorge über das Ausmaß der Schulden in den chinesischen Provinzen und über den Anstieg der Inflation. Der Präsident des Staatsfonds China Investment Corp., Gao Xiping, hatte jüngst gesagt, dass „wir keine Beschützer sind. Wir müssen uns selbst retten“. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken!
Die Wahrheit: Der Kapitalismus hat keine Lösung und keine Zukunft
Der Kapitalismus kann nicht mehr reformiert werden. Als Realist muss man sich eingestehen, dass nur die Revolution die Katastrophe verhindern kann. Der Kapitalismus ist, wie das Sklaventum und die Leibeigenschaft zuvor, ein Ausbeutungssystem, das dazu verdammt ist, zu verschwinden. Nachdem er sich in über zwei Jahrhunderten, vor allem im 18. und 19. Jahrhundert entwickelt und den Planeten erobert hatte, betrat der Kapitalismus mit einem lauten Knall seine Niedergangsepoche, als er den Ersten Weltkrieg auslöste. Die Große Depression in den dreißiger Jahren, dann das fürchterliche Gemetzel des Zweiten Weltkriegs – all dies bestätigte die Überalterung dieses Systems und die Notwendigkeit, ihm ein Ende zu setzen, wenn die Menschheit überleben soll. Doch ab den fünfziger Jahren gab es keine Krise, die so gewalttätig war wie die von 1929. Die Bourgeoisie hatte gelernt, wie sie den Schaden begrenzen und die Wirtschaft wiederbeleben kann, so dass viele glauben, dass die heutige Krise nur eine weitere in einer Reihe von Abstürzen ist und dass das Wachstum wieder zurückkehren wird, so wie dies in den letzten sechzig Jahren geschehen war. In Wahrheit ebneten die aufeinanderfolgenden Krisen von 1967, 1970-71, 1974-75, 1991-93 (in Asien) und 2001-2002 nur den Weg für das heutige Drama. Jedes Mal gelang es der Bourgeoisie lediglich durch das Öffnen der Kreditschleusentore, die Wirtschaft zum Laufen zu bringen. Nie war es ihr gelungen, zur Wurzel des Problems vorzudringen: chronische Überproduktion. Alles, was sie getan hat, war, den Zahltag hinauszuschieben, indem sie in den Kredit flüchtete. Heute erstickt das System unter dem Gewicht all dieser Schulden. Kein Bereich, kein Staat bleibt dabei ausgespart. Dieser Sprung kopfüber in die Verschuldung ist an seine Grenzen gestoßen. Bedeutet dies, dass die Wirtschaft dabei ist, zu einem vollständigen Halt zu kommen? Natürlich nicht. Die Bourgeoisie wird die Optionen, die sie hat, diskutieren, was auf die Wahl zwischen Pest und Cholera hinauslaufen wird: drakonische Sparpolitik oder ein monetärer Neustart. Das erste führt zu einer brutalen Rezession, das zweite zu unkontrollierter Inflation.
Von jetzt an ist der Wechsel zwischen kurzen Phasen der Rezession und langen Perioden der kreditfinanzierten Wiedererholung Vergangenheit: Die Arbeitslosigkeit wird explodieren, Armut und Barbarei werden sich dramatisch ausbreiten. Wenn es Erholungsphasen (wie 2010) gibt, dann werden sie nichts anderes sein als ein flüchtiges Japsen nach Luft, gefolgt von neuen wirtschaftlichen Desastern. All jene, die das Gegenteil behaupten, ähneln ein bisschen dem Optimisten, der von der Spitze des Empire State Building springt und nach dem Passieren einer jeden Etage erklärt, dass bis jetzt alles gut gegangen ist. Vergessen wir nicht, dass zu Beginn der Großen Depression der US-Präsident erklärte, dass „die Prosperität schon in Sicht ist“. Die einzige Ungewissheit ist, wie das Schicksal der Menschheit aussehen wird. Wird sie mit dem Kapitalismus untergehen? Oder wird sie in der Lage sein, eine neue Welt der Solidarität und gegenseitigen Hilfe aufzubauen, ohne Klassen oder Staaten, Ausbeutung oder Profit? Wie Friedrich Engels mehr als Jahrhundert zuvor schrieb: „Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma: entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Der Schlüssel zu dieser Zukunft liegt in den Händen der Arbeiterklasse, in ihren Kämpfen, die die Beschäftigten, die Arbeitslosen, die Rentner und die jungen Leute in prekären Jobs vereinigen.
Pawel 29.9.2011
[4] Die Idee eines „Mehr Europa“ oder „Mehr Weltregierung“ ist eine weitere Sackgasse. Ob sie allein oder mit anderen handeln, die Staaten haben keine realen und dauerhaften Lösungen. Zusammenzukommen ermöglicht ihnen, das Fortschreiten der Krise zu verlangsamen, so wie ihre Spaltungen dieselbe beschleunigt.
Aktuelles und Laufendes:
- Wirtschaftskrise [167]
- Staatsbankrott [44]
- Rettungspakete [215]
- Rolle Finanzhändler [374]
- Ratingagenturen [375]
Weltrevolution - 2012
- 3194 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 170
- 2347 Aufrufe
Der Kapitalismus ist bankrott Wir müssen ihn überwinden !
- 2416 Aufrufe
Vor gar nicht allzu langer Zeit stießen die Revolutionäre nur auf Skepsis oder man machte sich lustig über sie, wenn sie behaupteten, dass das kapitalistische System sich auf den Abgrund zubewege. Heute müssen die innigsten Verfechter des Kapitalismus eingestehen, « Wir stecken mitten drin im Chaos » (Jacques Attali, ehemaliger enger Mitarbeiter des verstorbenen französischen Präsidenten Mitterand und gegenwärtiger Berater von Präsident Sarkozy). « Vielleicht sind Sie sich nicht dessen bewusst, dass dieses System innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen zusammenbrechen könnte. Es wäre der Weltuntergang. Wir bewegen uns auf eine soziale Revolution zu. » (Jean-Pierre Mustier, Bankdirektor bei der französischen Großbank Société Générale). Diese Verteidiger des Kapitalismus kostet es Überwindung zu bekennen, dass die von ihnen so verherrlichte Gesellschaft auf dem Sterbebett liegt. Sie sind natürlich bestürzt darüber und dies umso mehr, da sie feststellen müssen, dass deren Rettungsversuche des Systems erfolglos sind. Die Verteidiger dieses Systems haben keine Lösung anzubieten.
Natürlich können die Leute, die trotz ihres schonungslosen Eingeständnisses hinsichtlich der Perspektiven des Systems meinen, es könne kein anderes System geben, nicht mit einer wirklichen Lösung der Katastrophe aufwarten, vor der heute die Menschheit steht. Denn für die Widersprüche des Kapitalismus gibt es keine Lösung innerhalb des Systems. Die Widersprüche, vor denen dieses Systems steht, sind nicht auf « Misswirtschaft » durch diese oder jene Regierung oder durch die Finanzwirtschaft zurückzuführen, sondern auf die Gesetze des Systems selbst. Nur indem wir den Rahmen dieser Gesetze überwinden, den Kapitalismus durch eine andere Gesellschaft ersetzen, kann die Menschheit der Katastrophe entgehen, in welche sie immer mehr versinkt.
Die einzige Lösung: die Menschheit von der Geißel des Kapitalismus befreien
Genauso wie alle vorhergehenden Gesellschaften wie die Sklavenwirtschaft und der Feudalismus ist der Kapitalismus kein ewig bestehendes System. Die Sklavenwirtschaft herrschte in der Antike, weil sie dem damaligen Niveau der landwirtschaftlichen Produktionstechnik entsprach. Als diese sich weiter entwickelte und von den Produzenten eine größere Aufmerksamkeit erforderlich wurde, geriet die Gesellschaft in eine tiefgreifende Krise (zum Beispiel die römische Dekadenz). An deren Stelle trat der Feudalismus, wo der Leibeigene an seine Scholle gefesselt wurde und seinem Grundbesitzer zu dienen und einen Teil seiner Ernte abzuliefern hatte. Am Ende des Mittelalters war dieses System wiederum veraltet; es stürzte die Gesellschaft in eine neue historische Krise. An deren Stelle trat der Kapitalismus, der nicht auf der kleinen landwirtschaftlichen Produktion fußte, sondern auf Handel, assoziierter Arbeit und der Großindustrie, die wiederum erst möglich wurden dank des Fortschritts der Technik (z.B. der Dampfmaschine). Heute ist der Kapitalismus im Gegenzug aufgrund seiner ihm eigenen Gesetze historisch überholt. Und er muss ebenso ersetzt werden.
Aber welche Gesellschaft soll an dessen Stelle treten? Dies ist DIE sehr beängstigende Frage, welche sich eine immer größere Zahl von Leuten stellt, die sich dessen bewusst werden, dass das gegenwärtige System keine Zukunft mehr hat und die Menschheit in den Abgrund der Verarmung und der Barbarei treibt. Niemand kann genau vorhersehen, wie im Einzelnen diese zukünftige Gesellschaft aussehen könnte, aber eins ist sicher: Sie muss an erster Stelle die Produktion für einen Markt abschaffen; stattdessen muss die Produktion mit dem alleinigen Ziel der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse erfolgen. Heute werden wir mit dieser Absurdität konfrontiert, dass überall auf der Welt die absolute Verarmung zunimmt, die Mehrheit der Bevölkerung gezwungen ist, immer mehr Verzicht zu leisten, nicht weil das System nicht ausreichend produzieren würde, sondern im Gegenteil – es wird zu viel produziert. Man zahlt den Bauern Entschädigungen, damit sie ihre Produktion reduzieren, man schließt Betriebe, schmeißt massenhaft Beschäftigte auf die Straße, sehr viele Jugendliche werden zur Arbeitslosigkeit verdammt, selbst wenn sie lange Studien- und Ausbildungszeiten hinter sich haben, und gleichzeitig zwingt man die Ausgebeuteten immer mehr dazu, den Gürtel enger zu schnallen. Not und Elend sind nicht die Folge eines Mangels an Arbeitskräften oder an Produktionsmitteln. Nein, sie sind die Auswirkungen einer Produktionsweise, die zu einer Kalamität für die ganze Menschheit geworden ist. Nur indem radikal die Produktion für den Markt überwunden wird, nur indem der Markt überhaupt abgeschafft wird, kann die Produktionsform, die den Kapitalismus ersetzen muss, verwirklicht werden: Jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen.
Aber wie kann solch eine Gesellschaft aufgebaut werden? Welche Kraft in der Gesellschaft ist in der Lage, solch eine Umwälzung des Lebens der ganzen Menschheit in Angriff zu nehmen?
Es liegt auf der Hand, dass solch eine Umwälzung nicht durch die Kapitalisten und die bestehenden Regierungen angestoßen werden kann, weil diese ALLE – unabhängig von ihrer politischen Couleur – dieses System und die damit für sie gegebenen Privilegien verteidigen. Nur die ausgebeutete Klasse im Kapitalismus, die Klasse der Lohnabhängigen, die Arbeiterklasse, kann solch eine Umwälzung bewerkstelligen. Diese Klasse ist nicht die einzige, die unter Armut, Ausbeutung und Unterdrückung leidet. Überall auf der Welt gibt es unzählige kleine Bauern, die ebenso ausgebeutet werden und oft unter noch größerer Armut leben als die ArbeiterInnen in dem jeweiligen Land. Aber deren Stellung in der Gesellschaft ermöglicht es ihnen nicht, den Aufbau der neuen Gesellschaft in Angriff zu nehmen, obwohl sie auch an solch einer Umwälzung interessiert wären. Zunehmend durch dieses System in den Ruin getrieben, neigen diese kleinen Produzenten dazu, das Rad der Geschichte zurückdrehen, zu den ‘gesegneten’ Zeiten zurückkehren zu wollen, als sie noch von ihrer eigenen Arbeit leben konnten, und als die großen Agrar- und Lebensmittelmultis ihnen noch nicht den Hals zudrehten. Bei den lohnabhängig Produzierenden des modernen Kapitalismus verhält es sich anders. Die Wurzel ihrer Ausbeutung und ihrer Misere ist die Lohnarbeit, d.h. die Tatsache, dass sich die Produktionsmittel in den Händen der Kapitalisten (egal ob im Privat- oder Staatsbesitz) befinden, und das einzige Mittel zum Broterwerb und um ein Dach über dem Kopf zu haben darin besteht, ihre Arbeitskraft den Kapitalisten zu verkaufen. Die Abschaffung der Ausbeutung verlangt somit die Überwindung der Lohnarbeit, d.h. der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft. Mit anderen Worten es gibt eine tiefgreifende Bestrebung der Klasse der lohnabhängigen Produzenten – obwohl sich die Mehrheit der ArbeiterInnen dessen noch nicht bewusst ist – zur Überwindung dieser Trennung zwischen Produzenten und Produktionsmitteln, die den Kapitalismus auszeichnet, und die Warenbeziehungen, durch welche sie ausgebeutet werden, abzuschaffen, und die immer wieder als Rechtfertigung für all die Angriffe auf ihre Lebensbedingungen benutzt werden, weil man den Kapitalisten zufolge « wettbewerbsfähig » sein müsse. Die Arbeiterklasse muss also die Kapitalisten enteignen, gemeinsam die Produktion auf der ganzen Welt in die eigene Hand nehmen, um die Bedürfnisse der Menschheit tatsächlich zu befriedigen. Dies wäre eine wirkliche Revolution. Dabei wird diese aber unvermeidbar mit all den Organen zusammenstoßen, die der Kapitalismus zu seinem Schutz und zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft geschaffen hat, in erster Linie die Staaten, die Repressionskräfte, aber auch den gesamten ideologischen Apparat, der den Ausgebeuteten jeden Tag eintrichtern soll, es gebe keine Alternative gegenüber dem Kapitalismus. Die herrschende Klasse ist fest entschlossen, mit allen Mitteln diese große gesellschaftliche Revolution zu verhindern, vor denen die Herrschenden alle Heidenangst haben.
Die Aufgabe ist zugegebenermaßen gewaltig. Die Kämpfe der jüngsten Zeit gegen die Zuspitzung der Armut in Ländern wie Griechenland oder Spanien sind nur die erste Etappe, die notwendig ist für die Vorbereitung des Proletariats zur Überwindung des Kapitalismus. In ihren Kämpfen, in ihrer Solidarität, in ihrer Vereinigung, in ihrer Bewusstwerdung über die Notwendigkeit und Möglichkeit der Überwindung eines immer bankrotteren Systems, werden die Ausgebeuteten die notwendigen Waffen schmieden für die Überwindung des Kapitalismus und den Aufbau einer von Ausbeutung, Armut , Hunger und Kriegen befreiten Gesellschaft.
Der Weg ist lang und schwierig, aber es gibt keinen anderen. Die wirtschaftliche Katastrophe, deren Ausmaße wir jetzt deutlicher sehen, und die in den Reihen der Herrschenden solche großen Sorgen auslöst, wird für all die Ausgebeuteten auf der ganzen Welt eine schreckliche Verschlechterung ihrer Existenzbedingungen mit sich bringen. Aber die Krise wird die Ausgebeuteten auch dazu zwingen den Weg zur Revolution und der Befreiung der Menschheit einzuschlagen. Fabienne, Dez. 2011
Aktuelles und Laufendes:
- Staatsbankrott [44]
- Eurokrise [303]
- Kapitalismus bankrott [376]
- Alternative zum Kapitalismus [377]
Occupy Zürich: Wenn Erschöpfung in eine Bewegung einzieht
- 1896 Aufrufe
„Macht Vorschläge für einen gerechteren Kapitalismus“ – Stolpersteine der Demokratie
Wie in New York und anderen Städten in den USA wurde am 15. Oktober der Paradeplatz in Zürich zu einem mit Zelten besetzten Camp, das aber unter Räumungsandrohung durch die Polizei nach 2 Tagen in den zentral gelegenen Lindenhof-Park umgesiedelt wurde. Die Occupy-Bewegung in Zürich war von Beginn weg nicht mit direkter Repression konfrontiert, wie wir sie in Spanien erlebten, aber umso mehr mit der Politik der versuchten Integration, wie sie typisch ist für die herrschende Klasse in der Schweiz, die mittels der „direkten Demokratie“ jeglichen Widerstand gegen den Kapitalismus abzufedern versucht. Gerade in der Schweiz hat die herrschende Klasse aus den Ereignissen zu Beginn der 80er Jahren gelernt, dass sie nicht allein mit Brutalität soziale Bewegungen unterdrücken kann, sondern vor allem mit Angeboten zur Beteiligung am System.
Die Chefs der Banken und die Regierung gaben sich scheinheilig verständnisvoll für die Anliegen der Occupy-Bewegung. Occupy-Aktivisten wurden sofort in eine der wichtigsten politischen Fernsehsendungen eingeladen, um dort zusammen mit führenden Bankern und Professoren über mögliche Wege zur Verbesserung des Finanzsystems nachzudenken, denn selbst die Herrschenden können sich heute nicht ausschliesslich in eine arrogante Haltung kleiden, dass „alles gut laufe“. Die Angriffe der bürgerlichen Presse gegenüber Occupy beschränkten sich in dieser Anfangsphase vor allem auf das angebliche Fehlen „konkreter“ politischer Vorschläge.
Wenn die Occupy-Bewegung im Enthusiasmus des Beginns auf Angebote wie die des staatlichen Fernsehens eingegangen ist, dann vor allem in der Hoffnung auf mehr Popularität. Die Vollversammlungen gegen Ende Oktober schafften es dennoch meist, diese Falle der „konkreten Forderungen“ zur Verbesserung des kapitalistischen Finanzsystems zu durchschauen und sich nicht ins Räderwerk der klassischen demokratischen Mitsprache einbinden zu lassen. Es war unübersehbar, dass in den Reihen der Bewegung durch Individuen geäusserte Illusionen in demokratische Reformen die Runde machten, wie es bei allen sozialen Bewegungen und auch bei Arbeitskämpfen der Lohabhängigen Normalität ist. Da Occupy aber vor allem eine Bewegung des kollektiven Nachdenkens und Verstehens ist, die durch die kapitalistische Finanzmisere entzündet wurde; weil sie mit unglaublich komplexen und globalen politischen Fragen konfrontiert ist, auf die es auch keine schnellen Lösungen anzubieten gibt; weil sie nicht wie andere soziale Bewegungen in der Vergangenheit auf den Wunsch nach Freiräumen fixiert ist - aus diesen Gründen überlebte bis Mitte Dezember 2011 innerhalb der Occupy-Bewegung in der Schweiz die Sichtweise, dass wir uns durch die bürgerliche Politik nicht zu etwas drängen lassen sollen, auf das wir keine Antwort haben.
Für die herrschende Klasse schien es gängiger, die Bewegung als Ganzes erst einmal zu tolerieren und auf ihre Erschöpfung zu warten, als sie sofort ins demokratische Spiel integrieren zu können oder niederzuknüppeln. Nebst der fast neuartig solidarischen Diskussionskultur, die versuchte, alle zu Wort kommen zu lassen, war es in der Anfangsphase der Monate Oktober und November sicher eine grosse Stärke der Bewegung, sich die Prämisse zu setzen: „Nehmen wir uns Zeit für unsere Diskussionen und lassen wir uns nicht drängen!“
Das Camp – die Bewegung als Ganzes – Ausweitung?
Das Zeltcamp auf dem Lindenhof, gut organisiert und einladend für alle, die sich beteiligen wollten, wurde (neben den samstäglichen Vollversammlungen auf dem Paradeplatz) in Kürze organisch zum eigentlichen Zentrum der Diskussionen der Occupy-Bewegung. Wie in der Bewegung der Indignados in Spanien erlaubte die kollektive Besetzung von öffentlichem Raum einen Rahmen, in dem sich die Bewegung treffen konnte. Sehr schnell wurden aber trotz der offenen Haltung der direkt im Camp lebenden Aktivisten zwei Dynamiken sichtbar: 1. Das Entstehen einer eigenständigen Camp-Gemeinschaft, an der sich nur Personen beteiligen konnten, welche genügend Zeit und Durchhaltevermögen hatten, ihr Leben an diesen Ort zu verlagern – für die meisten Leute mit Familie und Lohnarbeit kaum möglich. 2. Die Dominanz der alltäglichen Sorgen rund um die Aufrechterhaltung und Organisierung des Camps, über den Freiraum zur politischen Diskussion – den eigentlichen Ursprung der Occupy-Bewegung. Diese Situation wurde von den Besetzern nicht frei gewählt und kann ihnen auch nicht zum Vorwurf gemacht werden, sie wurde ihnen durch die objektive Schwierigkeit, eine lebenswerte Camp-Infrastruktur zu gewährleisten, aufgezwungen, vor allem aber auch durch die permanent drohende Räumung durch den Repressionsapparat der Polizei. Im Gegensatz zum Zuccotti Park in New York ging die Bewegung in Zürich als Ganzes nicht so weit, in die Dynamik eines nach innen gerichteten Park-Fetischs zu verfallen, sie machte sich in Vollversammlungen intensiv Gedanken darüber, wie die Bewegung auf den Rest der „99%“ zugehen kann.
Ausdruck dieses Bestrebens nach Ausweitung war unter anderem eine Vollversammlung am Abend des 3. November, welche den Innenhof der Universität für eine kollektive Diskussion besetzte, um auch die StudentInnen direkt einzuladen. Befreit von den Alltagssorgen des Camps wurden die wöchentlichen Vollversammlungen an der Universität während 5 Wochen zu ermutigenden kollektiven Momenten des Nachdenkens über allgemeine politische Fragen. Dem Auftauchen von Positionen, die sich der Bewegung absurd als „Führung“ anboten oder sie fatalistisch als „illusionär“ bezeichneten, waren die Plenarversammlungen fähig, ihren selbstorganisierten Gemeinschaftsgeist entgegenzuhalten. Doch die Empörung und Kampfbereitschaft unter den StudentInnen war nicht genug hoch, um eine Verbindung der Anliegen der Occupy-Bewegung mit ihren eigenen Sorgen auszulösen. Selbst wenn die erhoffte grosse Beteiligung der Studierenden ausblieb (2009 war an der Universität in Zürich eine Bewegung ausgebrochen), bildeten diese als „Inhalts-Vollversammlungen“ bezeichneten Abende, an denen auch neue Gesichter auftauchten, eine Bereicherung, die klar machte, dass die Occupy-Bewegung nicht direkt mit dem Camp gleichgesetzt werden kann. Occupy hatte versucht, konkrete Schritte zur Ausbreitung der Bewegung zu machen.
In Zukunft sollte eine Bewegung es aber gerade aufgrund des positiven Momentes solcher „Inhalts-Vollversammlungen“ vermeiden, die grundlegenden politischen Diskussionen aus der allgemeinen Vollversammlung an die „Inhalts-Vollversammlungen“ zu delegieren - genauso wie das politische Leben auch nicht ausschliesslich in die Arbeitsgruppen verlegt werden darf. Im Gegenteil sollte sich die allgemeine Vollversammlung die Zeit nehmen, gemeinsam und in Ruhe Raum für die Klärung grundlegender politischer Fragen der Bewegung zu bleiben. Occupy Zürich, stark vom Aktivismus geprägt, rutschte ab Dezember aber immer mehr ins Problem ab, allgemeine Vollversammlung abzuhalten, die ein ermüdendes Durchpauken zahlreicher organisatorischer Detailfragen wurden.
Aufbruchsgeist – Ernüchterung - Individualisierung
Der Aufbruchsgeist, den die ersten grossen Mobilisierungen im Oktober und November auf dem Zürcher Paradeplatz manifestierten, hat sich gelegt. Occupy ist nicht tot, wie die schmierige bürgerliche Boulevardpresse Ende Dezember mit dem Slogan „Bye Bye Occupy“ den Protest gegen die Krise und die Finanzinstitute beerdigen wollte. Aber die Beteiligung an den Vollversammlungen hatte im Dezember rapide abgenommen. Das Zelt-Camp war zudem von der Polizei schon am 15. November geräumt und den Aktivisten waren Moral zermürbende Geldstrafen auferlegt worden. In der ersten Vollversammlung 2012, am 4. Januar, an der sich rund 70 Personen beteiligten, wurde von mehreren Teilnehmern festgestellt, dass „wir immer weniger geworden sind“. Occupy hatte sich innerhalb eines Monates deutlich aus einer spontanen, zahlreiche Leute mobilisierenden Bewegung zu einem Kern von Aktivisten zurück entwickelt, der versucht, mit allen Kräften fast tägliche Aktivitäten aufrecht zu erhalten.
Es war auch ein deutlich anderer Wind in die Diskussionskultur der Vollversammlung eingezogen: Die ursprünglich beeindruckende gegenseitige Geduld und das Zuhören innerhalb der Bewegung litten nun unter Ermüdung, Ungeduld, Spannungen und dem Gefühl, bei Entscheiden übergangen zu werden. Es entwickelte sich eine Dynamik, welche die zunehmende Isolation durch einen Aktivismus zu kompensieren versuchte, der sich aber immer deutlicher nur auf die individuellen Kapazitäten und den guten Willen einzelner Aktivisten abstützte, und nicht auf eine tragende kollektiven Perspektive. Occupy Zürich klammerte sich an die zahlreichen Aktivitäten, die aber mit schwindenden Kräften kaum mehr aufrecht erhalten werden können, wie es in der Vollversammlung die Diskussion über den Informationsstand auf einem öffentlichen Platz am Stauffacher zeigte. Zwar ehrlich gemeinte, aber fast verzweifelte Appelle an die Disziplin - auf der eine soziale Bewegung, die sich das Ziel der Emanzipation der Menschheit setzt, nicht basieren kann, weil dies schlussendlich der individualisierten Moral der kapitalistischen Gesellschaft gleichkommt - führten lediglich zu Spannungen.
Es ist ein bekanntes Phänomen von sozialen Bewegungen, dass Höhenflüge des Beginns schnell in Frustration umschlagen können, wenn eine Bewegung vom Rest der ArbeiterInnenklasse isoliert bleibt. Die Frage der Isolation bildet einen Kernpunkt in solchen Bewegungen. Der ersichtliche Park-Fetisch im New Yorker Zuccotti-Park war aber nicht Grund einer beginnenden Isolation von Occupy Wall Street, sondern vielmehr Ausdruck davon. Es gibt keine „Rezepte für das Überleben“ einer Bewegung wie Occupy, denn wie andere soziale Bewegungen entspringt sie nicht einer aktivistischen Machbarkeit, sondern einer politischen Gärung innerhalb der Gesellschaft aufgrund der objektiven Lebensbedingungen. Doch um Enttäuschungen über die eingetretene Durststrecke zu begrenzen, ist es für die Vollversammlungen wichtig, sich die internationale Dynamik von Occupy zum Thema zu machen und die Situation in anderen Städten und Ländern zu besprechen – eine Diskussion, die Occupy Zürich bisher allzu sehr unterschätzt hat.
Eine andere Dynamik wurde an der Vollversammlung vom 4. Januar ebenfalls sichtbar: Es hatten sich in den vergangenen 10 Wochen auch unterschiedlichste Vorstellungen und v.a. Wünsche herausgeschält, was Occupy sein soll - an sich kein Wunder in einer sozialen Bewegung, die so offen ist. Diese Heterogenität über Inhalt und Perspektiven einer Bewegung ist in der Phase des Anwachsens oft ein stimulierender Faktor, da er interessante Diskussion auslöst. Doch in einer Phase der Ernüchterung, aber vor allem dann, wenn es zusätzlich nicht gelingt, gemeinsam die gemachten Erfahrungen zu bilanzieren, droht die Gefahr eines unreflektierten aktivistischen Auseinandergehens in verschiedenste Richtungen. Die Vollversammlung vom 4. Januar hatte stark den Charakter einer Präsentation und Absegnung von Aktions-Projekten, in die sich Aktivisten zum Teil sehr individuell gestürzt hatten. In einem solchen Moment ist es ergiebiger, sich die Fragen zu stellen wie: „Was wollen wir?“, „Was sind unsere gemeinsamen Kräfte?“, „Was sind die Gründe für den Rückgang der Bewegung?“
Debattenkultur – eine „permanente“ Bewegung? – Bündnisse als Rettungsanker?
Die Notwendigkeit für die Engagierten in Occupy Zürich, sich aufgrund der Ermüdung und des Zusammenschrumpfens auf einen Kern von Aktivisten ganz grundsätzliche Fragen zu stellen, zeigte sich auch deutlich in den ersten zwei Januarwochen 2012 anhand der Frage der Häufigkeit von Vollversammlungen. Die Sorge eines sehr engagierten Aktivisten trotz Ermüdungserscheinungen, die Zahl der Vollversammlungen nicht auf einmal pro Woche zu reduzieren, konnte unbefriedigend diskutiert werden. Was sich in dieser Diskussion zeigte, war ein Widerspruch, der in einer sozialen Bewegung in einer Phase des Rückgangs kaum gelöst werden kann: das Aufrechterhalten häufiger Vollversammlungen als Herzstück der Bewegung einerseits und die fehlende Kraft und Beteiligung an der Bewegung andererseits. In der Vollversammlung am 4. Januar wurde diese Frage schlicht anhand des „Ermüdungsbarometers“ entschieden (ab sofort nur einmal pro Woche Vollversammlung), was nur realistisch und vernünftig erschien. Aber es war absolut korrekt, dass ein Engagierter am folgenden Tag der Vollversammlung gegenüber eine schriftliche Kritik formulierte: „Der Konsensentscheid Vollversammlungen nur noch einmal in der Woche durchzuführen war kein Konsensentscheid sondern ein Mehrheitsentscheid. Ich hatte mich von Anfang an klar dagegen ausgesprochen, die Häufigkeit der Vollversammlungen weiter zu reduzieren, jedoch wurde auf meine Argumente kaum eingegangen und meine Bedenken ignoriert. In einer Runde, in der jeder im Kreis seine Meinung sagte, stellte sich heraus, dass eine Mehrheit dafür war, weniger Vollversammlungen abzuhalten, was schlussendlich dazu geführt hatte, dass ich, als ich meine Position weiter vertreten wollte, von allen niedergeschrien worden bin. Leider wurden zwei Kompromissvorschläge ohne Diskussion verworfen. Ich muss mich an dieser Stelle bei denjenigen, die die Kompromissvorschläge gemacht haben entschuldigen, ich hatte in dieser Situation, von allen Seiten unter Druck gesetzt, die Vorschläge nicht ohne meine Emotionen zu kontrollieren überdacht und sie deshalb voreingenommen abgelehnt. Das tut mir Leid. Im Nachhinein denke ich dass beide Potential gehabt hätten, hätte man sie ausführlich diskutieren können.“ Was er hier verteidigt, ist nicht die blinde Losung eines hohen Rhythmus von Vollversammlungen, ungeachtet der Dynamik der Bewegung, sondern die Aufrechterhaltung der Diskussionskultur. Die Konsens-Methode der Occupy-Bewegung, auch wenn sie die latente Schwäche hat, oft verfrüht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner als Resultat einer Diskussion auszuloten, und damit oft auch notwenige Polarisierungen verdrängt, hatte es zumindest in der Anfangsphase einladend erlaubt, allen Meinungen Platz einzuräumen. Es ist klar, dass manchmal konkrete Entscheide gefällt werden müssen, auch wenn nicht alle einverstanden sind. Doch wenn Mehrheitsentscheide gefällt werden, soll diese nicht grundsätzlich das Ende einer Diskussion darüber bedeuten. An der Vollversammlung vom 11. Januar fand leider das Anliegen des oben zitierten Engagierten unter der erdrückenden Menge von Informationen und Aktionspunkten ebenfalls keinen Platz, obwohl er mit seiner Kritik an der veränderten Debattenkultur den Kern des Problems ansprach.
Es ist schwer zu sagen, wohin Occupy geht. Doch die Vollversammlung vom 11. Januar hatte deutlich eine Tendenz enthalten, sich von einer Bewegung hin zu einer politischen Gruppierung zu wandeln, welche aber die Auffassung der Möglichkeit einer „permanenten Bewegung“ in sich trägt. Gleich wie Kämpfe um Arbeitsbedingungen und gegen Lohnabbau im heutigen Kapitalismus keinen permanenten Charakter haben können, ohne in gewerkschaftliche Suche nach faulen Kompromissen und Stellvertreterpolitik abzugleiten, lauern auch auf Occupy ähnliche Gefahren. Die Vollversammlung vom 11. Januar zeigte dies deutlich: Aufgrund der momentan verlorenen eigenen Stärke und Dynamik wurden Stimmen für Bündnisse mit linken Gruppierungen wie den Jungsozialisten oder Greenpeace lauter, wohl in der Hoffnung, damit wieder stärker zu werden. Als Beispiel dafür liess sich die Vollversammlung von einem an sich unbedeutenden Angebot zur punktuellen Zusammenarbeit mit einer spirtuell-politischen Gruppe richtiggehend jagen. Anstelle auf die Autonomie der eigenen Bewegung zu bauen und die Fragen, die wirklich anstehen, zu besprechen, liess sich die Vollversammlung zu einer Diskussion zwingen, heute und sofort zu einem Entscheid über ihr Verhältnis gegenüber dieser Gruppe, und zu religiösen Gruppen im Allgemeinen, zu gelangen. Eine Diskussion, die an sich interessant sein, in solcher von aussen auferlegter Hast aber nie geführt und geklärt werden kann, und die schon den Vorgeschmack wohlbekannter linksbürgerlicher Politik erahnen liess. Die zu Beginn der Bewegung mit einem gesunden Reflex zurückgewiesene Erpressung von Seiten der herrschenden Klasse, sich zu „konkreten Forderungen“ zur Verbesserung des Finanzsystems durchzuringen, also der Druck zu einer Positionierung im Rahmen der bürgerlichen Politik, schleicht sich so unbemerkt durch die Hintertür wieder in die Bewegung hinein.
Wenn Occupy nicht aufgesplittert und verloren gehen will in bürgerlichen parlamentarischen Vorstössen zur „Offenlegung der Finanzierung der politischen Parteien“ oder demokratiegläubigen Initiativen gegen die Lebensmittelspekulation, so wie es an der Vollversammlung von einzelnen Teilnehmern als ihre politischen Projekte angekündigt wurde, dann sollte sie sich wieder auf die Frage des Beginns zurückbesinnen: Weshalb diese Krise im Kapitalismus? Sie sollte sich die Frage stellen, ob all diese Probleme, die von den Engagierten in der Occupy-Bewegung mit beeindruckender Sensibilität wahrgenommen werden, innerhalb des Kapitalismus eine Lösung finden – oder ob es an der Zeit ist, diese Produktionsweise als Ganzes zu überwinden. Da es keine sozialen Bewegungen gibt, die permanent bestehen, und auch Occupy nicht die letzte sein wird, ist es wichtig, all die positiven Erfahrungen von Occupy in die Zukunft anderer sozialer Bewegungen mitzunehmen, falls Occupy keinen frischen Wind mehr bekommen sollte. Die Sackgasse des Kapitalismus, der Auslöser von Occupy, wird sicher nicht verschwinden. Versuche des Zusammengehens mit den Anliegen von Lohnabhängigen, wie es ansatzweise mit den Beschäftigten der Elektrizitätswerke in London oder deutlicher in Oakland der Fall war, werden für die Zukunft wohl die besten „Bündnispartner“ und eine wirkliche Verstärkung sein. Mario 16.1.2012
Aktuelles und Laufendes:
- Occupy Zürich [378]
Weltrevolution Nr. 171
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 297.88 KB |
- 2027 Aufrufe
„Demokratisierung des Kapitalismus? Wir müssen ihn überwinden!“
- 1486 Aufrufe
Eine Ausrichtung, die in den Bewegungen immer wieder zu hören war, lautete: „Wir müssen den Kapitalismus demokratisieren“. Natürlich wird diese Ausrichtung von den Medien, den linken Parteien, den Gewerkschaften, kurz allen systemtragenden Kräften gefördert. Warum hat dieser Slogan „Für einen demokratischeren Kapitalismus“ soviel Erfolg? Dass in den arabischen Ländern mit ihren Machthabern, die oft seit Jahrzehnten die Zügel der Macht in der Hand hielten, diese Forderung soviel Anhänger fand, ist leichter verständlich. Und selbst in Europa, der Wiege der Demokratie, richtete sich die Wut vieler gegen die Führungselite“ einiger „reicher, korrupter, unehrlicher“ Politiker (Sarkozy, Berlusconi)). In Spanien, wo im Mai 2011 die Bewegung der Empörten losbrach, als die Herrschenden unsere Aufmerksamkeit auf die anstehenden Wahlen lenken wollten, konnte man sehr oft hören: „Rechte und linke Parteien, der gleiche Mist“.
Was bedeutet dies? Die Idee breitet sich immer mehr aus, dass überall auf der Welt, unter allen Regierungen an allen Orten die « gleiche Scheiße » praktiziert wird. Was haben die jüngsten „demokratischen Wahlen“ in Ägypten und Spanien geändert? Nichts! Was hat der Rücktritt Berlusconis in Italien oder Papandreous und in Griechenland bewirkt? Die Sparmaßnahmen wurden noch mehr verschärft und sind heute unerträglich geworden. Ob Wahlen oder nicht, die Gesellschaft findet sich fest in der Hand einer herrschenden Minderheit, die ihre Privilegien aufrechterhält – auf Kosten der Mehrheit. Dies ist die tieferliegende Bedeutung des Slogans „Wir sind die 99% und ihr die 1%“, der von der Occupy-Bewegung in den USA in Umlauf gebracht wurde. Eine wachsende Zahl von Leuten ist nicht mehr bereit, sich auf der Nase rumtanzen zu lassen und die Sachen in die eigene Hand zu nehmen. Die Idee gewinnt an Auftrieb, dass die Massen die Gesellschaft organisieren müssen. Der Slogan „Alle Macht den Vollversammlungen“ bringt dieses Begehren zum Ausdruck, dass eine Gesellschaft aufgebaut werden soll, in der nicht mehr eine Minderheit über unser Leben entscheidet.
Aber die Frage ist: können wir diese neue Gesellschaft mittels eines Kampfes um die „Demokratisierung des Kapitalismus“ erreichen?
Ob diktatorisch oder demokratisch - der Kapitalismus bleibt ein Ausbeutungssystem
Es stimmt, von einer Minderheit von Privilegierten beherrscht zu werden, ist unerträglich. Es stimmt, wir müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Aber wer ist „wir“? In der Antwort der meisten Beteiligten der gegenwärtigen Bewegung heißt „wir“ „jeder und jedermann“. „Jeder“ sollte die gegenwärtige Gesellschaft, d.h. den Kapitalismus, mittels einer wirklichen Demokratie führen. Aber an dieser Stelle tauchen die Probleme auf: gehört der Kapitalismus nicht den Kapitalisten? Stellt dieses Ausbeutungssystem nicht das Wesen des Kapitalismus selbst dar? Wenn die Demokratie in ihrer heutigen Form die Beherrschung der Welt durch eine Elite bedeutet, geschieht das dann nicht, weil diese Welt und diese Demokratie sich in den Händen dieser Elite befinden? Wenn wir die Argumentation bis zu ihrem Ende führen und uns einen Augenblick eine kapitalistische Gesellschaft vorstellen, die von einer perfekten und idealen Demokratie regiert wird, in der „jeder“ über alles kollektiv entscheiden würde, was würde sich dann ändern? Gibt es nicht in einigen Ländern wie der Schweiz und anderswo so etwas wie „Volksabstimmungen“! Eine Ausbeutungsgesellschaft zu lenken, heißt aber nicht die Ausbeutung abzuschaffen. In den 1970er Jahren forderten Arbeiter oft Arbeiterselbstverwaltung. „Ein Leben ohne Arbeitgeber, wir nehmen die Produktion in die Hand und zahlen uns die Löhne selbst aus!“ In den betroffenen Betrieben – wie zum Beispiel Lip in Frankreich – haben die Beschäftigten es am eigenen Leib erfahren: sie haben die Leitung des Betriebs in die eigene Hand genommen. Aber aufgrund der erbarmungslosen, unausweichlichen Mechanismen des Kapitalismus waren sie – den Gesetzen der Marktwirtschaft folgend – dazu gezwungen, sich selbst auszubeuten, schlussendlich sich selbst zu entlassen, und all das auf eine sehr „demokratische“ Weise. Eine auch noch so „demokratische“ Regierungsform im Kapitalismus würde nichts zum Aufbau einer neuen, ausbeutungsfreien Gesellschaft beitragen. Die Demokratie ist im Kapitalismus kein Organ zur Eroberung der Macht durch die Arbeiterklasse oder der Überwindung des Kapitalismus. Die Demokratie ist ein Herrschaftsmittel zur Verwaltung des Kapitalismus. Um die Ausbeutung zu überwinden, gibt es nur eine Lösung – die Revolution.
Wer kann die Welt verändern? Wer kann die Revolution durchführen?
Immer mehr Leute träumen von einer Gesellschaft, in der die Menschheit ihr Schicksal in die Hand genommen hat, eigenständig Entscheidungen treffen kann und nicht mehr zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten gespalten ist. Aber die Frage ist, wer diese Gesellschaft aufbauen kann? Wer kann es möglich machen, dass in der Zukunft die Menschheit ihr Schicksal in die eigene Hand nimmt? Jeder? Natürlich nicht! Denn nicht « jeder « hat ein Interesse daran, den Kapitalismus aus der Welt zu schaffen. Die führenden Kreise der herrschenden Klasse werden alles daransetzen, um ihr System und ihre herrschende Stellung aufrechtzuerhalten; dazu ist sie bereit, ein endloses Blutvergießen hinzunehmen, auch in den „großen Demokratien“. Ebenso wenig haben die Gewerbetreibenden, die Führungskreise der Oberschicht, die Grundbesitzer, Kleinbürgerliche ein Interesse daran, denn diese wollen entweder nur ihren Lebensstandard, den ihr diese Gesellschaft bietet, aufrechterhalten oder – wenn sie von einer Herabstufung bedroht sind – sie schwelgen idealisieren nostalgisch die Vergangenheit. Die Überwindung des Privateigentums haben sie sich sicherlich nicht auf die Fahnen geschrieben.
Um die Kontrolle über ihr eigenes Leben auszuüben, muss die Menschheit den Kapitalismus überwinden. Aber nur die Arbeiterklasse kann dieses System aus der Welt schaffen. Die Arbeiterklasse umfasst die Beschäftigten aus den Fabriken und Büros, ob privat oder staatlich beschäftigt, die Rentner und jüngeren Beschäftigten, Arbeitslose und prekär Beschäftigte. Diese Arbeiterklasse stellt die erste Klasse in der Geschichte dar, die gleichzeitig ausgebeutet und revolutionär ist. In früheren Gesellschaften hatte der Adel einen revolutionären Kampf gegen die Sklavenwirtschaft geführt, schließlich die Bürgerlichen gegen den Feudalismus. Jedesmal wurde ein Ausbeutungssystem aus der Welt geschafft, dieses aber immer wieder durch ein neues Ausbeutungssystem ersetzt. Heute können die Ausbeuteten in Form der Arbeiterklasse dieses System überwinden und eine Welt errichten, in der es keine Klassen und Landesgrenzen geben wird. Keine Landesgrenzen, weil unsere Klasse eine internationale Klasse ist. Sie leidet überall unter der gleichen Last des Kapitalismus; sie hat überall die gleichen Interessen. Von 1848 an hat unsere Klasse diesen Schlachtruf übernommen: „Die Arbeiter haben kein Vaterland. Arbeiter aller Länder vereinigt Euch“. All diese Bewegungen der letzten Monate – von den arabischen Ländern über die Empörten bis zu den Occupyern, - berufen sich in der einen oder anderen Form auf den Kampf der anderen in all diesen Ländern und beweisen, dass es keine Grenze für den Kampf der Ausgebeuteten und Unterdrückten gibt. Aber diese Protestbewegungen werden von einer großen Schwäche geprägt: die treibende Kraft der Ausgebeuteten, die Arbeiterklasse, hat noch nicht ihr Selbstbewusstsein erlangt. Sie ist sich ihrer Existenz, ihrer Stärke, ihrer Fähigkeit, sich als Klasse zu organisieren, noch nicht bewusst. Deshalb geht sie in diesem Meer von Leuten unter, und sie wird selbst Opfer der ideologischen Fallen, die unter der Forderung „für einen demokratischeren Kapitalismus“ in Erscheinung tritt.
Damit die internationale Revolution siegreich verlaufen und eine neue Gesellschaft aufgebaut werden kann, muss sich unsere Klasse in Bewegung setzen. Ihr Kampf, ihre Einheit, ihre Solidarität… und vor allem ihr Klassenbewusstsein sind von Nöten. Dazu muss sie in ihren Reihen die breitest möglichen Debatten und lebendigsten Diskussionen anstoßen, um ihr Begreifen der Welt, dieses Systems, des Wesens ihres Kampfes vorantreiben. Die Debatten müssen allen offenstehen, die auf die vielen Fragen antworten liefern wollen, vor denen die Ausgebeuteten stehen: Wie den Kampf entfalten? Wie können wir uns selbst organisieren? Wie können wir der Repression entgegentreten? Und wir müssen entschlossen gegenüber denjenigen auftreten, die Werbung für die herrschende Ordnung machen. Es darf wirklich nicht darum gehen, diese dahinsiechende, barbarische Gesellschaft zu retten oder zu reformieren. In einer gewissen Hinsicht spiegelt dies die Demokratie Athens in einem umgekehrten Sinne wider. Im antiken Griechenland war in Athen die Demokratie das Privileg der Sklavenbesitzer, der männlichen Bürger, die anderen Schichten der Gesellschaft waren davon ausgeschlossen. In dem revolutionären Kampf der Arbeiterklasse wird die größte Freiheit herrschen, aber davon werden nicht diejenigen profitieren, die daran interessiert sind, die kapitalistische Ausbeutung aufrechtzuerhalten.
Die Bewegungen der Empörten und der Occupyer wollen wirklich debattieren. Sie spiegeln diese unglaubliche Wallung, die Kreativität der handelnden Massen wider, die unsere Klasse auszeichnen, wenn diese kämpft, wie wir es z.B. im Mai 1968 gesehen haben, als man an allen Straßenecken diskutierte. Aber heute wird diese schöpferische Kraft verwässert, gar gelähmt aufgrund ihrer Unfähigkeit, von ihrem Kampf und ihren Debatten all diejenigen auszuschließen, die in Wirklichkeit mit Herz und Seele für die Aufrechterhaltung des Systems einsetzen. Wenn wir eines Tages die Produktion für Profit und Ausbeutung und die Repression erfolgreich aus der Welt schaffen und Herr über unser eigenes Leben werden wollen, werden wir nicht umhin können, diese illusorischen Aufrufe der „Demokratisierung des Kapitalismus“ und der Schaffung eines „humaneren Kapitalismus“ zu verwerfen IKS, Januar 2012
Aktuelles und Laufendes:
- Bewegung der Empörten [380]
- Occupyer [381]
- Demokratisierung Kapitalismus [382]
2011: Von der Empörung zur Hoffnung
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 108.99 KB |
- 1982 Aufrufe
Die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2011 waren die Verschärfung der globalen Krise des Kapitalismus und die sozialen Bewegungen in Tunesien, Ägypten, Spanien, Griechenland, Israel, Chile, USA, GB…(1).
Die Empörung hat eine internationale Dimension angenommen
Die Folgen der kapitalistischen Krise sind für die große Mehrheit der Weltbevölkerung sehr hart: die Lebensbedingungen verschlechtern sich, die Arbeitslosigkeit nimmt immer größere Ausmaße an und deren Dauer nimmt zu; die Prekarisierung, welche ein Mindestmaß an Stabilität verhindert, frisst sich immer tiefer; extreme Armut und Hunger greifen um sich…
Millionen von Menschen sehen mit großer Sorge, wie die Möglichkeit eines „stabilen und normalen“ Lebens, einer „Zukunft für unsere Kinder“ dahinschwindet. Das hat eine tiefgreifende Empörung ausgelöst, einen Drang, die Passivität zu durchbrechen, Plätze und Straßen zu besetzen, Fragen hinsichtlich der Ursachen der Krise zu diskutieren, die sich seit fünf Jahren extrem verschärft hat.
Die Empörung wurde noch einmal verstärkt durch die Arroganz, die Habsucht und die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden der Mehrheit der Bevölkerung, die von Bankern, Politikern und anderen Repräsentanten der Kapitalistenklasse an den Tag gelegt wird. Aber auch durch die Hilflosigkeit, welche die Regierungen gegenüber den schwerwiegenden Problemen der Gesellschaft offenbaren: ihre Maßnahmen verschärfen nur die Armut und die Arbeitslosigkeit ohne irgendeine Lösung zu bieten.
Die Bewegung der Empörten hat sich international ausgedehnt. In Spanien hat sie ihren Ausgang genommen, wo die sozialistische Regierung eines der ersten und drakonischsten Sparprogramme durchboxte; dann in Griechenland, dem Symbol der Schuldenkrise; in den USA, dem Tempel des Weltkapitalismus; in Ägypten und Israel, zwei Frontstaaten in einem der schlimmsten und längsten imperialistischen Konflikte des Nahen Ostens.
Das Bewusstsein, dass es sich um eine globale Bewegung handelt, breitet sich weiter aus trotz des zerstörerischen Gewichtes des Nationalismus, der Anwesenheit von Leuten, die Nationalfahnen in den Demonstrationen in Griechenland, Ägypten und den USA schwenkten. In Spanien wurde die Solidarität mit den ArbeiterInnen in Griechenland durch Slogans zum Ausdruck gebracht wie: „Athen hält aus, Madrid erhebt sich“. Die Streikenden von Oakland (USA, November 2011) riefen: „Solidarität mit der Occupy-Bewegung auf der ganzen Welt“. In Ägypten wurde die Solidaritätserklärung von Kairo zur Unterstützung der Bewegung in den USA verabschiedet. In Israel wurde gerufen: „Netanjahu, Mubarak, el Assad – gleiche Bande“ – man nahm Kontakt zu palästinensischen Beschäftigten auf.
Gegenwärtig ist der Höhepunkt dieser Kämpfe überschritten, und obwohl es Anzeichen von neuen Kämpfen (Spanien, Griechenland, Mexiko) gibt, fragen sich viele, „wozu hat diese Protestwelle der Empörung gedient“, „haben wir etwas gewonnen?“
Es ist notwendig, eine Bilanz zu ziehen, um sowohl auf die positiven Seiten als auch auf die Schwächen und Grenzen einzugehen.
“Besetzen wir die Plätze” – gemeinsamer Slogan der Bewegung
Seit mehr als 30 Jahren gab es nicht mehr solche breitgefächerten, vielfältigen Initiativen wie die Besetzung von Straßen und Plätzen, um zu versuchen für die eigenen Interessen einzutreten und über die Illusionen und Verwirrungen hinauszugehen, die uns bremsen.
Diese Leute, ArbeiterInnen, Ausgebeutete, die als ‚gescheiterte, gleichgültige, apathische‘ Menschen dargestellt werden, ‚unfähig Initiativen zu ergreifen und irgendetwas gemeinsam zu machen‘, waren dazu in der Lage, sich zusammenzuschließen, gemeinsam Initiativen zu ergreifen und die nervende Passivität zu durchbrechen, zu der uns die Alltagsnormalität dieses Systems verurteilt.
Dies hat unserer Moral Auftrieb verliehen, das Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten verstärkt und wir haben angefangen, die Macht zu entdecken, die das gemeinsame Handeln der Massen freisetzt. Die soziale Atmosphäre wandelt sich. Das Monopol der Politiker, Experten, „großen Führer“ über die öffentlichen Themen wird langsam infragegestellt durch eine Vielzahl von unbekannten Menschen, die zu Wort kommen wollen. [2] [384].
Sicher ist das noch ein zerbrechlicher Ausgangspunkt. Die Illusionen, Verwirrungen, die unvermeidbaren Schwankungen der Gemütsverfassungen, die Repression, die gefährlichen Fallen, in welche die Repressionskräfte und der kapitalistische Staat uns locken wollen (die linken Parteien und die Gewerkschaften an der Spitze), werden Rückschritte und bittere Niederlagen bewirken. Wir stehen vor einem langen und schwierigen Weg, voll von Hindernissen und ohne Garantie des Sieges. Aber die Tatsache, dass wir angefangen haben uns in Bewegung zu setzen, ist der erste Sieg.
Die Versammlungen- das Herz der Bewegung
Die Versammlungen beschränkten sich nicht auf die passive Haltung, nur die Unzufriedenheit zu artikulieren, sondern es wurde eine aktive Haltung der Selbstorganisierung in den Versammlungen entwickelt. Die vielfältigen Versammlungen konkretisierten den Leitgedanken der I. Internationale (Internationale Arbeiterassoziation) von 1864: „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiter selbst sein“. Damit wird die Tradition der Arbeiterbewegung fortgesetzt, die mit der Pariser Kommune einsetzte und ihren Höhepunkt in Russland 1905 und 1917 erreichte, und sich in Deutschland 1918, Ungarn 1919 und 1956 und Polen 1980 fortsetzte.
Vollversammlungen und Arbeiterräte sind die wahre Organisationsform des Arbeiterkampfes und der Kern einer neuen Organisationsform der Gesellschaft.
Vollversammlungen, um sich massenhaft zusammenzuschließen, anzufangen, die Ketten zu zerschlagen, die uns an die Lohnsklaverei ketten, die Atomisierung, das „jeder für sich“ aufheben, die Isolierung im Getto des jeweiligen Bereiches oder gesellschaftlicher Kategorien zu überwinden.
Vollversammlungen, um gemeinsam nachzudenken, zu diskutieren und zu entscheiden; kollektiv Verantwortung zu übernehmen für die getroffenen Entscheidungen, mit Beteiligung aller an den Entscheidungen und bei der Umsetzung derselben.
Vollversammlungen um das gegenseitige Vertrauen, allgemeine Empathie, Solidarität aufzubauen, die nicht nur unentbehrlich sind um den Kampf vorwärtszubringen, sondern auch als Stützpfeiler einer zukünftigen klassenlosen, ausbeutungsfreien Gesellschaft dienen.
2011 gab es eine Explosion echter Solidarität, die nichts mit der heuchlerischen und eigennützigen „Solidarität“ zu tun hat, die die Herrschenden predigen: Demonstrationen in Madrid zur Befreiung der Inhaftierten oder zur Verhinderung der Festsetzung von Flüchtlingen durch die Polizei. Massenhaftes Zusammenkommen in Spanien, Griechenland und den USA, um Zwangsräumungen von Wohnungen zu verhindern. In Oakland (Kalifornien) hat „die Streikversammlung beschlossen, Streikposten zu anderen Betrieben zu entsenden und andere Betriebe oder Schulen zu besetzen, die Beschäftigte oder Studenten bestrafen, weil sie sich am Generalstreik des 2. November beteiligt haben.“ Es gab Augenblicke, zwar noch immer sehr sporadisch und von kurzer Dauer, in der sich alle unterstützt und geschützt fühlten durch die Gleichgesinnten, was im totalen Gegensatz steht zur „Normalität“ dieser Gesellschaft, in der ein Gefühl der Angst, Schutz- und Hilflosigkeit vorherrscht.
Die Debattenkultur ist das Licht, das die Zukunft erhellt
Das notwendige Bewusstsein, damit Millionen ArbeiterInnen die Welt umwälzen, kann nicht erreicht werden, indem wir erleuchteten Führern lauschen und deren Anweisungen folgen, sondern es entsteht aus einer Kampferfahrung, die von massenhaften Debatten begleitet und geführt wird, in dem die Erfahrung früherer Kämpfe berücksichtigt, aber auch der Blick nach vorne in die Zukunft gerichtet ist. Dies wurde durch Slogans in Spanien zum Ausdruck gebracht wie: „Ohne Revolution wird es keine Zukunft geben“.
Die Debattenkultur, die offene Diskussion, die von dem gegenseitigen Respekt und dem gegenseitigen, aufmerksamen Zuhören ausgeht, fängt nicht nur in den Vollversammlungen zu keimen an, sondern auch in deren Umkreis. Man hat angefangen, ambulante Bibliotheken, Treffen, Zusammenkünfte zu organisieren. Viele geistige Aktivitäten mit geringer technischer Ausrüstung wurden mit großem Improvisationstalent in den Straßen und Plätzen in Gang gesetzt. Und wie bei den Versammlungen bedeutet dies ein Wiederanknüpfen an die frühere Erfahrung der Arbeiterbewegung. „Der Drang nach Wissen, so lange unterdrückt, brach sich in der Revolution mit Ungestüm Bahn. Allein aus dem Smolny-Institut gingen in den ersten sechs Monaten täglich Tonnen, Wagenladungen Literatur ins Land. Rußland saugte den Lesestoff auf, unersättlich, wie heißer Sand das Wasser. Und es waren nicht Fabeln, die verschlungen wurden, keine Geschichtslügen, keine verwässerte Religion oder der billige Roman, der demoralisiert – es waren soziale und ökonomische Theorien, philosophische Schriften, die Werke Tolstois, Gogols und Gorkis ...“ (John Reed, „10 Tage, die die Welt erschütterten“, 1. Kapitel).
Gegenüber der Kultur dieser Gesellschaft, die vorgibt für “Erfolgsmodelle” zu kämpfen, die aber immer wieder millionenfach scheitern, gegen die entfremdenden Stereotypen und Verfälschungen, welche die herrschende Ideologie und die Medien uns einzutrichtern versuchen, haben Tausende Personen angefangen, eine wirkliche Kultur des Volkes zu entwickeln, die von ihnen selbst getragen wird, mit dem Bestreben, nach eigenen kritischen und unabhängigen Maßstäben vorzugehen. Dabei kamen Themen wie die Krise und ihre Wurzeln, die Rolle der Banken usw. auf die Tagesordnung. Ebenso wurde über die Revolution diskutiert, wobei alle möglichen Auffassungen zu diesen Fragen auftauchten, die eine Menge Verwirrungen zum Ausdruck bringen. Es wurde über Demokratie und Diktatur geredet. Dabei entstanden die sich ergänzenden Sprüche: „Sie nennen es Demokratie, aber es ist keine“ und „Es ist eine Diktatur, aber man sieht sie nicht“.
Die ersten Schritte wurden unternommen, damit eine wahre Politik der Mehrheit in Gang kommt, die nichts zu tun hat mit der Welt der Intrigen, Lügen und dem Fischen in trüben Gewässern, all den Machenschaften, die die Politik der herrschenden Klasse auszeichnen. Bei dieser Vorgehensweise werden all die Themen angepackt, die uns betreffen – nicht nur die Bereiche Wirtschaft oder Politik, sondern auch die Umweltzerstörung, Ethik, Kultur, Erziehung, Gesundheitswesen.
Die Zukunft liegt in den Händen der Arbeiterklasse
Wenn die vorhin aufgezeichnete Entwicklung des Jahres 2011 dieses zu einem Jahr des Beginns der Hoffnung macht, müssen wir dennoch einen nüchternen, hellsichtigen und kritischen Blick auf die Bewegungen werfen, um ihre Grenzen und Schwächen zu erkennen, die noch sehr groß sind.
Während eine wachsende Zahl von Menschen auf der ganzen Welt erkennt, dass der Kapitalismus ein überholtes System ist, und “damit die Menschheit leben kann, der Kapitalismus überwunden werden muss”, reduzieren viele den Kapitalismus immer noch auf eine Handvoll „Übel“ (rücksichtslose Finanzhaie, erbarmungslose Diktatoren), obwohl er ein komplexes Netz von gesellschaftlichen Beziehungen ist, die insgesamt tiefgreifend umgewälzt werden müssen. Man darf sich nicht durch seine mannigfaltigen Erscheinungen (Finanzen, Spekulation, Korruption der Führer der Wirtschaft und Politik) in die Irre führen lassen, sonst verzettelt man sich.
Obwohl wir die Gewalt, welche aus allen Poren des Kapitalismus strömt (Repression, Terror und Terrorismus, moralische Barbarei) verwerfen müssen, darf man nicht glauben, dass dieses System nur mit Hilfe eines friedlichen Drucks der „Bürger“ über Bord geworfen werden könnte. Die herrschende Klasse, die eine Minderheit darstellt, wird ihre Macht nicht freiwillig aufgeben; sie verschanzt sich hinter einem Staat, dessen demokratische Spielart sich mit Wahlen legitimiert, die alle vier oder fünf Jahre stattfinden. Er stützt sich auf Parteien, die Sachen versprechen, welche sie nie einhalten und Sachen tun, die sie vorher nie angekündigt haben. Ein weiterer Stützpfeiler sind die Gewerkschaften, die mobilisieren um zu demobilisieren und alles unterzeichnen, was die herrschende Klasse ihnen auf den Tisch zur Unterschrift vorlegt. Nur ein massiver, hartnäckiger, und mit Ausdauer geführter Kampf kann den Ausgebeuteten die notwendige Kraft verleihen, um die Unterdrückungsmittel zu zerstören, mit denen der Staat sich am Leben hält. Nur so können sie den Slogan umsetzen, der in Spanien immer wieder zu hören ist: „Alle Macht den Versammlungen“.
Obwohl der Slogan “Wir sind die 99%“ (gegenüber der Minderheit von 1%), welcher in den USA in der Occupy-Bewegung so populär wurde, durchschimmern lässt, dass man langsam die tiefen Klassenspaltungen erkennt, mit denen wir leben, hat sich die Mehrheit der Teilnehmer der Protestbewegung eher als „Bürger von Unten“ betrachtet, die nach Anerkennung in einer Gesellschaft streben, in der „freie und gleiche Bürger“ leben.
Aber die Gesellschaft ist in Klassen gespalten. Auf der einen Seite gibt es eine Kapitalistenklasse, die die Produktionsmittel besitzt und nichts produziert; auf der anderen Seite eine ausgebeutete Klasse, die Arbeiterklasse, die alles produziert und immer ärmer wird. Der Motor der gesellschaftlichen Entwicklung ist nicht das demokratische Spiel der „Entscheidung durch eine Mehrheit der Bürger“ (dieses Spiel stellt eher die Maske dar, welche die Diktatur der herrschenden Klasse verschleiert und legitimiert), sondern der Klassenkampf.
Die soziale Bewegung muss sich um den Kampf der wichtigsten ausgebeuteten Klasse – die Arbeiterklasse - als Bezugspunkt ausrichten, denn diese produziert gemeinsam die Hauptreichtümer der Gesellschaft und stellt das Funktionieren des gesellschaftlichen Lebens sicher: Fabriken, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, Universitäten, Büros, Häfen, Bauindustrie, Transport, Post usw. In einigen Bewegungen des Jahres 2011 konnte man ansatzweise ihre Stärke erahnen: die Kampfwelle, die in Ägypten losbrach, und Mubarak zum Rücktritt zwang. In Oakland (Kalifornien) riefen die „Occupyer“ zu einem Generalstreik auf, der Hafen wurde lahmgelegt, und man rief die Beschäftigten des Hafens und LKW-Fahrer zu aktiver Unterstützung auf. In London kamen die streikenden Elektriker und die Besetzer der Saint Paul Kathedrale zu gemeinsamen Aktionen zusammen. In Spanien gab es bei den Versammlungen auf Plätzen Bestrebungen zur Vereinigung bestimmter, im Kampf befindlicher Bereiche.
Es gibt keinen Gegensatz zwischen dem Klassenkampf des modernen Proletariats und den tiefgreifenden Bedürfnissen der gesellschaftlichen Schichten, die unter der kapitalistischen Unterdrückung leiden. Der Kampf des Proletariats ist keine egoistische Bewegung, sondern die Grundlage „der selbständigen Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehrzahl“ (Kommunistisches Manifest, MEW, Bd 4, S. 472).
Indem die Erfahrung von zwei Jahrhunderten Arbeiterkampf kritisch aufbereitet wird, können die gegenwärtigen Bewegungen aus den früheren Kämpfen und Befreiungsversuchen lernen. Der Weg ist lang und voll von Hindernissen. Daraus entstand in Spanien der immer wieder gehörte Slogan: „Wir bewegen uns nicht langsam, wir reisen weit“ „No es que vamos despacio, es que vamos muy lejos“. Wir müssen so breit und tiefgehend wie möglich debattieren, ohne Vorbehalte und Angst, damit wir zielstrebig eine neue Bewegung vorbereiten. Nur so können die Grundlagen gelegt werden für eine neue, andere Gesellschaft als der Kapitalismus. IKS 12.3.2012
[1] [385] Siehe “Die Wirtschaftskrise ist keine endlose Geschichte. Sie kündigt das Ende eines Systems und den Kampf für eine neue Welt an“, in International Review Nr. 148. Zusammenhängend mit der globalen Krise des Systems verdeutlichte Fukushima die riesigen Gefahren, vor denen die Menschheit steht.
[2] [386] Es ist aufschlussreich, dass Times Magazine als “Person des Jahres” Protestteilnehmer an der Bewegung der “Empörten” gewählt hat www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2101745_2102132_2102... [387].
Aktuelles und Laufendes:
- Sozialproteste weltweit [360]
- Bilanz Proteste 2011 [388]
2012: Hin zur Verschärfung der sozialen Gegensätze
- 1543 Aufrufe
Auch wenn die Entschlossenheit, sich gegen die Krise zur Wehr zu setzen, und die Proteste und Abwehrkämpfe in den einzelnen Ländern noch ein sehr unterschiedliches Niveau aufweisen, ist dieser Trend in immer mehr Ländern deutlich erkennbar: von Südafrika, wo in den Platin-Minen von Implats mehrere Tausend Arbeiter wild streikten, über Indien (siehe dazu den Artikel in dieser Ausgabe) und China, wo immer wieder Streiks und andere Proteste aufflammen, oder die Occupy-Bewegung in den letzten Monaten in mehreren Industriestaaten, bis hin zu den fortdauernden Abwehrkämpfen in Griechenland.
Spanien – hin zu einer neuen Stufe?
Die Entwicklung in Spanien während der letzten Monate ist dabei besonders aufschlussreich. Während im Mai letzten Jahres die Bewegung der Indignados (Empörten) hauptsächlich eine Protestbewegung ohne konkretere Forderungen war, bei der man auf öffentlichen Plätzen seine Wut über die Verhältnisse zum Ausdruck brachte, gleichzeitig viele die Hoffnung auf eine „Demokratisierung des Systems“ hegten, war diese Bewegung von 2011 vor allem dadurch geprägt, dass zwar eine allgemeine Atmosphäre des Protestes aufblühte, aber aus den Betrieben war relativ wenig Widerstand zu vernehmen. Eine Protestbewegung mit viel Debatten und Initiativen auf den öffentlichen Plätzen, mit generationenübergreifender Beteiligung, ohne sichtbar treibende Kraft beherrschte das Bild. Die Medien berichteten teilweise gar relativ ausführlich über diese Proteste.
Die Proteste der letzten Wochen deuten darauf hin, dass es mehr Initiativen seitens der ArbeiterInnen – ob beschäftigt oder arbeitslos - gibt, die darauf drängen zusammenzukommen. Das Potenzial, ökonomische und politische Fragen des Kampfes miteinander zu verknüpfen, wächst. Der Schwerpunkt liegt bislang im Bereich des öffentlichen Dienstes und im Widerstand gegen staatliche Sparprogramme. Vor allem in Barcelona, Bilbao, Valencia, Castellon und Alicante fanden im Januar und Februar eine Reihe von Protesten statt. Die meisten Proteste stehen im Vergleich zu 2011 noch stark unter gewerkschaftlicher Kontrolle, aber die Tendenz zu Eigeninitiativen nimmt zu, vor allem im Erziehungswesen. Darüberhinaus steigt die Zahl der Beteiligten an Demonstrationen. Am 18. Januar protestierten Gewerkschaftsangaben zufolge mehrere Zehntausend in Barcelona gegen Kürzungen im öffentlichen Dienst. Unsere GenossInnen, die vor Ort anwesend waren, berichten, dass die Teilnehmer mehr als zuvor anfingen, miteinander zu diskutieren, anstatt sich wie bislang üblich passiv und abwartend zu verhalten. Es waren Leute aus verschiedenen Orten der Umgebung zusammengekommen, verschiedene Altersgruppen waren vertreten. Die meisten betonten die Notwendigkeit, dass die Belegschaften aus den Betrieben in Versammlungen und Demonstrationen zusammenkommen müssen. Teilnehmer schilderten Schwierigkeiten, Vollversammlungen gegen den Widerstand der Gewerkschaften abzuhalten. Die Offenheit gegenüber politischen Gruppen war beeindruckend. Viele Teilnehmer wollten unser Flugblatt haben, um es weiterzuverteilen. Am 21. Januar protestierten in Valencia ca. 80.000, in Alicante 40.000 gegen Kürzungen im Bildungswesen, am 26. Januar zogen erneut ca. 100.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Valencia, 50.000 in Alicante, 20.000 in Castellon auf die Straße. In den Stadtvierteln entwickeln sich auch viele Initiativen. In Madrid protestierten Feuerwehrleute und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. 10.000 Menschen solidarisierten sich in Vigo (Nordspanien) mit den Beschäftigten des Schiffsbaus. In Alicante kommen viele LehrerInnen in Nachbarschaftsversammlungen zusammen. In Vollversammlungen, die allen Beschäftigten offenstehen, diskutieren Beschäftigte des Gesundheits- und Bildungswesen, der Gasversorgung usw. miteinander. In Valencia protestieren Eltern, Kinder und Lehrpersonal gegen Kürzungen im Bildungswesen. Wiederum in Valencia wurden in verschiedenen Stadtteilen „Stadtteilversammlungen“ gebildet, in denen die Proteste des Bildungswesens koordiniert werden. Immer mehr stoßen an einzelnen Orten auch Arbeitslose dazu. In mehreren Städten fanden Solidaritätsversammlungen mit den ArbeiterInnen in Griechenland statt. Mitte Februar schließlich gingen Gewerkschaftsangaben zufolge in Madrid über 500.000 Menschen auf die Straße; 450.000 in Barcelona; 300.000 in Valencia. Selbst aus relativ kleinen Städten, wie dem asturianischen Gijón, wurden 50.000 Teilnehmer gemeldet. Die Polizei bestätigte jeweils nur ein Zehntel der von den Gewerkschaften gemachten Angaben. Die Wut richtet sich gegen die jüngsten Sparbeschlüsse der Regierung: Im Falle einer Kündigung müssen den Angestellten nicht mehr wie früher 45 Tage Lohn, sondern nur noch 33 Tage pro Jahr Betriebszugehörigkeit gezahlt werden. Verzeichnen die Betriebe rückläufige Einnahmen, sind es sogar nur noch 20 Tage.
Indem nun mehr Widerstand und Protest aus den Betrieben kommt und mehr Belegschaften in Demonstrationszügen auf der Straße oder bei Protestveranstaltungen in Erscheinung treten, entwickelt sich die Möglichkeit, dass der Widerstand einen Dreh- und Angelpunkt bekommt. In der Polarisierung zwischen Kapital und Arbeit ist es wichtig, dass man sich „einem Pol zugehörig“ fühlt, sozusagen von ihm angezogen wird. Solange die Belegschaften in den Betrieben ruhig bleiben, fehlt dieser Bezugspunkt. Dies ist ein wesentlicher Faktor. Gleichzeitig erfahren wir von Spanien, dass dort in Versammlungen (in den Stadtteilen und anderswo) viele Diskussionen stattfinden über die Perspektiven des Kapitalismus. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung für einen qualitativen Schritt in den Auseinandersetzungen. Während ja in den jüngsten Protesten noch stark der Ruf nach „Demokratisierung des Kapitalismus“ zu vernehmen war, muss der Klärungsprozess deutlich werden lassen, dass nur die Überwindung des Systems eine Lösung bietet. Sicher reifen diese Elemente – der Aufbau eines Selbstvertrauens durch die eigene Erfahrung im Kampf und die Identifizierung mit der Klasse sowie die Erkenntnis, dass die Krise systembedingt ist und nur durch die Überwindung des Systems überwunden werden kann – nicht sehr schnell heran. Sie entstehen nicht im Schnelldurchgang; deren Reifung verläuft keineswegs geradlinig sondern äußerst gewunden, und immer wieder mit Rückschritten.
Deutschland- wie durch ein Wunder verschont?
Während die Krise zwar mehr als je zuvor eine internationale, weltweite Krise ist, ist offensichtlich, dass die Bedingungen für die ArbeiterInnen noch immer von Land zu Land ziemlich unterschiedlich sind.
In den USA
und Frankreich sorgt zum Beispiel im Augenblick der Wahlkampf stark für
Ablenkung – trotz einer äußerst brutalen Verschlechterung der Lage der
ArbeiterInnen. In einem anderen Schlüsselland, Deutschland, ist die Lage sehr
heterogen. Während auf der einen Seite aufgrund der rapide um sich greifenden
Verarmung der Einzelhandel über sinkenden Konsum klagt, bislang immer mehr
Geschäfte schließen – der Fall der Niedrigstlohnkette Schlecker ist nur der
spektakulärste in den letzten Wochen -, werden auf der anderen Seite in den
exportorientierten Betrieben fette Sonderprämien gezahlt. So haben z.B.
Autohersteller zwischen 4.000 (Daimler), 7.500 (VW) und 8.000 (Audi) Euro
Bonuszahlungen für die Beschäftigten angekündigt. Während also in den meisten
europäischen Ländern drastische Lohnkürzungen vorgenommen werden, werden in
Deutschland Sonderzahlungen in einigen Branchen ausgezahlt. Und dennoch –
gleichzeitig stehen bei Siemens, Opel, Osram und anderswo massive
Stellenstreichungen und gar Werksschließungen zur Diskussion. Die deutschen
Exportrekorde werden nämlich nicht ewig halten, dann wird auch die Talfahrt der
Weltwirtschaft im Land der Exportrekorde zu spüren sein. Die Abhängigkeit des
deutschen Kapitals vom Weltmarkt ist enorm (je nach Branche sogar über 50%),
und auch bei weiteren Finanzdesastern wäre das deutsche Kapital mit am meisten
betroffen. All das bedeutet, dass die Arbeiterklasse in der Zukunft dann umso
heftiger angegriffen werden wird. 19.03.2012
Der Teufelskreis der Krise
- 2079 Aufrufe
100-10=X
100-4= Y
Diese einfachen Rechenaufgaben lernen SchülerInnen ab dem zweiten Grundschuljahr. Leider gibt es Kinder, die schon mit diesen simplen Aufgaben Schwierigkeiten haben, wie z.B. PISA-Untersuchungen immer wieder zeigen. Zugegeben, wenn ein paar Nullen hinzukommen und es sich bei den Zahlen um Millionen oder Milliarden handelt, kann man sich viel schneller verrechnen, auch wenn sich an der Grundrechenart nichts ändert. Nun wurde in einem jüngsten PISA-Test eine besonders diffizile Aufgabe gestellt. Es ging um den Zusammenhang zwischen der Beherrschung der Grundrechenarten, wirtschaftliches Verständnis, Logik und einem durch die SchülerInnen zu ermittelnden Faktor. Die Frage lautete. „Wenn die Anfangskaufkraft 100% beträgt, diese um 10% reduziert wird, hat die Kaufkraft infolgedessen zu- oder abgenommen?“ Nahezu alle SchülerInnen konnten diese Frage ohne Probleme beantworten. Auf die Zusatzfrage aus dem Bereich Wirtschaft, ob das massive Absaugen von Kaufkraft zu einer Ankurbelung der Wirtschaft führen könne, konnten auch hier die meisten SchülerInnen die Frage schnell und richtig beantworten. Anschließend sollten die SchülerInnen die Aussagen von Politikern, Unternehmern usw., dass „nur ein striktes Sparen, eine Kürzung der Löhne usw. die Wirtschaft wieder ans laufen bringe“, mit ihren eigenen Antworten vergleichen. In dem PISA-Test konstatierten nahezu alle SchülerInnen ein eklatantes Auseinanderklaffen zwischen ihren Ergebnissen und den Aussagen der Politiker. Die Frage, wie man dieses Auseinanderklaffen zwischen den elementarsten Ergebnissen der Mathematik, Logik und den „Versprechen“ der Politiker und Unternehmer erklären kann, wird zur Zeit unter den SchülerInnern heiß diskutiert…
Scherz beiseite, was ist dran an den „Lösungsvorschlägen“ der Herrschenden?
Griechenland: Sparen und Verarmung – ein Weg aus der Krise?
„Allein im Jahr 2010 schrumpfte das griechische BIP um 4,5 Prozent, bis zum zweiten Jahresdrittel 2011 um weitere 7,5 Prozent, während die Verschuldung des Landes bis März 2011 bereits auf über 340 Milliarden Euro wuchs.[1] Die Arbeitslosigkeit, die Ende 2009 etwa 9,6 Prozent betrug, ist auf 16,3 Prozent gestiegen; unter den 15- bis 29-Jährigen ist sogar fast jeder Dritte erwerbslos. Den im europäischen Vergleich schlecht bezahlten staatlichen Angestellten wurden ihre Bezüge im Schnitt um 30 bis 40 Prozent gekürzt, sämtliche Rentner des Landes mussten Einschnitte in Höhe von etwa 20 Prozent hinnehmen. Branchentarifverträge dürfen mittlerweile unterlaufen werden, die absolute Untergrenze von etwa 740 Euro Bruttolohn für eine Vollzeitstelle gilt für neu eingestellte junge Erwachsene unter 25 Jahren nicht mehr. Sie müssen mit knapp 600 Euro im Monat auskommen - brutto.“
Griechenland mit seinen ca. 20% Arbeitslosen ist nur ein Beispiel einer Entwicklung, die sich immer mehr Bahn bricht in einer Reihe von europäischen Staaten. In Irland ist die Arbeitslosigkeit auf 14%, in Portugal auf 12%, in Spanien auf über 25% angestiegen – mit jeweils umfangreichen Sparprogrammen. Italien, Großbritannien, Belgien usw. folgen auf den Plätzen. In einem großen Teil Europas also überall Sparen, Kaufkraft schrumpfen… Wachstumsrückgang, Zusammenbruch der Märkte.
Das erinnert an die Zeit der 1930er Jahre, als der damalige Kanzler Brüning nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise die öffentlichen Ausgaben um 30% kürzte, die Steuern erhöhte, die Löhne und Sozialleistungen radikal gesenkt wurden, die Arbeitslosen und noch Beschäftigten mit viel weniger Geld in der Tasche ums Überleben kämpften. Das Bruttosozialprodukt schrumpfte 1931 um 8%, 1932 um 13%, die Arbeitslosigkeit schnellte auf über 30%. Die weitere Entwicklung ist bekannt. Dem Kapital gelang es nicht, die Wirtschaft aus dem Schlamassel zu ziehen. Der Krieg war die Folge.
Deutschland: Niedriglöhne, Verarmung und Spaltung
Mitte März wurde eine neue Studie zum Lohnniveau in Deutschland veröffentlicht. „Knapp acht Millionen Menschen in Deutschland müssen einer Studie zufolge mit einem Niedriglohn [389] von weniger als 9,15 Euro brutto pro Stunde auskommen. Ihre Zahl sei zwischen 1995 und 2010 um mehr als 2,3 Millionen gestiegen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf eine Untersuchung des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen. Demnach sind etwa 23 Prozent - fast ein Viertel der Beschäftigten - im Niedriglohnsektor tätig. Laut der Studie bekamen die Niedrigverdiener im Durchschnitt im Jahr 2010 6,68 Euro im Westen und 6,52 Euro im Osten. Von ihnen erhielten mehr als 4,1 Millionen weniger als sieben Euro, gut 2,5 Millionen weniger als sechs Euro und knapp 1,4 Millionen nicht einmal fünf Euro die Stunde. Knapp jeder Zweite der niedrig bezahlten Menschen arbeitet dabei voll und nicht Teilzeit. So gibt es nach den Berechnungen allein fast 800.000 Vollzeitbeschäftigte, die weniger als sechs Euro kassieren können. Sie kommen auf einen Monatslohn unter 1000 Euro brutto.
Stark gestiegen ist die Zahl der Niedrigbezahlten vor allem in Westdeutschland. Der Studie zufolge wuchs sie in 15 Jahren in den alten Bundesländern um 68 Prozent, im Osten dagegen nur um drei Prozent. Die große Mehrheit der knapp acht Millionen Betroffenen habe aber einen Beruf erlernt.“(https://www.stern.de/wirtschaft/job/einkommen-in-deutschland-jeder-viert... [390]e)
Wenn in Deutschland vom Jobwunder und hohen Beschäftigungszahlen die Rede ist, liegt einer der Gründe in der brutalen Senkung der Löhne, welche Lohnabhängige oft dazu zwingt, neben einer ersten schlecht bezahlten Stelle noch eine weitere schlecht bezahlte zu suchen. Selbst das „Manager-Magazin“ musste zugeben: „Das ist die hässliche Seite des Jobbooms: Viele neue Stellen entstanden hierzulande in den Vorjahren auch deshalb, weil die Löhne für die Tätigkeiten gering waren. Jetzt wird das Ausmaß der Billigjobs offenbar - aber auch, wie stark Nebenjobber diesen Boom befeuern.“ www.manager-magazin.de/politik/artikel/a-821203.html [391]. „So erhalten z.B. auch viele Leiharbeiter in Automobilfabriken, die immer wieder neue Absatzrekorde vermelden, gerademal 7.5 Euro, während Beschäftigte der Stammbelegschaft bis 18 Euro erhalten.“
All die Beteuerungen seitens des Staates und des Unternehmerlagers, „Sparen bringt die Wirtschaft wieder ans Laufen“, ändern nichts an der Tatsache: Reduziert man die Kaufkraft durch Lohnsenkungen, streicht man von Sozialleistungen usw., senkt man die Nachfrage. Die Folge: noch mehr produzierte Waren bleiben unverkauft, der Konkurrenzdruck für die Unternehmen wächst, Rationalisierungszwang und Preiskrieg verschärfen sich. Die Betriebe sind gezwungen, noch mehr Personal abzubauen oder zu entlassen. Der Staat nimmt noch weniger Steuern ein und muss noch mehr Geld für die Unterhaltung der Arbeitslosen ausgeben. Das Wachstum wird nicht angeschoben, sondern schrumpft; die Konsequenz: noch weniger Schuldenabbau… Diese Methode löst nur eine Kettenreaktion aus. In Wirklichkeit verschlimmert also die ganze Sparpolitik nur noch die Krise und führt das System nicht aus der Sackgasse.
Der Teufelskreis der Verschuldung und des Sparens
Der andere „Lösungsansatz“ – zusätzliche Kaufkraft schaffen durch künstliche Nachfragestimulierung in Form von Billigkrediten, Verschuldung usw. hat aber ebenso Schiffbruch erlitten. Diese Politik wurde während der letzten Jahrzehnte systematisch betrieben.
Die Folge. In dem führenden Industriestaat, der einzig verbliebenen Supermacht USA, melden immer mehr Kommunen Bankrott an, immer mehr Bundesstaaten bewegen sich in diese Richtung. Die Kapitalisten fallen ebenso wie Räuber über die Lohnabhängigen her. Einige Beispiele: „New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg, ein Milliardär, hat für den Haushalt 2012 bereits drastische Sparmaßnahmen verordnet, darunter Entlassungen in vielen städtischen Behörden, die nächtliche Schließung von 20 Feuerwehrkommandos, gekürzte Öffnungszeiten für Bibliotheken und Kulturzentren sowie die Entlassung von 6000 Lehrern im Juni. Trotzdem droht, laut dem Büro des Bürgermeisters, eine Etatlücke von 4,4 Milliarden Dollar.“ (URL: www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/a-806026.html [392])
Nachdem im Sommer 2011 eine Insolvenz des Staates drohte, konnte die Regierung mit einer weiteren Erhöhung der Schuldengrenze und angekündigten drastischen Streichungen die Insolvenz erst einmal aufschieben. "Die Bundesregierung in Washington kann Geld drucken, die Bundesstaaten können ihre Budgetprobleme auf die Städte abwälzen. Doch die müssen Insolvenz anmelden, weil sie die Defizite nicht weiterreichen können." (ebenda) So beschreibt Stephanie Gomes, eine Stadträtin in Vallejo, die drohende fiskalische Kettenreaktion in den USA. „Die malerische Stadt Vallejo mit 115.000 Einwohnern in den Hügeln gegenüber von San Francisco kehrte in diesem Sommer 2011 nach drei Jahren aus der Insolvenz zurück. Etwas verkürzt lautet die fiskalische Wiederauferstehung so: Die Hälfte der Feuerwehrleute wurde heimgeschickt, ein Drittel der Polizisten entlassen, Bibliotheken und Parks geschlossen, zahlreiche öffentliche Dienstleistungen - darunter für Senioren - eingestampft. (…) Staatliche Pensionen gelten plötzlich doch nicht mehr als unantastbare Leistung, die selbst einer kommunalen Insolvenz standhält.“ Die bankrotte Stadt Central Falls in Rhode Island hat jahrelang in die Pensionsfonds von Feuerwehrleuten, Polizisten und anderen Beamten keine Beiträge eingestellt. Nun wird ein Teil der 47 Millionen Dollar Zusagen für Pensionen gestrichen, um den Banken Zinsen zahlen zu können. Bereits 82 Pensionäre der Stadt haben sich mit Kürzungen ihrer Renten um bis zu 55 Prozent einverstanden, berichten die Zeitungen in der ärmsten Stadt von Rhode Island.“ (ebenda).
Selbst die gigantischsten Konjunkturankurbelungsprogramme und Verschuldungspraktiken können den Bankrott nur aufschieben, bis der Zeitpunkt kommt, wo sowohl Zahlungsunfähigkeit als brutale Sparprogramme anstehen.
So offenbaren all die Maßnahmen, die die Herrschenden ergreifen, um die Wirtschaftskrise zu überwinden, eigentlich nur die Ausweglosigkeit des Systems. Aus diesem Teufelskreis kann keine Maßnahme des Kapitals führen, sondern nur die Überwindung des Systems selbst. Die Herrschenden wiederum müssen immer mehr und unverfrorener lügen.
D, 18.03.2012
Hin zu Vollversammlungen in Indien
- 1780 Aufrufe
Aber die von den Gewerkschaften erhobenen Forderungen gehen von der Annahme aus, dass die kapitalistische Regierung Indiens in der Lage wäre, auf die Bedürfnisse anderer Klassen einzugehen. Auch verbreiten sie die Illusion, dass sie die Inflation eindämmen und den Verkauf von Staatsbetrieben einschränken könnte, was zum Vorteil der Arbeiter wäre. Die Wirtschaftskrise zeigt auch deutlich in Indien ihre Spuren. Die Umsätze der IT Industrie und Call-Center in Indien hängen bis zu 70% von US-Firmen ab. Diese Wirtschaftsbranche ist von der Krise schwer erfasst worden; sie wächst nicht mehr, die Profite brechen ein, überall wurden die Löhne gekürzt und Stellen gestrichen. Aber auch in anderen Branchen gibt es die gleiche Entwicklung. Die indische Wirtschaft kann sich nicht vor der Weltwirtschaftskrise abschirmen.
Bei diesem Streik zogen alle Gewerkschaften an einem Strang. Seit 1991 gab es 14 Generalstreiks. In der jüngsten Zeit jedoch haben immer mehr Beschäftigte eigenständig gehandelt anstatt auf gewerkschaftliche Anweisungen zu warten. Zum Beispiel beteiligten sich zwischen Juni und Oktober 2011 Tausende Beschäftigte an Fabrikbesetzungen, wilden Streiks und Protestlagern in Maruit-Suzuki und anderen Autofabriken in Manesat, einer „Boom town“ in der Nähe von New Delhi. Nach gewerkschaftlicher Übereinkunft mit den Arbeitgebern Anfang Oktober wurde der Vertrag für 1.200 Zeitarbeiter nicht verlängert. Darauf legten 3.500 Beschäftigte in einem spontanen Streik die Arbeit nieder und besetzten die Fließbänder aus Solidarität. Mehr als 8.000 Beschäftigte schlossen sich aus Solidarität in anderen Werken an. Dadurch wurden ebenso sit-in Proteste ausgelöst; Vollversammlungen wurden abgehalten, um sich der Sabotage durch die Gewerkschaften zu widersetzen.
Die Wiederentdeckung von Vollversammlungen als das wirksamste Mittel zur breitest möglichen Beteiligung von ArbeiterInnen und der größtmögliche Austausch von Ideen ist ein gewaltiger Fortschritt für den Kampf. Die Vollversammlungen bei Maruit-Sazuki in Manesar standen jedem offen, alle ArbeiterInnen wurden aufgefordert, sich an den Versammlungen zu beteiligen und die Führung und Ziele des Kampfes festzulegen. Daran beteiligten sich zwar nicht Millionen, aber sie machten klar, dass die Arbeiterklasse in Indien eindeutig ein Teil der gegenwärtigen internationalen Intensivierung des Klassenkampfes ist. Car. 3/3/12.
Aktuelles und Laufendes:
- Streiks Indien [393]
- Arbeiterkämpfe Indien [394]
- Vollversammlungen Indien [395]
Massenverarmung wie in Griechenland kommt auf uns alle zu
- 2023 Aufrufe
- Kürzung des Mindestlohns um 22% (er wird von 750 auf 480 Euro gesenkt) und eine Kürzung um 32% für die unter 25jährigen, mit Konsequenzen für all diejenigen, deren Einkommen durch die Entwicklung des Mindestlohns bestimmt wird – für viele Beschäftigte bedeutet dies eine Halbierung ihrer Löhne.
- 150.000 Stellen im öffentlichen Dienst werden in den nächsten zwei Jahren gestrichen, deren Löhne sollen auf 60% des bisherigen Niveaus gesenkt werden.
- Rentenkürzungen,
- Das Arbeitslosengeld wird auf ein Jahr beschränkt,
- keine automatischen Lohnanpassungen mehr, keine Berücksichtigung der Dauer der Betriebszugehörigkeit,
- Die Sozialausgaben werden gesenkt, dadurch werden die Gesundheitskosten für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr erstattet.
- Lohnabkommen werden in ihrer Dauer auf drei Jahre Laufzeit beschränkt.
Das ist noch nicht alles. Im November 2011 betrug die offizielle Arbeitslosigkeit 20.9% (ein Anstieg um 48.7% gegenüber dem Vorjahr). Die Arbeitslosenrate beträgt bei Jugendlichen in der Altersgruppe 18-25 Jahre 50%.
Innerhalb von zwei Jahren stieg die Zahl der Obdachlosen um 25%. Immer mehr Menschen wissen nicht wie sie sich ernähren sollen; es erinnert sie an die Hungertage des 2. Weltkriegs. Ein für ein NGO tätiger Arzt berichtete in Libération (30.1.12): „Ich wurde wirklich besorgt, als ich bei Arztbesuchen immer häufiger feststellte, dass immer mehr Kinder zu Arztbesuchen kamen, nachdem sie seit einiger Zeit nichts zu essen bekommen hatten.“
Die Zahl der Selbstmorde hat sich innerhalb von zwei Jahren verdoppelt, insbesondere junge Leute nehmen sich häufiger das Leben. Und die Zahl der an Depression Erkrankten ist sprunghaft angestiegen.
Aufgrund der breiten Ablehnung der jüngsten Sparbeschlüsse durch die Bevölkerung haben sich ca. 100 Parlamentsabgeordnete der Stimme enthalten oder mit Nein gestimmt; dazu gehörten auch ca. 40 Abgeordnete der beiden großen Parteien vom rechten und linken Flügel. Sie beugten sich nicht der von ihnen verlangten Parteidisziplin. Die Lage wird immer chaotischer, da die beiden traditionellen großen Parteien, die in der Zeit nach dem Krieg abwechselnd die Macht ausübten, total diskreditiert sind. Große Stimmenverluste für sie sind zu erwarten. Auf diesem Hintergrund wird es den Herrschenden schwer fallen, die für April angekündigten Parlamentswahlen zu ihren Gunsten durchzuführen.
Die Proteste in Griechenland haben zu Solidarisierungen und zu Eigeninitiativen der Betroffenen geführt. In vielen Stadtvierteln und in Dörfern kommen die Nachbarn zusammen. Die Besetzung der Novicki-Universität dient als Diskussionsforum. Ministerien wurden ebenso besetzt (so das Arbeits-, Gesundheits- und Wirtschaftsministerium), sowie Regionalbehörden, das Megalopolis Kraftwerk, das Rathaus in Holargos. Firmen haben Milch und Kartoffeln verteilt. Arbeiter haben die Zeitungsdruckerei Eleftherotypia, in der 800 Arbeiter beschäftigt sind, besetzt. Während des Streiks haben sie ihre eigene Zeitung gedruckt.
Schwächen und Illusionen der Bewegung
Aber die deutlichste Reaktion, die die Entschlossenheit der Bewegung in Griechenland zum Ausdruck bringt, spiegelt ebenso all ihre Schwächen und Illusionen wider. Dies wird anhand der Reaktion im Kilkis-Krankenhaus in Zentralmazedonien in Nordgriechenland ersichtlich. In einer Vollversammlung beschlossen die Beschäftigten in den Streik zu treten und das Krankenhaus zu besetzen, um ausstehende Löhne einzufordern. Sie stellten gleichzeitig Notoperationen und freie Behandlung für die Mittellosen sicher. Die Beschäftigten haben einen Aufruf an andere Beschäftigte verfasst: „Die einzig legitimierte, entscheidungsbefugte Instanz wird die Vollversammlung der Arbeiter sein.“ Wir haben diesen Aufruf auf unserer (englischen) Webseite veröffentlicht, weil dieser die Absicht zum Vorschein bringt, nicht isoliert bleiben zu wollen. Die Beschäftigten richten sich nicht nur an die Beschäftigten anderer Krankenhäuser, sondern an alle Beschäftigten, damit diese sich ihrem Kampf anschließen. Aber dieser Aufruf bringt auch viele demokratische Illusionen an den Tag, weil man sich auf „die Reaktionen der Bürger“ stützen möchte und auf eine schwammige Kraft wie „Arbeitergewerkschaften“, oder die „Zusammenarbeit aller Gewerkschaften und fortschrittlicher politischer Organisationen und wohl gesonnener Medien.“ Im Aufruf kommt ebenso eine Menge Patriotismus und Nationalismus zum Vorschein. „Wir sind entschlossen weiterzumachen, bis die Verräter, die unser Land verschachert haben, weg sind.“ Dies ist ein echtes Gift für die Kämpfe [1] [396].
Hier handelt es sich um eine Hauptschwäche der “Volksbewegung” in Griechenland. Sie steckt in der Fall des Nationalismus und nationaler Spaltungen, die von Politikern und Gewerkschaften systematisch verschärft werden. Alle Parteien und Gewerkschaften schimpfen zunehmend über den „verletzten Nationalstolz“. An erster Stelle steht dabei die KKE (die stalinistische Partei), die überall die nationalistische Karte spielt und die Regierung des Ausverkaufs des Landes beschuldigt und dass diese die Nation verraten habe. Sie behaupten, die Ursache der jetzigen Entwicklung sei nicht das kapitalistische System selbst, sondern es liege alles an Europa, Deutschland oder den USA.
Durch dieses Gift wird der Abwehrkampf der Klasse in den Grabenkrieg der nationalen Spaltungen hineingezogen, der wiederum ein Ergebnis kapitalistischer Spaltungspolitik ist. Dies ist nicht nur eine Sackgasse, sondern ein Haupthindernis für die unerlässliche Entwicklung des proletarischen Internationalismus. Wir haben kein Vaterland zu verteidigen. Unsere Kämpfe müssen sich ausdehnen und auf internationaler Ebene zusammenschließen. Es geht darum, dass die ArbeiterInnen anderer Länder ebenso in den Kampf treten und allen anderen vor Augen führen, dass die Antwort der Ausgebeuteten auf der ganzen Welt, die mit den Angriffen der Kapitalisten konfrontiert sind, nicht aus nationalistischer Sicht erfolgen darf, sondern nur mit einer internationalistischen Perspektive. W 18/2/12
Siehe auch: Workers take control of the Kilkis hospital in Greece [397]
"In order to liberate ourselves from debt we must destroy the economy" [398]
[1] [399] Die Erklärung der Besetzer der Athen Rechtsschule, die wir ebenso auf unserer (englischen) Webseite veröffentlicht haben, wendet sich direkt gegen alle nationalistischen und staatskapitalistischen „Lösungen“. Sie bezeichnen die ‚Schuldenkrise’ richtigerweise als einen Ausdruck der globalen Krise des Kapitalismus. Diese Auffassung spiegelt sicherlich die Meinung einer Minderheit in der gegenwärtigen Bewegung wider, aber diese Minderheit scheint an Zahl zuzunehmen.
Aktuelles und Laufendes:
- Massenverarmung [400]
- Sparpakete Griechenland [401]
- Verarmung Deutschland [402]
Russland: Demokratische Illusionen stören das Wachstum des Bewusstseins
- 1915 Aufrufe
Am 4. Dezember 2011 fanden in Russland die Parlamentswahlen statt. Der Wahlbetrug war so zynisch, dass sich Hunderttausende von Bürgern empörten. Zehntausende von Menschen nahmen an den Demonstrationen „für ehrliche Wahlen“ teil. In verschiedenen Städten des Landes gab es solche Demonstrationen. Man muss aber anmerken, dass die Mehrheit der Empörten sich mit demokratischen Illusionen für die Verbesserung des kapitalistischen Systems einsetzt, statt sich diesem mit den Mitteln des Klassenkampfes zu widersetzen.
Reiche und Arme zusammen auf der Straße
Die größten Demonstrationen fanden in Moskau statt, am 10. Dezember auf dem Balotnaia-Platz und am 24. Dezember in der Sacharov-Allee, wo die Anzahl der Teilnehmer_innen auf einige Zehntausend geschätzt wurde. An den Protesten nahmen verschiedene politische Kräfte teil. Man sah die Banner der Liberalen neben den roten Flaggen, die Nationalisten neben den rotschwarzen Fahnen der Anarchisten. Aber die Mehrheit der Teilnehmer_innen war keiner Organisation oder Tendenz zugehörig.
Die wichtigste Forderung der Demonstration war die nach „ehrliche Wahlen“. Viele Leute, die nicht politisch engagiert sind, wollten nichts anderes, als dass sich die Behörden den Gesetzen unterwerfen und friedliche, demokratische Veränderungen stattfinden. Im Allgemeinen hatte die große Masse kein offenes Ohr für revolutionäre Aufrufe oder radikale Aktionen.
Man muss auch sagen, dass die Zusammensetzung der Teilnehmenden buntscheckig war. Man fand Geschäftsleute, alte Mitglieder der Regierung (den ehemaligen Premierminister Mikhail Kassianov), Stars aus dem Showbusiness, bekannte Journalisten und sogar eine Vertreterin der High Society wie Xenia Sabchak, deren Vater Anatoli Sabchak als graue Eminenz von Putins Politik bezeichnet wird. Andererseits gab es viele gewöhnliche Leute: Büroangestellte, Student_innen, Arbeiter_innen, Rentner_innen, Arbeitslose ... Einigen Beobachtern zufolge war die Anzahl von Proletarier_innen in anderen Städten, abgesehen von Moskau und St. Petersburg, größer als in diesen.
Die Gründe der Proteste und die Reaktion des Kremls
Es steht außer Zweifel, dass die weltweite ökonomische Krise auch in Russland die Rolle des Katalysators in den Protesten gespielt hat. Trotz des von offizieller Seite propagierten Optimismus spüren die gewöhnlichen Leute je länger je mehr die Krise. Der Wahlbetrug der Parlamentswahlen von 2011 diente einzig als Vorwand für die Massenproteste. Die Forderung nach „ehrlichen Wahlen“ war das Leitmotiv fast aller Proteste, vom Fernen Osten bis zu den Zentren Russlands.
Das Internet ist die wichtigste Waffe der Opponenten Putins geworden. Im Internet kann man Hunderte, wenn nicht Tausende von Videos anschauen, auf denen laut ihren Herstellern der Wahlbetrug festgehalten ist. Im Übrigen hat aber niemand die Glaubwürdigkeit dieser Videos überprüft. Die Empörung hat im Wahlbetrug einen formellen Aufhänger gefunden. Wie wir oben schon gesagt haben, ist aber ihr wichtigster Grund die Unzufriedenheit von Millionen von Menschen über ihre Lebensverhältnisse.
Auf der anderen Seite wird von offizieller Seite behauptet, dass die Anschuldigungen des Wahlbetrugs haltlos seien. Der Kreml lancierte eine mediale Kampagne, in der behauptet wurde, die Proteste ständen unter dem Einfluss westlicher Agenten, die in Uncle Sam‘s Dienste arbeiteten.
Durch diese generelle Unzufriedenheit war Putin trotz allem gezwungen, gewisse Konzessionen zu machen. Zum Beispiel machte Medwedew gewisse demokratische Versprechen, namentlich dass die Gouverneure der Republiken wieder von den Bürger_innen gewählt werden sollen, welches Recht Putin unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung abgeschafft hatte.
Die demokratischen Illusionen
Es steht außer Zweifel, dass die Unzufriedenheit soziale Gründe hat. Russland geht wie andere Teile der Weltwirtschaft durch eine Krise. Die Arbeiter_innen Russlands und der anderen Länder beginnen zu verstehen, dass der Kapitalismus ihnen keine strahlende Zukunft zu bieten hat. Aber dieses Gefühl hat sich noch nicht in Klassenbewusstsein verwandelt. Die demokratischen Illusionen, die von der bürgerlichen Propaganda verbreitet werden, behindern die Bewusstseinsbildung. Leider verstehen viele nicht, dass Wahlen, wie Marx richtig bemerkte, nur das Recht der Unterdrückten sind, alle paar Jahre die Vertreter der herrschenden Klasse zu wählen. Dabei verändert sich aber das Gesicht der Macht nicht. Es bleibt kapitalistisch und ausbeuterisch. Was macht es für einen Unterschied, ob man diesen oder jenen Präsidenten hat, diesen oder jenen Vertreter? Die Proletarier_innen, die Lohnabhängigen, die Hand- und Kopfarbeiter_innen, die von den Produktionsmitteln und der politischen Macht getrennt sind, bleiben ausgebeutet. Die Arbeiter_innen werden nicht die soziale Emanzipation erlangen, außer sie stürzen das System, wie z.B. in der Pariser Kommune oder in den Arbeiterräten von 1905 und 1917. Nur mit einem Wechsel des Systems ist es möglich, die Ausbeutung abzuschaffen.
Die Anführer der Opposition gegen Putin
Die Liberalen, die Linke (vor allem Stalinisten), Nationalisten, haben sich an die Spitze dieser Bewegung gestellt. Zusammen haben sie das Koordinationszentrum „ Für ehrliche Wahlen“ gebildet.
Unter den „Anführern“ gibt es Figuren wie Boris Nemtsov, Vize-Premier unter Jelzin, der nicht wenig zur Verschlechterung der Lage der Arbeiter beigetragen hat.
Alles in allem erhalten die Opponenten Putins keinen großen Zuspruch von Seiten der Arbeiter_innen. Die Leute erinnern sich nur zu gut an die Armut, an die zurückgehaltenen Löhne und Renten, an die Zeit, in der die heutige Opposition an der Macht war. Die Führer der Opposition versuchen bloß, die aktuelle Unzufriedenheit für ihre Wahlziele auszunutzen. Es geht ihnen um die zukünftige Präsidentschaft. In den Protestdemonstrationen werden die Wähler_innen dazu aufgerufen, so abzustimmen, „wie es sich gehört“. Aber es ist klar, dass, selbst wenn die jetzige Opposition Putin ablösen sollte, dies keine Verbesserungen für die Arbeiter_innen bedeuten würde.
Die Aufgaben der Revolutionäre
Man weiß nur zu gut, dass die Forderung nach „ehrlichen“ Wahlen nichts mit dem Klassenkampf zu tun hat. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass unter den vielen Tausenden, die an diesen Demonstrationen teilgenommen haben, viele unserer Klassengenoss_innen sind. In einer solchen Situation müssen wir offen die demokratischen Illusionen kritisieren. Auch wenn es nicht dazu führt, dass wir uns bei den „Anhängern“ von „ehrlichen Wahlen“ beliebt machen. Ohne das Verständnis dafür, dass die eigentliche Grundlage dieser Probleme das Wesen der kapitalistischen Produktionsweise ist, wird es keine Entwicklung eines revolutionären Bewusstseins geben. Trotz der medialen Kampagnen um diese Wahlen müssen Revolutionäre die falschen Illusionen der bürgerlichen „Freiheiten“ entlarven. Auch wenn wir die Fehler der Teilnehmer_innen an den Demos für „ehrliche Wahlen“ kritisieren, sollte man aber nicht vergessen, dass es einen Unterschied zwischen der bürgerlichen „Opposition“ gibt, die diese Proteste für sich nutzen und sich bequeme Posten in den Organen der Macht ergattern will, und den gewöhnlichen Leuten, die ehrlich ihren Unmut über die Unverschämtheit und Dreistigkeit der Autoritäten im Kreml zum Ausdruck bringen.
Aber die Erfahrung zeigt, dass in so sterilen und unbedeutenden Protesten, wie sie die Demonstrationen von Moskau für die Machthaber waren, sehr schnell ein radikaler Geist erwachen kann. Vor Monaten noch konnte sich niemand vorstellen, dass Zehntausende auf die Straße gehen würden, um gegen das Regime Putins zu protestieren.
Es ist unsere revolutionäre Aufgabe, den wirklichen Charakter der Opposition als auch Putins zu entlarven. Wir müssen den Arbeiter_innen erklären, dass nur der autonome Klassenkampf für den Umsturz des Kapitalismus und den Aufbau einer Gesellschaft ohne Ausbeutung ihre Probleme und die der ganzen Menschheit lösen können.
Sympathisant_innen der IKS in der ex-UdSSR (Januar 2012)
Aktuelles und Laufendes:
- Massenproteste Russland [403]
- Sozialproteste Russland [404]
- Proteste Russland [405]
Spartenwerkschaften Fortschritt oder Fessel?
- 2065 Aufrufe
Im Februar schaffte es der Streik von 200 Vorfeldarbeitern am Frankfurter Flughafen Fraport, nicht nur eines der zentralen Drehkreuze im weltweiten Flugverkehrsnetz zu behindern, sondern der Streik brachte auch die Geschäftsführung von Fraport, die Gewerkschaft Verdi, die bürgerliche Justiz und die Regierungsparteien gegen sich auf. Eine solche Konfrontation verdient es näher untersucht zu werden.
Der Streik war organisiert und ausgerufen von der kleinen Gewerkschaft der Flugsicherung GdF. Wie schon beim spektakulären Streik der Lokführer 2007 ist es wieder eine kleine Spartengewerkschaft, der es mit höheren Forderungen und der Androhung eines größeren volkswirtschaftlichen Schadens gelingt, den Streik in die mediale Öffentlichkeit zu katapultieren.
Neben den mächtigen Einheitsgewerkschaften des DGB haben Spartengewerkschaften wie die GdF, die GdL, der Marburger Bund und Cockpit sich durch eigenständige Aktionen einen Namen gemacht und die sozialpartnerschaftlich verordnete Trägheit zumindest medial aufgemischt. Doch was bedeutet dies für den Klassenkampf? Was bedeutet dies für die Analyse der Funktion von Gewerkschaften im niedergehenden Kapitalismus?
Spartengewerkschaft – DGB Einheitsgewerkschaft
Die kontrollierende Funktion von Verdi gegenüber der Arbeiterklasse wird doppelt deutlich. Einmal ist der Arbeitsdirektor und somit Vorstandsmitglied von Fraport Herbert Mai. Vormals jahrzehntelang Gewerkschaftsfunktionär und von 1995 – 2000 Gewerkschaftsvorsitzende der ÖTV (der Vorgängerorganisation von Verdi). Die Fraport hatte sich mit Hilfe von Mais gewerkschaftlicher Erfahrung gut auf den Streik vorbereitet und viele Mitarbeiter aus dem verwaltenden Bereich in Kurzschulungen auf die Streikbrecherarbeit vorbereitet. Zum zweiten hatte Verdi vor drei Jahren mit Fraport ein 24 Millionen Euro schweres Kostensenkungsabkommen auf Kosten der ArbeiterInnen vereinbart. Die Masse der Beschäftigen und der Verdi-Mitglieder sind im einfachen Dienstleistungssektor (Service-, Sicherheits-, Reinigungskräfte, kaufmännische Angestellte usw) tätig. Die GdF dagegen sieht sich hauptsächlich als Nischenkraft für die ArbeiterInnen an strategisch wichtigen Stellen, wie die Vorfeldmitarbeiter, die mit ihren „follow me“ Fahrzeugen die Flugzeuge auf dem Rollfeld dirigieren. Diese Nischenkraft scheint auch für die anderen Spartengewerkschaften typisch zu sein. Doch was haben diese strategischen Punkte mit der gewerkschaftlichen Organisierung zu tun?
In der klassischen Industrieproduktion waren beispielsweise die Kämpfe der Fließband-ArbeiterInnen in den großen amerikanischen Autofabriken 1936/37 der Geburtsakt der modernen Industriegewerkschaft der Autoarbeiter CIO. In den Streiks wurde der Terror des Fließbands unterbrochen und die Verwundbarkeit des Produktionsprozess wurde offensichtlich. [1] Die deutsche Entsprechung bietet die IGM, sie erfüllt hervorragend die Rolle, die Neuausrichtung der hochproduktiven deutschen Industrie über die Jahrzehnte begleitet und moderiert zu haben. Doch der kapitalistische Produktionsprozess hat sich in der Zeit stark verändert. In den gegenwärtigen weltweiten Produktionsketten und Dienstleistungswolken sind viele neue Berufsbilder um immer mehr strategisch wichtige Knotenpunkte entstanden. Dazu kommen Spezialisten und Experten, die sich selbst ehemals außerhalb der Arbeiterklasse gesehen haben und mittlerweile immer offensichtlicher proletarisiert wurden (Lokführer, Lehrer, teilweise sind Ingenieure, Architekten, Techniker, bis hin zu Ärzten von dieser Entwicklung betroffen). Aus diesen Bereichen nähren sich die Spartengewerkschaften.
Dabei ist auffällig, dass sie besonders häufig genau mit dieser strategischen Macht drohen, um im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Größe eine relativ große Verhandlungsmacht aufzubauen. Was diese „Strategische Macht“ politisch bedeutet, gucken wir uns weiter unten an. Vorher sollten wir uns noch etwas intensiver mit der Frage der gewerkschaftlichen Konkurrenz beschäftigen.
Der Streik der Lokführer hatte gezeigt, dass eine kleine Spartengewerkschaft ohne großen bürokratischen Apparat und nach Jahrzehnten Dornröschenschlaf mit keiner Streikerfahrung mehr Raum für die Eigeninitiative der ArbeiterInnen ließ. Dies drückte sich gleich in den Forderungen aus, die sich entgegen der Logik solcher Spartengewerkschaften nicht nur exklusiv auf die Lokführer beschränken sollte, sondern auch für das mitfahrende Zugbegleitpersonal gelten sollte. Es ist kein Wunder, dass diese Forderung von der GdL als erstes am Verhandlungstisch fallen gelassen wurde. Die Eigeninitiative der Lokführer und die Kuschelpolitik der Transnet (konkurrierende DGB Gewerkschaft) mit dem DB Vorstand versetzte die bürgerliche Linke in Aufregung. Unterstützen wir die DGB-Einheitsgewerkschaften und wehren uns gegen die Aufspaltung oder fördern wir die kämpferischen Gewerkschaften, wie damals die GdL?
Die meisten sogenannten Linksgewerkschafter haben diese Frage mittlerweile pragmatisch entschieden: Die gewerkschaftliche Konkurrenz tut auch dem DGB gut, wir brauchen insgesamt kämpferischere Gewerkschaften. Diese Haltung drückt sehr gut die Befürchtung aus, dass die Gewerkschaften ihre Funktion, die Arbeiterklasse im Auftrag des Kapitals zu kontrollieren, insgesamt verlieren könnten.
Die Spartengewerkschaften erscheinen kämpferischer. Somit müssen wir uns nun der Frage zuwenden, was heißt „kämpferischer“? Es sollte klar sein, dass dies nicht statistisch an Streiktagen zu messen ist, hier schlagen die Warnstreiks von Verdi und IGM durch Masse immer durch. Diese Frage lässt sich nur qualitativ beantworten: wird der politische Lernprozess des Proletariats gestärkt. [Stärkung der Arbeitermacht, Entwicklung des Klassenbewusstseins]
Produktionsmacht – die Quelle des Lernprozesses des Proletariats?
Die Fraport hatte sich mit enormen Aufwand auf den Streik vorbereitet und so die Ausfälle von Landungen und Starts kleiner als befürchtet gehalten; doch zeigte auch dieser Streik, was 200 ArbeiterInnen an einer strategisch günstigen Situation für die Funktionsweise des Produktionsprozesses bedeuten können. Wie wirkt sich diese Produktionsmacht [2] auf die anderen ArbeiterInnen aus? Sind solch spektakuläre Aktionen der Beginn eines tieferen Bewusstseinsprozesses?
Die Macht der ArbeiterInnen zeigt sich dort, wo Streiks sich ausweiten, wo sie Berufsgruppen überspringen, wo sie ArbeiterInnen zusammenbringen, wo sie das Werk verlassen und sich über verschiedene Branchen ausbreiten. Dies drückt sich nicht nur in der Form der Ausweitung aus, sondern auch in der Beteiligung der ArbeiterInnen, das Zusammenkommen um zu diskutieren, hier bekommt der Streik eine politische (und kulturelle) Dimension, das gemeinsame Lernen, Erfahrungen austauschen, Ideen entwickeln usw. Die Kampfbewegung selbst ist durchzogen von kollektiven Lern-, Emanzipations- und Bewusstseinsprozessen innerhalb des Proletariats als Klasse. Dies ist die Quelle ihrer politischen Kraft, die notwendig ist, um die Revolution zu machen. Das Proletariat ist die erste ausgebeutete Klasse in der Geschichte, die die Revolution machen kann. Sie ist die erste Klasse, die sich nicht aufgrund einer neuen ökonomischen Struktur herausbildet, um die Ausbeutung zu optimieren, sondern um diese abzuschaffen. Ihre Macht ist daher primär eine im weitesten Sinne politische. Umso drängender die Frage: Woher kommt die Vorstellung, dass die Arbeitermacht eine technische Figur der „strategischen Macht im Produktionsprozess“ sei?
Als die Arbeiterklasse um 1968 mit vielfältigen massiven Kämpfen als politische Kraft wieder auf der Bühne erschien, bestand ihre Stärke genau darin, weite Teile der Gesellschaft in ihren Bann zu ziehen. Die Kämpfe der Industriearbeiter animierten die Kämpfe der Landarbeiter und umgekehrt, künstlerische Berufe, Versicherungsangestellte, öffentlicher Sektor bis hin zu Technikern in Kraftwerken – die Macht der Arbeiterklasse bestand in ihrer Breite und Vielfältigkeit, was auch für ihre Kampfformen galt. [3] Ein Teil der neuen Linken begab sich auf die Suche nach der Achillesferse der kapitalistischen Produktion. Der Operaismus [4] theoretisierte eine der vielfältigen kreativen Formen, die der Arbeiterkampf zu dieser Zeit angenommen hatte. Dies basierte auf der Erfahrung der Kämpfe um den „heißen Herbst“ 1969 in Italien, dass bestimmte Arbeitersegmente „den gesamten Zyklus des Kapitals lahm legen könnten“ (für Leute die tiefer mit der Begrifflichkeit der Operaisten vertraut sind: dass eine bestimmte Kapitalzusammensetzung eine bestimmte Klassenzusammensetzung hervorbringen würde). Diese Arbeitersegmente wurden als zentrale oder ziehende Sektoren bestimmt. Diese quasi Arbeiteravantgarden seien die Vorhut der Kämpfe zur Revolution. In sogenannten Untersuchungen wurde versucht festzustellen, wo genau solche strategischen Punkte im Produktionsprozess seien und wie die ArbeiterInnen sich dort verhalten würden. Mit der Theoretisierung dieser Fragestellung wurde eine taktische Frage im Arbeiterkampf aus ihrem politischen Kontext herausgelöst. Verrückterweise überschnitt sich an dieser Stelle die linksradikale Kritik des Operaismus häufig mit den Ansichten der verhassten stalinistischen Organisationen, die ihre Agitation stark auf den blue-collar-worker ausrichteten, was den Operaismus darin bestärkte, jede politische Dimension zu verteufeln. Die politische Dimension der Arbeitermacht wurde auf eine soziologisch-empirische (und technische) im rein ökonomischen Kampf zurechtgestutzt.
Der politische Gang in die Fabrik, um die Arbeiterklasse zu untersuchen (wie die Operaisten) oder zu agitieren (wie die K-Gruppen), ist heute nur noch Gegenstand von akademischen Untersuchungen [siehe das Buch Jan Ole Arps, Frühschicht. Linke Fabrikintervention in den 70er Jahren]. Die Produktionsmacht [5] wird heute von den Spartengewerkschaften eingesetzt, und dieser Ansatz unterstützt ihre Aufgabe, die ArbeiterInnen voneinander zu trennen statt sie zusammenzubringen.
Arbeitersolidarität
Die linksradikale Hoffnung auf „ziehende Sektoren“ wird bei ihnen umgedreht, statt Solidarität organisiert die Gewerkschaft den Streik gegen die Masse der zumeist schlechter bezahlten ca 70.000 ArbeiterInnen am Frankfurter Flughafen. Die Solidarität ist ein Wesensmerkmal der Arbeiterklasse. Bei einem Fortschreiten des Klassenbewusstseins werden sich die ArbeiterInnen bewusst, dass sie Teil einer Klasse sind. Die einzelnen Sparten, Branchen und Berufsfelder gehen in der politischen Figur der Arbeiterklasse auf. In dieser Einheit entfaltet sich erst die Vielfältigkeit und Kreativität der ArbeiterInnen. Die gegenseitige Unterstützung und Hilfestellung sind praktischer Ausdruck einer Solidarität der Masse. Diese Masse ist nicht allein eine Frage der Quantität, sondern auch der Qualität. In dem bewussten Bezug auf weitere Teile der Arbeiterklasse über die bürgerlich-kapitalistischen Grenzen hinweg liegt die Stärke der Arbeitersolidarität. Der Aufruf zum „Solidaritätsstreik“ für ein Dutzend Towerlotsen erscheint so rum nur noch als Farce dieser Idee. Dennoch gilt es zu betonen, dass unsere volle Solidarität den streikenden ArbeiterInnen gilt. Wir wissen, dass auch im Klammergriff der Gewerkschaften die ArbeiterInnen versuchen den Streik weiterzutragen. Diese Dynamik politisch durch Interventionen zu unterstützen, ist eine unserer Aufgaben. Genauere Informationen über die VorfeldarbeiterInnen liegen uns nicht vor. Doch für einige Lokführer war es selbstverständlich, während des BVG-Streiks vor den Toren eines Straßenbahnbetriebshofs zu erscheinen. Sie waren zwar den Fängen der GdL entkommen, doch nur um von den Funktionären der Verdi eingefangen zu werden. Als wiederum ein erneuter Lokführerstreik drohte und ein selbstorganisierter Kreis von Lokführern Streikzentren organisierte, um mit anderen ArbeiterInnen zusammen zu kommen, setzte die GdL erst auf Disziplinierungsmaßnahmen und kündigte dann am Vorabend den Streik auf.
Wir sollten uns also keinen Illusionen über den kämpferischen Charakter von Spartengewerkschaften hingeben. Ihre Funktion ist die Unterdrückung der politischen Dynamik von Arbeiterkämpfen, das Verhindern von kollektiven Lernprozessen.
Erosion der bürgerlichen Institutionen
Erklärt sich das Auftauchen von Spartengewerkschaften bzw. ihre Reaktivierung tatsächlich nur über die Veränderungen im Produktionsprozess und die Proletarisierung? Es ist tatsächlich eine wichtige Möglichkeit, das Unbehagen von proletarisierten Menschen einzufangen. Doch warum sind die DGB-Einheitsgewerkschaften nicht in der Lage, diese Rolle auszufüllen? Es würde naheliegen, darauf zu antworten, dass diese Proletarisierten sich selbst nicht als ArbeiterInnen definieren würden, doch dies gilt vermutlich ebenfalls für die Angestellten der Versicherungen und Banken, die jedoch bei Verdi gelandet sind und dort auch bereits Teil von größeren Mobilisierung waren. Die Spartengewerkschaften (ebenfalls wie die „Für eine kämpferische Gewerkschaft“-Fraktion der anarcho-syndikalistischen FAU) scheinen Ausdruck des allgemeineren Erodierungsprozesses der bürgerlichen Institutionen zu sein: das kurze Haltbarkeitsdatum für Bundespräsidenten, das kurze Aufblitzen von Karrieristen (wie von Gutenberg), die Missbrauchsskandale der christlichen Kirchen, allgemeine Politikverdrossenheit durch den Legitimationsverlust der politischen Kaste usw. Der Ansehensverlust der quasi-staatlichen Vermittlungsinstanzen nimmt groteske Formen an. Um nicht falsch verstanden zu werden, die Funktionen dieser bürgerlichen Institutionen und insbesondere der Gewerkschaften sind nach wie vor notwendig im niedergehenden Kapitalismus, sie werden nicht von selbst zerfallen, sondern sich immer wieder eine „modernere Form“ (und damit häufig zerbrechlichere und irrationalere) geben. Doch diese sind von den herrschenden Widersprüchen angespannt und deuten auf die innere Aushöhlung des politischen Systems hin. Das ist der Hintergrund, vor dem man die diktatorischen Maßnahmen am besten versteht, die die bürgerliche Justiz jüngst gewählt hat, um sowohl den „Solidaritätsstreik“ von zwölf Fluglotsen zu unterbinden, als auch gleich den ganzen Streik wegen eines Formfehlers für unrechtsmäßig zu erklären (dass die Justiz gegenüber den Spartengewerkschaften nicht einheitlich vorgeht und sich auch schon mal zu „deren Gunsten“ ausgesprochen hat, zeigten die gerichtlichen Auseinandersetzungen um den Lokführerstreik). Die Bourgeoisie steht auf jeden Fall gegenwärtig vor der schweren Aufgabe, entweder den DGB gegen das Grundgesetz zu stärken oder aber die Gewerkschaftsvielfalt als „moderne“ Falle auszubauen oder beides miteinander in Einklang zu bringen. [6] So oder so, der Zerfall des Ansehens der bürgerlichen Institutionen macht auch vor den Gewerkschaften nicht halt. G.
Anmerkungen
[1] Im Rahmen dieses Artikels kann keine weitere Analyse der entstehenden Industriegewerkschaften geliefert werden, es sei nur darauf verwiesen, dass die Arbeiterklasse in Europa zu dem Zeitpunkt politisch vollkommen geschlagen war, der Nationalsozialismus nahm Gestalt an, der Stalinismus führte seine blutigen Prozesse durch und in Spanien kündigte sich bereits der zweite Weltkrieg an. Die amerikanische Arbeiterklasse hatte noch nichts Vergleichbares erlebt, doch sie war isoliert und politisch – trotz der Migration – noch relativ unerfahren. Die neuen Gewerkschaften konnten die Klasse gut einfangen und auf den zweiten Weltkrieg vorbereiten.
[2] "Die strukturelle Arbeitermacht war in der neuen Leitindustrie (Automobile) weit größer als in der alten (Textilien). Die Automobilarbeiter verfügten über mehr Produktionsmacht, weil diese Industrie anfälliger gegenüber den Störungen war, die Arbeiter und Arbeiterinnen in der Produktion verursachen konnten.“ S. 125 Beverly Silver, Arbeiterbewegungen und Globalisierung seit 1870. Forces of Labor - sehr gute Zusammenfassung der Kernaussagen: www.arbeitsalltag.de/Texte/Silver.pdf [406].
[3] Tragischer war der organisatorische Bruch, der es der Klasse sehr mühsam machte, an den Kampferfahrungen der revolutionären Welle anzuknüpfen und zu einer Tiefe zu kommen. Diese Aufgabe wurde erst durch 1968 und das Auftauchen von revolutionären Minderheiten wieder aufgenommen.
[4] Zur kritischen Würdigung siehe die Artikelfolge zum Operaismus; Start in der Weltrevolution 141 – 143 /content/1396/der-operaismus-eine-oekonomistische-und-soziologische-betrachtungsweise-des [407]
/content/1428/der-operaismus-eine-oekonomistische-und-soziologische-betrachtungsweise-2 [408]
/content/1479/der-operaismus-eine-oekonomistische-und-soziologische-betrachtungsweise-des [409]
[5] Die Verdi Betriebsratsvorsitzende Claudia Amier hat dies im Gespräch mit der Financial Times Deutschland sehr gut festgestellt: „Eine kleine Gruppe von Beschäftigten nutzt ihre Monopolstellung aus, um Entgelte zu erzielen, die weit über jedes Maß hinausgehen und völlig unverhältnismäßig sind.“
[6] Hier einige Bruchstücke aus der derzeit innerhalb der deutschen Bourgeoisie tobenden Debatte:
SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier stellte die „Zerfledderung der deutschen Tariflandschaft“ fest und sagte der Passauer Neuen Presse: "Wir müssen zur Tarifeinheit zurückkehren, zum Grundsatz: Ein Tarif pro Betrieb. Der Vorsitzende der Monopolkommission, Justus Haucap, warnte die Politik derweil vor einem Bruch des Grundgesetzes in ihrem Bestreben, Arbeitskämpfe von konkurrierenden Gewerkschaften in einem Betrieb zu verhindern. Wer nicht beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) mitmachen wolle, dürfe auch nicht dazu gezwungen werden, sagte er dem Handelsblatt Online. Dessen ungeachtet hält auch Haucap die "Machtanballung bei Kleinstgewerkschaften" für ein Problem. Er regte an, über eine Änderung des Streikrechts gegen Gewerkschaften vorzugehen, die mit ihrer monopolartigen Macht nicht verantwortungsvoll umgehen.
Aktuelles und Laufendes:
- Spartengewerkschaften [410]
- Fraport-Streiks [411]
- Streiks Spartengewerkschaften [412]
- GdL [413]
Syrien - Iran - zwei Brandherde des kapitalistischen Infernos
- 2022 Aufrufe
Wer ist für diesen Horror verantwortlich ? Wessen mörderische Hand steckt hinter den Militärs und den Söldnern ?
Die Barbarei des syrischen Regimes ist mittlerweile jedem bekannt. Die herrschende Clique wird vor nichts zurückschrecken; sie hat keine Skrupel, Massaker zu verüben, um weiter die Kontrolle im Land auszuüben und ihre Privilegien aufrechtzuerhalten. Aber wer ist diese «Freie Syrische Armee », die behauptet, sich unter die Führung der « Volksproteste » zu stellen? Nichts als eine neue Bande von Mördern! Die FSA beansprucht für die Freiheit des Volkes zu kämpfen, aber in Wirklichkeit ist sie nur der bewaffnete Arm einer anderen bürgerlichen Clique, die mit Bashar al-Assad um die Macht kämpft. Dies ist eine wahre Tragödie für die Demonstranten. Diejenigen, die gegen die unerträglichen Lebensbedingungen, gegen Armut und Ausbeutung protestieren wollen, haben die Wahl zwischen Pest und Cholera. So wird ihr Widerstand zermalmt, die Protestierenden gefoltert, niedergeknüppelt und ermordet.
In Syrien ist die Protestbewegung zu schwach, um einen eigenständigen Kampf zu entfalten. So konnte ihre Wut sofort kanalisiert und von den verschiedenen, sich bekämpfenden rivalisierenden bürgerlichen Cliquen im Lande vereinnahmt werden. Die Demonstranten sind zu Kanonenfutter geworden, gefangen in einem Krieg, den sie nicht wollen, eingespannt in Machtkämpfe, die auf ihre Kosten ausgetragen werden. Wir sehen eine Wiederauflage dessen, was in Libyen einige Monate zuvor geschah.
Die FSA braucht von dem an der Macht befindlichen blutrünstigen al-Assad Regime in Syrien nichts Neues zu lernen. Anfang Februar zum Beispiel drohte die FSA damit, Damaskus und all die Hauptquartiere und Hochburgen des Regimes zu beschießen. Die FSA rief die Bevölkerung Damaskus dazu auf, sich aus den Gefechtsgebieten zu entfernen, obwohl dies unmöglich war. Die Einwohner von Damaskus hatten keine andere Wahl als verzweifelt Schutz zu suchen in Kellern und unterirdischen Löchern. Ihnen geht es ähnlich wie den vom Assad-Regime Verfolgten und Bombardierten in Homs und anderen Städten.
Aber die sich zerfleischenden Rivalen in Syrien sind nicht die einzigen Verantwortlichen für diese Massaker. Die international Verantwortlichen haben alle einen Sitz in UN-Gremien. Ammar al-Wai, einer der Befehlshaber der FSA, beschuldigte Russland und einige Nachbarländer wie Libanon und den Iran direkt an der Repression beteiligt zu sein, und auch die Arabische Liga und die ‚internationale Gemeinschaft‘ wurden wegen ihrer Inaktivität angeprangert, weil dadurch das al-Assad Regime noch mehr Spielraum für seine Massaker erhalten hätte. Welch eine Erkenntnis ! Die neuen Anträge für die Verabschiedung einer UN-Resolution, die Ende Februar vor der UNO eingebracht wurden, stießen aufgrund der imperialistischen Interessensgegensätze der Staaten, die Syrien unterstützen, auf deren unerbittlichen Widerstand: China und Russland stellen sich hinter das syrische Regime. Russland und Iran liefern dem Regime Waffen. Und wahrscheinlich mischen auch Soldaten aus diesen Ländern direkt oder indirekt vor Ort mit. Für Russland ist Syrien ein vitaler Verbündeter, denn nur Syrien hat Russland einen Flottenstützpunkt in Tartus am Mittelmeer überlassen. Für den Iran ist Syrien ein wichtiger Stützpfeiler seiner Machtbestrebungen im Mittleren Osten. Deshalb unterstützt das iranische Regime das bestehende syrische Regime vorbehaltlos, auch mit direkter militärischer Beteiligung. Und die « großen demokratischen Nationen », die Krokodilstränen vergießen und erklären, die Niederschlagung von Demonstranten durch das Regime Basha al-Assads sei nicht hinnehmbar, scheren sich in Wirklichkeit einen Dreck um das Schicksal der Opfer, stattdessen verfolgen auch sie nur ihre schmutzigen imperialistischen Interessen.
Syrien am Rande des imperialistischen Krieges
In der Zwischenzeit werden die Stimmen immer lauter, die auf ein militärisches Eingreifen in Syrien drängen. Das russisch-chinesische Veto der UN-Resolution zur Verurteilung der Repression durch das Assad-Regime beschleunigt diese Tendenz noch. All diese imperialistischen Geier nehmen die Massaker des syrischen Regimes als Vorwand, um ihre Kriegsvorbereitungen für Syrien zu treffen. So verbreiteten russische Medien wie « Voice of Russia » und die iranischen Medien die Nachricht, dass die Türkei mit US-Hilfe Truppen entlang der Grenze zu Syrien zusammenziehe, um nach Syrien einmarschieren zu können. Seitdem wurde diese Nachricht von allen westlichen Medien weiter zirkuliert. Gleichzeitig wurden in Syrien in der Kamechi und Deir Ezzor-Region entlang der Grenzen zum Irak und der Türkei Raketen installiert, die Syrien während der Zeit der UdSSR erworben hatte. Diese Schritte wurden nach einem Treffen in Ankara im November 2011 beschlossen. Der Gesandte Katars bot dem türkischen Premierminister Erdogan Geldmittel zur Durchführung von militärischen Maßnahmen gegen Syrien von türkischem Territorium aus an. Diese Treffen führten das syrische Regime und seine Verbündeten dazu, allen voran Iran und Russland, den Ton zu verschärfen und kaum verhüllte Drohungen gegen die Türkei auszusprechen. Bislang hat der syrische Nationalrat, in welchem westlichen Medien zufolge die Mehrheit der Opposition des Landes zusammengeschlossen ist, noch keine ausländische Militärhilfe angefordert. Sicherlich hat diese abwartende Haltung des syrischen Nationalrates das türkische und auch das israelische Militär bislang davon abgehalten, militärisch einzugreifen. Auch in den USA werden die Möglichkeiten eines militärischen Eingreifens ermittelt. Aber der US-Generalstabschef, General Dempsey, warnte davor, dass « die Kapazitäten der syrischen Luftwaffe mehr als fünfmal so groß seien wie die der libyschen Streitkräfte des gestürzten Gaddafi. Zudem befänden sich die meisten syrischen Flugabwehrsysteme in dicht besiedelten Gebieten, so dass man bei Luftangriffen auf diese mit zahlreichen Toten unter der Zivilbevölkerung rechnen müsse.“ (FAZ, 8.3.2012) Er fügte hinzu, das syrische Arsenal biologischer und chemischer Waffen sei 100 mal größer als das libysche. Die Vernichtung der syrischen Luftabwehr werde lange dauern und aufwendig sein, ohne die Führung der USA würde dies nicht gelingen. In Wirklichkeit ist natürlich kein einziger Staat, der sich an einer Militäroperation gegen das Assad-Regime beteiligen würde, an dem Schicksal der Menschen interessiert (1).
Zudem treiben in Syrien und im benachbarten Libanon Terrorgruppen wie Hamas, Hisbollah und vermutlich auch al-Qaida ihr Unwesen, von denen Hamas und Hisbollah Waffen aus dem Iran beziehen. Mittlerweile sollen auch bewaffnete Kräfte aus Libyen in Syrien an der Seite der FSA kämpfen. Auch wenn es im Vergleich zu Libyen keine Petro-Dollars zu gewinnen gibt, ist das Land ein strategisches Drehkreuz im Mittleren Osten, das keiner der imperialistischen Rivalen dem anderen ohne erbitterten Widerstand überlassen würde. Eine militärische Intervention von Außen in Syrien würde deshalb einen noch viel größeren Brand auslösen. Auch wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu einem weiteren Blutvergießen im Libanon käme. Ein Sturz des Assad-Regimes, das bislang als Achilles-Ferse des Irans gilt, würde darüberhinaus den Einfluss des Irans in der Region entscheidend schwächen. Dies wäre sicherlich eines der Hauptanliegen der westlichen Kräfte bei einer möglichen militärischen Intervention in Syrien. Die Ausgebeuteten und Unterdrückten in Syrien laufen somit Gefahr, zwischen der FSA und den Killerkommandos des Assad-Regimes und den imperialistischen Ambitionen ausländischer Mächte aufgerieben zu werden.
Der Brandherd Iran
Syrien ist nicht der einzige Brandherd in der Region. Denn gleichzeitig nehmen die Spannungen zwischen dem Iran und mehreren imperialistischen Staaten, den USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien, Israel usw. jeden Tag zu. Die Kriegsgefahr wächst.
Wenn heute ein Land wie der Iran die USA und die anderen imperialistischen Haie herausfordern kann, spiegelt diese Entwicklung die Tendenz des wachsenden imperialistischen Chaos wider, das mit dem Zusammenbruch des Schah-Regimes Anfang 1979 einsetzte und ein Jahrzehnt später mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Ende der Konfrontation zwischen zwei Blöcken ein neues Kapitel im Niedergang des Kapitalismus eröffnete. Seitdem sind die USA die noch einzig übrig gebliebene Supermacht, die aber zunehmend von anderen Staaten herausgefordert wird, während sich gleichzeitig ein wahres Chaos in den imperialistischen Beziehungen gebildet hat, wo „Jeder gegen jeden“ antritt. Bis 1979 war der Iran ein strategisch wichtiges Bindeglied in der Abwehrkette des von den USA angeführten westlichen Blocks gegen die Sowjetunion gewesen. Nach dem Zusammenbruch des Schah-Regimes, der Übernahme der Macht durch die Mullahs und der danach einsetzenden Amerika-feindlichen Politik versuchte einerseits seinerzeit die Sowjetunion durch den Einmarsch in Afghanistan Ende 1979 Kapital aus der Schwächung der USA zu schlagen. Das russische Fiasko in Afghanistan ist bekannt; es trug mit zum Zusammenbruch des stalinistischen Regimes in der Sowjetunion bei. Andererseits reagierten die USA mit dem Anstacheln des Iran-Irak-Krieges 1980, der nahezu 10 Jahre Massaker zwischen Iran-Irak brachte. Seit mehreren Jahrzehnten ist die ganze Region – von Israel/Palästina über den Irak und Afghanistan - mit Kriegen übersät worden. Durch ihre verzweifelten Versuche, ihre Vormachtstellung hauptsächlich mit militärischen Mitteln aufrechtzuerhalten, haben die USA eine riesige Blutspur in der Region hinterlassen. Und die USA selbst sind im Irak, in Afghanistan, indirekt in Pakistan in einen riesigen Schlamassel geraten, wo sie keine Beruhigung der Lage, sondern nur eine weitere Destabilisierung bewirkt haben. Und gleichzeitig hat sich der Iran (neben der Türkei) auf Kosten der USA zu einer neuen Regionalmacht im Mittleren Osten mausern können. Weil der Iran eigentlich keine anderen Trümpfe als Öl- und Gasexporte einsetzen kann und über keine industrielle Konkurrenzfähigkeit verfügt, kann das Regime nur „erpresserisch“ und militärisch destabilisierend wirken. Die Mullahs setzen dabei die Keule der religiösen Spaltung ein. Jeder Schiit ist für das Regime Kanonenfutter im Kampf gegen die rivalisierenden Regime – z.B. gegen Saudi-Arabien. Gegenüber Israel droht der Iran seit langem mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Irans derzeit hochambitioniertes Atomprogramm, angeblich nur friedlichen Zwecken dienend, ist derzeit der Hauptkonfliktpunkt, welcher die Kriegsgefahr in der Region weiter auf die Spitze treibt. Die Aussicht, dass das Regime in Teheran bald über Kernwaffen verfügen könnte, ist für die israelische Regierung jetzt schon Grund genug, militärisch gegen seinen östlichen Herausforderer vorgehen zu wollen.
Auch wenn der Iran im Vergleich zu seinem Rivalen Saudi-Arabien nur ein Fünftel von dem in die Rüstung steckt, was die Saudis dafür ausgeben, hat das Land einen Großteil seiner Ressourcen in Rüstung gesteckt. Solch ein aufgeblähter Militarismus ist eine klassische Erscheinungsform eines niedergehenden Systems. Auch wenn es schwierig ist, die militärische Schlagkraft des Irans genau einzuschätzen, ist das Regime dazu in der Lage, viel größere Verwerfungen hervorzurufen als Syrien selbst. Wenn sich der Iran zur Blockade der Straße von Hormus entschließen sollte, wodurch der Ölnachschub beeinträchtigt würde, würde dies die wirtschaftliche Lage weltweit noch mehr destabilisieren. Jeder direkte Angriff auf den Iran würde ein noch größeres, unkontrollierbares Chaos auslösen.
Gegenwärtig rüstet sich Israel für einen Militärschlag gegen den Iran. Im Gegensatz zu früheren Militärschlägen gegen den Irak 1981 oder Syrien 2007 würde ein Angriff gegen den Iran die gegenwärtigen Kapazitäten des israelischen Militärs überfordern (2). Israel wäre letzten Endes auf die Unterstützung der USA angewiesen. Damit könnten die USA in einem Krieg gegen den Iran ein neues militärisches Desaster erleben. Zudem haben die USA erst jüngst ihre neuen militärischen Prioritäten für die nächsten Jahrzehnte bekannt gegeben. Und da steht an erster Stelle die notwendige Anpassung an die zu erwartende Intensivierung der Konflikte in Ostasien und der Zwang, China ausreichend gerüstet entgegenzutreten. Wenn die USA im Mittleren Osten militärisch angreifen würden, spiegelt das somit die ganze Unkontrollierbarkeit der militaristischen Spirale wider, welche das kapitalistische System immer weiter in den Abgrund treibt. Auch wenn wegen des bevorstehenden Wahlkampfes in den USA zur Zeit viele Fragen hinsichtlich des Vorgehens der USA offen sind, müssten die USA in den beiden Brandherden Syrien und Iran mit an vorderster Front stehen.
Während das Krebsgeschwür des Militarismus und das Terrorregime der Herrschenden immer mehr Opfer hinterlässt, liegt der Schlüssel für den Ausweg aus dieser Barbarei mehr denn je in den Händen der Arbeiterklasse – vor allem in den Händen der Arbeiter der Industriestaaten, die am ehesten den Arm der Repression und des Militarismus zurückhalten können.
W/D Anfang März 2010
(1)Nur einige Beispiele der Heuchelei einiger Staaten, die an einer „humanitären Intervention“ in Syrien mitwirken könnten: Der türkische Ministerpräsident verbrachte in den letzten Jahren seinen Urlaub mit dem Assad-Clan, um dadurch die Beziehungen zu Syrien zu verbessern. Ohne jegliche Berührungsängste mit dem blutrünstigen Assad-Regime verfolgt Ankara seit Jahren die Kurden. Oder Israel, das behauptet, der Genozid an den Juden im Holocaust legitimiere jeglichen Gewalteinsatz (von der Vertreibung bis zur Bombardierung usw. ) ist eher am Machterhalt des Israel feindlich gesonnenen, aber berechenbaren Assad-Regimes interessiert als am möglichen Aufstieg eines eventuell stärker muslimisch geprägten syrischen Regimes. Auch wenn die vom Assad-Regime bombardierten Dörfer und Städte oft nur wenige Kilometer von Israel entfernt sind, zeigt der israelische Staat keine Sorge um die Opfer der Repression in Syrien. Im Libanon werden viele der ins Land geflüchteten Opfer der syrischen Repression von Polizeikräften aufgegriffen und - wenn sie nicht in Libanon verfolgt werden – wieder nach Syrien abgeschoben. Der deutsche Staat hat jahrelang mit den syrischen Geheimdiensten kooperiert und nie davor gezögert, syrische Flüchtlinge den Henkern des Regimes auszuliefern.
(2 „Primäre Ziele wären alle Anlagen zur Herstellung von Spaltmaterial, das für den Bau von Atomwaffen nötig ist. Dazu zählen die Urankonversionsanlage in Isfahan und der noch nicht fertiggestellte Schwerwasserreaktor Arak, der einmal Plutonium liefern könnte - vor allem aber die Urananreicherungsanlagen in Natans und Fordow (die sich in Bunkern befinden). Sie bereiten den Israelis das meiste Kopfzerbrechen: Beide Kavernen liegen unter 80 Meter Fels und sind laut Experten mit konventionellen Waffen nicht zu knacken. Israel [414] müsste aber zugleich sicherstellen, dass die Atomfabrik nicht nach wenigen Monaten wieder arbeitet. (…) Analysten in Israel [414] gehen davon aus, dass die Luftwaffe mehrere Angriffswellen fliegen müsste, auch um Irans Luftabwehr auszuschalten und Sekundärziele zu attackieren, wie Stützpunkte und Produktionsstätten für Raketen. 125 Kampfjets der Typen F-15 und F-16 hat Israel dafür mit Zusatztanks für Langstrecken ausgerüstet. Marschflugkörper, Raketen und Drohnen dürften ebenso zum Einsatz kommen, wie Kommandoeinheiten. Die Gelegenheit ist aus Sicht der Hardliner in Israel günstig: Die Jets könnten unbehelligt über Irak fliegen, nachdem die Amerikaner dort Ende 2011 abgezogen sind. Zudem dürfte es sich US-Präsident Obama kurz vor der Wahl kaum leisten können, Israel die Unterstützung nach einem Angriff zu entziehen, so sehr er sich gegen diesen stemmt.“ https://www.sueddeutsche.de/politik/atomstreit-wie-israel-sich-fuer-einen-angriff-gegen-iran-ruestet-1.1290231 [415]Aktuelles und Laufendes:
- Aufstände Bürgerkrieg Syrien [416]
- Iran-Konflikt [417]
- Rolle Irans [418]
- Iran Regionalmacht [419]
Wulff-Affäre, NRW-Neuwahlen Hintergründe für das Großreinemachen in der politischen Klasse
- 1941 Aufrufe
Der Vordergrund...
uf dem ersten Blick reiht sich diese Affäre in jene Kette von „Skandalen“ ein, die mit schöner Regelmäßigkeit die Öffentlichkeit heimsuchen. Zunächst sickern ganz „zufällig“ Details über angebliche oder tatsächliche Verfehlungen an die Öffentlichkeit, dem zumeist Dementis der Betroffenen folgen. Dann folgen immer mehr Details, bis es am Ende - ungeachtet aller Beschwichtigungsversuche und öffentlicher Entschuldigungen des betreffenden Politikers bzw. Spitzenfunktionärs – zum „freiwilligen“ Rücktritt des Letzteren kommt. Die Medien, in so gut wie allen Fällen Auslöser dieser Affären, sonnen sich im Glanz der unerschrockenen Aufklärer und preisen ihre Tugenden als „Wächter der Demokratie“; die politische Klasse schreit „Igitt“ angesichts dieser Verderbtheit eines ihrer Angehörigen, und die Regierung verspricht eiligst juristische Verbesserungen. Und schließlich wird das hohe Lied von den „Selbstreinigungskräften der Demokratie“ angestimmt.
Bundespräsident a.D. Wulff war in diesem Sinn ein idealer Sündenbock auf dem Altar der „politischen Hygiene“, der sich die politische Klasse derzeit mal wieder verschrieben hat. Sein Ungeschick im Umgang mit der Medienkampagne, das in der Torheit kulminierte, ausgerechnet die BILD unter Druck zu setzen, seine Dementis, denen stets zunächst Relativierungen, schließlich reuevolle Schuldeingeständnisse folgten, sein Krisenmanagement per Anwalt boten den Tugendwächtern der Republik die Gelegenheit, ein wenig Dampf aus dem Kessel abzulassen. Denn ihnen war nicht entgangen, dass sich in den letzten eine brisante Mischung aus Wut und Misstrauen unter den Erwerbstätigen dieses Landes angestaut hat. Eine Wut, die sich – noch – gegen die Raffzähne in der Finanzwirtschaft und nicht gegen die kapitalistische Wirtschaftsweise als solches richtet, ein Misstrauen, das sich gegen bürgerliche Politiker, aber – noch - nicht gegen die bürgerliche Politik an sich wendet. Es ist das altbekannte Lied: Indem sie das altbekannte Märchen vom schwarzen Schaf bemühen und das ganze Problem als „Fehlverhalten“ Einzelner herunterspielen, indem sie ausgesuchte Mitglieder ihrer Klasse als Blitzableiter für die Wut der Bevölkerung opfern (wobei im Falle Wulffs das „Opfer“ mit 200.000 Euro jährlichem „Ehrensold“ versüßt wird), versuchen die Herrschenden größeren Schaden vom System an sich abzuwenden.
Der tiefere Grund
Doch es scheint, als gäbe es hinter diesem eher banalen Motiv für die Anti-Wulff-Kampagne noch eine zweite, tiefere Wahrheit, eine Wahrheit, die sich dem Normalsterblichen nur indirekt, anhand von einigen wenigen Indizien schemenhaft erschließt. War Wulff etwa nur vordergründig der Sündenbock für den moralischen Furor, von dem die politische Klasse aktuell ergriffen ist, und in Wahrheit ein Bauernkopf im unsichtbaren Krieg zwischen verschiedenen Seilschaften innerhalb der herrschenden Klasse? Geht es im Kern dieser Affäre nicht um den moralischen Kodex, wie vorgegeben wird, sondern auch etwa um Macht, Interessen und Strategie? Es gibt rund um die Wulff-Affäre einige Auffälligkeiten, die es durchaus möglich erscheinen lassen, dass es Sinn und Zweck der ganzen Affäre war, einen bestimmten Teil der herrschenden Klasse zu schwächen, indem seine Machenschaften ans Tageslicht gezerrt werden. Eine Seilschaft, die in Niedersachsen beheimatet ist und in den letzten anderthalb Jahrzehnten ziemlich erfolgreich dabei war, ihre Leute in wichtige Positionen der Bundespolitik zu hieven. In der Tat waren und sind niedersächsische Politiker in Berlin überrepräsentiert: angefangen mit dem ehemaligen Bundeskanzler Schröder über die beiden SPD-Spitzenpolitiker Steinmeier und Gabriel bis hin zu Wirtschaftsminister Rösler, Arbeitsministerin von der Leyen und eben dem – nunmehr – ehemaligen Bundespräsidenten Wulff.
Diese Niedersachsen-Connection war offensichtlich parteienübergreifend und entfaltete sich in der Grauzone zwischen Politik und Geschäft. Hier tummelten sich einige schillernde Figuren wie jener Parvenü Carsten Maschmeyer, der – Ex-Mitinhaber der AWD, einem Finanzvertrieb, der Tausende von Kleinanleger um ihr Geld gebracht hat – sowohl zum ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder als auch zu seinem Nachfolger Wulff enge Beziehungen unterhielt und ihre Wahlkämpfe mit erheblichen Geldmitteln unterstützte. Oder der Eventmanager und Strippenzieher Manfred Schmidt, der es verstand, mit seinen prominent besetzten Partys und Events sowie mit seinen Einladungen in seine Feriendomizile zahlreiche „Volksvertreter“ zu umgarnen. Man könnte diese Liste fortsetzen, haben doch die bürgerlichen Medien in den letzten Wochen detailliert über dieses Netzwerk berichtet. Sie haben dies so ausgiebig getan, dass das eigentliche Kraftzentrum dieses Netzwerkes völlig außer Acht blieb: der – nennen wir ihn einmal – „industriell-gewerkschaftliche Komplex“ des VW-Konzerns. Er bildet die Schnittstelle und die Machtbasis etlicher politischer und gewerkschaftlicher Karrieren; allein seine rechtliche Grundlage, das „VW-Gesetz“, mit der Sperrminorität der Landesregierung im VW-Aufsichtsrat – eine Besonderheit, die von der EU schon vor langem ins Visier genommen worden war, bis heute jedoch von der deutschen Politik hartnäckig verteidigt wird -, verschaffte den Ambitionen dieser Kreise ein erhebliches bundespolitisches Gewicht. Von hier ging der in der Geschichte der Bundesrepublik schlimmste Angriff gegen die Arbeiterklasse aus: Hartz IV. Ihr Namensgeber und Erfinder war Peter Hartz, lange Jahre Personalmanager bei VW mit kurzem Draht zur IG Metall, bis er 2005 wegen einer Korruptionsaffäre im Zusammenhang mit dem Konzernbetriebsrat gehen musste.
Von hier gingen auch die Impulse für eine stärkere Akzentuierung der „strategischen Partnerschaft“ mit Russland aus, wobei sich vor allem einer aus dem Hannoveraner Stall hervortat, der schon bei der Einführung der „Agenda 2010“ eine federführende Rolle gespielt hatte: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Noch kurz vor der Abwahl der von ihm angeführten rot-grünen Bundesregierung im November 2005 fädelte er jenen berüchtigten Deal mit der staatseigenen russischen Gazprom ein, der eine direkte Erdgaspipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee unter Umgehung der baltischen und polnischen Transitländer vorsah und sowohl im In- wie im Ausland vehement kritisiert wurde. War es zunächst die Tatsache, dass Schröder unmittelbar nach seiner Abwahl und ohne jegliche Schamfrist in den Vorstand der NorthStream AG wechselte (dem eigens für die Betreibung der Ostseepipeline gegründeten Gazprom-Ableger), die den Unmut der herrschenden Klassen hierzulande erregte, so stellte sich bald ein grundsätzlicher Dissens zwischen dem Schröder-Clan und anderen gewichtigen Kreisen in der herrschenden Klasse ein. Es ging dabei um die Frage der Gewichtung der deutschen Außenpolitik: Sollte den deutsch-russischen Beziehungen eine stärkere Bedeutung eingeräumt werden, oder sollte die „deutsch-französische Freundschaft“ weiterhin Vorrang genießen?
Spätestens der Ausbruch der sog. Euro- oder Schuldenkrise beantwortete diese Schlüsselfrage für die deutsche Bourgeoisie. Die Existenz der EU steht auf Messers Schneide; Experten sprechen davon, dass das Jahr 2012 zum Schicksalsjahr für die Europäische Union werden könnte. Kaum ist Griechenland aus den Schlagzeilen verschwunden (was keinesfalls bedeutet, dass es über dem Berg ist, im Gegenteil), lauert schon mit Portugal der nächste Wackelkandidat. Ein Scheitern der EU bzw. der Euro-Zone hätte unabsehbare ökonomische und soziale Folgen für Deutschland. Unter diesen Umständen ist die deutsch-französische Achse überlebenswichtig für die deutsche Bourgeoisie. Nicht dass sie die strategische Partnerschaft mit Russland aufzukündigen beabsichtigen, aber die Ton angebenden Kreise in der deutschen Bourgeoisie haben nicht vor, ihren französischen Partner durch einen allzu innigen Flirt mit dem russischen Nebenbuhler noch einmal vor den Kopf zu stoßen. Nicht Putin, der „lupenreine Demokrat“ (Schröder) genießt heute in der deutschen Außenpolitik Priorität, sondern das deutsch-französische Tandem.
Affären vom Zuschnitt der Wulff-Affäre haben oftmals einen doppelten Boden; hinter der für die breite Öffentlichkeit bestimmten Botschaft enthalten sie Absichten, die sich nur für Eingeweihte erschließen – und erschließen sollen. Möglicherweise steckt hier die eigentliche Botschaft hinter der Anti-Wulff-Kampagne: eine Warnung an jene Kräfte in der deutschen Bourgeoisie, deren Bestrebungen den strategischen Interessen der bürgerlichen Klasse in ihrer Gesamtheit zuwiderlaufen. Es fiel in diesem Zusammenhang jedenfalls auf, wie vornehm sich die SPD-Führung, insbesondere der ehemalige Schröder-Mann Steinmeier und Schröders einstiger Nachfolger in das Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten Gabriel, in der Wulff-Affäre zurückgehalten hatte. Steckte dahinter wirklich nur das Motiv, „das Amt des Bundespräsidenten nicht zu beschädigen“?
All dies geschah rechtzeitig, bevor die nächste Bombe platzte: die Auflösung der rot-grünen Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Die Begleitumstände des „Sturzes“ der erst vor 20 Monaten gebildeten rot-grünen Landesregierung unter Hannelore Kraft (SPD) waren recht merkwürdig: Während die Abgewählten, SPD und Grüne, Mühe hatten, ihre Freude über ihre eigene Abwahl zu verbergen, herrschten in der Opposition betretene Mienen vor. Besonders die FDP-Fraktion im Düsseldorf erntete angesichts ihrer Rolle bei der Lesung des Haushalts der rot-grünen Landesregierung im Düsseldorfer Landtag verständnisloses Kopfschütteln. Schließlich hatte sie mit ihrem Nein in der zweiten Lesung nicht nur dafür gesorgt, dass der Haushalt scheiterte und Ministerpräsident Kraft umgehend die Auflösung ihrer Regierung erklärte, sondern auch politisches Harakiri begangen angesichts von Umfragewerten, die seit Monaten um die zwei Prozent pendeln. Es hat aber den Anschein, als sei die FDP in eine Falle gelaufen; ihr Kalkül, in der zweiten Lesung die Einzelhaushalte abzulehnen, um in der dritten Lesung schließlich dem Gesamthaushalt doch zuzustimmen, wurde durch eine sehr umstrittene Auslegung der Rechtslage durch die Düsseldorfer Landesverwaltung unterlaufen, nach der die Ablehnung der Einzelhaushalte in der zweiten Lesung automatisch die Ablehnung des Gesamthaushaltes nach sich zöge und damit eine dritte Lesung überflüssig sei. Es ist offensichtlich, dass Rot-Grün die Gelegenheit nutzen will, via vorzeitiger Neuwahlen die kleineren Parteien aus dem Landtag zu kegeln; denn neben der FDP krebst auch die Linke unterhalb der Fünfprozenthürde herum.
Spätestens seit 2005, als die SPD zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit die Macht in NRW an die CDU und dem selbsternannten Arbeiterführer Rüttgers abgeben musste, womit das vorzeitige Ende der rot-grünen Bundesregierung unter Schröder eingeläutet wurde, gelten Wahlen in dem bevölkerungsreichsten Bundesland als Wegweiser für wichtige Veränderungen auf Bundesebene. Vor diesem Hintergrund findet derzeit eine regelrechte Heerschau der politischen Klasse in NRW statt: Die FDP schickt ihr bestes Pferd ins Rennen, den ehemaligen Generalsekretär Lindner, der mit seinem „mitfühlenden“ Liberalismus das Unmögliche wahr machen und die FDP vor dem Schicksal einer Splitterpartei in NRW bewahren soll. Die CDU setzt ihre Hoffnungen auf Bundesumweltminister Röttgen, der für die schwarz-grüne Option steht. Währenddessen setzen die Grüne und die SPD auf ihre bewährten Kräfte in NRW; Hannelore Kraft wird von manchen gar schon als die kommende Kanzlerkandidatin der SPD gehandelt. Die Landtagswahlen in NRW werden ein Probelauf für die Bundestagswahlen 2013 sein; hier wird die Antwort auf die Frage vorweggenommen, welche Optionen in der politischen Farbenlehre auf Bundesebene möglich sind. Werden die kleinen Parteien auch nach den Wahlen im kommenden Mai im Düsseldorfer Landtag präsent sein, um weiterhin populistische Tendenzen in der Bevölkerung zu kanalisieren? Und wenn nicht, wird es Röttgen gelingen, die Grünen für ein gemeinsames Regierungsprojekt zu begeistern? Oder kommt es zu einer rot-grünen Wiederauflage, diesmal aber nicht als Minderheitsregierung, sondern mit einer satten Mehrheit ausgestattet? Letzteres würde in Kombination mit dem Sturz der NRW-FDP unter die Fünfprozenthürde die Merkel-Regierung in Berlin – vorsichtig ausgedrückt – in erhebliche Turbulenzen bringen und die Wiederauflage einer rot-grünen Bundesregierung immer näher rücken lassen.
Im Unterschied zu offenen Diktaturen wie die stalinistischen Einparteiensysteme im früheren Ostblock bergen Wahlen in parlamentarischen Demokratien viele Unwägbarkeiten in sich, die die Herrschenden trotz aller Manipulationskünste nicht völlig beeinflussen können. Das Aufkommen populistischer Parteien in den westlichen Demokratien in den letzten Jahren zeigt, dass die herrschenden Kreise nicht vor unliebsamen Überraschungen gefeit sind. Umso wichtiger ist es für sie, dass die Hauptprotagonisten der politischen Klasse in ihrer strategischen Orientierung an einem Strang ziehen. Ein sehr effektives Mittel zu ihrer Disziplinierung ist das Lancieren von Affären in der Öffentlichkeit. Vom Grundsätzlichen ins Konkrete übersetzt: möglicherweise waren – und da schließt sich der Kreis - die eigentlichen Adressaten der Anti-Wulff-Kampagne die führenden SPD-Mitglieder und potenziellen Kanzlerkandidaten Gabriel und Steinmeier. Vielleicht war die Wulff-Affäre in Wirklichkeit ein verkappter Warnschuss gegen die Niedersachsen-Connection, die sich erneut anschickt, nach der Macht zu greifen – ein Warnschuss, mit dem die SPD-Führung für den Fall, dass sie im kommenden Jahr zusammen mit den Grünen die Bundesregierung bildet, an die strategischen Gesamtinteressen und Prioritäten des deutschen Imperialismus erinnert wird. B. 24.3.2012
Weltrevolution Nr. 172
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 294.8 KB |
- 1930 Aufrufe
Die Gründung zweier neuer Sektionen der IKS in Peru und Ecuador
- 1335 Aufrufe
Der Artikel wurde schon auf IKSonline veröffentlicht.
https://de.internationalism.org/IKSonline2012_peruecuadorneuesektionen [421]
Die „Piraten“: Freibeuter des bürgerlichen Parlamentarismus
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 80.63 KB |
- 1734 Aufrufe
Angesichts dessen stellen sich zwei Fragen, wovon die erste spekulativer Natur, die zweite aber durchaus konkret ist: Handelt es sich bei den „Piraten“ lediglich um eine politische Eintagsfliege, die sich spätestens nach den nächsten Bundestagswahlen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen wird, oder hat sie das Zeug zu einer Protestpartei mit Zukunftspotenzial? Und: Welche Rolle spielen die „Piraten“ heute, worin besteht ihre aktuelle Funktion?
Das Internet im Fadenkreuz von Kommerz und staatlicher Kontrolle
Treibende Kraft hinter dem Phänomen der „Piraten“ ist ein Konflikt zwischen der sog. Internet-Community, also jener Heerschar von Internet-Usern, Hackern, Bloggern, Spielern, etc., und staatlichen Institutionen (Justiz, Geheimdienste, der Gesetzgeber) und Konzernen um die Freiheit des World Wide Web. Dieser Konflikt schwelt bereits seit geraumer Zeit und flammt immer wieder auf. Es war die Affäre rund um Wikileaks und dessen Spiritus rector, Julian Assange, der der breiten Öffentlichkeit erstmals einen Eindruck davon verschaffte, wie verbissen die Auseinandersetzungen zwischen den Verfechtern der uneingeschränkten Transparenz und den staatlichen Geheimniskrämern inzwischen geführt werden. Seither ist dieser Konflikt zu einem mehr oder minder offenen „Cyberkrieg“ eskaliert, in dem beide Seiten immer größeres Geschütz auffahren. Auf der einen Seite drohen die staatskapitalistischen Regimes überall mit immer drakonischeren Strafen, hetzen ihre Geheimdienst- und Polizeiapparate auf zum Teil minderjährige Hacker und drangsalieren die Internet-Community mit immer neuen Einschränkungen. Auf der anderen Seite schrecken Internet-Aktivisten wie die ominöse Gruppe „Anonymus“ immer weniger davor zurück, Konzerne, staatliche Behörden und selbst Privatpersonen mit immer ausgeklügelteren Methoden elektronisch lahmzulegen, ihre Kundendateien bzw. persönlichen Daten zu hacken, um sie anschließend zu veröffentlichen. Besonders heftig tobt der Kampf in den USA; der US-amerikanische Staatskapitalismus hat den Krieg gegen die sog. Cyberkriminalität auf sein Schild gehoben und jagt Betreiber illegaler Dienste notfalls um den ganzen Globus.
Aber auch das politische Regime in Deutschland hat die Zeichen der Zeit erkannt. Während es einerseits darum bemüht ist, die „Auswüchse“ des Webs gesetzlich einzudämmen, weiß es andererseits auch um die Vorteile, die die neuen Medien im Sinne der Aufrechterhaltung seiner Herrschaft bieten. Im Grunde war es seine Umtriebigkeit, die die Internet-Community erst sensibilisierte und politisierte. Initialzündung für die Gründung der „Piraten“ in Deutschland waren Pläne der damaligen Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen („Zensursula“), unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Kinderpornographie die gesetzliche und infrastrukturelle Möglichkeit zu schaffen, Internetseiten zu sperren – unter Verwendung von sog. Sperrlisten des Bundeskriminalamtes und ohne Einbeziehung von Gerichten. Und als sich die Bundesregierung Anfang des Jahres anschickte, das auf völlig undurchsichtige Art und Weise zwischen den USA, der EU und einigen anderen Ländern zustande gekommene sog. Anti-Produktpiraterie-Handelsabkommen (Anti-Counterfeiting Treat Agreement, kurz: ACTA) zu ratifizieren, schuf sie mit den anschließenden Straßenprotesten erst die (wenn auch labile) Massenbasis für die „Piraten“, mit der diese sich dann in die o.g. Landtage katapultierte.
Der gesamte Konflikt besteht in seinem Kern aus zwei Brandherden. Zum einen laufen die Netzaktivisten Sturm gegen die zunehmende Einschränkung kostenloser Downloads und die Kommerzialisierung des Internets auf Kosten der Nutzer. Erst jüngst ließ das juristische Vorgehen des Musikrechteverwerters Gema gegen die Musik- und Filmplattform YouTube die Wellen im Netz hochschlagen; YouTube wurde vom Landgericht Hamburg zu einer strikteren Kontrolle der hochgeladenen Musikstücke verdonnert. Aber auch die Internet-Anbieter selbst sinnen über Möglichkeiten des elektronischen Abkassierens ihrer bisher für den Nutzer kostenlosen Dienste nach. Zum anderen sieht sich die Netzgemeinde zunehmend mit dem Griff des staatlichen Regimes nach der Kontrolle über das Internet konfrontiert, muss sie erleben, wie sich der staatliche Moloch die neuen elektronischen Medien zunutze macht, um seine Überwachungsmethoden zu verfeinern und zu perfektionieren. Vor einigen Jahren, im April 2007, wurde die Öffentlichkeit von einer Nachricht des Chaos Computer Club (CCC) über die Existenz sog. „Bundestrojaner“ aufgeschreckt, einer Spionagesoftware, die, einmal im Computer, Laptop oder I-Phone installiert, eine lückenlose Überwachung durch Geheimdienste ermöglicht; der CCC fand ferner heraus, dass diese Spitzelsoftware in einem Programm mit dem vielsagenden Titel ELSTER vorinstalliert war, mit dem künftig jeder Bundesbürger seine Steuererklärung erstatten soll… Erst im letzten Jahr wurde bekannt, dass die neue Handy-Generation, die I-Phones, ein detailliertes Bewegungsprofil des stolzen Besitzers eines solchen Gerätes erlaubt; in Kombination mit der sog. Vorratsdatenspeicherung eröffnet dies den staatlichen Überwachungsbehörden ganz neue Möglichkeiten.
All dies ist ein schlagender Beweis für ein Phänomen, das den niedergehenden Kapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts prägt. Der Konflikt rund um das Internet ist nur ein weiteres Beispiel für die Unfähigkeit und den Unwillen des „senilen Kapitalismus“, der Entwicklung der von ihm selbst geschaffenen Produktivkräfte (das Internet ist bekanntlich eine Erfindung des US-Militärs im Kalten Krieg) freien Lauf zu lassen. Er veranschaulicht angesichts des technisch möglichen freien, weltweiten Zugangs zum Internet und seinen Produkten die ganze Perversion, die heute in der Warenwirtschaft und im Privateigentum an Produktionsmitteln steckt. Und er zeigt, dass bei aller Grenzenlosigkeit des World Wide Web die staatskapitalistischen Regimes dieser Welt keineswegs geneigt sind, auf ihr Primat gegenüber dem Internet zu verzichten, dass sie bereit sind, mit allen Mitteln – angefangen von einer Überwachung Orwellschen Ausmaßes über die Kriminalisierung blutjunger Teenager bis hin zum Abschalten des Internets – ihre Vorherrschaft auch gegenüber diesem gesellschaftlichen Segment zu verteidigen.
Die „Piraten“ – unter vollen Segeln in die bürgerliche Demokratie
Mit den „Piraten“ verhält es sich ähnlich wie einst mit den Grünen: Sie geben falsche Antworten auf eine richtige Frage. So wie die Grünen in ihren Anfängen üben sich die „Piraten“ in urdemokratischen Praktiken und propagieren sie als politisches Gegenmodell zu den etablierten Parteien; Erstere nannten dies „Basisdemokratie“, die Piraten dagegen bevorzugen, angeregt von der Occupy-Bewegung, die Begriffe „Teilhabe“ und „Transparenz“. Doch anders als die Grünen, die die „Basisdemokratie“ in Gestalt der seinerzeit wie Pilze aus dem Boden schießenden Bürgerinitiativen nur als ein Mittel zum Zweck der Durchsetzung ökologischer Politik betrachteten, scheinen die „Piraten“ die „liquid democracy“ selbst als den Hauptzweck ihrer Politik anzusehen. Es ist dieses Versprechen, das die „Piraten“ derzeit insbesondere in der jungen Generation so attraktiv macht: Weg mit der undurchsichtigen Hinterzimmer-Diplomatie, den intriganten Manövern, der Politik nach Gutsherrenart, für eine transparente Politik unter voller Beteiligung der Bevölkerung! Dabei kommt den „Piraten“ der Umstand zugute, dass die sozialen Proteste sich hierzulande noch nicht der Straßen und Plätze bemächtigt haben, wie das beispielsweise in Spanien der Fall ist. Nur so ist zu erklären, dass eine „Partei“ wie die „Piraten“ in die Parlamente katapultiert wird, obwohl sie bisher mit keiner einzigen Silbe auf die brennenden sozialen Fragen eingegangen ist, sieht man einmal von ihrer Forderung nach einem sog. Bürgergeld ab.
Im Grunde rennen die „Piraten“ mit ihrer Forderung nach Partizipation und Transparenz lediglich offene Türen ein. Die Herrschenden in Deutschland haben schon längst begriffen, dass ihr Herrschaftsmodell der „repräsentativen Demokratie“, sprich: der Parteienherrschaft, ein neues Make-up nötig hat. Spätestens mit den live im Fernsehen übertragenen Gesprächen zwischen Gegnern und Befürwortern von „Stuttgart 21“ hat die so genannte Bürgerbeteiligung eine neue Qualität gewonnen – mehr Transparenz geht nicht. Allerorten suchen die etablierten Parteien den „Dialog mit dem Bürger“: Kanzlerin Merkel geht mit ihren „Townhall-Meetings“ hausieren, SPD-Vorsitzender Gabriel schlägt vor, dass auch Nicht-Mitglieder den SPD-Kanzlerkandidaten nominieren dürfen, und auch beim Ausbau des Stromnetzes im Zuge der sog. Energiewende sollen die Betroffenen per „Dialog“ eingebunden werden. Wohin das Auge blickt, „Partizipation“ ohne Ende. Für die politische Klasse überwiegen die Vorteile einer solchen „bürger-beteiligten“ Demokratie. Zwar ist das ganze Prozedere der „Bürgerbeteiligung“ sehr Zeit raubend und sorgt für lange Vorlaufzeiten bei infrastrukturellen Großvorhaben, doch am Ende zählt der politische Gewinn, nämlich eine neue Politur für die bürgerliche Demokratie und ein Zeichen gegen die grassierende „Politikverdrossenheit“.
So sind denn die „Piraten“, ohne es zu wollen, nichts anderes als nützliche Idioten im Dienste der Bourgeoisie. Sie erwecken den Glauben an das bürgerliche Parlament zu neuem Leben, was nirgendwo sichtbarer wird als in der Tatsache, dass es ihnen wie keiner anderen im Bundestag vertretenen Partei gelingt, bisherige Nichtwähler für die Wahlen zu mobilisieren. Sie sind die reformistische Auflösung des Widerspruchs, in dem sich große Teile gerade der jungen Generation, ihre Hauptwähler, befinden: Einerseits mit einer gehörigen Portion Negativität gegenüber dem Überwachungsstaat ausgestattet, drückt sich in ihrem Sehnen nach einer „sauberen“, „transparenten“ Politik andererseits auch eine prinzipiell positive Erwartungshaltung gegenüber dem Parlament, eine ungebrochene Demokratiegläubigkeit ihrer jungen Wähler aus. Ihre Stimmen sind kein Votum für das Programm der „Piraten“, das in seiner Dürftigkeit eh einem Nichts gleicht. Sie sind vielmehr ein Denkzettel für die etablierten Politiker, was in letzter Konsequenz ein – wenn auch negativer – Vertrauensbeweis gegenüber diesem Establishment darstellt.
Noch schwimmen die „Piraten“ auf einer Welle des Erfolges. Der von den Medien erzeugte Hype um die „Piraten“ hat sich verselbstständigt, so dass nicht mit ihrem baldigen Schiffbruch zu rechnen ist. Nichtsdestotrotz stellt sich bereits der erste Gegenwind ein. Eine erste Ahnung davon bekamen die „Piraten“, als in den Medien Informationen über rechtsradikale Umtriebe und den Hitlerfaschismus verharmlosende Äußerungen in ihren Reihen durchsickerten. Das Wohlwollen, das ihnen auch deswegen von der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde, weil sie eben keinen rechts durchwirkten Populismus repräsentieren (was für die deutsche Außenpolitik unvorteilhaft wäre), drohte umzuschlagen. Doch dies war lediglich ein Warnschuss vor dem Bug der „Piraten"; es gelang ihnen, die aufbrandenden Wogen durch entsprechende Klarstellungen wieder zu beruhigen. Komplizierter gestalten sich dagegen die immer heftigeren Auseinandersetzungen rund um die Frage der Urheberrechte. Hier sind es vor allem linksbürgerliche Intellektuelle, Autoren, Musiker und andere Beschäftigte aus dem Kulturbetrieb, die Front gegen die „Piraten“ machen. Eine Aussöhnung zwischen dem Interesse der „Piraten“-typischen Klientel an kostenlosen Downloads und dem Interesse der Künstler an Vergütung ihrer Leistungen ist nicht in Sicht.
Die größte Klippe wartet auf die „Piraten“ allerdings noch, der Schritt von der reinen Protestpartei zu einem festen Bestandteil im politischen Leben der Bourgeoisie. Dabei steht ihnen sozusagen ihr eigener Erfolg im Weg: Während die Grünen sich im parlamentarischen Alltagsleben schnell ihrer basisdemokratischen Folklore entledigt hatten, ohne dabei ihre Identität zu verlieren, und mit ihrer eigentlichen „Kernkompetenz“, der ökologischen Frage, einen dauerhaften Platz im Parteienspektrum errangen, besteht das Hauptanliegen der „Piraten“ in nichts Geringerem als der Durchsetzung der „wahren Demokratie“ in Parlament und Politik. Das heißt, dass sie künftig daran gemessen werden, ob sie ihren hehren Anspruch der inner- wie außerparteilichen Demokratie, die sog. liquid democracy, erfüllen, ob ihnen in den zahlreichen parlamentarischen Ausschüssen der Spagat zwischen totaler Transparenz und der vorgegebenen Geheimhaltungspflicht gelingt. Die „Piraten“ stecken in einem Dilemma: Gelingt ihnen nicht der Sprung aus der Fundamentalopposition, so wird es ihnen so ergehen wie der „Linken“, die, was kein Zufall ist, just zu dem Zeitpunkt in die Versenkung zu verschwinden droht, in dem die „Piraten“ reüssieren. Vollziehen sie aber die Metamorphose zu einer „normalen“ Partei, so verlieren sie alsbald ihren Reiz bei ihren Wählern und drohen ebenfalls zu einer Episode in der Geschichte des bürgerlichen Parlamentarismus zu werden. 18.5.2012
Massaker in Syrien, iranische Krise...
- 1426 Aufrufe
Der Artikel wurde schon auf IKSonline veröffentlicht.
https://de.internationalism.org/IKSonline2012_syrieniranabgrund [423]
Massive Mobilisierungen in Spanien, Mexiko, Italien, Indien… Die gewerkschaftlichen Hürden
- 1306 Aufrufe
Der Artikel wurde schon von IKS-online veröffentlicht.
https://de.internationalism.org/IKSonline2012_gewerkschaftlicheh%C3%BCrd... [424]
Weltrevolution Nr. 173
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 292.04 KB |
- 1910 Aufrufe
Ablehnung der Ferieninitiative in der Schweiz – „Sind die Arbeiter doof?“
- 1985 Aufrufe
Ausgangslage
Im Frühjahr 2012 ist es der offiziellen Schweiz wieder einmal gelungen, nach einem „Volksentscheid“ Verwunderung in der internationalen Presse hervorzurufen. Dieses Mal ging es um die Frage: mehr Urlaub oder nicht. Eine Volksinitiative des zweitgrössten nationalen Gewerkschaftsbundes Travail.Suisse wollte das Recht auf sechs Wochen Ferien für alle ArbeitnehmerInnen in der Verfassung verankern. Der Initiativtext sah vor, dass sich der Ferienanspruch im Jahr nach Annahme des Volksbegehrens auf fünf Wochen erhöht. In den folgenden fünf Jahren sollte der Anspruch jeweils um einen Tag steigen. Die Idee dahinter war laut Abstimmungspropaganda, „so einen gezielten und wirksamen Ausgleich für die gestiegene Belastung am Arbeitsplatz zu schaffen“. Derzeit beziehen die LohnarbeiterInnen in der Schweiz im Durchschnitt fünf Wochen bezahlte Ferien. Gesetzlich garantiert sind für Festangestellte nur deren vier (Art. 329a Obligationenrecht).
Am 11. März 2012 fand die Abstimmung über die Initiative statt. Sie wurde deutlich abgelehnt: 66,5 Prozent der Stimmenden sagten Nein, in keinem einzigen Kanton resultierte ein Ja. Am meisten Zustimmung erhielt die Initiative in der französischsprachigen Westschweiz. Abgelehnt wurde sie allerdings auch dort. Am knappsten war die Ablehnung im Kanton Jura mit rund 51 Prozent Nein-Stimmen. Am deutlichsten verworfen wurde die Initiative im Kanton Appenzell Innerrhoden mit 82 Prozent Nein-Stimmen.
Die Stimmbeteiligung lag bei 45 Prozent. Das heißt, dass 55 Prozent der Stimmberechtigten sich gar nicht beteiligten. Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung hat keinen Schweizer Pass und ist deshalb ohnehin nicht stimmberechtigt.
Schon vor der Abstimmung im Januar 2012 ergaben Meinungsumfragen offenbar folgendes: „Während die Erwerbstätigen aller Alterskategorien der Initiative zustimmen, hat sie bei den Pensionierten keine Ja-Mehrheit (39% Ja, 49% Nein).“ (Travail.Suisse, Medienmitteilung vom 8.1.12) Soviel zu den Zahlen und der übrigen Faktenlage.
Gleich nach der Bekanntgabe des Ergebnisses kam es zu Reaktionen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in andern Ländern. Abgesehen von der Medienberichterstattung, die je nach politischer Couleur die Entscheidung des Stimmvolks verhöhnte oder bewunderte, brach eine Diskussion darüber aus, ob die Schweizer Arbeiter verrückt, ob sie arbeitswütig seien oder nicht wüssten, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen.
Ein paar Fragen, die sich aufdrängen
Aus der Sicht der Arbeiterklasse stellen sich dabei insbesondere folgende Fragen:
Warum stimmen die ArbeiterInnen nicht für mehr Ferien? Gibt es denn da etwas zu verlieren? Wäre die Initiative angenommen worden, wenn alle ArbeiterInnen abgestimmt hätten (auch diejenigen, die keinen Schweizer Pass haben, oder die unter 18-jährigen)? Oder auf einer allgemeineren Ebene: drückt sich in Abstimmungsresultaten ein bestimmter Stand des Arbeiterbewusstseins aus? Sind Abstimmungen eine Messlatte für das Klassenbewusstsein? Ist die Stimmabstinenz (die in der Schweiz meist geringe Beteiligung an Referenden und Wahlen) Ausdruck einer Politikverdrossenheit, eines Illusionsverlustes gegenüber der parlamentarischen Demokratie?
Diese Fragen stellen sich natürlich nicht allein aufgrund einer einzelnen seltsamen Abstimmung in der Schweiz. Vielmehr rieben sich auch in Ägypten in den letzten Wochen viele Revolutionäre vom Tahrirplatz die Augen, als sie in den Präsidentschaftswahlen plötzlich vor der korrekt demokratischen, aber alles andere als revolutionären Alternative standen, entweder einen Luftwaffengeneral und ehemaligen Premierminister Hosni Mubaraks (Ahmad Schafiq) oder einen Islamisten (Mohammed Mursi) zu wählen. Ist dies alles, was vom Arabischen Frühling übrig bleibt?
Wir werfen solche Fragen hier nicht auf, um ein Abstimmungsergebnis im Hinblick auf künftige Urnengänge präziser zu analysieren. Dieser Aspekt der Einschätzung der Stärke oder Schwäche der bürgerlich-demokratischen Herrschaft ist zwar interessant. Aber zentral für die kommenden Kämpfe unserer Klasse (nicht nur in der Schweiz) scheint uns die umgekehrte Perspektive zu sein – jene von unten, der Bruch mit der Logik dieser bürgerlichen Demokratie. Dabei sei hier im Sinne einer Begriffsklärung voraus geschickt, dass es für uns zwischen der repräsentativen Demokratie (z.B. à la française) und der direkten Demokratie (nach Schweizer Art) keinen wesentlichen Unterschied gibt. Beiden gemeinsam ist das Prinzip der Stellvertreterpolitik anstelle der Selbsttätigkeit, die umgekehrt beispielsweise in Vollversammlungen der Indignados in Spanien oder in den Arbeiterräten gelebt worden ist.
Diskussionen auf zwei Internet-Foren
Interessant finden wir insbesondere die Diskussionen auf zwei Internet-Foren, auf denen sich internationalistische Stimmen zu treffen pflegen. Das eine ist das englischsprachige Forum libcom.org, das andere das Forum undergrounddogs.net aus der Schweiz. Werfen wir einen Blick auf ein paar Argumente, die da ausgetauscht worden sind. Zunächst ein paar Kommentare aus libcom.org, übersetzt auf Deutsch. Schon bald fand sich da der Erste, der einfach schrieb:
- „Idioten“ – gemeint waren damit, aus dem Zusammenhang zu schliessen, die „Schweizer“. Ob Schweizer Stimmbürger oder Schweizer Arbeiter, blieb zunächst unklar.
- Ein weiterer Kommentar nahm dann aber Bezug auf das Klassenbewusstsein: Er habe in einem anderen Diskussionsstrang auf dem Forum gelesen, „die Schweizer seien eine der am wenigsten klassenbewussten Bevölkerungen auf der Welt. Ich bin geneigt, ihm/ihr zu glauben.“
- Ein dritter Teilnehmer brachte eine neue Sichtweise in die Diskussion. Er fand, das Abstimmungsresultat sei “ein gutes Bespiel dafür, dass es wenig Sinn macht, den Kapitalismus häppchenweise zu ‘demokratisieren’, denn in einem gewissen Sinn (innerhalb des Kapitalismus) ist es vernünftig, gegen deine Klasseninteressen zu stimmen – wie die Genossenschaftsarbeiter, die Lohnkürzungen absegnen.“
- In der gleichen Richtung intervenierte ein Vierter: “Es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie das Proletariat ständig im Dilemma ist. Egal was es tut, zieht es den Kürzeren.”
- Jemand, der sich auf den hier eingangs zitierten Ausruf bezog, warf die Frage auf: “Macht es dich zum Idioten, wenn du so abstimmst, wie es dir ein quasselnder Idiot vorsagt? Irgendwie schon, aber das macht es auch nicht besser …”
Individuum – Kollektiv
Da sind wir also wieder einmal am Punkt angelangt, wo das Bewusstsein reift, dass wir alle verschiedene Teile der gleichen kollektiven Bewusstseinsentwicklung sind – die sich leider noch auf ziemlich bescheidenem Niveau bewegt, aber eben doch bewegt. Jemand auf libcom.org sprach es offen so aus:
- “Wenn es da Idioten gibt, so sind wir alle Idioten. Zeig mir einen (nationalen/regionalen/lokalen) Teil der Arbeiterklasse, der sich nicht irgendwann verarschen und in die scheiss Chef-Klassenpropaganda einlullen liess. Wenn ad infinitum wiederholt wird, dass mehr Ferien bekanntermassen das Ende der Welt bedeuten, so ist es keineswegs eine Überraschung, wenn Arbeiter einen solchen Vorschlag ablehnen.“
Welches Zwischenfazit können wir in Frage, ob die Arbeiter Idioten sind, ziehen? Wenn die Arbeiter den bürgerlich-demokratischen Wahlzettel einwerfen, haben sie schon verloren. Ihnen daraus auch noch einen moralischen Vorwurf zu machen bringt nichts. Es geht um unsere Klasse.
Da
wird es Zeit, auf die Diskussion im undergrounddogs.net zu schauen. Einer
schlägt hier den Bogen zur alten Einsicht (aus dem Kommunistischen Manifest),
dass die herrschenden Ideen einer Zeit stets nur die Ideen der herrschenden
Klasse waren:
„Ich finde das Resultat nicht so
erstaunlich, sonst könnte sich ja eine Minderheit wie die Bourgeoisie sie ist,
nicht an der Macht halten, wenn sie nicht fähig ist, ihre Ideen
durchzubringen.“ Ein anderer konkretisierte den Stand des Bewusstseins bei den
ArbeiterInnen so: „Die Arbeiter machen
sich in der Regel eben gerade keine Gedanken über wirkungsvollen Klassenkampf.
Eben weil sie sich andauernd überlegen wie sie sich - individuell - am besten
im Kapitalismus einrichten können. Und weil sie denken, dass ihr Wohl vom Gang
der kapitalistischen Geschäfte und vom Abschneiden der Schweiz in der
Standortkonkurrenz abhängt, verhalten sie sich entsprechend. Mehr Ferien, das
ist ja ein Konkurrenznachteil gegenüber dem Ausland und gefährdet
Arbeitsplätze. Die Konsequenz heisst dann halt: williges und billiges Anhängsel
will ich sein.“
Die Diskussionsteilnehmer verfolgen meist mehrere Ideen gleichzeitig, die sie rüberbringen wollen. Wir möchten uns hier bewusst auf einen Aspekt konzentrieren, auf den Aspekt der kollektiven Bewusstseinsentwicklung; natürlich sind Missverständnisse (sei es kreativer oder destruktiver Art …) nie ausgeschlossen. Die Missverstandenen werden sich hoffentlich melden! Aber eines sticht doch aus all den bisher zitierten Argumenten heraus: Wenn sich die Summe aller Arbeiter als Stimmbürger sowohl der Form als auch dem Inhalt nach zu 100 Prozent in der kapitalistischen Logik bewegt (und genau dies geschieht bei Volksabstimmungen), so ist es kein Wunder, wenn ein kapitalistisch sinnvoller Entscheid herausschaut – selbst wenn scheinbar die „Arbeiterklasse“ die Möglichkeit gehabt hätte, anders zu entscheiden. Wie hätte sie denn sonst entscheiden sollen? Für die Revolution? Die Revolution wird gerade nicht von vereinzelten Individuen, die getrennt jedes für sich zur Abstimmungsurne gehen und anonym ihren Zettel einwerfen, gemacht, sondern von der Masse der ProletarierInnen im Kollektiv, selbstbestimmt und selbstorganisiert.
Nation – Klasse – Klassenterrain
Im Kern geht es also um die Frage, ob sich die ArbeiterInnen ausschliesslich in der Logik des Kapitals bewegen, oder ob sie sich eine eigene Logik zulegen. Diese Logik hat einerseits mit der Form zu tun: Stellvertretung durch demokratische (individuelle) Stimmabgabe oder (kollektive) Selbsttätigkeit und Selbstorganisation. Andererseits hat die proletarische Logik auch eine inhaltliche Seite. Es geht darum, sich ein eigenes Terrain zu schaffen und sich darauf zu bewegen. Ein Genosse auf undergrounddogs.net:
„Es gibt da doch zwei
verschiedene Terrains.
1. das demokratisch-nationale Terrain.
Dies ist für den Klassenkampf zwar nicht das wichtige, aber es war nun mal eine
Abstimmung. Auf der Ebene stimmt zwar einerseits das, was R [der zuletzt zitierte
Genosse] sagt, dass die Arbeiter hier als
einzelne (Insassen der Nation) agieren und sich diese Konkurrenzgedanken
machen. Zumindest die, die so abgestimmt haben. Zusätzlich sollte es auch klar
sein, dass auf dieser Ebene sowieso nicht gewonnen werden kann, weil hier
antagonistische Interessen gegeneinander stehen, wo ein grosser Teil der
Abstimmenden eh schon auf der anderen Seite steht, von Kleinbürgern aufwärts.
Rechnerisch fällt da also schon einiges weg. Zusätzlich kommt noch hinzu, dass
ein grosser Teil von denen, die ein unmittelbares Interesse an so einer
Verbesserung hätten (sagen wir mal, die Proletarier seien hierzulande etwa zu Hälfte
Ausländer) eh aus der demokratischen Willensbildung ausgeschlossen sind.
Von der Seite her kann man die Aussage von R auch gar nicht beurteilen, weil
man dafür erst mal untersuchen müsste: Wer hat alles abgestimmt? Wie haben die
verschiedenen Klassen abgestimmt? Was hätten diejenigen gestimmt, die nicht abstimmen
dürfen? usw. Das mal zur demokratisch-arithmetischen Wahlhuberei.
2. das Klassenterrain.
Der Punkt ist doch, dass diese ganze Abstimmung sich um den alten Antagonismus
dreht, er aber nicht als ein solcher behandelt wird, sondern die Frage nach dem
Wohl der Nation im Zentrum einer solchen Abstimmung steht. Der
Klassenantagonismus wird also gar nicht erst zur organisatorischen Struktur so
einer Abstimmung. Man müsste sich also fragen, wie man das Interesse der
Arbeiter als Klasseninteresse organisieren kann. Also Formen zu finden, wo
nicht Schweizer Kapitalisten und Schweizer Proletarier gemeinsam über das Wohl
der Nation abstimmen, sondern wie man den Klassenkampf so organisieren kann,
dass unsere Seite zu maximaler Stärke kommt und wie man gegen die anderen
gewinnt. Das ist aber keine Frage demokratischer Willensbildung, sondern eine
Frage der Macht.“
Das sind wohl die entscheidenden Fragen: Nation oder Klasse, Kapitallogik oder proletarisches Klassenterrain.
Schlussfolgerungen
Wenn wir auf die eingangs aufgeworfenen Fragen zurückblicken, können wir aufgrund der verschiedenen Argumente folgende Schlussfolgerung ziehen:
In einem Abstimmungsresultat im Rahmen der repräsentativen oder direkten bürgerlichen Demokratie kommt das Bewusstsein der Arbeiterklasse nur mehrfach gebrochen zum Ausdruck:
1. Zunächst einmal sind die Stimmberechtigten keineswegs identisch mit der Arbeiterklasse; viele ArbeiterInnen sind nicht stimmberechtigt, und ein grosser Teil des Stimmvolkes ist nicht proletarisch. Im Abstimmungszirkus wird das Proletariat im Volk der Staatsbürger aufgelöst.
2. Noch wichtiger ist aber das Prinzip der Vereinzelung in der demokratischen Abstimmung: Jeder Arbeiter/jede Arbeiterin geht als Individuum und als StaatsbürgerIn anonym einen Zettel einwerfen, auf dem nur ein Ja oder ein Nein steht. Die Volksabstimmung ist das Gegenteil einer kollektiven Debatte. Die Politiker führen stellvertretend eine (Schein-)Debatte. Die StimmbürgerInnen sollen dann Ja oder Nein dazu sagen. Das Resultat dieser „Partizipation“ ist eine rein quantitative Grösse, wie der Preis einer Ware. Die differenzierte Qualität einer proletarischen Debatte wäre blosser Störfaktor. Das Gefühl, dass man als Ausgebeuteter ein- und derselben Klasse angehört und als Kollektiv ein Gewicht hätte, kann so gar nicht erst aufkommen.
3. Ein Ausbrechen aus der vorgegebenen kapitalistischen Logik ist nicht möglich. Das Proletariat kann im Rahmen dieser demokratischen Spielregeln innerhalb eines bestimmten Nationalstaats nur Ja oder Nein sagen zu (Schein-)Lösungen innerhalb dieses Systems, selbst wenn sich immer mehr ProletarierInnen bewusst werden, dass es eine grundlegende Umwälzung der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft bedarf.
Damit ist auch gesagt, dass selbst eine perfektionierte bürgerliche Demokratie, z.B. mit einem AusländerInnen-Stimmrecht, kein brauchbares Mittel für unsere Interessen ist. Vielmehr setzt eine proletarische Revolution die Selbsttätigkeit, die kollektive Debatte und die Selbstorganisierung immer grösserer Massen unserer Klasse voraus. Nur so lässt sich eine neue Welt ohne Ausbeutung von Mensch und Natur schaffen.
Noch nicht entschieden ist damit allerdings die Frage, ob aus einer grossen Stimmabstinenz, z.B. im konkreten Fall der Schweiz, abgeleitet werden kann, dass die Leute von der Politik verdrossen oder sogar tendenziell revolutionär sind. Die letztere Schlussfolgerung wäre sicher falsch, und zwar genau wegen des zuvor beschriebenen Prinzips: Eine Revolution setzt die bewusste Selbsttätigkeit der Massen voraus, d.h. eine aktive Haltung. Die heute praktizierte Wahlabstinenz ist aber in den allermeisten Fällen ein passiver Reflex, der sicher mit Resignation zu tun hat, aber nur ausnahmsweise mit einer alternativen Perspektive.
Ob eine Politikverdrossenheit herrscht, lässt sich nicht direkt an einem bestimmten Stand der Wahlabstinenz ablesen. Gerade bei den Wahlen stellt man oft fest, dass sich eine erste Empörung im „Volk“ gegen eine bestimmte Regierung zunächst einmal in einer hohen Wahlbeteiligung ausdrückt; die WählerInnen wollen die regierende Partei abstrafen. Die Desillusionierung verschafft sich Luft – in einer neuen Illusion.
Der Weg zum Bruch mit der demokratischen Ideologie ist noch lang. Dieser Wall, der die herrschende Ordnung schützt, ist deshalb ein perfides Hindernis, weil er nirgends physisch sichtbar ist, sondern in den Köpfen der ProletarierInnen existiert und sich ständig reproduziert, solange wir nicht gemeinsam die Stärke und das Selbstvertrauen für die Befreiung gewinnen. Es ist aber sicher nötig, dass revolutionäre Minderheiten der Klasse beginnen, den Weg zur Überwindung dieses Walls abzustecken.
GF, 10.7.12
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
Ankündigung einer Buchveröffentlichung: Dietmar Lange: Revolution und Massenstreik – Berlin im März 1919
- 2471 Aufrufe
In der Tat stellten die Verwerfungen des Krieges in allen Ländern die an ihm teilgenommen hatten, die Bedingungen für vielfältige soziale Unruhen, Massenstreiks und Revolutionen her, zeigten aber auch die Grenzen der alten Arbeiterbewegung auf. Ein besonders symptomatisches Beispiel hierfür ist die Revolution von 1918/19 in Deutschland, eines der am stärksten industrialisierten Länder in Europa mit der größten sozialistischen Massenpartei und Gewerkschaftsbewegung.
Zumeist wird mit Verweis auf die anfänglich dominante Position der im Krieg kollaborierenden Mehrheitssozialdemokratie und die schnelle Niederlage revolutionärer Kräfte im „Spartakusaufstand“ vom Januar 1919, ein sozialrevolutionärer oder gar „sozialistischer“ Charakter der Revolution abgesprochen. Bisher weniger beachtet wird dabei jedoch eine breite Streikbewegung im Frühjahr 1919, welche die industriellen Zentren in Deutschland erschütterte. Getragen wurde sie von den im November 1918 entstandenen Arbeiterräten, welche als Organisationsformen proletarischer Selbstermächtigung revitalisiert wurden. Erstmals erhielten dabei Sozialisierungsforderungen einen zentralen Stellenwert in der Bewegung und drückten damit die eigentliche sozialrevolutionäre Komponente der Revolution aus. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichte die Bewegung im Generalstreik vom März 1919 in Berlin, der schließlich im bis dahin größten Blutbad, durch Freikorps und sozialdemokratische Führungsebene, ertränkt wurde.
In „Massenstreik und Schießbefehl“ werden diese Ereignisse in Berlin vom März 1919 unter Auswertung der verfügbaren Quellen rekonstruiert. Dabei geht es vor allem um eine Analyse der Streikbewegung auf lokaler Ebene und ihrer Verknüpfung mit der Berliner Rätebewegung seit November 1918. Die Hauptthese besteht darin, dass sich in der Streikbewegung vom Frühjahr 1919 die sozialrevolutionären Erwartungen der Arbeiter und Soldaten vom November 1918 nun gegen die neuen parlamentarischen Institutionen und die alte sozialdemokratische Parteiführung ausdrückten. Der politische Radikalisierungsprozess vollzog sich allerdings parallel zur Restauration bürgerlicher und monarchistischer Kräfte in Heer und Verwaltung und traf daher bei seiner Eruption auf eine bestens vorbereitete Gegenrevolution. Dennoch bestand, so die These, für einen kurzen Zeitraum die Möglichkeit die gegenrevolutionäre Entwicklung aufzuhalten oder wieder in die Richtung einer sozialrevolutionären Perspektive zu lenken. Die Bedingungen hierfür und die Gründe für das Scheitern dieser Möglichkeiten sind der Gegenstand des Buches.
Titel: Dietmar Lange, Massenstreik und Schießbefehl. Generalstreik und Märzkämpfe in Berlin 1919, Edition Assemblage, Münster 2012.
[1]Friedrich Engels, Einleitung zu Sigismund Borkheims Broschüre "Zur Erinnerung für die deutschen Mordspatrioten. 1806-1807", in: Karl Marx; Friedrich Engels, Werke, Band 21, 5. Auflg., Berlin 1975, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage 1962, Berlin/DDR. S. 346-351, Zitat S. 351.
Politische Strömungen und Verweise:
- Rätekommunismus [427]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
- März 1919 Deutschland [428]
Der Kapitalismus besteht weltweit, die Krise auch!
- 1951 Aufrufe
Aber diese historische Krise des Kapitalismus wurde zum Teil vertuscht und unter einem Berg von Lügen und Propaganda begraben. In jedem Jahrzehnt wurde das gleiche Register gezogen: Ein Land, eine Weltregion oder ein Wirtschaftsbereich, dem es etwas besser ging als den anderen, wurde besonders herausgehoben, um uns einzutrichtern, die Krise sei keine Fatalität, es reiche aus, die richtigen „Strukturreformen“ einzuleiten, damit der Kapitalismus wieder zu seiner Dynamik zurückfinde und Wachstum und Wohlstand bringe. In den 1980-1990er Jahren wurden Argentinien und die „asiatischen Tiger“ als Erfolgsmodelle dargestellt, dann, von 2000 an, galten Irland und Spanien als Aushängeschilder. Natürlich stellten sich diese „Wunder“ samt und sonders als Schimären heraus: 1997 wurden die „asiatischen Tiger“ als „Papiertiger“ entblößt, Ende der 1990er Jahr musste Argentinien seine Zahlungsunfähigkeit erklären, heute stehen Irland und Spanien am Abgrund. Jedes Mal wurde das “unglaubliche Wachstum” durch Schulden finanziert und jedes Mal führte die Schuldenlast dazu, dass die willkürlich aufgebauschten Hoffnungen allesamt verflogen. Und als ob man auf unser schlechtes Gedächtnis setzt, tischt man uns jetzt wieder die gleichen Lügengeschichten und Schönfärbereien auf. Schenkt man ihnen Glauben, so krankt Europa an hausgemachten Problemen: Schwierigkeiten, Reformen durchzusetzen und die Schulden der Mitglieder auf alle umzulegen, ein Mangel an Einheit und Solidarität unter den Ländern, eine Zentralbank, der die Ankurbelung der Wirtschaft nicht gelingt, weil sie nicht Geld nach ihrem Belieben drucken kann. Aber diese Argumente ziehen nicht mehr. Die USA und ihre Fed, Weltmeister im willkürlichen Ankurbeln der Notenpresse seit 2007, stehen ebenfalls schlecht da.
Eine große Entdeckung: Auch den BRIC-Staaten geht die Luft aus
Mit der Abkürzung „BRIC“ bezeichnet man die boomenden Wirtschaften der letzten Jahre: Brasilien, Russland, Indien und China. Wie bei jedem Eldorado entspricht auch ihr „guter Zustand“ eher einem Mythos als der Wirklichkeit. All diese „Booms“ werden im Wesentlichen durch Schulden finanziert und enden da, wo ihre Vorgänger auch gelandet sind. Auch sie werden vom Würgegriff der Rezession erfasst. Schon jetzt hat sich der Wind gedreht.
In Brasilien sind in den letzten zehn Jahren die Verbraucherkredite buchstäblich explodiert. Ähnlich wie in den USA im letzten Jahrzehnt verfügen die Privathaushalte in Brasilien jedoch über immer weniger Mittel, um die Schulden zurückzuzahlen. Die Zahlungsunfähigkeit von Privatkonsumenten bricht alle Rekorde. Die Währungsblase gleicht exakt der spanischen Blase, bevor diese platzte: Jüngst errichtete Gebäude – Wohn- und Bürohäuser – stehen oft weitestgehend leer.
In Russland beträgt die Inflation offiziell sechs Prozent, andere Instanzen sprechen von 7,5 Prozent. Und die Obst- und Gemüsepreise sind im Juni und Juli gewaltig angestiegen, nämlich um 40 Prozent!
In Indien nimmt das Haushaltsdefizit weiter gefährlich zu; für das Jahr 2012 werden 5,8 Prozent des BIP erwartet. Die Industrieproduktion ist rückläufig (-0,3 Prozent im ersten Quartal 2012), der Privatverbrauch ist ebenso rückläufig; die Inflation hat zugenommen (7,2% im April, im letzten Oktober kletterten die Lebensmittelpreise sogar um zehn Prozent). Indien wird heute von der Finanzwelt als risikoreich eingestuft. Sein Rating beträgt BBB (die niedrigste Bewertung der Kategorie „untere mittlere Qualität“). Indien läuft Gefahr, demnächst jener Reihe von Ländern zugeordnet zu werden, bei denen man von Investitionen ganz abrät.
In China flacht die wirtschaftliche Aktivität langsam weiter ab. Im Juni war die Produktion zum achten Mal in Folge rückläufig. Die Wohnungspreise sind zusammengebrochen, die Aktivitäten der Bauindustrie scheinen sich im freien Fall zu befinden. Ein Beispiel ist sehr aufschlussreich: Allein in Beijing stehen mehr Wohnungen leer als in den USA zusammengenommen (3,8 Millionen in Beijing im Vergleich zu 2,5 Millionen leer stehender Wohnungen in den USA) (https://www.germanyinews.com/Nachrichten-920819-Peking-Immobilien-Leerst... [429]). Doch am bedrohlichsten sind ohne Zweifel die Haushaltsdefizite in den Provinzen. Denn wenn der Staat nicht offiziell unter der Schuldenlast erstickt, dann geschieht dies nur aufgrund von Buchungstricks, mit denen beispielsweise all diese Defizite auf die Kommunen abgewälzt werden. Zahlreiche Kommunen in den Provinzen stehen am Rand des Bankrotts.
Die Investoren sind sich des schlechten Zustands der BRIC-Länder bewusst. Deshalb flüchten sie aus den vier Landeswährungen – Real, Rubel, Rupie und Yuan -, deren Wechselkurse seit Monaten absacken.
In den USA platzt die Blase der Studentenkredite!
Die Stadt Stockton, Kalifornien, hat am 26. Juni Zahlungsunfähigkeit angemeldet, wie vor ihr bereits Jefferson County, Alabama und Harrisburg, Pennsylvania. Dabei haben die 300.000 Einwohner Stocktons alle möglichen notwendiger Opfer für die „Sanierung“ erbracht: Der Stadthaushalt wurde um 90 Millionen Dollar gekürzt, 30 Prozent der Feuerwehrleute und 40 Prozent der anderen städtischen Beschäftigten wurden entlassen, die Löhne der städtischen Beschäftigten um 11.2 Millionen Dollar wurden gekürzt, die Renten drastisch reduziert. Dieses sehr konkrete Beispiel spiegelt den ganz realen Auflösungszustand der US-Wirtschaft wider. Die Haushalte, Betriebe, Banken, Städte, die Bundesstaaten und die Washingtoner Regierung – alle sind davon betroffen. All diese Teile der Wirtschaft werden buchstäblich unter einem Schuldenberg begraben, der nie zurückbezahlt werden wird. Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass die anstehenden Verhandlungen zwischen Demokraten und Republikanern über die Schuldengrenze wie im Sommer 2011 zu einem Psychodrama zu werden drohen. Eigentlich steht die amerikanische Bourgeoisie vor einem unlösbaren Problem: Um die Wirtschaft anzukurbeln, muss sie sich immer mehr verschulden. Um nicht pleite zu gehen, muss sie die Verschuldung reduzieren.
Jeder verschuldete Teil der Wirtschaft wirkt wie eine Mine: Hier steht eine Bank kurz vor dem Bankrott, dort ist eine Stadt oder ein Betrieb nahezu pleite… und wenn eine Mine hochgeht, besteht die Gefahr einer Kettenreaktion.
Heute droht die “Blase der Studentenkredite“ zu platzen, befürchten jedenfalls die Finanzexperten. Das Studium wird immer kostspieliger, immer weniger Jugendliche finden einen Job nach ihrem Studienabschluss. Mit anderen Worten – die Studentenkredite werden immer umfangreicher, und das Risiko der Zahlungsunfähigkeit wird immer wahrscheinlicher. Konkret heißt das:
- Am Ende ihres Studiums sind die US-Studenten im Durchschnitt mit 25.000 Dollar pro Kopf verschuldet;
- Die laufenden Studentenkredite übertreffen sogar die Verbraucherkredite in den USA; sie betragen ca. 904 Milliarden Dollar (und haben sich während der letzten fünf Jahre praktisch verdoppelt); dies entspricht ca. sechs Prozent des BIP.
- Die Arbeitslosigkeit der Universitätsabsolventen unter 25 Jahren liegt über neun Prozent.
- 14 Prozent der Diplominhaber, die sich verschuldet haben, werden drei Jahre nach ihrem Studienabschluss zahlungsunfähig.
Dieses Beispiel ist sehr typisch dafür, was aus dem Kapitalismus geworden ist: ein krankes System, das seine Zukunft (im wahren Sinne des Wortes) nur noch mehr mit Hypotheken belasten kann. Um zu überleben, müssen die Jugendlichen sich heute verschulden und die Gehälter von morgen, die ihnen nicht ausgezahlt werden, „investieren“. Es ist kein Zufall, wenn auf dem Balkan, in England oder in Quebec in den letzten beiden Jahren die neue Generation mit massiven Protestbewegungen auf die Erhöhung der Studiengebühren reagiert hat (siehe Artikel auf unserer Webseite dazu). Mit Anfang 20 von einem Schuldenberg erdrückt zu werden, um später arbeitslos oder unterbezahlt zu sein - das führt uns die Zukunftslosigkeit im Kapitalismus vor Augen. Die USA sind wie Europa, ja die ganze Welt krank. Unter dem Kapitalismus wird es keine wirkliche und dauerhafte Gesundung geben, denn dieses Ausbeutungssystem ist unheilbar krank.
Wenn es trotz dieses Artikels immer noch Leser gibt, die ein wenig Hoffnung haben und glauben, dass ein „Wirtschaftswunder“ noch möglich ist, so sei ihnen gesagt, dass auch der Vatikan in den roten Zahlen steckt…
- Auf die Entwicklung der Krise in Deutschland werden wir in kürze in einem gesonderten Artikel eingehen.
Pawel, 6. 7. 2012.
(1) Allein in Madrid werden jeden Tag 40 Familien aus ihren Wohnungen geholt. Laut der Bürgerplattform PAH, die in allen spanischen Städten versucht, Zwangsräumungen zu verhindern, wurden seit Beginn der Krise rund 300.000 Zwangsvollstreckungen ausgesprochen. 125.000 Familien wurden bereits vor die Tür gesetzt. Bei den Gerichten sind weitere anderthalb Millionen Fälle anhängig. "Das sind fast zwei Millionen Familien, die am Rande der Gesellschaft leben, eine echte Zeitbombe", resümiert PAH-Sprecher José Maria Ruiz die Lage. In Spanien gibt es 3,1 Millionen leer stehende Wohnungen. (https://www.welt.de/wirtschaft/article13939609/Dutzende-spanische-Famili... [430])
Aktuelles und Laufendes:
- Weltwirtschaftskrise [333]
Die utopistischen Vorläufer des wissenschaftlichen Sozialismus
- 3644 Aufrufe
Der sozialistische Gedanke, der in unserer Zeit stärker als je die Geister bewegt, ist nicht erst in der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit lebendig geworden, sondern er kann auf eine Jahrtausende lange Geschichte zurückblicken. Das was man heute gemeinhin unter Sozialismus oder Kommunismus versteht, der proletarische Sozialismus, ist zwar jungen Datums, ist kaum ein Jahrhundert alt. Aber zu allen Zeiten hat es Denker gegeben, die, wenn auch gefühlmäßig und unklar, der auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhenden Gesellschaft ein neues Kulturideal gegenüberstellten, die einen Zustand herbeisehnten, in dem nicht mehr Willkür und Macht, sondern Recht und Gerechtigkeit bestimmend wären für die Beziehungen von Mensch zu Mensch. Alle diese Denker können sich Sozialisten nennen, können darauf Anspruch erheben, als Sozialisten anerkannt zu werden; denn sie alle weisen in ihrer Zielsetzung auf das Ideal des Sozialismus hin. Es kann aber nicht wundernehmen, dass über dieses eine, allen sozialistischen Denkern gemeinsame Ziel hinaus die Gedanken dieser verschiedenen Sozialisten in mannigfacher Weise von einander abweichen. Klar und deutlich lassen sich in der sozialistischen Geistesweit namentlich zwei Strömungen unterscheiden, in die wir die Gesamtheit der sozialistischen Systeme gliedern wollen: 1. der utopische oder naturrechtliche Sozialismus, auch als „nationaler" Sozialismus bezeichnet, und 2. der entwicklungsgeschichtliche, moderne oder wissenschaftliche Sozialismus: der Marxismus.
Alle sozialistischen Theorien, alle sozialistischen Denker lassen sich in eine dieser beiden Gruppen einordnen. Unsere Aufgabe ist es nun, die gemeinsamen Züge und die Unterschiede dieser Spielarten des Sozialismus festzustellen. Gemeinsam ist dem utopistischen mit dem modernen Sozialismus: 1. der Gegensatz gegen die bestehende Gesellschaftsordnung 2. das Ziel einer von Ausbeutung und Unterdrückung freien Gesellschaft. Die Scheidung beginnt bereits, sobald es sich um: 1. eine nähere Kennzeichnung dieses Zieles handelt. Der utopische Sozialismus ergeht sich in weitschweifigen Darstellungen des "Zukunftsstaates". dessen „vernünftige" und „gerechte" Einrichtungen genau beschrieben werden, als ob sie schon verwirklicht wären. Es ist eines der Kennzeichen des Utopismus, dass seine literarischen Erzeugnisse häufig nichts anderes sind als Beschreibungen der sozialen Zustände von Ländern, die es in Wirklichkeit nicht gibt, die nur in der Phantasie des betreffenden Schriftstellers existieren. Daher auch der aus dem Griechischen stammende Name „Utopie", das heißt Nicht‑Ort, Nirgendwo. Wie dieser ersehnte Zukunftsstaat im Einzelnen aussieht, darüber gehen die Wünsche der Utopisten selbst welt auseinander, darüber denkt z.B. Thomas Morus ganz anders als Fourier. Das wesentliche ist an dieser Stelle nur, dass die Utopisten auf die genaue Ausmalung des künftigen Reiches das Hauptgewicht legen. Damit stehen sie im Gegensatz zu den modernen Sozialisten: diese haben es im Allgemeinen mit Recht abgelehnt zu sagen, wie sie sich den Zukunftsstaat" im Einzelnen „vorstellen", und sich darauf beschränkt. die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die Aufhebung der kapitalistischen Gesellschaft und der Klassengegensätze und die Schaffung der gleichen EntwicklungsmögIichkeiten für alle als die Grundlagen der künftigen Gesellschaft aufzuzeigen.
Dieser Unterschied in der Zielsetzung führt uns unmittelbar auf: 2. die Verschiedenheit in der Methode, d.h. der Begründung der sozialistischen Anschauung. Hier liegt rechteigentlich der springende Punkt, der wesentlichste Unterschied zwischen utopischen und wissenschaftlichen Sozialismus: a) die Utopisten begründen ihre Forderungen naturrechtlich, d.h. sie stellen der bestehenden „unnatürlichen" Gesellschaftsordnung eine andere, bessere gegenüber, die sie für die „natürliche" Ordnung ausgeben. Mit anderen Worten: die Utopisten erheben sittliche Forderungen, die sie nicht aus den gegebenen Verhältnissen, sondern aus ihrer höheren Einsicht herleiten. Die Utopisten sind Erfinder einer neuen, bisher unbekannten Gesellschaftsordnung. Der Utopismus sagt, was „gut" ist und daher kommen soll. b) die modernen wissenschaftlichen Sozialisten, voran Marx und Engels, leiten das sozialistische Ziel historisch aus dem bisherigen Verlauf der Geschichte und der Erkenntnis der gegenwärtigen Verhältnisse her. Es gibt für sie keine „natürliche", über Zeit und Raum erhabene Ordnung, sondern jeder Epoche ist die ihr eigene Ordnung „natürlich", und: „Alles was besteht, ist welt, dass es zugrunde geht". Der Marxismus stellt keine moralischen Forderungen auf, sondern er sagt, was nach wissenschaftlicher Einsicht kommen muss. Marx ist kein Erfinder bisher nicht existierender Dinge, sondern ein Entdecker von Zuständen, die zwar bisher unbekannt waren, aber doch schon im Keime in der bestehenden Gesellschaft schlummerten. Kurz: der wissenschaftliche moderne Sozialismus sagt, was notwendig ist und daher kommen muss und kommen wird. 3. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen utopischen und wissenschaftlichen Sozialismus liegt in der Taktik, der Anschauung über den Weg zum Ziel. Dieser Gegensatz ergibt sich mit Notwendigkeit aus dem obigen:
a) Die Utopisten, soweit sie überhaupt die Frage nach dem Weg zum Ziel aufwerfen (was keineswegs durchgehend der Fall ist), wollen den Sozialismus sozusagen „machen", künstlich herbeiführen. Sie glauben, dass es nur des Planes eines klugen Kopfes bedürfe, um alle Menschen von der Vortrefflichkeit der sozialistischen Ordnung zu überzeugen und die Reichen und Großen dieser Welt zum freiwilligen Aufgeben ihrer Vorrechte, ja sogar zur Hilfeleistung zu bewegen. Als Mittel dazu dient ihnen neben der Überredung vor allem das soziale Experiment: die Utopisten haben zahlreiche kommunistische Gemeinwesen nach ihren Plänen errichtet, um durch die Macht des Beispiels Anhänger für ihre Ideen zu gewinnen und zugleich den Keim für die künftige Gesellschaft zu legen. Alle diese Versuchskolonien haben sich nicht lange behaupten können innerhalb einer ganz anders gearteten Welt. Klassenkampf und revolutionäre Betätigung als Mittel zum Ziel lehnen die Utopisten ab: sie stützen sich überhaupt nicht auf das Proletariat als Klasse, sie treten nicht als Interessenvertreter der Lohnarbeiterschaft auf, sondern als Vertreter aller Armen und Bedrängten. Auch das ist erklärlich; denn zu der Zeit, als der Utopismus in Blüte stand. gab es noch gar keine zum Bewusstsein ihrer selbst gelangte Lohnarbeiterklasse. Das moderne Proletariat steckte noch in den Kinderschuhen: als es erst zum Klassenbewusstsein erwacht war, da war notwendig auch die Zeit des unklaren Utopismus vorbei.
b) Der wissenschaftliche moderne Sozialismus will keine künstlichen Gebilde schaffen, sondern erwartet alles von der notwendigen Entwicklung, die durch menschliches Eingreifen zwar gefördert oder gehemmt werden kann. Nicht das „Genie" wird die künftige Gesellschaft durch Erfindung eines klugen Planes herbeiführen: denn es übersteigt die Kraft eines einzelnen, der Weltgeschichte ohne weiteres die Bahn zu weisen. Auch die Hoffnung auf Hilfe seitens der Reichen und Mächtigen wird als utopistisch abgelehnt; denn nie werden sich die herrschenden Klassen dazu bequemen, freiwillig das Feld zu räumen. Soweit es menschlichen Eingreifens bedarf, um die kommende Entwicklung zu fördern und Hindernisse aus dem Weg zu räumen, erwartet der Sozialismus dieses Eingreifen nur von unten her, von der unterdrückten Klasse: von dem Proletariat. Er appelliert an die Proletarier, die sich damals (zurzeit von Marx) allmählich von der Bevormundung durch dass Bürgertum lossagten und nun nicht mehr als unterste Stufe, als „Anhängsel" dieses Bürgertums, sondern als ständige Klasse zu fühlen begannen. Das Proletariat soll durch seinen Klassenkampf (von dem ja bekanntlich die Utopisten nichts wissen wollten) nicht nur in der kommenden Entwicklung von sich aus richtunggebend wirken, sondern auch seine Klasseninteressen während dieses Umbildungsprozesses wahrnehmen. Aus dem Gesagten folgt bereits, dass der moderne wissenschaftliche Sozialismus grundsätzlicher Gegner jedes utopistischen Experiments ist; er erkennt klar die Unmöglichkeit, in einer von Kapitalismus beherrschten Umwelt sozialistische Eilande zu schaffen, wie er überhaupt in der sozialen Entwicklung nur die Daseinsberechtigung des natürlich Gewordenen anerkennt.
Alles in allem kann man den Unterschied zwischen utopischem und wissenschaftlichem Sozialismus dahin zusammenfassen: Die Utopischen erwünschen und erhoffen das Gute und Schöne, Marx erforscht das Wirkliche und erkennt das Notwendige. Aus dem Gesagten ergeben sich nun folgende Begriffsbestimmungen: Unter utopischem Sozialismus verstehen wir diejenige Spielart des Kommunismus oder Sozialismus, die sich in erster Reihe mit der Ausmalung eines Zukunftsstaates beschäftigt, ihr Ziel naturrechtlich begründet und den Weg zu diesem Ziel entweder gar nicht oder in wirklichkeitsfremder Weise behandelt. Unter dem modernen wissenschaftlichen Sozialismus oder Kommunismus verstehen wir diejenige Art des Sozialismus, die unter Verzicht auf die nähere Ausmalung des Zukunftsstaates ihr Ziel historisch begründet und die Entwicklung selbst sowie den Klassenkampf des Proletariats als die Hebel zur sozialistischen Gesellschaft betrachtet.
Die bisherige Betrachtung hat uns zwei große Gruppen von sozialistischen Systemen erkennen lassen. Der utopische Sozialismus 1st heute praktisch überwunden, d.h. es gibt keine ernst zu nehmende sozialistische Bewegung. die noch heute auf den Lehren der Plato, Morus. Fourier usw. fußt. Wir wollen aber nicht verkennen, dass der Utopismus in der sozialistischen Geistesgeschichte Jahrhunderte hindurch eine große und eine - damals - notwendige Aufgabe erfüllt hat: Das Fundament einer über Ziel und Weg klaren sozialistischen Bewegung hat er nicht werden können, wohl aber haben die Utopisten durch die sittliche Kraft ihrer Gedanken die Geister erst einmal aufgerüttelt. Zudem knüpft der moderne Sozialismus geistig unmittelbar an sie an, und - auch darüber wollen wir uns klar sein - so mancher Gedanke, den Vertreter des utopischen Sozialismus zum ersten Male ausgesprochen haben. ist als unveräußerlicher Besitz in den Ideenansatz der modernen Arbeiterbewegung übergegangen.
All das macht es notwendig, dass wir nach der zusammenfassenden Kennzeichnung der Eigenart des Utopismus auch noch einige der bedeutsamsten utopistischen Systeme kurz besprechen.
Leute:
Historische Ereignisse:
- KAPD [230]
- utopischer Sozialismus [433]
Entwicklung des proletarischen <br>Bewusstseins und der Organisation:
- Utopischer Sozialismus [434]
Notizen zu einer Geschichte der Kunst im aufsteigenden und dekadenten Kapitalismus
- 2351 Aufrufe
„Die marxistische Methode gibt die Möglichkeit, die Entwicklungsbedingungen der neuen Kunst zu beurteilen, alle ihre Veränderungen zu verfolgen und durch kritische Verfolgung der Wege die fortschrittlichsten zu fördern – aber auch nicht mehr. Ihre Wege muß die Kunst auf eigenen Füßen zurücklegen.“ (Trotzki, Parteipolitik in der Kunst, 1923; in „Literatur und Revolution“, 1924).
1. Kunst im Kapitalismus
Der Aufstieg des Kapitalismus entfesselt eine beispiellose, bis dato unvorstellbare Produktivkraft, die neue Gefühle und Ideen ins Leben ruft, zusammen mit neuen künstlerischen Mitteln, um ihnen Ausdruck zu verleihen. Die Ausweitung dieser neuen Produktionsweise über den gesamten Globus und ihre Durchdringung aller Bereiche menschlicher Erfahrungen löst die Barrieren zwischen den Nationalkulturen und lokal fixierten Stilarten auf, indem sie erstmals eine einzige Weltkultur schafft.
Durch die ständige Revolutionierung der Produktion und den Anstieg in der Produktivität zerstört der Kapitalismus auch die alten, engstirnigen Gesellschaftsverhältnisse und wandelt alles, einschließlich der Kunst, in eine Ware um. War der Künstler bis dahin eine geachtete und geehrte Person, die direkt für den Kunden produzierte, so ist er nun mehr oder weniger auf eine bezahlte Lohnarbeitskraft reduziert, deren Produkte auf einen anonymen Markt geworfen und den Gesetzen der Konkurrenz unterworfen werden.
Einmal abgesehen davon, dass die Kunst vom einzelnen Kapitalisten gern als Investition oder zur Ausschmückung seines Privatlebens verwendet wird, steht der Kapitalismus im Grunde der Kunst als Ablenkung von seiner einzigen Triebkraft, der Kapitalakkumulation um ihrer selbst willen, feindlich gegenüber. Mehr noch, als ein ausbeuterisches System, verhält sich der Kapitalismus grundsätzlich unversöhnlich gegenüber den Interessen der Humanität und daher zu den humanistischen Idealen der besten Art. Je bewusster sich die Kunst darüber ist, desto mehr führt sie zum Protest gegen die Unmenschlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft. Auf diese Weise sind die größten Künstler in der Lage, über die Grenzen ihrer Epoche und Klassenherkunft hinauszugehen, um wortgewaltige Anklagen gegen die Verbrechen und menschlichen Tragödien des Kapitalismus zu erheben (Goethe, Balzac, Goya).
Diese Antagonismen zwischen Kapitalismus und Humanität kommen in den frühesten Stufen der neuen Produktionsweise noch nicht völlig zum Vorschein, da die Bourgeoisie noch in einem revolutionären Kampf gegen den feudalen Absolutismus steckt. Die schöne Kunst ist imstande, die fortschrittliche Moral und die geistigen Werte dieser neuen ausbeutenden Klasse zu reflektieren, deren Energie und Selbstvertrauen – sowie generöse Patronage – die künstlerischen Errungenschaften der Renaissance ermöglichten, lange bevor ihre eigene Herrschaft etabliert ist.
2. Kunst in der Ära der bürgerlichen Revolutionen
In der Ära der bürgerlich-demokratischen Revolutionen (ca. 1776-1848) ist die Kunst noch in der Lage, die revolutionären Ziele der Bourgeoisie auszudrücken, doch die schmutzige Realität des Kapitalismus wird bereits deutlich. Die Romantik (Blake, Goethe, Goya, Puschkin, Shelley, Turner) spiegelt die widersprüchliche Natur dieser Periode wider, indem sie feudale und aristokratische Werte in der Kunst ablehnt, aber auch leidenschaftlich gegen die brutalen Auswirkungen der kapitalistischen Industrialisierung auf die Kunst und das Individuum protestiert.
Entgegen der „Rationalität“ der neuen ausbeutenden Klasse streitet die Romantik für die Macht der subjektiven Erfahrung, Vorstellungskraft und die Erhabenheit der Natur, indem sie ihre Inspirationen aus dem Mittelalter, der Mythologie und der volkstümlichen Kunst bezieht. Politisch nimmt sie häufig eine reaktionäre, rückwärtsgewandte Form an, führt aber auch zu eindeutig revolutionären Tendenzen, die eine internationalistische, kommunistische Vision zum Ausdruck bringen (Heine, Blake, Byron, Shelley).( 1) Die profundesten unter den dichterischen Einblicken dieser Tendenz nehmen nicht nur die späteren künstlerischen Ideen des Expressionismus und Surrealismus, sondern auch die theoretischen Entwicklungen des Marxismus und der Psychoanalyse vorweg.
Sobald sie an die Macht gekommen und das Proletariat auf der historischen Bühne erschienen ist, kehrt die Bourgeoisie ihren fortschrittlichen Werten den Rücken zu und begräbt die ganze Idee der Revolution, stellt diese doch eine tödliche Gefahr für ihre Klassenherrschaft dar. Von da an treten die Versuche der Kunst, die Wirklichkeit zu verstehen und die Interessen der Humanität auszudrücken, unvermeidlich mit der kapitalistischen Ideologie in Konflikt.
3. Die Geburt der modernen bürgerlichen Kunst
Das bestimmende Kennzeichen der modernen bürgerlichen Kunst besteht darin, dass sie just zu dem Zeitpunkt erscheint, als die Bedingungen für die Weiterentwicklung des Kapitalismus ihren Zenit erreicht haben.
Der entscheidende Triumph des Industriekapitalismus Mitte des 19. Jahrhunderts in den am meisten fortgeschrittenen Ländern Europas und Amerikas spiegelt sich im Wachstum rationalistischer, positivistischer und materialistischer Ideologien in den Wissenschaften und in der Philosophie sowie in den realistischen oder naturalistischen Annäherungen der Künste wider. Marx und Engels betrachten den Realismus in der Literatur (Flaubert, Balzac, Elliot) als die höchste Errungenschaft in der Weltkunst. Der Realismus in den visuellen Künsten (Courbet, Millet, Degas) ist die Reaktion sowohl auf die klassische Kunst als auch auf den Emotionalismus und Subjektivismus der Romantik und bekräftigt an Stelle dessen die Ziele der Wahrhaftigkeit und Präzision sowie der Schilderungen des Alltags, einschließlich der bis dahin ignorierten rauen Realität des ArbeiterInnenlebens. Für die Bourgeoisie ist jede Kunst, die die hässliche Wirklichkeit des Lebens im Kapitalismus akkurat schildert, per se revolutionär und somit abzulehnen.
Diese Periode erblickt auch den Aufschwung der Arbeiterbewegung, und es ist daher nicht überraschend, dass der Realismus einer revolutionären Tendenz zum Leben verhilft, die sich ausdrücklich mit der Arbeiterklasse und dem Kampf für den Sozialismus identifiziert. Courbet, Anführer der realistischen Bewegung in Frankreich, bekräftigte: „Ich bin nicht nur ein Sozialist, sondern auch ein Demokrat und Republikaner, mit einem Wort: ein Anhänger der Revolution und vor allem ein Realist, das heißt, ein aufrichtiger Freund der wirklichen Wahrheit.“ (2)
Der Impressionismus (Picasso, Manet, Degas, Cézanne, Monet) ist die künstlerische Antwort auf das Wachstum der industriellen und urbanen Gesellschaft, auf neue technologische Entwicklungen und wissenschaftliche Entdeckungen (Photographie und Optiken), auf die Globalisierung des Handels (ersichtlich beispielsweise im Einfluss japanischer Drucke) und auf das Wachstum der Mittelschichten als eine Klientel für die neuen Künste. Er stützt sich auf die Hingabe zur Wahrheit und Akkuratesse, aber konzentriert sich auf die subjektive Wahrnehmung von Bewegung und Licht: „Während der alte akademische Stil sagte: ‚Hier sind die Regeln (oder Bilder), denen zufolge die Natur beschrieben werden muss‘, und der Naturalismus sagte: ‚Hier ist die Natur‘, sagte der Impressionismus: ‚So sehe ich die Natur‘.“ (3). Impressionistische Ideen und Einflüsse befinden sich auch in der Musik (Debussy, Ravel) und in der Literatur (Lawrence, Conrad).
Als echte moderne bürgerliche Kunstbewegung ist der Impressionismus eine widersprüchliche Bewegung. Während die klassische Kunst der Renaissance einen grundlegenden Sinn für die Einheit ausdrückt, der aus der Vision und dem Selbstvertrauen der revolutionären Bourgeoisie herrührt, reflektiert der Impressionismus den Triumph des Kapitalismus und die Atomisierung des Einzelnen in der Industriegesellschaft. Indem er sich auf subjektive und Sinneswahrnehmungen stützt, repräsentiert er die Realität entsprechend als ein Flickwerk:
„Und so war der Impressionismus in einem gewissen Sinne ein Symptom des Niedergangs, der Fragmentierung und Entmenschlichung der Welt. Doch gleichzeitig war er in der langen ‚Schonzeit‘ des bürgerlichen Kapitalismus (…) ein glorreicher Gipfel der bürgerlichen Kunst, ein goldener Herbst, eine späte Ernte, eine enorme Bereicherung der dem Künstler zur Verfügung stehenden Ausdrucksmittel.“ (4)
4. Die Kunst am Ende des kapitalistischen Aufstiegs
Der Zeitraum zwischen ca. 1890 und 1914 – die so genannte Belle Epoque bzw. das Goldene Zeitalter – erlebt den Kapitalismus am optimistischsten und technologisch am weitesten fortgeschritten, besonders mit einem mächtigen Wirtschaftswachstum, das fruchtbare Bedingungen für künstlerische und wissenschaftliche Entwicklungen schafft (Freuds Theorie des Unbewussten, die Quanten- und Relativitätstheorie). Doch unter der Oberfläche der Gesellschaft machen sich nagende Zweifel und Ungewissheiten breit, kommt es zum Anstieg des Militarismus und der imperialistischen Spannungen, zu den wachsenden staatlicher Eingriffen in die Gesellschaft und zu massiven Arbeiterkämpfen – alles Anzeichen einer wachsenden Krise im Herzen des Kapitalismus.
Die künstlerischen Bewegungen, die in dieser Periode entstehen (Kubismus, Expressionismus, Symbolismus) spiegeln diese Widersprüche notgedrungen wider, indem sie sowohl ein letztes Aufblühen fortschrittlicher bürgerlicher Kunst als auch die ersten Symptome ihres Endes zum Ausdruck bringen. Der Kubismus (Picasso, Braque), der den Einfluss der jüngsten wissenschaftlichen und philosophischen Theorien zeigt, wendet sich ab von Schilderung von Objekten aus einer Perspektive, analysiert die Objekte, zerlegt sie und setzt sie aus mannigfaltigen Perspektiven neu zusammen. Der Expressionismus lehnt den Realismus gänzlich ab, indem er subjektive Bedeutungen oder emotionale Erfahrungen statt der physischen Realität schildert. Er übt auch auf die Literatur (Kafka) und Musik (Schönberg, Webern, Berg) großen Einfluss aus, wo er die traditionelle Tonalität zugunsten einer A-Tonalität und Dissonanz aufgibt. Der Symbolismus (Baudelaire, Verlaine) ist eine poetische Reaktion gegen Realismus und Naturalismus zugunsten des Mystizismus und der Vorstellungskraft, die später als „träumerischer Rückzug in absterbende Gebiete“ (5) beschrieben wurde.
Innerhalb der modernen bürgerlichen Kunst gibt es eine radikale Tendenz, die sich selbst als Avantgarde einer neuen fortschrittlichen Gesellschaft mit neuen künstlerischen Werten betrachtet; diese Tendenz argumentiert, dass Kunst eine große Rolle bei der Modernisierung der kapitalistischen Gesellschaft spielt. Diese „modernistische“ Avantgarde erscheint ausgerechnet in dem Moment, als die Möglichkeiten einer Reformierung des Kapitalismus nahezu ausgeschöpft sind. Der Futurismus (Marinetti, Majakowski, Malewitsch), dessen Einfluss sich in der Malerei, Poesie, Architektur und Musik im frühen 20. Jahrhundert niederschlägt, besonders in Italien und Russland, glorifiziert Themen und Symbole des kapitalistischen Fortschritts wie die Jugend, die Geschwindigkeit, den Dynamismus und die Macht. Doch andere modernistische Elemente, besonders in Deutschland, verhalten sich kritischer gegenüber der kapitalistischen „Modernität“ und artikulieren die Entfremdung des Lebens in der bürgerlichen Gesellschaft (Munchs „Der Schrei“).
5. Der Tod der modernen bürgerlichen Kunst
Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs spaltet diese modernistische Avantgarde in einerseits die Glorifizierer des kapitalistischen Fortschritts, wie Marinetti und die italienischen Futuristen, die begeistert Partei ergreifen für die Barbarei (und später für den Faschismus), und andererseits in radikalere Tendenzen wie die russischen Futuristen und die deutschen Expressionisten, die gegen den Krieg sind und auf eine mehr oder weniger konfuse, bruchstückhafte Weise beginnen, sich auf die proletarische Bewegung zu beziehen.
Die erste spezifisch künstlerische Reaktion auf den Krieg ist Dada. Als internationale Antikriegs- und antikapitalistische Bewegung erblickt Dada im Gemetzel auf dem Schlachtfeld einen Beweis für den Bankrott aller bürgerlichen Kultur. Sein „Programm“ steht dem Anarchismus nahe: die Zertrümmerung der Kultur und die Abschaffung der Kunst; und seine Praxis begrüßt das Chaos und die Irrationalität (Gedichte, die sich aus wahllos zusammengewürfelten Worten aus Zeitungsausschnitten, etc. zusammensetzen). Die Berliner Dadaisten (Heartfield, Grosz, Dix, Ernst), die den proletarischen Kämpfen gegen den Krieg näher stehen, nehmen eher ausdrücklich kommunistische Positionen ein, ja bilden ihre eigene politische Partei und unterstützen aktiv die deutsche Revolution. (6)
Die russische Revolution im Oktober 1917 war der Höhepunkt der revolutionären Welle nach dem Krieg und der Versuche der modernistischen Avantgarde, eine befreiende Kunst zu kreieren. Für eine kurze Zeit im Anschluss an die Machtergreifung durch die Sowjets gibt es eine riesige Flut von künstlerischen Experimenten und Aktivitäten, von denen sich viele ausdrücklich mit der Revolution identifizieren. Unter dem Schutz des jungen Sowjetstaates und mit kritischer Unterstützung durch die bolschewistische Partei geben Bereiche der russischen Avantgarde (Futuristen, Produktivisten, Konstruktivisten), angeregt von Majakowskis Erklärung „Straßen sind unsere Pinsel, die Plätze unsere Paletten" die „reine“ Kunst zugunsten der Industrieproduktion auf, begrüßen Architektur, Industriedesign, Kino, Werbung, Möbel, Verpackung und Bekleidung, mit dem erklärten Ziel, Kunst zu benutzen, um den Alltag umzuwandeln. Es gibt hitzige Debatten über Kultur und die Zukunft der Kunst. Die einflussreiche Proletkult-Bewegung neigt dazu, alle frühere Kultur abzulehnen, und will eine neue revolutionäre, proletarische Ästhetik schaffen, wohingegen andere wie Trotzki das gesamte Konzept der proletarischen Kultur ablehnen, jedoch das Aufkommen einer neuen revolutionären Kunst unterstützen, die sie unmittelbar erwarten. (7)
Im Kontext der revolutionären Welle, die den Kapitalismus in den Jahren 1917 bis 1923 bis in seine Grundfeste erschütterte, erscheint dies nicht unrealistisch zu sein. Das Urteil, das Dada über die gesamte bürgerliche Kultur und Kunst fällt, scheint nun vom Weltproletariat in Deutschland, Großbritannien, Amerika, etc. ausgeführt zu werden….
Doch mit der Isolation der russischen Bastion und des Scheiterns des revolutionären Ansturms des Proletariats in Europa wird der anfängliche Rückhalt des modernistischen Experimentierens durch die Bolschewiki durch die Unterdrückung des Dissens‘ und durch eine wachsende staatliche Kontrolle ersetzt, als die stalinistische Konterrevolution ihren Griff verstärkt. Auf internationaler Ebene endet der Modernismus letztendlich damit, dass er von den reaktionären staatskapitalistischen Regimes, gleich ob stalinistisch, faschistisch (besonders in Italien) oder sozialdemokratisch, zum offiziellen Architekturstil auserwählt wird.
6. Kunst und die kapitalistische Konterrevolution
In der sich ausbreitenden bürgerlichen Konterrevolution sieht sich die russische Kunstavantgarde im Wesentlichen mit derselben Wahl konfrontiert wie die überlebende kommunistische Minderheit: entweder Unterordnung unter dem stalinistischen Totalitarismus mit seiner Durchsetzung des „sozialistischen Realismus“, Schweigen oder Exil. Mit dem Aufstieg des Faschismus ist auch die europäische künstlerische Avantgarde immer mehr dazu gezwungen, auszuwandern und/oder einen ausdrücklich oppositionellen politischen Standpunkt zu vertreten.
Der Surrealismus (Breton, Aragon, Ernst, Péret, Dali, Miró, Duchamp) entstand aus Dada und wurde erst zu einer eigenen Bewegung, als die praktische Möglichkeit für eine Revolution bereits am Zurückweichen war. Er ist eine ausdrücklich revolutionäre Kunstrichtung, die sich eng mit der politischen Opposition gegen den Stalinismus verband. (8) Der Surrealismus bezieht seine Ideen aus der Freudschen Psychoanalyse wie aus dem Marxismus und betont den Nutzen der freien Assoziation, der Traumanalyse, der Gegenüberstellung und des Automatismus, um das Unbewusste zu befreien. Seine Versuche, eine permanente revolutionäre künstlerische Praxis innerhalb des Kapitalismus aufrechtzuerhalten, und dies in einer Zeit tiefer Niederlagen, macht ihn anfällig gegenüber Zerfall und schließlicher Vereinnahmung, doch üben surrealistische Ideen einen großen Einfluss auf die visuellen Künste, die Literatur, den Film und die Musik wie auch auf die philosophischen, politischen und gesellschaftlichen Theorien aus.
Mit dem Triumph der bürgerlichen Konterrevolution in den 1930er Jahren – die „Mitternacht des Jahrhunderts“ (Victor Serge) – erleben wir ein volles Aufblühen all der klassischen Symptome der Dekadenz in der kapitalistischen Kultur:
„Die Ideologie zerfällt, die alten moralischen Werte brechen auseinander, die künstlerische Schöpferkraft stagniert oder sie nimmt stagnierende Formen an, Obskurantismus und philosophischer Pessimismus blühen auf (…) Was den Bereich der Kunst angeht, so hat sich die Dekadenz hier schon lange gewalttätig ausgedrückt (…) Wie in anderen dekadenten Perioden wiederholt die Kunst, wenn sie nicht stagniert, ständig alte Formen, und sie erhebt den Anspruch, eine Haltung gegen das System einzunehmen, oder stellt sehr oft einen Ausdruck des Erschreckens dar.“ (9)
Unter diesen Umständen sieht sich Kunst, die „den Anspruch erhebt, Stellung gegen die herrschende Ordnung zu beziehen“, in wachsendem Maße isoliert oder wird von der einen oder anderen reaktionären politischen Fraktion zu propagandistischen Zwecken vereinnahmt (Picassos „Guernica“). Auch die Kunst, die den Schrei des Entsetzens über die kapitalistische Barbarei zum Ausdruck bringt, ist immer ohnmächtiger durch das schiere Ausmaß der Gräuel dieser Barbarei geworden: der Zweite Weltkrieg (über 60 Millionen Tote, zumeist Zivilisten, im Vergleich zu den 20 Millionen im Ersten Weltkrieg), die Todeslager der Nazis, Hiroshima und Nagasaki, Hamburg, Dresden, die Massenverbrechen des Stalinismus… Um Adorno frei zu übersetzen, ist es nach Auschwitz unmöglich, Poesie zu verfassen, ohne einen weiteren Beitrag zu einer bereits barbarischen Kultur zu leisten.
Doch die kapitalistische Dekadenz bedeutet nicht, dass die Produktivkräfte zu einem Halt gekommen sind. Um zu überleben, muss das System weiterhin versuchen, die Produktion zu revolutionieren und die Produktivität zu steigern. Stattdessen sehen wir, was Marx die „Entwicklung als Zerfall“ nannte. Auch in der Kunstsphäre sehen wir weiterhin eine Entwicklung von Kunstrichtungen, zum Teil als Antwort auf neue technologische Entwicklungen und den gesellschaftlichen Wandel. Doch dies zeichnet sich immer mehr durch ein rasendes Recyceln früherer Stilrichtungen, durch abrupte Stimmungswechsel zwischen Hoffnung und Verzweiflung, durch eine Fragmentierung, Zersplitterung und Auflösung jeder Richtung aus, noch bevor sie ihre volle Reife erreicht hat. Die menschliche Kreativität hört niemals auf zu existieren, doch sieht sie sich zunehmend erdrosselt, kanalisiert, blockiert und korrumpiert. Wir erleben noch immer künstlerische Weiterentwicklungen (Jazz) und die Einführung neuer Techniken und Stilarten, doch spiegeln diese Entwicklungen in wachsendem Maße den Zerfall einer Gesellschaft wider, die den Gang zur Exekution vermieden hat und nun nur noch überlebt, indem sie sich selbst kannibalisiert.
Dies wird durch den abstrakten Expressionismus veranschaulicht, der einflussreichsten Kunstrichtung (zumindest in der Malerei und Bildhauerei), die im „Nachkriegsboom“ auftritt. Der abstrakte Expressionismus ist zum Teil eine Reaktion auf den ausdrücklich politischen Inhalt des gesellschaftlichen Realismus der 1930er Jahre (Rivera). Beeinflusst durch den Surrealismus und der europäischen Avantgarde betont er den Ausdruck unbewusster Ideen und Emotionen durch spontane, improvisierte oder automatische Techniken, um Bilder von mannigfaltigen Abstraktionsausmaßen zu kreieren (Pollock, Rothko, Newman, Still). Beeinflusst durch das Trauma des II. Weltkriegs und der repressiven Nachkriegsatmosphäre in den USA, vermeidet er offen politische Inhalte, indem er sich der primitiven Kunst, der Mythologie und dem Mystizismus als Inspirationsquelle zuwendet. Dies und sein Streben nach reiner Abstraktion erleichtert die Promotion des abstrakten Expressionismus durch den US-Staat im Kalten Krieg als eine kulturelle Waffe gegen den „sozialistischen Realismus“ seines imperialistischen Rivalen aus Russland.
Kunst und die „Kulturindustrie“
Auch wenn die Kunst ab Mitte des 20. Jahrhunderts die klassischen Symptome der Dekadenz in allen Klassengesellschaften abbildet, so gibt es dennoch auch besondere Entwicklungen, insbesondere während des „Wirtschaftswunders“ nach dem II. Weltkrieg, die nicht allein die Art und Weise umwandeln, in der Kunst in der kapitalistischen Gesellschaft produziert und verteilt wird, sondern auch, wie dies von den Massen der Arbeiterklasse „erlebt“ wird. Der sich aus diesen Entwicklungen ergebende Effekt: die Bedingungen für das Aufkommen revolutionärer Kunst werden untergraben und das Verschwinden der überlebenden künstlerischen Avantgarde beschleunigt. Viele dieser Entwicklungen sind dieselben Symptome der Dekadenz oder Versuche des Kapitalismus, die Widersprüche seiner historischen Krise zu überwinden. Sie umschließen:
- die Entwicklung der „Kulturindustrie“ und die Anwendung der Massenproduktionstechniken und Fließbandprinzipien auf die von ihr produzierten Waren (Musik, Filme, Fernsehprogramme, etc.)
- die Entwicklung des Staatskapitalismus und insbesondere eines raffinierten ideologischen Apparates, um die Arbeiterklasse besser zu kontrollieren und jegliches Anzeichen von Revolte zu vereinnahmen
- der Aufstieg der „Konsumgesellschaft“ in der Nachkriegsperiode, die sich auf eine relative Steigerung der Löhne für die Arbeiterklasse und auf die gestiegene Warenproduktion für den Massenkonsum (zum Teil finanziert durch eine Ausweitung der Kredite) stützt
- das Wachstum der unproduktiven Ausgaben und Aktivitäten, z.B. im Marketing und in der Werbung.
Infolgedessen ist der Kapitalismus zum ersten Mal in der Geschichte in der Lage, künstlerische Waren (Musik, Filme, etc.) billig für den Konsum durch die Masse der Arbeiterklasse zu produzieren, wobei er seine ihm innewohnende Feindseligkeit gegenüber der Kunst als eine unnötige Ablenkung von seinem Streben zur Akkumulation überwindet. Dies erleichtert größtenteils die Verwendung der künstlerischer Waren für ideologische Zwecke, nicht nur um die Reproduktion der Arbeit durch die Schaffung von Mitteln für das „Freizeitvergnügen“ der ArbeiterInnen sicherzustellen, sondern auch um jeglichen künstlerischen Ausdruck des Dissenses zu vereinnahmen.
Als das Proletariat in den Kämpfen vom Mai 68 auf die Bühne der Geschichte zurückkehrt, erleben wir durchaus das Auftreten radikaler Kunstrichtungen (Arte Povera), jedoch nicht in einem Umfang, den man erwarten konnte. Stattdessen werden die radikalsten Nachfahren der europäischen Avantgarde, die Situationisten, festgemacht an ihrer Kritik der „Gesellschaft des Spektakels“, d.h. der bürokratischen, kapitalistischen Umwandlung der Kultur in Waren und der Verwendung der Massenmedien durch den Kapitalismus, um subversive Ideen zu vereinnahmen , und an ihren Vorschlägen zur praktischen Aktion für „eine revolutionäre Neuordnung des Lebens, der Politik und der Kunst“. Die Situationisten übertreiben die Macht dieses „Spektakels“ genau zu dem Zeitpunkt, als die historische Krise des Kapitalismus zurückkehrt, doch sind sie näher an der Realität, wenn sie die Unfähigkeit selbst der radikalsten künstlerischen Aktivitäten deutlich machen, ihre Vereinnahmung zu verhindern, es sei denn, sie sind ausschließlich politisch, das heißt in dieser Periode: revolutionär.
7. Kunst und Zerfall
Mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine finale Phase, jene des Zerfalls, besteht die ganz reelle Möglichkeit der Zerstörung sämtlicher menschlicher Kultur, zusammen mit der Kunst, die in Trotzkis Worten unvermeidlich dahin rotten werde „wie griechische Kunst unter den Ruinen einer auf der Sklaverei gegründeten Kultur dahin rottete“. (10) Ab den 1970er Jahren ist die moderne Kunst Teil der offiziellen staatskapitalistischen Kultur in Amerika und Europa, unterstützt und subventioniert von Korporationen und Regierungsagenturen sowie sicher aufgebahrt in den Museen. Trotz fortwährender Wellen von ArbeiterInnenkämpfen bis hin zum Kollaps des russischen Blocks 1989-91 erleben wir einen weiteren Verfall der Kunst, beschleunigt durch den falschen Wirtschaftsboom in den 1980er Jahren und genährt von einer Explosion der Verschuldung, die zu einem Goldrausch von spekulativen Investitionen in die Kunst als ungemünztes Gold führt. Die Exzesse auf dem Markt beenden, was die Konterrevolution, der Nachkriegsboom und der Aufstieg der „Kulturindustrie“ begonnen hatten.
Das Erscheinen des „Post-Modernismus“ besonders ab den 1980er Jahren ist in gewissem Sinn lediglich die letzte unvermeidliche Anerkennung dieses sich lange hinziehenden Todes des Modernismus. Der „Post-Modernismus“ hat seine Ursprünge in den ausgedörrten Regionen der linksbürgerlichen Intelligentsia (Derrida et all) als ein „demokratisierendes Projekt“. Er theoretisiert die Aufgabe nicht nur jeglicher weiteren Avantgarderolle der Kunst, sondern auch jeglichen Konzepts für eine nach vorn gerichtete Bewegung in der Geschichte. Er passt somit perfekt zu all den bürgerlichen ideologischen Kampagnen in den 1990er Jahren über das „Ende des Kommunismus“ und das „Ende der Geschichte“ und fügt dem Ganzen lediglich die allgemeine Demoralisierung und Verzweiflung hinzu.
Noch vor dem Eintritt des dekadenten Kapitalismus in seine letzte Phase, jene des Zerfalls, können wir daher auf den fortgeschrittenen Zerfall der Kunst hinweisen, d.h. „die Leere und Käuflichkeit sämtlicher künstlerischer Produktion: Literatur, Musik, Malerei, Architektur sind außerstande, anderes auszudrücken als Angst, Verzweiflung, den Zusammenbruch allen kohärenten Denkens, die Leere“ (11). Tatsächlich geht diese Schilderung nicht weit genug. Wir können dem noch hinzufügen, dass ein Trend in der Kunst darin besteht, sich selbst zu zerstören, um – in den Worten des deutschen Künstlers Anselm Kiefer – zur „Anti-Kunst“ zu werden. Im zerfallenden Kapitalismus ist selbst Anti-Kunst… Kunst: „Die Kunst hat etwas, was ihre eigenen Zelle zerstört. Damien Hirst ist ein großartiger Anti-Künstler. Um zu Sotheby’s zu gehen und sein eigenes Werk direkt zu verkaufen heißt, Kunst zu zerstören. Doch indem er dies auf solch übertriebene Weise tut, wird es zur Kunst (…) die Tatsache, dass dies zwei Tage vor dem Crash (von 2008) geschah, macht die Sache noch besser“ (12).
Neben den zynischen Manipulationen von „Künstler/Unternehmer“ wie Hirst, dessen Schriften mittlerweile als ein weiteres Symptom der Spekulationsblase des Kapitalismus vor 2007 erscheinen, gibt es eine grundsätzlichere Wahrheit. Der expressionistische Dichter Rainer Maria Rilke (1875-1926) vergleicht den Künstler mit einem „ein Tänzer, dessen Bewegung sich bricht an dem Zwang seiner Zelle. Was in seinen Schritten und dem beschrankten Schwung seiner Arme nicht Raum hat, kommt in der Ermattung von seinen Lippen, oder er muss die noch ungelebten Linien seines Leibes mit wunden Fingern in die Wände ritzen.“ (13). Wenn der Künstler in der Tat ein Gefangener in der Zelle ist, dann sind im zerfallenden Kapitalismus die besten Künstler mehr und mehr dazu gezwungen, wieder auf das Äquivalent eines „schmutzigen Protests“ unter den unerträglichen Bedingungen des kapitalistischen Lebens und auf die Unmöglichkeit eines authentischen künstlerischen Ausdrucks zurückzufallen. Jedoch ist selbst das Beschmieren der Zellenwände mit dem eigenen Kot, so scheint’s, nicht mehr genug, um die Verdinglichung und Verwertung zu verhindern. 1961 produzierte der italienische Künstler ein Werk, das aus 90 Dosen eigener Scheiße bestand. 2007 verkaufte Sotheby’s eine davon für 124.000 Euros. MH 6.12.2011
(1) Siehe Heinrich Heine: Die Revolution und das Fest der Nachtigallen, IKSonline. (https://en [435]. Internationalism.org/icconline/2007/march/heine) (1)
(2) Courbet, ein Unterstützer Proudhons, wurde wegen seiner aktiven Rolle in der Pariser Kommune eingekerkert.
(3) Culture and Revolution in the Thought of Leon Trotsky, Revolutionary History, Bd. 7, Nr. 2, Porcupine Press. London 1999, S. 102, eigene Übersetzung (2)
(4) Ernst Fischer, Von der Notwendigkeit der Kunst (eigene Übersetzung). Der Impressionist Cézanne war sich dieses Rückschritts sehr wohl bewusst: Im Werk der alten Meister sei es, sagt er, als „könne man die ganze Melodie im Kopf hören, einerlei, welches Detail man vergönnt ist zu studieren. Man kann alles aus dem Ganzen reißen (…) Sie malten kein Flickwerk, wie wir es taten…“ (E. Fischer).
(5) Edmund Wilson, Axels’Castle (3), 1931. Die Symbolisten waren damals auch als die „Dekadenten“ bekannt.
(6) Anfang 1919 gebildet, rief der „Zentralrat von Dada (4) für die Weltrevolution“ zu Folgendem auf: „die internationale revolutionäre Gewerkschaft aller kreativen und intellektuellen Männer und Frauen auf der Grundlage des radikalen Kommunismus (…) Die sofortige Enteignung des Eigentums (…) und die kommunale Ernährung Aller (…) Einführung des simultanen Gedichts als kommunistisches Staatsgebet“ (Wikipedia).
(7) Trotzki, Parteipolitik in der Kunst. 1923. Mehr über die Proletkult-Bewegung und die Debatten innerhalb der bolschewistischen Partei über die Kultur siehe die Reihe „Der Kommunismus ist nicht nur eine schöne Idee“ in der Internationalen Revue.
(8) Obgleich einige Surrealisten wie Aragon zu Apologeten des Stalinismus wurden, während Dali den Faschismus unterstützte. Führende Surrealisten nahmen Kontakt zu Trotzki auf, und die Bewegung verband sich eng mit der Linksopposition, doch der führende surrealistische Dichter Benjamin Péret brach 1948 mit der trotzkistischen IV. Internationalen wegen deren reaktionären politischen Positionen und arbeitete eng mit der Munis-Gruppe zusammen.
(9) Die Dekadenz des Kapitalismus, IKS-Broschüre.
(10) Trotzki, Kunst und Politik in unserer Zeit, 1938, in Kunst und Revolution, in: Lev Trockij: Literaturtheorie und Literaturkritik, München 1973, S.149. Der Text über Rivera befindet sich in Fußnote 10 auf Seite 182f.
(11) „Thesen über den Zerfall, der letzten Phase in der Dekadenz des Kapitalismus“, Internationale Revue, Nr. 107, 2001 (engl., franz. Und span. Ausgabe). Man könnte dem die ganze Krise des Bildungssystems und ihre Auswirkungen auf traditionelle Kunstfertigkeiten, -kenntnisse, –techniken, etc. hinzufügen.
(12) The Guardian, 9.12.2011.
(13) Zitiert aus: Norman O. Brown, Life against death. The psychoanalytical meaning of history, S. 66, 1959, Rilke “Über Kunst”, https://www.rilke.de/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=4007&sid=36bfec8dfa5043... [436]
Aktuelles und Laufendes:
- Kunst Kapitalismus [437]
- Kunst Sozialismus [438]
- Kommunismus [439]
- Geschichte Kunst [440]
Spanien: Wie können die Arbeiter angesichts einer Wirtschaft, die am Boden liegt, reagieren?
- 1958 Aufrufe
Die Probleme eines Kampfes, wenn sowieso Betriebsschließungen geplant sind
Die Bergarbeiter in Asturien verkörpern eine stolze Tradition innerhalb der Arbeiterbewegung, so beim Aufstand von 1934, und es ist nicht verwunderlich, dass sie am 31. Mai entschlossen in den Streik traten. Ihre Courage ist unübersehbar in zahlreichen Straßenblockaden, bei denen sie auch mit improvisierten Waffen die anrückenden Polizeieinheiten fernhielten wie auf der Nationalstraße N-360, oder als sie auf dem Weg nach Madrid mit Polizeigewalt, Verhaftungen und Gummigeschossen konfrontiert waren. Dies war Anstoß für die Beiträge auf den Internetforen libcom (https://libcom.org/news/coal-mines-ignite-asturias-10062012?page=1 [441]https://libcom.org/article/coal-mines-ignite-asturias-updates?page=1 [442]) und der IKT (Internationale Kommunistische Tendenz) (https://www.leftcom.org/en/articles/2012-06-19/the-struggle-of-the-asturian-miners [443]).
Alles erinnert stark an den Bergarbeiterstreik von 1984/85 in Großbritannien, als dieser kämpferische Sektor, der den Respekt der ganzen Arbeiterklasse genoss und in vielen Belangen deren Hoffnungen ausdrückte, in einen beherzten und bitteren Streik trat und dabei zahlreiche Konfrontationen mit der Polizei hatte, als er mit jeder Arten der Repression konfrontiert war. Wie heute in Spanien waren die Bergarbeiter mit geplanten Minenschließungen in einer Zeit hoher Arbeitslosigkeit konfrontiert. Der Kampf endete in einer Niederlage, die zwei Jahrzehnte lang schwer auf den Schultern der britischen Arbeiterklasse lastete.
In der Diskussion auf dem Internetforum libcom warf Fingers Malone die Schwierigkeiten der spanischen Bergarbeiter angesichts des Wesens des Angriffs auf, in einem Industriesektor, der sowieso abgebaut wird: „nur der Streik an sich führt zu nichts“. Er sieht dies als Grund für die Errichtung der Straßenblockaden und auch die verzweifelten unterirdischen Minenbesetzungen, die unter ungesündesten und unangenehmsten Bedingungen stattfinden. Hilft dies für einen wirkungsvollen Kampf? In unseren Augen liegt das Problem nicht darin, dass zu streiken allein nicht genügt, sondern dass allein zu kämpfen, isoliert von anderen Sektoren der Arbeiterklasse, die Bergarbeiter angesichts der Staatsmacht in eine Position der Schwäche versetzt und der Kampf meist in einer Niederlage endet. Der Generalstreik vom 18. Juni, der von den Gewerkschaften CCOO und UGT und von den linken Parteien PCE (Stalinisten) und PSOE (Sozialdemokraten) organisiert wurde, durchbrach ihre Isolation keineswegs, sondern begrenzte den Kampf auf die Gebiete und Branchen, die von den Subventionskürzungen betroffen sind. Ihre Forderung nach einem „Kohleplan“ für Spanien, der an den Slogan “Kohle statt Almosen” der Bergarbeitergewerkschaft NUM in Großbritannien in den 80er Jahren erinnert, verschärfte die Isolation des Streiks noch mehr.
In diesem Sinne verkörpert der Slogan „Wir sind nicht empört, sondern angepisst“ die Grenzen des Kampfes mit all seinen Illusionen in ihre Stärke als Bergarbeiter, die fähig sind, sich gegen die Polizei durchzusetzen. In gewisser Weise betrachten sich die Bergarbeiter als Ausdruck eines radikaleren Standpunktes als die Indignados, deren Kampf eine der Schlüsselauseinandersetzungen des letzten Jahres war, dies nicht nur in Spanien sondern weltweit. Trotz all ihrer starken Klassenidentität ist gerade die Isolierung der Bergarbeiter in Asturien eine entscheidende Schwäche, welche die Kämpfe insgesamt zurückwerfen kann.
Ein Jahr danach – was ist von der M15-Beewegung übriggeblieben?
Auch wenn die herrschende Klasse ihre liebe Mühe hat, die Ökonomie im Griff zu behalten, so sollten wir nie ihre Erfahrung unterschätzen, die sie in der Konfrontation mit der Arbeiterklasse hat. Dies zeigten eben gerade die Isolierung der Bergarbeiter und der gewerkschaftlich organisierte Generalstreik vom 29. März auf, dem unmittelbar die Ankündigung von Sparmaßnahmen in der Höhe von 27 Milliarden Euros folgte.
Das „Zelebrieren“ des Jahrestages der 15M-Bewegung durch die herrschende Klasse ist ein weiteres Beispiel einer Parodie mit dem Zweck, die ursprünglichen Ereignisse zu verwischen oder mindestens die Erinnerung an die Ursprünge der Bewegung vollständig zu verzerren – gerade dann, wenn wir eigentlich darüber nachdenken, diskutieren und uns der Lehren daraus bewusst werden sollten. Im Mai 2012 wurde zum Jahrestag von einem Kartell linker und gewerkschaftlicher Organisationen mobilisiert, und nicht von den Vollversammlungen, die es leider nicht mehr gibt, und es wurde nun prompt die demokratische und reformistische Sichtweise des „Bürgers“ in den Vordergrund gestellt als Gegenpol zu derjenigen der Arbeiterklasse.
Die falschen politischen Alternativen, die von der rechten Regierung des Partido Popular (PP) auf der einen Seite und den Linken auf der anderen Seite angeboten werden, ergänzen sich sehr gut. Erstere hatten eine aggressive Repression durchgezogen und beschuldigten die Indignados, ein „Unterseeboot“ der sozialdemokratischen Partei PSOE zu sein. Während die PSOE, die ein Jahr zuvor die 15M-Bewegung noch als kleinbürgerlich, als hoffnungslose Leute, als Hund auf den Hinterpfoten dargestellt hatte, sie jetzt ehrte als ein „Triumpf“ mit großer Zukunft und mit einem Gewicht innerhalb der Gesellschaft. Die herrschende Klasse verunglimpft eine wirkliche soziale Bewegung immer, doch sie liebt es auch, die Erinnerungen an deren Mythos zu pflegen, wenn sie sie damit in eine leere Hülle verwandeln kann.
Die Jahrestags-Demonstrationen 2012 waren massiv, doch bei weitem nicht so wie beim Höhepunkt der Bewegung im Juni, Juli und Oktober 2011. Vollversammlungen fanden in Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante und anderswo statt. Doch auch wenn die Vollversammlungen am Samstag mit Interesse und Neugier besucht waren, bröckelten sie danach schnell ab und es gab keinen Elan in der Bewegung, sich gegen die Kontrolle durch linke Organisationen zu wehren. Die Leute zogen es vor, nach Hause zu gehen. Dennoch gab es Zeichen des Lebens der Arbeiterklasse: die massive Beteiligung von jungen Leuten, eine gesunde und fröhliche Atmosphäre und auch gute Beiträge in den Diskussionen. In Madrid gab es eine gute Diskussion über Fragen des Gesundheitswesens; es waren Stimmen zu hören, die wir selber als Ausdruck des proletarischen Flügels der Bewegung sehen, auch wenn sie nicht so selbstbewusst auftraten wie im letzten Jahr. Trotz alledem konnte die Mobilisierung die Fesseln, die ihnen die herrschende Klasse angelegt hatte, nicht sprengen, und sie blieb mehr eine Karikatur der M15-Bewegung, bei der die Luft nach einem Tag des Wochenendes draußen war und wieder der Alltag einkehrte.
Die Aussicht für die Arbeiterklasse
Die sozialen Bewegungen, die 2011 stattgefunden haben, waren für die Arbeiterklasse eine wichtige Erfahrung – mit ihrer internationalen Ausbreitung, der Besitznahme der Straßen und Plätze, den Versammlungen im Zentrum der Bewegung, wo lebendige Debatten geführt wurden (vgl. 2011: Von der Empörung zur Hoffnung in Weltrevolution Nr. 171). In Spanien gab es massive Mobilisierungen im Bildungswesen in Madrid und Barcelona, im Gesundheitswesen in Barcelona wie auch unter der Jugend in Valencia. Der Gewerkschaftsstreik vom 29. März und der Bergarbeiterstreik sind auch wichtige Erfahrungen, über die wir nachdenken sollten. (Vgl. die Artikel dazu auf unserer spanisch- oder englischsprachigen Webseite, z.B. General strike in Spain: radical minorities call for independant workers‘ action in World Revolution Nr. 353)
Unsere Genoss_innen in Spanien haben festgestellt, dass nach all diesen Erfahrungen in der Bewegung ein Gefühl der Prüfung aufgekommen ist – Prüfung ihrer Schwächen und der Schwierigkeit, einen Kampf zu entfalten, welcher der Ernsthaftigkeit der Lage und der Stärke der Angriffe entspricht. Dieser Prozess der Hinterfragung ist absolut wesentlich, ein lebendiger Beitrag für die Entwicklung eines Verständnisses in der Arbeiterklasse, das den Boden vorbereitet für eine Antwort, die einerseits von einer breiteren Bewegung kommen und andererseits tiefer gehen wird bei der Infragestellung des Kapitalismus insgesamt.
Die Erkenntnis, dass der Kapitalismus ein bankrottes System ist, greift langsam um sich; dass es keine Zukunft hat, dass die herrschende Klasse nach fünf Jahren Krise keine Antwort hat und dass das System ausgewechselt werden muss. So ergriff beispielsweise in einer Versammlung in Valencia eine Frau das Wort und unterstützte einen Beitrag der IKS, der argumentiert hatte, in der 15M-Bewegung gebe es einen revolutionären und einen reformistischen Flügel und es gehe darum, jenen zu unterstützen. Aber es gibt auch eine Suche nach unmittelbaren Antworten und Aktionen, die zu unfruchtbaren oder sogar lächerlichen Vorschlägen führen können wie die Idee, wir sollten alle unsere Guthaben bei der verstaatlichen Bankia abheben, das werde „den Kapitalismus wirklich treffen“.
Während also die Frage der Notwendigkeit, den Kapitalismus zu ersetzen, aufgeworfen wird, gibt es die Schwierigkeit zu sehen, wie dies umgesetzt werden kann, und auch die Hoffnung, dass der Bankrott des Systems vielleicht doch noch abgewendet werden könne. Da haben die Linken und Linksextremen alle möglichen „Lösungen“ zur Reformierung des Kapitalismus zur Hand wie die höhere Besteuerung der Reichen, die Beseitigung der Korruption, Verstaatlichungen usw. Tatsächlich können sich die Mitte- und Rechtsparteien diesen „radikalen“ Kampagnen gegen Korruption und Steuerflucht sogar anschließen.
Wir dürfen nicht in die Falle der reformistischen Alternativen gehen. Aber ebenso wichtig ist es, dass uns der Ekel vor den Politikern insgesamt und vor den Lügen der Linken im Besonderen nicht dazu verleiten, uns in lokale Aktivitäten oder isolierte Gruppen zurück zu ziehen, die jedem Außenstehenden gegenüber misstrauisch sind. Nur wenn wir diesen Fallen aus dem Weg gehen, können wir den Prozess des Nachdenkens über die Krise des Kapitalismus, über die Notwendigkeit seiner Überwindung, über die Mittel und Wege der Arbeiterklasse zu diesem Ziel voran bringen. Diese Reflexion ist wesentlich für die Vorbereitung auf die zukünftigen Kämpfe.
Alex 30.06.12
Aktuelles und Laufendes:
- Kämpfe in Spanien [444]
Syrien: Die imperialistischen Mächte kreisen über ein Land in der Barbarei
- 1785 Aufrufe
Mit schamloser Arroganz rechtfertigen die Beschützer des Regimes die blutigen Belagerungen, behaupten, dass "bewaffnete terroristische Gruppen" diese Städte übernommen hätten. Sehr oft werfen sie die in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Massaker an Frauen und Kindern diesen Gruppen vor, die angeblich darauf abzielen, den Ruf der Regierung zu schädigen. Aber die ruchlosen, dreisten Verbrechen und Lügen der syrischen Regierung sind alles andere als ein Beleg dafür, dass das Regime festen Boden unter den Füßen hat. In Wirklichkeit spiegeln diese Massaker die Verzweiflung eines Regimes wider, dessen Tage gezählt sind.
In Anbetracht der sich immer mehr ausdehnenden Proteste gegen seine Herrschaft, die durch die Massenbewegungen in Nordafrika und im Nahen & Mittleren Osten angespornt wurden, versucht Assad jun. in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. 1982 wurde auch Hafez al-Assad mit einem Aufstand konfrontiert, der seinerzeit von der Muslimbruderschaft angeführt wurde und dessen Zentrum in Hama lag. Das Regime entsandte die Armee, die einen Großteil der Bevölkerung abschlachtete: Man geht von ca. 17.000-40.000 Toten aus. Der Aufstand wurde niedergeschlagen, und die Assad-Dynastie konnte ihre Herrschaft über das Land während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte mehr oder weniger unangefochten aufrechterhalten.
Die Veränderung der Lage seit 1982
Doch einfach schnell zum unbarmherzigen Terror zu greifen reicht nicht mehr aus, weil sich die Geschichte seit den 1980er Jahren weiterentwickelt hat. Zunächst wurde die relative Stabilität des alten Blocksystems (in dem Syrien der konsequenteste Verbündete der UdSSR in der Region war) durch den Zusammenbruch des Ostblocks und dem darauf folgenden Auseinanderbrechen des von Washington angeführten westlichen Blocks untergraben. Diese tiefgreifende Umwälzung der internationalen Beziehungen öffnete das Tor für die Konfrontation zwischen den imperialistischen Ambitionen einer ganzen Reihe von Staaten (sowohl kleiner, mittelgroßer als auch größerer), die nun nicht mehr von den alten Supermächten beherrscht wurden. Im Mittleren Osten war der Iran schon vor dem Zusammenbruch der Blöcke ein Unruhestifter. Seine Ambitionen haben seit der Besetzung des Irak durch die von den USA angeführten Truppen mächtig Auftrieb erhalten. War der Irak unter Saddam Hussein noch ein wichtiges Gegengewicht zu Teherans Ambitionen in der Region gewesen, so wurde nach dem Sturz Saddams das Land durch innere Unruhen erschüttert. Seitdem wird auch der Irak von einer schwachen schiitischen Fraktion beherrscht, die iranischen Einflüssen sehr offen gegenübersteht. Die Türkei, einst ein zuverlässiger Verbündeter der USA, hat begonnen, ihr eigenes Spiel zu betreiben; sie tritt zunehmend als Führer des muslimischen Nahen Ostens auf. Selbst Israel macht immer mehr Unabhängigkeit gegenüber seinem Zahlmeister, den USA, geltend. Die Stimmen im israelischen Staat, die auf einen Angriff gegen die iranischen Atomkraftanlagen drängen, unterstreichen dies. Die USA schrecken jedoch vor solch einem Schritt zurück, weil er das große Risiko eines gewaltigen Chaos mit unabsehbaren Konsequenzen beinhaltet.
Auf diesem Tummelplatz nationaler Ambitionen wurde das, was einst als unbewaffneter Protest gegen das Assad-Regime begann, sehr schnell zu einem Stellvertreterkrieg zwischen regionalen und globalen imperialistischen Mächten. Der Iran, Syriens mächtigster Verbündeter in der Region, hat sich entschlossen auf die Seite des Assad-Regimes geschlagen. Es gibt Berichte von iranischen Revolutionswächtern oder anderen Handlangern der islamischen Republik, die vor Ort als Komplizen des Terrors aktiv sind, der von den Schergen Assads ausgeübt wird. Assad genießt auch weiterhin den Schutz Russlands und Chinas, die im UN-Sicherheitsrat eine Reihe von Resolutionen blockiert haben, in denen das Assad-Regime verurteilt und zu Sanktionen gegen das Land aufgerufen werden sollte. In Anbetracht der sehr starken Kritik musste Russland seine Haltung etwas abschwächen und kritisierte zum ersten Mal, wenn auch moderat die vom Assad-Regime verübten Massaker. Seine Unterstützung einer „Nicht-Interventionspolitik" läuft darauf hinaus, sicherzustellen, dass die Rebellen keine Waffen erhalten, während die regierungstreuen Kräfte weiterhin über ein gewaltiges Waffenarsenal verfügen. US-Außenministerin Hilary Clinton beschuldigte neulich Russland, Damaskus Kampfhubschrauber zu liefern, woraufhin der russische Außenminister Sergej Lawrow entgegnete, die Hubschrauber dienten lediglich "Verteidigungszwecken", und schließlich liefere der Westen über geheime Kanäle ja auch Waffen an die Rebellen.
Dies war die erste öffentliche Beschuldigung dieser Art durch die Russen, aber die Tatsache der Waffenlieferungen an die Rebellen war schon seit langem bekannt. Nachdem die Opposition zu einer größeren politischen bürgerlichen Kraft herangewachsen war und sich um die Freie Syrische Armee und den Syrischen Nationalrat zusammengeschlossen hatte, erfolgten Waffenlieferungen aus Saudi-Arabien und Qatar. Die Türkei hat in der Zwischenzeit eine Kehrtwende vollzogen und ist von der vormals freundschaftlichen Haltung gegenüber dem Assad-Regime zur Verurteilung des unmenschlichen Vorgehens des Regimes übergegangen. In der Zwischenzeit hat sie Flüchtlingen aus Syrien Unterkunft angeboten. Auf militärischer Ebene hat sie beträchtliche Kräfte an der syrischen Grenze zusammengezogen. In der gleichen Rede, in der H. Clinton Moskau die Lieferung von Kampfhubschraubern an Syrien vorwarf, meinte sie, dass der „Aufmarsch von syrischen Truppen um Aleppo, das nahe der türkischen Grenze liegt, vitale strategische oder nationale Interessen der Türkei verletzen könnte“ (The Guardian, 13. Juni 2012). Der jüngste Abschuss einer türkischen Militärmaschine, die angeblich syrischen Luftraum verletzt hatte, hat die Spannungen zwischen Ankara und Damaskus weiter verschärft.
Imperialistisches Patt
So hat die Politik der Terrorisierung der Bevölkerung nicht die Kontrolle Assads über das Land verstärkt, sondern das Land in einen zunehmend unberechenbaren imperialistischen Konflikt getrieben, in dem auch die religiösen und ethnischen Spaltungen im Land vertieft werden. So unterstützt der Iran die dominierende alawitische Minderheit, während die Saudis versuchen, ein sunnitisches Regime durchzuboxen; gleichzeitig streifen Dschihad-Terroristen wie Hyänen durchs Land, um ihre Terrorangriffe auszuführen. Hinzu kommen Spaltungen zwischen Christen und Muslimen, Kurden und Arabern, die alle noch an Schärfe zunehmen und das Land in ein noch größeres Chaos treiben werden, wie wir es schon aus dem Irak kennen.
Je mehr Syrien zu einem gescheiterten Staat zu werden droht, je weniger die UN-Sanktionen und Beobachtermissionen sich als fähig erweisen, dem Töten ein Ende zu setzen, desto lauter werden die Rufe nach einer “humanitären” militärischen Intervention durch die westlichen Mächte werden. Schließlich, so sagen deren Befürworter, habe das doch auch in Libyen „funktioniert“, wo Frankreich und Großbritannien die Verantwortung übernommen hatten, eine Flugverbotszone durchzusetzen. Ihr militärisches Eingreifen ermöglichte letztendlich den Sieg der Rebellen und den Sturz des Gaddafi-Regimes. Doch im Falle Syriens sind Staaten wie Großbritannien, Frankreich und die USA weitaus vorsichtiger, auch wenn sie Assad immer lauter auffordern, seinen Platz zu räumen. Es gibt eine Reihe von Gründen für ihr Zögern: Die Geographie des Landes eignet sich, anders als in Libyen, das zum Großteil aus Wüste besteht, nicht für eine Kriegsführung aus der Luft. Und während Gaddafi in seinen letzten Tagen an der Macht international zunehmend isoliert wurde, pflegt Syrien viel engere Bande zu Russland, China und zum Iran. Vor dem Hintergrund, dass Israel die USA bereits dazu drängt, den Iran anzugreifen, und droht, dass es andernfalls allein vorpreschen werde, könnte eine Eskalation in Form eines Krieges in Syrien auch einen Krieg mit dem Iran auslösen, der noch viel größere Folgen nach sich ziehen würde. Zudem ist die Armee Assads viel besser ausgerüstet und gedrillt als Gaddafis Soldaten. Kurzum, die westlichen Truppen laufen Gefahr, in Syrien und seinem Umfeld in ein völlig unkontrollierbares Schlamassel zu geraten, so wie schon in Afghanistan und im Irak. Im Gegensatz zu Libyen gibt es keine Gefahr, dass wertvolle Ölreserven in die falschen Hände geraten, denn Syrien ist mit keinerlei Ölquellen gesegnet. Die sozialen und politischen Konsequenzen eines weiteren Kriegsschauplatzes mit Beteiligung der Großmächte in dieser von Kriegen übersäten Region sind - zumindest im Augenblick – nicht abzuwägen, um ein solches Risiko einzugehen. Auch die Türkei, die am stärksten durch die Folgen einer humanitären Katastrophe in Syrien betroffen wäre, geht gegenwärtig sehr vorsichtig mit ihren Karten um.
Man kann von einer Art imperialistischem Patt in Syrien sprechen, während gleichzeitig die Opfer –Tote und Verwundete - nicht mehr zu zählen sind. Das heißt nicht, dass ein westliches militärisches Eingreifen auszuschließen ist. Wie die Erfahrung im Irak und Afghanistan (und Libyen, wo die Konflikte nach einiger Zeit sich auch auf die Nachbarländer Libyens ausgedehnt haben) zeigt, sind die Folgen des militärischen Eingreifens des Westens alles andere als „humanitär“. Auch wenn es ihren imperialistischen Interessen entspricht, eine gewisse Ordnung in der Region herzustellen und die Konflikte in einigen Gebieten einzudämmen, besteht die vorherrschende Tendenz darin, dass Chaos, Gewalt und „Unordnung“ noch mehr zunehmen werden. Wie die Wirtschaftskrise, vor der der Kapitalismus wie vor einer unüberwindbaren Mauer steht, beweist die Zunahme von Kriegen und imperialistischen Spannungen auf der Welt, dass der Kapitalismus zu einer Sackgasse für die Menschheit geworden ist.
Amos 4.7.2012
Weltrevolution Nr. 174
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 572.7 KB |
- 1832 Aufrufe
Ausstellungsbericht: Baumeister der Revolution: Konstrukteure der Zukunft in der Vergangenheit
- 1894 Aufrufe
Zunächst einmal ist es das Thema der Ausstellung: die Suche nach einer neuen Bauweise, die einer klassenlosen und damit menschlicheren Gesellschaft Ausdruck verleihen soll. Kernstück bilden die beeindruckenden Fotografien von Richard Pare, der 1993-2010 auf der Suche nach Gebäuden der Avantgarde durch die ehemalige UdSSR reiste. So wird man in vier Räume zur Architektur und Malerei Avantgarde geführt. Den Kontrapunkt setzt der fünfte und letzte Raum der Ausstellung, der die neue Ära des sogenannten Sozialistischen Realismus in der Architektur unter Stalin in den 1930ern repräsentiert.
Zwischen 1905 und 1920 entstanden zahlreiche künstlerische Strömungen, die Teil einer dynamischen sozialen Bewegung waren.[2] Es waren ihrer viele und oft hatten sie sehr unterschiedliche Visionen und Ausdrucksweisen. Eines war ihnen jedoch gemeinsam: Ihre ästhetischen Aktivitäten waren eine Reaktion auf die damaligen Verhältnisse, die sie massiv kritisierten. Ihre neuen Kunstformen stellten eine Suche nach einer besseren Welt dar. Und sie waren keineswegs auf Russland beschränkt, sondern ein internationales Phänomen.
Während der Russischen Revolution positionierten sich die Bolschewiki zur Kunst, indem der Volkskommissar für Kunst, Lunascharski, folgende Grundsätze entwickelte: 1. Erhaltung der Kunstwerke der Vergangenheit (als Erbe der Menschheit), 2. Bereitstellung der Kunst für die Massen, 3. Nutzung der Kunst für die Propaganda des Kommunismus, 4. eine objektive Einstellung zu allen künstlerischen Strömungen (d.h. keine Einschränkung), 5. die Demokratisierung aller Kunstschulen.
Es brannten leidenschaftliche Debatten darüber, wie der „neue Mensch“ sich entwickeln werde, wie die revolutionäre Gesellschaft kollektiv organisiert werden müsse und schließlich, welche Rolle die Kunst hier zu spielen habe. Der Kreativität wurde freien Lauf gelassen. Allerdings sind die meisten Konzepte und Ideen bislang nicht realisiert worden, denn die siegreiche Russische Revolution 1917 bildete ja „nur“ den Auftakt der Weltrevolution und wurde sogleich von der weißen Armee bis ca. 1921 in einen blutigen Bürgerkrieg verwickelt. Es war eine Zeit des unendlichen Leids, des Hungers und des allgemeinen Mangels. Die Verwaltung des Mangels setzte sich in den Folgejahren des NEPs fort. Umso erstaunlicher ist, dass auch unter diesen Bedingungen die Avantgarde unbeirrt versuchte, Funktionalität und Schönheit für die neue Gesellschaft zu verbinden. Ein Beispiel ist der Funkturm von Schuchow, der 1919-1922 als Sendeturm für den sowjetischen Rundfunk errichtet wurde. Bereits 1919 präsentierte Schuchow einen Entwurf für einen Turm, der 350 Meter hoch sein sollte, doch der Mangel an Stahl ließ letztlich nur den Bau eines 150 Meter hohen Turms zu. Der filigrane Funkturm ist noch heute in Moskau in Betrieb und löst(e) damals wie heute Begeisterung aus. Er wurde schon bald das Symbol der Überwindung des Alten und Schweren gesehen. Vor allem aber brauchte die junge Sowjetrepublik Wohnraum, Industrieanlagen, Arbeiterclubs und Großküchen. In der Ausstellung wird der von Ginsburg und Milinis entworfene und 1930 in Moskau gebaute Narkomin-Wohnblock präsentiert. Er war einer der experimentellsten Projekte dieser Ära. Neben Wohnungen und kollektiven Wohneinheiten umfasste der Gebäudekomplex eine Mensa, einen Kindergarten, einen Ruheraum, einen Dachgarten sowie eine Sporthalle und eine Waschküche.
Tragisch aber auch bezeichnend ist die Tatsache, dass sich diese experimentelle Phase in der sowjetischen Architektur letztlich nur so lange hielt, wie die Chance oder zumindest die Hoffnung auf eine weltweite Ausbreitung der Revolution bestand. Mit der Machtübernahme Stalins und der im Gegensatz dazu stehenden Doktrin des „nationalen Sozialismus“ (Sozialismus in einem Land), die ab den 1930ern mit aller Gewalt und Repression durchgesetzt wurde, bekamen auch die avantgardistischen Architekten die Repression zu spüren. So erklärt der Fotograf Richard Pare in einem Interview: „Das Regime wurde immer repressiver, es war unmöglich, von der stalinistischen Norm abzuweichen. Man spürt direkt, wie etwa ab 1932 der Optimismus in den Arbeiten der Architekten verloren geht. Danach wurden die vom stalinistischen Regime immer stärker bevormundet und gegängelt.“[3] Dies wird z.B. an dem Architekten Konstantin Melnikows deutlich– an seinem 1925 Aufsehen erregenden sowjetischen Pavillon in der Pariser Kunstgewerbeausstellung, seinem Entwurf für den Sarkophag Lenins und an dem Gosplan-Parkhaus von 1936. Der Architekt, der die Oktoberrevolution 1917 noch als Arbeiter in der AMO-Fabrik in Moskau erlebte, war einer der wichtigsten Vertreter der Avantgarde. Als Anerkennung erhielt Melnikow sogar ein Grundstück, um sich ein Heim darauf zu errichten. Ein Kleinod des Lichtes, das übersät ist mit sechseckigen Fenstern, die flexibel zu handhaben sind. Wenn man die Räume umgestaltet, kann man problemlos die Fenster mit Backsteinziegeln verschließen oder wieder freilegen – dies vermittelt ein Gefühl von Dynamik, Flexibilität und organischem Leben. Der Bau passt sich stets den Bedürfnissen des Lebens an. Doch zur Zeit der stalinistischen Säuberungen Mitte der 30er Jahre fiel Melnikow in Ungnade; zwar blieb er am Leben, aber er musste seine Lehrtätigkeit aufgeben und erhielt keine Bauaufträge mehr. Er zog sich enttäuscht zurück.
An diesem abrupten Bruch in Melnikows Leben zeigt sich, dass der Wind sich nun endgültig gedreht hatte: von der Hoffnung auf das Ausbreiten der internationalen Revolution auf den Schrecken der stalinistischen Konterrevolution. Stalin hatte seine Macht gefestigt. Nun hatte die Architektur einem anderem Zweck zu dienen: weg mit dem Experimentellen und Modernistischen. Es sollten staatstragende Bauten errichtet werden. Sie sollten den „sozialistischen Realismus“ Ausdruck verleihen, der am Klassizismus angelehnt war. Es sollten protzige, überdimensionierte Monumentalbauten sein, die die allumfassende Macht des stalinistischen Staatsapparates symbolisieren sollten. Dieser Bruch, ja Gegensatz wird im fünften Raum der Ausstellung sofort deutlich. Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Raum im Gegensatz zu den anderen Räumen dunkler und damit (be)drückend ist.
Zurück zu der Ausgangsfrage, weshalb „die Baumeister der Revolution“ als Ausstellung auf ein solch großes Interesse gestoßen sind. Auf die Frage, ob Architektur einen Beitrag zur Entwicklung einer besseren Gesellschaft leisten kann, antwortet Richard Pare: „Man möchte das zumindest glauben. Es gehört zu den großen Katastrophen in der Geschichte der Architektur des 20. Jahrhunderts, dass die Architekten in Russland nicht die Chance hatten, ihre Ideen weiter zu entwickeln und zu größerer Reife zu bringen. Obwohl es nur eine kurze Zeitspanne dauerte, stellten die Debatten, die geistige Gärung und die Bautätigkeit selbst eine heroische Leistung dar (…). Sie kämpften darum, eine ideale Lebensweise zu schaffen, merkten aber auch ziemlich schnell, glaube ich, dass sie auf verlorenem Posten standen (…). Es war das radikalste Experiment bis heute. Es war nicht erfolgreich, doch lag es nicht am fehlendem Willen.“[4] Es stimmt, das revolutionäre Experiment von damals ist gescheitert, musste scheitern, als die Weltrevolution ausblieb. Genau diese Botschaft senden die Bauten der russischen Avantgarde den nachfolgenden Generationen, also uns! Deshalb ist es wichtig, dass diese Gebäude nicht weiter dem Verfall überlassen werden und in Vergessenheit geraten. Gegen dieses Vergessen ist die Ausstellung ein Beitrag. Deshalb ist der Blick in die Vergangenheit wichtig. Aber ebenso wichtig ist der Blick in die Zukunft, denn gerade, weil die revolutionäre Welle scheiterte, leiden wir heute mehr denn je unter diesem kapitalistischen System und der Schwindel erregenden Beschleunigung der Krise. Welche Zukunft wollen wir? In welch einer Gesellschaft wollen wir gemeinsam leben? Was für Gebäude wollen wir für dieses Leben kreieren? Die Suche geht weiter…
Juli 2012, Anna
[1] „Baumeister[n] der Revolution. Sowjetische Kunst und Architektur 1915-1935“. Leider ist die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, Berlin bereits am 9.Juli 2012 zu Ende gegangen. Allerdings gibt es einen sehr lohnenden Ausstellungskatalog.
[2] Dadaismus, Expressionismus, Futurismus, Bauhaus etc.
[3] Interview Richard Pare www.wsws.org [446]
[4] Ebenda.
Euro-Krise: Tauziehen am Rande des Abgrunds
- 2028 Aufrufe
Die Währungsunion: ein Mittel zur Domestizierung des deutschen Imperialismus
Mit dem Ende des Kalten Krieges 1989 war nicht nur der Nato, sondern auch der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als Bollwerk gegen den sowjetischen Imperialismus der Sinn abhanden gekommen. Für das durch die Wiedervereinigung endgültig zur stärksten Macht Europas aufgestiegene Deutschland Anlass genug, Europa neu zu interpretieren, d.h. nach der wirtschaftlichen nun auch die politische Vereinigung Europas anzustreben. Der Zeitpunkt schien günstig, einen europäischen Bundesstaat zu schaffen, dessen Strukturen „dem politischen System der Bundesrepublik nachgebildet“ (SPIEGEL, Nr. 36/2012) sind. Die neu erwachten imperialistischen Avancen Deutschlands stießen jedoch auf heftigen Widerstand seitens Großbritanniens und besonders Frankreichs. Die engen Kontakte der deutschen Bourgeoisie, die sich im Zuge der Abwicklung der DDR mit Jelzins Russland ergaben, die Expansion der deutschen Wirtschaft nach Mittel- und Osteuropa, die Einführung der „Deutschmark“ als heimliche Ersatzwährung in etlichen mitteleuropäischen Ländern und nicht zuletzt das emsige Treiben deutscher Dienste auf dem Balkan Anfang der 90er Jahre – all dies weckte in Paris, London und anderswo die alten Gespenster der „teutonischen Gefahr“.
Das jahrelange Ringen um die Deutungshoheit über Europa – gemeinsamer Wirtschaftsraum oder Vereinigte Staaten von Europa (was natürlich nicht die Überwindung oder gar Aufhebung der nationalen Grenzen bedeutet, sondern eine Neuordnung Europas nach deutschem Gusto) – endete schließlich 1993 mit der Erkenntnis für den deutschen Imperialismus, dass die Trauben höher hängen als erwartet – und mit Maastricht und der Währungsunion. „Wieder einmal hat ein französischer Präsident demonstriert, dass der Euro nicht primär ein großer Schritt zum vereinten Europa ist, sondern ein Instrument, um die Dominanz der D-Mark zu beseitigen“, äußerte Hans-Peter Schwarz in seiner Kohl-Biographie. In der Tat gelang es den Rivalen Deutschlands, mit der Gründung der EZB als obersten Währungshüter des Euro die Abhängigkeit der restlichen EU von den Entscheidungen der zumeist auf Stabilität der D-Mark bedachten Bundesbank zu lösen.
Das Fehlen einer politischen Dimension für die europäische Einheit, das hierzulande immer wieder als „Geburtsfehler“ der Währungsunion beklagt wurde, war aus der Sicht der Rivalen des deutschen Kapitals durchaus kein Versäumnis, sondern Kalkül. Maastricht war der goldene Käfig, in dem der deutsche Imperialismus eingeschlossen werden sollte.
Die politische Union: Der deutsche Imperialismus zwischen Wohl und Wehe
Kaum geriet die EU in die aktuelle „Schuldenkrise“, witterte die deutsche Bourgeoisie eine neue Chance. Zunächst hatte es den Anschein, als sei der Merkel-Regierung ein gewisser Erfolg bei ihren Bemühungen beschieden, den „Konstruktionsfehler“ des Maastrichter Vertrages zu beheben. So wurde die Aushandlung des Fiskalpaktes Anfang dieses Jahres hierzulande als Erfolg der deutschen Politik verbucht. Schließlich bedeutet er einen ersten substanziellen Schritt zu einer gemeinsamen europäischen Haushaltspolitik und einen kleinen Schritt zur politischen Union. Und nicht zuletzt die deutsch-französische Liaison unter Merkel/Sarkozy trug zur zeitweisen Stärkung der deutschen Stellung bei.
Spätesten mit dem Antritt des Sozialisten Hollande zum französischen Staatspräsidenten drehte sich der Wind wieder und bläst seither der deutschen Bourgeoisie ins Gesicht. Der beispiellose Absturz der griechischen Wirtschaft machte deutlich, dass das Spardiktat, das die Euro-Gruppe unter deutscher Federführung Griechenland aufzwang, die Lage nur noch weiter verschlimmerte. Allerorten geht das Gespenst der Rezession um, allein Deutschland weist noch ein geringes Wachstum auf. So stimmte Hollande in den Chor jener ein, die mehr „Solidarität“ Deutschlands mit den Südstaaten – die Schuldenunion - und eine Lockerung der strikten Geldpolitik der EZB – die Monetarisierung - fordern. Auf dem Euro-Krisengipfel Ende Juni war die Isolation Deutschlands innerhalb der Euro-Zone mit Händen zu greifen; es stand einer Phalanx der Südstaaten, mit Frankeich an der Spitze, gegenüber, die sich scheinbar erfolgreich gegen den deutschen Kurs stemmte. In den hiesigen Medien herrschte mehrheitlich die Meinung vor, dass Merkel in Brüssel einen weiteren Schritt in Richtung einer Vergemeinschaftung der Schulden gemacht habe. Den nächsten Kontrapunkt zum deutschen „Kurs“ der Geldstabilität setzte EZB-Präsident Draghi, als er ankündigte, „alles zu tun, um den Euro zu erhalten“, was von den Finanzmärkten prompt so verstanden wurde, dass die EZB italienische und spanische Staatsanleihen aufkaufen werde. Der Aufschrei war groß in Deutschland, allerdings nicht so sehr im politischen Berlin, sondern vielmehr in der Finanzhochburg Frankfurt. Während deutsche Finanzexperten, allen voran Bundesbankchef und EZB-Mitglied Weidmann, offen vor einem inflationären Sündenfall warnten, hielt sich die politische Klasse in Deutschland bedeckt, ja, übernahmen Schäuble und Merkel nahezu wortgleich die Formulierung Draghis.
Wenn Merkel und Schäuble sich jetzt „bewegen“ und ihre bisherigen Positionen etwas aufzuweichen scheinen, dann geschieht dies jedoch nicht, weil die deutsche Bourgeoisie plötzlich von der Alternative überzeugt ist, die die Südstaaten favorisieren: Die Vergemeinschaftung der Schulden via Eurobonds führt - neben der finanziellen Belastung Deutschlands – ohne deutsches Diktat möglicherweise zur Auflockerung der Sparpolitik in den besonders betroffenen Euro-Ländern. Und die Monetarisierung, sprich: die Herausgabe frischen Geldes durch die Notenpresse beschwört die Gefahr der Inflation herauf. Nein, sie tun dies, weil ihnen keine andere Wahl bleibt. Ein weiteres Beharren auf Schuldenabbau und Geldstabilität könnte einen verhängnisvollen Prozess in Gang setzen, in dessen Verlauf der Ausstieg Griechenlands aus der Euro-Zone nur der Anfang vom Ende der Euro-Zone, wenn nicht sogar der Europäischen Union ist.
Die Schuldenunion: Hintergründe für die deutsche Kursänderung
Allen Planspielen in deutschen Konzernen für den Fall einer Auflösung der Euro-Zone zum Trotz wäre ein Rückfall in den Zustand vor der Währungsunion aus wirtschaftlicher Sicht für den deutschen Kapitalismus eine Katastrophe - sowohl für den Finanzsektor, für Banken und Versicherungen, die Kredite in astronomischer Höhe in den Wind schreiben könnten, als auch für die sog. Realwirtschaft, für die die Euro-Zone und die EU insgesamt immer noch der größte Absatzmarkt darstellt.
Doch daneben spielen auch die Befürchtungen der deutschen Bourgeoisie vor dem eigenen Bedeutungsverlust in den globalen imperialistischen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle bei ihrem Abwägen zwischen den verschiedenen Alternativen. Eine Auflösung der Euro-Zone und schlimmstenfalls der gesamten Union würde den imperialistischen Ambitionen der deutschen Bourgeoisie ein jähes Ende setzen. Ohne europäisches Hinterland drohte dem deutschen Imperialismus das Los, zum Spielball der interimperialistischen Auseinandersetzungen in einer - nach dem Aufstieg Chinas - zunehmend multipolaren Welt zu werden. So handelt es sich bei der „Kursänderung“ der deutschen Politik eher um einen taktischen Rückzug, um nicht die langfristige Strategie des deutschen Imperialismus zu gefährden: die Schaffung eines Europas unter deutscher Regie.
Doch das vielleicht wichtigste Motiv für das Einlenken der Merkel-Regierung ist die Furcht vor… der Arbeiterklasse. Das mag sich verwegen anhören, ist doch die Antwort der Arbeiterklasse auf die beispiellosen Angriffe besonders der spanischen, italienischen, portugiesischen, irischen und griechischen Bourgeoisie bisher alles andere als adäquat. Dennoch treibt die europäischen, insbesondere aber die deutsche Bourgeoisie die Sorge vor der sozialen Unruhe um. Auch wenn die Erinnerung immer mehr verblasst, wirkt das Trauma der revolutionären Welle von 1917-23 noch immer nach. Sicher, der verzweifelte Kampf der schwachen Arbeiterklasse Griechenlands gegen die existenzbedrohenden Angriffe hat den Herrschenden keinen großen Schrecken eingejagt. Anders verhält es sich dagegen, wenn die italienischen oder spanischen ArbeiterInnen auf den Plan treten, die mit ihrer zahlenmäßigen Stärke, ihrer Kampfkraft und nicht zuletzt dank ihrer historischen Erfahrung ein ganz anderes Gewicht im internationalen Kräfteverhältnis zwischen Kapital und Arbeit darstellen. Und nicht auszumalen, wenn das französische Proletariat in Aktion tritt. Mit seiner Strahlkraft gerade gegenüber der deutschen Arbeiterklasse kann sein Kampf die Initialzündung für einen grenzüberschreitenden Widerstand der Arbeiterklasse gegen den Generalangriff auf seine Lebensbedingungen sein. Wahrhaftig Grund genug für die Herrschenden, Kreide zu fressen.
9.9.2012
Aktuelles und Laufendes:
- Euro-Krise [447]
Leute:
Massaker in Syrien, iranische Krise… Die Gefahr einer imperialistischen Katastrophe im Nahen und Mittleren Osten
- 2485 Aufrufe
In Syrien kommt es jeden Tag zu neuen Massakern. Nun ist auch dieses Land im Sumpf der imperialistischen Kriege im Nahen Osten versunken. Nach Palästina, Irak, Afghanistan und Libyen ist nun Syrien an der Reihe. Leider wirft diese Entwicklung sofort eine sehr besorgniserregende Frage auf. Was wird in der Zukunft passieren? Der Nahe und Mittlere Osten stehen vor einem Flächenbrand, dessen Ausgang schwer vorherzusehen ist. Hinter Syrien zieht der Iran die Fäden. Der Iran ruft selbst die größten Ängste hervor und facht die imperialistischen Appetite an; alle großen imperialistischen Räuber sind fest entschlossen, ihre Interessen in der Region zu verteidigen. Auch hier befinden wir uns am Rande des Krieges, dessen dramatischen Konsequenzen völlig wahnsinnig und zerstörerisch für das kapitalistische System selbst wären.
Massive Zerstörungen und Chaos in Syrien. Wer ist verantwortlich?
Aus der Sicht der internationalen Arbeiterbewegung wie für alle Ausgebeuteten der Erde kann die Antwort auf diese Frage nur folgende sein: Verantwortlich ist das Kapital, und nur dieses allein. Dies war schon bei den Massakern im Ersten und Zweiten Weltkrieg der Fall. Und auch bei all den endlosen Kriegen, die seitdem mehr Tote hinterlassen haben als die beiden Weltkriege zusammen. Vor mehr als 20 Jahren erklärte der damalige Präsident George Bush lange bevor sein Sohn ins Weiße Haus einzog, triumphierend, dass „die Welt nun eine neue Weltordnung“ erleben werde. Der Sowjetblock war sprichwörtlich zusammengebrochen. Die UdSSR befand sich in der Auflösung, und mit ihrem Verschwinden sollten gleichzeitig alle Kriege und Massaker verschwinden. Dank des siegreichen Kapitalismus und unter dem Schutz der USA würde jetzt Frieden auf der Welt einkehren. Natürlich handelte es sich nur um Lügen, die sofort von der Wirklichkeit bloßgestellt wurden. So löste zum Beispiel G.Bush eine kurze Zeit nach dieser zynischen und heuchlerischen Rede den ersten Irak-Krieg Anfang 1991 aus.
1982 hat die syrische Armee die Erhebung der Bevölkerung in der Stadt Hama blutig niedergeschlagen. Die Zahl der Opfer konnte nie zuverlässig ermittelt werden: man schätzt zwischen 10.000 und 40.000 Ermordete.[1] Niemand sprach seinerzeit davon, dort einzugreifen um der Bevölkerung zu helfen; niemand verlangte damals den Rücktritt von Hafez Al-Assad, dem Vater des gegenwärtigen syrischen Präsidenten. Der Gegensatz zur gegenwärtigen Lage ist nicht unerheblich. Der Grund liegt darin, dass 1982 die Weltlage noch beherrscht wurde durch die Rivalitäten zwischen den beiden großen imperialistischen Blöcken. Trotz des Sturzes des Schahs von Persien und seine Ersetzung durch das Regime der Ajatollahs Anfang 1979 und der russischen Invasion in Afghanistan ein Jahr später wurde damals die US-Vorherrschaft in der Region noch nicht durch die anderen imperialistischen Mächte herausgefordert und die USA waren damals noch in der Lage, eine relative Stabilität zu garantieren.
Seitdem hat sich die Lage geändert: Der Zusammenbruch der Blöcke und die Schwächung der US-“Führerschaft” haben den imperialistischen Bestrebungen der Regionalmächte wie Iran, Türkei, Ägypten, Syrien, Israel usw. freien Lauf gelassen. Die Zuspitzung der Wirtschaftskrise treibt die Bevölkerung in die Armut und verstärkt das Gefühl der Verzweiflung und der Revolte gegenüber den Machthabern.
Während heute kein Kontinent der Zuspitzung der inter-imperialistischen Spannungen ausweichen kann, bündeln sich die Gefahren im Nahen und Mittleren Osten mit am gefährlichsten. Im Mittelpunkt der Spannungen steht gegenwärtig Syrien, nachdem zuvor monatelang gegen Arbeitslosigkeit und Armut von allen Ausgebeuteten protestiert worden war. Daran beteiligten sich gemeinsam Drusen, Sunniten, Christen, Kurden, Männer, Frauen, Kinder, denn sie alle hoffen auf ein besseres Leben. Aber die Lage ist schnell umgeschlagen. Die Sozialproteste wurden schnell auf ein verhängnisvolles Terrain gedrängt, so dass die ursprünglichen Forderungen alle begraben und die Bewegung vereinnahmt wurde. In Syrien ist die Arbeiterklasse sehr schwach, die imperialistischen Appetite sind sehr stark; deshalb war in Anbetracht des gegenwärtigen Kräfteverhältnisses und dem Niveau der Arbeiterkämpfe diese Perspektive nahezu unvermeidbar.
Innerhalb der syrischen Bourgeoisie haben sich alle wie Geier auf die revoltierende und verzweifelte Bevölkerung gestürzt. Für die herrschende Regierung und die Bachir Al-Assad unterstützende Armee geht es darum, die Macht mit allen Mitteln zu erhalten. Und die Opposition, deren verschiedene Flügel bereit sind sich gegenseitig umzubringen und die nur über die Notwendigkeit einig sind, Bachir Al-Assad zu stürzen, versucht die Macht an sich zu reißen. Vor kurzem gab es Versammlungen dieser Opposition in Paris und London. Niemand wollte die Zusammensetzung dieser Opposition näher aufschlüsseln. Wofür stehen der syrische Nationalrat oder das Nationale Koordinationskomitee oder die Freie syrische Armee? Welche Macht haben die Kurden, die Muslimbrüder oder die salafistischen Jihadisten in ihren Reihen? Es handelt sich um einen Haufen zusammengewürfelter bürgerlicher Cliquen, von denen jede mit den anderen rivalisiert. Einer der Gründe, weshalb das Regime Assads noch nicht gestürzt ist, besteht darin, dass Assad die Machtkämpfe innerhalb der syrischen Gesellschaft zu seinen Gunsten ausnutzen konnte. So reagieren die Christen ablehnend gegenüber dem Machtzuwachs der Islamisten und befürchten das gleiche Schicksal zu erleiden wie die Kopten in Ägypten. Ein Teil der Kurden versucht mit dem Regime zu verhandeln. Die Regierung selbst wird noch teilweise von der religiösen Minderheit der Alawiten unterstützt, welcher die Präsidentenclique angehört.
Jedenfalls könnte der Nationalrat militärisch und politisch nicht wirklich bestehen, wenn er nicht von ausländischen Kräften unterstützt würde, wobei jeder auf seine eigenen Vorteile erpicht ist. Dazu gehören die Arabische Liga, Saudi-Arabien an führender Stelle, die Türkei, aber ebenso Frankreich, Großbritannien, Israel und die USA.
All diese imperialistischen Haie nehmen das unmenschliche Verhalten des Regimes als Vorwand zur Kriegsvorbereitung in Syrien. Die russische Medienstimme „Voice of Russia“, welche wiederum das öffentliche Fernsehen des Irans Press TV zitierte, brachte Informationen in Umlauf, denen zufolge die Türkei sich mit US-Hilfe anschickte, Syrien anzugreifen. Zu diesem Zweck habe die Türkei Truppen und Material an der syrischen Grenze zusammengezogen. Seitdem wurde diese Information von allen westlichen Medien aufgegriffen. In Syrien wurden in Russland produzierte Boden-Boden-Raketen in der Region von Kamechi und Deir ez-Zor entlang der irakischen Grenze installiert. Und das Regime Al-Assads wird selbst wiederum von ausländischen Mächten unterstützt, insbesondere von China, Russland und Iran.
Dieser Machtkampf zwischen den stärksten imperialistischen Geiern der Erde um Syrien wird ebenso in der Räuberversammlung namens UNO ausgetragen. In der UNO hatten Russland und China schon zweimal ihr Veto gegenüber Resolutionsprojekten gegen Syrien eingelegt. Das letzte Resolutionsprojekt unterstützte zum Beispiel den Vorschlag der Arabischen Liga, der die Absetzung Bachir Al-Assads vorsah. Nach tagelangen schmutzigen Verhandlungen ist die Heuchelei aller Beteiligten noch einmal offen zutage getreten. Der UN-Sicherheitsrat hat mit russischer und chinesischer Zustimmung am 21. März eine Erklärung verabschiedet, in welcher die Beendigung der Gewalt gefordert wird, weil ein berühmter Sondergesandter der UNO, Kofi Annan, im Land eintraf. Natürlich war diese Erklärung in keiner Weise bindend. Das bedeutet, nur diejenigen sind verpflichtet, die sich zu irgendetwas verpflichtet fühlen. All das ist ein schmutziges Manöver.
Wir stehen somit vor einer anderen Frage. Wie ist es möglich, dass bislang noch keine in diesem Konflikt involvierte ausländische imperialistische Macht direkt eingegriffen hat – natürlich zugunsten ihrer eigenen nationalen Interessen – wie zum Beispiel vor einigen Monaten in Libyen? Hauptsächlich weil die Flügel der syrischen Bourgeoisie, die sich gegenüber Bachir Al-Assad in Opposition befinden, dies offiziell nicht wollen. Sie wenden sich gegen eine massive militärische ausländische Intervention, und sie haben das lautstark verkündet. Jeder dieser Flügel hat sicherlich verständlicherweise Angst davor, in diesem Fall von der Machtbeteiligung ausgeschlossen zu werden. Aber dies schließt nicht aus, dass die Gefahr des totalen imperialistischen Krieges, die an den Grenzen Syriens lauert, gebannt werden kann. Der Krieg kann dort weiterhin Einzug halten, auch wenn der Schlüssel für die weitere Entwicklung der Lage woanders liegt.
Man muss sich die Frage stellen, warum dieses Land heute die imperialistischen Appetite so auf sich zieht. Die Antwort liegt woanders – im Osten Syriens – im Iran.
Der Iran im Zentrum der weltweiten imperialistischen Spannungen
Am 7. Februar 2012 erklärte die New York Times: “Syrien war der Anfang des Krieges mit dem Iran.” Ein Krieg, der zwar noch nicht direkt ausgelöst wurde, der im Schatten des Konfliktes in Syrien weiter schwelt.
Das Regime Bachir Al-Assads ist der Hauptverbündete Teherans in der Region, und Syrien ist für den Iran ein strategischer Dreh- und Angelpunkt. Die Allianz mit Syrien ermöglicht Teheran einen direkten Zugang zum strategisch wichtigen Mittelmeerraum und gegenüber Israel zu erlangen, mit der Möglichkeit einer direkten militärischen Auseinandersetzung mit Israel. Aber diese Kriegsgefahr, die sich eher verdeckt entwickelt, hat ihre tieferliegenden Wurzeln in dem Machtkampf, der im Mittleren Osten stattfindet, wo erneut alle kriegerischen Spannungen, die in dem verfaulenden System stecken, aufbrechen.
Dieser Teil der Welt ist ein großes Drehkreuz an dem Berührungspunkt zwischen Ost und West. Europa und Asien stoßen in Istanbul aufeinander. Russland und Europa werden durch das Mittelmeer vom afrikanischen Kontinent und den Weltmeeren getrennt. Und während die Weltwirtschaft immer mehr erschüttert wird, wird das schwarze Gold zu einer herausragenden wirtschaftlichen und militärischen Waffe. Jeder muss versuchen, die Transportwege des Öls zu kontrollieren. Ohne Öl kämen alle Fabriken zum Stillstand, kein Jagdflugzeug könnte vom Boden abheben. Diese Tatsachen erklären, weshalb alle Imperialismen im Machtkampf in dieser Region mitmischen. Aber all diese Betrachtungen sind nicht die wichtigsten Faktoren, welche diese Region in den Krieg treiben.
Seit mehreren Jahren standen die USA, GB, Israel und Saudi-Arabien an der Spitze einer gegen den Iran gerichteten ideologischen Kampagne. Diese Kampagne ist in der jüngsten Zeit noch einmal verstärkt worden. Der jüngste Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) hat verlautbaren lassen, dass der Iran möglicherweise militärische Absichten hinter seinem Atomprogramm verbirgt. Und ein mit Atomwaffen bewaffneter Iran ist aus der Sicht vieler imperialistischer Länder der Region unerträglich. Der Aufstieg des Irans als eine Atommacht, die sich überall in der Region durchsetzen könnte, ist für all diese imperialistischen Haie undenkbar. Zudem bleibt der israelisch-palästinensische Konflikt weiterhin ein Schwelbrand. Der Iran ist militärisch völlig umzingelt. Die US-Armee verfügt über Stützpunkte entlang all der Grenzen Irans. Im Persischen Golf treiben sich so viele Kriegsschiffe aller Größenordnungen herum, dass man – wenn man sie aneinanderreiht – den Golf nahezu trockenen Fußes überqueren könnte. Der israelische Staat erklärt unaufhörlich, dass er den Iran nie in den Besitz der Atombombe kommen lassen würde; israelischen Quellen zufolge würde der Iran spätestens innerhalb eines Jahres zu einer Atommacht werden. Diese in der ganzen Welt verbreitete Aussage ist angsteinjagend, denn diese Konfrontation birgt viele Gefahren in sich. Der Iran ist nicht Irak und nicht Afghanistan. Es gibt mehr als 70 Millionen Einwohner mit einer „respektabel“ ausgerüsteten Armee.
Große, katastrophale Auswirkungen
Auf wirtschaftlicher Ebene:
Aber der Einsatz von Atomwaffen durch den Iran ist nicht die einzige Gefahr und auch nicht das Wichtigste. In der jüngsten Zeit haben die politischen und religiösen Führer Irans behauptet, dass sie mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel reagieren würden, wenn ihr Land angegriffen würde. Tatsächlich verfügt der Iran über Waffen, deren Wirkung niemand richtig einschätzen kann. Wenn der Iran sich dazu entschließen würde, die Straße von Hormus zu blockieren, selbst wenn er dabei eigene Boote versenken müsste, würde der Schiffsverkehrt dort unterbrochen. Das hätte weltweit katastrophale Auswirkungen.
Ein beträchtlicher Anteil der Weltölförderung würde nicht mehr die Abnehmer erreichen. Die jetzt schon offen ausgebrochene Weltwirtschaftskrise würde dann noch einmal neue Ausmaße erreichen. Die Schäden wären in Anbetracht einer jetzt schon kranken Wirtschaft noch einmal beträchtlich.
Ökologisch
Die ökologischen Konsequenzen könnten unumkehrbar sein. Ein Angriff auf iranische Atomanlagen, die unter Tausenden Tonnen von Beton und Kubikmetern Erde geschützt liegen, würde einen taktischen Luftschlag mit gezielten Atomwaffeneinsätzen erforderlich machen. Dies ist jedenfalls die Meinung von Militärexperten aus allen imperialistischen Staaten. Wenn es dazu käme, was würde aus der gesamten Region des Mittleren Osten werden? Welche Auswirkungen könnte man auf die Bevölkerung und das Ökosystem weltweit erwarten? All das sind keine Überlegungen eines völlig verrückt gewordenen Wahnsinnigen. Das ist auch nicht irgendwie ein Szenario eines neuen Horrorfilms. Dieser Angriffsplan ist ein integraler Bestandteil der Strategie, welche der israelische Staat sich ausgedacht und geplant hat – unter Beteiligung der USA, die sich aber bislang noch zurückhaltend verhalten. Der israelische Generalstab plant jedenfalls im Falle eines Scheiterns eines klassischen israelischen Luftangriffs den Übergang zu solch einer höheren Stufe der Zerstörung. Der Wahnsinn breitet sich immer mehr aus in diesem niedergehenden System.
Humanitär
Seit der Auslösung der Kriege im Irak, Afghanistan, Libyen während der letzten Jahre hat ein immer größeres Chaos in diesen Ländern Einzug gehalten. Der Krieg hat sich festgefressen. Jeden Tag gibt es neue, immer mörderischere Anschläge. Die Bevölkerung kämpft jeden Tag verzweifelt um ihr Überleben. Die bürgerliche Presse bestätigt es: „Jeder ist Afghanistan überdrüssig. Dem Überdruss der Afghanen entspricht der Überdruss des Westens“ (Le Monde, 21.3.2012). Während die bürgerliche Presse von einem Überdruss hinsichtlich der endlosen Fortsetzung des Krieges in Afghanistan spricht, ist die Bevölkerung verbittert und entkräftet. Wie kann man im Krieg und dem ständigen kriegerischen Chaos überleben? Und falls es zu einem Krieg im Iran käme, wäre die menschliche Katastrophe noch unvorstellbarer. Die Bevölkerungsdichte, die eingesetzten Zerstörungsmittel lassen das Schlimmste befürchten. Und so lautet das Szenario – Krieg mit all seinen Zerstörungen im Iran, ein im Chaos versinkender Mittlerer Osten. Keiner der zivilen oder militärischen Staatsführer, die alle zu Massenmorden fähig sind, kann sagen, wo der Krieg im Iran aufhören würde. Was würde in der arabischen Bevölkerung der Region passieren? Wie würden die Schiiten reagieren? Diese Vorstellung ist einfach katastrophal für die Menschen.
Gespaltene bürgerliche Cliquen, imperialistische Bündnisse am Rande einer großen Krise
Auch nur an einen kleinen Teil der Folgen zu denken, jagt schon den Teilen der Herrschenden Angst ein, die noch ein wenig klarer sehen. Die kuwaitische Zeitung Al-Jarida ließ eine Information durchsickern, welche die israelischen Geheimdienste in Umlauf bringen wollten. Ihr letzter Chef, Meir Dagan, meinte nämlich, dass „die Perspektive eines Angriffs gegen den Iran die dümmste Idee sei, die er jemals gehört habe“. Diese Auffassung vertritt wohl auch ein anderer Flügel der Geheimdienste, der israelische Auslandsgeheimdienst – Shin Bet.
Es ist allseits bekannt, dass ein ganzer Teil des israelischen Generalstabs diesen Krieg nicht möchte. Aber ebenso bekannt ist, dass ein Teil der politischen Klasse Israels, die sich um Netanjahu schart, dessen Auslösung zu einem für Israel günstigen Zeitpunkt anstrebt. In Israel schwelt eine politische Krise in Anbetracht der einzuschlagenden Ausrichtung der imperialistischen Politik. Im Iran prallt der religiöse Führer Ali Chamenei ebenso wegen dieser Frage mit dem Präsidenten des Landes, Mahmud Ahmadinejad zusammen. Aber am spektakulärsten erscheint der Machtkampf zwischen den USA und Israel wegen dieser Frage. Gegenwärtig möchte die US-Administration keinen offenen Krieg mit dem Iran. Tatsächlich ist die Erfahrung der USA im Irak und in Afghanistan keine Ermunterung, und die Obama-Administration hat bislang immer heftigere Sanktionen befürwortet. Der Druck der USA auf Israel, dass das Land sich geduldig verhält, ist gewaltig. Aber die historische Schwächung der US-Führungsrolle ist eben auch bei seinem traditionellen Verbündeten im Nahen und Mittleren Osten zu spüren. Denn Israel behauptet lautstark, es werde den Besitz von Atomwaffen in den Händen des Irans nicht zulassen, was immer seine ihm am stärksten verbündeten Alliierten auch meinen. Der Druck der USA auf Israel ist nicht mehr so wirkungsvoll; sogar Israel fordert jetzt die Autorität der USA offen heraus. Aus der Sicht einiger bürgerlicher Kommentatoren könnte es sich um erste Bruchstellen des Bündnisses zwischen den USA und Israel handeln, das bislang als unzerbrechlich galt.
Die Haupttriebkraft in der unmittelbaren Nachbarschaft ist die Türkei, die über die größte Zahl Soldaten im Nahen Osten verfügt (mehr als 600.000). Während das Land zuvor ein unzertrennlicher Verbündeter der USA und einer der seltenen Freunde Israels war, ist die türkische Bourgeoisie mit dem Aufstieg des Erdogan-Regimes danach bestrebt, ihre eigene Karte des „demokratischen“ und „gemäßigten“ Islamismus zu spielen. Sie versucht, die Erhebungen in Ägypten und Tunesien zu ihren Gunsten auszuschlachten. Und dies erklärt auch den Kurswechsel ihrer Beziehungen zu Syrien. Früher verbrachte Erdogan seine Ferien mit den Assads, aber von dem Zeitpunkt an, als der syrische Führer sich weigerte, den Forderungen Ankaras nachzugeben und mit der Opposition Verhandlungen aufzunehmen, zerbrach das Bündnis. Die Bemühungen der Türkei, ihre eigenes „Modell“ des „gemäßigten“ Islams zu exportieren, stehen in direktem Gegensatz zu den Bemühungen Saudi-Arabiens, seinen eigenen Einfluss in der Region mit Hilfe des erzkonservativen Wahabismus zu vergrößern.
Die Möglichkeit der Auslösung eines Krieges in Syrien und vielleicht später im Iran hat sich dermaßen zugespitzt, dass die Führer Chinas und Russlands immer stärker reagieren. Der Iran ist für China von großer Bedeutung, da China aus dem Iran 11% seiner Energieimporte erhält.[2] Seit dem industriellen Aufstieg Chinas ist das Land zu einem wichtigen Player in der Region geworden. Im letzten Dezember warnte China vor der Gefahr eines weltweiten Konfliktes um Syrien und Iran. In der Global Times[3] erklärte China: „Der Westen leidet unter einer Wirtschaftskrise, aber seine Bestrebungen des Umsturzes von nicht-westlichen Regierungen aufgrund von politischen und militärischen Interessen haben einen neuen Höhepunkt erreicht. China wie auch sein großer Nachbar Russland müssen wachsam bleiben und notwendige Gegenmaßnahmen ergreifen.“[4] Auch wenn eine direkte Konfrontation zwischen den imperialistischen Großmächten der Welt unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht denkbar erscheint, lassen solche Erklärungen den Ernst der Lage deutlich werden.
Der Kapitalismus treibt geradewegs auf den Abgrund zu
Der Mittlere Osten ist ein Pulverfass – einige sind bereit, dort das Feuer zu legen. Einige imperialistische Staaten sind bereit und planen kaltblütig den Einsatz von bestimmten Atomwaffen in einem möglichen Krieg gegen den Iran.
Die Militärmaschinerie ist gerüstet und hat sich strategisch auf dieses Szenario eingestellt. Da im dahinsiechenden Kapitalismus bei dessen Todeszuckungen das Schlimmste am wahrscheinlichsten ist, können wir solch einen Krieg nicht ausschließen. Jedenfalls treibt die Flucht nach vorn des Kapitalismus, der völlig senil und morsch geworden ist, die Irrationalität dieses Systems auf immer neue Höhen. Sollte es zu einem eskalierenden Konflikt in der Region kommen, wird der Zerstörungsdrang des Kapitalismus eine neue Stufe erreichen. Wenn der Kapitalismus, der durch die Geschichte verdammt ist, verschwindet, wird die Arbeiterklasse und die Menschheit ihm keine Träne nachweinen. Aber leider birgt der Zerstörungsdrang des Systems die Gefahr einer vollständigen Zerstörung der Menschheit in sich. Die Feststellung, dass der Kapitalismus dabei ist die ganze Zivilisation mit in den Abgrund zu reißen, darf uns nicht den Mut nehmen, nicht in Verzweiflung treiben oder in Passivität verfallen lassen. Wir schrieben zu Anfang des Jahres: „Die Wirtschaftskrise ist keine endlose Geschichte. Sie kündigt das Ende eines Systems und den Kampf für eine neue Gesellschaft an.“ Diese Behauptung stützt sich auf die Entwicklung des Klassenkampfes auf internationaler Ebene.
Dieser weltweite Kampf für eine andere Gesellschaft hat eben erst begonnen. Er verläuft sicher noch sehr langsam und mit großen Schwierigkeiten, aber er ist in Gang gesetzt worden. Diese in Gang gekommene Bewegung, deren beeindruckendster Ausdruck bislang die Bewegung der „Empörten“ letztes Jahr in Spanien war, erlaubt uns zu sagen, dass es potentiell die Mittel gibt, all diese kapitalistische Barbarei von diesem Planeten hinwegzufegen. Tino, 11.4.2012
[3] Zeitung zur internationalen Aktualität, die zur offiziellen “Volkszeitung” gehört.
[4] Bericht aus www.solidariteetprogres.org/Iran-La-Chine-ne-doit-pas-reculer-devant-une... [453].
Aktuelles und Laufendes:
- Syrien Repression [454]
- Syrien Bürgerkrieg [455]
- Syrien Krieg [456]
- Irankonflikt [457]
- Kriege im Nahen Mittleren Osten [458]
Massaker in Südafrika: Die Herrschenden hetzen ihre Bluthunde auf die Arbeiter
- 2287 Aufrufe
Am 16. August fielen in den Minen von Marikana im Nord-Westen von Johannesburg 34 Arbeiter unter den Schüssen der südafrikanischen Polizei, die darüber hinaus noch weitere 78 Arbeiter verletzte. Mehrere Hundert Demonstranten wurden verhaftet. Sofort gingen die Bilder von diesen Erschießungen um die Welt. Aber wie immer verzerrten die Herrschenden und ihre Medien den Klassencharakter dieses Streiks und reduzierten ihn auf schmutzige Auseinandersetzungen zwischen den beiden größten Bergarbeitergewerkschaften, was an die dunkelsten Zeiten während der Zeit der Rassentrennung erinnerte.
Südafrika – auch von der Krise erfasst
Trotz der Investitionen von Hunderten von Milliarden Euros zur Unterstützung der Wirtschaft ist das Wachstum schwach geblieben und die Arbeitslosigkeit weiterhin massiv angestiegen[1] [459]. Ein Teil des Reichtums des Landes basiert auf dem Export von Rohstoffen wie Platin, Chrom, Gold und Diamanten, die in Minen gefördert werden. Diese Wirtschaftsbranche, die mehr als 10 Prozent des BIP erwirtschaftet, 15 Prozent des Exportes und mehr als 800.000 Jobs umfasst, litt 2011 unter einer starken Rezession. Der Kurs des Platins, von dem Südafrika ca. 80 Prozent der Weltreserven besitzt, ist seit Anfang des Jahres stark rückläufig.
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Bergarbeiter, die ohnehin schon extrem schlecht sind, haben sich weiter verschlechtert. Sie erhalten Hungerlöhne (ungefähr 400 Euro im Monat), wohnen in Elendshütten, schuften oft neun Stunden in sehr heißen und stickigen Schächten. Jetzt stehen sie vor Entlassungen, Produktionsstillständen und Arbeitslosigkeit. Deshalb fanden in Südafrika zahlreiche Streiks statt. Bereits seit Februar befanden sich die Arbeiter der größten Platinmine der Welt, die von Impala Platinum betrieben wird, im Ausstand. Die von Präsident Zuma, dem Nachfolgers des berühmten Nelson Mandela, geführte Regierung wollte in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften diese Dynamik kippen. Denn die Entwicklung von Arbeiterkämpfen in Südafrika ist ein Teil der weltweiten Reaktionen der Arbeiterklasse auf die Weltwirtschaftskrise.
Das Massaker von Marikana – eine von den Gewerkschaften errichtete Falle
Vor diesem Hintergrund beschlossen am 10. August 3.000 Bergarbeiter Marikanas, die Arbeit niederzulegen, um anständige Löhne durchzusetzen, d.h. ca. 1250 Euros. „Wir werden ausgebeutet, weder die Regierung noch die Gewerkschaften haben uns geholfen […] Die Bergwerksgesellschaften verdienen dank unserer Arbeit Geld, aber man zahlt uns Hungerlöhne. Wir können nicht anständig leben. Aufgrund der miserablen Löhne zwingt man uns dazu, wie Tiere zu hausen.“[2] Die Bergarbeiter traten in einen wilden Streik. Zwei Gewerkschaften, die National Union of Mineworkers (NUM) und die Gewerkschaft der Berg- und Bauarbeiter (AMCU) prallten gewaltsam aufeinander, um ihre jeweiligen Interessen zu verteidigen, wobei sie die Arbeiter in die Mausefalle gewaltsamer Zusammenstöße trieben.
Die NUM ist eine völlig korrupte Gewerkschaft und mit dem Machtapparat des Präsidenten Jacob Zuma verwoben. Die offene Zusammenarbeit und die systematische Unterstützung für die Regierungspartei, den African National Congress (ANC), hat diese Gewerkschaft schließlich in den Augen zahlreicher Beschäftigter diskreditiert. Dieser Glaubwürdigkeitsverlust führte zur Bildung einer Gewerkschaft, die radikalere Töne anschlug: die AMCU.
Aber wie die NUM kümmert sich die AMCU genauso wenig um die Interessen der Bergarbeiter. Nach einer sehr aggressiven Rekrutierungskampagne hat die Gewerkschaft den Streik ausgenutzt, um mit ihren Schlägertrupps Auseinandersetzungen mit der NUM anzuzetteln. Dabei wurden mehr als zehn Bergarbeiter ermordet, mehrere verletzt. Abgesehen davon haben die Auseinandersetzungen zwischen den Gewerkschaften den Ordnungskräften auch einen Vorwand zum Eingreifen geliefert. Sie verübten ein wahres Massaker, mit dem die Dynamik der Arbeiterkämpfe gebrochen werden sollte.
Nach tagelangen Zusammenstößen forderte Frans Baleni, Generalsekretär der NUM, den Einsatz der Armee: “Wir verlangen den Einsatz von Sonderkräften oder der südafrikanischen Armee, bevor die Lage ganz außer Kontrolle gerät.“[3] Warum eigentlich nicht gleich die Mine aus der Luft bombardieren, Herr Baleni? Aber die Arbeiter steckten schon in der Falle. Am nächsten Tag schickte die Regierung Tausende von Polizisten, gepanzerte Fahrzeuge und zwei Hubschrauber, um die Ordnung wiederherzustellen – d.h. natürlich die bürgerliche Ordnung!
Mehreren Zeugenaussagen zufolge, die in Anbetracht des Rufs der südafrikanischen Repressionskräfte vermutlich authentisch sind, hat die Polizei die Arbeiter ständig zu provozieren versucht, sie mit Flashballs, Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen angegriffen, unter dem Vorwand, dass die Streikenden über Schusswaffen verfügten.
Am 16. August wagten einige verbitterte und wütende Bergarbeiter nach Tagen erschöpfender Auseinandersetzungen und aufgestachelt durch die Gewerkschaftsvertreter, die – glücklicher Zufall! – an diesem Tag von der Bildfläche verschwunden waren, die Polizei mit Stöcken anzugreifen. Was? Der Mob „greift“ die Polizeikräfte an? Welche Frechheit! Und was konnten Tausende Polizisten mit ihren Schusswaffen, ihren Schutzschilden, ihren gepanzerten Fahrzeugen, ihren Wasserwerfern, ihren Tränengasgranaten, ihren Hubschraubern gegenüber einer Horde von 34 ‚Wilden’ tun, die sie mit Schlagstöcken angriffen? Auf die Menge schießen, um „ihr eigenes Leben zu retten“.[4] [459]
So tauchten bald diese ekelhaften, empörenden Bilder von dem Massaker auf. Die Arbeiterklasse muss ihre Empörung über solch eine Barbarei zum Ausdruck bringen muss; sie muss ferner begreifen, dass die Verbreitung dieser Bilder auch darauf abzielt, das Gefühl in den ArbeiterInnen der „demokratischen“ Länder zu erwecken, froh darüber zu sein, dass sie „frei“ mit gewerkschaftlichen Spruchbändern und Fahnen demonstrieren können. Und es ist eine implizite Warnung an all diejenigen auf dieser Welt, die gegen das Elend und das dafür verantwortliche System ankämpfen wollen.
Die Herrschenden wollen die Bewegung entstellen
Sofort nach dem Massaker erhoben sich überall Stimmen, um den „Dämon der Apartheid“ zu beschwören und leidenschaftliche Erklärungen abzugeben. Die Herrschenden wollen den wahren Anlass dieser Streikbewegung verschleiern und Fragen ethnischer und nationalistischer Konflikte in den Vordergrund drängen. Julius Malenna, im April aus dem ANC ausgeschlossen, kam regelmäßig nach Marikana, um die ausländischen Firmen an den Pranger zu stellen, die Verstaatlichung der Minen und die Ausweisung der „reichen weißen Großgrundbesitzer“ zu fordern.
Der Präsident Zuma erklärte heuchlerisch vor der Presse: „Wir müssen die Wahrheit über die Ereignisse ans Licht bringen, deshalb habe ich entschieden, eine Untersuchungskommission zur Aufklärung der wahren Ursachen dieses Vorfalls einzusetzen“. Die Wahrheit besteht darin, dass die Herrschenden die Arbeiterklasse hinters Licht zu führen versuchen, indem sie den Klassenkampf mit dem Schleier des Rassenkampfes verhüllen. Doch der Verdummungsversuch ist zu offensichtlich. War es nicht eine „schwarze“ Regierung, die dem Verlangen einer „schwarzen“ Gewerkschaft nach einem Polizeieinsatz Folge leistete? Und hat nicht eine „schwarze“ Regierung alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Bergarbeiter weiterhin unter unmöglichen Bedingungen schuften zu lassen? Hat nicht eine „schwarze“ Regierung Polizisten eingesetzt, die in der Zeit der Apartheid ausgebildet wurden, und Gesetze verabschiedet, die Polizisten zum gezielten Todesschuss ermächtigen? Ist diese „schwarze“ Regierung nicht aus den Reihen des ANC hervorgegangen, die von Nelson Mandela angeführt wird, der in der ganzen Welt als der Vorkämpfer der Demokratie und der Toleranz gepriesen wird?
Die Streiks dehnen sich aus
In der Nacht vom 19. auf den 20. August hat die Geschäftsleitung der Mine Lonmin den „3000 wild streikenden Beschäftigen befohlen, die Arbeit am 20. August wieder aufzunehmen, sonst droht ihnen die Entlassung."[5] Aber die Wut und die Lebensbedingungen der Bergarbeiter sind derart, dass sie dieser Aufforderung nicht nachgekommen sind, auf die Gefahr hin, entlassen zu werden. „Werden sie auch auf die schießen, die im Krankenhaus oder in der Leichenhalle liegen? Es ist besser auf die Straße zu fliegen, anstatt hier weiter zu leiden. Unser Leben wird sich nicht verbessern. Lonmin schert sich einen Dreck um unsere Arbeitsbedingungen; sie haben sich geweigert mit uns zu reden, sie haben die Polizei auf uns gehetzt."[6] Während Lonmin schnell nachgeben musste, dehnte sich der Streik am 22. August mit den gleichen Forderungen auf andere Minen aus, die von Royal Bafokeng Platinum und Amplats betrieben werden. Als dieser Artikel verfasst wurde, war es noch nicht absehbar, ob die Streiks in Auseinandersetzungen zwischen den Rassen übergehen oder sich weiter ausdehnen. Aber das Massaker von Marikan hat klar aufgezeigt, was hinter der Gewalt eines demokratischen Staates steckt. Ob schwarz oder weiß, die Regierungen sind zu allen möglichen Massakern gegen die Arbeiterklasse bereit. El Generico, 22.8.2012
[1] Die Arbeitslosigkeit betrug Ende 2011offiziell 35,4 Prozent.
[2] Zitiert aus Le Monde 16.8.2012.
[3] Kommuniqué der NUM vom 13.8.2012
[4] Erklärung der Polizei nach dem Massaker. Der Sprecher der Polizei wagte gar zu behaupten: „Die Polizei wurde feige von einer Gruppe angegriffen, die verschiedene Waffen benutzt hat, u.a. Schusswaffen. Die Polizisten mussten zum Schutz ihres eigenen Lebens gewaltsam vorgehen.“
[5] Kommuniqué von Lonmin 19..8.2012
[6] www.jeuneafrique.com [460], 19.8 2012.
Geographisch:
- Südafrika [461]
Aktuelles und Laufendes:
- Gewerkschaften [462]
- Bergarbeiterstreik [463]
- bürgerliche Demokratie [464]
Leute:
Politik und Philosophie von Lenin bis Harper (Teil 1)
- 2463 Aufrufe
Bei der Lektüre von Harpers Buch über Lenin wird deutlich, dass es sich um eine ernsthafte und tiefgehende Studie über Lenins philosophische Arbeit handelt, getragen von einer klaren Struktur der materialistischen Dialektik, mit der er Lenins philosophisches Konzept abgleicht.
Für Harper stellt sich das Problem folgendermaßen: Statt Lenins Konzeption der Welt von seiner politischen Aktivität zu trennen, besteht der beste Weg, sich das Handeln dieses Revolutionärs anzuschauen, darin, die dialektischen Ursprünge seiner Aktivität zu begreifen. Für Harper ist „Materialismus und Empiriokritizismus” das Werk, das Lenins Denken am besten beschreibt. Hier startet Lenin seinen Angriff auf den ausgeprägten Idealismus, den große Teile der russischen Intelligentsia, beeinflusst durch das philosophische Konzept Machs, angenommen hatten. Sein Ziel war es, dem Marxismus neues Leben einzuflößen, da dieser litt nicht nur unter dem Revisionismus Bernsteins sondern auch unter dem Machs itt.
Ausgehend von Marx und Dietzgen leitet Harper das Problem mit einer tiefgreifenden und scharfsinnigen Analyse der Dialektik ein. Mehr noch, Harper macht in seiner Untersuchung einen deutlichen Unterschied zwischen dem frühen Marx mit seinen ersten philosophischen Studien und dem späteren Marx, der mit der bürgerlichen Ideologie gebrochen hatte und den Klassenkampf „entdeckt“ hatte. Diese Unterscheidung erlaubt ihm den Widerspruch zwischen dem bürgerlichen Materialismus der prosperierenden kapitalistischen Epoche – verkörpert durch die Naturwissenschaft – und des revolutionären Materialismus, konkretisiert in der Wissenschaft der Gesellschaftsentwicklung, hervorzuheben. Harper bemüht sich, verschiedene, von Lenin entwickelte Konzeptionen zu widerlegen, die sich nach seiner Meinung weniger auf die Auseinandersetzung mit Machs Ideen bezogen als eher aus polemischen Gründen benutzt wurden, um die Einheit der russischen sozialdemokratischen Partei zu festigen.
Interessant ist Harpers Arbeit in Bezug auf sein Studium der Dialektik, wichtig seine Behandlung der Art und Weise, wie Lenin Machs Ideen korrigiert, doch der unbestreitbar interessanteste Teil (da er die wichtigsten Konsequenzen nach sich zieht) ist die Analyse der Quellen des Materialismus Lenins und ihr Einfluss auf seine Aktivitäten in der internationalen sozialistischen Diskussion und der Revolution 1917 in Russland.
Der erste Teil der Kritik beginnt mit einer Studie der philosophischen Ahnen Lenins, von Holbach über verschiedene französische Materialisten wie Lametrie bis hin zu Avenarius. Das gesamte Problem dreht sich um die Erkenntnistheorie. Selbst Plechanow entkam nicht der Sogwirkung des bürgerlichen Materialismus. Feuerbach ging Marx voran. All dies erschwerte das soziale Denken des gesamten russischen Marxismus, allen voran Lenins.
Harper betont korrekterweise den statischen Blick auf die Welt, der die Erkenntnistheorie des bürgerlichen Materialismus kennzeichnet, und kontrastiert dies mit der Natur und Orientierung des revolutionären Materialismus.
Die Bourgeoisie betrachtet die Erkenntnis als ein rein empfangendes Phänomen (nach Harper teilt auch Engels diese Sicht). Für sie bedeutet Erkenntnis einfach Vorstellung und Empfindung der externen Welt - als ob wir nicht mehr als ein Spiegel seien, der mehr oder weniger zuverlässig die externe Welt widerspiegeln würde. Darin erkennen wir, warum die Naturwissenschaften das Schlachtross der bürgerlichen Welt waren. In ihren ersten Ausformungen basierten Physik, Chemie und Biologie mehr auf einem Versuch, die Phänomene der externen Welt festzuschreiben, als auf den Versuch, die Realität zu interpretieren und zu analysieren. Die Natur schien ein großes Buch zu sein und das Ziel war es, natürliche Äußerungen in verständliche Zeichen zu übertragen. Alles schien geordnet, rational zu sein; Ausnahmen von dieser Ansicht konnten nicht zugelassen werden, es sei denn, sie würden als Unvollkommenheiten unserer Wahrnehmungsmittel erklärt werden. Zusammengefasst wurde Wissenschaft zu einem Abbild der Welt, deren Gesetze unabhängig von Zeit und Raum immer die gleichen waren – jedoch abhängig von dem jeweiligen separaten Gesetz.
Das natürliche Objekt der ersten Bemühungen dieser Wissenschaft war dem Menschen äußerlich: Diese Wahl ist Ausdruck dafür, dass es einfacher war, die externe sinnliche Welt zu erfassen als die weit konfusere menschliche Welt, deren Gesetze sich den einfachen Gleichungen der Naturwissenschaft entziehen. Wir müssen auch an die Bedürfnisse der aufstrebenden Bourgeoisie denken, die schnell und empirisch Zugriff auf alles außerhalb ihrer selbst benötigte, um dies für die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte zu benutzen. Schnell, da die Grundlagen ihres sozial-ökonomischen Systems noch nicht so sicher waren. Empirisch, da der Kapitalismus mehr an Ergebnissen und Schlussfolgerungen als an dem Weg, diese zu erreichen, interessiert war.
Die Naturwissenschaften, die sich im Rahmen des bürgerlichen Materialismus entwickelten, beeinflussten das Studium anderer Bereiche und bewirkten den Aufstieg der Geisteswissenschaften wie Geschichte, Psychologie und Soziologie, die die gleichen Methoden der Erkenntnis anwandten.
Der erste Gegenstand der menschlichen Erkenntnis, der den menschlichen Geist beschäftigte, war die Religion. Diese wurde zum ersten Mal als historisches und nicht als philosophisches Problem behandelt. Dahinter stand auch die Notwendigkeit einer jungen Bourgeoisie, sich vor religiösen Festschreibungen zu hüten, die die natürliche Rationalität des kapitalistischen Systems in Frage stellten. Dies drückte sich in dem Aufkommen einer ganzen Reihe von bürgerlichen Denkern wie Renan, Strauss, Feuerbach usw. aus. Aber was versucht wurde, war stets eine methodische Zergliederung: Sie kritisierten die ideologische Figur Religion nicht auf ihrer gesellschaftlichen Grundlage, sondern verfolgten das Ziel, ihre menschlichen Grundlagen zu entdecken. Dadurch reduzierten sie die Untersuchungen auf ein naturwissenschaftliches Niveau, als ginge es darum, historische Dokumente und ihre Veränderung über die Jahrhunderte fotografisch genau nachzuzeichnen. Letztendlich normalisierte der bürgerliche Materialismus den gegenwärtigen Stand der Dinge und schrieb diesen auf ewig und unveränderbar fest. Er behandelte die Natur als unbestimmte Wiederholung rationaler Ursachen. Der bürgerliche Mensch reduzierte die Natur auf das Verlangen nach einer konservativen Unbeweglichkeit. Er spürte, dass er die Natur bis zu einem gewissen Punkt beherrschen würde, doch er begriff nicht, dass die Instrumente seiner Beherrschung dabei waren, sich vom Menschen zu befreien und sich gegen diesen zu wenden. Bürgerlicher Materialismus war ein Fortschritt in der Entwicklung des menschlichen Wissens. Er wurde konservativ – was so weit ging, dass er von der Bourgeoisie selbst abgelehnt wurde –, als das kapitalistische System seinen Höhepunkt erreicht hatte und sein Untergang eingeläutet wurde.
Diese Denkweise begegnet uns auch in Marx‘ frühen Werken. Doch Harper sah den Weg, der Marx zum revolutionären Materialismus führte, erst durch die Bewusstwerdung der Arbeiterklasse als Reaktion auf die ersten schweren Widersprüche des kapitalistischen Systems eröffnet.
Harper beharrt darauf, dass der revolutionäre Marxismus nicht einfach das Produkt reiner Vernunft sei. Der bürgerliche Materialismus wuchs in einem bestimmten sozio-ökonomischen Umfeld auf; entsprechend war auch für den revolutionären Materialismus ein bestimmtes sozio-ökonomisches Milieu erforderlich. Marx wurde bewusst, dass die Existenz ein Prozess permanenter Veränderung war. Und wo die Bourgeoisie nur Rationalismus, die Wiederholung von Ursache und Wirkung sah, entdeckte Marx das sich entwickelnde sozio-ökonomische Milieu als neues Element, das in die Sphäre der Erkenntnis integriert werden müsse. Für ihn war das Bewusstsein nicht ein Abbild der äußeren Welt. Sein Materialismus wurde durch all die natürlichen Faktoren angeregt – zuallererst durch den Menschen selbst.
Die Bourgeoisie konnte den menschlichen Anteil an der Erkenntnis vernachlässigen, da zu Beginn ihr System mit einer präzisen Regelmäßigkeit - wie die Gesetze der Astronomie - zu funktionieren schienen. Ihr Wirtschaftssystem hatte keinen Platz für den Menschen.
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich die Nachlässigkeit des Systems gegenüber dem Menschen in den gesellschaftlichen Beziehungen langsam bemerkbar: Revolutionäres Bewusstsein begann zu reifen und mit diesem wurde deutlich, dass die Erkenntnis nicht ein Spiegel der äußeren Welt war, wie der bürgerliche Materialismus behauptete: Die menschliche Erkenntnis ist nicht nur ein empfangender, sondern auch ein aktiver und verändernder Faktor.
Für Marx war demnach die Erkenntnis sowohl das Produkt der Empfindung der äußeren Welt als auch das der Ideen und Handlungen des Menschen, der Mensch war also selbst ein Faktor und Motor der Erkenntnis.
Die Wissenschaft der Gesellschaftsentwicklung war damit geboren; diese eliminierte die alten Geisteswissenschaften und war Ausdruck eines deutlichen Fortschritts. Auch die Naturwissenschaften durchbrachen ihre engen Grenzen. Die bürgerliche Wissenschaft des 19. Jahrhunderts kollabierte aufgrund ihrer eigenen Blindheit.
Dieses falsche Verständnis der Rolle der menschlichen Handlung für die Erkenntnis gibt Lenins philosophischer Arbeit einen ideologischen Charakter. Wie bereits angedeutet, untersucht Harper Lenins philosophische Quellen und misst diesen einen entscheidenden Einfluss auf Lenins politische Tätigkeit zu.
Das gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein. Lenin kam aus einem rückschrittlichen Gesellschaftsmilieu. Hier herrschte noch der Feudalismus, die Bourgeoisie war schwach und ließ jede revolutionäre Energie missen. In Russland entwickelte sich der Kapitalismus zu einer Zeit, als die reife Bourgeoisie des Westens bereits in ihren Niedergang trat. Russland wurde ein kapitalistisches Land, ohne dass die eigene nationale Bourgeoisie gegen den feudalen Absolutismus des Zaren aufbegehrte. Diese Leistung fiel dem ausländischen Kapital zu, das die gesamte kapitalistische Struktur in Russland dominierte. Da der bürgerliche Materialismus durch die Entwicklung der kapitalistischen Ökonomie und ihrer Widersprüche immer unbedeutender wurde, musste die russische Intelligentsia in ihrem Kampf gegen den Absolutismus ihr Heil im revolutionären Materialismus suchen. Für diesen revolutionären Materialismus galt der Kampf dem Feudalismus, nicht dem Kapitalismus, der keine wirkungsvolle Kraft darstellte. Lenin war Teil dieser Intelligentsia – deren Grundlage die revolutionäre Klasse des Proletariats war –, deren Aufgabe die verspätete kapitalistische Umwandlung des feudalen Russlands war.
So interpretiert Harper die Fakten.
Harper sieht die russische Revolution als Ausdruck der objektiven Reife der Arbeiterklasse, jedoch hat diese für ihn einen bürgerlichen politischen Inhalt. Nach Harper wird dieser bürgerliche politische Inhalt von Lenin ausgedrückt. Lenins Bewusstsein sei geprägt von den unmittelbaren Aufgaben Russlands, ein Land, das mit seiner sozio-ökonomischen Struktur wie eine Kolonie ohne nationale Bourgeoisie erschien. Die einzig entscheidenden Kräfte seien die Arbeiterklasse und der Absolutismus.
Das Proletariat könne sich also nur unter diesen rückständigen Bedingungen ausdrücken, daher sei Lenins materialistische Ideologie bürgerlich. So sagt Harper über Lenin und die russische Revolution:
„Diese materialistische Philosophie war gerade die richtige Lehre für die Masse der neuen russischen Intelligenz, die voll Begeisterung in Naturwissenschaft und Technik die Basis einer von ihnen geleiteten Produktion erkannte – mit den noch religiösen Bauern als einzigen Widerstand – und die als neue herrschende Klasse eines Riesenreichs die Zukunft vor sich offen sah.“ (Pannekoek, Lenin als Philosoph, in: Pannekoek, Arbeiterräte, Texte zur sozialen Revolution, S. 362)
Harpers Methode in „Lenin als Philosoph” gehört, wie auch seine Darstellung des Problems der Erkenntnis, zu den besten Arbeiten des Marxismus. Jedoch führen seine politischen Schlussfolgerungen zu solchen Konfusionen, dass er uns zwingt, seine politischen Schlussfolgerungen, die uns fehlerhaft erscheinen und unter dem Niveau der übrigen Arbeit liegen, deutlich von der Formulierung des Problem zu trennen.
Harper schreibt:
“Der Materialismus hat nur kurze Zeit die Weltanschauung der bürgerlichen Klasse beherrscht…“ (ebenda, S. 311).
Dies führt ihn nach seiner Feststellung, dass Lenins Philosophie in „Materialismus und Empiriokritizismus“ in ihren Grundzügen bürgerlicher Materialismus sei, dazu, dass die bolschewistische Revolution vom Oktober 1917 :
„ … eine bürgerliche Revolution, die auf dem Proletariat fußt.“
Hier verfängt sich Harper in seiner eigenen Dialektik und versäumt es, eine wichtige Frage zu beantworten: Wie kann es zu einer Zeit, in der der Kapitalismus in die tiefste Krise seiner Geschichte stürzt, eine bürgerliche Revolution geben? Die dazu noch ihre eigene Ideologie – entsprechend der revolutionären Periode der Bourgeoisie eine materialistische - produziert? Die Krise von 1914 – 20 scheint Harper überhaupt nicht zu berühren.
Noch einmal, wie konnte diese Revolution bürgerlich sein, und dies zumal in dieser Situation? Vorangetrieben von den fortschrittlichsten und bewusstesten Arbeitern und Soldaten Russlands, solidarisch begrüßt von den Arbeitern und Soldaten der ganzen Welt, insbesondere in jenem Land, in dem der Kapitalismus am meisten fortgeschritten war, d.h. Deutschland? Wie konnte es sein, dass genau in diesem Moment die Marxisten, die gründlichsten Dialektiker, die besten Theoretiker des Sozialismus, die materialistische Geschichtsauffassung wie Lenin selbst – wenn nicht gar besser – verteidigten? Wie konnte es sein, dass ausgerechnet Leute wie Plechanow und Kautsky sich auf der Seite der Bourgeoisie gegen die revolutionären Arbeiter und Soldaten der gesamten Welt und insbesondere gegen Lenin und die Bolschewiki wiederfanden?
Harper stellte sich nicht einmal diese Fragen, wie sollte er also Antworten finden? Umso überraschender ist es, dass er diese Fragen nicht stellt.
Weiterhin fällt auf, dass Harpers grundsätzlich richtige philosophische Studie einige Behauptungen enthält, die Erstere wiederum in ein anderes Licht stellt. Nach Harper gibt es unter den marxistischen Theoretikern zum Problem der Erkenntnis zwei fundamental entgegengesetzte Tendenzen. Diese Trennung, die er bereits im Leben und Werk von Marx selbst sieht, ist etwas vereinfachend und schematisch. Harper sieht in Marx‘ Werk zwei Perioden:
1. Vor 1848 Marx, der fortschrittliche bürgerliche Materialist: „Religion ist das Opium des Volkes“, eine Aussage, die später von Lenin aufgegriffen wurde; weder Stalin noch die russische Bourgeoisie haben es für notwendig gehalten, die Parole von den Denkmälern der offiziellen Parteipropaganda zu verbannen.
2. Dann Marx, der revolutionäre Materialist und Dialektiker: der Angriff auf Feuerbach, das Kommunistische Manifest usw., „das Sein bestimmt das Bewusstsein“.
Für Harper ist es kein Zufall, dass Lenins Werk („Materialismus und Empiriokritizismus“) im Grunde genommen ein Beispiel für die erste Periode des Marxismus darstellt. Ausgehend von der Vorstellung, dass Lenins Ideologie durch die historische Bewegung, an der er teilnahm, bestimmt ist, behauptet Harper, dass sich der grundlegende Charakter dieser Bewegung als eine Variation des bürgerlichen Materialismus in Lenins Ideologie ausdrückt (Harper berücksichtigt hier allein „Materialismus und Empiriokritizismus“).
Dies führt Harper zu der Schlussfolgerung, dass “Materialismus und Empiriokritizismus” nun die Bibel der russischen Intellektuellen, Techniker usw. – der Repräsentanten der neuen staatskapitalistischen Klasse – sei. Aus seiner Sicht sind die russische Revolution im Allgemeinen und die Bolschewiki im Besonderen die Vorwegnahme einer allgemeineren revolutionären Entwicklung: die Evolution des Kapitalismus zum Staatskapitalismus, die revolutionäre Mutation der liberalen Bourgeoisie zu einer bürokratischen Staats-Bourgeoisie, von der der Stalinismus der vollkommenste Ausdruck sei.
Harpers Vorstellung ist, dass diese Klasse, die überall „Materialismus und Empiriokritizismus“ als ihre Bibel ansieht (Stalin und seine Freunde verteidigen weiterhin das Buch), das Proletariat als Basis für ihre staatskapitalistische Revolution benutzt. Deshalb ist die neue Klasse auf die marxistische Theorie angewiesen.
Daher ist es Ziel dieser Ausführungen, nachzuweisen, dass diese erste Ausformung des Marxismus über Lenin direkt zu Stalin führt. Ähnliches haben wir bereits von bestimmten Anarchisten gehört, wobei diese dies gleich auf den gesamten Marxismus beziehen. Stalin ist danach das logische Ergebnis des Marxismus – nach anarchistischer „Logik“ ist es das tatsächlich!
Dieser Ansatz versucht ebenfalls zu zeigen, dass eine neue – sich auf das Proletariat stützende - revolutionäre Klasse genau in dem Moment auf der Bühne der Geschichte erscheint, wo der Kapitalismus selbst, aufgrund der Hyperentwicklung der Produktivkräfte innerhalb einer Gesellschaft, die auf der Ausbeutung der menschlichen Arbeit (Mehrwertabpressung) basiert, in seine permanente Krise eingetreten ist.
Diese zwei Ideen, die Harper in „Lenin als Philosoph“ vor dem Krieg von 1939 – 45 entwickelt, wurden bereits von Anderen mit unterschiedlichstem sozialem und politischem Hintergrund vorgetragen. Die erste Vorstellung wird von den meisten Anarchisten vertreten, die zweite von vielen reaktionären bürgerlichen Schreiberlingen, wie James Burnham.
Es ist nicht überraschend, dass Anarchisten solch mechanistische und schematische Konzepte vorbringen, die behaupten, dass der Marxismus die Quelle des Stalinismus und der staatskapitalistischen Ideologie oder der neuen herrschenden Management-/Bürokraten-Klasse sei. Sie sind das Problem der Philosophie nie in der Form angegangen, wie Revolutionäre es getan haben: Für sie stammen Marx und Lenin von Auguste Comte ab und alle marxistischen Strömungen werden ausnahmslos mit der „bolschewistisch-stalinistischen Ideologie“ in einen Topf geworfen. Zwischenzeitlich orientiert sich die anarchistische Version des philosophischen Denkens an der letzten Mode des Idealismus, von Nietzsche zum Existenzialismus, von Tolstoi zu Sartre.
Harpers These ist, dass Lenins „Materialismus und Empiriokritizismus“ als philosophische Untersuchung des Problems der Erkenntnis nicht weiter geht als die Interpretationsmethoden, die typisch für den mechanistischen, bürgerlichen Materialismus sind. Doch von hier zu der Schlussfolgerung zu kommen, dass weder die Bolschewiki noch der Bolschewismus oder die russische Revolution über das Stadium der bürgerlichen Revolution hinaus kommen konnten, lässt Harper in derselben Position wie die Anarchisten oder Vertreter der Bourgeoisie, wie Burnham, enden. Darüber hinaus widerspricht diese Schlussfolgerung einer anderen korrekten Aussage von Harper:
„Der Materialismus hat nur kurze Zeit die Weltanschauung der bürgerlichen Klasse beherrscht. Nur solange diese glauben konnte, dass die bürgerliche Gesellschaftsordnung, mit ihrem Privateigentum, ihrer persönlichen Freiheit und ihrem freien Wettbewerb, durch die Entwicklung der Produktion unter dem endlosen Fortschritt der Wissenschaft und der Technik die praktischen Probleme des Lebens für jeden lösen würde, nur solange konnte sie glauben, dass mittels der Naturwissenschaft die theoretischen Probleme gelöst wurden, und brauchte sie keine übernatürlichen geistigen Mächte mehr. Als die Tatsache, dass der Kapitalismus die Frage der Existenz für die Massen nicht lösen konnte, hervortrat in dem emporkommenden Klassenkampf des Proletariats, verschwand die zuversichtliche materialistische Betrachtung der Welt. Die Welt erschien nun voll der Unsicherheit und der unlösbaren Widersprüche, voll unheimlich drohender Mächte.“ (ebenda, S. 311)
Wir werden im weiteren Verlauf dieses Problem vertiefen, hier sehen wir uns – in der Hoffnung, nicht in eine sterile Polemik hineingezogen zu werden – jedoch veranlasst, auf diesen unlösbaren Widerspruch, in den Harper sich selbst bringt, hinzuweisen - auf der einen Seite ein solch komplexes Problem so simpel anzugehen und auf der anderen Seite unter Berücksichtigung der Schlussfolgerungen, die er über Bolschewismus und Stalinismus zieht.
Noch einmal fragen wir: Wie erklärt man die Tatsache, dass genau zu dem Zeitpunkt, als der Klassenkampf beispiellose Höhen erklomm, innerhalb der Bourgeoisie eine materialistische Strömung geboren wurde, die eine neue bürgerlich-kapitalistische Klasse hervorbrachte - wenn wir gleichzeitig Harpers These folgen, dass die Bourgeoisie idealistisch wurde, als der proletarische Klassenkampf auf der Bühne erschien? Harper erkennt in Lenins Philosophie den Aufstieg einer bürgerlichen materialistischen Strömung genau zu dem Zeitpunkt, als die Bourgeoisie eigentlich vollständig idealistisch sein sollte. Und falls, nach Harper, Lenin „gezwungen war, materialistisch zu sein, um die Arbeitern hinter sich zu sammeln“, müssen wir folgende Frage stellen: Nahmen die Arbeiter die Ideologie Lenins an, oder passte sich Lenin den Bedürfnissen des Klassenkampfes an? Harper präsentiert uns diesen erstaunlichen Widerspruch: Entweder folgte das Proletariat einer bürgerlichen Strömung, oder eine Bewegung der Arbeiterklasse scheidet eine bürgerliche Ideologie aus.
In beiden Fällen würde das Proletariat nicht mit einem eigenen Blick auf die Welt auf der Bühne erscheinen. Es ist eine merkwürdige Version des marxistischen Materialismus, die uns zu solchen Schlussfolgerungen verleiten kann: Das Proletariat lässt sich auf unabhängige Aktionen ein, aber produziert dabei eine bürgerliche Ideologie. Das ist exakt das Ergebnis von Harpers These.
Des Weiteren ist es nicht ganz richtig zu behaupten, dass die Bourgeoisie in einer bestimmten Phase rein materialistisch und in einer anderen rein idealistisch war. In der bürgerlichen Revolution von 1789 ersetzte der Kult der Vernunft in Frankreich den Gotteskult. Dies ist typisch für den dualen Charakter der Konzepte– materialistisch und idealistisch zugleich -, die die gegen Feudalismus, Religion und die Macht der Kirche kämpfende Bourgeoisie benötigte (ein Kampf im Übrigen, der sehr heftige Formen annahm, wie die Verfolgung von Priestern und das Niederbrennen von Kirchen zeigt). Wir werden später auf diesen permanenten dualen Aspekt der bürgerlichen Ideologie zurückkommen, der selbst in seinen höchsten Ausschlägen der „Großen Revolution“ nie über das Stadium von „Religion ist das Opium des Volkes“ hinauskam.
Wir haben jedoch noch längst nicht alle Schlussfolgerungen gezogen, zu denen uns Harpers Arbeit bringt. Dazu müssen wir all jenen einige historische Tatsachen in Erinnerungen zurückrufen, die die Oktoberrevolution dem bürgerlichen Lager zuschreiben wollen. Die erste Untersuchung von Harpers philosophischen Schlussfolgerungen und Theorien hat uns dazu gebracht, bestimmte Fragen, die wir später entwickeln werden, zu reflektieren. Darüber hinaus gibt es andere Fakten, die Harper wohl nicht übergehen wollte. Seitenlang spricht er über bürgerliche Philosophie und Lenins Philosophie und kommt zu Schlussfolgerungen, die, gelinde gesagt, gewagt sind und die eine ernsthafte und tiefere Untersuchung verlangen. Welcher marxistische Materialist kann eine Person, eine politische Gruppe oder Partei in dieser Weise anklagen, wie Harper Lenin und die bolschewistische Partei dafür anklagt, dass sie eine bürgerliche Strömung und Ideologie - „… auf dem Proletariat basierend“ (Harper) - repräsentieren würden, ohne zuerst die historische Bewegung, der sie angehörten, zu untersuchen?
Es war die Bewegung der internationalen und russischen Sozialdemokratie, die die bolschewistische Fraktion und alle anderen links-sozialistischen Fraktionen hervorgebracht hat. Wie wurde diese Fraktion gebildet? Welche ideologischen Kämpfe hatte diese zu führen, um sich als separate Gruppe, dann als Partei, schließlich als Avantgarde einer internationalen Bewegung herauszuschälen?
Der Kampf gegen den Menschewismus, Lenins Iskra und „Was tun?“, die Revolution von 1905 und die Rolle Trotzkis; Trotzkis Theorie der permanenten Revolution, die ihm dazu brachte, zwischen dem Februar und dem Oktober 1917 mit den Bolschewiki zu fusionieren; der revolutionäre Prozess zwischen Februar und Oktober; die rechten Sozialdemokraten und die Sozialrevolutionäre; Lenins Aprilthesen; die Konstitution der Sowjets und der Arbeitermacht; Lenins Position zum imperialistischen Krieg - Harper verliert hierzu nicht ein Wort. Dies ist keineswegs zufällig.
(wird fortgesetzt)
Mousso und Phillipe
Source URL: https://en.internationalism.org/node/3102 [467]
Französisches Original: https://fr.internationalism.org/rinte25/lenine.htm [468]Leute:
Politische Strömungen und Verweise:
- Rätismus [474]
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Historische Ereignisse:
Theoretische Fragen:
- Religion [479]
Welche Haltung gegenüber dem Krieg in Syrien?
- 2546 Aufrufe
Oder so: „Nach Libyen soll nun auch in Syrien ein imperialistisches Lakaienregime errichtet werden. Auch hier gilt: die fortschrittlichen Kräfte stützen und den Kampf gegen die imperialistischen Mächte führen.“ (aus Aufbau Nr. 68, März/April 2012)?
Weshalb dieser Artikel?
Wenn wir in die linken Zeitungen oder Internetpublikationen schauen, um uns über den blutigen Konflikt in Syrien zu informieren, stellen wir fest, dass es kaum grundsätzliche Stellungnahmen zum Charakter dieses Krieges gibt. Auf dem Diskussionsforum undergrounddogs.net beispielsweise, wo täglich Beiträge zu allen Fragen in den Bereichen Politik, Wirtschaftskrise, Klassenkampf etc. gepostet werden, steht der Thread „Syrien“ seit dem 24. Juni 2012 still. Die Diskussion wird nicht weiter geführt; schon vorher ging es kaum um den Charakter dieses Krieges, geschweige denn um eine internationalistische Haltung gegenüber diesem Krieg.
Was die Situation in Syrien betrifft, gibt es im Vergleich zu Konflikten während des Kalten Krieges, deren Stellvertretercharakter meist offensichtlich war (z.B. Vietnam), das Problem, die Hintergründe zu durchschauen. Doch auch in Syrien mischen andere Staaten mit (siehe dazu: „Die imperialistischen Mächte fachen den Krieg in Syrien weiter an“ in dieser Ausgabe). Im Vergleich zu früheren Konflikten ist es in Syrien aber schwieriger vorauszusagen, was bei einem Sturz des aktuellen Regimes geschehen wird. Die „Oppositionskräfte“ und ihre Mäzene vertreten z.T. gegensätzliche Positionen, das Trennende überwiegt das Verbindende bei weitem.
Im Frühjahr 2011 schien es, als sei in Syrien ein ähnlicher Prozess in Gang gekommen wie in Tunesien und Ägypten. Doch bald darauf wurden die sozialen Proteste gegen die Unterdrückung und die schlechten Lebensbedingungen in Syrien in einen blutigen Krieg zwischen verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse gezogen.
Es ist nicht absehbar, dass sich so etwas wie ein proletarischer Widerstand in Syrien noch äußern könnte. Jede Regung des gesellschaftlichen Lebens ist von der Logik des Krieges bestimmt, hinter dem die größeren und kleineren Mächte stehen. Der Krieg in Syrien ist ein imperialistischer, in dem es um die Vorherrschaft in einem bürgerlichen Nationalstaat bzw. um die Neuaufteilung des Territoriums zugunsten von neuen Nationalstaaten geht.
Das Proletariat hat dabei nichts zu gewinnen. Weder die Unterstützung des Assad-Regimes, noch diejenige des Syrischen Nationalrats, der Freien Syrischen Armee oder sonst einer Oppositionskraft bieten eine Perspektive.
Aber seien wir realistisch: Vor Ort hat die Arbeiterklasse momentan keine Chance, sich auf ihrem eigenen Terrain, mit Streiks und Massendemonstrationen zur Wehr zu setzen. Eine Umpolung der bürgerlichen Kriegslogik in eine proletarische, revolutionäre Dynamik ist nur unter einem veränderten internationalen Kräfteverhältnis zwischen der Arbeiterklasse und dem Kapital möglich. Jeder Teil des Proletariats, der in nationalen Grenzen gefangen bleibt, kann für sich allein nichts ausrichten (vgl. Griechenland).
Die linken Freunde Assads
In der Schweiz berichtet der so genannte Revolutionäre Aufbau ab und zu über Syrien, teilweise mit Artikeln aus der deutschen Tageszeitung Junge Welt. In der Nr. 69 (Mai/Juni 2012) publizierte der Aufbau einen Artikel unter dem Titel „Waffenhandel und Kriegshetze“, in dem etwas versteckt das Assad-Regime als die bessere Seite dargestellt wird: „Für den französischen Präsidenten Sarkozy war der Tod von zwei JournalistInnen Grund genug, um den Sturz des syrischen Präsidenten Assad zu fordern (…) Mit Geldern aus den Golfstaaten werden Söldner angeheuert, sicherlich nicht, um den von der UNO geforderten Waffenstillstand einzuhalten. Für die Hardliner der Golfstaaten, Israel und die USA geht es einzig und allein um den Sturz von Assad. Mit verstärkten militärischen Angriffen auf die syrische Armee sabotieren daher die ‚Rebellen‘ mit allen Mitteln eine mögliche Waffenruhe.“ Als ob das Assad-Regime dies anstrebt…
In demselben Geist stand schon in Nr. 68 unter dem Titel „Hände weg von Syrien“: „Das syrische Regime antwortete auf die Demonstrationen keineswegs nur mit Gewalt, sondern leitete zahlreiche Reformen ein. Gerade aus kommunistischer Sicht kann man sich damit sicherlich nicht begnügen. Nur, die Antwort der imperialistischen Mächte auf jeden Reformschritt war die Verschärfung der Boykottmaßnahmen und der Kriegshetze gegen die syrische Regierung.“
Der Aufbau bleibt seiner „antiimperialistischen“ Logik treu, dass es in der aktuellen Staatenwelt einerseits die imperialistischen und andererseits die „fortschrittlichen“ Mächte gebe. Und er lässt keinen Zweifel, dass die imperialistischen Mächte die USA, die EU-Staaten, die Türkei, Israel, die reichen Golfstaaten sind, nicht aber Syrien.
Die linken Freunde der syrischen „Opposition“
Schon vor einem Jahr schlugen sich aber Linke auch auf die andere Seite des Krieges in Syrien. Indymedia berichtete am 23.07.2011 über eine Solidaritätsdemo für den Aufstand in Syrien: „In Berlin haben heute 300 Menschen an einer Demonstration auf dem Kudamm teilgenommen. Aufgerufen hatte das Netzwerk 'Gemeinsam für ein freies Syrien‘. Es waren überwiegend in Deutschland lebende Menschen aus den arabischen Raum vertreten, einige wenige deutsche Linke nahmen auch teil, darunter mehrere Vertreter der Partei ‚Die Linke‘, die auch mit Fahnen ihrer Partei auftraten.“
In der Schweiz versuchten Linke im Sommer 2012, ebenfalls eine „Solidaritätsdemonstration mit dem syrischen Volk“ zu organisieren. Ob daraus etwas wird, ist zurzeit unklar. Aus den ersten Verlautbarungen dazu ging hervor, dass sich die Demo gegen das Assad-Regime richten und die „Selbstwehrgruppen“ unterstützen soll. Ähnliche „moralische“ Unterstützung für Teile der Opposition gegen Assad ist auch auf Blogs zu finden, die sich als libertär verstehen.
Welche Logik steckt hinter diesen Positionen? Wahrscheinlich sind sie von der Hoffnung geleitet, dass die „demokratischen“ Kräfte das geringere Übel seien. Dabei wird aber nicht gefragt, ob diese Kräfte tatsächlich etwas mit unserem Ziel zu tun haben, den Kapitalismus zu überwinden. Die Unterstützung der „Opposition“ in Syrien bedeutet die Parteinahme für eine andere bürgerliche Fraktion im Krieg, die unabhängig von ihrer Truppenstärke ein imperialistischer ist. So etwa waren die Linken mit ihrer Kampagne des „geringeren Übels“ während des Libyenkrieges 2011die besten Helfer der französischen Bourgeoisie, um den Widerstand im eigenen Land gegen den militärischen Feldzug so klein wie möglich zu halten.
Was ist das Prinzip des Internationalismus?
Die Rede von den „fortschrittlichen Kräfte“, auf die man sich stützen müsse, erinnert stark an die alte Leier der Trotzkisten, die unter dem gleichen Vorwand in jedem Krieg nach dem „geringeren Übel“ suchen, um dieses zu unterstützen. Unsere politischen Vorfahren, die Genossen von Internationalisme, schrieben 1947 zur Haltung der Trotzkisten im Zweiten Weltkrieg: „Ausgehend von dieser ewigen Wahl zwischen dem ‚geringeren Übel‘ haben sich die Trotzkisten am imperialistischen Krieg beteiligt. Die Notwendigkeit der Verteidigung der UdSSR stand keineswegs im Vordergrund. Bevor diese verteidigt wurde, hatten sie sich schon am Spanienkrieg (1936-1938) im Namen der Verteidigung des republikanischen Spaniens gegen Franco beteiligt. Dann verteidigten sie das China Chiang Kai-Sheks gegen Japan.“
(/content/1977/internationalisme-1947-was-die-revolutionaere-von-den-trotzkisten-unterscheidet [480])
Die konsequent proletarische Haltung in einem Krieg zwischen verschiedenen Fraktionen der Bourgeoisie um die Macht im kapitalistischen Nationalstaat ist der Internationalismus: Verbrüderung der ProletarierInnen über die Schützengräben hinweg – Kampf auf dem Klassenterrain weltweit gegen jede Bourgeoisie. Nur die Vereinigung der proletarischen Kämpfe über die Grenzen der Nationalstaaten hinweg kann mit der imperialistischen Kriegslogik brechen.
Eine internationalistische Position zu vertreten heißt nicht, sich der Illusion hinzugeben, dass die Arbeiterklasse in einem Krieg zwangsläufig die Waffen niederlegen. Revolutionär zu sein bedeutet, konsequent internationalistisch zu handeln – meist gegen den Strom. Dies bedeutet heute angesichts der Situation in Syrien, sich über den wahren Charakter dieses Krieges bewusst zu werden; ihn als Ausdruck der Barbarei des Kapitalismus zu bekämpfen, indem wir unsere Stimme innerhalb der Arbeiterklasse erheben. Vor allem dann, wenn die Kriegspropaganda von politischen Gruppen verbreitet wird, die sich auf die Arbeiterklasse berufen. Eine Demonstration gegen den Krieg auf der Grundlage des proletarischen Klassenkampfes wäre eine gute Sache. Solche Demonstrationen gab es während des Ersten Weltkriegs z.B. in Deutschland und Russland. Wenn aber die bürgerliche Linke zu Antikriegs-Demos aufruft, geht es meist um die Unterstützung einer Kriegspartei, d.h. es ist Kriegspropaganda im pazifistischen Schafspelz.
Die proletarischen Kämpfe brechen spontan aus. Revolutionäre spielen dabei nur selten eine auslösende Rolle. Hingegen hängt es von unserer Intervention ab, welche Inhalte in den Kämpfen zum Ausdruck kommen und ob Strukturen der Selbstorganisierung entstehen. Deshalb ist eine klare Haltung notwendig – auch zum Krieg in Syrien.
Aktuelles und Laufendes:
Wo wird das enden? Wie können wir antworten?
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 138.15 KB |
- 2372 Aufrufe
Wo wird das enden? Wie können wir antworten?
1984 setzte die damalige Regierung der PSOE
(Sozialistische Partei) die erste Arbeitsmarkt-Reform durch. Vor kaum drei
Monaten hat die jetzige PP-Regierung (des rechten Partido Popular) mit der
Umsetzung der schwersten Arbeits-Reformen begonnen, die es bisher je gegeben
hat. 1985 setzte die PSOE-Regierung die erste Renten-Reform durch; im Jahr 2011
kam es zu einer weiteren. Wann wird die nächste folgen? In den letzten 30
Jahren haben sich die Lebensbedingungen für die Arbeiter allmählich verschlechtert,
aber seit 2010 hat sich der Rhythmus der Verschlechterungen gewaltig
beschleunigt, und mit den neuen Maßnahmen der PP-Regierung werden Stufen
erreicht, die leider noch nichts sind im Vergleich zu den Angriffen, die uns
erwarten. Es gab aber zudem eine Verschärfung der Polizeirepression: Gewalt
gegen die Studenten in Valencia im vergangenen Februar; Knüppel gegen die Bergarbeiter;
der Einsatz von Gummischrot, der unter anderem bei einem Mädchen zu einem
riesigen Bluterguss am Rücken führte; die Schließung des Kongresses durch die
Polizei angesichts der spontanen Demonstrationen, die in der ersten Juli-Hälfte
ausgebrochen sind ...
Wir, die UNGEHEURE MEHRHEIT, nicht nur ausgebeutet und unterdrückt, sondern
auch empört, wir Arbeiter_innen des
öffentlichen und des privaten Sektors, Arbeitslose, Student_innen, Rentner_innen,
Einwanderer_innen... wir haben eine Menge Fragen zu allem, was da passiert.
Wir müssen diese Fragen gemeinsam auf den Straßen und Plätzen stellen, an den Arbeitsplätzen, um zusammen Antworten zu finden – um eine massenhafte, überzeugende und nachhaltige Antwort zu geben.
Der Zusammenbruch des Kapitalismus
Die Regierungen wechseln sich ab, aber die Krise wird immer schlimmer, und wir werden je länger je härter getroffen. Jedes Gipfeltreffen der EU, der G20 usw. wird dargestellt als die „endgültige Lösung“... und schon am Tag darauf entpuppt sie sich als Totalausfall. Sie sagen uns, dass die Einschnitte nötig seien, um die Risiken für die bedrohte Wirtschaft zu verringern, und am Tag darauf sehen wir, dass das genaue Gegenteil wahr ist. Nach so vielen Einschnitten in unseren Lebensstandard bekennt der IMF, dass wir bis 2025 (!) warten müssen, um wieder den Lebensstandard von 2007 zu erreichen. Die Krise rückt unerbittlich und unaufhaltsam vor und lässt in ihrem Kielwasser Millionen von zerstörten Existenzen zurück.
Natürlich sind einige Länder besser dran als andere, aber wir müssen die Welt als Ganzes betrachten. Das Problem ist nicht begrenzt auf Spanien, Griechenland oder Italien, noch kann es reduziert werden auf eine „Euro-Krise“. Deutschland ist am Rande der Rezession und hat 7 Millionen Mini-Jobs (mit Löhnen von 400 Euro pro Monat). In den USA steigt die Arbeitslosigkeit mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Zahl der Wohnungsräumungen. In China hat sich das Wirtschaftswachstum während nun schon 7 Monaten verlangsamt trotz der wahnsinnigen Immobilien-Blase, die dazu geführt hat, dass allein in Peking 2 Millionen Wohnungen leer stehen.
Wir erleben am eigenen Leib die weltweite und historische Krise des kapitalistischen Systems, zu dem alle Staaten gehören – unabhängig von deren offizieller Ideologie, ob sie sich „kommunistisch“ nennen wie China oder Kuba, „sozialistisch“ wie Frankreich, „demokratisch“ wie die USA, „liberal“ wie Spanien und Deutschland oder ob sie sich auf den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ berufen wie Ecuador oder Venezuela.
Der Kapitalismus hat den Weltmarkt geschaffen, aber vor bald 100 Jahren hat er sich in ein reaktionäres System verwandelt, das die Menschheit in die schlimmste Barbarei geführt hat: zwei Weltkriege, unzählige regionale Kriege, die Zerstörung der Umwelt ... und während es Momente eines künstlichen Wirtschaftswachstums gegeben hat, auf der Grundlage von Spekulation und Blasen aller Art, stürzt es heute und seit 2007 in die schlimmste Krise seiner Geschichte mit der Pleite von Staaten, Firmen und Banken, die sich vor einer ausweglosen Insolvenz befinden. Das Ergebnis eines solchen Debakels ist eine gigantische menschliche Katastrophe. Während sich die Hungersnot und die Armut in Afrika, Asien und Lateinamerika ausbreiten, verlieren in den sogenannten reichen Ländern Millionen von Menschen ihre Jobs, Hunderttausende werden aus ihren Häusern vertrieben und die Mehrheit der Lohnarbeitenden weiß nicht, wie sie es bis zum Monatsende schaffen soll mit den steigenden Kosten und der geringeren Verfügbarkeit von sozialen Dienstleistungen, so dass das Leben je länger je prekärer wird, und dazu kommt schließlich das erdrückende Gewicht der direkten und indirekten Steuern.
Der demokratische Staat ist die Diktatur der kapitalistischen Klasse
Der Kapitalismus teilt die Gesellschaft in zwei Pole: den Minderheitspol der kapitalistischen Klasse, die alles besitzt und nichts produziert; und den Mehrheitspol der ausgebeuteten Klassen, die alles produzieren und immer weniger davon erhalten.
Die kapitalistischen Klasse, dieses 1% der Bevölkerung, wie die Occupy-Bewegung in den USA gesagt hat, tritt immer korrupter, arroganter und beleidigender auf. Sie häuft schamlos Reichtum an; sie zeigt sich ganz gefühllos gegen das Leiden der Mehrheit; und überall, wo es nötig zu sein scheint, lässt sie ihr politisches Personal Kürzungen und Sparmaßnahmen umsetzen. Warum denn kann sie trotz der großen Bewegungen der sozialen Empörung, die sich 2011 entfaltet haben (in Spanien, Griechenland, den USA, Ägypten, Chile, etc.), immer noch eine Politik gegen die Interessen der Mehrheit durchziehen? Warum ist unser Kampf trotz der wertvollen Erfahrungen, die er uns gebracht hat, bei Weitem ungenügend gemessen an dem, was erforderlich wäre?
Eine erste Antwort liegt im Betrug des demokratischen Staates. Dieser stellt sich dar als „Ausdruck aller Bürger“, aber in Wirklichkeit ist er das ausschließliche und ausschließende Organ der kapitalistischen Klasse. Er dient völlig deren Interessen und kann sich auf zwei Hände verlassen: die Rechte bestehend aus Polizei, Gefängnissen, Gerichten, Gesetzen, Bürokratie, die es in Bewegung setzt, um uns zu unterdrücken und jeden Versuch des Aufstands niederzuschlagen. Und die Linke bestehend aus den politischen Parteien mit allen möglichen Ideologien, den scheinbar unabhängigen Gewerkschaften und verschiedensten Institutionen, die angeblich den sozialen Zusammenhalt zu unserem Wohl schützen sollen ... – eine ganzes Arsenal, das uns Luftschlösser malt, damit wir uns täuschen, spalten und demoralisieren lassen.
Was haben uns all die Wahlen alle vier Jahre gebracht? Haben die Regierungen je ihre Wahlversprechen gehalten? Welches immer auch ihre Ideologie war: Auf wessen Seite standen sie? Auf derjenigen ihrer Wähler_innen oder auf derjenigen des Kapitals? Was haben all die Reformen und Änderungen gebracht, die bei der Bildung, der sozialen Sicherheit, in der Wirtschaft, der Politik, etc. umgesetzt wurden? Waren sie nicht ein großer Betrug im Stile: „Alles muss sich ändern, damit alles beim Alten bleibt“? Wie die Bewegung des 15. Mai (15M) seinerzeit sagte: „Sie nennen es Demokratie, und sie ist es nicht – es ist eine Diktatur, und wir sehen sie nicht“.
Angesichts der weltweiten Elends: Weltrevolution gegen das Elend!
Der Kapitalismus führt zum verallgemeinerten Elend. Aber wir sollten im Elend nicht nur das Elend sehen! In diesem System befindet sich die wichtigste ausgebeutete Klasse, das Proletariat, die mit ihrer assoziierten Arbeit – die nicht beschränkt ist auf Industrie und Landwirtschaft, sondern die Arbeit in der Bildung, Gesundheit, im öffentlichen Dienst usw. mitumfasst – das Funktionieren der ganzen Gesellschaft gewährleistet. Deshalb hat diese Klasse die Fähigkeit, die kapitalistische Maschine zu lähmen und öffnet die Tür zur Schaffung einer Gesellschaft, wo das Leben nicht auf dem Altar des kapitalistischen Profits geopfert wird, wo die Wirtschaft der Konkurrenz durch eine Produktion ersetzt wird, die auf Solidarität beruht und der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dient. Kurz, eine Gesellschaft, welche die Widersprüche, in die der Kapitalismus die Menschheit verwickelt, aufhebt.
Dies ist nicht bloß ein Wunschtraum, sondern die historische und weltweite Erfahrung von 200 Jahren des Kampfes der Arbeiterbewegung, aber das Ziel erscheint noch als weit entfernt und schwierig zu erreichen. Einen Grund dafür haben wir schon erwähnt: Man betrügt uns ständig mit der Illusion des demokratischen Staates. Aber es gibt tieferliegende Gründe: Die Mehrheit der Arbeiter_innen verstehen sich nicht als solche. Wir haben nicht das nötige Selbstvertrauen, um uns als selbständige gesellschaftliche Kraft zu begreifen. Und vor allem die Lebensweise dieser Gesellschaft, die auf der Konkurrenz, auf dem Kampf eines Jeden gegen Jeden beruht, führt uns in die Vereinzelung, jeder für sich, zur Trennung voneinander und zur Konfrontation gegeneinander, statt miteinander.
Das Bewusstsein über diese Probleme, die offene und brüderliche Debatte über sie, die kritische Wiederaneignung der Erfahrung von mehr als zwei Jahrhunderten des Kampfes sind die Mittel, um diese Situation zu überwinden und auf die Angriffe zu reagieren. Am gleichen Tag, als Premierminister Rajoy die neuen Maßnahmen ankündigte (11. Juli), begannen schon Antworten aufzutauchen. Viele Menschen gingen nach Madrid, um ihre Solidarität mit den Bergarbeitern zum Ausdruck zu bringen. Diese Erfahrung der Einheit und Solidarität wurde in den darauf folgenden Tagen konkretisiert mit spontanen Demonstrationen, zu denen über die sozialen Netzwerke aufgerufen wurde. Es war eine Initiative von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, außerhalb der Gewerkschaften. Die Frage ist, wie wir weitermachen, wohl wissend, dass der Kampf lang und schwierig sein wird? Hier einige Vorschläge:
Vereinter Kampf: Arbeitslose, Beschäftigte im öffentlichen und privaten Sektor, Lehrlinge und Ausgebildete, Rentner_innen, Student_innen, Einwanderer_innen: Zusammen schaffen wir es. Kein Sektor darf isoliert und abseits stehen bleiben. Angesichts einer Gesellschaft der Spaltung und der Vereinzelung müssen wir die Kraft der Solidarität zeigen.
Offene Vollversammlungen: Das Kapital wird stark bleiben, solange wir alles in den Händen von Berufspolitikern und Spezialisten der gewerkschaftlichen Vertretung lassen, die uns ständig verraten. Vollversammlungen zum kollektiven Nachdenken, für die Diskussion und zum gemeinsamen Entscheid. Damit wir alle Verantwortung übernehmen für die Umsetzung dessen, was wir beschlossen haben; damit wir Freude daran haben, zusammen zu sein; damit wir die Barrieren der Einsamkeit und Isolation durchbrechen und Einfühlungsvermögen und Vertrauen kultivieren können.
Suchen wir die internationale Solidarität: Die Verteidigung der Nation macht aus uns Kanonenfutter für den Krieg, schafft Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, trennt uns und stellt uns gegeneinander. Doch die Arbeiter_innen der ganzen Welt sind die einzigen, denen wir vertrauen können, um die Kraft zu schaffen, die es braucht, um die Angriffe des Kapitals zurück zu schlagen.
Kommen wir zusammen an den Arbeitsplätzen, in den Vierteln, im Internet, in Kollektiven, um über alles nachzudenken, das vor sich geht; organisieren wir Treffen und Debatten, welche die kommenden Kämpfe befruchten und vorbereiten. Es genügt nicht, bloß zu kämpfen! Wir müssen mit dem klarst möglichen Bewusstsein darüber, was passiert, was unsere echten Waffen sind, wer unsere Freunde und wer unsere Feinde sind, kämpfen!
Jede gesellschaftliche Veränderung ist unausweichlich auch eine individuelle Veränderung. Unser Kampf kann sich nicht auf eine einfache Änderung der politischen und wirtschaftlichen Strukturen beschränken. Vielmehr geht es um eine radikale Änderung des gesellschaftlichen Systems und somit unseres eigenen Lebens, unserer Sicht der Dinge, unserer Wünsche. Nur so können wir die nötige Kraft entwickeln, um den unzähligen Fallen zu widerstehen, die man uns in den Weg stellen wird, den physischen und moralische Schlägen, die auf uns niedergehen werden. Es braucht eine Änderung in der Mentalität hin zur Solidarität, zum kollektiven Bewusstsein, die nicht nur der Kitt unsere Einheit sind, sondern das Fundament einer zukünftigen Gesellschaft jenseits der wilden Konkurrenz und der alles durchdringenden Kommerzialisierung in der kapitalistischen Gesellschaft.
Internationale Kommunistische Strömung, 16.07.12
Zum Tode von Robert Kurz: Nicht widerlegt, nicht gescheitert
- 2354 Aufrufe
Am 18. Juli starb der marxistische Wirtschaftstheoretiker Robert „Bobby“ Kurz aufgrund eines ärztlichen Behandlungsfehlers, als er - statt an den Nieren – an der Bauchspeicheldrüse operiert wurde. Damit ging mit 68 Jahren vorzeitig eine wissenschaftliche Forschungstätigkeit zu Ende, die die Ergebnisse seiner theoretischen Annahmen nicht mehr weiter verifizieren konnte. Er hinterlässt aber als Autor oder Co-Autor mit den Büchern wie zum Beispiel „Der Kollaps der Modernisierung“, „Honeckers Rache“, „Schwarzbuch Kapitalismus“, „Der Dritte Weg in den Bürgerkrieg“, „Weltordnungskrieg“ und zahllosen anderen Beiträgen in den Theoriezeitschriften „Krisis“ und „Exit!“ eine große Menge an anschaulichem Material, mit dem er eine Art Zusammenbruchstheorie in allen ihren gesellschaftlichen Schattierungen auf Basis kapitalistischer Wertvergesellschaftung skizzierte.
Robert Kurz war einer der Wenigen, denen schon in den siebziger Jahren die theoretische Enge bzw. Theorielosigkeit des Kommunistischen Arbeiterbundes Deutschlands (KABD) und anderer K-Gruppen zuwider war und die deshalb begannen, eigene theoretische Analysen auf marxistischer Grundlage zu entwickeln. Es gelang ihm, noch in den achtziger Jahren revolutionär gestimmte Abtrünnige der niedergehenden K-Gruppen und andere politisch Interessierte um sich zu sammeln und mit ihnen – jenseits tagesaktueller Kampagnenpolitik - ein theoretisches Fundament zu erarbeiten, was die Stagnation kapitalistischer Entwicklungsvorhaben der Jetztzeit auf der Basis der Marxschen Arbeitswertlehre und Wertkritik erklären konnte. Der Zusammenbruch des „real existierenden Sozialismus“, des Ostblocks, war eine erste zentrale Bestätigung seiner Annahmen und die Initialzündung für weitergehende ökonomische und gesellschaftliche Analysen auf Grundlage des „doppelten Marx“, wie Kurz es formulierte. Darunter versteht er den vom alten Arbeiterbewegungsmarxismus fast gänzlich unbeachteten, das kapitalistische Gesamtsystem transzendierenden Marxschen Theoriearm um Begriffe wie „Wertsubstanz“, „automatisches Subjekt“ und „Fetischcharakter des warenproduzierenden Systems“.
Robert Kurz wandte sich gegen das Hochjubeln der „Arbeiterklasse“ durch die K-Gruppen und die durch die „Linke“ und Parteien verstandene positive Besetzung des „Arbeitsbegriffs“. Er ersetzte ihn in den Folgejahren durch eine Perspektive des „produktiven Müßiggangs“, also einer Kategorie, die jeglichen Arbeiterstolz, Fleiß, Opfer, Genügsamkeit und jegliche Form des Proletenkults negiert. Hinzu kommt seine Feststellung, dass Arbeiter wie Angestellte, Manager wie Kapitalisten gleichermaßen einem subjektlosen und fetischisierten – aber mit Feuerwaffen und Staat über die Jahrhunderte durchgesetzten Wertverwertungszusammenhang von Waren und Geld ausgesetzt waren, den sie heute wie eine „zweite Natur“ anerkennen und den sie nicht hintergehen wollen. So war für Robert Kurz die Reduktion auf den „Klassenkampf“ eine zu einseitige Spielart der Marxschen Analyse, weil für ihn selbst über die Lohnkämpfe und durch die Revolution von 1917 die Wert- und Fetischform des Kapitals nicht überwunden wurden.
Weiter sind für Robert Kurz der Niedergang der so genannten „3. Welt“, dann des Ostblocks und das Hineinfressen der Krise in die imperialistischen Kernzentren untrügliche Zeichen dafür, dass die Ausdünnung der Wertsubstanz der Produkte (der variable Teil des Kapitals plus Mehrwert) durch aufeinanderfolgende produktivere Zyklen aufgrund der mikroelektronischen Revolution seit Mitte der siebziger Jahre immer größere und schnellere Rationalisierungspotenziale nach sich ziehen musste, die nicht durch Neueinstellungen kompensiert werden konnten. Die Folge: genau wie immer größere Massen an Lohnarbeitern außer Kurs gesetzt oder monetär degradiert werden, so versucht das Kapital nun, neue und höhere Profite im „finanzspekulativen Überbau“ zu generieren, also sich zunächst als realwirtschaftlicher Betrieb über die Börsen in die „schwarzen Zahlen“ zu zocken, um genügend Kapital für den nächsten Akkumulationszyklus zu haben. So wie hier für Robert Kurz der Grund für die Finanzblasen und Börsenkräche liegt, fehlen den Staaten mangels Besteuerungsmöglichkeiten die liquiden Mittel, um eine Gesundheits- und Infrastruktur aufrecht zu erhalten, die den Namen noch verdient. Die weitere Folge: die fetischistische Zurichtung der Akteure auf Ware, Wert, Geld, Zins und Kapital führt in einer nicht enden wollenden Abfolge zu absurden Verteilungskämpfen, neuen Krisen, Kriegen, Staatszerfall und Barbarisierung der Gesellschaft, ohne dass es noch irgendeine Hoffnung auf ein Anspringen der Weltkonjunktur mit Vollbeschäftigung geben könnte. Das heißt auch: Es gibt keinen plötzlichen Zusammenbruch, nicht den „großen Kladderadatsch“, was Robert Kurz als „Untergangspropheten“ permanent untergeschoben wurde, sondern eine länger andauernde Zersetzungsgeschichte des warenproduzierenden Systems mit katastrophalen Folgen, falls es nicht gelingt, den selbstdestruktiven Prozess umzukehren.
Dieses Szenario der Publikationen von „Marxistische Kritik“ über „Krisis“ bis „Exit!“ erlangte in den letzten 20 Jahren im In- und Ausland eine hohe Wertschätzung, was viele Einladungen zu Vorträgen nach sich zog. Dem kam Robert Kurz gerne nach; Reisen führten ihn bis nach Brasilien, Artikel von ihm wurden in viele Sprachen übersetzt. Nie gab er seine Unabhängigkeit auf, arbeitete lieber des Nachts in der Expedition der „Nürnberger Nachrichten“, als auf eine wie auch immer geartete Karriere zu schielen. Damit hatte er einen genügend großen Zeitfonds für sich, um seinen eigentlich wichtigen Forschungs- und Schreibarbeiten nachgehen zu können. Er ging seinen eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter, Anfeindungen beantwortete er scharfzüngig, scheute sich aber auch nicht, Brüche und Spaltungen hinzunehmen, um sich neu zu organisieren und seine Wert- und Abspaltungstheorie weiter ausformulieren zu können. Der Bruch der „Exit!“ von der „Krisis“ und Trennung von seinen langjährigen Weggefährten war eine Etappe in seinem Kampf um die Etablierung seiner theoretischen Annahmen ohne weitere Reibungsverluste.
Unbeirrbar seinen Weg zu gehen machte ihn aber blind für mögliche Verbündete, die theoretisch auf ähnlichen politisch-ökonomischen Feldern operieren. So war ihm Organisation und Theorie der „IKS“ faktisch nicht bekannt. Er hielt eine progressive Organisationsstruktur mit ähnlichen theoretischen Ansätzen (Arbeiterräte, Dekadenztheorie der IKS, staatskapitalistischer Ostblock) für nicht möglich oder wies die IKS - ohne sie direkt zu erwähnen - in seinem Artikel „Antiökonomie und Antikritik“ pauschal einer Unterabteilung des für ihn überkommenen „Arbeitermarxismus“ zu: „Der neuere Linkskommunismus wiederum mit seinen teils maoistischen, teils aus dem italienischen ‚Operaismus‘ stammenden Ingredienzien ist über eine bestenfalls platonische Kritik der ‚Ware-Geld-Beziehungen‘ ohne philosophiekritisch und anti-ökonomisch fundierte Kritik der Wertform nie hinausgekommen und bei ganz kruden Vorstellungen stehen geblieben, die in der Praxis nicht viel mehr als eine hedonistische Maskierung der alten Arbeiterbewegungs-Ideologie waren…, d.h. sie schweigen wie das Grab über die konkrete Aufhebung der fetischistischen, vom Wert gesetzten Formbestimmtheit kapitalistischer Reproduktion.“
Leute:
- Robert Kurz Nachruf [483]
Weltrevolution Nr. 175
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 1.27 MB |
- 2081 Aufrufe
Die Wiederwahl von Präsident Obama: Die Bourgeoisie bereitet die Sparpolitik vor
- 1737 Aufrufe
Die Präsidentschaftswahlen von 2012 haben sich als positiv für die Hauptfraktionen der US-Bourgeoisie erwiesen. Präsident Obama hat die Wiederwahl erreicht und den Republikaner Mitt Romney in die Schranken gewiesen, was bedeutet, dass die Demokratische Partei auch die nächsten vier Jahre die Geschicke des Staates lenken wird.
Die Reaktion der Medien nach den Wahlen war ohrenbetäubend. Obama habe einen Erdrutschsieg errungen, erzählten sie uns, habe er doch 332 Wahlmännerstimmen gegenüber 206 für Romney für sich gewonnen und mit mehr als drei Millionen Stimmen Mehrheit an den Urnen seinen Rivalen geschlagen. Obama besitzt nun ein nationales Mandat zum Regieren. Die Republikaner, die sich nach der Wahlschlappe, die sie auch im Senat Sitze einbüßen ließ, noch immer die Wunden lecken, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ihre Rhetorik ändern und an den Verhandlungstisch zurückkehren müssen, um ein allgemeines Übereinkommen über die Defizitreduzierung auszuhandeln, dem die US-Bourgeoisie während der ersten Amtszeit Obamas ausgewichen war.
Die eher optimistischen Experten erwarten, dass diese Wahlen das Ende des Aufstandes der Tea Party innerhalb der Republikanischen Partei einläuten werden. Sie meinen, dass die vernünftigeren Elemente in der Grand Old Party (GOP) nun in der Lage sein werden, die Kontrolle über die Partei wiederzuerlangen. Andere Experten sagen dagegen einen Bürgerkrieg in der GOP voraus, da diese darum kämpft, mit der neuen demographischen Realität zu Rande zu kommen, erlaubte doch eine Beibehaltung des alten Kurses mit seinem latenten Rassismus, seiner rückwärtsgewandten Sexualpolitik, den anti-wissenschaftlichen Verschwörungstheorien und ihr Niedermachen der Einwanderer ihr niemals mehr, einen Präsidenten zu stellen.
Das Wahlergebnis und die vorherige Kampagne haben die Analyse bestätigt, die eine galoppierende „politische Krise“ der US-amerikanischen Bourgeoisie ausgemacht hat:
- Die Auswirkungen des gesellschaftlichen Zerfalls haben Zentrifugalkräfte in der Bourgeoisie freigesetzt, die zur wachsenden Unfähigkeit bestimmter Fraktionen in ihrer Mitte führen, im allgemeinen Interesse des nationalen Kapitals zu handeln. Jedoch hat dieser Prozess nicht alle Fraktionen der Bourgeoisie gleichermaßen in Mitleidenschaft gezogen. So hat die Republikanische Partei eine unverhältnismäßig starke ideologische Degeneration erlitten, die ihre Regierungsfähigkeit in Frage stellt.
- Die Unfähigkeit der Bourgeoisie, irgendeine Lösung für die anhaltende Wirtschaftskrise zu finden, hat die Tendenzen zu heftigen fraktionellen Gerangel innerhalb der Bourgeoisie weiter gestärkt. Der ideologische Zerfall der Republikanischen Partei bedeutet, dass sie auf völlig diskreditierte konservative Wirtschaftsdogmen zurückfällt und eine aggressive Anti-Gewerkschaftspolitik verfolgt, die Gefahr läuft, den Staat seines besten Bollwerks gegen die Arbeiterklasse zu berauben.
- Angesichts dessen ist es für die Hauptfraktionen der Bourgeoisie zu riskant, die Republikanische Partei mit der nationalen Regierung zu betrauen. Dies trotz der Tatsache, dass die anhaltende Wirtschaftskrise und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, eine Sparpolitik zu verordnen, eigentlich nahelegt, dass die Bourgeoisie die Linke ihres politischen Apparats lieber in der Opposition sehen würde, wo diese den Zorn der Arbeiterklasse in Sackgassen lenken könnte, die für die kapitalistische Gesellschaftsordnung ungefährlich sind.
- Infolge der Degeneration der Republikanischen Partei bleibt es den Demokraten überlassen, die notwendige Sparpolitik durchzuführen. Dies droht die traditionelle ideologische Arbeitsteilung innerhalb der Bourgeoisie durcheinanderzubringen, sodass die Demokraten für die schmerzhaften Einschnitte in Sozialprogramme verantwortlich sind und die Republikaner gegen die Rhetorik des Wirtschaftsaufschwungs Sturm laufen.
- Nachdem sie anfangs für eine Revitalisierung des Wahlmythos in einer Bevölkerung gesorgt hat, die sich nach acht Jahren Bush-Präsidentschaft abgewendet hatte, hat Obamas Präsidentschaft lediglich eine noch intensivere und dauerhaftere rechte Gegenreaktion entzündet. Der ideologische Zerfall der Republikanischen Partei wird von einer ideologischen Verhärtung der Gesellschaft als Ganzes begleitet. Die Nation spaltet sich immer mehr in zwei – im Großen und Ganzen gleichgroße – politische Blöcke auf. Angesichts der Verschwörungstheorien und rassistischen Stereotypen, mit denen der erste schwarze Präsident in der Geschichte der USA belegt wurde, sah sich seine Präsidentschaft von Anbeginn Zweifeln an seiner Legitimation ausgesetzt.
Bedeutet Obamas Wiederwahl das Ende der politischen Krise? Haben die Hauptfraktionen der Bourgeoisie recht, wenn sie glauben, dass dies die Rückkehr zur politischen Normalität markieren werde? Welche Rolle spielte die Arbeiterklasse in dieser Wahl? War die Bourgeoisie fähig, den Schwung von 2008 mitzunehmen und die Bevölkerung im Glauben zu lassen, dass die Wahldemokratie der beste Weg ist, um ihre Interessen zu schützen? Was bedeutet Obamas Sieg für die Arbeiterklasse?
Die Bedeutung von Obamas Sieg für die Arbeiterklasse
Wir sollten uns keine Illusionen darüber machen, was Obamas zweite Amtszeit für die Arbeiterklasse bedeuten wird. Wir können es in einem Wort zusammenfassen: Austerität. Trotz all der Rhetorik, die vom Obama-Team, unterstützt von seinen gewerkschaftlichen und „fortschrittlichen“ Verbündeten, über den Schutz der Sozialversicherung und von Medicare gegen den „bösen Geist“ Paul Ryan ausgespuckt wurden, ist es klar, dass Einschnitte in beide Programme stets auf der Tagesordnung für Obamas zweite Amtszeit gestanden hatten. Die einzige Frage ist, wie tief die Einschnitte sein werden und wie schnell sie umgesetzt werden.
Die US-Bourgeoisie ist sich einig darin, dass der finanzpolitische Kurs der Nation einfach untragbar ist, dass „Reformen“ bei den Sozialausgaben unabdingbar sind, um zu versuchen, das Defizit unter Kontrolle zu bekommen. Es ist richtig, dass die Politik, die von Romneys Vizepräsidentschafts-Kandidaten Ryan befürwortet wurde, schlicht zu drakonisch war, um sie gegenwärtig zu verordnen. Es ist auch richtig, dass die Hauptfraktionen der Bourgeoisie das rechte Mantra ablehnen, wonach die sozialen Sicherungssysteme privatisiert werden müssten, um sie zu „retten“. Dennoch heißt all dies nicht, dass sie darum bemüht sind, diese Programme so, wie sie derzeit sind, zu erhalten. Im Gegenteil, schmerzhafte Kürzungen sind im Anzug.
Präsident Obama hat bereits seine Bereitschaft signalisiert, diese Programme drastisch zu kürzen. Dies war ein Hauptbestandteil des so genannten grand bargain (etwa: große Übereinkunft), den er mit dem republikanischen Sprechers des Repräsentantenhauses John Boehner an der Spitze auszuhandeln im Begriff war, um der Krise der Schuldenobergrenze im Sommer 2011 beizukommen. Der einzige wirkliche Unterschied zwischen beiden Kontrahenten in dieser Angelegenheit war das Begehren des Präsidenten, die Kürzungen mit einigen Steuererhöhungen für die Wohlhabenden zu bündeln, damit er der Bevölkerung den Deal als „gemeinsames Opfer“ verkaufen konnte. Erst die Unnachgiebigkeit der Tea Party hinderte Boehner daran, dem grand bargain zuzustimmen, was letztendlich die Gefahr des so genannten fiscal cliff heraufbeschwor: automatische Steuererhöhungen und drakonische Ausgabenkürzungen, die zu Beginn des neuen Jahres wirksam werden.
Tatsächlich haben die politischen Experten bereits geäußert, dass dies der wahre Sinn der Wahlen gewesen sei. Obama hat nun das politische Kapital, das er benötigt, um die Republikaner zu einem allgemeinen Übereinkommen zu zwingen, das wenigstens einige Steuererhöhungen für die Wohlhabenden beinhaltet. Die Linke in der Demokratischen Partei kann schreien, was sie will, aber am Ende wird sie uns die fixe Idee einreden, dass alles noch viel schlimmer gekommen wäre, wenn die Republikaner das Weiße Haus übernommen hätten und dass so zumindest auch die Milliardäre zur Kasse gebeten werden.
Jene ArbeiterInnen, die noch immer Illusionen in Obamas Präsidentschaft haben und glauben, dass er den Mittelstand wiederbeleben kann oder dass er irgendeine Art von Sachwalter der „Arbeiterrechte“ ist, müssen sich nur die Ereignisse rund um den Chicagoer LehrerInnenstreik vergegenwärtigen, um eine Ahnung zu bekommen, wo der Präsident in diesen Fragen steht. Es waren die Chicagoer Kumpane des Präsidenten, die diese Angriffe gegen die LehrerInnen durchführten. Kann es irgendeinen Zweifel darüber geben, dass dieser Blick auf den Bildungssektor – ja sogar auf die gesamte Arbeiterklasse – letztendlich vom Präsidenten selbst geteilt wird? Der ursprüngliche Architekt für den Plan von Bürgermeister Emanuel, das Chicagoer Schulsystem zu reformieren, war kein anderer als der frühere Chicagoer Schulrat (School Chancellor) Arne Duncan – Obamas aktueller Bildungssekretär!
Entgegen aller möglichen Wahlspekulationen sagen wir, dass die einzige Perspektive der Arbeiterklasse in ihren autonomen Kämpfen zur Verteidigung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen besteht. Es ist verständlich, dass ArbeiterInnen die drakonischen Angriffe der Republikaner fürchten. Doch sollen wir deshalb bei den Demokraten Zuspruch suchen? Der einzige wirkliche Unterschied zwischen den Parteien in diesem Punkt besteht in der Frage, wie schnell und wie dramatisch die Kürzungen ausfallen werden. Im Endeffekt führen beide Wege zum gleichen Ziel. Wenn wir für die Demokraten stimmen, sind wir Arbeiter es, die das Problem vor sich herschieben.
Das Ende der politischen Krise?
Wird Obamas Wiederwahl all den Rankünen innerhalb der herrschenden Klasse ein Ende bereiten, wie die bürgerlichen Medien uns mitteilen? Wird die „Wahlschlappe“ der Republikaner ihre rationaleren Fraktionen dazu veranlassen, die Partei den Irren der Tea Party zu entreißen? Bahnt sich eine neue Ära der Kooperation an, in der beide Parteien ihre Aufmerksamkeit den Interessen der Nation zuwenden?
Um diese Fragen zu beantworten, ist es notwendig, sich mit der Frage der angeblichen „Wahlschlappe“ zu beschäftigen. Es trifft zu, dass Obama mit großem Vorsprung bei den Wahlmännern gewann, doch nur im Kontext der jüngsten amerikanischen Politik kann ein 51 zu 48%-Vorsprung bei der Volksabstimmung als „Erdrutschsieg“ bezeichnet werden. Die Wahlergebnisse scheinen lediglich die Realität zu bestätigen, dass die USA ein tief gespaltenes Land sind. Die Bevölkerung ist so tief gespalten, dass selbst monatelange, schonungslose Propagandakampagnen, die Romney als einen gierigen Aasgeier-Kapitalisten und Obama als einen un-amerikanischen Sozialisten zeichneten, kaum etwas an den Mehrheitsverhältnissen änderten. So verhärtet sind die ideologischen Fronten in der Gesellschaft, dass die Aufgabe, ein nationales Narrativ schaffen, so schwierig ist wie noch nie zuvor.
Es ist wahrscheinlich richtig, dass die aufkommenden demographischen Trends innerhalb des Stimmvolkes ernsthafte Probleme für die GOP bedeuten. Doch wird die GOP in der Lage sein, ihren Kurs zu berichtigen, wie es die Medien vorhersagen? Dies erscheint unwahrscheinlich. Nachdem sie die Flammen der weißen, männlichen Gegenreaktion geschürt hatte, ist kaum zu erwarten, dass diese Elemente nun widerstandslos in der Versenkung verschwinden. Sollte die republikanische Führung einen Kompromiss mit Obama über eine umfassende Einwanderungsreform erzielen, kann es durchaus zu einer Spaltung der Republikanischen Partei kommen – mit beträchtlichen Schäden am Zwei-Parteien-System in den USA. Zwar können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass dies passieren wird, doch die Bruchstellen innerhalb der GOP sind klar. Sie wird noch eine geraume Zeit zerrissen sein in einen Parteiflügel, der ihr Image wieder aufmöbeln möchte, um die Erfolgsaussichten bei Wahlen zu bessern, und einen anderen Flügel, der die Absicht verfolgt, die ideologische Reinheit zu bewahren.
Jedoch sind die Republikaner nicht die einzigen, die ein demographisches Problem haben. Obama verlor bedeutend bei den weißen Wählern. Zwar konnte er unter den Schwarzen, Latinos, alleinstehenden Frauen und den jungen Wählern punkten, doch hatte er dafür erhebliche Defizite unter den weißen Fabrikarbeitern (besonders Männern) zu verzeichnen. Während eine hohe Beteiligung an den Präsidentschaftswahlen die Demokraten begünstigt, bleibt es ungewiss, ob dies auch auf die Gouverneurs- und lokalen Wahlen mit ihrer geringen Wahlbeteiligung übersetzt werden kann. Die GOP wird auf dieser Ebene wahrscheinlich weiterhin eine Macht darstellen. Tatsächlich war die GOP selbst im Jahr der Präsidentschaftswahlen – größtenteils aufgrund von korrupten Wahlkreisschiebungen – in der Lage, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zu behalten.
Auf einer anderen Ebene wird die US-Bourgeoisie auch weiterhin von der praktischen „Umkehrung“ ihrer traditionellen ideologischen Arbeitsteilung gepeinigt werden. Wenn sie gezwungen werden würde, die Demokraten auf unbestimmte Zeit an der Macht zu halten, bis hin zur Auflösung der Republikanischen Partei, würde dies ernste Probleme für die Legitimation der Demokratischen Partei selbst bedeuten. Was für ein seltsamer Anblick war es, den demokratischen Kandidaten dabei zuzuschauen, wie er inmitten einer fürchterlichen Rezession die Illusion nährte, dass der Zustand der Wirtschaft sich bessere, während der republikanische Kandidat als Stimme der Langzeit-Arbeitslosen auflief, denen der Präsident seine Hilfe versagt habe! Wie lange kann diese Situation anhalten? Die einzige Antwort der Demokraten darauf besteht lediglich in dem Argument, dass unversöhnliche GOP-Kräfte sie zu dieser Politik zwängen. Auch wenn sie mit dieser Taktik bis jetzt einigen Erfolg hatten, stellt sich die Frage, wie lange sie sie noch beibehalten können, ehe die Demokraten als Partei der Austerität betrachtet werden.
Wir sollten ebenfalls bedenken, dass Obamas erste Amtszeit vom Auftauchen einer waschechten außer-parlamentarischen Bewegung gekennzeichnet war, die in Gestalt der Occupy-Bewegung im Herbst und Winter 2011 die öffentliche Aufmerksamkeit fesselte. Es scheint, als sei die US-Bourgeoisie in der Lage gewesen, im Rahmen derselben Logik des „kleineren Übels“, die viele ArbeiterInnen dazu veranlasste, die Demokraten zu wählen, viel von der Energie dieser Bewegung in Obamas Wiederwahl-Kampagne einzuverleiben. Doch falls die Demokraten erst einmal als Partei der Austerität betrachtet werden, werden sie dann weiterhin imstande sein, die Energie künftiger außer-parlamentarischer Gesellschaftsbewegungen in die Sackgasse der Wahlen zu lenken?
Im Bereich der Außenpolitik ist klar, dass die Obama-Administration auch weiterhin wachsenden Bedrohungen der US-Hegemonie ausgesetzt ist, deren Abwendung ihr immer größere Schwierigkeiten bereitet. Obgleich die Außenpolitik kein Hauptthema in den Kampagnen der Präsidentschaftswahlen war, bedeutet dies nicht, dass es keine Spannungen in der US-Bourgeoisie in diesen Fragen gibt. Schon eine Woche nach den Wahlen musste sich Präsident Obama mit dem großen PR-Debakel bezüglich der sexuellen Indiskretionen des CIA-Direktors Petraeus befassen.
Auch wenn noch nicht klar ist, welche Tragweite diese Krise haben wird, scheint es, als witterten die Republikaner Morgenluft und benutzten diesen Skandal, um ihre Untersuchungen über die falsche Handhabung des Angriffs auf das Konsulat in Bengasi, der den Tod des US-Botschafters in Libyen nach sich zog, zu intensivieren. Wie immer dies ausgeht, die US-Bourgeoisie wird sich auch weiterhin ernsten Herausforderungen ihrer imperialistischen Hegemonie ausgesetzt sehen, einschließlich der Möglichkeit eines breiteren Krieges infolge der Syrien-Krise, der fortdauernden Spannungen mit dem Iran, wachsender Schwierigkeiten, Israel auf Linie zu bringen, und der wachsenden Bedrohung ihrer Hegemonie durch einen immer aggressiveren chinesischen Imperialismus.
Auch wenn die Hauptfraktionen der US-Bourgeoisie mit Obamas Wiederwahl einen Sieg errungen hat, bedeutet dies nicht die völlige Abwendung der politischen Krise, die die US-Bourgeoisie seit über einem Jahrzehnt im Griff hält. Es ist aufschlussreich, dass einige politische Experten, die die US-Politik begutachten, davon ausgehen, dass wir kurz vor einer Neuordnung der Parteienlandschaft stehen. Die Realität des Zerfalls erschwert es, vorauszusagen, welche Gestalt sie annehmen wird.
Für die Arbeiterklasse liegt die Schlussfolgerung auf der Hand: Es gibt keine Erlösung aus diesem Chaos der bürgerlichen Wahlpolitik. Wir können unsere eigenen Interessen nur auf einem grundsätzlich unterschiedlichen Terrain verfolgen – auf jenem unserer autonomen Kämpfe.
Henk 14.11.2012
Aktuelles und Laufendes:
- US-Wahlen [485]
- Obama Wiederwahl [486]
Ein Jahr nach der Befreiung - Libyen versinkt im Chaos
- 1456 Aufrufe
Der Artikel wurde schon als IKSonline veröffentlicht.
Hier der Link:
https://de.internationalism.org/IKSonline2012_Libyen1112 [487]Aktuelles und Laufendes:
- Libyen [488]
Krieg und Klassenkampf: die beiden Antipoden im zerfallenden Kapitalismus
- 1619 Aufrufe
Gegenwärtig werden in aller Deutlichkeit die Auswirkungen des Kapitalismus in seiner Dekadenz illustriert. Insbesondere verschärft die Krise seit 2008 die Ausformungen des Zerfalls des Kapitalismus.
Das Ausmaß der Krise reißt nun auch die kapitalistischen Kernländer Europas, Amerikas und Japans in das ökonomische Elend und verstärkt die hohe Arbeitslosigkeit (besonders unter der Jugend) zu einer allgemeinen Perspektivlosigkeit. Insbesondere in Spanien und Griechenland wehrt sich die Arbeiterklasse mit massenhaften Protesten – doch wir mussten lernen, dass dieser Funke noch nicht auf zentrale europäische Länder wie Frankreich und Deutschland übergesprungen ist. Auch in den USA regt sich vermehrt Widerstand gegen die fürchterlichen Angriffe, unter denen die Arbeiterklasse zu leiden hat. Die Kämpfe reichen vom öffentlichen Sektor (besonders sei an die Kämpfe an Wisconsin/USA erinnert) über die Hafenarbeiter bis hin zu der Occupy Wallstreet-Bewegung. Wir veröffentlichen in diesem Zusammenhang einen Artikel unserer amerikanischen Sektion zum Streik der Chicagoer LehrerInnen („Solidarität mit den Chicagoer LehrerInnen“).
Besonders hoffnungsfroh stimmen die Nachrichten über den sozialen Aufruhr auf dem afrikanischen Kontinent. Die Krise und die folgenden Massenproteste in Tunesien und Ägypten haben etliche Regimes in Nordafrika ins Taumeln gebracht. Die ganze arabische Region war und ist ein Tummelplatz im imperialistischen Gerangel der großen und kleinen Mächte, stark beeinträchtigt von verheerenden ideologischen Spaltungen. Und dennoch haben diese Massenproteste gezeigt, dass in Zeiten anschwellender Klassenkämpfe selbst waffenstarrende Regimes unversehens zu Papiertigern schrumpfen. Dabei sind die Massenproteste in Israel im letzten Jahr von ähnlicher Bedeutung wie die aktuellen Proteste in Westbank/Palästina; sie beweisen, dass die Arbeiterklasse Israels und Ägyptens immer weniger bereit ist, sich vor den Karren ihrer imperialistischen Ausbeuter spannen zu lassen. Besonders vor dem Hintergrund eines neuerlichen Krieges, der zwischen Israel und der Hamas drohte, als dieser Zeilen verfasst wurden, erscheint es uns als wichtig, den Kampf der palästinensischen ArbeiterInnen gegen die Autonomiebehörde eines Artikels zu würdigen („Massenproteste in der Westbank gegen hohe Lebenshaltungskosten, die Arbeitslosigkeit und die palästinensische Autonomiebehörde“). Seit einigen Monaten brennt nun auch auf der anderen Seite des afrikanischen Kontinents die Luft; weder brutale staatliche Repression noch gewerkschaftliche Spaltungsmanöver hat die südafrikanischen Bergarbeiter davon abhalten können, massenhaft in wilde Streiks zu treten („Die Streikwelle in Südafrika: Gegen den ANC und die Gewerkschaften“).
Es ist bezeichnend für die Epoche, in der wir leben, dass mit der offenkundigen Verschärfung des Klassenkampfes weltweit auch eine Eskalation der imperialistischen Spannungen einhergeht. Nichts spiegelt die Pattsituation zwischen den beiden historischen Klassen, zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat, besser wider als die „Koexistenz“ beider historischer Alternativen. Weder die Kapitalisten noch die ArbeiterInnen können ihren Kurs entscheidend durchsetzen. So gab es auch in Libyen anfangs soziale Proteste und die Hoffnung, das soziale Elend und die politische Enge abschütteln zu können. Doch war die Arbeiterklasse in Libyen weitaus schwächer als beispielsweise das ägyptische Proletariat und durch einen hohen Anteil an migrantischen Arbeiter/innen geprägt, die schnell durch eine ekelerregende Kampagne libyscher Nationalisten außer Landes vertrieben wurden. Das Resultat: Das Land wurde zum Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs und zum Spielball imperialistischer Ranküne. In dem Artikel „Ein Jahr nach der ‚Befreiung‘: Libyen versinkt im Chaos“ ziehen wir Bilanz. In Syrien fällt darüber hinaus noch viel mehr das Wirken von (regionalen) imperialistischen Mächten ins Gewicht. Neben den imperialistischen Big-Playern USA, China, Russland tummeln sich hier Frankreich, Saudi-Arabien ebenso wie die Türkei und der Iran. Der Artikel unserer türkischen Sektion „Die Türkei, Syrien und der Krieg“ beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, inwieweit die Kriegspropaganda der Herrschenden die türkische Arbeiterklasse in Mitleidenschaft gezogen hat.
Mit der Zuspitzung der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise werden die Zerfallserscheinungen des am lebendigen Leib verfaulenden Kapitalismus immer zerstörerischer. Neben dem aufflammenden Klassenkampf in aller Welt und dem verstärkten Suchen von proletarischen Minderheiten nach einem Ausweg aus dem Elend des Kapitalismus lauert in unmittelbarer Nachbarschaft die „Lösung“ des zerfallenden Kapitalismus: Bomben, Raketen, Drohnen und Massaker. Solange es den Ausgebeuteten nicht gelingt, ihre Kämpfe mit einer gesellschaftlichen Perspektive zu rüsten, wird der Kapitalismus ein gefährliches und gewalttätiges Hindernis für die Weiterentwicklung der Menschheit bleiben. 20.11.2012
Aktuelles und Laufendes:
- Krieg Klassenkamf [489]
Krise, imperialistische Spannungsfelder und die Schweizer Banken – Der Versuch einer Bestandsaufnahme
- 2099 Aufrufe
In letzter Zeit sind die Schweizer Banken stark unter Beschuss gekommen, weil sie Steuerflüchtlingen bisher Schutz gewährten. Deutschland und die USA stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Druck gegen die Schweiz auszuüben. Wieso ist das so?
Seit 1935 das Bankengesetz in der Schweiz eingeführt wurde, gibt es eine lange Reihe von politischen Anfeindungen und Auseinandersetzungen mit anderen Ländern. Das Bankengesetz war eine Folge der in allen entwickelten Industrieländern seit Anfangs des 20. Jahrhunderts einsetzenden staatskapitalistischen Entwicklung. Selbst in der im Vergleich zu ihren Nachbarn Ländern liberalen Schweiz war es notwendig geworden, den Staat schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg, insbesondere aber nach der Weltwirtschaftskrise von 1929 und der darauffolgenden Bankenkrise 1931 stärker als Regulativ und Kontrollorgan einzusetzen. Durch die Abhängigkeit vom deutschen Kapital traf die Krise einige zu dieser Zeit wichtige Banken, die vom Staat gestützt werden mussten (z.B. Schweizerische Volksbank). Robert U. Vogler, ein Historiker der eng mit der UBS und der Bankenwelt verbunden ist, erläutert in seiner Broschüre Das Schweizer Bankgeheimnis: Entstehung, Bedeutung, Mythos, dass das Bankgeheimnis als Teil des damaligen Bankengesetzes mehr ein Nebenprodukt dieser Situation gewesen sei, als das es explizit zur Anziehung fremdem Geldes ins Gesetz aufgenommen wurde. Wir wollen hier nicht weiter darauf eingehen, was der wirkliche Grund der Kodifizierung des Bankgeheimnisses war, sondern versuchen zu verstehen, warum gerade heute dieser Konflikt mit dieser Heftigkeit auftaucht.
Vom Gesichtspunkt des internationalen Proletariats ausgehend, spielt das Bankengeheimnis praktisch keine Rolle. Die deutsche Sozialdemokratie hatte 1918, nachdem sie von der deutschen Bourgeoisie im Anschluss an die Novemberrevolution 1918 als Schutzwall gegen die gegen den Kapitalismus anstürmende Arbeiterklasse eingesetzt worden war, eine verbalradikale Forderung nach kategorischer Aufhebung des damalig noch existierenden Bankgeheimnisses in Deutschland aufgestellt. Die nach 1918/19 eingeleiteten Massnahmen gegen die Steuerflucht und Kapitalverheimlichung haben aber das grundsätzliche Ausbeutungsverhältnis zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat nicht aufgehoben. So haben diese Massnahmen die Lage der Arbeiter_innenklasse um keinen Deut verbessert, vielmehr war es gerade die Sozialdemokratie in Deutschland, die die revolutionär gesinnte Arbeiterklasse mit grösster Brutalität niederschlug. Eine solche protektionistische Forderung, wie sie dann am konsequentesten in den 30er Jahren von den Nazis umgesetzt wurde, hatte überhaupt keinen Wert für das Proletariat und nährte nur die Illusion, dass es einen gerechten Kapitalismus geben könne. Wir sagen dies in aller Ausdrücklichkeit, weil gerade heute wieder die deutsche Sozialdemokratie an vorderster Front gegen das Bankgeheimnis steht, sehr wahrscheinlich um vergessen zu machen, dass gerade sie es war, die mit den Hartz4-Reformen die Bedingungen der Angestellten und Arbeiterinnen in Deutschland massiv verschlechtert hat. Ganz abgesehen davon, dass die heutige Sozialdemokratie solche Forderungen nur aufstellt, wenn sie gerade in der Opposition ist, um danach sich wieder genauso zu verhalten, wie es die vorherrschende Meinung in der jeweiligen nationalen Bourgeoisie erforderlich findet. Die markigen Sprüche eines Steinbrücks über das Entsenden der Kavallerie gegen die Schweiz oder erst kürzlich vom SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel ( „Was die machen, ist eine bandenmässige Steuerhinterziehung“), sind billige populistische Floskeln, um sich wieder bei dem von ihnen geschlagenen und geschundenen Proletariat einzuschmeicheln. Dazu kommt noch, dass eine solche Personifizierung allen kapitalistischen Übels auf die (Schweizer)Banken Vorschub für rechtsextreme Ideologen leistet, die dies dann (wie schon in den 30er-Jahren) dankbar aufgreifen und mit ihrer Sündenbocktheorie verwursten.
Natürlich geht es uns auch nicht darum, die Machenschaften der Schweizer Banken, gleichgültig ob legal oder illegal, zu verharmlosen. Im Gegenteil, das Bankensystem ist ein Teil des Kapitalismus und trägt somit bei, die Ausbeutung der Angestellten und Arbeiter ständig zu verschärfen. Mit der Spiegelung der deutschen und internationalen Propaganda um das Bankgeheimnis und den Banken versucht die Schweizer Bourgeoisie, die Arbeiter_innenklasse hinter die Banken und den Staat zu scharen. Neben dem ideologischen gibt es auch einen realen Hintergrund, der die Herrschenden in der Schweiz dazu veranlasst, ihren Finanzstandort vehement zu verteidigen. Die Schweizer Banken sind, gemessen an der Bevölkerungszahl aber vor allem auch an der Wirtschaftsleistung insgesamt, zu gross, um pleite zu gehen. Allein die UBS und die CS hatten noch 2011 ca. eine 6-fache Schuldenanhäufung, gemessen am Schweizer Bruttoinlandprodukt: „Besonders extrem ist es in der Schweiz, wo sich alleine die Schulden der UBS auf fast das Vierfache der dortigen Wirtschaftsleistung belaufen. Auch die Außenstände der Credit Suisse belaufen sich auf immerhin noch das Zweifache des schweizerischen BIP. Zusammen also mehr als das 6-fache des BSP“ (Die schweizerische Schuldenbombe, Artur Schmidt, 01.01.2011). Die Behauptung, der allgemeine Lebensstandard in der Schweiz sei so hoch, weil die Banken so erfolgreich und gross seien, ist natürlich ein Mythos. Die Arbeitsbedingungen in der Schweiz sind ausserordentlich hart, was sich an der Ausbeutungsrate zeigt (d.h. das was die Arbeiter_innenklasse über ihre unmittelbare Reproduktion hinaus an Mehrwert für das Kapital erzeugt). Die starke Ausbeutung der Arbeiter_innenklasse hat dazu geführt, dass der Industriestandort Schweiz trotzt verschiedener Krisen bis jetzt überlebt hat. Da es aber der Schweiz wie anderen Ländern auch an weiteren lukrativen Industriezweigen fehlt, wo die Bourgeosie ihr Geld investieren könnte, kommt neben der Gefahr, die der überdimensionierte Bankensektor darstellt, noch die Gefahr einer Immobilienblase hinzu. In den 90er Jahren konnte die Immobilienkrise durch einige grosse Banken, die die meisten krisenanfälligen Banken aufkauften, noch einmal zurückgestutzt werden. Es fand eine grosse Bankenkonzentration statt. Da 2007/2008 die Banken selber vom Staat gerettet werden mussten, ist eine solche Stabilisierungsaktion seitens der Banken heute undenkbar.
Seit einiger Zeit ist ein Umbruch in der schweizerischen Bankenlandschaft in Gang. Dieser Umbruch ist nicht freiwillig vonstattengegangen, sondern findet unter stetig erhöhtem Druck der grösseren kapitalistischen Haifische statt.
Seit der sog. Finanzkrise 2007 ist festzustellen, dass die verschiedenen Länder darauf bedacht sind, die Steuerflucht besser in den Griff zu bekommen. Gegenseitig werfen sich die Schweiz und die sie attackierenden Länder wie die USA, Deutschland, Frankreich, Italien usw. illegale Praktiken vor.
Beispielsweise gab die französische Ex-Finanzministerin und heutige Chefin des IWF, Lagarde. eine Liste über steuerhinterziehende Millionäre an Griechenland weiter, aus der deutlich wurde, dass ein beträchtlicher Teil dieser Gelder in der Schweiz geparkt wurde. Pikantes Detail: die damals regierenden Sozialdemokraten haben diese Liste nie gegen ihre Steuersünder verwendet. Die verschiedenen Skandale um die illegal erworbenen CD’s mit Informationen über Steuersünder aus Deutschland und Frankreich sind hinlänglich bekannt. Das ist im Übrigen auch keine neue Praxis dieser Länder. Schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts operieren diese und andere Länder mit geheimdienstlicher Informationsbeschaffung gegen die Banken. Neu ist, dass seit dem Zusammenbruch des Ostblocks die Toleranz gegenüber den Praktiken der Schweizer Banken gesunken ist. So drohen die USA immer wieder mit einem Ausschluss der sich nach ihren Gesetzen strafbar machenden Schweizer Banken aus dem US-Finanzmarkt, wenn diese nicht die Informationen über Steuerflüchtlinge an die US-Justizbehörden weitergeben. Die Reaktion der herrschenden Klasse in der Schweiz war diesmal prompt: Anders als in der Vergangenheit gewährte sie den USA Einsicht in verdächtige Akten, was faktisch eine Beugung der herrschenden Rechtsprechung in der Schweiz ist und einer Aufweichung des Bankgeheimnisses gleichkommt. Auch Deutschland lässt nicht locker; am 23. November wurde das bilaterale Steuerabkommen, das der deutsche Finanzminister Schäuble mit der Schweizer Regierung ausgehandelt hatte, vom deutschen Bundesrat, der Länderkammer, mehrheitlich abgelehnt. All diese Angriffe deuten darauf hin, dass die Schweiz, die während der Ost/West-Blockkonfrontation einen gewissen Freiraum genoss, in der aktuellen Situation parieren muss, wenn sie nicht mit ernsteren Konsequenzen rechnen will.
Die UBS hat das heute schon begriffen; nur so lässt sich erklären, warum der neue Konzernchef Ermotti in verschiedenen Interviews gesagt hat, dass das Bankgeheimnis in der Schweiz keine Zukunft mehr hat.
Letztlich sind die Stabilität und der gute Ruf das wichtigere Merkmal für gute Bankgeschäfte. Durch die Eurokrise hat die Schweiz wieder an Attraktivität gewonnen. Nach Presseangaben verliert die Schweiz bis 2014 ca. 200 Milliarden Euro. Es werden aber schon wieder neue Bankgeschäfte und Steuereinnahmen generiert, beispielsweise durch die internationalen Rohstoffkonzerne oder Coca Cola, die vom niedrigen Steuersatz angelockt werden.
Diese ganze Entwicklung ist aber höchst fragwürdig, da die für das kleine Land Schweiz viel zu grossen Banken im Falle einer künftigen Banken- oder Finanzkrise arg gebeutelt werden. Zusätzlich kommt die Hypothekenblase, die den Finanzsektor noch mehr aufbläst und fragilisiert. Letztlich ist für die Schweiz auch das ständige Aufkaufen von Fremd- vor allem Eurowährung, damit der Frankenkurs nicht ständig steigt, eine Zeitbombe. Wie die USA druckt sie einfach Geld, aber der Unterschied ist, dass der Franken keine Weltwährung ist und die Schweiz daher bei einer Verschärfung der Krise eines der am meisten gefährdeten Länder ist. Dass sie trotzdem noch so ein hohes Ansehen in Industrie- und Finanzkreisen geniesst, ist schwer verständlich und langfristig gesehen ziemlich irrational. Das ist aber eine weitere Tendenz, die der Kapitalismus immer stärker an die Oberfläche bringt. Die Irrationalität, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit staatskapitalistischen Massnahmen eingedämmt werden sollte, hat zu zwei Weltkriegen und einer fast 50-jährigen Ost/West-Blockkonfrontation geführt. Der weitere Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft manifestiert sich auch durch ständig verschärfende Wirtschaftskriege, wie sie jetzt mit dieser Anekdote um das Bankgeheimnis auftritt. Zu vermuten ist aber, dass es nicht bei so einem relativ harmlosen Wirtschaftskrieg bleiben wird.
Die Arbeiterklasse sollte sich nicht hinter die jeweiligen ideologischen Konstrukte - hier die „gierigen Schweizer Banken“, dort die „arroganten Amerikaner und Deutschen“ - stellen. Dies sind nur die jeweiligen Ideologien, welche die herrschenden Klassen eines jeden Landes vorbringt, um die wahren Ursachen der Krise zu verschleiern. Die eigenen Interessen als ausgebeutete Klasse wahrzunehmen heisst, den Klassenkampf gegen die gesamte Bourgeoisie, gegen dieses marode und immer irrationaler werdende System führen.
Aktuelles und Laufendes:
- Krise [490]
- Banken Schweiz [491]
Patriot-Stationierung: Der deutsche Imperialismus mischt mit
- 1866 Aufrufe
Seit dem Ende der Ost-West-Konfrontation versucht die Türkei systematisch ihre Vormachtstellung im Nahen und Mittleren Osten auszubauen. Gegenüber den Ländern des „arabischen Frühlings“ ist Ankara bestrebt, als „säkulare“, „moderne“, „demokratische“, wirtschaftlich erfolgreiche (islamische) Macht eine Führungsrolle zu übernehmen. Dies treibt die Türkei notwendigerweise in einen Konflikt mit Israel, mit dem sie zuvor als Verbündeter der USA intensiv militärisch zusammengearbeitet hatte. Auch die Hamas lobte im jüngsten Konflikt mit Israel die Unterstützung durch die Türkei. Die Türkei hat gegenüber dem Assad-Regime in Syrien eine große Kehrtwende vollzogen. Nach anfänglich engen Beziehungen - insbesondere zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und dem Assad-Clan - trat die Türkei kurz nach Beginn der Kämpfe als Schutzherr der syrischen Zivilbevölkerung auf. Tatsache ist, dass die Türkei ein Großteil der auf mehr als Hunderttausend angewachsenen Zahl syrischer Flüchtlinge, die entweder schon aus Syrien geflüchtet sind oder versuchen in die Türkei zu gelangen, entweder in Flüchtlingslagern festsetzt oder sie durch verstärkte Kontrollen im Grenzgebiet auf syrischem Gebiet selbst zurückhält. Und welch große „Schutzmacht“ die Türkei für die kurdische Bevölkerung ist, hat sie jahrelang unter Beweis gestellt. In Wirklichkeit hofft die Türkei, im Falle eines Sturzes des Assad-Regimes und eines eventuellen Auseinanderbrechens Syriens ein Beutestück aus syrischem Territorium herausreißen zu können.
Nachdem sich die syrische Opposition Mitte November neu formiert und eine Exilregierung ernannte hatte, die ihr Hauptquartier in Nordsyrien errichten möchte, deutet sich eine Intensivierung der Kampfhandlungen entlang der syrisch-türkischen Grenze an. Bislang verfügt die syrische Luftwaffe noch über die Lufthoheit im Grenzgebiet. Flugverbotszonen würden das Assad-Regime entscheidend schwächen. Diese Flugverbotszonen werden vom türkischen und amerikanischen Militär im Augenblick als eine wichtige Stufe in der Militärstrategie der Assad-Gegner vorbereitet. Die Durchsetzung solcher Flugverbotszonen ist aber nur mit entsprechend hochentwickelten NATO-Waffen denkbar. „Patriot"-Radaranlagen würden es ermöglichen, syrische Hubschrauber und Kampfflieger zu erfassen. Unter den NATO-Mitgliedsländern besitzen nur die USA, die Niederlande und Deutschland solche Waffensysteme.
Die Stationierung von "Patriot"-Raketen wäre auch deshalb von besonderer Brisanz, weil die PKK im Windschatten des Syrienkrieges ihre separatistischen Aktivitäten ausgeweitet hat. Das Assad-Regime hat die kurdischen Nationalisten im Norden Syriens längst nicht mehr im Griff. Weil PKK-nahe Kräfte im Norden Syriens nahe der Grenze zur Türkei die Zügel an sich gerissen haben, muss Ankara ein weiteres Anwachsen des kurdischen Separatismus und damit eine Destabilisierung im türkischen Grenzgebiet zu Syrien durch kurdische Nationalisten fürchten. Seitdem legt das türkische Militär wieder eine härtere Gangart gegenüber der PKK an den Tag. Die entlang der syrisch-türkischen Grenze von Ankara gewünschten Patriot-Raketen wären somit im Kampfgebiet zwischen PKK und Ankara stationiert.
Auch wenn die Türkei sich nun als Opfer syrischer Raketen- und Granatenangriffe darstellt, ist Ankara selbst längst zum Kriegstreiber in der Region geworden. Die zu erwartende Eskalation in der Region – sowohl im Konflikt mit Syrien als auch mit den Kurden – bekommt mit der türkischen Anforderung von NATO-Truppen eine neue Dimension.
Dass dabei Deutschland und seine High-Tech-Waffen eine neue Rolle übernehmen soll, ist keineswegs verwunderlich. Zum einen ist Deutschland im Mittelmeerraum insgesamt, insbesondere aber im südöstlichen Mittelmeer gegenüber Griechenland mit all seinen finanziellen und wirtschaftlichen Druckmitteln schon längst zur Ordnungsmacht aufgestiegen. Militärisch würde Deutschland mit dem Einsatz der Patriot-Waffen eine weitere Stufe in der imperialistischen Hierarchie erklimmen.
Des Weiteren steht dieser Schritt in Kontinuität mit der vom deutschen Imperialismus seit den 1990er Jahren systematisch eingeleiteten Wende. Mit der Beteiligung der Bundeswehr im Balkankrieg und der Bombardierung Serbiens hatte Rot-Grün kurz nach ihrer Machtübernahme 1999 schon ein historisches Kapitel beendet. Die deutsche „Isolation“, d.h. Nichtbeteiligung an wichtigen Kriegseinsätzen der Nato, war überwunden worden. Und seitdem mischt die Bundeswehr in unterschiedlicher Stärke bei nahezu jedem Konflikt weltweit mit. In Afghanistan hat die Bundeswehr das zweitgrößte Kontingent nach den USA stationiert. Am Horn von Afrika beteiligt man sich auf hoher See und unterstützt auch in den Küstengebieten die Jagd auf Piraten. Vor der libanesischen Küste sind Horchboote der Marine im Einsatz. Im Kosovo sind weitere Truppen stationiert. Und was Mali angeht, so soll nun auch deutsches Militär „Hilfe“ bei dem Versuch leisten, diesen auseinanderbrechenden Staat zu stabilisieren. Im jüngsten Konflikt zwischen Israel und Hamas konnte Deutschland seine besondere „Verantwortung“ gegenüber Israel in die Waagschale werfen. Deutschland hat zudem Israel die für einen Militärschlag gegen den Iran wichtigen U-Boote geliefert. Bereits 1991, im ersten Golfkrieg, hat die Bundeswehr Israel Patriot-Batterien ausgeliehen, um damit irakische „Scud“-Raketen abzufangen. Aufgrund seiner besonders guten Beziehungen zu Israel und den palästinensischen Behörden versuchte der deutsche Außenminister Westerwelle, sich als Vermittler zu profilieren.
Beim Militäreinsatz westlicher und anderer Staaten unter US-Führung in Libyen vor mehr als einem Jahr hatte sich Deutschland aus taktischen Gründen nicht beteiligt. Erstens ist Libyen strategisch nicht so wichtig wie die viel bedeutsamere Region des Nahen und Mittleren Ostens. Zweitens hätte man sich im Libyen-Feldzug der westlichen Mächte angesichts der militärischen Schwäche der Bundeswehr dem Kommando insbesondere der USA, Frankreichs und Großbritanniens unterwerfen müssen. Dies hätte zu einem Gesichtsverlust des deutschen Imperialismus geführt. Im Fall des jetzt angeforderten Einsatzes von Patriot-Batterien kann man sich auf die Nato-Strukturen berufen, in denen natürlich die USA eine führende Rolle spielen und auch der türkische Präsident Erdogan das Oberkommando über die Bundeswehrtruppen beansprucht. Für die strategischen Planer des deutschen Militärs geht es darum, ihr Operationsgebiet auszudehnen und wichtige Erfahrungen in solchen Kampfeinsätzen zu sammeln. Da die Assad-Regierung zur Zeit besonders entschlossen von dem Putin-Regime unterstützt wird, geht man mit dem Einsatz von deutschen Soldaten in der Türkei zwar ein weiteres besonderes Wagnis ein, werden sich doch die Reibereien mit dem heftig Widerstand leistenden russischen Imperialismus verstärken. Dabei ist Deutschland im Vergleich zu anderen westlichen Staaten das Land, das beste, ja besonders privilegierte Beziehungen zu Russland unterhält. Aber die gesamte Gemengelage im Nahen und Mittleren Osten lässt es aus der Sicht des deutschen Imperialismus nicht zu, den anderen Rivalen wie den USA, Frankreich oder GB das Feld zu überlassen. Dass der Einsatz von Patriot-Batterien aber nur eine Stufe zu einer weiteren Eskalation ist, verschweigt das deutsche Kapital tunlichst. Di. 23.11.12
Aktuelles und Laufendes:
- Patriot-Stationierung [492]
„Supersturm“ Sandy: Der Zorn von Mutter Natur oder die Irrationalität der herrschenden Klasse?
- 1511 Aufrufe
Die Vorbereitungen vor dem Sturm: Die Bourgeoisie ist untauglich zum Herrschen
Seit der Krise, die von der Reaktion auf den Wirbelsturm Katrina 2005 ausgelöst wurde, hatte sich die herrschende Klasse entschlossen, das Image ihres Staates wieder aufzupolieren. Bei dem Versuch, das Vertrauen der Massen in ihren Apparat wiederherzustellen, muss sie die Idee eines Staates entwerfen, der in der Lage ist, das Wohlergehen seiner Bevölkerung sicherzustellen.
Doch schon eine schnellere und bessere Kommunikation zwischen den vielen Behörden, die damit beauftragt waren, vor den potenziellen Gefahren eines Sturmes zu warnen, ist eine Aufgabe, die den kapitalistischen Staat offensichtlich vor unüberwindliche Hindernissen stellt. Laut Bryan Norcross, einem hoch geachteten Meteorologen, machte die Nationale Ozeanische und Atmosphärische Administration (NOAA) „hervorragende Vorhersagen. Ihre Vorhersagen über die Windstärke waren im Grunde genommen perfekt, und ihre Sturmflutvorhersage für New York City war so gut, wie sie dieser Tage nur sein kann.“ In der Tat können bereits eine Woche, bevor sie aufs Land treffen, ziemlich genaue Vorhersagen über potenziell zerstörerische Stürme gemacht werden. Doch das National Hurricane Center entschied sich, erst einen Tag vor seinem Eintreffen auf Land eine Sturmwarnung zum Wirbelsturm Sandy herauszugeben, weil es Informationen erhalten hatte, wonach der Sturm seinen Kurs ändern und sich zu einem tropischen Sturm abschwächen könnte. Als klar wurde, dass der Sturm nicht seinen Kurs ändert und sich auch nicht abschwächt, gab es für die Menschen nicht genug Zeit, um sich entsprechend vorzubereiten. In Anbetracht des Ausmaßes des Sturms und der Tatsache, dass er sich in Richtung des am dichtesten bevölkerten Landesteil zubewegte, war es auf Seiten der Behörden und Obrigkeiten nicht wirklich vernünftig zu entscheiden, die Sturmwarnung nicht früher herauszugeben.
Jedoch kann die Entscheidung, erst einen Tag vor dem Eintreffen des Sturms eine Warnung herauszugeben, nicht allein mit der verknöcherten Bürokratie erklärt werden. Es öffnet auch den Blick auf die ruinierte Infrastruktur der kapitalistischen Metropolen und wirft die Frage auf, welche Lösung, falls überhaupt, die Herrschenden haben, um mit solchen Stürmen in Zukunft fertig zu werden. Es scheint unter den gegenwärtigen Bedingungen der urbanen „Entwicklung“ im Kapitalismus aus mehreren Gründen unmöglich, einen vernünftigen Schutz und einen Flächenevakuierungsplan zu organisieren: 1. die schiere Anzahl von Menschen, die in diesen Gebieten leben; 2. der Mangel an einer Infrastruktur, die für die Evakuierung und Unterbringung der Menschen nach einem solchen Sturm erforderlich ist; 3. die Zerstörung der natürlichen Umwelt und die fortgesetzte Verstädterung in Gebieten, die für die Besiedelung ungeeignet sind; 4. die Verausgabung finanzieller, humaner, technologischer Ressourcen für militärische Zwecke.
Nun wo Supersturm Sandy wütete und jedermann realisierte, wie verwundbar die City und Millionen ihrer Einwohner sind, beginnt die unvermeidliche Kakophonie darüber, was in Zukunft zu tun ist, von neuem. Einige dieser Vorschläge sind ziemlich interessant und kreativ. Sie zeigen, dass die Menschheit auf der technologischen und wissenschaftlichen Ebene die potenzielle Fähigkeit entwickelt hat, die Wissenschaft in den Dienst der menschlichen Bedürfnisse zu stellen. Rund um St. Petersburg in Russland, Providence, Rhode Island und an der niederländischen Küste sind Sturmflutwehren gebaut worden. Das technologische Know-how ist vorhanden. Auch was die geographischen Besonderheiten von New York City anbetrifft, ist es nicht unmöglich, dass eine technologische Lösung gefunden wird. Doch angesichts der Realität der Wirtschaftskrise ist es nicht an den Haaren herbeigezogen, wenn man davon ausgeht, dass New York City eher auf das ausweichen wird, was die Ingenieurswissenschaft „Resilienz“ nennt, ein System, das kleinteilige Interventionen vorsieht, wie die Einrichtung von Schleusentoren an Kläranlagen und die Anhebung des Bodenniveaus in bestimmten Gebieten von Queens. In Anbetracht dass New York City ist Multimillionen-Stadt ist, die Teile der Weltwirtschaft am Laufen hält und deren Infrastruktur sehr komplex, alt und umfangreich ist, widersprechen kleine Eingriffe dieser Art jedoch dem gesunden Menschenverstand.
Die Folgen des Sturms: Wir sind auf uns gestellt
Präsident Obama erblickte im Wirbelsturm Sandy eine Gelegenheit, den Disput zwischen dem konservativen und dem liberaleren Flügel der herrschenden Klasse über die Rolle der Regierung neu aufzuwärmen. Es ist behauptet worden, dass die Reaktion der gegenwärtigen Administration wirksamer gewesen sei als die Reaktion der Bush-Administration im Anschluss an den Wirbelsturm Katrina. Die Bilder vom Convention Center in New Orleans, wo Tausende tagelang gestrandet waren und wo die entsetzlichsten Bedingungen geherrscht hatten, sind den Bildern von der Nationalgarde gegenübergestellt worden, die einen Tag nach dem Sturm in Hoboken, New Jersey, eintraf, um Nahrungsmittel und Wasser zu verteilen und gestrandete Anwohner zu bergen. Die Botschaft war klar: Die Regierung ist da, um den Menschen in Not zu helfen, und kann einen besseren Job verrichten, wenn Demokraten am Ruder sind.
Doch jeder kann die Nachrichten lesen, um sich ein Bild von den katastrophalen Bedingungen zu machen, unter denen Hunderttausende von Menschen noch zwei Wochen nach dem Sturm hausen. Von der Wiedereröffnung der Schulen, die als Schutzräume dienen, über die Stromengpässe in ganzen Landstrichen bis hin zur Rationierung von Treibstoff – die Tatsachen zeigen, dass die herrschende Klasse und ihr überbordender bürokratischer Staatsapparat in eine Sackgasse gelandet sind und unfähig sind, sich effizient und sinnvoll den dringenden und langfristigen Bedürfnissen der Bevölkerung zuzuwenden.
Aber wir schließen daraus nicht, wie es die rechten Konservativen tun, die Regierung durch Wohltätigkeiten zu ersetzen und die Menschen zu veranlassen, für die schlechten Tage zu sparen. Dies würde die Massen an die Launen der herrschenden Klasse ketten, indem sie entweder vom Großmut philanthropischer und religiöser Organisationen oder vom Schwanken des kapitalistischen Marktes zwischen Zeiten der Vollbeschäftigung und der Arbeitslosigkeit abhängig gemacht werden. Dies trägt nicht zur Hebung des Bewusstseins der ausgebeuteten Massen aus der Resignation gegenüber dem Ausbeutungssystem bei, dem sie unterworfen sind, da es keinen Unterschied macht, ob wir direkt vom Staat oder vom Markt oder vom einzelnen Kapitalisten, der durchaus auch ein Philanthrop sein kann, unterdrückt und ausgebeutet werden. Was unserer Auffassung nötig ist, ist die revolutionäre und autonome Aktion der Massen mit dem Ziel, die politische Macht zu ergreifen. Dies ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass all wichtigen Entscheidungen im Interesse dessen getroffen werden, was getan werden muss, um die Ressourcen der Gesellschaft für die eigenen Bedürfnisse der Gesellschaft zu schaffen, zu verwalten, auszuliefern und zu verteilen, und nicht für die Bedürfnisse des Profits, des Kapitals, der Regierung oder der Philanthropen.
Es ist die Bevölkerung, die – wahrscheinlich gewitzt aus den Erfahrungen der jüngsten klimatischen Ereignisse, dass die herrschende Klasse und ihre vielfältigen Behörden, wie die FEMA, nicht helfen bzw. nicht genug oder schnell genug helfen – ihre Ressourcen, ihre Zeit, ihr Geld zur Verfügung stellt. Dies zeigt das fundamentale und bedeutende Gespür für die Identität, die unter den Ausgebeuteten existiert, und dass es sie sind, die das Potenzial besitzen, eine neue Welt zu schaffen.
Ana, 10. November 2012
Aktuelles und Laufendes:
- Sturm Sandy [493]
Weltrevolution - 2013
- 1896 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 176
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 3.87 MB |
- 2173 Aufrufe
"Debattenwerkstatt": Nichts ist praktischer als eine gute Theorie
- 2452 Aufrufe
Wir haben eine Einladung zur Teilnahme an einer „Werkstatt für empörte Beschäftigte“ erhalten, die von der Asamblearios-TIA () veranstaltet wird. Wir unterstützen und beteiligen uns aktiv an dieser Initiative.
Wir sind der Ansicht, dass solche Werkstätten einem wirklichen Interesse an der Klärung von wesentlichen Fragen des politischen Verständnisses des Kapitalismus und der Suche nach Alternativen zu demselben dienen. Von den konkreten und unmittelbaren Kämpfen ausgehend haben die GenossInnen die Schlussfolgerung gezogen, dass es notwendig ist, die Wirklichkeit tiefgreifend zu verstehen, um die revolutionäre Theorie zu verstärken. Wir unterstützen diese Initiative enthusiastisch, weil damit eine Gelegenheit zu Diskussionen geschaffen wird, in denen wir alle die Wirklichkeit genauer erfassen und über Mittel diskutieren können, diese umzuwälzen.
Natürlich verfügen wir über kein Rezept und keine magische Formel, um die aufgeworfenen Fragen zu lösen. Aber wir sind davon überzeugt, dass es notwendig ist, in den Kämpfen zu intervenieren. Dabei müssen wir uns auf ein tieferes Verständnis stützen, auch um nicht in die Fallen des Gegners zu laufen und um Demoralisierung und Frustration zu vermeiden.
Was ein wundervolles Spinnennetz von der Arbeit eines Architekten unterscheidet, ist die Tatsache, dass der Mensch, bevor er solch ein Projekt erstellt, einen Plan in seinem Gehirn und die Mittel zur Umsetzung dieses Plans entwickelt.
Diese Fähigkeit, gemeinsam ein Ziel zu verfolgen oder ein Vorhaben anzupacken, das sich auf unser Verständnis der Realität stützt, ist das, was man „Theorie“ nennt. Die Theorie hat wesentlich zur Entwicklung der Menschheit mit beigetragen. Ohne die Fähigkeit zur Analyse, Schlussfolgerungen zu ziehen und in Übereinstimmung mit unseren Notwendigkeiten und den angestrebten Zielen zu handeln, würden wir sicherlich weiterhin in primitiven Jäger- und Sammlergesellschaften leben.
Die Theorie ist keinesfalls – und aus der Sicht der Arbeiterklasse noch weniger – das Ergebnis eines abstrakten Denkprozesses, der von der Praxis oder den unmittelbaren Bedürfnissen losgelöst ist. Die Theorie ist im Gegenteil Bestandteil derselben Praxis der Revolutionäre. Ohne Theorie kann es keine revolutionäre Praxis geben.
Der Kapitalismus ist die Gesellschaft, in der sich die Warenwirtschaft ausgebreitet hat, in welcher der Tauschwert in Geld verwandelt wurde, das die menschlichen Beziehungen bestimmt, auch im Bereich der Gefühle und Emotionen. Infolgedessen entspricht die gesellschaftliche Produktion den Notwendigkeiten der Warengesellschaft, anstatt die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, so dass diese materielle Wirklichkeit der Produktion eine herrschende Ideologie bestimmt, die als „gesunder Menschenverstand“ betrachtet wird. Jegliche Infragestellung der kapitalistischen Gesellschaft erfordert die Untersuchung und Kritik des herrschenden „gesunden Menschenverstandes“, der in Wirklichkeit nichts anderes als der Versuch der herrschenden Klasse ist, eine Denkweise aufzuzwingen, die den Anschein erweckt, eine „natürliche“ und die einzig mögliche und gültige zu sein. Ohne einen gründlichen Denkprozess ist diese Infragestellung des Kapitals nicht möglich.
Aber die „Theorie“ ist auch nicht das Werk von begnadeten Genies oder eines dogmatischen Katechismus. Im Gegenteil, die revolutionäre Theorie kann nur das kollektive und historische Werk einer ausgebeuteten Klasse sein, die in ihrem Wesen schon Trägerin einer zukünftigen, ausbeutungsfreien Gesellschaft ist. Diese theoretische Erarbeitung kann nur das Werk einer gemeinsamen Kultur des Nachdenkens und der Debatte sein, die dazu in der Lage ist, den „gesunden Menschenverstand“ der herrschenden Klasse in Frage zu stellen und eine Theorie zu erarbeiten, die uns ermöglicht, mit der Ausbeutung der Mehrheit durch eine Minderheit aufzuräumen.
Die Bewegung des 15M (15.Mai 2011) war eine spontane Bewegung, die die Unzufriedenheit und die Empörung der Ausgebeuteten zum Ausdruck brachte; zudem hob sie die Notwendigkeit, den Kampf massiv zu führen, auf eine neue Stufe. Nach dem 15M und ähnlichen Ausdrücken in anderen Ländern sind Gruppen entstanden, die sich der Notwendigkeit bewusst sind, dass man tiefergehend nachdenken muss Die Praxis hat es schon bewiesen: Wenn es an Theorie mangelt, kann man leicht in die Fallen laufen, die der Staatsapparat aufstellt, um uns dazu bewegen, uns für die Interessen des Feindes zu opfern. Diese kleinen Gruppen sind sich bewusst, dass der revolutionäre Kampf eine „theoretische Dimension“ erfordert; es entstehen Diskussionsforen, auf denen diskutiert wird, wie und wofür wir kämpfen. Solche Fragen zu stellen ist eine Notwendigkeit der revolutionären Praxis.
Wie die Asembalearios-TIA schreiben, ist die Selbstorganisierung der Beschäftigten der einzige Weg, um unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Die Systematisierung der Diskussionen, in denen wir alle die politischen Fragen des Kampfes zu klären versuchen, ist die Form der notwendigen Selbstorganisierung in diesen Zeiten der „latenten“ Kämpfe.
Die Krise des Kapitalismus zeigt zum einen auf, wie wir immer mehr in Armut, Barbarei und Zerstörung des Planeten abrutschen, zum anderen wird die Schwierigkeit ersichtlich, eine alternative Gesellschaft zu errichten, in der all die Widersprüche des kapitalistischen Systems überwunden sind. Die Herausforderung ist sehr groß. Deshalb ist es unverzichtbar, dem Kampf eine historische und internationale Perspektive zu verleihen, wodurch wir die Mittel und unser Ziel in der Tiefe begreifen können. Die Schaffung von wirklichen Diskussionsräumen und Orten des Nachdenkens ist die Aufgabe der Stunde für die zukünftigen KämpferInnen. Wir ermutigen die Minderheiten, die überall auf der Welt entstehen, dass sie diese Diskussionsräume und Orte des Nachdenkens schaffen und sich die revolutionäre Theorie aneignen, die unerlässlich ist für die Überwindung des Kapitalismus und die Errichtung einer neuen Gesellschaft.
Nachfolgend stellen wir den Aufruf der GenossInnen vor, wir für einen Liste von Literaturvorschlägen hinzu. Wir wünschen eine fruchtbare Debatte! IKS 27.12.2012
Werkstätten für empörte Beschäftigte
Alles, was ihr schon immer über den Arbeiterkampf diskutieren wolltet,
aber nie gewagt habt zu tun.
Alicante 2013
Wer sind wir?
Wir sind Beschäftigte, Arbeitslose, StudentInnen... wie du. Menschen, die unter diesem Ausbeutungssystem leiden. Wir haben uns in einer Gruppe organisiert, die sowohl handeln als auch diskutieren möchte. Unsere Gruppe nennt sich „Asamblearias-TIA“ (Empörte und selbstorganisierte Beschäftigte).
Was steckt hinter den Werkstätten?
Mit den Werkstätten, die wir organisieren werden, wollen wir einen Ort des Nachdenkens und des Zusammenkommens schaffen, in denen wir unsere Erfahrung, unser Wissen austauschen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen, wo wir aufgrund der tagtäglichen Angriffe des Kapitals in die Enge getrieben werden, halten wir die Schaffung von Orten des Nachdenkens für nötig, die dazu dienen, besser voranzukommen bei der Umsetzung unserer Ziele.
Welche Ziele verfolgen wir?
Es war immer unser Anliegen, die Analyse zu vertiefen und unsere Wirklichkeit mit der geschichtlichen Erfahrung der Bewegung der Ausgebeuteten zu verbinden. Wir glauben an die Notwendigkeit theoretischer, historischer Anstrengungen als eine Waffe, um die Welt zu ändern; eine Waffe, die uns aus den Händen gerissen und in die Hände unseres „Feindes“ gelegt wurde. Diese Werkstätten sollen einen Beitrag in diesem Sinne leisten. Ihr Inhalt und ihre Form drehen sich um die Bewegung der Leute von „Unten“; sie gehen von dieser Bewegung aus und beteiligen sich an ihr. Es geht nicht um irgendwelche Vorlesungen, die irgendein schlauer Professor hält, sondern es geht darum, die Geschichte und eine Theorie zu ergründen, um die Welt zu verändern. Nicht mehr und nicht weniger.
Hinsichtlich des Inhaltes und der Methode wollen wir uns bemühen, die Sachen tiefer zu verstehen; wir wollen zu Aktionen anregen, die sich auf einen Denkprozess stützen, und wir wollen unsere Geschichte und unsere Sprache wiederentdecken. Wir sind ambitiös, weil wir wissen, dass wir obwohl zahlenmäßig wenig, nicht alleine dastehen. Wir wissen, dass wir viele sind in den Reihen dieser „gewaltigen Mehrheit, die eine gewaltige Mehrheit repräsentiert.“
Wie werden wir vorgehen?
Wir wollen uns um Jahre 2013 monatlich zu den Werkstätten treffen, mit Ausnahme der Monate Juli und August. Die vorgeschlagene Methode setzt die Beteiligung der Teilnehmer voraus, womit wir sicherstellen wollen, dass alle Standpunkte mit eingebracht werden können. Wir werden an die Teilnehmer zum entsprechenden Thema Vorbereitungstexte schicken; wir wollen jeweils Einleitungen zum Thema machen, die auf die Vorbereitungstexte eingehen. Dann wollen wir in die Debatte einsteigen.
In der Debatte werden wir auf Begriffe und Wörter stoßen, von denen wir ein Glossar erstellen wollen. Das Glossar wird all diese Begriffe definieren, die uns für die Debatte wichtig erscheinen; dabei wollen wir auf alle möglichen Bedeutungen eingehen.
Worüber wollen wir reden und wann?
- 11.Januar: „Vorstellung der Werkstätten“
- 25. Januar: „Was ist eine Krise und wie dagegen kämpfen?
- 15. Februar: „Der Klassenkampf“
- 15. März: „Selbstorganisierung und Arbeiterautonomie“
- 12. April: „Internationalismus“
- 17. Mai: „Soziale Revolution“
- 14. Juni: „Was meinen wir mit Nationalismus?“
- 20. September: „Demokratie und Befreiung“
- 18. Oktober: „Selbstverwaltung“
-15. November „Syndikalismus“
-13. Dezember: „Parlamentarismus“
Wie kannst du dich beteiligen und wo finden die Werkstätten statt?
Um teilzunehmen, melde dich an unter: [email protected] [495]
Schicke uns deinen Namen, die Werkstätten, an denen du dich beteiligen willst (eine, mehrere, alle) und eine Kontakt-Mailadresse. Wir werden mit allen TeilnehmerInnen eine Einführungsveranstaltung machen, um uns zu organisieren und kennenzulernen. Sie findet am 11. Januar in den Räumen des ASIA statt.
Muss man etwas zahlen?
Um den Raum (und die dort stattfindenden Aktivitäten) zu finanzieren, müssen wir fünf Euro Teilnehmerkosten erheben. Um es deutlich zu sagen, alle eingesammelten Gelder werden für die Selbstverwaltung des ASIA verwendet (Selbstverwaltete ganzheitliche medizinische Hilfe). Wir warten auf Euch. Für weitere Kontaktaufnahmen: [email protected] [495]
Eine Übersicht über die Werkstätten
11. Januar: „Vorstellung der Werkstätten“
Wir verschaffen uns einen Überblick und teilen uns die Themen auf, besprechen Methode und Inhalt, gehen auf Vorschläge und mögliche Änderungsvorschläge ein. Wir wollen auch über die Themenauswahl und die Namensbezeichnung reden.
25. Januar: „Was ist eine Krise und wie kämpft man dagegen?“
Was ist eine Krise? Ist sie Wesensbestandteil des Kapitalismus? Welche Theorien über die Krise gibt es? „Krise“ ist der am häufigsten verwendete Begriff, die Krise rechtfertigt alles. Der Kapitalismus scheint in der Krise zu stecken. Handelt es sich um eine Niedergangskrise? Wenn dies der Fall ist, erfordert dies, auf eine revolutionäre Umwälzung als einziger Ausweg für die Menschheit hinzuarbeiten?
15. Februar: „Der Klassenkampf“
Was ist Klassenkampf? Gibt es ihn heute noch? Ist der Kampf „zentral“, der Dreh- und Angelpunkt? Was versteht man unter Arbeiterklasse? Warum sprechen wir von Klasse? Sind nur Beschäftigte im „Blaumann“ ArbeiterInnen? Gegenüber dem angeblich „modernen“ Staatsbürger als gesellschaftliche Kraft wollen wir auf das historische Subjekt par excellence zurückkommen: die Arbeiterklasse, das Proletariat, die Ausgebeuteten.
15. März: „Selbstorganisierung und Arbeiterautonomie“
Was ist Selbstorganisierung? Warum ist sie so notwendig? Wie können wir sie erreichen? An wen müssen wir uns wenden? Wir bestehen auf der Selbstorganisierung der Versammlungen, auf der Autonomie der Arbeiterklasse. Die Geschichte zeigt uns, dass Selbstorganisierung und Autonomie wesentliche Bestandteile für die Entwicklung der Arbeiterbewegung waren. „Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein“ (Marx und Engels, MEW 19, S. 165, 1879).
12. April: „Internationalismus“
Was ist Internationalismus? Kann es einen Internationalismus geben, der kein proletarischer ist? Warum ist er für die Arbeiterbewegung so grundlegend? Wie hat er sich in der Geschichte entwickelt? Der Internationalismus ist für die Entwicklung einer wirklichen Bewegung der Ausgebeuteten von grundsätzlicher Bedeutung. Die Befreiung der ArbeiterInnen kann nur weltweit erfolgen.
17. Mai: „Soziale Revolution“
Was ist eine Revolution? Was ist eine Revolution der Arbeiterklasse? Ist die Revolution möglich? Ist sie unvermeidbar? Welche Gesellschaft wollen wir errichten? Wir alle meinen, dass dieses System unhaltbar ist, und viele denken darüber nach, was wir ändern müssen, um in einer Gesellschaft zu leben, die die Bedürfnisse der Menschheit befriedigt.
14. Juni: „Was meinen wir mit Nationalismus?“
Was ist der Nationalismus? Wessen Klasseninteresse spiegelt die nationalistische Ideologie wider? Gibt es eine Verbindung zwischen Nationalismus und Internationalismus? Die nationalistischen Konflikte nehmen immer mehr an Schärfe zu (vor allem in Zeiten der „Krise“). Wir müssen einen Klassenstandpunkt gegenüber dieser Frage einnehmen, die die imperialistischen Konflikte immer mehr aufstachelt.
20. September: „Demokratie und Befreiung“
Was ist Demokratie? War oder ist der Demokratismus eine Befreiungsbewegung der Menschheit? Warum verwendet man diesen Begriff Demokratie so häufig? Wirkliche Demokratie, partizipative Demokratie, direkte Demokratie... In Anbetracht der vielen Verwendungen und Missbräuche des Begriffs der „Demokratie“ müssen wir klären: Was ist die Demokratie und wem dient sie? Was meinen wir in Wirklichkeit, wenn wir von Demokratie reden und warum benutzen wir diesen Begriff nicht?
18. Oktober: „Selbstverwaltung“
Was ist Selbstverwaltung? Warum gibt es solch unterschiedliche Definitionen? Ist Selbstverwaltung das gleiche wie Selbstorganisierung? Ist die Selbstverwaltung eine revolutionäre Waffe für die Arbeiter?
15. November: „Syndikalismus“
Was ist der Syndikalismus? Wie entwickelte er sich in der Arbeiterklasse? Ist er für die Arbeiterklasse weiterhin eine Waffe? Wenn nicht, warum ist das so? Worin unterscheiden sich Selbstorganisierung/Arbeiterautonomie und Syndikalismus? Intuitiv wird dieser Aktivitä von Arbeitern häufig kritisiert, aber die Gewerkschaften haben immer noch einen großen Einfluss in der Arbeiterklasse. Die Gewerkschaften sind nicht mehr nützlich, sie führen uns in die Niederlage. Warum ist das so?
13. Dezember: Parlamentarismus“
Wie entstand der Parlamentarismus? Ist er heute zu etwas nützlich? Welche Entscheidungen werden im Parlament getroffen? Kann der Parlamentarismus reformiert werden? Ebenso wie der Syndikalismus werden heute die Politiker und Wahlen ernsthaft von der Bevölkerung infrage gestellt. Diese zunehmende Infragestellung hat eine tiefere Bedeutung, die wir ergründen müssen.
Geschichte der Arbeiterbewegung:
Die Rolle der Frau bei der Entstehung der menschlichen Kultur (Teil 1)
- 2690 Aufrufe
Warum heute über den primitiven Kommunismus schreiben? Der abrupte Sturz in eine katastrophale Wirtschaftskrise und die Ausbreitung von Kämpfen auf der Welt stellen neue Probleme für die Arbeiterklasse auf; dunkle Wolken ballen sich über die Zukunft des Kapitalismus zusammen, alldieweil die Hoffnung auf eine bessere Welt sich offensichtlich nicht durchsetzen kann. Ist es wirklich an der Zeit, die Gesellschaftsgeschichte unserer Spezies in der Periode ihrer Entstehung etwa 200.000 Jahre vor Beginn der Neolithischen Revolution (vor etwa 10.000 Jahren) zu untersuchen? (1) Was uns selbst betrifft, so sind wir davon überzeugt, dass die Frage für die heutigen Kommunisten mindestens genauso wichtig ist wie für Marx und Engels im 19. Jahrhundert, sowohl aus wissenschaftlichem Interesse als auch als ein Element in unserem Verständnis der Menschheit und ihrer Geschichte und für unser Verständnis der Perspektiven und Möglichkeiten einer künftigen kommunistischen Gesellschaft, die in der Lage ist, den todgeweihten Kapitalismus zu ersetzen.
Aus diesem Grund können wir die Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel Le Communisme primitif n’est plus ce qu’il était („Der primitive Kommunismus ist nicht das, was er war“) von Christophe Darmangeat im Jahr 2009 nur begrüßen; und in der Tat ist es noch ermutigender, dass das Buch bereits seine zweite Auflage erlebt, was deutlich ein öffentliches Interesse an diesem Thema signalisiert. (2) Dieser Artikel wird in einer kritischen Rückschau versuchen, zu den Problemen zurückzukehren, die sich angesichts der ersten menschlichen Gesellschaften stellten; wir werden dabei von der Gelegenheit profitieren, die Ideen zu erkunden, die vor rund zwanzig Jahren von Chris Knight (3) in seinem Buch Blood Relations vorgestellt worden waren. (4)
Ehe wir ans Eingemachte gehen, sollte eins klar sein: Die Frage des primitiven Kommunismus und der „menschlichen Art“ sind wissenschaftliche Fragen, nicht politische. In diesem Sinn ist es für eine politische Organisation indiskutabel, sich zum Beispiel eine „Position“ über die menschliche Natur anzumaßen. Wir sind davon überzeugt, dass eine kommunistische Organisation solche Debatten und den Durst ihrer Mitglieder nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und, allgemeiner, in der Arbeiterklasse anregen sollte, doch das Ziel hier ist es, die Entwicklung einer materialistischen und wissenschaftlichen Sichtweise der Welt auf der Grundlage der modernen wissenschaftlichen Theorie zu ermutigen, zumindest soweit dies möglich ist für Nicht-Wissenschaftler, die die meisten von uns sind. Die vorgestellten Ideen können daher nicht als „Positionen“ der IKS betrachtet werden: Sie liegen allein in der Verantwortung des Autors resp. der Autorin. (5)
Warum ist die Frage nach unseren Ursprüngen so wichtig?
Warum ist schließlich die Frage nach dem Ursprung unserer Spezies und nach den ersten menschlichen Gesellschaften eine wichtige für Kommunisten? Die Begrifflichkeit des Problems hat sich seit dem 19. Jahrhundert geändert, als Marx und Engels mit Begeisterung das Werk des amerikanischen Anthropologen Lewis Morgan entdeckt hatten. 1884, als Engels Die Ursprünge der Familie, des Privateigentums und des Staates veröffentlichte, war die Wissenschaft gerade erst den Fängen einer Epoche entkommen, in der die Schätzungen des Alters des Planeten oder der menschlichen Gesellschaft auf den biblischen Berechnungen des Bischofs Ussher beruhten. (6) Wie Engels in seinem Vorwort von 1891 schrieb: „Bis zum Anfang der sechziger Jahre kann von einer Geschichte der Familie nicht die Rede sein. Die historische Wissenschaft stand auf diesem Gebiet noch ganz unter dem Einflusse der fünf Bücher Mosis. Die darin ausführlicher als anderswo geschilderte patriarchalische Familienform wurde nicht nur ohne weiteres als die älteste angenommen, sondern auch – nach Abzug der Vielweiberei – mit der heutigen bürgerlichen Familie identifiziert, so daß eigentlich die Familie überhaupt keine geschichtliche Entwicklung durchgemacht hatte…“ (7) Dasselbe traf auf den Eigentumsbegriff zu; die Bourgeoisie konnte gegenüber dem kommunistischen Programm der Arbeiterklasse immer noch einwenden, dass das „Privateigentum“ der menschlichen Gesellschaft immanent ist. Die Idee einer Existenz von gesellschaftlichen Bedingungen für den primitiven Kommunismus waren 1847 derart unbekannt, dass das Kommunistische Manifest mit den Worten begann: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen“ (eine Erklärung, die Engels mit einer Bemerkung 1884 zu korrigieren meinte).
Morgans Buch Ancient Society war eine großartige Hilfe bei der Demontage der ahistorischen Sichtweise einer menschlichen Gesellschaft, die auf Privateigentum beruht, auch wenn sein Beitrag von der offiziellen Anthropologie oft versteckt oder mit Schweigen übergangen wurde, besonders in Großbritannien. Wie Engels ebenfalls in seinem Vorwort anmerkte: „… machte Morgan das Maß übervoll, indem er nicht nur die Zivilisation, die Gesellschaft der Warenproduktion, die Grundform unserer heutigen Gesellschaft, in einer Weise kritisierte, die an Fourier erinnert, sondern von einer künftigen Umgestaltung dieser Gesellschaft in Worten spricht, die Karl Marx gesagt haben könnte“.
Heute, im Jahr 2012, ist die Situation eine ganz andere. Eine Reihe von Entdeckungen haben den Ursprung des Menschen immer weiter in die Vergangenheit gerückt, so dass wir heute nicht nur wissen, dass das Privateigentum keinesfalls von Anbeginn zum gesellschaftlichen Fundament des Menschen gehörte, sondern im Gegenteil auch, dass es eine verhältnismäßig junge Erfindung ist, da die Landwirtschaft und somit das Privateigentum sowie die Spaltung der Gesellschaft in Klassen erst etwa 10.000 Jahre alt sind. Sicherlich hat die Bildung von Reichtum und Klassen, wie Alain Testart in seinem Werk Les chasseurs-cueilleurs des inégalités gezeigt hatte, nicht über Nacht stattgefunden; es muss eine lange Zeit bis zur Entstehung einer vollentwickelten Landwirtschaft verstrichen sein, in der die Entwicklung von Lagerungstechniken zur Entstehung einer ungleichen Verteilung des angehäuften Reichtums ermuntert hatte. Nichtsdestotrotz ist heute klar, dass der bei weitem längste Abschnitt der menschlichen Geschichte nicht vom Klassenkampf beherrscht war, sondern einer Gesellschaft ohne Klassen vorbehalten war: einer Gesellschaft, die wir zu recht primitiven Kommunismus nennen können.
Heute wird gegenüber der Idee des Kommunismus nicht mehr eingewendet, dass er das ewige Prinzip des Privateigentums vergewaltige, sondern dass er angeblich der „menschlichen Natur“ zuwiderlaufe. „Man kann die menschliche Natur nicht ändern“, wird uns erzählt, und damit ist die angeblich gewalttätige, wetteifernde und egozentrische Natur des Menschen gemeint. Die kapitalistische Ordnung ist also nicht mehr ewig, sondern lediglich das logische und unvermeidliche Resultat einer unveränderlichen Natur. Dieses Argument ist beileibe nicht auf rechte Ideologien beschränkt. Humanistische Wissenschaftler, die, wie sie glauben, derselben Logik einer genetisch vorbestimmten menschlichen Natur folgen, kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Die New York Review of Books (ein tendenziell linkes Intellektuellenblatt) gibt uns in ihrer Ausgabe vom Oktober 2011 ein Beispiel für dieses Räsonieren: „Menschen wetteifern um Ressourcen, Lebensräume, Partner, gesellschaftlichen Status und um fast alles andere. Jeder lebende Mensch ist der Gipfel eines Geschlechts erfolgreicher Wettbewerber, das bis zu den Ursprüngen des Lebens zurückreicht. Wir sind nichts anderes als fein abgestimmte Konkurrenten. Der Zwang zu konkurrieren hat fast in allem, was wir tun, Einzug gehalten, ob wir dies anerkennen oder nicht. Und die besten Wettbewerber unter uns sind oftmals jene, die am meisten belohnt werden. Man muss nicht weiter schauen als bis zur Wall Street, um ein besonders krasses Beispiel dafür zu nennen (…) Das menschliche Dilemma der Überbevölkerung und der Überausbeutung der Ressourcen wird im Wesentlichen durch die ursprünglichen Impulse angetrieben, die einst unsere Urahnen dazu getrieben haben, einen überdurchschnittlichen Reproduktionserfolg zu erzielen.“ (8)
Dieses Argument scheint auf dem ersten Blick unwiderlegbar zu sein: Man muss in der Tat nicht weit schauen, um endlose Beispiele der Habgier, der Gewalt, der Grausamkeit und des Egoismus in der heutigen Gesellschaft und in der Geschichte zu finden. Aber folgt daraus, dass diese Defekte genetisch vorbestimmt sind – wie wir heute sagen würden? Nichts könnte zweifelhafter sein. Um eine Analogie zu bemühen: Ein Baum, der an einer windumtosten Stelle steht, wächst verbogen und verkrüppelt. Dennoch steht dies nicht in seinen Genen geschrieben; unter besseren Bedingungen würde der Baum gerade und hoch wachsen.
Können wir dasselbe über die menschlichen Wesen sagen?
Es ist eine in unseren Artikeln häufig anzutreffende Binsenweisheit, dass der Widerstand des Weltproletariats gegen die Krise des Kapitalismus nicht der Gewaltsamkeit der Angriffe entspricht, denen es ausgesetzt ist. Die kommunistische Revolution war vielleicht niemals notwendiger und trotzdem gleichzeitig so schwierig wie heute. Einer der Gründe hierfür ist sicherlich – aus unserer Sicht -, dass die ArbeiterInnen nicht nur in ihrer eigenen Kraft, sondern auch in der Möglichkeit des Kommunismus ein mangelndes Vertrauen haben. „Es ist eine schöne Idee“, sagen die Menschen uns, „aber weißt du, die menschliche Natur…“
Um sein Selbstvertrauen wiederzuerlangen, muss sich das Proletariat nicht nur den unmittelbaren Problemen des Kampfes stellen; es muss sich auch den größeren historischen Problemen widmen, die sich durch seine potenziell revolutionäre Konfrontation mit der herrschenden Klassen stellen. Unter diesen Problemen gibt es genau jenes der „menschlichen Natur“, und dieses Problem kann nur im wissenschaftlichen Geist erforscht werden. Wir haben kein Interesse an der „Beweisführung“, dass der Mensch „gut“ ist. Wir hoffen zu einem besseren Verständnis dessen zu gelangen, was der Mensch ist, um diese Erkenntnis in das politische Projekt des Kommunismus zu integrieren. Das kommunistische Ziel hängt nicht vom „Guten“ im Menschen ab: Die Notwendigkeit des Kommunismus als einzige Lösung der gesellschaftlichen Blockade ist in den Gegebenheiten der kapitalistischen Gesellschaft angelegt, die uns zweifellos in eine katastrophale Zukunft führen wird, wenn der Kapitalismus nicht einer kommunistischen Revolution Platz macht.
Wissenschaftliche Methode
Bevor wir fortfahren, möchten wir uns kurz der Frage der wissenschaftlichen Methode widmen, besonders ihrer Anwendung auf die Untersuchung der menschlichen Geschichte und des menschlichen Verhaltens. Eine Passage zu Beginn des Buches von Knight scheint uns die Frage, welchen Platz die Anthropologie in den Wissenschaften einnimmt, sehr gut zu schildern: „Mehr als jedes Gebiet der Erkenntnis überbrückt die Anthropologie, als Ganzes genommen, die Kluft, die traditionellerweise die Naturwissenschaften von den Geisteswissenschaften trennt. Daher nimmt sie potenziell, wenn auch nicht immer in der Praxis, eine zentrale Stellung unter den Wissenschaften insgesamt ein. Der ausschlaggebende Faden, der die Naturwissenschaften mit den Geisteswissenschaften verknüpfen könnte, müsste mehr als durch jedes andere Gebiet durch die Anthropologie verlaufen. Hier kommen die Enden zusammen – hier, wo das Studium der Natur endet und das der Kultur beginnt. An welchem Punkt auf der Skala der Evolution hörten biologische Prinzipien auf, die Vorherrschaft auszuüben, und begannen andere, komplexere Prinzipien ihren Platz einzunehmen? Wo genau verläuft die Trennungslinie zwischen dem tierischen und dem menschlichen Gesellschaftsleben? Ist die Unterscheidung eine grundsätzliche oder eher eine graduelle? Und ist es in Anbetracht dieser Frage wirklich möglich, menschliche Phänomene wissenschaftlich zu untersuchen – mit derselben unvoreingenommenen Objektivität, wie ein Astronom auf Galaxien verweisen kann oder ein Physiker auf subatomare Partikel?
Wenn die Frage des Verhältnisses zwischen den Wissenschaften für viele verworren erscheint, liegt dies nur zum Teil an den wirklichen Schwierigkeiten, die darin enthalten sind. Wissenschaft mag mit dem einen Ende in der objektiven Realität verwurzelt sein, doch mit dem anderen Ende ist sie in der Gesellschaft und in uns selbst verwurzelt. Letztendlich aus gesellschaftlichen und ideologischen Gründen ist die moderne Wissenschaft, fragmentiert und verzerrt unter dem immensen, größtenteils noch uneingestandenen politischen Druck, zufällig auf ihr größtes Problem und auf ihre größte Herausforderung gestoßen – die Geistes- und Naturwissenschaften auf der Basis des Verständnisses der Evolution und des Platzes der Menschheit im Rest des Universums in einer einzigen vereinten Wissenschaft zusammenzuschließen.“ (9)
Die Frage der „Trennungslinie“ zwischen der tierischen Welt, deren Verhalten vor allem von der genetischen Erblast vorbestimmt wird, und der menschlichen Welt, wo das Verhalten neben den Genen in einem weitaus größeren Umfang von unserer kulturellen Entwicklung abhängt, scheint uns in der Tat kreuzwichtig zu sein, um die „menschliche Natur“ zu verstehen. Andere Primaten sind durchaus in der Lage, zu lernen und bis zu einem gewissen Punkt zu erfinden und neue Verhaltensweisen zu übermitteln, doch dies bedeutet nicht, dass sie eine „Kultur“ im menschlichen Sinn besitzen. Diese erlernten Verhaltensweisen bleiben „marginal bei der Aufrechterhaltung der sozio-strukturellen Kontinuität“. (10) Was es der Kultur ermöglicht, in einer „kreativen Explosion“ (11) die Oberhand zu gewinnen, ist die Entwicklung der Kommunikation unter den menschlichen Gruppen, die Entwicklung einer symbolischen Kultur, die auf Sprache und Rituale basiert. Knight zieht in der Tat einen Vergleich zwischen der symbolischen Kultur und der Sprache, die den menschlichen Wesen gestattet, miteinander zu kommunizieren und somit Ideen und daher überall Kultur und Wissenschaften zu übermitteln, die ebenfalls auf einen gemeinsamen Symbolismus gründen, welcher sich auf eine planetare Übereinstimmung zwischen allen Wissenschaftlern und zumindest potenziell zwischen allen menschlichen Wesen stützt. Die wissenschaftliche Praxis ist untrennbar verbunden mit der Debatte und der Fähigkeit eines Jeden, die Schlussfolgerungen zu verifizieren, zu der die Wissenschaft gelangt ist: Sie ist daher der Erzfeind jeder Form der Esoterik, die vom Geheimwissen lebt, das dem Nicht-Eingeweihten verschlossen bleibt.
Weil sie eine universelle Form des Wissens ist und weil sie seit der industriellen Revolution eine eigenständige Produktivkraft gewesen war, die von der assoziierten Arbeit sowohl zeitlich als auch räumlich abhängig ist (12), ist die Wissenschaft von Haus aus internationalistisch, und in diesem Sinn sind Proletariat und Wissenschaft natürliche Verbündete. (13) Dies bedeutet überhaupt nicht, dass es so etwas wie eine „proletarische Wissenschaft“ geben kann. In seinem Artikel über „Marxismus und Wissenschaft“ zitiert Knight diese Worte von Engels: „… je rücksichtsloser und unbefangener die Wissenschaft vorgeht, desto mehr befindet sie sich im Einklang mit den Interessen und Strebungen der Arbeiter.“ (14). Knight fährt fort: „Die Wissenschaft als einzige universelle, internationale und die Spezies vereinigende Form des Wissens hat Vorrang. Wenn sie in den Interessen der Arbeiterklasse verwurzelt werden musste, dann nur in dem Sinne, dass alle Wissenschaft in den Interessen der menschlichen Spezies insgesamt verwurzelt sein muss, wobei die internationale Arbeiterklasse diese Interessen in der modernen Epoche verkörpert, so wie die Erfordernisse der Produktion in früheren Perioden immer diese Interessen verkörpert haben.“
Es gibt zwei weitere Aspekte im wissenschaftlichen Denken, die in Carlo Rovellis Buch über den griechischen Philosophen Anaximander von Miletos (15) beleuchtet werden, die wir hier aufgreifen wollen, weil sie uns fundamental erscheinen: Respekt für die Vorgänger und Zweifel.
Rovelli zeigt, dass Anaximanders Haltung gegenüber seinem Meister Thales mit dem Verhalten brach, dass seine Epoche charakterisierte: entweder totale Ablehnung, um sich selbst als neuer Meister zu etablieren, oder sklavische Ergebenheit gegenüber den Worten des „Meisters“, dessen Gedanken in einem Zustand der Mumifizierung gehalten werden. Die wissenschaftliche Haltung besteht im Gegenteil darin, uns auf das Werk der „Meister“ zu stützen, die von uns gegangen sind, und gleichzeitig ihre Fehler zu kritisieren und zu versuchen, das Wissen zu erweitern. Dies ist die Haltung, die wir in Knights Buch bezüglich Lévi-Strauss und bei Darmangeat hinsichtlich Morgan finden.
Der Zweifel ist fundamental für die Wissenschaft, die das ganze Gegenteil der Religion ist, welche stets Gewissheit und Trost in der Unveränderlichkeit einer ewigen Wahrheit anstrebt. Wie Rovelli sagt: „Die Wissenschaft bietet die besten Antworten an, eben weil sie ihre Antworten nicht als absolute Wahrheiten betrachtet; daher ist sie immer in der Lage, zu lernen und neue Ideen aufzunehmen.“ (16) Dies trifft besonders auf die Anthropologie und Paläo-Anthropologie zu, deren Daten oftmals diffus und ungewiss sind und deren beste Theorien über Nacht durch neue Entdeckungen umgekippt werden können.
Ist es überhaupt möglich, eine wissenschaftliche Sicht auf die Geschichte zu haben? Karl Popper (17), der eine Referenz für die meisten Wissenschaftler verkörpert, sagte nein. Er betrachtete Geschichte als ein „einmaliges Ereignis“, das daher nicht reproduzierbar sei. Da die Verifizierung einer wissenschaftlichen Hypothese von einem reproduzierbaren Experiment abhängt, könne die Geschichte nicht als wissenschaftlich erachtet werden. Aus den gleichen Gründen lehnte Popper die Evolutionstheorie als nicht-wissenschaftlich ab. Und doch ist es heute offensichtlich, dass die wissenschaftliche Methode sich als imstande erwiesen hat, die wesentlichen Mechanismen des evolutionären Prozesses soweit offenzulegen, dass die Menschheit nun die Evolution durch die Gentechnologie manipulieren kann. Ohne so weit zu gehen wie Popper, ist es dennoch klar, dass die Anwendung der wissenschaftlichen Methode auf die Untersuchung der Geschichte bis zu dem Punkt, dass wir Vorhersagen über ihre weitere Entwicklung machen können, eine äußerst heikle Übung ist. Auf der einen Seite verkörpert die menschliche Geschichte – wie die Meteorologie zum Beispiel – eine unkalkulierbare Anzahl von unabhängigen Variablen, auf der anderen Seite – und vor allem weil, wie Marx sagte, die Menschen ihre eigene Geschichte machten – ist die Geschichte daher durch Gesetze determiniert, aber auch durch die Fähigkeit (oder Unfähigkeit) der menschlichen Wesen, ihre Handlungen auf bewusstes Denken und auf die Kenntnis dieser Gesetze zu gründen. Die historische Evolution ist stets Beschränkungen unterworfen: In einem bestimmten Moment sind gewisse Entwicklungen möglich, andere nicht. Doch die Art, in der sich eine bestimmte Situation entwickelt, wird ebenfalls von der Fähigkeit des Menschen bestimmt, sich dieser Einschränkungen gewahr zu werden und auf der Grundlage dieses Bewusstseins zu handeln.
Es ist daher besonders wagemutig von Knight, wenn er die volle Strenge der wissenschaftlichen Methode akzeptiert und seine Theorie experimentellen Tests unterwirft. Natürlich ist es unmöglich, die Geschichte experimentell zu „reproduzieren“. Knight macht daher Vorhersagen auf der Basis seiner Hypothese (1991, dem Jahr, als Blood Relations publiziert wurde) bezüglich künftiger archäologischer Entdeckungen: insbesondere dass die frühesten Spuren der symbolischen Kultur des Menschen einen extensiven Gebrauch von rotem Ocker enthüllen würden. 2006, fünfzehn Jahre später, scheinen sich diese Vorhersagen durch die Entdeckungen der ersten bekannten Spuren menschlicher Kultur in der Blombos-Höhle (Südafrika) bestätigt zu haben. (18) Diese beinhalteten in Stein eingravierten roten Ocker, durchbohrte Meeresmuscheln, anscheinend als Körperschmuck benutzt, und sogar den ersten Farbtopf der Welt, was alles in das Evolutionsmodell passt, das Knight vorschlägt (zu dem wir später zurückkehren werden). Es liegt auf der Hand, dass dies kein „Beweis“ seiner Theorie ist, doch erscheint es uns unbestreitbar, dass es seine Hypothese stärkt.
Die wissenschaftliche Methode unterscheidet sich deutlich von dem Ansatz, der von Darmangeat verfolgt wurde, welcher sich, wie uns scheint, auf die induktive Methode einengt, eine Methode, die Tatsachen zusammenbringt, um anschließend aus ihnen einige gemeinsame Faktoren zu extrahieren. Diese Methode ist nicht ohne Wert im wissenschaftlichen Geschichtsstudium: Im Grunde genommen muss jegliche Theorie mit der Realität übereinstimmen. Doch Darmangeat scheint sehr zurückhaltend gegenüber dem Versuch zu sein, weiter zu gehen, und dies scheint uns eher ein empirischer denn ein wissenschaftlicher Ansatz zu sein: Wissenschaft schreitet nicht durch die Induktion aus beobachteten Tatsachen voran, sondern durch die Hypothese, die sich sicherlich in Übereinstimmung mit der Beobachtung befinden muss, aber auch einen Ansatz (experimentell, wenn möglich) anregen sollte, der es ermöglichen würde, weiter zu gehen in Richtung neuer Entdeckungen und neuer Beobachtungen. Die String-Theorie in der Quantenmechanik ist ein eindrucksvolles Beispiel für diese Methode: Obwohl sie soweit wie möglich mit beobachteten Fakten übereinstimmt, kann sie heute experimentell nicht verifiziert werden, da die Partikel (oder „Strings“), deren Existenz sie postuliert, zu klein sind, um mit den existenten Technologien gemessen werden zu können. Die String-Theorie bleibt somit eine spekulative Hypothese – doch ohne diese Art von gewagter Spekulation wäre die Wissenschaft nicht in der Lage, voran zu schreiten.
Ein anderes Problem mit der induktiven Methode besteht darin, dass sie notgedrungen eine Auswahl ihrer Beobachtungen aus der Unermesslichkeit der bekannten Realität treffen muss. So verfährt Darmangeat, wenn er sich allein auf ethnographische Beobachtungen stützt und jegliche Berücksichtigung der Rolle von Evolution und Genetik außer Acht lässt – was uns für ein Werk, das bezweckt, „den Ursprung der Unterdrückung der Frauen“ (so der Untertitel von Darmangeats Buch) offenzulegen, als ein Unding erscheint.
Morgan, Engels und die wissenschaftliche Methode
Wenden wir uns nun, nach diesen sehr bescheidenen Anmerkungen über die Frage der Methodik, wieder Darmangeats Buch zu, das der Ausgangspunkt dieses Artikels ist.
Das Buch ist in zwei Hälften geteilt: Der erste Teil untersucht das Werk des amerikanischen Anthropologen Lewis Morgan, auf dem Engels sein Buch Über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates basierte, während der zweite Teil Engels‘ Frage bezüglich der Ursprünge der Unterdrückung der Frau aufgreift. In diesem zweiten Teil konzentriert sich Darmangeat darauf, den Gedanken zu attackieren, dass einst ein primitiver, auf dem Matriarchat basierender Kommunismus existierte.
Der erste Teil erscheint uns besonders interessant (19), und wir können Darmangeat rückhaltlos zustimmen, wenn er jene angeblich „marxistische“ Position attackiert, die das Werk von Morgan (und erst recht von Engels) in den Rang eines unantastbaren religiösen Textes hebt. Nichts könnte dem wissenschaftlichen Geist des Marxismus fernerliegen. Auch wenn wir von Marxisten erwarten sollten, das Erscheinen und die Entwicklung der materialistischen Gesellschaftstheorie von einem historischen Standpunkt aus zu betrachten und somit auch früheren Theorien Rechnung zu tragen, ist es völlig klar, dass wir Texte aus dem 19. Jahrhundert nicht als letztes Wort nehmen und die immense Anhäufung von ethnographischen Erkenntnissen seither ignorieren können. Sicherlich ist es notwendig, eine kritische Sichtweise in diesem Zusammenhang aufrechtzuhalten: Darmangeat besteht wie Knight auf die Tatsache, dass der Kampf gegen Morgans Theorien in keiner Weise auf der Grundlage einer „reinen“, „neutralen“ Wissenschaft geführt wurde. Wenn Morgans zeitgenössische und spätere Gegner seine Fehler aufzeigten oder wenn sie die Aufmerksamkeit auf Entdeckungen lenkten, die nicht in seine Theorie passen, war ihr Ziel im Allgemeinen nicht unvoreingenommen. Indem sie Morgan angriffen, attackierten sie die evolutionäre Sichtweise der menschlichen Gesellschaft und versuchten, die patriarchalische Familie und das Privateigentum der bürgerlichen Gesellschaft als „ewige“ Kategorien aller menschlichen Gesellschaften in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wiederherzustellen. Dies war ganz eindeutig der Fall bei Malinowski, einem der größten Ethnographen des frühen 20. Jahrhunderts, der 1931 in einem Rundfunkinterview äußerte: „Ich glaube, dass das zerstörerischste Element in den modernen revolutionären Tendenzen die Idee ist, dass die Elternschaft kollektiv ausgeübt werden kann. Falls wir je an dem Punkt gelangten, die Einzelfamilie als das Schlüsselelement unserer Gesellschaft abzuschaffen, werden wir uns einer gesellschaftlichen Katastrophe gegenübersehen, gegen die der politische Umbruch der Französischen Revolution und die ökonomischen Veränderungen des Bolschewismus unbedeutend sind. Daher ist die Frage, ob die Gruppenmutterschaft eine Institution ist, die niemals existiert hat, oder ob sie ein Arrangement ist, das mit der menschlichen Natur und der sozialen Ordnung kompatibel ist, von einem beträchtlichen praktischen Interesse.“ (18) Hier sind wir weit entfernt von wissenschaftlicher Objektivität…
Kommen wir nun zu Darmangeats Kritik an Morgan. Diese ist in unseren Augen von größtem Interesse, und sei es nur, weil sie mit einer ziemlich detaillierten Zusammenfassung von Morgans Theorie beginnt und diese somit auch für die Nichteingeweihten unter den Lesern zugänglich macht. Besonders begrüßen wir dabei die Tabelle, die die verschiedenen Stufen der Gesellschaftsentwicklung auflistet, die von Morgan und der Anthropologie seiner Zeit benutzt wurden („Wildheit“, „Barbarei“, etc.) und die heute benutzt werden (Altsteinzeit, Jungsteinzeit, etc.), was es erleichtert, sich in die historische Zeit zu versetzen, und die erläuternden Diagramme verschiedener Verwandtschaftssysteme. Der ganze Abschnitt ist voll von klaren, didaktischen Erläuterungen.
Das Fundament der Theorie Morgans besteht darin, die Familienform, das Verwandtschaftssystem und die technische Entwicklung in einer Reihe von evolutionären Schritten zusammenzubringen, die aus dem „Zustand der Wildheit“ (der ersten Stufe der menschlichen Gesellschaftsentwicklung, die der Altsteinzeit entsprach) in die „Barbarei“ (die Jungsteinzeit, Eisen- und Bronzezeit) und schließlich in die Zivilisation führten. Diese Evolution wird demzufolge von der technischen Entwicklung bestimmt, und der scheinbare Widerspruch zwischen den Familien- und Verwandtschaftssystemen, den Morgan in vielen Völkern (insbesondere den Irokesen) beobachtet hat, stellt für ihn die dazwischen liegenden Stufen zwischen einer primitiven und einer fortgeschrittenen Wirtschaft und Technologie dar. Traurig nur für die Theorie, dass, wenn wir genauer hinschauen, dies nicht der Fall ist. Um nur eins der vielen Beispiele Darmangeats zu geben: laut Morgan soll das „punaluanische“ Verwandtschaftssystem angeblich eine der primitivsten technischen und gesellschaftlichen Stufen darstellen, und doch kann es auf Hawaii in einer Gesellschaft angetroffen werden, die Wohlstand, soziale Ungleichheit und eine aristokratische Gesellschaftsschicht beherbergt und die im Begriff ist, sich in einen voll entfalteten Staat und in eine Klassengesellschaft zu verwandeln. Familien- und Verwandtschaftssysteme werden also von gesellschaftlichen Bedürfnissen bestimmt, jedoch nicht in direkter Linie von den primitivsten zu den modernsten.
Bedeutet dies, dass die marxistische Sichtweise der gesellschaftlichen Evolution in die Mülltonne geworfen werden sollte? Ganz oder gar nicht, sagt Darmangeat. Jedoch müssen wir trennen, was Morgan und nach ihm Marx und Engels zusammenzubringen versuchten: die Evolution der Technologie (und somit der Produktivität) und die Familiensysteme. „Obgleich sich die Produktionsweisen alle qualitativ voneinander unterscheiden, besitzen sie alle eine gemeinsame Quantität, die es ermöglicht, sie in eine aufsteigende Reihe einzuordnen, die darüber hinaus grob ihrer chronologischen Ordnung entspricht (…) (Für die Familie) gibt es keine gemeinsame Quantität, die dazu benutzt werden könnte, eine aufsteigende Reihe von verschiedenen Formen herzustellen“. (20) Es liegt auf der Hand, dass die Ökonomie „in letzter Instanz“ (um Engels Worte zu benutzen) der ausschlaggebende Faktor ist: Wenn es keine Ökonomie (d.h. keine Reproduktion von allem Lebensnotwendigen für das menschliche Leben) gäbe, dann würde es auch kein gesellschaftliches Leben geben. Aber diese „letzte Instanz“ hinterlässt einen großen Raum für andere Einflüsse, seien sie geographischer, historischer, kultureller oder anderer Art. Ideen, Kulturen – in ihrem breitesten Sinn – sind ebenfalls ausschlaggebende Faktoren in der Gesellschaft. Am Ende seines Lebens bedauerte es Engels, dass die dringende Not, den historischen Materialismus auf eine sichere Basis zu stellen, Marx und ihm selbst zu wenig Zeit übrig ließ, andere historisch bestimmende Faktoren zu analysieren. (21)
Die Kritik der Anthropologie
Im zweiten Teil seines Buches stellt Darmangeat seine eigenen Gedanken vor. Wir finden hier zwei grundlegende Themen: auf der einen Seite eine historische Kritik der anthropologischen Theorie über die Stellung der Frauen in primitiven Gesellschaften, auf der anderen Seite haben wir die Erläuterungen seiner eigenen Schlussfolgerung zu diesem Subjekt. Die historische Kritik konzentriert sich auf die Evolution dessen, was für Darmangeat die marxistische – oder zumindest marxistisch beeinflusste – Sichtweise des primitiven Kommunismus vom Standpunkt der Frau in der primitiven Gesellschaft ist, und ist eine heftige Anprangerung der „feministischen“ Versuche, die Idee eines urzeitlichen Matriarchats in den ersten menschlichen Gesellschaften zu vertreten.
Diese Auswahl ist nicht unbegründet, auch wenn sie unserer Auffassung nach nicht immer glücklich ist und den Autor dazu verleitet, einige marxistischen Theoretiker zu ignorieren, die in eine solche Untersuchung hineingehören, und andere mit einzuschließen, die dort überhaupt nichts zu suchen haben. Nehmen wir nur einige Beispiele: Darmangeat kritisiert mehrere Seiten lang Alexandra Kollontai (22), sagt aber nichts über Rosa Luxemburg. Nun, welche Rolle Kollontai auch immer in der Russischen Revolution und im Widerstand gegen ihre Degeneration (sie spielte eine führende Rolle in der „Arbeiteropposition“) gespielt hatte, Kollontai hatte nie einen großen Anteil an der Entwicklung der marxistischen Theorie und noch weniger an der Theorie der Anthropologie.
Auf der anderen Seite war Luxemburg nicht nur eine führende marxistische Theoretikerin, sie war auch die Autorin von Einführung in die Nationalökonomie, die sich auf der Grundlage der zu damaliger Zeit aktuellsten Forschungsergebnissen zu einem bedeutenden Teil der Frage des primitiven Kommunismus widmet. Die einzige Rechtfertigung für dieses Ungleichgewicht ist, dass Kollontai zunächst in der sozialistischen Bewegung, schließlich im frühen Sowjet-Russland eine wichtige Rolle im Kampf für die Frauenrechte spielte, während Luxemburg nie großes Interesse am Feminismus zeigte. Zwei weitere marxistische Autoren, die über das Thema des primitiven Kommunismus schrieben, sind nicht einmal erwähnt worden: Karl Kautsky (Ethik und die materialistische Geschichtsauffassung) und Anton Pannekoek (Anthropogenesis).
Unter den unglücklichen Berücksichtigungen finden wir zum Beispiel Evelyn Reed: Dieses Mitglied der amerikanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (einer trotzkistischen Organisation, die die Teilnahme am II. Weltkrieg „kritisch“ unterstützte) wird mit berücksichtigt, weil sie 1975 Feminism and Anthropology schrieb, ein Werk, das damals einen gewissen Erfolg in linken Zirkeln erzielte. Doch wie Darmangeat sagt, wurde das Buch von Anthropologen fast vollständig ignoriert, hauptsächlich wegen der Dürftigkeit seiner Argumente, auf die selbst freundlich gesinnte Kritiker hinwiesen.
Wir finden dieselben blinden Flecken unter den Anthropologen: Claude Lévi-Strauss, eine der wichtigsten Gestalten in der Anthropologie des 20. Jahrhunderts, dessen Theorie über den Übergang von der Natur zur Kultur auf der Idee des Austausches von Frauen zwischen den Männern gründet, erhält nur eine Statistenrolle, während Bronislaw Malinowski erst gar nicht vorkommt.
Doch der blinde Fleck, der am meisten überrascht, ist Chris Knight. Darmangeats Buch konzentriert sich besonders auf die Lage der Frauen in primitiven kommunistischen Gesellschaften und auf die Kritik der Theorien, die einer bestimmten marxistischen oder marxistisch beeinflussten Tradition angehören. 1991 veröffentlichte der britische Anthropologe Chris Knight, der sein Werk ausdrücklich innerhalb der marxistischen Tradition ansiedelt, ein Buch, Blood Relations (Blutsverwandtschaften), das sich exakt mit dem Thema, das Darmangeat umtreibt, beschäftigt. Man könnte erwarten, dass Darmangeat ihm seine größte Aufmerksamkeit widmen würde, dies umso mehr, weil er selbst die „große Belesenheit“ anerkennt, die in diesem Buch zum Ausdruck kommt. Doch nichts davon kommt in Darmangeats Buch vor, ganz das Gegenteil. Er widmet nicht einmal eine Seite (S. 321) Knights These, wo er uns mitteilt, dass Knight „ständig die schwerwiegenden methodischen Fehler von Reed und Briffault wiederholt (Knight sagt nichts über den Erstgenannten, aber zitiert ausgiebig den Letztgenannten)“, was bei einem französisch sprachigen Leser ohne Zugang zu einem Buch, das nur auf Englisch erhältlich ist, den Eindruck hinterlässt, dass Knight nichts andere täte, als Leuten hinterherzulaufen, die von Darmangeat bereits als nicht ernst zu nehmen bezeichnet wurden. (23) Doch ein flüchtiger Blick auf Knights Bibliographie reicht aus, um zu zeigen, dass er, obwohl er in der Tat Briffault zitiert, Marx, Engels, Lévi-Strauss, Marshall Sahlins und vielen mehr einen viel größeren Platz einräumt. Und wenn man sich die Mühe macht, seine Bezugnahmen auf Briffault zu untersuchen, findet man schnell heraus, dass Knight das Werk des Letzteren (1927 veröffentlicht) ungeachtet seiner Verdienste als „überholt in seinen Quellen und seiner Methodik“ (24) betrachtet.
Kurz, unser Gefühl ist, dass Darmangeat uns „zwischen zwei Stühlen sitzen“ lässt: Wir landen bei einer kritischen Schilderung, die weder eine wahre Kritik der von Marxisten vertretenen Positionen noch eine wirkliche Kritik der anthropologischen Theorie ist, und dies vermittelt uns zuweilen den Eindruck, als schauten wir Don Quixote bei seinem Kampf gegen die Windmühlenflügel zu. Die Wahl dieser Struktur scheint uns obskurer als alles andere, ein Argument, das in anderen Zusammenhängen von einem beträchtlichen Interesse ist.
Jens (Fortsetzung folgt)
1) Eine Gesellschaftsgeschichte, die für einige menschliche Populationen bis zum heutigen Tag fortdauert.
2) Editions Smolny, Toulouse, 2009. Wir sind uns der Veröffentlichung der zweiten Ausgabe von Darmangeats Buch (Smolny, Toulouse, 2012) just zu dem Zeitpunkt gewahr geworden, als dieser Artikel kurz vor seiner Veröffentlichung stand, und wir fragten uns natürlich, ob wir diese Rezension neu schreiben müssen. Nachdem wir uns durch die zweite Ausgabe durchgelesen hatten, hatten wir den Eindruck, dass wir diesen Artikel im Wesentlichen in seinem ursprünglichen Zustand belassen konnten. Der Autor wies selbst in einem neuen Vorwort darauf hin, dass er nicht „die Kernideen des Textes verändert (habe), auch nicht die Argumente, auf die er basierte“, und ein Studium der zweiten Ausgabe bestätigt dies. Wir haben uns daher darauf beschränkt, einige Argumente auf der Basis der zweiten Ausgabe näher auszuführen.
3) Chris Knight ist ein englischer Anthropologe und Mitglied der „Radical Anthropology Group“. Er hat an den Debatten über die Wissenschaft auf dem 19. Kongress der IKS teilgenommen, und wir haben seinen Artikel über „Marxismus und Wissenschaft“ auf unserer Website veröffentlicht.
4) Yale University Press, New Haven and London, 1991.
5) Abgesehen davon, verdankt der Autor bzw. die Autorin sehr viel den Diskussionen in der Organisation, ohne die es mit Sicherheit unmöglich gewesen wäre, diese Ideen zu entwickeln.
6) Bischof Ussher war ein umtriebiger Gelehrter des 17. Jahrhunderts, der das Alter der Erde auf der Basis biblischer Ahnenforschungen berechnete: Er datierte die Schaffung der Erde auf das Jahr 4004 v.Chr.
7) MEW, Band 22, S. 212.
8) https://www.nybooks.com [496] articles/archives/2011/oct/13/can-our-species-escape-destruction.
9) Knight, ob.zit., S. 56f.
10) Ebenda, S. 11. Wir sehen hier eine Analogie zur Warenproduktion und zur kapitalistischen Gesellschaft. Warenproduktion und Handel existierten seit Beginn der Zivilisation oder vielleicht noch länger, doch wurden sie erst im Kapitalismus zu bestimmenden Faktoren.
11) Ebenda, S. 12.
12) Siehe unseren Artikel „Reading notes on science and Marxism“.
13) Dies trifft auf die Wissenschaft wie auch auf andere Produktivkräfte im Kapitalismus zu: „Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum hundertjährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangnen Generationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschiffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegraphen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden gestampfte Bevölkerungen – welches frühere Jahrhundert ahnte, daß solche Produktionskräfte im Schoße der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten (…) Die Produktivkräfte, die ihr zur Verfügung stehn, dienen nicht mehr zur Beförderung der bürgerlichen Eigentumsverhältnisse; im Gegenteil, sie sind zu gewaltig, für diese Verhältnisse geworden, sie werden von ihnen gehemmt; und sobald sie dies Hemmnis überwinden, bringen sie die ganze bürgerliche Gesellschaft in Unordnung, gefährden sie die Existenz des bürgerlichen Eigentums.“ (Marx/Engels, Das kommunistische Manifest, Teil 1, „Bourgeois und Proletarier“.
14) Engels, „Ludwig Feuerbach und das Ende der klassischen deutschen Philosophie. MEW, Band ??.
15) The first scientist: Anaximander and his legacy, Westholme Publishing, 2011.
16) Unsere Übersetzung aus dem Französischen, zitiert in einem auf unserer französischen Website veröffentlichten Artikel.
17) Karl Popper (1902-1994) wurde in Wien, Österreich geboren. Er war einer der einflussreichsten Wissenschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts und ein unumgänglicher Referenzpunkt für alle WissenschaftlerInnen, die an Fragen der Methodik interessiert sind. Er besteht insbesondere auf die Idee der „Widerlegbarkeit“, die feststellt, dass jegliche Hypothese, möchte sie als wissenschaftlich anerkannt werden, in der Lage sein muss, Experimente vorzuschlagen, die es gestatten würden, sie zu widerlegen: Sollten solche Experimente unmöglich sein, kann eine Hypothese nicht in Anspruch nehmen, wissenschaftlich zu sein. Auf dieser Grundlage meinte Popper, dass der Marxismus, die Psychoanalyse und – zumindest anfänglich – der Darwinismus nicht behaupten könnten, eine wissenschaftliche Disziplin zu sein.
18) Siehe das Werk der Stellenbosch-Konferenz, das in The cradle of language, OUP, 2009, und den Artikel, der in der Ausgabe von La Recherche (www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=30891 [497]) im November 2011 veröffentlicht wurde.
19) Ironischerweise hat Darmangeat in der zweiten Ausgabe den ersten Teil des Buches als Appendix angehängt, anscheinend aus Furcht davor, die fachfremden Leser mit der „Trockenheit“ dieses Teils abzuschrecken, um die Worte des Autors selbst zu benutzen.
20) S. 136 in der ersten Ausgabe. Die Übersetzung aus dem Französischen ist von uns.
21) „Daß von den Jüngeren zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden müssen. Wir hatten, den Gegnern gegenüber, das von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen, und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirklung beteiligten Momente zu ihrem Rcht kommen zu lassen. Aber sowie es zur Darstellung eines historischen Abschnitts, also zur praktischen Anwendung kam, änderte sich die Sache, und da war kein Irrtum möglich. Es ist aber leider nur zu häufig, daß man glaubt, eine neue Theorie vollkommen verstanden zu haben und ohne weiteres handhaben zu können, sobald man die Hauptsätze sich angeeignet hat, und das auch nicht immer richtig. und diesen Vorwurf kann ich manchem der neueren ‚Marxisten‘ nicht ersparen, und es ist da auch wunderbares Zeug geleistet worden.“ (Engels, Brief an J. Bloch, 21. September 1890)
22) In der zweiten Ausgabe hat Kollontai sogar einen eigenen Unter-Abschnitt.
23) Die Kritik an Knights Werk ist in der zweiten Ausgabe nicht mehr so ausführlich, mit Ausnahme einer Bezugnahme auf eine kritische Rezension von Joan M. Gero, eine feministische Anthropologin und Autorin von Engendering archaeology. Diese Rezension scheint uns ein wenig oberflächlich und politisch parteiisch. Hier ein typisches Beispiel: „Was Knight als eine ‚erzeugte‘ Perspektive über die Ursprünge der Kultur vorstellt, ist eine paranoide und verzerrende Sichtweise der ‚weiblichen Solidarität‘, die (alle) Frauen als sexuelle Ausbeuter und Manipulatoren (aller) Männer darstellt. Zwischengeschlechtliche Beziehungen werden immerdar und überall als Verhältnisse zwischen Opfern und Manipulatoren charakterisiert; ausbeuterischen Frauen wird stets unterstellt, Männer durch das eine oder andere Mittel in eine Falle locken zu wollen, und tatsächlich würde ihre Verschwörung als die eigentliche Grundlage der Entwicklung unserer Spezies dienen. Die LeserInnen könnten sich durch die Behauptung gekränkt fühlen, dass Männer stets promiskuitiv gewesen seien und dass lediglich guter Sex, gemessen von sich zierenden, aber berechnenden Frauen, sie zu Hause halten und an ihren Nachwuchs interessiert machen könne. Nicht nur, dass das Szenario unwahrscheinlich und nicht erwiesen ist und gleichermaßen abscheulich für Feministen und Nicht-Feministen ist, hinzu kommt, dass die soziologische Begründung all die nuancierten Versionen der Gesellschaftskonstruktion von geschlechtlichen Verhältnissen, Ideologien und Handlungen aufgibt, die so zentral und faszinierend in den Gender-Studien heute sind“. Kurz, wir werden eingeladen, eine wissenschaftliche These abzulehnen, nicht weil sie falsch ist – Gero hat nichts darüber zu sagen und macht sich nicht die Mühe, dies zu beweisen -, sondern weil sie für bestimmte Feministen „abscheulich“ ist.
24) Darmangeat, ob.zit. S. 328.
Historische Ereignisse:
- Frauenfrage [498]
- Gender [499]
- Kultur [500]
- Menschwerdung [501]
Theoretische Fragen:
Frankreichs Intervention in Mali: Noch ein Krieg im Namen des Friedens
- 2194 Aufrufe
Erneut übernimmt die französische Bourgeoisie in einem bewaffneten Konflikt in Afrika eine Führungsrolle. Und erneut rechtfertigt sie dies im Namen des Friedens. In Mali geht es angeblich um den Kampf gegen den Terrorismus und um die Sicherheit der Völker. Natürlich steht die Grausamkeit der bewaffneten Banden, die im Norden Malis die Bevölkerung terrorisieren, außer Frage. Diese Warlords hinterlassen viele Tote und verbreiten nur Schrecken. Doch das Motiv der französischen Intervention ist nicht die Verhinderung des Leids der einheimischen Bevölkerung. Der französische Staat will nur seine eigenen, schmutzigen imperialistischen Interessen schützen. In einigen Stadtvierteln der malischen Hauptstadt Bamako haben die Einwohner Freudentänze aufgeführt und François Hollande als Retter gefeiert. Dies sind die einzigen Bilder des Krieges, die die Medien verbreiten: eine feiernde Bevölkerung, die darüber erleichtert ist, dass der Vormarsch der mafia-ähnlichen Banden auf die Hauptstadt gestoppt worden ist. Aber diese Freude wird nicht lange anhalten. Wenn eine „große Demokratie“ mit ihren Panzern durchs Land rasselt, bleibt das Gras nicht mehr grün! Im Gegenteil: sie hinterlässt Verwüstung, Chaos, Elend. Ein Blick auf die Landkarte zeigt die Schauplätze der Hauptkonflikte und Hungersnöte auf, die in Afrika seit den 1990er Jahren gewütet haben. Die Ergebnisse sind erschreckend: Alle Kriege, die - wie in Somalia 1992 oder in Ruanda 1994 - oft unter dem Banner der „humanitären Hilfe“ geführt wurden, haben katastrophale Nahrungsmittelengpässe verursacht. Das Gleiche steht Mali bevor. Dieser neue Krieg wird die ganze Region destabilisieren und das Chaos vergrößern.
Ein imperialistischer Krieg„Wenn ich Präsident bin, wird das System des ‚französisch beherrschten Afrikas‘ aufhören“. Diese Riesenlüge von François Hollande riefe nur ein müdes Lächeln hervor, wenn sie nicht mit noch mehr Blutvergießen einherginge. Die linken Parteien beschwören stets ihre „humanitären“ Anliegen und verstecken so seit einem Jahrhundert ihr wahres Wesen. Sie sind eine bürgerliche Fraktion, die genau wie alle anderen bereit ist, jedes nur denkbare Verbrechen zu begehen, um das Interesse der Nation zu verteidigen. Denn genau darum geht es auch in Mali: die strategischen Interessen Frankreichs zu schützen. Wie François Mitterrand, der seinerzeit ein militärisches Eingreifen im Tschad, Irak, im damaligen Jugoslawien, in Somalia und Ruanda veranlasst hatte, beweist auch François Hollande, dass die „Sozialisten“ niemals zögern, ihre „Werte“ (d.h. die bürgerlichen Interessen der französischen Nation) auch bewaffnet zu verteidigen.
Seit Beginn der Besetzung des Nordens des Landes durch die Islamisten trieben insbesondere Frankreich und die USA hinter den Kulissen die Länder dieser Zone zu einem militärischen Eingreifen an; sie boten dazu finanzielle Unterstützung und logistische Hilfe an. Aber die USA schienen sich bei diesen Manipulationen und Ränkespielen um Bündnisse als die Überlegenen zu erweisen; ihr Einfluss nahm in der Region zu. Für Frankreich war es jedoch überhaupt nicht hinnehmbar, dass man ihm in seinem Hinterhof den Rang ablief; es musste reagieren und mit der Faust auf den Tisch schlagen: „Als Entscheidungen anstanden, hat Frankreich reagiert und sich auf sein Vorrecht als ehemalige Kolonialmacht berufen. Mali näherte sich sicherlich zu sehr den USA. Das ging sogar so weit, dass der halbamtliche Sitz von Africom, der vereinigten militärischen Kommandozentrale für Afrika, den George Bush 2007 einberufen hatte und seitdem von Barack Obama konsolidiert wurde, in Mali eingerichtet wurde“ (Courrier international, 17.1. 2013).
In Wirklichkeit sind in diesem Teil der Erde die imperialistischen Bündnisse äußerst komplex und sehr instabil. Die Verbündeten von heute können morgen schon Feinde sein, wenn sie es nicht gar gleichzeitig sind. So pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Saudi-Arabien und Katar, die von Frankreich und den USA als „enge Verbündete“ bezeichnet werden, auch die Hauptgeldgeber der in der Sahel-Zone agierenden islamistischen Gruppen sind. Deshalb überraschte es nicht, am 18. Januar in Le Monde zu lesen, dass der Premierminister Katars sich gegen die Intervention Frankreichs in Mali aussprach und die Operation „Serval“ ablehnte. Und was soll man von den Supermächten USA und China halten, die offiziell Frankreich unterstützen, um gleichzeitig hinter den Kulissen das Gegenteil zu tun und ihre eigenen Figuren in Stellung zu bringen?
Frankreich verstrickt sich im Sahel für eine lange ZeitWie für die USA in Afghanistan besteht das große Risiko, dass Frankreich im Morast des neuen Kriegsschauplatzes stecken bleibt. Frankreich wird schnell im „malischen Sumpf“ und der angrenzenden Sahel-Zone versinken; und es sieht danach aus, dass dies lange andauern wird (Hollande sagt: die „notwendige Zeit“). „Auch wenn die militärische Operation in Anbetracht der Gefahren gerechtfertigt ist, den die terroristischen, gut bewaffneten und immer fanatischer werdenden Gruppen darstellen, gibt es dennoch das Risiko, dass die Stabilität in der ganzen west-afrikanischen Region dauerhaft gefährdet wird und Frankreich in einen Sumpf gerät. Man muss die Lage mit Somalia vergleichen. Die Gewalt, die sich nach den tragischen Ereignissen von Mogadischu Anfang der 1990er Jahre ausbreitete, ist auf das ganze Horn von Afrika übergesprungen, so dass nun 20 Jahre danach noch immer keine Stabilität erreicht werden konnte“ (A. Bourgi, Le Monde, 15. 1.2013). Hier haben wir das Ergebnis der angeblich „humanitären“ und „antiterroristischen“ Kriege. Wenn die „großen Demokratien“ „zum Wohl des Volkes“, der „Moral“ und des „Friedens“ die Kriegstrommel rühren, bleiben tatsächlich immer Ruinen und Leichengeruch zurück.
Von Libyen bis Mali, von der Elfenbeinküste bis Algerien - das Chaos breitet sich immer weiter aus„Man kommt nicht umhin festzustellen, dass der jüngste Staatsstreich in Mali ein Kollateralschaden der Aufstände im Norden ist, die wiederum die Folgen der Destabilisierung Libyens durch eine westliche Koalition sind, die seltsamerweise keine Gewissensbisse und Schuldgefühle verspürt. Ebenso muss man feststellen, dass dieser afrikanische Wind Harmattan nun über Mali weht, nachdem er vorher durch die Nachbarstaaten Elfenbeinküste, Guinea, Niger und Mauretanien gezogen ist" (Courrier International, 11.4.2012). Tatsächlich kämpften viele bewaffnete Gruppen an der Seite Gaddafis; sie üben heute ihr Handwerk in Mali aus, nachdem sie zuvor noch die geheimen Waffenlager in Libyen geplündert hatten.
Doch die „westliche Koalition“ griff auch in Libyen angeblich nur ein, um Ordnung und Recht herzustellen und den Interessen des libyschen Volkes zu dienen. Heute leiden die Unterdrückten dieser Region unter der gleichen Barbarei und das Chaos sich weiter aus. Der Krieg in Mali wird auch Algerien destabilisieren. Am Donnerstag, den 17. Januar 2013, nahm eine Einheit von AQMI (al-Qaida in Mali) Hunderte von Beschäftigten in einer Gasförderanlage in Tagantourine als Geisel. Die algerische Armee ging massiv gegen die Geiselnehmer vor, auf beiden Seiten gab es viele Tote. Zu diesem Massaker hat Hollande wie jeder andere Kriegsherr, wie jeder Angehöriger der herrschenden Klasse, der ihre Interessen zu verteidigen sucht, erklärt: „Ein Land wie Algerien hat, wie mir scheint, die beste Antwort geliefert, denn man darf mit diesen Leuten nicht verhandeln.“ Der Eintritt Algeriens in den Sahel-Krieg, der von dem französischen Staatschef im Sinne der Logik des imperialistischen Krieges begrüßt wurde, zeigt den Teufelskreis auf, in dem der Kapitalismus steckt. „Die auf seinem Territorium bislang nicht dagewesene Eskalation treibt Algier ein Stückchen weiter in einen Krieg, den das Land um jeden Preis vermeiden wollte, weil es die Konsequenzen im Landesinnern befürchten muss.“ (Le Monde, 18. 1. 2013)
Seit Beginn der Krise in Mali betrieben die Machthaber in Algier ein doppeltes Spiel: Einerseits „verhandelte“ Algier mit islamistischen Gruppen, von denen sich einige gar auf algerischem Territorium mit Benzin versorgen konnten, um die Eroberung der Stadt Konna zu ermöglichen und ihren Vormarsch auf Bamako fortzusetzen. Andererseits hat Algerien französischen Militärflugzeugen den algerischen Luftraum zur Verfügung gestellt, damit sie dschihadistische Gruppen im Norden Malis bombardieren. Diese widersprüchliche Position und die Tatsache, dass die Kämpfer von AQMI so leicht auf die Gasförderanlage in diesem „sichersten Land“ vordringen konnten, offenbart, wie weit der Staatsapparat sowie die Gesellschaft Algeriens insgesamt verrottet sind. Wie schon die Entwicklung im Süden des Sahel wird der Eintritt Algeriens in den Krieg den Zerfallsprozess in der Region beschleunigen.
All diese Kriege zeigen, dass der Kapitalismus einer äußerst gefährlichen Spirale anheimfällt, die das Überleben der Menschheit aufs Spiel setzt. Ganze Weltregionen werden in Chaos und Barbarei gestürzt. Immer mehr vermischen sich die Gräueltaten der Folterknechte vor Ort (Warlords, Clanführer, terroristische Banden...) mit der Grausamkeit zweitrangiger Imperialisten (kleine und mittlere Staaten) und der vernichtenden Gewalt der großen Nationen. Jeder Beteiligte ist zu allem bereit, zu allen möglichen Intrigen, Manipulationen, Verbrechen, Attentaten. Die Grausamkeiten kennen keine Grenzen, wenn es darum geht, die eigenen Interessen zu verteidigen. Die ständigen Bündniswechsel vermitteln den Eindruck eines makabren Tanzballs.
Dieses todgeweihte System wird weiter in Gewalt versinken; die kriegerischen Konflikte werden sich weiter ausdehnen und immer größere Gebiete verwüsten. Für eine Seite Stellung beziehen, um „das geringere Übel“ zu verteidigen, heißt, sich dieser Dynamik zu unterwerfen, die keinen „Ausweg“ haben wird als noch mehr Tod und die Zerstörung der Menschheit. Nur eine Alternative ist realistisch, nur eine Kraft kann uns aus diesem Teufelskreislauf hinausführen: der massive und internationale Kampf der Ausgebeuteten auf der ganzen Welt für eine Gesellschaft ohne Klasse und ohne Ausbeutung, ohne Elend und ohne Krieg. Amina, 19.Januar 2013Gewerkschaftsdebatte, 1. Teil: Haben die Gewerkschaften einen „zwiespältigen“ Charakter ?
- 1771 Aufrufe
Im politischen Milieu im deutschsprachigen Raum, das den Anspruch hat, eine Rolle bei einer zukünftigen revolutionären Umgestaltung der menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu spielen, ist seit einiger Zeit eine Diskussion über das Wesen der Gewerkschaften im Gang. Es geht dabei insbesondere um die Fragen, ob die Arbeiterklasse sich noch auf diese Organe stützen könne und ob sie für eine Revolution mit dem Ziel einer Gesellschaft der freien Assoziation der Produzierenden von Nutzen oder umgekehrt ein Hindernis seien. Ein Beitrag zu dieser Diskussion ist Ende 2011 in Kosmoprolet Nr. 3 unter dem Titel Schranken proletarische Emanzipation – zur Kritik der Gewerkschaften erschienen. In der Schweiz ist die Debatte namentlich auf dem Internetforum undergrounddogs.net weiter geführt worden, wobei auch Artikel und andere Stellungnahmen der IKS zur Gewerkschaftsfrage zitiert und kritisiert worden sind.1 Der folgende Beitrag möchte auf zwei aus unserer Sicht offen gebliebene Fragen zurück kommen und versuchen, die begonnenen Gedanken weiter zu spinnen. Dabei geht es einerseits um die Frage, ob die Gewerkschaften heute einen eindeutigen Klassencharakter haben oder umgekehrt „zwiespältig“, „ambivalent“ seien, andererseits um das Argument, die IKS-Position zu den Gewerkschaften sei letztlich eine Art Verschwörungstheorie.
Klassencharakter der Gewerkschaften oder Ambivalenz?
In der Tradition der italienischen und französischen kommunistischen Linken, in der sich die IKS sieht, sind die Gewerkschaften seit Beginn der Dekadenz des Kapitalismus – seit dem Ersten Weltkrieg – Teil des kapitalistischen Staates. Da ab diesem Zeitpunkt die objektiven Bedingungen für eine revolutionäre Überwindung des Kapitalismus reif und umgekehrt für die Arbeiterklasse keine substantiellen und dauerhaften Reformen mehr herauszuschlagen sind, verlieren die bisherigen Organe der Arbeiterklasse, die sie sich zur Erkämpfung solcher Reformen geschaffen hatte, ihre Funktion. Sie werden für die Arbeiterklasse wertlos. Da sie aber nicht abgeschafft, sondern von der Bourgeoisie und ihrem Staat für ihre Zwecke angeeignet wurden (zur Erhaltung des „Burgfriedens“ und zur Mobilisierung der proletarischen Massen für den Krieg), verloren sie ihren proletarischen Klassencharakter2. Sie wurden in den totalitären Staat der Bourgeoisie (sei er demokratisch, stalinistisch oder faschistisch) integriert.3 Ihr Klassencharakter ist kapitalistisch, bürgerlich geworden. Die Gewerkschaftsführer sind oft Parlamentarier oder andere Funktionsträger des bürgerlichen Staats, während die Gewerkschaftsmitglieder weiterhin Arbeiter_innen sind, die sich je nach politischer und wirtschaftlicher Situation mehr oder weniger mit der Politik der Gewerkschaft identifizieren und sich durch sie vertreten fühlen – oder unabhängig von ihnen Kämpfe führen und sich selber organisieren.
Die in den Diskussionen aufgetauchte Position der Ambivalenz, des zwiespältigen Charakters der Gewerkschaften, unterscheidet nicht zwischen verschiedenen geschichtlichen Phasen des Kapitalismus, sondern versucht, das Wesen der Gewerkschaften rein „ihrem Inhalt nach“ zu bestimmen: „(…) die Gewerkschaften waren und sind keine Kampfform der Gesamtklasse. Dreierlei fällt auf, wenn man sie sich diesbezüglich anschaut: Erstens vertreten sie grundsätzlich die Interessen ihrer spezifischen Klientel und vertiefen damit die Zersplitterung der Arbeiterinnen und Arbeiter in Betriebe und Sektoren, sowie in Gelernte und Ungelernte. Zweitens sind die Gewerkschaften in ihrer Rolle als ‚Sozialpartner‘ im nationalen Rahmen entstanden und an diesen gebunden. (…) Auch die Spaltung der Klasse in Nationen wird somit von den Gewerkschaften verdoppelt. Drittens schliesslich ist zu beobachten, dass die Gewerkschaften – da sie sich in ihren Forderungen stets auf den vom Kapitalismus vorgegebenen Rahmen beschränken müssen – ihr Handeln immer an den durch die Konjunktur gegebenen Möglichkeiten ausrichten.“4
In der Diskussion auf undergrounddogs.net formuliert Muoit das zwiespältige Wesen so: „Die Gewerkschaften vertreten ähnlich wie der Staat das Interesse des Gesamtkapitals - auch gegen den Widerstand einzelner Kapitale oder Kapitalfraktionen - an der Reproduktion der Gesamtklasse und sie haben ein Interesse daran, dass die Arbeiterklasse verwaltet werden kann und nicht komplett aus dem Ruder läuft. In diesem Sinne sind sie tatsächlich ein Teil des Kapitals als gesellschaftlichem Verhältnis. Gleichzeitig aber sind sie Vertreter des variablen Kapitalteils, welches halt in der kapitalistischen Realität mit den immanenten Interessen der ArbeiterInnen zusammenfällt. Dieser Doppelcharakter zeigt die innere Widersprüchlichkeit der Gewerkschaften ziemlich gut auf: Auf der einen Seite vertreten sie ihre Klientel innerhalb des Kapitalismus - und sind dabei übrigens von der Mobilisierungsfähigkeit ihrer Basis abhängig! - andererseits haben sie dafür zu sorgen, dass die ArbeiterInnen eben gerade nicht unkontrollierbar werden und im Ernstfall dann mit ihrer Rolle als ArbeiterIn schluss machen wollen.“
Einigkeit besteht zwischen den beiden Positionen vermutlich in der Feststellung, dass die Gewerkschaften keine Organe der Revolution sind5. Die beiden Analysen scheiden sich auch nicht hinsichtlich der Frage, was passiert, wenn die Arbeiter_innen sich für ihre Kämpfe auf die Gewerkschaften verlassen: Diese haben die Aufgabe, die Kämpfe in Bahnen zu lenken, die das System nicht bedrohen, d.h. die nationalstaatliche Logik und ein in die verschiedenen Sektoren und Berufsgattungen gespaltenes Proletariat sind die Folgen. Grundsätzlich könnte man die gemeinsame Basis, auf der wir argumentieren, so zusammenfassen:
- Ablehnung jeder nationalstaatlichen Logik;
- das Proletariat muss für seine Ziele selbst kämpfen und
- sich dabei selbst, in eigenen von ihm kontrollierten Strukturen organisieren.
Worin besteht denn die wesentliche Differenz zwischen den beiden Positionen? – Vielleicht kann man sie so auf einen einfachen Nenner bringen: Während die IKS behauptet, dass die Gewerkschaften in der niedergehenden Phase des Kapitalismus für die Arbeiter_innen nicht nur unnütz sind, sondern ihrem Klassenfeind, der Bourgeoisie, dienen, entgegnet die „Position der Ambivalenz“: Dies ist zu einfach – wenn die Arbeiter_innen hinter den Gewerkschaften stehen, so fühlen sie sich in ihren Interessen, soweit diese im Kapitalismus realisierbar sind, vertreten und sind es auch; insofern sind die Gewerkschaften nicht nur Organe fürs Kapital, sondern auch fürs (nicht revolutionäre) Proletariat.
Aber die „Position der Ambivalenz“ macht es sich unseres Erachtens zu einfach, obwohl sie vorgibt, differenzierter zu sein.
Niemand wird bestreiten, dass die Gewerkschaften verschiedene Funktionen haben, je nach Sichtwinkel. Aus der Sicht eines Gewerkschaftsmitgliedes erfüllen diese Organisationen manchmal die Funktion, punktuelle, von ihm erwünschte Verbesserungen durchzusetzen. Aus der Sicht des bürgerlich-demokratischen Staates sind die Gewerkschaften „Sozialpartner“ und konstitutive Elemente der verfassungsmässigen Ordnung. Weiter ist auch klar, dass die Einstellung der Arbeiter und Arbeiterinnen zu den Gewerkschaften empirisch betrachtet ambivalent ist. In normalen Zeiten fühlen sie sich von ihnen vertreten; wenn es stürmisch wird, wenden sie sich enttäuscht von ihnen ab. Die Frage kann aber aus „kommunistischer“6 Sicht nicht sein, alle möglichen subjektiven Gesichtspunkte demokratisch gegeneinander abzuwägen und daraus eine „Objektivität“ zu kreieren – den Doppelcharakter –, sondern von einem Klassenstandpunkt aus zu bestimmen versuchen, welches ihre wesentliche Funktion ist.
Gehen wir von Muoits Feststellungen aus, dass die Gewerkschaften „Teil des Kapitals als gesellschaftlichem Verhältnis“ sind und „ähnlich wie der Staat das Interesse des Gesamtkapitals (…) an der Reproduktion der Gesamtklasse“ vertreten. Für die aufsteigende Phase des Kapitalismus wären wir mit dieser Charakterisierung nicht einverstanden, weil die Gewerkschaften in der damaligen Zeit ein lebendiger Ausdruck des Kampfes der Arbeiterklasse waren, auch wenn ihr Ziel nicht unmittelbar die Revolution war. Darin zeigt sich eine interessante Dialektik zwischen Ziel und Erreichbarkeit desselben: In den Zeiten, als die Gewerkschaften entstanden, erreichten sie genau die Ziele, die sie sich vornahmen – es ging um die langfristige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeiter_innen. Sie waren noch kein Organ, das im Interesse des Gesamtkapitals fungierte. Obwohl nicht explizit revolutionär waren die Gewerkschaften damals auf lange Sicht durchaus im Einklag mit den Interessen der Revolution. – Aber hier interessiert uns die Aktualität, so dass wir die Beschreibung Muoits gelten lassen können. Was folgt daraus? Die Gewerkschaften sind gemäss „Position der Ambivalenz“ Organe fürs Kapital – und gleichzeitig Organe fürs Proletariat. Sofern man von einem antagonistischen Verhältnis zwischen den Interessen des Proletariats und denen des Kapitals ausgeht (und diesen Ausgangspunkt werden die Verteidiger der Ambivalenz nicht in Frage stellen wollen), wäre dies als stabiler Zustand unmöglich. Dass Organe sich bekämpfender Klassen einen Doppelcharakter haben, kommt nur als Ausnahme in revolutionären Zeiten vor, beispielsweise bei den Sowjets bzw. Arbeiterräten im Frühsommer 1917 in Russland und im November/Dezember 1918 in Deutschland. Letztlich bedeutet die Position einer stabilen Ambivalenz, auf das Kriterium des Klassencharakters zu verzichten.
Vermutlich steckt hinter dieser Position die nicht zu Ende gedachte Erfahrung, dass es zwischen der „Klasse an sich“ und der „Klasse an und für sich“ in normalen Zeiten eine grosse Kluft gibt. Die „Klasse an sich“ ist das Proletariat, das in der Regel der herrschenden Ideologie unterworfen ist, in der bürgerlichen Demokratie mitmacht, die Gewerkschaften okay findet, in Milliarden von Individuen aufgeteilt ist – kurz: das Proletariat, das sich gar nicht als eigenständige und weltumspannende Klasse, als kollektives Subjekt wahrnimmt. Die „Klasse an und für sich“ ist das selbstbewusste, die Geschichte in die eigenen Hände nehmende Proletariat – eine Ausnahmeerscheinung. Bedeutet aber die Erfahrung, dass die Klasse im normalen kapitalistischen Alltag (selbst in wirtschaftlichen Krisenzeiten) seine antagonistischen Interessen zum Kapital nicht ausdrücklich formuliert, dass wir die Begriffe Klasseninteressen oder gar das Erkennen des Klassenwesens aufgeben müssen?
Marx schrieb in Die heilige Familie: „Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat, als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist, und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird.“ – Diese viel zitierte Stelle kann natürlich als Abkömmling des Hegelschen Weltgeistes oder schlicht deterministisch à la Bordiga7 interpretiert werden. Wenn man sich aber von diesen idealistischen Schalen befreit und nach dem materialistischen Kern fragt, so stösst man auf einen nützlichen Begriff: den des proletarischen Wesens, d.h. das, was das Proletariat geschichtlich ist (sein Sein). Daran misst sich das proletarische Interesse. Es zielt darauf ab, die kapitalistische Ausbeutung und damit sich selbst aufzuheben.
Gibt es einen Erkenntnisvorteil, wenn man von einem nicht eindeutigen, eben einem ambivalenten Charakter der Gewerkschaften ausgeht? Die „Position der Ambivalenz“ stellt sich als differenziert und „dialektisch“8 dar. Sie will insbesondere eine wesentliche Differenz zwischen dem Kapital und dem Staat machen: Die Gewerkschaften seien sehr wohl Teil des Kapitals als gesellschaftlichem Verhältnis, aber nicht Teil des Staats, obwohl sie wie dieser Interessen des Gesamtkapitals verträten. Selbst wenn wir diesem Gedanken folgen könnten und diese Differenzierung übernähmen, ist doch in Bezug auf die Frage des Klassencharakters der Gewerkschaften nichts Neues gewonnen. Wenn sie Teil der kapitalistischen gesamtgesellschaftlichen Reproduktion sind, üben sie eine Funktion fürs Kapital aus. Dass sie dabei gleichzeitig eine Funktion fürs Proletariat übernähmen, wird von der „Position der Ambivalenz“ nur insofern behauptet, als es um die „immanenten Interessen der Arbeiter_innen“ geht. Mit diesem Argument könnte auch ein kapitalistisches Unternehmen wie IKEA als ambivalent bezeichnet werden: Abgesehen davon, dass es dem Kapital Profit abwirft, kann sich auch der Arbeiter als Käufer an seinen neuen günstigen Möbeln freuen … Die subjektiven Befindlichkeiten von Gewerkschaftsmitgliedern oder Konsumenten zum Ausgangspunkt zu nehmen, wenn man die wesentliche Funktion einer gesellschaftlichen Organisation bestimmen will, ist nicht seriös. Die Dialektik dieses Zwiespalts ist die zwischen Wesen und – Schein.
Praktische Bedeutung der Divergenz?
Manche_r wird sich vielleicht in der Zwischenzeit gefragt haben, was die praktischen Folgen dieser scheinbar tiefschürfenden Meinungsverschiedenheiten sind. Wir wissen es auch nicht genau. Wir können es uns aber nicht verkneifen, da noch ein paar Gedanken anzustricken.
Betrachten wir die anscheinend praktischste aller Fragen – die der Intervention, des Eingreifens in den Klassenkampf. Verleitet die Position der Ambivalenz angesichts fehlender Kampfbereitschaft der „Klasse an sich“ nicht zur Schlussfolgerung, man könne das Terrain getrost der Gewerkschaften überlassen? Das Proletariat sei „selber schuld“, wenn es nur immanent kämpfe? – Fast jeder Kampf der Arbeiterklasse beginnt auf dem zunächst rein wirtschaftlichen Terrain der Verteidigung von vermeintlichen (oder tatsächlichen) Errungenschaften. Führt diese Position des zwiespältigen Charakters der Gewerkschaften nicht zur Aussage: Für solche Kämpfe sind die Gewerkschaften genau der richtige Helfer?
Wir haben diese Position in der laufenden Diskussion nicht gehört oder gelesen. Aber wenn es sie gäbe, wäre ihr zu entgegnen: Eine ambivalente Haltung gegenüber den Gewerkschaften in der heutigen Gesellschaft kann Ausdruck eines passiven Rollenverständnisses der Revolutionäre gegenüber der Kernfrage des Bewusstseins sein. Im Sinne von: Die Forderungen und Haltungen der Klasse „an sich“ seien in einem gewissen Sinne neutral – so sei sie halt, die Klasse, die „nur immanent“ kämpfe. Die Gewerkschaften helfen ihnen immanent, und für die grosse Sache ist nichts verloren – weit gefehlt! Wenn die Gewerkschaften (= „Vertreter des variablen Kapitalteils“) der richtige Ort für sich immanent wehrende Arbeiter sind, so sind sie logischerweise auch der richtige Ort für unser Eingreifen. So können, ja müssen wir Funktionen in diesem Räderwerk übernehmen, sei es im Gewerkschaftsapparat oder wenigstens an der Basis?
Die wohl gravierendste Schwäche und Konsequenz dieser Position der Ambivalenz ist die Reduzierung der Rolle der Gewerkschaften auf das ökonomische Terrain, da sie ja dort die Interessen des variablen Kapitals (sprich der Arbeiterklasse) repräsentieren würden. Die Gewerkschaften haben seit Beginn des 20. Jahrhunderts mitnichten nur in der Auseinandersetzung über Löhne, Arbeitsbedingungen oder Betriebsschliessungen eine Rolle gespielt. Sie waren (neben dem Tagesgeschäft der Teilnahme am demokratischen Abstimmungs- und Wahlzirkus)die unabdingbaren ideologischen und praktischen Faktoren für das Kapital zur Mobilisierung der Arbeiterklasse in die Weltkriege. Bekanntestes Beispiel dafür ist vielleicht die Rolle der deutschen Gewerkschaften 1914. Der Klassencharakter einer Organisation wie der Gewerkschaften zeigt sich unverblümt in Momenten der offenen Klassenkonfrontationen oder des Krieges. Gerade hier ist nicht nachvollziehbar, was die Rede vom „ambivalenten Charakter“ differenzieren will. Das Wesen der Gewerkschaften anhand einer auf die Ökonomie und die relativ „friedlichen Zeiten“ eingegrenzten Sichtweise beurteilen zu wollen, führt wohl zwangsläufig zu einer Unterschätzung ihrer konterrevolutionären Macht.
Da wird munter am alten kapitalistischen Verblendungszusammenhang gesponnen, unabhängig davon, ob sich die Protagonisten des Dramas dessen bewusst sind oder nicht.
Im zweiten Teil des Artikels werden wir auf die Kritik eingehen, die Haltung der IKS zu den Gewerkschaften habe Gemeinsamkeiten mit Verschwörungstheorien.Maluco, 29.01.13 - Fortsetzung folgt
2 Der Begriff des Klassencharakters oder Klassenwesens wird von dieser Position vorausgesetzt. Sie erklärt ihn nicht. Als Hinweis darauf, dass es sich dabei um eine für die Erkenntnis wichtige Kategorie handeln könnte, mag derjenige auf Marxens Analyse des Klassencharakters der Commune in Der Bürgerkrieg in Frankreich aushelfen (MEW 17 S. 342).
3 Diese Position wird ausführlicher begründet in unserer Broschüre Die Gewerkschaften gegen die Arbeiterklasse.
4 Kosmoprolet Nr. 3, S. 57 und 59f.
5 Auch auf diesem Gebiet wird es aber noch einige Fragen zu debattieren geben – z.B. mit den Anarchosyndikalist_innen.
6 So definiert wie im Kommunistischen Manifest: „Die Kommunisten unterscheiden sich von den übrigen proletarischen Parteien nur dadurch, dass sie einerseits in den verschiedenen nationalen Kämpfen der Proletarier die gemeinsamen, von der Nationalität unabhängigen Interessen des gesamten Proletariats hervorheben und zur Geltung bringen, andrerseits dadurch, dass sie in den verschiedenen Entwicklungsstufen, welche der Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie durchläuft, stets das Interesse der Gesamtbewegung vertreten.“
7 "Die kommunistische Revolution ist so sicher, als wäre sie bereits geschehen."
8 Muoit auf undergrounddogs.net: „Dialektik zwischen der Funktion der Gewerkschaften als Verwalter und Vertreter des variablen Kapitals und ihrer Rolle als Ordnungsfaktor“
"Gewerkschaftsdebatte, 2. Teil: Sind die Gewerkschaften Verschwörer? [504]"Historische Ereignisse:
- Gewerkschaftsdebatte [505]
Griechenland - Die Schuldenkrise und ihre Opfer
- 1680 Aufrufe
Die Krise im Euro-Raum nimmt immer dramatischere Züge an. Griechenland, das einst zu den Ländern mit den niedrigsten Selbstmordraten weltweit zählte, erlebt zurzeit eine Welle von Selbstmorden. Allein 2011 ist – laut der Zeitung „Ta Nea“ - die Selbstmordrate um 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. In vielen Abschiedsbriefen wird ausdrücklich die Krise als Grund für den Freitod angegeben, etliche Selbstmorde werden „öffentlich inszeniert, um auf die schlechte Lage aufmerksam zu machen“ (SPIEGEL online, 1 5.4.1 2). Doch dieses Phänomen ist nicht nur eine Reaktion auf die Krise und auf die mit ihr einhergehende Verarmung und Verelendung weiter Teile der Bevölkerung. Vollständig erklären lässt es sich nur, wenn man noch einen weiteren Faktor dabei berücksichtigt. Die Selbstmordwelle in Griechenland und anderswo wirft ein Schlaglicht auf die akute Perspektivlosigkeit, die derzeit beileibe nicht nur in der griechischen Arbeiterklasse grassiert. Im Gegensatz zu den Arbeitergenerationen des 19. Jahrhunderts, deren Kämpfe noch vom Streben nach einer besseren Gesellschaft beseelt gewesen waren, hat unsere Klasse heute ihren Glauben am Kommunismus verloren bzw. noch nicht wiederentdeckt. Auf Dauer reicht es jedoch nicht aus zu wissen, wogegen man kämpft; erst wenn sich die Ausgebeuteten auch bewusst sind, wofür sie kämpfen, erst wenn sie überzeugt sind, dass der Kommunismus nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist, wird ihr Widerstand jene moralische Kraft erlangen, die unerlässlich ist, um die Mutlosigkeit und Depression zu vertreiben, die sich derzeit in wachsenden Teilen der Arbeiterklasse breitmachen.
Noch eine andere Zahl lässt aufhorchen: Seit Ausbruch der Krise haben sich in Italien allein rund sechzig mittelständische Unternehmer das Leben genommen. Sie verzweifelten an säumige Schuldner, die selbst pleite sind, und an Banken, die nicht mehr bereit sind, Kredite zu vergeben. Ihr Freitod ist der krasseste Ausdruck für den Bankrott der herrschenden Klasse, für die Ausweglosigkeit der Lage der kapitalistischen Klasse, die – anders als im oben geschilderten Fall der Arbeiterklasse – nicht nur eine gefühlte, sondern auch eine faktische Ausweglosigkeit ist. Die Bourgeoisie, vom kleinen Familienunternehmer bis hin zum arrivierten Großkapital, ist eine Klasse, deren Uhr abgelaufen ist, die nur dank der Schwäche der Ausgebeuteten dieser Welt noch nicht von der historischen Bühne abgetreten ist.
Aktuelles und Laufendes:
- Suizide Griechenland [506]
- Suizide Krise [507]
Griechenland: "Gesundung" der Wirtschaft - Gefahr für unser Leben
- 2525 Aufrufe
Zur gleichen Schlussfolgerung kam Marc Sprenger, Leiter des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC). Dieser warnte am 6. Dezember, der Zusammenbruch der Gesundheitsversorgung und sogar der grundlegenden Hygiene in Griechenland könne in ganz Europa Pandemien in Gang setzen. Es fehlt an Geld für Handschuhe, Kitteln und Desinfektionstüchern, Wattebäuschen, Kathetern und Papierunterlagen zur Bedeckung von Untersuchungsbetten. Patienten mit hochinfektiösen Erkrankungen wie Tuberkulose erhalten nicht die notwendige Behandlung, das Risiko für die Ausbreitung resistenter Viren in Europa steigt.
Die Entwicklung in Griechenland führt uns den eklatanten Gegensatz vor Augen, der zwischen dem technisch Möglichen und der Wirklichkeit im Kapitalismus besteht.
Im 19. Jahrhundert starben oft bis zu einem Drittel der Patienten aufgrund mangelnder Hygiene in den Krankenhäusern, insbesondere Frauen bei der Entbindung. Was seinerzeit zu einem Großteil auf Unwissenheit zurückzuführen war, dass nämlich viele Ärzte und das Pflegepersonal sich vor Eingriffen nicht die Hände wuschen und oft mit blutverschmierten Kitteln von einem Patienten zum anderen eilten, wurde durch neue Erkenntnisse (zum Beispiel durch Semmelweis oder Lister) zurückgedrängt. Neue Hygienemaßnahmen und Entdeckungen hinsichtlich Keimübertragungen erlaubten eine deutliche Reduzierung der Infektionsgefahren im Krankenhaus; mittlerweile gehören Hygienehandschuhe und Einmalbesteck in den Operationssälen zum Mindeststandard moderner Medizin. Doch im Gegensatz zu den Zuständen im 19. Jahrhundert sind die jetzigen Gefahren, die in den Krankenhäusern in Griechenland erkennbar werden, kein Zeichen von Unwissenheit, sondern ein Ausdruck der Bedrohung der Menschheit durch ein vollkommen überholtes, bankrottes Produktionssystem.
Wenn heute in der einstigen Hochburg der Zivilisation, Griechenland, die Gesundheit von Menschen aufgrund von nicht bezahlbaren Hygienehandschuhen bedroht ist; wenn schwangere Frauen, die zur Geburt ins Krankenhaus kommen, abgewiesen werden, weil sie kein Geld oder keine Krankenversicherung haben; wenn herzkranke Menschen ihre lebenserhaltenden Medikamente nicht mehr bezahlen können, dann ist dies nicht anderes als ein vorsätzlicher und lebensgefährlicher Angriff gegen die Menschen. Die Tatsache, dass in einem Krankenhaus das für Hygiene unerlässliche Reinigungspersonal nicht mehr bezahlt wird und Ärzte sowie Pfleger, die selbst seit langem keinen Lohn mehr erhalten haben, die Putzaufgaben übernehmen, wirft ein bezeichnendes Licht auf die „Gesundung“ der Wirtschaft, von der die herrschende Klasse redet. Die „Gesundung" der Wirtschaft: eine Bedrohung für das Leben der Menschen!
Aber nicht nur in Griechenland wird das Gesundheitssystem abgebaut, nicht nur dort geht es scheibchenweise zugrunde. Auch anderswo wird das Gesundheitswesen immer mehr demontiert, wie zum Beispiel in Spanien. In der alten Industriehochburg Barcelona wie auch in anderen Städten werden Notaufnahmestationen zum Teil nur stundenweise geöffnet, um Kosten zu sparen. In Spanien, Portugal und Griechenland erhalten viele Apotheken wegen der Zahlungsunfähigkeit der Patienten bzw. wegen ihrer eigenen Insolvenz keine lebenswichtigen Medikamente mehr. So liefert die deutsche Pharmafirma Merck nicht länger ihre Krebsarznei „Erbitux“ an griechische Krankenhäuser. Biotest, ein Unternehmen, das aus Blutplasma Mittel zur Behandlung von Hämophilie und Tetanus gewinnt, hatte seine Lieferungen wegen unbezahlter Rechnungen schon im Juni eingestellt.
Kannte man bislang solch eine desolate medizinische Versorgung hauptsächlich aus afrikanischen Ländern oder aus vom Krieg zerrütteten Regionen, sorgt die Krise nun auch in den Industriezentren des Westens immer mehr dafür, dass lebenswichtigen Bereiche wie die Gesundheitsversorgung auf dem Altar des Profits geopfert werden. Medizin also nicht nach dem medizinischen Möglichen, sondern nur nach Barzahlung! Griechenland ist lediglich der extreme Ausdruck dessen, was auch im hiesigen Gesundheitssystem gängige Praxis ist: die Umwandlung der Krankenhäuser in „profit center“, die Metamorphose des Patienten zum „Kunden“ und die Banalisierung des kostbaren Gutes der Gesundheit zu einer einfachen Ware.Syrien - Ein weiteres Jahr Krieg
- 1617 Aufrufe
Historische Ereignisse:
- Syrien Krieg [508]
- Bürgerkrieg Syrien [509]
Weltrevolution Nr. 177
| Anhang | Größe |
|---|---|
| 2.95 MB |
- 1745 Aufrufe
10 Jahre Agenda 2010
- 1892 Aufrufe
Zehn Jahre nach der Verkündung der Agenda 2010 hat sich Deutschland vom ‚kranken Mann Europas‘ zum wirtschaftlichen Zugpferd des gesamten Kontinents entwickelt.“ So kommentierte das Zentralorgan der deutschen Bourgeoisie, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, in seiner Online-Ausgabe vom 13. März dieses Jahres den 10. Jahrestag der Ankündigung des in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis dahin schlimmsten Angriffs gegen die abhängig Beschäftigten dieses Landes. Dieser Angriff, der im Grunde aus einer Reihe von Einzelattacken bestand, die als „Hartz I bis IV“ (benannt nach Peter Hartz, einem ehemaligen VW-Manager, der seinerzeit von Schröder, damaliger Bundeskanzler einer rot-grünen Koalition, damit beauftragt wurde, die Einzelheiten dieser Angriffe auszuhecken) in die Annalen eingingen, veränderte die soziale Landschaft in Deutschland grundlegend. Er bedeutete das Ende der sog. „Sozialen Marktwirtschaft“, einst eines der Erfolgsgeheimnisse des „Wirtschaftswunders“ im Nachkriegsdeutschland, nun in den Augen der Herrschenden überflüssiger Ballast, den es schleunigst zu entsorgen galt.
Das „Modell Deutschland“ – ein Auslaufmodell
Um sich ein Bild von dem Ausmaß dieser Angriffe zu machen, hilft vielleicht ein Blick zurück auf den status ante quo, auf die ersten 40 Jahre der Bundesrepublik Deutschlands, als der Kalte Krieg noch seinen Schatten warf und die SPD, als sie noch mit der FDP die sozialliberale Koalition bildete, es sich noch leisten konnte, mit dem „Modell Deutschland“ hausieren zu gehen. Ohne den Blick zurück zu verklären, gehörte der Lebensstandard der westdeutschen Arbeiterklasse bis in die achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts zweifellos zu den höchsten in der gesamten Welt. Dies drückte sich zum einen in einer wachsenden Kaufkraft von „Otto Normalverbraucher“, die weit über die reinen Reproduktionskosten hinausging, und zum anderen in hohen Sozialstandards aus, die für ein relativ engmaschiges soziales Sicherungsnetz, aber auch für die Aufblähung der staatlichen und unternehmerischen Sozialausgaben (Renten-, Arbeitslosen-, Krankenversicherung, etc.) sorgten.
Das Phänomen des Wohlfahrtsstaates, das den gängigen marxistischen Vorstellungen von der absoluten Verelendung der Arbeiterklasse doch so offensichtlich zu widersprechen schien, hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen zwang der durch den blutigen Aderlass des Zweiten Weltkrieges bewirkte massive Mangel an Arbeitskräften die Unternehmen in den Zeiten des „Wirtschaftswunders“ zu erheblichen Lohnzugeständnissen. Trotz der Integration des Millionenheers der Vertriebenen in die bundesrepublikanische Wirtschaft war die Arbeitskraft insbesondere in den 1960er Jahren, den Jahren der Vollbeschäftigung, ein rares Gut, das es auch durch entsprechende Sozialleistungen wie die sog. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall oder die Arbeitslosenunterstützung (die bis in die 1970er Jahre fast 90 Prozent des Lohns betrug) zu hegen und zu pflegen galt. Zum anderen übte die Tatsache, dass Deutschland ein Frontstaat im Kalten Krieg war, einen nicht unerheblichen Druck auf die Herrschenden auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs aus, ihre Bevölkerung durch sozialpolitische Wohltaten „bei der Stange zu halten“.
Ab Ende der 1960er Jahre, das Ende der Wiederaufbauperiode wurde eingeläutet, begannen allmählich die Grundlagen des vielbesungenen Wohlfahrtstaates wegzubrechen. Die Krise, wenngleich anfangs in noch recht moderaten Ausmaßen, führte mit ihren Folgeerscheinungen wie der Massenarbeitslosigkeit zu einer Überbelastung der Sozialkassen; und die Hochlohnpolitik des Wohlfahrtstaates mündete letztendlich in Inflation. Doch während in Großbritannien und den USA diesen „Jahren der Illusion“, wie wir die 1970er Jahre charakterisierten, mit dem Machtantritt der erst kürzlich verstorbenen Margareth Thatcher in Großbritannien und von Ronald Reagan in den USA in den 80ern die „Jahre der Wahrheit“ folgten, blieb in der Bundesrepublik im Wesentlichen alles beim Alten. Sicherlich war die politische Klasse auch in Deutschland nicht untätig; da und dort wurde an den Stellschrauben des Sozialstaates zum Schaden der Arbeiterklasse gedreht. Doch schon in den achtziger Jahren häuften sich die Stimmen, die sich eine weitergehende „Reformierung“ des Sozialstaates oder gar gleich sein Ende wünschten. Gerne verwiesen diese Meinungsmacher dabei auf ausländische Stimmen, die den „unflexiblen“, „starren“ deutschen Arbeitsmarkt kritisierten, weil er nach dieser Lesart ausländischen Investoren den Eintritt in den deutschen Markt erschwerte, wenn nicht gar verunmöglichte. Doch die christlich-liberale Koalition unter Bundeskanzler Helmut Kohl, die 1982 mit dem Versprechen einer „geistig-moralischen Wende“ angetreten war, erwies sich als außerstande, zum großen Schlag gegen die Arbeiterklasse auszuholen. Die starken „Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft“ in der CDU, aber vor allem die Furcht der Konservativen vor gesellschaftlichen Widerständen ließ die Koalition vor allzu starken Einschnitten in den Wohlfahrtsstaat zurückschrecken.
Es gilt als sicher, dass die christlich-liberale Koalition unter Helmut Kohl nach zwei Legislaturperioden abgewählt worden wäre, wenn es im November 1989 nicht zum Fall der Berliner Mauer gekommen wäre. Denn während Kohls Rolle bei der „Wiedervereinigung“ in politischer Hinsicht ein Glücksfall für den deutschen Imperialismus war, erwies sie sich in ökonomischen Belangen als ein Desaster für die deutsche Bourgeoisie. Zwei Legislativperioden lang, von 1990 bis 1998, verharrte die Wirtschafts-und Sozialpolitik praktisch im Stillstand, mit verheerenden Folgen. Dank der immensen Wiedervereinigungskosten, die auch dadurch zustande kamen, dass das westdeutsche Sozialsystem quasi eins zu eins auf das wieder angeschlossene Ostdeutschland übertragen wurde, rutschte Deutschland vom Geberland in den Rang eines Schuldnerstaates, der sich auf den internationalen Finanzmärkten Kapital leihen musste. Neben den Kommunen und Arbeitsämtern ächzten auch die Unternehmen unter den hohen Lohnnebenkosten (Arbeitslosen-, Kranken-, Sozialversicherungsbeiträge sowie – neu hinzukommend – der sog. Solidaritätszuschlag), mit der Folge, dass nach der anfänglichen Wiedervereinigungseuphorie das Wachstum der deutschen Wirtschaft in den Keller ging. Mitte der 1990er Jahre nahm der Zustand der deutschen Wirtschaft solch besorgniserregende Züge an, dass die ganze Welt von Deutschland als den „kranken Mann Europas“ sprach.
Die Bundestagswahlen Ende 1998 waren eine Gelegenheit für die deutsche Bourgeoisie und ihre politische Klasse, die Notbremse zu ziehen und die Kohl-Regierung nach 16 Jahren endlich in die Wüste zu schicken. Dabei konnte sie auf eine Partei zurückgreifen, die in der Geschichte bereits mehrfach bewiesen hat, dass sie bis hin zur Selbstverleugnung bereit ist, das gesamtkapitalistische Interesse gegen partikularistische Einzelinteressen wie auch gegen umstürzlerische Bestrebungen zu verteidigen – die SPD. Und so wie der SPD-Politiker Gustav Noske mit den Worten: „Einer muss ja den Bluthund machen“ zur blutigen Niederschlagung des Aufstands der Berliner ArbeiterInnen im Januar 1919 angetreten war, so selbstverständlich schritt auch Gerhard Schröder zur Tat, nachdem seine rot-grüne Koalition im November 1998 ihre Regierungsgeschäfte antrat. Seine Koalition machte sich gleich in zweierlei Hinsicht um die Interessen der deutschen Bourgeoisie verdient: In ihrer ersten Amtszeit gelang es ihr ohne größere Blessuren, mit dem ersten Kriegseinsatz deutscher Soldaten nach dem II.Weltkrieg (im Rahmen des NATO-Einsatzes gegen Serbien 1999) den teils selbst auferlegten, teils von außen aufgezwungenen antibellizistischen Bann zu brechen. Das Gesellenstück allerdings gelang dieser Koalition nach ihrer Wiederwahl 2003 unter Federführung der SPD – die „Agenda 2010“. Es war aus Sicht der Herrschenden eine Meisterleistung, wie sie nur die alte „Tante“ SPD zustandebringen konnte, wenngleich um den Preis eines unerhörten Verlustes ihrer Reputation unter den Stammwählern, von dem sie sich bis heute noch nicht erholt hat.
Die Agenda 2010: Fitnessprogramm für den deutschen Kapitalismus
Der massivste Angriff gegen die Arbeiterklasse in Deutschland nach dem Krieg, unter dessen Namen „Agenda 2010“ die eingangs erwähnten Hartz-Gesetze und –regelungen zusammengefasst wurden, erfolgte auf mehreren Ebenen. Hier in aller Kürze die Kernpunkte. Es wurde:
- die bis dahin geltende Zumutbarkeitsregelung pulverisiert, die es Arbeitslosen gestattete, Arbeitsangebote des Arbeitsamtes abzulehnen, die unterhalb ihrer Qualifikation waren;
- die sog. Flexibilisierung der Arbeit massiv ausgeweitet, und zwar in Gestalt prekärer, unterbezahlter Arbeitsplätze (Zeitarbeit, Ich-AG, 400 Euro-Jobs, etc.);
- die sog. Parität zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten bei der Finanzierung der Sozialbeiträge zuungunsten Letzterer aufgehoben;
- die staatliche Hilfe für Arbeitslose massiv eingeschränkt, indem Arbeitslose nur noch ein Jahr lang Arbeitslosenunterstützung beziehen und die Sozialhilfe mit der sog. Arbeitslosenhilfe (Hartz IV oder ALG2) zusammengelegt wurde.
Die Auswirkungen der Agenda 2010 waren dramatisch und bestimmen bis heute das gesellschaftliche Geschehen. Dabei profitieren Unternehmen, Banken, Versicherungsträger und nicht zuletzt der Staat in vielfältiger Weise von der Agenda 2010, nachdem deren anfängliche handwerkliche Fehler behoben worden waren. Vor allem die Kombination aus Flexiblisierung und Verbilligung eines Teils der Arbeitskräfte hat sich dabei schon jetzt als überaus vorteilhaft für Wirtschaft und Staat in Deutschland herausgestellt. Als 2008 Lehman Brothers kollabierte und die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession stürzte, konnte die deutsche Bourgeoisie auf zwei Instrumente zurükgreifen, um die Folgen dieser weltweiten Rezession im Vergleich zu ihren Kontrahenten auf dem Weltmarkt relativ gut abzufedern. Neben der Kurzarbeit handelte es sich dabei um ein Mittel, das Marx einst die „industrielle Reservearmee“ nannte: das Heer der Arbeitslosen, aus dem das Kapital schöpft, um Produktionsspitzen zu kompensieren. Denn mit der Abschaffung der Umzumutbarkeitsklausel und der massiven Kürzung der Arbeitslosenunterstützung waren die Grundlagen für den enormen Ausbau der Zeitarbeitsbranche gelegt worden, die mit Löhnen knapp oberhalb von Hartz IV eine wachsende Schar von ArbeiterInnen köderten. Insbesondere die Automobilindustrie bediente sich dieses Mittels, um in den Nullerjahren die Nachfragespitzen abzudecken und – nach der Lehman-Pleite – die entstandenen Überkapazitäten ohne größere Unkosten und Widerstände abzubauen, indem zigtausende von ZeitarbeiterInnen von einem Tag auf den anderen entlassen wurden.
Die Entwertung der Arbeitskraft hat aber besonders im sog. Dienstleistungsbereich in Deutschland Einzug gehalten. Einzelhandel, Gastronomie, Callcenter, der Pflege- und Sozialbereich, das Reinigungsgewerbe – alle Bereiche, in denen das konstante Kapital, sprich: die menschliche Arbeitskraft, anders als im produzierenden Gewerbe, noch die Hauptrolle spielt, erlebte in den vergangenen zehn Jahren einen dramatischen Einbruch in den Löhnen. Deutschland gehört mittlerweile zu den Ländern mit der stärksten Zunahme der Niedriglohnarbeit auf der Welt. Diese Politik hat ein Ausmaß angenommen, dass sie die Rivalen Deutschlands auf den Plan rief. Bereits im März 2010 kritisierte die damalige französische Finanzministerin Christine Lagarde ungewöhnlich scharf die Politik des „Lohndumpings“ in Deutschland, die das Gleichgewicht in der Europäischen Union zu gefährden drohe. In der Tat haben beispielsweise Einzelhandelsketten wie Aldi, Plus, Metro, etc. ihre Expansion in alle Welt, aber besonders in Europa aller Wahrscheinlichkeit nach mit der Überausbeutung ihrer einheimischen Beschäftigten finanziert. Minijobs, 400 Euro-Jobs, sog. Werkverträge, etc. haben die Kernbelegschaften der Supermärkte marginalisiert und einen erheblichen Druck auf ihre Löhne ausgeübt.
Neben dem Privatkapital waren die öffentlichen Kassen die Hauptnutznießer der Agenda 2010. Nach dem finanziellen Aderlass der „Wiedervereinigung“, der die deutsche Bourgeoisie dazu genötigt hatte, die von ihr selbst durchgesetzten Stabilitätskriterien von Maastricht aufzuweichen, sorgten die drastischen Streichungen in den staatlichen Sozialausgaben (immer noch der größte Einzeletat der Bundesregierung) und steigende Beschäftigungszahlen in den vergangenen zehn Jahren für eine deutliche Entlastung der öffentlichen Etats. Die Neuverschuldung geht stetig zurück; bereits in den nächsten zwei Jahren soll die Netto-Neuverschuldung des deutschen Staates auf Null reduziert werden.
„Dass Deutschland heute wirtschaftlich so viel besser dasteht als die Mehrzahl der EU-Partner, ist ein Ergebnis der Agenda 2010. Es hat wesentlich dazu beigetragen, dass (…) Deutschland heute weitaus wettbewerbsfähiger als vor 2003.“ (Heinrich August Winkler, Historiker, in einem Interview mit dem Berliner TAGESSPIEGEL) Natürlich ist die neuerliche Verschärfung der Weltwirtschaftskrise in Gestalt der Immobilien- und Schuldenkrise nicht spurlos an der deutschen Wirtschaft vorübergegangen. Auch deutschen Banken drohte die Insolvenz, auch hierzulande fielen die Wachstumszahlen nach dem Ausbruch der Lehman-Pleite auf ein historisches Tief. Deutschland ist mitnichten eine Insel der Seligen im kapitalistischen Krisengewitter, aber in gewisser Weise ist der deutsche Kapitalismus auch ein Krisengewinner, der von dem Umstand profitiert, dass sich seine Konkurrenten, insbesondere seine europäischen Rivalen, als noch anfälliger gegenüber den Folgen der Krise erwiesen haben. Deutschland ist stark, weil die anderen schwach sind. Seine derzeitige Stärke bezieht der deutsche Imperialismus aus dem Versäumnis seiner Rivalen, ihre Volkswirtschaften ähnlich wetterfest zu gestalten, wie dies in Deutschland vor zehn Jahren mit der Agenda 2010 geschah.
Damit kein falscher Zungenschlag entsteht: Deutschland ist keinesfalls auf dem Sprung zu einem imperialistischen Blockführer. Genausowenig wie China ist der deutsche Imperialismus in der Lage, die US-amerikanische Supermacht ernsthaft herauszufordern. Doch die deutsche Bourgeoisie denkt langfristig oder vielmehr: sie praktiziert notgedrungen eine Politik der kleinen Schritte. So strebt sie derzeit die Einführung einer gemeinsamen europäischen Fiskalpolitik nach deutschen Maßstäben an, die – geht es nach den Vorstellungen der deutschen Europa-Politiker - ein erster wichtiger Baustein beim Aufbau der sog. Politischen Union sein soll. Und die Ironie der Geschichte will es, dass ausgerechnet die Agenda 2010, die seinerzeit auch von den Rivalen Deutschlands aus Sorge um den miserablen Zustand der deutschen Volkswirtschaft begrüßt worden war, nun der deutschen Bourgeoisie bei diesem Unterfangen den notwendigen Rückenwind verschafft hat.
Die Rückkehr der Verelendung der Arbeiterklasse
Hauptleidtragender der Agenda 2010 ist die Arbeiterklasse in Deutschland. Es wäre falsch verstandener Alarmismus, würde man behaupten, dass die Lage der heutigen Arbeiterklasse in Deutschland jener von 1929 gleicht, als die erste Weltwirtschaftskrise unsere Großeltern von einem Tag auf den anderen in tiefstes Elend stürzte. Und dennoch erleben wir nun schon seit Jahren eine schleichend um sich greifende Verelendung eines großen Teils der hiesigen Arbeiterklasse, sind wir Zeuge einer Zweiteilung des Arbeitsmarktes, wenn nicht gar einer Spaltung der Arbeiterklase in Deutschland.
Auf der einen Seite haben wir das so genannte „Prekariat“, das rasch anwächst. Über ein Viertel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze in Deutschland ist heute bereits prekärer Natur. Das Phänomen der workingpoor, d.h. jener Teile unserer Klasse, deren Einkommen nicht reicht, um ihre Regenerationskosten zu begleichen, hat dramatisch zugenommen; immer mehr ArbeiterInnen müssen ihren buchstäblichen Hungerlohn mit zusätzlichen Unterstützungszahlungen im Rahmen des sog. Arbeitslosengeldes II aufstocken. So lebt in Berlin mehr als die Hälfte der Bevölkerung völlig oder teilweise von Hartz IV. Nicht zuletzt sind es die Kinder, die an den Folgen der Armut leiden: Mehr als 2,5 Millionen Kinder in Deutschland gelten als arm; sie gehen mit knurrendem Magen in die Schule und sind von allen kostenträchtigen Unternehmungen (Klassenfahrten, Bildungsunterstützung, Vereine, etc.) ausgeschlossen. Darüber hinaus rollt in ein paar Jahren noch ein weiteres Problem auf die Gesellschaft zu, denn die prekär Beschäftigten von heute sind die Armutsrentner von morgen; ihnen droht eine Mindestrente von ein paar Hundert Euro – zuwenig zum Leben, zuviel zum Sterben.
Auf der anderen Seite gibt es die sog. Kernbelegschaften, deren Zahl immer mehr schrumpft: die festangestellten, hoch qualifizierten und spezialisierten, nach Tarif bezahlten Arbeitskräfte in Industrie und Handwerk. Neben dem „Privileg“ der Festanstellung kommt dieser Teil unserer Klasse auch in den Genuss tariflicher und außertariflicher Sonderzahlungen, wie die vierstelligen Sondervergütungen in der deutschen Automobilindustrie in den vergangenen Jahren. Doch der Schein trügt. Auch über diesem Teil der Beschäftigten schwebt das Damoklesschwert von Hartz IV, nicht nur als Drohung im Falle der Unbotmäßigkeit gegenüber dem Brötchengeber, sondern auch ganz konkret als permanenter Druck auf Löhne und Gehälter. Denn die paar Extrazahlungen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass seit Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts die tariflichen Reallöhne der Kernbelegschaften kontinuierlich gesunken sind.
Angesichts der Brutalität der Angriffe und verglichen damit, wie sich noch vor rund 30 Jahren die Beschäftigten schon gegen weitaus harmlosere Attacken seitens des Kapitals zur Wehr gesetzt hatten, nahmen sich die Proteste der Klasse gegen die Agenda 2010 wie ein laues Lüftchen aus. Nachdem es anfangs, nach der Verabschiedung der Hartz IV-Gesetze, wenigstens noch zu der einen oder anderen Großdemonstration (vor allem in Berlin) mit mehr als 100.000 Teilnehmern gekommen war, versandeten die Proteste anschließend schnell bzw. gerieten (wie die sog. Montagsdemonstrationen) in die Fänge von linksextremistischen Sektierern wie der MLPD. So stellt sich die Frage: Haben die Lohn- und Gehaltsabhängigen dieses Landes den Kampf bereits verloren, noch ehe er richtig begonnen hat? Wir denken, dass dem nicht so ist. Was wir allerdings auch konstatieren müssen, ist, dass es den Herrschenden in Deutschland bislang vortrefflich gelungen ist, die Arbeiterklasse in Deutschland mittels des uralten Herrschaftsprinzips des „Teile und herrsche“ in einem Zustand der vorläufigen Lähmung zu versetzen. Indem sie über die „Asozialität“ der so genannten Unterschichten deliriert und gleichzeitig die Besserverdienenden auf nicht nachvollziehbare Weise dem wie auch immer gearteten „neuen Mittelstand“ zurechnet, hat sie für eine gewisse Entfremdung zwischen beiden Bereichen der Arbeiterklasse gesorgt. So kam es bisher zu keinerlei nennenswerter Solidarisierung seitens der Kernbelegschaften mit den prekär beschäftigten KollegInnen; und unter Letzteren gab es, sofern sie sich nicht willig ihrem Schicksal beugten, gelegentlich die Neigung, im festangestellten Kollegen den Sündenbock für ihre katastrophale Lage zu sehen. Darüber hinaus herrscht in weiten Teilen unserer Klasse angesichts der Elendsbilder aus Griechenland und anderswo das Gefühl vor, man sei hierzulande noch einmal davongekommen. Daher gelte es, die Füße stillzuhalten, damit uns nicht das gleiche Los erwischt wie unserer griechischen, zypriotischen, portugiesischen und spanischen Klassenbrüdern und –schwestern. Diese Illusion wird auch noch durch den Umstand verstärkt, dass immer mehr junge Spanier und Griechen ihre Zukunft auf dem deutschen Arbeitsmarkt suchen, und von der ernüchternden Erkenntnis unterfüttert, dass die Abwehrkämpfe der griechischen Beschäftigten allem Anschein nach bisher ins Leere gelaufen sind, dass ihr Widerstand offenkundig nichts an ihrer elenden Lage verändert hat, jedenfalls nicht zum Guten.
Jedoch kann dieser Zustand, wie schon gesagt, nur vorläufiger Natur sein. Krise und Konkurrenzdruck zwingen das Kapital in Deutschland dazu, die Kernbelegschaften immer weiter zu schröpfen und ihre Lebens-und Arbeitsbedingungen jener der prekär Beschäftigten anzupassen – und beide zusammen Zug um Zug denselben Bedingungen auszusetzen, wie sie derzeit bereits in Südeuropa herrschen. Die Nivellierung des Lebensstandards nach unten wird so letztendlich dafür sorgen, dass zusammengeführt wird, was zusammengehört: „Unterschichten“ wie Kernbelegschaften oder der „neue Mittelstand“ sind alles Bestandteile ein-und derselben Gesellschaftsklasse, die nur vereint diesem kapitalistischen Jammertal ein Ende bereiten kann, vorausgesetzt, sie beschränken ihren Kampf nicht mehr allein auf die letztendlich vergebliche Verteidigung ihrer Positionen innerhalb des Systems, sondern machen sich auch eine Perspektive zu eigen, die über die kaputte und kaputt machende kapitalistische Gesellschaft hinausreicht.
Aktuelles und Laufendes:
- 10 Jahre Agenda 2010 [511]
Die Rolle der Frau bei der Entstehung der menschlichen Kultur, Teil 2
- 2217 Aufrufe
Die Rolle der Frauen in der primitiven Gesellschaft
Was ist laut Christophe Darmangeat schließlich die Rolle und die Situation der Frauen in der primitiven Gesellschaft? Wir können hier nicht die gesamte Argumentation wiedergeben, die in seinem Buch enthalten ist und die sich durch solide Kenntnisse der Ethnographie und bemerkenswerte Beispiele auszeichnet. Wir werden uns stattdessen auf eine Zusammenfassung seiner Schlussfolgerungen beschränken.
Eine erste Feststellung, die einleuchtend erscheint, es in der Realität aber nicht ist, lautet, dass die geschlechtliche Arbeitsteilung eine universelle Konstante in der menschlichen Gesellschaft bis zum Erscheinen des Kapitalismus ist. Der Kapitalismus bleibe eine fundamental patriarchalische Gesellschaft, die auf der Ausbeutung basiert (welche die sexuelle Ausbeutung, die Sexindustrie als eine der profitabelsten Industrie in der neueren Zeit mit beinhaltet). Nichtsdestotrotz habe der Kapitalismus durch die offene Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft und durch die Entwicklung einer Maschinerie (so dass die Körperkraft nicht mehr eine wichtige Rolle im Arbeitsprozess spielt) die Arbeitsteilung zwischen der „maskulinen“ und der „femininen“ Rolle in der gesellschaftlichen Arbeit zerstört. Auf diese Weise habe er das Fundament für eine wirkliche Befreiung der Frauen in der kommunustischen Gesellschaft gelegt.[2]
Die Lage der Frauen unterscheidet sich in den unterschiedlichen primitiven Gesellschaften, die Anthropologen zu untersuchen in der Lage waren, enorm: In einigen Fällen leiden Frauen unter einer Unterdrückung, die mehr als einen flüchtigen Vergleich mit der Klassenunterdrückung standhält, während sie in anderen nicht nur eine gesellschaftliche Wertschätzung genießen, sondern auch ganz real gesellschaftliche Macht ausüben. Wo solche Macht existiert, basiert sie auf den Eigentumsrechten über die Produktion, die durch das religiöse und rituelle Leben der Gesellschaft verstärkt werden: Um nur ein Beispiel zu nennen, berichtet uns Bronislaw Malinowski (in Argonauten des westlichen Pazifik), dass die Frauen der Trobriand-Inseln nicht nur das Monopol auf die Arbeit des Gartenbaus (von größter Bedeutung für die Inselwirtschaft) hatten, sondern auch auf verschiedene Formen der Magie, einschließlich jener, die als die gefährlichsten anerkannt sind)[3].
Während jedoch die geschlechtliche Arbeitsteilung von einem Volk und einer Existenzweise zum/zur nächsten sehr unterschiedliche Situationen umfassen kann, gibt es eine Regel, die fast ohne Ausnahme angewandt wird: Überall sind es die Männer, die das Recht haben, Waffen zu tragen, und die daher ein Monopol auf die Kriegführung haben. Infolgedessen haben sie ein Monopol auf die „äußeren Beziehungen“. Als sich die gesellschaftliche Ungleichheit zu entwickeln begann, zunächst mit der Lagerhaltung von Lebensmitteln, dann, in der Jungsteinzeit, mit der voll entfalteten Landwirtschaft und dem Aufkommen des Privateigentums und der gesellschaftlichen Klassen, erlaubte es ihre spezifische Situation den Männern, Stück für Stück die Totalität des Gesellschaftslebens zu dominieren. In diesem Sinn lag Engels zweifellos richtig, wenn er in Ursprung der Familie… sagte: „Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts durch das männliche“.[4] Dennoch sollte man tunlichst vermeiden, die Dinge schmeatisch zu betrachten, da selbst die ersten Zivilisationen in dieser Hinsicht alles andere als homogen waren. Eine Vergleichsstudie etlicher früher Zivilisationen[5] weist auf ein breites Spektrum hin: Während die Lage der Frauen in mittelamerikanischen und Inkagesellschaften wenig beneidenswert war, besaßen beispielsweise unter den Yoruba in Afrika die Frauen nicht nur Eigentum und übten ein Monopol auf bestimmte Produkte aus, sie betrieben auch einen ausgedehnten Handel auf eigene Rechnung und konnten selbst diplomatische und militärische Expeditionen anführen.
Die Frage der Mythologie
Bisher beschränkten wir uns mit Darmangeat auf den Bereich von Untersuchungen „historisch bekannter“ primitiver Gesellschaften (in dem Sinn, dass sie von den schriftkundigen Gesellschaften, von der antiken Welt bis zur modernen Anthropologie, beschrieben worden waren). Dies kann uns allenfalls etwas über die Lebensumstände seit der Erfindung der Schrift vor ungefähr 6000 Jahren verraten. Doch was können wir über die 200.000 Jahre des anatomisch modernen Menschen sagen, die dem vorausgingen? Wie sollen wir den entscheidenden Augenblick verstehen, als die Natur der Kultur als determinierender Hauptfaktor im menschlichen Verhalten Platz machte, und wie sind genetische und kulturelle Elemente in der menschlichen Gesellschaft miteinander verwoben? Um diese Fragen zu beantworten, ist eine rein empirische Betrachtung bekannter Gesellschaften völlig unzureichend.
Einer der auffälligsten Aspekte in der Untersuchung früher Zivilisationen (s.o.) ist, dass, wie unterschiedlich auch immer das Bild ist, das sie von den Lebensbedingungen der Frauen zeichnen, sie alle Legenden enthalten, die sich auf Frauen als Häuptlinge beziehen, welche gelegentlich mit Göttinnen identifiziert werden. Alle von ihnen haben im Laufe der Zeit einen Niedergang in der Lage der Frauen erlebt. Man ist versucht, ein allgemeines Gesetz hierin zu erblicken: Je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto größer war die gesellschaftliche Autorität, die die Frauen besaßen.
Dieser Eindruck wird bestätigt, wenn wir noch primitivere Gesellschaft untersuchen. Auf jedem Kontinent finden wir ähnliche oder gar identische Mythen: Einst besaßen die Frauen Macht, doch seither haben die Männer ihnen diese Macht entrissen, und nun sind sie es, die herrschen. Überall wird die Macht der Frauen mit dem mächtigsten Zauber von allen in Verbindung gebracht: dem Zauber, der auf dem Monatszyklus der Frauen und ihrem Menstruationsblut basiert, was bis zu Ritualen reicht, in denen Männer die Menstruation imitieren.[6]
Was können wir aus dieser allgegenwärtigen Realität schließen? Können wir daraus den Schluss ziehen, dass sie eine historische Realität repräsentiert und dass einst eine Gesellschaft existierte, in der Frauen eine führende, wenn nicht gar notwendigerweise eine herrschende Rolle innehielten?
Für Darmangeat ist die Antwort unmissverständlich und negativ: „… der Gedanke, dass Mythen, die von der Vergangenheit berichten, von einer wirklichen Vergangenheit, wenn auch deformiert, erzählen, ist eine äußerst kühne, um nicht zu sagen: haltlose Hypothese“ (S. 167). Mythen „erzählen Geschichten, die nur in Bezug auf die gegenwärtige Realität eine Bedeutung haben und die die Funktion haben, Letztere zu rechtfertigen. Die Vergangenheit, von der sie sprechen, wird allein dafür erfunden, um dieses Ziel zu erfüllen“ (S. 173).
Dieses Argument ist in zweierlei Hinsicht problematisch.
Das erste Problem ist, dass Darmangeat ein Marxist zu sein behauptet, der bei der Aktualisierung seiner Schlussfolgerungen der Methode von Engels treu geblieben sei. Doch auch wenn Engels‘Ursprünge der Familie… sich ausgiebig auf Lewis Morgan stützt, pflichtet er auch dem Werk des Schweizer Juristen Bachofen große Bedeutung bei, der der erste war, der die Mythologie als eine Grundlage zum Verständnis der Geschlechterbeziehungen in der fernen Vergangenheit benutzte. Laut Darmangeat ist Engels „überaus vorsichtig bei seiner Rezeption von Bachofens Matriarchats-Theorie (…) obgleich er sich zurückhält bei der Kritik an der Theorie des Schweizer Juristen, unterstützt er sie nur sehr eingeschränkt. Es gibt nichts Überraschendes hier: In Anbetracht seiner eigenen Analyse der Gründe für die Vorherrschaft des einen Geschlechts über das andere konnte Engels kaum akzeptieren, dass vor der Entwicklung von Privateigentum der Vorherrschaft der Männer über die Frauen die Vorherrschaft der Frauen über die Männer vorausging; er stellte sich die prähistorischen Geschlechterbeziehungen vielmehr als eine bestimmte Form der Gleichheit vor“ (S. 150f.).
Engels mag durchaus vorsichtig gewesen sein, was Bachofens Schlussfolgerungen anbelangte, aber er hatte keine Bedenken, was Bachofens Methode anging, die die mythologische Analyse nutzte, um die historische Wirklichkeit zu enthüllen: In seinem Vorwort zur 4. Ausgabe vonUrsprung der Familie… (mit anderen Worten: nachdem er eine Menge Zeit hatte, sein Werk neu zu strukturieren, einschließlich einiger notwendiger Korrekturen) griff Engels Bachofens Analyse des Orest-Mythos (insbesondere die Version des griechischen Tragikers Aescyklus) auf und schloss mit dem Kommentar: „Diese neue, aber entschieden richtige Deutung der ‚Oresteia‘ ist eine der schönsten und besten Stellen im ganzen Buch (…) er, zuerst, hat die Phrase von einem unbekannten Urzustand mit regellosem Geschlechtsverkehr ersetzt durch den Nachweis, daß die altklassische Literatur uns Spuren in Menge aufzeigt, wonach vor der Einzelehe in der Tat bei Griechen und Asiaten ein Zustand existiert hat, worin nicht nur ein Mann mit mehreren Frauen, sondern eine Frau mit mehreren Männern geschlechtlich verkehrte, ohne gegen die Sitte zu verstoßen (…) Diese Sätze hat Bachofen zwar nicht in dieser Klarheit ausgesprochen – das verhinderte seine mystische Anschauung. Aber er hat sie bewiesen, und das bedeutete 1861 eine vollständige Revolution.“
Dies bringt uns zur zweiten Frage: Wie sollten Mythen erklärt werden? Mythen sind Bestandteil der materiellen Realität wie andere Phänomene auch; sie sind daher von dieser Realität auch bestimmt. Darmangeat schlägt zwei mögliche Determinanten vor: Entweder handelt es sich bei ihnen schlicht und einfach um „Geschichten“, die von Männern erfunden wurden, um ihre Herrschaft über die Frauen zu rechtfertigen, oder sie sind irrational. „In der Vorgeschichte und auch lange Zeit danach waren natürliche oder gesellschaftliche Phänomene universell und unvermeidlich durch ein magisch-religiöses Prisma interpretiert. Dies bedeutet nicht, dass das rationale Denken nicht existierte; es bedeutet, dass es selbst, als es präsent war, in einem bestimmten Umfang stets mit einem irrationalen Diskurs kombiniert war: Die beiden wurden nicht als unterschiedlich, noch weniger als miteinander unvereinbar wahrgenommen“ (S. 319). Was kann dem noch hinzugefügt werden? All diese Mythen, die sich rund um die geheimnisvollen Mächte ranken, welche vom Menstruationsblut und dem Mond übertragen werden, gar nicht zu reden von der ursprünglichen Macht der Frauen, sind bloß „irrational“ und somit außerhalb des Bereichs der wissenschaftlichen Erklärung. Darmangeat ist bestenfalls bereit zu akzeptieren, dass Mythen das Bedürfnis des menschlichen Geistes nach Kohärenz befriedigen müssen[7]; doch wenn dies der Fall ist, dann müssen wir - es sei denn, wir akzeptieren eine rein idealistische Erklärung im ursprünglichen Sinn des Wortes – eine andere Frage beantworten: Woher kommt dieses Bedürfnis? Für Lévi-Strauss konnte die Quelle des bemerkenswerten Gleichklangs der Mythen der primitiven Gesellschaften in beiden Amerikas nur in der angeborenen Struktur des menschlichen Geistes gefunden werden, weswegen seinem Werk und seiner Theorie der Name „Strukturalismus“ angehängt wurde.[8] Darmangeats „Bedürfnis nach Kohärenz“ sieht wie ein schwacher Abglanz des Strukturalismus von Lévi-Strauss aus.
Dies lässt uns in zwei bedeutenden Punkten ohne jegliche Erklärung dastehen: Warum nehmen Mythen die Form an, die sie haben, und wie können wir ihre Universalität erklären?
Wenn sie nichts anderes als „Geschichten“ sind, die erfunden wurden, um die männliche Vorherrschaft zu rechtfertigen, warum sind solch unwahrscheinlichen Geschichten erfunden worden? Wenn wir die Bibel nehmen, so gibt uns das Buch Mose‘ eine vollkommen logische Erklärung für die männliche Vorherrschaft: Gott schuf den Mann zuerst! Logisch, solange wir bereit sind, die unwahrscheinliche Vorstellung, die Jahr für Jahr widerlegt wird, zu akzeptieren, dass die Frau aus dem Leib des Mannes kam. Warum wird dann ein Mythos erfunden, der nicht nur behauptet, dass Frauen einst Macht ausgeübt hatten, sondern auch von der Forderung begleitet wird, dass die Männer mit diesen Riten fortfahren, die mit dieser Macht assoziiert sind, bis zu dem Punkt einer eingebildeten männlichen Menstruation? Diese Praxis, die in Jäger-Sammler-Gesellschaften in der ganzen Welt, wo die männliche Vorherrschaft mächtig ist, bezeugt ist, besteht darin, dass Männer in bestimmten wichtigen Ritualen ihren eigenen Blutfluss erzeugen, indem sie in einer bewussten Imitation der Monatsblutung ihre Mitglieder malträtieren und insbesondere den Penis beschneiden.
Wäre diese Art von Ritual auf ein Volk oder auf eine Gruppe von Völkern beschränkt, könnte man akzeptieren, dass dies nichts als eine zufällige und „irrationale“ Erfindung ist. Doch wenn wir es überall auf der Welt verbreitet finden, auf jedem Kontinent, dann müssen wir, wenn wir dem historischen Materialismus treu bleiben wollen, seine gesellschaftlichen Determinanten suchen.
Auf jeden Fall erscheint es uns vom materialistischen Standpunkt aus notwendig zu sein, die Mythen und Rituale, die die Gesellschaft strukturieren, als Wissensquellen ernstzunehmen, eine Sache, an der Darmangeat scheiterte.
Der Ursprung der Unterdrückung der Frauen
Wir können Darmangeats Ansichten wie folgt zusammenfassen: Im Ursprung der Unterdrückung der Frauen stand die geschlechtliche Arbeitsteilung, die den Männern systematisch die Großwildjagd und den Gebrauch von Waffen überließ. Wie interessant sein Werk auch sein mag, es lässt unserer Ansicht nach zwei Fragen unbeantwortet.
Es scheint eindeutig genug, dass mit der Entstehung der Klassengesellschaft, die notwendig auf Ausbeutung und damit auf Unterdrückung beruhte, das Waffenmonopol nahezu eine selbstgenügsame Erklärung für die männliche Vorherrschaft in ihr ist (zumindest langfristig; der Gesamtprozess ist zweifellos komplexer). Gleichermaßen erscheint es a priori plausibel, davon auszugehen, dass - zeitgleich mit dem Aufkommen der sozialen Ungleichheiten, aber noch vor dem Auftritt der Klassengesellschaft, die den Namen verdient - das Waffenmonopol eine Rolle bei der Herausbildung der männlichen Vorherrschaft spielte.
Fortsetzung folgt...
Erklärung einer Arbeitergruppe in Alicante, Spanien, zum Generalstreik
- 1869 Aufrufe
Gewerkschaftsparaden versus Massenstreiks
Wir veröffentlichen hier die Übersetzung einer Erklärung einer Gruppe von ArbeiterInnen in Alicante im Südosten Spaniens, die „empörten Pro-Versammlungs-ArbeiterInnen“ („Pro-Versammlung“ daher, weil sie die Notwendigkeit von Generalversammlungen vertreten, um die Kontrolle über die Kämpfe auszuüben). Sie wurde als Antwort auf die Appelle zu 24-stündigen „Generalstreiks“ herausgegeben (für den 31. Oktober von der CGT, einer Abspaltung von der CNT, die sich selbst anarcho-syndikalistisch nennt, aber faktisch als kleine „radikale“ Gewerkschaft wirkt, und für den 14. November von fünf anderen Gewerkschaften ausgerufen, angeführt von den stalinistischen Arbeiterkommissionen und der sozialistischen UGT, den beiden größten Gewerkschaften). Die Genossen dieser Gruppe, die in den letzten zwei, drei Jahren aktiv gewesen waren, prangern diese Gewerkschaftsparaden an, die allein dazu dienen, die ArbeiterInnen zu demoralisieren, und eine Ergänzung zu den wiederholten Schlägen der Rajoy-Regierung sind. Doch sie belassen es nicht dabei. Sie stellen eine Perspektive vor: den Kampf für den Massenstreik, die umfassenste Tendenz in der Klassenbewegung des vergangenen Jahrhunderts, wie dies jeder bedeutende proletarische Kampf seit 1905 in Russland deutlich veranschaulicht hat.
Es ist völlig falsch zu argumentieren, dass es keine Alternative zu den demobilisierenden Mobilisationen gibt, die von den Gewerkschaften organisiert werden. Wir denken, dass andere Gruppen und Kollektive dem Beispiel der Genossen von Alicante folgen und eine Diskussion über die wahre Alternative zur gewerkschaftlichen Sackgasse beginnen sollten. In Großbritannien spucken die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes (NUT, Gewerkschaft der öffentlichen Angestellten, etc.) angesichts der brutalen Attacken der Regierungskoalition große Töne und versprechen uns Aktionstage und gar einen eintägigen Generalstreik. Doch die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Art von „Aktionen“ schlimmer als nur nutzlos sind; sie sind ein Sicherheitsventil für die wachsende Wut, wo doch das wirkliche Bedürfnis der ArbeiterInnen darin besteht, ihre Unzufriedenheit in einer selbst-organisierten, vereinheitlichenden Bewegung zu fokussieren, die die gesamte Gesellschaftsordnung herausfordern kann. IKS
Gegen 24- stündige „Aktionstage:
Welche Art von Streik wollen wir?
Den Massenstreik!
Wie kann eine 24-stündige Arbeitseinstellung Streik genannt werden? Und eine noch wichtigere Frage ist: Wie kann ein 24-stündiger „Aktionstag“ den Kampf der Arbeiterklasse voranbringen?
Unsere politische Position basiert auf dem Internationalismus und auf dem Bedürfnis nach proletarischer Autonomie: Für uns muss jede Aktion von bewussten Minderheiten dazu dienen, das Bewusstsein, die Einheit und die Selbstorganisation der Arbeiterklasse weiterzuentwickeln.
Es gab in letzter Zeit einen Haufen Mobilisierungen und viele Anstrengungen des Proletariats, sich selbst zu organisieren. Im Mai 2011 begann symbolisch eine neue Periode der Mobilisierungen. Dies war der Beginn einer Antwort auf die immer brutaleren Angriffe gegen den Lebensstandard der gesamten Bevölkerung. Doch es gibt keinen gradlinigen Fortschritt. Es war eine Periode gewesen, die von diversen Momenten geprägt war. Es gab einen großen Drang zur Selbstorganisation in Generalversammlungen, selbst in Bewegungen, die sehr embryonal und oft diffus waren. Doch dann kehrten die Gewerkschaften und die linken Organisationen auf die Bühne zurück, wobei sie von einer Ermattung und einem Rückgang in der Massenmobilisierung profitierten, und führten die Mobilisierungen auf ausgetretene Pfade: Mobilisierungen, die gut kontrolliert, alles andere als einig, partikularistisch und demotivierend sind, nichts gewinnen und die Teilnehmer ermüdet und isoliert zurücklassen. Angesichts all dessen denken wir, dass die Nicht-Beteiligung der Mehrheit der ArbeiterInnen an Mobilisierungen, die sie als fremd gegenüber ihren Interessen betrachten, vollkommen logisch ist. Und es ist ganz normal, dass wir uns nun in einem Denkprozess befinden.
Wir müssen reflektieren, begreifen, was geschehen ist, und nach einem Weg suchen, der zu unserer Selbstorganisation führt, ein Weg, der nicht von irgendeiner „aufgeklärten“ Elite oder durch irgendeine Art von konditioniertem Reflex entdeckt wird.
Der einzige Streik, den wir als effektiv erachten, den wir für notwendig halten, muss von den ArbeiterInnen selbst ausgerufen und auf die gesamte Gesellschaft ausgedehnt werden, muss die Kontrolle über den gesamten öffentlichen Raum ausüben, alles besetzen, neue Arten der gesellschaftlichen Verhältnisse und neue Formen der Kommunikation schaffen. Diese Art von Streik stoppt nicht das Leben, er beginnt es von neuem; dies ist der Massenstreik, der sich durch das vergangene Jahrhundert hinweg in einer Reihe von Gelegenheiten manifestiert hatte, auch wenn all unsere Gegner (all die Bourgeoisien, ob privater oder staatlicher Art) alles Mögliche angestellt hatten, ihn der Vergessenheit zu auszuliefern, ganz einfach deshalb, weil ein Streik, der die wahre Stärke des Proletariats zeigt, sie mit Furcht erfüllt.
Ein wirklicher Streik ist eine massive, tiefgehende Bewegung, die sich selbst nicht auf eintägige Arbeitseinstellungen beschränkt. Er ist die grundlegende Waffe der Arbeiterklasse, das Mittel für die Klasse, Kontrolle über ihr eigenes Leben auf allen Ebenen der Gesellschaft zu erlangen, mit der wir es zu schaffen haben, alle Aspekte einer menschlichen Gesellschaft auszudrücken, die sie anstrebt. Es liegt auf der Hand, dass dies nicht etwas ist, das von irgendjemanden ausgerufen werden kann, so gut seine Absichten auch sein mögen; es ist Teil des Prozesses, durch den die ArbeiterInnen sich ihrer selbst bewusst werden. Die Frage ist nicht, ob der Streik 24 Stunden, 48 Stunden oder unbegrenzt andauert. Sein radikaler Charakter ist nicht eine Zeitfrage. Es geht vielmehr darum, Bestandteil der wirklichen Bewegung der Arbeiterklasse zu sein, der ArbeiterInnen, die ihren eigenen Kampf organisieren und lenken.
Was ist ein Massenstreik?
Der Massenstreik ist das Resultat einer Periode im Kapitalismus, der Periode, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzte. Rosa Luxemburg war die erste Revolutionärin, die dies am klarsten begriff, indem sie ihr Verständnis auf die Grundlage der revolutionären Bewegung der ArbeiterInnen in Russland 1905 stellte. Der Massenstreik ist „eine historische Erscheinung (…), die sich in gewissem Moment aus den sozialen Verhältnissen mit geschichtlicher Notwendigkeit ergibt“ („Massenstreik, Partei und Gewerkschaften“).
Der Massenstreik ist nichts Zufälliges; er ist nicht das Ergebnis einer Propaganda oder von Vorausplanungen, er kann nicht willkürlich zustandegebracht werden. Er ist vielmehr das Produkt einer bestimmten Periode in der Evolution der Widersprüche des Kapitalismus.
Die ökonomischen Bedingungen hinter dem Massenstreik sind nicht auf ein Land beschränkt, sondern besitzen eine internationale Dimension. Es sind die historischen Umstände, die solch eine Form des Kampfes hervorrufen, der eine Grundvoraussetzung für die proletarische Revolution ist. Kurz, der Massenstreik ist nichts Geringeres als „eine allgemeine Form des proletarischen Klassenkampfes, die sich aus dem gegenwärtigen Stadium der kapitalistischen Entwicklung und der Klassenverhältnisse ergibt“ (ebenda).
Dieses „gegenwärtige Stadium“ besteht in der Tatsache, dass der Kapitalismus die letzten Jahre seiner Prosperität erlebte. Die Entwicklung interimperialistischer Konflikte und die Drohung des Weltkrieges, das Ende jeglicher nachhaltigen Verbesserung in den Lebensbedingungen der Arbeiterklasse – mit einem Wort, die wachsende Bedrohung, die die Arbeiterklasse für den Kapitalismus darstellte, waren die neuen historischen Umstände, die den Ausbruch des Massenstreiks begleiteten.
Der Massenstreik war das Produkt veränderter Lebensbedingungen auf einer historischen Ebene – was wir nun als das Ende des Aufstiegs des Kapitalismus und den Beginn seiner Niedergangsepoche erleben.
Zu jener Zeit gab es bereits mächtige Zusammenballungen der Arbeiterklasse in den fortentwickelten kapitalistischen Ländern, erfahren im kollektiven Kampf und mit Lebens- und Arbeitsbedingungen, die sich überall anglichen. Infolge der ökonomischen Entwicklung wurde auch die Bourgeoisie immer verdichteter; sie identifizierte sich immer mehr mit dem Staatsapparat. Wie das Proletariat hatten auch die Kapitalisten gelernt, wie sie sich zusammentun können, um sich mit ihrem Klassenfeind auseinanderzusetzen. Die ökonomischen Umstände erschwerten es den ArbeiterInnen immer mehr, Reformen auf der ökonomischen Ebene zu erlangen, während gleichzeitig der Ruin der bürgerlichen Demokratie es dem Proletariat immer schwerer machte, seine Errungenschaften durch parlamentarische Aktivitäten zu konsolidieren. So war der politische wie auch der ökonomische Kontext des Massenstreiks nicht der des russischen Absolutismus, sondern die nahende Dekadenz der bürgerlichen Herrschaft in allen Ländern.
Der Kapitalismus hat auf der ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Ebene die Fundamente für gewaltige globale Klassenkonfrontationen gelegt.
Die Form des Massenstreiks
Das Ziel der Gewerkschaften (die Erzielung von Verbesserungen innerhalb des Systems) ist im dekadenten Kapitalismus immer schwieriger zu verwirklichen. In dieser Epoche tritt das Proletariat nicht mit der sicheren Perspektive in den Kampf, reale Verbesserungen zu erringen. Die Streiks und die wichtigsten Bewegungen von heute können auf dem Wege der Verbesserungen nur wenig gewinnen.
Infolgedessen ist die Rolle der Gewerkschaften, ökonomische Verbesserungen innerhalb des System zu erlangen, verschwunden. Es gibt weitere revolutionäre Auswirkungen aus der Infragestellung der Gewerkschaften durch den Massenstreik:
1) Der Massenstreik kann nicht im Voraus geplant werden: Er ergibt sich ohne einen vorgefassten Plan, ohne einen Satz von Methoden für die proletarischen Massen. Die Gewerkschaften, ihrer permanenten Organisation ergeben, um ihre Bankkonten und Mitgliederlisten besorgt, können nicht einmal damit beginnen, die Aufgabe der Organisierung des Massenstreiks wahrzunehmen, der sich in und für den Kampf herausbildet.
2) Die Gewerkschaften haben die ArbeiterInnen und ihre Interessen in all die unterschiedlichen Industriebranchen aufgespalten, während der Massenstreik „zusammen(fließt) aus einzelnen Punkten, (…) aus anderen Anlässen, in anderen Formen“ und somit dazu tendiert, alle Spaltungen im Proletariat zu überwinden.
3) Die Gewerkschaften organisieren lediglich eine Minderheit der Arbeiterklasse, während der Massenstreik all die unterschiedlichen Schichten der Klasse, gewerkschaftliche und nicht-gewerkschaftliche Arbeiter in seinen Bannkreis zieht.
Die Dekadenz des Kapitalismus
Der Kampf ist mit der Realität verbunden, in der er sich entfaltet: Man kann ihn nicht von ihr trennen. Seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts hat die Auszehrung der vor-kapitalistischen Märkte das unersättliche Streben des Kapitals nach Vermehrung gebremst und damit eine permanente Krise, ein permanentes gesellschaftliches Desaster (Kriege und ein nie dagewesenes Elend) provoziert.
Die Periode seit Ende der 1960er Jahre war der Höhepunkt der permanenten Krise des Kapitalismus gewesen: die Unmöglichkeit für das System zu expandieren, die Beschleunigung der interimperialistischen Antagonismen, deren Konsequenzen die gesamte menschliche Zivilisation in Gefahr bringen.
Überall hat der Staat mit seinem beeindruckenden Repressionsapparat die Interessenn der Bourgeoisie in Obhut genommen. Sie sieht sich einer Arbeiterklasse gegenüber, die, obwohl im Verhältnis zur restlichen Gesellschaft seit den 1900er Jahren zahlenmäßig schwächer, immer noch hoch konzentriert ist und deren Lebensbedingungen sich in allen Ländern auf einem beispiellosen Niveau angeglichen haben. Auf politischer Ebene ist der Ruin der bürgerlichen Demokratie so unübersehbar, dass sie kaum ihre wahre Rolle als Nebelwand für den Terror des kapitalistischen Staates verbergen kann.
Die Bedingungen des Massenstreiks entsprechen der objektiven Lage des Klassenkampfes von heute, da die Merkmale der gegenwärtigen Periode am schärfsten die Tendenzen der kapitalistischen Entwicklung über das vergangene Jahrhundert hinweg ausdrücken.
Die Massenstreiks der ersten Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren eine Antwort auf das Ende der Periode des kapitalistischen Aufstiegs und den Beginn der Bedingungen, die die Dekadenz des Kapitalismus kennzeichen. Diese Bedingungen sind heute völlig klar und chronisch geworden. Der objektive Drang zum Massenstreik ist heute tausendmal stärker.
Die „allgemeinen Resultate der internationalen kapitalistischen Entwicklung“, die das historische Aufkommen des Massenstreiks bedingt haben, haben seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts nicht aufgehört zu reifen.
Was können wir tun?
Wie können wir die Entwicklung des Massenstreiks, die internationale Selbstorganisation und Vereinigung des Proletariats fördern? Unser Beitrag kann lediglich der Beitrag einer bewussten Sektion der Arbeiterklasse sein – nicht mehr oder nicht weniger.
Eine der Formen dieses Beitrags besteht darin, fehlerhafte Formen der Aktivitäten zu kritisieren, die eine Barriere gegen die Selbstorganisation und der Vertiefung des Bewusstseins sind. Trotz der besten Absichten ihrer Mitstreiter sind Aktivismus, Basisgewerkschaftstum und Linksextremismus… Bestandteil dieser Barrieren, die die ArbeiterInnen niederreißen müssen, um ihre Klassenautonomie zu erlangen.
Ein weiterer Beitrag besteht darin, zum Nachdenken zu ermuntern, zur Klärung dessen, was wir durchlebt haben. Doch es bedeutet auch, für die Ausweitung realer Kämpfe, ihre Koordination, die Verbreitung von Information über sie sowie für das Zusammenkommen und die Organisation der Revolutionäre zu arbeiten. Es bedeutet vor allem die Wiederbelebung der Erinnerung an unsere Kämpfe und ihre wichtigsten Waffen wie den Massenstreik.
Empörte, selbstorganisierte Pro-Versammlungs-ArbeiterInnen
für eine Arbeiterklasse und eine anti-kapitalistische 15-M (1)
(1) 15-M bezieht sich auf die Bewegung, die im Mai 2011 begann.
Aktuelles und Laufendes:
- Spanien [512]
- Erklärung einer Arbeitergruppe in Alicante [513]
- zum Generalstreik [514]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [300]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [301]
Fabrikkatastrophe in Bangladesh
- 1590 Aufrufe
Die Zahl der Toten nach dem Zusammensturz des Fabrikgebäudes an der Rana Plaza in Dhaka ist mittlerweile auf über 1000 gestiegen. Weitere acht Menschen sind in einem Feuer im Bezirk Mirpurn in derselben Stadt umgekommen – die Anzahl der Toten wäre sicherlich noch höher ausgefallen, wenn das Feuer tagsüber ausgebrochen wäre, so wie es im vergangenen November in Tazreen-Bekleidungsfabrik geschah, wo 112 ArbeiterInnen starben. (1)
Diese „Unfälle“ sind nichts Anderes als industrieller Mord. Es wird nicht einmal verheimlicht, dass es eine totale Missachtung der Sicherheit der ArbeiterInnen in der Bekleidungsindustrie von Bangladesh gibt, die für Elendslöhne und unter entsetzlichen Bedingungen schuften. Doch dies ist keineswegs ein Exzess einiger weniger skrupelloser Arbeitgeber. Es ist in die eigentliche Struktur der Weltwirtschaft eingemeißelt. Von der Verbilligung der Arbeitskosten profitieren nicht nur die örtlichen Gangster, denen die Fabriken gehören, sondern auch die großen internationalen Bekleidungskonzerne wie Primark, die ihre Profite auf dem Rücken der BilliglohnarbeiterInnen angehäuft haben, die sie in der „Dritten Welt“ finden.
Darüber hinaus stellt das Kapital trotz aller angeblicher Reformen und Fortschritte in der Industrieproduktion im „Westen“ den Profit über das menschliche Leben. Fast zeitgleich mit dem Terroranschlag auf die Besuchermassen des Bostoner Marathons wurde eine Düngemittelfabrik in West in der Nähe von Waco/Texas in einer gewaltigen Explosion zerstört; sie riss 14 Menschen in den Tod, 200 Menschen wurden verletzt, und fünf Häuserblöcke dem Erdboden gleichgemacht. Zunächst wurde dies als ein Unfall dargestellt. Kurz darauf wurde ein Rettungssanitäter, der am Unglücksort war, wegen des Verdacht festgenommen, die Explosion verursacht zu haben. Doch was auch immer wahr ist, die Explosion in West enthüllt die abgrundtiefe Unverantwortlichkeit der kapitalistischen Produktion, lag diese Fabrik, die ein derart hoch explosives Material beherbergte, doch in der Nähe eines Altersheimes, einer Schule und einer Reihe von Wohngebäuden. Es erinnert an die Explosion einer Düngemittelfabrik in Toulouse Anfang der Nullerjahre, wo 28 ArbeiterInnen und ein Kind getötet worden waren. 10.500 weitere Menschen wurden verletzt, ein Viertel von ihnen schwer. Total, dem der Betrieb gehörte, wurde in den folgenden Verfahren von aller Verantwortung freigesprochen. Wir können auch auf die Standortwahl des Kernkraftwerks von Fukushima hinweisen, das in einem Gebiet, welches höchst anfällig für Erdbeben und Tsunamis ist, und viel zu nahe an Wohngebieten liegt…
Angewidert von den jüngsten Berichten aus Bangladesh, sendete uns ein Sympathisant diese Bemerkungen über unser Diskussionsforum. Wir können nur sagen, dass sein Zorn völlig gerechtfertigt ist:
„… die Situation in Bangladesh nimmt groteske Züge an, mit entsetzlichen Katastrophen – industriellem Mord -, die sich mit erschreckender Regelmäßigkeit ereignen. Warum plagt sich überhaupt jemand in Bangladesh damit ab, zur Arbeit zu gehen? Werden sie doch weiß gott kaum bezahlt! Also warum? Die Antwort ist natürlich, dass wir im Kapitalismus alle selbst den lächerlichsten und winzigsten Geldbetrag benötigen, den die Bourgeoisie erübrigen kann – Löhne: ‚ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk‘ oder so ein Mist – nur um Tag für Tag arbeiten zu gehen. Wir leben von Almosen, die wir unter teils lebensgefährlichen Begleitumständen aus den Kapitalisten gepresst haben. Und die Bedrohungen müssen nicht alle physischer Art sein (Feuer und Gebäudeeinstürze oder vergiftete, verschmutzte Umwelt), sie können auch psychologischer Art sein und entsetzliches Elend und Unglück bewirken. Oh, wie dankbar wir der Bourgeoisie, ihrer Generosität und Menschenliebe, ihrer endlosen Sorge um den Planeten und der Friedensherrschaft weltweit sein sollten! Wo wären wir ohne sie? Wie kann es uns ohne sie gelingen, ihre halsabschneiderische Produktionsweise unserer Existenz aufzuzwingen, nur damit sie ihren Profit machen können? Und ihre barbarischen Kriege kämpfen! Wenn man nicht von einem zusammenbrechenden, schlecht gebauten Gebäude erschlagen wird oder darin verbrennt, gibt es immer noch die Möglichkeit des langsamen Todes durch radioaktive Tsunamis, der plötzlichen Auslöschung durch ferngelenkte Bomben, Raketen oder Drohnen, der entsetzlichen und quälenden Eliminierung via Chemiewaffen oder der abrupten Auslöschung durch die Hand eines Scharfschützen der einen oder anderen sich permanent bekriegenden Banden, offizielle oder andere.
Die Bourgeoisie hat nicht nur den ‚industriellen Mord‘ erfunden, sie hat darüber hinaus den Massenmord in eine Industrie verwandelt. Es ist die einzige Sache, worin sie gut ist.“
Amos 11.5.13
Historische Ereignisse:
Gewerkschaftsdebatte, 2. Teil: Sind die Gewerkschaften Verschwörer?
- 2135 Aufrufe
Im ersten Teil dieses Artikels [516] sind wir auf die in verschiedenen mündlichen und schriftlichen Beiträgen debattierte Frage des Klassencharakters der Gewerkschaften eingegangen. Wir sind dabei zum Schluss gekommen, dass die Position, die von einem nicht eindeutig bürgerlichen, sondern ambivalenten Charakter der Gewerkschaften in der heutigen Zeit spricht, letztlich mindestens in Teilen den Schein aufrecht erhält, den diese so genannten Arbeiterorganisationen über ihr eigenes Wesen erwecken wollen. Wir kommen nun zum zweiten Punkt, welcher der Klärung bedarf: Läuft die Position der IKS, die den Gewerkschaften in der Zeit seit dem Ersten Weltkrieg einen bürgerlichen, staatskapitalistischen Klassencharakter zuweist und von Gewerkschaftsmanövern gegen die Arbeiterklasse spricht, auf eine Verschwörungstheorie hinaus?
Manöver der Gewerkschaften
Schauen wir uns diese Kritik an. Entzündet hat sich der Widerspruch an einem Wort – dem „Manöver“ der Gewerkschaften. Die IKS verwendet den Begriff des Manövers seit langem in der Intervention. So schrieben wir beispielsweise Ende 2004 nach dem damaligen Opel-Streik in Bochum: „Dass die Arbeit nach sechs Tagen in Bochum wieder aufgenommen wurde, obwohl die Hauptforderung der Streikenden nicht erfüllt wurde, haben diverse 'kritische Gewerkschaftler' mit dem Manöver der IG Metall- und Betriebsratsleitung während der Abstimmung vom 20. Oktober erklärt. Natürlich war die Formulierung der Alternative, worüber die Streikenden abzustimmen hatten - entweder Streikbruch und Verhandlungen oder Fortsetzung des Streiks ohne Verhandlungen - ein typisches Beispiel eines gewerkschaftlichen Manövers gegen die Arbeiter. Eine endlose Fortsetzung eines bereits isolierten Streiks wurde nämlich als einzige Alternative zum Streikabbruch hingestellt. Dabei wurden die entscheidenden Fragen ausgeblendet, nämlich: Erstens, wie kann man am wirksamsten den Forderungen der Arbeiter Nachdruck verleihen? Zweitens, wer soll verhandeln, die Gewerkschaften und der Betriebsrat oder die Vollversammlung, die gewählten Delegierten der Arbeiter selbst?“[1]
Die neuere Gewerkschaftsdebatte auf dem undergrounddogs-Forum hat sich an der von uns vertretenen Meinung entfacht, dass die Ferieninitiative der Gewerkschaftsverbandes Travailsuisse im Frühjahr 2012 in der Schweiz „ein regelrechtes Manöver der Gewerkschaften ist, damit die Angestellten und Arbeiter nicht andere, wirkungsvollere Massnahmen gegen die Verschlechterung der Lebensbedingungen sich überlegen. Pressluft rauslassen, die sich angestaut hat, das ist die Funktion solcher Initiativen“[2].
Darauf gab es mehrere Antworten, die dieser Position eine Verschwörungstheorie unterstellten. Beispielsweise O.B.M.F.: „Was den Punkt 'Manöver der Gewerkschaften' betrifft (…) ich will nicht behaupten, dass es solche Manöver in der Geschichte nie gegeben hat oder dass es sie heute nicht geben würde. Aber einfach zu sagen, es sei eines gewesen, weil es doch zu diesen oder zu jenen Punkten passt, überzeugt doch niemanden. Das ist doch genau das, was diese Verschwörungsparanoiker auch die ganze Zeit machen. Es geht doch darum sich klarzumachen, was die Gewerkschaften sind und warum sie so handeln, wie sie es tun und warum die Arbeiter ihnen in den entscheidenden Momenten folgen. Das hat viel weniger mit Irreführungen durch Gewerkschaften zu tun, als damit dass es ein Kapitalismusimmanentes Interesse der Klasse tatsächlich gibt, welches die Gewerkschaft ihnen nicht erst unterjubeln muss. Sie muss es nur organisieren. Das ist das Problem und es ist viel tiefer, als ein blosser Beschiss.“
Oder Muoit: „Du hingegen gehst an die Sache mit einem bereits feststehenden und der Realität meines Erachtens äusserlichen Schablone heran: Die Gewerkschaften vertreten nie die Interessen der in ihnen organisierten – oder in diesem Falle sogar fast allen – Arbeiter, sondern sie sind bürgerliche Organe, entsprechend muss das ein Manöver gegen die Klasse sein. Um so was überhaupt denkmöglich zu machen, müsste man sich aber auch mal erklären, wie es zu so was in deiner Theorie kommen soll: Da bleibt dann nicht viel mehr übrig, als die Ansicht, die Gewerkschaftsführer hätten das als Manöver geplant und das – bei allem Respekt – ist zumindest nahe an der Verschwörungstheorie gebaut.“
Beschiss und Verschwörung
Dabei wurde in der Debatte nicht genauer umschrieben, was mit Verschwörungstheorie gemeint sei. Aber man kann sich den Kern der Kritik wohl so vorstellen: Es geht um die Idee, dass die so genannten Manöver in einem mehr oder weniger begrenzten Kreis von Verschwörern im Geheimen bewusst geplant und umgesetzt würden. Offenbar spielt in dieser Auseinandersetzung das Argument des Bewusstseins eine wichtige Rolle. Konkret: Mit welchem Bewusstsein handeln die Gewerkschaften (vertreten und handelnd durch ihre Organe, die Gewerkschaftsfunktionäre), wenn sie etwas tun oder unterlassen, was den allgemeinen und langfristigen Zielen der Arbeiter_innenklasse widerspricht?
Eines sei vorab klargestellt: Wenn wir von „Manövern der Gewerkschaften“ sprechen, meinen wir nicht, dass ihre Repräsentanten sich über ihr Handeln in einem grösseren Zusammenhang Rechenschaft ablegen, geschweige denn, dass sie stets bewusst (und versteckt vor der Öffentlichkeit) einen Plan aushecken würden, wie sie die Interessen der Arbeiter_innen am effektivsten hintertreiben können. Und trotzdem behaupten wir, dass die Gewerkschaften in der Regel so handeln, dass tatsächlich die langfristigen Klasseninteressen des Proletariats wirksam hintergangen werden, so dass sich zur Beschreibung des äusseren Ablaufs der Dinge der Begriff des Manövers förmlich aufdrängt.
Wie kommt aber dieses "Manöver" zustande? Aus unserer Sicht sind es nicht ideelle, sondern ganz materielle Gründe, nicht weil sich die Gewerkschaftsspitzen und ihre Funktionäre einen von A bis Z ausgedachten Plan zurechtlegten und bewusst ein Manöver inszenierten, sondern weil sie ihrer Funktion gemäss handeln. In Anlehnung an Marx könnte man über diese „Handlanger des Kapitals“ sagen, dass auch sie das tun, was sie ihrem Sein gemäss geschichtlich zu tun gezwungen sind: Sie sollen den Arbeitern und Arbeiterinnen Lösungsvorschläge zur „Verbesserung“ des Kapitalismus unterbreiten. Ist das denn etwas Anderes als Sabotage der Revolution! Mit welchem Bewusstsein die Gewerkschafter agieren, spielt für das Gelingen des Manövers zunächst keine Rolle. Es wird Gewerkschafter geben, die als alte Linke ziemlich bewusst ans Werk gehen. Andere haben keine Ahnung, was sie tun; schon der Vater war Gewerkschafter und der Grossvater auch – das macht man einfach so. Dabei sollte auf rein empirischer Ebene festgehalten werden, dass in offenen Kampfsituationen ein Manöver der Gewerkschaftsspitzen oft, wie im Kampf von 2004 bei Opel in Bochum, selbst von Gewerkschaftsmitgliedern als solches bezeichnet wird.
Bewusstsein und Ideologie
In dieser Diskussion darf nicht vergessen gehen, welches Abbild die kapitalistischen Verhältnisse im Bewusstsein der Menschen typischerweise produzieren. Im Kapitalismus stehen die Menschen in verdinglichten (über den Warenaustausch vermittelten) Beziehungen mit allen anderen, ohne dass sie die Gesamtheit dieser Verhältnisse bestimmen (oder auch nur durchschauen) würden. Die Menschen sind in ihren Handlungen durch diese materiellen Verhältnisse geprägt, nicht durch die ideellen Vorstellungen, die sie sich davon machen, auch wenn es ihnen genau umgekehrt erscheint – ein „Irrtum“, der „vom ideologischen Standpunkt aus um so leichter zu begehen“ war, „als jene Herrschaft der Verhältnisse (…) in dem Bewusstsein der Individuen selbst als Herrschen von Ideen erscheint“ (Marx, Grundrisse).
Auf der Grundlage, dass unbeherrschbare gesellschaftliche Verhältnisse falsche, d.h. ideologische Vorstellungen bei den Betroffenen hervorrufen, dürfte das Bewusstsein über die eigene Rolle bei einem Gewerkschaftsfunktionär oder selbst beim ganzen Gewerkschaftsapparat nur ausnahmsweise klar und dem Gegenstand angemessen sein. Der herrschenden Ideologie unterworfen, sitzen auch die Gewerkschaftskader dem Schein der falschen Verhältnisse auf: Sie meinen zu einem guten Teil tatsächlich, dass sie die Arbeiterinteressen verträten und wirksam gegen die kapitalistische Ausbeutung kämpften. Worum es hier also geht, ist die Frage, welchen Bewusstseinsgrad die Akteure, die die Intervention der Gewerkschaften bestimmen und tragen, bei ihren Handlungen haben. Von einer Verschwörung oder einem Komplott spricht man dann, wenn sich die massgebenden Leute miteinander bewusst über ihre Ziele und Mittel verständigen und auf eine Strategie einigen. Dass dies geschehen kann, gibt auch O.B.M.F. zu; dass es aber bei dem, was wir Manöver der Gewerkschaften nennen, in jedem Fall eine Verständigung über die langfristigen Ziele gebe, behaupten auch wir nicht. Was ist aber die Fortsetzung des Gedankens von O.B.M.F.? Manchmal gibt es bewusste Manöver und manchmal nicht? Sollten wir nicht vielmehr die Frage nach den Bewegungsgesetzen und Triebkräften hinter den allfälligen Manövern beantworten?
Meines Erachtens gibt es dabei mindestens zwei Aspekte, die genauer zu betrachten sind: Der erste Gesichtspunkt betrifft den subjektiven Standpunkt der Akteure, konkret der Gewerkschaftsfunktionäre. Sie vertreten, was auch Eiszeit in ihrem Beitrag in Kosmoprolet Nr. 3 konstatiert und kritisiert, u.a. Werte bzw. Inhalte wie: Spaltung der Klasse in Nationen, Souveränität des Nationalstaats, Herrschaft der bürgerlichen Demokratie, Verteidigung des Gewaltmonopols des kapitalistischen Staates usw. Wer so ausgerüstet in das Geschäft des „gewerkschaftlichen Kampfes“ steigt, kann doch nicht anders als, im Grossen und Ganzen gesehen, den proletarischen Interessen diametral entgegenstehen. Wenn es in einem Kampf der Arbeiter_innen um Selbstorganisation gehen könnte, ruft jener Demokrat: „Gewerkschaftliche Repräsentation!“ Wenn die bürgerliche Staatsordnung gefährdet ist, eilt er seinem Programm gemäss genau dieser Ordnung zu Hilfe. Dass die Spitzen der deutschen Politik offen über die gelungene Arbeitsteilung bei der Durchsetzung der Agenda 2010 reden können und Stoiber dem Linken Schröder zu den erfolgreichen Massnahmen/Angriffen gratuliert, die er als Rechter aufgrund drohender Volksproteste nicht hätte umsetzen können, ist ein Gradmesser für das Bewusstsein der herrschenden Klasse über ihre Strategien.[4]
Keine Naivität gegenüber der Bourgeoisie
Und hier ist der zweite Aspekt angesprochen, die Funktionsweise der herrschenden Klasse im Kapitalismus. Uns scheint, dass die Position, die in dieser Diskussion gegen uns den Bann ausspricht, die Gefährlichkeit des Gegners unterschätzt. Im Artikel „Marxismus und Verschwörungstheorien“ haben wir versucht, aufzuzeigen, dass das Phänomen der Verschwörungstheorien im Kapitalismus kein zufälliges ist. Vielmehr sind auch sie ein ideologischer Ausdruck der tatsächlichen Verhältnisse. Die Bourgeoisie ist eine herrschende Klasse, die selber in Nationen gespalten und von ständigen Rivalitäten geprägt ist. Die Verschwörung gehörte von Anfang an zum Arsenal ihres ihrer Funktionsweise. Niccolò Machiavelli (1469-1527) ist der Pate dieses Kindes - des Machiavellismus. Obwohl auch die Bourgeoisie nicht über den gesellschaftlichen Verhältnissen steht und insofern die von Widersprüchen zerrissene kapitalistische Produktionsweise nicht wirklich beherrschen kann, gehört die Verschwörung zu den von ihr verwendeten Mitteln und ist die verschwörerische Sicht auf die Welt Teil ihrer Ideologie – ein falsches Bewusstsein, das aber ihrer gesellschaftlichen Stellung und Funktion entspricht.
Die durchaus bestehende Fähigkeit und Bereitschaft zur Verschwörung zeigt sich bei der Bourgeoisie insbesondere in angespannten Zeiten, wenn das Proletariat zur Gefahr für die herrschende Ordnung wird. Beispiele:
- In der Novemberrevolution 1918 in Deutschland vereinbarten Friedrich Ebert als SPD-Vorsitzender und Mitglied des Rates der Volksbeauftragten und General Wilhelm Groener als Chef der Obersten Heeresleitung ein gemeinsames Vorgehen gegen linksradikale Gruppierungen (Ebert-Groener-Pakt, auch "Pakt mit den alten Mächten"). Die SPD war zuständig für die Legitimation der Regierung gegenüber der Arbeiterklasse, während gleichzeitig die Militärs die Bildung der Freikorps zur brutalen Niederschlagung der revolutionären Arbeiter_innen vorbereiteten. Die Fortsetzung der Geschichte ist bekannt.
- Als im Mai 1968 in Frankreich der bis damals grösste Streik in der Geschichte ausbrach, setzten sich (einmal mehr) Gewerkschaften, Arbeitgeber und Regierung zusammen. „Es war offensichtlich, dass die Bourgeoisie Angst hatte. Der Premierminister Pompidou leitete die Verhandlungen. Am Sonntagmorgen traf er den Chef der CGT, Séguy, eine Stunde lang unter vier Augen. Die beiden Hauptverantwortlichen für die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung in Frankreich brauchten Zeit, um ohne Zeugen die Bedingungen für die Wiederherstellung der Ordnung zu besprechen (…)“[5] Es kam dabei auch zu einem Geheimtreffen auf einem Dachboden zwischen dem damaligen Minister für soziale Angelegenheiten, Jacques Chirac, und der Nummer 2 bei der CGT, Krasucki. Wenn das kein Komplott ist!
O.B.M.F. hat sicher recht, wenn er sagt, dass das Problem tiefer ist „als ein blosser Beschiss“. Für das Gelingen eines Manövers spielt es – wie oben beschrieben – zunächst gar keine Rolle, ob ihre Protagonisten arglistig oder naiv ehrlich handeln. Einig sind wir uns auch in der Feststellung, dass die Bourgeoisie zu eigentlichen verschwörerischen Manövern fähig und bereit ist. Dabei spielen heute die Gewerkschaften eine kaum ersetzbare Rolle, was v.a. dort deutlich wird, wo die Gewerkschaften gerade nicht mehr den Schein der Unabhängigkeit gegenüber dem Staat (z.B. in den stalinistischen Ordnungen) haben. Doch über die Fähigkeit und Bereitschaft der herrschenden Klasse zum geplanten Manöver hinaus darf ihre Neigung, ihre spontane Tendenz dazu, nicht übersehen werden. Im Gegensatz zum Proletariat hat die im Kapitalismus das Kommando ausübende Klasse (mit all ihren bewussten oder unbewussten Agenten) kein Interesse an Ehrlichkeit, Offenheit, Debatte – sie hat kein Interesse an der Wahrheit.
Wut und Kampfbereitschaft
Wir können uns gut vorstellen, dass die eingangs erwähnten Kritiker unserer Position zur Ferieninitiative über weite Strecken mit unseren Argumenten einverstanden sind – und trotzdem finden, dass diese Initiative von Travailsuisse kein Manöver gewesen sei, weil die fehlende Kampfbereitschaft der Arbeiterklasse ein solches schlicht unnötig mache. Dabei muss man wohl zwischen tatsächlicher Kampfbereitschaft und wachsender Wut unter den Arbeiter_innen unterscheiden. Jene ist ein kollektiver Prozess, diese eine Vorstufe dazu, die zunächst individuell und noch nicht als gemeinsame Stimmung wahrgenommen wird. Schon in diesem Stadium gibt es für die Schützer der herrschenden Ordnung (z.B. die Gewerkschaften) eine Tendenz zum Manöver, um „Dampf abzulassen“. Denn die Wut ist eine Voraussetzung der Entwicklung der Kampfbereitschaft – und je früher ein solcher Prozess verhindert oder gebremst werden kann, desto besser fürs System. Wenn schon eine Ferieninitiative reicht, um etwas Dampf abzulassen (bzw. die demokratischen Illusionen zu stärken), umso stabiler die Ausbeutungsordnung. Wenn dieses Mittel nicht reicht, dann hilft vielleicht ein gewerkschaftlich kontrollierter Streik. Insofern ist die Analyse der verschiedenen Manöver des Bourgeoisie (von den fies geplanten bis zu den sich spontan ergebenden) ein Spiegel der Auseinandersetzung zwischen den Klassen und kann helfen, das Kräfteverhältnis möglichst differenziert einzuschätzen.
Maluco, 29.03.13
(leicht gekürzte Fassung des auf unserer Homepage veröffentlichten Originalartikels)
Aktuelles und Laufendes:
Neuer Rhythmus der IKS-Presse
- 1930 Aufrufe
Neuer Rhythmus der IKS-Presse
"Von Zeit zu Zeit siegen die Arbeiter, aber nur vorübergehend. Das eigentliche Resultat ihrer Kämpfe ist nicht der unmittelbare Erfolg, sondern die immer weiter um sich greifende Vereinigung der Arbeiter. Sie wird befördert durch die wachsenden Kommunikationsmittel, die von der großen Industrie erzeugt werden und die Arbeiter der verschiedenen Lokalitäten miteinander in Verbindung setzen. (…) Und die Vereinigung, zu der die Bürger des Mittelalters mit ihren Vizinalwegen Jahrhunderte bedurften, bringen die modernen Proletarier mit den Eisenbahnen in wenigen Jahren zustande."
So drückte sich Marx 1848 im Kommunistischen Manifest aus. Der Kapitalismus hat schließlich länger überlebt, als Marx dies voraussah, aber der Klassenkampf ist mehr denn je auf der ganzen Welt ebenso eine Tatsache. Da, wo die Arbeiter_innen von 1848 auf Eisenbahnen zählten, die natürlich nicht dazu geschaffen worden waren, um ihnen das Leben zu erleichtern, setzen die Arbeiter_innen und Revolutionäre von 2013 je länger je mehr auf das Internet, um ihre Ideen zu verbreiten und – so hoffen wir – nach und nach diese „immer weiter um sich greifende Vereinigung“ zu schmieden, von der Marx sprach. Das Internet hat unsere Arbeitsweise und vor allem unsere Kommunikationsweise von Grund auf verändert.
Als die IKS 1975 gegründet wurde, gab es das Internet natürlich noch nicht. Die Ideen wurden mit dem Mittel der gedruckten Presse weiter verbreitet, in Hunderten von kleinen radikalen Buchläden aufgelegt, die damals in der Dynamik nach dem Mai 68 und den folgenden Kämpfen auf der ganzen Welt aus dem Boden sprossen. Und die Korrespondenz wurde gepflegt auf dem Weg des (oft von Hand) geschriebenen Briefes, den die Post beförderte.
Heute sind die Verhältnisse ganz anders: Das Papier ist durch die elektronischen Medien ersetzt worden, und während die Buchläden ein günstiger Ort des Vertriebs unserer gedruckten Presse in der Welt waren, so verkaufen wir sie heute im Wesentlichen an Demonstrationen und bei Kämpfen am Arbeitsplatz.
Darüber hinaus haben wir uns mit der Presse seit der Gründung der IKS darum bemüht, zur Entwicklung einer internationalistischen Perspektive in der Arbeiterklasse beizutragen, indem wir uns auf Artikel stützten, die in verschiedenen Ländern Gültigkeit hatten. Heutzutage verfolgen wir immer noch dasselbe Ziel, aber die elektronischen Medien mit ihrer hohen Geschwindigkeit der Datenübertragung erlaubt es den Sektionen der IKS, enger zusammen zu arbeiten (vor allem dort, wo die Sprache die gleiche ist), und wir nutzen die neuen Möglichkeiten, um unsere weltweite Einheit in der Presse noch zu verstärken.
Diese Faktoren haben es uns nahe gelegt, über unsere Presse und über den Stellenwert der digitalen Publikationen beziehungsweise der gedruckten Presse im Rahmen unserer internationalen Intervention nachzudenken. Wir sind davon überzeugt, dass die gedruckte Presse ein wesentlicher Teil unserer Interventionsmittel bleibt. Mit ihr können wir direkt in laufende Kämpfe eingreifen. Aber die gedruckte Presse spielt nicht mehr die genau gleiche Rolle wie in der Vergangenheit und muss deshalb flexibler werden, sich an eine veränderte Lage anpassen können.
Da wir nur begrenzte Kräfte haben, sind wir zum Schluss gelangt, dass eine Verstärkung und Anpassung unserer Webseite eine Verringerung der Arbeit im Zusammenhang mit der gedruckten Presse voraussetzt: Eine der ersten Folgen dieser Neuorientierung der Pressearbeit wird deshalb sein, dass die gedruckten Publikationen weniger häufig erscheinen, insbesondere einige unserer Zeitungen. So werden unsere Zeitungen in Großbritannien (World Revolution) und in Frankreich (Révolution internationale) in Zukunft nur noch alle zwei Monate heraus kommen.
Abgesehen davon werden unsere Leser_innen sicher bemerkt haben, dass 2012 die Sommerausgabe der International Review (in englischer, französischer und spanischer Sprache) nicht erschienen ist. Wir möchten uns dafür entschuldigen. Wie ist dies zu erklären, wenn doch – wie wir sonst sagen – die geschichtlichen Notwendigkeiten des Kampfes der Arbeiterklasse von den Revolutionären eine erhöhte Anstrengung der Intervention auf theoretischer und historischer Ebene verlangen? Es hat sich in der Tat herausgestellt, dass unsere begrenzten Kräfte es uns nicht erlauben, gleichzeitig alle Aufgaben im Zusammenhang mit den Publikationen zu erfüllen, die nebst der Internationalen Revue auch noch die Broschüren und Bücher umfassen, deren Herausgabe uns eine bedeutende Arbeit abverlangt. Wir stehen erst am Anfang unserer Diskussion über die Pressearbeit, und wir wissen noch nicht genau, wie wir uns hinsichtlich des Rhythmus der Herausgabe der Internationalen Revue schließlich entscheiden werden.
Wir gehen davon aus, dass im laufenden Jahr neue Änderungen sich ergeben werden, insbesondere was die Struktur der Webseite betrifft. Wir möchten unsere Leser_innen in diese Aufgabe einbeziehen, weshalb wir bald einen Fragebogen auf die Webseite stellen werden, damit ihr eure Meinung dazu abgeben könnt. In der Zwischenzeit sind wir offen für eure Vorschläge, die ihr schon auf den Diskussionsforen einbringen könnt.
Das hier Gesagte bezieht sich natürlich nur auf die geographischen Gebiete, wo der Zugang zum Internet selbstverständlich geworden ist. Es gibt aber Regionen, wo der fehlende oder erschwerte Zugang bedeutet, dass die gedruckte Presse weiterhin die gleiche Rolle spielen muss wie bisher. Dies ist insbesondere in Indien und in Lateinamerika der Fall, wo wir mit unseren Sektionen in Indien, Mexiko, Venezuela, Peru und Ecuador schauen werden, wie wir am besten unsere Presse an die jeweiligen Bedingungen anpassen können.
IKS, 18. Januar 2013
Protestbewegungen, imperialistische Kriege -Die einzige Wahl – Sozialismus oder Barbarei
- 1651 Aufrufe
Der Krieg und die Massaker an der Bevölkerung in Syrien (mehr als 100.000 Tote, ca. 165 Tote täglich) führen den ganzen Horror und die Barbarei eines dahinsiechenden Systems vor Augen. Sie zeigen das ganze Drama, vor dem Millionen von ArbeiterInnen stehen, die in den sich zuspitzenden Konfrontationen zwischen verschiedenen bürgerlichen Cliquen aufgerieben werden. Diese Zusammenstöße werden wiederum von ausländischen imperialistischen Mächten mit angefacht.
Da die Menschen als Geiseln genommen werden, können sie keinen ausreichenden Widerpart und erst recht keine eigene Perspektive entwickeln. Leider bedeutet dies, dass in einem wachsenden Teil des Nahen Ostens und Afrikas die ausgebeutete Jugend oft von dem einen oder anderen Feindeslager vereinnahmt wird. Die Folge: sie wird als Kanonenfutter verheizt.
Im Gegensatz dazu versuchen derzeit Hunderttausende Proletarier in der Türkei wie in Brasilien, sich zu organisieren und eigenständig zu kämpfen. In beiden Fällen haben sie eine gewaltige Solidaritäts- und Protestwelle ausgelöst. Was besonders auffällt, ist die Tatsache, dass sich die junge Generation sowohl in der Türkei als auch in Brasilien auf die Bewegung der Indignados in Spanien beruft und stark von ihr inspiriert wird. Gleichzeitig werden beide Bewegungen mit der gleichen brutalen Repression konfrontiert: Sowohl die rückständige, islamistisch geprägte Regierung in der Türkei als auch die von der Linken geführte Regierung in Brasilien geht brutal gewaltsam gegen die Protestierenden vor. Dabei behauptet die « radikale » und « fortschrittliche » Linke in Brasilien, die als eine Variante des in Südamerika weit verbreiteten berühmten « Sozialismus des 21. Jahrhunderts » auftritt, aus Brasilien ein Schwellenland zu machen und die Mehrheit der Bevölkerung aus ihrer Armut zu führen. Auch wenn die Erhöhung der Fahrpreise im Nahverkehr als Sprengstoff der Bewegung wirkte und deren gemeinsamer Nenner darstellte, beschränkt sich die Bewegung in Brasilien keinesfalls auf ausschließlich ökonomische Forderungen. Trotz des spektakulären Kniefalls der Regierung, die aufgrund des Drucks diesen Angriff rückgängig machen musste (wie es 2006 in Anbetracht der massiven Mobilisierung der jungen Proletarier die französische Regierung auch tun musste, als sie den CPE (Ersteinstellungsvertrag) durchboxen wollte), reicht der Rückzug der Regierung nicht aus, um die einmal in Bewegung geratenen Massen aufzuhalten. Diese Bewegung bringt in Wirklichkeit eine viel tieferliegende Unzufriedenheit zum Ausdruck. Die Geschehnisse in der Türkei sind noch aufschlussreicher. Die dortige Bewegung stellt einerseits eine Kontinuität mit den Arbeiterkämpfen von Tekel 2008 dar, die seinerzeit ansatzweise ein Potenzial an Kampfbereitschaft und Solidarität zum Ausdruck brachten, das über die von den Herrschenden betriebene Spaltung zwischen den Bevölkerungsgruppen hinwegging. Andererseits kommt in der Bewegung, vor allem unter den jungen Arbeitergenerationen an ihrer Spitze, die Ablehnung der unerträglichen kulturellen und ideologischen Unterdrückung und anderer Zwangsmaßnahmen zum Ausdruck. Die obskuren moralischen und autoritären Werte, die durch die pro-islamische Erdogan-Regierung verkörpert werden, die provozierende Haltung Erdogans, die zu einer Radikalisierung und Ausdehnung der Bewegung infolge der Repression geführt hat, verstärkt das Bestrebungen nach Würde noch mehr.
Trotz des Gewichtes der Gewalt und des gesellschaftlichen Zerfalls und mehr noch als beim Arabischen Frühling, der relativ leicht durch die Religiösen wieder eingedämmt werden konnte, sind die Proteste der jungen Proletarier in Europa, die von eine Reihe von Arbeiterkämpfen in den großen Industriezentren des Landes mit angetrieben und durch die laizistische Erfahrung seit Mustafa Kemal beeinflusst wurden, Teil einer tiefgreifenden Dynamik, die sich in Kontinuität mit den Kämpfen der Indignados, der Occupy-Bewegung und letztendlich mit dem Mai 1968 befindet. Hier liegen die tieferen Wurzeln einer Bewegung, die sich gegen eine Welt der Armut, der ideologischen Unterdrückung und Ausbeutung richtet. Auch die Bewegung in Brasilien hat sich gegen diese Art von Staatsreligion und nationale Einheit in Gestalt des « Fußballgotts » gerichtet. Denn es wurde laut und heftig gegen die gewaltigen Staatsausgaben zur Vorbereitung der WM in Brasilien protestiert.
Die Bewegung wird von einer jungen, kämpferischen Generation getragen, von Arbeiterkindern, die weniger als die Generation ihrer Eltern von der Bürde der Niederlagen, des Stalinismus und der Konterrevolution im Allgemeinen gefesselt ist. Diese Jugend reagiert und ruft zu Massenversammlungen oder zu Mobilisierung mit Hilfe von Mobiltelefonen und sozialen Netzwerken wie Twitter auf. Von den Favelas im Norden Rios und den gigantischen Kundgebungen in allen Großstädten Brasiliiens über den Taksim-Platz und den Versammlungen in den Parks von Istanbul und anderswo in der Türkei bis zu den Kundgebungen der StudentInnen in Chile - sie alle streben nach einer anderen Art von gesellschaftlichen Verhältnissen, Verhältnisse, in denen die Menschen nicht mehr verachtet und wie Vieh behandelt werden.
Diese Bewegungen kündigen eine neue Zeit an. Sie spiegeln tiefgreifende Regungen wider, um aus der Resignation auszubrechen und die Logik der Konkurrenz zu überwinden, die das herausragende Merkmal des Kapitalismus ist. Sie entwickeln sich auf dem gleichen Boden wie die Bewegungen in den Ländern im historischen Herzen des Kapitalismus, wo sich die Lebensbedingungen zwar auch verschlechtert haben, es der Arbeiterklasse noch nicht gelungen ist, den Weg zu massiven Kämpfen zurückzufinden. Zum Großteil ist dies darauf zurückzuführen, dass sie einer sehr erfahrenen und gut organisierten herrschenden Klasse gegenübersteht. Aber schon jetzt richten sich die Blicke der Protestierenden in der Türkei und in Brasilien auf die Arbeiterklasse in den zentralen Ländern, insbesondere Europas, denn in Europa ist die Arbeiterklasse immer noch zahlenmäßig am stärksten gebündelt, verfügt über die meiste Erfahrung über die Fallen und tückischen Verschleierungen (wie die Demokratie oder die « freien » Gewerkschaften), die vom Klassenfeind ständig gegen sie eingesetzt werden.
Die Kampfmethoden, die sie potenziell entfalten könnte, wie selbständige und massenhafte Vollversammlungen, sind wirksame Waffen der gesamten Arbeiterklasse weltweit. Die Zukunft der ganzen Menschheit hängt davon ab, ob es gelingt, diese Waffen überall zum Einsatz zu bringen. Wim, 26.6.2013.
Aktuelles und Laufendes:
Proteste gegen Fahrpreiserhöhungen in Brasilien
- 2015 Aufrufe
Die Repression durch die Polizei fachte die Wut der Jugend an
Eine Welle von Protesten gegen die Fahrpreiserhöhungen des Nahverkehrs erschüttert gegenwärtig die großen Städte Brasiliens. Insbesondere São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Aracaju und Natal. Bei den Protesten kamen bislang Jugendliche, Studenten, Schüler und viele Beschäftigte und “Freiberufler”, zusammen, die gegen die Preiserhöhungen ankämpfen. Bislang waren die Fahrpreise bei schlechter Qualität des Nahverkehrs schon sehr hoch, die jüngste Preiserhöhung bedeutet einen weiteren Einschnitt in die Lebensbedingungen großer Teile der Bevölkerung.
Die brasilianische Bourgeoisie, mit der PT (Partei der Arbeit) und ihren Verbündeten an der Spitze, behauptete, alles läge im Bereich der Norm. Dabei sieht die Wirklichkeit ganz anders aus, denn die Mehrheit der Bevölkerung leidet unter der Inflation. Die bisherigen Geldspritzen zur Ankurbelung des Konsums, damit das Abrutschen der Wirtschaft in die Rezession vermieden wird, ändern daran nichts. In ihrem Spielraum eingeengt, ist die einzige Alternative beim Kampf gegen die Inflation aus der Sicht der Herrschenden die Erhöhung der Zinsen und die Reduzierung der öffentlichen Ausgaben im Bereich Gesundheitswesen, Erziehung, Sozialhilfe, wodurch die Lebensbedingungen für die Menschen, die von diesen Zahlungen abhängig sind, noch schlechter werden.
In den letzten Jahren haben viele Streiks gegen die Lohnsenkungen und die Prekarisierung der Arbeitsbedingungen sowie gegen die Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitswesen stattgefunden. Aber in den meisten Fällen waren diese Streiks isoliert worden durch den Sperrring, den die mit der Regierung (welche von der PT dominiert wird) verbundenen Gewerkschaften gelegt hatten. Die Unzufriedenheit konnte eingedämmt werden, damit der “soziale Frieden” nicht auf Kosten der Volkswirtschaft angekratzt wurde. Vor diesem Hintergrund begannen die Proteste gegen die Fahrpreiserhöhungen in São Paulo und den anderen Landesteilen: überall verlangt die Regierung mehr Opfer von den Beschäftigten zur Unterstützung der Volkswirtschaft, d.h. des nationalen Kapitals.
Zweifelsohne zeugen die Beispiele der Bewegungen, die in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern ausgebrochen sind und an denen sich viele Jugendliche beteiligt hatten, davon dass der Kapitalismus der Menschheit keine andere Alternative anzubieten hat als ein unmenschliches Dasein. Deshalb hat die jüngste Protestwelle in der Türkei auch bei den Protesten in Brasilien gegen die Fahrpreiserhöhungen ein solch großes Echo gehabt. Die brasilianische Jugend hat gezeigt, dass sie die Gesetze des Opferbringens, welche die herrschende Klasse durchboxen will, nicht hinnehmen möchte und stattdessen bereit ist, sich den Kämpfen anzuschließen, die in den letzten Jahren die Welt erschüttert haben – wie die Kämpfe der Jugend gegen den CPE in Frankreich 2006, der Jugend und der Arbeiterklasse insgesamt in Griechenland, Ägypten, Nordafrika, der Indignados in Spanien, der “Occupy”-Bewegung in den USA und in Großbritannien.
Eine Woche von Protesten und der brutalen Reaktion der Herrschenden
Ermutigt durch die Erfolge der Proteste in Porto Alegre und Goiânia, wo die Herrschenden mit brutaler Repression reagiert hatten, aber nicht dazu in der Lage waren, die Fahrpreiserhöhungen durchzusetzen, begannen die Proteste am 6. Juni in São Paulo. Dazu aufgerufen hatte die Bewegung für “kostenlosen Nahverkehr” (MPL, Movimento Passe Livre), eine Gruppe, die im Wesentlichen von jungen Student/innen getragen wird, welche von den Positionen der Linken und Anarchisten beeinflusst werden. Sehr schnell schlossen sich viele Leute dieser Gruppe an, so dass sie gegenwärtig ca. 2-5000 Mitglieder zählt. Weitere Proteste folgten am 7. und 11. und 13. Juni. Von Anfang an gingen die Herrschenden mit brutaler Repression vor, viele Teilnehmer wurden verhaftet und viele Jugendliche verletzt. Wir begrüßen den Mut und die Kampfbereitschaft der Protestierenden, sowie die große Sympathie, mit welcher die Bevölkerung ihnen gegenüber von Anfang an reagierte, so dass selbst die Organisatoren überrascht waren.
Die herrschende Klasse reagierte auf diese Kundgebungen mit einer Welle von Gewalt in einem Ausmaß, wie es die Geschichte dieser Bewegungen bislang noch nicht erlebt hatte. Die Medien haben dem Rückendeckung gegeben, indem sie über Vandalen und rücksichtslose, unverantwortliche Protestierende schimpften. Dabei ragte ein hochrangiger Staatsanwalt heraus, Rogério Zagallo, welcher der Polizei öffentlich empfahl, mit Schlagstöcken vorzugehen und dass diese auch vor dem Gebrauch von Schusswaffen nicht zurückschrecken sollte: „Seit zwei Stunden versuche ich nach Hause zu kommen, aber eine Bande von revoltierenden Affen blockiert die Haltestellen Faria Lima und Marginal Pinheiros. Könnte jemand die Sondereingreiftruppen informieren (Schocktruppen, Eliteeinheit der Militärpolizei), dass dieses Gebiet in meinen Zuständigkeitsbereich fällt, und wenn sie diese Hundesöhne töten, werde ich die polizeilichen Untersuchungen leiten. (…). Wie schön waren die Zeiten, als wir solche Angelegenheiten mit Gummiknüppeln regeln konnten, indem wir diesen Schuften eins auf die Rübe gegeben haben.“
Darüber hinaus hat eine Reihe von Politikern, die unterschiedlichen Parteien angehören, wie der Staatsgouverneur Geraldo Alckmin der PSDB (Sozialdemokratische Partei Brasiliens) und der PT-Bürgermeister von São Paulo die polizeiliche Repression heftig verteidigt und die Bewegung verurteilt. Solche gemeinsamen Stimmen sind nicht häufig zu vernehmen, da das übliche Spiel der Herrschenden darin besteht, sich jeweils gegenseitig die Verantwortung für die Probleme in die Schuhe zu schieben, vor denen die jeweils an der Regierung befindliche Fraktion der Herrschenden steht.
Als Reaktion auf die wachsende Repression und die irreführende Berichterstattung durch die meisten Medien haben sich noch mehr Leute an den Protesten beteiligt: ca. 20.000 am 13. Juni. Die Repression gegen die Demo war noch heftiger, 232 Leute wurden verhaftet, viele verletzt.
Es fällt auf, dass eine neue Generation von Journalisten in Erscheinung getreten ist. Obwohl sie in der Minderheit sind, haben sie eindeutig ihre Solidarität bekundet und über die Polizeigewalt berichtet, gleichzeitig wurden viele von ihnen selbst Zielscheibe polizeilicher Repression. Weil sie sich dessen bewusst sind, dass die Schlagzeilen und Leitartikel der großen Medien meistens manipulierend berichten, ist es diesen Journalisten gewissermaßen gelungen, das gewaltsame Vorgehen der Jugendlichen als Selbstverteidigung darzustellen. Und manchmal waren die Verwüstungen hauptsächlich von Regierungs- und Justizbüros ein Ausdruck der ungebremsten Empörung über den Staat. Aber daneben waren auch Provokateure am Werk, welche die Polizei üblicherweise in solchen Demos einsetzt.
Nachdem die Manipulationen immer deutlicher zutage traten und damit die offiziellen Berichterstattungen durch staatliche Quellen, die Medien und die Polizei sich als Lügen herausgestellt haben, welche eine legitime Bewegung demoralisieren und kriminalisieren sollten, bewirkte diese eine noch größere Mobilisierung der Demonstranten und einen noch größere Unterstützung in der Bevölkerung. Deshalb muss man den großen Beitrag der Leute hervorheben, die in den sozialen Netzwerken aktiv für die Bewegung mobilisiert haben oder mit ihr sympathisieren. Aus Angst, dass die Bewegung unkontrollierbar werde, haben einige Teile der Herrschenden angefangen, einen anderen Ton anzuschlagen. Nach einer Woche des Schweigens und Vertuschens haben die großen Medienunternehmen in ihren Zeitungen und Fernsehsendungen langsam angefangen, von „Polizeiexzessen“ zu reden. Und einige Politiker haben diese „Exzesse“ ebenso kritisiert und Untersuchungen angekündigt.
Die Gewalt der Herrschenden, die mittels des Staates ausgeübt wird, egal ob dieser eine „demokratische“ oder „radikale“ Maske auflegt, stützt sich auf den totalitären Terror der Herrschenden gegen die ausgebeuteten und unterdrückten Klassen. Wenn mit dem „demokratischen“ Staat diese Gewalt nicht so offen in Erscheinung tritt wie in den Diktaturen und mehr verdeckt ausgeübt wird, so dass die Ausgebeuteten ihre Lage als Ausgebeutete hinnehmen und sich mit den Verhältnissen zufrieden geben, bedeutet dies nicht, dass der Staat auf die verschiedensten und modernsten physischen Unterdrückungsmethoden verzichtet, wenn die Lage es erfordert. Es überrascht also nicht, wenn die Polizei so gewaltsam gegen die Bewegung vorgeht. Aber wie die Geschichte gezeigt hat; wer das Feuer gelegt hat, kann es nachher nicht mehr löschen. Die verschärfte Repression hat eine noch größere Solidarisierung in ganz Brasilien zur Folge gehabt, ja sogar international, auch wenn dies zahlenmäßig noch sehr beschränkt ist. Solidaritätskundgebungen außerhalb Brasiliens sind schon geplant. Hauptsächlich werden diese von „Auslandsbrasilianern“ organisiert. Man muss betonen, dass die Polizeigewalt dem Wesen des Staates entspricht und kein Einzelfall oder nur ein ‚Exzess‘ irgendeines Imponiergehabes der Polizei ist, wie es die bürgerlichen Medien und die dem System verbundenen Behörden gerne darstellen. Deshalb haben wir es hier nicht mit einem Versagen der „Führer“ zu tun und es nützt überhaupt nichts, „Gerechtigkeit zu verlangen“ oder ein „umsichtigeres Vorgehen der Polizei. Um die Repression aufzuhalten und den Staat zurückdrängen zu können, gibt es kein anderes Mittel als die Ausdehnung der Bewegung auf immer größere Teile der Arbeiterklasse. Zu diesem Zweck können wir uns nicht an den Staat wenden und ihn anbetteln. Die gesamte Arbeiterklasse muss die Repression anprangern und sich gegen die Preissteigerungen wenden. Ebenfalls muss man dazu aufrufen, dass sich immer mehr an dem Kampf gegen Präkarisierung und Repression beteiligen.
Die Kundgebungen, die noch lange nicht abflauen, haben sich auf ganz Brasilien ausgedehnt. Bei der Eröffnungsfeier des Confed Cup wurde die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff und der FIFA-Präsident Joseph Blatter beim Eröffnungsspiel Brasilien-Japan ausgepfiffen. Die beiden konnten nicht verheimlichen, wie sauer sie über diese Buhrufe waren und verkürzten deshalb ihre Reden. Vor dem Stadion beteiligten sich auch ca. 1200 Personen bei Protesten aus Solidarität mit der Bewegung gegen die Fahrpreiserhöhungen. Auch hier ging die Polizei wieder gewalttätig vor und verletzte 27 Personen und verhaftete 16 Teilnehmer. Um die Repression noch weiter zu verstärken, verbot der Staat jegliche Proteste in der Nähe der Stadien während des Confed Cups, unter dem Vorwand, den Ruf dieser Sportveranstaltung nicht zu schädigen und den Verkehr nicht zu behindern.
Die Grenzen der Bewegung für kostenlosen Nahverkehr und anderer Forderungen
Diese Bewegung konnte sich so stark landesweit ausdehnen, weil sie von jungen Studenten und Schülern getragen wird, die gegen die Fahrpreiserhöhungen protestiert haben. Aber man muss berücksichtigen, dass sie mittel- und langfristig das Ziel verfolgt, die Einführung des kostenlosen Nahverkehrs für die ganze Bevölkerung zu verhandeln, der vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Aber genau hier liegt die Grenze der Hauptforderung, da es in der kapitalistisch regierten Gesellschaft keinen allgemein kostenlosen Nahverkehr geben kann. Um dies durchzusetzen, müssten die herrschende Klasse und ihr Staat die Ausbeutung der Arbeiterklasse noch mehr verschärfen – z.B. durch Steuererhöhungen usw. Deshalb muss man darauf achten, dass der Kampf nicht mit der Perspektive von unmöglichen Reformen geführt wird, sondern immer mit dem Ziel, dass der Staat seine Entscheidungen rückgängig macht. Gegenwärtig scheinen die Perspektiven der Bewegung über die einfachen Forderungen der Rücknahme der Fahrpreiserhöhungen hinauszugehen. Jetzt schon sind Demos und Kundgebungen in Dutzenden von brasilianischen Städten in der nächsten Woche vorgesehen.
Die Bewegung muss sich vor den linken Kräften des Kapitals hüten, die auf die Vereinnahmung der Demonstrationen spezialisiert sind, um sie dann in Sackgassen zu führen wie z.B. die Forderung, dass die Gerichte ihre Probleme lösen....
Damit die Bewegung sich entfaltet, muss man Räume schaffen, wo die Teilnehmer zusammen kommen können, um sich gegenseitig zuzuhören, ihre Standpunkte auszutauschen und zu debattieren. All das geht nur durch die Organisierung von Vollversammlungen, die allen offenstehen müssen, wo jeder Teilnehmer das Wort ergreifen darf. Darüber hinaus müssen die Beschäftigten dazu aufgerufen werden, sich an diesen Versammlungen und Protesten zu beteiligen, denn auch sie sind natürlich von den Preiserhöhungen betroffen.
Die sich in Brasilien entfaltende Protestbewegung ist eine schallende Ohrfeige für die Kampagne der Herrschenden in Brasilien, die mit Unterstützung der Herrschenden auf der ganzen Welt behaupten, Brasilien sei ein „Schwellenland“, das dabei sei, die Armut zu überwinden und eine eigenständige Entwicklung durchlaufe. Diese Kampagne wurde vor allem von dem früheren Präsidenten Lula mit getragen, der weltweit den Ruf genießt, dass er angeblich Millionen Brasilianer aus der Armut geführt habe, während in Wirklichkeit sein großes Verdienst für das Kapital darin besteht, dass er unter der Bevölkerung, insbesondere unter den Ärmsten Krümel verteilt hat, um damit die Illusionen aufrechtzuerhalten und die Prekarisierung der Arbeiterklasse in Brasilien zu verschärfen.
Gegenüber der Weltwirtschaftskrise und den daraus entstehenden Angriffen gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Proletariats gibt es keinen anderen Weg als den Kampf gegen den Kapitalismus.
Revolução Internacional (Internationale Kommunistische Strömung). 16.6.2013.
(P.S. Nachdem dieser Artikel verfasst wurde, kam es den darauf folgenden Tagen in ganz Brasilien wieder zu massenhaften Protesten mit mehreren Hunderttausend Teilnehmern – wir werden weiter auf die Entwicklung eingehen).
Geographisch:
- Süd- und Mittelamerika [521]
Aktuelles und Laufendes:
- Proteste Brasilien [522]
- Fahrpreiserhöhungen Brasilien [523]
- Confed-Cup Proteste [524]
Weltrevolution Nr. 178
- 1642 Aufrufe
Die Tragödie von Lampedusa: Das Kapital und seine Politiker sind für die Katastrophe verantwortlich
- 3411 Aufrufe
Anfang Oktober kenterte ein überfülltes Boot vor der Insel Lampedusa. Mehr als 350 Flüchtlinge starben bei diesem tragischen Ereignis. Einige Tage später sank ein anders Schiff vor der Küste Maltas und ein Dutzend Menschen ertranken dabei. Jedes Jahr verlieren etwa 20.000 Menschen ihr Leben, bevor sie die Festung Europa erreichen! Anfang Oktober kenterte ein überfülltes Boot vor der Insel Lampedusa. Mehr als 350 Flüchtlinge starben bei diesem tragischen Ereignis. Einige Tage später sank ein anders Schiff vor der Küste Maltas und ein Dutzend Menschen ertranken dabei. Jedes Jahr verlieren etwa 20.000 Menschen ihr Leben, bevor sie die Festung Europa erreichen! Seit den 1990er Jahren werden an den Küsten Südeuropas Leichen angeschwemmt, gleich wie an anderen Orten auf der Erde wo ein Strom hungriger und armer Menschen Zuflucht in anderen Staaten sucht.
Die Heuchelei der herrschenden Klasse
Wenn die Bourgeoisie heute betroffene Mine macht und Krokodilstränen vergießt, während schon seit langem Tausende von Menschen an ihren Küsten verenden, dann nur deshalb, weil das Ausmaß, die Verzweiflung und vor allem die Zahl der Opfer an einem einzigen Tag so unübersehbar war. Die herrschende Klasse hat Angst, dass sich die Bevölkerung empört und drüber nachzudenken beginnt.
Die verlogene Polemik um die „unterlassene Hilfe“ der italienischen Fischer soll die Aufmerksamkeit umlenken und Sündenböcke produzieren, während gleichzeitig das bürgerliche Gesetz Leute kriminalisiert, die den Flüchtlingen helfen![1] Das Hauptziel der gehirnwäscheartigen Medienkampagne ist ein Nebel zur Verhüllung der unter den Staaten abgesprochenen repressiven Maßnahmen. Die klassische ideologische Kampagne, die geführt wird, enthält einerseits offen fremdenfeindliche Töne, andererseits den „humanitären“ bürgerlichen Diskurs zur „Verteidigung der Menschenrechte“, und sie versucht, die Immigrant_innen vom Rest der Arbeiterklasse zu trennen und zu isolieren.
Eines ist klar, der krisengeschüttelte Kapitalismus und seine Politiker sind voll und ganz für diese erneute Tragödie verantwortlich. Sie, die Hunderttausende hungriger Menschen dazu zwingen, sich in das selbstmörderische Abenteuer der Flucht zu stürzen, gegen die Hindernisse, die ihnen von der herrschenden Klasse gestellt werden! Es überrascht nicht, wenn die gleichen Politiker, die nach Lampedusa kamen, um sich als betroffen zu präsentieren, von den angewiderten und schockierten Einheimischen am Flughafen ausgebuht wurden.[2]
Die Arbeiterklasse ist eine Klasse von Immigrant_innen
Wenn wir über diese Immigrant_innen schreiben, gilt es festzuhalten, dass alle Arbeiter- und Arbeiterinnen in Wirklichkeit „Entwurzelte“ sind. Seit den Anfangszeiten des Kapitalismus wurden sie von Land und Handwerk vertrieben. Während im Mittelalter die Ausgebeuteten noch an die Erde gebunden waren, schuf sich der Kapitalismus mit einem gewaltsamen Exodus vom Lande die notwendigen Arbeitskräfte. „Die durch Auflösung der feudalen Gefolgschaften und durch stoßweise, gewaltsame Expropriation von Grund und Boden Verjagten, dies vogelfreie Proletariat konnte unmöglich ebenso rasch von der aufkommenden Manufaktur absorbiert werden, als es auf die Welt gesetzt ward. (…) Die Gesetzgebung behandelte sie als "freiwillige" Verbrecher und unterstellte, dass es von ihrem guten Willen abhänge, in den nicht mehr existierenden alten Verhältnissen fortzuarbeiten.“[3] Die Entwicklung des Kapitalismus ist geschichtlich von der freien Verfügbarkeit der Arbeitskraft abhängig. Er produzierte unzählige Bevölkerungsverlagerungen und Migrationsströme, die alles Vorangegangene überstiegen, nur um Mehrwert herauszupressen. Genau aus diesen neuen einheitlichen Bedingungen der Ausgebeuteten hat die Arbeiterbewegung immer wieder hervorgehoben, dass „die Arbeiter kein Vaterland haben“!
Ohne den Sklavenhandel im 17. und 18. Jahrhundert wäre die Entwicklung des Kapitalismus außerhalb der industriellen Zentren und Sklavenhandelsplätzen wie Liverpool, London, Bristol, Zeeland (in Holland), Nantes oder Bordeaux nie so schnell vorangeschritten. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts und in Folge der „gütigen Befreiung“ der Schwarzen in die Lohnarbeit, und begleitet von der kapitalistischen Akkumulation, haben andere ökonomische Faktoren einen Exodus vom Lande und riesige Migrationsströme verursacht, vor allem in den neuen Kontinent Amerika. In der Periode des 19. Jahrhunderts bis 1914 sind 50-60 Millionen Menschen aus Europa in die USA eingewandert, um dort Arbeit zu suchen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts machten sich jährlich fast eine Million Menschen auf den Weg in die USA. Nur schon aus Italien sind zwischen 1901 und 1913 etwa 8 Millionen Menschen emigriert. Die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die während der aufsteigenden Phase des Kapitalismus spielten, erlaubten es dem kapitalistischen System immer mehr Arbeitskräfte aufzusaugen, die es für seine ungehemmte Expansion benötigte.
Durch den dekadenten Kapitalismus wird der Staat zu einem Bunker
Durch den historischen Niedergang des kapitalistischen Systems haben sich die Bevölkerungsverlagerungen und Migrationsströme nicht verringert. Ganz im Gegenteil! Die imperialistischen Kriege, vor allem die zwei Weltkriege, die Wirtschaftskrise, die Verarmung und die Katastrophen aufgrund der Klimaerwärmung, stoßen immer mehr Menschen in die Migration. Im Jahr 2010 wurde die Zahl der Migrant_innen weltweit auf 214 Millionen geschätzt (3.1% der Weltbevölkerung[4]). Es gibt Schätzungen, dass alleine wegen der Klimaerwärmung im Jahre 2050 zwischen 25 Millionen und einer Milliarde mehr Migrant_innen hinzukommen werden![5]
Aufgrund der permanenten Krise des Kapitalismus und der Warenüberproduktion spüren die Einwanderer_innen immer direkter die Grenzen des Marktes und die brutalen Reglementierungen der Staaten. Das Kapital kann die Arbeitskraft nicht mehr aufnehmen und muss sie zum großen Teil zurück schicken! Nachdem schon nach der Zeit der Öffnung der USA vor dem Ersten Weltkrieg ein „Quotensystem“ eingeführt worden war, um die Einwanderung drastisch zu filtern, endete dies mit der Errichtung einer Mauer an der mexikanischen Grenze. Hier bezahlen nach der Tragödie der boat people aus Asien nun die „Chicanos“ mit ihrem Leben. Die offene Wirtschaftskrise während der 1960er und 70er Jahre hat alle Staaten, vor allem in Europa, dazu gebracht ihre Muskeln auf dem Mittelmeer spielen zu lassen, um mit einer Armada von Schiffen und Patrouillenbooten die Immigranten abzufangen und zurück zu schicken. Das unausgesprochene Ziel der herrschenden Klasse ist klar: „Die Immigranten sollen bei sich zu Hause verrecken“! Dazu haben die eifrigen Demokraten Europas, vor allem in Frankreich, nicht davor zurückgeschreckt, auf die Zusammenarbeit mit Gaddafi in Libyen und die Behörden in Marokko zu bauen, um die Menschen, die der Hölle entfliehen wollen, in der Wüste sterben zu lassen.
Diese Politik der „Kontrolle“ der Grenzen, welche immer härter wird, ist ein Produkt der Dekadenz und des Staatskapitalismus. Sie ist nichts Neues. In Frankreich zum Beispiel war „1917 die Schaffung einer Identitätskarte eine wahre Umwälzung der administrativen und polizeilichen Gewohnheiten. Die Mentalität der heutigen Zeit hat sich mit dieser individuellen Stempelung abgefunden, deren polizeilichen Ursprünge nicht mehr als solche wahrgenommen werden. Es ist aber nichts Neutrales, wenn die Institution der Identitätskarte geschaffen wurde, um Ausländer zu überwachen, und zwar mitten im Krieg“[6]
Heute erreicht die Paranoia der Staaten gegenüber den Ausländer_innen, die immer als suspekt betrachtet werden und die „nationale Ordnung gefährden“, einen Höhepunkt. Die gigantischen Mauern aus Beton und Stahl an den Grenzen[7], verziert mit Stacheldraht und Elektrodrähten, erinnern genau an die Zäune der Konzentrations- und Todeslager im Zweiten Weltkrieg. Wenn die europäischen Staaten in Berlin den Fall der „Mauer der Schande“, welche ein Symbol der Barbarei des Eisernen Vorhangs war, im Namen der „Freiheit“ feiern, so demaskieren sie sich selber als die neuen heuchlerischen Erbauer von Mauern!
Das Leid der Migrant_innen
Die Dekadenz des Kapitalismus ist zur Epoche der großen Vertreibungen geworden, die es zu „bewältigen“ gilt, das Zeitalter der Deportierten, der Konzentrationslager und auch der Flüchtlinge (die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge ist von 700‘000 im Jahr 1950 auf 4,8 Millionen im Jahr 2005 gestiegen!). Der Völkermord an den Armenier_innen 1915 führte zu einer der ersten großen Massenfluchtbewegungen im 20. Jahrhundert. Zwischen 1944 und 1950 wurden fast 20 Millionen Menschen in Europa vertrieben oder evakuiert. Die Aufteilung der Staaten und die Grenzziehungen verursachten Massenvertreibungen. Während der „Eiserne Vorhang“ den Exodus von Menschen aus den Ostblockländern bremste, suchten die europäischen Länder die billigen Arbeitskräfte südlich des Mittelmeers. Die so genannten „nationalen Befreiungskämpfe“, die eine Folge der Krise und des Imperialismus währen des Kalten Kriegs waren, trugen weiter zum Elend und zur Vertreibung der verarmten Bauern und Bäuerinnen bei, die in die Millionenstädte insbesondere der peripheren Länder strömten, die Slums ausbauten und allen möglichen Tätigkeiten von mafiösen Banden ausgeliefert waren, vom Drogen- und Waffenhandel bis zur Prostitution. Die Plagen des 20. und 21. Jahrhunderts haben überall, namentlich im Nahen und Mittleren Osten und in Afrika dazu geführt, dass ständige Flüchtlingslager wie Pilze aus dem Boden schossen; immer größere Menschenmassen (Palästinenser_innen, Afrikaner_innen …) wurden unter extremen (Über-)Lebensbedingungen zwischengelagert, Krankheiten und dem Hunger und den Mafias ausgeliefert.
Die Ausbreitung der „illegalen“ Arbeit
Seit dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch des Ostblocks gab es abgesehen von den wachsenden Konflikten zwei wichtige Erscheinungen, die auf den Weltarbeitsmarkt und die Wanderungsbewegungen einen Einfluss hatten:
- die Vertiefung der Wirtschaftskrise, insbesondere in den zentralen Ländern;
- das Aufstreben Chinas.
Zunächst kamen Arbeiter_innen aus den ehemaligen Ostblockländern in den Westen, namentlich nach Deutschland, begleitet von den ersten Produktionsauslagerungen und einem starken Druck auf die Löhne. Dann eröffneten Regime, die bisher eher am Rand des Weltmarktes gestanden hatten, wie Indien und China, die Möglichkeit, auf dem Land Millionen von Arbeier_innen ihrer Wurzeln zu berauben, so dass eine riesige Reservearmee aus frei verfügbaren Arbeitslosen geschaffen wurde.
Ihre extrem niedrigen Löhne auf einem gesättigten Markt erlaubten dem Kapital, den Druck auf die Kosten der Arbeitskraft erneut zu erhöhen, was zu neuen Produktionsauslagerungen führte. Dies erklärt, warum in den zentralen Ländern seit 1990 die Zahl der illegal und versteckt Beschäftigten in gewissen Wirtschaftszweigen gewaltig zugenommen hat, obwohl gleichzeitig die Kontrollen verstärkt worden sind, da diese Dynamik es erlaubte, die Kosten der Produktion und der Arbeitskraft zu senken. Im Jahr 2000 gab es in Europa ungefähr 5 Millionen Schwarzarbeiter_innen, in den USA 12 Millionen und in Indien 20 Millionen! Die meisten der zentralen Länder, welche die Kopfarbeit ausbeuten, stützen sich gleichzeitig auf billige Handarbeit von Papierlosen und Menschen ohne Berufsbildung, die ihre Arbeitskraft zu jedem noch so tiefen Preis verkaufen müssen, um zu überleben. In verschiedenen Wirtschaftszweigen organisierte sich in Komplizenschaft mit dem Staat ein paralleler und geheimer Arbeitsmarkt, was zu einem Zustrom von Migrant_innen und Flüchtlingen führte, die der Erpressung ausgeliefert sind, ihrer Papiere beraubt und in jämmerlichen Unterkünften vom Rest der Gesellschaft abschottet werden. Die Folge davon ist, dass heute ein wesentlicher Teil der landwirtschaftlichen Ernten durch ausländische Arbeitskräfte eingebracht wird, die oft Schwarzarbeit leisten. In Italien arbeiten 65% der landwirtschaftlichen Angestellten schwarz! Seit dem Fall der Berliner Mauer sind 2 Millionen Rumän_innen in die südlichen Regionen Europas ausgewandert, um Arbeiten in der Landwirtschaft anzunehmen. In Spanien beruhte ein wesentlicher Teil des „Booms“ vor dem Krach in der Immobilienbranche auf der Arbeit und dem Schweiß der unterbezahlten Schwarzarbeiter_innen, die oft auf Lateinamerika stammten (Ecuador, Peru, Bolivien usw.). Dazu kommen die „Grauzonen“ des Arbeitsmarktes wie die Prostitution. Im Jahr 2003 waren in Moldawien 30% der Frauen zwischen 18 und 25 Jahren verschwunden! Im gleichen Jahr arbeiteten 500‘000 Prostituierte aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks in Westeuropa. In Asien und in den Golf-Monarchien sind die gleichen Erscheinungen bei Hausangestellten oder auf dem Bau zu beobachten. In Katar machen die Eingewanderten 86% der Bevölkerung aus! Ein Teil der Jugend in China oder auf den Philippinen lässt sich mit dem Ziel ausbilden, später in Hongkong oder in Saudi-Arabien unter sklavenähnlichen Bedingungen zu arbeiten. Mit der Ausbreitung von kriegerischen Spannungen ist zu erwarten, dass in Zukunft noch mehr Menschen und solche Arbeiter_innen die Flucht ergreifen, insbesondere aus Afrika, Asien und aus dem Nahen Osten.
Der Kampf des Proletariats
Der sich entfesselnden Barbarei, der Polizeirepression gegen Einwanderer_innen und den fremdenfeindlichen Kampagnen, die ein Teil der Bourgeoisie mit ihren populistischen Botschaften zu führen versucht, kann das Proletariat nur seine eigene Empörung und seine internationale Klassensolidarität entgegenstellen. Dazu gehört natürlich, dass wir den herrschenden Diskurs entlarven, der versucht, Angstreflexe zu schüren, die Immigrant_innen und den „Ausländer“ verantwortlich zu machen für die Krise und die Arbeitslosigkeit. Nachdem früher die Aufmerksamkeit auf die „gelbe Gefahr“, die drohende „Invasion“ gelenkt worden ist, spielen heute die Medien und Politiker jeder Couleur mit den Ängsten, indem sie die „Kriminalität“ und die „Störung von Ruhe und Ordnung“ an die Wand malen. Unaufhörlich stopfen sie uns voll mit ihren Botschaften über „die Ausländer“, die „Illegalen“, die eine „unfaire Konkurrenz“ ausüben und die „sozialen Errungenschaft untergraben“ würden ... Und dies, obwohl die Migrant_innen die ersten und schwächsten Opfer des Systems sind! Eine solche plumpe und ekelerregende Taktik ist stets mit dem Ziel angewandt worden, die Proletarier_innen voneinander zu trennen. Aber die hinterhältigste Falle, der wir ausweichen müssen, ist diejenige des „guten Willens“ und der Pseudogroßzügigkeit der linken und „humanitären“ Organisationen, die aus den Einwanderer_innen eine „gesellschaftliche Sache“, einen Gegenstand einer „besonderen Politik“, eines „Teilbereichskampfes“ machen wollen, eine Rechtsfrage, die als solche im Rahmen des bürgerlichen Rechts zu behandeln sei.
Heute, wo die Fabriken eine nach der anderen schließen, wo die Auftragsbücher trotz der Ankündigung des „Wiederaufschwungs“ leer sind, wird es offensichtlich, dass alle Proletarier_innen von der Krise und der zunehmenden Armut getroffen werden – egal ob eingewandert oder nicht. Worin soll der Sinn der Idee liegen, dass die papierlosen Arbeiter_innen eine Konkurrenz seien, wenn die Arbeit eh eingestellt wird?
Angesichts aller ideologischen Angriffe und der Repressionspolitik muss sich das Proletariat auf seine historische Perspektive besinnen. Es muss damit beginnen, seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen, die revolutionäre Kraft erkennen, die es in dieser Gesellschaft darstellt. Nur es allein wird fähig sein, im Kampf zu zeigen, dass „die Arbeiter kein Vaterland haben“.
WH (21/10/2013)
[1] Es ist absurd: Fischer, die in Sangatte Bootsflüchtlingen Sicherheitsbegleitung geleistet hatten, wurden im Namen des Gesetzes Bossi-Fini verfolgt, weil sie sich angeblich der « Hilfe zur illegalen Einwanderung » schuldig gemacht hätten!
[2] Der italienische Premierminister Alfano wurde von Barroso, dem Präsidenten der Europäischen Union, und dem Zuständigen für innere Angelegenheiten Malmström begleitet. Sie traten mit Beteuerungen auf, im Namen der „Menschlichkeit“ die Überwachung der Grenzen mit dem Frontex-Dispositiv zu verstärken.
[3] Marx, Das Kapital Bd. 1: https://www.mlwerke.de/me/me23/me23_741.htm#Kap_24_3 [526]
[4] Quelle: INED
[5] 133 Naturkatastrophen wurden 1980 registriert. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren auf mehr als 350 pro Jahr angewachsen. Siehe: https://www.unhcr.org [527]
[6] P-J Deschott, F. Huguenin, La république xénophobe, JC Lattès, 2001(von uns ins Deutsche übersetzt)
[7] In Südeuropa (Ceuta, Melilla), an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, zwischen Israel und Palästina, und in Südafrika gegenüber dem Rest des Kontinents, wo die Behörden von Gaborone daran sind, eine elektrifizierte Mauer von 2.4 Metern Höhe und 500 Kilometer Länge zu errichten.
Filmkritik - Hannah Arendt: Ein Lob auf das Denken
- 2759 Aufrufe
Deutschlands leidvolle Geschichte des 20.Jahrhundert ist reich an dramatischen und schrecklichen Themen und eine ganze Anzahl von erfolgreichen Filmen in den letzten Jahren belegt dies eindrucksvoll: so etwa Der Pianist (über das Warschauer Ghetto), Goodbye Lenin oder Das Leben der Anderen (über die DDR und den Fall der Mauer) (1).
Die Regisseurin Margarete von Trotta hat sich bereits mehrmals mit heiklen Themen aus der jüngeren deutsche Geschichte auseinandergesetzt: Die bleierne Zeit (1981), eine dramatisierte Version vom Leben und Sterben der Terroristin Gudrun Ensslin von der Roten Armee Fraktion (die Umstände ihres Todes im Stammheimer Gefängnis konnten nie ganz geklärt werden); eine Filmbiographie über Rosa Luxemburg (1986); der Film Rosenstraße (2003), der sich mit dem Protest deutscher Frauen gegen die Gestapo im Jahre 1943 angesichts der Inhaftierung ihrer jüdischen Ehemänner auseinandersetzt. In ihrem neuesten Film Hannah Arendt (2012/13) kehrt von Trotta thematisch zu den Themen Krieg, Shoah und Nazismus zurück, indem sie sich mit einer Episode aus dem Leben der deutschen Philosophin Hannah Arendt auseinandersetzt, die übrigens überzeugend von Barbara Sukowa dargestellt wird.
Hannah Arendt: Ein Lob auf das Denken
Filmkritik
Deutschlands leidvolle Geschichte des 20.Jahrhundert ist reich an dramatischen und schrecklichen Themen und eine ganze Anzahl von erfolgreichen Filmen in den letzten Jahren belegt dies eindrucksvoll: so etwa Der Pianist (über das Warschauer Ghetto), Goodbye Lenin oder Das Leben der Anderen (über die DDR und den Fall der Mauer) (1).
Die Regisseurin Margarete von Trotta hat sich bereits mehrmals mit heiklen Themen aus der jüngeren deutsche Geschichte auseinandergesetzt: Die bleierne Zeit (1981), eine dramatisierte Version vom Leben und Sterben der Terroristin Gudrun Ensslin von der Roten Armee Fraktion (die Umstände ihres Todes im Stammheimer Gefängnis konnten nie ganz geklärt werden); eine Filmbiographie über Rosa Luxemburg (1986); der Film Rosenstraße (2003), der sich mit dem Protest deutscher Frauen gegen die Gestapo im Jahre 1943 angesichts der Inhaftierung ihrer jüdischen Ehemänner auseinandersetzt. In ihrem neuesten Film Hannah Arendt (2012/13) kehrt von Trotta thematisch zu den Themen Krieg, Shoah und Nazismus zurück, indem sie sich mit einer Episode aus dem Leben der deutschen Philosophin Hannah Arendt auseinandersetzt, die übrigens überzeugend von Barbara Sukowa dargestellt wird.
Hannah Arendt wurde 1906 als Spross einer jüdischen Familie geboren. Als junge Studentin besuchte sie Seminare und Vorlesungen des Philosophen Martin Heidegger, mit dem sie eine kurze, aber intensive Liebesbeziehung hatte. Die Tatsache, dass sie weder ihre Beziehung zu ihm noch die Person Heidegger abgelehnt hat, obwohl er 1933 der NSDAP beigetreten war(2), wurde ihr später immer wieder massiv zum Vorwurf gemacht. Ihre Beziehungen zu Heidegger und seiner Philosophie sind zweifelsohne komplex und könnten für sich genommen ein ganzes Buch füllen; und die Rückblenden zu ihren Begegnungen mit Heidegger sind vermutlich die am wenigsten gelungenen im Film, da sich von Trotta bei diesen Szenen ihrer zentralen Filmthematik am wenigsten sicher scheint: der „Banalität des Bösen“.
Nach der Machtergreifung Hitlers 1933 floh Arendt aus Deutschland und emigrierte nach Paris, wo sie, trotz ihrer kritischen Haltung, in der zionistischen Bewegung aktiv war. In Paris heiratete sie 1940 ihren zweiten Ehemann Heinrich Blücher. Im Zuge der deutschen Invasion Frankreichs wurde Arendt vom französischen Staat in einem Lager in Gurs interniert. Von dort gelang ihr die Flucht und nach so mancher Strapaze erreichte sie 1941 schließlich die USA.
Ohne einen Cent in ihren Taschen bei ihrer Ankunft gelang es ihr bald, für ihren Lebensunterhalt aufzukommen, und schließlich erhielt sie als erste Frau überhaupt eine Professur an der renommierten Princeton-Universität. 1960, wo der Film einsetzt, war Arendt bereits eine bekannte und anerkannte Intellektuelle, die schon zwei ihrer bekanntesten Werke veröffentlicht hatte: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951) und Vom tätigen Leben (1958).
Obgleich sie sicher keine Marxistin war, interessierte sie sich für die Arbeiten Marx‘ und somit auch für die von Rosa Luxemburg (3). Ihr Ehemann Heinrich war erst ein Spartakist gewesen, dann im Oppositionsflügel der KPD, der sich gegen die Stalinisierung der KPD in den 20ern wandte. Er folgte Brandler und Thalheimer in die KPD-Opposition (aka KPO), nachdem sie aus der Partei ausgeschlossen worden waren (4). Der Film erwähnt Heinrichs Parteimitgliedschaft: Wir erfahren von einem befreundeten amerikanischen Paar, dass „Heinrich bis zum Ende bei Rosa Luxemburg war“. Des Weiteren ist Arendts philosophisches Werk, besonders ihre Analyse der Mechanismen des Totalitarismus ist bis zum heutigen Tag relevant. Ihr rigoroses Denken und ihre Integrität erlaubten es Arendt, die Klischees und Allgemeinplätze der damaligen herrschenden Ideologie zu durchbrechen: Sie (ver-)störte durch ihre Ehrlichkeit.
Die Eingangsszene ruft die Entführung Adolf Eichmanns in Argentinien durch den Mossad in Erinnerung. Während der Nazi-Herrschaft hatte Eichmann zahlreiche wichtige Positionen inne, u.a. organisierte er erst die Deportation der Juden aus Österreich, dann die Durchführung der „Endlösung“, insbesondere den Transport der europäischen Juden in die Todeslager von Auschwitz, Treblinka und andere. Das Ziel David Ben-Gurions, dem damaligen ersten Premierminister von Israel und Verantwortlichen für die Mossad-Operation, war offensichtlich, einen Gerichtsprozess zu inszenieren, der die Fundamente des jungen israelischen Staates zementieren sollte. Außerdem sollten die Juden selbst über einen der Täter ihres Genozids urteilen.
Als Arendt von dem bevorstehenden Eichmann-Prozess erfuhr, meldete sie sich freiwillig für das literarische Magazin The New Yorker, um vom Prozess zu berichten. Ihre detaillierte und akribische Berichterstattung vom Prozess erschien zunächst in einer Serie von Artikeln, schließlich als Buch mit dem Titel Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen. Die Veröffentlichung löste einen riesigen Skandal in Israel, aber mehr noch in den USA aus: Arendt sah sich einer unglaublich aggressiven und feindseligen Medienkampagne ausgesetzt: „die sich selbst-hassende Jüdin“ und „die Rosa Luxemburg des Nichts“ waren nur zwei der etwas weniger schlimmen Verleumdungen, die ihr entgegen geschleudert wurden. Ihr wurde nahegelegt, von ihrer Universitätsberufung zurückzutreten, aber sie lehnte dies ab. Es ist eben diese Phase, die die Entwicklung von Arendts Denken und ihre Reaktion gegen jene Medienkampagne markieren, welche das Material für diesen Film liefern.
Arendts Denken und ihre Reaktion auf diese Medienkampagne bilden die Basis für den Film. Wenn man es recht bedenkt, dann ist es wahrlich eine Herausforderung, einen Film über das widersprüchliche Denken und die manchmal schmerzhafte Entwicklung einer Philosophin filmisch zu thematisieren, ohne die Thematik zu trivialisieren. Eine Herausforderung, die von Trotta und Sukowa mit Bravour meistern.
Wie konnte Arendts Bericht überhaupt solch einen Skandal auslösen? (5) Bis zu einem bestimmten Punkt war solch eine Reaktion nachvollziehbar und sogar zwangsläufig: auch wenn Arendt ihre Kritik so präzise wie ein kunstfertiger Chirurg das Skalpell anlegt, waren für viele Menschen der Zweite Weltkrieg und die ungeheuerlichen Leiden der Shoah noch zu nah, die Traumata noch zu aktuell, um sich diesen Ereignissen mit Abstand zu nähern. Doch die lautesten Stimmen waren auch die mit dem größten Interesse; Interesse, dass der Vorhang des Schweigens über die unbequemen Wahrheiten gezogen wird, die Arendts Kritik offenlegte.
Arendt ging ans Eingemachte, als sie Ben-Gurions Versuch, den Eichmann-Prozess zu instrumentalisieren, um Israels Existenz mit dem Leid der Juden während der Shoah zu rechtfertigen, argumentativ auseinander nahm.
Für dieses Vorhaben musste Eichmann regelrecht ein Monster sein, ein „würdiger“ Vertreter der monströsen Verbrechen der Nazis. Auch Arendt selbst hatte erwartet, ein Monster auf der Anklagebank vorzufinden, doch je mehr sie ihn beobachtete, desto weniger war sie nicht von seiner Schuld, aber von seiner „Monstrosität“ überzeugt.
In den Prozessszenen platziert von Trotta Arendt nicht in den Gerichtssaal, sondern in den Presseraum, wo die Journalisten den Prozess über die Videoüberwachung beobachten. Dieser Kunstgriff erlaubt es von Trotta den echten Eichmann im Film zu zeigen (statt eines Schauspielers, der Eichmann darstellt). Wie Arendt sehen und erleben wir als Zuschauer so einen mehr als durchschnittlichen Mann (Arendt verwendet den Begriff „Banalität“ im Sinne von „Durchschnittlichkeit“), der weder etwas mit dem mörderischen Wahnsinn Hitlers noch mit der verrückten Kaltblütigkeit eines Goebbels (die beide im Film „Der Untergang“ von Bruno Ganz und Ulrich Matthes großartig dargestellt wurden) gemeinsam hat. Im Gegenteil, wir sehen uns konfrontiert mit einem kleinen Bürokraten, dessen intellektueller Horizont kaum über die Wände seines Büros hinausreicht, der sich hauptsächlich mit der Hoffnung auf den Aufstieg auf der Karriereleiter und bürokratischen Rivalitäten beschäftigte. Eichmann ist kein Monster, war Arendts Schlussfolgerung: „es wäre sehr beruhigend gewesen, wenn man hätte glauben können, dass Eichmann ein Monster sei (…) Das Problem mit Eichmann war aber eben, dass so viele so sind wie e, und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch war und dass sie noch immer schrecklich und schrecklich normal sind (6).“ (eigene Übersetzung, S.274) Um es auf den Punkt zu bringen: Für Arendt bestand Eichmanns Verbrechen primär nicht darin, dass er im selben Maße wie Hitler für die Vernichtung der Juden verantwortlich war, sondern in erster Linie darin, dass er die Fähigkeit des eigenständigen Denkens abgelegt hat und sich legal und mit ruhigem Gewissen als Rädchen in der totalitären Maschinerie eines verbrecherischen Staates bewegt hat. Der nie in Zweifel gezogene „gesunde Menschenverstand“ der prominenten NS-Führer diente ihm als „moralische Instanz“. Die Wannsee-Konferenz (auf der die logistische Umsetzung der so genannten Endlösung beschlossen wurde) war dementsprechend „ein sehr wichtiger Moment für Eichmann, da er noch nie zuvor mit so vielen Nazigrößen persönlich in Kontakt gekommen war (…) Nun konnte er mit eigenen Augen sehen, dass nicht nur Hitler oder Heydrich oder die ‚Sphinx‘ Müller und nicht nur die SS oder die Partei, sondern die ganze Elite der Bürokratie miteinander in Konkurrenz standen und gegeneinander kämpften, um die Führung in diesen ‚blutigen‘ Angelegenheiten zu übernehmen“ (S.111f, eigene Übersetzung).
Arendt lehnt ausdrücklich die These ab, derzufolge „potenziell alle Deutschen schuldig“ seien oder eine „Kollektivschuld“ trügen. Für Arendt verdiente Eichmann die Hinrichtung für seine Taten (auch wenn dies die Millionen Opfer nicht wieder zum Leben bringen würde). Insgesamt kann man festhalten, dass ihre Analyse eine kühne Absage an die antifaschistische Ideologie ist, die bald offizielle Staatsideologie wurde, besonders in Israel. Aus unserer Sicht ist die Banalität, die Arendt beschreibt, die der kapitalistischen Welt, in der die Menschen verdinglicht und entfremdet werden. Sie werden reduziert auf den Status von Objekten, Waren oder Rädchen im kapitalistischen Getriebe. Dieses maschinelle Funktionieren ist nicht allein charakteristisch für den Nazistaat. Arendt erinnert uns daran, dass die Politik, das eigene Territorium „judenrein“ zu machen, bereits 1937 vom polnischen Staat in Betracht gezogen war, und auch die demokratische französische Regierung – besonders der französische Außenminister Georges Bonnet – hatte vor dem Zweiten Weltkrieg die Ausweisung von 200 000 „nicht-französischer“ Juden nach Madagaskar angedacht (hierzu hatte Bonnet sogar seinen deutschen Amtskollegen Ribbentrop um Rat gefragt). Ferner argumentierte Arendt, dass auch die Nürnberger Prozesse nichts weiter als Schauprozesse der Siegermächte waren, in denen die Richter Länder repräsentierten, die sich ebenfalls Kriegsverbrechen schuldig gemacht hatten: der russische Staat für die Toten im Gulag, der amerikanische Staat für den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.
Auch mit dem israelischen Staat ging Arendt nicht zimperlich um. Im Unterschied zu anderen Berichterstattern betonte sie in ihrem Buch die Ironie des Eichmann-Prozesses, in dem rassistisch motivierte Verbrechen durch einen israelischen Staat angeklagt wurden, der selbst „rassische“ Merkmale in seinen Gesetzen einbaute: „Nach den Rabbinerregeln gilt das Gesetz, dass es jüdischen Bürgern nicht erlaubt ist, Nicht-Juden zu heiraten; Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, werden zwar anerkannt, aber die Kinder von ‚Mischehen‘ gelten vor dem Gesetz als illegitim (…) und sollte jemand eine nicht-jüdische Mutter haben, kann er in Israel weder heiraten noch beerdigt werden.“ Es ist in der Tat eine bittere Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet jene, die der Nazipolitik der „Rassenreinheit“ entkommen konnten, dann selbst versuchten, ihre eigene „Rassenreinheit“ im Gelobten Land zu kreieren. Arendt verabscheute Nationalismus im Allgemeinen und den israelischen Nationalismus im Besonderen. Bereits im Jahre 1930 stellte sie sich gegen die zionistische Politik und deren Verweigerung eines gemeinsamen, friedlichen Lebens mit den Palästinensern. Auch zögerte sie nicht, die heuchlerische Politik der Regierung Ben-Gurions öffentlich anzuprangern, die zwar einerseits die Verbindungen zwischen Nazis und einigen arabischen Staaten öffentlich machte, andererseits aber verschwieg, dass in Westdeutschland eine nicht unerhebliche Zahl von Nazigrößen auf verantwortungsvollen Posten schützten.
Ein weiteres Skandalthema war die Frage des Judenrates – die Judenräte waren von den Nazis mit dem Ziel geschaffen worden, die sogenannte Endlösung effizienter umsetzen zu können. Dies füllt nur einige Seiten in ihrem Buch, aber sie gehen ans Herz. Sie schreibt: „Wo immer Juden lebten, stets gab es anerkannte jüdische Anführer, und diese Führerschaft kollaborierte– beinahe ohne Ausnahme – auf die eine oder andere Weise, aus dem einen oder anderen Grund mit den Nazis. Die ganze Wahrheit war, dass, wenn die jüdische Bevölkerung total unorganisiert und führerlos gewesen wäre, es zwar auch Chaos und unglaublich viel Leid gegeben hätte, aber die gesamte Opferzahl hätte kaum zwischen 4½ und 6 Millionen Menschen erreicht (…) Ich habe mich mit diesem Kapitel der Geschichte beschäftigt, weil der Prozess in Jerusalem gescheitert ist, diese wahren Dimensionen vor der Weltöffentlichkeit zu offenbaren. Warum? Nun, es bietet das deutlichste Beispiel für die Erkenntnis, dass der moralische Kollaps in der respektablen europäischen Gesellschaft durch die Nazis ein totaler war“(eigene Übersetzung, S. 123). Sie enthüllte sogar ein Element der Klassenunterscheidung zwischen den jüdischen Anführern und der anonymen Masse: inmitten des allgemeinen Desasters verfügten jene, die entkommen konnten, entweder über hinreichenden Reichtum, mit dem sie ihre Flucht kaufen konnten, oder waren der „internationalen Gemeinschaft“ bekannt genug, um in Theresienstadt, einer Art privilegiertes Ghetto (inhaltlich??), am Leben erhalten zu bleiben. Die Beziehungen zwischen der jüdischen Bevölkerung und dem Nazi-Regime, und mit anderen europäischen Bevölkerungen war viel komplizierter, als die offizielle manichäische Ideologie der Siegermächte bereit war zuzugeben.
Die Naziherrschaft und die Shoah nehmen einen zentralen Platz in der modernen europäischen Geschichte ein, heute sogar noch mehr als in den 1960ern. Trotz des Bemühens etwa der Autoren des Buches „Schwarzbuch des Kommunismus“, gilt der Nationalsozialismus bis heute als das „ultimative Böse“. In Frankreich bildet die Shoah neben der Résistance einen sehr wichtigen Bestandteil des Lehrplans Geschichte, unter Ausschluss fast aller anderen Aspekte des 2.Weltkrieges. Und doch, zumindest rein rechnerisch war der Stalinismus gemessen an der Anzahl seiner Opfer weit schlimmer: 20 Millionen Tote in Stalins Gulag und mindestens 20 Millionen Tote während Maos „Großem Sprung“. Natürlich hat dies zu einem Gutteil mit der opportunistischen Kalkulation zu tun, dass die Nachfolger Stalins und Maos noch immer an der Macht sind, dass sie Menschen sind, mit denen man „Geschäfte machen“ muss und kann. Arendt setzt sich nicht direkt mit dieser Frage auseinander, aber in einer Erörterung der Anklagepunkte gegen Eichmann besteht sie auf die Tatsache, dass die Naziverbrechen nicht ein Verbrechen gegen die Juden, sondern ein Verbrechen gegen die ganze Menschheit in Gestalt der jüdischen Menschen gewesen war, gerade weil den Juden die Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies abgesprochen wurde; sie wurden als unmenschliches Übel dargestellt, das es auszulöschen galt. Dieser rassistische, fremdenfeindliche und obskure Aspekt des Naziregimes wurde freimütig verkündet, was es Teilen der herrschenden europäischen Klasse, aber auch der Bauernschaft und des Handwerks, die von der Wirtschaftskrise ruiniert worden waren, ermöglichte, sich in ihm bequem zu machen. Auf der anderen Seite hatte der Stalinismus stets behauptet, fortschrittlich zu sein: Man sang noch immer: „Die Internationale erkämpft das Menschenrecht“, und das erklärt auch, warum bis zum Fall der Mauer und sogar danach gewöhnliche Menschen weiterhin die stalinistischen Regimes im Namen einer besseren Zukunft verteidigten (7).
Arendts zentrale These ist, dass sowohl die „unvorstellbare“ Barbarei der Shoah als auch die Durchschnittlichkeit der Nazibürokraten ein Produkt der Vernichtung der „Fähigkeit zum Denken“ entspringt. Eichmann „denkt nicht“, er führt die Befehle der Maschinerie aus, kommt seiner Tätigkeit gründlich und gewissenhaft nach, ohne jegliche Skrupel, ohne je die Verbindung zu dem Horror der Konzentrationslager zu sehen, obgleich sie ihm dennoch bewusst war. In diesem Sinne sollte von Trottas Film als eine Eloge des kritischen Denkens gesehen werden.
Hannah Arendt war keine Marxistin, auch keine Revolutionärin. Da sie aber Fragen stellte, die die offizielle antifaschistische Ideologie untergruben, wurde sie so zur Gegnerin des banalen Konformismus und der Abschaffung des kritischen Denkens. Das Verdienst ihrer Analyse besteht darin, dass sie ein Tor zur Reflexion des menschlichen Gewissens öffnet (ähnlich wie die Arbeit des US-Psychologen Stanley Milgram über die Mechanismen der „Gehorsamkeitsbereitschaft gegenüber Autorität“ von Folterknechten, was in Henri Verneuils Film „I wie Ikarus“ filmisch dargestellt wird).
Die öffentliche Aufmerksamkeit, die Arendts Werk von der demokratischen Bourgeoisie und deren Intelligenz erhielt – für die sie eine Art Ikone wurde –, ist nicht ganz harmlos. Die Wiederaneignung ihrer Analyse des Totalitarismus ist deutlich vom dem Versuch geprägt, eine Kontinuität zwischen den Bolschewiki und der Russischen Revolution von 1917 einerseits und dem totalitärem Apparat des stalinistischen Staates andererseits herzustellen. Die Botschaft lautet: Stalin ist nur Lenins Vollstrecker gewesen, und die Moral der Geschichte: Die proletarische Revolution kann nur zu Totalitarismus und neuen Verbrechen gegen die Menschlichkeit führen. So manche etablierten bürgerlichen Ideologen wie Raymond Aron haben nicht gezögert, Arendts Analyse des stalinistischen totalitären Staates für ihre Kampagnen während des Kalten Krieges und über den angeblichen Zusammenbruch des Kommunismus nach dem Zusammenbruch der UdSSR zu benutzen.
Hannah Arendt war eine Philosophin und wie Marx sagte: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verändern.“ Der Marxismus ist nicht eine „totalitäre“ Doktrin, sondern vielmehr eine theoretische Waffe der ausgebeuteten Klasse für die revolutionäre Transformation der Welt. Und eben deshalb ist nur der Marxismus wirklich in der Lage, wichtige Beiträge der Kunst, der Wissenschaft sowie der Philosophie aufzugreifen, so etwa frühere Philosophen wie Epikur, Aristoteles, Spinoza, Hegel usw., aber auch jene unserer Zeit wie Hannah Arendt mit ihrem tiefen und kritischen Blick auf die moderne Welt und ihrer Eloge auf das Denken.
Jens
1 [528]Siehe unsere Filmkritik in der Nr.113 der englisch-sprachigen International Review (https://en.internationalism.org/ir/113_pianist.html [529])
2 [530]The Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nazipartei)
3 [531] 1966 besprach Arendt JP Nettls Rosa Luxemburg Biographie in der New Yoek Review of Books. In diesem Artikel geißelte sie sowohl die Weimarer als auch die Bonner Regierungen und erklärte, dass die Ermordungen Luxemburgs und Liebknechts ausgetragen wurden „unter den Augen und höchstwahrlich mit Zustimmung der sozialdemokratischen Regierung, die damals an der Macht war (…) Dass die Regierung damals faktisch in den Händen der Freikorps war, weil sie die volle Unterstützung des „Sozialisten“ Noskes genossen, der als Experte der nationalen Verteidigung und zuständig für militärische Angelegenheiten war, wurde erst kürzlich von dem letzten Überlebenden der Attentate, Kapitän Pabst bestätigt. Die Bonner Regierung – in diesem wie in anderen Aspekten folgt sie nur allzu gern den finsteren Spuren der Weimarer Republik – verkündete öffentlich in ihrem Magazin durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, dass die Ermordung Liebknechts und Luxemburgs absolut legal gewesen seien, „eine Exekution auf der Grundlage des Kriegsrechts.“ Dies war mehr als die Weimarer Republik je behauptet hatte…“.
4 [532]Die KPO war eine der Oppositionsgruppen gegen den Stalinismus, welche aber nie völlig mit dem Stalinismus brach. Wie Trotzki konnten sie nie den Gedanken akzeptieren, dass in Russland die Konterrevolution herrschte.
5 [533]Wer des Französischen mächtig ist, der sei auf eine interessante Dokumentation verwiesen (bestehend aus Radiointerviews) von France Culture: Hannah Arendt et le procès d'Eichmann [534] [1]
6 [535] Die Zitate sind der Penguin Ausgabe von 2006 entnommen, die von Amos Elon eingeleitet wurde. Eigene Übersetzung der Zitate ins Deutsche.
7 [536]Siehe z.B. diese fazinierende Dokuserie (deutsch und englisch) über das Leben in der ehemaligen DDR [2].
-
Adolf Eichmann [537]
-
Hannah Arendt [538]
-
Heinrich Blücher [539]
-
Faschismus [540]
-
Eichmann Prozess [541]
-
Israel [543]
Links:
[1] https://www.franceculture.fr/emission-la-fabrique-de-l-histoire-histoire... [544]
[2] https://www.youtube.com/watch?v=7fwQv5h7Lq8 [545]
Leute:
- Heinrich Blücher [546]
- Hannah Arendt [547]
- Adolf Eichmann [548]
Politische Strömungen und Verweise:
Historische Ereignisse:
- Eichmann Prozess [550]
- Banalität des Bösen [551]
Theoretische Fragen:
- Religion [479]
Erbe der kommunistischen Linke:
- Das Klassenbewusstsein [301]
Rolle der Frau bei der Entstehung der Kultur (Teil 3)
- 2504 Aufrufe
Noch grundsätzlicher: woher kam die erste Arbeitsteilung, und warum sollte sie auf dem Geschlecht beruhen? Hier sehen wir, wie Darmangeat sich in seiner eigenen Vorstellungskraft verliert: „Wir können uns vorstellen, dass selbst eine keimhafte Spezialisierung der menschlichen Spezies gestattete, eine größere Effektivität zu erlangen, als wenn ihre Mitglieder weiterhin jede Handlung ohne Unterscheidung ausgeübt hätte (…) Wir können uns ebenfalls vorstellen, dass sich diese Spezialisierung durch die Stärkung der gesellschaftlichen Bande im Allgemeinen und der Bande innerhalb der Familiengruppen im Besonderen in der gleichen Richtung auswirkte.“[9] [552] Gut, natürlich können wir uns viel „vorstellen“, doch ist dies nicht vielmehr das, was eigentlich demonstriert werden sollte?
Was die Frage angeht: „Wie kam die Arbeitsteilung auf der Grundlage der Geschlechter zustande?“, scheint dies für Darmangeat „nicht sehr schwierig zu sein. Es erscheint offensichtlich, dass für die Mitglieder prähistorischer Gesellschaften dieser Unterschied der am unmittelbarsten ersichtliche ist.“[10] [552] Wir können hier einwenden, dass, auch wenn geschlechtliche Unterschiede sicherlich „unmittelbar ersichtlich“ für die ersten menschlichen Wesen gewesen waren, dies keine ausreichende Erklärung für die Entstehung einer geschlechtlichen Arbeitsteilung ist. Primitive Gesellschaften sind reich an Einordnungen, besonders jene, die auf Totems beruhen. Warum sollte die Arbeitsteilung nicht auf dem Totemismus basieren? Dies ist offensichtlich ein bloßes Hirngespinst – genauso wie Darmangeats Hypothese. Was noch schwerer wiegt, ist, dass Darmangeat einen anderen äußerst eindeutigen Unterschied nicht erwähnt, einen Unterschied, der überall in archaischen Gesellschaften wichtig ist: den Unterschied des Alters.
Wenn es darum geht, trägt Darmangeats Buch – trotz seines eher prahlerischen Titels – nicht viel Erhellendes bei. Die Unterdrückung der Frauen beruhte auf der geschlechtlichen Arbeitsteilung. So sei es. Doch wenn wir fragen, woher diese Teilung kommt, werden wir abgespeist „mit bloßen Hypothesen, demzufolge wir uns vorstellen können, dass gewisse biologische Einschränkungen, die wahrscheinlich mit der Schwangerschaft und dem Stillen zu tun haben, das physiologische Substrat für die geschlechtliche Arbeitsteilung und den Ausschluss der Frauen von der Jagd bilden“ (S. 322).[11] [552]
Von den Genen zur Kultur
Am Ende seiner Argumentation lässt uns Darmangeat mit folgender Schlussfolgerung zurück: Im Ursprung der Frauen-Unterdrückung liegt die geschlechtliche Arbeitsteilung, und trotzdem war diese Teilung ein erheblicher Schritt vorwärts in der Arbeitsproduktivität, selbst wenn ihre Ursprünge in einer weit entfernten und unzugänglichen Vergangenheit verborgen bleiben.
Darmangeat bemüht sich hier darum, dem marxistischen „Modell“ treu zu bleiben. Doch was ist, wenn das Problem verkehrt herum gestellt wurde? Wenn wir das Verhalten jener Primaten betrachten, die dem Menschen am nächsten sind, insbesondere die Schimpansen, dann sehen wir, dass nur die männlichen Tiere jagen gehen – die weiblichen sind zu sehr damit beschäftigt, ihre Jungen zu füttern und auf sie aufzupassen (und sie vor den männlichen Artgenossen zu schützen: Wir sollten nicht vergessen, dass männliche Primaten oftmals Kindsmord am Nachwuchs anderer männlicher Artgenossen praktizieren, um sich für ihre eigenen reproduktiven Bedürfnisse Zugang zu den Muttertieren zu verschaffen). „Arbeitsteilung“ zwischen männlichen Tieren, die jagen, und weiblichen Tieren, die es nicht tun, ist also nichts menschlich Spezifisches. Das Problem – das nach einer Erklärung ruft – ist nicht, warum die Jagd dem männlichen Geschlecht des Homo sapiens vorbehalten war, sondern warum es der männliche Homo sapiens ist, und nur der männliche Homo sapiens, der das Produkt seiner Jagd verteilt. Was bemerkenswert ist, wenn wir den Homo sapiens mit seinen Cousins unter den Primaten vergleicht, ist der Wirkungsbereich der oft sehr strengen Regeln und Tabus, die genauso unter den Aborigines in den glühenden Wüsten Australiens wie unter den Eskimos im arktischen Eis angetroffen werden und die den kollektiven Verzehr der Jagdbeute voraussetzen. Der Jäger hat nicht das Recht, sein eigenes Produkt zu konsumieren; er muss es zurück ins Lager bringen, um es an die anderen zu verteilen. Die Regeln, die die Verteilung regulieren, variieren beträchtlich von einem Volk zum anderen, aber ihre Existenz ist universell.
Es lohnt sich darauf hinzuweisen, dass die Geschlechtsunterschiede des Homo sapiens ein gutes Stück geringer sind als beim Homo erectus, was in der Tierwelt allgemein ein Indikator für ausgewogenere Verhältnisse zwischen den Geschlechtern ist.
Überall sind das Teilen von Nahrung und das kollektive Einnehmen von Mahlzeiten das Fundament der ersten Gesellschaften. In der Tat hat das gemeinsame Mahl bis in die modernen Zeiten überlebt: Selbst heute ist es unmöglich, sich irgendeinen großen Moment im Leben (Geburt, Hochzeit oder Begräbnis) ohne das gemeinsame Mahl vorzustellen. Wenn Menschen in schlichter Freundschaft zusammenkommen, findet dies fast immer rund um ein gemeinsames Essen statt, ob am Barbecue in Australien oder um einen Restauranttisch in Frankreich.
Dieses Teilen von Nahrung, das anscheinend aus uralten Zeiten stammt, ist ein Aspekt des menschlichen kollektiven und gesellschaftlichen Lebens, der sich stark von dem unserer weit entfernten Verfahren unterscheidet. Wir werden hier mit dem konfrontiert, was der Darwinologe Patrick Tort als einen „unbezahlbaren Ausdruck des ‚Egoismus‘ unserer Gene“ beschrieben hat: Die Mechanismen, die von Darwin und Mendel beschrieben worden waren und von den modernen Genetikern bestätigt wurden, haben ein soziales Leben generiert, in dem die Solidarität eine zentrale Rolle spielt, wobei dieselben Mechanismen durch den Wettbewerb funktionieren.[12] [552]
Diese Frage des Teilens ist unserer Ansicht nach fundamental, aber nur Teil eines viel weiter gefassten wissenschaftlichen Problems: Wie können wir den Prozess erklären, der eine Spezies, deren Verhaltensänderungen vom langsamen Rhythmus der genetischen Evolution bestimmt wurden, in unsere eigene Spezies umwandelt, deren Verhalten – auch wenn es sich natürlich noch immer auf unserem genetischen Erbe gründet – sich dank einer viel schnelleren Evolution der Kultur verändert? Und wie können wir erklären, dass ein auf Konkurrenz basierender Mechanismus eine Spezies geschaffen hat, die nur durch Solidarität überleben kann: die wechselseitige Solidarität der Frauen bei der Kindsgeburt und -aufzucht, die Solidarität von Männern auf der Jagd, die Solidarität der Jäger gegenüber der Gesellschaft als Ganzes, wenn sie die Jagdbeute beisteuern, die Solidarität der Gesunden mit den Alten oder Verletzten, die nicht mehr in der Lage sind, zu jagen oder ihre eigene Nahrung zu finden, die Solidarität der Alten gegenüber den Jungen, denen sie nicht nur die lebenswichtigen Kenntnisse über die Natur und Welt beibringen, sondern auch die gesellschaftlichen, historischen, rituellen und mystischen Kenntnisse, die das Überleben einer strukturierten Gesellschaft ermöglichen? Dies scheint uns das fundamentale Problem zu sein, dass sich durch die Frage der „menschlichen Natur“ stellt.
Dieser Übergang von einer Welt zu einer anderen fand in einem Zeitraum von mehreren hunderttausend Jahren statt, eine wichtige Periode, die wir in der Tat als eine „revolutionäre“ beschreiben können.[13] [552] Sie ist eng verknüpft mit der Evolution des menschlichen Gehirns, seiner Größe (und mutmaßlich auch seiner Struktur, auch wenn dies natürlich weitaus schwieriger in den archäologischen Funden nachzuweisen ist). Das Wachstum der Hirngröße stellt unsere sich entfaltende Spezies vor einer ganzen Reihe von Problemen, von denen der schiere Energiebedarf des Hirns nicht das geringste ist: ungefähr 20 Prozent der gesamten Energieaufnahme eines Individuums – enorme Proportionen.
Obwohl die Spezies zweifellos vom Prozess der Enzephalisation (der evolutionären Entwicklung der Großhirnrinde) profitiert hat, stellte dies ein ganz reales Problem für die Frau dar. Die Größe des Kopfes bedeutet, dass die Geburt früher eintreten muss, andernfalls passt der Embryo nicht mehr durch das mütterliche Becken. Dies wiederum setzt einen weitaus längeren Zeitraum der Abhängigkeit des Kleinkindes voraus, das, verglichen mit anderen Primaten, „vorzeitig“ zur Welt kommt; das Wachstum des Gehirns erfordert mehr Pflege, sowohl strukturell als auch energetisch (Proteine, Lipide, Kohlehydrate). Wir scheinen es mit einem unlösbaren Rätsel oder vielmehr mit einem Rätsel zu tun zu haben, das die Natur erst nach dem langen Zeitraum löste, in dem Homo erectus lebte und sich über Afrika verbreitete, in dem sich jedoch allem Anschein nach weder im Verhalten noch in der Morphologie viel änderte. Dann aber folgte eine Periode der rasanten Weiterentwicklung, die ein Wachstum des Gehirnumfangs und das Auftreten all der spezifisch menschlichen Verhaltensformen erlebte: Sprache, symbolische Kultur, Kunst, der intensive Gebrauch von Werkzeugen und deren große Vielfalt, etc.
Es gibt ein weiteres Rätsel. Wir haben die radikalen Änderungen im männlichen Homo sapiens zur Kenntnis genommen, doch die physiologischen und Verhaltensänderungen im weiblichen Homo sapiens sind nicht weniger bemerkenswert, besonders vom Standpunkt der Reproduktion aus.
Es gibt in diesem Zusammenhang einen auffälligen Unterschied zwischen dem weiblichen Homo sapiens und anderen Primaten. Unter Letzteren (und besonders jenen, die uns am nächsten stehen) signalisiert das Weibchen im Allgemeinen den Männchen seine Eisprungphase (und damit die Phase seiner größten Fruchtbarkeit) auf die deutlichste Weise: mit unübersehbaren Genitalorganen, einem „geilen“ Verhalten besonders gegenüber dem dominanten Männchen, charakteristischen Ausdünstungen. Unter den Menschen verhält es sich genau umgekehrt: Die Sexualorgane sind verborgen und ändern sich nicht während des Eisprungs, und die weiblichen Menschen sind sich nicht einmal bewusst, wenn sie „brünstig“ sind.
Am anderen Ende des Eizyklus‘ ist der Unterschied zwischen dem Homo sapiens und anderen Primaten gleichermaßen frappierend: ergiebige und sichtbare Monatsblutungen, das Gegenteil zum Schimpansen zum Beispiel. Da Blutverlust Energieverlust bedeutet, müsste die natürliche Selektion eigentlich gegen überflüssigen Blutfluss arbeiten; also kann Letzterer nur mit einem ausgesuchten Vorteil erklärt werden – aber welchem?
Ein weiteres bemerkenswertes Kennzeichen der menschlichen Menstruation ist ihre Periodizität und Synchronität. Viele Untersuchungen haben bereits die Leichtigkeit aufgezeigt, mit der viele Gruppen von Frauen ihre Perioden synchronisieren, und Knight zeigt mit einer Tabelle der Monatszyklen unter Primaten auf, dass die menschliche Frau eine Periode hat, die vollkommen mit dem Mondzyklus übereinstimmt. Warum? Oder ist dies nur Zufall?
Man könnte versucht sein, dies alles als irrelevant für die Erklärung der Sprache und der menschlichen Besonderheiten im Allgemeinen abzutun. Solch eine Reaktion wäre darüber hinaus in völliger Eintracht mit der aktuellen Ideologie, die die Periode der Frauen wenn nicht als Tabu, so doch als etwas Negatives betrachtet: Man denke nur an all die Reklamefeldzüge für „weibliche Hygieneprodukte“, deren Fähigkeiten, die Periode unsichtbar zu machen, angepriesen werden. Die Entdeckung der immensen Bedeutung des Menstruationsblutes und all dessen in der primitiven menschlichen Gesellschaft, was mit ihm assoziiert wird, die sich beim Studium des Buchs von Knight erschließt, ist somit umso erschreckender für uns als Mitglieder der modernen Gesellschaft. Und der Glaube an die enorme Macht – jenseits von Gut und Böse – der Perioden der Frauen ist, so meinen wir, ein universelles Phänomen. Es ist kaum eine Übertreibung zu sagen, dass die Monatsblutungen alles „regulieren“, einschließlich der Harmonie im Universum.[14] [552] Selbst in Völkern, wo es eine starke männliche Vorherrschaft gibt und wo alles getan wird, um Frauen zu entwerten, regen ihre Perioden die Furcht in den Männern an. Menstruationsblut wird als etwas „Giftiges“ betrachtet, eine kaum noch zurechnungsfähige Ansicht, die für sich genommen ein Hinweis auf seine Macht ist. Man ist gar versucht, den Schluss zu ziehen, dass die Gewalt der Männer gegen Frauen in direkter Proportion zur Furcht steht, die die Frauen in Männern auslösen.[15] [552]
Die Universalität dieses Glaubens ist bedeutend und verlangt nach einer Erklärung. Wir können uns drei mögliche Deutungen vorstellen:
· Er könnte das Resultat von Strukturen sein, die im menschlichen Geist angelegt sind, wie Lévi-Strauss‘ Strukturalismus suggeriert. Heute würden wir eher sagen, dass sie im human-genetischen Erbe angelegt sind – doch dies scheint allem zu widersprechen, was über die Genetik bekannt ist.
· Es könnte auf das Prinzip „dieselbe Ursache - dieselben Auswirkungen“ zurückgeführt werden. Gesellschaften, die sich in Hinsicht ihrer Produktionsverhältnisse und ihrer Techniken gleichen, produzieren die gleichen Mythen.
· Die Ähnlichkeit der Mythen könnte schließlich auf einen gemeinsamen historischen Ursprung zurückgeführt werden. Wenn dies der Fall wäre, dann müsste angesichts der Tatsache, dass die verschiedenen Gesellschaften, in denen Menstruationsmythen vorkommen, geographisch weit auseinanderliegen, der gemeinsame Ursprung sehr weit zurückliegen.
Knight favorisiert die dritte Erklärung: Er betrachtet in der Tat die universelle Mythologie rund um die Menstruation als etwas sehr Altes, das auf die eigentlichen Ursprünge der Menschheit zurückgeht.
Die Entstehung der Kultur
Wie sind diese verschiedenen Fragen miteinander verknüpft? Wie könnte der Link zwischen der Menstruation der Frauen und der kollektiven Jagd aussehen? Und wie zwischen den beiden und anderen auftretenden Phänomenen wie Sprache, symbolische Kultur, eine Gesellschaft, die auf gemeinsamen Regeln beruht? Diese Fragen scheinen uns fundamental zu sein, weil all diese „Evolutionen“ keine isolierten Phänomene sind, sondern Elemente in einem einzigen Prozess, der vom Homo erectus zu uns führt. Die Hyper-Spezialisierung der modernen Wissenschaften erschwert, was größtenteils auch von den Wissenschaftlern so gesehen wird, das Verständnis dieses umfassenden Prozesses, der von einer einzelnen spezialisierten wissenschaftlichen Disziplin nicht erfasst werden kann.
Was wir an Knights Werk am bemerkenswertesten finden, ist eben dieses Bemühen, genetische, archäologische, paläontologische und anthropologische Daten in einer „allumfassenden Theorie“ der menschlichen Evolution zusammenzubringen, analog zu den Anstrengungen der theoretischen Physik, die uns die Super-String- oder die Schleifenquantengravitationstheorie beschert hat.[16] [552]
Versuchen wir also diese Theorie zusammenzufassen, die heute als „Sexstreiktheorie“ bekannt ist. Um es einfach und schematisch zu sagen, stellt Knight die Hypothese auf, dass es zunächst bei den weiblichen Homo, die mit den Schwierigkeiten der Kindsgeburt und der Säuglingspflege konfrontiert waren, zu einer Verhaltensänderung gekommen war: Die Frauen wandten sich vom dominanten Männchen ab, um in einer Art von gegenseitigem Unterstützungspakt ihre Aufmerksamkeit den zweitrangigen Männchen zu schenken. Die Männchen akzeptierten, die Weibchen zurückzulassen, wenn sie jagen gingen, und ihnen die Jagdbeute zurückzubringen; im Gegenzug erlangten sie Zugang zu den Weibchen und somit eine Chance zur Reproduktion, was ihnen bis dahin vom Alphamännchen verwehrt worden war.
Diese Verhaltensänderung bei den Männchen – die anfangs, wir erinnern uns, den Evolutionsgesetzen unterworfen war – ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich, insbesondere unter zwei: Einerseits darf es für die Männchen nicht möglich sein, anderswo Zugang zu Weibchen zu finden; andererseits müssen die Männchen darauf vertrauen können, dass sie in ihrer Abwesenheit nicht verdrängt werden. Dies sind also kollektive Verhaltensweisen. Die Weibchen - die die treibende Kraft in diesem evolutionären Prozess sind – müssen gegenüber den Männchen eine kollektive Sexverweigerung aufrechterhalten. Diese kollektive Verweigerung wird den Männchen wie auch anderen Weibchen deutlich durch die Monatsblutung signalisiert, die mit einem „universellen“ und sichtbaren Ereignis synchronisiert ist: dem Mondzyklus und den Gezeiten, die sie in der semiaquatischen Umgebung des afrikanischen Grabenbruchs, wo die Menschheit zuerst auftauchte, begleiten.
Die Anfänge der Solidarität sind gemacht: zunächst unter den Weibchen, dann auch unter den Männchen. Kollektiv ausgeschlossen vom Zugang zu den Weibchen, können sie eine in wachsendem Maße organisierte kollektive Großwildjagd in die Tat umsetzen, die die Fähigkeit zur Planung und zur Solidarität im Angesicht von Gefahren erfordert.
Gegenseitiges Vertrauen entsteht in der kollektiven Solidarität innerhalb jedes Geschlechts, aber auch zwischen den Geschlechtern: das weibliche Vertrauen in der männlichen Beteiligung an der Kinderaufzucht, das männliche Vertrauen darin, dass ihnen nicht die Chance zur Reproduktion vorenthalten wird.
Dieses theoretische Modell gestattet uns, das Rätsel zu lösen, das Darmangeat unbeantwortet ließ: Warum sind Frauen so strikt von der Jagd ausgeschlossen? Gemäß des Modells Knights kann dieser Ausschluss nur ein absoluter gewesen sein, denn wenn sich einige Weibchen – und insbesondere jene, die noch unbelastet waren von eigenem Nachwuchs – der gemeinsamen Jagd mit den Männchen anschließen konnten, dann hätten Letztere Zugang zu empfängnisbereiten Weibchen gehabt und wären nicht mehr gezwungen gewesen, die Jagdbeute mit aufziehenden Weibchen und ihren Jungen zu teilen. Damit das Modell funktioniert, sind die Weibchen gezwungen, eine totale Solidarität unter Ihresgleichen aufrechtzuerhalten. Von diesem Standpunkt aus ist es möglich, das Tabu zu verstehen, das eine absolute Trennung zwischen Frauen und Jagd aufrechterhält und das das Fundament für allen anderen Tabus ist, die sich um die Menstruation und dem Blut der Jagd drehen und die den Frauen verbieten, mit irgendwelchen Schneidewerkzeugen umzugehen. Die Tatsache, dass dieses Tabu, einst eine Quelle der weiblichen Stärke und Solidarität, unter anderen Umständen zu einer Quelle der gesellschaftlichen Schwäche und Unterdrückung werden sollte, mag auf dem ersten Blick paradox erscheinen: In der Realität ist dies nur ein besonders auffälliges Beispiel für eine dialektische Umkehrung, eine weitere Veranschaulichung der tiefen dialektischen Logik allen evolutionären und historischen Wandels.[17] [552]
Die Weibchen, die am erfolgreichsten dieses neue Verhalten unter Ihresgleichen und unter den Männchen durchsetzten, hinterließen mehr Nachkommen. Der Prozess der Großhirnbildung konnte fortgesetzt werden. Das Tor zu einer Weiterentwicklung des Menschen war offen.
Gegenseitige Solidarität und gegenseitiges Vertrauen wurden also nicht durch eine Art glückseligen Mystizismus in die Welt gesetzt, sondern im Gegenteil durch die mitleidlosen Gesetze der Evolution.
Dieses gegenseitige Vertrauen ist eine Vorbedingung für die Entstehung einer echten Fähigkeit zur Sprache, die von der gegenseitigen Akzeptanz gemeinsamer Regeln (Regeln, die so elementar sind wie die Idee, dass ein einziges Wort dieselbe Bedeutung für mich wie für dich hat) und von einer Gesellschaft abhängt, die auf Kultur und Gesetz basiert, die nicht mehr dem langsamen Rhythmus der genetischen Evolution unterworfen, sondern in der Lage ist, sich weitaus schneller neuen Umgebungen anzupassen. Eines der ersten Elemente der neuen Kultur ist logischerweise der Transfer all dessen vom genetischen in den kulturellen Bereich (wenn wir es so sagen können), das die Entstehung dieser neuen Gesellschaftsform ermöglicht hat: Die ältesten Mythen und Rituale drehen sich rund um die Menstruation der Frauen (und den Mond, der ihre Synchronität garantiert) und ihre Rolle in der Regulierung nicht nur der gesellschaftlichen, sondern auch der natürlichen Ordnung.
Einige Schwierigkeiten und eine mögliche Fortsetzung
Wie Knight selbst sagt, ist seine Theorie eine Art von „Ursprungsmythos“ und bleibt eine Hypothese. Dies an sich ist selbstverständlich kein Problem; ohne Hypothesen und Spekulationen gäbe es keinen wissenschaftlichen Fortschritt. Die Religion, nicht die Wissenschaft, versucht bestimmte Wahrheiten zu etablieren.
Was uns angeht, so würden wir gern zwei Einwände gegen das Narrativ erheben, das Knight vorschlägt.
Der erste betrifft die verstrichene Zeit. Als Blood Relations 1991 veröffentlicht wurde, datierten die ersten Anzeichen künstlerischen Ausdrucks und daher der Existenz einer symbolischen Kultur, die in der Lage ist, Mythen und Rituale, die sich im Zentrum seiner Hypothese befinden, zu transportieren, vor nur 60.000 Jahren. Doch die ersten Gebeine moderner Menschen sind etwa 200.000 Jahre alt: Was passierte also in den 140.000 „fehlenden“ Jahren? Und wie könnte der Vorläufer einer völlig ausgebildeten Kultur zum Beispiel unter unseren unmittelbaren Ahnen ausgesehen haben?
Dies stellt nicht so sehr die Theorie an sich in Frage, sondern ist ein Problem, das nach weiterer Untersuchung verlangt. Seit den 1990er Jahren haben Ausgrabungen in Südafrika (Blombos Caves, Klasies River, Kelders) allem Anschein nach den Zeitraum des erstmaligen Gebrauchs von Kunst und abstrakten Symbolismus auf 80.000 oder gar 140.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung zurückdatiert.[18] [552] Was den Homo erectus anbetrifft, scheinen die Überreste, die bei Dmanisi in Georgien Anfang der Nuller Jahre entdeckt und auf ein Alter von 1,8 Millionen Jahren datiert wurden, bereits auf einen gewissen Grad an Solidarität hinzuweisen: Ein Individuum lebte etliche Jahre ohne Zähne, was nahelegt, dass andere ihm beim Essen halfen.[19] [552] Gleichzeitig waren ihre Werkzeuge immer noch primitiv, und laut den Experten praktizierten sie noch keine Großwildjagd. Dies alles sollte uns nicht überraschen: Darwin hat seinerzeit bereits festgestellt, dass menschliche Merkmale wie Empathie, die Wertschätzung des Schönen und der Freundschaft bereits im Tierreich existierten, wenn auch auf einem, verglichen mit der Menschheit, rudimentären Niveau.
Unser zweiter Einwand ist gewichtiger und betrifft die „Antriebskraft“, die das Wachstum des menschlichen Gehirns bewirkte. Knight ist mehr darauf bedacht, festzulegen, wie dieses Wachstum ermöglicht wurde, und so steht diese Frage nicht im Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit: Laut seinem Interview auf unserem Kongress hat er im Grunde die Theorie der „wachsenden sozialen Komplexität“ sich zu eigen gemacht, eine Theorie, wonach die menschlichen Wesen sich dem Leben in immer größeren Gruppen anpassen mussten (diese Theorie wird von Robert Dunbar verfochten[20] [552] und ist auch von J.-L. Dessalles in seinem Buch Warum wir sprechen aufgegriffen worden, dessen Argumente er selbst auf unserem letzten Kongress vorstellte). Wir können hier nicht in die Details gehen, doch scheint uns diese Theorie nicht ohne Probleme zu sein. Immerhin variiert die Größe der Primatengruppen von einem Dutzend im Falle der Gorillas bis zu etlichen Hundert für die Hamadryas-Paviane: Es wäre daher notwendig, sowohl aufzuzeigen, warum Hominini gesellschaftliche Bedürfnisse entwickelten, die über die der Paviane hinausgingen (dies steht noch aus), als auch zu demonstrieren, dass Hominini in immer größeren Gruppen lebten, bis hin zur „Dunbar-Zahl“ zum Beispiel.[21] [552]
Alles in allem ziehen wir es vor, den Prozess der Großhirnbildung und der Sprachentwicklung mit der wachsenden Bedeutung der „Kultur“ (im breitesten Sinn des Wortes) in der menschlichen Fähigkeit, sich der Umwelt anzupassen, in Verbindung zu bringen. Es gibt häufig die Neigung, sich die Kultur allein in materiellen Begriffen (Steinwerkzeuge, etc.) vorzustellen. Doch wenn wir das Leben von Jäger-Sammler-Völkern in unserer eigenen Epoche untersuchen, sind wir über nichts so beeindruckt wie über ihre profunde Kenntnis über ihre natürliche Umgebung: das Verhalten der Tiere, die Merkmale von Pflanzen, etc. Jedes jagende Tier „kennt“ das Verhalten seiner Beutetiere und kann sich dem bis zu einem gewissen Punkt anpassen. Bei menschlichen Wesen ist diese Kenntnis jedoch nicht genetisch, sondern kulturell bedingt und muss von Generation zu Generation übermittelt werden. Während die Nachahmung die Übermittlung eines beschränkten Grades von „Kultur“ erlaubt (Affen, die einen Stock benutzen, um zum Beispiel Termiten zu angeln), liegt es auf der Hand, dass die Übermittlung menschlicher (oder eigentlich proto-menschlicher) Kenntnisse etwas mehr als Nachahmung erfordert.
Man könnte auch behaupten, je mehr die Kultur die Genetik bei der Bestimmung unseres Verhaltens ersetzt, desto wichtiger wird die Übermittlung dessen, was wir die „spirituelle“ Kultur (Mythen, Rituale, die Kenntnis heiliger Plätze, etc.) nennen, für die Aufrechterhaltung des Gruppenzusammenhalts. Dies wiederum führt uns zur Verknüpfung der Sprachentwicklung mit einem anderen äußeren Merkmal, das in unserer Biologie verankert ist: die „frühe“ Menopause der Frauen, gefolgt von einer langen Periode der Unfruchtbarkeit, was ein weiteres Merkmal ist, das die menschlichen Frauen nicht mit ihren Primaten-Cousinen teilen.[22] [552] Wie konnte eine „frühe“ Menopause von der natürlichen Selektion favorisiert werden, obwohl sie offensichtlich das weibliche Reproduktionspotenzial einschränkt? Die wahrscheinlichste Hypothese ist wohl die, dass Frauen in der Menopause ihren Töchtern besser helfen können, das Überleben ihrer eigenen Enkelkinder und damit ihres eigenen genetischen Erbes sicherzustellen.[23] [552]
Die Probleme, die wir gerade angeschnitten haben, betreffen den Zeitraum, der von Blood Relations abgedeckt wird. Doch es gibt eine weitere Schwierigkeit, die den Zeitraum der bekannten Geschichte angeht. Es ist naheliegend, dass die primitiven Gesellschaften, von denen wir Kenntnis haben (und welche Darmangeat beschreibt), sich stark von den hypothetischen ersten menschlichen Gesellschaften Knights unterscheiden. Um nur das Beispiel von Australien zu nehmen, dessen Aboriginal-Gesellschaft eine der technisch primitivsten ist, die wir kennen: Die Hartnäckigkeit von Mythen und rituellen Praktiken, die der Menstruation große Bedeutung zumessen, geht Hand in Hand mit einer völligen Vorherrschaft der Männer über die Frauen. Wenn wir davon ausgehen, dass Knights Hypothese weitgehend korrekt ist – wie können wir dann erklären, was sich zu einer veritablen „männlichen Konterrevolution“ auswuchs? In seinem Kapitel 13 (S. 449) unterbreitet Knight eine Hypothese, um das zu erklären. Er behauptet, dass das Verschwinden der Megafauna – Arten wie der gigantische Wombat – und eine Zeit des trockenen Wetters am Ende des Pleistozän die Jagdmethoden durcheinanderbrachten und dem Überfluss ein Ende bereiteten, den er als materielle Vorbedingung für das Überleben des primitiven Kommunismus betrachtete. 1991 schrieb Knight, dass ein archäologischer Beweis seiner Hypothese noch aussteht. Seine eigenen Forschungen beschränken sich auf Australien. Auf jeden Fall hat es für uns den Anschein, dass dieses Problem ein weites Untersuchungsgebiet eröffnet, das es gestatten würde, die wahre Geschichte des längsten Zeitraums in der Existenz der Menschheit ins Auge zu fassen: von unseren Ursprüngen bis zur Erfindung der Landwirtschaft.[24] [552]
Die kommunistische Zukunft
Wie kann das Studium der menschlichen Ursprünge unsere Auffassung über eine künftige kommunistische Gesellschaft verdeutlichen? Darmangeat sagt uns, dass der Kapitalismus die erste menschliche Gesellschaft sei, die es gestatte, sich ein Ende der geschlechtlichen Arbeitsteilung und die Gleichheit der Frauen vorzustellen – eine Gleichheit, die heute in einigen wenigen Ländern Gesetz geworden sei, die aber nirgendwo eine faktische Gleichheit sei: „… auch wenn der Kapitalismus das Los der Frauen an sich weder verbessert noch verschlimmert hat, ist er dennoch das erste System, das es ermöglicht hat, die Frage ihrer Gleichheit mit Männern zu stellen; und obwohl er sich als unfähig erwiesen hat, diese Gleichheit Wirklichkeit werden zu lassen, hat er dennoch die Elemente zusammengeführt, die sie realisieren werden.“[25] [552]
Zwei Kritiken erscheinen uns angebracht zu sein: Die erste ist, dass die immense Bedeutung der Integration der Frauen in die Welt der Lohnarbeit ignoriert wird. Trotz allem hat der Kapitalismus den Arbeiterfrauen zum ersten Mal in der Geschichte der Klassengesellschaften eine ganz reale materielle Unabhängigkeit von den Männer geschenkt und somit die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit den Männern am Kampf für die Befreiung des Proletariats und somit der Menschheit in ihrer Gesamtheit teilzunehmen.
Die zweite Kritik betrifft den eigentlichen Gleichheitsbegriff. Dieser Begriff ist mit dem Brandzeichen der bürgerlichen Ideologie versehen, eine Hinterlassenschaft des Kapitalismus, und nicht das Ziel einer kommunistischen Gesellschaft, die im Gegenteil die Unterschiede zwischen den Individuen anerkennt und – um Marx‘ Ausdruck zu benutzen – auf ihre Fahnen schreibt: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“[26] [552] Nun, außerhalb des Gebiets der Science Fiction haben Frauen sowohl eine Fähigkeit als auch ein Bedürfnis, die bzw. das die Männer niemals haben werden: zu gebären.[27] [552] Ohne diese Fähigkeit hätte die Menschheit keine Zukunft, doch sie ist auch eine körperliche Funktion und daher ein Bedürfnis für Frauen.[28] [552] Eine kommunistische Gesellschaft muss daher jeder Frau, die es wünscht, die Möglichkeit zu geben, mit Freude zu gebären, im Vertrauen darauf, dass ihr Kind in der menschlichen Gemeinschaft willkommen geheißen wird.
Hier können wir womöglich eine Parallele zur evolutionistischen Vision ziehen, die Knight unterbreitet. Proto-Frauen stießen den Evolutionsprozess in Richtung Homo sapiens und symbolischer Kultur an, weil sie ihre Kinder nicht mehr allein aufziehen konnten: Sie mussten die Männer dazu bringen, der Kindesaufzucht und der Erziehung der Jungen materielle Unterstützung zukommen zu lassen. Auf diese Weise führten sie das Prinzip der Solidarität unter Frauen, die von ihren Kinder in Anspruch genommen werden, unter Männern, die von der Jagd in Beschlag genommen werden, und zwischen Frauen und Männern, die gemeinsam ihre gesellschaftliche Verantwortung teilen, in die menschliche Gesellschaft ein.
Heute sind wir mit einer Situation konfrontiert, in der der Kapitalismus uns immer mehr auf den Status atomisierter Individuen reduziert, worunter Kinder aufziehende Frauen am meisten leiden. Nicht nur, dass die „Herrschaft“ der kapitalistischen Gesellschaft die Familie auf ihren kleinsten Ausdruck (Mutter, Vater, Kinder) reduziert, die allgemeine Desintegration des sozialen Lebens bedeutet darüber hinaus, dass immer mehr Frauen sich in der misslichen Lage befinden, ihre sehr jungen Kinder allein aufzuziehen, und die Notwendigkeit, Arbeit zu finden, distanziert sie häufig von ihren eigenen Müttern, Schwestern oder Tanten, die einst das natürliche Unterstützungsnetzwerk für Frauen mit kleinen Kindern waren. Die „Welt der Arbeit“ ist mitleidlos gegenüber Frauen mit Kindern. Sie sind gezwungen, ihre Säuglinge nach bestenfalls ein paar Monaten abzustillen (abhängig vom verfügbaren Schwangerschaftsurlaub, wenn überhaupt) und sie einem Kindermädchen anzuvertrauen, oder sind – wenn sie arbeitslos sind – vom gesellschaftlichen Leben abgeschnitten und gezwungen, sich mittels äußerst begrenzter Ressourcen um ihre Babys zu kümmern.
In einem gewissen Sinn befinden sich Arbeiterinnen in einer Lage, die vergleichbar ist mit der ihrer fernen Vorfahren - nur eine Revolution kann ihre Situation verbessern. So wie die „Revolution“ es nach Knights Hypothese Frauen erlaubte, sich der sozialen Unterstützung erst durch andere Frauen, dann durch die Männer beim Gebären und bei der Erziehung ihrer Kinder zu versichern, so muss auch die kommende kommunistische Revolution die Unterstützung der Frauen bei ihrer Schwangerschaft und die kollektive Erziehung der Kinder in den Mittelpunkt stellen. Nur eine Gesellschaft, die ihren Kindern und ihrer Jugend einen privilegierten Platz einräumt, kann den Anspruch erheben, eine hoffnungsvolle Zukunft anzubieten: Von diesem Standpunkt aus kompromittiert sich der Kapitalismus allein durch die Tatsache, dass ein wachsender Teil seiner Jugend als „überzählig“ betrachtet wird.
Jens
[1] [552]Editions Smolny, Toulouse 2009 und 2012. Wenn nicht anders festgestellt, sind die Zitate und Seitenangaben der ersten Edition entnommen.
[2] [552]Darmangeat stellt einige interessante Ideen über die gewachsene Bedeutung der physischen Kraft bei der Bestimmung der Geschlechterrollen nach der Erfindung der Landwirtschaft vor (das Pflügen zum Beispiel).
[3] [552]Darmangeat besteht zweifellos zu Recht darauf, dass die Beteiligung an gesellschaftlicher Produktion eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Sicherstellung einer günstigen Umgebung für Frauen ist.
[4] [552]In dem Abschnitt „Die Familie“, MEW, Band 21, S. 68.
[5] [552]Bruce Trigger, Understanding early civilizations.
[6] [552]Knights Buch widmet ein Abschnitt der „männlichen Menstruation“ (S. 428). Ebenfalls verfügbar in PDF auf Knights Website.
[7] [552]„Der menschliche Geist hat seine Erfordernisse, von denen eines die Kohärenz ist“ (S. 319). Wir möchten hier nicht auf die Frage eingehen, woher diese Erfordernisse kommen und warum sie ihre besonderen Formen annehmen – Fragen, die Darmangeat unbeantwortet lässt.
[8] [552]Um eine leidenschaftliche, aber kritische Schilderung des Denkens von Lévi-Strauss zu erhalten, verweisen wir den Leser/die Leserin auf Knights Kapitel „Lévi-Strauss and ‚The Mind‘“.
[9] [552]C. Darmangeat, 2. Ausgabe, S. 214f.
[10] [552]Ebenda.
[11] [552]Merkwürdigerweise hebt Darmangeat selbst nur einige Seiten zuvor hervor, dass in bestimmten nordamerikanischen Indianergesellschaften unter bestimmten Bedingungen „Frauen alles tun konnten; sie meisterten die gesamte Bandbereite weiblicher und männlicher Aktivitäten“ (S. 314).
[12] [552]Siehe den Artikel über Patrick Torts L’Effet Darwin und Chris Knights Artikel über Solidarität und das egoistische Gen.
[13] [552]Vgl. „The great leap forward“ von Anthony Stigliani.
[14] [552]Bemerkenswerterweise ist das Wort für die Periode der Frauen in der deutschen, französischen, spanischen und englischen Sprache „die Regel“.
[15] [552]Dies ist ein Thema, das sich durch das gesamte Buch Darmangeats zieht. Siehe unter anderem das Beispiel der Huli in Neuguinea (S. 222, 2. Ausgabe).
[16] [552]Und besser noch: hat sich dabei verdient gemacht, die Theorie lesbar und zugänglich für den Laien zu machen.
[17] [552]Daher kommen wir, wenn Darmangeat uns erzählen will, dass Knights These „kein Wort über die Gründe verliert, warum es Frauen systematisch und vollkommen verboten wurde, zu jagen und Waffen zu bedienen“, nicht umhin, uns zu fragen, ob er das Buch bis zu seinem Schluss gelesen hat.
[18] [552]Siehe die Wikipedia-Artikel über Blombos Cave.
[19] [552]Siehe den Artikel in La Recherche: „Etonnants primitifs de Dmanisi“.
[20] [552]Siehe zum Beispiel Dunbar, The Human Story. Robin Dunbar erklärt die Evolution der Sprache mit dem Wachstum menschlicher Gruppen; Sprache erschien als eine weniger aufwändige Form der gegenseitigen Körperpflege, durch die unsere Primaten-Cousins ihre Freundschaften und Bündnisse aufrechterhalten. „Dunbars Zahl“ hat als die größte Zahl enger Beziehungen, die das menschliche Gehirn zu behalten in der Lage ist (ungefähr 150), Eingang in die anthropologische Theorie gefunden; Dunbar meint, dass dies die maximale Größe der ersten menschlichen Gruppen gewesen sei.
[21] [552]Die Hominini (der Zweig des evolutionären Stammbaums, zu dem die modernen Menschen gehören) trennte sich von den Panini (der Zweig, der Schimpansen und Bonobos umfasst) vor etwa sechs bis neun Millionen Jahren.
[22] [552]Vgl. „Menopause in non-human primates“, US-National Library of Medicine).
[23] [552]Siehe die Zusammenfassung der „Großmutter-Hypothese“.
[24] [552]Einiges ist bereits in dieser Richtung getan worden, in einem Land auf der anderen Seite der Erde, Australien, vom Anthropologen Lionel Sims in einem Artikel mit dem Titel „The ‚Solarisation‘ of the moon: manipulated knowledge at Stonehenge“, veröffentlicht in Cambridge Archaeological Journal, 16:2.
[25] [552]Darmangeat, ob.zit., S. 426.
[26] [552]Nicht umsonst schrieb Marx in seiner Kritik am Gothaer Programm: „Das Recht kann seiner Natur nach nur in Anwendung von gleichem Maßstab bestehn; aber die ungleichen Individuen (und sie wären nicht verschiedene Individuen, wenn sie nicht ungleich wären) sind nur an gleichem Maßstab meßbar, soweit man sie unter einen gleichen Gesichtspunkt bringt, sie nur von einer bestimmten Seite faßt, z.B. im gegebnen Fall sie nur als Arbeiter betrachtet und weiter nichts in ihnen sieht, von allem andern absieht.“
[27] [552]Einer der wenigen originellen Science Fiction-Autoren heute, Iain M. Banks, hat eine pan-galaktische Gesellschaft („The Culture“) geschaffen, die praktisch kommunistisch ist und in der Menschen eine solche Kontrolle über ihre hormonellen Funktionen erlangt haben, dass sie fähig sind, beliebig das Geschlecht zu wechseln und somit auch zu gebären.
[28] [552]Was natürlich nicht bedeutet, dass alle Frauen Kinder in die Welt setzen wollen, und noch weniger, dass sie dazu gezwungen werden sollten.
Theoretische Fragen:
- Religion [479]
- Vorkapitalistische Gesellschaften [502]
Syrien: Hinter dem diplomatischen Spiel die Sackgasse eines mörderischen Systems
- 2298 Aufrufe
Das abscheuliche Spektakel um die Ausstellung der Kinderleichen nach dem Giftgasangriff am 21. August am Rande Damaskus‘ hat die Führer der Welt, deren heuchlerische Reaktionen allein von ihren imperialistischen Interessen diktiert wurden, nicht wirklich bewegt. Der Einsatz von Giftgas auf beiden Seiten im Ersten Weltkrieg, die Freisetzung von chemischen Kampfstoffen in Vietnam und die Atombombe gegen Japan sind allesamt Beispiel dafür, dass unsere wunderbaren Demokratien nie gezögert hatten, Zuflucht bei den mörderischsten Waffen zu suchen. Die Regierungserklärungen sind umso heuchlerischer, waren doch die Bombardierung und Massakrierung der syrischen Bevölkerung, die über 100.000 Opfer seit Kriegsbeginn, die Flucht von Millionen Menschen vor dem Gemetzel bis heute keine „rote Linie“, was die Bourgeoisie angeht.
Eine Verschärfung der imperialistischen Spannungen
Es ist möglich, dass der Einsatz von Chemiewaffen eine syrisch-russische Provokation (Assad war im vergangenen Jahr mehrmals von Obama gewarnt worden, dass er diese „rote Linie“ nicht überschreiten dürfe) gegen rivalisierende Mächte, hauptsächlich die USA und Frankreich, war. Doch in jedem Fall war die „rote Linie“ nie mehr als ein mediengerechter Vorwand, um die „öffentliche Meinung“ auf eine eventuelle Militärintervention vorzubereiten. Angesichts der wachsenden Tragödie ist das Hin und Her zwischen etlichen Staaten nichts anderes als ein Gerangel um imperialistische Interessen, bei dem die Bevölkerung vor Ort keinerlei Bedeutung hat. Und es sind exakt die Beziehungen zwischen den rivalisierenden Mächten, die die Dauer des Konflikts und das grauenhafte Leiden der Zivilbevölkerung erklären. Nur zum Vergleich: andere Regimes, die, wie jenes in Libyen, vom „arabischen Frühling“ weggespült wurden, hielten nicht annähernd so lange, weil sie nicht im Fokus inter-imperialistischer Rivalitäten standen.
Russland gelang ein diplomatischer Coup, als es vorschlug, die Chemiewaffen Syriens unter „internationale Kontrolle“ zu stellen; dies löste hastige diplomatische Initiativen seitens seiner Rivalen aus, die jedoch nicht die Machtlosigkeit Letzterer und insbesondere der USA verbergen konnten. Doch wie immer diese jüngste Krise und die von den Regierungsministerien getroffenen Entscheidungen ausgehen und ob es eine direkte Militärintervention in Syrien geben wird oder nicht - wir sehen einen spektakulären Anstieg von kriegsähnlichen Spannungen vor dem Hintergrund zunehmenden Chaos‘, einer zunehmend unkontrollierbaren Lage, in der sich die bewaffneten Konflikte immer mehr verbreiten. Der Einsatz von Chemiewaffen bei etlichen Gelegenheiten, die Ausweitung des Konflikts auf den Libanon, die Präsenz aller Arten von Aasgeiern in der Region, von Katar und Saudi-Arabien bis zur Türkei und den Iran, dessen Verstrickungen in den Konflikt eine besondere Quelle der Besorgnis für Israel darstellen, sind alle ein Beleg dafür, dass der Konflikt bereits über die Grenzen Syriens geschwappt ist. Noch wichtiger ist die Präsenz der größeren imperialistischen Mächte; sie veranschaulicht die Stufe, die die imperialistischen Rivalitäten seit dem Ende des Kalten Krieges erreicht haben. So sehen wir zum ersten Mal seit 1989 eine größere politische Konfrontation zwischen den alten Blockführern USA und Russland. Obgleich sehr geschwächt durch die Auflösung des Ostblocks und der Sowjetunion, erlebt Russland ein Revival, nachdem es in den 1990er Jahren in Tschetschenien, Georgien und im Kaukasus eine Politik der verbrannten Erde betrieben hatte. Für Russland ist Syrien von vitaler Bedeutung, um seine Präsenz in der Region sicherzustellen, an seinen strategischen Verbindungen zum Iran zwecks Eindämmung des Einflusses der sunnitisch dominierten Republiken an seiner Südgrenze festzuhalten und einen Hafen im Mittelmeer aufrechtzuerhalten.
Das Ausmaß dieser Spannungen kann auch an der Tatsache abgelesen werden, dass China sich heute viel offener als in der Vergangenheit den USA entgegenstellt. Nachdem China während der Epoche der Blöcke dem russischen Einfluss entzogen und nach dem Deal mit Nixon bezüglich des Vietnam-Krieges vom amerikanischen Lager neutralisiert worden war, wird es nun zu einem Hauptkontrahenten, der die USA immer mehr Sorgen macht. Nach seinem kometenhaften Aufstieg auf wirtschaftlicher Ebene verschafft China auch seinen imperialistischen Interessen in Afrika, im Fernen Osten und dem Iran – einem Hauptziel, um seinen Zugang zu den Energiequellen sicherzustellen - Geltung. Als Spätankömmling ist China ein wichtiger Faktor bei der weiteren Destabilisierung der imperialistischen Beziehungen.
Die Stärkung dieser beiden Mächte war vor allem aufgrund der wachsenden offensichtlichen Schwächung und Isolation der USA ermöglicht worden, deren Versuche, die Rolle des Weltgendarmen zu spielen, in Afghanistan und im Irak völlig gescheitert sind. Wir bekommen eine Ahnung davon, wie schwierig die Dinge für die USA geworden sind, wenn man ihre „Intervention“ in Syrien mit ihrer Rolle im ersten Golfkrieg 1991 vergleicht. Indem sie Saddam Husseins Invasion in Kuwait als Vorwand dafür benutzt hatten, um ihre riesige militärische Überlegenheit zur Schau zu stellen, bildeten sie erfolgreich eine militärische „Koalition“, die eine Reihe von arabischen Ländern, aber auch die Hauptmitglieder des westlichen Blocks, die bereits versucht waren, sich nach der Auflösung des Ostblocks aus dem Griff der USA zu befreien, mit einbezog. Deutschland und Japan waren zwar militärisch nicht involviert, finanzierten aber das Abenteuer, während Großbritannien und Frankreich direkt zum Kampf „aufgerufen“ wurden. Gorbatschows marode UdSSR tat nichts, um Amerika im Weg zu stehen. Nur ein Jahrzehnt später, mit dem zweiten Golfkrieg, hatte es Amerika mit einer aktiven diplomatischen Gegenoffensive aus Deutschland, Frankreich und Russland zu tun. Und während sowohl bei der Invasion Afghanistans 2001 als auch bei der Invasion des Irak 2003 Amerika auf die loyale diplomatische und militärische Unterstützung durch Großbritanniens zählen konnte, war die Abtrünnigkeit Großbritanniens von der geplanten militärischen Intervention in Syrien der Schlüssel zur Entscheidung der Obama-Administration, die Intervention abzublasen und der diplomatischen Option zuzuhören, die von Moskau vorgestellt wurde. Die Abstimmung im Unterhaus gegen Camerons Ansinnen, eine militärische Intervention zu unterstützen, ist Zeugnis für die tiefe Spaltung in der britischen Bourgeoisie, die aus der Verwicklung des Landes im afghanischen und irakischen Schlamassel (1) herrührt, aber vor allem ist es eine Maßnahme , um den US-Einfluss zu schwächen. Die plötzliche Entdeckung, dass Frankreich, das weiterhin den Vorstoß zur Intervention unterstützte, Amerikas „ältester Verbündeter“ ist, sollte kein Anlass für die Illusion geben, dass Frankreich dabei ist, die Rolle des treuen Adjutanten zu übernehmen, die einst Großbritannien (ungeachtet seiner eigenen Ambitionen, nach einer unabhängigeren Rolle zu trachten)in den meisten imperialistischen Unternehmungen der USA seit Ende des Kalten Krieges gespielt hatte. Das Bündnis zwischen den USA und Frankreich ist schon aus amerikanischer Sicht von untergeordneter Bedeutung und somit nicht verlässlich. Wir können dem die diskreten Misstöne aus Deutschland hinzufügen, dessen stille Annäherung an Russland eine weitere Sorge für Washington darstellt.
Zurzeit des ersten Golfkriegs 1991 versprach Präsident Bush sen. eine Neue Weltordnung, mit den USA als Marshall, der die Dinge nett und friedlich gestaltet. Was wir derzeit sehen, ist eine imperialistische Massenschlägerei, die die Welt in die Barbarei und ins Chaos drängt.
Die strategische Bedeutung Syriens
Im Zusammenhang mit diesem neuen Schlachtfeld ist Syrien eine sehr wichtige strategische Trophäe. Das moderne Syrien entstand im 20. Jahrhundert mit dem Niedergang des osmanischen Reiches. Im Ersten Weltkrieg mobilisierte Großbritannien syrische Truppen, weil es versprach, dass dem Land die Unabhängigkeit gewährt werden sollte, sobald der Krieg gewonnen war. Das Ziel Großbritanniens war es natürlich, seine Kontrolle über die Region aufrechtzuerhalten. Doch bereits 1916, im Anschluss an das geheime Sykes-Picot-Abkommen, trat Großbritannien die Kontrolle über Syrien an Frankreich ab. Hauptziel dieser Übereinkunft war es, die Bestrebungen Deutschlands zu blockieren, das bereits mit dem Bau der Bagdad-Bahn beabsichtigte, „Konstantinopel und die militärischen Kleingebiete des türkischen Reiches in Kleinasien in unmittelbare Verbindung mit Syrien und den Provinzen am Euphrat und Tigris zu bringen“ (1). Heute ist Syrien wegen der Instabilität der traditionellen Seewege durch den Persischen Golf zu einer der Landwege für den Transport von Kohlenwasserstoff geworden. Sich durch einen Korridor an der Levante zum Mittelmeer (der auch für den Waffentransfer aus Russland genutzt wird) und im Osten gegenüber den ölproduzierenden Ländern öffnend, wird Syrien ein immer wichtigerer Faktor in der Politik dieser Region.
Die sich heute entwickelnden Spannungen sind zu einem großen Teil mit der historischen Bedeutung Syriens in der Region verknüpft. Sie werden auch angefeuert durch die Rolle, die Israel spielt, dessen Drohungen gegen Syrien und den Iran (3) eine weitere Quelle des Ungemachs für die großen imperialistischen Mächte sind. Regionalmächte wie Saudi-Arabien und Katar, die Hauptlieferanten für die Bewaffnung der „Rebellen“, sind tief verwickelt, während die Türkei danach strebt, ihre Interessen zu verteidigen, indem sie mit der Präsenz einer kurdischen Minderheit in Nordsyrien spielt.
Und es gibt auch eine Polarisierung rund um das schiitische Regime im Iran, das die strategische Erdölroute durch die Straße von Hormus kontrolliert. Dies ist aufs Engste verknüpft mit der Marinekonzentrierung in dem Gebiet, insbesondere der US-Flotte. Es erklärt auch das Festhalten des Iran an sein Atomprogramm, das Putin provokanterweise unterstützt, indem er zur „Hilfe beim Aufbau eines Kernkraftwerkes“ aufruft.
Weiter in Richtung eines beispiellosen Chaos‘
Bis jetzt ist das blutbesudelte Assad-Regime von allen imperialistischen Mächten als jemand angesehen worden, der eine gewisse Stabilität und Kalkulierbarkeit sicherstellte, als das geringere Übel. Heute gibt es, falls die syrische Opposition an die Spitze gelangt, keinen Zweifel daran, dass es eine Kettenreaktion geben würde, die zu einem beispiellosen Chaos und aller Arten von unkalkulierbaren Szenarien führen würde. Die Freie Syrische Armee ist ein wahres Flickwerk; es gibt keine wirklich vereinte Opposition. Dieses schwache politische Konglomerat ist trotz der diskreten Unterstützung der pro-amerikanischen und pro-europäischen Kräfte, denen eine Versorgung mit Waffen zugesichert wurde - ohne jegliche Gewähr, ihre Zirkulation zu kontrollieren -, von terroristischen Dschihadgruppen infiltriert oder flankiert worden, von denen viele von außerhalb Syriens kommen und die im eigenen Interesse handeln, wie die Warlords, die heute in Afrika wie Pilze aus dem Boden schießen. Es gibt so gut wie keine Möglichkeit für die Westmächte, sich auf eine reale Opposition zu verlassen, die eine Alternative zum Regime anbieten kann.
Dies ist ein breiteres Phänomen, das wir auch in all den anderen arabischen Ländern sehen können, die sich im Arabischen Frühling ähnlicher Ereignisse gegensahen: keine wirkliche bürgerliche Opposition, die in der Lage wäre, eine „demokratische Alternative“ und ein Minimum an Stabilität anzubieten. All diese Regimes waren nur dank der Macht der Armee in der Lage gewesen zu überleben, die versucht hatte, die zahllosen Clans der herrschenden Klasse zusammenzuhalten und das Auseinanderfallen der Gesellschaft zu verhindern. Wir sahen dies in Libyen und erst kürzlich in Ägypten, wo die Armee einen Staatsstreich gegen Mursi und die Muslimbruderschaft anzettelte. All dies ist der Ausdruck einer ganz realen Sackgasse, typisch für die kapitalistische Dekadenz und insbesondere ihrer finalen Phase des Zerfalls, wo alles, was in der Wirtschaftskrise angeboten werden kann, Armut, die rohe Gewalt der Armee, Repression und Blutvergießen ist.
Und diese Situation ist umso beunruhigender, nährt sie doch die religiösen Spaltungen, die in diesem Teil der Welt zu den schärfsten zählen: Spaltungen zwischen Christen und Muslimen, Schiiten und Sunniten, zwischen Muslimen und Juden, zwischen Muslimen und Drusen, etc. Ohne direkt an der Wurzel der Konflikte in der Region zu sitzen, vertiefen diese Risse den Hass und die Feindseligkeiten in einer Gesellschaft ohne Zukunft. Dies ist auch eine Region, die in der Vergangenheit von zahllosen Genoziden, wie den Völkermord an den Armeniern, von Kolonialmassakern geprägt wurde, welche ein Vermächtnis des Hasses hinterlassen haben, was seinerseits als Quelle neuer Massaker dient. Insbesondere Syrien befindet sich im Fokus dieser Spaltungen (Alawiten/Sunniten, Muslime/Christen, etc.); unter der Oberfläche des Krieges hat es mit dem Einströmen fanatischer Dschihadisten, einige von ihnen gestützt von Saudi-Arabien, zahllose Fälle von Pogromen gegen diese oder jene Gemeinschaft gegeben, was die Lage noch weiter verschlechterte.
Die Katastrophe ist umso ernster, als die USA, eine militärische Supermacht im Niedergang, die Speerspitze beim Abstieg ins Chaos sind. Sie haben sich vom Weltgendarmen zum pyromanischen Feuerwehrmann gewandelt. 2008, als Obama über Bush jun. triumphierte, geschah dies zu einem Gutteil aufgrund seines Images als Alternative zum unpopulären Kriegstreiber Bush. Doch nun hat sich der Friedensnobelpreisträger Obama selbst als nicht weniger kriegstreiberisch gezeigt, trotz seiner Talente als ein Politiker, etwas, was seinem Vorgänger abging. Obama verliert immer mehr seine Glaubwürdigkeit. Er hat es mit einer öffentlichen Meinung zu tun, die sich in wachsendem Maße gegen den Krieg sträubt, die immer mehr vom Vietnam-Syndrom erfasst wird, während er sich gleichzeitig einer unerträglichen Wirtschaftskrise gegenübersieht, die es immer schwieriger macht , Geld für militärische Kreuzzüge zu verschwenden. Für den Moment kann der Rückzieher der USA von einer Bestrafung des Assad-Regimes mit Militärschlägen unter Berufung auf die realen geostrategischen Schwierigkeiten erklärt werden, doch dies hat Washington dazu geführt, Zuflucht in neuen Verdrehungen zu suchen, wie die heuchlerische und lächerliche Unterscheidung zwischen „Chemiewaffen“ und „Waffen, die lediglich chemische Komponenten beinhalten“. Was für ein Unterschied!
Mit der wachsenden Anzahl von derlei Zwangslagen haben die Mystifikationen, die dazu dienten, die militärischen Kreuzzüge in den 1990er Jahren zu rechtfertigen – „sauberer Krieg“, „humanitäre Intervention“, etc. – ihre Wirkung verloren. Die USA sehen sich einem wirklichen Dilemma gegenüber, das ihre Glaubwürdigkeit bei den Verbündeten untergräbt, besonders bei Israel, das immer kritischer gegenüber den Amerikanern geworden ist. Das Dilemma ist: Entweder tun die USA nichts, was lediglich ihre Rivalen zu neuen Konfrontationen ermutigen kann; oder sie schlagen los, was nur die Feindschaft und die Ressentiments gegen sie steigern kann. Was sicher ist, ist, dass sie wie all die anderen imperialistischen Mächte nicht der Logik des Militarismus entkommen können. Letztendlich können sie sich nicht aus neuen militärischen Kampagnen heraushalten.
Die einzige Alternative: Sozialismus oder Barbarei
Die teuflische Spirale dieser militärischen Konflikte wirft einmal mehr ein Licht auf die Verantwortung des internationalen Proletariats. Selbst wenn es sich nicht einer Position befindet, in der es Einfluss auf die militärische Barbarei ausüben könnte, ist es dennoch die einzige historische Kraft, die dieser Barbarei durch seinen revolutionären Kampf ein Ende bereiten kann. Das Proletariat in Syrien ist angesichts der Ereignisse und der Tatsache, dass es vom offenen bewaffneten Konflikt überwältigt wurde, zu schwach, als dass es in der Lage sein könnte, auf den Krieg auf seinem eigenen Klassenterrain zu antworten. Wie wir bereits betont haben, „ist die Tatsache, dass die Manifestation des ‚Arabischen Frühlings‘ in Syrien nicht den geringsten Fortschritt für die unterdrückten und ausgebeuteten Massen gebracht hat, sondern in einen Krieg gemündet ist, der über 100.000 Tote hinterlassen hat, eine düstere Veranschaulichung für die Schwäche der Arbeiterklasse in diesem Land – der einzigen Kraft, die eine Barriere gegen die militärische Barbarei bilden kann. Und die Situation trifft auch - wenn auch in weniger tragischen Formen – auf die anderen arabischen Länder zu, wo der Sturz der alten Diktatoren in der Machtergreifung durch die rückständigsten Sektoren der Bourgeoisie, repräsentiert durch die Islamisten in Ägypten oder in der Türkei, oder in äußerstes Chaos, wie in Libyen, mündete.“ (4)
Heute bestätigt der der Ereignisse völlig die Perspektive, die Rosa Luxemburg in der Junius-Broschüre vorgestellt hatte:
„Friedrich Engels sagte einmal: Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein ‚Rückfall in die Barbarei‘ auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof; oder Sieg des Sozialismus, d.h. der bewußten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder-Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluß des klassenbewußten Proletariats. Die Zukunft der Kultur und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert mit männlichem Entschluß in die Waagschale wirft.“
WH, September 2013
(1) Rohrbach, Der Krieg und die deutsche Politik, zitiert von Rosa Luxemburg in der Junius-Broschüre, Kapitel 4.
(2) Israel hat faktisch dem Iran wegen dessen Nuklearpolitik mehrere Ultimaten gestellt, während es sich noch im Streit mit den Syrern wegen der Golan-Höhen befindet.
Resolution über die internationale Lage, 20. Kongress der IKS
Aktuelles und Laufendes:
- Syrien [553]
- Giftgas [554]
- Golfkriege [555]
Leute:
Historische Ereignisse:
- Sykes-Picot-Abkommen [560]
Wahlen in Deutschland - Die Bourgeoisie bereitet sich auf die kommenden Stürme vor
- 2091 Aufrufe
Im Anschluss an die Bundestagswahlen vom 22. September 2013 in Deutschland verhandelt nun die Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihres Zeichens Vorsitzende der Christdemokraten, mit den Sozialdemokraten über die Bildung einer „Großen Koalition“. Die neue Regierung wird die dritte hintereinander sein, in der Merkel Bundeskanzlerin ist. Die erste war ebenfalls eine „Große Koalition“ mit der zweitgrößten Partei im Bundestag, die SPD. Die zweite war eine Koalition mit dem kleinen liberalen Partner, der FDP. Eines der Ergebnisse der jüngsten Wahlen war, dass Merkel ihren Koalitionspartner verloren hat. Zum ersten Mal seit der Gründung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg scheiterten die Liberalen an der Fünfprozenthürde und zogen nicht in den Bundestag ein. Als diese Zeilen verfasst wurden, schien die Bildung einer Koalition der CDU/CSU mit der SPD der weitaus wahrscheinlichste Ausgang zu sein. Der Verlauf der Verhandlungen zwischen diesen beiden Parteien deutet bereits an, dass, obwohl die Christdemokraten einen viel größeren Anteil an den Parlamentssitzen besitzt, die neue Koalition mit der SPD, so sie denn zu Stande kommt, die „Handschrift der Sozialdemokraten“ tragen wird, wie die Medien bereits erklärt haben. Mit anderen Worten: das Programm der neuen Regierung wird nicht darin bestehen, die Arbeiterklasse unmittelbar und frontal zu attackieren, obgleich massive Angriffe auf die Dauer nicht ausbleiben werden.
Das bemerkenswerteste Resultat der jüngsten Wahlen war jedoch die Tatsache, dass die Kanzlerin und ihre Partei, die das Land bereits zwei Legislaturperioden lang regiert haben, solch einen Wahltriumph feiern konnten. In einem Land, das seit Kriegsende (bis auf eine Ausnahme) stets von Koalitionsregierungen regiert wurde, kam Merkel einer absoluten Mehrheit sehr nahe – für Deutschland eine Sensation. Dies ist umso bemerkenswerter, als in den meisten anderen Ländern Europas die wirtschaftliche Lage so ernst und die Notwendigkeit, die Bevölkerung zu attackieren, so akut ist, dass jede Regierung, ob links oder rechts, es riskiert, ihre Popularität oder gar ihre Glaubwürdigkeit rapide einzubüßen und somit bei den nächsten Wahlen prompt in die Opposition zurückgeschickt zu werden. Dies ist zumindest die Form, die das soziale Sicherheitsventil der kapitalistischen Demokratie gegenwärtig in Europa annimmt: Die Wut der Bevölkerung wird in einer „Protestwahl“ kanalisiert und neutralisiert, was für die „politische Klasse“ die Konsequenz hat, dass eine längere Kontinuität der jeweiligen Regierungsmannschaft immer unwahrscheinlicher wird. Ein dramatisches Beispiel dieser Entwicklung ist Frankreich, wo die linke Regierung von Francois Hollande, vor nicht allzu langer Zeit von den Medien als die neue Hoffnung für die arbeitende Bevölkerung gefeiert, nach nur einem Jahr im Amt ein Allzeit-Tief in der öffentlichen Gunst erreicht hat. Doch was wir in Deutschland sehen, ist eine entgegengesetzte Entwicklung, zumindest für den Moment. Die Frage ist: Wie kann man dies erklären?
Merkel profitiert von den Hinterlassenschaften der Schröder-Regierung
Das vielleicht wichtigste „Erfolgsgeheimnis“ für die anhaltende Stärke Angela Merkels an der Wahlurne liegt in der Tatsache begründet, dass es in ihrer Kanzlerschaft noch nicht notwendig war, die Bevölkerung massiv anzugreifen. Und einer der Gründe dafür ist, dass ihr Vorgänger, Kanzler Gerhard Schröder, und seine linke Koalition von SPD und Grünen dies bereits so erfolgreich taten, dass Merkel immer noch von ihren Früchten zehrt. Schröders so genannte „Agenda 2010“, die Anfang der Nuller Jahre in Gang gesetzt worden war, war ein riesiger Erfolg aus der Sicht des Kapitals. Mithilfe dieser Agenda gelang es, die allgemeinen Lohnkosten des Landes so radikal zu reduzieren, dass seine Hauptrivalen in Europa, wie Frankreich, in aller Öffentlichkeit gegen dieses „Lohndumping“ der führenden Wirtschaftsmacht des Kontinents protestierten. Es gelang ebenfalls, eine ohnehin beispiellose „Flexibilisierung“ der Arbeitskraft noch weiter zu intensivieren, insbesondere durch einen atemberaubenden Ausbau der „prekären Beschäftigungsverhältnisse“ nicht nur in den traditionellen Niedriglohnsektoren, sondern auch im Herzen der Industrie. Zum dritten (und dies war nicht die geringste Leistung Schröders) wurde all dies durch einen Angriff erreicht, der äußerst massiv, aber nicht allumfassend war. Mit anderen Worten, statt das Proletariat in seiner Gesamtheit anzugreifen, waren die Maßnahmen der Agenda dazu bestimmt, eine tiefe Spaltung innerhalb der Klasse zu bewirken, eine Spaltung zwischen den beschäftigten und unbeschäftigten Arbeiter/-Innen, zwischen Arbeiter/-Innen mit regulären Arbeitsverträgen und jenen ohne solche Verträge. In den Großbetrieben wurde ein wahrhaftiges Apartheidsystem zwischen den festangestellten und den auf Zeit angestellten Arbeiter/-Innen errichtet, die für denselben Job den halben oder gar nur ein Drittel des Lohnes der Festangestellten erhalten und denen es in einigen Fällen nicht einmal gestattet wird, die Firmenkantine aufzusuchen. Infolgedessen befand sich Merkel, während in vielen anderen europäischen Ländern solche massiven Angriffe ohne größere Vorausplanung unter den Hammerschlägen der so genannten Weltfinanzkrise ab 2008 durchgeführt werden mussten, in der komfortablen Situation, dass in Deutschland diese Maßnahmen bereits installiert sind und nun für das Kapital Früchte tragen.
Eine andere Besonderheit auf dieser Ebene besteht darin, dass die Angriffe in Deutschland nicht zum Beispiel von einer der berüchtigten neo-liberalen „Denkfabriken“ ausgeheckt wurden, sondern zuvorderst von den Gewerkschaften. Die „Agenda 2010“ wurde von einer Kommission ausgearbeitet, die von Peter Hartz, einem Freund Schröders im Volkswagen-Konzern, unter direkter Beteiligung des Betriebsrates von Volkswagen und der IG Metall, der mächtigsten Gewerkschaft in Europa, geleitet wurde, die (wie viele Arbeitgeber öffentlich zugegeben haben) mehr über erfolgreiches Management als die Manager verstehen. Kein Wunder, dass heute die Mehrheit der deutschen Bourgeoisie, einschließlich der Unternehmerverbände, darauf erpicht ist, dass die Sozialdemokraten (und mit ihnen die Gewerkschaften) mit Merkel zusammen eine Koalitionsregierung bilden. Und kein Wunder, dass sich Merkel nach dem Verlust ihres liberalen Koalitionspartners derzeit immer mehr von der Ideologie des Neo-Liberalismus distanziert und das Loblied auf das „gute alte“ deutsche Modell der angeblichen „sozialen Marktwirtschaft“ (wo die Gewerkschaften direkt daran beteiligt sind, das Land zu leiten) anstimmt und selbst die Ausweitung dieses „Modells“ auf den Rest Europas befürwortet.
Die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals
Ein weiterer Grund für diese „Erfolgsgeschichte“ Angela Merkels liegt in der ausgesprochenen Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Wenn dieser Wettbewerbsvorsprung allein auf dem oben erwähnten Lohndumping beruhte, würde er nun angesichts der drastischen Angriffe anderswo in Europa in jüngster Zeit dahinschmelzen. Doch in Wahrheit besitzt er eine viel breitere Grundlage in der ökonomischen Struktur des Landes selbst. Es besteht die Gefahr, dass Marxisten, konfrontiert mit der abstrakten Funktionsweise des Kapitals, sich von diesem abstrakten Charakter fesseln lassen und so dem Eindruck erliegen, dass die relative Stärke oder Schwäche eines nationalen Kapitals allein von abstrakten Kriterien wie die Entwicklung der organischen Zusammensetzung des Kapitals oder die Verschuldungsrate im Verhältnis zum BSP etc. abhängt. Dies führt zu einer rein schematischen Sichtweise der kapitalistischen Ökonomie, in der politische, historische, kulturelle, geographische, militärische und andere Faktoren aus dem Blickfeld verschwinden. Zum Beispiel, wenn man auf die Wachstumsraten oder auf das Schuldenniveau der USA schaut und es mit China vergleicht, kommt man unweigerlich zur Schlussfolgerung, dass Amerika das Rennen gegen seinen asiatischen Herausforderer bereits verloren hat und in einer Art Drittwelt-Status enden wird. Doch wird dabei übersehen, dass die USA noch immer das kapitalistische Paradies für innovative „Startups“ ist, dass es kein Zufall ist, dass das Zentrum der neuen Medien die Vereinigten Staaten sind und dass die politische Kultur eines Landes unter stalinistischer Leitung, wie China, es daran hindert, seinem Rivalen nachzueifern.
In ihrer Polemik gegen den Revisionisten Bernstein erklärte Rosa Luxemburg (in ihrem Buch „Reform oder Revolution“), dass die von Karl Marx entdeckten „Gesetze“, die eine wachsende organische Zusammensetzung und Zentralisierung des Kapitals betreffen, nicht das notwendige Verschwinden der mittelständischen Unternehmen bedeuten. Im Gegenteil, erklärt sie, bleiben solche kleineren Betriebe notwendigerweise das Zentrum der technischen Erneuerung, die sich im Mittelpunkt eines Wirtschaftssystems befinden, welches auf Konkurrenz und der Verpflichtung zur Akkumulation basiert. Deutschland ist kein Paradies für kapitalistische Startups wie die Vereinigten Staaten (allein das Schwergewicht seiner bürokratischen Traditionen verbietet dies). Doch es bleibt bis heute das Mekka des weltweiten Ingenieurswesens und der Maschinenbauindustrie. Diese Stärke beruht auf hoch spezialisierte, oftmals in Familienbesitz befindliche Firmen, die ihre Fertigkeiten von Generation zu Generation weiterreichen und – dank eines in der Welt einmaligen Ausbildungssystems – auf ein Reservoir hochqualifizierter Arbeitskräfte sowie auf Traditionen, die bis ins Mittelalter zurückreichen. In den vergangenen 20 Jahren sind diese kleinen und mittleren Maschinenbauunternehmen in einer koordinierten Operation zwischen den Unternehmerverbänden, der Regierung, den Banken und den Gewerkschaften in weltweit operierende Unternehmen umgewandelt worden, ohne zwangsläufig ihre Größe zu steigern. Doch ihre Operationsbasis bleibt Deutschland. Auch hier ist die Signatur der Gewerkschaften unverkennbar. Während einem Arbeitgeber es gleichgültig ist, ob die Profite aus einer Fabrik in Deutschland oder im Ausland kommen, solange es Profite gibt, ist das Denken der Gewerkschaften fast instinktiv nationalistisch, da es ihre vorrangige Aufgabe ist, die Arbeitskraft in Deutschland selbst im Interesse des Kapitals zu kontrollieren, und dies kann am besten getan werden, indem die Industrie und die Jobs „zuhause“ gehalten werden. Die IG Metall ist ein fanatischer Vertreter Deutschlands als Industriestandort („Standort Deutschland“).
Staatskapitalismus und der Unterschied zu 1929
All dies hilft bei der Erklärung, warum Deutschland zumindest derzeit besser als die meisten seiner Rivalen in der Lage ist, der fürchterlichen Vertiefung der Wirtschaftskrise des Kapitalismus seit 2008 zu widerstehen. Jedoch würde keiner dieser Vorteile viel helfen, wenn sich die Struktur der kapitalistischen Ökonomie seit den Tagen der fürchterlichen Depression, die 1929 begann und im Zweiten Weltkrieg endete, nicht radikal verändert hätte. Damals waren die Herzländer des Kapitalismus, die damals am höchsten entwickelten Länder Deutschland und die Vereinigten Staaten, als erste getroffen und am schlimmsten in Mitleidenschaft gezogen worden. Dies war kein Zufall. Die Krisen des dekadenten Kapitalismus sind nicht mehr Expansionskrisen, sie sind Krisen des Systems als solches, die sich in seiner Mitte entwickeln und natürlich die Zentren direkt heimsuchen. Doch im Gegensatz zu 1929 ist die Bourgeoisie heute nicht nur viel erfahrener, sie hat vor allen Dingen einen gigantischen staatskapitalistischen Apparat zur Verfügung, der Wirtschaftskrisen zwar nicht verhindern kann, der jedoch vermeiden kann, dass die Krise ihren natürlichen Verlauf nimmt. Hauptsächlich deshalb sind seit der Wiederkehr der offenen Krise der kapitalistischen Dekadenz Ende der 1960er Jahre die wirtschaftlich und politisch stärksten Staaten am besten in der Lage gewesen, der Krise zu widerstehen. Nichts von dem hindert die Krise sowohl daran, sich den historischen Zentren des Kapitalismus immer weiter anzunähern, als auch daran, diese Zentren viel ernster zu erfassen. Doch dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass es dort in naher Zukunft einen einseitigen ökonomischen Zusammenbruch wie in Deutschland oder den USA 1929 geben wird. Jedenfalls demonstriert das internationale und europäische Krisenmanagement der „Euro-Krise“ in den letzten Jahren deutlich, dass die staatskapitalistischen Mechanismen, die schlimmsten Auswirkungen auf die schwächeren Rivalen abzuwälzen, immer noch funktionieren. Sowohl die Immobilien- und Finanzkrise, die 2007/08 begann, als auch die Krise des Vertrauens in die gemeinsame europäische Währung, die ihr folgte, bedrohten direkt die Stabilität des deutschen und französischen Banken- und Finanzsektors. Das Hauptergebnis der verschiedenen europäischen Rettungsoperationen, all der Gelder, die so „generös“ Griechenland, Irland, Portugal, etc. geliehen wurden, war die Stützung der deutschen und französischen Interessen auf Kosten der schwächeren Rivalen, mit dem Nebeneffekt, dass die Arbeiter/-Innen jener Länder die Hauptlast dieser Angriffe tragen mussten. Und während die Gründe, die wir zu Beginn dieses Artikels angaben, um den Wahlerfolg von Merkel zu erklären, nicht ihr zuzuschreiben sind, waren es in dieser Frage sicherlich Merkel und ihr Finanzminister Schäuble, die die deutschen Interessen mit Zähnen und Klauen verteidigten, so dass die europäischen Partner häufig an den Rand der Verzweiflung getrieben wurden. Und hier wird klar, dass es hinter dem hohen Stimmenanteil für Merkel einen nationalistischen Impuls gibt, der sehr gefährlich für die Arbeiterklasse ist.
Die deutsche Bourgeoisie übernimmt Verantwortung
Es gibt objektive Gründe, die den Wahltriumph von Angela Merkel zu erklären helfen: der zumindest derzeit relativ erfolgreiche Widerstand Deutschlands gegen die Vertiefung der historischen Krise und der relative Erfolg Merkels jüngst bei der Verteidigung deutscher Interessen in Europa. Doch der wichtigste Einzelgrund für ihren Erfolg war, dass die gesamte deutsche Bourgeoisie ihren Erfolg wünschte und alles tat, ihn zu fördern. Die Gründe hierfür liegen nicht in Deutschland selbst, sondern in der Weltlage insgesamt, die immer bedrohlicher wird. Auf der ökonomischen Ebene sind die Krise der europäischen Ökonomie und das schwankende Vertrauen in den Euro alles andere als vorbei – das Schlimmste steht erst bevor. Daher ist das Phänomen von „Mutti Merkel“, der „weisen und fürsorglichen Mutter“ derzeit so wichtig. Laut einer beliebten Denkschule innerhalb der modernen bürgerlichen Wirtschafts-„Theorie“ ist die Ökonomie in hohem Grad eine Frage der „Psychologie“. Sie sagen „Ökonomie“ und meinen Kapitalismus. Sie sagen „Psychologie“ und meinen Religion, oder sollten wir sagen: Aberglauben? Im ersten Band des Kapital erklärt Marx, dass der Kapitalismus „bis zu einem wichtigen Ausmaß“ auf den Glauben in die magische Kraft von Personen und Objekten (Waren, Geld) basiert, denen rein eingebildete Fähigkeiten zugesprochen werden. Heute beruht das Vertrauen der internationalen Märkte in den Euro hauptsächlich auf den Glauben, dass die Einbeziehung „der Deutschen“ irgendwie eine Garantie dafür ist, dass alles gut werden wird. Mutti Merkel ist zu einem weltweiten Fetisch geworden. Das Problem der gemeinsamen europäischen Währung ist kein Randproblem, sondern absolut zentral, sowohl ökonomisch als auch politisch. Im Kapitalismus beruht das Vertrauen zwischen den Akteuren, ohne das eine Gesellschaft mit einem Minimum an Stabilität unmöglich wird, nicht mehr auf das gegenseitige Vertrauen zwischen den menschlichen Individuen, sondern nimmt die abstrakte Form des Geldvertrauens, des Vertrauens in die herrschende Währung an. Die deutsche Bourgeoisie weiß aus eigener Erfahrung mit der Hyperinflation 1923, dass der Kollaps einer Währung die Basis für Ausbrüche unkontrollierbarer Instabilität und des Irrsinns legt. Aber es gibt auch eine politische Dimension. Hier ist Berlin äußerst besorgt über die langfristige Entwicklung sozialer Unzufriedenheit in Europa und über die unmittelbare Lage in Frankreich. Sie ist alarmiert wegen der Unfähigkeit der Bourgeoisie auf der anderen Seite des Rheins, mit ihren wirtschaftlichen und politischen Problemen zu Rande zu kommen. Und sie macht sich Sorgen wegen der Aussichten auf gesellschaftlicher Unruhe in jenem Land, da die Arbeiterklasse in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten einen besonderen Respekt gegenüber dem französischen Proletariat entwickelt hat und dazu neigt, ihm die Führung des Kampfes in den Schoß zu legen.
In vollem Bewusstsein für ihre internationale Verantwortung hat die deutsche Bourgeoisie heute, mit den Resultaten der jüngsten Wahlen im Rücken, eine Regierung gewählt, die Stärke, Stabilität und Kontinuität verkörpert und symbolisiert und mit der sie hofft, sich den kommenden Stürmen erfolgreich zu stellen.
Weltrevolution 4. November 2013
Nationale Situationen:
- Wahlen in Deutschland [561]
Geographisch:
- Deutschland [562]
Aktuelles und Laufendes:
Leute:
- Merkel [448]
- Steinbrück [567]
Weltrevolution - 2014
- 1952 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 179
- 1560 Aufrufe
Der Kapitalismus ist verantwortlich!
- 1306 Aufrufe
Mehr als 300 Tote und Dutzende von Schwerverletzten: die Explosion, die das Bergwerk von Soma im Westen der Türkei erschütterte, ist die opferreichste Industriekatastrophe in der Geschichte des Landes. Sie ist keineswegs ein „Unfall“, ein Produkt schieren Pechs, das wir gottgegeben hinnehmen müssen. Sie ist ein Verbrechen – ein Verbrechen des Kapitals.
Nach dem Zusammenbruch der Mine gingen Tausende von ArbeiterInnen und StudentInnen nicht nur in Soma und Izmir (einer Hafenstadt nahe Soma), sondern auch in den Großstädten der Türkei, in Ankara und Istanbul, und in den kurdischen Regionen auf die Straße. Mutig der brutalen Repression, dem Tränengas und der Schlagstöcke trotzend, nahmen – fast ein Jahr nach der großen sozialen Bewegung, die von der Verteidigung des Gezi-Parks in Istanbul ausgegangen war – die Demonstrationen täglich an Umfang zu.
Die Bourgeoisie und ihre gefügigen Medien blieben sehr einsilbig gegenüber diesem Zorn. Alle Fernsehsender konzentrierten sich darauf, trauernde Familien, die um ihre Toten weinen, zu zeigen, und Reden von Erdogan und vom Energieminister einzustreuen, in denen diese Ausgleichszahlungen versprachen – als ob dies den Schmerz der Angehörigen lindern oder die Toten wieder lebendig machen könnte. Um die sozialen Spannungen abzubauen und dem Zorn der Bergarbeiter ein Ende zu bereiten, versprach man ihnen andere Jobs nach der Schließung des Bergwerks.
Das Stillschweigen der Medien über die Straßendemonstrationen und die Versammlungen von StudentInnen, die die Universitäten besetzten, ging einher mit vermehrten Polizeikontrollen gegen die Bevölkerung. Es drangen nur wenige Informationen darüber durch, was tatsächlich in Soma geschehen war. Die Regierung mobilisierte ihre Imame, um die ArbeiterInnen mit religiösem Opium zu narkotisieren, um sie dazu zu bringen, sich mit ihrem Schicksal abzufinden, sich der kapitalistischen Ordnung zu fügen.
Auf den Demonstrationen trafen die Solidarität mit den Familien der Opfer und die Empörung über die Gleichgültigkeit der Regierung und der Bosse auf die brutale Repression eines Polizeistaates. Das Foto, das eine junge Frau zeigt, die ein Plakat hochhält, auf dem geschrieben steht: „Dies war kein Unfall, dies ist Mord. Die Regierung ist verantwortlich!“, spricht für sich, was das Ausmaß der Wut und die gesellschaftliche Unzufriedenheit angeht.
Zum Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben wurden, wurden nach den Polizeiattacken gegen die Demonstrationen Generalversammlungen in den Universitäten von Istanbul und Ankara abgehalten.
Wahlen sind eine Falle für die Arbeiterklasse!
Neben den Imamen mobilisierte die türkische Bourgeoisie auch all ihre demokratischen Kräfte, ihre „Opposition“, um die Gefahr einer sozialen Explosion niederzuhalten. Alle demokratischen Kräfte, die in den Demonstrationen involviert sind, stimmen in den Schlachtruf ein: „Die Regierung muss zurücktreten!“ Die Kräfte des demokratischen „Fortschritts“ (die linken und linksextremen Parteien, die Gewerkschaften, etc.) tragen so ihren eigenen Part zum Schutz der kapitalistischen Ordnung und der nationalen Einheit bei. Ihre „radikalen“ Reden gegen die Erdogan-Regierung haben nur ein Ziel: die soziale Zeitbombe zu entschärfen und den Zorn der ArbeiterInnen und StudentInnen in die Falle der Wahlen zu lenken. Die Imame rufen die ArbeiterInnen dazu auf, Trost im Gebet zu suchen; die Oppositionskräfte rufen sie dazu auf, isoliert voneinander ihr Heil an der Wahlurne zu suchen und ein besseres Management des nationalen Kapitals durch eine „kompetentere“ bürgerliche Clique zu fordern.
Es fügt sich, dass die Präsidentschaftswahlen im August stattfinden, und das zum ersten Mal auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts. Alle Sirenen der Demokratie werden die Ausgebeuteten dazu aufzurufen, als bloße „Bürger“ zu handeln. Es ist kein Zufall, dass Erdogans Opponenten so sehr die „mangelnde Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber den Arbeitsbedingungen“, insbesondere in den Bergwerken, anprangern. Und es ist ebenfalls kein Zufall, dass die Gewerkschaften einen eintägigen Generalstreik angekündigt haben, um „gegen die Versäumnisse der Regierung“ zu protestieren. Die Gewerkschaften und die Oppositionsparteien versuchen, die Aufmerksamkeit auf Erdogan zu fokussieren, um die Illusion zu verbreiten, dass eine andere Clique von Ausbeutern die Ausbeutung der Proletarier humaner gestalten könnte, so jegliches Nachdenken über die wahren Ursachen dieser Katastrophe, die kapitalistische Produktionsweise, verhindernd.
Die provokanten Erklärungen des Ministerpräsidenten können offenkundig nur dazu führen, dieses Gefühl der Abscheu über den grenzenlosen Zynismus Erdogans zu steigern. Als er kaltherzig gegenüber den betroffenen Familien behauptete: „In solchen Minen passieren immer wieder solche Unfälle“, konnte dies den Zorn nur noch weiter steigern. Und schließlich sind wir Zeuge eines noch provokanteren Auftretens der Bullen und sogar Erdogans und seiner Leibwächter, die auf Demonstranten einschlagen.
Erdogans Brutalität und Arroganz zeigt uns das wahre Gesicht der gesamten Bourgeoisie, einer globalen Klasse von Ausbeutern und Mördern. Der Kapitalismus „mit einem humanen Antlitz“ ist eine reine Mystifikation, weil die Bourgeoisie, welche Clique auch immer an der Regierung sein mag, ob rechts oder links, sich nicht einen Deut um Menschenleben schert. Ihre einzige Sorge gilt dem Profit. Und ob er nun säkular oder religiös geprägt ist, der Staat ist stets ein Polizeistaat, wie wir in den meist entwickelten demokratischen Ländern sehen können, wo Demonstrationen stets gut von Kräften der Opposition und den Basisgewerkschaftern auf der einen und von den Repressionskräften auf der anderen Seite kontrolliert werden.
Der Kapitalismus ist ein System, das den Tod verbreitet
Akin Celik, der Direktor des Soma-Bergwerks, teilte im Jahr 2012 einer türkischen Zeitung mit, dass es gelungen war, die Produktionskosten auf 24 Dollar die Tonne zu reduzieren, im Vergleich zu den 130 Dollar vor der Privatisierung des Bergwerks. Wie konnte es zu einer solchen Meisterleistung kommen? Natürlich durch Kürzungen an allen Ecken und Enden, soweit möglich, besonders auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit. Sie wurden mit dem Segen der Gewerkschaften erzielt, die jetzt die Versäumnisse der Regierung anprangern. Man kann es nicht deutlicher ausdrücken, wie dieser Kumpel aus Soma: „Es gibt keinerlei Sicherheiten in diesem Bergwerk. Die Gewerkschaften sind nur Marionetten und die Bosse denken nur ans Geld.“[1]
Doch die Gier der Bosse ist nicht die wesentliche Ursache von Industriekatastrophen und Arbeitsunfällen. Wenn die Kosten ständig gedrückt werden müssen, geschieht dies, um die Produktivität des Unternehmens, seine Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Mit anderen Worten, es ist die eigentliche Produktionsweise des Kapitalismus – eine Produktionsweise, die auf die Konkurrenz, auf den Weltmarkt, auf die profitorientierte Produktion basiert -, die die Bosse, selbst die „humansten“ unter ihnen, unerbittlich dazu treibt, das Leben jener zu gefährden, die sie ausbeuten. Für die bürgerliche Klasse ist der/die LohnarbeiterIn lediglich die Quelle einer Ware, deren Arbeitskraft zu einem möglichst niedrigen Preis gekauft wird. Und um die Produktionskosten zu senken, hat die Bourgeoisie keine andere Wahl, als die Sicherheit auf dem Arbeitsplatz einzusparen. Die Ausbeuter können sich nicht allzu viele Sorgen um das Leben, die Sicherheit und die Gesundheit der Ausgebeuteten machen. Das einzige, was zählt, ist das Auftragsbuch, die Profitmarge, die Mehrwertrate.
Laut einem 2003 veröffentlichten Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation werden alljährlich weltweit 270 Millionen LohnarbeiterInnen Opfer von Arbeitsunfällen; 160 Millionen leiden an „Berufskrankheiten“. Die Untersuchung enthüllt, dass jedes Jahr zwei Millionen Menschen bei der Verrichtung ihrer Arbeit zu Tode kommen. Das sind 5.000 pro Tag!
Und dieser Horror beschränkt sich nicht auf die Dritte Welt. In Frankeich kommen laut der CNAM (Caisse National d’Assurance-Maladie – die nationale Krankenversicherungsorganisation) pro Jahr 780 Beschäftigte bei Arbeitsunfällen ums Leben, mehr als zwei pro Tag. Es gibt etwa 1.350000 Arbeitsunfälle im Jahr, das heißt 3.700 Opfer jeden Tag oder, bei einem Achtstunden-Arbeitstag, acht Verletzte jede Minute.
Wenn wir zurückblicken, so hat der Kapitalismus stets Tod verbreitet. Wie Engels 1845 in seiner Untersuchung über Die Bedingungen der Arbeiterklasse in England aufzeigt:
„Die Kohlengrube ist der Schauplatz einer Menge der schreckenerregendsten Unfälle, und gerade diese kommen direkt auf die Rechnung des Bourgeoisie-Eigennutzes. Das Kohlenwasserstoffgas, das sich so häufig in ihnen entwickelt, bildet durch seine Vermischung mit atmosphärischer Luft eine explosible Luftart, die sich durch die Berührung mit einer Flamme entzündet und jeden tötet, der sich in ihrem Bereich befindet. Solche Explosionen fallen fast alle Tage hier oder dort vor; am 28. September 1844 war eine in Haswell Colliery (Durham), welche 96 Menschen tötete. Das kohlensaure Gas, das sich ebenfalls in Menge entwickelt, lagert sich an den tiefern Stellen der Gruben oft über Mannshöhe und erstickt jeden, der hineingerät (…) Durch eine gute Ventilation der Gruben vermittels Luftschachten wäre die nachteilige Wirkung beider Gase gänzlich zu vermeiden, aber dazu gibt der Bourgeois sein Geld nicht her und befiehlt lieber den Arbeitern, nur von der Davyschen Lampe Gebrauch zu machen, die ihm wegen ihres düstern Scheins oft ganz nutzlos ist und die er deshalb lieber mit der einfachen Kerze vertauscht. Kommt dann eine Explosion, so war es die Nachlässigkeit der Arbeiter, wo doch der Bourgeois durch gute Ventilation jede Explosion hätte fast unmöglich machen können. Ferner fällt alle Augenblicke ein Stollen ganz oder teilweise ein und begräbt die Arbeiter oder zerquetscht sie; es ist das Interesse des Bourgeois, daß die Flöze soviel irgend möglich ausgegraben werden, und daher auch diese Art Unglücksfälle.“ (Kapitel über „Das Bergwerksproletariat“)
Der Kapitalismus – das ist der Mörder, das ist der Feind!
Die Toten von Soma sind auch unsere Toten. Es sind unsere Klassenbrüder, die durch den Kapitalismus getötet worden sind. Es sind unsere Klassenbrüder und -schwestern, die auf den Demonstrationen in der Türkei zusammengeschlagen wurden. Die Ausgebeuteten der gesamten Welt müssen sich von dieser Katastrophe mit betroffen fühlen, weil das gesamte System eine Katastrophe für die Menschheit ist.
Angesichts der Barbarei dieser Gesellschaftsordnung, die nicht nur in militärischen Konflikten, sondern auch immer häufiger auf dem Arbeitsplatz Tote produziert, müssen sich die Ausgebeuteten weigern, irgendeine gemeinsame Sache mit ihren Ausbeutern zu machen. Die einzige Solidarität, die sie mit den Familien der Opfer von Soma zeigen können, ist der Kampf auf ihrem eigenen Klassenterrain. Überall, auf den Arbeitsplätzen, in den Hochschulen und Universitäten, auf Versammlungen und Treffen müssen wir die wahren Ursachen dieser Tragödie diskutieren. Wir müssen über die Fallen der reformistischen Wächter der bürgerlichen Ordnung hinwegspringen, die mit der Vogelscheuche Erdogan herumfuchteln, um die wahre Verantwortung des Weltkapitals zu verschleiern.
Auf die Trauerreden der Imame – „Kämpft nicht, sondern betet!“ –, auf die Slogans der demokratischen Opposition – „Kämpft nicht, sondern geht wählen!“ – müssen wir entgegnen:
Solidarität mit unseren Klassenbrüdern und -schwestern in der Türkei! Kampf den Ausbeutern in aller Herren Länder!
Révolution Internationale, 16.5.14
Aktuelles und Laufendes:
- Soma [570]
- Solidarität [571]
- Grubenunglück [572]
Rubric:
Die Ukraine gleitet in die militärische Barbarei ab
- 2747 Aufrufe
Die Krise in der Ukraine ist die gefährlichste in Europa seit der Auflösung Jugoslawiens ein Vierteljahrhundert zuvor, da Russlands Versuche, seine Interessen gegen das Streben der westeuropäischen Mächte nach mehr Einfluss in dieser Region zu verteidigen, einen Bürgerkrieg und die Destabilisierung der Region heraufbeschwören.
Das Land hat einen neuen Präsidenten, Petro Poroschenko, der von einer Mehrheit in der ersten Wahlrunde gewählt wurde und sogleich versprach, die „separatistischen Terroristen“ im Osten des Landes binnen Stunden zu bezwingen. Eine neue Hoffnung ist er beileibe nicht. Er begann seine politische Karriere in der Vereinten Sozialdemokratischen Partei der Ukraine und anschließend in der Partei der Regionen, die Kutschma, einem Verbündeten Russlands, treu war, ehe er 2001 zu Juschtschenkos Block „Unsere Ukraine“ wechselte. Er war Minister sowohl in der Juschtschenko- als auch in der Janukowitsch-Regierung gewesen. Der Schokoladen-Milliardär wurde 2005 der Korruption beschuldigt; er bestritt die Präsidentschaftswahlen mit der Unterstützung des Ex-Boxers Witali Klitschko, der zur gleichen Zeit zum Bürgermeister von Kiew gewählt wurde, und seiner korrupten Helfer Lewoschkin und Firtasch. In der Ukraine hat damit nun ein weiterer korrupter Oligarch das Sagen, um die einzige Perspektive, die dieses verrottete kapitalistische System für die Menschheit parat hat, Militarismus und Austerität, durchzusetzen.
Weit davon entfernt, eine neue Ära der demokratischen Stabilität und des Wachstums einzuleiten, waren die Präsidentschaftswahlen am 24. Mai wie auch die Referenden, die von Separatisten auf der Krim im März und in Donezk und Luhansk im Mai abgehalten wurden, ein weiterer Schritt der Ukraine bei ihrem Abgleiten in einen blutigen Bürgerkrieg. Was wir nun sehen, ist eine Ausweitung der inneren Spaltungen in diesem bankrotten, künstlichen Gebilde, beschleunigt von den imperialistischen Manövern von außen. Es besteht die Gefahr, dass das Land von einem Bürgerkrieg, von ethnischen Säuberungen, Pogromen, Massakern zerrissen wird und die imperialistischen Konflikte sowie die Instabilität in der Region verschärft werden.
Die „angeborene“ Instabilität der Ukraine
Die Ukraine ist Europas zweitgrößtes Land, ein künstliches Konstrukt, in dem 78 Prozent der Bevölkerung Ukrainisch sprechen und 17 Prozent Russisch; Letztere bilden die Mehrheit in der Donbas-Region. Hinzu kommen noch etliche andere Nationalitäten, einschließlich der Krimtartaren. Die wirtschaftlichen Spaltungen folgen den gleichen Linien, mit der Kohle und dem Stahl im russisch sprechenden Osten, die nach Russland exportiert werden und sich auf 25 Prozent der Exporte des Landes belaufen, und mit dem westlichen Teil des Landes, der die Bühne für die orangenen Proteste 2004 und den Maidan-Protesten im vergangenen Winter gebildet hatte und in der EU sein Heil sucht.
Die Wirtschaft ist eine Katastrophe. Seit 1999 ist ihr Ausstoß auf 40 Prozent des Standes von 1991 gefallen, als das Land unabhängig wurde. Nach einer relativen Wiederbelebung schrumpfte er auf 15 Prozent im Jahr 2009. Die Industrie im Osten ist veraltet, hoch gefährlich und eine Umweltbelastung. Die Tatsache, dass die Flöze immer weniger hergeben, hat zu noch gefährlicheren Arbeiten in Tiefen von 1200 Metern geführt, mit der Gefahr von Methan- und Kohlenstaubexplosionen wie auch von Gebirgsschlägen (ein Risiko, das erst kürzlich in Soma in der Türkei über 3000 Tote verursachte). Die Verschmutzung aus dem Abwasser der Bergwerke zieht die Trinkwasserversorgung in Mitleidenschaft, während antiquierte Kokereien und Stahlhütten sichtbar Luftverschmutzung und Abraumhalden Bergrutsche verursachen.[1] Hinzu kommt die radioaktive Belastung, ein Vermächtnis aus der sowjetischen Ära des nuklearen Rohstoffabbaus. Diese Industrien sind nicht mittelfristig und schon gar nicht kurzfristig wettbewerbsfähig angesichts der EU-Konkurrenz. Es ist kaum ersichtlich, wer die notwendigen Investitionen stemmen soll. Nicht die Oligarchen, die sehr, sehr reich wurden, während die Wirtschaft den Bach hinunterging. Nicht Russland, das selbst veraltete Industrien aus den Sowjetzeiten hat, mit denen es fertig werden muss. Und mit Sicherheit nicht das westeuropäische Kapital, das die Regie bei der Schließung der meisten seiner eigenen Bergbau- und Stahlindustrie in der 1970er und 1980er Jahre geführt hatte. Die Idee, dass Russland aus der wirtschaftlichen Katastrophe, der Verarmung und Arbeitslosigkeit, die immer weiter fortschreiten, während die Oligarchen immer reicher werden, einen Ausweg anbieten könnte – eine Art von Nostalgie des Stalinismus und seiner versteckten Arbeitslosigkeit -, ist eine gefährliche Illusion, die die Fähigkeit zur Selbstverteidigung der Arbeiterklasse nur untergraben kann.
Hoffnungen auf Gelder aus dem Westen sind gleichermaßen gefährlich. Der IWF-Rettungsfond im März, 14-18 Milliarden Dollar schwer, der die 15 Milliarden Dollar ersetzen soll, die von Russland gestrichen wurden, als Janukowitsch fiel, ist nur unter der Bedingung einer strikten Austerität, eines 40%igen Anstiegs der Brennstoffpreise und eines Abbaus von zehn Prozent der öffentlichen Arbeitsplätze, rund 24.000 Jobs, zugesagt worden. Die Arbeitslosenzahlen sind wenig verlässlich, da viele Menschen nicht registriert oder unterbeschäftigt sind.
Als die Ukraine noch Teil der UdSSR und an seinen westlichen Grenzen von russischen Satelliten umgeben war, bedrohte die Zweiteilung nicht die Integrität des Landes. Dies heißt nicht, dass solche Spaltungen nicht benutzt und missbraucht wurden. Beispielsweise wurden vor 70 Jahren die Krimtartaren vertrieben, von denen erst vor kurzem einige wieder zurückkehrten. Die Spaltungen wurden von allen Seiten auf widerlichste und blutigste Weise ausgespielt. Es ist nicht nur die ultrarechte Svoboda oder die Rehabilitierung von Stephan Bandera, einem ukrainischen Nazi aus Kriegszeiten, durch die Interimsregierung: Auch Julia Timoschenko bedient sich einer martialischen Sprache gegen russische Führer und gegen die russische Bevölkerung, und Poroschenko setzt dies in die Praxis um. Die russische Seite ist genauso widerlich und mörderisch. Beide Seiten haben paramilitärische Einheiten gebildet. Auch Kiew verlässt sich nicht allein auf die reguläre Armee. Diese irregulären Kräfte umfassen die gefährlichsten Fanatiker, Söldner, Terroristen, Killer; sie üben Terror gegenüber der Zivilbevölkerung aus, wenn sie sich nicht gegenseitig umbringen. Wenn diese Kräfte erst einmal von der Leine gelassen worden sind, werden sie dazu neigen, autonom zu werden, außer Kontrolle zu geraten, was zu Opferzahlen führen wird, wie wir sie aus dem Irak, aus Afghanistan, Libyen oder Syrien kennen.
Russland verteidigt seine strategischen Interessen auf der Krim
Der russische Imperialismus braucht die Krim für seine Schwarzmeerflotte. Ohne seine Basen auf der Krim könnte Russland nicht mehr Operationen im Mittelmeer oder im Indischen Ozean durchführen. Seine strategische Position hängt von der Krim ab. Die Ukraine wird auch zur Verteidigung der South Stream-Gaspipeline benötigt, sobald sie fertig gestellt ist. Dies war ein ständiges Anliegen seit der ukrainischen Unabhängigkeit gewesen. Russland kann einfach nicht eine pro-westliche ukrainische Regierung, die für die Krim verantwortlich zeichnet, dulden, entsprechend seine Antwort auf jegliches Abkommen mit der EU. 2010 gewährte Russland einen Preisnachlass für Erdgas im Austausch für eine Verlängerung der Pacht für seine Schiffsbasen auf der Krim. Als die Janukowitsch-Regierung die Unterzeichnung des Assoziationsabkommens mit der EU vergangenen November aussetzte, antwortete Russland mit einem 15 Milliarden Dollar schweren Unterstützungspaket, das annulliert wurde, als Janukowitsch angeklagt wurde und aus der Ukraine floh. Kurz danach übernahm es die Krim und organisierte ein Referendum für den Anschluss an Russland, das es in seiner Kriegspropaganda für ihre Annexion benutzen konnte, ungeachtet der Tatsache, dass diese Annexion international nicht anerkannt wurde.
So hatte Russland im März die Krim de facto in seiner Tasche. Doch die Krim ist für Russland noch längst nicht sicher, da sie von der Ukraine umzingelt ist, einem Land, das im Begriff ist, ein Assoziationsabkommen mit der EU zu unterzeichnen und sich folglich sich mit Russlands Feinden zu verbünden, und das versucht, sich Russlands Erpressung zu entziehen, indem es neue Geldgeber in Westeuropa findet. Aus strategischen Gründen, d.h. um einen Landweg zur Krim zu haben, muss Russland den östlichen Teil der Ukraine unter seine Kontrolle bringen. Die Ostukraine ist jedoch ein ganz anderes Kaliber als die Krim, trotz des Gewichts der russisch-sprechenden Bevölkerung, die für Russlands Schachzüge das Alibi liefert. Ohne militärischen Stützpunkt in der Ostukraine können die separatistischen Referenden in Donezk und Luhansk diese Regionen nicht für Russland sichern, sondern sie allenfalls destabilisieren. Nicht einmal die Kontrolle dieser lokalen, separatistischen Banden kann als sicher gelten.
Russland kann eine weitere Karte bei der möglichen Destabilisierung dieses Gebietes ausspielen: Transnistrien, das von Moldawien an der südwestlichen Grenze der Ukraine wegbrach und ebenfalls einen großen Teil russisch sprechender Bevölkerung hat.
Kein neuer Kalter Krieg, aber eine weitere Drehung der Spirale der militärischen Barbarei
Es handelt sich hier keinesfalls um die Rückkehr zum Kalten Krieg. Dieser war eine Periode von Jahrzehnten militärischer Spannungen zwischen zwei imperialistischen Blöcken, die Europa spalteten. Doch 1989 ist Russland so sehr geschwächt worden, dass es nicht länger die Kontrolle über seine Satelliten, nicht einmal über die alte UdSSR ausüben konnte, trotz seiner Anstrengungen wie sein Krieg in Tschetschenien. Mittlerweile sind viele osteuropäische Länder in der Nato, deren Operationsbasis nun bis an die russischen Grenzen reicht. Aber Russland besitzt noch immer sein Nukleararsenal, und es hat noch immer dieselben imperialistischen Interessen. Der drohende Einfluss jeglichen Einflusses in der Ukraine ist eine weitere Schwächung, die es nicht tolerieren darf und die es zur entsprechenden Reaktion gezwungen hat.
Die USA sind die einzig verbliebene Supermacht, doch sie haben nicht mehr die Autorität eines Blockführers über ihre „Verbündeten“ und Konkurrenten in Europa. Dies wird anhand der Tatsache deutlich, dass sie diese Mächte nicht mehr – wie im ersten Golfkrieg - zur Unterstützung des zweiten Golfkriegs mobilisieren konnten. Die USA sind dadurch geschwächt worden, dass sie mehr als 20 Jahre lang im Sumpf der Kriege im Irak und in Afghanistan versunken waren. Und nun sehen sie sich dem Aufstieg eines neuen Rivalen gegenüber, der Südostasien und den Fernen Osten destabilisiert: China. Infolgedessen sind die USA trotz ihrer Absicht, ihre Militärausgaben zu kürzen, gezwungen, ihre Aufmerksamkeit auf jene Weltregion zu richten. Obama hat gesagt: „Einige unserer kostspieligsten Fehler entstanden nicht aus unserer Zurückhaltung, sondern aus unserer Bereitschaft, uns in militärische Abenteuer zu stürzen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.“[2] Dies bedeutet nicht, dass sie nicht versuchen werden, durch Diplomatie, Propaganda und verdeckte Operationen ein Stück vom ukrainischen Kuchen zu ergattern, doch sie besitzen keine unmittelbare Perspektive einer militärischen Intervention. Russland sieht sich nicht einem vereinten Westen gegenüber, sondern einer Reihe von unterschiedlichen Ländern, die alle ihre eigenen imperialistischen Interessen verfolgen, wie sehr sie seine Züge in der Ukraine verbal auch verurteilen mögen. Großbritannien will keine Sanktionen, die russische Investitionen in der City beeinträchtigen könnten; Deutschland ist vorsichtig wegen seiner gegenwärtigen Abhängigkeit vom russischen Gas, auch wenn es nach anderen Energieversorgern Ausschau hält. Die baltischen Staaten sind für die schärfste Verurteilung und für harte Maßnahmen, da sie sich angesichts eines großen Anteils an russisch sprechender Bevölkerung ebenfalls bedroht fühlen. So hat der Ukraine-Konflikt eine weitere Spirale militärischer Spannungen in Osteuropa ausgelöst; er zeigt, dass Letztere ein unheilbares Krebsgeschwür sind.
Zurzeit hat Russland es mit Sanktionen zu tun, die potenziell sehr abträglich sind, da Russland stark auf seine Öl- und Gasexporte angewiesen ist. Sein jüngster Deal, der Verkauf von Erdgas an China, wird eine große Hilfe sein. China enthielt sich bei der Verurteilung der russischen Annexion der Krim durch die UN. Hinsichtlich der Propaganda beansprucht China Taiwan auf der Grundlage derselben Prinzipien, auf die Russland bezüglich der Krim pocht, nämlich die Einheit des chinesisch sprechenden Volkes. Dagegen möchte es nicht das Prinzip der Selbstbestimmung zulassen, hat es doch selbst viele Minderheiten in seinen Grenzen.
Alle Fraktionen der Bourgeoisie, sowohl die ukrainische als auch jene Aufwiegler von außen, sehen sich einer Situation gegenüber, in der jeder Zug die Dinge noch weiter verschlimmert. Dies ist wie der Zugzwang beim Schach, ein Spiel, das in Russland und in der Ukraine sehr beliebt ist: eine Situation, in der jeder Mitspieler seine Position nur verschlechtern kann, trotzdem er einen Zug machen muss – oder aufgeben muss. Beispielsweise wollen Kiew und die EU eine engere Assoziation, was nur zu Konflikten mit Russland und zum Separatismus im Osten führen kann; Russland möchte seine Kontrolle über die Krim sichern, doch statt die Kontrolle über die Ukraine oder ihre östliche Region zu übernehmen, ist alles, was es tun kann, zum Separatismus und zur Instabilität aufzuwiegeln. Je mehr sie versuchen, ihre Interessen zu verteidigen, desto chaotischer wird die Situation, desto mehr rutscht das Land in den offenen Bürgerkrieg – wie Jugoslawien in den 1990er Jahren. Dies ist ein Merkmal des Zerfalls des Kapitalismus, in dem die herrschende Klasse nicht mehr in der Lage ist, auch nur eine Perspektive für die Gesellschaft vorzubringen, und in dem die Arbeiterklasse noch nicht im Stande ist, ihre eigene Perspektive vorzustellen.
Die Gefahr für die Arbeiterklasse
Die Gefahr für die Arbeiterklasse in dieser Lage besteht darin, dass sie von allen möglichen nationalistischen Fraktionen rekrutiert wird. Diese Gefahr ist umso größer, da sich die reale Barbarei auf die historische Feindschaft stützt, die von allen Fraktionen im 20. Jahrhundert praktiziert wurde: Die ukrainische Bourgeoisie kann die Bevölkerung und besonders die Arbeiterklasse an die Hungersnot erinnern, die in Folge der Zwangskollektivierung im stalinistischen Russland Millionen von Menschen das Leben kostete; die Russen können ihre Bevölkerung an die ukrainische Unterstützung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg erinnern; und die Tartaren haben nicht ihre Vertreibung von der Krim und das Sterben von 200.000 Menschen vergessen. Es gibt zudem die Gefahr, dass ArbeiterInnen dazu verleitet werden, die eine oder andere Fraktion für ihr wachsendes Elend verantwortlich zu machen, und auf dieser Grundlage in die Unterstützung der einen oder anderen von ihnen getrieben werden. Keine dieser Fraktionen hat der Arbeiterklasse etwas anderes anzubieten als eine sich verschlimmernde Austerität und blutige Konflikte.
Sicherlich werden sich einige ArbeiterInnen von pro- oder antirussischen Gefühlen hinreißen lassen[3], doch kennen wir die Situation vor Ort nicht. Die Tatsache jedoch, dass der Donbass zu einem Schlachtfeld für nationalistische Kräfte geworden ist, unterstreicht die Schwäche der Arbeiterklasse in dieser Region. Angesichts von Arbeitslosigkeit und Armut war sie nicht imstande gewesen, zusammen mit ihren Klassenbrüdern und –schwestern in der Westukraine Kämpfe für ihre eigenen Interessen zu entwickeln, und ist mit der Gefahr der Spaltung konfrontiert.
Es gibt eine winzige, aber gleichwohl bedeutende Minderheit von Internationalisten in der Ukraine und in Russland, die KRAS und andere, deren mutiges Statement: „Krieg dem Krieg! Nicht einen einzigen Blutstropfen für die ‚Nation‘!“[4] die Position der Arbeiterklasse vertritt. Auch wenn sie noch nicht mit ihrer eigenen revolutionären Perspektive aufwarten kann, bleibt die Arbeiterklasse international ungeschlagen, und dies ist die einzige Hoffnung auf eine Alternative zum Kapitalismus, der kopfüber in die Barbarei und Selbstzerstörung stürzt.
Alex, 8.6.2014
[1] Niemand, der 1966 in Großbritannien lebte, kann an einer solchen Schlammlawine denken, ohne sich an die Katastrophe von Aberfan zu erinnern, in der eine Abraumhalde eine Grundschule unter sich begrub und dabei 116 Kinder und 28 Erwachsene tötete.
[2] The Economist, 31.5.2014
[3] Beispielsweise versammelten sich 300 Bergarbeiter, eine nicht unbedeutende Zahl, um die Separatisten zu unterstützen (www.theguardian.com/world/2014/may/28/miners-russia-rally-donetsk [573]).
Aktuelles und Laufendes:
- Imperialismus [575]
- Zerfall [576]
Theoretische Fragen:
- Krieg [577]
Rubric:
Die Utopie bringt den Kampf nicht voran
- 1614 Aufrufe
Der folgende Artikel wurde das erste Mal im Frühjahr 2014 in Wereldrevolutie, der Zeitung der IKS in den Niederlanden, publiziert. Er ist eine Antwort auf Betrachtungen der Kritischen Studenten Utrecht (KSU), die auf ein breites Echo in der Gesellschaft stießen. In September 2013 widmete die KSU eine Ausgabe ihrer Zeitung Krantje Boordje dem Thema Utopie.
In den letzten Jahren wurden immer mehr Stimmen laut, die radikalere Ansprüche stellen und die Lösung in einer grundlegenden Umwälzung der Gesellschaft suchen. Die Kämpfe der vergangenen Jahre (Occupy, Indignados, usw.) haben deutlich gemacht, dass Teilforderungen allein, Forderungen in bestimmten Bereichen der Gesellschaft, durchaus ein Ausgangspunkt für den Kampf sein können, aber, sofern sie nicht durchgesetzt und nicht im und durch den Kampf selbst weiter entwickelt werden können, ab einem bestimmten Moment dem Kampf in die Parade fahren. Es ist der Text Sanders von den KSU, der versucht, die Frage zu beantworten.
„Der Kampf um Reformen scheint realistischer zu sein, aber es lohnt sich trotzdem, für ein Zusammenleben zu kämpfen, das genau so ist, wie du es dir vorstellst. Mit dem Einfordern von Reformen riskierst du, dass der Kampf geschwächt wird, sobald die Forderungen einmal erfüllt sind. […] Die grundlegenden Ursachen […] sind leicht durch die gemäßigten Parteien, die den Widerstand kanalisieren, zu übergehen. Wenn du allerdings für ein ganz anderes Zusammenleben kämpfst, […] dann kannst du darauf weiter aufbauen, weil dein Endziel von Anfang an ein ganz anderes Zusammenleben ist, und so kannst du dazu übergehen, was du wirklich vor Augen hast.“ (Sander van Lanen, „Onpraktisch denken als praktische oplossing“, Krantje Boordje, Nr. 18, 2013)
Und Sander ist nicht der einzige, der findet, dass das Aufstellen von „realistischen Forderungen“ den Kampf nicht weiter bringt. Auch andere plädieren dafür, weitergehende Forderungen zu stellen:
„Wer die Kunst vermarktet, schafft das Versprechen auf die Zukunft ab. Wahre Kunst steckt voller Möglichkeiten und Fantasie, und das ist es, wo die Veränderung beginnt. Auch der Künstler und der Kulturliebhaber müssen es hinsichtlich der Kulturpolitik wagen, über radikale Änderungen nachzudenken.“ (Robrecht Vanderbeeken, „De verbeelding aan de macht! (Ook in het cultuurbeleid)”, De Wereld Morgen, 2013)
„Die letzten Jahre haben mich gelehrt, dass viele Menschen inzwischen wissen, dass radikale Veränderungen unvermeidlich sind. Die soziale, ökologische und wirtschaftliche Krise ist nicht mit der ‚üblichen Praxis‘ zu überwinden, mit business as usual. Bestehende Konzepte haben zu den Krisen geführt und können nicht für deren Lösung benutzt werden.“ (Martijn Jeroen van der Linden, „Radicale verandering“, Economie, Filosofie en Kunst, 2013)
Aber wie kann man radikalere Forderungen stellen als die, für die man schon immer gekämpft hat, nämlich für die Abschaffung des Kapitalismus? Etwas orientierungslos, aber nicht entmutigt und geschlagen ziehen sich die kämpferischen Genossen der KSU zurück, um die Wunden zu lecken und die Lehren zu ziehen auf der Suche nach einem anderen Weg, um eine breitere Bresche in die Mauer des kapitalistischen Staates zu schlagen. Auf der Webseite der Kritischen Studenten aus Utrecht sind verschiedene Artikel erschienen, die einen Ansatz für ein neues strategisches Konzept für den kommenden Kampf zu finden versuchen.
Allerlei Gruppierungen, vornehmlich anarchistische, bewegen sich schon seit Jahren auf ausgetretenen Pfaden. Die KSU ist eine der wenigen Gruppen des politischen Milieus, in denen noch Leben steckt; sie scheint die Fähigkeit zu besitzen, einen anderen Weg zu gehen, um zu versuchen, aus der Sackgasse herauszukommen, worin sie sich wegen ihres eigenen Aktivismus zeitweise befand. Die KSU ist eine Gruppierung, die schon seit etlichen Jahren besteht. Sie ist keine klassische Aktivistengruppe. Obwohl nichts darauf hinweist, dass viele Diskussionen innerhalb der Gruppe stattfinden, sind die Teilnehmenden doch an Theorie interessiert. Regelmäßig erscheinen Texte, meistens übernommene, die das eine oder andere Thema vertiefen. Die Gruppe ist ziemlich heterogen. Sie hat kein festes ideologisches Konzept (anarchistisch, situationistisch, modernistisch, usw.) und entwickelt hauptsächlich Aktivitäten im Rahmen von Hochschulbildung und Wissenschaft. Auch wenn der Kern von Leuten schon seit einigen Jahren derselbe geblieben ist, werden doch regelmäßig neue, junge Leute angezogen, die dieser Gruppierung mit neuen Ideen neues Leben einhauchen. Wie erst kürzlich mit der Veröffentlichung von Beiträgen zu einer utopistischen Strategie, die dem antikapitalistischen Kampf möglicherweise wieder etwas Perspektive geben kann.
Nehmen wir z. B. den Artikel „Ökotopia“ aus der jüngsten Ausgabe, in dem die Anstrengung unternommen wird, gegen das dauernde Streben nach Wachstum und den endlosen Konsum, wozu die kapitalistische Produktionsweise führt, eine utopische Alternative einer Gesellschaft zu skizzieren, in der die Natur an erster Stelle steht. In einem zweiten Artikel auf dieser Webseite mit dem Titel „Realität über Träume und Fantasie“ steht geschrieben: „Träume von einer besseren Welt. Unrealistisch! Unpraktisch! Zeitverschwendung! Gefährlich? Wir haben den Wert des Idealismus vergessen.“ In einem dritten Artikel („Unpraktisch denken als praktische Losung“) kann man lesen: „Andere wählen sofort das Endziel und stellen utopische Forderungen. […] Indem man sich ein weitreichendes Ziel steckt, wird man mehr Menschen für dieses Ziel finden […] Es scheint utopisch, aber es ist vielleicht die praktischste Vorgehensweise.“
Dass die gerade genannten Artikel nicht das Bedürfnis einer zufälligen Gruppe zum Ausdruck bringen, sondern eine Reaktion auf ein allgemeines Bedürfnis der nicht ausbeutenden Schichten der Gesellschaft sind, zeigt sich in der Tatsache, dass im letzten Jahr verschiedene Bücher über die Utopie erschienen sind, so:
- „Die neue Kooperation zwischen Realität und Utopie“ von Walter Lotens;
- „Von der Krise zu einer machbaren Utopie“ von Jan Bossuy;
- „Die neue Demokratie und andere Formen der Politik“ von Willem Schinkel.
Und dabei ist es nicht geblieben. Die Zeitschrift „Konfrontation“ hat den Hauptteil einer Ausgabe der Frage der Utopie gewidmet. Ein Jahr zuvor fanden drei Radiosendungen über utopische Ideen statt. Und unlängst hat in Leiden eine Podiumsdiskussion über dasselbe Thema stattgefunden.
Antikapitalismus ist nicht genug; das haben die Leute von der KSU inzwischen wahrscheinlich wohl begriffen. Das war übrigens schon einmal in einem früheren Beitrag auf der Webseite der KSU unterstrichen worden.[1] Es muss auch einen Ausblick auf eine reelle Perspektive einer anderen Gesellschaft geben. Diese Perspektive stellt eine andere Zukunft dar, bildet eine Anziehungskraft, die dem heutigen Kampf eine Richtung und Inspiration geben kann. Nach Willem Schinkel haben auch wir mehr utopische Fantasie nötig, stellt sie doch ein Mittel dar, um über das reine Problemmanagement hinauszugehen. Um den rein antikapitalistischen Charakter des Kampfes zu übersteigen, legen manche die Betonung auf die Bedeutung von Träumen, denn das utopische Denken ist die Kunst des Traums von einer Alternative. Um unserer Wirklichkeit zu entrinnen, müssen wir tatsächlich lernen, über den Horizont des Kapitalismus hinauszuschauen und die Vision einer Alternative und einer besseren Welt mit Inhalt zu füllen. Um den Gedanken eine Form, Struktur einer solchen Gesellschaft zu geben, müssen wir uns einlassen auf eine Idealvorstellung, auch wenn diese eine materielle Grundlage hat. Befreit von der Notwendigkeit, nach einer praktischen Lösung für das tägliche Elend im Kapitalismus zu suchen, entsteht ein Freiraum, um in unseren Gedanken eine ideale Vorstellung zu schaffen.
„Die Fantasie an die Macht“ lautete die berühmte Losung der Mairevolte 1968 in Frankreich. Nicht dass die Fantasie genügen würde, um eine andere Gesellschaft zu verwirklichen, aber Fantasie kann eine wichtige Aufgabe erfüllen. „Wir müssen zu träumen wagen. Denn von einer besseren Welt zu träumen bedeutet, über die heutige Welt nachzudenken. Wenn man nämlich über Dinge nachdenkt, die unmöglich erscheinen, wird man in die Lage versetzt, über den vorgegebenen Rahmen hinaus zu denken, ungeachtet dessen, ob die Idee ‚realisierbar‘ ist oder nicht.“ (Ying Que, Realität über Träume und Fantasie, Krantje Boordje, Nr. 18, 2013)
Die kulturelle Komponente im Kampf gegen den Kapitalismus
Der Kampf gegen den Kapitalismus besteht aus drei Teilen:
- aus dem Kampf gegen die Angriffe auf unsere Lebensbedingungen: auf unsere Einkommen, auf die Bildung, auf die Gesundheitsversorgung usw.;
- aus dem Kampf um die politische Macht: die Ersetzung des Systems des Privateigentums durch gemeinschaftliches Eigentum;
- aus dem Kampf gegen Entfremdung, gegen die Verengung des Bewusstseins, gegen die Abstumpfung durch die maschinenartige Lebensweise als bedeutsame Aspekte der kulturellen Komponente des Kampfes.
Diese dritte Komponente, die kulturelle Komponente des Kampfes, ist gekennzeichnet durch grundlegende menschliche Eigenschaften, wie moralische Verpflichtungen (der inneren Stimme) und künstlerische Empfindungen (das Gefühl für die Schönheit), aber auch durch Aspekte der Einbildungskraft und Fantasie, der Schöpferkraft und Intuition. „Die Fantasie umfasst alles, sie entscheidet über Schönheit, Rechtschaffenheit und Glück, die alles bedeuten in der Welt.“ (Blaise Pascal[2], Pensées, 1669) Der Kampf „für den Sozialismus ist nicht eine Messer-und-Gabelfrage, sondern eine Kulturbewegung […]“ (Rosa Luxemburg an Franz Mehring, 1919)
In den Augen von Henriette Roland-Holst[3] bekommt der Kampf erst seine Bedeutung, wenn Vernunft, Intuition und Eingebung zusammenfließen. Es ging ihr darum, „auf die innere Stimme zu hören“, wobei Wahrhaftigkeit und Mitgefühl die zwei vornehmsten seelischen Kräfte sind. Nach Roland-Holst erkennt man die Welt nicht in ihrer Gänze, wenn man sie allein durch die Brille der Vernunft betrachtet. Die Intuition, das Gefühl, die Wahrnehmung und ihre Zusammenfassung in der Fantasie sind die anderen unverzichtbaren Momente. (Roland-Holst, „Kommunismus und Moral“, 1925)
„Indem man sich ein weitreichendes Ziel steckt, wird man mehr Menschen für dieses Ziel finden und werden sich mehr Menschen in diesem Ziel wiederfinden. […] Es scheint utopisch […]“ Das Voranstellen einer Utopie im Rahmen des Kampfes um Forderungen hat jedoch in der heutigen Periode noch nie zu einer allgemeinen Mobilisierung von Arbeitern, Studenten und Arbeitslosen geführt. Die „utopische“ Forderung nach einem Grundeinkommen für jeden, die von der extremen Linken propagiert wird, führt zum Gegenteil einer Vereinigung im Kampf. Die vergleichbare Forderung nach „freier Bildung“ [ohne Staatsaufsicht], welche die KSU unlängst als eine „utopische“ Forderung propagiert hat, hat nichts gebracht. Dies deshalb, weil diese „Utopie“ sich nicht auf der Ebene des materiellen Kampfes bewegt, sondern etwas Typisches für den rein geistigen Kampf ist. Natürlich ist und bleibt der Kampf für die Verteidigung der materiellen Lebensbedingungen unter den heutigen Umständen die allererste Sorge im Klassenkampf. Denn ohne ein Minimum an Lebensmöglichkeiten ist das Leben sowieso nicht wert, gelebt zu werden. Aber der Kampf gegen den Kapitalismus und seine engstirnige und beschränkte Ideologie macht hier nicht Halt. Das Streben nach einem tieferen Bewusstsein, nach Wahrheit wird nicht allein durch materielle Dinge motiviert, wie z. B. ein menschenwürdiges Einkommen für jedermann, sondern auch durch das Vorbild eines Ideals. „Wir haben den Wert des Idealismus vergessen.“ Ohne uns als Idealisten einzuschätzen, liegt der höchste Wert des Kampfes für eine andere Gesellschaft letztendlich nicht auf der Ebene des Materiellen, sondern auf der Ebene des Bewusstseins, des geistigen Kampfes. Und wir können hier nur ansetzen, wenn wir begreifen, dass der schöpferische Gedanke dabei ein unverzichtbares Moment bildet. Das Übersteigen der Grenzen des bestehenden Systems im Kopf, in der idealen Vorstellung ist nicht möglich ohne Intuition und Fantasie. Die Erschaffung von Idealen in unserem Geist ist eine mächtige Kraft, die den Kampf entscheidend stimulieren kann.
Es mag deutlich geworden sein, dass es kurzsichtig ist, uns hier auf die Quelle der Inspiration zu beschränken, die durch die oben genannten Gruppen und Kropotkin entwickelt wurden. Wir müssen uns den Wert der Fantasie, die schöpferischen Gedanken, die die ganze Geschichte der Menschheit hindurch schon immer ein wesentliche Kraft für den Fortschritt waren, in einem weitergehenden Rahmen ansehen. Die Menschen leben nämlich auch in einer Welt von Ideen und Idealen, nach denen zu streben in bestimmten Momenten wichtiger sein kann als der Trieb zum Erhalt der unmittelbaren materiellen Lebensumstände. So wurden beispielsweise die sozialdemokratischen Revolutionäre vom revolutionären Aufschwung in Russland 1905 überrascht, überflügelt, hinter sich gelassen und waren verblüfft über das Ungestüme der Bewegung, über ihre neuen Formen und ihre schöpferische Fantasie.
Ein Vorbild für das beharrliche Bemühen, das von Fantasie und Inspiration geleitet wurde, ist das Leben von Leo Tolstoi. Die Quelle seiner Kraft kam aus der Tiefe seiner Persönlichkeit, die ihm den Mut gab, sich unbeirrt auf die Suche nach Wahrheit zu begeben. So wie Rosa Luxemburg 1908 in der Leipziger Volkszeitung schrieb: „… sein ganzes Leben und Schaffen war zugleich ein unermüdliches Grübeln über die ‚Wahrheit‘ im Menschenleben.“ (Tolstoi als sozialer Denker in Luxemburg Werke, Band 2, Seite 246) Tolstoi war ein Forscher und Kämpfer, aber keineswegs ein revolutionärer Sozialist. Trotzdem erfasste er mit seiner Kunst sehr wohl das ganze menschliche Leid und Elend und die ganze menschliche Leidenschaft, alle Schwächen und Gemütslagen, was ihn in die Lage versetzte, bis zum letzten Atemzug mit offenen Augen den sozialen Problemen gegenüberzutreten.
Zyart, 15.01.2014
[1]Arjan de Goede, „Reine Antikapitalisten? Das sind wir vielleicht doch nicht alle“, 2013
[2]Blaise Pascal (1623-1662, Frankreich) war ein Mathematiker, Naturwissenschaftler und Philosoph. In seinem philosophischen Werk Pensées (Gedanken) verteidigt er eine christliche Weltanschauung und thematisiert den menschlichen Geist, die Rede, Moral, Religion und Politik.
[3]Henriette Roland-Holst (1869-1952) war eine bekannte Poetin und Sozialistin/Kommunistin in den Niederlanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Siehe auch das Buch und die Artikel der IKS über die Deutsch-Holländische Kommunistische Linke.
Aktuelles und Laufendes:
- Utopie [578]
Rubric:
Im Dilemma: Die deutsche Bourgeoisie und der Ukraine-Konflikt
- 2126 Aufrufe
Der Konflikt in und um die Ukraine stellt die deutsche Bourgeoisie vor besondere Herausforderungen. Wir möchten dieses Thema hier aus der Sicht der Arbeiterklasse aufgreifen. Es gibt gute Argumente für die Annahme, dass sich für Deutschland und allgemeiner für Westeuropa gegenwärtig eine Veränderung abspielt, die für die zukünftige Konstellation der Kräfte des Klassengegners wichtig wird.
In den letzten Monaten hat es in den Reihen der herrschenden Klasse in Deutschland ungewohnt viel Aufregung um das Verhältnis zu den USA einerseits und zu Russland andererseits gegeben. Während sich Regierung und Opposition in der Außenpolitik der letzten 25 Jahre in den wesentlichen Zügen immer einig gewesen sind – in Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien – tauchen heute angesichts der Offensive Russlands in der Ukraine Dissonanzen auf, die selbst die Regierungskoalition erfassen. Außenminister Steinmeier bemüht sich, die Wogen im Osten zu glätten wie umgekehrt Bundeskanzlerin Merkel diejenigen im Westen – beide sind in der Defensive und dies mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Steinmeier versucht, in der Tradition Schröders die begonnene wirtschaftliche Allianz zwischen Deutschland und Russland trotz der politischen und militärischen Offensive Putins weiter zu verfolgen, während Merkel die alte „Freundschaft“ mit den USA trotz wiederholten Geheimdienstskandalen nicht aufgeben will.
Wir haben im Artikel zur Lage in der Ukraine vom Dezember 2013[1] die Einschätzung vertreten, dass die gegenwärtige Entwicklung der Ereignisse auf einer Offensive Russlands beruht – ein Versuch Russlands, die Niederlage und Demütigung der „Orangenen Revolution“ 2004/05 rückgängig zu machen. Ein halbes Jahr später finden wir diese These bestätigt. Dabei möchten wir insbesondere einige Fragen zu den Konsequenzen für die imperialistischen Gelüste Deutschlands aufwerfen.
Der geschichtliche Rahmen – die Zäsur von 1989
Um die heutige Lage zu verstehen, müssen wir uns zunächst den größeren Rahmen in Erinnerung rufen: Der Zusammenbruch des Ostblocks 1989 führte zu einer qualitativen Veränderung bei den imperialistischen Konflikten. Die NATO blieb zwar als Militärbündnis unter us-amerikanischer Vorherrschaft bestehen, von einem Block im alten Sinn konnte man aber auch im Westen nicht mehr sprechen. Gerade auf dieser Ebene war der vollzogene Übertritt in ein neues Zeitalter des Kapitalismus (dasjenige des Zerfalls) besonders handgreiflich. Die Zentrifugalkräfte dieser dekadenten Gesellschaftsordnung nahmen Überhand. Die Staaten, die sich vorher einer Blockdisziplin unterwerfen mussten, namentlich Deutschland, konnten nun offener ihre eigenen und im Vergleich zum früheren Blockführer divergierenden Interessen verfolgen. Die Kriege auf dem Balkan und die Aufteilung Jugoslawiens gehörten in den 1990er Jahren zu den ersten unmittelbaren Resultaten dieser neuen Ära.
Die ehemaligen Blockführer USA und Russland wurden geschwächt und reagierten beide – mit roher Gewalt. Die USA blieben alleinige Supermacht und Weltpolizist. Im Bemühen darum, diese Rolle nicht in Frage gestellt zu sehen, traten sie ständig aggressiv auf. Aber ihre militärischen Feldzüge, insbesondere in Afghanistan und im Irak bewirkten das Gegenteil von dem, was angeblich beabsichtigt war: mehr Chaos statt Stabilität und Sicherheit (vgl. dazu Obamas eigene Bilanz: „Einige unserer kostspieligsten Fehler entstanden nicht aus unserer Zurückhaltung, sondern aus unserer Bereitschaft, uns in militärische Abenteuer zu stürzen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken.“ – im Artikel „Die Ukraine gleitet in die militärische Barbarei ab“ in dieser Nummer der Zeitung zitiert[2]). Russland umgekehrt musste als Koloss auf tönernen Füßen zuschauen, wie zuerst die Sowjetunion demontiert und dann auch noch die Pufferzonen im Westen (ehemalige Ostblockstaaten, Baltikum) abfielen. Im Nordkaukasus, namentlich in Tschetschenien, stellte sich Russland dem weiteren Auflösungsprozess mit einer Politik der verbrannten Erde entgegen. Die 1990er Jahre waren für den russischen Imperialismus ein Jahrzehnt der Gebietsverluste und der Defensivkämpfe. – Die beiden ehemaligen Blockführer befinden sich also seit 1989 im Sinkflug, wenn auch auf unterschiedlicher Höhe und auf andere Art.
Mit den Kriegen im Irak und in Afghanistan verfolgten die USA eine Umzingelungsstrategie gegenüber Russland. Gleichzeitig versuchten die USA, ihre ehemaligen „Partner“ im westlichen Block durch die Fortsetzung der Militärbündnisse unter Kontrolle zu halten. Gegenüber Deutschland spielt dabei die NATO die wesentliche Rolle. Deutschland ist militärisch zu schwach, um sich von den USA zu emanzipieren. Umso wichtiger ist für die deutsche Außenpolitik die EU und die enge Anlehnung an Frankreich, das zwar längst nicht mehr die „Grande Nation“, aber doch noch eine Atomstreitmacht ist.
Die neue imperialistische Konstellation in Europa führte aber auch dazu, dass deutsche Politiker und Wirtschaftskapitäne die Hände nach Russland ausstreckten, und zwar in langfristigem Kalkül. Aus deutscher Sicht gibt es gute Gründe, gemeinsame Interessen mit Russland auf wirtschaftlichem Gebiet zu verfolgen. Russland verfügt über die nötigen Rohstoffe für die deutsche Industrie und ist ein Absatzmarkt für die von ihr produzierten Waren. Der Export deutscher Güter nach Russland ist zwar vom Umfang her nicht bedeutend, er beträgt weniger als 5% des gesamten Exportgeschäftes des Landes; aber der Handel zwischen den beiden Ländern begünstigt – wie immer im Kapitalismus – auf lange Sicht den wirtschaftlich Stärkeren, und das ist Deutschland. Die deutsche Industrie exportiert Fertigprodukte, namentlich Maschinen; Russland verkauft in umgekehrter Richtung Rohstoffe, vor allem Erdöl und Erdgas.
Auch militärisch-strategisch gibt es gemeinsame Interessen zwischen Deutschland und Russland. Moskau ist militärisch an seiner Westgrenze durch die NATO bedroht. Da die NATO in erster Linie ein Herrschaftsmittel der USA ist und Deutschland seine Vormachtstellung in Europa nur ausbauen kann, wenn der Einfluss der USA eingeschränkt wird, gibt es ein gemeinsames Anliegen für Deutschland und Russland – dass nämlich die NATO nicht noch weiter nach Osten greift. Russland und Deutschland wollen den US-Einfluss möglichst zurückbinden.
In der Außenpolitik spielt auch die Geographie eine wichtige Rolle. Marx hat im 19. Jahrhundert einen Aspekt beleuchtet, der selbst nach allen Katastrophen des 20. Jahrhunderts gerade in Osteuropa immer noch gilt: Russland ist aufgrund seiner geographischen Lage dazu verurteilt, eine Politik in Bezug auf die Mächte Westeuropas zu führen, also eine Europapolitik zu betreiben – obwohl ihm zu einer erfolgreichen Strategie im 19. Jahrhundert die Kräfte fehlten.
Die Triebkräfte in der aktuellen Konstellation
Deutschland verfügt über eine konkurrenzfähige Industrie und hat mittels der EU einen Wirtschaftsraum erhalten und mitgeschaffen, der ihm Zugang zu einem großen, bevölkerungsreichen Absatzmarkt gibt. Der deutsche Imperialismus kann seine Stellung am besten ausbauen, wenn eine von Deutschland dominierte EU gegenüber den USA an Autonomie gewinnt, ohne in neue Abhängigkeiten, z.B. gegenüber Russland, zu geraten.
Russland hat umgekehrt mit dem eingeleiteten Abfall der Ukraine vor 10 Jahren eine Demütigung, einen Eingriff in seine Einflusssphäre hinnehmen müssen, auf den es so bald wie möglich zurück kommen musste. Die Ukraine ist für Deutschland seit dem Ersten Weltkrieg ein immer wieder kehrendes Ziel der Machtgelüste gewesen – der Drang nach Osten, die beiden Weltkriege sind brutale Belege dafür. Trotz veränderter Verhältnisse ist die Kornkammer Ukraine auch heute noch ein wichtiger Faktor im Ringen um Einfluss. Dazu kommt ein etwas veraltetes, aus der Sowjetära stammendes Inventar mit dem entsprechenden Know-how auf dem Gebiet der Weltraum- und Luftfahrttechnologie.
Deutschland will das Dilemma vermeiden, sich in seinen Allianzen entweder für die Ukraine oder für Russland zu entscheiden – aber wenn es sich entscheiden müsste, hat Moskau mehr zu bieten als Kiew. Auf der Erscheinungsebene der aktuellen politischen Praxis sieht man folgende Allianzen: Zur Geburtstagsparty des früheren Bundeskanzlers Schröder im April 2014 war auch Putin eingeladen. Die Party war organisiert von der Pipeline Gesellschaft North-Stream. Diese gehört zu 51 Prozent dem russischen Gasriesen Gazprom (wo Schröder sich verdingt). Die anderen 49 Prozent aber liegen in deutschen, niederländischen und französischen Händen. Der deutsche Energiekonzern E.ON aus Düsseldorf und die zur BASF-Gruppe gehörende Wintershall Holding mit Sitz in Kassel teilen sich zusammen 31 Prozent der Anteile. Die Schlüsselpositionen in dem Unternehmen sind zu einem Großteil mit Deutschen besetzt. Unter den Gästen der Feier waren nach Angaben aus der North-Stream-Zentrale in Berlin unter anderen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) (in Mecklenburg-Vorpommern erreicht die Pipeline deutschen Boden), der deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger Freiherr von Fritsch, der E.ON-Vertriebsvorstand Bernhard Reutersberg und weitere Manager der Nord-Stream-Anteilseigner Wintershall und E.ON. Für Aufregung sorgte die Teilnahme des außenpolitischen Sprechers der CDU und langjährigen JU-Vorsitzender Philipp Mißfelder.
Ebenfalls waren der Siemens-Chef Joe Kaeser und der Bahn-Chef Rüdiger Grube bereits Ende März mit Putin zusammengetroffen.
Hier treffen wir also auf einen potenten Ausdruck vorsichtiger und langjähriger deutsch-russischer Zusammenarbeit, die zu einem Großteil auf politisch-strategische Bemühungen aus der SPD und den Konzernzentralen von systemrelevanten Unternehmen (E.ON, BASF, Siemens, Deutsche Bahn sind rein juristisch gesehen keine Staatsunternehmen) basieren. Der rein politische Ausdruck dieser Tendenz der deutschen Bourgeoisie scheint derzeit eher schwach zu sein, worauf die Anwesenheit des widerlichen Pogromisten Mißfelder auf Schröders Geburtstagsparty hindeutet (bekannt oder besser berüchtigt geworden ist er als JU-Vorsitzender mit der Parole: „alte Leute brauchen keine künstliche Hüfte, sie sind auch früher an Krücken gelaufen“), und dennoch darf diese Tendenz nicht ignoriert werden.
Destabilisierungspolitik Russlands
Diese Fakten und die Entwicklung des Krieges in der Ukraine lassen den folgenden Schluss zu: Russland versucht zielstrebig, die NATO und letztlich auch die EU zu destabilisieren. Dabei geht es augenscheinlich darum, einen Keil in die transatlantische Allianz zwischen Deutschland und die USA zu treiben. Auf dem Hintergrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts, unter Berücksichtigung der strategischen Bedeutung Deutschlands auf dem Kontinent, muss Russland die deutschen gegen die us-amerikanischen Interessen ausspielen. Im Kalten Krieg war die DDR eine zuverlässige Stütze des stalinistischen Imperialismus; die Büros in Berlin mussten zwar geräumt, aber alte Freundschaften können weiter gepflegt oder neue geknüpft werden. Deutschland spielt auf der anderen Seite für das transatlantische Bündnis unter amerikanischer Vorherrschaft eine Schlüsselrolle. Ohne seine Mitgliedschaft in der NATO verliert dieses Militärbündnis strategisch entscheidendes Terrain: In Europa bräche der zentrale Pfeiler ein, das Bollwerk der amerikanischen Militärpräsenz auf diesem (Sub-)Kontinent.
Man kann darüber spekulieren, ob hinter den peinlichen Leaks, welche die westliche Allianz seit Edwards Snowdens Kündigung beim NSA torpedieren, Russland steckt. Obwohl sonst nicht gerade als Asylland bekannt, gewährte Russland in zynischem Kalkül Snowden Gastrecht. Die Spezialisten der russischen Geheimdienste – Putin gehörte zu deren Personal, ist durch diese Schule gegangen – dürften den Fundus des NSA-Überläufers auswerten, auch zur Planung der jeweiligen Schachzüge. Gewisse Details darüber, wie die NSA & Co. deutsche Politiker_innen ausspioniert haben, sind willkommenes Salz in der medialen Suppe. Snowden ist so gesehen ein Trumpf in den Händen Russlands. Allerdings ist zu vermuten, dass beim ganzen Hype um ihn seine Rolle im Sinne der demokratisch üblichen Personalisierung gesellschaftlicher Beziehungen überbewertet wird. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die russische Spionage ohne Snowden wesentlich schwächer wäre.
Militärisch ist Russland ebenfalls am Drücker. Die Arsenale im Südwesten Russlands stehen für all diejenigen offen, die Waffen, auch grobes Geschütz, brauchen, um in den Krieg zu ziehen, in Donezk und Luhansk. Die Proletarier_innen im Osten der Ukraine sind unsäglichem Leid ausgesetzt – fliehen oder versuchen, trotz Pogromstimmung einen Alltag in diesem Sommer zu leben, als sei nichts geschehen. Eine Fliegerabwehrrakete trifft ein Linienflugzeug auf 10‘000 Metern Höhe – mit 298 Menschen an Bord.
Nicht nur beim menschlichen Grauen, sondern auch auf dem strategischen Schachbrett sind neue Tatsachen geschaffen worden. Die Krim als Brückenkopf zu den Weltmeeren ist annektiert – und die Ukraine für die NATO als potentielles Mitglied entwertet. Diese Prozesse finden auf einer materiellen Grundlage statt, die Russland in doppelter Hinsicht in die Hände spielt:
- Die herrschende Tendenz des Jeder gegen Jeden – Ausdruck der entfesselten Zentrifugalkräfte in der Zerfallsphase des Kapitalismus – ist die Welle, die die regierende Klasse um Putin reiten kann. Zersetzend zu wirken ist heutzutage einfach – im Kleinen wie im Großen. (Dass es umgekehrt mit „konstruktiven“ Projekten nicht so einfach ist, beweist Putins Eurasische Union.)
- Russland – ein Koloss auf tönernen Füßen? – Nicht ganz, denn die Bodenschätze, über deren Ausbeutung es das Monopol hat, werden zwar die Rückständigkeit des produktiven Apparats in Russland nicht aufheben, sind aber viel wert: Die Rohstoffe werden sowohl hüben, wo noch produziert, als auch drüben, wo nur noch im Krieg zerstört wird, gebraucht und nachgefragt. Und weil Russland das Monopol über einen so großen Teil der Welt hat wie sonst kein Land, wird die daraus sich ergebende Verfügungsmacht über Erdöl, Gas und andere strategisch wichtige Rohstoffe Sonderprofite durch den Verkauf dieser Waren in die Schatullen des Kremls spülen.
Oder anders gesagt: Da Russland gegenüber Europa nur Ziele verfolgt, die der zersetzenden Logik folgen, hat es heute im Gegensatz zum 19. Jahrhundert die Möglichkeiten, seine Europapolitik, zu der es aufgrund seiner geographischen Lage gezwungen ist, auch tatsächlich umzusetzen. Die Kriegskasse ist voll und wird weiterhin gespiesen.
Deutscher Imperialismus in der Zwickmühle
Der Krieg in der Ukraine läuft den Interessen des deutschen Imperialismus zuwider. Dabei geht es nicht in erster Linie um die wirtschaftlichen Geschäfte, die zu ihrer Entfaltung stabile und „befriedete“ Verhältnisse bräuchten, sondern um die geostrategische Lage für Deutschland: Es kann militärisch weder Russland noch den USA die Stirn bieten. Deutschland braucht zum Ausbau seiner Macht in Europa (und der Welt) eine von ihm kontrollierte Zone zwischen den USA und Russland, eine Art Grauzone, in der es seinen Einfluss vor allem dank der wirtschaftlichen Stärke konsolidieren kann. Der Vorstoß Deutschlands nach Osten ist zwar strategisch konzipiert, beruht aber einstweilen im Wesentlichen auf seiner wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit. Mit dem Krieg in der Ukraine stehen sich aber Russland und die USA (mittels der NATO) in Osteuropa gegenüber – in einem Gebiet, das eigentlich Deutschland als seine Einflusssphäre aufbauen will, jedoch militärisch nicht verteidigen kann.
Die deutsche Bourgeoisie sieht sich also mit einer Situation konfrontiert, die nicht sie geschaffen hat und nicht von ihr kontrolliert werden kann. Die USA arbeiten dabei ebenso bewusst gegen die deutschen imperialistischen Interessen wie Russland. Beide wollen nicht mit verschränkten Armen zuschauen, wie Deutschland „friedlich“ nach Osten vorstößt. In der Ukraine führt Russland der Welt vor Augen, was ein Land zu erwarten hat, das zu seiner Einflusssphäre gehört und sich nach einem neuen Patenonkel umschaut. Die USA auf der anderen Seite schicken Soldaten und Kriegsmaterial nach Polen – bauen ihre Militärpräsenz in Osteuropa aus, ohne das Deutschland etwas dagegen unternehmen kann.
Auf diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass Berlin sowohl gegenüber Washington als auch gegenüber Moskau zurückhaltend ist. Ins Feuer zu blasen, ist aus deutscher imperialistischer Sicht nicht ratsam. Vielmehr sollte der Brand im eigenen Vorgarten möglichst bald wieder gelöscht werden.
Zwei Modelle – beide auf der gleichen Grundlage
Die internationalistische Gruppe Barikád Kollektíva in Ungarn beschreibt in einem Artikel vom Frühjahr 2014 die politische Ausrichtung der herrschenden Klasse in Russland wie folgt:
“Seit Beginn des neuen Jahrtausends hat sich Russland langsam aber sicher zu einer eigenständigen imperialistischen Kraft in der kapitalistischen Weltordnung errichtet. Die „freie Konkurrenz“ der Jelzin-Ära (Privatisierung, Bandenkriege, wirtschaftliche Zersetzung), in welcher die „aufgeklärte“ Bourgeoisie, die erst gerade dem Ei des Sowjetsystems entschlüpft war, sich wie an einer Party fühlte, entlarvte sich als ihr Totentanz. Die feinen bürgerlichen Ideen Chodorkowskis über die Freiheit – welche die vollkommene Unsicherheit für die Existenz der Massen der Arbeiterklasse bedeutete – wurden schnell durch eine viel prosaischere, seit Urzeiten bestens bekannte und somit kalkulierbare Diktatur der Organe der Staatssicherheit beseitigt. Angesichts der harten ökonomischen Tatsachen von steigenden Ölpreisen konnten die Vertreter der Ideologie der formalen Demokratie wählen: entweder Kniefall vor einer staatlich zentralisierten Wirtschaft oder Auswanderung oder in den Knast.“ (April 2014, barricade.hol.es/kialtvanyok/haborut_a_haborunak-en.html, unsere Übersetzung)
Zwei Herrschaftsmodelle stehen sich gegenüber, wobei Russland unter Putin für das eine der beiden steht: „russischer“ Kollektivismus, offener nationaler Chauvinismus, Populismus, plumpe Propaganda, unverschleierte Repression, militärische Logik. Das Gegenmodell ist das des westlichen Liberalismus: Individualismus, Demokratie, Heuchelei, wirtschaftliche Performance – und verschleierte Repression.
Das „russische“ Modell ist in vielen Ländern wegleitend: bei Großen wie China oder bei Kleineren wie Iran, Venezuela, Ecuador, Kuba. Dieses Modell hat auch im Westen seine Anhänger und Parteien, nämlich die Populisten von Rechts bis Links - von Blochers SVP in der Schweiz bis zur Linken in Deutschland. Unterstützer dieser Tendenz sind in Deutschland auch in wirtschaftlich maßgebenden Kreisen zu finden. Es ist auffällig, zu welcher Ambivalenz gegenüber der sogenannten Werteordnung der Westbindung zum ehemaligen Blockführer USA diese Tendenz fähig ist. So wurde beim China-Besuch von Kanzlerin Merkel Anfang Juli 2014 eine Schrift des Deutsch-Chinesischen Beratenden Wirtschaftsausschusses in der Presse lanciert, darin wurde gefordert, dass die deutsche Presse doch wohlwollender über China berichten und nicht so sehr über mangelnde Menschenrechte jammern solle. Auf deutscher Seite sind neben Joe Kaeser (Siemens) auch Martin Brudermüller (BASF), Martin Winderkorn (VW), Martin Blessing (Commerzbank), Thomas Enders (Airbus), Frank Appel (Post), Jürgen Fitschen (Deutsche Bank), Heinrich Hiesinger (Thyssen-Krupp), Carsten Spohr (Lufthansa) und der BDI-Chef Ulrich Grillo in diesem Ausschuss vertreten. Auch wenn einige Tage später behauptet wurde, dies sei ein Arbeitsentwurf, kann man davon ausgehen, dass die Vertreter der versammelten deutschen (Groß-)Bourgeoisie diese Botschaft bewusst lanciert haben.
Die beiden Herrschaftsmodelle schließen sich keineswegs gegenseitig aus. Geschäfte machen lässt sich mit beiden Seiten, auch über die scheinbaren ideologischen Gräben hinweg – Hauptsache, der „Partner“, sei er liberal-global oder autoritär-korporatistisch, ist zahlungsfähig und –willig. Für das Proletariat ist keine Seite besser, denn letztlich gibt es für die Unangepassten hier wie dort nur die harte Hand der Repression (mit ihrem verlängerten Arm der Psychiatrisierung). Die Logik der Profitmaximierung und Entmenschlichung ist gemeinsame Grundlage beider Modelle – für die liberale Variante muss die Anpassung des Menschen an die Maschine aus innerer Überzeugung – nach calvinistischem Vorbild – gelingen, die autoritär-kollektivistische Variante setzt auf die Zurichtung durch äußere Gewalt.
KH, 02.08.14
[1] Russlands Offensive gegen seine Großmachtrivalen, https://de.internationalism.org/weltrevolution/201402/2432/russlands-off... [579]
[2] Dieses Dilemma der USA haben wir bereits vor dem zweiten Irak-Krieg analysiert, vgl. „Die Barbarei des Krieges im Irak: die bürgerliche Gesellschaft in ihren wahren, nackten Gestalt“, Internationale Revue Nr. 31, Frühjahr 2003
Rubric:
Russlands Offensive gegen seine Großmachtrivalen
- 3055 Aufrufe
Seit dem 21. November vergangenen Jahres erlebt die Ukraine eine politische Krise, die wie die so genannte „Orangene Revolution“ von 2004 ausschaut. Wie 2004 liegt sich die pro-russische Fraktion mit der Opposition, den ausgewiesenen Anhängern einer „Öffnung zum Westen“, in den Haaren. Wie damals verschärfen sich die diplomatischen Spannungen zwischen Russland und den Ländern der Europäischen Union sowie den USA.
Dennoch ist dieses Remake keine simple Kopie. 2004 entzündete die Ablehnung von offensichtlich manipulierten Wahlen die Lunte; heute ist es die Ablehnung des Assoziationsabkommens, das von der EU unterbreitet wurde, durch Präsident Janukowitsch, die am Anfang der Krise stand. Dieser Streitfall mit der EU eine Woche vor dem geplanten Datum für die Unterzeichnung des Abkommens provozierte eine gewaltsame Anti-Regierungs-Offensive der verschiedenen pro-europäischen Fraktionen der ukrainischen Bourgeoisie, die von „Hochverrat“ sprachen und den Rücktritt des Präsidenten forderten. Nach dem Aufruf an „das gesamte Volk, darauf zu antworten, als sei es ein Staatsstreich, d.h. auf die Straße zu gehen“[1], besetzten die Demonstranten das Stadtzentrum von Kiew und zelteten auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem symbolischen Zentrum der orangenen Revolution. Die brutale Repression, die Konfrontationen mit ihrer großen Anzahl von Verletzten veranlassten den Premierminister Mykola Asarow zur Erklärung, dass „das, was sich derzeit ereignet, alle Anzeichen eines Staatsstreichs hat“, und zur Organisierung von Gegendemonstrationen. Wie 2004 veranstalteten die Medien in den großen demokratischen Ländern eine Menge Lärm über den Willen des ukrainischen Volkes, sich selbst von der Moskau-gestützten Clique, die sich derzeit an der Macht befindet, zu befreien. Die Fotos und Berichte stellen nicht so sehr die Perspektive der Demokratie in den Vordergrund, sondern die gewaltsame Unterdrückung durch die pro-russische Fraktion, die Lügen Russlands und das Diktat Putins. Die Hoffnung auf ein besseres, freieres Leben wird nicht mehr mit der Perspektive eines Wahlsiegs durch die Opposition verknüpft, die sich heute in der Minderheit befindet, anders als 2004, als Viktor Juschtschenkos Wahlsieg eine todsichere Wette war.
Ukraine: ein imperialistischer Preis
2005 schrieben wir in Bezug auf die Orangene Revolution:
„Hinter den Kulissen dreht sich die wesentliche Frage nicht um den Kampf für Demokratie. Der wirkliche Streitpunkt ist die stetig zunehmende Konfrontation unter den Großmächten, insbesondere die gegenwärtige US-Offensive gegen Russland, die darauf abzielt, die Ukraine aus der russischen Einflusssphäre herauszubrechen. Es ist bemerkenswert, dass Putin seinen Zorn im Wesentlichen gegen die USA richtete. In der Tat sind es die USA, die versuchen, ‚die Vielfalt der Zivilisation durch die Prinzipien einer unipolaren Welt, dem Äquivalent eines Erziehungslagers, umzugestalten‘, und ‚eine Diktatur in den internationalen Angelegenheiten (durchzusetzen), die sich mit hübsch klingendem, pseudo-demokratischen Wortgeklingel schmückt‘. Putin schreckte nicht davor zurück, den USA die Realität ihrer eigenen Lage im Irak ins Gesicht zu schleudern, als er am 7. Dezember in Moskau gegenüber dem irakischen Premierminister darauf hinwies, dass es ihm rätselhaft sei, ‚wie es möglich ist, Wahlen im Kontext einer totalen Okkupation durch ausländische Truppen zu organisieren‘! Mit derselben Logik widersetzte sich der russische Präsident der Erklärung der 55 Länder der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa), mit der der derzeit stattfindende Prozess in der Ukraine unterstützt und die Rolle der Organisation bei der Überwachung des Prozederes der dritten Runde in den Präsidentschaftswahlen am 26. Dezember bestätigt wurde. Die Demütigung, die die ‚internationale Gemeinschaft‘ Putin zufügte, indem sie sich weigerte, seinen eigenen Hinterhof anzuerkennen, wird von der Tatsache verschlimmert, dass etliche Hundert Beobachter nicht nur aus den USA, sondern auch aus Großbritannien und Deutschland entsendet werden.
Spätestens seit dem Zusammenbruch der UdSSR und der katastrophalen Konstituierung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (die die Krümel seines Ex-Imperiums retten sollte) standen Russlands Grenzen pausenlos unter Beschuss, sowohl wegen des Drucks aus Deutschland und den USA als auch wegen der ihm inhärenten zentrifugalen Tendenzen. Die Entfesselung des ersten Tschetschenien-Krieges 1992, schließlich der zweite 1996 unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terrorismus drücken die Brutalität einer Großmacht im Niedergang aus, die versucht, ihre strategisch wichtigen Positionen im Kaukasus koste-es-was-es-wolle abzusichern. Für Moskau war der Krieg eine Gelegenheit, sich Washingtons Plänen, die auf die Destabilisierung Russlands abzielen, und jenen Berlins zu widersetzen, das eine unleugbare imperialistische Aggressivität an den Tag legt, wie wir im Frühjahr 1991 sehen konnten, als Deutschland eine Hauptrolle bei der Explosion des Jugoslawien-Konfliktes spielte.
Die Kaukasus-Frage ist also alles andere als gelöst, weil die USA entschlossen damit fortfahren, ihre eigenen Interessen in diesem Gebiet zu fördern. In diesem Zusammenhang ist auch die Vertreibung Schewardnadses aus dem Präsidentenamt im Jahr 2003 verstehen, der von einer pro-amerikanischen Clique ersetzt wurde. Dies erlaubte den USA, ihre Truppen in diesem Land zu stationieren, zusätzlich zu jenen, die bereits in Kirgisistan und Usbekistan im Norden von Afghanistan stationiert worden waren. Dies stärkt die militärische Präsenz der USA im Süden von Russland und bedroht es mit einer Einkreisung durch die USA. Die ukrainische Frage war immer eine Schlüsselfrage gewesen, ob in der Zeit des zaristischen Russland oder in Sowjetrussland, doch heute stellen sich die Probleme auf eine weitaus kritischere Weise.
Auf der wirtschaftlichen Ebene ist die Partnerschaft zwischen der Ukraine und Russland von großer Bedeutung für Moskau, doch vor allem auf militärstrategischer Ebene ist die Kontrolle der Ukraine von noch größerer Bedeutung als der Kaukasus. Dies daher, weil die Ukraine zunächst einmal die drittgrößte Nuklearmacht auf der Welt ist, dank der militärischen Atombasen, die sie aus der Zeit des Ostblocks geerbt hatte. Moskau braucht sie, um im Kontext der interimperialistischen Erpressungen seine Fähigkeit zu demonstrieren, die Kontrolle über solch eine große Nuklearmacht auszuüben. Zweitens, neben dem Verlust jeglichen direkten Zugangs zum Mittelmeerraum würde der Verlust der Ukraine auch die Möglichkeit eines Zugangs zum Schwarzen Meer für Moskau schmälern. Mit dem Verlust des Zugangs zum Schwarzen Meer einschließlich Sewastopol, wo Russland Nuklearbasen unterhält und ein Teil seiner Flotte stationiert hat, steht die Verbindung zur Türkei und nach Asien zu auf dem Spiel. Hinzu kommt, dass der Verlust der Ukraine die russische Position gegenüber den europäischen Mächten und insbesondere gegenüber Deutschland dramatisch schwächen würde, während es gleichzeitig seine Fähigkeit einschränken würde, eine Rolle in Europas künftigem Schicksal und jenem der osteuropäischen Länder zu spielen, von denen die Mehrheit bereits pro-amerikanisch ist. Es gilt als gewiss, dass eine Ukraine, die sich dem Westen zuwendet und daher von ihm und insbesondere von den USA kontrolliert wird, ein Licht auf das völlige Unvermögen Russlands werfen und eine Beschleunigung der Zerfallserscheinungen in der GUS anregen würde, mit all ihren schrecklichen Folgen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass solch eine Situation ganze Gebiete Russlands selbst nur dazu drängen würde, ihrerseits, und ermutigt von den Großmächten, die Unabhängigkeit zu erklären.“[2]
Der große Unterschied zwischen heute und 2004 ist das Resultat aus der Schwächung der USA, die durch ihre fortlaufenden militärischen Abenteuer besonders im Nahen und Mittleren Osten beschleunigt wurde. Der Rückzug Russlands von der internationalen Bühne ist andererseits besonders durch den russisch-georgischen Krieg 2008 verlangsamt worden. Dieser Konflikt kehrte die Tendenz zu einer Annäherung zwischen Georgien und der EU um, was auch die Ukraine anstrebt. Während also die erste „Revolution“ eine Offensive der USA gegen Russland gewesen war, ist die zweite allem Anschein nach eine Gegenoffensive Russlands. Es war Präsident Janukowitsch, der durch die Annullierung des Assoziationsabkommens mit der EU zugunsten einer „Dreierkommission“ einschließlich sowohl der EU als auch Russlands die Feindseligkeiten entfachte. Das anfangs angestrebte Abkommen hätte die Etablierung einer Freihandelszone ermöglicht, die am Ende den Beitritt der Ukraine in die EU durch die Hintertür und somit ihre Annäherung an die NATO bedeutet hätte. Diese Versuche einer Annäherung an die EU wurden von Moskau als eine Provokation betrachtet, deren Ziel es war, die Ukraine seinem Einfluss zu entziehen. Die Lage in der Ukraine wurde im Wesentlichen von diesen imperialistischen Konflikten bestimmt.
Der unmittelbare Ursprung dieser neuen Krise kann auf den Druck zurückgeführt werden, der von Russland und den Westmächten auf die ukrainische Bourgeoisie ausgeübt wurde, nachdem die pro-russische Fraktion in den Wahlen von 2010 an die Macht gelangt war. Seither bot sich Angela Merkel als Vermittlerin in den Verhandlungen über die Gasverträge an, die von der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko in Moskau 2009 unterzeichnet worden waren. Doch Moskau lehnte umgehend dieses Angebot ab und hinderte so die Europäer daran, ihre Nase in die russisch-ukrainischen Angelegenheiten zu stecken.
Drei Monate vor dem Wilna-Gipfel, der seinen Höhepunkt in der Unterzeichnung des Abkommens zwischen der Ukraine und der EU finden sollte, setzte Russland eine erste Warnung in den Umlauf, indem es seine Grenzen gegenüber ukrainischen Exporte schloss. Eine Reihe von Sektoren, einschließlich der Stahlindustrie und des Turbinenbaus, wurden in Folge dessen in Mitleidenschaft gezogen. Die Ukraine verlor fünf Milliarden Dollar in diesem Geschäft; 400.000 Arbeitsplätze standen auf dem Spiel, zusammen mit zahllosen Unternehmen, die allein für den russischen Markt produzieren. Moskau griff auch zu folgender Erpressung: Wenn die Ukraine nicht der Gemeinsamen Union rund um Russland beitritt, würde der Kreml die anderen Mitglieder dieser Union dazu aufrufen, ebenfalls ihre Grenzen zu schließen.[3]
Die mannigfaltigen Cliquen der ukrainischen Bourgeoisie sind unter diesem Druck tief gespalten worden. Gewisse Oligarchen, wie Rinat Achmetow, haben sich gegen eine Unterzeichnung des Wilna-Abkommens gewandt. Im Augenblick wartet jedermann das Ergebnis ab. Die Pro-EU-Oligarchen, aber auch jene, die Russland nahestehen, fürchten sich vor exklusiven Beziehungen zu Moskau. Sie möchten so lange wie möglich an der „neutralen“ Position der Ukraine festhalten und die Stabilität der Ukraine bis zu den nächsten Wahlen gewährleisten, um eine Konfrontation mit Russland hinauszuschieben. Der Anschluss der Ukraine an die imperialistische Politik Russlands wird also nicht akzeptiert, auch nicht von der pro-russischen Fraktion.
Auf der anderen Seite ist der Druck aus der EU nicht ohne eigene Widersprüche. Das Hauptabsatzgebiet der ukrainischen Industrie und Landwirtschaft sind die Länder der früheren Sowjetunion. Die Ukraine exportiert so gut wie nichts in die EU-Länder, die dabei sind, ein Freihandelsabkommen für Waren zu unterzeichnen, die schlicht nicht existieren! Für ukrainische Waren, die mit dem europäischen Standard mithalten können, müsste die Industrie rund 160 Milliarden Dollar in den Produktionsapparat investieren.
Für die westlichen Mächte ist die Ukraine hauptsächlich als zusätzliche Einflusssphäre von Interesse. Zwischen der Ukraine und Russland gibt es praktisch keine Zollschranken – es gibt lediglich einige wenige Zollabgaben. Somit wird sowohl aus Sicht Moskaus als auch aus Sicht des Westens das Abkommen auf die Öffnung Russlands für westliche Waren hinauslaufen. Natürlich ist dies für Russland nicht akzeptabel.
Die Arbeiterklasse darf nicht auf die demokratische Lüge hereinfallen
Die Ukraine ist von den Widersprüchen zwischen seinen ökonomischen Interessen und dem imperialistischen Druck betroffen. Diese Sackgasse untergräbt den Zusammenhalt zwischen ihren mannigfaltigen bürgerlichen Fraktionen und drängt Letztere, insbesondere aber die Opposition zu einem irrationalen Verhalten. Während die Regierungspartei mehr oder weniger für die „Neutralität“ der Ukraine ist, versucht die Opposition der Bevölkerung die Illusion eines Lebensstandards zu verkaufen, der mit dem der Europäer vergleichbar wäre, wenn die Ukraine das Abkommen mit der EU unterzeichnete. Doch ihre heterogene Zusammensetzung hat jeglicher politischen Perspektive ihren Stempel aufgedrückt. Die klarste Analyse[4], die grundsätzlich zugunsten einer europäischen Orientierung der Ukraine ist, macht daraus keinen Hehl:
„Falls diese Opposition die Macht übernähme, sehe ich durchaus nicht, wie dies für eine Opposition ausgeht, die von einem Boxer angeführt wird, der zwar leutselig genug sein wird, aber nicht in der Lage ist, eine Regierung zu führen. Dann gibt es als nächste Persönlichkeit die Timoschenko und ihr Team, und jeder weiß, dass dies ein Mafia-Team von der Pike auf ist. Es gibt in der Tat große Fragen über die finanzielle Integrität dieses Teams – deshalb befindet sie sich im Gefängnis. Schließlich gibt es als dritte Komponente die Nazis.[5] Also Nazis plus inkompetente Leute – es wäre eine Katastrophe. Es wäre eine Regierung wie in gewissen Staaten Afrikas.“ Hier wird die Tatsache bestätigt, dass das „Gebiet, wo sich der Zerfall der kapitalistischen Gesellschaft am spektakulärsten ausdrückt, (…) das der militärischen Konflikte und der internationalen Beziehungen im Allgemeinen“ ist.[6]
Der ideologische Einfluss der verschiedenen Fraktionen des politischen Apparates wird von den Widersprüchlichkeiten der Lage unterminiert. Die Arbeitsteilung, wie sie in den entwickelteren demokratischen Ländern üblich ist, funktioniert hier nicht sehr gut. Doch dies heißt nicht, dass die demokratische Mystifikation nicht gegen die Arbeiterklasse in der Ukraine wie auch auf internationaler Ebene benutzt wird. Auch hier haben wir es mit einem angeblichen Kampf zwischen Demokratie und Diktatur zu tun. Die Bourgeoisie ist auch sehr wohl in der Lage, auf der nationalistischen Klaviatur zu spielen, die in der Ukraine so gepriesen wird. Die Appelle zugunsten der Interessen der „ukrainischen Nation“, mit der die pro-russische Fraktion hausieren geht, treffen angesichts der vielen Nationalflaggen auf ein Echo in den Demonstrationen.
Die „orangene Welle“ von 2004 war das Resultat aus den Spaltungen innerhalb der herrschenden Klasse, die die Position von Viktor Janukowitsch schwächte.[7] Ihm entglitt zunehmend die Kontrolle über den Staatsapparat. Der Erfolg seines Rivalen, Juschtschenko, war zu einem großen Umfang aufgrund der Paralyse der zentralstaatlichen Autorität, aber auch wegen Juschtschenkos Fähigkeit zustande gekommen, sich die offiziellen Werte des Regimes von Leonid Kutschma zunutze zu machen: Nationalismus, Demokratie, den Markt und die so genannte „europäische Option“. Juschtschenko wurde zum „Retter der Nation“ und Subjekt eines Personenkultes. Die Ideologie der „orangenen“ Bewegung unterschied sich in keiner Weise von den Mystifikationen, die die Bourgeoisie benutzt hatte, um der Bevölkerung 14 Jahre lang das Gehirn zu waschen. Die Massen, die Viktor Juschtschenko unterstützten oder Janukowitsch stützten, waren nur die Bauern auf dem Schachbrett, die von unterschiedlichen bürgerlichen Fraktionen im Interesse dieser oder jener imperialistischen Option manipuliert wurden. Heute ist die Situation in dieser Frage nicht anders, die „demokratische Wahl“ ist nur eine Falle.
Aber dieselbe Timoschenko, Heldin der Demokratie und der Orangenen Revolution, zeichnet für einen 15-Milliarden-Dollar-Kredit des IWF verantwortlich, der nach „harten“, dreimonatigen Verhandlungen zustande kam. Im Anhang dieses Abkommens steht, was sie für die Arbeiterklasse in der Ukraine „herausgeschlagen“ hat: Anhebung des Renteneintrittsalters, die Erhöhung von Kommunalsteuern, der Strom- und Wasserpreise, etc.
Trotz ihrer Uneinigkeit über die imperialistischen Optionen haben die unterschiedlichen politischen Fraktionen der Bourgeoisie, von der Rechten bis zur Linken, keine andere Perspektive, als die Arbeiterklasse in die Armut zu treiben. Zugunsten dieses oder jenen politischen Clans an den Wahlen teilzunehmen führt zu keinem Nachlassen in den Angriffen. Vor allem werden die ArbeiterInnen, wenn sie sich hinter einer politischen Fraktion der Bourgeoisie und hinter demokratischen Slogans einordnen, ihre Fähigkeit verlieren, auf ihrem eigenen Klassenterrain zu kämpfen.
Die Ukraine und all die Haie, die um sie herum schwimmen, sind ein Ausdruck der Realität eines kapitalistischen Systems, das am Ende seines Lateins ist. Die Arbeiterklasse ist die einzige Klasse, die sich diesem System radikal widersetzen kann. Sie muss vor allem ihre eigene historische Perspektive vertreten und gegen all die Kampagnen kämpfen, die darauf abzielen, sie für die Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden bürgerlichen Cliquen, eine auswegloser als die andere, zu mobilisieren. Die proletarische Revolution stellt sich nicht einer spezifischen bürgerlichen Clique zugunsten einer anderen entgegen, sondern ist gegen das gesamte System - den Kapitalismus.
Sam, 22.12.13
[1]Appell von Julia Timoschenko, Oberhaupt des zwischen 2005 und 2009 an der Macht befindlichen Clans, aus dem Gefängnis.
[3]Kasachstan, Weißrussland und Armenien, die zusammen mit Russland den größten Absatzmarkt bilden.
[4]Siehe das Interview mit Iwan Blot mit The Voice of Russia über die ukrainische Opposition.
[5]Die Svoboda-Partei (Freiheitspartei) wird formell National-Sozialistische Partei der Ukraine genannt, historisch stammt sie von der Organisation der ukrainischen Nationalisten ab, deren bewaffneter Arm (die UPA) während des Zweiten Weltkrieges aktiv mit den Nazis kollaborierte und die Juden Galiziens in der Westukraine massakrierte.
[6]Resolution zur internationalen Lage vom 20. Kongress der IKS: https://en.internationalism.org/ir/126_authoritarian_democracy [581].
[7]Siehe ”Ukraine, the authoritarian prison and the trap of democracy”:
Aktuelles und Laufendes:
- Ereignisse in Ukraine [582]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [583]
Rubric:
Sozialismus oder Barbarei! Vor 100 Jahren: Ausbruch des Ersten Weltkrieges
- 1688 Aufrufe
Der Ausbruch des Krieges am 4. August 1914 war für die Bevölkerung Europas und vor allem für die Arbeiterklasse keine Überraschung. Schon seit Jahren, seit Beginn des Jahrhunderts, hatten sich Spannungen und Krisen einander abgelöst: die Marokkokrisen von 1905 und 1911, die Balkankriege 1912-13, um nur die gravierendsten zu nennen. Hinter diesen Krisen standen als Akteure die Großmächte, welche alle dem Aufrüstungswahn verfallen waren: Deutschland startete ein gigantisches Kriegsschiff-Bauprogramm, auf das Großbritannien antworten musste. Frankreich führte den dreijährigen Militärdienst ein und finanzierte mit enormen Krediten die Modernisierung der Eisenbahnen Russlands zum Transport von Truppen an die deutsche Grenze sowie die Modernisierung der serbischen Armee. Russland lancierte nach dem Debakel des russisch-japanischen Krieges von 1905 ein Reformprogramm für seine Armee. Im Gegenteil zu dem, was die heutige Propaganda über die Kriegsursachen behauptet, wurde der Erste Weltkrieg emsig vorbereitet, ja die herrschende Klasse in allen großen Staaten dürstete geradezu danach.
Auch wenn er keine Überraschung war, für die Arbeiterklasse war er dennoch ein furchtbarer Schock. Zweimal, in Stuttgart 1907 und Basel 1912, hatten die sozialistischen Bruderparteien der Zweiten Internationale sich feierlich zu den internationalistischen Prinzipien, zur Verweigerung der Kriegsmobilisierung der Arbeiter für den Krieg und zum Widerstand mit allen Mitteln bekannt. Der Kongress von Stuttgart nahm einen Änderungsantrag - der von der Linken um Lenin und Luxemburg vorgeschlagen wurde – als Entwurf einer Resolution über die imperialistische Politik an: „Falls der Krieg dennoch ausbrechen sollte, sind sie (die sozialistischen Parteien) verpflichtet, für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit allen Kräften dahin zu streben, um die durch den Krieg herbeigeführte wirtschaftliche und politische Krise zur politischen Aufrüttelung der Volksschichten und zur Beschleunigung des Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft auszunutzen.“ Jean Jaurès, der große Redner des französischen Sozialismus, sagte auf demselben Kongress: „Die parlamentarische Aktion ist in keiner Weise genügend (…) Unsere Gegner werden vor den unberechenbaren Kräften des Proletariats zurückschrecken. Wir, die wir mit Stolz den Bankrott der Bourgeoisie ausgerufen haben, werden es nicht zulassen, dass sie vom Bankrott der Internationale sprechen.“ Auf dem Kongress der französischen Sozialistischen Partei in Paris im Juli 914 trat Jaurès für die Annahme einer Resolution ein, in der stand: „Der Kongress erachtet als besonders wirksames Mittel den Generalstreik, gleichzeitig und international in den betroffenen Ländern organisiert, sowie die Agitation und öffentliche Aktion zur Verhinderung des Krieges in der aktivsten Form und mit allen Mitteln.“
Doch im August 1914 brach die Internationale zusammen, oder genauer gesagt, sie löste sich auf, indem alle Parteien, die sie gebildet hatten (mit der löblichen Ausnahme der russischen und serbischen Parteien) den proletarischen Internationalismus - ihr raison d‘etre – verrieten, dies alles im Namen der Verteidigung des „bedrohten Vaterlandes“ und - der „Kultur“. Bereit, Millionen von Menschenleben auf den Schlachtfeldern zu opfern, präsentierten sich alle Bourgeoisien als Verteidiger der Zivilisation und Hochkultur, während der Gegner die blutdurstige Bestie war, verantwortlich für alle Gräueltaten.
Wie war eine solche Katastrophe möglich geworden? Wie konnten sich jene, die noch Tage zuvor gegen den Krieg aufgetreten waren, den die Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung ihrer Herrschaft sucht, widerstandslos in den Heiligen Bund mit dem Klassenfeind, in die Politik des Burgfriedens fügen?
Von allen Parteien der Internationale trug die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) die gewichtigste Verantwortung. Dies zu sagen bedeutet aber keineswegs eine Entschuldigung für alle anderen Parteien, insbesondere nicht für die französische sozialistische Partei. Dennoch: die SPD galt als das Kronjuwel der Internationalen, erschaffen vom Proletariat. Mit mehr als einer Million Mitgliedern und mehr als 90 regelmäßigen Publikationen war die SPD mit Abstand die stärkste und bestorganisierte Partei der Internationalen. Die Artikel, die in ihrem theoretischen Organ Neue Zeit erschienen, waren zentraler Bezugspunkt für die marxistische Theorie, und Karl Kautsky, Chefredakteur des SPD-Organs Neue Zeit, war der allseits anerkannte „Papst des Marxismus“. Rosa Luxemburg hatte dazu geschrieben: “Sie hat durch zahllose Opfer der unermüdlichen Kleinarbeit die stärkste und mustergültige Organisation ausgebaut, die größte Presse geschaffen, die wirksamsten Bildungs- und Aufklärungsmittel ins Leben gerufen, die gewaltigsten Wählermassen um sich geschart, die zahlreichsten Parlamentsvertretungen errungen. Die deutsche Sozialdemokratie galt als die reinste Verkörperung des marxistischen Sozialismus. Sie hatte und beanspruchte eine Sonderstellung als die Lehrmeisterin und Führerin der zweiten Internationale“ (Die Krise der Sozialdemokratie – auch als Junius-Broschüre bekannt).
Die SPD war Modell, an dem sich all die Anderen orientierten, sogar die Bolschewiki in Russland. „In der zweiten Internationale spielte der deutsche ‚Gewalthaufen‘ die ausschlaggebende Rolle. Auf den Kongressen, in den Sitzungen des Internationalen Sozialistischen Büros wartete alles auf die deutsche Meinung. Ja, gerade in den Fragen des Kampfes gegen den Militarismus und den Krieg trat die deutsche Sozialdemokratie stets entscheidend auf. ‚Für uns Deutsche ist dies unannehmbar‘, genügte regelmäßig, um die Orientierung der Internationale zu bestimmen. Mit blindem Vertrauen ergab sie sich der Führung der bewunderten mächtigen deutschen Sozialdemokratie: diese war der Stolz jedes Sozialisten und der Schrecken der herrschenden Klassen in allen Ländern.“ (ebenda).
Es oblag also der deutschen Partei, die Beschlüsse von Stuttgart zum Widerstand gegen den Krieg in die Tat umzusetzen.
Doch an diesem Schicksalstag des 4. August 1914 reihte sich die SPD ein in die Parade der bürgerlichen Parteien im Reichstag, die den Kriegskrediten zustimmten. Von einem Tag auf den anderen sah sich die Arbeiterklasse in allen Krieg führenden Ländern entwaffnet, d.h. ohne Organisation, denn ihre Parteien und Gewerkschaften waren zur Bourgeoisie übergelaufen und von nun an die wichtigsten Organisatoren nicht des Widerstands gegen den Krieg, sondern umgekehrt der Militarisierung der Gesellschaft für den Krieg.
Ein Bestandteil der heutigen Legendenbildung ist die Aussage, dass die ArbeiterInnen in einer gewaltigen Welle des Patriotismus vom Rest der Bevölkerung mitgerissen worden seien. Die Medien verbreiten gerne die Bilder der zur Front aufbrechenden Truppen, in deren Gewehrläufe Blumen steckten. Wie viele andere Legenden hat auch diese nur wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Unbestreitbar gab es Demonstrationen nationalistischer Hysterie, doch diese waren in erster Linie getragen vom kleinbürgerlichen und studentischen Milieu der kriegstrunkenen Jugend. Immerhin demonstrierten in Frankreich und Deutschland im Juli 1914 Hundertausende von ArbeiterInnen gegen den Krieg – erst der Verrat ihrer Organisationen machte sie kraft- und machtlos.
In Tat und Wahrheit vollzog sich der Verrat der SPD nicht über Nacht, vielmehr wurde er schon länger vorbereitet. Die Stärke der SPD bei den Wahlen verschleierte ihre politische Schwäche, oder besser gesagt: eben jene Stärke der SPD an den Wahlurnen und die organisatorische Macht der deutschen Gewerkschaften bewirkten die Schwäche der SPD als revolutionäre Partei. Die lange Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und der relativen politischen Freiheit, die auf die Abschaffung des Sozialistengesetzes und die Legalisierung der sozialistischen Parteien in Deutschland 1890 folgte, überzeugte schließlich die parlamentarischen und gewerkschaftlichen Anführer von der Idee, dass der Kapitalismus in ein ruhigeres Fahrwasser gelangt sei, wo die inneren Widersprüche aufgehoben seien und der Sozialismus nicht mehr durch eine revolutionäre Massenerhebung, sondern durch einen allmählichen Prozess parlamentarischer Reformen erreicht werden könne. Wahlen zu gewinnen wurde in dieser Logik das Hauptziel der politischen Tätigkeit der SPD, und dementsprechend erhielt die parlamentarische Fraktion ein immer größeres Gewicht in der Gesamtpartei. Das Problem bestand darin, dass die ArbeiterInnen selbst, trotz aller Versammlungen und Demonstrationen während der Wahlkampagnen, nicht als Klasse teilnahmen, sondern als voneinander isolierte Individuen, Seite an Seite mit den Individuen anderer Klassen – deren Vorurteile demokratisch zu akzeptieren sind. So führte die Reichsregierung unter dem Kaiser anlässlich der Wahlen 1907 eine Kampagne für eine aggressive Kolonialpolitik, und die SPD, die sich bis dahin militärischen Abenteuer entgegengestellt hatte, erlitt empfindliche Sitzverluste im Reichstag. Die Führer des SPD und insbesondere die Parlamentsfraktion zogen daraus den Schluss, dass man die patriotischen Gefühle nicht offen verletzen dürfe, und so widersetzte sich die SPD (insbesondere auf dem Kongress 1910 in Kopenhagen) gegen jeden Versuch innerhalb der Zweiten Internationalen, konkrete Maßnahmen zu diskutieren, die im Falle eines Kriegsausbruchs zu ergreifen wären.
Die Führer und der Apparat der SPD entwickelten sich inmitten einer bürgerlichen Welt und übernahmen von dieser immer mehr die Geisteshaltung. Der revolutionäre Elan, der ihre Vorfahren 1870 zur Anprangerung des französisch-preußischen Kriegs verpflichtet hatte, war bei den Parteiführern in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg verflogen – oder schlimmer noch: er war als gefährlich verpönt, da er die Partei ja der Repression aussetzen könnte. Im Jahr 1914 schließlich verbarg sich hinter der eindrücklichen Fassade der SPD nur noch „eine radikale Partei wie die anderen“. Die Partei übernahm den Blickwinkel der Bourgeoisie, sie stimmte den Kriegskrediten zu, und nur noch eine kleine linke Minderheit hielt am Widerstand gegen das Debakel fest. Diese gejagte, eingesperrte, verfolgte Minderheit war der Keim der späteren Gruppe Spartakus, die 1919 an der Spitze der Deutschen Revolution stand und als KPD deutsche Sektion der neuen Internationalen wurde.
Es ist beinahe banal zu sagen, dass wir immer noch im Schatten des Krieges von 1914-18 leben. Dieser Krieg stellt den Zeitpunkt dar, in dem der Kapitalismus den Planeten eingenommen und unterworfen hat, mit der Vereinnahmung der ganzen Menschheit in einen einzigen Weltmarkt, welcher das Objekt der Begierde der verschiedenen Mächte war und ist. Ab 1914 beherrschten Imperialismus und Militarismus die Produktion; der Krieg wurde zu einer weltweiten und dauerhaften Erscheinung. Seither droht der Kapitalismus die ganze Menschheit in den Abgrund zu stürzen!
Die Entfachung des Ersten Weltkrieges war nicht unvermeidlich. Wenn die Internationale ihre Pflicht erfüllt hätte, hätte sie zwar vielleicht nicht den Krieg verhindern, aber dafür den Arbeiterwiderstand dagegen beleben können, der wenig später tatsächlich stattfand. Sie hätte ihm eine politische und revolutionäre Richtung geben und so den Weg eröffnen können, zum ersten Mal in der Geschichte eine Weltgemeinschaft ohne Klassen und Ausbeutung zu schaffen sowie dem Elend und den Grausamkeiten ein Ende zu bereiten, die der imperialistische und dekadente Kapitalismus dem Menschengeschlecht aufoktroyiert hat. Dabei handelt es sich nicht um einen frommen und abstrakten Wunsch; vielmehr beweist die Russische Revolution, dass die Revolution nicht bloß notwendig, sondern auch möglich ist. Denn es war in der Tat diese außergewöhnliche Erstürmung des Himmels durch die Massen, dieser gewaltige proletarische Elan, der die internationale Bourgeoisie erschauern ließ und sie zur vorzeitigen Beendigung des Krieges zwang. Krieg oder Revolution, Barbarei oder Sozialismus, 1914 oder 1917: die Wahl, vor der die Menschheit stand, konnte nicht deutlicher sein!
Die Skeptiker werden einwenden, dass die Russische Revolution isoliert geblieben und schließlich unter der stalinistischen Konterrevolution erstickt worden sei. Sie werden hinzufügen, dass auf 1914-18 1939-45 gefolgt sei. Das trifft absolut zu. Aber wenn man falsche Schlussfolgerungen vermeiden will, muss man die Ursachen verstehen, sich fragen, warum es geschehen ist, und nicht einfach die offizielle Dauerpropaganda schlucken. Die revolutionäre Welle begann 1917 zu einem Zeitpunkt, als die Gräben des Krieges noch tief waren. Diese Schwierigkeiten führten zu einer Heterogenität im Proletariat, die durch die herrschende Klasse ausgenutzt wurde, um die Arbeiterklasse zu schlagen. Konfus und orientierungslos, konnte sich das Proletariat nicht in einer breiten internationalen Bewegung vereinen. Es blieb gespalten in die beiden Lager der „Sieger“ und „Verlierer“. Die heroischen revolutionären Aufstände, wie jener in Deutschland 1919, konnten in der Folge niedergeschlagen und in ihrem Blut ertränkt werden, insbesondere dank der Judasdienste der großen Arbeiterpartei, der Sozialdemokratie. Diese Isolierung erlaubte es der internationalen Bourgeoisie, ihr Verbrechen zu vollenden, die Russische Revolution zu vernichten, um ein zweites weltweites Abschlachten vorzubereiten – und uns daran zu erinnern, dass die einzige geschichtliche Alternative immer noch gültig ist: „Sozialismus oder Barbarei“!
Jens, 30. Juni 2014
Rubric:
Stellungnahme zu Eurem Kommuniqué, die „IGKL“ betreffend
- 1408 Aufrufe
Einerseits ist man zunächst einmal überrascht, dass ausgerechnet die IKS von subversiven Kräften angegriffen wird. Aber: man sollte sich über die Realität des bürgerlichen Systems, das uns ja umgibt, auch nicht täuschen lassen
Denn andererseits - falls diese unselige IGKL tatsächlich als "Agent Provocateur" fungiert, wofür nach Eurer Darstellung einiges spricht, passt das genau zu den markanten Eigenarten dieses kapitalistischen Systems, nämlich der Umgang mit Kritikern, Andersdenkenden, schlicht mit der "echten" Opposition, den bewussten Vertretern der Arbeiterklasse! Das System bekämpft diese Tendenzen immer radikal und erbarmungslos, man darf sich in dieser Hinsicht einfach nichts vormachen... So gesehen ist es leider doch nur folgerichtig, dass die IKS Ziel von Angriffen des Systems wird. IHR seid es doch, die durch schonungslose Analysen und ungeschminkte Berichterstattung der Bourgeoisie den Spiegel vorhaltet und ihre Lügen entlarvt.
Dazu kommt im Falle der IGKL neben kriminellen Beweggründen wohl noch eine gehörige Portion Reputationsgehabe, welches jene zum willigen, perfekten Instrument der kapitalistischen Interessen macht. Dieses Reputationsgehabe entspringt dem Individualismus der kapitalistischen Gesellschaft. "Jeder gegen jeden" schimmert auch hier durch. Die grenzenlose Gier nach Anerkennung, eben Reputation, führt doch dazu, die eigene Person selbst ins rechte Licht zu rücken, ohne Rücksicht auf andere Meinungen. Sehr schnell wird dabei vergessen, dass erst das Einbringen von Ideen, Meinungen, Anregungen in die Gemeinschaft einen Prozess in Gang setzt, der, bedingt durch gegenseitigen Respekt und auch Solidarität, neue Denkansätze entstehen lässt. Aber das erfordert die Einhaltung einer proletarischen Moral. Diese umfasst genau eine Solidarität, in der Klasse verankert, mit der Verpflichtung der Einordnung in die Werte der Arbeiterklasse. Aber unsere derzeitige Gesellschaft ist sehr weit entfernt, auch nur ansatzweise Werte zu vermitteln; ganz im Gegenteil: der Werteverfall ist drastisch! Umso wichtiger ist die Funktion der IKS einzustufen: Sie ist verpflichtet, nicht nur ein revolutionäres Bewusstsein zu vermitteln, sondern auch für eine proletarische Moral einzutreten.
Da das Verhalten, Denken und Handeln dieser IGKL rein gar nichts mit irgendwelchen Moralgrundsätzen der Klasse zu tun hat sowie auch keinen revolutionären Inhalt besitzt, kann man mit Fug und Recht von sehr niedrigen Beweggründen dieser Gruppierung sprechen, für die es keinerlei Rechtfertigung geben kann.
Erstaunlich erscheint mir, dass diese Kriminellen trotz der Trennung von der IKS vor über zehn Jahren einen derartigen Hass schüren, der durch nichts erklärbar oder gar begründet ist. Das spricht in der Tat Bände über deren Geisteszustand. Folgerichtig ist es auch meiner Ansicht nach, hart mit diesen separatistischen Elementen zu verfahren und alles zu versuchen, die IKS frei davon zu halten. Es kann keinesfalls hingenommen werden, dass ein Zersetzungsprozess eingeleitet wird, der die Kapitalistenklasse frohlocken ließe!
In diesem Sinne wünsche ich, dass Ihr den eingeschlagenen Weg unbeirrt fortsetzt, ohne Euch durch solche „Störungen“ aufhalten zu lassen, um einen Bewusstseinswandel in der Arbeiterklasse herbeizuführen.
Aktuelles und Laufendes:
- Solidarität mit der IKS [584]
Politische Strömungen und Verweise:
- Parasitismus [585]
Rubric:
Weltrevolution - 2015
- 1240 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 180
- 1119 Aufrufe
2015 – Streiks in Deutschland: Geschwächte Arbeiterklasse, aber mit bedeutenden Fragen für die Zukunft
- 2127 Aufrufe
In diesem Frühjahr und Sommer 2015 hat es in Deutschland eine Reihe von Streiks gegeben – so gehäuft, dass sogar von einer „Streikwelle“[1] die Rede war. Lokführer, Kita-, Krankenhaus-, Telecom und Postangestellte, Lehrer_innen, Arbeiter_innen bei Amazon und der Geldtransportfirma Prosecur traten in den Ausstand. Wir möchten in diesem Artikel die aktuelle Lage des Klassenkampfes einschätzen. – Welches Kräfteverhältnis zeichnet sich ab zwischen den beiden Hauptklassen der Gesellschaft – zwischen Bourgeoisie und Proletariat? – Und welche untergründigen Fragen sind gestellt?
Kämpfe, Forderungen und Resultate
Monatelang folgte ein Streik dem anderen. Es ging dabei nicht bloß um ein paar Prozent mehr Lohn, sondern ausdrücklich um mehr Gerechtigkeit. Widerstand formiert sich gegen die wachsende Ungleichheit der Löhne. Die grundlegende Frage ist gestellt: Wird die Arbeit in Deutschland gerecht entlohnt?
Die Streiks waren für die Bevölkerung in Deutschland ein Thema. Einerseits weil zu einem großen Teil Arbeitsbereiche stillstanden, die in der Gesellschaft unmittelbar mit uns in Kontakt stehen, wie Kindertagesstätten, Bahn, Post und Spital. Andererseits aber auch durch die öffentliche Berichterstattung; die bürgerlichen Medien gaben sich keine Mühe, die Kämpfe totzuschweigen, sondern berichteten im eigenen Interesse und mit ihren besonderen Botschaften über sie.
Doch schauen wir uns zunächst die konkreten Ereignisse an. In letzter Zeit standen insbesondere die folgenden Arbeitskämpfe im Rampenlicht:
– Lokführer: Die Spartengewerkschaft GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) beginnt am 1. September 2014 den ersten Warnstreik, weitere 8 teilweise mehrtägige Streiks folgen im Herbst 2014 und in den Monaten April-Mai 2015. Einerseits geht es um Forderungen für höheren Lohn und weniger Stress bei der Arbeit, andererseits um die Anerkennung der GDL als Verhandlungspartnerin für Tarifverträge. Dank einem hohen Organisationsgrad der Lokführer (75%) ist die Beteiligung stark. Der Streik wird von den GDL-Mitgliedern entschlossen bis verbissen geführt, weitet sich aber nicht auf andere Bahnarbeiter_innen aus, die z.B. in der EVG (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) organisiert sind. Es kommt zwar zu zahlreichen Zugsausfällen insbesondere im Mai 2015, aber die Ersatzfahrpläne funktionieren zuverlässig. Am 21. Mai 2015 verkündet die GDL-Spitze, dass mit der DB ein Schlichtungsverfahren vereinbart worden sei und bricht den Streik ab. Der Anfang Juli 2015 akzeptierte Schlichterspruch sieht unter anderem die Anerkennung der Autonomie der GDL gegenüber anderen Gewerkschaften und eine Lohnerhöhung von insgesamt 5.1% in zwei Etappen bis Mai 2016 vor. Überstunden sollen abgebaut und zusätzliches Personal angestellt werden. Gleichzeitig einigen sich GDL und DB auf künftige Schlichtungsverfahren im Konfliktfall, die faktisch bis 2020 legale Streiks ausschließen.
– Kita: Am 8. Mai 2015 beginnt Verdi einen landesweiten Streik bei den Kindertagesstätten, der 4 Wochen dauerte, bis ein Schlichtungsverfahren eingeleitet wird. Verdi will höhere Löhne und eine Aufwertung der Berufe in der Erziehungsbranche. Die Schlichtung sieht eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3.3% vor, dabei gibt es aber je nach Beruf große Unterschiede. Berufserfahrene Erzieher_innen und Leiter_innen kleiner Einrichtungen erhalten nach dem Vorschlag am meisten. Schulsozialarbeiter_innen gar nichts. Für 80% der Streikenden sei nichts herausgekommen, zitiert die TAZ eine Betroffene. Da die Unzufriedenheit mit dem Resultat so weit verbreitet ist, führt Verdi eine Mitgliederbefragung durch, die im August 2015 mit einer Ablehnung des Schlichterspruchs endet. Fortsetzung folgt.
– Post: Anfang Juni 2015 kündigt Verdi einen unbefristeten Streik bei der Post an. Die Gewerkschaft fordert Lohnerhöhungen, und dass die Anfang 2015 gebildeten 49 regionalen Gesellschaften für die Paketzustellung wieder aufgelöst werden. Mit den ausgelagerten, regionalen Paketzustellungs-Gesellschaften werden die betroffenen 6000 Angestellten nach lokalen Tarifverträgen der Logistikbranche, d.h. etwa 20% schlechter bezahlt. Nach vierwöchigem Streik gibt es einen Einigung zwischen der Deutschen Post und Verdi: eine Einmalzahlung von € 400 und Lohnerhöhungen von 2% im 2016 und von 1.7% im 2017; die ausgelagerte Paketzustellung bleibt.
– Charité: in der zweiten Juni-Hälfte 2015 treten Teile der Belegschaft des berühmten Berliner Krankenhauses, v.a. Pfleger_innen, in den Streik, der 11 Tage dauert. Sie fordern, dass mehr Personal angestellt wird, damit die Angestellten mehr Zeit für die einzelnen Patient_innen haben. Patient_innen solidarisieren sich mit den Anliegen des kämpfenden Personals. Der Streik endet mit einer Vereinbarung zwischen der Charité-Leitung und der Gewerkschaft Verdi über die Verringerung der Arbeitsbelastung und die Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte.
– Amazon: Zwei Tage lang streiken ca. 400-450 Angestellte von Amazon im hessischen Bad Hersfeld. Verdi organisiert den Streik. Die Beschäftigten der riesigen Versandlager des Internet-Händlers werden nach dem Tarifvertrag der Logistikbranche entlohnt; Verdi fordert die Unterstellung unter den Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels, welcher höhere Löhne vorsieht. Amazon beschäftigt in Deutschland etwa 10‘000 Angestellte. Verdi versucht seit Jahren in mehreren deregulierten Bereichen mit solchen Auseinandersetzungen den Organisierungsgrad zu erhöhen. Amazon will aber mit Verdi nicht in Verhandlungen treten. Die Gewerkschaft verspricht weitere Aktionen an anderen Standorten, z.B. Pforzheim.
– Prosegur: Der mehrere Wochen dauernde Streik der Geldtransporteure der Potsdamer Niederlassung von Prosegur führt im Mai 2015 in Berlin und Brandenburg zu leeren Geldautomaten. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von einem Euro pro Stunde und mehr Sicherheit für die Angestellten bei Raubüberfällen. Die Firma sperrt vorübergehend 150 Streikende aus. Anfang Juni setzt Verdi den Streik aus. Es kommt zu neuen Tarifverhandlungen, dabei schaut eine Lohnerhöhung in der Form einer Erfolgsbeteiligung heraus.
Eine Zwischenbilanz
Wie sind diese Streiks einzuschätzen? – Es gibt einige Gemeinsamkeiten, die teils auffällig sind oder aber schlicht wegen ihrer zentralen Bedeutung erwähnt werden müssen:
a) Die meisten der Streikenden waren diesmal nicht klassische Industriearbeiter_innen, sondern vorwiegend Proletarier_innen, die Dienstleistungen erbringen. Diese Teile der Arbeiterklasse sind im Allgemeinen weniger kampferfahren (wenn auch mit Ausnahmen: Post).
b) Die Kämpfe entwickelten sich im strengen Korsett der gewerkschaftlichen Kontrolle. Die Fragen eines spontanen Streiks, der Selbstorganisation, der Ausweitung der Kämpfe haben sich anscheinend nirgends gestellt.
c) Im Gegensatz zu zahlreichen Streiks der letzten 15 Jahre gegen Betriebsschließungen, die meist mit trostlosen Niederlagen endeten, gab es diesmal meist Zugeständnisse: kleine Lohnerhöhungen, das Versprechen, dass mehr Personal angestellt werde, und andere, vor allem gewerkschaftliche Anliegen.
d) Die bürgerlichen Medien insbesondere in Deutschland haben den Streiks Beachtung geschenkt und mehrheitlich Verständnis für die Anliegen der Streikenden zur Schau getragen.
Die Botschaft, die vermittelt wird, ist die, welche Wolfgang Schäuble schon 2012 im Zusammenhang mit Lohnkämpfen in den alten Industrien (Metall-, Elektro- und Chemiebranchen) zur Freude der Gewerkschaften IGM und IG BCE verkündete: „Es ist in Ordnung, wenn bei uns die Löhne aktuell stärker steigen als in allen anderen EU-Ländern.“ Deutschland habe seine Hausaufgaben gemacht und könne sich höhere Tarifabschlüsse besser leisten als andere Staaten. „Wir haben viele Jahre der Reformen hinter uns“, sagte Schäuble in einem Interview der Zeitschrift Focus.
Mit anderen Worten lautet die Message: „Den Gürtel enger zu schnallen, lohnt sich – nach ein paar mageren Jahren gibt es eine Belohnung. Die anderen EU-Staaten sollen auch diesen Weg gehen, den Deutschland schon gegangen ist.“
In der Tat war es ja die rot-grüne Sparpolitik in den Nullerjahren, welche den Standort Deutschland nach den Wünschen des Kapitals trimmte. Nur eine linke Regierung war in der Lage, eine Agenda 2010 und Hartz IV ohne starken Widerstand der Arbeiterklasse umzusetzen. Die mit diesen Maßnahmen eingeleitete Umstrukturierung führte dazu, dass in Deutschland im Durchschnitt die Lohnkosten sanken, die Lohnarbeit prekärer und flexibler, die Produktion in Deutschland wieder richtig profitabel wurde. Deutschlands Wirtschaft, namentlich die Industrie, eroberte sich auf dem Weltmarkt einen Spitzenplatz – ja wurde Exportweltmeister trotz ernsthafter Gegner wie China oder USA. Im EU-Binnenmarkt ohne Zollschranken, v.a. im Euroraum, war das deutsche Kapital kaum aufzuhalten, es machte sich breit, eroberte für sich neue Märkte und beschäftigte im Inland mehr Arbeitskräfte, wenn auch zu schlechteren Bedingungen. Die Arbeitslosigkeit ging zurück. Die Ungleichheit der Arbeitsverhältnisse und der Löhne ist gewachsen.[2] Viele Großbetriebe lagern ihre Produktion aus, verschwinden oder verkleinern sich. Kurz: In den letzten 10-15 Jahren hat sich die deutsche Wirtschaft, das Kapital, neue effizientere Strukturen gegeben; die Arbeiter_innen werden im Durchschnitt mehr ausgebeutet, leben aber in sehr verschiedenen Umständen und fühlen sich oft gar nicht als Teil einer Klasse.
Eine erste Zwischenbilanz muss deshalb trotz kleiner Streikerfolge nüchtern ausfallen: Es hat zwar eine Häufung von Streiks in Deutschland gegeben, aber anscheinend haben sie sich in den Bahnen bewegt, welche die herrschende Klasse in diesem Land – von Bsirske (Verdi-Chef) bis zu Schäuble – vorgesehen haben. Dabei hat die Bourgeoisie natürlich keine Hemmungen, die nationale Karte zu spielen und so zu tun, als ob Arbeiter und Kapital im gleichen Boot säßen. Sie klopft dem deutschen Arbeiter auf die Schulter und billigt ihm eine Lohnaufbesserung zu, während die angeblich faulen Südländer in der EU zuerst ihre Hausaufgaben erledigen sollen. Die deutschen Arbeiter werden so zu Komplizen gemacht und in einen Gegensatz gestellt zu beispielsweise den griechischen Arbeitern – denen ja umgekehrt dasselbe nationalistische Gift in die tägliche Suppe gemischt wird: die deutschen Arbeiter würden von der griechischen Misere profitieren.
Tiefer liegende Fragen
Wir meinen aber, unter dieser scheinbar desolaten Oberfläche einige Keime von Fragestellungen zu entdecken, die in der Zukunft für die Entwicklung neuer Kämpfe und Perspektiven wichtig werden können.
Auch wenn die Schwierigkeiten der Klasse, sich gegen die Angriffe der letzten Jahre zur Wehr zu setzen, handgreiflich sind, so sind die Kämpfe als Zeichen einer immer noch vorhandenen Kampfbereitschaft zu werten. Die Streiks waren zwar weder grandios noch außerhalb gewerkschaftlicher Kontrolle, aber sie haben einen nicht erloschenen Kampfgeist gezeigt, und zwar gerade in Bereichen der Lohnarbeit, wo bis jetzt eher selten gestreikt worden ist.
Auf diesem Hintergrund möchten wir auf einige Anliegen eingehen, die in den Kämpfen zur Sprache gekommen sind und die wichtig werden können für die Perspektive. Sie sind Boten, die eine unterirdische Bewusstseinsentwicklung ankündigen.
Solidarität
Der Krankhausstreik in der Charité richtete sich gegen den Stress der Pfleger_innen, unter dem nicht nur die Angestellten, sondern auch die Kranken, die gepflegt werden müssen, leiden. Nicht erstaunlich ist es deshalb, dass sich Patient_innen und Angehörige mit dem Streik und seinen Zielen solidarisiert haben. Die Solidarität mit anderen Teilen der Klasse ist elementar, wenn sich Kämpfe in Zukunft entwickeln und ausbreiten sollen. Mit der Solidarisierung werden weitere Teile des Proletariats in einen Kampf einbezogen, der Druck steigt. Ob der Streik bei der Charité aus diesem Grund so rasch zu Zugeständnissen geführt hat, möchten wir offen lassen. Es geht uns hier nicht in erster Linie um die taktische Frage, wie effizient ein Anliegen durchgesetzt werden kann, als vielmehr um die langfristige Notwendigkeit, dass breite Teile der Klasse zu Kämpfen und Diskussionen zusammenkommen. Wenn unsere Klasse die Geschichte in die eigenen Hände nehmen will, wird sie nicht anders können, als sich auf gemeinsame Ziele zu einigen, über die Vereinzelung hinaus zusammen die Umwälzungen anzupacken. Die Solidarität zwischen den heute scheinbar isolierten Teilen der Klasse wird auf diesem Weg wachsen; so wie umgekehrt dieses wachsende Zusammengehörigkeitsgefühl die Kämpfe beschleunigen kann. Die Solidarität ist zwar in den Kämpfen dieses Jahres nur selten ausdrücklich thematisiert worden – sie ist aber grundlegend für die Einheit der Klasse in Zukunft. In den letzten Monaten haben wir zudem den Eindruck gewonnen, dass die Bevölkerung, insbesondere die Arbeiter_innen, den Streiks mit Verständnis und einer stillschweigenden Solidarität begegnet sind. Die Zugausfälle und die verspätete Postzustellung waren zwar zu spüren, aber reklamiert wurde nur wenig – im Gegenteil haben wir immer wieder Sympathiebekundungen gehört.
In einem anderen Kontext, aber gleichzeitig ist die Solidarität ja auch spürbar: beim Empfang der Flüchtlinge durch breite Teile der Bevölkerung in Deutschland und anderen Ländern. Wir können an dieser Stelle nicht tiefer auf die aktuelle Ankunft von Zehntausenden Proletarier_innen eingehen, die dem Elend und der Gewalt im Nahen Osten und in Afrika entfliehen. Wenn wir aber von einer Solidarität sprechen, die in einzelnen Kämpfen von verschiedenen direkt oder indirekt Betroffenen gepflegt worden ist, so sollten wir diese Grundstimmung auch im Zusammenhang mit den Flüchtlingen begrüßen und in den gleichen Zusammenhang stellen. Das Proletariat hat kein Vaterland. Und: Vereinigt euch!
Gerechtigkeit
Auch die oft gehörte Forderung nach Gerechtigkeit, die wir schon eingangs erwähnt haben, hat mit der Einheit der Klasse zu tun. Der Unmut über die ständig zunehmende Diskrepanz bei den Arbeitsbedingungen, über die schreiende Ungleichheit = Ungerechtigkeit im Arbeitsalltag nimmt zu. Die Kampfbereitschaft der Streikenden gründete auf dieser Wut. Es ist in der Tat empörend zu sehen, wie ein großer Teil der gesellschaftlich notwendigen Arbeit zu immer miserableren Bedingungen geleistet werden muss. Mit der Agenda 2010 hat das deutsche Kapital ja auch nicht die gesamte Klasse frontal angegriffen, sondern richtig dosiert jeweils Teile davon, nämlich in erster Linie die nicht Festangestellten, und zwar so, dass die Klasse aufgrund ihrer neuen Arbeitsbedingungen möglichst aufgespalten ist in Beschäftigte und Erwerbslose, Festangestellte und befristet Angestellte, Männer und Frauen, Alte und Junge, etc., wobei sogar im gleichen Betrieb krasse Unterschiede geschaffen wurden.
Auf diesem Hintergrund heißt Gerechtigkeit Widerstand gegen die neu geschaffenen Ungleichheiten, gegen die Zerstückelung der Belegschaft in einem Betrieb, wo für die gleiche Arbeit ganz verschiedene Arbeitsverträge existieren mit den unterschiedlichsten Löhnen und Kündigungsfristen. Auch hier ist also das Kernanliegen die Einheit der Klasse, die nicht länger in möglichst weit voneinander entfernte Atome gespalten werden soll.
Und der Aufschrei gegen die Ungerechtigkeit in dieser kapitalistischen Welt ist eine wichtige Triebfeder für moralische Empörung und damit für die Entwicklung einer kämpferischen Haltung. Wir kämpfen nicht für abstrakte Gleichheit, nicht für Gleichmacherei, denn die Menschen sind verschieden, vielfältig. Gerade die Vielfalt und die Kooperation der verschiedenen Talente machen uns zu Menschen, im Unterschied zu Robotern. Der alte kommunistische Grundsatz, ursprünglich von Saint-Simon formuliert, heißt: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. In diesem Sinn greifen wir sicher den Kampf gegen die Ungerechtigkeit auf, aber wir hüten uns davor, uns für die bürgerliche, abstrakte Gerechtigkeit, für die Gleichmacherei einspannen zu lassen.[3]
Allerdings offenbaren auch hier die Gewerkschaften ihren unwiderruflich bürgerlichen Charakter, da sie den Aufschrei gegen die zunehmende Ungerechtigkeit in ihre sterilen Tarifverträge kanalisieren. Bei der Post, den Kitas und bei Amazon haben die Gewerkschaften die Parole der „Gerechtigkeit“ eingesetzt: Es sei ungerecht, wenn die gleiche Arbeit unter verschiedenen Tarifverträgen stehe und ungleich bezahlt werde. Dabei landen wir aber wieder bei der abstrakten Gleichheit bestimmter Berufe in einer bestimmten Branche – und der konkreten, tarifvertraglich verbrieften Ungleichheit, die der Kapitalismus ständig verstärkt.
Gegen Stress
Ein drittes wiederkehrendes Thema in den verschiedenen Streiks war der Kampf gegen den Stress bei der Arbeit. Die Streiks der Charité-Angestellten und der Lokführern richteten sich insbesondere gegen die zunehmende Belastung. Auch dabei stellen sich grundsätzliche Fragen des kapitalistischen Systems von Produktion und Verteilung. Obwohl die Produktivkräfte immer noch weiter entwickelt und ständig mehr in immer kürzerer Zeit produziert werden kann, arbeiten wir nicht weniger und nicht ruhiger. Das Gegenteil ist der Fall: Die Intensität der Arbeitsabläufe wächst. Diejenigen, die noch eine Erwerbsarbeit haben, müssen sich dem immer intensiver werdenden Rhythmus unterwerfen. Und wer keine Arbeit hat, muss wieder welche suchen, und zwar sofort und effizient. Nicht nur die Maschinen mit ihrer Kadenz stressen, sondern auch die Bürokratie, der wir in jeder Lebenssituation ausgeliefert sind, der Verkehr im Beruf und in der Freizeit. Apropos: Auch die Freizeit MUSS effizient organisiert sein. Sei’s im Fitnessstudio oder beim Komasaufen. – Krank werden wir so oder anders. Burn-outs und Depressionen nehmen schon lange und nach wie vor zu.
Der Kampf gegen den Stress am Arbeitsplatz und im sonstigen Alltag konfrontiert uns deshalb mit den Fragen: In was für einem System leben wir? – Welche Bedingungen müsste ein menschliches System erfüllen? – Auch hier gibt es eine unterirdische Reifung im Bewusstsein über grundsätzliche Fragen.
Ausblick
Angesichts der aktuellen Lage können wir uns keine Illusionen über die Schwächen der Arbeiterklasse machen. Dabei sollten wir aber die Anzeichen, die zu Hoffnung Anlass geben, nicht übersehen. Die Klasse ist nicht geschlagen, nicht völlig unterworfen unter die Gesetze der blind wütenden Kapitalakkumulation und Verarmung. Die Kampffähigkeit drückt sich in 'untypischen' Formen und Fragen aus, in zaghaften Versuchen von neueren Teilen der Klasse, die sich nicht als Teil der Klasse verstehen, Gegenwehr zu leisten. Wir haben ähnliche Erscheinungen der Bewusstseinsreifung auch schon in den Bewegungen 2011/2012 gesehen: das Bedürfnis zusammen zu kommen, die Einheit auf Plätzen und Straßen zum Ausdruck zu bringen, sich über die Grenzen der Nationalstaaten solidarisch aufeinander zu beziehen.
Die Hauptschwierigkeiten können wir so zusammenfassen:
a. Fehlende Klassenidentität: vordergründig das fehlende Bewusstsein, zu einer und derselben Klasse von Ausgebeuteten und Besitzlosen zu gehören; grundsätzlicher die noch nicht vorhandene Perspektive einer großen kulturellen Umwälzung zur Menschwerdung unserer Gattung, bei der wir – die Arbeiterklasse – das kreative Subjekt sind.
b. Die Spaltungen innerhalb der Arbeiterklasse: Die Arbeitsbedingungen im Kapitalismus gleichen sich nicht an, sondern werden je länger je differenzierter. Dies entspricht der immer komplizierteren Arbeitsteilung einerseits; aber auch den Herrschaftsbedürfnissen des Kapitals andererseits. Nur wenn wir gespalten, statt vereint agieren, sind wir machtlos.
c. Auf der ideologischen Ebene ist die Arbeiterklasse heute potentiell Geisel der nationalen Bourgeoisie. Für den in Deutschland arbeitenden Teil des Weltproletariats hat sich dies beispielsweise in diesem Sommer während den Verhandlungen um die griechischen Schulden gezeigt; auf diesem Terrain hat die Arbeiterklasse keine Stimme. Unter etwas anderen Vorzeichen stellt sich die Frage heute erneut angesichts der in Wien, München, Dortmund und Hamburg eintreffenden Flüchtlinge.
Josef, Sept. 2015
[1] So auch Wildcat Nr. 98, Sommer 2015, S. 33
[2] Diese Tendenz wird in aktuelle Studien bestätigt, vgl. Süddeutsche Zeitung vom 26. August 2015: „Trotz eines neuen Beschäftigungsrekords ist die deutsche Mittelschicht in den vergangenen 20 Jahren deutlich geschrumpft. Nach einer Studie der Universität Duisburg-Essen ging der Anteil von Haushalten mit mittleren Einkommen zwischen 1993 und 2013 von 56 auf 48 Prozent zurück. Gleichzeitig stieg die Quote der schlechter Verdienenden.“
[3] Dass im Kapitalismus der Ruf nach gleichem Lohn ein „unerfüllbarer törichter Wunsch“ ist, hat Marx in Lohn, Preis und Profit (1865) aufgezeigt und so kommentiert: „Nach gleicher oder gar gerechter Entlohnung auf Basis des Lohnsystems rufen, ist dasselbe, wie auf Basis des Systems der Sklaverei nach Freiheit zu rufen.“
Nationale Situationen:
Aktuelles und Laufendes:
- Streiks in Deutschland [588]
Theoretische Fragen:
- Arbeiterklasse [300]
Rubric:
70 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki
- 1986 Aufrufe
Vor 70 Jahren, am 6. August 1945, wurden in Hiroshima als Opfer der Demonstration der neuen amerikanischen Nuklearwaffe mehr als Hunderttausend Menschen getötet. Nach offiziellen Zahlen starben 70`000 bei der Explosion und Tausende erlitten in den Tagen danach dasselbe Schicksal. Drei Tage danach, am 9. August, explodierte in Nagasaki eine zweite Atombombe, die eine ähnlich hohe Zahl von Opfern forderte1. Die Barbarei und das Leid, die die Bevölkerung in Japan erlitt, lassen sich kaum beschreiben.
1995 schrieben wir angesichts des 50. Jahrestages dieses schrecklichen Ereignisses: “Um ein solches Verbrechen zu legitimieren und um auf den berechtigten Schock eine Antwort zu geben, der durch die katastrophalen Auswirkungen der Bomben verursacht wurde, setzten Truman, der US-Präsident, der diesen nuklearen Holocaust angeordnet hatte, und sein Busenfreund Churchill eine durch und durch zynische Lüge in die Welt: Der Einsatz der Atombomben habe eine Million Menschenleben gerettet, die die Invasion der amerikanischen Truppen erfordert hätte. Trotz der grausamen Auswirkungen seien die Bomben, die Hiroshima und Nagasaki zerstört hätten, Bomben für den Frieden gewesen! Diese besonders widerliche Behauptung wurde jedoch von zahllosen, von der Bourgeoisie selbst herausgegebenen Geschichtsstudien widerlegt.“
Wenn wir Japans militärische Situation zur Zeit der Kapitulation Deutschlands näher unter die Lupe nehmen, so sehen wir ein Land, das am Rande der Niederlage stand. Die Luftwaffe, seine wohl wichtigste Waffe im Zweiten Weltkrieg, war auf eine Handvoll Kampfflugzeuge geschrumpft, die von jugendlichen Piloten geflogen wurden, deren Unerfahrenheit durch Fanatismus wettgemacht wurde. Auch die Kriegs- und Handelsflotte war praktisch ausgeschaltet. Die Flugabwehr wies so viele Lücken auf, dass die amerikanischen B29-Bomber im Frühling 1945 Tausende von nahezu verlustfreien Angriffen starten konnten, ohne auf nennenswerten Widerstand zu stoßen. Churchill selbst hielt dies im 12. Band seiner Kriegsmemoiren fest.
Eine 1989 in der New York Times veröffentlichte Studie, die vom US-Geheimdienst 1945 erstellt worden war, zeigte, dass „der japanische Kaiser, die Niederlage eingestehend, am 20. Juni 1945 entschied, alle Kampfhandlungen zu beenden und vom 11. Juli an Friedensverhandlungen in Gang zu setzen mit dem Ziel, die kriegerischen Auseinandersetzungen zu beenden".2 Doch da in der kapitalistischen Gesellschaft Zynismus und Verachtung keine Grenzen kennen, ist hier noch anzufügen, dass die Überlebenden dieser Explosionen, die „Hibakusha“, erst im Jahr 2000 vom japanischen Staat als Opfer anerkannt wurden und immer noch unter Diskriminierungen leiden.3
Bezüglich der wirklichen Ziele der Bombardierungen schrieben wir 2005: „Im Gegensatz zu all den Lügen, die seit 1945 über den angeblichen Sieg der Demokratie und des Friedens in die Welt gesetzt wurden, war der Zweite Weltkrieg dann zu Ende, als die imperialistische Neuaufteilung der Welt erfolgt war. Enthielt der Vertrag von Versailles den Keim eines neuen Krieges in sich, so enthielt auch Jalta den Gegensatz zwischen den zwei Hauptsiegern des Zweiten Weltkrieges, den USA und ihrem russischen Gegner. Durch den Zweiten Weltkrieg von einer ökonomisch schwachen Macht zu einem Imperialismus von Weltrang aufgestiegen, konnte die Sowjetunion nicht anders, als die US-amerikanische Supermacht zu bedrohen. Bereits im Frühling 1945 benutzte die UdSSR ihre militärische Stärke, um einen Block in Osteuropa auf die Beine zu stellen. Jalta diente nur dazu, das existierende Kräfteverhältnis zwischen den mächtigsten imperialistischen Haien, die aus der größten Schlächterei der Geschichte hervorgingen, zu sanktionieren. Die Situation, die durch das eine Kräftegleichgewicht geschaffen worden war, wurde nun durch ein anderes über den Haufen geworfen. Im Sommer 1945 war das wahre Problem, vor dem die USA stand, nicht, wie es uns in den Schulbüchern eingetrichtert wird, Japan sobald als möglich zur Kapitulation zu zwingen, sondern, wie man dem imperialistischen Feldzug des ‚großen russischen Verbündeten‘ begegnen konnte.“
In Wirklichkeit begann schon vor 1945 aufgrund der sich zuspitzenden imperialistischen Spannungen ein regelrechter nuklearer Aufrüstungswettlauf. Kapitalistische Großmächte konnten ihre Position auf der imperialistischen Bühne nur noch aufrechterhalten und wurden von ihren Gegnern nur dann ernstgenommen, wenn sie Atomwaffen besaßen oder, noch besser, selbst entwickelten. Dies galt vor allem für die „Blockführer“ USA und UdSSR. Ab 1949 begann Russland seine eigenen Atombomben zu testen. 1952 war Großbritannien an der Reihe. 1960 wurde die erste französische Atombombe, zynischerweise „Blaue Springmaus“ (gerboise bleue) genannt, in der algerischen Sahara gezündet. Während dieser Periode wurden - und dies ist nicht übertrieben - Hunderte von Atombombentests mit tragischsten Konsequenzen für die Natur (und oft auch für die Bevölkerung in der Umgebung) durchgeführt, die von den jeweiligen Staaten geheim gehalten wurden. Nicht nur entfaltete sich ein irrsinniger Wettlauf zwischen den USA und der UdSSR um die Erhöhung der Anzahl von immer größeren Nuklearwaffen; es wurden auch alle erdenklichen Anstrengungen zur Verstärkung der Zerstörungskraft dieser Waffen unternommen. Zwar stellten die Bomben vom August 1945 einen Moment äußerster Grausamkeit in der kapitalistischen Barbarei dar, doch waren sie weit entfernt vom Zerstörungspotenzial der heute existierenden Waffen.
Die kapitalistische Barbarei kennt keine Grenzen. Als wären die mehr als Hunderttausend Toten von Hiroshima und Nagasaki lediglich ein Vorgeschmack auf das, was der dekadente Kapitalismus anzurichten vermag, gingen die USA noch einen Schritt weiter, als sie 1952 eine Wasserstoffbombe namens „Ivy Mike“ mit 10,4 Megatonnen Sprengkraft zündeten, eine Bombe mit der sechshundertfachen Zerstörungskraft der Atombombe von Hiroshima. Russland zündete 1961 in dieser fatalen Rüstungsspirale mit der berühmten „Tsar-Bomba“ auf der Insel Nowaja Semlija die stärkste je getestete Wasserstoffbombe. Sie hatte eine Kraft von mehr als 50 Megatonnen, verglaste buchstäblich die Erde in einem Radius von 25 Kilometern und zerstörte alle hölzernen Gebäude im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Die Armeeführung war von der Vorstellung angetan, dass die Hitze, die durch die Explosion entstand, noch in einem Umkreis von 100 Kilometern Verbrennungen dritten Grades verursachte.1968 unterzeichneten die großen Atommächte USA, Russland, Großbritannien und Frankreich formell einen Atomwaffensperrvertrag. Dieser Vertrag, der das Ziel hatte, die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen zu bremsen, hatte aber kaum Wirkung. Er war genau so heuchlerisch wie Jahre später das Kyoto-Protokoll gegen die Erderwärmung. Seit dem Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrages 1970 erweiterte sich die Liste der Nuklearmächte um eine Reihe von Ländern: Indien, China, Pakistan, Nordkorea, Israel. Dazu kommt eine Reihe von Staaten, bei denen der Besitz von Atomwaffen Gegenstand von Diskussionen zwischen den verschiedenen Fraktionen der herrschenden Klasse ist: der Iran natürlich, aber auch Brasilien, das verdächtigt wird, ein Atomwaffenprogramm zu entwickeln4, Saudi-Arabien und Syrien, über dessen Kernreaktor in Damaskus schon viel gesprochen wurde. Es ist unübersehbar, dass dieser Sperrvertrag nichts anderes als Augenwischerei ist, der die brutale Realität des illegalen Handels mit nuklearem Material verheimlichen soll. In einem System, basierend auf der Konkurrenz und dem Kräftemessen, ist die Idee, zur Vernunft zurückzukehren, reine Mystifikation. Seit dem Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der Blöcke 1990 hat die militärische Instabilität in fortschreitendem Maße alle Zonen des Planeten ergriffen. Die internationale Situation zeigt uns dies täglich. Es handelt sich um einen wahren Zerfallsprozess, der immer mehr Barbarei und Irrationalität erzeugt. In diesem Rahmen muss man auch die Ankündigung Putins vom 16. Juni verstehen, laut der: „… Russland sein nukleares Arsenal mit der Installierung von mehr als 40 neuen Interkontinentalraketen bis Ende des Jahres verstärken wird (…) Diese Ankündigung wurde vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Russland und den USA gemacht, deren Pläne, schwere Waffen in Europa zu stationieren, wie von der New York Times enthüllt wurde, Moskau in Rage gebracht hatten“.5 Angesichts des 70. Jahrestages des nuklearen Holocaust ist eine solche Deklaration bezeichnend für die Verwesung, in die die kapitalistische Gesellschaft abgleitet.
Die Arbeiterklasse, die als einzige Klasse der Menschheit eine Perspektive bieten kann, ist auch die einzige Klasse, die der kriegerischen Barbarei der imperialistischen Mächte etwas entgegenzusetzen vermag. Das Proletariat darf sich nicht durch den Schrecken und die Angriffe, die die kapitalistische Klasse zu veranstalten fähig ist, einschüchtern und lähmen lassen. Zweifellos löst das Grauen vom August 1945 in Japan und des Krieges insgesamt Angst aus. Und dies aus gutem Grund. Im Getümmel der kapitalistischen Konkurrenz will die Bourgeoisie stets ihre Rivalen auslöschen. Die einzig reale Bremse gegen diese Barbarei ist das Bewusstsein der revolutionären Klasse und ihre Fähigkeit, sich über die Schrecken einer zerfallenden Gesellschaft zu empören.
Erinnern wir uns schließlich daran, dass der Sommer 2015 auch ein anderer Jahrestag ist, auch wenn er von den Medien viel diskreter behandelt wird: der 110. Jahrestag der Meuterei auf dem Panzerkreuzer Potemkin (Juni 1905). Die über das Misstrauen der Offiziere aufgebrachten russischen Matrosen richteten, erschöpft durch den Krieg gegen Japan, ihre Waffen gegen die eigenen Offiziere und begannen einen Aufstand, der einen Markstein in der Geschichte der Arbeiterbewegung darstellt.6 Es sind nicht die Tränen der Verzweiflung, sondern die Empörung, die Kampfbereitschaft und das Bewusstsein, die in sich die Perspektive einer kommunistischen Gesellschaft tragen.
Tim 2. 7. 2015
1 Auf dem „Friedensdenkmal in Japan wird die Zahl der Opfer mit 140`000 angegeben.
2 Le Monde Diplomatique, August 1990. Für einen tieferen Einblick in den Zynismus dieser Lügengeschichten siehe unseren Artikel „Hiroshima, Nagasaki: Die Lügen der Bourgeoisie“ in Internationale Revue Nr. 17
3 Zuvor bekamen die Opfer keinerlei Unterstützung vom japanischen Staat. „Im Mai 2005 gab es 266`598 von der japanischen Regierung anerkannte Hibakusha.“, Japan Times, 15. März 2006.
4 Lula unterzeichnete mit Argentinien einen Vertrag zur gemeinsamen Entwicklung eines atomaren Programms, das militärische Ziele nicht ausschließt.
5 Le Monde, 16. 6. 2015
6 Es ist wichtig sich auch daran zu erinnern, dass es die Arbeiterbewegung war, die dem Ersten Weltkrieg mit der revolutionären Bewegung ab 1917 ein Ende setzte.
Aktuelles und Laufendes:
- 70 Jahre Ende 2. Weltkrieg [589]
- Atombombe [590]
Historische Ereignisse:
- Atomare Verseuchung [591]
- Hiroshima [592]
Theoretische Fragen:
- Imperialismus [583]
Rubric:
Klassenkampf in Spanien: Beitrag zur Bilanz des Streiks der Techniker von Movistar
- 1553 Aufrufe
Wir veröffentlichen hier eine Stellungnahme zum Streik der technischen Arbeiter von Movistar, der in diesem Frühjahr stattfand. Diese Stellungnahme ist das Ergebnis einer breiten Debatte unter nahen Weggefährten der IKS. Der Beitrag eines Genossen hat die Diskussion angestoßen und stellt das Gerüst des Artikels dar; darauf sind verschiedene Entgegnungen gefolgt, die nun in den vorliegenden Text eingeflossen sind.
Die Rolle der unmittelbaren Kämpfe des Proletariats
Die unmittelbaren Kämpfe zur Verteidigung der Lebensbedingungen des Proletariats stellen einen Faktor im Prozess der Bildung des Bewusstseins, der Solidarität, der Einheit und der Entschlossenheit des Proletariats dar. Die Revolutionäre schenken diesen Kämpfen eine große Aufmerksamkeit und nehmen an ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten teil. Sie unterstützen sie mit all ihren Kräften und schätzen die wirtschaftlichen Verbesserungen keineswegs gering, die sich herausholen lassen, denn diese sind nötig für das Überleben der Arbeiter_innen im Alltag und sie konkretisieren den Elan und die Initiative der Proletarier_innen, damit ihre Bedürfnisse gegenüber dem Kapital zur Geltung gebracht werden; diese Kämpfe stellen eine Kriegserklärung gegen die nationale und Warenlogik des Kapitals dar.
Diese Logik besagt, dass wir uns zu opfern hätten für die Zwänge der Kapitalakkumulation und dass wir folglich länger zu arbeiten, weniger zu verdienen und die Entlassungen, die Verschärfung der Arbeitsbedingungen, der Verlust der Sozialleistung usw. zu akzeptieren hätten, damit die Gewinne der Kapitalisten stiegen und vor allem damit die Nation – die spanische, die griechische, die deutsche oder die katalanische – ihren Platz im internationalen Konzert verteidige und ihr Label „anerkannt“ werde.
Wenn die Proletarier_innen für ihre Lebensbedingungen kämpfen, wenden sie sich gegen diese Logik und stellen ihr implizit entgegen, dass das menschliche Leben nicht der Produktion untergeordnet sei – wie es die kapitalistische Logik besagt –, sondern dass die Produktion umgekehrt dem Leben zu dienen habe – dies ist die Logik der neuen kommunistischen Gesellschaft, die das Proletariat in sich trägt[1].
Auf dieser impliziten Position zu verharren ist aber nicht genug, denn die überwältigende Mehrzahl dieser Kämpfe endet ohne Ergebnis. Deshalb besteht ihr wichtigster Beitrag darin, uns Lehren – meist negativer Art – zu erteilen für den historischen Kampf um eine neue Gesellschaft. Wir müssen sie kritisch betrachten, um die theoretischen, organisatorischen und moralischen Errungenschaften des Proletariats zu entwickeln und zu vertiefen.
Die Rolle der Streiks
Der Streik ist die Grundlage, von der aus die Proletarier_innen klassischerweise ihrer selbst als Klasse bewusst werden, den er stellt den besten Nährboden dafür dar: der Kampf gegen die wirtschaftlichen Angriffe des Kapitals, die Wahrnehmung oder zumindest die Intuition in der unmittelbaren Lage, dass alle Lohnarbeiter_innen früher oder später sich verteidigen und in den Kampf treten müssen in diesem Gesellschaftsverhältnis, das die kapitalistische Produktion ist.
Doch was ist der wesentliche Sinn des Streiks? Früher, in der aufsteigenden Phase des Kapitalismus, der damals noch eine ganze Welt zu erobern hatte, konnten wirkliche und mehr oder weniger dauerhafte wirtschaftliche Verbesserungen für das Proletariat herausgeschlagen werden. Aber sogar in jener Zeit unterstrichen die Revolutionäre die Notwendigkeit zu begreifen, dass die wahre Bedeutung der Streiks darin besteht, was sie die Proletarier_innen lehren, was sie massenhaft debattieren und lernen, und dass sie sich politisch stärken. Heutzutage bietet die kapitalistische Akkumulation in einer sich zersetzenden Produktionsweise nur noch wenig Spielraum für eine wirkliche und dauerhafte Verbesserung der Lage des Proletarier_innen, wenn überhaupt. Wenn wir hier als Revolutionäre den selbstorganisierten Streik verteidigen, so deshalb, weil er die optimalsten Bedingungen liefert, um Beziehungen der Solidarität und des Vertrauens unter Arbeiter_innen zu knüpfen, und weil der Streik sie dazu drängt, massenhafte Debatten zu führen, Massenversammlungen zu organisieren, wo jeder Aspekt dieser Gesellschaft auf den Prüfstein der Kritik und der Diskussion gestellt wird.
Es geht also nicht darum, den Streik als eine für einen konkreten Kapitalisten an sich „schädliche“ Aktion hervorzuheben oder der Produktion oder der Geldbörse des Bourgeois um jeden Preis „Schaden zuzufügen“. Vorrangig sind für uns vielmehr die Debatte, die Versammlungen als vom Staat und vom Kapital politisch unabhängiges Mittel, damit der Streik die Proletarier_innen dazu ermutige, vorwärts zu schreiten, Kontakt aufzunehmen mit ihresgleichen und sich die in der Geschichte erprobten Mittel des Kampfes jenseits vom Einfluss der bürgerlichen staatlichen Politik wieder anzueignen.
Der Streik ist Teil des Arsenals, auf welches der Klassenkampf des Proletariats zurückgreifen kann. Dieser Klassenkampf ist eine Einheit von wirtschaftlichen, politischen und geistigen Schlachten, die zusammen das proletarische Bewusstsein nähren.
Ein Versuch der Selbstorganisation
Der unbefristete Streik, den die technischen Arbeiter_innen von Movistar organisierten, war praktisch seit Beginn zweischneidig: Einerseits wurde er, was für seinen Erfolg abträglich war, und soweit wir wissen, von den Gewerkschaften CCOO und UGT ausgerufen, was ihm in seiner Dynamik den Stempel eines allein in einer Sparte geführten Kampfes aufdrückte und entsprechende Tendenzen verstärkte. Andererseits gab es zum Glück die bemerkenswerten Anstrengungen der Arbeiter_innen im Kampf, Versammlungen außerhalb und unabhängig von den großen Gewerkschaftszentralen abzuhalten, sich selber zu organisieren und darüber hinaus zu gehen. Aus diesem Grund können wir behaupten, dass der Kampf während einer beachtlichen Zeitspanne eine Perspektive eines echten selbstorganisierten proletarischen Kampfes hatte und sein Potential aufrecht erhielt.
Die Versammlungen drücken erstens den Willen zur Vereinigung, den es in der Arbeiterklasse gibt, aus; zweitens den Versuch, den Kampf in die eigenen Hände zu nehmen und der Kontrolle der staatskapitalistischen Organisationen zu entreißen, die ihn in die Niederlage führen würden. Drittens kündigen sie eine neue gesellschaftliche Organisationsweise an – den Kommunismus –, die auf der assoziierten Entscheidung der Menschheit beruht, die von jeder Form der Ausbeutung befreit ist. Wir betrachten die Vollversammlungen als eines der herausragenden Merkmale der Bewegung der Indignados und auch von Gamonal[2].
Jeden Kampf müssen wir in seinem geschichtlichen und internationalen Zusammenhang sehen, andernfalls schauen wir durch die empiristische Brille der Unmittelbarkeit, die uns daran hindert, den reichhaltigen Saft zu gewinnen, den sie beinhalten. Der Kampf von Movistar findet statt in einem geschichtlichen Augenblick der Schwäche des Proletariats aufgrund des Verlusts seiner Klassenidentität und eines schrecklichen Mangels an Vertrauen in seine Fähigkeiten zur Aktion als unabhängige gesellschaftliche Kraft.
Er ist Teil eines Fadens von Kämpfen, die trotz allem, was sie erreichen, weit unter dem stehen, was die Ernsthaftigkeit der Lage des Kapitalismus erfordern würde. Einerseits die Streikbewegungen in Asturien (2012), Bangladesch[3], China[4], Südafrika[5], in Vietnam und vor kurzem in einigen Gebieten der Türkei … Andererseits die Besetzung von Plätzen und Massenversammlungen, wie sie in der Bewegung gegen den CPE in Frankreich (2006)[6] zum Ausdruck kamen und in der Bewegung der Indignados in Spanien (2011)[7], wovon abgeschwächte Echos in Brasilien[8], der Türkei[9] (2013) und in Peru (2015)[10] zu hören waren.
Die politischen und gewerkschaftlichen Kräfte der Bourgeoisie sind erpicht darauf, die Proletarier_innen zu spalten und voneinander zu isolieren, und stellen die beiden Arten von Kämpfen einander gegenüber, die zwar ihre Unterschiede haben, aber tiefgründig Teile einer Einheit sind. In diese Einheit und insbesondere in den Drang zur Selbstorganisierung reiht sich der Kampf bei Movistar ein.
Versuche der Solidarisierung
Wir haben auch Versuche der Solidarisierung festgestellt. Ein starkes Gefühl der Solidarität unter den Arbeiter_innen – das sich aber nicht als eines der Klasse ausbreitet, das heißt als „externe“ Solidarität, von Arbeiter_innen anderer Bereiche praktiziert; es wird nicht als Teil ein und derselben Kampfbewegung gelebt, sondern nur als Unterstützung (die zwar mit ehrlicher Dankbarkeit empfangen wird); es fehlt somit logischerweise am Bewusstsein, zu ein und derselben weltweiten Klasse zu gehören, die für die gleichen Interessen kämpft. Die Linksextremen, die auf dem Papier die Vokabeln aus dem sehr proletarischen Wörterbuch benützen, verbreiten diese verkürzte Sichtweise, stellen das Unmittelbare und den „gesunden Menschenverstand“ in den Vordergrund, der behauptet, dass man sich um das „Dringende“ zu kümmern habe – immer im möglichst bornierten Sinn.
Der Kampf selber drückt ein deutliches Streben nach Einheit aus, der im Falle von Movistar besonders anerkennenswert ist, da es sich hier um ein Unternehmen handelt, in dem die technischen Angestellten in einer stark ausgeprägten Vereinzelung arbeiten müssen, ohne in Arbeitszentren zusammenzukommen, mit zerstückelten Belegschaften, wobei viele der Arbeiter_innen nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht als Lohnabhängige angestellt sind, sondern Verträge als „Selbständigerwerbende“ haben[11].
Die Gefahr der Einigelung im Kampf
Auf der anderen Seite hat der Kampf auch die ernsthafte Gefahr der Gewerkschaftsideologie zum Vorschein gebracht, des „spartanischen“ Handelns: Das ist schon den Arbeiter_innen von Coca Cola passiert und auch denjenigen von Panrico, denn zu merken, was die großen Gewerkschaftszentralen im Schilde führen, heißt noch nicht automatisch, dass man die gewerkschaftliche Logik überwunden hat. Es gab und gibt in den beschränkten Kämpfen des Proletariats eine starke Tendenz dazu, nicht ausdrücklich die Vereinigung, die Ausweitung und die Massendebatte in den Versammlungen zu suchen und sich stattdessen im Betrieb oder im Produktionsbereich zu verschanzen und auszuharren, bis man ein Gerichtsurteil oder einen günstigen Vertrag erhält.
Solche Reaktionen, die darin bestehen, sich im dunklen Loch der Branche, des Unternehmens oder der Berufssparte einzuschließen, haben verschiedene Ursachen. Eine erste ist klar, und wir haben sie soeben analysiert: Der Verlust der Klassenidentität ruft ein Gefühl der Leere hervor, man weiß nicht, an wen man sich wenden soll auf der Suche nach Solidarität, man klammert sich verzweifelt an den vermeintlich schützenden Zufluchtsort, den der beschränkte und scheinbar „naheliegende“ Bereich des Unternehmens, der Berufssparte, der „Kollegen“ bietet.
Dies ist der Stempel einer historischen Situation, die wir als den Zerfall des Kapitalismus umschrieben haben und in der in allen Bereichen der Gesellschaft eine gefährliche Tendenz zum Auseinanderbrechen, des Jeder-für-sich, zur Zersplitterung vorherrscht. Wie wir in den Thesen zum Zerfall 1990 gesagt haben: „die Haltung des 'Jeder für sich', die Atomisierung des Einzelnen, die Zerstörung der Familienbeziehungen, die Abgrenzung und Isolierung der Rentner, die Zermürbung des Emotionalen und der Erotik, die durch Pornographie ersetzt wird, der total kommerzialisierte und in denen Medien vollkommen vermarkte Sport, die Massenversammlungen von Jugendlichen mit kollektiver Hysterie, bei denen gemeinsam Lieder gesungen werden und getanzt wird, die allemal ein finsterer Ersatz für eine Solidarität und gesellschaftliche Beziehungen sind, die heute vollkommen verloren gegangen sind. All diese Merkmale der gesellschaftlichen Verfaulung haben heute ein bislang in der Geschichte nie dagewesenes Ausmaß angenommen; sie dringen in alle Poren der Gesellschaft ein und spiegeln nur ein Element wider: nicht nur das Auseinanderbrechen der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch das Erlöschen jeglichen Prinzips kollektiven Lebens innerhalb einer Gesellschaft, in der es selbst kurzfristig nicht die geringsten Perspektiven auch nicht die illusorischsten gibt“[12].
Das ist natürlich ein Boden, auf dem gewerkschaftliche und linksextreme Tendenzen und Organisationen sich breit machen, die immer bereit sind, die Kämpfe der Arbeiter_innen in den „sicheren Hafen“ der bürgerlichen Legalität zu führen, „zu ihrem Besten“ oder demjenigen „des Kampfes“ an sich, abstrakt. In einem Klima der Vereinzelung, des fehlenden Nachdenkens, des Mangels an Debatte und Kontakt zwischen Streikenden und Arbeiter_innen anderer Sektoren findet die gewerkschaftliche und reformistische Logik ihren Nährboden vor, und dieser ist das optimale Betätigungsfeld für Organisationen, die nur darauf aus sind, die Arbeiter_innen hinter sich zu scharen und sich damit deren Stimmen und passive Gefolgschaft zu sichern.
Sie behaupten, die Interessen der Arbeiter zu vertreten, aber wir sehen, was sie tun, wenn sie einmal die Regierungsverantwortung haben, wie es bei Syriza der Fall ist. Doch müssen wir ihr Wesen auch dann durchschauen, wenn sie nicht an der Macht sind, denn sie rufen ständig dazu auf, eine Lösung in den gesetzlichen Gremien der Ausbeuter, des Staates zu suchen, statt in der Hitze des Gefechtes zu lernen, nachzudenken und zu debattieren - sie wollen die Lösung des Konfliktes den Vertretern dieser Produktionsweise überlassen, die ihn hervorgerufen haben und ständig und überall hervorrufen. Ein mehr als sattsam bekanntes Beispiel dafür ist die trotzkistische Tendenz „El Militante“, die es wärmstens begrüßte, als die Arbeiter von Coca Cola ihren Kampf aufgaben und sich an das Hohe Gericht wandten mit dem Begehren, dass es die Schließung ihrer Fabrik in Fuenlabrada verbiete, und dabei die Parole ausgaben: „Gerechtigkeit in der Justiz“.
Im Kampf bei Movistar tönt die Unterbrechung des Streiks zugunsten „anderer Kampfformen“ nach Beendigung des Kampfes der Techniker. Schon seit Wochen ist festzustellen, wie die fehlende Vereinigung und Ausweitung den Kampf zermürbt, wobei „neue Protagonisten“ auftauchten wie Cayo Lara, der Chef der Izquierda Unida (Vereinigte Linke), oder Pablo Iglesia von Podemos, den eine – wenn auch kleine – Gruppe von Arbeitern mit dem Ruf „Presidente“ verabschiedete, nachdem er an einer der Demonstrationen der Streikenden eine Rede gehalten hatte.
Perspektiven
Den gegenwärtigen Kämpfen fehlen wesentliche Bestandteile – von denen wir hier gesprochen haben – und die sich noch nicht in greifbarer Nähe befinden: Was fast intuitiv auftaucht (die Solidarität und die Selbstorganisierung), muss bewusster gepflegt werden, damit sich auch die weiteren Elemente entwickeln: die Identität als Klasse, das Klassenbewusstsein (als historisches und internationales), die Ausweitung des Kampfes – damit wir voran kommen bei der Wiederaneignung einer revolutionären Theorie durch die Massen.
Selbstverständlich ist eine Propaganda gegen alle Versuche notwendig, die Glaubwürdigkeit des bürgerlichen Staates in den Augen der Arbeiter zu verstärken, seiner Demokratie und der Organe, die dazu geschaffen wurden, die Konflikte zwischen den Arbeitern und ihren Ausbeutern zu schlichten; wie auch eine Propaganda gegen jede Art von Gewerkschaftsideologie, die reformistisch und Kennzeichen einer längst vergangenen Epoche von Kämpfen ist und von linksextremen Organisationen ständig im Proletariat verbreitet wird. Diese Ideologie ist ein zusätzliches Hindernis gerade in den Ländern, in denen die Bourgeoisie es geschafft hat, auf der Grundlage langer Erfahrungen mit Situationen wie der vorliegenden einen gut geschmierten demokratischen Apparat aufzubauen. Die Propaganda gegen diese Ideologie und ihre Repräsentanten ist so notwendig wie die Intervention der Revolutionäre – soweit es ihre Kräfte erlauben – in den Streiks und ihre aktive Teilnahme an der Reifung des Bewusstseins und dem Kampf gegen die reformistischen Auffassungen und ihre Vertreter, die – seien sie Demokraten oder nicht – im Solde des Staates gewiss zur Stelle sind und/oder ihren Einfluss in den Kämpfen des Proletariats geltend machen und ebenfalls, aber in umgekehrter Richtung einen aktiven Faktor darstellen: in der Auflösung, der Zersplitterung, der Demoralisierung – der physischen und ideologischen.
Es ist wichtig, Bilanzen zu ziehen, Kritik zu üben – und dies solidarisch zu tun, nicht als Gruppen von außerhalb, sondern als Teil einer und derselben kämpfenden Klasse. Es ist wichtig, in diesen Kämpfen zu sein, denn sie führen uns zur Wirklichkeit des Kampfes in seinen unmittelbaren Momenten; sie bringen uns konkrete Elemente, die wir für die Theorie und ihre Weiterentwicklung brauchen; sie helfen uns, die unmittelbaren Kämpfe mit dem revolutionären Kampf zu verbinden und die geschichtliche Perspektive zu entwickeln.
23.07.2015
[1] Kommunismus hat nichts zu tun mit der Gesellschaft des Kasernen-Staatskapitalismus, der in der früheren UdSSR herrschte oder heute noch in Ländern wie Nordkorea, Kuba oder China regiert.
[5] de.internationalism.org/content/2330/die-streikwelle-sudafrika-gegen-den-anc-und-die-gewerkschaften [596]
[10] es.internationalism.org/cci-online/201501/4071/la-ley-pulpin-es-un-ataque-mas-contra-la-clase-obrera [600] und es.internationalism.org/cci-online/201503/4085/balance-de-las-movilizaciones-contra-la-ley-de-empleo-juvenil [601]
[11] Klärung für Leser_innen, die nicht in Spanien leben: Wer in diesem Land auf eigene Rechnung Arbeit für Unternehmen (oder Einzelpersonen) leistet oder Dienstleistungen erbringt, wird gesetzlich als „selbständigerwerbend“ oder sogar als „Kleinunternehmer“ eingestuft. Diese rechtliche und gesellschaftliche Lage ist bedeutsam unter dem Gesichtspunkt der Klassenidentität: Es sind zwar Arbeiter_innen, die Arbeiten verrichten, die typisch sind für Lohnarbeiter_innen, sie tun es aber als Kleinunternehmer, die scheinbar selbständig sind.
[12] Thesen zum Zerfall – Der Zerfall: letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus, in Internationale Revue Nr. 13, /content/748/der-zerfall-die-letzte-phase-der-dekadenz-des-kapitalismus [602]
Aktuelles und Laufendes:
- Klassenkampf [603]
- Spanien [512]
- Movistar [604]
- Streik [605]
Rubric:
Die deutsche Politik und das Flüchtlingsproblem: Ein Spiel mit dem Feuer
- 2292 Aufrufe
Der folgende Artikel ist ein Beitrag zur Flüchtlingsfrage, wie sie sich heute in Deutschland stellt. Gewisse Aspekte der Analyse sind nicht ohne weiteres auf andere Länder Europas übertragbar. So präsentiert sich beispielsweise das im Artikel behandelte demographische Problem in Ländern wie Frankreich nicht, in Spanien oder Italien anders, da in diesen Ländern trotz tiefer Geburtenrate eine hohe Jugendarbeitslosigkeit besteht. Aufgrund des politischen und wirtschaftlichen Gewichts Deutschlands in der EU und mit ihr in der Welt ist aber der Artikel über die nationalen Grenzen hinaus von Belang.
Als Anfang September Bundeskanzlerin Merkel ebenso aufsehenerregend wie plötzlich für die vielen Tausenden unter unwürdigen Bedingungen im und um den Budapester Hauptbahnhof campierenden Flüchtlinge die Tore ins Gelobte Deutschland weit öffnete (und seither mehr oder weniger offen ließ), als sie die Öffnung der Grenzen für syrische Flüchtlinge mit für ihre Verhältnisse geradezu emotionalen Worten gegen die aufkeimende Kritik aus den eigenen Reihen verteidigte und trotz der immer offeneren Proteste seitens der förmlich überrannten Kommunen feststellte, dass es keine Obergrenze für politische Flüchtlinge gebe, da fragte sich alle Welt, warum sich Merkel, die bisher bekannt dafür war, dass sie „vom Ende aus denkt“, sprich: alle Konsequenzen gründlich miteinander abwägt, ehe sie handelt, auf dieses „Abenteuer“ eingelassen hat. Denn es ist in der Tat eine Rechnung mit etlichen Unbekannten, die der Großen Koalition präsentiert wird. So stellt sich ihr die Frage, wie man diesen Flüchtlingsstrom stoppen kann; war bis vor kurzem noch die Rede von 800.000 Flüchtlingen, die in diesem Jahr nach Deutschland kommen, so kursieren mittlerweile Prognosen in der Öffentlichkeit, die von mindestens anderthalb Millionen ausgehen. Auch scheint sich Merkel, was ungewöhnlich wäre, hinsichtlich der Wirkung, die die Politik des ausgestreckten Arms auf die einheimische Bevölkerung ausübt, verkalkuliert zu haben; zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit ist sie laut Umfragen in der Gunst des Wählers gefallen, ja gar von einem Sozialdemokraten (Außenminister Steinmeier) überholt worden. Und der Eindämmung des Rechtspopulismus hat sie einen Bärendienst erwiesen; der nicht endende Strom von vorwiegend muslimischen Flüchtlingen ist Wasser auf den Mühlen der AfD, die in Umfragen zumindest in Thüringen mit der drittstärksten Partei, der SPD, gleichgezogen hat.
Warum also hat sich die Regierungskoalition unter Führung von Merkel und Gabriel auf dieses riskante Spiel eingelassen? Geschah dies, um nach dem Merkel-Bashing im Zusammenhang mit der Griechenland-Krise das eigene Image aufzupolieren oder gar aus reiner Gefühlsduselei? Mag sein, dass Merkels Rührung auf ihrem letzten „Townhall-Meeting“ angesichts des Schicksals jenes von der Abschiebung bedrohten palästinensischen Mädchens und Gabriels Gefühlswallungen angesichts des nicht minder grausamen Schicksals der syrischen Familie in dem von ihm besuchten Flüchtlingslager in Jordanien echt waren; auch bürgerliche Politiker sollen bekanntlich ja ein Gefühlsleben haben. Doch ausschlaggebend für diese Politik der offenen Tür waren nach unserem Dafürhalten andere, weitaus profanere Gründe. Es sind Motive, die nicht so altruistisch und selbstlos sind wie der Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer aus der Bevölkerung, ohne die das Chaos, was sich bereits heute in den Anlaufstellen für die Asylsuchenden abspielt, noch ungleich größer wäre. Es sind Beweggründe, deren Relevanz die Risiken und Nebenwirkungen einer solchen Politik weit übersteigt. Gehen wir die Ziele, die die „Politik der offenen Grenzen“ insgeheim verfolgt, im Einzelnen durch.
Die ökonomischen Vorteile
Schon seit Jahren geistert das Wort von der „Demografiefalle“ durch die Medien. Laut dem Statistischen Bundesamt droht der Bundesrepublik eine Überalterung und Schrumpfung der einheimischen Bevölkerung, die bis zum Jahr 2050 um sieben Millionen auf dann rund 75 Millionen abnehmen soll. Schon seit der Wiedervereinigung 1989 hat die gesamtdeutsche Bevölkerung um drei Millionen abgenommen, insbesondere durch den dramatischen Einbruch in den Geburtenraten Ostdeutschlands. Die deutsche Bourgeoisie ist sich, das zeigt die zahlreiche einschlägige Literatur in den letzten Jahren, im Klaren: Geht dieser Prozess ungebremst weiter, dann führt dies langfristig auf ökonomischer, militärischer und politischer Ebene zu einem erheblichen Bedeutungsverlust des deutschen Kapitalismus.
Bereits heute erweist sich der Mangel an gut ausgebildeten Arbeitskräften als Hemmschuh der ansonsten starken Konjunktur der deutschen Wirtschaft. In rund einem Sechstel aller Berufsgruppen gibt es einen Fachkräftemangel, der zum Teil solch gravierende Züge angenommen hat, dass er die Wettbewerbsfähigkeit etlicher Unternehmen beeinträchtigt, glaubt man den Stimmen von Personalmanagern. Nach einer Studie der Prognos AG („Arbeitslandschaft 2030“) „fehlen (…) 2015 gut eine Million Fachkräfte mit Hochschulabschluss - 180 000 mehr als die Ökonomen vor dem Einbruch für das gleiche Jahr erwarteten. Für Beschäftigte mit Berufsausbildung wird die Lücke nach wie vor auf 1,3 Millionen geschätzt. Und selbst von den Arbeitskräften ohne Berufsausbildung werden den Unternehmen 2015 rund 550 000 fehlen.“ (HANDELSBLATT, 9.10.15) In Ostdeutschland hat der Facharbeitermangel bereits einen verhängnisvollen Kreislauf eingeläutet: Die Abwanderung junger Arbeitskräfte nach Westdeutschland, deren Quote nach wie vor höher als die der Zuwanderer ist, bewirkt die Schließung mittelständischer Unternehmen, was wiederum den Abwanderungsprozess beschleunigt.
In dieser Situation erweist sich der Zustrom der vielen Kriegsflüchtlinge in den letzten Wochen als ein wahrer Segen für die deutsche Wirtschaft. Und Letztere zeigt sich überaus dankbar dafür: Die Telekom bietet ihre Hilfe bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und den verantwortlichen Behörden gegenüber personelle Unterstützung an, Audi spendete eine Million Euro für Flüchtlingsinitiativen, Daimler und Porsche wollen Ausbildungsplätze für junge Flüchtlinge schaffen, Bayer unterstützt Mitarbeiter-Initiativen für Flüchtlinge. Selbstredend, dass die „soziale Verantwortung“, derer sich die Unternehmen rühmen, in Wahrheit einem Eigennutz dient. Es geht schlicht darum, sich das Ausbeutungspotenzial, das in den Flüchtlingen steckt, nutzbar zu machen.
Insbesondere die syrischen Flüchtlinge stellen eine interessante Quelle von Humankapital dar, die die hiesigen Unternehmen so dringend benötigen. Erstens sind sie in der überwiegenden Mehrheit jung; sie könnten mit dazu beitragen, die Altersstruktur in den Betrieben zu verjüngen und – ganz allgemein – den Altersdurchschnitt in der Gesellschaft zu senken. Zweitens sind syrische Flüchtlinge deutlich besser ausgebildet als andere Flüchtlinge, wie Befragungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ergaben. Mehr als ein Viertel von ihnen hat nach eigenen Angaben eine Hochschulausbildung und stellt eine besonders lukrative Quelle von Arbeitskräften dar, deren Qualifikationen als Ingenieure, Techniker, Ärzte, Pflegepersonal u.ä. hierzulande so nachdrücklich (s.o.) gesucht werden. Die deutschen Unternehmen profitieren gleich in zweifacher Hinsicht von diesen Flüchtlingen: Zum einen wird es ihnen ermöglicht, Lücken in ihrem Personal zu schließen; zum anderen zieht das deutsche Kapital aus einem Effekt Nutzen, der bereits in den 1970er Jahren unter dem Begriff „brain drain“ thematisiert worden war: das Absaugen hochqualifizierter Arbeitskräfte aus der sog. Dritten Welt und somit die Einsparung eines beträchtlichen Teils der Reproduktionskosten (d.h. Kosten für Erziehung, Schule, Universität, etc.) zuungunsten der Heimatländer.
Kommen wir zum dritten Pluspunkt, der die syrischen Flüchtlinge derart attraktiv macht für die deutsche Wirtschaft. Es ist die außerordentliche Motivation dieser Menschen, die Spitzenmanager wie den Daimler-Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche so fasziniert. Die Mentalität dieser Menschen, die jahrelang dem Terror von Assads Fassbomben und dem Schrecken des IS hilflos ausgesetzt waren, die bis auf ihr nacktes Leben alles verloren haben und selbst auf ihrer Flucht nach Europa fürchterlichen Erfahrungen ausgesetzt waren, macht sie zu dankbaren Opfern des kapitalistischen Ausbeutungssystems. Der Hölle entkommen, sind sie bereit, für wenig Geld zu schuften, im Bewusstsein, dass es nur aufwärts gehen kann. Es ist dieselbe Mentalität, mit der vor 70 Jahren die „Trümmerfrauen“, statt sich ihrem Schicksal zu fügen und die Hände in den Schoß zu legen, mit bloßen Händen die verwüsteten Städte in Deutschland von ihren Trümmern befreiten und so einen entscheidenden Anteil an Wiederaufbau und „Wirtschaftswunder“ hatten, wie gerne von den Nationalökonomen übersehen wird.
Diese unglaubliche Energie und Initiative, die auch die syrischen Flüchtlinge bewiesen haben, bietet vom Standpunkt der deutschen Bourgeoisie eine gewinnversprechende Quelle des Humankapitals. Ähnlich wie die sog. Gastarbeiter in den 1960er und 1970er Jahren drohen sie zudem auf kurze Sicht zur Verfügungsmasse des Kapitals zu werden, um auch in Zukunft den Druck auf die Löhne und Gehälter hochzuhalten oder gar zu steigern.
Die imperialistische Rendite
Die syrischen Flüchtlinge sind aber auch Manövriermasse für den deutschen Imperialismus, wie sich in den vergangenen Tagen und Wochen im Zusammenhang mit der Zuspitzung des Bürgerkriegs herausgestellt hat. Dies gleich in mehrfacher Hinsicht. So instrumentalisiert die Bundesregierung die Flüchtlingsfrage nicht nur auf moralischer Ebene, indem sie nicht nur die restlichen EU-Länder, sondern ausgerechnet auch das Einwanderungsland per se, die USA wegen deren zögerlicher Aufnahmebereitschaft an den Pranger stellt, sondern auch auf politischer Ebene. Wir haben in den letzten Tagen klare Anzeichen dafür gesehen, dass Deutschland seine Syrien-Politik neu ausrichtet. Geschickt das Flüchtlingsdrama mit einer angeblichen Lösung des Syrien-Konflikts verknüpfend, sind die Hauptrepräsentanten der deutschen Außenpolitik (Steinmeier, Genscher u.a.) dazu übergegangen, die Notwendigkeit zu betonen, Russland, den Iran und (vorübergehend) gar den Fassbomber Assad in den sog. Friedensprozess für Syrien einzubinden. Mehr noch, Berlin ist sich mit dem Kreml darin einig, dass der Krieg in der Ostukraine zurückgefahren werden soll, damit sich alle Kräfte auf die Bewältigung der Situation in Syrien konzentrieren können. Nicht einmal die Tatsache, dass Putin mit der Stationierung zusätzlicher militärischer Kräfte im syrischen Latakia Nägeln mit Köpfe macht, hat die Bundesregierung sonderlich irritiert. Wirtschaftsminister Gabriel fordert gar ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland, schließlich könne „man nicht auf der einen Seite Sanktionen dauerhaft aufrechterhalten und auf der anderen Seite darum bitten (…), zusammenzuarbeiten“.
Mit dieser Neuausrichtung begibt sich die deutsche Politik erstmals seit dem Irak-Krieg wieder auf einen offenen Konfrontationskurs gegen die USA. Diese hat in Gestalt des State Departments (Außenministerium) in den letzten Tagen ihren Tonfall gegenüber Assad verschärft und zeigte sich zuletzt angesichts des diplomatischen Vorstoßes Putins auf der vergangenen UN-Generalversammlung alles andere als amüsiert. Ihr Verhältnis zum IS ist dagegen zumindest sehr ambivalent; ihre Rolle beim Durchbruch des IS zu einer Massenbewegung war äußerst dubios, und die Halbherzigkeit, mit der die USA ihm zu Leibe rückt, lässt viele Fragen hinsichtlich der wahren Absichten des US-Imperialismus gegenüber dieser Terrororganisation offen.
Der Kurswechsel in der deutschen Außenpolitik scheint zum Teil auch das Ergebnis der Interventionen und des Drucks der deutschen Industrie zu sein. In ihren Reihen verschärft sich die Kritik an den Sanktionen gegen Russland, zumal immer deutlicher wird, dass der Hauptgeschädigte die deutsche Wirtschaft ist, während US-amerikanische Konzerne wie beispielsweise Bell und Boeing trotz der Sanktionen immer noch glänzende Geschäfte mit den Russen machen. Brach der Umsatz der deutschen Wirtschaft aus dem Russland-Geschäft um mehr als 30 Prozent ein, so wuchs der Handel zwischen den USA und Russland in demselben Zeitraum um sechs Prozent. Neben den ökonomischen Gründen sprechen aber auch politische Argumente aus Sicht des deutschen Kapitalismus gegen die Aufrechterhaltung des Wirtschaftsembargos gegen Russland. In Ermangelung eines militärischen Droh- und Einschüchterungspotenzials, wie es der US-Imperialismus besitzt, muss der deutsche Imperialismus auf andere Mittel zurückgreifen, um seinen Einfluss weltweit geltend zu machen. Eines davon ist seine Wirtschaftsmacht, seine industrielle Potenz, auf deren Grundlage der Ausbau von Handelsbeziehungen durch die deutsche Politik forciert wird. (Ein Aspekt, der die Verquickung von Politik und Business, die politische Instrumentalisierung von Wirtschaftsprojekten aufzeigt, ist der Umstand, dass, wenn der Kanzler/die Kanzlerin zu offiziellen Staatsbesuchen in Ländern wie China, Indien, Brasilien, Russland, etc. unterwegs ist, sich in seinem/ihrem Schlepptau stets die Spitzenmanager deutscher Großkonzerne, aber auch Vertreter mittelständischer Maschinenbauer befinden.) In diesem Sinn bringt die Sanktionspolitik die deutsche Bourgeoisie um mehr als ein paar Aufträge, sie läuft auch ihren imperialistischen Interessen zuwider.
Als weiteres Mittel zur Kompensation seiner militärischen Schwäche sind – und da schließt sich der Kreis – die Massen der von Deutschland aufgenommenen syrischen Flüchtlinge zu betrachten. Man sollte in diesem Zusammenhang nicht die langfristige politische Wirkung unterschätzen, die eine zutiefst menschliche Regung wie die Dankbarkeit auf die Beziehung zwischen ganzen Ländern haben kann. Die offenkundige Sympathie der von der Hilfsbereitschaft großer Teile der einheimischen Bevölkerung tief beeindruckten Flüchtlinge ist ein Pfund, mit dem die deutsche Bourgeoisie wuchern kann. Aus der Dankesschuld, die viele dieser gestrandeten Menschen für Deutschland empfinden, könnte langfristig ein Türöffner für die Interessen des deutschen Imperialismus im Nahen und Mittleren Osten werden, könnten pro-deutsche Fraktionen entwachsen, die in ihren Heimatländern zugunsten deutscher Interessen antichambrieren können.
Der ideologische Nutzen
Was sofort ins Auge sticht, ist der Kostümwechsel des deutschen Nationalismus. Bis vor kurzem, in der Griechenland-Krise, im Ausland noch als „IV. Reich“ tituliert, dessen Repräsentanten gerne mit Nazi-Emblemen geschmückt und als hartherzig, ja gnadenlos dargestellt wurden, sonnen sich Deutschland und seine Epigonen derzeit in ihrem frisch erworbenen Ruhm als Retter der Verdammten dieser Erde. Die Deutschen gelten weltweit als „die Guten“. Nie seit ihrer Gründung war der Ruf der Bundesrepublik so gut wie heute. Neben der Außenwirkung soll dieses Facelifting auch nach innen abstrahlen, und zwar in Gestalt des Demokratismus. Der deutsche Staat geriert sich derzeit als Ausbund an Bürgernähe, Weltoffenheit und Toleranz und treibt damit einen für die Arbeiterklasse verhängnisvollen Prozess an – die Auflösung der sozialen Klassen in der nationalen Einheit. Und Bundeskanzlerin Merkel, die kühle Physikerin, findet offenbar zunehmend Gefallen an ihrer neuen Rolle der Heiligen Johanna der Asylsuchenden. Wie sagte sie noch? „Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist dies nicht mein Land“.
Treffender kann man es nicht sagen. In der Tat geht es lediglich darum, ein nettes Gesicht zu machen; hinter der freundlichen Miene wird munter weiter gehetzt und gespalten. So findet parallel zur „Willkommenskultur“ eine zynische Spaltung zwischen Kriegsflüchtlingen und „Scheinasylanten“, eine gnadenlose Aussonderung der sog. Wirtschaftsflüchtlinge, zumeist junge Leute aus dem Balkan ohne jegliche Perspektive außer der Verelendung, statt. Flugs haben sich Bund und Länder darauf verständigt, den Kosovo, Serbien und Montenegro wider besseres Wissen zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären, womit jeglicher Asylgrund für Menschen aus dieser Region entfällt. Doch auch die „echten“ Asylsuchenden sind nicht sakrosankt vor den Giftspritzen aus Politik und Medien, wie die Attacken von Bundesinnenminister de Maizière gegen renitente Flüchtlinge zeigen.
Darüber hinaus werden bestimmte Medien, trotz aller Durchhalte-Rhetorik seitens der Bundeskanzlerin („Wir schaffen das“), nicht müde, Panik und Ängste in der einheimischen Bevölkerung zu schüren. Da wird von ganzen Völkern gesprochen, die sich auf dem Weg nach Europa machen, da wird die Gefahr von terroristischen Anschlägen durch islamistische „Schläfer“ im Flüchtlingsheer beschrien und darüber gemunkelt, wann die Stimmung in der Bevölkerung „umkippt“. Vor allem aber schwillt der Chor jener an, die hysterisch vor einer „Überforderung“ Deutschlands angesichts der Flüchtlingsmassen warnen und zetern, dass das Boot voll sei.
Es ist nicht schwer zu ermessen, welcher Weg, Öffnung oder Schließung der Grenzen, sich letztendlich durchsetzen wird. Die „Politik der offenen Grenzen“ war, davon kann man ausgehen, ein einmaliges Intermezzo; die nahe Zukunft wird von einer weiteren Abriegelung der Grenzen geprägt sein, sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene. In Zukunft soll, so sind die Pläne, die Auswahl der für Deutschland „nützlichen“ Asylanten schon vor Ort, in den Heimatländern erfolgen. Besonders perfide ist die Kampagne gegen die sog. Schleuser bzw. Schlepper, die sich beileibe nicht nur gegen gewerbsmäßige Schleuserbanden richtet, sondern auch gegen durchaus professionelle, jedoch nicht gewinnorientierte Fluchthelfer. „Die Europäische Union, die ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sein will, und ihre Mitgliedstaaten haben ein System geschaffen, das es verfolgten, gequälten und erniedrigten Menschen, die dringend Hilfe benötigen, nahezu unmöglich macht, ohne professionelle Fluchthilfe Schutz in Europa zu finden. Diese Helfer dann vor Strafgerichte zu stellen und in Gefängnisse zu sperren, ist pharisäerhaft, widersprüchlich und zutiefst inhuman“, schreibt hierzu der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) in seinem Infobrief „Lob der Schleuser“.
Es ist unbestritten, dass die Welt derzeit ein Flüchtlingsdrama nie gekannten Ausmaßes erlebt. Waren 2013 noch 51,2 Millionen Menschen auf der Flucht, so stieg die Zahl der Flüchtlinge Ende 2014 auf 59,5 Millionen – der höchste Zuwachs binnen eines Jahres und die höchste jemals von der UN-Flüchtlingsagentur UNHCR verzeichnete Gesamtzahl von Flüchtlingen weltweit. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Dinge allmählich aus der Kontrolle geraten. Nach Syrien droht nun auch Libyen in einen finalen Bürgerkrieg zu entgleiten – mit all den aus Syrien bekannten Folgen. In den Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien und in der Türkei, wo der weitaus größte Teil der syrischen Kriegsflüchtlinge Asyl gefunden hat, droht eine weitere Massenabwanderung Richtung Europa, nachdem die UN ihre Hilfen drastisch zusammengestrichen hat, denn nun gesellt sich zur trostlosen Perspektivlosigkeit auch noch der Hunger hinzu.
Dennoch sind die Medien geradezu erpicht darauf, die ohnehin schlimmen Zustände zu überdramatisieren, noch eins drauf zu setzen. So geistert seit einiger Zeit der Begriff der Völkerwanderung durch die Öffentlichkeit, und im Fernsehen wird das Schreckensszenario verbreitet, dass Millionen von Afrikanern auf gepackten Koffern säßen und nur auf eine Gelegenheit warteten, ihr Glück in Europa zu versuchen. Beide Aussagen dienen offenbar dem Versuch, die einheimische Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, und entsprechen – zumindest noch - nicht den Tatsachen. Schaut man sich die Fluchtbewegungen genauer an, so stellt man fest, dass der Löwenanteil der weltweiten Flüchtlinge Unterschlupf in den Nachbarländern ihrer Heimat sucht; erst wenn sich jede Hoffnung auf eine Rückkehr zerschlagen hat, nehmen jene Flüchtlinge, die es sich finanziell leisten können, den langen, lebensgefährlichen Weg nach Europa, Nordamerika und Australien auf sich. Und auch das Gerücht vom Massenexodus aus Afrika entbehrt bisher jeder Grundlage; die Migration auf dem schwarzen Kontinent ist weitaus weniger chaotisch, als es die Schreckensmeldungen der Medien vermuten lassen. Häufig verkaufen ganze Dorfgemeinschaften ihr bewegliches Hab und Gut, um einen einzigen jungen Mann aus der Mitte der Gemeinschaft die Flucht nach Europa zu finanzieren, der dann verantwortlich für die künftige Unterstützung des Dorfes ist - ein seit Jahrzehnten erprobtes Modell der Arbeitsmigration.
Dennoch: aufgeschreckt durch die anschwellenden Flüchtlingszahlen, sieht sich die Bundesregierung veranlasst, den tieferen Ursachen des Flüchtlingsdramas auf den Grund zu gehen, wie sie sagt. Allein, der Berg kreißte und gebar eine Maus: Alles, was Merkel & Co. zur grundsätzlichen Lösung dieses globalen Problems einfällt, sind schöne Worte und ein paar Hundert Millionen Euro aus der Portokasse zur Finanzierung der Flüchtlingslager in der Türkei und im Libanon. Kein Wort über die Mitwirkung der führenden Industrienationen bei der Vernichtung der Existenzgrundlagen für den Großteil der Menschheit in der Dritten Welt. Lassen wir noch einmal den RAV zu Wort kommen, der den wahren Ursachen des Elends in den sog. Entwicklungsländern weitaus näher kommt, auch wenn er die eine oder andere Ungenauigkeit aufweist (wer ist mit „Europäer“ gemeint, wer ist „wir“?): „Europa hat für viele dieser Gründe die Ursachen gesetzt und tut dies noch heute. Die politischen Verhältnisse, die die europäischen Kolonialmächte bei ihrem Rückzug hinterlassen haben, einschließlich oft willkürlicher Grenzziehungen, sind nur ein Teil davon. Vom 16. bis 18. Jahrhundert sind Europäer in Südamerika eingefallen und haben, bis an die Knie in Blut watend, schiffsladungsweise Gold und Silber geraubt, das in Europa das Startkapital für die aufblühende Wirtschaft darstellte. Europäer haben ca. 20 Millionen Afrikaner zu Sklaven gemacht und in alle Welt verkauft. Durch die Ausbeutung ihrer Rohstoffe, das Leerfischen ihrer Meere, die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft für Billigprodukte und den Export hochsubventionierter Lebensmittel, die die Landwirtschaft dieser Länder vernichtet, stehen wir heute noch auf den Schultern der Bevölkerung der meisten Fluchtländer.“ (ebenda)
Populismus und Pogromismus
Die Bildung der modernen Nationalstaaten in den Industrieländern des 19. Jahrhunderts stand auf zwei Fundamenten. Das eine Fundament war ein sehr rationales – die wirtschaftliche Zentralisierung -, das andere dagegen war irrationaler Natur: Die Nationenbildung im 18. und 19. Jahrhundert fand auf der Grundlage von Gründungsmythen statt, die alle möglichen nationalen Narrative beinhalten konnten, die aber alle eine Grundidee, ein gemeinsamer erfundener Mythos eint: die Mär von der großen nationalen Gemeinschaft bzw. Familie, die sich definiert durch die gemeinsame Abstammung („Blutsverwandtschaft“), Kultur und Sprache. Dieser nach innen gerichtete, sich nach außen abschottende Charakterzug der bürgerlichen Nation auf der einen Seite bildet zusammen mit dem nach außen gerichteten, die Welt erobernden Streben des einzelnen Kapitalisten auf der anderen Seite einen der Hauptwidersprüche, in dem der Kapitalismus unentrinnbar feststeckt.
Wie heikel es ist, beide Prinzipien unter einen Hut zu bekommen, zeigt sich gerade in der aktuellen Flüchtlingskrise. Ginge es allein nach den Wirtschaftsführern, so sollte der Strom der zumeist sich im besten Arbeitsalter befindlichen Flüchtlinge möglichst nie abreißen. Sie hätten kein Problem damit, wenn eine Million Flüchtlinge kommen – jährlich. Doch was wirtschaftlich durchaus Sinn macht, könnte politisch fatale Folgen haben. Denn im Kapitalismus sind Flüchtlinge nicht nur arme Habenichtse, sondern zugleich auch Konkurrenten im Kampf um Wohnungen, Sozialfürsorge, Arbeitsplätze. Für den Kapitalisten ist dies kein Anlass zum Fürchten, für die armen Bevölkerungsschichten, für die Hartz IV-Empfänger, Niedriglohnbeschäftigten, für die hiesigen Entwurzelten sehr wohl.
Es ist bekanntlich nicht das erste Mal, dass Deutschland von einer Flüchtlingswelle überrollt wurde. In den ersten fünf Nachkriegsjahren (1945-50) strömten über zwölf Millionen Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten und aus Böhmen und Mähren nach Deutschland, das selbst in Trümmern lag und dessen eigene Bevölkerung darbte. Es liegt auf der Hand, dass von einer „Willkommenskultur“ damals nicht die Rede sein konnte; im Gegenteil, die Vertriebenen stießen auf massive Ressentiments, Ablehnung und Hass unter den Einheimischen. Dennoch gelang die gesellschaftliche, nicht nur berufliche Integration der Vertriebenen viel reibungsloser als befürchtet, was vor allem an zwei Umständen lag: erstens an der Tatsache, dass die Vertriebenen aus dem gleichen Sprach- und Kulturraum kamen; zweitens an den Begleitumständen des Wiederaufbaus, der mit der Währungsunion zumindest in Westdeutschland ins Rollen kam und der sämtliche verfügbare Arbeitskraft aufsog, so dass es die Unternehmen waren, die im Kampf um die raren Arbeitskräfte Konkurrenz zueinander standen. Heute dagegen kommen die Flüchtlingsmassen durchweg aus einem fremden Kultur- und Sprachraum und stoßen auf eine Gesellschaft, die sich schon seit vielen Jahren in einer krisenhaften, allgemeinen und sich immer weiter zuspitzenden Abwärtsbewegung befindet und in der die Verteilungskämpfe um Arbeit, Wohnraum, Bildung ungeahnte Ausmaße angenommen haben, dabei immer größere Bevölkerungsteile in die Armut katapultierend.
Wenn sich dann zur allgemeinen Krise auch noch eine Perspektivlosigkeit, der Mangel an einem gesellschaftlichen Gegenentwurf zum kapitalistischen Elend hinzugesellt, feiert der politische Populismus, der sich aus einem Phänomen speist, das Marx die „Religion des Alltagslebens“ nannte, Hochzeit. Es handelt sich um die Mentalität des „kleinen Mannes“, der nicht anerkennen will, dass der Kapitalismus, anders als die früheren Gesellschaftsformen, ein entpersonalisiertes, verdinglichtes System ist, in dem selbst der einzelne Kapitalist kein souveräner Akteur auf dem Markt ist, sondern ein Getriebener desselben oder – wie Engels sagt – ein von seinem eigenen Produkt Beherrschter und in dem die politische Klasse von „Sachzwängen“ und nicht von Vorlieben geleitet wird. Es ist die Geisteshaltung des beleidigten Spießbürgers, der sich zwar gegen die Politik der herrschenden Klasse auflehnt und gegen „seine“ politischen Repräsentanten zetert, der sich aber letztendlich doch wieder den eben noch beschimpften „Volksverrätern“ an die Brust wirft, in der Hoffnung, Schutz bei ihnen zu finden vor der Bedrohung durch die „Fremden“. Es ist eine durch und durch reaktionäre Denkweise, die den Konformismus als höchstes Ideal feiert und willens ist, Pogrome gegen Andersdenkende, Andersfarbige und Andersartige zu entfesseln.
Die vorwiegend im Osten Deutschlands ansässige Pegida-Bewegung ist ein genauso anschauliches wie abstoßendes Beispiel für diese äußerst engstirnige, intolerante und scheinheilige Geisteshaltung. Ihr Schlachtruf „Wir sind das Volk“ blendet völlig aus, dass die Arbeiterklasse bzw. das „Volk“ (um in ihrem Jargon zu bleiben) in Deutschland und anderswo nie - und heute noch weniger denn je - solch eine homogene Zusammensetzung aufwies, wie diese Bewegung fantasiert. Sowohl ihr Boykott der sog. „Lügenpresse“ als auch ihr Wutgeheul gegen die etablierten Parteien (einschließlich der Morddrohungen gegen Politiker) bilden lediglich ihre Enttäuschung über den „Verrat“ durch Politik und Medien ab, als sei es Aufgabe dieser zutiefst bürgerlichen Institutionen, „Volkes Wille“ wiederzugeben bzw. zu vertreten. In Wahrheit richtet sich, wie ihre Aufläufe vor Flüchtlingsheimen, ihre feigen Anschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte und Ausländer Tag für Tag beweisen, ihr zügelloser Hass nicht gegen die Herrschenden, sondern gegen die Schwächsten der Gesellschaft. Als Sündenbock für ihr eigene verkorkste Existenz (man denke nur an die kleinkriminelle Vergangenheit eines Lutz Bachmann!) müssen, was ganz typisch ist für den Pogromismus, ausgerechnet jene Teile der Bevölkerung herhalten, die sich am wenigsten wehren können.
Das Problem des Populismus und Pogromismus zwingt die etablierten Parteien, insbesondere die Regierungsparteien, dazu, mit dem Feuer zu spielen. Sie gleichen in ihrem Handeln dem berühmten Zauberlehrling, der den (Un-)Geist der Panik und Fremdenfeindlichkeit aus der Flasche entlässt und dabei riskiert, die Kontrolle über ihn zu verlieren. Bisher ist es der deutschen Bourgeoisie im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Staaten gelungen, den Aufstieg einer populistischen Partei, ob rechts oder links, zu verhindern, was ihr aufgrund der unseligen Vergangenheit ein besonders wichtiges Anliegen ist. Ob dies so bleibt, hängt auch von der Bewältigung der Flüchtlingskrise ab. Bisher deuten alle Zeichen darauf hin, dass besonders die rechtspopulistischen Kreise von der Merkel-Politik profitieren. Neben der AfD, die, wie eingangs erwähnt, in Meinungsumfragen derzeit zulegt, scheint auch die o.g. Pegida-Bewegung ihren zweiten Frühling zu erleben. Auf den letzten „Montagsspaziergängen“ in Dresden kamen wieder weit über 10.000 Menschen, deren Aggressionspotenzial deutlich zugenommen hat – sowohl verbal als auch tätlich.
Wie geht die deutsche Bourgeoisie mit diesem Problem um? Zunächst ist festzustellen, dass einerseits die politische Klasse den Anschlägen rechter Dumpfbacken nicht mehr entgegentritt, indem sie sie, wie bislang, verharmlost und banalisiert, sondern indem sie sie neuerdings als „terroristisch“ etikettiert. Dies ist insofern wichtig, als der Begriff „Terrorismus“ in Deutschland bestimmte Reflexe hervorruft und Assoziationen zum II. Weltkrieg, als massenhaft so genannte Saboteure ohne viel Federlesens exekutiert wurden, oder zum „Deutschen Herbst“ 1977 weckt, in dem die Terroristen der RAF zu Staatsfeinden hochgejazzt wurden. Zudem fährt der Staat mit dem Terrorismus-Vorwurf auch juristisch und polizeilich schweres Geschütz auf, um zu verhindern, dass der Mob nicht allzu sehr über die Stränge schlägt. Gleichzeitig wurde die AfD gespalten und bekam in den Medien ihr Fett weg. Zuletzt konnte man auch beobachten, wie Politik und Medien darum bemüht waren, die Pegida-Bewegung in die Nähe des Neonazismus zu rücken, was ja schon immer ein probates Mittel war, um Protestbewegungen, gleich welcher Couleur, gesellschaftlich zu isolieren.
Andererseits bieten die etablierten Parteien alles auf, um den Eindruck zu erwecken, sie verstünden die Sorgen und Ängste der Bevölkerung. So versucht die Bundesregierung andere EU-Länder mit moralischem Druck und finanziellen Versprechungen dazu zu veranlassen, Deutschland einen Teil der syrischen Flüchtlinge abzunehmen – bisher ohne Erfolg. Hektisch bastelt die große Koalition ein Gesetz zur Ermöglichung von Turbo-Abschiebung („beschleunigtes Abschiebeverfahren“) zusammen und bringt dabei das Kunststück fertig, es bereits anzuwenden, bevor es offiziell in Kraft tritt, nur um dem Wahlvolk verkünden zu können, man schütze es vor „Überfremdung“. Schon spricht man in der Regierung offen von einer Abschiebequote von bis zu 50 Prozent aller in Deutschland ankommenden Flüchtlinge. Es sind vor allem der CSU-Vorsitzende Seehofer und sein Generalsekretär Söder, die in diesem arbeitsteiligen Prozess die bad guys spielen und vehement die Schließung der Grenzen sowie eine Einschränkung des im Grundgesetz verankerten Asylrechts verlangen.
Die Konsequenzen für die Lage der Arbeiterklasse
In einem gewissen Sinn spiegeln die unterschiedlichen Auffassungen in der Koalition das diffuse Stimmungsbild innerhalb der Bevölkerung, d.h. unter den Beschäftigten und Arbeitslosen dieses Landes, wider. Es gibt eine wachsende und lautstarke Minderheit in der Bevölkerung im Allgemeinen und in der Arbeiterklasse im Besonderen, die, eher zum bildungsfernen Milieu zählend, oftmals im Schatten der verblichenen DDR sozialisiert und/oder von staatlicher Stütze lebend, den Resonanzboden für die antimuslimischen Kampagnen bestimmter Sprachrohre aus Politik und Kultur (Sarrazin, Broder, Pirinçci, Buschkowsky, etc.) bilden und als deren Fürsprecher die CSU und Teile der CDU auftreten. Und es gibt die schweigende Mehrheit, die es bisher jungen Aktivisten, zumeist aus dem Antifa-Milieu stammend, überlassen hatte, Widerstand in Form von Straßenblockaden und Gegendemos gegen den rassistischen Mob zu leisten, nun aber, angesichts der Elendsbilder vom Balkan, sich bemüßigt fühlte, ihren Protest gegen die Untätigkeit der europäischen Staaten und ihre Empörung über die fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Dresden, Heidenau und Freital vernehmbar zu artikulieren, sei es, dass sie fast schon demonstrativ applaudierend Spalier standen für die in den Bahnhöfen von München, Frankfurt und anderswo ankommenden Flüchtlinge, sei es, dass sie sich zu Tausenden als freiwillige und unbezahlte Helfer für die Bewältigung der Flüchtlingsmassen meldeten oder die Anlaufstellen mit Spenden aller Art überschwemmten.
Die spontane Solidarisierung weiter Teile der Bevölkerung hat in dieser Wucht die Herrschenden sicherlich überrascht und auf dem falschen Fuß erwischt, stand diesen doch nicht im Sinn, um Sympathie für die Kriegsflüchtlinge zu werben, sondern eine Atmosphäre der Panik und Isolation zu schaffen. Doch Merkel bewies wieder einmal ihr Gespür für die Stimmungen und Befindlichkeiten in der Gesellschaft. Ähnlich wie im Zusammenhang mit dem GAU im Kernkraftwerk von Fukushima, als sie quasi über Nacht eherne Grundsätze der Konservativen in Sachen Atomenergie zum Alteisen geworfen hatte, leitete sie nun abrupt eine Kehrtwende in der Asylpolitik ein und hob ganz nebenbei das sog. Dubliner Abkommen auf, das es der deutschen Bourgeoisie bis dahin erlaubt hatte, sich elegant aus der Verantwortung für die in Italien und in anderen EU-Ländern mit Außengrenzen gestrandeten Flüchtlinge zu stehlen.
Einige der Gründe, die Merkel zur „Politik der offenen Grenzen“ bewogen haben mag, haben wir in diesem Text bereits genannt. Möglicherweise spielt aber noch ein weiteres Motiv eine Rolle in ihrem riskanten Spiel. Spätestens seit den Bundestagswahlen von 2005, als sie einen sicher geglaubten Wahlsieg fast noch verspielt hatte, weil es dem amtierenden Bundeskanzler Schröder gelungen war, ihren auf dem Leipziger Parteitag von 2003 eingeläuteten wirtschaftsliberalen Kurswechsel gegen sie zu instrumentalisieren, hat sie gelernt, welche Konsequenzen es haben kann, wenn die politischen Repräsentanten nonchalant die Stimmung „an der Basis“ ignorieren. Nicht auszudenken, welche Auswirkungen die Bilder von Hunderttausenden von sich selbst überlassenen Flüchtlingen an der ungarischen Grenze, die stattdessen die Schlagzeilen heute und in den nächsten Monaten beherrscht hätten, auf das Wahlverhalten jener gehabt hätte, die heute die Kriegsflüchtlinge aus Syrien willkommen heißen.
Es hat den Anschein, als seien zwei Bevölkerungsgruppen besonders stark in der Solidarisierung mit den Flüchtlingen involviert. Zum einen junge Menschen, die zu anderen Zeiten und anderen Gelegenheiten sich ebenso gut an den Anti-CPE-Protesten oder der Bewegung der Indignados beteiligt hätten. Zum anderen betagte Menschen, die entweder aus eigener Erfahrung oder durch die Überlieferungen ihrer Eltern über die Vertriebenen nach dem II. Weltkrieg das Los von Flüchtlingen kennen und nicht gleichgültig gegenüber Stacheldraht, Lager und Deportationen sein können. Aufgewachsen in den dunklen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, ist diese Generation auch vom Impuls angetrieben, es heute anders zu machen. Die zahlreiche Beteiligung der Rentner zeigt aber noch etwas Anderes: die tiefe Sehnsucht vieler alter Menschen nach einer Verjüngung der Gesellschaft, nach der Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen. Diese Sehnsucht nach Verjüngung unterscheidet sich vom Verlangen der deutschen Wirtschaft nach jungen Arbeitskräften. Die Überalterung der Gesellschaft ist ein zentrales Problem nicht nur für den Kapitalismus, sondern für die Menschheit schlechthin, denn die Abwesenheit der Jugend bedeutet nicht nur den Verlust an Lebensfreude und Vitalisierung für die Alten, sondern auch und vor allem die Beeinträchtigung einer ihrer wichtigsten Funktionen in der Evolution der Menschheit: den Transfer ihres Erfahrungsschatzes an die Enkel(Innen)generation.
Stellt sich abschließend die Frage, ob diese Welle der Solidarisierung eine Klassenbewegung ist. Wir denken, dass ihr dafür sämtliche Insignien fehlen. Was ins Auge sticht, ist ihr völlig unpolitischer Charakter; im Gegenteil, die zutage tretende Hilfsbereitschaft hat durchweg karitative Züge. Es gibt so gut wie keine Diskussionen, keinen Austausch von Erfahrungen zwischen Jung und Alt, zwischen Einheimischen und Flüchtlingen (Letzteres auch bedingt durch die Sprachbarrieren). Es fehlt jeglicher Ansatz zu außerstaatlichen, autonomen Strukturen, zur Selbstorganisation; stattdessen machen sich die Hunderttausenden von Helfer/Innen zu Handlangern eines Staates, der es trotz Merkels Kraftmeierei an allem fehlen lässt und dessen Repräsentanten jetzt, nachdem sie die freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer/Innen durch eigene Untätigkeit in die Erschöpfung getrieben haben, von den „Grenzen der Belastbarkeit“ faseln.
Noch einmal: die Welle der Solidarisierung, die in den vergangenen Wochen durch Deutschland ging, fand nicht auf einem Klassenterrain statt. Die arbeitende Bevölkerung als das Hauptsubjekt der Solidarität hat sich nahezu spurlos im „Volk“ aufgelöst. Dies war auch bei der weltweiten Solidarität für die Opfer des Tsunamis 2004 der Fall. Damals wie heute ging der Solidarität jeglicher Klassencharakter ab, fand sie im Rahmen einer klassenübergreifenden Kampagne statt. Doch im Unterschied zum Tsunami, der sich weit weg, in Asien, ereignete, entfaltet sich das Flüchtlingselend direkt vor unserer Haustür, so dass die Solidarität und Betroffenheit von einem ganz anderen Kaliber sind.
In der Tat kann die Flüchtlingskrise, die gerade erst begonnen hat, zu einer Gretchenfrage für die Arbeiterklasse werden. Es ist noch nicht ausgemacht, wie die Arbeiterklasse bzw. ihre ausschlaggebenden Teile national wie international auf diese Herausforderung reagieren werden – mit Solidarität oder mit Ab- und Ausgrenzung. Wenn es unserer Klasse gelingt, ihre Identität wiederzufinden, kann die Solidarität ein wichtiges, verknüpfendes Mittel in ihren Kämpfen sein. Wenn sie allerdings in den Flüchtlingen nur den Konkurrenten sieht und als Bedrohung wahrnimmt, wenn es ihr nicht glückt, eine Alternative zum kapitalistischen Elend zu formulieren, in der kein Mensch mehr gezwungen ist, aus seiner Heimat zu fliehen, sei es, weil er vom Krieg oder vom Hunger bedroht ist, dann droht uns eine massive Ausbreitung der Pogrommentalität, von der auch die Kernbereiche der Arbeiterklasse nicht verschont bleiben werden.
FT, 7.11.2015
Aktuelles und Laufendes:
- Deutschland [606]
- Flüchtlinge [607]
Rubric:
Weltrevolution - 2016
- 786 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 181
- 1128 Aufrufe
Bericht und Präsentation über die nationale Lage Deutschlands
- 2394 Aufrufe
Die gemeinsame Konferenz der Sektionen der IKS in Deutschland und der Schweiz, die im März 2016 stattfand, verabschiedete neben anderen Dokumenten einen Bericht über die nationale Lage in Deutschland, den wir hier veröffentlichen. Dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Stattdessen konzentriert er sich auf Punkte, die wir für besonders wichtig halten, um einen Denk- und Diskussionsprozess anzustoßen. Da diese Aspekte im Allgemeinen die dramatischen Ereignisse der gegenwärtigen Lage als Ausgangspunkt haben, fügen wir diesem Bericht die Präsentation hinzu, die auf der Konferenz vorgestellt wurde und die teilweise dazu diente, den Bericht zu aktualisieren. Kritische Kommentare zum Bericht und zur Präsentation, die im Verlauf der sich anschließenden Debatte gemacht wurden, sind als Fußnoten der Präsentation beigefügt. Angesichts der Bedeutung der Entwicklungen im zentralsten Land des europäischen Kapitalismus heute hoffen wir, dass diese Texte ein vom Standpunkt des Proletariats positiver Beitrag zum notwendigen Denkprozess über die gegenwärtige Weltlage sind.
Bericht über die nationale Lage in Deutschland (Februar 2016)
Die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Kapitals von heute
Da der deutsche Nationalstaat erst 1870 konstituiert wurde und spät an der imperialistischen Aufteilung der Welt teilnahm, hatte er sich nie als eine führende Finanz- und Kolonialmacht etablieren können. Die Hauptgrundlage seiner Wirtschaftsmacht war und blieb seine hocheffiziente Industrie und Arbeitskraft. Während die östlichen Teile (DDR) als Teil des Ostblocks ökonomisch zurückfielen, war Westdeutschland (BRD) in der Lage, diese Grundlage zu konsolidieren und sogar noch weiter auszubauen. Bis 1989 wurde die BRD zur weltweit führenden Exportnation, mit dem niedrigsten Staatsdefizit unter sämtlichen Führungsmächten. Trotz vergleichsweise hoher Löhne war ihre Wirtschaft äußerst wettbewerbsfähig. Sie profitierte wirtschaftlich auch von den neuen weltweiten Handelsmöglichkeiten, die durch den westlichen Block eröffnet wurden, und vom eingeschränkten Rüstungsetat, den sie als Hauptverlierer der beiden Weltkriege hatte.
Auf politischer und territorialer Ebenen nutznießte die BRD 1989 am meisten vom Zusammenbruch des Ostblocks, indem sie die frühere DDR schluckte. Doch wirtschaftlich stellte die plötzliche Einnahme dieser Zone, die hoffnungslos hinter den internationalen Standards zurückgefallen war, auch eine beträchtliche Last dar, vor allem finanziell. Eine Bürde, die die Wettbewerbsfähigkeit des neuen, größeren Deutschland beeinträchtigte. In den 1990er Jahren verlor Deutschland auf dem Weltmarkt an Boden, während das Niveau des Staatsdefizits sich jenen der anderen führenden Mächte anzunähern begann.
Heute, ein Vierteljahrhundert später, hat Deutschland mehr als nur verlorenen Boden gutgemacht. Knapp hinter China ist Deutschland der zweitgrößte Exporteur der Welt. Letztes Jahr wies der Staatshaushalt ein Plus von 26 Milliarden Euro auf. Das Wachstum war mit 1,7 Prozent bescheiden, doch für ein hochentwickeltes Land dennoch eine Leistung. Die offizielle Arbeitslosenquote ist auf ihren niedrigsten Stand seit der „Wiedervereinigung“ gedrückt worden. Die Politik, eine hochentwickelte Industrieproduktion in Deutschland zu erhalten, war bisher eine Erfolgsgeschichte gewesen.
Natürlich ist die Voraussetzung dieses Erfolges eine hohe organische Zusammensetzung des Kapitals, das Produkt eines alten Industrielandes mit mindestens zwei Jahrhunderten der Akkumulation auf dem Rücken. Doch in diesem Zusammenhang sind die hohen Fertigkeiten und Qualifikationen seiner Bevölkerung entscheidend für seinen Wettbewerbsvorteil. Vor dem I. Weltkrieg war Deutschland zum Hauptzentrum der wissenschaftlichen Entwicklung und Anwendung in der Produktion geworden. Mit der Katastrophe des Nationalsozialismus und des II. Weltkrieges verlor es diesen Vorteil, und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich davon erholt hat. Was jedoch geblieben ist, ist sein Know-how im eigentlichen Produktionsprozess. Seit dem Niedergang der Hanse war Deutschland nie mehr eine führende, langlebige maritime Macht gewesen. Obwohl sein Boden im Durchschnitt weniger fruchtbar ist als die französische Erde, war Deutschland lange Zeit eine im Kern bäuerliche Ökonomie. Seine natürlichen Vorteile lagen in seiner geographischen Lage im Herzen Europas und in den wertvollen Metallen, die bereits im Mittelalter abgebaut wurden. Heraus kam ein großes Geschick für handwerkliche und industrielle Arbeit sowie Kooperation und ein Know-how, das weiterentwickelt wurde und von einer Generation zur nächsten überging. Zwar hatte seine industrielle Revolution enorm von den großen Kohlevorkommen profitiert, doch machte der Niedergang der Schwerindustrien ab den 1970er Jahren deutlich, dass das Herz des wirtschaftlichen Aufstiegs Deutschlands nicht die Schwerindustrie war, sondern seine Effizienz in der Produktion von Produktionsmitteln und, etwas allgemeiner, in der Umwandlung von lebendiger in tote Arbeit. Heute ist Deutschland weltweit der Hauptproduzent von komplexen Maschinen. Weit über die Autoindustrie hinausgehend, ist dieser Sektor das Rückgrat seiner Wirtschaft. Hinter dieser Stärke steckt auch das Know-how der deutschen Bourgeoisie, die sich bereits während des kapitalistischen Aufstiegs im Wesentlichen auf ihre ökonomischen und geschäftlichen Aktivitäten konzentrierte, da sie durch die preußischen Junker mehr oder weniger von den politischen und militärischen Machtstellen ausgeschlossen wurde. Die Ingenieurs-Leidenschaft, die diese Bourgeoisie entwickelte, drückt sich zudem nicht nur im Maschinenbausektor aus, der sich häufig auf mittelgroße Familienunternehmen stützt, sondern auch in der besonderen Fähigkeit der herrschenden Klasse in ihrer Gänze, die gesamte deutsche Industrie zu betreiben, als sei sie eine einzige Maschine. Die komplexe und hocheffektive Verknüpfung all der unterschiedlichen Produktions- und Verteilungseinheiten ist einer der Hauptvorteile des deutschen Nationalkapitals.
Während das deutsche Kapital in den 1990er Jahren noch unter dem toten Gewichts der kollabierenden DDR-Wirtschaft litt, schaffte es in den Nuller Jahren die Wende zu einer Erholung seiner Wettbewerbsfähigkeit. Zwei Faktoren waren dabei entscheidend. Auf der organisatorischen Ebene begannen alle großen Konzerne, einschließlich der mittelgroßen Maschinenbauer, auf Weltebene zu produzieren und zu operieren, indem sie Produktionsnetzwerke schufen, die alle um Deutschland herum zentriert sind. Auf der politischen Ebene waren die Angriffe gegen die Löhne und Sozialleistungen unter der Führung der SPD (Agenda 2010) so radikal, dass die französische Regierung Deutschland des Lohndumpings bezichtigte.
Diese Wende wurde von drei wichtigen Entwicklungen im Kontext der globalen Wirtschaft begünstigt, die sich als sehr vorteilhaft für Deutschland erwiesen.
Erstens der Übergang vom Keynesianismus zum so genannten neoliberalen Modell des Staatskapitalismus, der mehr exportorientierte Ökonomien begünstigt. Auch wenn das westdeutsche „Modell“ sich nach 1945 stark an der keynesianischen Wirtschaftsordnung orientierte, die den westlichen Block dominierte, war es von Anbeginn von den „ordo-liberalen“ Ideen von Ludwig Erhard, der Freiburger Schule, beeinflusst, die nie die Art von „Etatismus“ pflegte, der noch heute die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs beeinträchtigt. Zweitens die Konsolidierung der europäischen Wirtschaftskooperation nach dem Fall der Berliner Mauer (Europäische Union, Euro). Obwohl teilweise von politischen, im Kern imperialistischen Motiven (die „Kontrolle“ Deutschlands durch seine Nachbarn) angetrieben, war auf der ökonomischen Ebene Deutschland als stärkster Wettbewerber der Hauptnutznießer der EU und der gemeinsamen Währung. Die Finanzkrise und die Euro-Krise nach 2008 bestätigten, dass die führenden kapitalistischen Länder immer noch die Fähigkeit besitzen, die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf ihre schwächeren Rivalen abzuwälzen. Die verschiedenen internationalen und europäischen Rettungspakete, wie jene für Griechenland, dienten im Wesentlichen dazu, deutsche (und französische) Banken auf Kosten der „geretteten“ Ökonomien finanziell zu stützen.
Drittens half die geographische und historische Nähe zu Osteuropa dabei, Deutschland zum Profiteur der dortigen Umwandlung zu machen und Märkte zu erobern, die früher außer Reichweite waren, einschließlich der außerkapitalistischen Überbleibsel[1].
Das Verhältnis zwischen der wirtschaftlichen und militärischen Macht des deutschen Imperialismus
Um die Bedeutung der Konsequenzen aus dieser Wettbewerbsstärke auf andere Ebenen zu veranschaulichen, möchten wir nun die Verknüpfung zur imperialistischen Position untersuchen. Nach 1989 konnte Deutschland seine imperialistischen Interessen mit größerer Entschlossenheit und Unabhängigkeit geltend machen. Beispiele hierfür waren die deutsche Initiative unter Helmut Kohl, den Anstoß zur Zerschlagung Jugoslawiens (angefangen mit der diplomatischen Anerkennung der staatlichen Unabhängigkeit Kroatiens und Sloweniens) zu geben und die Weigerung unter Gerhard Schröder, den zweiten Irakkrieg zu unterstützen. In den vergangenen 25 Jahren hat Deutschland sicherlich Fortschritte auf der imperialistischen Ebene erzielt. Vor allem hat sich sowohl die „internationale Gemeinschaft“ als auch die Bevölkerung „zuhause“ an deutsche Militärinterventionen im Ausland gewöhnen können. Der Übergang von einer wehrpflichtigen Armee zu einer Berufsarmee ist gemacht worden. Die deutsche Rüstungsindustrie hat ihren Anteil auf dem Weltmarkt gesteigert. Dennoch ist Deutschland auf der imperialistischen Ebene nicht in der Lage gewesen, ähnlich wie in der Wirtschaft an Boden dazuzugewinnen. Das Problem, ausreichend Freiwillige für die Bundeswehr zu gewinnen, bleibt ungelöst. Vor allem ist das Ziel, die Streitkräfte technisch auf den neuesten Stand zu bringen und ihre Mobilität sowie Feuerkraft zu erhöhen, in keinster Weise erreicht worden.
Im Grunde war es im gesamten Zeitraum nach 1989 nie das Ziel der deutschen Bourgeoisie gewesen, kurz- oder mittelfristig zu versuchen, als potenzieller Blockführer gegen die USA „ihren Hut in den Ring zu werfen“. Auf der militärischen Ebene wäre dies auch unmöglich, angesichts der überwältigenden Militärmacht der Vereinigten Staaten und des gegenwärtigen Status Deutschlands als „ökonomischer Riese, aber militärischer Zwerg“. Jeglicher Versuch in diese Richtung würde auch dazu führen, dass seine europäischen Hauptrivalen sich gegen Deutschland zusammentun würden. Auf ökonomischer Ebene würde die Last des notwendigen, enormen Wiederaufrüstungsprogramms die Wettbewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft ruinieren, die bereits mit der finanziellen Bürde der „Wiedervereinigung“ zu kämpfen hat – und auch Konfrontationen mit der Arbeiterklasse riskieren.
Doch all dies bedeutet nicht, dass Berlin seine Ambitionen, seinen Status als führende europäische Militärmacht wiederzuerlangen, aufgegeben hätte. Im Gegenteil, spätestens seit den 1990ern verfolgt es eine langfristige Strategie, die darauf abzielt, seine Wirtschaftskraft als Basis für eine künftige militärische Renaissance zu steigern. Während die frühere UdSSR eine Mahnung ist, dass eine Militärmacht langfristig nicht ohne eine äquivalente ökonomische Grundlage bestehen kann, bestätigt in jüngerer Zeit China die andere Seite dieser Medaille: wie wirtschaftlicher Aufstieg einen späteren militärischen Aufstieg vorbereiten kann.
Einer der Schlüssel solch einer langfristigen Strategie ist Russland, aber auch die Ukraine. Auf militärischer Ebene sind es die USA und nicht Deutschland, die am meisten von einer Ausweitung der NATO nach Osten profitieren (in der Tat versuchte Deutschland einige der Schritte zu verhindern, die darauf abzielten, Russland zurückzudrängen). Im Gegenteil, vor allem auf ökonomischer Ebene hofft Deutschland gegenwärtig von dieser ganzen Zone zu profitieren. Anders als China ist Russland aus historischen Gründen nicht in der Lage, seine eigene ökonomische Modernisierung zu organisieren. Bevor der Ukraine-Konflikt begann, hatte der Kreml bereits entschieden, diese Modernisierung in Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie anzugehen. Im Grunde besteht einer der Hauptvorteile dieses Konflikts für die USA darin, dass er (mittels des Embargos gegen Russland) diese wirtschaftliche Zusammenarbeit blockiert. Hier liegt also eines der Hauptmotive für die deutsche Bundeskanzlerin (und für den französischen Staatspräsidenten Hollande als ihr Juniorpartner in dieser Angelegenheit), zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Trotz des derzeit desolaten Zustandes der russischen Wirtschaft ist die deutsche Bourgeoisie immer noch davon überzeugt, dass Russland in der Lage wäre, solch eine Modernisierung selbst zu finanzieren. Der Ölpreis wird nicht für immer so niedrig sein wie gegenwärtig, und Russland hat eine Menge kostbarer Metalle zu bieten. Hinzu kommt, dass die russische Landwirtschaft erst noch auf eine moderne kapitalistische Basis gestellt werden muss (dies trifft umso mehr auf die Ukraine zu, die – trotz der Tschernobyl-Katastrophe – immer noch mit die fruchtbarsten Böden auf der Welt besitzt). In der mittelfristigen Perspektive von Nahrungsmittelkürzungen und steigender Preise für landwirtschaftliche Produkte können solche landwirtschaftlichen Gebiete eine beträchtliche ökonomische und gar imperialistische Bedeutung erlangen. Die Befürchtung der USA, dass Deutschland von Osteuropa profitieren könnte, um sein relativ großes ökonomisches und politisches Gewicht in der Welt zu steigern und das Gewicht Amerikas in Europa ein Stück weit zu reduzieren, ist also nicht unbegründet.
Ein Beispiel, wie Deutschland erfolgreich seine Wirtschaftsmacht für imperialistische Zwecke einsetzt, sind die syrischen Flüchtlinge. Selbst wenn es wollte, wäre es Deutschland auf Grund seiner militärischen Schwäche sehr schwierig, sich direkt an den gegenwärtigen Luftschlägen in Syrien zu beteiligen. Doch da es auf Grund seiner verhältnismäßig geringen Arbeitslosigkeit Teile der syrischen Bevölkerung in Gestalt der gegenwärtigen Flüchtlingswelle aufnehmen kann, erlangt Deutschland ein alternatives Mittel, um die Nachkriegsperiode dort eines Tages zu beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass insbesondere die USA gegenwärtig versuchen, juristische Mittel zu benutzen, um die Wirtschaftsmacht ihres deutschen Konkurrenten einzudämmen, z.B. indem sie Volkswagen oder die Deutsche Bank vor Gericht laden und ihnen mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen.
Die Schwierigkeiten der Arbeiterklasse
Das Jahr 2015 erlebte eine Reihe von Streiks vor allem im Transportwesen (Deutsche Bahn, Lufthansa) und unter den Kita-Angestellten. Es gab zudem eher lokale, aber bedeutsame Bewegungen wie die in der Charité in Berlin, wo es eine Solidarisierung zwischen Patienten und Pflegepersonal gab. All diese Bewegungen waren allzu sehr auf einzelne Bereiche beschränkt und isoliert, manchmal sich auf die falsche Alternative zwischen großen und kleinen korporatistischen Gewerkschaften fokussierend, die die Notwendigkeit einer autonomen Selbstorganisation durch die ArbeiterInnen verschleierte. Obwohl alle Gewerkschaften die Streiks so organisierten, dass sie ein Maximum an Beeinträchtigungen verursachten, gelang der Versuch, die Solidarität, zumindest in Form von öffentlicher Sympathie mit den Streikenden, auszuhöhlen, nur teilweise. Das Argument z.B., das die Forderungen im Kita-Bereich begleitete, wonach das System der besonders niedrigen Löhne in traditionell weiblichen Berufen endlich beendet werden müsse, stieß innerhalb der Klasse in ihrer Gesamtheit auf offene Ohren, schien diese doch zu erkennen, dass diese „Diskriminierung“ vor allem ein Mittel zur Spaltung der ArbeiterInnen ist.
Es ist durchaus unüblich, dass Streiks in Deutschland solch eine prominente Rolle in den Medien spielen wie jene im Verlauf von 2015. Diese Streiks sind, auch wenn sie den Nachweis einer immer noch existierenden Kampflust und Solidarität liefern, kein Beleg für eine immer noch existente Welle oder Phase eines proletarischen Kampfes. Sie sollten zumindest als Manifestation der besonderen ökonomischen, oben geschilderten Lage in Deutschland verstanden werden. Vor dem Hintergrund einer relativ niedrigen Arbeitslosigkeit und eines Mangels an qualifizierter Arbeit stellt die Bourgeoisie die Idee in den Vordergrund, dass nach Jahren sinkender Reallöhne, eingeleitet unter Schröder (sie sanken radikaler als fast überall in Westeuropa), die Beschäftigten endlich für ihren „Realitätssinn“ „belohnt“ werden sollen. Die neue Große Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten setzte selbst den Trend, als sie endlich (als einer der letzten Staaten Europas) den gesetzlichen Mindestlohn beschloss und die Sozialleistungen anhob. In der Automobilindustrie zahlten die großen Konzerne 2016 beispielsweise Boni (die sie „Gewinnbeteiligung“ nannten) von bis zu 9.000 Euro pro Beschäftigten. Dies war umso mehr möglich, als die Modernisierung des Produktionsapparates so erfolgreich war, dass – zumindest im Moment – die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands viel weniger von niedrigen Löhnen abhängt als eine Dekade zuvor.
2003 analysierte die IKS den internationalen Klassenkampf, der mit den Protesten gegen die Angriffe auf die Renten in Frankreich und Österreich begann, als eine (unspektakuläre, fast unmerkliche) Wende zum Besseren, im Wesentlichen weil in ihnen die heutige ArbeiterInnengeneration (zum ersten Mal seit dem letzten Weltkrieg) zu erkennen begann, dass ihre Kinder nicht bessere, sondern schlechtere Bedingungen haben werden als sie selbst. Dies führte zu ersten bedeutsamen Ausdrücken der Solidarität zwischen den Generationen in den Arbeiterkämpfen. Aufgrund der Einschüchterung von Streikbewegungen durch wachsende Arbeitslosigkeit und immer prekärere Arbeitsbedingungen drückte sich diese Entwicklung „am Arbeitsplatz“ mehr auf der Ebene des Bewusstseins denn des Kampfgeistes aus – es wurde zunehmend schwieriger und entmutigender, zu streiken. In Deutschland verlor die anfängliche Antwort der Arbeitslosen auf die Agenda 2010 (die Montagsdemonstrationen) ebenfalls an Schwung. Doch dafür begann eine neue Generation auf die Straßen zu gehen; sie profitierte dabei von dem Umstand, dass sie noch nicht direkt unter dem Joch der Lohnarbeit stand, und brachte ihre Wut und Sorge nicht nur über die eigene Zukunft, sondern auch (mehr oder weniger bewusst) über die der gesamten Klasse zum Ausdruck. Ihr schlossen sich häufig prekär Beschäftigte an. Diese Proteste, die sich auf Länder wie die Türkei, Israel und Brasilien ausweiteten, aber ihren Höhepunkt mit der „Anti-CPE“-Bewegung in Frankreich und den Indignados in Spanien erreichten, stießen auch auf kleines, aber bedeutsames Echo in der Schüler- und Studentenbewegung in Deutschland. Und sie wurden begleitet von der Herauskristallisierung wenn nicht einer neuen Generation von Revolutionären, so doch ihrer potenziellen Vorläufer.
In Deutschland drückte sich dies in einer kleinen, aber kämpferischen „Occupy“-Bewegung aus, die gegenüber internationalistischen Ideen offener denn je war. Der Schlachtruf der ersten Occupy-Demonstrationen hieß: „Nieder mit Kapital, Staat und Nation!“ Zum ersten Mal seit Jahrzehnten setzte in Deutschland eine Politisierung ein, die nicht von der antifaschistischen Ideologie und der Ideologie der nationalen Befreiungsbewegungen überschattet zu sein schien. Dies fand als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 statt, auf die die Euro-Krise folgte. Einige dieser kleinen Minderheiten begannen darüber nachzudenken, ob der Kapitalismus sich am Rande des Zusammenbruchs befindet. Es begann sich die Vorstellung zu verbreiten, dass, wenn sich Marx mit seinen Aussagen zur Krise des Kapitalismus als richtig erwiesen hat, er auch in der Frage des revolutionären Wesens des Proletariats bestätigt werden könnte. Die Erwartung wuchs, dass die massiven, internationalen Angriffe bald auf ähnlich massive, internationale Kämpfe der Klasse stoßen würden. „Heute Athen – morgen Berlin – internationale Solidarität gegen das Kapital“ wurde zum neuen Schlachtruf.
Was folgte, war zwar keine historische Niederlage, aber eine momentane Ruhigstellung der 2003 begonnenen politischen Öffnung durch die Bourgeoisie; sie brachte diese Phase des Klassenkampfes zu einem Ende. Denn was als US-Hypothekenkrise begann, stellte sich bald als sehr reale Bedrohung der Stabilität der internationalen Finanzarchitektur dar. Die Gefahr war akut. Es gab keine Zeit für langatmige Verhandlungen zwischen den Regierungen darüber, wie damit zu verfahren ist. Der Bankrott von Lehman Brothers hatte den Vorteil, dass er die Regierungen aller Industrieländer zwang, sofortige und radikale Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation zu beruhigen (wie die HERALD TRIBUNE später schrieb: „Wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann hätte der Lehman-Zusammenbruch erfunden werden müssen.“). Doch er hatte noch andere Vorteile: gegen die Arbeiterklasse. Vielleicht zum ersten Mal antwortete die Weltbourgeoisie auf eine große, akute Krise ihres Systems nicht, indem sie sie herunterspielte, sondern indem sie ihre Bedeutung übertrieb. Den ArbeiterInnen der Welt wurde erzählt, dass, wenn sie nicht sofort die massiven Angriffe akzeptierten, ganze Staaten und mit ihnen die Renten und Krankenkassen Bankrott gehen, ihre Ersparnisse sich in Luft auflösen würden. Diese ideologische Terroroffensive erinnerte an die militärische Schockstrategie (shock and awe), die von den USA im zweiten Irakkrieg angewendet wurde und die die Lähmung, Traumatisierung sowie Entwaffnung ihres Gegners bezweckte. Und sie funktionierte. Gleichzeitig gab es eine objektive Grundlage dafür, nicht alle zentralen Bereiche des Weltproletariats gleichzeitig anzugreifen, da große Sektoren der Klasse in den USA, in Großbritannien, in Irland und in Südeuropa viel stärker litten als in Deutschland, Frankreich und im restlichen Nordwesteuropa.
Das zweite Kapitel dieser Offensive des Terrors und der Spaltung war schließlich die Euro-Krise, in der das europäische Proletariat erfolgreich zwischen dem Norden und dem Süden gespalten wurde, zwischen den „faulen Griechen“ und den „arroganten Nazideutschen“. In diesem Kontext hatte die Bourgeoisie noch einen weiteren Trumpf im Ärmel: den ökonomischen Erfolg der Deutschen. Selbst die Streiks von 2015 und, allgemeiner, die jüngsten Erhöhungen der Löhne und der Sozialleistungen wurden allesamt genutzt, dem europäischen Proletariat die Botschaft einzubläuen, dass es sich letztlich lohne, Opfer angesichts der Krise zu bringen.
Diese Botschaft, dass Kämpfe sich nicht auszahlen, wurde zusätzlich durch die Tatsache unterstrichen, dass in den Ländern, in denen die politische und wirtschaftliche Stabilität besonders fragil und die Arbeiterklasse schwächer ist, die Protestbewegungen der jungen Generationen („Arabischer Frühling“) nur zur Auslösung von mörderischen Bürger- und imperialistische Kriegen und/oder neuen Repressionswellen führten. All dies verstärkte das Gefühl der Machtlosigkeit und den Mangel an Perspektive in der gesamten Klasse.
Der ausbleibende Zusammenbruch des Kapitalismus und das Versagen des europäischen Proletariats, sich den massiven Angriffen zu widersetzen, schränkte auch das Aufkommen von Vorläufern einer neuen revolutionären Generation ein. Die Zunahme von öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen, die diese Phase in Deutschland kennzeichnete, wich einer Phase wirklicher Demoralisierung. Seither haben weitere Demonstrationen stattgefunden – gegen „Pegida“, TTIP, Gentechnologie oder die Überwachung des Internet -, die jedoch bar jeglicher grundsätzlicheren Kritik am Kapitalismus an sich sind.
Und jetzt, seit dem Sommer 2015, folgte den Schlägen der Finanz- und Eurokrise ein weiterer: die gegenwärtige Flüchtlingskrise. Auch sie wird von der herrschenden Klasse bis zum Äußersten gegen das Nachdenken des Proletariats benutzt. Doch mehr noch als die bürgerliche Propaganda stellt die Flüchtlingswelle selbst einen Schlag gegen die ersten Keime eines Klassenbewusstseins dar, das sich gerade vom Schlag 1989 („Tod des Kommunismus“) erholt hatte. Die Tatsache, dass Millionen aus der „Peripherie“ des Kapitalismus ihr Leben aufs Spiel setzen, um nach Europa, Nordamerika und in andere „Festungen“ zu gelangen, kann für den Moment nur den Eindruck verstärken, dass es ein Privileg sei, in den entwickelteren Teilen der Welt zu leben, und dass die Arbeiterklasse im Herzen des Systems mangels Alternative also doch etwas im Kapitalismus zu verteidigen habe. Darüber hinaus neigt die Klasse, zurzeit ihres eigenen politischen, theoretischen und kulturellen Vermächtnisses entkleidet, insgesamt dazu, die Ursachen dieser verzweifelten Migration nicht innerhalb des Kapitalismus, nicht verknüpft mit den in den demokratischen Ländern angesiedelten Widersprüchen zu sehen, sondern in einer Abwesenheit von Kapitalismus und Demokratie in den Konfliktzonen.
All dies hat zu einem neuerlichen Rückgang sowohl des Kampfgeistes als auch des Bewusstseins in der Klasse geführt.
Das Problem des politischen Populismus
Obwohl das Phänomen des rechten Terrors gegen Fremde und Flüchtlinge nicht neu ist in Deutschland, besonders seit der „Wiedervereinigung“ und namentlich (obgleich nicht nur) in seinen neuen, östlichen Provinzen, war bis jetzt der Aufstieg einer stabilen populistischen Bewegung in Deutschland erfolgreich von der herrschenden Klasse verhindert worden. Doch im Kontext der Euro-Krise, der akuten Phase, die bis zum Sommer 2015 andauerte, und der „Flüchtlingskrise“, die ihr folgte, erlebte der politische Populismus einen Aufschwung. Dieser hat sich hauptsächlich auf drei Ebenen manifestiert: mit dem Aufstieg der AfD (Alternative für Deutschland) in der Wählergunst, die sich ursprünglich in Opposition zum griechischen Hilfspaket und auf der Grundlage einer vagen Opposition gegen eine gemeinsame europäische Währung konstituiert hatte; einer rechtspopulistischen Bewegung, die sich um die „Montagsspaziergänge“ in Dresden konzentriert (Pegida); einem neuerlichen Wiederaufleben des Rechtsterrorismus gegen Flüchtlinge und Fremde, wie der „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU).
Solche Phänomene sind nicht neu auf der politischen Bühne Deutschlands. Doch bis jetzt ist es der Bourgeoisie noch stets gelungen, diese Erscheinungen daran zu hindern, zu irgendeiner Art von stabiler und parlamentarischer Präsenz zu gelangen. Bis zum Sommer 2015 schien es, als gelänge es den herrschenden Sektoren auch diesmal. Die AfD war um ihr Thema (die „griechische“ Krise) und um einige ihrer finanziellen Quellen gebracht worden und erlitt ihre erste Spaltung. Doch dann gelang diesem Populismus ein Comeback; dank der neuen Immigrantenwelle wurde er stärker denn je. Und da die Immigrantenfrage auf absehbare Zeit eine mehr oder weniger dominante Rolle zu spielen droht, sind die Chancen für die AfD gewachsen, sich selbst als eine neue, dauerhaftere Komponente des parteipolitischen Apparates zu etablieren.
Die herrschende Klasse ist imstande, all dies zu nutzen, um ihren Wahlzirkus interessanter zu gestalten, der Ideologie der Demokratie und des Antifaschismus neuen Schub zu verleihen und auch Spaltung sowie Fremdenfeindlichkeit zu verbreiten. Doch weder entspricht der ganze Prozess direkt ihren Interessen, noch ist sie in der Lage, ihn vollständig zu kontrollieren.
Dass es eine enge Verbindung zwischen der Verschärfung der globalen Krise des Kapitalismus und dem Vormarsch des Populismus gibt, wird von der Euro-Krise und ihren Auswirkungen auf die politische Szenerie in Deutschland illustriert. Die Wirtschaftskrise verstärkt nicht nur Unsicherheit und Furcht, indem sie den Überlebenskampf intensiviert. Sie speist auch die Flamme der Irrationalität. Deutschland hätte ökonomisch am meisten zu verlieren, wenn der Zusammenhalt der EU und der Euro weiter geschwächt werden würden. Millionen von Arbeitsplätzen hängen direkt oder indirekt vom Export und von der Rolle der EU ab, die sie für Deutschland in diesem Zusammenhang spielt. In solch einem Land ist es umso irrationaler, die EU, den Euro, die ganze Ausrichtung auf den Weltmarkt in Frage zu stellen. In dieser Hinsicht ist es kein Zufall, dass das jüngste Aufkommen solch fremdenfeindlicher Bewegungen von den Sorgen über die Stabilität der neuen europäischen Währung ausgelöst worden ist.
Rationalität ist ein unerlässliches, aber nicht das einzige Moment in der menschlichen Vernunft. Rationalität konzentriert sich rund um das Element des berechnenden Denkens. Da dies die Fähigkeit beinhaltet, seine eigenen objektiven Interessen zu kalkulieren, ist dies ein unerlässliches Element nicht nur der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch des proletarischen Befreiungskampfes. Historisch erschien und entwickelte es sich überwiegend unter dem Impuls des Äquivalententausches. Da unter dem Kapitalismus das Geld seine Rolle als universelles Äquivalent voll entwickelt, spielen die Währung und das Vertrauen, das sie bewirkt, eine Hauptrolle bei der „Formatierung“ der Rationalität in der bürgerlichen Gesellschaft. Ein Verlust von Vertrauen in das universelle Äquivalent ist daher eine der Hauptquellen der Irrationalität in der bürgerlichen Gesellschaft. Daher sind Währungskrisen und Zeiten der Hyperinflation besonders gefährlich für die Stabilität dieser Gesellschaft. So war die Inflation in Deutschland 1923 einer der wichtigsten Faktoren bei der Wegbereitung des nationalsozialistischen Triumphes zehn Jahre später.
Andererseits betont und illustriert die aktuelle Flüchtlings- und Immigrationswelle einen weiteren Aspekt des Populismus: die Verschärfung der Konkurrenz zwischen den Opfern des Kapitalismus und die Tendenz zum Ausschluss, zur Xenophobie und zur Suche nach einem Sündenbock. Das Elend unter der kapitalistischen Herrschaft erweckt eine Triade der Zerstörung zum Leben: erstens die Anhäufung von Aggressionen, Hass, Heimtücke und das Verlangen nach Zerstörung und Selbstzerstörung; zweitens die Projektion dieser anti-sozialen Impulse auf Andere (moralische Heuchelei); drittens das Richten dieser Impulse nicht gegen die herrschende Klasse, die als zu mächtig erscheint, sondern gegen offensichtlich Schwächere. Dieser dreigleisige „Komplex“ blüht daher vor allem in Abwesenheit des kollektiven Kampfes des Proletariats, wenn sich die individuellen Subjekte gegenüber dem Kapital machtlos fühlen. Der Kulminationspunkt dieser Triade an der Wurzel des Populismus ist das Pogrom. Obgleich sich die populistische Aggression auch gegen die herrschende Klasse ausdrückt, fordert sie lautstark von ihr, beschützt und begünstigt zu werden. Was der Populismus begehrt, ist, dass die Bourgeoisie alles eliminiert, was nach bedrohlichen Rivalen aussieht, oder zulässt, dass er die Dinge selbst in die Hand nimmt. Diese „konformistische Revolte“, eine permanente Erscheinung im Kapitalismus, wird akut im Angesicht der Krise, des Krieges, des Chaos, der Instabilität. In den 1930er Jahren war der Rahmen seiner Ausbreitung die weltgeschichtliche Niederlage des Proletariats gewesen. Heute ist dieser Rahmen die Abwesenheit jeglicher Perspektive: die Epoche des Zerfalls.
Wie bereits in den Thesen der IKS zum Zerfall entwickelt, ist eine der sozialen und materiellen Grundlagen des Populismus der Prozess der Deklassierung. Trotz der wirtschaftlichen Robustheit und des Mangels an qualifizierter Arbeitskraft gibt es einen wichtigen Teil der Bevölkerung des deutschen Nationalkapitals heute, der, obgleich arbeitslos, nicht wirklich ein aktiver Faktor der industriellen Reservearmee ist (bereit, den Job Anderer zu übernehmen, und daher einen Druck auf die Löhne ausübend), sondern eher zu dem zählt, was Marx die Lazarusschicht der Arbeiterklasse nannte. Aufgrund gesundheitlicher Probleme, der Unfähigkeit, den Stress der modernen kapitalistischen Arbeitskraft und des Existenzkampfes auszuhalten, oder zu niedriger Qualifikation ist dieser Sektor, vom kapitalistischen Standpunkt aus betrachtet, „nicht beschäftigungsfähig“. Statt Druck auf das Lohnniveau auszuüben, steigern diese Schichten die Gesamtlohnkosten durch die Leistungen, die sie beziehen. Es ist dieser Sektor, der die Flüchtlinge heute am meisten als potenzielle Rivalen betrachtet.
Innerhalb dieses Sektors gibt es zwei wichtige Gruppen der proletarischen Jugend, von denen Teile anfällig für die Mobilisierung als Kanonenfutter für bürgerliche Cliquen, aber auch als aktive Protagonisten von Pogromen sein können. Die erste Gruppe setzt sich aus Kindern der ersten oder zweiten Generation der „Gastarbeiter“ zusammen. Die ursprüngliche Vorstellung war, dass diese „Gastarbeiter“ nicht bleiben werden, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, und vor allem dass sie nicht ihre Familien mitbringen oder Familien in Deutschland gründen. Das Gegenteil trat ein, und die Bourgeoisie unternahm keine besonderen Anstrengungen, um die Kinder solcher Familien auszubilden. Das Resultat heute ist, dass, weil die ungelernten Jobs zu einem großen Teil in die so genannten „Drittweltländer“ exportiert wurden, ein Teil dieses Segments der proletarischen Jugend zu einer von staatlichen Leistungen finanzierten Existenz verdammt und niemals in assoziierte Arbeit integriert worden ist. Die andere Gruppe sind die Kinder der traumatischen Massenentlassungen in Ostdeutschland nach der „Wiedervereinigung“. Teile dieses Segments, eher Deutsche als Immigranten, die nicht aufgezogen wurden, um mit der hoch kompetitiven „westlichen“ Form des Kapitalismus mithalten zu können, und die es sich nicht zutrauten, nach 1989 nach „Westdeutschland“ zu ziehen, wie es die Unerschrockeneren taten, haben sich der Armee der von Sozialleistungen lebenden Menschen angeschlossen. Diese Sektoren sind besonders anfällig gegenüber der Verlumpung, Kriminalisierung und den dekadenten, fremdenfeindlichen Formen der Politisierung. Obschon der Populismus das Produkt ihres Systems ist, kann die Bourgeoisie dieses Phänomen weder beliebig produzieren noch verschwinden lassen kann. Doch sie kann ihn nicht nur für ihre Zwecke manipulieren, sondern auch seine Entwicklung mehr oder weniger er- oder entmutigen. Im Allgemeinen tut sie beides. Aber auch dies ist nicht leicht zu beherrschen. Selbst im Kontext des totalitären Staatskapitalismus ist es für die herrschende Klasse schwierig, ihm gegenüber eine Kohärenz zu erreichen und zu erhalten. Der Populismus selbst ist tief in den Widersprüchen des Kapitalismus verwurzelt. Die Aufnahme von Flüchtlingen heute zum Beispiel liegt im objektiven Interesse der wichtigen Sektoren des deutschen Kapitalismus. Die ökonomischen Vorteile sind noch offenkundiger als die imperialistischen. Aus diesem Grund sind die Industrieführer und die Geschäftswelt zurzeit die enthusiastischsten Anhänger der „Willkommenskultur“. Sie rechnen damit, dass Deutschland einen Zustrom von einer Million pro Jahr in der kommenden Periode angesichts des prognostizierten Mangels an qualifizierten Arbeitskräften und vor allem der demographischen Krise (die beständig niedrige Geburtsrate) benötigen wird. Darüber hinaus erweisen sich Flüchtlinge aus Kriegs- und Katastrophengebieten häufig als besonders emsige und disziplinierte ArbeiterInnen, bereit, für einen niedrigen Lohn zu arbeiten, aber auch die Initiative zu ergreifen und Risiken in Kauf zu nehmen. Auch ist die Integration von Newcomern von „Außen“ und die kulturelle Offenheit, die dies erfordert, an sich schon eine Produktivkraft (potenziell natürlich auch für das Proletariat). Ein Erfolg Deutschlands auf dieser Ebene könnte ihm einen zusätzlichen Vorteil gegenüber seinen europäischen Konkurrenten geben. Jedoch ist die Exklusion die Kehrseite der Merkelschen Inklusionspolitik. Die Immigration bedarf heute nicht mehr der unqualifizierten Arbeitskraft der „Gastarbeiter“-Generationen, jetzt, wo die ungelernten Jobs sich in der Peripherie des Kapitalismus konzentriert haben. Die neuen Migranten sollten hohe Qualifikationen mitbringen oder zumindest den Willen haben, sie zu erlangen. Die jetzige Lage erfordert eine viel organisiertere und schonungslosere Selektion als in der Vergangenheit. Wegen diesen widersprüchlichen Bedürfnissen von Inklusion und Exklusion ermutigt die Bourgeoisie zu Offenheit und Fremdenfeindlichkeit in einem Atemzug. Sie antwortet heute auf dieses Bedürfnis mit einer Arbeitsteilung zwischen der Linken und der Rechten, einschließlich der Arbeitsteilung in der Koalition zwischen Merkels Christdemokraten sowie den Christsozialen auf der einen und der SPD auf der anderen Seite. Doch hinter den jüngsten Dissonanzen zwischen den unterschiedlichen politischen Gruppierungen über die Flüchtlingsfrage stecken nicht nur eine Arbeitsteilung, sondern auch unterschiedliche Anliegen und Interessen. Die Bourgeoisie ist kein homogener Block. Während jene Teile der herrschenden Klasse des Staatsapparats, die der Wirtschaft nahestehen, auf Integration drängen, ist der gesamte Sicherheitsapparat über Merkels Öffnung der Grenzen im Sommer 2015 und über die Massen, die seither kamen, entsetzt, führte dies doch zeitweilig zu einem Verlust der Kontrolle darüber, wer das Staatsterritorium betritt. Ferner gibt es innerhalb des Repressions- und Rechtsapparates natürlich auch jene, die, weil sie deren Besessenheit von Law & Order, Nationalismus, etc. teilen, mit den Rechtsextremisten sympathisieren und sie schützen.
Was die politische Kaste angeht, gibt es nicht nur jene, die (abhängig von der Stimmung in ihrem Wahlkreis) aus Opportunismus mit dem Populismus flirten. Es gibt auch viele, die ihre Mentalität teilen. Zu alledem können wir noch die Widersprüche des Nationalismus selbst hinzufügen. Wie alle modernen, bürgerlichen Staaten wurde Deutschland auf der Grundlage von Mythen über gemeinsame Geschichte, Kultur, ja, über gemeinsames Blut gegründet. Vor diesem Hintergrund kann selbst die mächtigste Bourgeoisie nicht beliebig unterschiedliche Definitionen der Nation erfinden und wiederauflegen, um sie ihren wechselnden Interessen anzupassen. Sie hat zwangsläufig auch kein Interesse daran, da die alten nationalistischen Mythen immer noch ein wichtiges und mächtiges Druckmittel des „Teile und herrsche“ nach innen und für die Mobilisierung der Unterstützung imperialistischer Aggressionen nach außen sind. Somit ist es heute immer noch keineswegs selbstverständlich, ein schwarzer oder muslimischer „Deutscher“ zu sein.
Die deutsche Bourgeoisie im Angesicht der „Flüchtlingskrise“
Im Kontext des Zerfalls und der Wirtschaftskrise war der hauptsächliche Motor des Populismus in Europa in den letzten Jahrzehnten das Problem der Immigration gewesen. Heute hat sich dieses Problem durch den größten Exodus seit dem II. Weltkrieg verschärft. Warum ist dieser Zustrom in Europa ein weitaus größeres politisches Problem als in Ländern wie der Türkei, Jordanien oder gar Libanon, die weitaus größere Kontingente erhalten? In den älteren kapitalistischen Ländern sind die vorkapitalistischen Gebräuche der Gastfreundschaft sowie die mit ihr einhergehende Subsistenzwirtschaft und Gesellschaftsstruktur viel radikaler verkümmert. Da ist auch die Tatsache, dass diese Migranten aus einer anderen Kultur kommen. Dies ist selbstverständlich kein Problem an sich, im Gegenteil. Doch insbesondere der moderne Kapitalismus macht ein Problem daraus. Namentlich in Westeuropa ist der Wohlfahrtsstaat der Hauptorganisator von Sozialunterstützung und Zusammenhalt. Es ist dieser Staat, der die Flüchtlinge unterbringen soll. Schon dies setzt Letztere in Konkurrenz zu den „einheimischen“ Armen um Jobs, Wohnungen und Sozialleistungen.
Bis jetzt haben die Immigration und – mit ihr – der Populismus aufgrund der verhältnismäßigen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Stabilität weniger Probleme in Deutschland verursacht als anderswo in Westeuropa. Doch angesichts der gegenwärtigen Lage wird die deutsche Bourgeoisie zunehmend nicht nur zuhause, sondern auch im Zusammenhang mit der Europäischen Union mit diesem Problem konfrontiert.
In Deutschland selbst stört der Aufstieg des rechten Populismus ihr Projekt, Teile der Immigranten zu integrieren. Ein wirkliches Problem, da bis jetzt alle Versuche, die Geburtenrate „zuhause“ zu steigern, gescheitert sind. Der rechte Terror beschädigt auch ihre Reputation im Ausland – ein sehr empfindlicher Punkt angesichts der Verbrechen der deutschen Bourgeoisie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Etablierung der AfD als stabile parlamentarische Kraft könnte die Bildung künftiger Regierung verkomplizieren. Auf der Ebene der Wahlen ist es vor allem ein Problem für die gegenwärtige CDU/CSU, der führenden Regierungspartei, die bis jetzt unter Merkel in der Lage gewesen ist, sowohl sozialdemokratische als auch „konservative“ Wähler anzuziehen und so ihre führende Position gegenüber der SPD zu zementieren.
Doch vor allem auf europäischer Ebene bedroht der Populismus deutsche Interessen. Der Status Deutschlands als ökonomischer und, in einem geringeren Umfang, politischer global player hängt zu einem bedeutenden Teil von der Existenz und dem Zusammenhalt der EU ab. Wenn populistische, mehr oder weniger anti-europäische Parteien im Osten (in Ungarn und Polen bereits der Fall) und vor allem im Westen Europas an die Regierung kommen, würde dies den Zusammenhalt beeinträchtigen. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Merkel die Flüchtlingsfrage zu einem Thema erklärt hat, das „über das Schicksal entscheiden wird“. Die Strategie der deutschen Bourgeoisie gegenüber dieser Frage ist es, die mehr oder weniger chaotische Einwanderung der Nachkriegs-Gastarbeiter und der Periode der De-Kolonisierung in eine leistungsorientierte, höchst selektive Immigration mehr nach kanadischem oder australischem Modell umzuwandeln. Die effektivere Abschottung der Außengrenzen der EU ist eine der Voraussetzungen für die vorgeschlagene Umwandlung der illegalen in legale Einwanderung. Dies würde auch die Etablierung von jährlichen Einwanderungsquoten zur Folge haben. Statt horrende Summen zu zahlen, um sich in die EU einzuschmuggeln zu lassen, würden Migranten ermutigt werden, in die Verbesserung ihrer eigenen Qualifikationen zu „investieren“, um die Chancen zum legalen Zutritt zu erhöhen. Statt auf eigene Faust sich auf den Weg nach Europa zu machen, würden jene Flüchtlinge, die akzeptiert werden, herein transportiert werden, in eigene Wohnungen und bereits mit für sie ausersehenen Jobs. Die Kehrseite dieser Medaille ist, dass die unerwünschten Einwanderer an den Grenzen gestoppt werden oder schnell und brutal hinausgeworfen werden, falls sie es bereits geschafft haben, nach Europa zu gelangen. Diese Umwandlung der europäischen Grenzen in Selektionsrampen (bereits im Gange) wird als humanistisches Projekt dargestellt, das darauf abziele, die Zahl der Todesopfer im Mittelmeer, die trotz aller Medienmanipulationen zu einer Quelle der moralischen Schande für die europäischen Bourgeoisien geworden ist, zu reduzieren. Indem Deutschland auf eine europäische statt nationale Lösung beharrt, nimmt es seine Verantwortung gegenüber dem kapitalistischen Europa wahr und untermauert gleichzeitig seinen Anspruch auf die politische Führung des alten Kontinents. Sein Ziel ist nichts Geringeres als der Versuch, die Zeitbombe der Immigration zu entschärfen und mit ihr den politischen Populismus in der EU.
In diesem Kontext öffnete die Merkel-Regierung im Sommer 2015 die deutschen Grenzen für die Flüchtlinge. Zu jenem Zeitpunkt hatten die syrischen Flüchtlinge, die bis dahin bereit gewesen waren, in der Osttürkei zu bleiben, begonnen, die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat zu verlieren, und machten sich in Massen auf den Weg nach Europa. Zur gleichen Zeit beschloss die türkische Regierung, um die EU zu erpressen, die Ankaras Kandidatur für einen „Eintritt in Europa“ blockiert, die Flüchtlinge nicht daran zu hindern, die Türkei zu verlassen. In dieser Situation hätte ein Schließen der deutschen Grenzen ein Stau von Hunderttausenden von Flüchtlingen auf dem Balkan bewirkt, eine chaotische, nahezu unkontrollierbare Situation. Doch durch die zeitweilige Aufhebung jeglicher Grenzkontrollen löste Berlin eine neue Flut von verzweifelten Flüchtlingen aus, die nun (miss)verstanden, dass sie von Deutschland eingeladen worden seien. All dies zeigt die Realität eines drohenden Verlustes der Kontrolle über die Situation. So radikal, wie Merkel sich selbst mit „ihrem“ Projekt identifiziert, würden sich die Erfolgsaussichten ihrer vorgeschlagenen „europäischen Lösung“ beträchtlich verschlechtern, falls der/die neue KanzlerIn nach den Wahlen von 2017 nicht die alte ist. Einer der Bausteine der Wiederwahlkampagne Merkels scheint wirtschaftlicher Natur zu sein. Angesichts der gegenwärtigen Verlangsamung der Wachstumsraten in China, aber auch in den USA stünde der exportorientierten deutschen Wirtschaft normalerweise eine Rezession bevor. Eine Steigerung der Staatsausgaben und des Wohnungsbaus „für die Flüchtlinge“ könnte solch ein Szenario im Vorfeld der Wahlen verhindern.
Anders als in den 1970er Jahren (als in vielen führenden westlichen Ländern linksbürgerliche Parteien an die Regierung kamen: „die Linke an der Macht“) oder in 1980er Jahren („die Linke in der Opposition“) wird die aktuelle Regierungsstrategie und der „Wahlzirkus“ in Deutschland viel weniger von einer unmittelbaren Bedrohung durch den Klassenkampf und weitaus mehr als in der Vergangenheit von den Problemen der Immigration und des Populismus bestimmt.
Die Flüchtlinge und die Arbeiterklasse
Die Solidarität mit den Flüchtlingen, die von einem bedeutenden Teil der Bevölkerung in Deutschland zum Ausdruck gebracht worden war, war, obgleich vom Staat bis zum Geht-nicht-mehr ausgebeutet, um das Bild eines humanen, weltoffenen deutschen Nationalismus zu promoten, spontan und zu Beginn „selbstorganisiert“. Und noch heute, mehr als ein halbes Jahr nach dem Beginn der aktuellen Krise, würde das staatliche Management des Zustroms ohne die Initiativen der Bevölkerung kollabieren. Es gibt nichts Proletarisches an diesen Aktivitäten. Im Gegenteil, diese Menschen verrichten teilweise die Arbeit, die der Staat nicht gewillt oder unfähig ist zu tun, oftmals ohne jegliche Bezahlung. Für die Arbeiterklasse besteht das zentrale Problem darin, dass diese Solidarität gegenwärtig nicht auf dem Klassenterrain stattfinden kann. Für den Augenblick nimmt sie einen sehr unpolitischen Charakter an, losgelöst von jeglicher ausdrücklichen Opposition gegen den imperialistischen Krieg in Syrien zum Beispiel. Wie die „NGOs“ und all die verschiedenen „kritischen“ Organisationen der (in Wahrheit nicht existenten) „Bürgergesellschaft“ sind diese Strukturen mehr oder weniger direkt in Anhängsel des totalitären Staates umgewandelt worden.
Doch gleichzeitig wäre es falsch, diese Solidarität nur als karitativ abzuqualifizieren. Dies umso mehr, als sich diese Solidarität gegenüber einem Zustrom potenzieller Rivalen auf dem Arbeits- und anderen Märkten äußert. In Abwesenheit vorkapitalistischer Traditionen der Gastfreundschaft in den alten kapitalistischen Ländern ist die assoziierte Arbeit und Solidarität des Proletariats die hauptsächliche soziale, materielle Basis solcher allgemein gefühlten Solidarität. Ihr ganzer Geist entspricht nicht der „Hilfe für die Armen“, sondern der Kooperation und kollektiven Kreativität. Wenn die Klasse langfristig ihre Identität, ihr Bewusstsein und ihr Erbe zu entdecken beginnt, kann diese gegenwärtige Erfahrung der Solidarität in die Erfahrung der Klasse und in ihre Suche nach einer revolutionären Perspektive integriert werden. Unter den ArbeiterInnen in Deutschland heute drückt der Impuls der Solidarität zumindest potenziell gewissermaßen den Zündwürfel eines Klassengedächtnisses und -bewusstseins aus, daran erinnernd, dass auch in Europa Krieg und Vertreibung keine sehr weit zurückliegende Erfahrung sind und dass die De-Solidarisierung in der Zeit der Konterrevolution (vor, während und nach dem II. Weltkrieg) sich heute nicht wiederholen darf. Das Gegenteil zum Populismus im Kapitalismus ist nicht die Demokratie und der Humanismus, sondern die assoziierte Arbeit – das Hauptgegengewicht zur Fremdenfeindlichkeit und zum Pogromismus. Der Widerstand gegen Ausschluss und Sündenbocksuche war stets ein permanentes und wichtiges Moment im täglichen Klassenkampf des Proletariats. Es kann heute der Beginn einer sehr unklaren und tastenden Erkenntnis sein, dass die Kriege und andere Katastrophen, die Menschen zur Flucht zwingen, Teil eines gewaltsamen Trennungsprozesses sind, durch den das Proletariat sich permanent konstituiert. Und dass die Weigerung jener, die alles verloren haben, gehorsam dort zu bleiben, wo die herrschende Klasse sie hin wünscht, ihre Weigerung, das Streben nach einem besseren Leben aufzugeben, konstituierende Momente des proletarischen Kampfgeistes sind. Der Kampf für ihre Mobilität, gegen das Regime der kapitalistischen Disziplinierung ist einer der ältesten Momente im Leben der „freien“ Lohnarbeit.
„Globalisierung“ und das Erfordernis eines internationalen Kampfes
Im Kapitel über die Bilanz des Klassenkampfes argumentierten wir, dass die Streiks in Deutschland 2015 eher ein Ausdruck der momentanen nationalen Wirtschaftslage waren denn ein Anzeichen eines breiteren europäischen oder internationalen Kampfgeistes. Es bleibt daher richtig, dass es zunehmend schwieriger wird für die Arbeiterklasse, ihre unmittelbaren Interessen durch Streikaktionen und andere Kampfmittel zu vertreten. Dies bedeutet nicht, dass ökonomische Kämpfe nicht mehr möglich sind oder ihre Relevanz verloren haben (wie die sog. Essener Tendenz der KAPD irrtümlicherweise in den 1920er Jahren meinte). Im Gegenteil, es bedeutet, dass die ökonomische Dimension des Klassenkampfes heute eine weitaus direktere politische Dimension als in der Vergangenheit enthält – eine Dimension, die äußerst schwierig einzuschätzen ist. In den letzten Jahren haben Kongressresolutionen der IKS richtigerweise einen der objektiven Faktoren ausgemacht, die die Entwicklung der Kämpfe für die Verteidigung der unmittelbaren, ökonomischen Interessen hemmen: das einschüchternde Gewicht der Massenarbeitslosigkeit. Doch dies ist nicht die einzige, nicht einmal die wichtigste ökonomische Ursache dieser Blockierung. Eine grundlegendere Ursache liegt in dem, was „Globalisierung“ genannt wird – die gegenwärtige Phase des totalitären Staatskapitalismus -, und im Rahmen begründet, den sie für die Weltwirtschaft vorgibt.
Die „Globalisierung“ des Weltkapitalismus ist an sich kein neues Phänomen. Wir finden sie an der Schwelle des ersten hoch mechanisierten Sektors der kapitalistischen Produktion: der Textilindustrie in Großbritannien, des Zentrums in einem Dreieckshandel, der mit dem Raub von Sklaven in Afrika und ihrer Arbeit in den Baumwollplantagen in den Vereinigten Staaten verknüpft war. Was den Welthandel angeht, wurde das Ausmaß der vor dem I. Weltkrieg erreichten „Globalisierung“ erst Ende des 20. Jahrhunderts wieder erreicht. Jedoch hatte diese „Globalisierung“ in den letzten drei Jahrzehnten vor allem auf zwei Ebenen eine neue Qualität erreicht: in der Produktion und in der Finanzwelt. Die Peripherie des Weltkapitalismus als Lieferant billiger Arbeitskraft, landwirtschaftlicher Plantagenfrüchte und von Rohstoffen – diese Muster ist zwar nicht ersetzt worden, aber sicherlich durch das globale Produktionsnetz erweitert worden, dessen Zentrum immer noch in den dominanten Ländern liegt, während die industriellen und Dienstleistungsaktivitäten jedoch überall auf der Welt stattfinden. In diesem „ordo-liberalen“ Korsett kann sich, zumindest tendenziell, kein nationales Kapital, keine Industrie, kein Bereich und Geschäft aus dieser internationalen Konkurrenz befreien. Es wird nahezu nichts irgendwo auf der Welt produziert, das nicht auch anderswo produziert werden könnte. Jeder Nationalstaat, jede Region, jede Stadt, jeder Stadtteil, jeder Wirtschaftssektor ist dazu verurteilt, mit all den anderen um die globalen Investitionsfonds zu konkurrieren. Die ganze Welt ist in den Bann gezogen, so als sei sie dazu verdammt, auf die Erlösung durch die Ankunft des Kapitals in der Form von Investitionen zu warten. Diese Phase des Kapitalismus ist keinesfalls ein spontanes Produkt, sondern eine Staatsordnung, die vor allem von den führenden, alten bürgerlichen Nationalstaaten eingeführt und durchgesetzt worden ist. Eines der Ziele dieser Wirtschaftspolitik ist es, die Arbeiterklasse der gesamten Welt in ein monströses disziplinarisches System einzusperren.
Auf dieser Ebene können wir vielleicht die Geschichte der objektiven Bedingungen des Klassenkampfes sehr schematisch in drei Phasen unterteilen. Im Aufstieg des Kapitalismus sahen sich die ArbeiterInnen an erster Stelle einzelnen Kapitalisten gegenüber und konnten sich somit mehr oder weniger wirksam in Gewerkschaften organisieren. Mit der Konzentration von Kapital in den Händen großer Unternehmen und des Staates verloren die etablierten Kampfmittel ihre Wirksamkeit. Jeder Streik sah sich direkt mit der gesamten Bourgeoisie, zentralisiert im Staat, konfrontiert. Es dauerte eine Zeitlang, bis das Proletariat eine wirksame Antwort auf diese neue Situation fand: den Massenstreik des gesamten Proletariats auf der Ebene eines ganzen Landes (Russland 1905), der in sich bereits das Potenzial der Machtübernahme und der Verbreitung auf andere Länder enthielt (die erste revolutionäre Welle, die im Roten Oktober ihren Ausgang nahm). Mit der heutigen „Globalisierung“ erreicht eine objektive, historische Tendenz des dekadenten Kapitalismus ihre volle Entwicklung: Jeder Streik, jeder Akt des „wirtschaftlichen“ Widerstandes durch ArbeiterInnen irgendwo auf der Welt sieht sich sofort mit dem gesamten Weltkapital konfrontiert, das jederzeit bereit ist, Produktion und Investitionen zurückzuziehen und irgendwo anders zu produzieren. Zurzeit erweist sich das internationale Proletariat als ziemlich außerstande, eine adäquate Antwort oder auch nur eine Ahnung davon zu finden. Wir wissen nicht, ob es ihm letztendlich gelingen wird. Doch es scheint klar zu sein, dass die Entwicklung in diese Richtung viel länger dauern wird als der Übergang vom Gewerkschaftswesen zum Massenstreik. Denn einerseits muss die Lage des Proletariats in den alten, zentralen Ländern des Kapitalismus – in jenen, die wie Deutschland an der Spitze der ökonomischen Hierarchie stehen – weitaus dramatischer sein, als dies heute der Fall ist. Andererseits ist der Schritt, den die objektive Realität erfordert - ein bewusster internationaler Klassenkampf, der „internationale Massenstreik“ – weitaus anspruchsvoller, als der Massenstreik in einem Land. Denn er erfordert die Infragestellung nicht nur des Korporatismus und Partikularismus, sondern auch der wichtigsten, oftmals Jahrhunderte oder Jahrtausende alten Spaltungen der Klassengesellschaft wie die nach Nationalität, ethnischer Kultur, Rasse, Religion, Geschlecht, etc. Ein weitaus profunderer und politischerer Schritt. Wenn wir über diese Frage nachdenken, sollten wir berücksichtigen, dass die Faktoren, die die Entwicklung einer revolutionären Perspektive durch das Proletariat, nicht nur in der Vergangenheit liegen, sondern auch in der Gegenwart, dass sie nicht nur politische Ursachen haben, sondern auch „ökonomische“ (korrekter: wirtschaftspolitische).
Präsentation über die nationale Lage in Deutschland (März 2016)
Zurzeit der „Finanzkrise“ 2008 gab es eine Tendenz in der IKS zu einer Art von „Katastrophismus“, eine der Manifestationen der von einigen Genossen vorgestellten Idee, dass der Zusammenbruch der zentralen Ländern des Kapitalismus wie Deutschland nun auf der Tagesordnung stünde. Einer der Gründe, die relative wirtschaftliche Stärke und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands zu einer Achse dieses Berichts zu machen, ist die Hoffnung, dazu beizutragen, solche Schwächen zu überwinden. Doch wir wollen auch den Geist der Nuancierung gegen das schematische Denken stärken. Weil der Kapitalismus selbst eine abstrakte Funktionsweise (gestützt auf dem Austausch von Äquivalenten) hat, gibt es die verständliche, aber ungesunde Tendenz, die ökonomischen Fragen zu abstrakt zu betrachten, indem man zum Beispiel die relative wirtschaftliche Stärke der nationalen Kapitale nur in sehr allgemeinen Begriffen beurteilt (wie dem Grad der organischen Zusammensetzung des Kapitals, der arbeitsintensiven Produktion, der Mechanisierung, wie im Bericht erwähnt) und vergisst, dass der Kapitalismus ein soziales Verhältnis zwischen menschlichen Wesen, vor allem zwischen sozialen Klassen ist.
Zur Klarstellung: Als im Bericht darauf hingewiesen wurde, dass die US-Bourgeoisie juristische Mittel (Geldstrafen gegen Volkswagen und andere) als ein Mittel einsetzt, um der deutschen Konkurrenzfähigkeit zu begegnen, sollte nicht der Eindruck erweckt werden, dass die Vereinigten Staaten keine eigene Wirtschaftskraft besitzen, die sie in die Waagschale werfen könnten. Zum Beispiel liegen die USA zurzeit vor Deutschland in der Entwicklung von elektrisch angetriebenen und selbstfahrenden Autos, und eine der Vermutungen, die in den „sozialen Medien“ über den sog. Volkswagenskandal die Runde machen (dass es Kreise der deutschen Bourgeoisie waren, die die Information über die Manipulation der Messverfahren durch den Konzern an die US-amerikanischen Behörden durchsickern ließen, um so die deutsche Autoindustrie zu zwingen, auf dieser Ebene aufzuschließen) ist nicht bar jeglicher Plausibilität.
Über die Weise, wie die Flüchtlingskrise für imperialistische Zwecke benutzt wird, ist es notwendig, den Bericht auf den neuesten Stand zu bringen. Gegenwärtig machen sowohl die Türkei als auch Russland massiven Gebrauch von der Notlage der Flüchtlinge, um das deutsche Kapital zu erpressen und das, was von Europas Zusammenhalt übriggeblieben ist, zu schwächen. Wie Ankara die Flüchtlinge westwärts hat ziehen lassen, ist im Bericht bereits erwähnt. Der Preis für die türkische Kooperation in dieser Frage wird sich nicht auf einige Milliarden Euro beschränken. Was Russland anbelangt, so ist es kürzlich von einer Reihe von NGOs und Flüchtlingshilfeorganisationen beschuldigt worden, absichtlich Krankenhäuser und Wohnviertel in syrischen Städten zu bombardieren, um neue Flüchtlingsströme auszulösen. Allgemeiner gesagt, hat die russische Propaganda die Flüchtlingsfrage systematisch benutzt, um die Flammen des politischen Populismus in Europa weiter anzufachen.
Was die Türkei anbetrifft, so fordert sie nicht nur Geld, sondern auch die Beschleunigung des visafreien Zugangs ihrer Bürger nach Europa und der Verhandlungen über den Beitritt der Türkei zur EU. Von Deutschland fordert sie auch die Einstellung der militärischen Hilfe für die kurdischen Einheiten im Irak und in Syrien.
Für Bundeskanzlerin Merkel, die prominenteste Exponentin einer engeren Zusammenarbeit mit Ankara in der Flüchtlingsfrage und eine mehr oder weniger entschiedenen „Atlantikerin“ (für sie ist die Nähe zu den USA das kleinere Übel, verglichen mit der Nähe zu Moskau), ist dies weniger ein Problem als für andere Mitglieder ihrer eigenen Partei. Wie der Bericht bereits erwähnte, hatte Putin die Modernisierung der russischen Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie geplant, insbesondere mit ihrem Maschinenbausektor, der seit Ende des II. Weltkrieges hauptsächlich im Süden Deutschlands angesiedelt ist (einschließlich Siemens, einst in Berlin gegründet und nun in München, das anscheinend dazu bestimmt ist, eine zentrale Rolle in dieser „russischen Operation“ zu spielen). In diesem Kontext können wir die Verbindung zwischen der anhaltenden Kritik der bayrischen CSU an Merkels „europäischer“ (und „türkischer“) „Lösung“ der Flüchtlingskrise und dem spektakulären Besuch des bayrischen Parteiführers in Moskau zum Höhepunkt dieser Kontroverse nachvollziehen.[2] Diese Fraktion zieht es vor, mit Moskau statt mit Ankara zu kollaborieren. Paradoxerweise kommt die größte Unterstützung der Kanzlerin in dieser Frage nicht aus den Reihen ihrer Partei, sondern von ihrem Koalitionspartner, der SPD, und der parlamentarischen Opposition. Dies lässt sich zum Teil mit einer Arbeitsteilung innerhalb der regierenden Union erklären, bei der ihr rechter Flügel (im Augenblick nicht sehr erfolgreich) versucht, ihre „konservativen“ WählerInnen davon abzuhalten, abtrünnig zu werden und zur AfD überzulaufen. Doch es gibt auch regionale Spannungen (nach dem II. Weltkrieg war das „kulturelle“ Leben der deutschen Bourgeoisie, obwohl die Regierung in Bonn saß und das Finanzkapital in Frankfurt am Main, hauptsächlich in München konzentriert; erst in jüngster Zeit beginnt es sich wieder in Berlin anzusiedeln). In Bezug auf die jüngsten Flüchtlingswellen gibt es nicht nur Gegensätze, sondern auch Zusammenarbeit und Arbeitsteilung, beispielsweise zwischen der deutschen und österreichischen Bourgeoisie. Indem Österreich den Anfang bei der „Schließung der Balkan-Route“ machte, macht es Berlin weniger abhängig von der Türkei, um die Flüchtlinge auszuhalten, und stärkt damit teilweise Berlins Verhandlungsposition gegenüber Ankara.[3]
Wenn ein wichtiger Teil der Geschäftswelt Merkels „Willkommenspolitik“ gegenüber den Flüchtlingen im letzten Sommer unterstützte, so war dies bei den staatlichen Sicherheitsorganen alles andere als der Fall; sie waren angesichts des mehr oder weniger unkontrollierten und unregistrierten Zustroms ins Land absolut entsetzt. Sie haben das ihr noch immer nicht verziehen. Die französische und andere europäische Regierungen waren nicht weniger skeptisch. Sie sind alle davon überzeugt, dass imperialistische Opponenten aus der islamischen Welt die Flüchtlingskrise benutzen, um Dschihadisten nach Deutschland hineinzuschmuggeln, von wo aus sie nach Frankreich, Belgien, etc. ziehen können. Im Grunde bestätigten die kriminellen Übergriffe in Köln in der Silvesternacht bereits, dass selbst kriminelle Banden das Asylverfahren nutzen, um ihre Mitglieder in den großen europäischen Städten zu positionieren. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass eines der hauptsächlichen Resultate der jüngsten Entwicklungen eine weitere Ausdehnung in Umfang und Bedeutung von Polizei und Geheimdiensten in Europa sein wird.[4]
Der Bericht zog eine Verbindung zwischen Wirtschaftskrise, Immigration und politischem Populismus. Wenn wir die wachsende Rolle des Antisemitismus hinzufügen, dann fallen die Parallelen zu den 1930er Jahren besonders ins Auge. Doch es ist in diesem Zusammenhang aufschlussreich, auch einen Blick auf die historischen Unterschiede zu werfen. Die Tatsache, dass es zurzeit keinen überzeugenden Nachweis gibt, dass die zentralen Sektionen des Proletariats geschlagen, desorientiert und demoralisiert sind wie 80 Jahre zuvor, ist der wichtigste, aber nicht der einzige Unterschied. Die Wirtschaftspolitik, die von der Weltbourgeoisie heute bevorzugt wird, ist die „Globalisierung“, nicht die Autarkie und auch nicht der von den „moderaten“ Populisten befürwortete Protektionismus. Dies berührt einen anderen Aspekt des zeitgenössischen Populismus, der im Bericht noch nicht richtig entwickelt war: seine Opposition gegen die Europäische Union. Letztere ist auf ökonomischer Ebene eines der Instrumente der heutigen „Globalisierung“. In Europa ist sie zu ihrem Hauptsymbol geworden. Teil des Hintergrundes der Bildung von populistischen Regierungen in Mitteleuropa in jüngster Zeit sind zum Beispiel die Verhandlungen über das TTIP-Abkommen zwischen Nordamerika und Europa, das der Großindustrie und dem Agrar-Business Vorteile verschafft, auf Kosten von Kleinbauern und -produzenten in Gebieten, wie den so genannten Visegrad-Staaten (Polen, Ungarn, Tschechien und der Slowakei). Was die Situation des Proletariats anbetrifft, so wird am Ende des Berichts die Mahnung ausgedrückt, dass wir nicht nur auf die Ursachen schauen dürfen, die aus der Vergangenheit herrühren (wie die Konterrevolution, die der Niederlage der Russischen und Weltrevolution Ende des I. Weltkrieges folgte), um die Schwierigkeiten der Arbeiterklasse zu erklären, nach 1968 ihren Kampf politisch in eine revolutionäre Richtung zu lenken. All diese Faktoren aus der Vergangenheit, die zutiefst richtige Erklärungen sind, verhinderten dennoch weder Mai ’68 noch den Heißen Herbst 1969 in Italien. Auch sollten wir nicht davon ausgehen, dass das revolutionäre Potenzial, das sich damals auf embryonale Weise artikulierte, von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Erklärungen, die sich einseitig auf die Vergangenheit berufen, führen zu einer Art von deterministischen Fatalismus. Auf der ökonomischen Ebene war die sog. Globalisierung ein wirtschaftliches und politisches Instrument des Staatskapitalismus, das die Bourgeoisie entdeckte, um ihr System zu stabilisieren und der proletarischen Bedrohung zu begegnen, ein Instrument, auf das das Proletariat umgekehrt eine Antwort finden muss. Daher sind die Schwierigkeiten der Arbeiterklasse in den vergangenen 30 Jahren bei der Entwicklung einer revolutionären Alternative aufs Engste mit der polit-ökonomischen Strategie der Bourgeoisie verknüpft, einschließlich ihrer Fähigkeit, einen ökonomischen Kladderadatsch für die Arbeiterklasse – und somit die Gefahr eines Klassenkrieges – in den alten Zentren des Weltkapitalismus hinauszuschieben.
[1] Laut Rosa Luxemburg zentrieren sich außerkapitalistische Zonen um die noch nicht auf der Ausbeutung von Lohnarbeit basierenden Produktion, ob als Subsistenzwirtschaft oder als Produktion für den Markt durch individuelle Produzenten. Die Kaufkraft solcher Produzenten hilft die Kapitalakkumulation in Gang zu setzen. Der Kapitalismus mobilisiert und beutet die Arbeitskraft und die „Rohstoffe“ (d.h. den natürlichen Reichtum) aus, die aus diesen Zonen kommen.
[2] Die Diskussion auf der Konferenz hob richtigerweise hervor, dass die Formulierung im Bericht, wonach die Geschäftswelt in Deutschland die Flüchtlingspolitik von Merkel unterstützt, als sei sie ein einziger Block, sehr schematisch und als solche nicht richtig ist. Selbst der Bedarf an frischer Arbeitskraft für die Arbeitgeber variiert stark von einem Sektor zum anderen.
[3] Obwohl diese Annäherung der Interessen zwischen Wien und Berlin, wie in der Diskussion hervorgehoben wurde, nur vorübergehend und zerbrechlich ist.
[4] Diese dschihadistische Infiltration und die zunehmende Wahrscheinlichkeit terroristischer Attacken ist eine Realität. Aber es ist auch eine Realität, dass die herrschende Klasse diese und andere Mittel benutzt, um eine Atmosphäre von permanenter Angst, Panik und von Misstrauen zu schaffen, ein Gegengift gegen kritische Reflexion und Solidarität innerhalb der arbeitenden Bevölkerung.
Rubric:
Die "Neue Türkei": neue Probleme für das Land, den Nahen Osten und darüber hinaus
- 1290 Aufrufe
Der Putschversuch vom 15./16. Juli war Präsident Erdogans Worten zufolge "ein Geschenk Gottes". Er betonte, dass die "Säuberungen" weitergehen werden und der "Virus ausgemerzt" werden solle, zusammen mit den Terroristen, wo immer sie sich aufhielten. Tatsächlich wurde anhand von Listen bereits zuvor erstellter Namen eine quasi-stalinistische Säuberungsaktion brachial abgearbeitet; der Krieg gegen die Kurden im Südosten der Türkei nahm umgehend an Heftigkeit zu.
Putsch und Gegenputsch
Ohne über die Rolle und Kenntnisse ausländischer Geheimdienste im bzw. über den Putsch zu spekulieren, scheint es offenkundig zu sein, dass einige ranghohe Militärs der türkischen Armee, die, als der Putsch seinen Lauf nahm, vom BBC als "Gewährsmänner des türkischen Säkularismus" bezeichnet wurden, im Putschversuch verwickelt waren.
Dieser Putsch gegen Erdogan und die AKP war aller Wahrscheinlichkeit nach breiter und tiefer reichend, um allein als das Produkt der "gülenistischen" Bewegung [1]durchzugehen, wenngleich die Allianzen und Verknüpfungen zwischen den mannigfaltigen undurchsichtigen Fraktionen und Strömungen im türkischen Staat in ihrer Kompexität oftmals wahrhaft byzantinisch sind. So sind beispielsweise die Gülenisten lange beschuldigt worden, in der Verschwörung des "tiefen Staates" - Ergenekon - verwickelt gewesen zu sein, der angeblich in den 1990ern als Garant der säkularen Traditionen erichtet wurde; traditionell sind die Hauptgegner von Erdogans "moderater" islamistischen Partei, die AKP, jedoch nicht die gülenistischen, sondern die kemalistischen Fraktionen[2] im Militär und in der Gesellschaft insgesamt. Doch dieser Putschversuch war nicht einfach eine neue Konfrontation zwischen der islamistischen AKP und den säkularen Kemalisten - tatsächlich scharte sich nach dem Putsch die größte kemalistische Partei, die CHP, in einer rührseligen Demonstration der nationalen Einheit um die Regierung. Auch komplexe religiöse Rivalitäten spielten mit: zwischen den Sunniten und den andersgläubigen Alewiten, zwischen Erdogans Version des sunnitischen Islams und der Version, die von den Gülenisten verkündet wird. Doch einstweilen haben Erdogan und die AKP mit dem dreimonatigen Ausnahmezustand, der es ihnen gestattet, per Dekret und in einer Atmosphäre der Furcht und erhöhter staatlicher Beobachtung zu herrschen, ihren totalitären Zugriff auf den türkischen Staat verstärkt.
Bislang sind laut CNN (9.8.16) 22.000 Menschen festgenommen und weitere 16.000 unter spezifischen Vorwürfen arrestiert worden, einschließlich Tausender Militärs, darunter rund ein Drittel der türkischen Generäle und Admiräle. Hunderte von Journalisten sind verhaftet, interniert oder gekündigt worden, ebenso viele Tausende von Beamten; vielen sind Auslandsreisen untersagt worden. Insgesamt sind 68.000 Menschen gefeuert oder suspendiert, 2000 Institutionen geschlossen worden.
Auch einige Leute aus Erdogans innerem Kreis sind inhaftiert worden; die Präsidentengarde ist aufgelöst worden. Auf Regierungsseite sind rund 250 Soldaten und Zivilisten getötet worden; auf Seiten der Putschisten ist, ob wissentlich oder unwissentlich, eine unbekannte Zahl von Menschen umgekommen. Dutzende von Kampfflugzeugen und Helikoptern, Tausende gepanzerte Fahrzeuge und drei Schiffe wurden für den Putschversuch eingesetzt. Laut einigen Berichten entkam Erdogan, nach Warnungen der russischen Aufklärung, nur knapp seinen Häschern.
Die innere Destabilisierung der Türkei
Einige Jahre lang war die Türkei eine stabile, wirtschaftlich aufwärtsstrebende Oase inmitten einer Wüste von Problemen im Nahen Osten und Vorbild eines moderaten, demokratischen Islams. Und in der Tat hat die Türkei solidere historische Wurzeln als viele ihrer kriegsgeschundenen Nachbarn, wie Syrien oder der Irak. Doch es bleibt eine Tatsache, dass die Türkei in Bezug auf ethnische und religiöse Spaltungen auch vieles gemeinsam hat mit Syrien und dem Irak.
Die Stärke von Erdogans AKP war ihre Förderung der Wirtschaft gewesen, durch die der Lebensstandard für die meisten Menschen auf dem Lande und für die städtischen Armen angehoben wurde. Es wurden Jobs geschaffen, indem riesige Anleihen für Staatsinvestitionen und Staatsprojekte auf dem Kapitalmarkt aufgenommen wurden. Gleichzeitig hat Erdogan vom Aufstieg des Islams profitiert und eine moderate Form des Fundamentalismus verfolgt, um das Image der "Neuen Türkei" aufzuwerten und seine Macht als ein potenzieller Führer der sunnitischen Welt zu demonstrieren. Hinter dem Konflikt zwischen der islamistischen AKP und den säkularen Kemalisten in der Armee und in breiteren Gesellschaftsschichten, d.h. der Konfrontation zwischen Islamismus und säkularistischen Nationalismus, steckt ein weiteres religiöses Element. Das frühere säkulare, kemalistische System wurde verdächtigt, indirekt die schiitisch-alewitische Minderheit zuungunsten der sunnitischen Mehrheit zu begünstigen, da die alewitische Form des Islams als für die moderne Welt besser geeignet betrachtet wurde. In diesem Punkt gibt es eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem früheren kemalistischen System in der Türkei und dem Assad-Regime, das über eine sunnitische Mehrheit herrscht, während es selbst größtenteils aus der schiitischen Glaubensrichtung der Alewiten zusammengesetzt ist.[3] Der gegenwärtige Krieg in Syrien zwischen Alewiten und Sunniten wird die religiösen und kulturellen Rivalitäten zwischen vergleichbaren Elementen in der Türkei beeinflussen und verschärfen. So gab es nach dem Putschversuch Berichte über pogromistische Angriffe gegen Wohnungen und Geschäfte von Alewiten.
Die Türkei von heute ist nicht dasselbe Land, das es zurzeit des Militärputsches von 1980 war, der seine Rechtfertigung aus dem wachsenden Chaos zog, das von den Konflikten zwischen rechten und linken politischen Fraktionen angerichtet wurde, oder das es vor nur zehn Jahren war, als die AKP an die Macht gelangt war. Infolge des Wirtschaftsbooms, der nun anscheinend zu Ende geht, entstand sowohl ein modernes Proletariat als auch eine neue Elite von Spezialisten und Intellektuellen in den großen Städten. Ein großer Teil dieser Elemente fühlt sich absolut nicht wohl angesichts der "Islamisierung". So ist eine gefährliche Situation entstanden, in der der Putsch der alten Elite (in dem Maße, wie sie sie daran teilgenommen hat) Hass und Rachegelüste unter den AKP-Anhängern provoziert hat. Andererseits muss Erdogan die Warnung ernstnehmen, die dieser Putschversuch darstellt. Wenn er mit seinem "Gegen-Putsch" zu weit geht, kann er im schlimmsten Fall einen Bürgerkrieg oder einen endlosen Konflikt in Gestalt von bewaffneten Revolten oder neuen Formen des Terrorismus provozieren - selbst wenn der Widerstand dieser Kräfte im Augenblick gebrochen ist.
Zu einer Zeit, wo das Land von einem Wirtschaftswunder zu einem von Morgan Stanleys "Fragile Five" geworden ist, wo seine Produktivität und sein Wachstum bergab gehen, während Arbeitskosten, Inflation und Schuldenmacherei im Steigen begriffen sind, könnten die Folgen einer weiteren wirtschaftlichen Instabilität dramatisch sein - Zusammenbruch des Tourismus, Emigration der neuen Generation ausgebildeter ArbeiterInnen, etc.
Hinzu kommt, dass die türkische Bourgeoisie eine lange Tradition in der "Exklusion" hat; auf ihr sind die Fundamente der modernen Türkei gegossen worden: der Völkermord an den Armeniern, die Massaker an den Griechen und eine lang andauernde Gegnerschaft gegenüber jeglicher Möglichkeit eines kurdischen Staates. Die Ansicht der AKP, dass alle Opponenten Feinde sind, die unterdrückt werden müssen, hat eine lange Vorgeschichte in der Türkei.
Weitere Destabilisierung im ganzen Nahen Osten
Seit dem Zusammenbruch des Ostblocks 1989 ist die Türkei von den dadurch ausgelösten zentrifugalen Tendenzen heftig tangiert worden. Die Schwächung des US- und russischen Imperialismus hat es der Türkei erlaubt, ihre eigenen Ambitionen geltend zu machen und als regionaler Führer der sunnitischen Regimes zu posieren. Das Erdogan-Regime hat sich mit Israel entzweit, stärkte dagegen seine Bande zur Hamas und nannte die al Sisi-Regierung in Ägypten, die die Muslim-Bruderschaft gestürzt hatte, "illegitim". Seine Beziehungen zu Russland, die sich nach dem Putsch und Erdogans Treffen mit Putin in St. Petersburg am 9. August wieder verbessert haben, sind kompliziert und schwankend. In ihrer gegenwärtigen Lage kann die Türkei den Westen mit ihren Verbindungen zu Russland, China (und den Iran) erpressen und ihre eigene Karte im Nahen Osten ausspielen.
Der größte Albtraum für die türkische Bourgeoisie wäre die Etablierung eines kurdischen Staates. Der Westen hat ein Dilemma hier: In seinem Krieg gegen den IS verlässt er sich auf die Kurden als Kanonenfutter, versorgt sie mit Waffen, Luftsicherung und "Beratern". Solche Entwicklungen können den kurdischen Nationalismus und seine Ambitionen für einen "unabhängigen" Staat nur befeuern, auch wenn die kurdischen Nationalisten selbst in eine Reihe von unterschiedlichen Fraktionen aufgespalten sind. Die Interessenskollision zwischen den USA, Deutschland und Großbritannien auf der einen Seite und der Türkei auf der anderen in der Kurdenfrage ist schroff. Erdogan stand vor dem Krieg dem Assad-Regime sehr nahe, und während des Krieges haben beide die IS-Kräfte zu ihrem eigenen vermeintlichen Vorteil benutzt. Assad hat die kurdische PKK aus deselben Gründen benutzt. Und jetzt, nach fünf Kriegsjahren und der russischen (und anderen) Intervention zu Gunsten Assads, gibt es Anzeichen dafür, dass Ankara in Betracht zieht, Assad an der Macht zu lassen und gleichzeitig eine Art Deal mit ihm auszuhandeln. Weder Assad noch die Türkei haben irgendein Interesse an einem kurdischen Staat oder an jeglicher Art einer autonomen kurdischen Region entlang der Grenze. Seit rund einem Jahr werden zwischen Assads alewitischen Repräsentanten in Damaskus und Repräsentanten der türkischen Heimatpartei[4] zusammen mit Elementen des türkischen Geheimdienstes mit Blick darauf u.a. Gespräche darüber geführt, die militärische Unterstützung von Assads Feinden durch die Türkei zu stoppen. Diese türkischen "Gesprächspartner" scheinen unberührt von der Atmosphäre nach dem Putschversuch zu sein; dies deutet darauf hin, dass die Gespäche fortgeführt werden. Wenn dies der Fall ist, so wird dies auf Kosten des Westens und seiner kurdischen "Verbündeten"[5] geschehen.
Wir müssen ebenfalls die Bedeutung der Tatsache berücksichtigen, dass Erdogan, der Führer eines NATO-Landes, die Regierungen anderer NATO-Länder - insbesondere der USA -beschuldigt hat, den Putsch unterstützt zu haben, während er gleichzeitig Russland dafür preist, dass es ihn vor den Plänen eines Staatsstreichs gewarnt hatte. Es gibt auch ein dickes Fragezeichen hinter der Verfügbarkeit der Militärbasis Incirlik: Bis jetzt wird Incirlik als NATO-Basis betrachtet, doch Erdogan hat geäußert, dass er sich nicht den Russen widersetzen werde, wenn sie Incirlik für ihre Operationen gegen den IS benutzen wollen. Diese Entwicklung, dieses Spiel des Schacherns und Erpressens ist ein weiteres Anzeichen für die wachsende Fragilität imperialistischer Bündnisse in dieser Region.
Die Flüchtlinge: "... Benzin direkt am Feuer"
Sir Richard Dearlove, Ex-Chef des MI6, verglich den EU-Deal mit der Türkei über die Flüchtlinge damit, "Benzin direkt am Feuer zu lagern" (BELFAST TELEGRAPH, 15.5.16). Die Türkei wird diese Millionen von "Aktivposten" als ein weiteres Element zur Erpressung der EU (die Erdogan einen "Christenklub" nennt) nutzen. Erdogan hat bereits gedroht, den Deal zu canceln, was die Europäer umgehend dazu zwang, ihn zu beschwichtigen. Die gegenwärtige Säuberungswelle und die Jagd auf Oppositionelle bedeuten, dass es zusätzlich zu den mehr als zwei Millionen Syrern und anderen Flüchtlingen immer mehr Türken geben wird, die selbst aus dem Land fliehen und ihren Beitrag zur allgemeinen Flüchtlingskrise leisten werden.
Langfristige Ungewissheit
In einem System, das sich in einem sich beschleunigenden Niedergang befindet, ist die Tendenz zu Instabilität und Chaos auf historischer Ebene vorherrschend. Doch dies bedeutet nicht, dass die herrschende Klasse angesichts dessen hilflos ist und dass es keine Gegentendenzen gibt. Wir haben dies am Beispiel Großbritanniens nach dem katastrophalen Ergebnis des EU-Referendums gesehen: Die herrschende Klasse reagierte sehr schnell auf die Gefahr ernsthafter Brüche in ihren Reihen, reorganisierte clever ihre Regierungsmannschaft, um eine vereinte Antwort auf die Brexit-Krise zu präsentieren. Und wir können ähnliche Tendenzen in der Türkei wahrnehmen. Obwohl Kemalisten und Gülenisten in dem Putsch kooperierten, wurden nach seinem Scheitern allein die Gülenisten ausgesondert. Nach dem Putsch hat Erdogan mehrfach das Vermächtnis von Atatürk betont und die Karte des türkischen Nationalismus statt des Islamismus gespielt. Dies könnte einen ernsthaften Versuch bedeuten, die Kemalisten wie auch Alewiten und andere bürgerliche Fraktionen für die Option eines autokratischen Führers zu gewinnen, der die Ansprüche der türkischen Nation durchdrückt (ein wenig wie das Modell Putin in Russland).
Die gegenwärtige Verherrlichung Erdogans in den ausgiebig publizierten Straßendemonstrationen könnten Bestandteil dieser Strategie sein, eine neue Einheit innerhalb der herrschenden Klasse der Türkei zu schmieden. Indes dürfen die offiziellen Bilder, die eine Unterstützung Erdogans und der AKP durch die Massen zeigen, nicht für bare Münze genommen werden. Im Augenblick ist er der Sieger, nachdem er die rivalisierenden Cliquen aufgemischt hat, doch es gibt Grenzen für Erdogans autoritäres Projekt... Eine Stärke Erdogans und der AKP war die starke Wirtschaft gewesen, doch wie wir bereits erwähnt haben, neigt sich diese Phase ihrem Ende zu. Er war nie so populär gewesen, wie die Propaganda suggeriert; Anti-Regierungs-Demonstrationen in wichtigen Gebieten 2013 zeigten, nachdem sie von den Protesten im Gezi-Park am Taksim-Platz[6] entfacht wurden, die Existenz einer breiten Ablehnung seiner Politik unter der urbanen, gebildeten Jugend im Besonderen. Und es bleiben tiefe Ressentiments im Militär gegen Erdogan und seine Partei bestehen. Nur ein Jahr zuvor sahen sich AKP-Minister auf Begräbnissen von Soldaten, die im Kampf gegen die kurdische PKK getötet worden waren, öffentlichen Schmähungen und dem Gespött seitens ranghoher Militärs ausgesetzt. Die Erdogan-Regierung antwortete auf diese öffentliche Erniedrigung - bei Anlässen, die eigentlich als Schaufenster der Staatspropaganda dienen sollten - damit, dass sie die Medien aufforderte, ihre Berichterstattung über die Begräbnisse einzustellen (TIMES, 31.8.16). Die Militärs nahmen öffentlich Anstoß daran, dass die getöteten Soldaten "Märtyrer" genannt wurden, und drückten die Ansicht aus, dass der Militärschlag gegen die PKK nur der Stärkung der AKP in den Wahlen gegen die pro-kurdische Demokratische Partei (HDP) dienen sollte.
Zurzeit hat die Erdogan-Clique ihre Stellung gestärkt, weil sie den Putschisten die Kontrolle entriss, doch ihre gesellschaftliche Kontrolle bleibt ungewiss, mit Konsquenzen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Türkei.
Boxer (Dieser Artikel ist der Beitrag eines Sympathisanten der IKS)
[1]Fetullah Gülen, ein Ex-Verbündeter Erdogans, nun im Exil in den USA, betreibt von dort aus so etwas wie ein Imperium und übt die Kontrolle über etliche Einrichtungen und Vermögenswerte aus, die nach Berichten etwa 50 Milliarden Dollar wert sein sollen. Die gülenistische oder Hizmet-Bewegung hat weltweit über 80 Millionen Anhänger und unterstützte offen die Clintons und die Demokraten. Ihr Islamismus scheint fundamentalistischer zu sein als der der AKP. Durch ihr Bündnis mit Erdogan und der AKP von 2002 bis 2011 waren die anti-kemalistischen Gülenisten auch in der Lage, Elemente in den türkischen Staat einzuschleusen. Doch ihre sektenartige Struktur wurde von Erdogan in wachsendem Maße als eine Bedrohung seiner Herrschaft wahrgenommen.
[2]Kemalisten: säkulare Nationalisten, die behaupten, in der Tradition von Kemal Atatürk zu stehen, dem Begründer des modernen türkischen Staates in den 1920er Jahren.
[3]Die Alewiten (oder Alawiten) sind nicht dieselbe Glaubensrichtung, obwohl ihre beiden Namen ihr Bekenntnis zu Ali bedeuten, dem Schwiegersohn Mohammeds und eine Schlüsselfigur im schiitischen Richtung des Islam. Es gibt auch ethnische Unterschiede in der Mehrheit ihrer Angehörigen.
[4]Heimatpartei (YP), eine kleine, rechtskonservative Partei, die 2002 gegründet worden war.
[5]Am 29. August verurteilten die USA scharf die wiederaufgeflammten Kämpfe zwischen dem türkischen Militär und den kurdischen Kämpfern in Nordsyrien. Wie in der Vergangenheit benutzte die Türkei eine Offensive gegen den IS (die selbigen aus der Stadt Jarablus vertrieb) als ein Mittel der Eskalation ihres Krieges gegen die Kurden; dieser Konflikt weitete sich nun offen auf den syrischen Kriegsschauplatz aus.
Rubric:
Brexit, Trump: Rückschläge für die Bourgeoisie, nichts Gutes für das Proletariat
- 2086 Aufrufe
Das Referendum, das außer Kontrolle geriet
Vor mehr als 30 Jahren stellten wir in den "Thesen über den Zerfall"[1] fest, dass es für die Bourgeoisie immer schwieriger werden würde, die zentrifugalen Tendenzen ihres eigenen Politapparates zu kontrollieren. Was dies konkret bedeuten kann, demonstriert das "Brexit"-Referendum in Großbritannien und Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur in den Vereinigten Staaten. In beiden Fällen haben skrupellose politische Abenteurer aus der herrschenden Klasse zur eigenen Selbsterhöhung die populistische Revolte jener ausgenutzt, die am meisten unter den ökonomischen Umbrüchen der letzten 30 Jahre gelitten haben.
Die IKS hat erst spät den Aufstieg des Populismus erkannt und seine Konsequenzen in Betracht gezogen. Daher veröffentlichen wir nun einen allgemeinen Text über den Populismus, der noch in unserer Organisation diskutiert wird.[2] Der folgende Artikel hat zum Ziel, die Hauptgedanken in Anwendung zu bringen, die im Diskussionstext bezüglich der besonderen Lage in Großbritannien und den USA vorgebracht worden waren. Angesichts einer sich schnell verändernden Weltlage gibt er nicht vor, vollständig zu sein, doch hoffen wir, dass er einen Denkanstoß geben und weitere Diskussionen anregen kann.
Der Kontrollverlust der herrschenden Klasse war noch nie so offensichtlich gewesen wie im Spektakel des beispiellosen Wirrwarrs, das sich nach dem EU-Referendum in Großbritannien und seinen Folgen entfaltet hat. Niemals zuvor hat die herrschende Klasse Großbritanniens so sehr die Kontrolle über den demokratischen Prozess verloren, nie zuvor hat sie ihre existenziellen Interessen solch Abenteurern wie Boris Johnson oder Nigel Farage überlassen.
Das allseitige Versäumnis, sich auf die Konsequenzen eines Brexit einzustellen, zeigt das Ausmaß der Verwirrung innerhalb der herrschenden Klasse Großbritanniens. Nur Stunden nachdem das Resultat verkündet worden war, mussten die Hauptaktivisten für den Brexit gegenüber ihren Anhängern einräumen, dass die 350 Millionen Pfund zusätzlich pro Woche für den NHS[3], die ein Brexit-Votum, wie sie versprochen hatten, bringen würde - eine Zahl, mit der die "Leave EU"-Busse von allen Seiten bepflastert wurden -, natürlich ein "Druckfehler" waren. Binnen weniger Tage trat Farage als UKIP-Führer[4] zurück und ließ seine Amtskollegen auf dem ganzen Brexit-Schlamassel sitzen; Boris Johnsons früherer Kommunikationschef Guto Harri erklärte, dass die Brexit-Kampagne "keine Herzenssache" für Johnson gewesen sei; es gibt den mehr als starken Verdacht, dass Johnsons Eintreten für den Brexit ein rein opportunistisches, eigennütziges Manöver war, das dazu bestimmt war, seinen Führungsanspruch gegenüber David Cameron zu zementieren. Michael Grove, der Johnsons Kampagnenchef während des gesamten Referendums gewesen war und Johnsons Kampagne für den Posten des Premierministers leiten sollte (und selbst wiederholt erklärte, dass er selbst kein Interesse an diesem Job habe), meuchelte keine zwei Stunden vor Fristablauf der Kandidatur Johnson von hinten, indem er seinen Hut in den Ring warf und dies damit begründete, sein langjähriger Freund Johnson eigne sich nicht als Premier. Nachdem sie noch vor drei Jahren erklärt hatte, dass der Austritt aus der EU eine Katastrophe für Großbritannien wäre, trat Andrea Leadsom nun als stramme "Leave"-Anhängerin in das Rennen um die Tory-Führung ein. Lügen, Heucheleien, Doppelspiele - nichts davon ist an der herrschenden Klasse natürlich neu. Was auffällt, ist der Verlust jeglichen staatsmännischen Sinnes, eines übergeordneten historischen, nationalen Interesses in der weltweit erfahrensten herrschenden Klasse, das über den persönlichen Ambitionen und den kleingeistigen Rivalitäten von Cliquen steht. Um eine vergleichbare Episode im Leben der englischen Herrschaftsklasse zu finden, müssen wir zu den Rosenkriegen (die in Shakespeares Drama Heinrich VI. thematisiert wurden) zurückkehren, dem letzten Atemzug einer niedergehenden Feudalordnung.
Das Unvorbereitetsein der Finanz- und Industriebosse auf den Ernstfall eines Brexit ist gleichermaßen auffällig, vor allem angesichts all der Anzeichen dafür, dass das Resultat "den knappsten Ausgang (nehmen würde), den du in deinem Leben jemals gesehen hast" (um uns die Freiheit zu nehmen, den Duke von Wellington nach der Schlacht von Waterloo zu zitieren.[5] Der Kollaps des Pfund Sterling um 20, dann 30 Prozent gegenüber dem Dollar ist ein Hinweis, dass der Brexit unerwartet kam - er wurde bei der Bewertung des Pfunds vor dem Referendum nicht berücksichtigt. Wir werden mit einem wenig erbaulichen Schauspiel traktiert, in dem Banker und Geschäftsleute zum Ausgang eilen, nachdem sie ihre Büros oder gar Körperschaften nach Dublin oder Paris haben umziehen lassen. George Osbornes spontaner Entschluss, die Körperschaftssteuer auf 15 Prozent zu senken, war offenkundig eine Notbremse, um Firmen in Großbritannien zu halten, ist doch die britische Wirtschaft weltweit mit am abhängigsten von den ausländischen Direktinvestitionen.
Das Imperium schlägt zurück
Davon abgesehen jedoch, ist die herrschende Klasse Großbritanniens nicht ausgezählt. Camerons sofortige Ersetzung als Premier durch Theresa May (anfangs nicht vor September erwartet) - eine grundsolide und kompetente Politkerin, die diskret für ein Bleiben warb - und die Demontage ihrer Opponenten Andrea Leadsom und Michael Grove durch die Presse und Tory-Abgeordnete demonstrieren die ausgesprochene Fähigkeit zu raschen, kohärenten Reaktionen von Seiten der dominanten Staatsfraktionen der herrschenden Klasse.
Im Grunde wird diese Situation durch die Evolution des Weltkapitalismus und des Kräfteverhältnisses der Klassenkräfte bedingt. Sie ist das Produkt einer allgemeineren Dynamik In Richtung Destabilisierung einer kohärenten bürgerlichen Politik auf der gegenwärtigen Ebene des Staatskapitalismus. Die treibenden Kräfte hinter der Tendenzen zum Populismus sind nicht das Thema dieses Artikels: Sie werden im o.g. "Diskussionsbeitrag zum Problem des Populismus" analysiert. Doch diese internationalen Phänomene nehmen unter dem Einfluss der spezifischen nationalen Historien und Charakteristiken konkrete Gestalt an. Demgemäß hat die Tory-Partei stets einen "euroskeptischen" Flügel beherbergt, der nie wirklich die britische Mitgliedschaft in der EU akzeptiert hat und dessen Ursprünge wir wie folgt definieren können:
1. Großbritanniens - und zuvor Englands - geographische Lage fern der Küsten Europas hatte bedeutet, dass Großbritannien in der Lage gewesen war, auf eine Weise unbeteiligt in den europäischen Rivalitäten zu bleiben, wie es die Kontinentalstaaten nicht sein konnten; seine verhältnismäßig kleine Größe und die Nicht-Existenz eines Landheeres hatte bedeutet, dass es niemals darauf setzen konnte, Europa zu dominieren, wie es Frankreich bis zum 19. Jahrhundert tat und Deutschland seit 1870, sondern seine existenziellen Interessen nur verteidigen konnte, indem es die Hauptmächte gegeneinander ausspielte und jegliche Verpflichtung gegenüber ihnen vermied.
2. Großbritanniens geographische Lage als eine Insel und sein Status als die weltweit erste Industrienation haben seinen Aufstieg als maritime Weltimperialist bedingt. Zumindest seit dem 17. Jahrhundert hatten die herrschenden Klassen Großbritanniens eine Weltsicht gehabt, die es ihnen gestattete, eine gewisse Distanziertheit zu einer ausschließlich europäischen Politik zu erhalten. Diese Situation änderte sich nach dem II. Weltkrieg radikal, erstens weil Großbritanniens Status als dominante Weltmacht nicht mehr aufrechtzuerhalten war; zweitens weil die moderne Militärtechnologie (Airpower, Langstreckenraketen, Nuklearwaffen) bedeutete, dass die Isolation gegenüber der europäischen Politik keine Option mehr war. Einer der ersten, die diese Situation erkannten, war Winston Churchill, der 1946 zur Schaffung der "Vereinten Staaten von Europa" aufrief; seine Position wurde jedoch innerhalb der Konservativen Partei niemals völlig akzeptiert . Die Opposition gegen eine Mitgliedschaft in der EU[6] wuchs, als Deutschland immer stärker wurde, insbesondere nach dem Zusammenbruch der UdSSR und der deutschen Wiedervereinigung 1990, die das Gewicht Deutschlands in Europa steigerte. Während der Referendumskampagne verursachte Boris Johnson bekanntermaßen einen Skandal, als er sagte, dass die EU ein Instrument der deutschen Vorherrschaft "à la Hitler" sei, doch konnte er keine Urheberschaft anmelden. Dieselben Ressentiments, in so ziemlich dergleichen Sprache, wurden 1990 von Nicolas Ridley ausgedrückt, damals Minister in Thatchers Regierung. Es spricht für den Autoritätsverlust und die Disziplinlosigkeit innerhalb des politischen Apparates nach dem Krieg, dass, während Ridley sofort gezwungen wurde, aus der Regierung zurückzutreten, die Konsequenzen für Johnson darin bestehen, dass er Mitglied im neuen Kabinett wird.
3. Großbritanniens einmaliger Status als die weltweit größte imperiale Macht und der Verlust dieses Status' ist ein tief verwurzeltes psychologisches und kulturelles Phänomen in der britischen Bevölkerung (einschließlich der Arbeiterklasse). Die nationale Besessenheit vom II. Weltkrieg - das letzte Mal, dass Großbritannien so tun konnte, als handle es als eine unabhängige Weltmacht - veranschaulicht dies perfekt. Ein Teil der britischen Bourgeoisie und mehr noch des Kleinbürgertums hat noch immer nicht begriffen, dass Großbritannien heute nur noch eine zweit- oder drittrangige Macht ist. Viele der "Leave"-MitstreiterInnen schienen zu glauben, dass, wenn Großbritannien von den "Fußfesseln" der EU befreit wäre, die Welt herbeieilen würde, um britische Güter und Dienstleistungen zu erwerben - eine Fantasievorstellung, für die die britische Wirtschaft wahrscheinlich teuer bezahlen muss.
Diese Empfindung des Ressentiments und Zorns gegen die äußere Welt wegen des Verlustes der imperialen Macht ist vergleichbar mit jener eines Teils der amerikanischen Bevölkerung als Ergebnis des so wahrgenommenen Statusverlustes der Vereinigten Staaten und ihres Unvermögens, ihre eigene Herrschaft durchzusetzen, so wie sie dies im Kalten Krieg taten.
Das Referendum als Zugeständnis an den Populismus
Die populistischen Eskapaden von Boris Johnson waren spektakulärer und erhielten mehr Medienrummel als David Camerons althergebrachte, schrecklich vornehme, "verantwortungsvolle" Rolle. Doch in Wahrheit ist Cameron ein besseres Indiz dafür, wie weit die Fäulnis in der herrschenden Klasse gediehen ist. Johnson mag der Hauptakteur gewesen sein, doch es war Cameron, der die Bühne bereitete, indem er das Versprechen eines Referendums für parteipolitische Zwecke benutzte, um die letzten allgemeinen Wahlen zu gewinnen. Ein Referendum ist von Hause aus weitaus schwerer zu kontrollieren als eine Parlamentswahl und stellt als solches stets ein Wagnis dar.[7] Wie ein Süchtiger im Casino zeigte sich Cameron als wiederholter Hasardeur, zunächst mit dem Referendum über die schottische Unabhängigkeit, das er mit Ach und Krach gewann, dann mit dem Brexit. Seine Konservative Partei, die sich stets als der beste Vertreter der Wirtschaft, der Union[8] und der nationalen Sicherheit darstellte, hat letztendlich alle drei aufs Spiel gesetzt.
Angesichts der Schwierigkeit, die Ergebnisse zu manipulieren, sind Plebiszite über wichtige Angelegenheiten von nationalem Interesse größtenteils ein unerwünschtes Risiko für die herrschende Klasse. Im klassischen Konzept und in der Ideologie der parlamentarischen Demokratie, selbst in ihrer dekadenten Scheinform, sind für solche Entscheidungen "gewählte Repräsentanten" vorgesehen, die von Experten und Interessengruppen beraten (und beeinflusst) werden - nicht von der Bevölkerung in ihrer Gesamtheit. Vom Standpunkt der Bourgeoisie aus ist es der reine Wahnwitz, Millionen von Menschen aufzufordern, über solch komplexe Themen wie den EU-Verfassungsvertrag 2004 zu entscheiden, als die Massen von Abstimmenden ungewillt, ja nicht einmal in der Lage waren, den Vertragstext zu lesen oder zu verstehen. Kein Wunder, dass die herrschende Klasse in den Referenden, die über diesen Vertrag abgehalten worden waren (Frankreich, Niederlande, im ersten Anlauf Irland), so oft das "falsche" Resultat erzielte.[9]
Einige aus der britischen Bourgeoisie scheinen heute zu hoffen, dass die May-Regierung denselben Trick wie die französische und irische Regierung nach ihren vermasselten Referenden über den Verfassungsvertrag anwendet und das Referendum einfach ignoriert oder kippt. Dies erscheint uns zumindest kurzfristig als unwahrscheinlich, nicht weil die britischen Bourgeois feurigere Demokraten sind als ihre Kumpel, sondern gerade weil das Ignorieren des "demokratischen" Ausdrucks des "Volkswillens" lediglich den populistischen Ideen mehr Glaubwürdigkeit verleiht und sie noch gefährlicher macht.
Theresa Mays Strategie hat bislang das Beste aus einem miesen Job gemacht und den Rahmen für den Brexit abgesteckt, wobei drei der prominentesten "Leave"-Befürworter Ministerposten erhalten haben und sich für die Organisierung der Loslösung Großbritanniens von der EU verantwortlich zeichnen. Selbst Mays Ankündigung, den Clown Johnson zum Außenminister zu machen - im Ausland mit einer Mischung aus Horror, Heiterkeit und Unglauben aufgenommen -, ist gewiss Teil dieser breiter angelegten Strategie. Indem sie Johnson auf den heißen Stuhl der Verhandlungsführung für den Austritt aus der EU setzt, stellte May sicher, dass der Großsprecher der "Leave"-Befürworter am meisten unter Beschuss und im Zentrum der Glaubwürdigkeitskrise stehen wird und somit daran gehindert wird, von außen querzuschießen.
Die Auffassung besonders unter jenen, die für die populistischen Bewegungen in Europa oder in den USA stimmten, dass der gesamte demokratische Prozess ein Schwindel sei, weil die Elite einfach unbequeme Resultate ignoriert, ist eine reale Bedrohung für die Effektivität der Demokratie als ein System der Klassenherrschaft. In der populistischen Konzeption von Politik soll der "direkte Volksentscheid" die Korruption gewählter Repräsentanten durch die etablierten Politeliten verhindern. Daher wurden in Deutschland als Folge der negativen Erfahrungen mit ihnen in der Weimarer Republik und ihres Gebrauchs in Nazi-Deutschland solche Referenden aus der Nachkriegsverfassung ausgeschlossen.[10]
Die Wahlen, die aus dem Ruder gerieten
Wenn Brexit ein Referendum war, das außer Kontrolle geriet, dann ist Trumps Wahl als republikanischer Kandidat für die Präsidentschaftswahlen 2016 eine Wahl, die aus dem Ruder geriet. Als Trump seine Kandidatur erklärte, wurde er zunächst kaum ernstgenommen: Der Frontmann war Jeb Bush, Mitglied der Bush-Dynastie, bevorzugte Wahl der republikanischen Granden und als solche potenziell ein mächtiger Spendensammler (immer ein entscheidender Gesichtspunkt in US-Wahlen). Doch entgegen aller Erwartungen triumphierte Trump in den ersten Vorwahlen und gewann auch weiterhin einen Bundesstaat nach dem anderen. Bush verpuffte wie ein Knallfrosch, andere Kandidaten zählten nie mehr als unter ferner liefen, und die Bosse der republikanischen Partei sahen sich letztendlich der unerquicklichen Aussicht ausgesetzt, dass der einzige Kandidat mit einer Chance, Trump zu schlagen, Ted Cruz war, ein Mann, der von seinen Senatskollegen als absolut nicht vertrauenswürdig und als nur etwas weniger egoistisch und eigennützig als Trump angesehen wird.
Die Möglichkeit, dass Trump Clinton schlägt, ist an sich schon ein Hinweis darauf, wie irrsinnig die politische Lage geworden ist. Doch auch so schon hat Trumps Kandidatur Schockwellen durch das ganze System imperialistischer Bündnisse gejagt. 70 Jahre lang waren die USA der Hauptgarant des NATO-Bündnisses gewesen, dessen Wirksamkeit von der Unantastbarkeit der wechselseitigen Verteidigung (Bündnisfallklausel) abhängt: Ein Angriff auf einen wird als ein Angriff gegen alle aufgefasst. Wenn ein potenzieller US-Präsident das NATO-Bündnis und die Bereitschaft der USA in Frage stellt, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, wie es Trump getan hat, als er erklärte, dass eine US-Antwort auf einen russischen Angriff gegen die baltischen Staaten davon abhänge, ob sie nach seiner Einschätzung "ihren Unterhalt bestreiten können", dann jagt dies sicherlich einen Schauer über den Rücken der herrschenden Klassen Osteuropas, die direkt mit Putins Mafia-Staat konfrontiert sind, ganz zu schweigen von den asiatischen Ländern (Japan, Südkorea, Vietnam, Philippinen), die sich darauf verlassen haben, dass Amerika sie vor dem chinesischen Drachen beschützt. Fast ebenso alarmierend ist die reale Möglichkeit, dass Trump einfach nicht weiß, was los ist, wie dies in seiner jüngsten Stellungnahme angedeutet wird, wonach es keine russischen Truppen in der Ukraine gibt (anscheinend unwissend, dass die Krim von jedermann, außer den Russen, noch immer als Bestandteil der Ukraine angesehen wird).
Mehr noch, Trump forderte den russischen Geheimdienst auf, sich in die IT-Systeme der Demokratischen Partei zu hacken und lud Putin ein, sein Bestes zu geben. Wie sehr dies, wenn überhaupt, Trump beschädigen wird, ist schwer zu sagen, aber es lohnt sich, sich zu vergegenwärtigen, dass seit 1945 die Republikanische Partei entschieden, wenn nicht fanatisch anti-russisch gewesen war und zugunsten einer starken, weltweiten militärischen Präsenz, koste es, sie was sie wolle (es war Reagans militärische Aufrüstung, die die Staatsschulden explodieren ließ).
Es ist nicht das erste Mal, dass die Republikanische Partei einen Kandidaten aufs Feld schickte, der von ihrer Führung als gefährlich extremistisch betrachtet wurde. 1964 gewann Barry Goldwater, dank der Unterstützung durch die religiöse Rechte und die "konservative Fraktion" - den Vorläufern der heutigen Tea Party -, die Vorwahlen. Sein Programm war zumindest kohärent: drastische Reduzierung besonders der Sozialfürsorge durch die Bundesregierung, militärische Stärke und die Bereitschaft, Nuklearwaffen gegen die UdSSR einzusetzen. Dies war das klassische Programm von Rechtsaußen, aber eines, dass überhaupt nicht zu den Bedürfnissen des US-Staatskapitalismus passte; Goldwater erlitt schließlich in den Wahlen, auch in Folge der Verweigerung der republikanischen Hierarchie, ihn zu unterstützen, eine schwere Niederlage.
Ist Trump lediglich ein Goldwater 2.0.? Keineswegs, die Unterschiede sind aufschlussreich. Goldwaters Kandidatur stellte die Machtübernahme in der Republikanischen Partei durch die seinerzeitige "Tea Party" dar, die nach Goldwaters krachender Wahlniederlage auf Jahre kaltgestellt wurde. Es ist kein Geheimnis, dass die letzten paar Jahrzehnte ein Comeback dieser Tendenz erlebt haben, die der GOP[11] ein mehr oder weniger erfolgreiches Übernahmeangebot gemacht hat. Die Goldwater-Anhänger waren dagegen eine im wahrsten Sinn des Wortes "konservative Koalition": Sie stellte eine reale konservative Tendenz innerhalb eines Amerikas dar, das tiefgehende gesellschaftliche Veränderungen (Feminismus, die Bürgerrechtsbewegung, der Beginn der Opposition gegen den Vietnam-Krieg und der Zusammenbruch traditioneller Werte) durchlief. Obwohl viele "Ursachen" der Tea Party dieselben wie Goldwaters sein mögen, ist der Kontext nicht der gleiche: Die gesellschaftlichen Veränderungen, denen er sich widersetzte, haben stattgefunden; die Tea Party von heute ist dagegen nicht so sehr eine Koalition von Konservativen, sondern ein Bündnis der Hysterie.
Dies hat der großen Bourgeoisie, die sich wenig bis gar nicht um soziale und "kulturelle" Fragen kümmert und im Wesentlichen an der Militärmacht der USA und am Freihandel, aus dem sie ihre Profite zieht, interessiert ist, wachsende Schwierigkeiten bereitet. Es ist eine Binsenweisheit, dass ein jeder, der in den republikanischen Vorwahlen aufläuft, in einer Reihe von Themen "untadelig" sein muss: Abtreibung (man muss "fürs Leben" sein), Waffenkontrolle (dagegen), fiskalischer Konservatismus und niedrige Besteuerung, "Obamacare" (Sozialismus, sollte abgeschafft werden: in der Tat stützt Ted Cruz einen Teil seiner Qualifikationen auf einen öffentlichkeitsheischenden Filibuster gegen Obamacare im Senat), Ehe (heilig), Demokratische Partei (wenn Satan eine Partei hätte, wäre es sie). Nun, in einem Zeitraum von wenigen Monaten, hat Trump die Republikanische Partei faktisch zerlegt. Wir haben hier einen Kandidaten, der sich selbst als "unzuverlässig" in der Abtreibung, Waffenkontrolle, Ehe (drei in seinem Fall) gezeigt hat und der in der Vergangenheit an den Teufel höchstpersönlich, Hillary Clinton, gespendet hat. Ferner schlägt er vor, den Mindestlohn anzuheben, Obamacare zumindest in Teilen zu erhalten, zur isolationistischen Außenpolitik zurückzukehren, die Haushaltsschulden in die Höhe schnellen zu lassen und elf Millionen illegaler Immigranten, deren billige Arbeitskraft existenziell für das US-Business ist, auszuweisen.
Wie die Tories in Großbritannien mit dem Brexit, so findet sich die Republikanische Partei - und potenziell die gesamte herrschende Klasse in Amerika - in einem Programm wieder, das vom Standpunkt ihrer imperialistischen und ökonomischen Klasseninteressen aus betrachtet völlig irrational ist.
Die Folgen
Die einzige Sache, die wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass Brexit und Trump-Kandidatur in eine Periode wachsender Instabilität in jeder Hinsicht hineinführen werden: wirtschaftlich, politisch und imperialistisch. Auf der ökonomischen Ebene befinden sich die europäischen Länder - die, was wir nicht vergessen sollten, einen Hauptteil der Weltwirtschaft und ihren größten einzelnen Markt repräsentieren - bereits in einer fragilen Situation: Sie mussten die Finanzkrise von 2007/08 und einen drohenden griechischen Austritt aus der Euro-Zone überstehen, doch sie haben sie nicht überwunden. Großbritannien bleibt eine der wichtigsten Ökonomien; der langwierige Prozess der Aufdröselung seiner Verbindungen zur EU wird durch Unvorhersehbarkeit belastet sein, nicht zuletzt auf finanzieller Ebene: Niemand weiß beispielsweise, welchen Effekt der Brexit auf die City von London haben wird, Europas Epizentrum im Bankgeschäft, in Versicherungen und im Aktienhandel. Politisch kann der Erfolg des Brexit die populistischen Parteien in Europa nur ermutigen und ihnen größere Glaubwürdigkeit verleihen. Nächstes Jahr finden die Präsidentschaftswahlen in Frankreich statt, wo Marine Le Pens populistischer, antieuropäischer Front National, gemessen an Wählerstimmen, mittlerweile die größte Partei geworden ist. Die Regierungen in den europäischen Hauptmächten sind zerrissen zwischen dem Anliegen, die Trennung Großbritanniens von Europa so glatt und schmerzlos wie möglich zu gestalten, und der realen Furcht, dass jegliche Zugeständnisse an Großbritannien (wie zum Beispiel der Zugang zum gemeinsamen Markt zusammen mit der Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Menschen) andere auf dumme Gedanken bringen könnten, namentlich Länder wie Polen und Ungarn. Der Versuch, Europas südöstliche Grenzen zu stabilisieren, indem die Länder des ehemaligen Jugoslawien integriert werden, wird fast sicher eingestellt werden. Die EU wird größte Schwierigkeiten haben, eine gemeinsame Antwort auf Erdogans demokratischen Staatsstreich in der Türkei und seine Benutzung der syrischen Flüchtlinge als Faustpfand in einem widerlichen Spiel der wechselseitigen Erpressungen zu präsentieren. Obwohl die EU selbst niemals ein imperialistisches Bündnis gewesen war, sind die meisten ihrer Mitglieder ebenfalls Mitglieder der NATO. Jegliche Schwächung des europäischen Zusammenhalts wird daher einen Dominoeffekt auf die Fähigkeit der NATO haben, dem russischen Druck auf ihre östliche Flanke, der weiteren Destablisierung der Ukraine und der baltischen Staaten zu begegnen. Es ist kein Geheimnis, dass Russland eine geraume Zeitlang den französischen Front National finanziert hatte und die deutsche Pegida-Bewegung zumindest benutzt, wenn nicht sogar finanziert. Der einzige klare Sieger aus dem Brexit-Referendum ist in der Tat Wladimir Putin.
Wie wir oben sagten, hat bereits Trumps Kandidatur der Glaubwürdigkeit der USA einen Schlag versetzt. Der Gedanke an einen Präsidenten Trump mit dem Finger am Nuklearknopf ist, gelinde gesagt, eine Schrecken erregende Aussicht.[12] Doch wie wir viele Male gesagt haben, ist eines der Hauptelemente der Instabilität und des Krieges heute die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten, ihre dominante imperialistische Stellung gegen alle Neuankömmlinge aufrechtzuerhalten. Diese Situation wird sich nicht ändern.
Rage against the machine
Boris Johnson und Donald Trump haben mehr gemein als nur ihr Großmaul. Beide sind politische Abenteurer, bar jeglicher Prinzipien oder jeglichen Sinns für übergeordnete nationale Interessen. Beide sind bereit, sich drehen und zu winden, ihre Botschaft danach auszurichten, was ihr Publikum zu hören wünscht. Ihre dummen Mätzchen werden von den Medien aufgeblasen, bis sie überlebensgroß sind, doch in Wahrheit sind sie ein komplettes Unding, nichts anderes als Sprachrohre, durch die die Verlierer der Globalisierung ihre Wut, ihre Verzweiflung und ihren Hass gegen die reichen Eliten und gegen die Immigranten herausheulen, die sie für ihr Elend verantwortlich machen. Daher kommt Trump trotz haarsträubendster und widersprüchlichster Stellungnahmen ungeschoren davon: Seine Anhänger kümmert es einfach nicht, denn er sagt, was sie hören wollen.
Das heißt nicht, dass Johnson und Trump identisch sind, doch ihre Unterschiede haben weniger mit dem persönlichen Charakter zu tun als vielmehr mit den Differenzen zwischen den beiden herrschenden Klassen, denen sie angehören: Die britische Bourgeoisie hat jahrhundertelang eine Hauptrolle auf Weltebene gespielt, während Amerikas ungestüme, freibeuterische, auf sich bezogene Phase erst mit Roosevelt zu Ende ging, als dieser die Isolationisten besiegte, um in den II. Weltkrieg einzutreten. Wichtige Fraktionen der herrschenden Klasse Amerikas sind bis heute zutiefst ignorant gegenüber der Außenwelt geblieben; man ist versucht zu sagen, dass sie in einem Zustand der zurückgebliebenen Pubertät steckengeblieben sind.
Wahlergebnisse werden niemals ein Ausdruck von Klassenbewusstsein sein; dennoch können sie uns etwas über die Bedingungen der Arbeiterklasse mitteilen. Ob es nun um das Brexit-Referendum geht, um die Unterstützung Trumps in den USA, Marine Le Pens in Frankreich oder der deutschen Populisten von Pegida und AfD - alle Wählerzahlen weisen darauf hin, dass diese Parteien und Bewegungen Unterstützung vor allem unter jenen ArbeiterInnen genießen, die am meisten unter den Veränderungen in der kapitalistischen Ökonomie in den letzten 40 Jahren gelitten haben und die nicht ganz zu Unrecht den Schluss ziehen, dass nach Jahren der Niederlagen und endlosen Angriffe gegen ihre Lebensbedingungen vonseiten rechter wie linker Regierungen der einzige Weg, die herrschenden Eliten zu erschrecken, darin besteht, demonstrativ verantwortungslose Parteien zu wählen, deren Politik eben jenen Eliten ein Gräuel ist. Die Tragödie ist, dass es genau jene ArbeiterInnen sind, die in den Kämpfen der 1970er Jahre zu den am massivsten Involvierten zählten. Ein gemeinsames Thema sowohl in den Brexit- als auch in den Trump-Kampagnen ist der Gedanke, dass "wir die Kontrolle zurückerlangen" können. Ganz gleich, dass "wir" niemals auch nur reale Kontrolle über unser Leben gehabt haben - wie ein Bewohner Bostons in Großbritannien sagte: "Wir wollen Dinge so, wie sie früher waren". Früher gab es Jobs; Jobs mit steigenden Löhnen, als die soziale Solidarität der Arbeitergemeinden noch nicht von Arbeitslosigkeit und Heruntergekommenheit zerbrochen waren, als Veränderung etwas Positives zu sein schien und in einer aushaltbaren Geschwindigkeit stattfand.
Es ist zweifellos richtig, dass der Brexit eine neue, hässliche Atmosphäre in Großbritannien bewirkt hat, eine Atmosphäre, in der unverhohlene Rassisten Morgenluft wittern und aus ihren Löchern kriechen. Doch viele - wahrscheinlich die Mehrheit - von jenen, die für den Brexit oder für Trump stimmten, um die Einwanderung zu stoppen, sind keine Rassisten als solche, sondern kranken vielmehr an Xenophobie: Angst vor dem Fremden, Angst vor dem Unbekannten. Und dieses Unbekannte ist im Grunde die kapitalistische Ökonomie selbst, die grundsätzlich mysteriös und unverständlich ist, weil sie die realen gesellschaftlichen Verhältnisse im Produktionsprozess so darstellt, als seien sie Naturkräfte, so elementar und unkontrollierbar wie das Wetter, deren Auswirkungen auf die Lebensgrundlage der ArbeiterInnen jedoch noch verheerender sein können. Es ist eine fürchterliche Ironie, dass in diesem Zeitalter der wissenschaftlichen Entdeckungen die Menschen zwar nicht mehr glauben, dass schlechtes Wetter von Hexen verursacht wird, aber ohne Weiteres bereit sind zu glauben, dass ihre wirtschaftlichen Nöte von ihren eingewanderten Leidensgenossen verursacht werden.
Die Gefahr, der wir uns gegenübersehen
Wir begannen diesen Artikel mit der Bezugnahme auf die "Thesen zum Zerfall", die vor fast 30 Jahren, 1990, geschrieben wurden. Wir möchten den Artikel schließen, indem wir aus eben diesen Thesen zitieren: "Man muß sich besonders klar über die Gefahr sein, den der Zerfall für die Fähigkeit der Arbeiterklasse, ihre historischen Aufgaben zu erfüllen, darstellt (...) Die verschiedenen Elemente, die die Stärke der Arbeiterklasse ausmachen, stoßen direkt mit den verschiedenen Erscheinungsweisen des ideologischen Zerfalls zusammen:
- das kollektive Handeln, die Solidarität; all das hebt sich ab von der Atomisierung, dem Verhalten, 'Jeder für sich', 'jeder schlägt sich individuell durch';
- das Bedürfnis nach Organisierung steht dem gesellschaftlichen Zerfall entgegen, der Zerbröckelung der Verhältnisse, auf die jede Gesellschaft baut;
- die Zuversicht in die Zukunft und in die eigenen Kräfte wird ständig untergraben durch die allgemeine Hoffnungslosigkeit, die in der Gesellschaft immer mehr überhand nimmt, durch den Nihilismus, durch die Ideologie des 'No future';
- das Bewußtsein, die Klarheit, die Kohärenz und den Zusammenhalt des Denkens, den Geschmack für die Theorie, all diese Elemente müssen sich behaupten gegenüber den Fluchtversuchen, der Gefahr der Drogen, der Sekten, dem Mystizismus, der Verwerfung der theoretischen Überlegungen, der Zerstörung des Denkens, d.h. all den destruktiven Elementen, die typisch sind für unsere Epoche."
Diese Gefahr droht uns heute.
Der Aufstieg des Populismus ist gefährlich für die herrschende Klasse, weil er ihre Fähigkeit beeinträchtigt, ihren Politapparat zu kontrollieren und gleichzeitig die demokratische Mystifikation aufrechtzuerhalten, die eine der Pfeiler ihrer gesellschaftlichen Vorherrschaft ist. Doch er hat dem Proleratariat ebenfalls nichts zu bieten. Im Gegenteil, es ist eben jene Schwäche des Proletariats, seine Unfähigkeit, irgendeine alternative Perspektive zum den Kapitalismus bedrohenden Chaos zu bieten, die den Aufstieg des Populismus heute erst ermöglicht hat. Allein das Proletariat kann einen Ausweg aus der Sackgasse anbieten, in der sich die Gesellschaft heute befindet, doch wird es nie dazu im Stande sein, wenn ArbeiterInnen sich von den Sirenenklängen der populistischen Demagogen bezirzen lassen, die eine unmögliche Rückkehr zur Vergangenheit versprechen, die nie so existiert hat.
Jens, August 2016
[1] Veröffentlicht 1991 in Internationale Revue 13 (/content/748/der-zerfall-die-letzte-phase-der-dekadenz-des-kapitalismus [602]).
[2] Siehe "Über das Problem des Populismus [610]"
[3] Nationaler Gesundheitsdienst.
[4] United Kingdom Independance Party: eine populistische Partei, die 1991 gegründet wurde und die im Grunde für den Austritt aus der EU und gegen Immigration wirbt. Paradoxerweise hat sie in Straßburg 22 Parlamentsmitglieder und ist damit die größte einzelne britische Partei im Europäischen Parlament.
[5] Es ist richtig, dass die EU und der britische Schatzkanzler einige Anstrengungen unternahmen, um Eventualpläne im Falle eines Sieges des "Leave"-Lagers ins Auge zu fassen. Dennoch spricht einiges dafür, dass diese Vorbereitungen unzureichend waren und - vielleicht wichtiger noch - dass keiner wirklich damit rechnete, dass "Leave" das Referendum tatsächlich gewinnen wird. Dies traf selbst auf die "Leave"-Anhänger selbst zu. Anscheinend räumte Farage um ein Uhr morgens in der Nacht des Referendums bereits den Sieg des "Remain"-Lagers ein, nur um am Morgen danach zu seinem Schrecken festzustellen, dass "Remain" verloren hat.
[6] Großbritannien trat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 1973 unter einer konservativen Regierung bei. Seine Mitgliedschaft wurde in einem Referendum bestätigt, das von der Labour-Regierung 1975 abgehalten wurde.
[7] Es lohnt sich daran zu erinnern, dass Thatcher mehr als zehn Jahre an der Macht blieb, obwohl sie nie mehr als 40 Prozent der landesweiten Stimmen in Parlamentswahlen errang.
[8] D.h. die Union des Vereinten Königreiches Englands, Wales, Schottlands und Nordirlands.
[9] Nach diesen unbequemen Ergebnissen ließen die europäischen Regierungen den Verfassungsvertrag fallen, retteten jedoch seine wesentlichsten Elemente, indem sie mit dem Lissaboner Vertrag von 2009 die existierenden Übereinkommen einfach modifizierten.
[10] Man sollte hier unterscheiden von den Referenden in Orten wie der Schweiz und Kalifornien, wo sie Bestandteil eines historisch etablierten Prozesses sind.
[11] "Grand Old Party": ein umgangssprachlicher Name für die Republikanische Partei, der auf das 19. Jahrhundert zurückgeht.
[12] Einer der Gründe für Goldwaters Niederlage war seine erklärte Bereitschaft, taktische Atomwaffen einzusetzen. Die Johnson-Kampagne konterte Goldwaters Motto: "In your heart, you know he's right" (In eurem Herzen wisst ihr, er hat recht) mit dem Slogan: "In your guts, you know he's nuts" (In euren Eingeweiden wisst ihr, dass er Eier hat).
Aktuelles und Laufendes:
- Populismus [89]
- Zerfall [576]
- Brexit [611]
- Wahlzirkus [612]
- Trump [613]
Rubric:
Weltrevolution - 2018
- 43 Aufrufe
Weltrevolution Nr. 182
- 71 Aufrufe
Bericht zur nationalen Lage Deutschlands (Frühjahr 2018)
- 94 Aufrufe
Nach der jüngsten Krise in der Bundesregierung (zwischen der Christlich-Demokratischen Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrer "Schwesterpartei", der bayerischen CSU) veröffentlichen wir hier Auszüge aus dem Bericht[1] über die nationale Situation in Deutschland von unserer Konferenz im Frühjahr 2018. Wir glauben, dass er eine Analyse und einen Hintergrund liefert, der zum Verständnis der gegenwärtigen politischen Krise im zentralen Land des europäischen Kapitalismus beitragen kann. Wir haben auf eine Aktualisierung des Berichts verzichtet. Dies wird die Aufgabe späterer Artikel sein.
Die Notwendigkeit einer radikalen Korrektur der deutschen Wirtschaftspolitik
(…) Deutschland ist derzeit die Lokomotive der Europäischen Union, die heute eine der Hauptstützen der Weltwirtschaft ist. In der Tat profitiert letztere momentan von einer Situation, in der zum ersten Mal seit Jahren die Hauptkomponenten der Weltwirtschaft alle gleichzeitig, wenn auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, wachsen. Dazu gehören auch die USA und Japan, die sich insbesondere von einer langen Phase ohne Wachstum erholen. Russland und Brasilien haben endlich eine Phase der schweren Rezession hinter sich gelassen. In China gelingt es, das Wachstum bei rund 7% zu halten. Ausschlaggebend hierfür war die Politik der hohen Geldmenge und der billigen Kredite der Zentralbanken in Washington, Frankfurt und Tokio.
Die hohe Konkurrenzfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die wir in unserem letzten Bericht zur Lage in Deutschland beschrieben haben, ist weiterhin vorhanden. Deutschland bleibt der weltweit führende Hersteller von Produktionsmitteln. Deutsche Maschinen sind nicht nur von hoher Qualität, viele hochspezialisierte Maschinenbauprodukte werden nur von deutschen Firmen hergestellt. Der Grad weltweiter Vernetzung deutscher Familienunternehmen ist einzigartig. Noch mehr als die großen Unternehmen wie Siemens oder Bosch sind diese "versteckten Meister" das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. (…)
Dank dieser Stärke ist es Deutschland gelungen, den Angriffen in den Vereinigten Staaten gegen so wichtige Stützen seiner Wirtschaft wie die Deutsche Bank und Volkswagen (gegen die enorme Geldbußen verhängt wurden) oder den deutschen Energiesektor (insbesondere wegen der Zusammenarbeit mit Russland) zu widerstehen. Unser vorheriger Bericht sprach in diesem Zusammenhang von einem "Wirtschaftskrieg" (im Sinne des preußischen Militärtheoretikers von Clausewitz: der Versuch, den Willen des Gegners zu brechen). In den Reden während des Wahlkampfes in Hannover vor den Parlamentswahlen im September 2017 erklärte der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder freimütig: "Amerika hat einen Wirtschaftskrieg gegen uns begonnen." "Die Art und Weise, wie eine bestimmte Technologie, die des Dieselmotors, den Löwen zum Fraß geworfen wurde, ärgert mich". In Bezug auf die Wirtschaftssanktionen gegen Moskau sagte er auch, dass die "Isolation Russlands nur den Vereinigten Staaten dient". Wir sollten hier hinzufügen, dass die amerikanische Dämonisierung des Dieselkraftstoffs eine Reaktion darauf ist, dass er von den europäischen Regierungen über viele Jahre hinweg privilegiert wurde: eine Art versteckter Protektionismus, da sich die europäische Automobilindustrie auf diese Technologie spezialisiert hat. Auf jeden Fall hat Volkswagen in den ersten neun Monaten 2017 trotz der in den USA verhängten Bußgelder in Milliardenhöhe einen Gewinn von 7,7 Milliarden Euro erzielt - ein neuer Unternehmensrekord. VW behauptet auch seine Position als das Automobilunternehmen mit dem höchsten Forschungsbudget. Der Konzern hat auch enorme Neuinvestitionen angekündigt: 10 Milliarden Euro in China und 24 Milliarden Euro in Europa (vor allem im ostdeutschen Zwickau) für die Produktion von Elektroautos. Die Situation der Automobilindustrie ist widersprüchlich. Technologisch ist Deutschland sowohl bei der Elektromobilität als auch bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor weit fortgeschritten. Doch während die Marktposition in diesem Bereich sehr stark ist, hinkt sie bei der Produktion von E-Autos immer noch hinter ihren Hauptkonkurrenten hinterher.
Trotz all dieser Erfolge muss sich Deutschland angesichts der Instabilität der Weltfinanzsysteme, der Gefahr von Handelskriegen und politischer Instabilität für die Zukunft rüsten. Nach Angaben des Institute of International Finance hat sich die weltweite Verschuldung in den letzten drei Jahrzehnten vervierfacht und erreichte 232 Billionen Dollar: 318% höher als der weltweite BIP (in der Europäischen Union 104%, in Deutschland 66%). 172 Billionen dieser Schulden befinden sich in den alten kapitalistischen Ländern, 61 Billionen in den "Schwellenländern". Für die Europäische Union drohen Handelskonflikte sowohl mit den Vereinigten Staaten als auch mit China. Die EU selbst ist dabei ein aktiver Faktor. Zum Beispiel war sie bisher gegenüber China protektionistischer als die USA. Sie trifft insbesondere Maßnahmen, um die Übernahme von High-Tech-Unternehmen durch chinesische, russische oder andere Konkurrenten einzuschränken. Was die politischen und wirtschaftlichen Krisen anbelangt, so gibt es bereits innerhalb der Europäischen Union eine Reihe von Krisen, die entweder bereits vollständig aufgeflogen sind (Brexit, die Verfassungskrise in Spanien) oder drohen (Italien, der Konflikt zwischen Brüssel und Warschau, bei dem Donald Tusk bereits vor der Gefahr warnt, dass Polen die EU verlässt). Die Steuerreform von Trump kann dem deutschen Staatshaushalt Milliardeneinnahmen entziehen. Siemens, eines der wichtigsten deutschen Unternehmen, hat kürzlich angekündigt, dass es aufgrund der neuen Steuerregelung in den USA in diesem Jahr mit einer Gewinnsteigerung von einer Milliarde Dollar rechnet. Daher ist geplant, Teile der Entwicklung und Produktion von Deutschland nach Amerika zu verlagern. Doch nicht nur von außen drohen Gefahren für die deutsche Wirtschaft. Denn ohne eine radikale Änderung der Wirtschaftspolitik droht Deutschland mittelfristig seine Konkurrenzfähigkeit zu verlieren, was in der heutigen Welt in etwa fünf Jahren bedeutet. So fordert der Verband der mittleren Unternehmen dringend massive Investitionen in Bildung und Qualifizierung, eine radikale Reform des Bildungssystems (insbesondere weniger "Föderalismus"), einen "digitalen Neuanfang", ein neues Zuwanderungsgesetz "nach kanadischem Vorbild" sowie eine "Auszeit" für Arbeitnehmer zur Qualifizierung, Kinderbetreuung oder als Prophylaxe gegen Burn-out (die IG Metall hat ähnliche Forderungen). Das ist eine widersprüchliche Realität: "Boomende Industrie und hohes Beschäftigungsniveau" in vielen Bereichen, aber ein zunehmender Arbeitsdruck für diejenigen, die eher gut bezahlte Arbeitsplätze haben und vor allem eine steigende Zahl von Working Poor. Das widersprüchliche Gesicht der Krise bedeutet also einerseits höchste Beschäftigung und andererseits verstärkte Verarmung für viele Schlechtverdiener. Die Besonderheiten dieser Situation, die niedrigste Arbeitslosigkeit, ist ein Aspekt, der die relative soziale Ruhe der letzten Jahre erklärt.
(…)
Deutschland: Anker der europäischen Wirtschaft in stürmischen Zeiten
Einer der Hauptfaktoren, die die deutsche Politik heute beeinflussen, ist die veränderte Einstellung Frankreichs dazu. Seitdem sich der damalige Amtsinhaber im Elysee, Francois Mitterrand, unmittelbar nach dem Fall der Mauer für den Erhalt der DDR ausgesprochen hat ("Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich zwei von ihnen will"), ist es für die französischen Staatschefs so etwas wie eine Tradition, innerhalb der EU (manchmal in Großbritannien, manchmal in den Mittelmeerstaaten) und innerhalb der Eurozone nach Verbündeten gegen Berlin zu suchen. Aus französischer Sicht diente die Schaffung einer einheitlichen europäischen Währung in erster Linie der politischen Kontrolle Deutschlands. Insbesondere sollte verhindert werden, dass die Bundesbank in Frankfurt über die dominante Rolle der Deutschen Mark ihre Geldpolitik dem übrigen Europa diktiert. Macron bekräftigt jedoch, dass Europa ohne die wirtschaftliche Stärke Deutschlands und ohne ein starkes deutsch-französisches Bündnis keine Chance hat, sich in der heutigen Welt zu behaupten. Zum ersten Mal seit dem Zusammenbruch der Nachkriegsordnung 1989 hat Frankreich eine Art Bündnis mit Deutschland als Hauptziel seiner Außenpolitik vorgeschlagen. Dieser Politikwechsel ist natürlich mit der Machtübernahme von Macron verbunden, aber natürlich hat "Macronisme" selbst tiefere Ursachen. Und eine davon ist die Lehre aus der so genannten Euro-Krise, die nach der weltweiten "Finanzkrise" von 2007/08 folgte. In Wirklichkeit waren das nur zwei verschiedene Momente ein und derselben Krise. Eine Krise, die in vielerlei Hinsicht die tiefste Erschütterung des Weltkapitalismus seit der Großen Depression der 1930er Jahre war. Die Schulden des kleinen Griechenlands standen nur scheinbar im Mittelpunkt der Euro-Krise. Neben den Vereinigten Staaten war Europa der Teil der Weltwirtschaft, der am stärksten von der Finanzkrise und der damit einhergehenden brutalen Rezession betroffen war. Da die amerikanische Bourgeoisie versuchte, die schlimmsten Auswirkungen der Krise auf ihre europäischen "Partner" abzulenken, begann die internationale Finanzwelt massiv gegen die gemeinsame europäische Währung zu spekulieren und sogar auf ihre Explosion zu wetten. Der Grund für diese Vertrauenskrise in den Euro war weniger die wirtschaftliche Schwäche Griechenlands oder anderer seiner Mitgliedstaaten, sondern vielmehr sein Charakter als gemeinsame Währung verschiedener Nationalstaaten, die nicht durch einen einigen Willen und eine einzige Autorität zusammengehalten werden. Der Wendepunkt dieser Krise wurde erst am 26. Juli 2012 mit der berühmten Aussage des Chefs der Europäischen Bank Mario Draghi erreicht: "Die EZB ist bereit, im Rahmen unseres Mandats alles zu tun, um den Euro zu erhalten. Und glaubt mir, es wird reichen." Möglich wurde diese Wende jedoch fast ausschließlich durch das Vertrauen der Investoren in die deutsche Wirtschaft und in die deutsche Wirtschaftspolitik. Obwohl die Sparpolitik, die die Regierung Merkel-Schäuble Athen diktierte, der griechischen Bevölkerung große zusätzliche Schwierigkeiten bereitete (und für die herrschende Klasse den sehr willkommenen Nebeneffekt hatte, das europäische Proletariat zu spalten, vor allem indem sie die deutschen und griechischen Arbeiter gegeneinander ausspielte), ging es Berlin nicht um die griechische Wirtschaft, sondern um die Glaubwürdigkeit des Euro. Der künftige französische Präsident Macron gehörte als Banker von Beruf selbst zu denen, die verstanden haben, wie sehr die Volkswirtschaften der Eurozone heute von der Glaubwürdigkeit des deutschen Staates abhängen, um das Privateigentum der Investoren zu schützen. Aufgrund der Stärke seiner Wirtschaft und seiner im Verhältnis zum BSP vergleichsweise niedrigen Verschuldungsrate wird es als in der Lage angesehen, seine Schulden zurückzuzahlen, wann immer dies erforderlich ist. Aufgrund seiner politischen Stabilität, seiner Tradition des "sozialen Friedens" und seines Rufs, jede "extremistische" oder "unverantwortliche" Partei am Regierungsantritt hindern zu können, gilt es als die wichtigste Garantie der bürgerlichen Ordnung auf dem europäischen Kontinent. Der wirtschaftliche und politische "Kredit" (aus dem lateinischen "Credo": Glaube) Deutschlands rettete die Finanz- und Währungsarchitektur und damit die Grundlage der politischen Stabilität des alten Kontinents. Es war Berlin, das diese Rettungsaktion mehr oder weniger gegen den Willen seiner verschiedenen europäischen "Partner", darunter Frankreich, und ohne die Hilfe der Obama-Regierung in Washington, die damals selbst mit den Auswirkungen der Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten zu kämpfen hatte, organisierte. Es war Berlin, das dem Rest der Eurozone brutal seine Version der Sparpolitik aufzwang, die es für notwendig hielt, das "Vertrauen der Märkte" zurückzugewinnen. Diese Erfahrung hat einen wichtigen Teil der französischen Bourgeoisie dazu gebracht, Deutschland in einem neuen Licht zu sehen: weniger als Bedrohung und mehr als Anker in stürmischen Zeiten. (…)
Macron hat erkannt, dass keine der westeuropäischen Mächte - einschließlich Italien, Frankreich und sogar Deutschland - eine Chance hat, als mehr oder weniger "unabhängige" Kräfte im Weltmaßstab zu überleben, wenn sie nicht eng zusammenarbeiten. (…) Ohne Deutschland ist Macron wie ein Kommandant ohne Armee. Wir haben jedoch Grund zu der Annahme, dass sich die deutsche Bourgeoisie bereits an der Formulierung dieser Politik beteiligt hat. Macron selbst hat gesagt, dass er seine "Sorbonne-Rede" an Bundeskanzlerin Merkel geschickt hat, um ihre Zustimmung einzuholen, bevor er sie gehalten hat. Diese Politik reagiert unter anderem auf Brexit und die zunehmende Renitenz der V4-Regierungen in Mitteleuropa. Ihr Kerngedanke ist die Entwicklung der Eurozone, ohne auf Osteuropa zu warten. Es ist jedoch klar, dass Deutschland und Frankreich in Europa nicht die gleiche Rolle spielen und nicht die gleichen Interessen haben. Das Hauptaugenmerk der französischen Bourgeoisie liegt auf der Durchsetzung der Euro-Zone. Deutschland sieht sich jedoch aufgrund seiner geografischen Lage im Herzen Europas und der Bedeutung seiner wirtschaftlichen Interessen in Osteuropa auch in der Verantwortung, die EU als Ganzes zusammenzuhalten. Auch in der Handelspolitik gibt es Unterschiede: Deutschland ist wettbewerbsfähiger und damit tendenziell weniger protektionistisch als Frankreich.
Die EU-weite Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten hat zwangsläufig eine wichtige militärische Dimension, da Rüstung ein zentraler Faktor der kapitalistischen Wirtschaft ist, allen voran der Hightech-Sektor. Aber für Berlin und Paris soll die Zusammenarbeit der europäischen Rüstungsunternehmen durch eine stärkere Zusammenarbeit der Armeen "ergänzt" werden. Bisher hat Großbritannien solche Entwicklungen immer behindert. Heute ermöglicht die Perspektive von Brexit militärische Projekte wie Pesco oder die heutige deutsch-französische Militärinitiative von Ursula von der Leyen und Jean-Yves Le Driand.
(…)
Die gegenwärtigen Spaltungen innerhalb der deutschen herrschenden Klasse
Aber wenn die Divergenzen in der Wirtschafts- und Außenpolitik nicht gravierend genug sind, um Spaltungen innerhalb der deutschen herrschenden Klasse hervorzurufen, so ist doch klar, dass es solche Spaltungen gibt. Eine erste große Spaltung innerhalb der Christlich-Demokratischen Union zwischen CDU und CSU über Merkels Flüchtlingspolitik trat bereits 2015 ein. Nach den Parlamentswahlen im September 2017 kam es zu einem zweiten großen Konflikt zwischen der Union und den Grünen einerseits und der FDP andererseits, der zum Scheitern des Koalitionsprojekts "Jamaika" führte. Dies wiederum hat innerhalb der SPD zu einer Spaltung zwischen Befürwortern und Gegnern einer neuen Großen Koalition ("GroKo") mit der Union unter Merkel geführt. Für eine Bourgeoisie, die im vergangenen halben Jahrhundert so einheitlich und kohärent war wie kaum eine andere, sind diese Spaltungen in der Tat relativ dramatisch. Ihre wichtigste Ursache ist die unterschiedliche Herangehensweise an die Herausforderungen einer neuen historischen Phase. Heute werden diese Unterschiede zu Spaltungen. Bis zu einem gewissen Grad sind sie auch zu einem Generationenkonflikt geworden. Auf der einen Seite gibt es diejenigen, die glauben, dass Kontinuität und eine "ruhige Hand" die besten Möglichkeiten sind, den Problemen der Stunde zu begegnen. Die prominenteste Vertreterin dieser "business as usual"-Haltung ist die Kanzlerin selbst, die nach den Parlamentswahlen (wo die Regierungsparteien 14% ihres Stimmenanteils verloren haben) erklärte: "Ich sehe nicht, was in meiner Politik geändert werden müsste." Andererseits fordern Vertreter der neuen Politikergeneration wie Lindner von der FDP oder die Jusos ("Junge Sozialisten in der SPD") ein Ende des "Merkelsystems" und radikale politische Veränderungen. Diese Kräfte verlangen massive Investitionen und eine umfassende Umstrukturierung des Bildungssystems, Forschung und Entwicklung neuer Technologien sowie eine neue Einwanderungsgesetzgebung nach kanadischem Vorbild. Vor allem aber wollen sie der so genannten Diktatur des Konsenses in der deutschen Nachkriegspolitik ein Ende setzen, die sie kontroverser gestalten wollen. Insbesondere kritisieren sie den politischen Stil von Angela Merkel, das Programm der eigenen politischen Gegner zu übernehmen und damit die ohnehin schon kleinen Unterschiede zwischen den politischen Parteien zusätzlich zu verwischen. Obwohl sie immer noch die erfahrenste und am meisten respektierte politische Führerin in Europa (und in der "westlichen Welt", so Barak Obama) ist, denken diejenigen, die sich ihr heute widersetzen, dass Angela Merkel mehr Teil des Problems der deutschen Bourgeoisie als Teil ihrer Lösung geworden ist. Obwohl ihre Einwanderungspolitik "Flüchtlinge willkommen" gescheitert ist, weigert sie sich, dies öffentlich anzuerkennen und erweckt den Eindruck, dass sie sich mehr um ihren "Platz in der Geschichte" als um die alltägliche Politik sorgt. Damit ist sie zu einem "roten Tuch" für Populisten in Deutschland und für Regierungschefs in Osteuropa geworden. Merkels Vision war, dass die Flüchtlinge die demographischen Probleme Deutschlands (einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung) lösen würden. Sie orientiert sich an der Rolle der Vertriebenen (die Millionen von Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Osteuropa vertrieben wurden) beim Wiederaufbau, aber auch der sogenannten "Dreamer" in den Vereinigten Staaten, die als "Humankapital" gelten. Im Jahr 2015 wurde ihre Politik von den meisten Arbeitgeberverbänden mit Begeisterung unterstützt, die erklärten, dass die deutsche Wirtschaft während bis zu einem Jahrzehnt vom Zustrom von einer Million (vorzugsweise) junger Menschen pro Jahr profitieren würde. Der Aufstieg des Rechtspopulismus hat diesen Träumen ein Ende gesetzt. Merkels "Willkommenspolitik" ist gescheitert, obwohl etwa 80% der Bevölkerung Deutschlands dafür sind. Der deutlichste Beweis dafür ist, dass die AfD bei den Parlamentswahlen 13% der abgegebenen Stimmen erhielt.
Das bedeutet nicht, dass die Öffnung der deutschen Grenze für Flüchtlinge im Sommer 2015 aus Sicht der Kapitalinteressen ein Fehler war. Seitdem hat die Regierung in Athen (die nicht den Ruf hat, deutschfreundlich zu sein) öffentlich anerkannt, dass es diese Entscheidung von Angela Merkel war, die die Situation in Griechenland gerettet hat. Wäre die Flüchtlingswelle über den Balkan nach Griechenland zurückgeschickt worden (wie es das "Dubliner Abkommen" normalerweise verlangt), hätte das wahrscheinlich zum Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und der Staatsfinanzen in Hellas geführt. Dies wiederum wäre das Ende des mühsam erreichten Bergungspakets gewesen, das dazu beigetragen hatte, die Spekulationen gegen den Euro zu stoppen. Mit anderen Worten, was Merkel rettete, war in erster Linie der Euro und das "Vertrauen der Märkte" in die europäische Wirtschaft. Auf dieser Ebene war die "Flüchtlingskrise" von 2015 gewissermaßen die Fortsetzung der "Euro-Krise" auf einer anderen Ebene, die mit anderen Mitteln bewältigt wurde.
Das Problem der AfD
Das Problem des politischen, insbesondere des Rechtspopulismus, ist international und hat sich in den letzten Jahren verschärft. Brexit und die Trump-Präsidentschaft gehörten zu den wichtigsten Faktoren der neuen Virulenz dieses Problems. Jetzt hat sie Deutschland in überwältigender Weise erreicht. Die "Alternative für Deutschland" ist bei weitem nicht der einzige, aber derzeit wichtigste Ausdruck dieser Entwicklung, die mit der Erosion der politischen Glaubwürdigkeit der "Establishment"-Parteien einhergeht.
Franz-Josef Strauß, der Vorsitzende der bayerischen CSU von den 1960er bis 1980er Jahren, formulierte folgende Strategie der deutschen Christdemokraten: die Verhinderung der Gründung einer Partei im Parlament zur Rechten der Union. Die rechte Partei, die die Christdemokraten damals aus dem Bundestag ausschließen wollten, war die neonazistische NPD. Und es ist gelungen. Heute etabliert sich eine rechtspopulistische Partei im Parlament, und insbesondere die CSU macht Angela Merkel dafür verantwortlich. Der Aufstieg einer Fraktion zu ihrer Rechten ist ein schwerer Schlag für die Union, nicht zuletzt, weil er die absolute Mehrheit der CSU in Bayern gefährdet. Für die deutsche Bourgeoisie als Ganzes ist es aber nicht unbedingt ein großer Rückschlag. Es ist offensichtlich, dass eine weitere parlamentarische Kraft die Regierungsbildung erschwert. (…)
Trotz aller Schwierigkeiten wäre die deutsche Bourgeoisie in der Lage, mit einer sechsten Partei zurechtzukommen, mit einer nationalen konservativen Partei auf der rechten Seite der Union. Und trotz Verhältniswahl ist es ihr in den letzten Jahrzehnten immer gelungen, die NPD aus dem Parlament herauszuhalten. Das Problem mit der AfD ist, dass sie weder eine traditionelle konservative noch eine neonazistische Partei ist. Es ist eine Mischung aus beidem. Die Politik der etablierten Parteien im Bundestag ist klar: Es sollte keine Macht- und Privilegienteilung mit einer Partei geben, die Neonazis in ihren Reihen beherbergt. Diese Politik des Ausschlusses ist ein Angebot an die AfD: Sie sind auf dem Staatsbankett willkommen, wenn Sie Ihre Neonazis loswerden. Bis jetzt waren die Ergebnisse dieser Politik von Zuckerbrot und Peitsche jedoch dürftig. Obwohl Frauke Petry, einst die Vorsitzende der AfD, die ein Direktmandat in Sachsen gewann, ihre Partei unmittelbar nach den Parlamentswahlen verließ, folgten nur wenige ihrem Beispiel. Dies wiederum veranschaulicht das gegenwärtige Dilemma der Bourgeoisie. Das Geheimnis des Erfolgs der zeitgenössischen populistischen Parteien ist gerade ihre Mischung aus national-konservativen und rechtsradikalen Positionen. Wir befinden uns nicht in den 1930er Jahren, in der Zeit der radikalen Niederlage der Arbeiterbewegung und der unmittelbaren Vorbereitung auf den Weltkrieg. Faschistische Massenbewegungen stehen derzeit nicht auf der Tagesordnung. Gleichzeitig stellt der heutige Populismus etwas Neues in Bezug auf die Jahrzehnte nach 1968 dar. Er ist nicht nur eine weitere Variante von Nationalismus und Konservatismus. In den Teilen der Bevölkerung, die er direkt beeinflusst, reitet er auf der Welle des Hasses. Eines Hasses, der sich nur scheinbar gegen die etablierten "Eliten" richtet. Die Skandale, die der Populismus erzeugt und von denen er lebt, enthalten immer den Hinweis und damit das Versprechen zukünftiger Pogrome, nicht gegen die Eliten, sondern gegen viel verletzlichere Opfer. Neben der Heiligkeit des Privateigentums bleibt in den alten kapitalistischen "Demokratien" vor allem das Tabu gegen Rassismus. Deshalb sind die heutigen Rechtspopulisten "nicht rassistisch", können aber auch nicht ohne Rassismus auskommen.
Die AfD begann als konservative neoliberale Protestpartei gegen die griechischen und europäischen Rettungsaktionen, die als Ausverkauf deutscher Interessen durch Christdemokraten und Liberale angesehen wurden. Die Rolle der selbständigen Handwerker, der Familienunternehmen und der kleinen Unternehmen, die für den Binnenmarkt arbeiten und die ausländische Konkurrenz fürchten, war beträchtlich. Doch die "Flüchtlingskrise" und Protestbewegungen wie Pegida haben sie schnell in eine fremdenfeindliche Partei verwandelt. Auf wirtschaftspolitischer Ebene präsentiert sich einer seiner Flügel nun als Verteidiger des "Wohlfahrtsstaates" gegen die "Globalisierung". (…) Seine Weltsicht basiert auf Verschwörungstheorien, wie der Idee, dass Merkel und die "Globalisierer" die "europäischen Nationen", die als Haupthindernisse für die "planetarische Herrschaft des Finanzkapitals" dargestellt werden, verwässern und schließlich liquidieren wollen. Während Schröders "Agendapolitik" verurteilt wird, sind für dieses Milieu die Hauptfeinde des "Wohlfahrtsstaates" die Flüchtlinge und Migranten. Diese Art von Rechtspopulismus ist derzeit typisch für die Länder Nordeuropas (in Skandinavien, der Schweiz oder Österreich ist die Situation ähnlich), wo der "Wohlfahrtsstaat" einen öffentlicheren, Hegel würde sagen eher "abstrakten" Charakter hat. (…)
In Ländern wie Deutschland sind die Migranten das Ziel eines (…) Hasses, der sie vor allem als Konkurrenten von "Sozialleistungen" sehen will. So scheint zum Beispiel gegenwärtig in Cottbus, der zweitgrößten Stadt des ostdeutschen Bundeslandes Brandenburg, nur eine starke Polizeipräsenz die Entwicklung einer Pogrom-Situation zu verhindern. Cottbus, eine Stadt mit einer (sehr proletarischen) Bevölkerung von rund 100.000 Einwohnern, galt noch vor wenigen Jahren als Vorbild für eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen, die zur Revitalisierung des Ortes beigetragen hatten.
Mit dem Aufstieg der AfD haben die Geister der Vergangenheit, die die deutsche Bourgeoisie zumindest teilweise hinter sich gelassen zu haben schien, sie wieder eingeholt. In der heutigen Bundesrepublik erhielt die Kapitulation vom Mai 1945 den Titel "die Stunde Null". Es war die Mythologie des Neuanfangs. In Wirklichkeit wurde das "Wunder" der Nachkriegszeit (mit wenigen Ausnahmen) unter der Herrschaft der ehemaligen Nazis vollbracht, die den Kampf der amerikanisch geführten "freien Welt" als direkte Fortsetzung des Hitler-Kreuzzugs gegen den "Bolschewismus" sahen. Erst als eine neue Generation der Bourgeoisie an die Macht kam, entwickelte Deutschland die Politik der eindeutigen Verurteilung seiner nationalsozialistischen Vergangenheit - eine Haltung, die ihm weltweit viel Anerkennung und Popularität eingebracht hat. In Deutschland, dem Land des Holocaust, ist das Flirten mit der Nazi-Terminologie, ihren historischen Bezügen und Symbolen ein noch probateres Mittel als in anderen Ländern für politische Zerstörer und Hasardeure, um die herrschenden Eliten zu stören und zu erpressen.
(…)
Die Situation des proletarischen Kampfes
Deutschland hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Arbeiterkämpfen erlebt. Es gab Protestdemonstrationen von Stahlarbeitern (Thyssen-Krupp), die eine Verschlechterung der Bedingungen bei einer möglichen Fusion mit Tata befürchteten. In jüngster Zeit haben Siemens-Mitarbeiter in mehreren Städten gegen Werkschließungen und den Verlust von 4000 Arbeitsplätzen demonstriert. Auch die Mitarbeiter von Ryanair streiken (nicht nur in Deutschland). Die IG Metall hat zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Berichts Zehntausende von Arbeitern zu Aktionen aufgerufen, in denen sie höhere Löhne und die Möglichkeit einer befristeten Arbeitszeitverkürzung mit einem gewissen Lohnausgleich fordern. Solche Manifestationen der Unzufriedenheit der Klasse sind nicht überraschend. Zur Zeit der "Finanzkrise" haben wir geschrieben, dass es wahrscheinlich weniger Arbeitskämpfe geben wird, da es angesichts von Fabrikschließungen und rasch steigender Arbeitslosigkeit schwieriger ist, in den Streik zu treten. In diesem Sinne ist der gegenwärtige Zeitpunkt der wirtschaftlichen Expansion und des Arbeitskräftemangels für die Arbeiter_innen viel günstiger, um ihre Forderungen durchzusetzen. Es wäre falsch, darin erste Anzeichen des Beginns des Endes des weltweiten Rückgangs in Klassenkampf, Klassenidentität und Klassenbewusstsein nach dem sogenannten "Zusammenbruch des Kommunismus" 1989 zu sehen. Im Gegenteil, dieser Rückgang setzt sich nicht nur fort, sondern vertieft sich. Die Tatsache, dass in Spanien in den letzten Monaten Hunderttausende von Menschen, viele von ihnen Arbeiter_innen, hinter den Nationalflaggen Kataloniens oder Spaniens (oder von beiden!) auf die Straße gegangen sind, ist eine dramatische Bestätigung dafür.
(…)
Ein weiteres Beispiel für die gegenwärtigen Schwierigkeiten des Proletariats ist der Kampf gegen die Entlassungen bei Siemens. Proteste fanden unter anderem in Görlitz, Leipzig, Dessau und Berlin statt. Görlitz ist besonders betroffen, da Bombardier dort auch ein Werk geschlossen hat. Vor kurzem fand eine Demonstration mit 7000 Teilnehmern statt - die größte in der Stadt seit 1989. Seit einiger Zeit fordern die Arbeiter_innen dort, dass der Siemens-Chef Joe Kaeser persönlich erscheint, um ihre Fragen zu beantworten. Er war sehr zurückhaltend, aber als er schließlich kam, sagte er, er sei "angenehm überrascht", dass "seine Mitarbeiter" keineswegs unrealistische Forderungen wie die Fortsetzung der Produktion von Gasturbinen, die niemand kaufen wird, aufwerfen würden. Stattdessen versuchten sie ihn davon zu überzeugen, wie wertvoll sie für Siemens aufgrund ihrer Erfahrung, ihres Könnens und ihrer "Motivation" sein können. Er verkündete, wie "tief beeindruckt" er von ihren Argumenten gewesen sei, und versprach, alle Möglichkeiten zu prüfen, die "Görlitz helfen" könnten. Wie viel Wert seine Versprechungen haben, zeigte sich bald darauf in Davos, wo er neben Donald Trump die Entwicklung der nächsten Generation von Siemens-Gasturbinen in den USA ankündigte. Siemens hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 6,2 Milliarden Euro erzielt. Neben dem Abbau von 4000 Arbeitsplätzen in diesem Jahr will Siemens in Deutschland 10.000 neue schaffen. Wer weiß, vielleicht gehen einige dieser Jobs sogar nach Görlitz. Aber was diese ganze Tragikomödie vor allem illustriert, ist das gegenwärtige Dilemma des Proletariats. Ohne die geringste Hoffnung, den Kapitalismus in Frage stellen zu können, wird es für die "wirtschaftlichen" Kämpfe gegen Ausbeutung schwieriger, sich zu entwickeln und vor allem auf einem Klassengelände zu bleiben, um die Fallstricke einer bürgerlichen Politisierung zu vermeiden. Die Situation erfordert daher eine proletarische Politisierung der Arbeiterkämpfe. Um den gegenwärtigen Rückzug des Proletariats zu stoppen, ist auch eine Entwicklung der politischen und theoretischen Dimensionen seines Kampfes erforderlich.
Weltrevolution, 01.02.2018
[1] Den vollständigen Bericht stellen wir so bald als möglich auf unsere Webseite de.internationalism.org
Rubric:
„Schwarzer Block“: Der Kampf der Arbeiterklasse braucht keine Vermummung
- 124 Aufrufe
Im Juli 2017 trafen sich in Hamburg die höchsten Repräsentanten der Herrschenden aus 20 Staaten. Geschützt von mehr als 30.000 Polizisten aus vielen Teilnehmerländern, mit einem Kostenaufwand von ca. 130 Millionen Euro stritten die Vertreter der Herrschenden um gemeinsame Schritte gegen Terrorismus, äußerten ihre Ablehnung der angekündigten protektionistischen Maßnahmen von Trump und dessen Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Wir wissen, dass seitdem sowohl der internationale Handelskrieg heftiger entbrannt, die Klimafolgen 2018 dramatischer denn je geworden sind, und der Kampf gegen den Terrorismus durch die imperialistischen Rivalen die Gewaltspirale nicht eingedämmt hat. Kurzum, die Führer der G20 können die Widersprüche und Gegensätze nicht lösen und überwinden; sie selbst sind Teil des Problems, und um diese Widersprüche und Gegensätze zu überwinden muss das System selbst überwunden werden.
Gegen diese Veranstaltung mit der größten Polizeimobilisierung brachten Zehntausende ihre Wut und ihre Abscheu zum Ausdruck. Überschattet aber wurden diese Proteste durch die Brandstiftungen und Plünderungen durch eine zahlenmäßig kleine Gruppe von Randalierern, welche auf die Provokationen des Polizeiapparates, der nur nach gewaltsamen Auseinandersetzung lechzte, hineinfielen und nach ihren Gewaltorgien von der vollen Wucht der staatlichen Repression getroffen wurden, u.a. durch die europaweite intensive Fahndung nach beteiligten Gewalttätern. Durch das Auftreten und den medialen Fokus auf den Schwarzen Block und andere Randalierer soll der Eindruck vermittelt werden, diese Aktionen seien die einzig möglichen. Wir öffentlichen nachfolgenden einen Artikel unserer Sektion in Frankreich, der sich mit diesem Phänomen in Frankreich befasst, um zu zeigen, dass es sich um ein internationales Phänomen handelt, das überall eine Gefahr für diejenigen darstellt, die aufrichtig gegen dieses System ankämpfen wollen.
Weltrevolution, Juli 2018
„Schwarzer Block“: Der Kampf der Arbeiterklasse braucht keine Vermummung
1200 „vermummte und maskierte Personen“, schwarz gekleidet, randalierend, plündernd, Einrichtungsgegenstände auf den Straßen zerschlagend, Geschäfte demolierend, gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei: dieses Bild prägte die Kundgebungen des 1. Mai in Paris. Presse, Politiker, Gewerkschaften, Soziologen, jeder von ihnen bot seine Analyse, seine Verurteilung der Gewalt, und einen Versuch, diese schwarzen Blöcke zu „verstehen“: „Schläger“ und „grundlose Gewalt“ für die einen, „Kämpfer“ und „Taktiken des Kampfes“ gegen den Kapitalismus für die anderen.
Ein Ausdruck des Zerfalls
Diese Bewegung ist nicht neu: Der Ursprung der schwarzen Blöcke ist Ende der 1980er Jahre zu suchen, als die West-Berliner Polizei den Ausdruck ‚schwarzer Block‘ einführte, um bestimmte linksextreme Demonstranten zu bezeichnen, die Kapuzen tragen und mit Stöcken bewaffnet sind, die ihrerseits von der in den 1960er Jahren in Italien geborenen Autonomia-Bewegung inspiriert wurden. Ihre spektakulären Aktionen wiederholten sich 1999 in Seattle gegen die Konferenz der Welthandelsorganisation (WTO) im Juli 2001 in Genua, in friedlichen Märschen der G8-Gegner in Straßburg, im Jahr 2009, am Rande der Feiern zum 60-jährigen Bestehen der NATO; im Oktober 2011 in Rom, während der Proteste der Indignados gegen die Krise und das Finanzkapital; im Februar 2014 bei den Gegnern des Flughafenbaus Notre-Dame in Frankreich; im Juli 2017 in Hamburg beim G20; anlässlich der Demonstrationen gegen das „Arbeitsgesetz“ in Frankreich im selben Jahr...
Die schwarze Blockbewegung behauptet, sich dem Kapitalismus, den Regierungen, den Polizeikräften und der Globalisierung entgegenzustellen und lehnt die klassischen politischen Aktivitäten der Linken oder extremen Linken ab, wie ihre anarchistischen Parolen es ausdrücken: „Marx attack“, „Unter dem Pflaster der Strand“! (ein Slogan aus der Zeit des Mai 68), „Nieder mit dem Hess!“ (Elend, auf Arabisch). Sie sagen, „kaputtzuschlagen“ bedeutet, das Geld zurückzuerobern, das multinationale Konzerne dem Volk stehlen, Versicherungen, Privatisierungsagenturen, steinreiche Eigentümer und alle anderen blechen lassen, die den Reichtum monopolisieren, und die von ihnen geschaffenen Ungleichheiten zu bekämpfen“ (Auszug aus einem am 1. Mai verteilten Flugblatt).
Die Methoden des Schwarzen Blocks, die von winzigen Gruppen angezettelten Zusammenstöße mit der Polizei und das Kaputtschlagen bieten in Wirklichkeit keine echte Perspektive und keine Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft. Tatsächlich sind sie ein Teil des Fäulnisprozesses des Kapitalismus, in der unmittelbares, nihilistisches und zerstörerisches Handeln Vorrang vor jeder langfristigen politischen Vision hat, die sich auf geschichtliche Erfahrungen und die wirklich bewusste Inangriffnahme und Durchführung eines revolutionären Projekts durch die Arbeiterklasse stützt.
Kaputtzuschlagen, zu zerstören, die Vergangenheit über Bord zu werfen, all dies ist das Gegenteil des Kampfes des Proletariats für eine andere Welt, die sich im Gegenteil bewusst auf die Geschichte und das Beste aus der Erfahrung der ganzen Menschheit stützt. Diese Handlungsweisen des Schwarzen Blocks, diese „berauschenden“ Abenteuer sollen „heroisch und vorbildlich“ sein und die kollektiven Formen des Kampfes des Proletariats verachten. Diese individualistischen, rein durch den Willen angetriebenen, durch Ungeduld geprägten Revolten sind nur Ausdruck des Gewichts der kleinbürgerlichen Gesellschaftsschichten ohne Zukunft. Sie richten sich nicht gegen das kapitalistische Weltsystem, sondern nur gegen die gröbsten Formen und Symbole dieses Systems in Form einer ‚Abrechnung‘, der Rache frustrierter kleiner Minderheiten und nicht einer revolutionären Konfrontation einer Klasse mit der anderen. Die Zerstörung einer Bushaltestelle, eines Fastfood-Ladens oder der Fenster einer Bank hat den Kapitalismus weder finanziell noch ideologisch geschwächt. Dies dient noch weniger dazu, „gestohlenes Geld von den multinationalen Konzernen zurückzuerobern“: Die Proletarier werden nur noch mehr bestraft, um für die sinnlos zerstörten städtischen Einrichtungen zu zahlen! Die schwarzen Blöcke haben daher keinerlei positiven Auswirkungen auf den Kampf des Proletariats und führen im Gegenteil nur zu den schlimmsten Illusionen der jungen Arbeitergeneration über die Möglichkeit, einen vermeintlich anderen, schnelleren und einfacheren Weg als den des Klassenkampfes einzuschlagen.
Tatsächlich sind schwarze Blöcke sogar ein beliebtes Feld für gezieltes Vorgehen von Bullen und dem Staat im allgemeinen gegen dieses Milieu. Ihre aufsehenerregenden und gewalttätigen Aktionen werden von der herrschenden Klasse geschickt ausgenutzt, um die polizeilichen Kontrollen, Überwachung und Unterdrückung zu verstärken. Diese kleinen Gruppen sind selbst regelmäßig Opfer der Unterwanderung durch Polizeispitzel, die noch mehr Menschen in ihren Reihen anstiften, um soviel wie möglich zu zerschlagen und die Wut in sinnlosen Zusammenstößen verpuffen zu lassen. Warum? Die herrschende Klasse ist sich vollkommen bewusst, dass diese Art von Aktionen ihr System stärkt, indem sie Angst schürt, Unterdrückung legitimiert, vom Kampf abschreckt, der „nur dazu dient, kaputtzuschlagen und nicht aufzubauen“, zu spalten und noch mehr zu verhindern, dass über die Bedürfnisse der Einheit des proletarischen Kampfes nachgedacht wird. Wenn am Ende einer Demonstration nicht die kämpferischsten und bewusstesten Arbeiter zusammenkommen, um beispielsweise über die gerade stattgefundene Bewegung, die Sinnlosigkeit der von den Gewerkschaften vorgeschlagenen Aktionen, den Aufbau von Verbindungen und die Fortsetzung von Denkprozessen in Diskussionsgruppen und über sinnvolle Aktionen zu diskutieren, wenn stattdessen Demonstranten vor der prügelnden Polizei fliehen, kann sich der Staat nur freuen! Zynisch erklärte der französische Innenminister Collomb, die Demonstranten hätten diese auf Gewalt erpichten Elemente „nicht kontrollieren“ können, ihnen freien Lauf gelassen anstatt sie unter „Kontrolle“ zu haben.
So wurden viele Demonstranten dazu gedrängt, sich auf die Seite der Gewerkschaften und den Ordnungsdienst der Gewerkschaft CGT zu stellen. Die Aktion der Schwarzen Blöcke trägt darüber hinaus zu wachsender politischer Verwirrung bei: Früher als Linke, Libertäre, Anarchisten, „Globalisierungsgegner“ dargestellt, werden sie heute als Ausdruck der „Linksradikalen“ eingestuft, ein Ausdruck, der mitunter auch zur Bezeichnung der Kommunistischen Linken verwendet wird.
Wir wissen, wie sehr dem Staat daran liegt, alles mögliche in einen Topf zu schmeißen um die Repression besser vorzubereiten. Dies trifft heute zu für die Verstärkung der polizeilichen Maßnahmen und der gewerkschaftlichen Überwachung der Arbeiter, um sie „vor Gewalt zu schützen“, vor allem wird dies noch wichtiger für die Zukunft, wenn der Klassenkampf die Macht der Herrschenden wirklich schwächen wird. Die „Radikalität“ der schwarzen Blöcke nimmt daher in keiner Weise am Prozess der Reifung des proletarischen Bewusstseins für die Revolution teil. Es gibt nichts Revolutionäres an deren „Programm“, weder in ihren Aktionen, noch in deren Parolen, noch in deren Zielen. Auch wenn es den Neoanarchisten nicht gefällt, die glauben, dass „die Verurteilung der schwarzen Blöcke bedeutet, die Vertreter der Macht zu stützen“ (Dissent, 15. Juni 2007), sind es die schwarzen Blöcke und ihre Anhänger, die in Wirklichkeit die Macht des Kapitals eher stützen, als sie zu schwächen.
Nur das Proletariat und seine Kampfmethoden bieten eine Perspektive
Wenn Politologen auf zynische Weise feststellen, dass „der schwarze Block die Stimmung prägt und in der Demonstration eine Stimmung des Zusammenhalts schafft“, dass sie „den Kapitalismus nicht stürzen werden“ und „der Aufstand mag erheiternd sein, aber es ist keine Revolution....“, stellen sie eine falsche Kontinuität zwischen der Bewegung der Indignados in Spanien, Occupy in den Vereinigten Staaten und dem arabischen Frühling mit der blinden Aktion der schwarzen Blöcke her. Dies ist echt irreführend, denn diese Protestbewegungen wurden durch ständiges Nachdenken und Diskussion, durch Solidarität bei großen Versammlungen vorwärtsgetrieben. So auch während des Anti-CPE-Kampfes in Frankreich im Jahr 2006, als die junge Studentengeneration die offene Konfrontation mit den Bullen ablehnte und sich für die Abhaltung von Vollversammlungen, politische Diskussionen und Konfrontationen einsetzte, die Ausweitung der Bewegung und den Zusammenschluss zwischen den Generationen bei den Demonstrationen anstrebte und für alle offen war. All das bewegte sich, wenn auch noch zögernd, abtastend und konfus in Richtung der historischen Formen des Kampfes des Proletariats gegen den Kapitalismus. Der Sturz des Kapitalismus wird durch den Klassenkampf verwirklicht werden, indem er durch eine aktive Beteiligung der Mehrheit der Arbeiter getragen wird, bei dem eine Klassengewalt ganz anderer Art als die der schwarzen Blöcke angewandt wird: massiv und bewusst, einheitlich und organisiert, emanzipatorisch. Sie wird ein Teil sein bei der Machtergreifung der arbeitenden Massen für eine weltweite Revolution.
Stopio, 18. Juni 2018
Rubric:
Den Mai verstehen (Nachdruck aus Revolution Internationale Nr. 2, 1969)
- 98 Aufrufe
Die Ereignisse vom Mai 1968 haben eine außergewöhnliche Fülle literarischer Aktivitäten hervorgebracht. Bücher, Broschüren und Anthologien aller Art sind in beeindruckender Anzahl erschienen. Die Verleger - immer auf der Suche nach modischen „ Spielereien“ - sind übereinander gestolpert, um das immense Interesse der Massen für alles zu nutzen, was mit diesen Ereignissen zu tun hat. Und sie hatten keine Schwierigkeiten, zahlreiche Journalisten, Fotografen, PR-Experten, Professoren, Intellektuelle, Künstler und Literaten zu finden. Wie jeder weiß, wimmelt es in diesem Land von ihnen, und sie sind immer bereit, ein gutes kommerzielles Thema aufzugreifen.
Diese ganze hektische Wiederbelebung lässt einen kotzen wollen
Aber unter der Masse der Kämpfer des Mais ist das Interesse, das während des Kampfes geweckt wurde, nicht mit den Straßenkämpfen zu Ende gegangen. Im Gegenteil, es ist stärker denn je geworden. Forschung, Konfrontationen, Diskussionen gehen weiter. Die Massen waren nicht nur Zuschauer oder einmalige Rebellen. Sie befanden sich plötzlich in einem Kampf von historischer Dimension, und nachdem sie sich von ihrem eigenen Erstaunen erholt hatten, konnten sie nicht umhin, nach den grundlegenden Wurzeln dieser sozialen Explosion zu suchen, die ihre eigene Arbeit war, und nach den Perspektiven, die diese Explosion sowohl kurzfristig als auch in ferner Zukunft eröffnet hat. Die Massen versuchen zu verstehen, sich ihrer eigenen Aktivität bewusst zu werden.
Deshalb finden wir in der Masse der über den Mai geschriebenen Bücher nur selten ein Spiegelbild der Unruhe und der Befragung unter den Menschen. Diese finden sich eher in kleinen Publikationen, in oft kurzlebigen Rezensionen, in den kopierten Flugblättern und Schriften von Gruppen aller Art oder von regionalen Kampfkomitees und Kampfkomitees der Fabriken, die den Mai überlebt haben, in ihren Sitzungen und durch Diskussionen, die unweigerlich verwirrt sind. Doch trotz dieser Verwirrung wird ernsthaft daran gearbeitet, die durch den Mai aufgeworfenen Probleme zu klären.
Nach einigen Monaten des Schweigens, die wahrscheinlich der Ausarbeitung ihrer Arbeit gewidmet waren, hat sich die Gruppe Situationistische Internationale[1] mit einem Buch mit dem Titel „Enragés[2] et Situationnistes dans le mouvement des occupations“ (Wütende und Situationisten in der Bewegung der Besetzungen) in diese Debatte eingeschaltet.
Von einer Gruppe, die tatsächlich aktiv am Kampf teilgenommen hat, konnten wir zu Recht einen tiefgreifenden Beitrag zur Analyse der Bedeutung des Mai erwarten, vor allem im Nachhinein. Wir hatten das Recht, Forderungen an dieses Buch zu stellen, aber es hält nicht, was es verspricht. Abgesehen von ihrem eigenen speziellen Vokabular („Gesellschaft des Spektakels“, Konsumismus, „Kritik des täglichen Lebens“ usw.) können wir nur bedauern, dass die Situationisten der Mode des Tages nachgegeben und ihr Buch mit Fotos, Bildern und Comics gefüllt haben.
Man kann von Comics als Mittel der revolutionären Propaganda und Agitation denken, was man will. Und wir wissen, dass die Situationisten eine besondere Vorliebe für Comics und Sprechblasen als Ausdrucksmittel haben. Sie behaupten sogar, in der Technik des „détournement“ (der Zweckentfremdung[3]) die moderne Waffe der subversiven Propaganda entdeckt zu haben, und sehen dies als Zeichen ihrer Überlegenheit gegenüber anderen Gruppen, die sich an die „veralteten“ Methoden der „traditionellen“ revolutionären Presse, an „langweilige“ Artikel und an kopierte Flugblätter gehalten haben.
In der Beobachtung, dass die Artikel in der Presse vieler kleiner Gruppen oft repetitiv, lang und langweilig sind, liegt sicherlich etwas Wahres. Dies sollte jedoch kein Argument dafür sein, sich darüber lustig zu machen. Der Kapitalismus entdeckt ständig alle möglichen Arten von „kulturellen“ Aktivitäten, organisierte Freizeit und vor allem Sport für die Jugend. Es geht dabei nicht nur um den Inhalt, sondern auch um eine sehr bestimmte „Zweckentfremdung“ – mit dem Ziel, junge Arbeiter vom Nachdenken abzuhalten.
Die Arbeiterklasse muss nicht unterhalten werden. Sie muss vor allem verstehen und denken. Comics, Witze und Wortspiele nützen wenig, vor allem, wenn dies in einer philosophischen Sprache (voll von obskuren, verworrenen und esoterischen Begriffen) geschieht, die den „intellektuellen Denkern“ vorbehalten ist, während die große infantile Masse der Arbeiter mit ein paar Bildern und einfachen Schlagworten abgespiesen wird.
Wenn man das „Spektakuläre“ überall anprangert, muss man darauf achten, nicht selbst dem Spektakel zu verfallen. Leider ist es genau das, was dieses Buch zum Mai tut. Ein weiteres Merkmal dieses Buches ist die Tendenz, die Ereignisse Tag für Tag zu beschreiben, wo eine Analyse erforderlich wäre, die Ereignisse in ihren historischen Kontext zu stellen und ihre grundlegende Bedeutung hervorzuheben. Darüber hinaus werden weniger die Ereignisse selbst als vielmehr die Aktionen der Wütenden und Situationisten beschrieben, wie wir es dem Titel entnehmen können. Die absurde Übertreibung der Rolle, die diese oder jene „Persönlichkeit“ unter den Wütenden spielt, das Selbstlob erwecken den Eindruck, dass nicht die Situationisten an der Besetzungsbewegung teilnahmen, sondern dass die Mai-Bewegung nur dazu gedacht war, die großen revolutionären Qualitäten der Situationisten und Wütenden hervorzuheben. Jeder, der den Mai nicht erlebt hat, würde durch dieses Buch eine sehr merkwürdige Vorstellung davon bekommen. Wenn man ihnen zuhört, könnte man meinen, dass die Situationisten von Anfang an eine dominierende Rolle in den Ereignissen gespielt haben. Das zeugt von großer Phantasie und der Illusion, „seine Sehnsüchte für die Wirklichkeit zu halten“. Tatsächlich war der Anteil der Situationisten an den Ereignissen wahrscheinlich geringer und sicherlich nicht größer als der vieler anderer Gruppen. Anstatt das Verhalten, die Ideen und Positionen anderer Gruppen zu kritisieren – was interessant gewesen wäre, was sie aber nicht tun –, reden sie sie einfach klein (siehe auf den Seiten 179 bis 181, wie herablassend und oberflächlich sie die anderen „rätistischen“ Gruppen „kritisieren“) oder ignorieren sie. Das ist ein ziemlich zweifelhaftes Mittel, um die eigene Größe herauszustellen, und bringt uns nicht sehr weit.
Das Buch (oder was davon übrig ist, ohne die Comics, Fotos, Lieder, Graffiti und andere Reproduktionen) beginnt mit einer Beobachtung, die im Allgemeinen korrekt ist: Der Mai überraschte fast alle, insbesondere die revolutionären oder vermeintlich revolutionären Gruppen. Alle, außer natürlich die Situationisten, die „die Möglichkeit und den bevorstehenden Neuanfang der Revolution kannten und aufzeigten“. Für die situationistische Gruppe war dank „der revolutionären Kritik, die der praktischen Bewegung ihre eigene Theorie zurückgibt, die sie aus sich hergeleitet und zur Kohärenz geführt hat, sicherlich nichts besser voraussehbar, nichts klarer vorhergesehen als die neue Ära des Klassenkampfes ...“.
Es gibt kein Gesetz gegen Überheblichkeit – sie ist vielmehr eine weit verbreitete Manie innerhalb der revolutionären Bewegung, besonders seit dem Triumph des „Leninismus“, darin sticht die Strömung der Bordigisten hervor. Wir werden den Situationisten diesen Anspruch nicht streitig machen, sondern ihn einfach zur Kenntnis nehmen, indem wir mit den Schultern zucken und versuchen herauszufinden: Wo und wann und auf welcher Grundlage, aufgrund welcher Daten haben die Situationisten die Ereignisse vom Mai vorhergesagt? Wenn sie sagen, sie hätten „die aktuelle Explosion und ihre Folgen seit Jahren sehr genau vorausgesagt“, verwechseln sie offensichtlich eine allgemeine Aussage mit einer genauen Analyse des Augenblicks. Seit mehr als 150 Jahren, seit es eine revolutionäre Bewegung des Proletariats gibt, gibt es die „Prognose“, dass eines Tages die revolutionäre Explosion unvermeidlich sein wird. Für eine Gruppe, die behauptet, nicht nur eine kohärente Theorie zu haben, sondern auch „ihre revolutionäre Kritik in die Praxis zurückzubringen“, ist eine solche Vorhersage weitgehend unzureichend. Um nicht nur ein rhetorischer Satz zu bleiben, muss „die Rückkehr der revolutionären Kritik zur praktischen Bewegung“ eine Analyse der konkreten Situation, ihrer Grenzen und ihrer realen Möglichkeiten bedeuten. Die Situationisten haben eine solche Analyse vor dem Mai nie gemacht, und nach diesem Buch zu urteilen, haben sie es danach auch nicht mehr getan: Wenn sie von einer neuen Periode erneuter revolutionärer Kämpfe sprechen, beziehen sie sich nirgends auf mehr denn auf abstrakte Allgemeingültigkeiten. Und selbst wenn sie sich auf die jüngsten Kämpfe beziehen, tun sie nie mehr, als eine empirische Tatsache zu beobachten. An sich geht diese Beobachtung nie über das Zeugnis der Kontinuität des Klassenkampfes hinaus und sagt nichts über seine Richtung aus, noch über seine Fähigkeit, sich in eine historische Periode revolutionärer Kämpfe, vor allem auf internationaler Ebene, zu öffnen, wie es eine sozialistische Revolution unbedingt sein muss. Selbst eine so gewaltige und wichtige revolutionäre Explosion wie die Pariser Kommune eröffnete keine revolutionäre Periode in der Geschichte, da ihr im Gegenteil eine lange Periode folgte, in der sich der Kapitalismus stabilisierte und blühte und sich die Arbeiterbewegung dem Reformismus zuwandte.
Wenn wir nicht den Anarchisten folgen wollen, die glauben, dass immer alles möglich ist, wenn es nur einen Willen dazu gibt, müssen wir verstehen, dass die Arbeiterbewegung nicht einer ständig steigenden Kurve folgt, sondern dass sie aus Perioden des steigenden und fallenden Kampfes besteht und in erster Linie durch den Entwicklungsgrad des kapitalistischen Systems und seine inhärenten Widersprüche objektiv bestimmt wird.
Die SI definiert die gegenwärtige Periode als „die gegenwärtige Rückkehr der Revolution“. Worauf basiert diese Definition? Hier ist die Erklärung:
1) „Die von der SI ausgearbeitete und verbreitete kritische Theorie zeigte leicht (....), dass das Proletariat nicht abgeschafft worden war“ (wie interessant, dass die SI „leicht“ etwas zeigt, was alle Arbeiter und Revolutionäre schon immer gewusst haben, ohne auf die SI warten zu müssen).
2) „... der Kapitalismus hat seine Entfremdungen weiter entwickelt“ (wer hätte das gedacht?)
3) „... wo immer dieser Antagonismus existiert (als ob dieser Antagonismus nicht im gesamten Kapitalismus existierte), bleibt die soziale Frage auch nach mehr als einem Jahrhundert bestehen“ (da haben wir eine Entdeckung!)
4) „... der Antagonismus existiert auf der gesamten Oberfläche des Planeten“ (eine weitere Entdeckung!).
5) „Die SI erklärt die Vertiefung und Konzentration dieser Entfremdungen durch die Verzögerung der Revolution“ (offensichtlich …).
6) „Diese Verzögerung entspringt eindeutig der internationalen Niederlage des Proletariats seit der russischen Konterrevolution“ (eine weitere Wahrheit, die Revolutionäre seit mindestens 40 Jahren verkünden).
7) Darüber hinaus „wusste die SI sehr wohl (....), dass die Emanzipation der Arbeiter immer und überall auf die bürokratischen Organisationen treffen würde“.
8) Die Situationisten stellen fest, dass die ständige Lüge, die für das Überleben dieser bürokratischen Maschinen notwendig ist, ein Eckpfeiler der allgemeinen Verblendung in der modernen Gesellschaft ist.
9) Schließlich „hatten sie auch die neuen Formen (?) der Subversion, deren erste Anzeichen sich bereits sammelten, erkannt und begonnen, mit ihnen zu arbeiten“.
10) Und deshalb „erkannten und bewiesen die Situationisten die Möglichkeit und Notwendigkeit eines Neubeginns der Revolution“.
Wir haben diese langen Auszüge nachgedruckt, um so genau wie möglich und mit ihren eigenen Worten zu zeigen, was die Situationisten „wussten“.
Wie wir sehen können, kann dieses „Wissen“ auf Allgemeingültigkeiten reduziert werden, die seit Jahren Tausenden von Revolutionären bekannt sind, und obwohl diese Allgemeingültigkeiten ausreichen, um das revolutionäre Projekt zu bekräftigen, enthalten sie nichts, was als ein Beweis des „bevorstehenden Neubeginns der Revolution“ angesehen werden könnte. Die „Theorie“ der Situationisten kann somit auf ein reines Glaubensbekenntnis reduziert werden, mehr nicht.
Es ist so, dass die Sozialistische Revolution und ihre Notwendigkeit nicht aus einigen verbalen „Entdeckungen“ wie der Konsumgesellschaft, dem Spektakel, dem Alltag abgeleitet werden kann, die mit neuen Worten die bekannten Vorstellungen von der kapitalistischen Gesellschaft der Ausbeutung der arbeitenden Massen bezeichnen, mit allem, was dies in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens mit sich bringt, von Deformationen und menschlichen Entfremdungen.
Selbst wenn wir vor einem Neuanfang der Revolution stehen, wie erklärt die SI, dass wir seit dem Sieg der Russischen Revolution genau diese Zeitspanne - sagen wir, 50 Jahre - warten mussten. Warum nicht 30 Jahre oder 70? Man kann nicht beides haben: Entweder wird diese Erholung grundsätzlich von objektiven Bedingungen bestimmt, und in diesem Fall muss erklärt werden, welche - was die SI nie tut - oder sie ist allein das Ergebnis eines sich anhäufenden subjektiven Willens, der sich eines schönen Tages zeigt, in welchem Fall sie nicht vorhergesagt werden konnte, weil es keine Kriterien zur Bestimmung ihres Reifegrades geben würde.
Unter diesen Bedingungen wäre die Vorhersage, auf die die SI so stolz ist, mehr das Werk eines Wahrsagers als das Ergebnis jeder Theorie. Als Trotzki 1936 schrieb: „Die Revolution beginnt in Frankreich“, irrte er sich sicherlich, aber diese Behauptung basierte auf einer insgesamt ernsthafteren Analyse als die der SI, da sie sich auf eine Wirtschaftskrise bezog, die die ganze Welt erschütterte. Die „richtige“ Vorhersage der SI ähnelt eher Molotows Einweihung der berühmten „dritten Periode“ der Kommunistischen Internationale zu Beginn des Jahres 1929 und verkündet die große Nachricht, dass die Welt gerade in die revolutionäre Periode eingetreten ist. Die Verwandtschaft zwischen den beiden besteht in der freien Natur ihrer jeweiligen Behauptungen - deren Untersuchung als Ausgangspunkt für jede Analyse über einen bestimmten Zeitraum unerlässlich ist. Molotow war der Meinung, dass die Wirtschaftskrise, deren Untersuchung in der Tat ein wichtiger Ausgangspunkt für jede Analyse eines bestimmten Zeitraums ist, ausreicht, um den revolutionären Charakter der Krise von 1929 zu bestimmen; deshalb dachte er, er könne die bevorstehende Revolution ankündigen. Die SI hingegen hält es für ausreichend, alles zu ignorieren, was nach einem objektiven Zustand riecht, woher ihre tiefe Abneigung gegen alles, was mit einer ökonomischen Analyse der modernen kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat.
Die ganze Aufmerksamkeit der SI ist also den offensichtlichsten Äußerungen sozialer Entfremdung gewidmet, und sie vernachlässigt den Blick auf die Quellen, die sie speisen. Wir bestehen erneut darauf, dass eine solche Kritik, die sich im Wesentlichen mit oberflächlichen Äußerungen befasst, egal wie radikal sie auch sein mag, sowohl in Theorie als auch in der Praxis begrenzt sein muss.
Der Kapitalismus produziert notwendigerweise seine eigenen Entfremdungen, und es ist nicht der Ausdruck dieser Entfremdungen, in denen wir nach dem Motor seines Untergangs suchen sollten. Solange der Kapitalismus an seinen Wurzeln ein lebensfähiges Wirtschaftssystem bleibt, kann er nicht allein durch Willenskraft zerstört werden.
„Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist“ (Marx, Vorwort zu einer Kritik der politischen Ökonomie).
Eine radikale kritische Theorie muss die Wurzeln der kapitalistischen Gesellschaft betrachten, um die Möglichkeit ihres revolutionären Sturzes aufzudecken.
„Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen [...] Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein.“ (Marx, idem).
Dieser Widerspruch, von dem Marx spricht, drückt sich in wirtschaftlichen Umwälzungen wie Krisen, imperialistischen Kriegen und sozialen Erschütterungen aus. Alle marxistischen Denker haben darauf bestanden, dass, um von einer revolutionären Periode zu sprechen, „es nicht genügt, dass die Arbeiter nicht mehr wollen, es ist immer noch notwendig, dass die Kapitalisten nicht weitermachen können wie bisher“. (Lenin). Und hier geht die SI, die behauptet, heute praktisch der einzige organisierte Ausdruck revolutionärer Praxis zu sein, genau in die entgegengesetzte Richtung. In den seltenen Fällen, in denen dieses Buch seine eigene Abneigung gegen wirtschaftliche Fragen überwindet, will es zeigen, dass der Neubeginn der Revolution nicht nur unabhängig von den wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft ist, sondern in einem wirtschaftlich florierenden Kapitalismus stattfindet. „Es war keine Tendenz zur Wirtschaftskrise zu beobachten [S. 25] ... Der revolutionäre Ausbruch kam nicht von der Wirtschaftskrise ... was im Mai frontal angegriffen wurde, war eine GUT funktionierende kapitalistische Wirtschaft“ (Hervorhebung im Original, S. 209).
Damit soll gezeigt werden, dass die revolutionäre Krise und der wirtschaftliche Zustand der Gesellschaft zwei verschiedene Dinge sind, die sich jeweils auf ihre eigene Art und Weise entwickeln können, ohne miteinander verwandt zu sein. Die SI glaubt, dass die Fakten diese „große Entdeckung“ unterstützen, und schreit deshalb triumphierend: „Keine Tendenz zur Wirtschaftskrise zu beobachten“!!
Überhaupt keine Tendenz? Wirklich?
Ende 1967 begann sich die wirtschaftliche Lage in Frankreich zu verschlechtern. Die Gefahr der Arbeitslosigkeit sorgte immer mehr für Besorgnis. Anfang 1968 stieg die Zahl der Arbeitslosen auf über 500.000. Es war kein lokales Phänomen mehr, sondern hatte alle Regionen erreicht. In Paris stieg die Zahl der Arbeitslosen langsam aber sicher. Die Presse war voll von Artikeln über die Angst vor Arbeitslosigkeit in verschiedenen Milieus. Kurzarbeit setzt sich in vielen Betrieben durch und provoziert Reaktionen bei den Arbeitern. Bei mehreren sporadischen Streiks geht es um die Aufrechterhaltung von Beschäftigung und Vollbeschäftigung aus unmittelbarem Anlass. Betroffen sind vor allem junge Menschen, die es nicht schaffen, sich in die Produktion zu integrieren. Die Beschäftigungskrise ist umso schlimmer, als diese Generation der demographischen Explosion, die unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs einsetzte, in den Arbeitsmarkt eintritt. Bei den Arbeitern und vor allem bei den Jugendlichen entwickelt sich ein Gefühl der Unsicherheit von morgen. Dieses Gefühl ist umso lebendiger, als es den Arbeitern in Frankreich seit dem Krieg praktisch unbekannt war.
Mit steigender Arbeitslosigkeit sanken auch die Löhne und Lebensbedingungen. Natürlich versuchten Regierung und Chefs, die Situation so gut wie möglich zu nutzen, um den Lebensstandard der Arbeiter anzugreifen (z.B. die Verordnungen über die soziale Sicherheit).
Mehr und mehr wächst in den Massen das Gefühl, dass die Zeit des Wohlstands zu Ende ist. Die Gleichgültigkeit der Arbeiterinnen und Arbeiter, die die Bourgeoisie in den letzten 10-15 Jahren so beklagt hat, weicht einer tiefen und wachsenden Angst.
Sicherlich ist es schwieriger, diese wachsende Angst und Unzufriedenheit unter den Arbeitern zu erkennen als spektakuläre Aktionen an einer Universitätsfakultät. Aber man kann sie nach der Mai-Explosion nicht weiter ignorieren, es sei denn, man glaubt, dass 10 Millionen Arbeiter eines schönen Tages plötzlich vom Heiligen Geist des Anti-Spektakels berührt wurden. Eine solche massive Explosion beruht auf einer langen Anhäufung echter Unzufriedenheit unter den Massen über ihre wirtschaftliche Situation und ihre Arbeitsbedingungen, auch wenn ein oberflächlicher Beobachter nichts davon sah. Auch können wir die wirtschaftlichen Forderungen des Streiks nicht allein auf die „politique canaille“ („Schurken-Politik“) der Gewerkschaften und der Stalinisten zurückführen.
Es liegt auf der Hand, dass die Gewerkschaften und die KPF (französische „Kommunistische Partei“) der Regierung zu Hilfe kamen, indem sie die wirtschaftlichen Forderungen in den Griff bekamen, um den Ausbruch des Streiks auf ein globales, soziales Terrain zu verhindern. Aber wir sprechen hier nicht über die Rolle dieser staatlichen Organismen, sie haben ihre Arbeit getan, und man kann ihnen kaum vorwerfen, dass sie es bis zum Äußersten getan haben. Aber die Tatsache, dass sie so leicht in der Lage waren, die riesige Masse der streikenden Arbeiter auf dem rein wirtschaftlichen Terrain zu halten, beweist, dass die Hauptanliegen der Massen, den Kampf aufzunehmen, die zunehmend bedrohliche wirtschaftliche Situation war. Während die Aufgabe der Revolutionäre darin besteht, die im Kampf der Massen enthaltenen radikalen Möglichkeiten aufzudecken und aktiv an ihrer Verwirklichung mitzuwirken, ist es vor allem notwendig, die unmittelbaren Anliegen, die die Massen in den Kampf getrieben haben, nicht zu ignorieren.
Trotz des proklamierten Selbstbewusstseins der Regierungskreise ist die Wirtschaft zunehmend beunruhigt über die wirtschaftliche Lage, wie wir zu Beginn des Jahres in der Finanzpresse gesehen haben. Was sie am meisten beunruhigt, ist nicht so sehr die Situation in Frankreich, dessen Position immer noch relativ privilegiert ist, sondern die Tatsache, dass sich die Wirtschaft in einem Kontext der weltweiten Wirtschaftsflaute verlangsamt, was sich in Frankreich nicht vermeiden lässt. In allen Industrieländern, sowohl in Europa als auch in den USA, steigt die Arbeitslosigkeit und die Konjunkturaussichten verschlechtern sich. Trotz einer ganzen Reihe von Maßnahmen war Großbritannien Ende 1967 gezwungen, das Pfund abzuwerten und andere Länder in seinen Sog zu ziehen. Die Regierung Wilson hat ein außergewöhnliches Sparprogramm angekündigt: Reduzierung der öffentlichen Ausgaben, einschließlich Rüstung; Abzug der britischen Truppen aus Asien; Lohnstopp; Reduzierung des Inlandsverbrauchs und der Importe; Unterstützung der Exporte. Am 1. Januar 1968 schlug die Regierung Johnson (in den USA) Alarm und kündigte harte Maßnahmen an, um die Wirtschaft im Gleichgewicht zu halten. Im März kam die Dollar-Krise. Die Wirtschaftspresse wurde von Tag zu Tag pessimistischer und begann mehr und mehr vom Gespenst der Krise von 1929 zu sprechen; viele befürchteten, dass die Folgen diesmal noch schlimmer sein würden. Überall stiegen die Kreditzinsen, die Börsen fielen. In jedem Land gilt: Ausgaben und Konsum reduzieren, Exporte um jeden Preis steigern und Importe auf das absolute Minimum reduzieren. Die gleiche Verschlechterung zeigte sich auch im Ostblock, was die Tendenz von Ländern wie der Tschechoslowakei und Rumänien erklärt, sich vom sowjetischen Griff zu lösen und nach Märkten anderswo zu suchen.
Dies ist der wirtschaftliche Hintergrund für die Situation vor Mai.
Natürlich ist dies noch keine offene Wirtschaftskrise, erstens, weil wir erst am Anfang stehen, und zweitens, weil der Staat im heutigen Kapitalismus über ein ganzes Arsenal an Mitteln verfügt, um die markantesten Äußerungen der Krise zu verlangsamen und vorübergehend abzuschwächen. Dennoch ist es notwendig, die folgenden Punkte hervorzuheben:
a) Seit 20 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg lebt der Kapitalismus auf der Grundlage des Wiederaufbaus einer vom Krieg verwüsteten Wirtschaft, der schamlosen Plünderung der unterentwickelten Länder, die durch den Schwindel der nationalen Befreiung und der Hilfe für den Aufbau unabhängiger Staaten bis zu dem Punkt ausgebeutet wurden, an dem sie zu verzweifelter Armut und Hungersnot reduziert werden, und einer wachsenden Rüstungsproduktion: der Kriegswirtschaft.
b) Diese drei Quellen des Wohlstands und der Vollbeschäftigung in den letzten 20 Jahren sind nahezu erschöpft. Der Produktionsapparat steht vor einem gesättigten Weltmarkt, und die kapitalistische Wirtschaft befindet sich in genau der gleichen Situation wie 1929, nur schlimmer noch.
c) Es besteht eine engere Wechselbeziehung zwischen den Volkswirtschaften als 1929, so dass etwaige Schwierigkeiten in einer Volkswirtschaft unmittelbarere und größere Auswirkungen auf die Wirtschaft anderer Länder haben.
d) Die Krise von 1929 brach nach einer Reihe schwerer Niederlagen für das internationale Proletariat aus: der Sieg der Konterrevolution in Russland vollendet mit der Mystifizierung des „Sozialismus in einem Land“ und dem Mythos des antifaschistischen Kampfes. Dank dieser besonderen historischen Bedingungen konnte sich die Krise von 1929, die nicht nur konjunktureller Natur war, sondern ein gewaltsamer Ausdruck der chronischen Krise des niedergehenden Kapitalismus, über Jahre hinweg entwickeln und schließlich zum Weltkrieg und zur allgemeinen Zerstörung führen. Das ist heute nicht der Fall.
Der Kapitalismus verfügt über immer weniger Themen der Mystifikation, die in der Lage sind, die Massen zu mobilisieren und zum Schlachten zu bringen. Der russische Mythos bricht zusammen; die falsche Wahl zwischen bürgerlicher Demokratie und Totalitarismus wird immer dünner. Unter diesen Bedingungen ist die Krise sofort erkennbar. Die ersten Symptome werden in allen Ländern immer heftigere Reaktionen der Massen hervorrufen. Weil die Wirtschaftskrise heute nicht ihren vollen Lauf nehmen kann, sondern sich sofort in eine soziale Krise verwandelt, mag sie einigen als unabhängig erscheinen, in der Luft schwebend, ohne Bezug zur wirtschaftlichen Situation, die dennoch ihre Grundlage ist.
Wenn wir diese Realität vollständig erfassen wollen, ist es natürlich nicht gut, sie naiv zu betrachten. Vor allem ist es sinnlos, nach einem engen Verhältnis von Ursache und Wirkung zu suchen, das lokal auf bestimmte Länder oder bestimmte Industriezweige beschränkt ist. Die Grundlagen dieser Realität und die Ursachen, die letztendlich ihre Entwicklung bestimmen, sind nur global, auf der Ebene der Weltwirtschaft zu finden. So gesehen offenbart die Bewegung der Studentenkämpfe in jeder Stadt der Welt ihre grundlegende Bedeutung, aber auch ihre Grenzen. Wenn die Studentenkämpfe im Mai als Zünder für die gewaltige Bewegung der Fabrikbesetzungen dienen konnten, dann deshalb, weil sie mit all ihren Besonderheiten nicht mehr als die Vorläufer einer sich verschlechternden Situation im Kern der Gesellschaft waren: in der Produktion und in den Beziehungen der Produktion.
Die volle Bedeutung des Mai '68 ist, dass es eine der wichtigsten Reaktionen der Masse der Arbeiter auf eine sich verschlechternde Weltwirtschaftslage war.
Daher ist es falsch zu sagen, wie der Autor dieses Buches, dass „die revolutionäre Umwälzung nicht aus der Wirtschaftskrise hervorgegangen ist; im Gegenteil, sie hat dazu beigetragen, eine Krisensituation in der Wirtschaft zu schaffen“ und dass „diese Wirtschaft, sobald sie durch die negativen Kräfte ihrer historischen Überwindung gestört wurde, weniger gut funktionieren muss“.
Das stellt die Realität auf den Kopf: Wirtschaftskrisen sind nicht mehr das unvermeidliche Produkt der dem kapitalistischen System innewohnenden Widersprüche, wie Marx uns sagt, sondern es sind die Arbeiter und ihr Kampf, die Krisen in einem System schaffen, das „gut funktioniert“. Genau das sagen uns die Bosse und kapitalistischen Apologeten immer wieder. Dies war das Thema von De Gaulle im November, als er die Krise des Francs auf das Wüten des Mai[4] zurückführte.
Dies läuft darauf hinaus, die marxistische Wirtschaftstheorie durch die politische Ökonomie der Bourgeoisie zu ersetzen. Kein Wunder, dass der Autor die immense Bewegung, die der Mai '68 war, als Werk einer kleinen, entschlossenen Minderheit erklärt, die er hervorhebt: „Die Agitation, die im Januar 1968 von den vier oder fünf Revolutionären, die die Gruppe der Wütenden bilden sollten, ausgelöst wurde, sollte in fünf Monaten zur virtuellen Auflösung des Staates führen. Später schreibt er: „Niemals hat eine Agitation, die von so wenigen unternommen wurde, in so kurzer Zeit zu solchen Konsequenzen geführt“.
Für die Situationisten stellt sich das Problem der Revolution in Form von „Führung“, wenn auch nur durch beispielhafte Handlungen. Für uns ist es eine spontane Bewegung der Massen des Proletariats, die gezwungen ist, sich gegen ein zerfallendes Wirtschaftssystem zu erheben, das nur noch zunehmendes Elend und Zerstörung sowie Ausbeutung bieten kann.
Auf diesem Granitfelsen gründen wir die revolutionäre Perspektive der Klasse und unsere Überzeugung von ihrer Leistung.
MC
[1] Die SI war eine Gruppe, die im Mai 68 vor allem in den radikalsten Bereichen des Studentenmilieus einen deutlichen Einfluss hatte. Sie fand ihre Quellen einerseits in der "lettristischen" Bewegung, die in der Kontinuität der Tradition der Surrealisten eine revolutionäre Kunstkritik betreiben wollte, und andererseits in der Bewegung der Zeitschrift Socialisme ou Barbarie (Sozialismus oder Barbarei), die Anfang der 1950er Jahre in Frankreich vom ehemaligen griechischen Trotzkisten Castoriadis gegründet wurde. Die SI berief sich also auf Marx, aber nicht auf den Marxismus. Sie nahm einige der fortschrittlichsten Positionen der revolutionären Arbeiterbewegung auf, insbesondere der deutsch-holländischen kommunistischen Linken (kapitalistischer Charakter der UdSSR, Ablehnung von Gewerkschafts- und Parlamentsformen, Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats durch die Arbeiterräte), stellte sie aber als ihre eigenen Entdeckungen dar, die sie in ihre Analyse des Phänomens des Totalitarismus verpackte – in die Theorie der "Gesellschaft des Spektakels". Die SI verkörperte sicherlich einen Höhepunkt, den Teile des radikalisierten studentischen Kleinbürgertums erreichen konnten: die Ablehnung ihres Zustandes ("Ende der Universität") in dem Versuch, sich in die revolutionäre Bewegung des Proletariats zu integrieren. Aber ihr Anschluss blieb von den Wesenszügen ihrer Herkunft geprägt, insbesondere von ihrem verklärten Geschichtsbild, das die Bedeutung der Wirtschaft und damit die Realität des Klassenkampfes nicht begriff. Die Zeitschrift der SI verschwand kurz nach 1968, und die Gruppe endete in einer Reihe von gegenseitigen Ausschlüssen.
[2] „Enragés“ bedeutet auf Französisch wörtlich "die Wütenden". Das französische Original der Broschüre findet sich hier: https://www.lautre.net/ [615] , einige Auszüge in Deutsch hier: https://www.geocities.ws/situ1968/parismai68.html [616]
[3] „Détournement“ ist ein Begriff, der den Situationisten teuer ist und der nur schwer ins Deutsche übersetzt werden kann (die häufigste Übersetzung ist „Zweckentfremdung“, siehe wikipedia). Kurz gesagt, es bezog sich auf eine populäre situationistische Technik, Produkte der kapitalistischen Medien (Werbung, Comics, etc.) zu nehmen und „gegen sie zu wenden“ („Umwendung“), was sie als „Gesellschaft des Spektakels“ bezeichneten.
[4] Wir verweisen diejenigen, die die Novemberkrise des Francs auf Spekulationen einiger „schlechter Franzosen“ zurückführen wollen, auf diese Zeilen von Marx:
„Die Krise selbst bricht zuerst aus auf dem Gebiet der Spekulation und bemächtigt sich erst später der Produktion. Nicht die Überproduktion, sondern die Überspekulation, die selbst nur ein Symptom der Überproduktion ist, erscheint daher der oberflächlichen Betrachtung als Ursache der Krise. Die spätere Zerrüttung der Produktion erscheint nicht als notwendiges Resultat ihrer eignen vorhergegangenen Exuberanz, sondern als bloßer Rückschlag der zusammenbrechenden Spekulation.“
www.mlwerke.de/me/me07/me07_421.htm [617]
Karl Marx/Friedrich Engels, Revue, Mai bis Oktober [1850]
„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue“, Fünftes und Sechstes Heft, Mai bis Oktober 1850. MEW 7, Seite 421
Rubric:
Die Schwächen der IKP in der Frage des Populismus (Teil I)
- 141 Aufrufe
Die Internationale Kommunistische Partei (IKP) hat in der 523. Ausgabe ihrer Zeitung Le Prolétaire vom Februar/März/April 2017 einen Artikel veröffentlicht: Populismus – ihr sagtet: Populismus? In diesem Artikel untersucht sie das Phänomen des Populismus und sein gegenwärtiges Anwachsen. Auf der Grundlage dieser Untersuchung kritisiert sie die Analyse der IKS zu diesem Phänomen. Der erste Teil unserer Antwort auf diese Polemik wird sich auf die Elemente der Analyse konzentrieren, die von der IKP verwendet werden. Ziel ist es, ihre Fähigkeit zu bewerten, das Phänomen des Populismus zu erklären.
Wir müssen jedoch zunächst einmal sagen, dass die IKP durch ihre Positionen auf dem Boden eines proletarischen Standpunktes steht. Damit zeigt sie, dass sie sich immer noch im Lager des Proletariats befindet und die Positionen der Kommunistischen Linken weltweit verteidigt.
Was ist Populismus laut der IKP?
Die Genossen der IKP stellen richtigerweise fest:
- dass die anderen Parteien der Bourgeoisie den Populismus ideologisch nutzen, um die Proletarier mit Hilfe der Mystifizierung der „Verteidigung der Demokratie“ auf das Terrain der Wahlen zu treiben. Wir stimmen also mit der IKP darin überein, dass die künstliche und falsche Gegenüberstellung von Populismus und Antipopulismus eine ideologische Falle ist, die den Interessen der Bourgeoisie dient.
- dass die größte Gefahr für die Arbeiterklasse nicht die extreme Rechte darstellt, sondern die Linke des politischen Apparats der Bourgeoisie: Der Populismus „kann jedoch nicht die unendlich mächtigere konterrevolutionäre Rolle ersetzen, die der klassische Reformismus spielt (wie die IKP die Parteien der Linken bezeichnet), der in der Arbeiterklasse fest verankert ist und sie somit lähmt“. Die Genossen sind sich ebenso klar über den Antifaschismus, was sie vollständig von den Positionen der extremen Linken des Kapitals unterscheidet. Sie haben den Aufruf zur Wahl von Chirac im Jahr 2002 unmissverständlich verurteilt und bei den letzten Wahlen erneut den Parlamentarismus und die demokratischen Mystifikationen angeprangert.1
Zudem betont Le Prolétaire zu Recht, dass Demagogie keineswegs eine Besonderheit des Populismus ist. Dasselbe gilt für Wahlversprechen. Wir teilen zweifellos den gleichen proletarischen Standpunkt.
Aber was ist die Analyse der IKP über den Populismus? Vor allem versichert sie uns, dass er kleinbürgerlicher Natur ist. Um dies zu untermauern, beruft sie sich auf ein Zitat von Marx aus Der 18. Brumaire des Louis Napoleon Bonaparte: „Man muss sich nur nicht die bornierte Vorstellung machen, als wenn das Kleinbürgertum prinzipiell ein egoistisches Klasseninteresse durchsetzen wolle. Es glaubt vielmehr, dass die besonderen Bedingungen seiner Befreiung die allgemeinen Bedingungen sind, innerhalb deren allein die moderne Gesellschaft gerettet und der Klassenkampf vermieden werden kann.“ Diese allgemeine Charakterisierung des Kleinbürgertums bleibt vollkommen gültig, aber welche Beziehung hat das Kleinbürgertum zum Milliardär Trump, zu den Befürwortern von Brexit? Dies scheint uns absolut unklar. Eine solch allgemeine Charakterisierung erklärt nichts über die gegenwärtige Situation.
Das einzige historische Element in ihrem Artikel ist der Hinweis auf den Populismus Russlands im 19. Jahrhundert. Aber auch hier sehen wir keine Verbindung zwischen dem Populismus im Russland des 19. Jahrhunderts (Beziehungen zwischen der intellektuellen Kleinbourgeoisie und der Bauernschaft, die Methoden dieser Kleinbourgeoisie der damaligen Zeit, die sich an individuellem Handeln und Terrorismus orientierten) zur Gegenwart. Anstatt dass die IKP sich auf Trump, die Tea Party oder die Strömungen der heutigen extremen Rechten (den Front Nationale und andere rechtsextreme Populisten in Europa) bezieht, redet sie über den Populismus „im Allgemeinen“. Und zwar indem sie ohne zu unterscheiden Kraut und Rüben in den gleichen „kleinbürgerlichen“ Topf wirft: den Populismus der heutigen extremen Rechten (Trump, Le Pen und die Verfechter von Brexit) und die eifrigen Propagandisten bürgerlich-demokratischer Mystifikationen („Demokratie jetzt“ in Spanien oder die Globalisierungskritiker) wie auch authentische Reaktionen der Arbeiterklasse, die aber zweifellos noch von Illusionen in die Demokratie beeinflusst sind, wie beispielsweise die Occupy-Bewegung oder die Indignados …
Was kann man aus einer solchen Verwirrung für Schlüsse ziehen, die den Populismus mit dem Kleinbürgertum gleichsetzt und versucht, schematisch eine Analyse der Realität zu stricken, die alles aufspürt, was sie für die Ideologie der Kleinbourgeoisie hält? Nichts! Man kann lediglich feststellen, dass auf diese Art und Weise keine Analyse des Phänomens des Populismus und seiner historischen Entwicklung möglich ist, die helfen könnte, die gegenwärtige Situation zu verstehen.
Indem Le Prolétaire eine Analyse des Populismus durch eine Reihe von vorgefertigten Schemata ersetzt, lässt er sich lediglich in die Irre leiten und stellt zweifelhafte Behauptungen auf, die von der Realität völlig losgelöst sind. Das ist der Fall, wenn er von einer „Arbeiteraristokratie“ spricht, um den Einfluss populistischer Ideen in den Reihen der Arbeiter zu erklären. Diese von Engels aufgestellte und von Lenin aufgegriffene „Theorie“, die versuchte, die Verbreitung der bürgerlichen Ideologie (nicht speziell die der Kleinbourgeoisie) in den Reihen der Arbeiter zu erklären, war schon damals ein Fehler. Außerdem sind die erfahrensten Arbeiter, welche die besten Lebens- und Arbeitsbedingungen mit den höchsten Löhnen haben, nicht die, welche der gegenwärtigen populistischen Ideologie am meisten zugeneigt sind. Die Realität sieht anders aus: Die am stärksten von Krise und Arbeitslosigkeit in den verarmten und heruntergekommenen Regionen Betroffenen (im ehemaligen Bergbaugebiet im Norden Frankreichs oder in den alten stahlverarbeitenden Bastionen Lothringens, wo der FN einen Durchbruch bei den Wahlen erzielt hat), sind am empfänglichsten für die Ideen des Populismus. Die Realität widerspricht der absurden These der IKP über das Gewicht einer „Arbeiteraristokratie“ in der Frage des heutigen Populismus.2
Eine schematische Sicht auf eine Bourgeoisie ohne Widersprüche
Le Prolétaire sieht den Populismus also als eine Art rationale und mechanische Abwehrreaktion der Schichten der Kleinbourgeoisie zugunsten ihrer besonderen wirtschaftlichen Interessen, die allgemein mit den Interessen des nationalen Kapitals vereinbar seien. Dies führt Le Prolétaire dazu, das eigentliche Problem auszublenden. Der Artikel versucht sogar zu zeigen, dass der Populismus nicht das geringste Problem für die Bourgeoisie darstelle, indem er empirische Befunde, Momentaufnahmen, als „Beweismittel“ verwendet: So verweist er auf die Tatsache, dass kurz nach Trumps Wahl die Wall Street einen Börsenhoch registrierte. In der gleichen Weise verwendet er als ein vermeintliches Hammerargument die Höchststände der Londoner Börse nach der Brexit-Abstimmung, die bestätigen sollen, dass „die Führung der britischen Bourgeoisie überhaupt nicht glaubt, dass dieser Bruch ein ernstes Problem für sie ist“. Die IKP greift damit auf eine veraltete und falsche Sicht des 19. Jahrhunderts zurück, als ob die Börse nicht par excellence die Domäne einer alltäglichen, kurzfristigen Vision wäre, die von den unmittelbaren, kurzfristigen Profiten der Kapitalisten geleitet wird. Aus diesem Grund verlässt sich die Bourgeoisie nicht auf die Börse, sondern richtet ihre Orientierung nach den allgemeinen Interessen ihres Staates, ihrer Verwaltung, ihrer „Planung“. Effektiv gab es nach der Wahl von Trump deswegen ein Börsenhoch, weil bereits zuvor angekündigt worden war, dass die Unternehmenssteuern gesenkt würden. Und eben dies konnte nur zu einer positiven Antwort der Börsianer führen.
Ein anderes Argument, das in diesem Artikel entwickelt wird, überzeugt nicht wirklich: Die Idee, Trump diene den Interessen der gesamten Bourgeoisie, da es noch nie so viele Milliardäre in derselben Regierung gegeben habe. Es gibt keinen Zweifel an der kapitalistischen Natur der gegenwärtigen US-Regierung und der Tatsache, dass viele sehr Reiche drin sind. Das bedeutet aber nicht, dass dies den allgemeinen Interessen des kapitalistischen Systems am besten dient. Wir können davon ausgehen, dass die IKP auch der Meinung ist, dass der Brexit definitiv den Interessen des britischen Kapitals dienen wird. Aber wir sehen nicht wirklich, wie der Brexit das britische Kapital stärken sollte und die IKP führt nichts an, um ihre Behauptung zu unterstützen.
Es ist wichtig aufzuzeigen, was die IKP nicht sagt und welche Fragen sie nicht stellt. Welche Strategie verfolgt die amerikanische Bourgeoisie mit der Wahl von Trump? Was ist das Interesse der britischen Bourgeoisie an der Durchführung von Brexit? Stärkt es sie bei der Verteidigung ihrer wirtschaftlichen und imperialistischen Interessen im globalen Wettbewerb? Die IKP sagt dazu nichts und liefert nicht die geringste Argumentation. Die IKP hat sicherlich recht, wenn sie unterstreicht, dass der Nationalismus angesichts der Konkurrenz zwischen den Staaten ein privilegiertes Mittel ist, um zu versuchen, die Reihen der Bourgeoisie hinter der Verteidigung des nationalen Kapitals zu schließen. Aber das gibt keine Erklärung und keinen anderen Rahmen, um das Phänomen des Populismus zu verstehen, geschweige denn seine gegenwärtige Entwicklung. Ein solches Vorgehen erweist sich als untauglich, die zahlreichen Probleme der heutigen Gesellschaft zu begreifen, und erst recht nicht, um ihre Entwicklung zu analysieren.
Der Artikel der IKP ist gezwungen, ein Lippenbekenntnis darüber abzugeben, dass der Populismus einen Teil der Bourgeoisie stört und Sorgen bereitet, aber er erklärt nichts, wenn er sagt: „Zweifellos haben einige von Trumps markanten Erklärungen die Augenbrauen der Vertreter bestimmter kapitalistischer Sektoren hochziehen lassen: Die Drohung, Importe mit erhöhten Zöllen zu treffen, wäre ein schwerer Schlag für eine Reihe von Industrien, die einen Teil ihrer Produktion verlagert haben, aber auch für die großen Distributionszentren. Aber man kann wetten, dass die Kapitalisten an der Spitze mächtiger Interessengruppen das ihrem „Kollegen Trump“ deutlich machen werden.“ Ebenso muss die IKP anerkennen, dass die Programme der Populisten „in bestimmten Punkten in Widerspruch zu den Interessen der größten, internationalsten kapitalistischen Gruppen geraten“. Aber sie sehen darin etwas, das keine Konsequenzen hat und halten daran fest, dass die Bourgeoisie diese Widersprüche wie immer für ihren eigenen Profit nutzen und überwinden wird. Es ist offensichtlich, dass die Wahl und die Politik von Trump ein Jahr später in eine völlig entgegengesetzte Richtung geht, als es die IKP vorhersah mit ihrer Idee, dass die Bourgeoisie auf die Vernunft hören und den Anmaßungen Trumps ein Ende setzen würde. Gegenwärtig ist ein großer Teil der amerikanischen Bourgeoisie in Unordnung geraten und mehrere Sektoren, einschließlich seines eigenen Lagers, versuchen die Mittel zu finden, ihn los zu werden, oder nach anderen Wegen suchen, um ihn in seiner Funktion als Präsident auszuhebeln. Seit einem Jahr erleben wir eine wachsende Diskreditierung, eine Verurteilung der mangelnden Seriosität Trumps, sowie der inkohärenten und chaotischen Politik der führenden Weltmacht auf internationaler Ebene. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels durch Trump ist unter anderem ein eklatantes Beispiel für eine Außenpolitik, die nur Öl ins Feuer gießt und einen neuen Brandherd für die unkontrollierte Gewalt im Nahen Osten gesetzt hat. Gleichzeitig sehen wir eine Anhäufung von Hindernissen für die von der Verwaltung favorisierte Politik (einschließlich der Aufhebung von „Obamacare“, dem großen Schlachtross Trumps im Wahlkampf), den unaufhörlichen Rücktrittswalzern der höchsten Beamten, um nur einige Beispiele für diese Unordnung auf höchster Ebene zu nennen. In Großbritannien stellt der Brexit seit einem Jahr ernsthafte Probleme für die Gesundheit des nationalen Kapitals dar. Begründet ist dies insbesondere durch die Schwächung und erhebliche Untergrabung seiner Macht durch die Flucht des internationalen Kapitals, die der Brexit hervorgerufen hat – obwohl gerade der Finanzsektor immer eine Stärke der britischen Wirtschaft gewesen ist. Angesichts einer Reihe von Rückschlägen und widersprüchlichen Initiativen für eine Einigung mit der EU wird Theresa May immer mehr geschwächt und von ihren Kollegen offen der Inkompetenz sowie der mangelnden Vorbereitung und der Verwirrung bezichtigt.3
Das bedeutet keineswegs, dass die Wahl Trumps zum Präsidenten oder der Sieg des Brexit tödliche Schläge für den Kapitalismus wären, ebenso wenig wie diese Ereignisse die Vereinigten Staaten oder Großbritannien daran hindern werden, dominante imperialistische Mächte zu bleiben. Sie hindern die Bourgeoisie auch nicht daran, die mit populistischen Entscheidungen verbundenen Probleme zu kanalisieren und sogar die Manifestationen des Gewichts des Populismus zu nutzen, um den Niedergang des Klassenbewusstseins zu beschleunigen, insbesondere mittels der Themen des Nationalismus und der Verteidigung der Demokratie. Aber die IKP, die sich auf die ideologische Nutzung des Populismus durch die Bourgeoisie konzentriert, übersieht völlig die Probleme, die sich aus der allgemeinen Dynamik des Kapitalismus heute ergeben. Gerade auch jene, die sich aus der Anhäufung und Verschärfung der Widersprüche, auch innerhalb der Bourgeoisie selbst ergeben. Sie unterschlägt die Bedeutung der wachsenden Tendenz zur Barbarei, von der der Populismus in seiner jetzigen Form eine seiner bedeutendsten Erscheinungen ist. Ebenso unterschätzt sie massiv die Bedrohungen, die Gefahren und Fallen (Nationalismus, Kanalisierung der falschen Wahl zwischen Populismus und Antipopulismus) sowie die zunehmende Desorientierung und Verwirrung, welche die Klassenidentität des Proletariats zurückdrängt.
Le Prolétaire leugnet und ignoriert völlig die Folgen der Wahl Trumps und des Referendums über den Brexit, der populistischen Programme und politischen Anstrengungen, sie in die Praxis umzusetzen. Die IKP tut so, als ob die Bourgeoisie dieser beiden Mächte, obwohl sie zu den mächtigsten und erfahrensten der Welt gehören, vor den Gefahren gefeit wäre. Sie will uns dadurch glauben machen, dass die Politik und die wirtschaftlichen Orientierungen, die seit diesen Ereignissen verfolgt werden, keine katastrophalen Folgen für das nationale und internationale Kapital hätten. Das jüngste Beispiel der Situation in Deutschland nach den Parlamentswahlen und dem erstmaligen Einzug der rechtsextremen AfD (Alternative für Deutschland) mit 87 Sitzen und 13,5% der Stimmen bestätigt einmal mehr die historische Tendenz der Entwicklung des Populismus. Dieses Phänomen ist in Deutschland besonders stark in den alten Industriezentren, insbesondere in der ehemaligen DDR anzutreffen, was keineswegs der reduktionistischen und falschen Sichtweise der IKP entspricht.
„Nichts Neues unter der Sonne“: eine starre Vision der Geschichte
Anstatt das Wachstum, die Entwicklung und die Dynamik des populistischen Phänomens zu analysieren und zu erklären, sagt die IKP hartnäckig, dass es „nichts Neues unter der Sonne“ gebe. Sie hat also keinen Rahmen für ihre Analyse. Für sie ist die Frage nach dem Wachstum des Populismus sozusagen eine Erfindung der Medien, ein einfaches Instrument der Propaganda. Wie es am Anfang des Artikels heißt, ist der Populismus nichts anderes als „eine politische Orientierung, welche die Teilung der Gesellschaft in Klassen leugnet“ mit dem alleinigen Ziel, „das Proletariat seine Klassenorientierung verlieren zu lassen“. Das ist eine extrem reduktionistische Sichtweise, die darauf hinausläuft, dass die Zunahme der Macht des Populismus nur einem Manöver, einer Aufstellung und einer Orchestrierung aller Teile der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse entspreche.
Statt ein Phänomen zu erklären, welches sie eben nicht versteht, leugnet die IKP die Realität und erweckt den Eindruck, dass es innerhalb der Bourgeoisie keine echten Widersprüche gebe, als wäre alles eine einfache Summe, eine Ansammlung verschiedener Interessen: Bosse, Aktionäre, Staaten, Parteien und Kandidaten ... Für sie gibt es bloß eine bewusste, allmächtige Bourgeoisie, die keine inneren Widersprüche hat und mal diese oder mal jene Karte je nach ihren Bedürfnissen spielt, welche Karten so oder so ausschließlich gegen die Arbeiterklasse gerichtet sind und es ihr ermöglichen, von der Unzufriedenheit der Klasse abzulenken. Dies ist paradox, weil die IKP einerseits diese Notwendigkeit der Mystifikation betont, andererseits aber anerkennt, dass die Bedrohung der Bourgeoisie durch die Arbeiterklasse tatsächlich auf einem sehr niedrigen Niveau liegt. Das Problem ist, dass die IKP versucht, nicht nur den Populismus, sondern auch die Entwicklung verschiedener nationaler Situationen in vorher festgelegte Formen, in fertige Schemata zu pressen und sie für „invariant“, also unveränderbar (um ihren eigenen Begriff zu verwenden) zu erklären. Dadurch gelingt es ihr nicht, den Populismus in den Rahmen einer Analyse zu stellen, oder gar die Realität und Dialektik dieser Bewegung zu erfassen. Die IKP ist nicht in der Lage, eine klare Analyse der Realität zu liefern.
Warum legen wir so viel Wert darauf, das Phänomen des Populismus besser zu verstehen? Weil diese Debatte, in der die Divergenzen für Haarspalterei, für die Verteidigung eines Territoriums, eine Diskussion im Café oder eine Debatte in „intellektuellen Kreisen“ gehalten werden könnten, tatsächlich eine wesentliche Frage der revolutionären Organisationen betrifft. Das Ziel ist, methodisch die klarste Einschätzung der Funktionsweise, Dynamik und Entwicklung des Kapitalismus herauszuarbeiten, um das Proletariat in seinem Klassenkampf besser zu wappnen.
(Fortsetzung folgt)
CB, 28. Dezember 2017
1) Wir verweisen die Leser auf ihren Artikel: Bilanz der Präsidentschaftswahlen: Umstrukturierung des bürgerlichen politischen Theaters zur besseren Verteidigung des Kapitalismus, Le Prolétaire, Nr. 524, Mai/Juni 2017.
2) Siehe unseren Artikel Die Arbeiteraristokratie: eine soziologische Theorie um die Arbeiterklasse zu spalten, Internationale Revue Nr. 7 (1981).
3) Trump und sein Schwiegersohn Jared Kushner scheinen den saudischen Herrscher Prinz Mohammed bin Salman in seinen destabilisierenden Abenteuern im Nahen Osten ermutigt zu haben, insbesondere in seinen Feindseligkeiten gegen Katar, die direkt gegen die militärischen Interessen der USA gerichtet sind. Auch in Großbritannien brach die Ministerin für Außenpolitische Entwicklung und Brexit-Unterstützerin Priti Patel im "Urlaub" in Israel nicht nur mit der britischen Außenpolitik, sondern sie versuchte ohne Wissen des Außenministeriums diese auf einen neuen Kurs zu bringen. Das Zögern von Premierministerin May, sie zu entlassen, zeigte erneut ihre Schwäche.
Rubric:
Die Schwächen der IKP in der Frage des Populismus (Teil 2)
- 71 Aufrufe
In diesem zweiten Teil antworten wir auf die Hauptkritiken der IKP (Le Prolétaire) uns gegenüber, indem wir ihre Herangehensweise unserer Methode und unserem Analyse-Rahmen gegenüberstellen, um ein klareres Verständnis des Kampfes der Arbeiterklasse herauszuarbeiten.
Die Rolle der Revolutionäre besteht nicht lediglich darin, proletarische Prinzipien zu wiederholen, sondern vor allem darin, einen Beitrag zur Bewusstseinsbildung der Arbeiterklasse zu leisten. Mit anderen Worten geht es darum, “eine konkrete politische Analyse einer konkreten Situation zu machen”, wie Lenin es ausdrückte. Wer die aktuelle Situation verstehen will und nach deren Ursachen sucht, findet in der Presse der IKP leider keine ausreichende Erklärung des internationalen und gewichtigen Phänomens des Populismus, sondern lediglich Behauptungen, welche unserer Ansicht nach nur zur Verwirrung beitragen. Die Ausbreitung des Populismus gründet auf einer konkreten und geschichtlich neuen Situation, die es zu analysieren gilt, und erfordert eine klare und methodische Debatte mittels Polemiken. Um diese Debatte zu führen, welche innerhalb des proletarischen Milieus unabdingbar ist, gilt es zuerst falsche Debatten und Interpretationen zu erkennen und zu vermeiden.
Ein klarer Rahmen zur Analyse: eine Notwendigkeit zum Bewusstsein der Arbeiterklasse
Die IKP wirft uns vor, zu behaupten, dass “der Sieg von Trump und der Verfechter von Brexit ein “Rückschlag der Demokratie” bedeute”[1] und bezieht sich dabei auf einen Artikel, den wir in Révolution Internationale Nr. 461 veröffentlicht haben. Wir behaupten in unseren Analysen nirgends, dass der Populismus die bürgerliche Demokratie und ihren Staat schwäche oder gar in Frage stelle. Für uns sind alle Fraktionen der herrschenden Klasse reaktionär, und der Populismus, als politischer Ausdruck, ist ein Teil der herrschenden Klasse und reiht sich voll und ganz in die Verteidigung der kapitalistischen Interessen ein. Die populistischen Parteien sind ein Teil der herrschenden Klasse, Parteien des kapitalistischen totalitären Staates. Was sie auszeichnet, ist die bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie und deren Verhaltensweisen: Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Autoritarismus und der kulturelle Konservatismus. Sie manifestieren Ängste, drücken den Willen zur Abkapselung aus und stellen die “Eliten” in Frage. Der Populismus ist ein Produkt des Zerfalls, der das politische Spiel durcheinander bringt, mit der Konsequenz eines Kontrollverlustes des bürgerlichen politischen Apparates auf der Ebene der Wahlen. Doch dies hindert die herrschende Klasse nicht im Geringsten daran, dieses politisch negative Phänomen des Populismus so weit wie möglich für ihre Interessen auszunützen und es gegen die Arbeiterklasse zu verwenden. Sie verstärkt damit die Verherrlichung der bürgerlichen Demokratie, in der “jede Stimme zählt”, und prangert die mangelnde Beteiligung an den Wahlen als “Begünstigung der extremen Rechten” an. In diesem Rahmen versuchen die traditionellen bürgerlichen Parteien ihren Anti-Populismus herauszustreichen und sich als “humanistischer” und “demokratischer” als die Populisten darzustellen. All dies ist für die Arbeiterklasse eine gefährliche Falle und dient dazu, sie in die falsche Alternative zu locken: Populismus oder bürgerliche Demokratie.
Anders als wir, die IKS, verwirft die IKP die Analyse der Dekadenz des Kapitalismus, welche für den Marxismus grundlegend ist, wie dies die Gründer der Dritten International erkannt hatten und nach der Erfahrung des Ersten Weltkrieges und des Oktobers 1917 in Russland in ihrer Plattform von 1919 ausdrückten: “Die neue Epoche ist geboren! Die Epoche der Auflösung des Kapitalismus, seiner inneren Zersetzung, die Epoche der kommunistischen Revolution des Proletariats”. Es ist schon ein Jahrhundert vergangen, seit die Bolschewiki und vor allem Rosa Luxemburg aufzeigten, dass die durch den Ersten Weltkrieg eröffnete historische Periode zwei Alternativen eröffnete: Krieg oder Revolution, Sozialismus oder Barbarei. Im Gegensatz dazu wiederholt die IKP auf der Grundlage ihrer “invarianten” Interpretation des Kommunistischen Manifests von 1848, dass die Krisen des Kapitalismus „zyklisch“ seien und ignoriert die Auswirkungen des Eintritts in die Dekadenz, dies vor allem bei der Frage des Krieges. Durch die Ablehnung der grundlegenden Erkenntnis der Dekadenz des Kapitalismus fehlt Le Prolétaire logischerweise die Klarheit über das Wesen der Krisen und der imperialistischen Kriege im 20. Jahrhundert, sowie die Klarheit über die aktuelle Situation und ihre Entwicklung hin zur letzten Phase der Agonie des Kapitalismus, des Zerfalls.[2]
Die IKP ist politisch nicht dazu gewappnet, zu verstehen, dass der Zerfall durch die Widersprüche des Kapitalismus eine neue Dimension erhalten hat, allem voran “die Unfähigkeit (…) der beiden sich gegenüberstehenden Klassen, der Bourgeoisie und der Arbeiterklasse, ihre eigene Perspektive durchzusetzen (Krieg oder Revolution), was zu einer Situation der “momentanen Blockade” und einem Verrotten der Gesellschaft führte”. Im Gegenteil interpretieren sie daraus in ironischer Art und Weise, ohne die wirkliche Natur dieser Analyse zu verstehen, dass “die Arbeiter, welche im Alltag die Zuspitzung ihrer Ausbeutung und die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen sehen, glücklich sind zu erfahren, dass ihre Klasse fähig sei, die Bourgeoisie zu blockieren und sie daran zu hindern, ihre “Perspektive” umzusetzen”.
Die IKP interpretiert das, was wir wirklich über die Idee der “Blockade der Bourgeoisie durch die Arbeiterklasse” sagen, falsch, ohne sich ernsthaft mit den politischen Inhalten, die wir vertreten, auseinanderzusetzen: Die gesamte Gesellschaft steht in einer Situation, in der keine der zwei bestimmenden Klassen der Gesellschaft ihre Perspektive durchsetzen kann. Sie steht in einer Situation der perspektivlosen, täglichen kapitalistischen Ausbeutung. In diesem Kontext ist die Bourgeoisie nicht in der Lage, einen politischen Horizont aufzuzeigen, der eine Mobilisierung und Unterstützung erlaubt. Auf der anderen Seite ist die Arbeiterklasse nicht fähig, sich als Klasse wahrzunehmen und eine entscheidende und genügend bewusste Rolle zu spielen. Es ist diese Situation, welche zur Blockade jeglicher Perspektive führt. Die Phase des Zerfalls der kapitalistischen Gesellschaft ist mitnichten eine “Erfindung” oder eine “vage Idee” der IKS. Marx selbst formulierte am Anfang des Kommunistischen Manifests diese Möglichkeit aufgrund der historischen Erfahrungen der Klassengesellschaften: “Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zu einander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedes mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen”. Als “kämpfende Klassen” gibt es heute nur die Bourgeoisie und das Proletariat. Der Marxismus ist die Frage der historischen Alternative nie in einer schematischen Art und Weise angegangen. Wenn unter den heutigen Bedingungen die revolutionäre Klasse nicht in der Lage ist, sich durchzusetzen und den Weg einer neuen Produktionsweise einzuschlagen, den Kommunismus, dann wird durch ihre Unfähigkeit und historische Niederlage die kapitalistische Gesellschaft ins Chaos und die Barbarei versinken: genau dies ist der “gemeinsame Untergang der kämpfenden Klassen”.
Die Grundlagen der Phase des Zerfalls
Was bestimmt und erklärt die gegenwärtige Phase des Versinkens des dekadenten Kapitalismus im Zerfall der Gesellschaft?[3] Die Bourgeoisie ist in einer dauerhaften ökonomischen Krise gefangen, was für die Arbeiterklasse immer mehr Elend, Unsicherheit, Angriffe gegen die Lebensbedingungen und Ausbeutung bedeutet. Auf der anderen Seite gelingt es der Bourgeoisie nicht, ihre „Lösung“ gegenüber der ökonomischen Krise durchzusetzen: einen neuen Weltkrieg. Zwischen 1968 und 1989 konnte die Bourgeoisie wegen des internationalen Wiedererstarkens des Klassenkampfes die Arbeiterklasse nicht in die Vorbereitungen für einen neuen Weltkonflikt lotsen. Nach 1989, mit dem Verschwinden der zwei imperialistischen Blöcke infolge des Zusammenbruchs des Ostblocks, verschwanden die diplomatischen und militärischen Bedingungen für einen neuen Weltkrieg: Die Bourgeoisie war nicht mehr in der Lage, neue imperialistische Blöcke zu bilden.
Die Auflösung der imperialistischen Blöcke bedeutete aber keineswegs das Ende der militärischen Konflikte. Der Imperialismus verschwand keineswegs, er nahm lediglich andere Formen an, indem jeder Staat versucht, seine eigenen Interessen und Gelüste gegen die Interessen der anderen durchzudrücken, dies auf Kosten stabiler Allianzen. Es entstand eine Situation des „Jeder gegen Jeden“ und einer Tendenz hin zum Chaos und grausamen militärischen Konflikten. Seit 1989 haben sich Konflikte vermehrt, in denen sich die großen und mittleren imperialistischen Mächte mittels kleiner Staaten, bewaffneter Banden oder instrumentalisierter ethnischer Gegensätze bekämpfen.
Die Bourgeoisie kann die Arbeiterklasse also nicht länger für den Traum einer „neuen Weltordnung des Friedens und Wachstums“ mobilisieren, wie ihn Bush sen. nach dem Zusammenbruch des Ostblocks versprach und der kurz darauf kläglich verpuffte.
Die Arbeiterklasse, welche zwischen 1968 und Ende der 1980er Jahre immer wieder Wellen des Widerstandes gegen die Krise und die Angriffe auf ihre Lebensbedingungen hervorbrachte, zeigte in den zentralen Ländern, dass sie nicht bereit war, sich für einen neuen Weltkrieg zu opfern. Dennoch gelang es der Arbeiterklasse nicht, ihre Kämpfe zu politisieren und damit die bewusste Perspektive einer Überwindung des Kapitalismus greifbar zu machen, nicht zuletzt wegen des enormen Gewichts der langen Jahre der Konterrevolution und den anhaltenden Illusionen in einen angeblich proletarischen Charakter der linken Parteien und der Gewerkschaften. Im Gegensatz zu 1905 und 1917, und vor allem nach dem August 1980 in Polen, war die Arbeiterklasse nicht fähig, sich auf ein politisches Terrain zu begeben, eine Bedingung für die revolutionäre Veränderung der Gesellschaft, und auch nicht fähig, ihre Verteidigungskämpfe in einen internationalen politischen Kampf zu verwandeln, der eine revolutionäre Perspektive in sich trägt.
Der Bankrott der stalinistischen Regime während des brutalen Zusammenbruchs des Ostblocks erlaubte es der Bourgeoisie, die größte Lüge des 20. Jahrhunderts zu stärken – die Identifikation des Stalinismus mit dem Kommunismus – und eine riesige Kampagne über den „Bankrott des Marxismus“ und den „Tod des Kommunismus“ zu entfalten, welche die Idee beinhaltet, dass es keine Alternative zum Kapitalismus gebe. All das erklärt die enormen Schwierigkeiten, mit denen die Arbeiterklasse heute konfrontiert ist: der Verlust der Klassenidentität und des Selbstvertrauens, der Verlust des Vertrauens in ihren Kampf, hin zu einer Orientierungslosigkeit.
Das Aufkommen des Populismus und antisozialer Phänomene
Diese Schwierigkeiten, neben anderen, erlaubten die Entstehung populistischer Ideen in der Gesellschaft, inklusive innerhalb der schwächsten Teile der Arbeiterklasse. Denn die Arbeiterklasse ist ebenfalls von der schädlichen Atmosphäre, welche durch den zerfallenden Kapitalismus und die Politik der Bourgeoisie entsteht, beeinflusst.
Im Rahmen von mangelnden politischen Perspektiven verstärkt sich das Misstrauen gegen alles, was sich als „politisch“ ausgibt (so diskreditieren sich die traditionellen politischen Parteien der Bourgeoisie), während umgekehrt die populistischen Ideen Zulauf erhalten, welche die „Ablehnung der Eliten“ predigen. Dies kombiniert sich mit dem Gefühl des „No future“ und dem Aufblühen aller Arten von individualistischen Ideologien, dem Rückzug auf reaktionäre, archaische und nihilistische Modelle.
Der Artikel von Le Prolétaire behauptet: „Die populistische Orientierung ist von typisch kleinbürgerlicher Natur: Das Kleinbürgertum, das sich zwischen den zwei Hauptklassen der Gesellschaft befindet, hat Angst vor dem Kampf dieser zwei Klassen und davor, zermalmt zu werden. Deshalb wendet es sich gegen alles, was den Klassenkampf aufwecken könnte, und schwört auf „das Volk“ und die „Einheit des Volkes“. Für die IKP war der Populismus von Beginn weg Ausdruck des Wesens und der Ideologie des Kleinbürgertums, und nichts weiter. Sie analysieren den Populismus nicht als einen Ausdruck des perspektivlosen Kapitalismus und seiner Dynamik in der Periode des Zerfalls. Auch wenn der Populismus durch verschiedene Faktoren vorangetrieben wird (Wirtschafskrise von 2008, Auswirkungen der Kriege, Terrorismus, Flüchtlingskrise), so ist er allem voran ein konzentrierter Ausdruck der gegenwärtigen Unfähigkeit der beiden Hauptklassen in der Gesellschaft, der Menschheit eine Zukunft anbieten zu können.
Dies ist die globale Wirklichkeit, mit der die Arbeiterklasse und die gesamte Gesellschaft konfrontiert sind. Es ist wichtig zu erkennen, dass das gegenwärtige Anwachsen anti-sozialer Verhaltensweisen und die gegenwärtige Schwäche der Arbeiterklasse, eine revolutionäre Perspektive zu entwickeln, zentrale Aspekte dieser Situation sind. Es zeigt ein grundsätzliches Problem auf, welches nicht identisch ist mit der Situation unmittelbar nach den 1990er Jahren, und noch weniger mit der simplen kleinbürgerlichen Natur des Populismus des 19. Jahrhunderts.
Die IKP teilt unsere Analyse nicht, und deshalb sollte sie einen generellen Rahmen für eine andere Sichtweise gegenüber der gegenwärtigen Situation aufzeigen. Eine lediglich ironische Antwort genügt da keinesfalls.
Die wirklichen Fragen für die Arbeiterklasse angesichts des Zerfalls
Wenn das Proletariat nicht in der Lage ist, den Weg des revolutionären Kampfes zu finden, wird die Gesellschaft als Ganzes in Katastrophen aller Art versinken: Bankrotte, ökologische Katastrophen, Ausweitung lokaler Kriege, Versinken in Barbarei, soziales Chaos, Hungersnöte ... Das hat nichts mit einer Prophezeiung zu tun. Es kann aus dem einfachen und guten Grund nicht anders sein, weil die zerstörerische Logik von Kapital und Profit, die wir jeden Tag am Werk sehen, dem System zutiefst innewohnt und unumkehrbar ist. Der Kapitalismus kann seinem Wesen nach nicht "vernünftig" werden und bleibt in seinen eigenen Widersprüchen stecken.
1. Der Klassenkampf des Proletariats ist nicht, wie die IKP meint, das mechanische "Instrument" eines absolut bestimmten "historischen Schicksals". In der Deutschen Ideologie kritisieren Marx und Engels eine solche Vision heftig: "Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen, von denen Jede die ihr von allen vorhergegangenen übermachten Materialien, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert, daher also einerseits unter ganz veränderten Umständen die überkommene Tätigkeit fortsetzt und andererseits mit einer ganz veränderten Tätigkeit die alten Umstände modifiziert, was sich nun spekulativ so verdrehen lässt, dass die spätere Geschichte zum Zweck der früheren gemacht wird, z.B. dass der Entdeckung Amerikas der Zweck zugrunde gelegt wird, der Französischen Revolution zum Durchbruch zu verhelfen.“
2. Das bedeutet nicht, dass das Proletariat, weil ein Teil an der Urne für die populistischen Parteien stimmt, fremdenfeindlich oder fundamental nationalistisch geworden ist. Wie wir in unserer auf dem 22. Kongress der IKS angenommenen Resolution zum internationalen Klassenkampf betont haben: „Viele Arbeiter_innen, die heute für populistische Kandidaten stimmen, können sich von einem Tag zum nächsten im Kampf vereint mit ihren Klassenbrüdern und -schwestern befinden; dasselbe trifft auch auf Arbeiter_innen zu, die von anti-populistischen Demonstrationen eingefangen sind.“
Der Ausgang des Klassenkampfes ist aber keinesfalls schon festgelegt, wie dies in der falschen Vision Bordigas ausgedrückt wird: „Ein Revolutionär ist (unserer Meinung nach) jemand, für den die Revolution so sicher ist, als wäre sie bereits geschehen“. Nein, die proletarische Revolution ist nicht schon im Voraus bestimmt! Sie kann nur durch die bewusste Handlung der Arbeiterklasse in einem lebendigen historischen Kampf erreicht werden, gegen alle Hindernisse und gegen die herrschende Klasse, welche sich verteidigen wird und dabei ihr Gift und ihre Grausamkeit einsetzen wird.
Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen das Proletariat konfrontiert ist, müssen Revolutionäre mehr denn je die ideologische Instrumentalisierung, die die Bourgeoisie aus den Tendenzen zur Auflösung der gegenwärtigen Gesellschaft einsetzt, analysieren und anprangern.
Den Populismus verstehen bedeutet, den Zerfall zu verstehen. Das heißt, die Gefahr, die über der Arbeiterklasse und der gesamten Menschheit schwebt, die Schwierigkeiten und Hindernisse denen wir in diesem Zusammenhang begegnen, zu verstehen, um sie besser bekämpfen zu können und uns gegen sie zu wappnen. Trotz des Gewichts des Populismus und seiner Gefahren hat die Arbeiterklasse immer noch die einzig mögliche Alternative zum Kapitalismus anzubieten, und ihre Ressourcen sind grundsätzlich intakt, um diesen Kampf zu führen und zu entwickeln.
CB, 26. März 2018
[1] Populisme, vous avez dit populisme?, Le Prolétaire Nr. 523, (Febr., März, April 2017)
[2] Wir empfehlen den Leser_innen die Lektüre unserer Polemik mit Le Prolétaire zur grundlegenden Frage der Dekadenz: Le rejet de la notion de décadence conduit à la démobilisation du prolétariat face à la guerre, Revue Internationale Nr. 77 und 78, 1994 (frz., engl., span. Ausgabe).
[3] Wir empfehlen den Leser_innen unseren Text Der Zerfall, die letzte Phase der Dekadenz des Kapitalismus vom Mai 1990. Internationale Revue Nr. 13 (/content/748/der-zerfall-die-letzte-phase-der-dekadenz-des-kapitalismus [602]) sowie den Text Die Dekadenz des Kapitalismus verstehen, Internationale Revue 10, 11, 12 (/content/1360/die-dekadenz-des-kapitalismus-verstehen [618], /content/1357/die-dekadenz-des-kapitalismus-verstehen-teil-2 [619], /content/1359/die-dekadenz-des-kapitalismus-verstehen-teil-3 [620]).
Rubric:
1918: Novemberrevolution Deutschland: Das Proletariat bringt den Krieg zu Ende
- 82 Aufrufe
Wir legen hier einen Artikel neu auf, den wir vor 20 Jahren – zum 80. Jahrestag der Novemberrevolution 1918 geschrieben und in Weltrevolution Nr. 91 abgedruckt haben. Damit diese für unsere Klasse wesentlichen Ereignisse nicht vergessen gehen und wir die Lehren aus den Stärken und Schwächen ziehen können, werden wir in unseren Publikationen – insbesondere online – in den verschiedenen Sprachen in nächster Zeit weitere Artikel zur Revolution in Deutschland vor 100 Jahren veröffentlichen. Folgender Artikel also zum Auftakt.
Weltrevolution, 27. August 2018
Am 4. Nov. 1918 meuterten in Kiel an der deutschen Ostseeküste die Matrosen gegen den Befehl des Militärs, zu einer weiteren Seeschlacht auszulaufen.
Ein Siedepunkt der Unzufriedenheit, der Ablehnung des Krieges war erreicht worden. Nach 4 Jahren mörderischen Abschlachtens mit mehr als 20 Mio. Toten, unzähligen Verletzten, den verlustreichen, zermürbenden Stellungskriegen mit ihren Giftgaseinsätzen in Frankreich, der Ausmergelung und Aushungerung der arbeitenden Bevölkerung, war diese restlos kriegsmüde geworden und nicht mehr bereit, den Preis für dieses Abschlachten mit ihrem eigenen Leben zu zahlen. Die militärische Führung dagegen wollte die Fortführung des Krieges mit brutaler Repression durchsetzen und verhängte drakonische Strafen gegen die meuternden Matrosen.
Dagegen erhob sich sofort eine breite Solidarisierungswelle, deren Zündungsfunke von Kiel ausging und der sofort auf andere Städte in ganz Deutschland übersprang. Arbeiter traten in den Ausstand, Soldaten verweigerten die Befehle; sie bildeten - wie zuvor schon Anfang des Jahres in Berlin geschehen, Arbeiter- und Soldatenräte, die sich in Windeseile auch auf andere Städte ausbreiteten. Am 5./6. November setzten sich Hamburg, Bremen und Lübeck in Bewegung; Dresden, Leipzig, Magdeburg, Frankfurt, Köln, Hannover, Stuttgart, Nürnberg, München befanden sich am 7. und 8. November in den Händen der Arbeiter- und Soldatenräte. Innerhalb einer Woche gab es keine deutsche Großstadt, in der nicht auch Arbeiter- und Soldatenräte gegründet waren.
In dieser Anfangsphase wurde Berlin schnell zum Zentrum der Erhebung: dort strömten am 9. November unzählige Arbeiter und Soldaten zu Demonstrationen auf die Straße. Die Regierung hatte zuvor noch die als "zuverlässig" bezeichneten Bataillone nach Berlin zum Schutz der Regierung kommen lassen. Aber am Morgen jenes 9. November "leerten sich die Fabriken in unglaublich schnellen Tempo. Die Straßen füllten sich mit gewaltigen Menschenmassen. An der Peripherie, wo die größten Fabrikbetriebe liegen, formierten sich große Demonstrationszüge, die in den Mittelpunkt der Stadt zuströmten ... Wo sich Soldaten zeigten, bedurfte es zumeist keiner Aufforderung, sie schlossen sich freiwillig den Arbeiterzügen an. Männer, Frauen, Soldaten, ein Volk in Waffen flutete durch die Straßen den zunächst gelegenen Kasernen zu" (R. Müller, Die Novemberrevolution, Bd. II, S. 11). Unter dem Übergewicht dieser auf den Straßen versammelten Massen wechselten die letzten regierungstreuen Truppen das Lager, schlossen sich den Aufständischen an und verteilten ihre Waffen an die Arbeiter. Das Polizeipräsidium, die großen Zeitungsbetriebe, Telegraphenbüros, das Reichstags- und andere Regierungsgebäude – sie alle wurden an dem Tag von bewaffneten Arbeitern und Soldaten besetzt, Gefangene aus den Gefängnissen befreit. Viele Regierungsbeamte hatten die Flucht ergriffen. Wenige Stunden hatten genügt, um diese Schaltstellen der bürgerlichen Macht zu besetzen. In Berlin wurde ein die Stadt übergreifender Rat der Arbeiter- und Soldatenräte gegründet: der Vollzugsrat.
Die Arbeiter in Deutschland traten damit in die Fußstapfen ihrer Klassenbrüder in Russland, die ebenfalls als eine Reaktion gegen den Krieg sich im Februar 1917 schon in Arbeiter- und Soldatenräten zusammengeschlossen und im Oktober 1917 siegreich die Macht übernommen hatten. Damit schickten sich die Arbeiter in Deutschland an, den gleichen Weg zu beschreiten, den Sturz des kapitalistischen Systems in Angriff zu nehmen: Übernahme der Macht durch die Arbeiter- und Soldatenräte, Lahmlegung des bürgerlichen Staatsapparates, Bildung einer Arbeiterregierung ... Die Perspektive war: das Tor zur weltweiten Erhebung der Arbeiterklasse weiter aufzustoßen, nachdem in Russland zuvor schon die Arbeiter den ersten Schritt dazu getan hatten.
Mit dieser Aufstandsbewegung hatten die Arbeiter in Deutschland die größten Massenkämpfe in ihrer Geschichte in Gang gesetzt. All die von den Gewerkschaften während des Krieges geschlossenen Stillhalteabkommen, die Politik des Burgfriedens, waren damit unter den Paukenschlägen des Klassenkampfes zerplatzt. Durch diese Erhebung hatten die Arbeiter die Niederwerfung vom August 1914 abgeschüttelt und sich wieder aufgerichtet; der Mythos einer durch den Reformismus gelähmten Arbeiterklasse in Deutschland war verflogen. Dabei setzten die Arbeiter in Deutschland ebenso die neuen typischen Waffen des Proletariats in dem Zeitraum der kapitalistischen Dekadenz ein, deren Gebrauch zuvor schon von den Arbeitern in Russland (1905 und 1917) erfolgreich erprobt worden war: Massenstreiks, Vollversammlungen, Bildung von Arbeiterräten, Massendemonstrationen, kurzum die Eigeninitiative der Arbeiter selbst. Neben dem Proletariat in Russland, das die Kapitalistenklasse ein Jahr zuvor erfolgreich gestürzt hatte, standen die Arbeiter in Deutschland an der Spitze der ersten großen internationalen, revolutionären Welle von Kämpfen, die aus dem Krieg hervorgegangen waren. In Ungarn und Osterreich hatten die Arbeiter 1918 sich auch schon erhoben und angefangen, Arbeiterräte zu errichten.
Die SPD - Speerspitze gegen das Proletariat
Aber während so auf örtlicher Ebene überall Herde proletarischer Aktivität entstanden, das Proletariat in Wallung gekommen war, blieb die herrschende Klasse nicht untätig. Die Ausbeuter und die Militärs in ihrer Mitte brauchten eine Kraft, die der Ausbreitung dieser revolutionären Erhebung entgegentreten könnte. Aus der Erfahrung in Russland lernend, zog die deutsche Bourgeoisie mit den Chefs der Obersten Heeresleitung die Fäden. General Groener, oberster Boss des Militärs, berichtete:
"Es gibt zur Zeit in Deutschland nach meinem persönlichen Dafürhalten keine Partei, die Einfluss genug im Volk, insbesondere bei den Massen hat, um eine Regierungsgewalt mit der Obersten Heeresleitung wiederherstellen zu können. Die Rechtsparteien waren vollkommen verschwunden, und mit den äußersten Radikalen zu gehen war natürlich ausgeschlossen. Es blieb nichts übrig, als dass die Oberste Heeresleitung dieses Bündnis mit der Mehrheitssozialdemokratie schloss ... Wir haben uns verbündet zum Kampf gegen die Revolution, zum Kampf gegen den Bolschewismus ... An eine Wiedereinführung der Monarchie zu denken, war meines Erachtens vollkommen ausgeschlossen. Der Zweck unseres Bündnisses, das wir am 10. November abends geschlossen hatten, war die restlose Bekämpfung der Revolution, Wiedereinsetzung einer geordneten Regierungsgewalt, Stützung dieser Regierungsgewalt durch die Macht einer Truppe und baldigste Einberufung einer Nationalversammlung ...“ (W. Groener über die Vereinbarungen zwischen der Obersten Heeresleitung und F. Ebert vom 10. Nov. 1918).
Damit war die SPD wieder einmal zum Dreh- und Angelpunkt der Politik des Kapitals geworden, wie zuvor schon im August 1914 und im weiteren Verlauf des Krieges - als sie sich als sicherer Pfeiler des kapitalistischen Gerüsts erwiesen hatte.
Am 4. August 1914 hatte die parlamentarische Fraktion der Sozialdemokratie mit ihrer rechten Führung die Interessen des Proletariats verraten und den Krediten für den imperialistischen Krieg zugestimmt. Trotz des heftigsten Widerstands einer unbeugsamen Minderheit (deren prominenteste Vertreter K. Liebknecht, R. Luxemburg, Cl. Zetkin, O. Rühle waren und die sich später im Spartakusbund und als Linksradikale vor allem in Norddeutschland und Mitteldeutschland organisiert hatten) hatte diese kapitalistische Führung den ganzen Krieg über für diesen mobilisiert.
Aber die Opposition gegen diese Kriegspolitik erhielt vor allem an der Basis immer mehr Aufschwung, insbesondere durch die Streiks, die von 1916-17 an Deutschland in zunehmendem Maße erschütterten, und infolge des Drucks der Ereignisse in Russland 1917. Die Opposition in der Partei weigerte sich, dem kapitalistischen Vorstand Beiträge zu zahlen, immer mehr SPD-Zeitungen und immer mehr Ortsverbände bezogen gegen den Krieg und damit gegen den Vorstand Stellung. Als sich die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Partei gegen die kapitalstreue SPD-Führung zu wenden begannen, schloss diese die Opposition im April 1917 aus der Partei aus. Die so Ausgeschlossenen gründeten darauf eine neue Partei – Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschland.
Engster Verbündeter des Kapitals während des Krieges waren auch die Gewerkschaften gewesen, die sofort nach Kriegsanfang ein generelles Streikverbot (Burgfrieden) erlassen hatten. Und wenn es dennoch Proteste, Streiks und Demonstrationen gab, und deren Häufigkeit nahm seit dem Sommer 1916 beständig zu, dann wurden die kämpferischsten Arbeiter, die sogenannten Rädelsführer, von den Gewerkschaften bei den Behörden denunziert, welche diese oft zwangsrekrutierten und als Kanonenfutter an die Front zum Abschlachten schickten. Hier hatten die Gewerkschaften zum ersten Mal unter Beweis stellen können, dass diese mit dem Eintritt des Kapitalismus in seine Dekadenz zu staatstragenden Organen, zur eigentlichen Polizei im Betrieb geworden waren. Damit trat nun mit diesem Bündnis aus SPD, Gewerkschaften und den höchsten Stellen des Militärs im Hintergrund den Arbeitern ein mächtiges Bollwerk entgegen, das sich schon im Krieg für die Verteidigung der Interessen des Kapitals bewährt hatte.
Der Deckmantel der "Einigkeit" soll die Klassengegensätze übertünchen
Um nicht den gleichen Fehler wie die Herrschenden in Russland zu begehen – dort hatte die bürgerliche provisorische Regierung nach dem Sturz des Zaren im Februar 1917 den imperialistischen Krieg weitergeführt und damit den erbitterten Widerstand der Arbeiter, Soldaten und Bauern auf sich gezogen, die Widersprüche auf die Spitze getrieben und unbeabsichtigt den Boden für die Oktoberrevolution bereitet –, reagierte die Kapitalistenklasse in Deutschland schnell und weitsichtiger: am 9. November wurde der Kaiser aus dem Verkehr gezogen und ins Ausland geschickt, am 11. November der Waffenstillstand vereinbart, wodurch der schmerzhafteste Dorn aus dem Fleisch der Arbeiterklasse gezogen und der erste Anlass des Widerstandes der revoltierenden Soldaten beiseite geschafft war. Damit gelang es den Kapitalisten in Deutschland, der Bewegung frühzeitig Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber neben der Absetzung des Kaisers und dem Abschluss des Waffenstillstandes war die Übergabe der Regierungsgeschäfte an die SPD ein entscheidender Schritt zur Eindämmung der Kämpfe.
Am 9. November bildeten drei SPD-Führer (Ebert, Scheidemann, Landsberg) zusammen mit drei USPD-Führern den Rat der Volksbeauftragten, die bürgerliche Regierung in treuen Diensten des Kapitals. Diese selbsternannte (bürgerliche) Regierung kam nur gegen den Widerstand der Spartakisten und anderer bewusster USPD-Mitglieder zustande, denn vielen war klar, dass die SPD als Speerspitze gegen die Revolution wirkte. "Der Regierungssozialismus stellt sich mit seinem jetzigen Eintritt in die Regierung als Retter des Kapitalismus der kommenden proletarischen Revolution in den Weg. Die proletarische Revolution wird über seine Leiche hinwegschreiten ", hatte R. Luxemburg in den Spartakusbriefen schon im Oktober 1918 gewarnt. Und auch jetzt, am 10. November, schrieb die Rote Fahne, Zeitung der Spartakisten: "Vier Jahre haben die Scheidemänner, die Regierungssozialisten, euch durch die Schrecken eines Krieges gejagt, haben euch gesagt, man müsse das "Vaterland" verteidigen, wo es sich nur um die nackten Raubinteressen des Imperialismus handelte. – Jetzt, da der deutsche Imperialismus zusammenbricht, suchen sie für die Bourgeoisie zu retten, was noch zu retten ist und suchen die revolutionäre Energie der Massen zu ersticken. Es darf kein "Scheidemann" mehr in der Regierung sitzen; es darf kein Sozialist in die Regierung eintreten, solange ein Regierungsozialist noch in ihr sitzt. Es gibt keine Gemeinschaft mit denen, die euch vier Jahre lang verraten haben. Nieder mit dem Kapitalismus und seinen Agenten!" Während im Laufe des Krieges immer mehr Arbeiter angefangen hatten, die wahre Rolle der Mehrheitssozialdemokratie zu durchschauen, und es in jeder revolutionären Situation von entscheidender Bedeutung ist, dass sich die Klassengegensätze zunehmend polarisieren und die Gegner eindeutig erkennbar sind, versuchte die SPD diese Gegensätze, die wahren Fronten zu verdecken. So zog jetzt die SPD mit der Parole in den Kampf:
"Es darf keinen Bruderkampf geben ... Wenn Gruppe gegen Gruppe, Sekte gegen Sekte arbeitet, dann entsteht das russische Chaos, der allgemeine Niedergang, das Elend statt des Glückes ... Soll nun der Welt nach solchem herrlichen Triumph [der Absetzung des Kaisers und der Zustimmung der rechten USPD-Führung zur Bildung einer gemeinsamen, paritätisch besetzten bürgerlichen Regierung mit der SPD] das Schauspiel einer Selbstzerfleischung der Arbeiterschaft in sinnlosem Bruderkampf geboten werden? Der gestrige Tag hat in der Arbeiterschaft das Gefühl für die Notwendigkeit innerer Einheit hoch emporlodern lassen! Aus fast allen Städten ... hören wir, dass alte Partei und Unabhängige sich am Tage der Revolution wieder zusammengefunden und zu der alten geschlossenen Partei geeint haben. … Und wenn auch noch soviel Verbitterung sich eingefressen hat, wenn auch der eine Teil dem anderen manches aus der Vergangenheit vorwirft, und umgekehrt, ein Tag wie der gestrige ist groß und überwältigend genug, um all das vergessen zu machen. Das Versöhnungswerk darf nicht an einigen Verbitterten scheitern, deren Charakter nicht stark genug ist, um alten Groll überwinden und vergessen zu machen.... Die Bruderhand liegt offen – schlagt ein!" (Vorwärts, 10.11.1918)
Der Vorwärts war an diesem Tag die Zeitung, die sich jeder Arbeiter zu verschaffen suchte. War bis dahin alles, was aus den Reihen der SPD stammte, mit Misstrauen aufgenommen worden, schaffte die SPD es nun mit dieser Demagogie, den Klassengraben zwischen ihr und der Arbeiterklasse zu übertünchen; die ganze Kriegspolitik, der Burgfrieden mit der Bourgeoisie, mit ihren Wirkungen auf die Lage der Arbeiter, alles was die Arbeiter bis aufs Blut gereizt hatte, wollte sie vergessen machen; und viele Arbeiter gingen ihr dabei auf den Leim. So hatte sie mit dieser Vorgehensweise Erfolg bei der ersten Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte am 10. November. "‘Wir kennen keine verschiedenen sozialistischen Parteien mehr, wir kennen nur noch Sozialisten.‘ Die Flagge eines neuen Burgfriedens ist gehisst; fanatischer Hass wird gesät gegen jeden, der sich dem neuen Einigkeitstaumel entgegenwirft. Die lautesten Rufer nach Einigkeit ... finden ein hallendes Echo vor allem unter den Soldaten. Kein Wunder. Bei weitem nicht alle Soldaten sind Proletarier; und Belagerungszustand, Zensur, amtliche Propaganda und Stampferei waren nicht wirkungslos. Die Masse der Soldaten ist revolutionär gegen den Militarismus, gegen den Krieg und die offenkundigen Repräsentanten des Imperialismus; im Verhältnis zum Sozialismus ist sie noch zwiespältig, schwankend, unausgegoren. Ein großer Teil der proletarischen Soldaten wie der Arbeiter ... wähnt, die Revolution sei vollbracht, nun gelte es nur noch den Frieden und die Demobilisation [zu verwirklichen]. Sie wollen Ruhe nach langer Qual ... Aber nicht jede "Einigkeit" macht stark. Einigkeit zwischen Wolf und Lamm liefert das Lamm dem Wolfe zum Fraß; Einigkeit zwischen Proletariat und herrschenden Klassen opfert das Proletariat, Einigkeit mit Verrätern bedeutet Niederlage. Nur gleichgerichtete Kräfte stärken sich durch Vereinigung; einander widerstrebende Kräfte zusammenzuketten heißt sie lähmen ... Zerstreuung des Einigkeitsphrasennebels, Bloßstellung aller Halbheit und Lauheit, Entlarvung aller falschen Freunde der Arbeiterklasse ist dann das erste Gebot - heute mehr als je." So beschrieb Liebknecht im Namen der Spartakisten die Lage und die Aufgaben in der Roten Fahne vom 19. November 1918. Mit dieser Taktik des Einigkeitsrummels trat der Rat der Volksbeauftragten gegenüber der Vollversammlung der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte auf. Weil die bürgerliche Regierung unter dem Deckmantel des Rates der Volksbeauftragten zwischen SPD und USPD paritätisch besetzt war, bestand sie auf einer paritätischen Zusammensetzung der Leitung des Berliner A.- und S.-Rates (Vollzugsrat). Auch schaffte sie es, sich von dieser Vollversammlung ein "Mandat" als provisorische Regierung geben zu lassen, um so ihr konterrevolutionäres Treiben "demokratisch legitimiert" fortzusetzen.
Aber nach "der Beendigung des Weltkriegs und der Beseitigung der augenfälligsten politischen Vertreter des Systems, das zum Krieg geführt hat, darf das Proletariat sich nicht mit diesem Ergebnis begnügen. Es geht um die Aufhebung der kapitalistischen Klassenherrschaft, die Befreiung der Arbeiterklasse überhaupt." (Liebknecht, 28.11.1918) Hier zeichneten sich all die Schwierigkeiten der Arbeiterklasse ab, das Ziel der Bewegung klar zu erkennen und damit auch die Täuschungs- und Betrugsmanöver der SPD zu durchschauen. "Man kann nicht erwarten, wenn man auf dem Boden historischer Entwicklung steht, dass man in dem Deutschland, das das furchtbare Bild des 4. August und der vier Jahre darauf geboten hat, plötzlich am 9. November 1918 eine großartige, klassen- und zielbewusste Revolution erlebt, - und was wir am 9. November 1918 erlebt haben, war zu drei Vierteln mehr Zusammenbruch des bestehenden Imperialismus als Sieg eines neuen Prinzips. Es war einfach der Moment gekommen, wo der Imperialismus wie ein Koloss auf tönernen Füßen, innerlich morsch, zusammenbrechen musste, und was darauf folgte, war eine mehr oder weniger chaotische, planlose, sehr wenig bewusste Bewegung, in der das einigende Band und das bleibende, das rettende Prinzip nur in der Losung zusammengefasst war: die Bildung der Arbeiter- und Soldatenräte" (Gründungsparteitag der KPD 1918/19).
Nur die Arbeiterklasse konnte den Krieg beenden
Mit ihren Erhebungen Anfang November 1918 hatte die Arbeiterklasse in Deutschland nach dem revolutionären Aufstand in Russland den Weltkrieg schließlich zu Ende gebracht. Der Aufstand eines zentralen Teils der Arbeiterklasse war nötig gewesen, um die Bourgeoisie zur Beendigung des Krieges zu zwingen. Der unbeugsame Widerstand der revolutionären Minderheit - allen voran die Spartakisten an ihrer Spitze - hatte seine Früchte getragen, denn nur dieser heldenhafte Kampf hatte der Arbeiterklasse den Weg zur Beendigung des Kriegs gezeigt. Die Einkerkerung R. Luxemburgs kurz nach Kriegsbeginn, um sie mundtot zu machen, selbst die Festungshaft im Zuchthaus für K. Liebknecht hatten diese bekanntesten Stimmen der Arbeiterklasse nicht zum Schweigen gebracht, sondern nur noch mehr die Widerstandskraft der Arbeiter gegen den Krieg angespornt. So streikten und demonstrierten beispielsweise im Juni 1916 55.000 Arbeiter allein in Berlin gegen den imperialistischen Krieg und die Verurteilung K. Liebknechts. Wie schon in Russland war es in Deutschland ebensowenig der Pazifismus gewesen, der den Krieg zu Ende brachte, sondern nur der Klassenkampf des Proletariats. Und dies ist das große Verdienst der Arbeiterklasse, den Beweis angetreten zu haben, dass sie die große Barriere gegen den Krieg ist und die einzige Kraft, um ihn zu beenden. Und bei dieser Umwandlung des imperialistischen Kriegs in einen Klassenkrieg war die Arbeiterklasse gezwungen, einen Sturmlauf gegen den Staat und seine ihn verteidigenden Kräfte anzutreten. Während es der Arbeiterklasse in Russland gelungen war, die Regierung zu stürzen und die Macht zu ergreifen, stieß das Proletariat in Deutschland auf ungleich größere Hindernisse. Nicht nur hatte es hier mit einer viel intelligenteren und mächtigeren Bourgeoisie zu tun, sondern es befand sich auch in einer neuen historischen Situation, wo es die Konsequenzen des Eintritts des Kapitalismus in seinen Zeitraum der Dekadenz zu begreifen hatte.
Dino, November 1998
Rubric:
Weltrevolution - 2019
- 82 Aufrufe
Oktober
- 36 Aufrufe
Berlin
- 28 Aufrufe
Adresse:
Kultur Cafe Neukölln
Friedelstr. 28
12047 Berlin
Termin:
Veranstaltungsart:
Thema:
Einladungstext:
Die aktuellen Proteste gegen den Klimawandel werden von einem ganzen Teil der herrschenden Klasse, von Merkel bis Corbyn, unterstützt und gelobt. Das allein sollte uns dazu veranlassen, darüber nachzudenken, ob diese Proteste wirklich Teil der Lösung für die Verwüstung der Natur durch den Kapitalismus sind. Oder ob diese Proteste nicht vielmehr instrumentalisiert werden, um die Ideologie der herrschenden Klasse zu fördern.
In dieser Diskussionsveranstaltung wollen wir darüber diskutieren, ob die Umweltzerstörung innerhalb dieses Systems vermieden werden kann oder ob das System dazu überwunden werden muss. Wenn das System überwunden werden muss, welche Kraft ist dazu in der Lage, und wie muss dieser Kampf geführt werden?
Keine Lösung der Klimakrise ohne die Überwindung des Kapitalismus!
- 97 Aufrufe
Die aktuellen Proteste gegen den Klimawandel werden von einem ganzen Teil der herrschenden Klasse, von Merkel bis Corbyn, unterstützt und gelobt. Das allein sollte uns dazu veranlassen, darüber nachzudenken, ob diese Proteste wirklich Teil der Lösung für die Verwüstung der Natur durch den Kapitalismus sind. Oder ob diese Proteste nicht vielmehr instrumentalisiert werden, um die Ideologie der herrschenden Klasse zu fördern.
In dieser Diskussionsveranstaltung wollen wir darüber diskutieren, ob die Umweltzerstörung innerhalb dieses Systems vermieden werden kann oder ob das System dazu überwunden werden muss. Wenn das System überwunden werden muss, welche Kraft ist dazu in der Lage, und wie muss dieser Kampf geführt werden?
Veranstaltungstermine
BERLIN: Samstag 26.10.2019 18.00 Uhr; Kultur Café Neukölln; Friedelstr 28; 12047 Berlin
ZÜRICH: Freitag 08.11.2019 19.00 Uhr; Zentrum Karl der Große; Kirchgasse 14; 8001 Zürich
Aktuelles und Laufendes:
- Öffentliche Veranstaltung [621]
- Klimawandel [622]
- Umwelt [623]
Rubric:
Zürich
- 18 Aufrufe
Adresse:
Zentrum Karl der Grosse
Kirchgasse 14
Zürich
Termin:
Veranstaltungsart:
Thema:
Einladungstext:
Die aktuellen Proteste gegen den Klimawandel werden von einem ganzen Teil der herrschenden Klasse, von Merkel bis Corbyn, unterstützt und gelobt. Das allein sollte uns dazu veranlassen, darüber nachzudenken, ob diese Proteste wirklich Teil der Lösung für die Verwüstung der Natur durch den Kapitalismus sind. Oder ob diese Proteste nicht vielmehr instrumentalisiert werden, um die Ideologie der herrschenden Klasse zu fördern.
In dieser Diskussionsveranstaltung wollen wir darüber diskutieren, ob die Umweltzerstörung innerhalb dieses Systems vermieden werden kann oder ob das System dazu überwunden werden muss. Wenn das System überwunden werden muss, welche Kraft ist dazu in der Lage, und wie muss dieser Kampf geführt werden?